
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Da saßen wir in London am Abend vor der Eröffnung der Feindseligkeiten zwischen unserem Vaterland und der kolossalen Macht der Roten Union, und keiner von uns drei Amerikanern war imstande, an etwas anderes zu denken als an dieses englische Mädchen!
Speed Binney und Whit Dodge, die beide in Margot Denison verliebt waren, vergaßen unter dem Eindruck der Gefahr, die ihr drohte, alle Eifersüchteleien.
Das rote, revolutionäre London, Hauptstadt der Paneurasischen Sowjetföderation und Hauptquartier des gelben Genies, dessen Wille und Furchtbarkeit diese gewaltige Machtkonzentration zuwege gebracht hatte, war eine ganz andere Stadt als das London König Georgs V. Und Margots Situation, die vielleicht nicht ungefährlich war, öffnete uns wieder die Augen für die Szenen, die jedem Amerikaner entsetzlich sein mußten – wegen des alten Rassenstolzes, der eine Barriere zwischen weißen Frauen und farbigen Männern errichtet hat.
Gelbe, Schwarze, Braune und Rote, die asiatischen und afrikanischen Truppen der roten Heere zusammengewürfelt mit der weißen kommunistischen Soldateska Europas in den überfüllten Straßen, Hotels und Schenken der roten Hauptstadt.
Diese Veteranen des unbarmherzigen Blutvergießens an den Küsten Australiens und der Exekutivkommanden in den europäischen Hauptstädten waren jetzt Waffenkameraden, sie sangen und tranken und waren auf Beute aus in der Stadt, die einst die Metropole der englisch sprechenden Welt gewesen war.
Und im Zentrum dieses Hexenkessels der Ausschweifungen aller Rassen schien Margot verlorengegangen zu sein. Wenn sie meine Schwester gewesen wäre, hätte ich nicht besorgter um sie sein können.
Seit jener wilden Nacht in Moskau, in der Binney und ich sie aus der Balgerei in einem revolutionären Café herausgeholt hatten, war meine väterliche oder brüderliche Zuneigung zu ihr stets gewachsen.
Während Karakhans Armeen Europa in raschem Siegeslauf durcheilten, hatte sie mich niemals im Stich gelassen. Lange Arbeitsstunden, beschwerliche Reisen, unangenehme Quartiere – nichts hatte sie von der Erfüllung ihrer Pflichten abhalten können.
In Paris und London, während der politischen und militärischen Reorganisationsarbeiten und Eroberungen des Roten Napoleons, war Margot infolge ihrer Vertrautheit mit der Politik, Diplomatie und Wirtschaft der Alten Welt aus einer Privatsekretärin ein wertvoller Mitarbeiter geworden. Ihr jugendlicher Standpunkt und ihr nahezu enzyklopädisches Wissen waren von unschätzbarem Wert gewesen.
»Das ist die Hölle«, sagte Whit mit aufeinander gebissenen Zähnen, während wir drei düster im Tribune-Büro saßen. »Meine Finger zucken bei jedem gelben Hals, den ich sehe.«
Binneys Gefühle waren so heftig, daß er kein Wort hervorbringen konnte.
Wir zogen in ganz London telephonisch Erkundigungen ein, konnten aber nur erfahren, daß sie angerufen worden war und dann das Savoyhotel in einem geschlossenen Wagen verlassen hatte. Oberst Boyar gab uns die einzige Hoffnung.
»Es ist ihr gar nichts passiert – warten Sie nur«, sagte er.
In der Nacht nach diesem 2. Januar 1934 wurden die Nachrichten über das Bombardement und die Besetzung der Stadt und des Hafens Salina Cruz an der mexikanischen Südküste in den Straßen Londons bekanntgegeben.
Als die Extraausgaben, die in Dutzenden von Sprachen gedruckt waren, ausgerufen wurden, erreichten die wilden Feiern der Menge einen neuen Höhepunkt.
Aus den Pressenachrichten ging hervor, daß die ersten Kämpfe zwischen amerikanischen und roten Truppen jeden Augenblick zu erwarten waren. Die Vereinigten Staaten hatten Karakhan davon verständigt, daß Amerika bei jedem Versuch der Roten Union, in Mexiko einzumarschieren, auf Grund einer Verletzung der Monroe-Doktrin intervenieren würde.
Das offizielle rote Communiqué lautete:
»Die Landung aus sibirischen, mongolischen und japanischen Kontingenten bestehender roter Truppen in Salina Cruz konnte ohne erhebliche Verluste durchgeführt werden.
Der Ausschiffung, die unter dem Schutz der Geschütze japanischer Einheiten der Roten Flotte bewerkstelligt wurde, ging eine Beschießung voraus, die zu erheblichen Sachbeschädigungen in der Stadt und zu Todesfällen unter der Zivilbevölkerung führte. Unsere Truppen marschieren längs der Eisenbahn, die den Isthmus von Tehuantepec durchquert, in nördlicher Richtung vor.
Die mexikanischen Truppen ziehen sich auf den Golf von Campeche zurück.
Rote Luftpatrouillen sind unterwegs.«
Später sollte ich erfahren, daß in dem Augenblick, in dem wir die ersten Nachrichten in London bekamen, amerikanische und rote Luftstreitkräfte bereits über der mexikanischen Front Fühlung genommen hatten.
Auf meine Bitten verschaffte mir Boyar eine Unterredung mit Karakhan.
In den Hallen des Buckingham-Palastes herrschte große Erregung, als ich auf das Wartezimmer des roten Oberbefehlshabers zuschritt. Augenblicklich wurde ich in den langen Salon geführt, in dem er sein Arbeitszimmer eingerichtet hatte. Als die Tür sich hinter mir schloß, sah ich, daß der Rote Napoleon und ich allein im Raum waren.
Ich ging auf den langen, breiten Tisch zu, hinter dem Karakhan stand. Sein Kopf war vorgeneigt, er studierte eine große Karte, die fast die ganze Tischplatte bedeckte.
Mit einem flüchtigen Blick sah ich, daß es eine Erdkarte war, die mit bunten Fähnchen und Nadeln übersät war.
Nach etwa einer Minute hob Karakhan den Kopf und sah mich an. Kein Lächeln, kein Gruß war auf seinen Zügen zu sehen.
»Was gibt es?«
Der Ton war hart und trocken. Nicht unfreundlich, aber sehr kurz angebunden.
»Ich bin gekommen, um mich von meinem Ehrenwort entbinden zu lassen«, erwiderte ich. »Sie stehen jetzt im Krieg mit meinem Vaterland oder werden in wenigen Stunden so weit sein.
Ich bin Bürger der Vereinigten Staaten, und als solchem war es mir während des letzten Jahres gestattet, bei Ihren Truppen zu dienen. Ich habe das Vertrauen zu achten und zu schätzen gewußt, das Sie in mich gesetzt haben.
Sie kennen meine persönlichen Ansichten über Patriotismus und Nationalismus, kurz, über einfache Treue. Ich bitte um die Erlaubnis, in mein Vaterland zurückkehren und meine beiden Mitarbeiter mitnehmen zu dürfen.«
Auf meine Worte folgte ein zweites langes Schweigen, während dessen die stahlharten Augen in mein Gesicht starrten. Trotz allen Bemühungen konnte ich nicht erraten, was mir dieser Blick und dieses Schweigen verhießen.
Meine nahen Beziehungen zu dem Roten Napoleon konnten mich keine persönliche Rücksichtnahme erwarten lassen, wenn diese den Vorteilen Karakhans zuwiderlaufen sollte. Dann sprach er:
»Die Welt steht an der Schwelle einer neuen Ära. Sie ist jetzt zu klein, um zwei einander widersprechenden Denksystemen Platz zu gewähren. Diese Meinungsteilung muß zum Verschwinden gebracht werden. Es darf nur einen Herrn geben.
Für die Vorgänge in Salina Cruz habe ich kein Bedauern. Wäre es nicht dort gewesen, so hätte es an irgendeinem anderen Ort geschehen müssen.
Ich bin stolz darauf, daß ich seit dem Frieden von Paris imstande gewesen bin, meine Truppen neu zu organisieren, daß der heutige Tag mich darauf vorbereitet findet, dem Schicksal, das vor uns liegt, mit Siegesgewißheit entgegenzumarschieren.
Napoleon eroberte ganz Europa, wurde aber von dem Wasserstreifen zwischen dem Kontinent und diesen britischen Inseln aufgehalten. Ich habe die ganze Welt mit Ausnahme der westlichen Hemisphäre erobert.
Der englische Kanal und die britische Flotte hielten Napoleons Vormarsch auf. Das war der Anfang seiner Niederlage und sein Ende, das war der schwache Punkt in seinen Plänen; das war sein großer Fehler. Ich habe aus seinem Fehler gelernt.«
Das war schon eine lange Rede für Karakhan. Aber bald sprach er noch weiter:
»Die Völker der Neuen Welt hoffen, daß der Atlantische und der Stille Ozean ihnen die Sicherheit gewähren, die England in den Tagen Bonapartes im englischen Kanal fand. Diese Hoffnung ist ihr Irrtum. Das werden sie bald sehen. Der Atlantische und der Stille Ozean bieten mir keine Hindernisse.
Sie kennen die Kräfte, die heute zur roten Flagge stehen – die 900 000 000 Menschen Asiens, die 400 000 000 Europas und die 180 000 000 Afrikas.
Unsere Gegner sind die 130 000 000 Nordamerikas und vielleicht die 40 000 000 Südamerikas.
Vergleichen Sie die Summen: 1 500 000 000 Menschen gegen nicht ganz 200 000 000.
Unter der roten Flagge sind die Materialien dreier ganzer Kontinente. Wir haben Nahrungsmittel und Rohmaterialien in Überfluß. Die Industrie Europas, die zum erstenmal vereinigt ist und zusammenarbeitet, kann mehr als unsere Bedürfnisse versorgen.
Die Handelsmarine dreier Kontinente genügt zur Überbrückung aller Ozeane. Die Flotten der Paneurasischen Union werden innerhalb vierundzwanzig Stunden alle Wasserwege der Erde kontrollieren. Kein Schiff wird sich ohne unsere Flagge auf den Meeren zeigen – ich wiederhole: kein Schiff!«
Das hatte ich vergessen. Wie sollte ich nach Amerika zurückkehren?
»Meine Armeen umfassen den Erdball«, fuhr Karakhan in ruhigem Ton fort. »Jedem Feind und jeder möglichen Vereinigung von Feinden zahlenmäßig überlegen, ziehe ich in den Krieg, mit dem Wissen, daß hinter meinen Schlachtlinien eine Menschenreserve steht, die es mir möglich macht, frische und sogar größere Truppen mit jeder erforderlichen Geschwindigkeit auf den Kriegsschauplatz zu werfen.
Was glauben Sie, weshalb ich Ihnen gestattet habe, meine militärischen Operationen im Lauf dieses Jahres zu beobachten und darüber zu berichten? Ihr Blick ist scharf; Ihre Auffassung ist gut; Sie schreiben mit großer Lebendigkeit.
Ich hatte gehofft, daß Ihre Worte Ihre Landsleute überzeugen würden – überzeugen und so vor dem unvermeidlichen Unheil bewahren, das ihnen jetzt bevorsteht. Jetzt muß die Gewalt der Lehrer sein – und sie ist ohnedies der beste Lehrer.
Und nun zu Ihrer Bitte. Sie wissen selbstverständlich, daß es in meiner Macht läge, Sie hier bei mir zu behalten. Ich würde auch gar keine moralischen Bedenken dagegen haben. Die Moral ist im Krieg überflüssiger Ballast, aber es paßt besser in meine Zwecke, Sie in Ihr Land zurückzuschicken. Ich lerne aus den Fehlern meiner Vorgänger.
Einer der größten Fehler im Weltkrieg wurde von den militärischen Führern auf beiden Seiten begangen. Das war die Torheit blinder Zensur, die alle Aufklärung – militärische und andere – unterdrückte.
Die Zensur hatte keine Daseinsberechtigung. Sie wurde von idiotischen Militärs eingerichtet, die auf diese Weise zu verhindern hofften, daß ihre kostspieligen Dummheiten unter der Zivilbevölkerung bekannt würden.
Ich habe in Europa den Terror herrschen lassen. Sie haben den Anfang unserer Exekutionen in Warschau und Bukarest gesehen; Sie haben gesehen, wie die Vertreter der Bourgeoisie in Belgrad und Wien ihr Leben lassen mußten; Sie haben die fascistischen Narren zu Tausenden in Italien fallen sehen; Sie haben gesehen, wie Franzosen, Spanier und Engländer von unseren Exekutivkommanden niedergeschossen wurden. Sie durften über jeden dieser Vorgänge mit allen grauenhaften Einzelheiten berichten. Weshalb?
Das ist Krieg. Ich führte Krieg. Ich hatte nichts zu verbergen, nichts zu bedauern, es war nichts da, dessen ich mich zu schämen gehabt hätte. Die Welt sieht heute das Resultat in der Vereinigung dreier Kontinente, in der Befriedung von eineinhalb Milliarden Menschen und der Verschmelzung ihrer wirtschaftlichen, finanziellen und militärischen Kräfte unter einer Flagge – und all dies wurde im Lauf eines Jahres erreicht.
Das ist der Vollendung wert. Es wiegt alle Menschenleben auf, die es gekostet hat, jeden Blutstropfen und jede Träne, die dafür vergossen worden ist.«
Karakhan ging hinter dem langen Tisch auf und ab und stellte sich wieder hinter die Karte. Er umfuhr mit einem Finger die Grenzlinie der Vereinigten Staaten und sagte:
»Ihr Land und Ihre Regierung hätten aus den Ereignissen des letzten Jahres lernen sollen. Die unerhörte Wohlhabenheit, in die Ihr Land nach dem Jahr 1918 kam, hat Ihr Volk blind gegen Wirklichkeiten gemacht. Seitdem die Schuldenfrage im Jahre 1918 akut geworden ist, hat die Popularität Amerikas in Europa stets abgenommen.
Das unglaubliche Unwissen hinter den Ratschlägen, welche Ihre hinterwäldlerischen Staatsmänner stets von neuem der übrigen Welt erteilt haben, konnte nur Empörung hervorrufen.
Immer wieder hat sich Amerika, wie Präsident Wilson in Versailles, damit gebrüstet, daß es nichts von der Welt wolle, und sich darüber beklagt, daß die übrige Welt Forderungen stelle.
Diese Politik war richtig für Amerika, das alles hatte und nichts brauchte. Aber es war eine schlechte Medizin und ein armseliges Predigen, wenn amerikanische Moralisten denselben Maßstab auf übervölkerte, kämpfende, mit Armut geschlagene Länder anwenden wollten, die nichts hatten und alles brauchten.
Ich spreche ganz offen mit Ihnen, weil ich den Wunsch habe, daß Sie Ihre Landsleute darüber informieren, was man in der ganzen Welt von ihrer Regierung hält.
Sie ersuchen darum, nach Amerika zurückkehren zu dürfen, und ich gestatte es Ihnen. Sie haben die Vereinbarung eingehalten, die wir in Moskau getroffen haben. Ab und zu war ich genötigt, den einen oder anderen Bericht, der zur Veröffentlichung in Amerika bestimmt war, zurückzuhalten. Einige Ihrer Schlußfolgerungen waren zu rasch und hätten meinen Zielen schaden können.
Aber jetzt, bei Ihrer Abreise, sollen Sie mit dem Gefühl gehen, daß Sie in Ihrer Berichterstattung durch nichts gehemmt sein werden.
Alles, was Sie wissen, alles, was Sie gesehen, und alles, was Sie gehört haben, alle altmodischen Militärgeheimnisse, in deren Besitz Sie vielleicht zu sein glauben – Sie haben meine Sanktion, alles zu enthüllen. Geben Sie Ihrer Regierung und Ihrem Volke die Informationen mit meinen besten Komplimenten.«
Ich verbeugte mich dankend. Karakhan nahm ein Blatt Papier von seinem Tisch und las darin.
»Ihr Pilot Binney geht mit Ihnen, aber Ihre Stenotypistin oder Sekretärin bleibt hier. Sie ist nicht Amerikanerin. Sie ist Bürgerin der Roten Union. Sie werden mit Ihrem Piloten in Sicherheit bis zu den amerikanischen Linien gebracht werden, und wenn das Glück Ihnen günstig ist, werden wir uns vielleicht wiedersehen. Ich würde mich freuen, wenn das der Fall sein sollte. Sie können gehen. Um die Ausführung der Einzelheiten wird sich Oberst Boyar kümmern.«
Er wußte also, wo Margot steckte. Eine Frage drängte sich mir auf die Lippen, aber die Verabschiedung war so endgültig, daß ich nicht dazu kam, sie auszusprechen.
Aber auch Boyar wußte, wo sie war, und mit diesem Gedanken eilte ich in das Tribune-Büro zurück, wo ich den lächelnden Oberst und den nervösen Speed Binney vorfand.
»Wo ist Margot?« fragte ich. »Sie wissen es.«
»Jetzt kann ich es Ihnen sagen«, antwortete Boyar.
»Rasch!« schrie Binney in etwas drohendem Ton. »Wo?«
»Sicher und gesund und so glücklich, wie ein hübsches Mädchen es nur sein kann, wenn sie von zwei miteinander rivalisierenden Amerikanern getrennt ist. Übrigens, Whit sollte auch hier sein. Wo steckt er denn?«
»Zum Teufel mit Whit, wo ist Margot?« rief Binney.
»Sie wird nicht mit Ihnen zurückkehren dürfen«, antwortete Boyar. »Das ist entschieden. Es ergibt sich aus den häuslichen Angelegenheiten unseres Onkelchens. Leider Gottes hat Mrs. Karakhan die abendländische Vorstellung, daß eine Frau stets in der Nähe ihres Gatten sein muß.
Margot schloß mit ihr Freundschaft, als sie entgegen den Befehlen des Generals nach Wien kam. Karakhan ist Margot deshalb nicht böse.
Im Gegenteil, er ist überzeugt davon, daß sie sehr viel dazu beigetragen hat, daß er von Belästigungen durch eine hysterische Frau verschont geblieben ist – er ist so überzeugt davon, daß er die beiden zusammen lassen will. Er hat sie bis jetzt nicht gesehen und wird es wohl auch kaum tun.
Die Frauenaffären des Generals sind eine Sache, und seine Familie – seine Frau und die Mutter seiner Kinder – eine ganz andere. Ich kann Ihnen für die Sicherheit Mrs. Karakhans und Margots bürgen. Das müßte Sie freuen, Speed.«
»Und sie wird in England bleiben müssen, bis der Krieg aus ist?« fragte Binney.
»Wenn der General ihr nicht erlaubt, seine Frau nach New York zu begleiten.«
Als ich an diesem Abend packte, fand ich in meinem Necessaire-Köfferchen folgenden Zettel:
»Die Roten suchen alle Amerikaner, um sie zu internieren. Mit Ihnen und Binney ist alles in Ordnung, aber hinter mir sind sie her. Jedenfalls werde ich es ihnen nicht leicht machen, mich zu kriegen. Ich weiß noch nicht, wie ich in die Staaten kommen soll, aber wenn ich am Leben bleibe, werde ich hinkommen und am Krieg teilnehmen.
Ich glaube zu wissen, wo Margot ist, und werde sie sehen, bevor ich gehe.
Leben Sie wohl, und viel Glück.
Whit.«
Spät in der Nacht reisten Binney und ich, begleitet von Boyar, mit einem Flugzeug des Roten Transeurasischen Luftdienstes von London nach Yokohama ab. Boyar erklärte uns, daß wir über den Stillen Ozean nach Amerika geschafft werden sollten. Den größten Teil der vier Tage und Nächte, welche die Reise in Anspruch nahm, verbrachten wir mit den Kopfhörern am Ohr, den Radiobotschaften lauschend, welche die Roten von London verbreiteten.
Wir hörten die Stimme des Roten Napoleons selbst, als er in langsamem, präzisem Englisch die Kriegserklärung verlas, die den Millionen der Roten Union den Sieg verhieß und an das »amerikanische Proletariat« appellierte. Darauf folgten in allen Sprachen Reden der Roten, die sich an die verschiedenen Teile der Vereinigten Staaten wandten. Allen im Ausland Geborenen und allen Bindestrich-Amerikanern wurde innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten territoriale Autonomie versprochen.
Den deutschsprechenden Bürgern Wisconsins stellten die Roten einen autonomen Sowjetstaat in Aussicht. Ansprachen in norwegischer, schwedischer und dänischer Sprache verkündeten den Skandinaviern Minnesotas und der beiden Dakotas ein unabhängiges Neu-Skandinavien.
Den Italienern New Yorks, den Irisch-Amerikanern in allen Gebieten, den nord- und südslawischen Auswanderern, den Bürgern mexikanischer und spanischer Abstammung im Südwesten – allen wurden unabhängige Territorien versprochen.
Moses Carling, der exilierte amerikanische Neger, der seit Jahren Besitzer eines bekannten Moskauer Cafés war, sprach am Mikrophon zu zehn Millionen Negern und erklärte, daß Karakhan ihnen die Staaten Louisiana und Mississippi als unabhängige Sowjetrepublik geben würde, wenn sie gegen die »weißen Lyncher« von Washington revoltierten.
»In Amerika gibt es mehr Empfangsapparate als in der ganzen übrigen Welt«, erklärte Boyar. »In der Roten Union hat die Polizei Kenntnis von jedem Apparat, so daß wir alle unter unserer Kontrolle haben. Washington hat keine Kontrolle über die Apparate in Amerika, ich wüßte also nicht, wie verhindert werden sollte, daß unsere Propaganda ihr Ziel erreicht.«
Später erfuhr ich in Washington, daß es der Regierung möglich gewesen wäre, die Aufnahme der roten Propaganda durch Sendung von Störungswellen unmöglich zu machen. Aber man hatte auf diese Verteidigungsmaßnahme verzichtet und die Luft für die Propaganda beider Seiten offen gelassen.
Loyale Amerikaner jeglicher Abstammung sandten durch das Radio Antworten in allen Sprachen. Aber trotz diesen schönen patriotischen Bemühungen konnte die rote Propaganda Teilerfolge verzeichnen.
Als wir in Yokohama ankamen, war der Hafen mit Schiffen überfüllt – es waren Fahrzeuge aus allen Gegenden des Orients, die Ladungen für die mexikanische Westküste hatten. In den roten Flottenstützpunkten Yokosuka, Maisuru, Kure, Sasebo und Pescadores herrschte die gleiche Emsigkeit.
Kaum wie Gefangene, wie wir selbst uns vorkamen, eher wie Ehrengäste wurden Binney und ich an Bord des Dampfers Reba Harris von der American Dollar Line geleitet; es war eines der vielen amerikanischen Fahrzeuge, die bei der Kriegserklärung in einem fremden Hafen gekapert worden waren.
Auf diese Weise erfuhren wir von der furchtbaren Tatsache, daß die kolossale Überlegenheit der roten Flotte und das Fehlen neutraler Häfen in der ganzen Welt dazu geführt hatten, daß die amerikanische Flagge von den Meeren verschwunden war.
Viele amerikanische Schiffe waren aufgegriffen worden, während sie mit Volldampf auf amerikanische Häfen zustrebten, und unzählige Fahrzeuge, die bei der Kriegserklärung gerade in roten Häfen lagen, wurden beschlagnahmt, bevor sie ausfahren konnten.
Mit dreitausend japanischen Soldaten an Bord stachen wir in See. Wir hatten eine große Anzahl japanischer und russischer Stabsoffiziere bei uns, die nach Salina Cruz reisten, um den Generalstab für General Kamku zu bilden, dem Karakhan den Befehl über die roten paneurasischen Expeditionstruppen in Mexiko erteilt hatte.
Französisch, deutsch und englisch plauderten sie mit uns munter über ihre Aussichten in Mexiko. Zum größten Teil waren sie jung, leichtsinnig und wagemutig. Sie sprachen von Wein und weißen Mädchen, von Guitarren und Mondschein unter Palmen. Binney und ich schwiegen angesichts dieses übermütigen Jubels, aber Boyar scherzte mit ihnen und mit uns.
Als wir am zweiten Vormittag in der kalten Januarluft auf dem Verdeck auf und ab gingen, erzählte mir der Oberst:
»Unsere Linien rücken von Salina Cruz in nördlicher Richtung langsam vor. Kamku ist ein wilder Teufel. Er ist der Gelbe, der bei der Eroberung der Philippinen die Landung im Norden der Manila-Bai durchgeführt hat – er versteht sich ausgezeichnet auf sein Geschäft – er war schon in der alten kaiserlichen Armee Offizier – sozusagen ein adliger Renegat – ein Samurai, der rot geworden ist. So etwas Ähnliches wie der alte Tschitscherin in Moskau.«
»Wurde die Landung in Salina Cruz nicht durch Flottenmanöver erschwert?« fragte ich.
»Leider nicht. Unter anderem hatte die Aktion ja auch den Zweck, amerikanische Flotteneinheiten in den Stillen Ozean zurückzulocken. Die Hälfte der japanischen Flotte deckte Kamkus Landung und hätte sich jedes amerikanische Kriegsschiff vornehmen können, das Eure Flotte im Karaibischen Meer abgeordnet hätte.
Aber da trotz allem Gebrüll von Euren Politikern an der pazifischen Küste keine Seestreitkräfte zur Verteidigung von Salina Cruz ausgeschickt wurden, scheint Euer Generalstab in Washington durchaus nicht auf den Kopf gefallen zu sein.«
»Was hat Karakhan für taktische Absichten? Wieviel Mann hat er? Was will er unternehmen?«
»Seine Truppen haben augenblicklich eine Stärke von mehr als hunderttausend Mann«, erklärte Boyar. »Und täglich werden weitere zehntausend Mann gelandet. Aber nicht alle aus Japan, verstehen Sie.
Einige von den Kontingenten kommen aus Australien, Neuseeland, den Philippinen und einem Teil der früheren britischen und französischen Inselgruppen im Stillen Ozean. Im Verlauf der letzten drei Monate wurden die betreffenden Garnisonen verdoppelt und verdreifacht und ihre Truppen bis zur letzten Minute für die Landungsmanöver ausgebildet. Viele von ihnen haben das australische Massaker mitgemacht. Glauben Sie nicht, daß diese Expedition auf gut Glück unternommen ist. Sie ist seit langer Zeit geplant.
Kamku rückt längs der Eisenbahnstrecke vor, die von Salina Cruz in nördlicher Richtung über den Isthmus von Tehuantepec nach Puerto Mexiko führt. Sein Ziel ist, zum Golf von Mexiko durchzustoßen. Ich glaube auch, daß er es schaffen wird. Bedenken Sie, daß der ganze Isthmus nur zweihundertzwanzig Kilometer breit ist.«
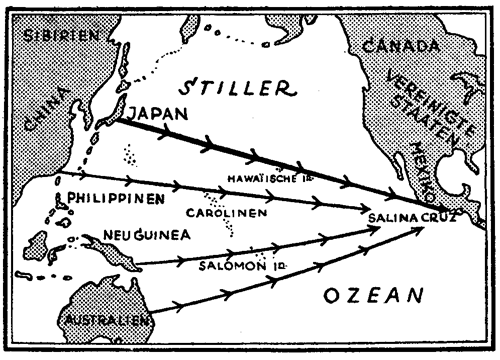
Konzentration der roten See- und Landstreitkräfte für den Einmarsch in Mexiko
Wir gingen in den Rauchsalon hinunter, wo eine Kriegskarte der mexikanischen Front an der Wand hing.
»Rote Truppen haben den Knotenpunkt San Gueronimo eingenommen«, erklärte Boyar. »Sie sehen, Salina Cruz ist das Zentrum eines Achtzigkilometer-Kreises, der ungefähr unsere Linie um die Stadt darstellt.
Wir halten die Bahnstrecke im Süden von Cerro Loco. Die Natur des Landes ist so, daß alle Kämpfe an der Bahnstrecke vor sich gehen müssen. Ich weiß nicht, wie stark die amerikanischen und mexikanischen Truppen sind, die uns gegenüberstehen. Aber ich glaube, sie leiden schwer darunter, daß sie nur eine Eisenbahn hinter sich haben. Ihre Stützpunkte sind Puerto Mexiko und Vera Cruz.«
Einer der wenigen Zivilisten an Bord der Reba Harris war Remus Stein, ein alter Agent des Moskauer Auswärtigen Amtes. Er hatte eine diplomatische Mission in Mexiko, und Boyar machte mich mit ihm bekannt, um mir Aufschlüsse über die innere Lage Mexikos zukommen zu lassen.
»Sie wissen selbstverständlich, daß Madame Collontai, die alte russische Botschafterin in Mexiko City, die Rote Union dort vertreten hat«, erläuterte Stein. »Sie ist eine alte Revolutionskameradin Lenins und Trotzkis. Ihr amerikanischer Geheimdienst interessiert sich seit Jahren für ihre Tätigkeit in Mexiko. Jetzt ist sie in Salina Cruz, und von ihr stammen die Berichte über die Ereignisse nach dem Eintreffen unseres Ultimatums in Mexiko City.«
»Was ist geschehen?« fragte ich.
»Die übliche mexikanische Krise. Ihr amerikanischer Botschafter Ketcham konferierte sofort mit dem Präsidenten Maytoreyna, und es kam zu langen Ferngesprächen mit Washington. Morones, der Führer der Opposition, warf Maytoreyna vor, er wende sich in einer Gefahr, der der Ansicht der Opposition nach mit den Land- und Luftstreitkräften Mexikos allein begegnet werden könnte, zu rasch um Hilfe an die Vereinigten Staaten.
Es kam zu einer öffentlichen Demonstration, in deren Verlauf die Opposition zur Bezeichnung ihrer Politik das Schlagwort prägte: ›Lieber Sowjetföderation mit Karakhan als Kapitalsklaverei unter dem amerikanischen Imperialismus!‹ Ich sage Ihnen ganz offen, daß das ein unverhüllter Appell an die weitverbreiteten mexikanischen Vorurteile gegen Amerika war, muß aber gleichzeitig leider zugeben, daß er versagte. Präsident Maytoreyna ersuchte offiziell um die Hilfe Amerikas gegen unsere Landung.«
»Wie lange dauerten diese Verhandlungen?« fragte ich. »Es muß auf jede einzelne Stunde angekommen sein.«
»Die Verhandlungen waren Kohl«, antwortete Stein lächelnd. »Washington hatte sie gar nicht abgewartet. Schon lange bevor sie beendet waren, waren amerikanische Abteilungen von Garnisonen im Westen und Mittelwesten an der amerikanischen Grenze konzentriert. In Tampa, Mobile und New Orleans mobilisierte Truppen der atlantischen Küste waren schon auf Transportschiffen unterwegs nach Mexiko, während die Narren in den Straßen von Mexiko City noch immer ein Geschrei um ihre Unabhängigkeit erhoben.«
»Wann traten die Amerikaner in Aktion?« fragte Binney.
»Nach der Washingtoner Radiomeldung erschien ein amerikanisches Geschwader vor Puerto Mexiko, nicht ganz eine Stunde, nachdem das Abkommen getroffen war. Die amerikanischen Kriegsschiffe salutierten der mexikanischen Flagge, und die mexikanischen Küstenbatterien begrüßten die amerikanische Fahne. Zuerst gingen amerikanische Marinedetachements an Land, dann Truppen, deren Zahl wir noch nicht kennen, und diese rückten längs der Eisenbahnstrecke auf Salina Cruz vor, wo sie sich mit den mexikanischen Truppen vereinigten. Und dort finden jetzt die Kämpfe statt.
Im Norden war Madame Collontais Arbeit von mehr Erfolg begleitet. Die Yaqui-Indianer revoltierten in Sonora und behinderten das Vorwärtskommen der von der Arizona-Grenze abgegangenen amerikanischen Truppenzüge.
Bei Hermosillo war ihr Widerstand so entschlossen, daß das amerikanische Vorrücken durch die Rebellen und die meuternde Garnison der Stadt zwei volle Tage aufgehalten wurde. Hermosillo litt schwer unter der amerikanischen Beschießung, der einige Zivilisten zum Opfer fielen.
Im Süden von Chihuahua City wurde ein amerikanischer Transportzug aus den Schienen geworfen und ein anderer kurz vor dem Eisenbahnknotenpunkt Irapuato durch eine Mine in die Luft gesprengt. Die Verluste der Amerikaner waren sehr groß.«
Später erfuhr ich, daß der mexikanische Generalstab so klug gewesen war, einen großen Teil seiner Streitkräfte zur Verteidigung der Häfen Manzanillo, Guaymas, Mazatlan und Topolobambo an der mexikanischen Westküste einzusetzen, und daß man Eisenbahnartillerie auf den Strecken am Golf von Kalifornien konzentriert hatte.
Binney klagte täglich darüber, wie langsam unser Schiff vorwärts komme, und auch ich brannte darauf, endlich zu unserem Heere zu gelangen. Boyar verstand und achtete unsere Gefühle wohl, aber er schien sich über jede entmutigende Nachricht zu freuen, die er uns bringen konnte.
Als wir zehn Tage von Yokohama unterwegs waren, erzählte er uns:
»Auf Hawai sind fürchterliche Kämpfe im Gange. Die japanische Bevölkerung hat revoltiert und sich eines Forts mit voller Bewaffnung und Munitionsvorräten bemächtigt. Sie halten auch das Wahiawa-Reservoir besetzt, das Oahu mit Wasser versorgt.
In den Straßen Honolulus ist es zu schweren Kämpfen gekommen, und ich muß Ihnen leider mitteilen, daß einige amerikanische Ananaspflanzer mit ihren Frauen und Kindern von ihren Angestellten umgebracht worden sind.
Wir haben Radioberichte von den japanischen Aufständischen aufgefangen, und sowohl diese wie amerikanische Depeschen, die wir bereits dechiffriert haben, weisen darauf hin, daß es überall so lustig zugeht. Es sieht so ähnlich aus wie damals in Australien.«
»Quatsch«, rief Binney. »Ihr scheint nicht zu begreifen, daß Ihr jetzt gegen Amerikaner kämpft.«
»Aber selbstverständlich. Sonst ist ja niemand mehr da. Sie vergessen aber, mein lieber Speed, daß die amerikanische Flotte den Stützpunkt in Pearl Harbour evakuiert hat, so daß Ihren Landstreitkräften auf der Insel jetzt nichts anderes übrigbleibt, als bis auf den letzten Mann zu kämpfen. Auf Verstärkungen können sie nicht rechnen. Der Stille Ozean steht unter unserer Herrschaft.
Ob der hawaische Aufstand Erfolg hat oder nicht, ist ziemlich gleichgültig. Ich glaube nicht, daß Karakhan den Versuch machen wird, die Inseln mit einem Expeditionskorps zu erobern. Das sind sie uns nicht wert, und für Euch sind sie auch nutzlos, weil Ihr keine Flotte im Stillen Ozean habt. Ihr könntet uns ein bißchen unangenehm werden, wenn Ihr einen Unterseebootstützpunkt dort einrichtet, aber ich glaube, Ihr werdet alle Eure Unterseeboote im Atlantik brauchen.«
»Trotzdem merke ich«, sagte Binney, »daß unser Schiff bei Nacht ohne Lichter fährt, und daß wir Honolulu in einem weiten Bogen ausweichen.«
Einige Male während der Fahrt waren wir an japanischen Zerstörern vorbeigekommen, und einmal hatte uns in der Nacht der Dreißigtausendtonnen-Dampfer Nichi Maru angerufen, der, wie Boyar uns erzählte, zu einem bewaffneten Handelsmarinezerstörer umgewandelt worden war und vier Fünfzehnzentimeter-Geschütze führte.
»In der vergangenen Woche hat sie vier amerikanische Schiffe aufgebracht«, sagte er. »Zwei wurden gekapert, und zwei versenkt, weil die Kapitäne sich weigerten, beizudrehen. Jetzt schafft sie die aufgebrachten Mannschaften und Passagiere nach Yokohama.«
Einundzwanzig Tage, nachdem wir von Yokohama ausgefahren waren, dampften wir in den Hafen von Salina Cruz. Zwei kleine halbstarre Luftschiffe, deren zigarrenförmige Körper in der Morgensonne rosig und silbern leuchteten, patrouillierten langsam über der braunen Küste vor uns. Minensucher fuhren uns voraus, und japanische Zerstörer waren ununterbrochen in wachsamer Bewegung. In der Luft über uns surrten Aeroplane. Die Fahrstraßen vom und zum Hafen waren überfüllt mit ein- und ausfahrenden Schiffen.
Auf der langen Dünung des Stillen Ozeans lagen die großen Schlachtschiffe, deren Bordwände jetzt grotesk bemalt waren. Boyar zeigte uns alle. Zunächst die beiden alten kaiserlichen japanischen Linienschiffe Ise und Fuso, die aus den Jahren 1917 und 1915 stammten. Sie hatten wenig mehr als dreißigtausend Tonnen, konnten eine Geschwindigkeit von dreiundzwanzig Knoten entwickeln, und ihre Hauptbestückung bestand aus Dreißigzentimeter-Geschützen.
Etwas weiter draußen lagen die alten Kreuzer Hiyei und Kongo, etwas kleinere Fahrzeuge, die aber fünf Knoten mehr machen konnten und mit acht Fünfunddreißigzentimeter-Geschützen bestückt waren.
»Dort sehen Sie die Flugzeug-Mutterschiffe Akagi und Kaga«, sagte Boyar. »Sie können sie an den drei Schornsteinstumpfen erkennen, die an der linken Seite des Schiffes unterhalb des Landungsverdecks hervorragen. Beide führen hundert Flugzeuge mit sich und sind mit Zwanzigzentimeter-Geschützen bestückt.«
Von den Decks der Mutterschiffe stiegen in ununterbrochener Reihenfolge Flugzeuge auf, die hinter dem Halbkreis kahler, brauner Anhöhen verschwanden, in deren Mitte Salina Cruz liegt. Wenn man diesen Bergring vom Meer sah, konnte man nicht feststellen, wo er von der Eisenbahnlinie durchschnitten wurde.
Zahlreiche Flugzeugabwehrkanonen, deren Mündungen zum Himmel wiesen, waren auf den beiden Molen eingebaut, die den äußeren Hafen begrenzen.
Rechts bei der Einfahrt in den inneren Hafen sah eine Mole schwer beschädigt aus.
»Irgendein amerikanisches Vögelchen hier hat anscheinend etwas auf den Hafen fallen lassen«, sagte Speed voll Fliegerstolz zu Boyar.
»Das wäre sehr schön gewesen, Speed«, antwortete Boyar. »Es hätte uns die Mühe erspart, selbst die Mole wegzusprengen. Wir mußten es tun, weil die Einfahrt nur siebenundzwanzig Meter breit war und einige unserer Schiffe nicht durch konnten. Amerikanische und mexikanische Flugzeuge versuchen immer wieder Bomben abzuwerfen, aber bis jetzt konnten sie von unseren Luftstreitkräften verjagt werden.«
Im Inneren des Hafens, der eine Fläche von etwa zwanzig Morgen einnahm, waren Truppen und Proviantschiffe an den Kais vertäut, und die elektrischen Krane, Aufzüge und Heber luden Geschütze, Protzen und Pferde aus, Tanks, Automobile und alle möglichen militärischen Lasten. Von ferne war Geschützdonner zu hören.
Aus den Schiffen marschierten über Laufplanken lange Reihen japanischer Infanterie an Land. Sie trugen Gewehre, Feldflaschen, Hafersäcke, Gasmasken, aufgerollte Decken und ihre persönlichen Habseligkeiten.
Japanische Stewards brachten respektvoll unser Gepäck auf den Kai und nahmen mit lächelndem Dank unsere Trinkgelder an. Mexikanische Lastträger, nackt bis zum Gürtel, luden sich unsere Koffer auf die knochigen braunen Schultern, und, geführt von einem jungen und eleganten japanischen Leutnant, gingen wir durch die Hauptstraße von Salina Cruz zum Hotel Guasti, dem Hauptquartier des Generals Kamku, der uns erwartete.
Der verhältnismäßig noch junge japanische General, der ziemlich klein war, hatte ein rundes Gesicht und einen runden Bauch. Er lächelte uns zu, wobei er zwei ebenmäßige Reihen weißer Zähne zeigte, und sprach uns französisch an:
»Wir haben Befehl aus London, Sie hinter die amerikanischen Linien zu schaffen. Bei Tag wird sich das leider nicht machen lassen, weil ich nicht wünsche, daß Sie unsere Stellungen beobachten können, aber morgen in der Nacht wird man Sie in der Gegend des Hafens von Puerto Mexiko mit Fallschirmen abspringen lassen.«
Ich sah Binney fragend an. Sollte ein Abspringen in der Dunkelheit über einem fremden Hafen als gesunde Übung betrachtet werden? Binney zuckte die Achseln.
»General, es ist ganz gleichgültig, was Mr. Gibbons und Mr. Binney beobachten können«, sagte Oberst Boyar sanft. »Sie sind …«
»Ich denke lediglich an die Sicherheit meiner Truppen«, antwortete Kamku hitzig, ärgerlich aufspringend. »Unseren Linien wird im Norden schwer zugesetzt. Unsere augenblicklichen Stellungen müssen so gut wie möglich geheimgehalten werden. Ich habe hier den Befehl und werde nicht dulden, daß Spione durch …«
»Würde der General die Freundlichkeit haben, diese Instruktionen zu lesen?« unterbrach ihn Boyar, ihm ein zusammengefaltetes weißes Papier reichend, das einen dreiviertel Zentimeter breiten roten Rand hatte.
Schweigend sahen wir zu, während der japanische Befehlshaber mit spitzen Augen die Maschinenschrift las. Wortlos gab er Boyar das Dokument zurück und setzte sich. Dann sagte er zu seinem Adjutanten:
»Sie werden dafür sorgen, daß dem Oberst Boyar, wann und wo er will, alles für den Flug zur Verfügung gestellt wird. Ich danke.«
Nach gegenseitigen Verbeugungen gingen wir aus dem Zimmer, und auf dem Flur blinzelte Binney Boyar zu und sagte:
»Ich weiß nicht, was auf dem Papier steht, aber für den guten Papa Kamku muß es so etwas gewesen sein wie die Stimme seines Herrn.«
»Es ist von Karakhan«, antwortete Boyar. »Wir werden alles für eine Tageslandung vorbereiten und für so viel Sicherheit, wie möglich ist, sorgen.«
Während die schwitzenden Lastträger unser Gepäck zum Hotel Gambrinus schafften, führte Boyar uns zu dem Terminal-Hotel, das jetzt in ein Lazarett umgewandelt war.
»Hier liegen einige verwundete amerikanische Offiziere«, erklärte er uns. »Ich sehe nicht ein, warum Sie nicht mit ihnen sprechen sollten.« Eine Ordonnanz führte uns zu einem bewachten Zimmer am Ende des Korridors im zweiten Stockwerk.
Auf einem Feldbett lag ein Mann, der, als wir eintraten, Zigaretten rauchend zur Decke starrte, uns aber nach unserem Eintritt sofort musterte.
»Na, da sollen doch zehntausend Teufel kommen und mich …«
»Und mich auch«, unterbrach ich ihn, vorwärts tretend und seine ausgestreckte Hand ergreifend. Es war Major Hickey Collins von der fünften Marinebrigade.
Collins, der im Rufe stand, der versierteste Flucher des ganzen Marinekorps zu sein, hatte von der Pike auf gedient und in den ersten Julitagen 1918, als die Marinebrigade der alten zweiten Division die Deutschen von der Marne zurücktrieb, das Offizierspatent bekommen. Hickey und ich hatten so manches Gefecht und so manches Saufgelage gemeinsam durchgemacht. Zum letztenmal hatte ich ihn 1924 in Peking gesehen, wo sein Bataillon zu der amerikanischen Gesandtschaftswache gehörte. Als ich ihm kurz auseinandergesetzt hatte, wieso ich nach Salina Cruz kam, erzählte er mir von den Kämpfen im Inneren des Landes, in deren Verlauf er verwundet gefangengenommen worden war.
»Die Brigade wurde in Puerto Mexiko gelandet, und mein Bataillon wurde mit der Bahn augenblicklich in das Landesinnere transportiert. In Santa Lucrecia, dem Kreuzungspunkt mit der Straße, die nach Vera Cruz führt, ließen wir eine Kompanie zurück, und die beiden anderen Kompanien führte ich an den Fuß der Berge bei Chievela. Und dort tat sich allerhand!
Dschungel, Schlingpflanzen, Unterholz, Schlangen und schreiende Papageien, Landkrabben, die einem unter den Füßen herumkriechen, Dschungeldickichte, so feucht und heiß, daß der ganz Boden dampft.
Wir gingen rechts und links von der Strecke in Stellung und suchten uns einzugraben. Auf beiden Seiten waren die Dschungel voller Japs, in der Luft wurde Tag und Nacht ununterbrochen gekämpft.
Kaum daß unser Zug in Chievela eingefahren war, haben japanische Bombengeschwader die Strecke hinter uns zerstört, so daß wir von allem Nachschub abgeschnitten waren.
Ich habe mein Ding am dritten Tag von einer Fliegerbombe erwischt, irgendeine Schweinerei im Rücken, wodurch ich das Bewußtsein verlor. Unsere Linie muß rechts eingedrückt worden sein, denn die haben ganze Schmiedewerkstätten voll Eisen auf uns heruntergeschmissen. Na, auf jeden Fall bin ich erst wieder zu mir gekommen, wie ich in den Händen der Feinde war.
Dann haben sie mich hierhergeschafft, und mir sieht das Ganze nach einem langen Krieg aus. Ich Gefangener der Japs, wo man mich mit Reis jagen kann!« schloß er trostlos.
Binney und ich teilten mit ihm, was wir an Geld bei uns hatten, und versprachen ihm, daß wir seine Frau verständigen würden, deren Adresse er mir gab.
Mit einem Händedruck nehmen wir Abschied voneinander.
Nach dem Lunch brachte Boyar Binney und mich mit unserem Gepäck in den Hafen, wo wir einen Aviso nahmen, der uns zu dem Flugzeugmutterschiff Akagi übersetzte.
Binney, Boyar und ich stiegen in einem großen Transportflugzeug vom Verdeck des Schiffes auf. Zehn Minuten lang kreisten wir über Salina Cruz, während eine Eskorte von fünfzig Kampfflugzeugen sich uns anschloß. Langsam höher steigend, flogen wir östlich von der Eisenbahnstrecke mit nördlichem Kurs über das grüne Dschungel unter uns.
Zweimal sichteten wir kleinere Gruppen von amerikanischen Flugzeugen, und einmal kam es zu einem Kampf, in dem zwei amerikanische und eine japanische Maschine abgeschossen wurden. Die Amerikaner, die verschont geblieben waren, hängten sich an unsere Staffel, die in nördlicher Richtung weiterflog.
Eine Stunde später flogen wir über den Golf von Campeche. Eine wahre Hölle von Abwehrfeuer begrüßte uns aus den Vorstädten und Hafenschutzanlagen Puerto Mexikos. Amerikanische Zerstörer und leichte Kreuzer führten rasche Bewegungen unter uns aus, während ihre vertikal gerichteten Geschütze Feuer zu uns hinaufspien und dicke schwarze Rauchsäulen aus ihren Schornsteinen quollen.
Die amerikanischen Flugzeuge griffen an, um die uns begleitenden roten Bombengeschwader nicht in Stellung über den Kriegsschiffen kommen zu lassen.
Ich untersuchte zum letztenmal meine Fallschirmausrüstung, band mir den Rettungsring um den Gürtel und stand sprungbereit da. Binney stand neben mir, bereit, mir zu folgen.
»Vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe«, hörte ich ihn Boyar ins Ohr schreien. »Bestellen Sie Margot, daß ich sie holen werde.«
Plötzlich spürte ich den Luftdruck an meinen Ohren, während unser Flugzeug sich rasch aus seiner Höhe von dreitausend Metern hinabsenkte. Als wir ungefähr fünfhundert Meter über dem Wasserspiegel des Hafens waren, fing der Pilot die Maschine auf und ließ sie horizontal weitergleiten.
Boyar schob die Seitentür auf, lächelte mir zu und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Leben Sie wohl, Gibbons, hier trennen wir uns.«
»Leben Sie wohl, Boyar, auf Wiedersehen«, antwortete ich.
Meine Finger packten den stählernen Zugring des Fallschirms, und ich trat ins Leere hinaus.