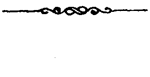|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
 Die Bevölkerung einer kleinern, aber durch den Wohlstand und die intelligente Thätigkeit ihrer Bürgerschaft weitbekannten Schweizerstadt war an einem Sommernachmittage des Jahres 1849 in ungewöhnlicher Aufregung. Die Arbeit feierte in den meisten Häusern und die Leute bewegten sich in zahlreichen Gruppen und unter lebhaften Gesprächen in den Straßen herum. Wer am fleißigsten zu seinem Geschäfte sehen mußte, das waren die Wirthe, welche heute, um in ihrer eigenen Sprache zu reden, einen »guten Tag« hatten.
Die Bevölkerung einer kleinern, aber durch den Wohlstand und die intelligente Thätigkeit ihrer Bürgerschaft weitbekannten Schweizerstadt war an einem Sommernachmittage des Jahres 1849 in ungewöhnlicher Aufregung. Die Arbeit feierte in den meisten Häusern und die Leute bewegten sich in zahlreichen Gruppen und unter lebhaften Gesprächen in den Straßen herum. Wer am fleißigsten zu seinem Geschäfte sehen mußte, das waren die Wirthe, welche heute, um in ihrer eigenen Sprache zu reden, einen »guten Tag« hatten.
Dieses in dem sonst so thätigen Städtchen ungewohnte Treiben war zunächst durch die unerwartete Heimkehr der städtischen Schützengesellschaft von dem eidgenössischen Freischießen, das in diesen Tagen in Aarau gefeiert wurde, veranlaßt worden. Das Fähnlein war erst in der gestrigen Morgenfrühe ausgezogen und diesen Mittag nun bereits wieder zurückgekehrt, während es eine Abwesenheit von wenigstens vier bis fünf Tagen vorausgesehen gehabt hatte. Auf dem Festplatze in Aarau waren nämlich schon im Laufe des gestrigen Nachmittags die ersten zersprengten Flüchtlinge des pfälzisch-badischen Aufstandes erschienen, hatten dem in Waffen festfeiernden Schweizervolke von der Rednertribüne herab ihre Noth geklagt, und zugleich die hohe Wahrscheinlichkeit dargethan, daß das Preußenheer, welches die Volkserhebung niedergeschlagen, die Schweizergrenze schwerlich respektiren werde. Diese Besorgniß war zwar nicht erst von heute aufgetaucht, und bereits waren einige Bataillone auf's Piket gestellt; denn man wußte wohl, daß Preußen die vor einem Jahre erfolgte gänzliche Einverleibung Neuenburgs in den neugefesteten Schweizerbund noch nicht verschmerzt hatte; aber bei der Voraussicht, daß die badische Hauptarmee ihren Verfolgern entwischen und mit Sack und Pack auf schweizerischen Boden übergehen werde, ohne daß man von dieser Seite dies hindern konnte noch wollte, hatte die Sache nun plötzlich eine schlimmere Wendung genommen. Das hatte auch der Bundesrath schnell genug eingesehen, und mitten in den Aarauer Festjubel hinein rauschte die Nachricht von einem augenblicklichen und massenhaften Truppenaufgebote. Die Schützen unserer kleinen Stadt, die wir aus naheliegenden Gründen nur Heimstädt nennen wollen, waren aber fast alle dienstpflichtig, warfen deshalb die Stutzer, welche schon zum friedlichen Wettkampfe aufgelegt waren, sofort wieder über die Schulter, um deren Trefffähigkeit vielleicht bald im ernsten Feldkampfe zu erproben. Trotz der Eilfertigkeit, mit welcher die Heimkehr geschah, langten die Aufgebote fast zugleich mit dem flatternden Schützenfähnchen in Heimstädt an, und nun ging's sofort an's Packen und Rüsten zum marschfertigen Auszuge. –
Das war es, was heute das Heimstädterleben aus seinem geregelten Geleise gebracht. Schon um die vierte Nachmittagsstunde zogen die Schützen wieder zum Thore hinaus dem Hauptsammelplatze zu, diesmal unter muthigem Trompetengeschmetter und dem glückwünschenden Abschiedrufen der Zurückbleibenden. Da und dort sah man wohl auch in schönen Augen eine Thräne blinken und hörte die bange Frage flüstern: Werden wir uns Wiedersehen? – Aber im Allgemeinen herrschte doch bei weitem eine patriotisch zuversichtliche Stimmung vor, und auch die Kontingente der übrigen Waffengattungen zogen alle noch vor dem einbrechenden Abend unter Trommelschlag und der Melodie des erhebenden Vaterlandsliedes zur Stadt hinaus.
Die Zurückbleibenden standen noch vor dem Thore, der letzten abmarschirenden Truppe nachschauend, als ein Bauernwägelein die Straße gefahren kam. Das Pferd wurde von einem jungen Burschen an der Halfter geführt, während auf dem Wägelein, das mit einigen Bündeln Stroh angefüllt war, zwei junge Männer im Soldatenkleide saßen, das indessen nicht das einheimische war. Die Uniform des Einen ließ auf den ersten Blick den Offizier erkennen; aber er selbst erkannte offenbar nicht mehr, was um ihn herum vorging; denn er lehnte sich in halb liegender, halb sitzender Stellung, mit geschlossenen Augen und todtbleichem Antlitze an seinen Begleiter, der bekümmert und schmerzlich bewegt aussah. Voll Neugier und Mitleiden drängte sich die Menge an das Fuhrwerk, und der noch aufrechtsitzende Soldat war sofort bereit, mit wenigen Worten die gewünschte Auskunft zu geben. Die Beiden waren badische Flüchtlinge; der Bewußtlose ein Hauptmann, den sein Begleiter nicht hatte verlassen wollen. Jener hatte, trotz ziemlich starker Verwundung seine Kompagnie bis an die Schaffhausische Grenze geführt und wollte dann, nachdem seine Leute auf sicherm Boden angelangt waren, sich nach Bern begeben, wo er bei einem ehemaligen Bekannten vorläufige Unterkunft und Pflege zu finden hoffte; aber die erschöpften Kräfte reichten nicht mehr hin zur Ausführung dieses Vorhabens und es war nur zu augenscheinlich, daß hier ungesäumte Hülfe von Nöthen war. »Wir wollten wenigstens noch hieher gelangen,« schloß der Soldat seine Erzählung, »weil hier besserer ärztlicher Beistand zu finden sein wird, als draußen auf dem Dorfe; aber unterwegs ist mein armer Hauptmann nun ohnmächtig geworden.«
Während einige der Umstehenden sich anerboten, einen Arzt herbeizurufen und das Wägelein zum nächsten Gasthofe zu geleiten, trat ein stattlich aussehender Mann herzu, dem mit großer Zuvorkommenheit Platz gemacht wurde. Es war der allgemein geachtete und reiche Kaufmann Theiler, der mit seiner Frau und drei Töchtern einem ebenfalls in's Feld ziehenden Sohne bis vor das Thor hinaus das Geleit gegeben hatte. Er lud den Soldaten freundlich ein, den Verwundeten in sein Haus führen zu lassen, wo für vorläufige Pflege wohl besser gesorgt werden könne, als dies in einem Gasthause möglich sei. Der Vorschlag wurde natürlich mit freudiger Bereitwilligkeit angenommen und das Fuhrwerk setzte sich in der angewiesenen Richtung wieder in Bewegung.
Als der Verwundete im Hause des Kaufmanns zu Bette gebracht und zwei Aerzte angelangt waren, sagte der Soldat gerührt zu dem menschenfreundlichen Hausherrn: »Ihr erwerbt Euch einen größern Gotteslohn an meinem Hauptmanne, als Ihr vielleicht im Augenblicke selbst noch denkt, Herr. Er ist zwar von gutem Hause; aber aus Unterstützung von seiner Familie könnte er schwerlich rechnen, auch abgesehen davon, daß er sich durch seine Betheiligung am Aufstande mit derselben für immer überworfen hat. Und das Letzte, was er in der Kasse besaß, hat er an der Grenze unter seine Soldaten vertheilt, das weiß ich.«
»Nun, das wäre, alles Andere abgesehen, allein schon hinlänglicher Grund für meine eigene Handlungsweise,« erwiderte Herr Theiler; »beruhigt Euch also, mein Braver.« –
Der Verwundete wußte nicht wie ihm geschah, als er nach zwei Tagen aus seinen Fieberträumen wieder zum Bewußtsein aufwachte. Anfänglich meinte er, nun erst in einem wirklichen Traume zu liegen; aber allmälig mußte er sich doch überzeugen, daß die weichen, schwellenden Kissen, auf denen er lag, und die grünseidenen Gardinen, die ihn mit einem angenehmen Zwielichte umgaben, greifbare Wirklichkeit und nicht bloße Gebilde der Einbildungskraft waren.
Bei der ersten Bewegung, die er versuchte, kam auch der Schmerz der Wunde dem aufdämmernden Bewußtsein zu Hülfe; aber wie war er hieher gekommen, und wo war eigentlich dieses hier? In dem Bauernhause, an welchem er mit seinem Begleiter ein Fuhrwerk hatte besteigen wollen, konnte es doch nicht sein; dagegen zeugten dieses Linnen, das im besten Herrenschlosse nicht feiner gefunden werden konnte, diese seidenen Decken und die zierlichen, handbreiten Spitzen, mit denen die Gardinen besetzt waren; weiter jedoch, als bis zu jenem Bauernhause vermochte das Erinnerungsvermögen keine Auskunft zu geben. Nun, nun, dachte der Verwundete, indem er nochmals mit der Hand die Fülle und Weichheit der Pfühle prüfte, an den schlechtesten Ort schein' ich schon nicht hingerathen zu sein; doch man kann ja eine kleine Recognoscirung anstellen. Damit hob er den Kopf langsam und nicht ohne Mühe in die Höhe und versuchte die Gardine zurückzustreifen; im nämlichen Augenblicke wurde diese indessen von außen auseinandergeschoben, doch nur, um plötzlich mit einem leisen Aufschrei, der halb Freude, halb Schreck auszudrücken schien, wieder fallen gelassen zu werden. Bei der Schnelligkeit dieser Bewegung konnte der Verwundete, zumal auch das Licht im ganzen Gemache durch geschlossene Jalousien zur milden Dämmerung gedämpft war, nur bemerken, daß eine weibliche Gestalt vor dem Bette gestanden, die aber nun schon durch die Thüre verschwunden sein mußte; denn diese wurde im Augenblicke, wenn auch mit kaum hörbarem Geräusche zugemacht. »Wahrhaftig, ganz wie im Feenmärchen,« sagte der Verwundete, indem er den Kopf etwas weiter vorbog und nicht ohne Verwunderung die Eleganz und reiche Ausstattung des Gemaches betrachtete; »und noch die Hauptsache – ich wollte drauf schwören, daß meine Fee nicht in der Gestalt einer alten, zahnlosen Hexe erscheint. Doch, da ist ja gleich eine Klingelschnur zur Hand und auf Ehre – die Quaste aus ächtem Golddraht geflochten. Laßt sehen, ob ein dienstbarer Geist oder die Beherrscherin dieses Feenpalastes selbst erscheinen wird.« – Er erhob die Hand, um zu klingeln; aber noch bevor die Schnur angezogen war, erschien der dienstbare Geist in der Gestalt eines großgewachsenen, jungen Mannes, der unter einem Ausrufe der Freude auf das Bett zueilte. »Endlich, Herr Hauptmann, wird wieder Ordre parirt – dem Himmel sei Dank,« rief er, beeilte sich aber zugleich, den Kranken in's Bett zurückzuschieben. »Halt,« rief dieser abwehrend und sein Gegenüber mit großen Augen betrachtend, »soweit kann ich schon selbst kriechen; aber zum Teufel, Heinzelmann, du siehst ja aus, wie ein Hahn nach der Mauserung; wo hast du denn deine Uniform?«
»Oh, die liegt mir gut im Kasten und vermuthlich für lange Zeit, denk' ich; in diesem Rocke da sollt's mir auch wohl genug sein, wenn nur Sie erst wieder gesund wären.«
»Bah, das wird auch kommen,« sagte der Hauptmann, während er doch zugleich spürte, wie die kleine Anstrengung ihn angriff und um den Kopf wieder ein leises Summen zu schwirren anfing; »aber jetzt will ich nur erst wissen, wo ich eigentlich bin, Heinzelmann.«
»Bei Menschen, wie sie von dieser Qualität, glaub' ich, nur im gottgesegneten Schweizerland wachsen,« antwortete der ehemalige Soldat mit warmer, gerührter Stimme; »ja, Herr Hauptmann, das sind Menschen, daß ich mir selbst neben ihnen wie ein wahrer Hundsfötter vorkomme; Theiler heißt der wackere Hausherr, der Sie so bereitwillig aufgenommen hat. Aber jetzt, noch diese Tropfen genommen, und dann kein Wort mehr für diesmal; die Aerzte haben's aufs Strengste anbefohlen.«
»So, so, die Aerzte,« machte der Hauptmann, der mit einem halbspöttischen Verziehen des Gesichtes die dargereichten Tropfen hinunterschluckte; »vorerst will ich aber doch noch wissen, wer vorhin in diesem Zimmer war. Ist's eine Tochter des Hauses, oder so was?«
»Nichts da,« erwiderte Heinzelmann sich mit pfiffigem Gesichte abwendend; »es war eine alte Frau, die sich mit mir in Ihre Abwartung theilt.«
»Das lügst du, Schelm,« rief der Hauptmann; »ein altes Wartweib schwebt nicht davon wie ein Lufthauch. Ich will andern Bescheid!«
Dem Himmel sei Dank, daß er sie nicht gesehen, das Fräulein Sophie, sonst würde des Fragens und Plauderns erst kein Ende werden, dachte Heinzelmann; laut aber sagte er: »Nun, Sie werden mich doch nicht belehren wollen, wer mich mit der freudigen Nachricht hergerufen, daß Sie endlich wieder aufgewacht seien; Töchter, oder überhaupt junge Frauensleute gibt es keine hier im Hause. Aber jetzt ist's übergenug; darum weiter kein Wort mehr.«
Mit dieser Erklärung setzte sich der Soldat an's Fenster und that, als ob er sich eifrig in den Inhalt eines Buches versenken wolle; aber statt zu lesen, ging er seinen eigenen Gedanken nach, denen er nicht zu wehren vermochte. Er bedachte, welch ein leichtes und glückliches Temperament doch der Kranke habe, der nicht einmal gefragt, wie lange er schon bewußtlos gelegen, noch sich die geringste Sorge um die Zukunft zu machen schien, trotz seiner hülflosen Lage. »Ja, ja,« sagte er leise vor sich hin, »so können doch nur die vornehmen Leute sein, welche von Jugend auf gewöhnt sind, daß ihnen die Welt dienstbar sei.«
Mit diesem Gedanken war der Soldat jedoch nicht ganz auf der richtigen Spur; denn dem Hauptmann kamen, als ihm Heinzelmann hartnäckig jedes Gehör verweigerte und er sich wieder auf die Kissen zurückgelegt hatte, fast wider Willen ebenfalls Zukunftsgedanken; damit verbanden sich sofort die Erinnerungen an die Vergangenheit und bald zog in diesem stillen Nachdenken sein ganzes Leben an ihm vorüber. Es gab neben dem Lichte, das über diesem Lebenslaufe lag, auch manche dunkle Stelle in demselben, oder vielmehr dem still Sinnenden erschien nun Manches dunkel, was er sonst in anderm Lichte betrachtet, oder vor dem er lieber die Augen geschlossen hatte.
Der Hauptmann stammte aus einer jener Familien, deren einziger Reichthum in dem altadeligen Namen besteht, der zu den mannigfaltigsten Ansprüchen im Staatsdienste, besonders im Militär berechtigt. So hatte auch sein Vater eine hohe Militärstellung bekleidet und war mit dem Großherzoge vor der Volkserhebung aus dem Lande geflohen. Warum der Sohn der altaristokratischen Familie sich dieser Erhebung angeschlossen – darüber hatte er sich, wie noch gar viele seiner Kameraden, nie ganz genaue Rechenschaft gegeben. Einmal übergroße Vorliebe für die demokratischen Forderungen des Volkes hatte ihn gewiß nicht dazu bewogen, obwohl er unbefangen und billig genug dachte, um den Klagen über mancherlei Uebelstände Recht zu geben; aber im Ganzen war's doch mehr der Ueberdruß an dem ewigen Einerlei des Kasernenlebens, verbunden mit der Erinnerung an wirkliche oder vermeintliche Zurücksetzungen und Demüthigungen gewesen, was ihn zu dem Schritte verleitet hatte. Im Uebrigen – was war denn so viel zu verlieren dabei; ohne das zu Hülfe kommen eines Feldzuges schlich das Avancement seinen unerträglich langsamen Schneckenschritt, da der ebenfalls Bevorrechteten noch die Menge auf und neben dem Wege standen. Dabei bedachte der junge Mann freilich nicht genugsam, daß er im Grunde genommen blutwenig gelernt hatte, worauf er sich eine neue Existenz für den Fall gründen könnte, daß er aus seiner bisherigen Carriere weggedrängt würde; denn sein ganzer Bildungsweg war eben nur auf diese Carriere abgesehen und er selbst von jeher viel zu leichten Sinnes gewesen, um daneben von sich aus noch ein Uebriges zu thun. Doch ein Grund, der zu dem Schritte bewog, darf nicht unerwähnt bleiben, weil er im entscheidenden Augenblicke den Ausschlag gab. Der gemeine Soldat war durchweg für die Volksbewegung gewonnen und der Hauptmann wollte sich in einer so kritischen Lage nicht von seiner Kompagnie trennen, weil er wußte, daß die Leute, vom ersten bis zum letzten, ihm mit Leib und Seele ergeben waren. Das indessen hatte wiederum seine richtigen Gründe; denn dem Hauptmanne von Beuren, so war sein Name, konnten die Männerherzen unter dem groben Kommisrocke ebenso wenig widerstehen, als die Frauenherzen unter dem Mieder oder der seiderauschenden Mantille. Abgesehen davon, daß sich in der ganzen Armee wohl wenige Offiziere fanden, die ihm in Beziehung auf männliche Schönheit zur Seite stehen durften, verstand er es im Umgänge mit Hoch oder Nieder eine bezwingende Liebenswürdigkeit zu entfalten. Er war muthig bis zur Tollkühnheit, freigebig bis zur Verschwendung und selbst mit der Aussicht, sich dadurch eine fortlaufende Kette von Verlegenheiten zu bereiten. Neben einem angeborenen Stolze brach oft genug die naivste Gutmüthigkeit hervor, und behandelte er einmal seine Untergebenen rauh, so wußte er's auf die ungesuchteste Weise wieder gut zu machen. Freilich redeten ihm seine Neider und Feinde nach, daß er auch launisch, wankelmüthig, wo nicht gar leichtsinnig bis zur Mißachtung der gewöhnlichsten, sittlichen Forderungen sei. Und leider fehlte es nicht an Beispielen, die diesen Anklagen einen Rückhalt gaben.
Eines dieser Beispiele fiel nun dem Kranken selbst schwer auf das Herz. Es war ein rührend schönes Frauenbild, das vor seinem innern Gesichte emporstieg und ihn mit thränengefüllten Augen anblickte. Keine Klage, kein Vorwurf kam über ihre Lippen; aber sie preßte die beiden Hände gegen das Herz, als ob sie durch diesen Druck ein tödtliches Weh ersticken könnte. Dann begannen sich auch ihre Lippen zum Sprechen zu bewegen, doch der Hauptmann vernahm nichts als den Klang seines Namens, der aus weiter Ferne zu ihm herüberzutönen schien. Seine Sinne verschwammen in ein fieberhaftes, dämmerndes Weben, bis er mit dem leisen Ausrufe »Leonie!« wieder in völlige Bewußtlosigkeit versank.
Unter der geschickten, ärztlichen Behandlung und der trefflichen Pflege im Theiler'schen Hause machte die Genesung des Verwundeten rasche Fortschritte. Nach kaum vierzehn Tagen war er schon im Stande, sich in dem schönangelegten Garten seiner Gastfreunde zu ergehen, wenn auch erst noch mit Hülfe des treuen Heinzelmann, der bisher Tag und Nacht kaum von der Seite seines Hauptmannes gewichen war; aber an dem Tage, da dieser fernen Gartenspaziergang ohne andere Beihülfe, als diejenige eines Stockes, beendigen konnte, trat Heinzelmann in die Dienste des Herrn Theiler. Fortan führte er, statt militärischer Rotten, die Rotten der Packer und Lader in den weiten, waarengefüllten Magazinen, und es war eine wahre Freude zu sehen, mit welcher Handlichkeit er die neuen Geschäfte anfaßte. Er war noch keine zwei Wochen bei denselben, als er zu dem Hauptmanne sagte: »Verzeih' mir's Gott – aber wenn ich nur an mich denken wollte, so müßte ich die Revolution als das glücklichste Begegniß meines Lebens segnen. Es wird mir nun erst recht deutlich, wie mir die Kaserne eine Reihe der besten Jahre weggestohlen hat. Das ist doch ein ganz anderes Leben hier, und am Abend weiß man auch wofür und wozu man den Tag verbraucht hat.« – »Ja, ja,« erwiderte der Hauptmann gutmüthig, »ich sehe dich auf dem besten Wege ein ausgemachter Schacherer zu werden. Nach Jahr und Tag mußt du auf diese Weise ein hübsches Kapitälchen zusammengerackert haben, bei dem du dann, der ganzen Welt Trotz bietend, auf den Sack schlagen kannst.«
»Oh,« lachte Heinzelmann, »zum Zusammenrackern wird es wohl nie kommen bei mir; aber ich freue mich doch, sobald einen Weg gefunden zu haben, auf dem ich mein ehrliches Brod erwerben kann, und zwar erst noch bei einem solchen Dienstherrn!«
»Du hast recht,« erwiderte der Hauptmann, einen leisen Seufzer unterdrückend; »ich wollt«, ich wär' an deiner Stelle.« –
Mit diesem Worte war ein Gedanke ausgesprochen, der den nun bereits Wiedergenesenen von Tag zu Tag mehr beschäftigte, mehr und ernstlicher, als er's je gedacht hätte. Von der ganzen Theiler'schen Familie wurde er mit einer so zarten Aufmerksamkeit und Herzlichkeit behandelt, als ob er ein naher und lieber Anverwandter derselben sei; auch wußte er wohl, daß ihm im ganzen Hause eine verlängerte Annahme der einmal angebotenen Gastfreundschaft kein Mensch nachrechnete; aber doch wär' es ihm unmöglich gewesen, hier länger als es unumgänglich nöthig war unthätig zu verbleiben. Im Grunde genommen erging es ihm gerade, wie dem braven Heinzelmann. Zuerst fühlte er sich unbehaglich gegenüber der rastlosen und geordneten Thätigkeit, die in dem Hause herrschte; dann aber begann er unwillkürlich die Resultate dieser Thätigkeit mit Demjenigen zu vergleichen, was ihm nun selbst als Ergebniß seines bisherigen Lebens geblieben war. Der Sohn Theiler, der bereits wieder aus dem unblutig abgelaufenen Feldzuge zurückgekehrt war, zählte etliche Jahre weniger als der Hauptmann, war überhaupt kaum aus dem Jünglingsalter herausgetreten; aber wie tief in das Leben eingreifend stand er jetzt schon da, und über welch reichen materiellen und geistigen Besitz konnte er jetzt schon gebieten! –
Der Herr von Beuren hatte sich bisher eingebildet, er sei im Besitze einer Welt- und Menschenkenntniß, wie sich deren nicht leicht ein junger Mann seines Alters rühmen könne, am wenigsten ein bloßer Kaufmann; jetzt jedoch mußte er einsehen, daß er von der »Welt« nur jenen Theil kennen gelernt, der sich ohne die geringste Berechtigung diesen Namen selbst beigelegt, und von Menschen durchschnittlich nur solche, die eines ernstlichern Studiums gar nicht werth gewesen. Wie ganz anders der junge Theiler, der fast alle größern Städte Europas aus eigener Anschauung kannte, und von dem mächtigen Wettkampfe großer Völkerinteressen mit einer Sachkenntniß und Sicherheit sprach, wie der Hauptmann etwa von den Chancen einer Whistparthie. Kein Wunder, daß diesen, so ganz im Widerspiele mit seiner ganzen bisherigen Anschauungs- und Empfindungsweise, oft ein erdrückendes Gefühl der Unbedeutendheit beschleichen wollte, und er aller Anstrengung bedurfte, um sich das hergebrachte Selbstgefühl, wenigstens äußerlich, nicht verloren gehen zu lassen; denn er empfand wohl, wie nöthig ihm gerade jetzt eine gehörige Sicherheit seines Auftretens und Benehmens sein müsse. Er glaubte sogar, diese Sicherheit in seinem ganzen Leben nie nöthiger gehabt zu haben; denn – wie wollte er ohne dieselbe vor den Blicken eines Augenpaares bestehen, die oft wie mit einer wehmüthigen, inhaltschweren Frage an ihm zu hängen schienen. Warum, so grübelte und sann er Tag um Tag, warum mußte ich diesem Mädchen erst jetzt begegnen, wo ich ohne Heimath, ohne Lebensstellung bin, wo ich in ihrem Hause das Gnadenbrod esse, und wo – er schlug sich mit der Hand an die Stirne, um den weitern Gedankenlauf abzuschneiden; fügte aber bitter hinzu: »Sie kann mich höchstens bemitleiden und würde mich wohl bald verachten. Morgen reise ich, und wenn ich meinen Degen dem schmutzigsten Juden anbieten müßte.«
Aber trotz dieses fast täglich wiederholten Entschlusses, kam derselbe doch nie zur Ausführung, obgleich es damals einem muthigen Offiziere, der es mit politischen Meinungen nie zu genau genommen hatte, gerade nicht an Gelegenheit, wieder in Dienst zu treten, gefehlt haben würde. An eine Rückkehr in die Heimath war freilich nicht zu denken; der Name des Hauptmannes von Beuren stand in der ersten Reihe der Proscribirten und daheim würde wahrscheinlich eine preußische Standrechtskugel auf ihn gewartet haben.
Unter solchen Grübeleien und Erwägungen saß er eines Abends in einer Gartenlaube, als die älteste Tochter des Hauses daher kam. Unter freundlichem Geplauder nahm sie ebenfalls Platz in der Laube, bis der Hauptmann plötzlich sagte: »Diesen Abend ist mir zum letzten Mal das Glück vergönnt, hier Ihnen gegenüber zu sitzen, Fräulein Sophie; morgen werde ich unwiderruflich reisen – es kann nicht länger so bleiben, wie unvergeßlich mir der Aufenthalt in Ihrem Hause auch Zeitlebens bleiben wird.« Er sprach diese Worte sichtlich bewegt und sie schaute ihn wieder mit einem jener Blicke an, die ihm so wundersam die Seele berührten.
»Sie scherzen, Herr Hauptmann,« sagte sie endlich, jedoch nicht ohne einen Ton der Besorgniß, da sie ihn so ernst dasitzen sah; »oder vielmehr, Sie wollen mich erschrecken; was sollte denn vorgefallen sein, daß Sie uns so plötzlich verlassen wollten!«
»Sie mit einer solchen Ankündigung erschrecken?« rief er; »spotten Sie meiner nicht, Fräulein, ich bitte Sie, nur jetzt nicht.« Es lag etwas schmerzlich Bitteres in diesem Ausrufe und sie ließ ihren Blick wiederum auf seinem Gesichte ruhen.
»An Spott denke ich wahrlich nicht, das werden Sie mir glauben,« sagte sie dann; »aber ich sehe ebenso wenig ein, warum Sie uns verlassen sollten.«
»Warum?« erwiderte der junge Mann rasch, indem er auf die feine Stickarbeit deutete, welche das Fräulein in Händen hielt: »Sie fragen warum? Sehen Sie, Sie sind unablässig thätig, vom Morgen bis in den Abend hinein; ich bin überhaupt der einzige Müßiggänger in diesem Hause und hätte es doch gewiß am wenigsten nöthig. Das darf nicht länger so bleiben – ich werde wieder in Militärdienst treten.«
»Und wo denn?« fragte sie leise; »nach Hause können Sie ja nicht zurück.«
»In Oesterreich, Italien, Frankreich,« sagte er; »mir ist's gleichgültig.«
Fräulein Sophie schwieg eine geraume Weile, während sie einige falsche Maschen an ihrer Stickerei loslöste; dann sagte sie ernst: »Hören Sie, Herr Hauptmann, ich bin freilich nur ein unerfahrenes Mädchen; aber das werden Sie doch nicht thun. Könnten Sie wieder in ihre Heimath zurückkehren, oder hätten Sie sich eine neue Heimath erworben, zu deren Schutz Sie die Waffen wieder ergreifen könnten, dann würd' ich Sie mit Freuden ziehen sehen; aber das Leben an eine Sache wagen, für die man kein Herz hat, das ist – zürnen Sie mir nicht – das ist keine würdige Mannesarbeit.«
Sie hatte diese Worte mit so hohem Ernste und zugleich in einem so reizenden Strafpredigertone gesprochen, daß der Hauptmann unwillkürlich lächeln mußte.
»Nun, nun, meine liebenswürdige Patriotin,« sagte er, »unser Eins kämpft eben auch für die Fahnenehre, für Ehre überhaupt.«
»Die Fahne kann ihre Ehre zunächst nur von der guten Sache entlehnen, welche sie deckt,« entgegnete sie rasch, »und die Mannesehre ruht auf dem nämlichen Grunde; oder ist's nicht so?«
»Ich werde mich wohl hüten, Ihnen unbedingt Recht zu geben,« erwiderte er, noch immer auf das Anmuthigste berührt von dem Ernste seiner liebenswürdigen Gegnerin; »denn sobald ich's thäte, würde ich ja den einzigen Schlüssel für meine ganze Zukunft wegwerfen.«
Es verging wiederum eine kleine Weile bevor sie sagte: »Ich vermag nicht einzusehen, warum Sie von einem einzigen Schlüssel sprechen; daß Sie sich langweilen müssen bei unserer einförmigen Bürgerlichkeit, ist ganz natürlich; gleichwohl mein' ich, müßte sich immer noch eine Bethätigung finden lassen, die mit der Zeit den Reiz des Soldatenlebens aufwiegen würde.«
»Den Reiz des Soldatenlebens!« rief er; »der Himmel weiß, wie gerne ich dasselbe an jede andere Beschäftigung vertauschen würde, die mir hinlänglichen Raum in der Welt verschaffen könnte; aber wenn ich Ihren Vater, Ihren Bruder sehe, die durch ihre geräuschlose Thätigkeit Tausende von Händen in zweien Welttheilen in dienstbare Bewegung setzen, da –«. Er sprach nicht zu Ende, sondern legte die Hand über das erröthende Gesicht; er fühlte, daß er sich für sein Selbstgefühl zu weit hatte hinreißen lassen, was er sonst gerade vor diesen Augen möglichst zu vermeiden gesucht. Aber das Fräulein hatte sich schon erhoben und sagte näher tretend: »Wenn Ihnen das Ernst wäre – Sie kennen ja mehrere neue Sprachen – oh, wenn Sie das doch meinem Vater sagen möchten!«
Man brauchte in Herzensangelegenheiten nicht die Erfahrung des Hauptmannes zu besitzen, um aus diesen Worten das freudig Bewegte, Hoffnungsfrohe herauszufühlen, das durch des Mädchens Stimme zitterte. Er schaute auf und ihr gegen ihn vorgeneigtes Gesicht war wie eine frisch aufbrechende Rose erblüht. »Sie glauben?« sagte er, seine Hand leise auf die ihrige legend; – »und Sie würden mich gerne an das Haus Ihres Vaters gebunden sehen, Fräulein Sophie?«
Die Rosengluth hatte sich auch über ihren Nacken ergossen und er fühlte das Zittern ihrer Hand, als sie mit einem leisen Nicken des lieblichen Kopfes Antwort auf seine Frage gab. Er sprang empor und seine Lippen ruhten auf einem jungfräulichern Munde, als sie noch je einen berührt hatten. –
Schon am folgenden Vormittage saß der Hauptmann von Beuren an einem zierlich und bequem hergerichteten Pulte im Comptoir des Herrn Theiler, emsig bemüht, durch Copierung einiger Briefe den Geheimnissen des kaufmännischen Styles auf die Spur zu kommen. –
Solche Umwandlungen in der Lebensstellung, wie die des Hauptmanns von Beuren, gehörten damals durchaus nicht zu den Seltenheiten in der zahlreichen Flüchtlingswelt, die sich von allen Seiten her in der Schweiz zusammengefunden. Ehemalige hochgestellte Beamte hielten in einem abgelegenen Bergdörfchen Schule, flüchtige Pfarrherren copierten auf einem Advocatenbureau, und eine große Zahl von Offizieren griff ebenfalls zur nächsten besten Hantierung, wie sie sich gerade darbieten wollte. Es galt eben, sich zunächst für das liebe Leben zu wehren. Bei der einheimischen Bevölkerung wurden auch diejenigen, die sofort frisch zugriffen, mit weit günstigern Augen angesehen als andere, welche sich mit der Verkündung nahen Ausbruches einer europäischen Revolution begnügten, und unterdessen nicht selten die Leichtgläubigkeit oder Gutmüthigkeit auf wenig ehrenhafte Weise ausbeuteten. So sah denn auch in dem Schritte des Herrn von Beuren Niemand etwas Auffallendes, im Gegentheil wurde ihm derselbe sehr zu seinen Gunsten angerechnet. Er hatte dadurch namentlich in Heimstädt mit einem Schlage festen Boden gefaßt; er gehörte jetzt zum Hause Theiler, und zwar nicht mehr blos als ein aus Mitleiden aufgenommener Gast, sondern als thätiges Mitglied, und das war genug um ihm den Weg durch jede Thüre zu öffnen.
Einen jedoch gab es im Städtchen, der sich mit diesem Schritte nicht befreunden konnte, und es war noch gerade derjenige, auf dessen freudigste Zustimmung der Hauptmann am allermeisten gerechnet hatte. »Nun, Heinzelmann,« rief er, als er dem treuen Burschen nach bereits geschehener Bereinigung mit Herrn Theiler begegnete, »jetzt mag auch meine Uniform neben der deinigen im Kasten liegen und wir bleiben ebenfalls zusammen. Das wird dir recht sein, hoff' ich.«
»Was meinen Sie?« fragte Heinzelmann hochaufschauend; »ich hoffe schon, daß es Ihnen in diesem prächtigen Hause noch nicht sobald verleidet sein wird.«
»Im Gegentheil, von Morgen an werde ich auf dem Comptoir des Herrn Theiler pünktlichst genau zusammenrechnen, wie viel Waarenballen du den Tag hindurch in den Magazinen aufstapelst oder weiterspedirst.«
»Was ist – was gibt's,« erwiderte Heinzelmann zögernd, »ich kann Sie immer noch nicht verstehen, Herr Hauptmann.«
»Ei, du zählst doch sonst nicht zu den Harthörigen,« lautete die Antwort; »ich trete Morgen um acht Uhr, vorerst als Volontair, in das Comptoir deines eigenen, vortrefflichen Brodherrn und werde mich fortan mit Eifer dem edeln Handelsstande widmen.«
»Wird nicht sein – kann nicht sein, Sie belieben zu scherzen,« stotterte Heinzelmann.
»Und warum sollte denn das nicht sein können?« rief der Hauptmann halb verwundert, halb belustigt; ich sage dir aber, es ist, und morgen werde ich den Fahnenschwur zu leisten haben.«
Heinzelmann stand lange ohne ein Wort hervorzubringen vor sich hinschauend; dann sagte er leise: »Nun, wenn es schon so weit ist, so möge der Himmel Ihrem neuen Beginnen seinen Segen verleihen.« –
Wenn auch nicht in dem nämlichen Grade, wie der alte Soldat, so hatte doch auch Herr Theiler seine Bedenken, die er indessen für einmal gegen Niemanden aussprechen mochte. Er war ein Mann, der das Geschäft mit geringen Mitteln gegründet und es durch Einsicht und energische Thätigkeit zu seiner jetzigen Blüthe emporgebracht hatte. Natürlich war ihm bei einem solchen Lebensgange keine Zeit geblieben, sich, was man so nennt, eine umfassende Bildung oder auch nur eine vollendete Menschenkenntniß anzueignen; aber was seinen Geschäftskreis berührte und in denselben hintrat, das hatte er bald mit scharfem Auge gewürdigt. Wenn er nun auch den unerwarteten Entschluß des Hauptmannes nicht mißbilligen konnte, so würde er doch nie daran gedacht haben, denselben aus freien Stücken dazu aufzumuntern. Er befürchtete, daß es ihm an der nöthigen Ausdauer, wie an der unerläßlichen Pünktlichkeit in scheinbaren Geringfügigkeiten fehlen möchte. Indessen, es kam ja auf einen Versuch an. »Nur Eines noch,« sagte Herr Theiler, nachdem die Sache in Ordnung gebracht war; »ich leide an einem Fehler, den ich mir nie abzugewöhnen vermochte, der auch denjenigen, die stets um mich sein müssen, oft sehr beschwerlich sein kann, der aber in einem Geschäfte, wie das meinige, doch nicht so ganz vom Uebel ist. Ich kann nämlich, wo etwas Schiefes zum Vorschein kommt, eine augenblickliche Hitze nicht bemeistern, und da gilt es denn, nicht allzuempfindlich oder gar nachträgerisch zu sein.«
»Das kann ich auf das Beste bestätigen,« sagte Madame Theiler, die bei diesem Gespräche zugegen war; »da gilt es, das eigene kalte Blut nicht zu verlieren.«
»Nun, nun Mama,« rief Herr Theiler, »mach mich nicht schlimmer, als ich wirklich schon bin; du wenigstens hast die Furcht längst verloren vor meinem Zorne, und dann weißt du auch – wenn nur nichts Ungerades, Unlauteres mitunterläuft, so schäme ich mich auch nicht, ein allfällig begangenes Unrecht nach Kräften wieder gut zu machen.«
»Das ist wahr, Papa, der Schlimmste bist du gleichwohl nicht,« lächelte die Frau. –
Eine große Freude über das Vorhaben des Hauptmannes empfand der junge Theiler, der den neuen Hausgenossen aufrichtig lieb gewonnen hatte. Er nahm sich auch vor, ihm in jeder Weise behülflich zu sein, damit die trockenen Anfangsgründe der neuen Geschäftsschule, wie die schwierigern Subtilitäten, möglichst rasch und leicht überwunden würden. In seiner frohen Laune konnte er es nicht unterlassen, die Schwester zu necken – oder war im Herzen des Jünglings vielleicht eine Ahnung über die wirklichen Bewegungsgründe aufgegangen, die hier im Spiele waren? – »Was meinst du, kluges Fräulein Sophie,« rief er, »wie würde es sich ausnehmen, wenn es dereinst hieße, die Firma Theiler, von Beuren und Compagnie – na, das klingt gleich anders! Oder?« – Es war gut, daß Fräulein Sophie im Schatten des Lichtschirmes verborgen saß, sonst würde ihr dunkles Erröthen eine ganz andere Antwort gegeben haben als es der Mund mit den gleichgültigen Worten that: »Mir wird jede Firma recht sein, die der Herr Bruder einst anzunehmen beliebt.« – Eine Nacht voll freudigbanger Unruhe aber wartete auf das Mädchen; von Schlaf konnte keine Rede sein, und doch kamen die Träume heran, mit allerlei lieblichen Bildern, die das Herz bewegten. »Er liebt mich,« flüsterte sie von Zeit zu Zeit vor sich hin, während sie in einem süßen Schauer zusammenbebte; »er liebt mich; und wie muß er mich lieben, daß er auf die leiseste Andeutung meiner stillen Wünsche so schnell zu dem schweren Entschlusse bereit war; er, der stolze, ritterliche, und ach, so liebe Mann!« – Am Morgen, als Herr von Beuren sein Zimmer verlassen wollte, um sich zur festgesetzten Stunde in's Comptoir zu begeben, glitt ihm in dem dunkeln Corridor fast unhörbar eine Gestalt entgegen. »Sie haben Ihren Entschluß nicht bereut über Nacht – Sie bleiben dabei?« flüsterte sie schüchtern. »Und warum sollte ich nicht dabei bleiben?« antwortete er, die leis erzitternde Jungfrau umfassend; »warum sollte ich einen Entschluß bereuen, durch dessen Ausführung ich in deiner Nähe bleiben darf, mein süßes Kind?« – »Dann begleite der Himmel Ihren ersten Schritt auf dem neuen Lebenswege,« sagte sie, seine Küsse erwidernd, und schlüpfte dann wieder rasch und lautlos in einen Seitengang. –
Der jungfräuliche Segenswunsch schien sich an dem neuen Handelsbeflissenen bewähren zu sollen, die Sache ließ sich über alle Erwartung gut an. Der alte Herr Theiler war selbst höchlich erstaunt angesichts der Fortschritte, welche der Zögling machte. Ueber sein leichtes Erfassen und rasches Hineinarbeiten in jede Branche des Geschäftes wunderte er sich weniger, da konnte mit einem gereiften Verstande viel ausgerichtet werden; aber daß der Hauptmann sich auch der trockensten Arbeit mit solch ruhiger Ausdauer, und sicherer Genauigkeit unterziehen würde, das hatte der alte Herr nicht zu hoffen gewagt. Er war deshalb auch nicht zurückhaltend mit lobender Anerkennung und rief oft aus: »Das muß man sagen, eine tüchtige Soldatenschule hat denn doch auch ihr Gutes; mein jüngster Commis und mein Magazinier sind die striktesten Arbeiter in meinem ganzen Geschäfte, und das Holz zu diesen Pfeifen ist im Soldatenrocke geschnitten worden!« – Wie horchte Sophie mit freudigem Herzklopfen auf, wenn Vater und Bruder dem heimlich Geliebten übereinstimmendes Lob spendeten, und dieser dann mit ruhiger Bescheidenheit erwiderte: »Wenn nur der Fortgang nicht Schwereres bringt, die Anfänge sind freilich wohl zu überwinden, besonders unter solchen Lehrmeistern.« – Er hätte noch hinzusetzen können, neben einer solchen Lehrmeisterin; denn er war sich's gar wohl bewußt, daß eine Umwandlung in seinem ganzen Wesen vorgegangen und diese durch die Liebe bewirkt worden war. »Durch die Liebe – aber ist es auch Liebe, was du für dieses Mädchen empfindest,« mußte er sich oft fragen; ist es nicht eher nur Freundschaft, aus Dankbarkeit und freilich auch aus Achtung hervorgegangen? Wäre das Alles nicht mit dem Reize des Geheimnisses umgeben, wahrhaftig, ich wüßte nicht, wie ich mein Gefühl dann benennen sollte.« – Und Herr von Beuren war gewissermaßen ganz in seinem Rechte mit diesem Zweifel. Er hatte, wie das die äußern Verhältnisse mit sich gebracht, viel geliebt in seinem Leben; aber diese besänftigende, still stärkende Kraft der Liebe, die er jetzt empfand, hatte er noch nie kennen gelernt. Schon allzufrüh in den Strudel eines leichtsinnigen Militärtreibens geworfen, war die heilige Jungfräulichkeit erster Liebesregungen unerkannt an ihm vorübergegangen. Rascher Genuß und rascher Wechsel – das war es gewesen, was er Liebe nannte und als solche kannte. Jetzt freilich war es anders geworden. Statt begehrlicher Aufregung war eine mild erwärmende Ruhe über ihn gekommen und in Sophiens Nähe schien jede Begierde verstummen zu müssen. –
So ging Alles in ruhigen, erfreulichen Geleisen fort bis zur Neujahrszeit. Herr Theiler huldigte der Regel, daß nach sauren Arbeitswochen auch die frohen Feste ihr Recht haben sollten. Dem zu Folge wurden nun nicht nur in dem eigenen, sonst so stillen Hause rauschende Festlichkeiten veranstaltet, sondern es folgte auch Einladung auf Einladung von Befreundeten, die ebenfalls ihr Möglichstes thaten. Herr von Beuren war überall dabei, als wäre er längst ein Mitglied der Familie Theiler, und überall war er ein höchst willkommener Gast, namentlich bei der schönern Hälfte der städtischen Bevölkerung. Ihm selbst gewährte es Vergnügen, seine geselligen Vorzüge wieder einmal in's Licht zu setzen, und zugleich mußte er sich gestehen, daß ihm ein leichtes, genießendes Leben doch eigentlich besser zusage, als die trockene, angestrengte Arbeit.
So lebte der Hauptmann zum Theil schon wieder in seinem alten Elemente, als er zu einem kleinen Concerte eingeladen wurde. Unter anderm sollte dabei auch eine Sängerin sich hören lassen, von der viel Wesens gemacht wurde und die, wie man sagte, beabsichtigte, sich als Musiklehrerin in der Stadt niederzulassen. Sie erschien, von lautem Beifall einiger bereits gewonnener Verehrer begrüßt, und Herr von Beuren klatschte lebhaft mit, obwohl er seinen Augen kaum traute, als er das hübsche, kokette Gesicht erblickte. Es war eine Sängerin zweiten Ranges, die er am Theater in Mannheim kennen gelernt – der Gegenstand seiner letzten Liebesintrigue vor dem Ausbruche des Aufstandes. Ihr Auge mußte ihn ebenfalls sofort entdeckt haben; denn sie schickte ihm unter einer leichten Verbeugung ein freudiges Erkennungslächeln zu. Natürlich suchte er sich ihr, sobald der Gesang beendigt war, zu nähern, wie noch viele andere jüngere und ältere Männer, und sie selbst wußte so geschickt zu manövriren, daß sie ihm sogleich mitten in dem Schwarme ein Papier in die Hand drücken konnte; dann aber sich unbefangen Andern zuwendete. »Ich werde,« so stand auf dem Papierchen mit Bleistift gekritzelt, »in der zweiten Concert-Abtheilung nur noch ein Lied singen; eine Viertelstunde später erwarte ich Dich in meiner Wohnung, in dem grünen Hause vor dem Thore. Die Begleitung will ich Dir diesmal noch erlassen, Du holder, treuloser Flüchtling Du!« –
In ruhigerer Stimmung, vor wenigen Tagen noch, würde Herr von Beuren diese Einladung vielleicht abgelehnt, oder dieselbe wenigstens nur unter bestimmten Vorsätzen der Vorsicht angenommen haben; aber jetzt verließ er das Concert, um keinerlei Verdacht zu erregen, schon nach Beendigung der ersten Abtheilung, voller Neugierde zu erfahren, wie das verführerische Weib hiehergekommen sei. Mit ihrer Erscheinung war eine lange Reihe verlockender, rauschender Erinnerungen in ihm aufgewacht, die wie lachende Satyren an seinem hausbackenen Comptoirleben vorüberzogen, und sein Blut in ungeduldige Wallung brachten. Die Schöne ließ ihn auch nicht lange warten, und kaum war er in ihr Zimmer getreten, als sie ihm unter leidenschaftlichen Liebkosungen an den Hals flog. »Endlich, endlich,« rief sie, »hab' ich dich gefunden, du geliebter Treuloser, der geglaubt, er brauche nur in's Ausland zu gehen und dann nichts mehr von sich hören zu lassen, um vor meiner Liebe sicher zu sein; aber nein, nein, meinst du, ich habe Alles dran gesetzt, meinen Ruf, meine Ehre, um dich deiner einfältigen Leonie zu entreißen und dich dann nur einige Wochen, was sag' ich, nur einige Tage mein nennen zu können? – O, da hast du mein Herz noch zu wenig kennen gelernt, du böser Flatterhafter! Beinahe die ganze Schweiz habe ich durchzogen, bis ich deine Spur gefunden, und würde eher nicht geruht haben, hätt' ich auch die ganze Welt durchwandern müssen. Jetzt aber hab' ich dich und werde dich nicht mehr lassen!« – Mit heißem Ungestüm zog sie ihn auf den Sopha nieder und begann sogleich, bald in fröhliches Gelächter, bald in Thränen ausbrechend, zu erzählen, wie sie Mannheim, von unüberwindlicher Sehnsucht getrieben, verlassen, um den Flüchtling aufzusuchen. »In Luzern endlich,« schloß sie, »konnte ich dein Versteck auskundschaften, und bin dann sogleich unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln, die mir hier einen allfällig nöthig werdenden Aufenthalt sichern, hergeeilt; denn Vorsicht ist von Nöthen in diesen kleinen Nestern, ich kenne sie. Aber nun sag' auch du mir, theurer Eugen, wie konntest du dich unter diesem Krämervolke so lange ruhig verhalten? – Hoffentlich hat dir's keines von diesen, nicht einmal gackernden, sondern höchstens piepsenden Gänschen angethan, wenigstens konnte ich, um nach meiner Gewohnheit offen zu sein, bisher noch nichts ausspioniren. Doch, im Grunde wär' mir's auch gleichgültig; Gefahr kann es nun keine mehr haben, da ich bei dir bin – nicht wahr, du mein süßester Herzenstrost?« –
Der Hauptmann wußte gut genug, wie viel Gemachtes, Unwahres und Unlautres in dieser Leidenschaftlichkeit war; gleichwohl hatte er nicht die Kraft, ihr zu widerstehen, und nun war es das erste Mal, während seines Heimstädter Aufenthaltes, daß er erst bei schon grauendem Morgen nach Hause kam. Es schien jedoch Niemandem aufgefallen zu sein, oder wenigstens beachtete er, zu sehr mit dem Chaos seiner durcheinander streitenden Gefühle und Gedanken beschäftigt, den still besorgten Blick nicht, mit dem ihm Sophie den Morgengruß bot.
Als die Festtage endlich verrauscht waren und das Leben wieder in seine gewohnten Gleise zurückgeleitet werden sollte, bemerkte Herr Theiler wohl, daß sein Zögling nicht mit dem bisherigen Eifer an die Geschäfte ging, sondern sich mancherlei Unachtsamkeit und Ungenauigkeit zu Schulden kommen ließ; er saß oft zerstreut, gedankenlos in die vor ihm liegenden Papiere starrend, oder vielmehr in Gedanken verloren, die mit diesen Papieren nichts zu schaffen hatten. Das sind eben noch die Nachwehen der Festzeit, dachte Herr Theiler anfänglich, und machte den Zerstreuten höchstens in scherzhafter Weise auf seine Mißgriffe oder Unterlassungen aufmerksam; aber es schien, als ob die Nachwehen, statt sich allmälig zu verlieren, eher stärker werden sollten, und bald war es offenbar, daß Herr von Beuren sich namentlich zur Einhaltung der herkömmlichen Arbeitsstunden förmlich zwingen mußte. Er war oft mißstimmt, und verließ dann das Comptoir unter dem Vorwande, sich unwohl zu befinden und eines Ganges in frischer Luft bedürftig zu sein. »Wenn Sie ein Unwohlsein verspüren, mein lieber Herr von Beuren,« sagte der Kaufherr, »so bleiben Sie einige Tage ganz aus dem Geschäfte weg; es ist für uns Beide besser. Sie können sich leichter erholen, und ich kann die erforderliche Arbeit anders reguliren. Mir gilt als oberste Geschäftsregel, soweit möglich jede Unsicherheit und Unordnung zu verhüten! Am besten ist es wohl, Sie ziehen alsbald den Arzt zu Rathe; vielleicht daß sich noch irgend ein alter Rest ihrer Wunde regen will.«
Der Hauptmann machte sofort Gebrauch von dieser zuvorkommenden Urlaubsertheilung; aber er blieb jetzt nicht nur vom Comptoir weg, sondern ließ sich auch, trotz der unfreundlichen Witterung, ganze Tage kaum mehr im Hause sehen. Der alte Herr Theiler schüttelte den Kopf und konnte sein Mißvergnügen nicht mehr unterdrücken über eine solche Heilmethode. »Ich fürchte, es rege sich nicht nur die Wunde in dem jungen Herrn,« sagte er zu seinem Sohne, »sondern das alte, vornehme Blut, das sich auf die Dauer an keine stetige Arbeit gewöhnen will.« Der Sohn nahm den Freund in Schutz und meinte, der Hauptmann werde sich nicht gleich wie ein Wickelkind dem Arzte überliefern wollen, bevor sein Uebel in bestimmter Gestalt auftrete; tüchtige Bewegung in freier Luft möge seiner soldatisch gewöhnten Natur zuträglicher sein, als die Apothekenbüchsen. – In ähnlich vertheidigender Weise äußerten sich auch die übrigen Familienglieder, wenn der Hauptmann nicht zu Tische kam und der Vater seine Mißbilligung darüber laut werden ließ. Nur Sophie schwieg dabei. Während sie früher das Lob des geliebten Mannes mit so gierigen Ohren eingesogen, schnitt es ihr jetzt durch die Seele, wenn nur sein Name genannt wurde; denn sie wußte ja besser als irgend sonst Jemand, daß eine schlimme Veränderung in ihm vorgegangen, wenn sie auch die Ursache und Natur derselben nicht erkannte. Wie sein Benehmen gegen sie früher bei aller Hingebung und Wärme von zarter Schonung ihrer jungfräulichen Gefühle begleitet gewesen war, so war er jetzt manchmal in so ungestümer Aufregung, daß ihr Herz von banger Beklemmung erfüllt werden mußte. Sie erzitterte unter seinen Küssen, die sie wie glühende Funken durchzuckten, und ihr den Athem in der Brust zu ersticken drohten; aber ach, er war ja doch der Abgott ihrer Seele, der wachend und träumend all' ihr Thun und Denken erfüllte, und von dem sie nimmer und nimmer lassen konnte. Jetzt freilich zog es auch wie ein dunkler, drohender Schatten durch dieses Denken und Träumen, daß ihre heimliche Liebe, in der sie früher nichts Unrechtes erblickt, eine schwere Schuld in sich schließe, und wie oft faßte sie den Entschluß, durch ein offenes Bekenntniß an die Mutter vor dem drückenden Bewußtsein dieser Schuld Erleichterung zu erlangen; aber je weniger sie sich schuldlos fühlte, um so schwerer wurde es ihr, dieses Bekenntniß abzulegen. Gingen die Andern zur Ruhe und der Hauptmann war noch nicht nach Hause gekommen, so harrte sie, vor, Kälte zitternd, stundenlang an der Hausthüre, damit er durch kein Geräusch seine späte Heimkunft verrathen müsse. Für solchen Liebesdienst erstickte er den schmerzlich stillen Vorwurf, der auf ihrem bleichen Gesichte lag, durch seine Feuerküsse, von denen sie sich einige Augenblicke berauschen ließ, um dann die Nacht unter Thränen zu durchwachen.
Es gab im Hause noch eine zweite Person, die unter dem veränderten Betragen des Hauptmannes ebenfalls schmerzlich litt, und zwar um so schmerzlicher, weil sie den Grund desselben durchschaute. Heinzelmann hatte die Sängerin gesehen, und wußte darum bald, wohin die geheimen Wege des Hauptmannes ausliefen; aber er getraute sich nicht zu warnen oder Vorstellungen zu machen, wie es ihn innerlich wohl getrieben hätte. Er fügte sich mit einer Art verzweifelnder Ergebung in das, was er als das Unvermeidliche betrachtete. »Es mußte so oder so kommen,« sagte er traurig zu sich selbst; »gehen konnte es nicht auf die Dauer, wie ich's vorausgesehen habe.« –
Diese trüben Zustände hatten schon nur zu lange angedauert, als sich dem alten Kaufherrn eine Gelegenheit darbot, dieselben wenn auch nicht zu beseitigen, so doch ihnen einigermaßen eine andere Wendung zu geben. Eine unerwartete, aber wichtige Geschäftsangelegenheit machte eine plötzliche Reise des jungen Herrn Theiler nach England nothwendig, und Herr Theiler der ältere war schnell entschlossen, diesen Anlaß zu benützen, um dem über Gebühr verlängerten Urlaube des Hauptmannes ein Ende zu machen, oder ihn wenigstens zu einer bestimmten Erklärung zu veranlassen. »Nun Herr von Beuren,« sagte er zu diesem, nicht unfreundlich, doch in ziemlich trockenem Tone, »durch die voraussichtlich längere Abwesenheit meines Sohnes wird in unserm Comptoir eine bedeutende Lücke offen, die ich einzig nicht auszufüllen vermag. Gestatten es Ihre Gesundheitsumstände, so wäre mir's sehr angenehm, wenn Sie Ihre regelmäßige Arbeit wieder aufnehmen könnten; andernfalls bin ich genöthigt, einen neuen Commis einzustellen, den ich dann natürlich nicht wieder ganz nach Belieben verabschieden kann.«
Dieser Wink war so deutlich, daß sich Herr von Beuren erröthend in die Lippen biß. Er verschluckte jedoch die Pille und erwiderte lächelnd: »Ich war so eben im Begriffe, mich meinem verehrten General, als wieder genesen, zum Diensteintritte zu melden.« –
Am nächsten Morgen erfolgte dieser Eintritt pünktlich und Herr Theiler konnte mit den Dienstleistungen nicht gerade unzufrieden sein. Freilich, wie es vor dem Neujahr gewesen, kam es nicht wieder. Herr von Beuren war oft zerstreut und von einer auffallenden Unruhe ergriffen, die ihn Manches übersehen, manchen Mißgriff begehen ließ. Dies war besonders in den ersten Vormittagsstunden der Fall, wo der Hauptmann nicht selten durch ein übernächtiges Aussehen die Ursache seines Mangels an Arbeitsfähigkeit verrieth. Herr Theiler konnte, so sehr er auch an sich hielt, seinen Unmuth nicht immer ganz unterdrücken. »Hören Sie, Herr von Beuren,« sagte er eines Morgens, »die Art und Weise, mit welcher Sie in mein Haus gekommen, überhaupt ihre ganze Lebensstellung, erlauben mir nicht mit Ihnen zu sprechen, wie ich's jedem Andern meiner Angestellten gegenüber thun würde; aber seit Ihnen unsere Familienabende nicht mehr behagen, sind Sie, wie ich genau erfahren, in die Gesellschaft von Spielern gerathen, lauter nichtsnutzige Bursche, ob mit feinerm oder schlechteren Rocke bekleidet, mir ist's gleichgültig; ich bezeichne sie doch mit dem wahren Namen. Ueber ein anderes Gemunkel, das mir erst gestern Abend zugetragen werden wollte, hab' ich kein Recht mit Ihnen zu sprechen, so unlieb mir dasselbe auch war. In solchen Dingen mag Jeder selbst zusehen, was ihm frommt. Aber das Spiel, das Spiel – das ist mir in die Seele verhaßt; es schwächt durch seine Aufregungen den Arbeitsnerv, wie Sie oft genug an sich selbst erfahren müssen, und dann das Geld! – Denn Geld frißt es immer, auch wenn man glaubt eine glückliche Hand zu haben.«
Auf das Gesicht des Herrn von Beuren war bei'm Beginne dieser kleinen Strafpredigt eine brennende Röthe gestiegen, die aber bei der Erwähnung des Geldes einer fast leichenhaften Blässe Platz machte. Er warf einen scheuen, doch scharf forschenden Blick auf den Kaufherrn, sagte dann aber, als dieser ohne Zeichen besonderer Aufregung schwieg: »Wahr ist es, daß ich einige Male gespielt habe, mit Leuten indessen, deren Bekanntschaft ich in Ihren eigenen Kreisen gemacht; hatte ich dabei auch nicht besonderes Glück, so konnten doch auch keine großen Summen verloren gehen. Was Sie mit der andern Andeutung meinen, Herr Theiler, ist mir unverständlich.«
»Um so besser und mir Ihretwegen um so lieber,« erwiderte der Kaufherr; »übrigens möchte ich nicht mißverstanden werden und wiederhole, daß ich mich nicht in Dinge mische, die mich nichts angehen, ganz abgesehen davon, daß mir alle unnöthigen Klatschereien verhaßt sind. Ob Sie im Spiele Glück oder Unglück gehabt, habe ich nicht einmal gewußt und wollte es auch nicht wissen; was ich wünsche ist nur, daß Sie Ihre so schöne Arbeitskraft frisch erhalten.« –
So ging dieser kleine Sturm rasch vorüber, jedoch nicht ohne eine erfreuliche Luftreinigung bewirkt zu haben. Herr Theiler erfuhr schon nach wenigen Tagen, daß die schöne Musiklehrerin die Stadt verlassen habe. Sie hatte, wie es hieß, nicht hinreichende Beschäftigung gefunden für ihre Kunstfertigkeit. –
Herr Theiler hatte alle Ursache, sich über diese Abreise Glück zu wünschen; denn von der Stunde an war sein Zögling wie umgewechselt. Herr von Beuren trat wieder Tag um Tag mit dem Glockenschlage in's Comptoir, und Abends verließ er das Haus nur äußerst selten mehr. Er schien sich sogar über Gebühr zurückziehen zu wollen, indem er sich nach dem Abendtische öfters sobald thunlich auf sein Zimmer zurückzog, um daselbst angeblich allerlei Werke über Handelswissenschaften, die verschiedenen Handelsgesetzgebungen, Wechselrechte und dergl. zu studieren. Zwar mochte ihn wohl hie und da noch etwas Anderes beschäftigen, indem eine gewisse Zerstreutheit, ein stummes Sinnen ihn mitten in der Arbeit anfassen wollte; aber er raffte sich immer wieder von selbst auf, um die auf solche Weise verlorne Zeit mit Hast einzubringen. Der Kaufherr machte keinen Hehl aus der Freude, die er über diesen günstigen Wechsel empfand, sondern suchte demselben vielmehr durch reichlich gespendete Anerkennung einen festen Rückhalt zu geben. Und wie gierig sog Fräulein Sophie die väterlichen Lobsprüche, die dem Lieblinge ihres Herzens gespendet wurden, wiederum ein! Gerade wie ein von brennendem Durste gequälter Wanderer, der nach trüber Wüstenreise an einen frischen Quell gelangt. Es kam ihr vor, als ob jeder dieser Lobsprüche einen Theil des Schuldbewusstseins, das sie um ihre heimliche Liebe bedrückte, von ihr wegwälze, als ob in der väterlichen Anerkennung eine Rechtfertigung ihrer Liebe selbst ausgesprochen sei. Einer solchen Rechtfertigung aber bedurfte sie mehr als je; denn unaufhörlich raunte ihr eine leise Stimme zu, daß ihr Geheimniß nicht mehr lange verborgen bleiben könne; daß aber die Offenbarung desselben die schwerste Stunde ihres Lebens sein werde. Dabei mußte sie mit bitterm Schmerze an eine andere Stunde denken, die an ihrem bisherigen, sonst so mildbesonnten Lebenswege wie ein unheilschwangrer, drohender Schatten stand. Bei dieser Erinnerung verhüllte sie das Gesicht mit beiden Händen und aus ihrer Brust stieg ein Seufzer empor, der halb bange Klage, halb inbrünstiges Gebet war.
Unter solch wechselnden Verhältnissen war der Frühling angekommen. Wiederum spielten die letzten Strahlen einer untergehenden Sonne um das von frischem Grün übersponnene Gartenhäuschen und drinnen saßen, wie an jenem verhängnißvollen Herbstabend, an welchem der Flüchtling den Entschluß zum Betreten einer neuen Laufbahn gefaßt, der Hauptmann und die älteste Tochter des Hauses ihm gegenüber. Ein nur leichthin geführtes Gespräch war in's Stocken gerathen und Jedes von den Beiden schaute ernst vor sich hin, mit Gedanken, beschäftigt, die sich vor dem Worte zu scheuen schienen. Endlich, nachdem das Schweigen schon lange gedauert, sagte Fräulein Sophie schüchtern, und ihr seit einiger Zeit merklich bleicher gewordenes Antlitz neigte sich erröthend noch tiefer auf ihre Strickarbeit herab: »Ich habe mir vorgenommen, dir etwas mitzutheilen, oder vielmehr dich über eine wichtige Sache um Rath zu fragen, Eugen; aber du bist, wie oft die letzte Zeit her, so ernst, wo nicht finster gestimmt, daß ich nun wieder den Muth nicht habe dazu.«
Der Hauptmann blickte hastig und scheu um sich, als ob er von irgend einem unbekannten Laute erschreckt worden wäre; dann fuhr er mit der Hand über Stirn und Augen und erwiderte: »Wie – was, wozu hast du den Muth nicht; oder wie sagtest du?«
»Du bist sehr mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt,« lautete die Antwort mit dem Tone der Besorgniß und zugleich eines leisen Vorwurfes; »oder fehlt dir etwas – fühlst du dich unwohl?«
»Nein, nein, das nicht mein liebes Kind,« erwiderte er, sich zu einem Lächeln zwingend; »ich habe da freilich an etwas gedacht, und warum sollten mir nicht manchmal ernste und trübe Gedanken kommen! Aber was ist's denn, daß du nicht den Muth hast mir anzuvertrauen – vermuthlich ein hochwichtiges Geheimniß!«
»Wichtig genug, lieber Eugen,« sagte das Fräulein leise, »ich fürchte, leider viel wichtiger, als du's nur erwarten kannst.«
Er warf wieder den scheuen, ängstlichen Blick um sich, bevor er zögernd fragte: »Wie denn – kommt es vielleicht vom Vater her, was du mir zu sagen hast?«
»Es kommt von Niemandem als von mir,« entgegnete sie; »aber darum ist's nicht weniger wichtig, Eugen.«
»Einzig von Dir!« sagte er wieder heiterer; »nun dann frisch ausgerückt, da kann es ja unter allen Umständen nur etwas Liebes und Gutes sein.«
»Wollte der Himmel, daß es dir so vorkäme,« erwiderte sie, »das wäre mir wenigstens ein Trost.« Nach diesen Worten schaute nun auch sie um sich, als ob sie ein verrätherisches Ohr fürchte, neigte dann ihr Gesicht an seine Schulter hinüber und flüsterte: »Wir können unser Geheimniß nicht mehr länger verbergen vor den Aeltern – ich muß mich der Mutter anvertrauen, Eugen.«
»Du mußt?« rief er hastig und erschrocken; »aber warum solltest du müssen, was könnte dich nöthigen dazu?« – Er faßte ihr tiefvorgebeugtes Haupt mit beiden Händen, richtete es empor und schaute forschend in die Augen, die sich mit Thränen füllten, während dunkler Purpur ihr Stirn und Wangen übergoß. So blieben die Beiden eine Weile stumm und unbeweglich, bis er seine Hände schlaff niedersinken ließ, um dumpf vor sich hinzustarren. Sie lehnte ihr Gesicht wieder an seine Schulter und fing heftig zu weinen an. »Höre,« nahm endlich der Hauptmann das Wort: »jetzt dürfen die Aeltern noch nichts erfahren davon, wenn nicht Alles verloren sein soll; später, vielleicht schon in einem Monate – nur jetzt nicht.«
»Aber warum denn jetzt nicht,« erwiderte sie, »da doch der Vater wieder so ganz zufrieden ist mit dir? – Es wird freilich einen schweren, schweren Kampf kosten, und der Himmel verleihe mir die Kraft, ihn durchzukämpfen; aber ich will mich ihm zu Füßen werfen und nicht mehr aufstehen, bis ich seine Verzeihung erfleht und seine Einwilligung zu unserer Verbindung erhalten habe. Nur muß dies um so schwerer werden, je länger wir zurückhalten. Ach, daß ich es überhaupt jemals verheimlicht habe – ich werd' es schwer büßen müssen.«
»Und es darf gleichwohl jetzt nicht geschehen,« sagte er, sie liebkosend an sich ziehend; »warum, wirst du später wohl einsehen. Am Ende,« fügte er leiser hinzu, »wär's auch besser, wir würden uns entfernen, und anderswo abwarten, wie die Dinge sich gestalten wollen.«
»Heimlich uns entfernen, meinst du, Eugen?«
»Heimlich!« rief er fast hastig, da er den Ton des Vorwurfes wohl empfand, der in ihrer Frage lag; »was nennst du heimlich? Etwas, das einige Tage verborgen bleibt, um dann ja doch aller Welt bekannt zu werden! – Die Hauptsache ist ja nur, dem befürchteten Sturme aus dem Wege zu gehen, ehe er uns niederwirst.«
»Nein, Eugen, das werde ich nicht thun,« erwiderte Sophie fest; »ich will mich gegen meine Mutter, meine Schwestern und gegen den Vater, der bei all' seiner zeitweiligen Heftigkeit stets ein guter und liebevoller Vater gewesen ist, nicht noch mehr versündigen, als es bereits geschehen ist. Tausendmal lieber die begangene Schuld durch ein offenes Bekenntniß abwälzen, und dem Weitern mit Geduld und Standhaftigkeit entgegengehen.«
Der Hauptmann konnte nichts mehr erwidern. In unbefangener Fröhlichkeit kamen die zwei andern Töchter des Hauses den Garten herauf und Sophie fand kaum noch Zeit ihre Thränen zu trocknen, bevor die Beiden in die Laube traten.
Das Gespräch wollte indessen nicht in den leichten Fluß gerathen, wie es sonst den stets freundlichen Mädchen gegenüber der Fall war. Der Hauptmann fiel, trotz einzelner gegen ihn geschleuderten Neckereien, immer wieder in seine nachdenkliche Zerstreutheit zurück, und Sophie vermochte es noch weniger über sich, in den heitern Ton ihrer Schwestern einzustimmen. Sie war froh, daß die Stunde zum Nachtessen herankam.
Bei diesem jedoch war der Hausherr nicht erschienen, etwas fast Unerhörtes bei dem Manne, der seine Zeit für Alles, für die Arbeit wie die Ruhe, so genau einzuhalten pflegte. Die Mutter wußte nur, daß er mit dem alten Kassier kurze Zeit vor der Essensstunde ausgegangen sei.
Ein feingeordnetes Räderwerk geräth in's Stocken durch das Ausbrechen eines einzigen Radzähnchens, das dem gewöhnlichen Auge kaum sichtbar ist. So geht es auch in einer fest gefügten Familienordnung. Die geringste Abweichung von der gewohnten Stetigkeit bringt ein Mißbehagen hervor, das unter andern Verhältnissen kaum begreiflich erschiene. Ueber der Theiler'schen Familie lag an diesem Abend ein unheimlicher Druck, dem sich keines zu erwehren vermochte, und die Mutter schaute jeden Augenblick nach der Uhr und horchte bei jedem leisesten Geräusche auf, ob es nicht die Tritte des heimkehrenden Vaters wären. Als es aber zehn Uhr geschlagen und dieser noch immer nicht erschienen war, begaben sich die Töchter auf ihre Gemächer, jede innerlich froh, für sich allein sein zu können. Der Hauptmann war schon früher in sein Zimmer gegangen.
Für die arme Sophie aber war weder an Schlaf noch Ruhe zu denken. Sie löschte das Licht und setzte sich an das offene Fenster, vielleicht daß der milde Mondschein, der um die Gebüsche des Gartens spielte, auch einen Strahl der Milderung in ihr dunkles Leid ergießen konnte. Doch sie hatte noch kaum einige Minuten so still dagesessen, als sich über den Hofweg herein Schritte vernehmen ließen. Es war der Vater mit zwei andern Männern, welche die Lauscherin jedoch nicht zu erkennen vermochte, da sie im Schatten der Mauer gingen. Vor der Hausthüre blieben die Zwei stehen, während der Vater hineintrat. Er trat leise auf, als ob er die nächtliche Ruhe nicht stören wolle; aber Sophie hörte gleichwohl, wie er nach dem gemeinsamen Wohngemache ging, aus dessen Fenstern der Lichtschein der harrenden Mutter noch immer hervorbrach. Von dort herauf glaubte sie, immer ängstlicher horchend, einzelne zornige Laute zu vernehmen, bis sich nach einer Weile die Thüre wieder öffnete, der Vater heraustrat und mit den beiden Andern über den Hof zurückging. Erst als sie durch das große Hofthor bogen, traten sie mehr auf die Lichtung heraus, und nun schimmerten im Mondschein einzelne helle Punkte auf, die nur von glänzenden Metallstücken herrühren konnten. Mit unklarem Schrecken durchfuhr die stille Beobachterin dieser nächtlichen Scene der Gedanke: Das sind Polizeimänner – was mögen die mit dem Vater zu schaffen haben, daß er sie wieder fortbegleitet! – Gütiger Himmel, warum ist er nicht zu Hause geblieben – durfte er nicht? – Zwar kam ihr diese Befürchtung bald wieder thöricht vor; es konnten ja auch Offiziere sein, die der Vater jetzt noch in ihre Herberge begleitete. Aber warum waren dieselben nicht in's eigene Haus zu Gast gekommen, wenn es gute, auswärtige Bekannte waren? Denn nur solche konnten es sein, da der Vater mit Einheimischen so spät gewiß nicht wieder fortgegangen wäre. – So stritten sich Gedanken und Vorstellungen durcheinander, bis Sophie sich entschloß, zur Mutter hinunterzugehen, um ihrer wechselnden Unruhe los zu werden.
Madame Theiler saß, als ihre Tochter wieder in das Gemach trat, in einem Winkel auf einem Stuhle zusammengekauert, als ob sie erschöpft, einer Ohnmacht nahe, dahingesunken wäre. Ihr Gesicht war bleich und die Augen starrten unbeweglich nach dem Lichte, ohne jedoch zu beachten, daß dasselbe tief herabgebrannt war. »Um Gotteswillen,« rief Sophie bei diesem Anblicke erschreckt – »was hast du, liebe Mutter, was ist denn vorgefallen! Ich glaubte, der Vater sei heimgekommen.«
Bei diesem Rufe richtete Frau Theiler ihre Blicke langsam auf die Tochter und sagte dann, die Fingerspitze an den Mund legend, leise: »Bist du noch nicht zu Bette? Ach Gott, das ist eine erschreckliche Geschichte. Wie wird das ein Ende nehmen!«
»Aber um Gotteswillen, was ist es denn – es wird doch dem Vater kein Unglück begegnet sein?« fragte Sophie von immer schwererer Angst beklommen; »er war doch hier vorhin!«
»Ein Unglück ist ihm freilich begegnet,« erwiderte die Mutter langsam, wie in Gedanken verloren; »aber ich weiß nicht einmal, ob ich dir's anvertrauen darf.«
»Thu' es, ich bitte dich,« drängte die Tochter; »ich vermöchte die ungewisse Angst nicht zu tragen diese Nacht.«
Frau Theiler nickte zwei-, dreimal langsam mit dem Kopfe, näherte sich dann Sophien und flüsterte ihr in's Ohr: »Es sind von unserm Comptoir Wechsel mit der gefälschten Unterschrift des Vaters ausgestellt worden. Er ist in schrecklicher Aufregung und nur mit größter Mühe konnte ich's verhindern, daß nicht noch diese Nacht eine polizeiliche Untersuchung auf dem Zimmer des Hauptmanns vorgenommen wurde; denn auf ihm einzig scheint der Verdacht zu liegen.«
Sophie ließ das Licht, das sie bisher noch in der Hand gehalten, unter dem leisen Ausrufe »Barmherziger Himmel« auf den Boden fallen, und würde selbst zusammengesunken sein, hätte die Mutter sie nicht in ihren Armen aufgefangen. –
Als sich am folgenden Morgen Herr Theiler bald nach Tagesanbruch auf das Zimmer des Hauptmanns begeben wollte, fand er dasselbe noch immer verschlossen. Er klopfte und verlangte Einlaß; aber es kam keine Antwort zurück und als endlich die Thüre durch einen herbeigerufenen Arbeiter mit Gewalt geöffnet wurde, war das Gemach leer. Das Aussehen des Bettes bewies indessen, daß der Hauptmann wenigstens einen Theil der Nacht in demselben geruht hatte; durcheinandergeworfene Kleidungsstücke und Papiere deuteten auf eine schleunig ausgeführte Flucht, obgleich ein sicheres Anzeichen nicht vorhanden war, wie dieselbe bewerkstelligt worden. Freilich stand ein Fenster offen; aber das war eine Gewohnheit, die der Herr von Beuren selbst bei kühlen Nächten in seinem Schlafzimmer befolgte. Indessen kam es hier auch weniger auf die Art und Weise der Flucht, als auf die Frage an, woher der Flüchtling gewarnt worden sei.
Die Aufregung des Kaufherrn kannte keine Grenzen mehr. Ueber Nacht hatte er sich soweit wieder beruhigt gehabt, daß er sich vorgenommen, gegen den Schuldigen keine gesetzlichen Schritte zu thun, wenn derselbe ein offenes, namentlich aber auch umfassendes Geständniß seines Vergehens ablege. An Letzterm war Herrn Theiler besonders viel gelegen, weil nur an der Hand eines solchen Geständnisses die nöthigen Vorkehren getroffen werden konnten, um von der Ehre der Firma jeden Makel fernzuhalten. Nun war der Einzige, der diese Aufschlüsse zu geben im Stande war, verschwunden, und zwar unter welchen Verumständungen! – Außer dem alten, felsentreuen Kassier und dem Polizeihauptmanne nebst seinem Stellvertreter, hatte im Orte noch Niemand etwas erfahren von dem Vorfalle als Madame Theiler, und doch war das Geheimniß verrathen worden! Von welcher Seite her konnte wohl nicht lange zweifelhaft sein, und das mußte die Erbitterung des Kaufherrn aufs Neue um so mehr steigern, da er selbst seiner ersten gerechten Aufwallung schon Gewalt angethan hatte.
Madame Theiler erschrak indessen bei der unerwarteten Nachricht von dem Verschwinden des Hauptmannes weit mehr über etwas Anderes, als über den ihr drohenden Zornausbruch ihres Gatten. Sie hatte wohl, trotz aller Vorsicht der Liebenden und ihrer Zurückhaltung in Gegenwart Anderer, schon längere Zeit eine Ahnung von der verborgenen Neigung ihrer Tochter; aber sie wußte, daß in solchen Verhältnissen ein allzufrühes Dreinreden oder Warnen die Flamme eher schüren als dämpfen kann, und war deshalb entschlossen abzuwarten, bis sich ihr eine wirklich faßbare Handhabe für ihr mütterliches Wort bieten würde. Immerhin war sie weit entfernt, sich den wirklichen Sachverhalt auch nur träumen zu lassen; aber gestern Nacht, als ihr die Tochter bei der Nachricht von der Gefahr, welche den Hauptmann bedrohte, halbbewußtlos in den Armen zusammensank, da war ihr mit einem Male ein unheilvoll helles Licht aufgegangen. Jetzt hatte der Verdacht, den dieses Licht in ihr entzündet, in der Flucht des Hauptmannes seine Bestätigung gefunden; denn begreiflich konnte Niemand anders als Sophie die Urheberin dieser Flucht gewesen sein.
Aber das war für die Mutter ein schon mehr als hinreichender Grund den ersten Anprall des Sturmes einzig auszuhalten und alle Verantwortlichkeit auf sich selbst zu nehmen. Von dem, was sie mit ahnungsvoller Bekümmerniß erfüllte, durfte der Vater in seiner jetzigen Stimmung nicht die leiseste Andeutung erfahren, wenn das Schlimmste vermieden werden wollte. So ließ die gute Frau den Ausbruch der Zornrede ihres Gatten geduldig über sich ergehen; doch hatte derselbe kaum begonnen, als Sophie unter der Thüre erschien. Ihr Anblick war von so geisterhafter Blässe, ihre Haltung und ihr ganzes Wesen von so ergreifender Art, daß selbst der erzürnte Vater einen Augenblick inne hielt und betroffen nach der ungewohnten Erscheinung blickte.
»Was willst du hier?« rief er dann; »wenn du unwohl bist, wie mir's scheint, so lege dich wieder zu Bette; was ich mit der Mutter zu verhandeln habe, taugt nicht für Kranke, taugt überhaupt nicht für dich.«
»Ich bin nicht krank,« erwiderte Sophie in einem Tone wehmüthiger Entschlossenheit, indem sie sich dem Vater näherte und vor ihm auf die Knie sank; »aber was du der Mutter zu sagen hast, gilt mir selbst. Ich habe den Hauptmann gewarnt, Vater.«
Dieses Bekenntniß war so rasch und unerwartet erfolgt, daß Frau Theiler nicht im Stande gewesen, es zu verhindern. Sie stand, nachdem es geschehen, wie vom Schrecken gelähmt, unfähig ein Wort hervorzubringen oder eine Bewegung zu machen.
Auch der Vater stand sprachlos, mit starren Blicken auf die vor ihm hingesunkene Tochter schauend. Die Röthe des Zornes entwich aus seinem Gesichte, um einem aschfarbenen Grau Platz zu machen, und um die Lippen bewegte sich ein seltsames Zucken, als ob der Mund sich zu einem Lächeln öffnen, oder zum Weinen sich verziehen wolle. Endlich sagte er – und am Tone seiner Stimme würde ihn die eigene Gattin nicht mehr erkannt haben, so sehr war derselbe ein anderer, gleichsam fremder geworden: »Wie meinst du das, Sophie? Ich verstehe dich nicht.«
Frau Theiler hatte sich von ihrem ersten Schreck unterdessen etwas erholt und wollte nun dazwischentreten. »Du siehst ja, Vater,« sagte sie, die noch immer knieende Tochter an beiden Armen fassend, »daß das Kind schwer erkrankt ist, und wohl schon in Fiebern redet. Gütiger Himmel – was Alles zusammenkommen muß!«
Aber Vater und Tochter machten zugleich eine abwehrende Bewegung. »Nein Mutter,« sagte Sophie, diesmal jedoch ging ein vernehmliches Zittern durch ihre Stimme; »hier will ich liegen bleiben, bis ich mein Herz erleichtert habe. Das muß geschehen, Mutter, und zwar nicht nur vor dem Vater und dir, sondern auch vor meinen Schwestern; denn ich habe gegen euch Alle gesündigt. Seht, da kommen sie schon, wie ich sie gebeten habe.«
Die beiden Mädchen, die sanfte Adele und die lebhafte Auguste, traten ängstlich herein, noch unbekannt mit dem, was vorgegangen; aber schon durch die Art und Weise wie sie von ihrer ältesten Schwester gerufen worden, waren sie von bangen Vorgefühlen erfüllt. »Ja,« fuhr Sophie fort, »ich habe mich gegen euch Alle hart vergangen und das Vertrauen, das ihr in mich gesetzt, schwer mißbraucht, indem ich die Liebe, die mich vom ersten Augenblicke an für den Hauptmann erfüllt, euch verheimlicht und nur ihm anvertraut habe. Jetzt freilich hat mein Geständniß kein Verdienst mehr; denn ich hätte es ablegen müssen, auch ohne daß dieses Unglück über uns gekommen ist. O blicke mich nicht so voll Zorn und Verachtung an, theurer Vater; ich habe mein Vergehen schon mit ungezählten Thränen gebüßt; aber nun kann ich nicht mehr von meinem Geliebten lassen, und darf nie einem Andern angehören. Darum hab' ich ihn letzte Nacht aus dem Schlafe geweckt und zur Flucht aufgefordert.«
Wenn das Unerwartete, Ungeahnte so plötzlich mit der Schnelligkeit des Blitzes über uns hereinbricht, sei es in Freud oder Leid, so verstummen die Worte, da eines der widerstreitenden Gefühle zuerst die Oberhand gewinnen muß, bevor es nach einem äußern Ausdruck verlangt. So geschah es auch in dem bestürzten, häuslichen Kreise des Kaufherrn. Aber das Gesicht dieses letztern selbst nahm mehr und mehr einen schreckenerregenden Ausdruck an. Die starr vor sich hinblickenden Augen quollen hervor, der Mund preßte sich zusammen und auf Stirn und Wangen schien sich Fiebergluth mit tödtlichem Froste zu streiten. Endlich hob er den Fuß langsam empor, als wollte er die vor ihm Kniende von sich schleudern. Da sank Adele, die zweitältere Tochter, die angstvoll jeder seiner Geberden und Bewegungen gefolgt, ebenfalls vor ihm auf die Knie. »Vater,« rief sie, die gefalteten Hände und thränenvollen Augen erhebend, »Vater, vergib, o vergib der Schwester, oder lasse deinen Zorn auch auf mich fallen; denn auch ich habe den Hauptmann heimlich geliebt, und wenn ich diese Liebe vor ihm selbst im tiefsten Herzen verbarg, so geschah es vielleicht nur, weil ich aus keine Gegenliebe hoffen durfte. Aber auch ich würde ihn vor einer drohenden Gefahr gewarnt haben, wenn mir dieselbe bekannt geworden wäre, wie der Schwester.«
Der Kaufherr ließ den noch immer erhobenen Fuß wieder sinken und lehnte sich an die Wand zurück. Die Mutter wollte sich ihm mit besänftigender Bitte nähern; aber er stieß sie hart von sich und rief mit bebender Stimme: »O, die unglückseligen Stunden, in denen du mir deine Kinder geboren! – O, daß sie dahinschwinden würden, wie unnützes Laub, das von den Bäumen fällt! Sie alle haben mich mit Verrath und Schmach umgarnt; denn auch Wilhelm – ihm ist der Betrug des Elenden vor mir bekannt geworden; aber statt es mir zu entdecken, hat er Alles gethan, den Schurken zu schonen und mich hinteres Licht zu führen. Schmach und Verderben über solche Kinder!«
Die arme Mutter mußte sich bei diesen entsetzlichen Worten mit beiden Händen an einem Tische halten, um nicht niederzusinken. Auch der alte Kaufherr ließ sich, kaum noch seiner Sinne mächtig, auf einen Lehnstuhl niederfallen.
Sophie, in deren Auge keine Thräne gekommen, erhob sich langsam und schwand, gleich einer dem Grab entstiegenen Schattengestalt, lautlos zur Thüre hinaus. –
Sophie ließ sich an diesem Tage nicht mehr erblicken. Der Vater hatte auch Mutter und Schwestern aufs Strengste verboten, in irgend welchen Verkehr mit ihr zu treten; er selbst werde das Weitere von ihr vernehmen und über sie verfügen, sobald er erst zu einem Entschlusse gekommen. – Es hätte unter den obwaltenden Verhältnissen das Unheil nur vergrößern müssen, wenn diesem Befehle von irgend einer Seite zuwidergehandelt worden wäre, wie schwer sich Mutter und Schwestern auch in denselben fügen konnten. Aber am folgenden Tage, als sich der Vater selbst nach dem Zimmer seiner ältesten Tochter begab, fand er dasselbe ebenfalls leer, wie am vorigen Morgen dasjenige des Hauptmannes. Auf dem Tische lag ein mit vielfachen Thränenspuren bedecktes Blatt, das folgende Worte enthielt: »Vater und Mutter! Der Vaterfluch, der durch meine Schuld auch auf meine Geschwister gefallen ist, würde mich wie ein zürnendes Strafgericht aus Euerm Hause treiben, selbst wenn mich keine Pflichten von hinnen riefen; aber meine Pflicht ist es, dem Manne, den ich vor Gott meinen Gatten nennen muß, zu folgen, was er auch Uebels begangen haben, und welches Schicksal ihm auch bevorstehen mag. Er hat mir gestanden, daß er die Wechsel ausgestellt, um einem seiner gefangenen Kriegskameraden die Mittel zur Flucht aus der Festung zu verschaffen, und daß die Papiere zur Verfallzeit sicher eingelöst worden wären, wenn die Fälschung nicht vorher an's Licht gekommen. Sei dem wie ihm wolle, er hat gefehlt; doch ich, die ebenfalls Schuldbeladene, darf nicht zu Gericht sitzen über ihn; ich habe nur sein Loos zu theilen. Läßt es einst Gottes Güte zu, so versagt mir Eure Verzeihung nicht, o Vater und Mutter, und laßt Euerm unglücklichen Kinde nicht für immer Zorn und Verachtung in die Fremde folgen. Lebt wohl; lebt wohl theure Geschwister; über Euch Allen möge stets die segnende und beschützende Hand des Herrn walten.«
Der alte Kaufherr blickte lange unter einem Sturm wild widerstreitender Gefühle auf diese Zeilen, bis die Mutter, voller Angst über das, was sich zwischen ihm und der Tochter zutragen möchte, ebenfalls in das Gemach trat. Schwelgend reichte er ihr das Blatt dar; aber ein kalter Schauer durchrieselte ihn, als sie, in Thränen ausbrechend, ausrief: »Nun ist, wie du es gewünscht, schon eines unserer Kinder gleich einem dürren Laube hinweggeweht!« –
Dieser traurige Vorgang führte einen scharfen Axtstreich auf die sonst so schnellgefaßte und klare Willenskraft des Herrn Theiler. Mehrere Tage lang schwankte er unter den wechselndsten Eindrücken und Gedanken hin und her, bevor er zu einem bestimmten Entschlusse kommen konnte. An eine gerichtliche Verfolgung des Hauptmannes durfte nicht wohl mehr gedacht werden, wenn man nicht das eigene Kind vor aller Welt der Schande, wo nicht einem verzweiflungsvollen Tode in die Arme jagen wollte; aber noch ferner lag dem Handelsherrn der Gedanke an eine Aussöhnung mit dem Manne, der sein Vertrauen so schmählich mißbraucht hatte. So entschloß er sich endlich keinerlei Nachforschung über die Flüchtlinge anzustellen, und sie bis auf Weiteres ihrem Schicksale zu überlassen. Mit diesem Entschlusse mußte und konnte sich die leidvolle Mutter um so eher zufrieden geben, als die flüchtige Tochter wenigstens so viele Mittel besaß, daß sie für die nächste Zukunft ihre Existenz fristen konnte. Später, so dachte Frau Theiler im Stillen, werden sich schon neue Wege öffnen. –
Für das ganze Theiler'sche Haus waren nun trübe, dunkle Tage angebrochen. Es schien, als ob alles sonst so heitere und behagliche Leben in demselben eine schattenhafte Gestalt angenommen habe. Das muntere, von manchem Lied und kräftigem Scherzworte gewürzte Treiben in den hintern Höfen und geräumigen Magazinen war verstummt; die Lader und Packer schlichen einher, als fürchteten sie sich auf unrechten Wegen ertappt zu werden. Und der Oberanführer dieser Leute, der brave Heinzelmann – wer ihn vor zwei Monaten noch gesehen, würde ihn schwerlich mehr erkannt haben. Wenn er so in Gedanken versunken an einem Waarenballen lehnte, als fehle ihm die Kraft aufrecht auf seinen Füßen zu stehen, mit dem tief vorgebeugten fahlen Antlitze und den unstät schimmernden hohlen Augen, dann sagten seine Kameraden wohl kopfschüttelnd zusammen: »Der arme Bursche – mit dem ist's Matthäi am letzten.« Zwar kannte er den genauern Verlauf der Dinge, die ihm fast das Herz abdrücken wollten, so wenig als die Andern; aber er hatte mehr Anhaltspunkte als Andere, diesem Verlaufe errathend auf die Spur zu kommen.
Am Düstersten sah es freilich im Innern des Hauses selbst aus. Wenn eine der Töchter ein Lächeln versuchte, so geschah es nur, um die verborgene Thräne im Auge der Mutter zu verscheuchen. Der Vater war ernst und schweigsam, so daß er Abends Stunden lang in seinem Lehnstuhle sitzen konnte, ohne ein Wort zu sprechen. Das war sonst nie seine Art gewesen, und um so bedrückender mußte diese Veränderung seinen Angehörigen, die sich stets in allen Wechselfällen an seinem heitern Muthe aufgerichtet, nun auffallen. Fast unerträglich aber war das Mitleid Anderer, selbst wo es aufrichtig gemeint sein mochte. In das eigentliche Sachverhältniß waren nur sehr wenige Personen eingeweiht; natürlich lebten dafür alle Andern von Gerüchten, die zehnmal Schlimmeres sagten, als die Wirklichkeit es an sich schon war. Daher glaubte Jeder, der mit der Familie auch nur irgendwie bekannt war, seine Theilnahme dadurch bezeugen zu müssen, daß er auf die ihm gerüchtweise zu Ohren gekommenen Ungeheuerlichkeiten hindeutete; Mancher mochte dabei freilich die Absicht haben, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Aber wo dies auch nicht der Fall war – es gibt eben Leiden und Kümmernisse, die von dem Einzelnen, oder wenigstens nur von seinem Familienkreise getheilt und getragen werden müssen. –
Eines Tages, es ging bereits dem Feierabend zu, kam ein großes Geschrei von den Hinterhöfen herauf. Herr Theiler eilte sogleich hinunter und sah zu seinem Schrecken, von den ebenfalls erschrockenen Mitarbeitern umstanden, den armen Heinzelmann am Boden liegen. Ein von einem hochgethürmten Lastwagen herabrollendes Fäßchen hatte ihn auf die Brust getroffen und lautlos war er dann zusammengesunken. Eine äußere Verletzung war nicht bemerklich; nur daß die festgeschlossenen Lippen von einigen Blutstropfen gefärbt waren. Der Verunglückte lag unbeweglich, mit geschlossenen Augen, einer Leiche gleich. Der sogleich herbeieilende Arzt konnte keinen bestimmten Bescheid geben; unter allen Umständen müsse die Wiederkehr des Bewußtseins abgewartet werden. Hoffnung sei jedoch so wie so wenig vorhanden.
Dieser Unfall traf Herrn Theiler äußerst schmerzlich. Der tüchtige Heinzelmann war ihm, ungeachtet ihn sein Anblick jedesmal an einen Andern erinnerte, den er lieber vergessen hätte, aufrichtig lieb geworden. Aber noch tiefer berührte es ihn, als er von einem der Lader die leise Aeußerung hörte: »Ach, dem ist's auch lieber, wenn er die Augen nimmer öffnen muß; mich sollt's nur Wunder nehmen, ob er das Fäßchen nicht ganz gut hat anrollen sehen.«
»Wie meint Ihr das?« fragte der Kaufherr, sich nach dem Manne umwendend; »versteh' ich Euch recht, so wollt Ihr andeuten, der brave Heinzelmann habe sich den Unfall absichtlich zugezogen.«
»Das gerade nicht, Herr,« erwiderte der Gefragte nach der Art solcher Leute ausweichend; »ich sage nur, es wundere mich, daß er das anrollende Fäßchen nicht gesehen habe. Es hatte einen ziemlich weiten Weg zu machen, und mit einem Stoße des Schiebhakens, den er in der Hand gehalten, hätte es vorbeigleiten müssen.« Das bedeutsame Schweigen der übrigen Umstehenden belehrte Herrn Theiler, daß der Mann nicht einzig stand mit seinem Zweifel.
Um Mitternacht wurde der Kaufherr, nachdem er den Kranken vor kaum einer Stunde noch immer bewußtlos verlassen, an dessen Bett zurückgerufen. »Ich muß Sie für die Störung um Verzeihung bitten,« sagte Heinzelmann mit matter Stimme zu dem Eintretenden; »aber ich fürchte, bis zum Morgen wär's zu spät geworden, und doch hätt' ich noch eine Bitte, Herr Theiler.«
»Will's Gott, steht es nicht so schlimm, lieber Heinzelmann,« erwiderte der Kaufherr theilnehmend; »ich habe so eben nach dem Arzte geschickt, damit Ihr ihm selbst Auskunft geben könnt.«
Der Kranke schüttelte leise mit dem Kopfe. »Mit dem Arzte hat es keine Eile, wie herzlich ich Ihnen auch für Ihre Vorsorge dankbar bin,« sagte Heinzelmann tief Athem holend; »helfen wird mir der wenig mehr. Aber dort – im Schranke liegt eine kleine Summe Geldes – es ist nicht viel, doch durch Ihre Freigebigkeit mehr, als ich je in meinem Leben besessen habe; das Geld – möcht' ich Sie bitten, Herr Theiler – an Handen zu nehmen – an Zins zu legen – und es einst – wenn – wenn – meinem unglücklichen Hauptmann zukommen zu lassen. – Ich kann ihn immer nicht vergessen, Herr – gleichwohl nicht; denn seht – ich war von Kindesbeinen ein armes, verstoßenes Menschenkind. Er – er ist der Erste gewesen, der mir – manchmal ein freundliches Wort gegeben – und damit das rechte Gefühl – daß ich eben doch auch ein Mensch sei. Nein – vergessen kann ich ihn nicht – mit meinem letzten Gedanken nicht.«
Bei diesen Worten, die nur mühsam und mit mancher Unterbrechung hervorgebracht wurden, traten dem Kaufherrn die Thränen in die Augen. Die schon erkaltende Hand des treuen Soldaten ergreifend, rief er bewegt: »Nur den Muth nicht sinken lassen, mein Braver; mit Gottes Hülfe werdet Ihr's überstehen, und dann – wer weiß; man sollte meinen, wer sich so viel Treue und Liebe zu erwerben gewußt, der könnte nicht gänzlich verloren gehen.«
»Ja – verzeihen Sie ihm – wenn es einst möglich ist,« sagte Heinzelmann leiser, kaum noch hörbar; »ich – ich möcht' nicht wieder – gesund werden. Das Leben ist mir zu schwer geworden.« – Ueber sein Gesicht bewegte sich etwas, wie ein Lächeln schmerzlicher Befriedigung; seine Hand zuckte in derjenigen seines Dienstherrn, und – die treue Seele war hinübergegangen. –
Der schmerzliche Eindruck dieses traurigen Vorganges war noch lange nicht verschwunden, als Herr Theiler mit seiner ganzen Familie von einem andern Schlage niedergeworfen wurde. Es kam die Nachricht, daß der Sohn und Bruder auf der Heimfahrt von London nach Hamburg seinen Tod in den Wellen gefunden habe.
Bei dieser erschütternden Trauerbotschaft hatte die Mutter den Vater wohl nicht an sein furchtbares Wort erinnert, wie bei dem Verschwinden der Tochter aus dem älterlichen Hause; aber der Gedanke daran stürmte dennoch wie der Spruch eines zürnenden Strafgerichtes durch seine Seele. Seine bisherigen Lebenswege hatten ihn noch nie an die geheimnißvolle Pforte geführt, hinter deren Schwelle nach der Lösung der dunkeln Räthsel unsers Daseins geforscht wird; um so unheimlicher und banger aber wurde ihm nun zu Muthe, als er sich plötzlich vor diese Pforte hingestellt sah. Ein tiefgehender Schmerz, der uns von dem äußern, werkthätigen Leben abzieht, leitet uns, auch ohne daß wir's wollen, immer gerne in jene träumerische Gedankenwelt, die sich über den Zusammenhang aller Dinge nicht mit bloßen Worten zufrieden geben will; darum mußte der schwergeprüfte Vater bei jedem Gedanken an den verlornen Sohn, der seines Lebens Stolz und Hoffnung gewesen, an jene verhängnißvollen Worte denken, die nun wie ein drohendes Schicksalsräthsel vor ihm standen. Das war aber ein Gedanke, der ununterbrochen vom Morgen bis zum Abend dauerte, und in nächtlichen Träumen fortgesponnen wurde, bis wieder das Morgenlicht erschien.
Bei einer solchen Gemüthsstimmung konnte Herr Theiler an seiner bisherigen Thätigkeit bald keine Freude mehr finden. Was ihn früher mächtig angeregt und zu weitaussehenden Unternehmungen angespornt, das kam ihm jetzt öde, schaal und nichtig vor. Wozu sollte er sich darum noch länger mit Dingen abmühen, die ihm keine Theilnahme mehr abgewinnen konnten? – Das ganze Handlungsgeschäft mußte so wie so in fremde Hände übergehen, da der einzige Sohn todt war, und was Herr Theiler für sich selbst sowohl, als zur Sicherheit der Zukunft der Seinigen bedurfte, war ja in reichem Maße vorhanden. Daneben wurde ihm auch der Aufenthalt in dem Hause, das früher sein Paradies umschlossen, ihn aber jetzt auf Schritt und Tritt an getäuschte Hoffnungen, an ein zertrümmertes Glück erinnerte, allmälig unerträglich. –
So trat er eines Abends in die Wohnstube, in welcher Frau Theiler einzig am Fenster saß, gedankenvoll in das verglimmende Abendroth hinausschauend. »Sieh' da, Mama,« sagte er auf eine Stelle des Blattes deutend; »erinnerst du dich noch an das Haus?«
»Ach ja,« sagte Frau Theiler, nachdem sie die Stelle gelesen; »das ist die so still und freundlich gelegene Campagne links ab vom Wege nach Lütry, in der wir damals bei unserer Reise – wie lange ist es – bald zwanzig Jahre her – von deinem Geschäftsfreunde zu Gaste geladen wurden. So, das Gut soll jetzt verkauft werden!«
»Richtig, das ist's,« erwiderte er; »ich erinnere mich noch, daß du damals den Wunsch äußertest, an einem solchen Orte deine Tage zu beschließen. Ist dir's noch so?«
»Mehr als je,« sagte sie leise.
»Was meinst du, wenn ich die Campagne kaufen würde?«
Frau Theiler schaute ihren Gatten eine Weile mit ihren stillen Augen an und antwortete dann: »Mich meinentheils hält hier nichts mehr fest.«
»Dann reise ich morgen nach Lausanne,« rief Herr Theiler, »für mein hiesiges Geschäft weiß ich bereits einen Liebhaber.« –
Noch vor Ablauf einer Woche kehrte er als Besitzer der Campagne wieder nach Heimstädt zurück und kaum einen Monat später war die ganze Familie zur Abreise in ihre neue Heimath bereit.
»Aber Eines noch,« sagte Frau Theiler am Tage vor dieser Abreise zu ihrem Gatten, »ich verlasse dieses Haus, in dem wir so vieles in Freud und Leid zusammen erlebt, nicht, bevor wir vorher noch eine gemeinsame Pflicht erfüllt haben.«
»Und die wäre?« fragte er aufschauend; »was willst du sagen?«
»Du ordnest von hier aus noch möglichst genaue Erkundigungen nach unserer verlorenen Tochter an,« antwortete sie.
»So!« erwiderte er langsam, »mich wundert nur, daß du das Begehren nicht früher gestellt hast. Jetzt ist's zu spät; denn ich habe schon vor mehrern Tagen gethan, was du von mir verlangst.« –
Einige Tage später war die Theiler'sche Familie in ihrer neuen Heimath eingehaust. –
Und es war eine Heimath, wohl angethan, daß sich in ihr die Wunden des Gemüthes schließen, stürmisch bewegte Tage in einen friedlichen Abend auslaufen konnten. Am obern Rande des wundervollen Abhanges gelegen, der sich von der Höhe Lausannens langsam gegen den See niedersenkt, bot das in schönen Verhältnissen gebaute Haus eine bezaubernde Aussicht auf die tiefer gelegenen Campagnen mit ihren reizenden Anlagen, auf den im mannigfaltigsten Tageslichte schimmernden See und auf die Gebirge, die in so prächtigen als erhabenen Bildungen am jenseitigen Ufer emporstiegen. Zunächst um das Haus zog sich der Blumengarten mit seinen Gewächshäusern, gegen seine äußern Ränder hin immer mehr in höheres Strauchwerk auslaufend, bis dasselbe den Gebüschen und Baumgruppen des Parkes Platz machte. Der Park selbst maß nach jeder Seite hin mehrere hundert Schritte in die Länge vom Hause weg; nach zwei Seiten hin war er von Mauern begrenzt, hinter denen ebenfalls wieder die Baumgruppen anderer Campagnen emporstiegen; nach der dritten Seite verlief er sich in einen zum Gute gehörigen Rebberg, dessen Höhe von einem niedlichen Belvedere gekrönt war; die vierte Seite aber wurde von einer mehr als mannshohen Mauer abgegrenzt, über die, wie bei den zwei andern, Bäume und Blüthenbüschel hereinnickten. Beim Abschlusse des Kaufes hatte Herr Theiler in dem angenehmen Eindrucke, den das Ganze auf ihn hervorgebracht und in der Voraussetzung, daß hinter dieser Mauer ebenfalls eine Campagne liege, keine weitere Nachfrage nach Name u. s. w. gehalten; er war auch schon mehrere Tage in seinem Besitzthume eingezogen, als er erfuhr, daß dasselbe nach dieser Seite hin an einen – Gottesacker grenze. Zu andern Zeiten würde ihn eine solche Nachbarschaft wenig gestört haben – denn eine stillere gibt es ja nicht leicht; jetzt aber griff ihm die unerwartete Entdeckung wie eine kalte Todeshand selbst an's Herz. Ihm war's, als ob ihm eine Stimme in's Ohr raunte: »Damit du nicht weite Wege hast, um die Deinigen zu begraben.« Allmälig milderte sich freilich die Schärfe dieses ersten Eindruckes und Herr Theiler sagte zu sich selbst: »Nun, da hab' ja auch ich meine letzte Heimath in der Nähe«; aber immerhin hatte diese Nachbarschaft über das sonnenhelle und schönheitschimmernde Landschaftsgebilde einen Schatten hingeworfen, der durch zwei Umstände eine tiefere Färbung erhielt. Einmal war es zu deutlich, daß an der Jugendblüthe Adelens ein Wurm nagte; mochte nun der Gram über die Schicksale ihrer zwei ältern Geschwister, über verlorene Liebe, oder aber ein geheimes, körperliches Leiden sein – so viel war gewiß, daß die ohnedies Stille noch stiller war, als früher, und von Monat zu Monat bleicher, sozusagen durchsichtiger wurde. Dabei weigerte sie sich hartnäckig, ärztlichen Beistand anzunehmen und erklärte fortwährend, durchaus wohl und gesund zu sein, sich über die Begebenheiten in ihrer Familie auch nicht mehr zu grämen, als dies in der Natur der Sache liege und von den Andern, der Schwester und den Aeltern ebenfalls geschehe.
Der zweite Umstand, der Herrn Theiler die Tage in der neuen Heimath verdüsterte, lag darin, daß alle Nachforschungen nach Sophien ergebnißlos geblieben. Alles, was in Erfahrung gebracht werden konnte, war, daß ein junges Paar, das der Beschreibung nach nur Herr von Beuren und Sophie gewesen sein konnte, sich einige Zeit in der Nähe von Straßburg aufgehalten; dann aber sich nach Paris oder Brüssel begeben habe. Die Namen paßten freilich nicht; aber es schien, daß Herr von Beuren sich falsche Legitimationspapiere zu verschaffen gewußt. – Die Resultatlosigkeit dieser Bemühungen drückte um so schwerer auf den alten Kaufherrn, als er sie unwillkürlich und fortwährend mit dem Zustande Adelens in Verbindung bringen mußte.
Und dieser Zustand nahm endlich eine mehr als bedenkliche Wendung. Adele, die nach ihren Aussagen sich bisher körperlich wohl befunden, mußte nun erklären, daß ihr die Kräfte zu fehlen anfängen, sich den ganzen Tag außer Bett zu halten. Die Ansichten sämmtlicher herbeigezogener Aerzte gingen übereinstimmend dahin, daß eine schon lange im Verborgenen arbeitende Abzehrung bereits bedenkliche Fortschritte gemacht habe, und sobald es die Jahreszeit erlaube, eine anhaltende Badekur gebraucht werden müsse. –
Als die hiefür günstige Zeit wieder gekommen, zog die ganze Theiler'sche Familie nach den berühmten Heilquellen von Leuk, und in der That schienen die Bäder, verbunden mit der gesunden Alpenluft, nicht nur auf die Kranke, sondern auch auf die übrigen Familienglieder die wünschenswertheste Wirkung ausüben zu wollen. Das muntere Treiben der Badegesellschaft, die täglich sich erneuernde bunte Mannigfaltigkeit der vorüberziehenden Touristenwelt, im Verein mit der großartigen Umgebung, zogen das Denken von den dunkeln Grübeleien ab und machten das Herz wieder einem unbefangenern Genusse der Gegenwart zugänglicher. Aber seinem Verhängnisse vermag Keiner zu entgehen.
Auguste, die fast ihre ganze angeborene Fröhlichkeit wiedergewonnen hatte, war von einer Parthie Herren und Damen zu einem Ausflug nach einer hochgelegenen Alp eingeladen. Herr Theiler wurde von seinem Vorhaben, ebenfalls Theil daran zu nehmen, durch eine kleine Erkältung, die er sich am Abend vorher zugezogen, abgehalten; doch da das Wetter prächtig war und die Gesellschaft aus eben so verständigen als liebenswürdigen Badegästen bestand, sah er keinen Grund ein, warum seinetwegen das liebe, muntere Kind sich das Vergnügen versagen sollte. Zudem verstand Auguste vortrefflich das Maulthier zu regieren und ein Ritt auf demselben machte ihr jedesmal eine wahre Herzensfreude. Nicht ohne eine Regung geheimen, aber berechtigten Stolzes sahen Vater und Mutter der abziehenden kleinen Caravane nach, in welcher ihre jüngste Tochter unbestritten die anmuthigste Erscheinung war, obwohl es keineswegs an würdigen Nebenbuhlerinnen fehlte. –
Als man sich im Bade zur Mittagstafel niedersetzte, strahlte der Himmel noch in seinem stahlblauen Sommerglanze; als man sich aber von derselben erhob, hatte sich von den gegenüberliegenden Gebirgswänden ein schwarzbrauner Wolkenstreifen schon weit über das enge Hochthal hereingeschwungen. In einer halben Stunde war der Tag in dunkle Nacht verwandelt, die nur von dem blendenden Lichte der Blitze durchzuckt, von dröhnenden Donnerschlägen erschüttert wurde. Und kaum war das Gewitter vorübergezogen, so schallten ihm von da und dort die Nothglocken nach und von allen Seiten her kamen die Bergbäche als wüthende Ströme zu Thal geschossen.
Im Bade war man begreiflicher Weise in ängstlichster Besorgniß um die Bergfahrer. Zwar versuchte der Badbesitzer damit zu trösten, daß an dem begangenen Wege an mehrern Punkten bequeme Unterkunft zu finden sei, und daß sich bei der Gesellschaft Herren befänden, die mit diesem Wege genau bekannt wären. Dem Einwande, daß das Gewitter zu plötzlich und unversehens herangebraust sei, begegnete er mit der Bemerkung, daß man die Vorboten desselben auf der Höhe auch viel früher habe bemerken können, als unten im Thale. Gleichwohl konnte der Mann seine eigene Unruhe selbst nicht verbergen, und sogleich wurde eine ganze Abtheilung von männlichen Dienstboten mit trockenen Kleidern, Stärkungen u. s. w. den Abwesenden entgegengeschickt. Herr Theiler sah diesen Vorbereitungen mit einer Art verzweiflungsvoller Ergebung schweigend zu; die Kraft, die entgegengehenden Leute zu begleiten, hätte er trotz des innern Dranges dazu, nicht finden können. »Wenn auch keinem Andern ein Haar gekrümmt worden ist,« stöhnte er dumpf vor sich hin, »so muß doch meinem Kinde ein schwerer Unfall begegnet sein. Ich spür's da drinnen.«
Und er hatte in seiner trüben Ahnung nur zu klar gesehen, der arme Mann. Als die Dunkelheit bereits angebrochen war, bewegte sich vom Berge herab ein stiller Zug dem Bade zu, voran zwei Männer, die eine Bahre trugen. Darauf lag, von einem Tuche bedeckt, eine Leiche, an die der Tod in furchtbarer Gestalt herangetreten war.
Droben im Gebirge hatte sich die von dem Gewitter überraschte Gesellschaft unter einen Felsenvorsprung geflüchtet, der in ähnlichen Fällen schon Tausenden ein schützendes Obdach geboten haben mochte. Man schickte sich, als das Wetter vorübergezogen, auch bereits wieder zum Weitermarsche an, als sich in der Höhe einige vom Wasser gelockerte Steine loslösten und in mächtigen Bogensprüngen niederstürzten. Der Stein, welcher die eben wieder auf ihr Thier steigende Auguste an die braunlockige Schläfe traf, war kaum von der Größe einer Kinderfaust; aber in seiner zerstörenden Gewalt groß genug, dem blühenden Leben die Qualen des Todeskampfes zu ersparen. –
Um Mitternacht saß der unglückliche Vater unbeweglich, lautlos in der nämlichen Stellung neben der Leiche des Kindes, wie er sich am Abend, als dieselbe heimgebracht worden war, hingesetzt hatte. Keine Thräne kam in seine Augen und nach einem ersten Aufschrei der Verzweiflung beim Anblicke der Todten, war auch keine Klage mehr über seine Lippen gekommen. Jetzt legte sich eine Hand auf seine Schulter und eine wehmuthvolle Stimme sagte leise: »Vater!« – Als er aufblickte, stand seine Gattin neben ihm, die fortfuhr: »Komm' mit hinüber zu Adelen – sie wünscht es.«
»Ja, ich komme,« erwiderte er, sich erhebend mit jener starren Ruhe, die der Athem des Todes über unser Herz hauchen kann; »sie überdauert den Schlag nicht und wird mir das letzte Lebewohl sagen wollen.«
Die Mutter nickte feierlich; auch ihre Augen waren thränenlos und das bleiche Antlitz ruhig, als ob die Züge desselben in dem ungeheuern Schmerze erstarrt wären. Einem solchen Schmerze hatte die längst geknickte Lebenskraft Adelens keinen Widerstand mehr zu leisten vermocht. –
Am folgenden Mittage fuhren langsam zwei Wagen vom Bade weg auf der Straße nach Sitten hinunter. Auf dem vordern lagen, von einem einzigen Trauertuche bedeckt, zwei jungfräuliche Schwesterleichen; im Hintern saßen, noch immer stumm und thränenlos, die Aeltern, welche heimkehrten, um dort ihre Kinder zu begraben. –
Nachdem diese traurige Pflicht erfüllt war und über den zwei engverbundenen Gräbern der Schwestern Ein Stein sich erhob, der von dem Loose der Frühvollendeten Kunde gab, fand das Mutterherz wohl allmälig den bittern Thränentrost; aber der unglückliche Vater blieb von jener dumpfen Schmerzensnacht umfangen, in die kein Stern mehr einen Strahl des Trostes oder der Hoffnung zu werfen vermag. In dieser dunkeln, bangen Nacht wurde auch jeder Glaube an göttliche Gnade und Barmherzigkeit ausgelöscht, oder wenigstens vermochte ein solcher Glaube in das umnachtete Gemüth nicht einzudringen. »Ich trage ja die Strafe meiner Schuld,« erwiderte er auf dahinzielende Trostworte mit schmerzlicher Bitterkeit – »was wollt ihr denn von Gnade sprechen?« – In der begründeten Befürchtung, daß ein solcher schuldbewußter Schmerz auf die Dauer jede menschliche Kraft übersteigen müsse, hatte die tiefgebeugte Gattin das bisher wohlbewahrte Geheimniß einem wackern Geistlichen anvertraut, mit der Hoffnung, daß dieser einen Weg zu dem verfinsterten Gemüthe des Gatten finden möchte; aber dadurch wurde das Uebel wo möglich nur noch größer gemacht. Der Unglückliche klagte, daß er nun vor aller Menschen Augen als Kindesmörder dastehen müsse, und von Stunde an war er nicht mehr zu bewegen, aus eigenem Willen vor eines Menschen Angesicht zu erscheinen. Er ließ vom Parke aus die Mauer nach dem Gottesacker durchbrechen, und das war nun noch der einzige Weg, auf dem er das Haus verließ. Aber auch auf dem Grabe seiner Kinder vermochte er sein Leid nicht durch Klagen zu lindern. Das Einzige, was er sprach, war die verzweiflungsvolle Wiederholung der Worte: »Sie sind dahingegangen, wie das Laub, das von den Bäumen fällt.« Wenn die Mutter ihn alsdann mit dem Troste aufzurichten suchte, daß ja schon tausend und aber tausend Aeltern ihre Kinder begraben hätten und nicht jede Hoffnung verschwunden sei, daß wenigstens noch Eines unter den Lebenden weile, erwiderte er, das ergraute Haupt schüttelnd: »Und hätte die Arme auch alles Elend, alle Noth überwunden, so muß sie meinem Fluche schon längst erlegen sein. Frage diese Gräber, frage die Meereswogen, die Wilhelm verschlungen haben. Es gibt nicht Trost, nicht Gnade für mich, weder hier noch dort.«
»Herr,« flehte die gramerfüllte Mutter auf dem Grabe der Kinder niederkniend, »laß die Last nicht schwerer werden, als deine schwachen Kreaturen sie zu tragen vermögen.«
Zur nämlichen Zeit, als in der reichen Campagne am Genfersee mit so schwerem Leid gerungen wurde, ward ein verwandter Leidenskampf auch an einem fernen Meeresstrande gekämpft; aber dort war der Schauplatz eine unscheinbare Fischerwohnung, die unfern der französischen Hafenstadt Toulon auf einer kleinen Anhöhe lag. In der ärmlichen, doch saubern Stube dieser Hütte saß eine bleiche Frauengestalt, deren jugendliche Schönheit Kummer und Herzeleid trotz ihrer verheerenden Spuren noch nicht gänzlich zu verdunkeln vermocht hatten, und deren erster Anblick deutlich genug zeigte, daß sie schon bessere Tage gesehen. Sie schaute gedankenvoll durch das kleine Fenster auf das im Abendscheine auffunkelnde Meer und wendete den Blick von dem ergreifenden Schauspiele nur ab, um ihn dann und wann nach einem kleinen Bettchen zu richten, das zu ihrer Rechten an der Wand stand. Unter der Decke dieses Bettchens wurde ein kleines Kinderantlitz sichtbar, das, im Hauche süßen Schlummers erblühend, noch von keinem Leid und keiner Sorge wußte.
Es mußten dunkle, traurige Bilder sein, die vor den träumerischen Blicken der einsamen Frau aus der goldschimmernden Meeresfluth emportauchten, da unter ihren langschattigen Wimpern hervor von Zeit zu Zeit eine Thräne blinkte, die langsam über die bleiche Wange herabfloß, begleitet von Seufzern, die unwillkürlich der kummerbedrückten Brust entstiegen. Thränen und Seufzer galten der verlornen Heimath, einem schwankenden Liebesglück und einer Zukunft, die von sternenloser Nacht umhüllt schien. Denn die Arme hatte ja ihr reiches Heimathsglück einer Liebe geopfert, die nun schon von der Qual nagenden Zweifels erschüttert war.
Als Sophie, die Tochter des reichen Heimstädter Kaufherrn in jener bangen Nacht dem bedrohten Geliebten zur Flucht aus dem väterlichen Hause verholfen, hatten die Beiden Verabredung getroffen, wo sie einander wiederfinden könnten, wenn es ihr nicht gelingen sollte, den Zorn des Vaters zu versöhnen. Statt daß sie dies, freilich hoffnungslose Ziel erreicht, entfloh sie ebenfalls aus der Heimath, von der furchtbaren Last des väterlichen Fluches niedergedrückt, aber von der Alles besiegenden Kraft einer hoffnungsvollen Liebe aufrecht gehalten. Da den Flüchtigen keine Nachstellungen folgten, wurde es dem lebensgewandten Hauptmanne nicht schwer, sich unter angenommenem Namen die Mittel zu einem unangefochtenen Aufenthalte in Frankreich zu verschaffen, und bald war auch Sophie auf ihr Andrängen ihm bürgerlich angetraut. Nicht lange, nachdem das junge Paar die Gegend von Straßburg verlassen, wurde sie des Glückes und der Schmerzen einer Mutter theilhaftig, indem sie eines lieblichen Mädchens genas. Wie sehnlich wünschte sie, dieses Ereigniß zu benützen, um noch einmal bei dem Vater um Versöhnung anzuflehen; aber der Hauptmann sträubte sich dagegen, aus Furcht, daß ihm die Entdeckung seines Aufenthaltes doch noch nachträgliche Verfolgung zuziehen könnte, und – die junge Mutter kannte noch keinen stärkern Wunsch, als ihrem Gatten zu Willen zu leben.
Aber dieses schöne Verhältniß veränderte und umdüsterte sich. Sophie hatte das unstäte, oft finstere Wesen, das der Hauptmann seit ihrem Beisammenleben gezeigt, begreiflich und leicht verzeihlich gefunden; denn ach, sie wußte ja am Besten, wie es in ihrem eigenen Innern aussah; aber von der Zeit an, wo die Mittel, welche sie als ihr Eigenthum aus dem väterlichen Hause mitgebracht, zu schwinden begannen, da glaubte sie wahrnehmen zu müssen, daß ihr Gatte kälter, unfreundlicher gegen sie wurde. Sie selbst, die nie etwas von dem Kampfe mit des Lebens Nothdurft gewußt, machte sich auch jetzt noch über die Mittel zu ihrem nöthigsten Unterhalte keine allzu schweren Sorgen; denn durfte sie sich auch nicht an den Vater wenden, so stand noch ein liebevoller Bruder im Hinterhalte, der sie nie gänzlich verlassen würde. Die Arme wußte nicht, daß dieser Helfer in der Noth schon lange im tiefen Meeresgrunde versenkt lag und konnte deshalb sich immer noch an der auf ihn gebauten Hoffnung festhalten; aber daß ihr Gatte sie nun schon Tage lang allein lassen konnte, ohne bei der Heimkehr sich um ihr Ergehen zu erkundigen, oder dem kleinen Engel in der Wiege ein freundlich begrüßendes Lächeln zu gönnen, das fing an, ihr Herz wie mit einer kalten, eisigen Hand zusammenzupressen. Das Unheil war in dieser unheimlichen Gestalt mit einer Bekanntschaft gekommen, die der Hauptmann mit einem jungen Herrn angeknüpft hatte, der noch im Jünglingsalter zu stehen schien; aber trotz dieses Altersunterschiedes waren die Beiden bald unzertrennlich, und der armen, einsamen Frau kam es vor, als ob ihre Liebe dieser Freundschaft gänzlich zum Opfer fallen müsse. Ihre leise Klage suchte der Gatte mit dem Troste zu beschwichtigen, daß sein Freund einer einflußreichen Familie angehöre und im Stande sei, ihm zu einer neuen gesicherten Lebensstellung den Weg zu ebnen. Und wirklich, eines Tages kam er mit der Nachricht nach Hause, daß sie unverweilt nach Toulon abreisen müßten, sein Freund habe ihm eine Offiziersstelle in der afrikanischen Fremdenlegion ausgewirkt.
Bei dieser Mittheilung schossen der armen, jungen Frau die Thränen in die Augen, als ob man ihr den Tod eines liebsten Wesens gemeldet hätte. Aus den hundertfach sich kreuzenden, unheimlichen Vorstellungen, die sich an den Gedanken eines so wild bewegten Lebens jenseits des Meeres knüpften, tauchte die Erinnerung an jenen Abend auf, wo sie aus voller Ueberzeugung dem Geliebten das Unwürdige eines solchen Solddienstes siegreich entgegengehalten. Aber jetzt? die Unmöglichkeit, die nämlichen Ansichten und Empfindungen, wie damals, geltend machen zu können, zeigte ihr in schmerzlichem Lichte die traurige Lage, auf welche sie, innerlich und äußerlich, herabgesunken war. Deshalb wiederholte sie die Bitte, nochmals einen Versöhnungsversuch in der Heimath wagen zu dürfen; aber mit finsterm Blicke erwiderte er: »Wie lange wird es noch gehen, bis du begreifst, daß du mein Weib bist, und für einmal nichts Anderes sein darfst!« –
Schon am folgenden Tage wurde die Reise nach Toulon in Gesellschaft des Freundes und Protektors des Hauptmannes angetreten – für die arme Frau eine trübere, bangere Fahrt, als es selbst die Flucht aus dem Vaterhause gewesen war. So oft sie ihren Begleiter nur ansah, ging ihr ein Stich durchs Herz, ohne daß sie sich über den Grund einer solchen Abneigung irgendwie klar zu werden vermochte. Sie mußte sich's selbst gestehen, daß es ein hübscher, junger Mann war, mit einem feinen, nur zu mädchenhaften Gesichte; aber wenn sein Blick auf ihr ruhte, dann wagte sie kaum aufzuschauen; es lag etwas Tückisches, Höhnisches darin, das ihr durch die Seele schnitt. Die Stimmung des Hauptmannes selbst war eine unstäte, beängstigende. Waren die beiden Gatten allein, so schien eine ungestüme Zärtlichkeit hervorbrechen zu wollen; aber blos um vor den Augen Anderer einer düstern Gleichgültigkeit Platz zu machen. Nur die stillen Nächte und Derjenige, dessen Auge von keiner Nacht verschleiert wird, haben die Thränen gezählt, welche die bekümmerte Mutter auf dieser Reise geweint hat. –
In Toulon angekommen, miethete der Hauptmann sogleich die kleine Wohnung auf der Anhöhe vor der Stadt. Hier mußte noch einige Zeit verbracht werden, bis die Equipirung vollendet, überhaupt die Abfahrt nach Algerien vor sich gehen konnte. Zur Aufbringung der Ausrüstungskosten hatte Sophie die letzten Schmuckgegenstände hergegeben, welche ihr noch geblieben, und zur Betreibung dieser Angelegenheit war der Hauptmann nun schon drei Tage in der Stadt abwesend, ohne einmal nach Weib und Kind gesehen zu haben. Beim Abschiede hatte er einen solchen Aufenthalt zwar vorausgesehen, und war tief bewegt gewesen; aber nun lastete die Einsamkeit doch mit erstickendem Drucke auf der Verlassenen, und ihr war es, sie möchte mit ihrem Kinde tief im Meere untersinken, wie die Sonne, die eben jetzt blutroth in die Fluthen niedersank.
Da ließen sich vor der kleinen Thüre Schritte vernehmen. Die Einsame fuhr aus ihren dunkeln Träumen mit dem Rufe »endlich kommt er« empor, und eilte der Thüre zu; aber dem Ausrufe hoffnungsvoller Erwartung folgte ein mühsam unterdrückter Ausruf schmerzlicher Enttäuschung, als vor ihr ein Mann im Matrosenkleide stand. Er schaute der bleichen Frau in das erschrockene Antlitz, zog ein versiegeltes Blatt hervor und sagte, indem er es ihr überreichte: »Ja, hier werd' ich am rechten Orte sein.« Dann wendete er sich grüßend ab und ging seines Weges.
Es flog wieder ein Strahl der Hoffnung über das Gesicht der Unglücklichen, da sie auf dem empfangenen Briefe die Hand ihres Gatten erkannte; aber kaum hatte sie zitternd das Siegel erbrochen und die ersten Zeilen durchflogen, als sie mit dem leisen Ausrufe: »O mein Herz!« bewußtlos an der noch geöffneten Thüre zusammensank. –
Der erste Laut, der wieder in die tiefe Umnachtung ihrer Sinne drang, war das klägliche Wimmern ihres Kindes. Als sie die Augen aufschlug, erkannte sie bei'm spärlichen Schimmer einer Lampe das Stübchen, in dem sie die letzten Tage zugebracht hatte. Neben dem Bette, auf dem sie lag, saß eine alte Frau, das Kind auf den Armen haltend und bemüht, das Weinende durch leisen Gesang wieder einzuschläfern. »Dem Himmel sei Dank,« rief die Alte, das Erwachen der Mutter bemerkend; »ich fürchte, Ihr seid sehr krank geworden, liebe Frau. Als ich vorhin in der Dämmerung da vorbeiging, laget Ihr ohnmächtig an der offenen Thüre und seht nur, neben Euch diese zwei prächtigen Goldringe, die Euch entfallen sein müssen. So hab' ich denn Euch aufgehoben und zu Bette gebracht, in der Hoffnung, es werde wohl noch sonst Jemand zu Hülfe kommen, bis nun auch die liebe Kleine da laut geworden ist.« Die Kranke streckte die Arme nach dem Kinde aus, schloß die Augen noch einmal und fragte dann, nach einer Weile sie wieder aufschlagend, ängstlich: »Und der Brief – oder ist das nur ein schrecklicher Traum gewesen?« – »Nein, nein,« erwiderte das alte Weib, »da lag auch noch dieses Papier; es wird der Brief sein – lesen kann ich nicht, gute Frau. Aber wenn Ihr sonst Niemand habt, will ich gerne diese Nacht bei Euch bleiben, zu versäumen hab' ich nichts.«
Die Arme nickte leise zum Danke und bald kam der kummererlösende Schlaf gegangen, um die Erschöpfte mit ihrem Kinde in seinen Frieden aufzunehmen. –
Am folgenden Morgen zog sie, bevor sie sich zu erheben wagte, das unglückselige Blatt unter dem Kopfkissen hervor und las langsam, als ob sie noch immer den eigenen Augen nicht trauen dürfe, folgende Worte:
»Meine arme Sophie! Wenn Dir diese Zeilen zu Gesichte kommen, bin ich für immer aus Deinen Augen entschwunden; aber ich kann nicht von Dir scheiden, ohne mein Gewissen wenigstens durch ein offenes Bekenntniß meiner Schuld zu erleichtern. Dieses Bekenntniß wird Dir das Unvermeidliche leichter ertragen helfen.
Ja, ich habe schwer gesündigt an Dir, mein armes Weib, und ich wage nicht Deine Verzeihung anzurufen; aber wenn Dein Herz nur den geringsten Theil meiner Schuld von mir abwälzen und der Gewalt unseliger Verhältnisse zur Last legen möchte, so mein' ich, ich müßte meine Wege durch die umnachtete Zukunft leichter finden können.
Ich gehe nicht als Offizier nach Algerien, wie ich Dich glauben machte; ich verlasse Europa, um den Nachforschungen einer Unglücklichen zu entgehen, mit der ich einst nicht weniger enge als mit Dir verbunden war, und die meine Spuren nun aufgefunden. Ich glaube, es sei dies durch den Verrath des Menschen geschehen, den Du in letzter Zeit unter dem Namen und Schein eines Freundes kennen gelernt, und vor dem Dein ahnungsvolles Gemüth sich vom ersten Augenblicke an schaudernd abgewendet. Dieser angebliche Freund – meine Hand zittert, aber ich muß Dir Alles bekennen – ist ein – Weib, der böse Dämon meines Lebens, von dem ich nicht lassen kann, weil sie die Mitwisserin meiner Vergehen ist. Um mich von ihr zu befreien, habe ich das Vertrauen und den Kredit Deines Vaters mißbraucht; aber die böse That hat mir auch nur böse Frucht getragen. Die Unselige verließ zwar Heimstädt, bis wohin sie mich verfolgt hatte, doch nur um mich wieder aufzusuchen, sobald der ihr zugewendete Sold meines Verbrechens verschleudert war. Um mich von Dir zu trennen, hat sie der mir früher heimlich angetrauten Leonie meinen Aufenthalt und meine Verbindung mit Dir verrathen, wohl wissend, daß ich dadurch ihrer Gewalt gänzlich anheimfallen mußte.
So gehe ich nun, ausgestoßen von meiner Heimath und von den bürgerlichen und sittlichen Gesetzen eines ganzen Welttheiles vervehmt, über das Meer, um auf fremder Erde ein Grab zu suchen. Wenn Du Dein Loos beklagst, so habe ich wenigstens den Trost, daß Du jetzt von meinem unseligen Schicksale losgekettet bist, und statt meiner trügerischen Stütze wieder in den sichern Schutz Deiner Aeltern zurückkehren wirst. Lebe wohl, und der Himmel helfe Dir bald vergessen Deinen unglücklichen
Eugen.«
Eine Weile noch blieb die Beklagenswerthe regungslos liegen, nachdem sie diesen Brief zu Ende gelesen; dann erhob sie sich, ohne eine Klage laut werden zu lassen, bat die gute Alte, welche die Nacht bei ihr gewacht, sie nach der Stadt zu begleiten und verließ das Häuschen, ihr Kind auf den Armen tragend.
Ueber der Villa am Genfersee lag einer jener wunderbar klaren Herbsttage, die mit ihrer milden Schönheit unser Gemüth wie eine Ahnung ewigen Friedens umwehen. Am ruhigen Silberspiegel des Sees schienen die besonnten Ufer in die stille Betrachtung ihrer Abbilder verloren und die blauen Berge traten dem Auge so nahe, als ob sie sehnsüchtig in die fruchtschwellenden Thäler herausrücken möchten. Ein solcher Herbsttag ist der Sabbath, den die Natur nach segensreicher Arbeit in heiliger Feierlichkeit begeht.
Ein Strahl dieser versöhnenden Feierlichkeit war selbst in das umdüsterte Gemüth des alten Kaufherrn gedrungen und hatte den herben Seelenschmerz zur milden Wehmuth aufgelöst. »Ich weiß nicht, wie mir's werden will,« sagte er, »mir ist's, als ob ich aus weiter Ferne den Gesang der Seligen erklingen höre. Es weht mich etwas an und will mir zuflüstern, ich könne bald zur Ruhe eingehen.«
Betroffen über solch ungewohnte Rede schaute ihn die Gattin besorgt an und forschte, wie er zu so traurigen Todesgedanken komme. »Nein, nein,« erwiderte er, »es sind nicht traurige Gedanken, noch weniger denk' ich an den Tod und nahes Sterben. Mir ist's vielmehr, als könnt' ich doch noch einmal wieder aufleben, oder aufwachen aus schweren Träumen zum lichten, frischen Morgenroth.«
»Das möge Gott walten,« seufzte die Gattin, noch immer ungewiß, ob sie sich dieser seltsamen Stimmung freuen dürfe, oder ob dieselbe nicht eher das Abendroth einer anbrechenden Geistesnacht sei. »Komm', gib mir den Arm,« fuhr er nach einer Weile fort, »wir wollen zu unsern Kindern hinübergehen; ich glaube, sie warten schon lange auf uns.«
Sie stiegen miteinander die Treppe hinunter und gingen langsam den Park entlang. »Siehst du,« sagte er, an einer Baumgruppe stehen bleibend, zwischen welcher ein hundertfach gebrochener Sonnenschein niederspielte; »die Natur weiß selbst Tod und Vergehen ihrer Kinder in rührende Schönheit und erhebenden Trost zu verwandeln; oder ist dir der Laubschmuck dieser Bäume jemals schöner erschienen als jetzt, wo er sich in ungezähltem Farbenspiel zu seinem Todesgang bereitet? Warum muß denn Tod und Vergehen nur dem Menschen in so düstrer, herber Gestalt entgegentreten?«
»Das geschieht auch nicht,« erwiderte sie, »sobald der Mensch über den Augenblick hinaus, an die Unendlichkeit göttlicher Liebe und Gnade denkt und glaubt.«
»Die Unendlichkeit göttlicher Gnade,« sagte er leise, »ja das ist ein schöner, erhebender Gedanke.«
So waren die Beiden an die Pforte des einsamen Gottesackers gekommen, als sie zu ihrer Verwunderung eine dunkle Gestalt auf den Gräbern ihrer Kinder erblickten. Es war ein Frauenbild, das auf den Knien lag und das Haupt, wie schlafend, an den Grabstein lehnte. Neben ihr lag im Grase ein kleines Kind, das ebenfalls eingeschlummert sein mußte. »Ich glaube, da thut Hülfe noth,« sagte der alte Kaufherr, rasch vor seiner zögernden Gattin hertretend; aber kaum war er an das Grab gelangt, als er mit einem lauten Aufschrei zu Boden sank. Tief erschreckt eilte ihm die Gattin nach, doch nur, um wie vom Schlage getroffen ebenfalls neben ihm niederzusinken. »Sophie, mein armes, verlorenes Kind,« rief sie mit herzerschütternder Stimme, »soll ich dich nur todt bei den Todten wiederfinden?« – Doch der Klageruf der Mutter mußte an das Kindesherz gedrungen sein; denn die Todtgeglaubte öffnete die Augen und sagte um sich blickend mit matter Stimme: »Seid ihr mir alle vorangegangen, o Vater und Mutter, aus dieser Leidenswelt?« – »Sie lebt, sie lebt,« rief der Vater vor Schmerz und Seligkeit bebend; »o ewige Barmherzigkeit, du bist kein leerer Schall und willst dich mächtig erweisen an mir. Meine Kinder sind nach Gottes Rathschluß gestorben, mein Fluch hat sie nicht in's Grab gebracht, sonst könnte mir das Eine nicht gerettet sein!« –
Schon nach einer Viertelstunde lag die Wiedergefundene auf schwellenden Kissen in der Campagne, von der seligen Sorgfalt ihrer Aeltern umgeben. An der Mutterbrust lächelte das Kleine so vergnügt, als ob sein ahnendes Gemüth das ihm widerfahrene Heil begriffen hätte. –
Die arme Sophie hatte weder von dem Tode ihrer Geschwister noch von dem neuen Aufenthalte ihrer Aeltern etwas gewußt. Von Lyon über Genf heimkehrend, hatte sie mit dem Reste ihres Geldes die Fahrt bis Ouchy gemacht, und schlug von dort den Weg durch die Campagnen ein, um nicht durch die lärmende Stadt gehen zu müssen. Sie kam an den einsamen Gottesacker, trat zu einem stillen Gebete ein und fand den Stein, dessen ausführliche Inschriften ihr sagten, daß sie auf den Gräbern ihrer Schwestern stehe. Von tödtlichem Schmerze überwältigt sank sie bewußtlos nieder, um, in den Armen ihrer Aeltern erwachend, sich bereits in eine bessere Welt eingegangen zu wähnen. –
In der Campagne zog mit ihrer Heimkehr zwar nicht die laute Freude ein, welche viele Menschen als den einzigen Ausdruck des Glückes kennen; wohl aber jene heitere Ruhe, welche aus dem Bewußtsein gesühnter Irrungen und der Ergebung in den Willen des Allvaters entspringt. Der alte Kaufherr erwachte, von dem dunkeln Banne, der auf ihm gelastet, erlöst, in der That wieder zu neuem Leben; ein Wort des Zornes aber ist nie mehr über seine Lippen gekommen. –