
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
![]()
 on Bielefeld streift der Rücken des Osnings in grader Richtung gen Nordwesten
Korrektur zur Übertragung in den E-Text: Im Original heißt es "Nordosten". Der Einsender.
, bis er mit seiner letzten Höhe, bei Bevergern, auf den Spiegel der Emse niederblickt. Nach dieser Begrüßung mit dem friedlichen Strome, der so still, so kampflos, so sanft auch den geringsten Exceß, den er etwa in einem kleinen Hader mit einer vordringlichen Felskante begehen könnte, vermeidet, der sich nie zu einer wenn auch noch so unbedeutenden Stromschnelle aufrafft – nach dieser Begrüßung mit dem Urbild träger Friedlichkeit scheint über den »heiligen Berg« der Lebensüberdruß zu kommen. Die öden Breiten, in welche er gelangt ist, sind ganz darnach angethan, hier dem Leben Abschied zu sagen, und der heilige Berg wird zu einem niedern sandigen Todtenhügel. –
on Bielefeld streift der Rücken des Osnings in grader Richtung gen Nordwesten
Korrektur zur Übertragung in den E-Text: Im Original heißt es "Nordosten". Der Einsender.
, bis er mit seiner letzten Höhe, bei Bevergern, auf den Spiegel der Emse niederblickt. Nach dieser Begrüßung mit dem friedlichen Strome, der so still, so kampflos, so sanft auch den geringsten Exceß, den er etwa in einem kleinen Hader mit einer vordringlichen Felskante begehen könnte, vermeidet, der sich nie zu einer wenn auch noch so unbedeutenden Stromschnelle aufrafft – nach dieser Begrüßung mit dem Urbild träger Friedlichkeit scheint über den »heiligen Berg« der Lebensüberdruß zu kommen. Die öden Breiten, in welche er gelangt ist, sind ganz darnach angethan, hier dem Leben Abschied zu sagen, und der heilige Berg wird zu einem niedern sandigen Todtenhügel. –
Folgen wir ihm auf diesem seinem letzten Gange; er wird uns das Ehrengeleit, das wir ihm geben, nicht ungelohnt lassen.

Der erste Punkt, an dem wir dabei Halt machen, ist der Ravensberg. Unsere Abbildung zeigt seine Gestalt, seine zerfallenen Burggemäuer, seinen Belfried, der noch stark und trotzig in die Lande schaut. Der Ravensberg ist eine steile nach Südwesten sich richtende Vorhöhe des Bärenbergs, der mit seiner Waldkrone etwa die Mitte des Osnings bezeichnen mag, an die hohen Eggen von Werther und Halle sich reiht, und durch mannigfach gekreuzte Hügelreihen mit dem Zuge des Wiehengebirgs verbunden ist, der im Nordosten unseres Standpunkts von Minden her fast ganz westlich gen Osnabrück sich dehnt.
Oben auf dem Ravensberge die graue Warte, die Trümmer der festen Burgmauer, das Thor, den tiefen Brunnen in der Nähe beschauen zu können, ist für das mühsame Erklimmen der Höhe kein so großer Lohn, wie der Ausblick, den sie auf das beherrschte Land zu ihren Füßen bietet. Aus der Reihe der Berge vortretend, macht sie die Halden des Osnings rechts und links weithin überschaubar, und zeigt das Land von den Süderländischen Höhen bis nach Iburg hin, in der westlichen Ferne Westphalens Ebenen mit ihren Waldungen, Gehöften, Städten und Fluren, in der Nähe die rothen Dächer der Oerter Halle, Borgholzhausen, Dissen und wie sie alle heißen, die besonnten Dörfer, Meiereien und Güter da unten. Man sieht keine wildgrandiose oder pittoreske Romantik, keine in unermeßliche Höhen aufgethürmten Bergcolosse, keine nackten Felsungeheuer mit schäumenden Bachstürzen – die Berge haben Raum hier, in anmuthigen Formen sich zu dehnen: aber großartig genug ist die Gegend, um einen mehr als idyllischen Eindruck zu machen, das Gebirge gewaltig genug, um durch seine dichtbewaldeten Massen zu imponiren.
Die Volkssage macht den Ravensberg zu einem ursprünglich Römischen Castell, dessen Wahrzeichen, der Adler, den alten Deutschen, die solch Gethier nicht gekannt, ein Rabe geschienen und der Burg den Namen gebracht habe. Man leitet in Uebereinstimmung damit den Namen des in einem enggeschlossenen Thale am Fuße des Ravensbergs liegenden Dorfes Cleve von clivus ab, gleich dem der Stadt am Niederrhein. Ehemals soll auch unser Cleve eine bedeutende Stadt gewesen sein. Eine schon erwähnte andere Sage läßt einen alten Sachsenfürsten im Lande am Osning seinen drei Töchtern Ida, Teckla und Ravena als Ausstattung drei Burgen, Iburg, Tecklenburg und Ravensberg schenken. Jedenfalls ist der Ravensberg eine sehr alte Feste. Die heil. Thiathilde urkundet schon um 851 dem Kloster Freckenhorst den Zehnten zu »Ravensburg«. Zum zweitenmal geschieht ihrer Erwähnung in der Legende vom heiligen Bischof Bernward von Hildesheim; das Gebet zu diesem Heiligen ließ einen Ritter Odalrich, der auf dem Ravensberge im Burgverließe schmachtete, leicht und mühelos seine Ketten abstreifen und den Pfad in die Freiheit finden, daß er nach Hildesheim pilgern und seine Fesseln am Grabe des Bischofs aufhängen konnte. Die ältesten Besitzer von Ravensberg, welche die Geschichte kennt, treten bei ihrem ersten Erscheinen als mächtige Dynasten auf: sie heißen Hermann I. und II. von Calvelage (ein Hof zwischen Melle und Gesmold); und den Glanz und das Ansehn ihres Geschlechts bezeugt Hermann's I. Vermählung mit Edelinde, der Witwe Herzog Welf's von Bayern, der Tochter Otto's von Nordheim; der zweite Hermann war Vetter und Vertrauter Kaiser Lothar's von Sachsen. Dieses Hermann Enkel, Otto und Heinrich, werden zuerst Grafen von Ravensberg genannt, und von nun an wird der Name häufig in allen Fehden und Händeln der Zeit. Im vierzehnten Jahrhundert erlosch der Mannsstamm der Grafen von Calvelage mit Bernhard, dessen Erbin Margaretha, die Tochter seines Bruders Otto IV., Gemahlin des Herzogs Gerhard von Jülich war, den Kaiser Ludwig der Bayer 1346 zu Frankfurt am Main mit den sämmtlichen Besitzungen der Ravensberger Dynastie belehnte. Die fernere Geschichte der Herren vom Ravensberge fällt nun mit der Jülich-Cleve-Berg's zusammen. Die Burg aber wurde, nachdem Bischof Bernhard von Galen den Ravensberg als die Feste seines Feindes, des großen Kurfürsten, der Erbe dieses Theils der Jülischen Lande geworden war, hatte beschießen lassen, so unwirthlich, daß nun auch der Droste, der sie bisher inne gehabt, herunterzog und sie dem gänzlichen Verfalle überließ; doch hat eine Zinkbedachung und ein Kranz von Kragsteinen der weitern Zerstörung des Belfried jetzt Einhalt gethan. Werfen wir noch einen Blick auf das Panorama unter uns hinab, ehe auch wir die Höhe verlassen. Da unten in dem Thale gen Norden, wo Borgholzhausen liegt, soll einst in düstren Bergeswaldungen des Tacitus Tanfanæ templum, celeberrimum illis gentibus, wie der Römer sagt, sich befunden haben. Noch jetzt will man als Benennung der Stelle das Wort »Dämpfanne« von den Landleuten vernehmen, obwohl kritische Köpfe sagen, dies Wort bedeute nur eine Lache, aus der man Feuersbrünste gelöscht. Daß man Opfergefäße und alte Waffenstücke hier auffand (noch im Herbste 1838 zwei Opferschalen von seltener Schönheit) ist gewiß: über die Göttin Tanfana und ihr Heiligthum aber fehlen uns alle nähern Angaben, als die des Tacitus, daß es bei den Marsen gewesen, und dieses Volkes Wohnsitz suchten wir früher am Eggegebirge. Wir können uns aber immerhin einen alten Tempel in den Gehölzen von Borgholzhausen wieder aufbauen, den Alach, wie der Sachsen Ausdruck war, aus seinen grobgeschnittenen Holzsäulen in einander fügen und die Balkendecke schützend über das Wih, das Heiligthum, legen, um zwischen mystisch dunklem Gewände von der sonderbaren, so rohen und doch so tiefes Gemüth hegenden Vorzeit zu träumen und ihren Wundern nachzusinnen. Denn mag man die Wunder der Legende für eine schöne Poesie und nichts anders halten, die Wunder der Geschichte bleiben, und ist es nicht eines ihrer größten Wunder, daß dort vor uns der bemooste Dorfthurm hoch empor das siegende Kreuzeszeichen über der Tanfana Gauen trägt, – daß, wenn sein Geläute über die Strohdächer der Wohnungen umher tönt, um den aufdämmernden Sonntag zu begrüßen, der Schall zusammenrinnt mit Nachbarklängen, soweit bis gen Süd und Nord das Rauschen des Meeres sie verzehrt? Die Germanische Waldesnacht ihrer grandiosen Traumgebilde zu berauben; den in dieser Nacht Träumenden Vorstellungen, die ihrem Gemüth heilig, ihrem Bildungsstand angemessen waren, die sich bei ihnen in keiner Weise überlebt hatten, zu nehmen und ihnen das Christenthum zu geben, ehe sie geweckt werden konnten an's Tageslicht der Cultur, – war es nicht ein wunderbares Vollbringen?
Um das Gewaltsame des plötzlichen Uebergangs, dies unvermittelte Ueberschlagen von einem Gegensatze zum andern, wie mit einem Schlage die in der Wüste rufende Stimme des neuen Lebensprincips es bewirkte, zu versinnlichen, rufen wir uns nur zwei Gestalten wach, beide edle Germanische Frauen, beide im Dienste ihres Gottes stehend, nur durch wenige Jahrhunderte von einander getrennt, – und doch, welcher schreiende Contrast! Die eine ist Priesterin, der Tanfana etwa, oder einer andren Gottheit, der Irmensul z. B., wie wir sie oben kennen lernten. Sie folgt den Männern in den Kampf, sie steht im linnenen Gewande, mit ehernem Gürtel, mit nacktem Fuße auf der Wagenburg, das gewaltige Reckenweib, sie schwingt ein Schwert wie eine haarflatternde Walkyre der Schlacht. Da wird ein Gefangener ihr gebracht, sie schlingt einen Kranz um sein Haupt, einen Strick um seine Brust; behende fliegt sie eine Leiter hinan, zieht das Opfer sich nach und durchschneidet ihm die Gurgel, um aus dem Blute, das in den ehernen Kessel unten hinabströmt, die Weissagungen des Schlachtenglücks zu schöpfen! (Vgl. Strabo, lib. VII.)
Die andre erzieht das Kloster zu Herford, sie wird das Weib eines sächsischen Edlen, sie gebiert ihm zwei starke Söhne, wird Witwe, schafft dann die Burg, worauf ihr Gemahl gestorben ist, zum Kloster um, und dann seht ihr sie im Dienste ihres Gottes thätig, rastlos und keine Ermüdung kennend, von Sonnenauf- bis zum Niedergang. Sie speist, sie tränkt, sie kleidet die Schaaren der Armen, welche von Nah und Fern zu ihr strömen; sie redet Trost den Unglücklichen ein, sie glättet mit der weichen Hand der Liebe die Falte des Gram's auf jeder Stirne, wie ein warmer Hauch thaut ihr Wort jedes Herz auf, das eisig geworden ist in kaltem Leide. Und wenn sie Alle durchwärmt, beruhigt, in frommer Entsagung oder gestärkter Hoffnung froh, von sich gesandt hat, wenn die Sonne zur Rüste, ihre Schwestern zum Schlafe gegangen sind, dann lauscht sie, bis der letzte Schritt im Kreuzgange verklungen ist, schleicht sacht, daß Keiner sie erspähe, in die Kirche und kniet zum Gebete nieder, das die Nacht überdauert. Es ist eine doppelt geweihte Stätte dann, die Klosterkirche, worin sie niederkniet, und betet beim Lichte der ewigen Lampe, deren flackernder Schein auf die Pergamentblätter und buntglänzenden Malereien ihres Psalters, auf die weißen, von Kälte verklommenen Hände fällt, mit denen sie eifrig die Blätter umwendet; es ist ein Heiliges über die schlichte Matronengestalt ausgegossen; ihr könntet glauben, allein von ihrer hohen glatten Stirne gehe der milde gelbzitternde Lichtschein aus, der auf den goldenen Miniaturen ihres Buches liegt, sich ermattet in den Falten des schwarzen, mit schneeigem Hermelin gefütterten Mantels fängt, aus der Dunkelheit der Kirche aber nur noch die Schattengespenster der Pfeiler und Statuen zu wecken vermag, daß verriesigt Sankt Laurentius' Rost und Sankt Katharina's zerbrochenes Rad an den Wänden ineinander übergehen und verschwimmen.
Und wer ist, fragt ihr, diese nächtige Beterin, die auf den kalten Steinen der Klosterkirche zu Memleben liegt? Es ist eine Kaiserin, das Weib Heinrich's des Finklers, die Mutter Otto's des Großen, die heilige Mathilde. Sie könnte in dem ganzen Glanze sich sonnen, den ihr starker Sohn über das Germanische Kaiserthum leuchten läßt, aber sie zieht vor, den Tag über für die Armen, die Nacht hindurch für das Gebet zu leben. Sie läßt ihre Güter sich entreißen, weil man sie bei ihren Söhnen beschuldigt hat, daß sie alles in Almosen verschleudere, und zieht sich in das einsame Enger zurück, die Grabeshüterin ihres Ahnherrn Wittekind zu werden; als endlich der Tod den liebsten ihrer Söhne, Heinrich, den sein Bruder über Bayern zum Herzoge gesetzt hatte, ihr entreißt, da wirft sie in unendlichem Leide die Stirnbinde und alles, was an den Kaiserlichen Purpur sie erinnert, auf den Boden, und flieht vor ihrem Schmerze in das Wohl, das sie den Leidenden, den Darbenden bereitet. (S. Strunck, Westph. Sancta.)
Hat der innig fromme Geist des Mittelalters, hat der warme Hauch der Liebe, der Duft der Blüthe am Weltenbaume der christlichen Idee, hat die Kraft der Entsagung, die der Glaube gibt, je einen schöneren, einen begeisterndern Ausdruck gefunden, als in dieser heiligen Frau? Und dagegen, die ganze rohe Gewaltsamkeit, die verhärtende starre Idee des Heidenthums, wo tritt sie besser verkörpert, wo schreckenerregender auf, als in jenem blutigen Haarflatternden Reckenweibe, das Strabo beschreibt? Sie schneidet dem Gefangenen die Kehle ab, und damit uns wie eine grinsende Ironie alle Poesie entzwei, die wir uns in die alten Eichenhaine der Germanischen Urwelt träumen.

Pilgern wir weiter, oben über den Kamm unsrer Berge, dem von seiner Höhe lockenden Iburg zu. Gen Süd und Nord bleibt uns der Blick über die weite Ebene links, über das schöne hügelichte Land rechts dann unbeschränkt. Im Süden lassen wir Tatenhausen, den freundlichen Badeort mit seinen Anlagen und ansehnlichem Herrnhause, der Sommerresidenz der Grafen Korff genannt Schmising, unfern davon Stockkämpen, das stille Dörflein mit dem Grabe Fr. L. von Stolberg's; sodann das bekanntere und besuchtere Salzbad Rothenfelde: nördlich und nordöstlich liegt die reichbebaute anmuthige Gegend von Gesmold, dem Dorfe, in dessen Nähe aus einer und derselben Quelle die zur Ems strömende Hase und die Weserwärts fließende kleinere Elze entstehen. Das letztere Flüßchen windet sich an dem Städtchen Melle vorbei, das eine der freundlichsten Gegenden Westphalens belebt, und wo gefällige Landschaftsbilder nach Ostenwalde, dem einsamen Sitze Georg's von Vincke, oder auf die Dietrichsburg (eine Tannenbewaldete Höhe, welche die Burg eines verschollenen Nachkommen Wittekinds und Vaters der Kaiserin Mathilde, von der wir eben sprachen, des Grafen Dietrich, gekrönt haben soll) locken würden. Aber wir müssen eilen, denn der Tag wird sich senken, ehe wir über unsere unwegsamen Halden Iburg erreicht haben, den schönsten Punkt unserer ganzen Wanderschaft durch diesen Theil Westphalens. Wir wollen die Dämmerung in seinem Rittersaale verträumen, wo die Bilder starker Männer uns wie Herolde vergangener Tage, verklungener Thaten anlugen werden aus ihren düstren Rahmen und Cartouchen, von den bestäubten Wänden herab: in der weiten Halle, die uns wie eine Scene aus einem Romane des großen Schotten umfängt. Wir wollen dort, wenn es Abend wird, in Benno's Züge blicken, in das blasse wehmüthige Antlitz des treuen vielduldenden Mannes. Bischof Benno ist eine der interessantesten Erscheinungen unserer Geschichte. Schön, geistreich, gelehrt, das ganze Wissen der Zeit mit den seltneren Künsten und Kenntnissen der Technik verbindend, von den Frauen verehrt, band ihn wohl mehr die Dankbarkeit als die Sympathie seines Charakters an Heinrich IV., der ihn zum Ordner seines Haushalts und Aufseher über die Kaiserlichen Bauten ernannte und später auf den Bischöflichen Stuhl von Osnabrück erhob: von da ab blieb Benno II. der treueste Genosse seines Kaiserlichen Freundes, und theilte mit ihm die schwere Last des Päpstlichen Zornes. Gregor VII. entsetzte auch Benno seiner Würden: wie er darauf das Schicksal seines Kaisers theilte, seine Flucht von der Harzburg nach Eschwege u. s. w. hat Broxtermann, ein früh gestorbner begabter Dichter Osnabrück's, in seinem Gedichte: »Bischof Benno« geschildert.
Er erzählt, wie eine Hütte auf öder Haide den in Bettlertracht vermummten Bischof verborgen habe:
Der unglücksel'ge Benno! wer ihn sieht,
Verhöhnt ihn, denn in Bettlerkleidern sucht
Der Aechter fremde Gauen, unerkannt
Zu bleiben, unverfolgt! Wie mancher Wicht,
Der vor ihm kroch, als noch der Sonnenschein
Des Glückes hell von Heinrich's Diadem
Auf seine Freunde niederglänzte, stößt
Verspottend ihn zurück und weigert ihm
Ein Stückchen trocknen Brod's. Wir werden ihn
Auf dieser Erde niemals, er wird nie
Die Berge seines Landes wiederschaun,
Denn alles ist ja päpstlich um uns her.
Trotz dem erscheint Benno in Pilgertracht auf der Burg eines Freundes und bittet beim Scheiden:
Nur ein's noch! Führt mich Euren Thurm hinan‚
(Man sieht von Eurem Thurm doch Osnabrück?)
Daß ich noch einmal meine – meine Stadt
Noch einmal sehe! –
Knabe.
Werft das Fenster offen;
Die Burg liegt hoch. Seht da die liebe Stadt!
Benno.
In diesem schönen Thal! –
Wie schön sie daliegt, von dem Sterbeglanz
Des Tags verklärt! Wie mancher Edle dort
Der einst mit stolzer Wonne mir sein Herz
Entgegen trug und noch an seiner Thür
Mit Freuden mich empfinge! – Lebe wohl
Mit deinen guten Bürgern, gute Stadt! –
Leb wohl! und wenn des großen Vaters Ohr
Der Väter letzte Wünsche gnädig hört,
So schwebe stets mein Segen wie der Herbst
Mit nie erschöpftem Füllhorn über dir! – –
Broxtermann's Gedichte, Münster 1794. »Bischof Benno« entstand im sechszehnten Lebensjahre des Dichters.
Benno ist der Erbauer des Schlosses und der Gründer der Benediktiner-Abtei Iburg, die auf den Grundmauern eines sächsischen, von Carl dem Großen zerstörten Castell's steht: von Benno's Werk jedoch ist keine Spur mehr übrig geblieben, seine eigene Wohnung, der Bennothurm, ward gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts abgebrochen. Das jetzige Schloß ist im neueren Klosterstile gebaut. Im Jahre 1070, am Clemenstage, ward der Altar der kleinen hölzernen Kapelle eingeweiht, welche zuerst, nachdem man das Gestrüpp ausgerodet, das die Trümmer der alten Sachsenfeste überwucherte, in Eile aufgezimmert wurde. Die rasche Vollendung des Werkes jedoch wurde lange durch Benno's Entfernung aus seinem Stifte gehindert: erst als Gregor VII. 1085 zu Salerno verschieden war, durfte der Bischof wagen, zurückzukehren und seine Iburg auszubauen, die durch den Einsturz ihrer ersten Structuren ihm, dem geschickten Baumeister, dem Wiederhersteller des Speyrer Dom's, wenig Ehre gemacht hatte. In dem Altar der neuen Klosterkirche ließ er eine Höhlung anbringen, wie sie der Hochaltar der Kathedrale zu Brixen hatte: vor dem hatten Kaiser Heinrich's Bischöfe, Deutsche und Italienische, Papst Gregor seiner Würde entsetzt; Bischof Benno aber war, als es zur Abstimmung kam, in die Höhlung des Altars geschlüpft, um nicht seine Stimme gegen seinen und der Christenheit Oberhirten zu erheben. Als der Akt vorüber, saß Benno wieder auf seinem Platze, als ob er nicht von der Stelle gewichen sei: – eine Handlung, von der wir kaum begreifen, wie der edle Bischof ihr ein solches Denkmal setzen mochte. Wo jetzt das Städtchen Iburg den Berg sich bis an die Thore der Abtei hinaufzieht, lag schon vor deren Gründung ein Ort, welchen eine Matrone Azela bewohnte, die mit frommer Liebe an dem Bischof hing. Sein Biograph Norbert, Iburg's erster Abt, hat uns die Worte aufbewahrt, mit welchen er auf ihr dringendes Verlangen, an sein Sterbelager treten zu dürfen, antwortete: eam se videlicet malle in futuro videre saeculo; ubi sincere, secure et jucundius mutuo fruerentur aspectu, quicunque se hic invicem in Christo puritate castae caritatis amassent.
Benno starb im Jahre 1088 auf seinem Thurme zu Iburg, wo er die letzten Tage seines Lebens einsam ausgeruht hatte von all den Mühen seiner Fahrten und Züge durch Deutschlands Wälder, durch die Schluchten der Alpen und Apenninen, durch Syriens Wüsten und die staubigen Flächen Palästinas: denn auch nach Jerusalem und dem gelobten Lande hatte sein reiches Leben ihn geführt. –
Nach Benno's Tode hob sich seine Stiftung um so rascher, als ihre schöne Lage sie zum Lieblingssitze der Bischöfe Osnabrück's machte. Wir nennen unter ihnen Franz von Waldeck, den Bischof von Osnabrück und Münster, in dessen Regierungszeit der Wiedertäufersturm fiel und der den größten Theil seines vielgeplagten Lebens hier zubrachte, innerlich der Reformation gewonnen, ohne die Kraft, auch äußerlich ihr Bekenntniß durchzusetzen: 1548, auf einem zu Osnabrück gehaltenen Landtag mußte der Fürstbischof erklären, daß er der Augsburgischen Confession entsagen und der katholischen Lehre zugethan bleiben wolle. –
Ernst August, der erste Fürst aus dem Welfenhause, der infolge des westphälischen Friedens die Mitra von Osnabrück erhielt, verließ die Iburg, um des umgebauten Schlosses in der Hauptstadt willen. Mehrere Jahre vorher jedoch, 1665, war Iburg Zeuge eines bewegten und anziehenden kleinen Familiendrama's, das damals die fürstlichen Kreise Deutschlands in einige Aufregung versetzte. Im Jahre 1639, am 7. Januar, war auf dem Schlosse Olbreuse bei Usseau zwischen Niort und Rochelle in Poitou dem Alexander II. d'Emiers, Seigneur d'Olbreuse und der Inguline la Poussard de Vaudal eine Tochter geboren worden, welche den Namen Eleonore erhielt, und berufen war, die Stammmutter der Königshäuser von England und Hannover und auch des preußischen Hauses zu werden – sie, die aus niederm Adel hervorgegangene Frau, der noch obendrein an den zur Stiftsfähigkeit erforderlichen 16 Ahnen einer fehlte, und die dadurch eine beklagenswerthe Verwirrung in die allerhöchsten Stammbäume bringen sollte! Im Uebrigen, wenn das neben einem solchen betrübenden Faktum erwähnt zu werden verdient, war Eleonore schön, wohlgebildet, edeldenkend und eine vortreffliche Frau, an der nicht der leiseste Flecken haftet, von »großem Verstand und sonderbarer Tugend.« – Alexander d'Olbreuse gehörte zu den von den Jesuiten verfolgten Anhängern des Protestantismus in Frankreich; es ist jedoch nicht festgestellt, ob er als Flüchtling seine Heimath verließ; man weiß nur, daß seine Tochter Eleonore, als sie 26 Jahre alt war, sich mit einer aus Frankreich geflüchteten Familie, der des Prince de Tremouille, Fürsten von Tarent, am Hofe des Oraniers zu Breda in Holland aufhielt; sie war Hofdame der Gemahlin des Prinzen, einer gebornen Landgräfin von Hessen-Kassel. Hier nun lernte sie jenes oben genannten Kurfürsten und Osnabrücker Fürstbischofs Ernst August Bruder, der Herzog Georg Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, kennen und faßte eine heftige Leidenschaft für das schöne Fräulein aus dem Lande Poitou. Er warb um sie und sie mag Anfangs manchen innern und äußern heftigen Kampf zu bestehen gehabt haben, denn um die Sache zum Austrage zu bringen, ließ Ernst August sie aus Holland nach Iburg abholen; dort wurde sie von dem Letzteren und seiner Gemahlin, der Kurfürstin Sophie, so lange bearbeitet, bis sie sich darein fand, dem Herzoge Georg Wilhelm anzugehören, ohne Stand und Namen seiner Gemahlin zu beanspruchen. Georg Wilhelm stellte eine Urkunde aus, worin es heißt: Comme l'affection que j'ai pour mon frère m'a fait résoudre de ne me jamais marier, pour son avantage et celuy de ses enfants, dont je ne départiray jamais, et que Mademoiselle d'Olbreuse s'est résolue de vouloir vivre avec moy, je promets de ne l'abandonner jamais et de luy donner 2000 écus par an, et 6000 écus par an après ma mort. Sodann verlieh Georg Wilhelm seiner Geliebten den Namen Madame de Harburg und schenkte ihr das Gut Nilhorn auf der Elbinsel bei Hamburg, die er Wilhelmsburg nannte, so daß sie auch den Namen Frau (und später Gräfin) von Wilhelmsburg erhielt. In dem Abschiede der lüneburgischen Stände von 1676 heißt sie Eleonore von Harburg, Gräfin von Wilhelmsburg; die Stände bewilligten ihr 120,000 Thaler; 1680 aber heißt es in einem solchen Abschiede: »Da nach der Hand der Gemahlin Sr. Durchlaucht der Titel einer Herzogin von Braunschweig beigelegt worden.« Es hatte nämlich Kaiser Leopold I., durch den herzoglichen Agenten Praun gewonnen, am 22. Juli 1674 Eleonoren von Harburg zur Reichsgräfin von Wilhelmsburg ernannt: und nun ließ Georg Wilhelm durch den Großvoigt von Hammerstein seinen Bruder Ernst August um dessen Einwilligung zur priesterlichen Einsegnung seines Verhältnisses angehen. Dieser ließ sich dazu bewegen, nach eingeholtem Gutachten einer Juristenfakultät und unter der von den Ständen bekräftigten Bedingung, daß an der Erbfolgeordnung des Landes nichts geändert werde. Es fand nun 1676 die öffentliche Trauung in Celle unter vielem Glanze statt, und Eleonore galt von diesem Augenblicke an als die vollberechtigte Gemahlin des Landesherrn.

Schon am 15. September 1666 aber hatte Eleonore ihrem Herrn eine Tochter, Sophie Dorothea, geboren; noch drei Töchter folgten, die aber unmittelbar nach der Geburt starben. Sophie Dorothea war unzweifelhaft ein außerehelich geborenes, wenn auch später legitimirtes Kind; nichts desto weniger wurde sie um ihres großen Allodialvermögens willen und zur Sicherung der Erbfolge in sämmtliche hannoversche Lande dem Sohne des Kurfürsten Ernst August angetraut, jenem fatalen Georg I., trotz dem, daß Eleonoren d'Olbreuse fast das Herz darüber brach, als man ihr einziges geliebtes Kind an einen solchen Menschen aus der Familie fortgab, welcher sie so manche Bitterkeit verdankte, die sie ihre niedere Herkunft so schonungslos hatte fühlen lassen. Welches Ende diese Verbindung nahm, wie die arme Sophie Dorothea als Prinzessin von Ahlden 32 Jahre lang in der Gefangenschaft schmachtete, ist bekannt genug. Weniger bekannt ist, was Eleonore dabei litt, während Georg Wilhelm sich seiner Tochter gegenüber fühllos und ohne Herz zeigte. Der Mutter wurden nachher spärliche Besuche der gefangenen Tochter verstattet, bis ihr Gemahl starb, 1705. Nun war Eleonore ohne Schutz und Schirm, und der cellische Minister von Bernstorff suchte sich dem neuen Gebieter, dem Kurfürsten-König Georg I. dadurch gefällig zu erweisen, daß er die edle Frau auf alle Weise beschimpfte, ihr den Aufenthalt auf dem cellischen Schloß unmöglich machte und sie nach Lüneburg vertrieb. Hier hatte ihr Gemahl ihr ein Schloß als Witwensitz erbauen lassen, und hier wohnte sie, wie es heißt, von den Thränen, die der Kummer ihr erpreßte, in den letzten Lebensjahren erblindet. Sie starb am 3. Februar 1722 im 83. Jahre ihres Alters. Neben ihrem noch im Sarge prunkenden Gatten wurde ihre sterbliche Hülle in der cellischen Familiengruft in einem ganz schmucklosen Sarge von Zinn beigesetzt, dem am 16. November 1726 die irdischen Ueberreste der unglücklichen Tochter in gleich unfürstlicher Ausstattung beigesellt wurden.
Das ist in kurzen Umrissen die Geschichte eines armen französischen Weibes, das zuerst in unserm Iburg den Boden deutscher Fürstenschlösser betrat!
Jetzt Sitz einer Behörde bieten des Schlosses Gemächer nichts Sehenswerthes mehr dar, als die Bilder der Osnabrückischen Fürsten, welche um 1653 von dem Römer Vitus Andreas Aloysius gemalt, aber eben keinen besondern Kunstwerth besitzend, den großen, etwas verwahrlosten Saal schmücken, dessen Fenster zugleich eine weite schöne Aussicht bieten. Aber zu einer bessern Rundschau lockt uns ein mehr verheißender Punkt, die höchste Spitze des ganzen Gebirgszuges, der 1092 Fuß über der Meeresfläche erhabene Dörenberg. Nur durch ein schmales Thal von dem Schloßberge von Iburg getrennt, schützt gegen den Nord der Dörenberg die hellen Mauern der Abtei, die wie eine graue Gürtelspange an der Mitte seines Riesenleibes den fernen südlichen Thalbewohnern schimmern. Der jähe Steg führt durch dichtes Unterholz von weißstämmigen Birken und schlankeren Buchen auf den Gipfel, den eine Pyramide bezeichnet. Dort lacht ein Panorama vor uns auf, wie wir noch keines von solcher unbegrenzten Ausdehnung gesehen. Osnabrück hebt wie in nächster Nähe vor uns aus seinem Hasethal die Kuppel des Domes und seine Thürme wie in die Wette mit seinem freundlichen Gertrudenberg empor: uns näher rechts die dunkeln Mauern des kleinen Frauenklosters Oesede, dann Borgloh, weiter Melle, in blauer Ferne verschwimmend der Dümmersee: gen Osten die ganze Gebirgskette bis zur Weserscharte hin, unten Dissen mit dem hohen kegelförmigen Freden, der die Salinen von Rothenfelde überragt, weiter hinauf die Ruinen des Ravensberges: gen Süden und Südwesten die sparsamer bebauten Flächen des Kern's von Westphalen, der von den Thürmen von Münster bezeichnet wird, begrenzt von den Gebirgen der Ruhr: nach Westen endlich der sich verlaufende Höhenzug, der als romantischen Endpunkt die Trümmer der Tecklenburg zeigt.
Vor Allem zieht der alte Bischofssitz Osnabrück hier unsre Blicke auf sich. In einem breiten von der Hase durchschlängelten Thale zieht die endlos lange Hauptstraße, die fast den ganzen Ort bildet, von Süden nach Norden sich bis an den Fuß der unbeträchtlichen Höhe, welche einst ein Frauenstift trug, jetzt die breit sich entwickelnden Fronten einer Irrenanstalt. Die Stadt wird überragt von vier Kirchen, die, namentlich die schöne Marienkirche, das Moment des Ehrwürdigen einer alten geschichtlich denkwürdigen Stadt auf's würdigste vertreten; auch das Waterloo-Thor, ein Denkmal der in der Schlacht Gefallenen, die Statue Möser's, das geräumige fürstbischöfliche Schloß sind sehenswerth. Das Schloß ist 1675 erbaut durch Ernst August, den ersten Prinzen aus dem Hause Braunschweig, der (1662) in Folge des Westphälischen Friedens das Hochstift Osnabrück erhielt und hier nur einen unbewohnbaren alten Bischofshof bei der neuen Mühle vorfand.
Das Bisthum Osnabrück (Osenbrügge, wohl ursprünglich die Hase-Brücke, woraus die fränkische Aussprache den jetzt gebräuchlichen Namen bildete) verdankt seine Entstehung Karl dem Großen, dessen hoher schwerer Stab, eine Eisenstange umgeben von Zuckerrohr-Ringen, noch jetzt in dem Dome gezeigt wird. Früher hatte Bernhard, der Apostel dieser Gegenden, auch hier, im Gau Tregwithi, das Christenthum gepredigt und eine Kapelle errichtet; Karl erhob sie 783 nach seinem großen Siege an der Hase zur Münsterkirche und sein Feldbischof Egilfried von Lüttich weihte den ersten Altar des erweiterten Gotteshauses, dem heiligen Petrus das Stift, den heiligen Crispin und Crispinian, welche zu Soissons die Martyrerpalme erworben haben sollen, den Altar zum Schutze anbefehlend. Der erste Bischof, ein Zögling der damals berühmten Schule zu Utrecht, hieß Wiho; eine Schule für lateinische und griechische Sprache ward mit der neuen Stiftung verbunden und das Carolinum Osnabrücks ist stolz auf seinen mehr als zwölfhundertjährigen Bestand. Nach dem Falle Heinrichs des Löwen erscheinen die Bischöfe zuerst mit der weltlichen Jurisdiktion belehnt, als Fürstbischöfe. Der Westphälische Frieden, der in dem »Friedenssaale« des Rathhauses mit den Gesandten Schwedens und der protestantischen Mächte hier geschlossen wurde, gab dem Hause Braunschweig-Lüneburg das Recht, den fürstbischöflichen Stuhl, abwechselnd mit einem katholischen Prälaten, zu besetzen. So wurde der letzte Herzog von York mit der Inful von Osnabrück bekleidet, als er sieben Monate alt war, und Sterne konnte deshalb zwei Jahre später ein Buch ihm »Dem Hochwürdigsten, in Gott Vater (nur drei Jahre alt) u. s. w.« widmen. –

Im Jahre 1100 brannte die Domkirche ab sammt der Burg des Bischofs Wiho II., der nun den Bennothurm in Iburg bezog und so den Anfang zu der Residenz der spätern Bischöfe in diesem Kloster machte. Sein Nachfolger Johann I. erbaute bis zum Jahre 1107 die jetzige Cathedrale in schwerfälligem vorgothischem Style; das Innere, früher durch eine Restauration im Geschmacke des siècle de Louis XIV. entstellt, ist jetzt in seiner ursprünglichen Reinheit hergestellt und zeigt durchaus dieselbe Anlage wie der Dom zu Münster und die Abteikirche zu Marienfeld – alle drei Gebäude scheinen desselben Baumeisters Werk. Die beiden Thürme von ungleicher Höhe und Dicke wurden einige Jahrzehnte später von Bischof Udo von Steinfurt errichtet. Das Collegiatstift und die schöne Kirche zum heiligen Johannes dem Täufer in der jetzigen Neustadt, verdanken ihre Entstehung (1011) dem gelehrten Bischof Detmar, der auch eine Bibliothek bei der Domkirche anlegte und mit eigener Hand fünfzig Bücher dafür abschrieb.

Es knüpft sich mancher berühmte oder ruhmwürdige Name an die Stadt: zuerst der Rudolphs von Benninkhaus, des Westphälischen Hans Sachs, der hier im sechszehnten Jahrhundert in 37 Komödien dem Geschmacke und derben Witze seiner Zeit huldigte; dann der Hamelmann's, welcher zu Osnabrück geboren, als eifrig für das »
evangelium renatum« wirkender Superintendent in Oldenburg ausführlich die Reformationsgeschichte fast jeder Westphälischen Stadt geschrieben, und dadurch eine Hauptquelle für unsere historische Forschung geliefert hat. Der Abt Jerusalem ward 1709 in Osnabrück geboren; neben dem oben erwähnten Broxtermann ist der ältere Dichter von Bar zu nennen, der
Epîtres diverses im Geschmack der französischen Literatur zur Zeit Friedrichs des Großen schrieb. – In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden einem Beamten Osnabrücks zwei Knaben geboren, welchen mehr jedoch als allen diesen Genannten gegeben war, um der Stolz ihrer Vaterstadt zu werden; aber ihre Wege liefen wunderbar auseinander, und während der eine zu einem glänzenden Ziele gelangte, welches eine bronzene Ruhmessäule bezeichnet, ist des andern Namen verschollen und verklungen. Der älteste lief, als er ein halbwüchsiger Junge geworden war, eines schönen Morgens in die weite Welt, um sein Glück darin zu suchen, und kam bis nach Münster; aber als das erste, was die weite Welt ihm bot, sich als ein Siebenpfennigstück auswies, so ein Domherr ihm schenkte, nebst einem Ei mit etwas erbetteltem Brode, das eine ihm begegnende Vagabundin mit ihm theilte, da ging er nach Hause zurück und stiftete mit zwei andern Jungen eine gelehrte Gesellschaft. Der jüngere Bruder wanderte weiter: er studirte in Jena so viel Schulden zusammen, daß es ihn aus dem Musensitze in die stupideste Barbarei trieb; die Folgen seiner academischen Bestrebungen um die Gelehrsamkeit des Rechts führten ihn in's Land brutalster Gewalt, in's Land des Corsarennährenden Tripolis. Unterdeß beschäftigte der ältere Bruder sich daheim mit »Patriotischen Phantasien.« Jener speculierte auf Sklavenhandel und trieb sich auf dem Bazar des Dey's, unter den grimmen flammigwilden Scheik's umher. Dieser saß zu Hause voll stiller Verehrung zu den Füßen der geistreichen Demoiselle de Bar, und hörte ihr bildendes Gespräch über die
Epîtres diverses ihres Herrn Vaters, über die Marquise du Chatelet, über St. Evremont und die Gottschedin an, und was die Verehrungswürdige sonst auf's Tapet bringen mochte, um einen talentvollen jungen Menschen zu »decrassiren«: oder er las ihr seine regelrechte Tragödie Arminius in klingenden Alexandrinern vor. Der jüngere verlegte sich, als es mit dem Tripolitanischen Handel nicht kleckte, auf die Alchymie und suchte den Stein der Weisen; der ältere aber fand Gold; er schüttelte es in gediegenen Körnern aus dem Staube alter Pergamente, schmolz die einzelnen Körner zusammen, setzte das Gepräge seines Geistes darauf und hinterließ seiner Vaterstadt den goldenen Schatz, die »Osnabrückische Geschichte«. – Der jüngere kehrte endlich zerschlagen heim, und im Grimm darob, daß der Stein der Weisen ihm entgangen war, hielt er sich an die Thoren, und schrieb ihre Thaten auf, in hohen Aktenstößen, Beiträge zur Geschichte des modernen Faustrechts, wie sein Bruder das mittelaltrige beschrieben hatte. Sie haben keine Leser gefunden bis jetzt, die ein anderes Votum als das auf Pranger und Galgen darunter gesetzt hätten, und harren deshalb auf etwaige poetische Verklärung durch den Moderglanz der Jahrhunderte, in der Registratur des peinlichen Gerichts zu Osnabrück. Denn Johannes Zacharias Möser endete als Criminal-Actuar und ward 1767
ad acta gelegt, Justus aber, sein älterer Bruder, steht auf der Domfreiheit in glänzendes Erz gegossen und ist der Westphälische Franklin, der große Mann von Osnabrück geworden.
NachtragUeber Justus Möser's Persönlichkeit mag hier eine Stelle aus dem Briefe eines Pyrmonter Brunnenarztes an Zimmermann (den Verfasser der »Einsamkeit«) vom 2. Juli 1784 Platz finden: »Vor einigen Tagen ist Herr Möser mit seiner Tochter angekommen und wird eben noch acht Tage hier bleiben, um dann in Braunschweig seinen Freund Jerusalem zu besuchen. – Meine Frau ist beinahe beständig mit der Frau von Voigts, Möser's Tochter, die eine überaus kleine, reichlich häßliche, äußerst lebhafte, freie und dreiste, aber auch sehr kluge und verständige Person ist. Möser ist ein überlanger, sehr gutmüthiger, freundlicher Mann, den seine Größe – denn er ist fast noch einen halben Kopf länger, als ich – ein wenig verlegen macht. Seine Conversation verliert etwas, theils wegen fehlender Zähne, wegen stark westfälischen Dialektes, (etwas für Sie,) wegen hypochondrischer Dumpfheit der Stimme und einer polternden Geschwindigkeit im Sprechen, theils weil er nicht immer das beste Wort für die Sache gleich bei der Hand hat und oft Ausfüllungswörter braucht. Aus seiner Unterredung sollte man die Helligkeit seiner Ideen und die Präcision, die in seinen Schriften herrscht, nicht erwarten.
Zimmermann antwortete auf die Aeußerung über Möser's etwas unbeholfene Conversation: »Ich hätte gedacht, Möser spreche wie Cäsar!«
Indessen freut und interessirt seine nähere Bekanntschaft mich sehr. Die Geschichte seiner Visionen oder wachen Träume ist höchst merkwürdig, aber für jetzt zu lang. Einen kleinen Dienst habe ich ihm gethan, weil ich, nachdem dieses ungleiche Paar einen halben Tag in der Allee auf- und abgegangen war und, wie ich nachher erfuhr, grausame Langeweile gehabt hatte, so daß sie schon an ihre Abreise dachten, mich zuerst an sie heran begab und sie dadurch unter Menschen und auch sogleich auf das erste große Frühstück brachte. (Damals wurden von einzelnen Hochgestellten den sonst ausgezeichneten Badegästen große Frühstücke in der Allee gegeben, zu denen die ganze feinere Gesellschaft eingeladen wurde.) Jetzt gefällt es dem Alten und seiner Gouvernante hier sehr gut, besonders weil er gut schläft, was bei ihm etwas sehr Seltenes ist. Seit anderthalb Jahr hat er alle Nebenarbeit völlig aufgegeben wegen Inquietude. Wenn Möser's abreisen, so werden wir außerordentlich viel daran verlieren. Sie glauben nicht, welch ein lieber Mann der Alte ist, und so gar nicht stimmend in Ihr oberdeutsches oder schweizerisches Vorurtheil gegen die Niedersachsen und Westfalen.«
Justus Möser's Verdienste und geistige Thaten darzustellen, ist Aufgabe der deutschen Culturgeschichte geworden, sie hat zu zeigen, wie er vom Besondern zum Allgemeinen, vom Vereinzelten zur großartigen Ueberschau ausgehend, die gediegensten Resultate für praktische Lebensweisheit und Politik, für Gesetzgebung und Erziehung gewann, und durch seine Entwicklungen, welche von dem Festen, Gegebenen aus, durch die sichere Folgerung hindurch, zur allgemeinen Wahrheit kommen, einer der Gründer deutscher Staatsweisheit ward. Die Statue, welche ihm 1836 seine Vaterstadt errichtet hat, gibt die milden, wohlwollenden Züge des Repräsentanten des »tüchtigen Menschenverstandes« in gelungener Aehnlichkeit wieder. Unbedeckten Hauptes, in der linken Hand eine Pergamentrolle, die rechte wie lehrend gehoben, ist die Gestalt ein im Ganzen recht gutes Denkmal moderner Plastik; nur läßt sie Möser's körperliche Länge nicht errathen. Das geschmacklose Costüm des vorigen Jahrhunderts bedeckt ein faltenreicher Mantel, der dem ganzen Bilde etwas von einem Lehrer gibt. – Es ist von dem Bildhauer Drake in Berlin unter Rauch's Leitung modellirt und gegossen.
Osnabrück ist eine Stadt, die den regen Aufschwung, welchen die industrielle Entwicklung ihr gebracht, schon in dem neu entstandenen schönen Bahnhofs-Quartier zeigt. Zu dem in der Nähe liegenden gewaltigen Hochofen-Etablissement der »Georg Marien-Hütte« gesellen sich andre Unternehmungen, die ihr eine bedeutende Zukunft verbürgen. Im selben Maße schwindet der alterthümliche Character. Die alten Befestigungen sind in Spaziergänge umgewandelt, die besonders nach Süden und Westen hin eine hübsche Aussicht auf Gartenanlagen umher und die fernen bewaldeten Berge gewähren NachtragIn der Nachbarschaft von Osnabrück, in dem nordwestlichen Theile des großen Kirchspiels Ankum hat sich bis auf unsere Tage ein Ueberrest der alten Marken- und Holzgerichte erhalten. Alljährlich am ersten Donnerstage im Mai versammeln sich 88 ⅔ Erben mit den ½ und ⅓ Erben, 116 freie Männer unter der Linde beim Schenkwirth zu Bockraden zur Berathung ihrer Gemeinde- und Markangelegenheiten. Man nennt dies das Hölting der Dinninger Sette. Sie übt die freie Verwaltung der eigenen Angelegenheiten durch den frei gewählten Schriftführer als eigentlichen Leiter derselben und hat ihre selbst gewählten Mark- und Wasserschau-Aufseher, die über Brücken, Wege und Gemeindegründe Aufsicht führen. Die Gemeindevorsteher haben diese in ihren Rechten und Pflichten durch Einziehung der Brüchtengelder zu unterstützen. Bei dieser Versammlung wird aus altdeutschem Kruge das Bier frei verabreicht und erhält jedes Erbe 1 bis 2 Thlr. Abwechselnd müssen drei Colonen am Tage vorher drei schwere Schwarzbrode liefern, welche an die Armen vertheilt werden. Beim fröhlichen Methbecher werden dann die Markangelegenheiten berathen. Schriftliche Protokolle von dem »Hölting« finden sich schon vor von 200 Jahren her. Diese Reliquie altdeutscher Sitte wurzelt so fest, daß gewöhnlich Niemand bei dieser fröhlichen Versammlung fehlen mag. – In Osnabrück selbst halten die Laischaften noch in feierlichster Weise ihre Schnatgänge. Das betreffende Quartier der Stadt schmückt sich vorher mit grünen Maien, Fahnen und hoch- und plattdeutschen Inschriften. Zwei Trommeln geben um Mittag das Zeichen zur Versammlung auf dem Friedenssaale. Nach Beendigung des Zuges werden Schnatgangskrengeln an die Jugend vertheilt und ein Ball beschließt das ganze Fest.; unter den wenigen Mauer-Thürmen, die sich noch erhalten haben, ist einer, der »Bock«, merkwürdig als Gefängniß eines Grafen von der Lippe und bald darauf eines Grafen von Hoya, die im vierzehnten Jahrhundert in seine Verließe gesperrt wurden: die Sage erzählt, es sei ein Graf von Tecklenburg darin bestrickt gewesen und weiß nach alter Chronik das folgende:
Einst nach langer Fehde hatte der Graf von Tecklenburg mit den Osnabrückern Friede geschlossen und sandte wöchentlich einen Diener mit einem Esel in die Stadt, um den Fleischvorrath für seine Burg zu holen. Nun ließ er eines Tages den Fleischern sagen, der festgesetzte Preis für ihre Waare sei zu hoch und er wolle diese jetzt um ein gewisses weniger, das er von dem mitgesandten Gelde abgezogen hatte. Die Fleischer von Osnabrück aber waren grobe Leute in jener Zeit; sie schlugen den unglücklichen Träger der Botschaft todt und packten seine zerhauenen Glieder in die Tragkörbe des Esels, der ruhig den gewohnten Weg nach seinem Stalle heimwanderte. Als der Graf von Tecklenburg nun das Unheil erkannte, das dem Boten widerfahren, der zwar nur ein Leibeigener, aber doch sein Diener war, und vollends als er am Sonntage keinen Braten auf seiner Tafel hatte, ergrimmte er und rief seine Vasallen zur Fehde auf. Die Städter aber hatten einen Hinterhalt gelegt, sie schlugen seine Schaaren und bekamen ihn selbst gefangen. Da haben sie ihn in einen eisernen Käfig gesteckt, in dem er weder liegen noch stehen konnte und ihn acht Jahre lang in einem düstern Thurme so peinvoll schmachten lassen, bis er sich lösen konnte mit drei ganz blauen Windhunden, drei Rosenstämmen von gewisser Höhe ohne Dorn, und einem Scheffel voll ganz seltener Münzen. Dies wurde beschafft, obwohl sie es nur zum Spotte als Lösegeld gefordert hatten; die Windhunde, nachdem man die blaugefärbten Alten in ein blaues Zimmer eingesperrt und nur mit blauen Speisen gefüttert hatte; die Rosenstöcke waren durch Glasröhren geleitet worden und die seltenen Groschen nah und fern gesammelt. Da wurde der Graf nach beschworener Urfehde entlassen; doch hat er sich später blutig gerächt; der Käfig und der Thurm aber werden noch gezeigt.
Diese Erzählung leitet uns hinüber nach dem einige Stunden westlich von Osnabrück liegenden Tecklenburg, dem Sitze eines ausgestorbenen, einst mächtigen und kriegerischen Dynastengeschlechts, der Grafen von Tekeneborg, oder Tecklenburg, die im Mittelalter Schirmvögte der Bisthümer Münster und Osnabrück waren. Es ist ein hochgelegener Punkt mit sehr zerstörten Burgtrümmern und einem Städtchen, das sich an den Hügel lehnt, von dem die Ruinen nach allen Seiten hin über Münster, Osnabrück und Bentheim hinausschauen, über ein bewaldet hügelichtes oder ebenes, hier und da von Haiden und Sandflächen durchflecktes, von Kiefernhainen verdüstertes Land, an dessen Horizont fernste Gebirge im Ravensbergischen und der Ruhrgegend mit blau verdämmernden Wellenlinien oder leis wie duftige Wolkengebilde dahinziehen.
Die Trümmer des Tecklenburger Schlosses deuten auf einen ungewöhnlich großen Raum, den es umfaßt haben muß; doch ist nur das Portal, welches nach Norden hin den Eingang bildete, fast unversehrt erhalten worden: über demselben reihen sich die Wappenschilder der fürstlichen Geschlechter von Sachsen, Hessen, Barby, Brandenburg, Schwerin u. s. w., mit denen das erloschene Dynastenhaus verwandt geworden, aneinander. Von diesem Portal aus sieht man unter sich das Städtchen Tecklenburg wie ein Schwalbennest an die abschüssige Bergwand, unter den schirmenden Sims der Burg hingekittet; weiter hinüber nach derselben Seite hin den ziemlich jähen Schafberg, der Kohlenflötze im Innern birgt, und an seiner westlichen Wurzel das Städtchen Ibbenbüren, dann unfern davon, im Schooße dichter Waldungen, das ehemalige Kloster (jetzt Eisenhütte) Gravenhorst; nah unter uns taucht aus den grünen Buchenwipfeln des Forstes Sundern das Dörfchen Ledde mit seinem Kirchthurm, wie ein Schiff mit bewimpeltem Mast aus grüner Meerfluth, auf. Rechts vom Schafberge nach Osnabrück hin liegt das Halerfeld, eine stundenlange Haide, auf welcher Heinrich der Löwe den Grafen Simon II. von Tecklenburg und seine verbündeten Ghibellinen zu vielen Tausenden bestrickte oder erschlug. In einer Senkung des Schlachtfeldes liegen gewaltige Granitblöcke doppelt gereiht neben einander, und auf den paarweise zusammengestellten Colossen lastet eine noch gewaltigere Masse: es sind die »Slopsteine«, Schlafeswächter für den Helden, der sich hier gebettet haben mag; ein Heidenkönig, sagt das Volk, ruhe in goldenem Haushalt (Sarge) unter den Steinen. Des Nachts erglühen sie und stehen wie riesige Geisterlampen, dem aufstehenden König sein nächtlich Schaffen zu beleuchten auf der dunklen Haide. Ein Zauber machte es früher unmöglich, sie zu zählen. Der Zauber muß jetzt gewichen sein, denn man bringt mit leichter Mühe die Zahl 54 heraus. Es ist eines jener vorchristlichen Denkmale, die man im nördlichen Westphalen so häufig findet und Hünensteine nennt, Opferaltäre und Fana der Germanen, früher von der heiligen Siebenzahl alter Eichen und Buchen überschattet, jetzt meist auf nackter offener Haide den einsamen Hirten gegen den Windzug beschützend, der über die Fläche durch das braune Haidkraut pfeift und lispelnd die Halme des Sandhafers biegt, eine graue Staffage in einem nebelhaft farblosen Bild Ossianscher Poesie. –
Schreiten wir vom nördlichen Portale der Burg in die verlassenen Höfe, wo verwittertes Gemäuer nicht einmal mehr den Plan der großen Feste andeutet, von der ein alter Geschichtschreiber über »des heil. Röm. Reichs uralte hochlöbliche Graffschaft Tekelenburg« folgende Beschreibung macht: In den mittelsten Wall ist zu sehen der große fünfkantige Thurn, ist ein gar altes rares und ungewöhnliches Gebäw, so in gantz Teutschland, Italien und Frankreich nur zwo seines Gleichen haben soll, dessen oberster Theil heutiges Tages den ordentlichen Hochgräffl. Musicis und dem Uhrwerk zum Gebrauch: der mittelste, zur Verwahrung Kraut und Loht's, der unterste Theil aber denen großen Uebelthätern zur Gefängniß verordnet. – Daselbst ist auch zu beobachten der Unter-Erdische Gang, mit einer starken eisernen Thüren verwahrt, so tieff, raum und weit, daß ein Reuter gemächlich hindurch reuten kann: der Eingang desselben ist zwar bekannt, der Ausgang aber ist Niemand bewußt, nur daß auff einem bey die zwo Meilen abgelegenen Berg eben ein solcher Gang ist, welcher mit diesem übereinkommen soll. Den Weg der sonsten stracks auffs Schloß hinauff gegangen, hat die Hochgeborene Gräfin Anna, Christmilter Gedächtnis, zwischen die hohe Mauern und den Wall herum machen und verordnen lassen; der dann erstlich hinauf führet zum Gerichthause, darin das Hoff- und Nieder-Gerichte zu gewisser Zeit gehalten wird, dagegen über die große Linde mit Mauren rings umgeben stehet, darunter den Uebelthätern, so vom Leben zum Tode hingerichtet werden sollen, das Endurtheil gesprochen und vorgehalten wird: Ferner zur Hameyen und so durch das herrliche neuauffgebawte und schön gewölbte Thor auf den Unterplatz (alda das Bawhaus, Mahrställe u. s. w. ihren Ort haben), dann fort über die Brücken durch ein Gewölb, so über sich die Cantzeley träget auff den Oberplatz, da dan das rechte Castehl und die mit Tapeten, vergüldeten Ledder auch sonsten mit gar schönen Gemälden und Schildereyen wolgezierte Gemächer besehens wehrt seyn. – Im herunter spatzieren vom Castehl gehet man auf die linke Hand durch ein hoch Thor auff den Hagen alwo der Renn- und Reitplatz: Item der schöne Kraut- und Lustgarten mit schönen Lauben und Lusthäusern geziert, wie dann auch des Eltisten Fräuleins, Fr. Sophiae Agnes Hochgräffl. Gn. besonderer Kraut- Baum- und Lustgarten ihren recht wohlverordneten anmühtigen und lustigen Ohrt haben.
Diese ganze Hochgräffl. gnädigst wolverordnete anmühtige Gebäwherrlichkeit liegt zerstört, und gestattet uns so jetzt auch nach Süden hin einen ungehemmten Blick in die weite Landschaft. Tecklenburg liegt wie auf der Handwurzel des Armes, den des Teutoburger Waldes Riesenleib nach dem Meere im Westen ausstreckt, ohne es erreichen zu können, wie er auch die langen Finger über die Haide legt und reckt. Man sieht dem gigantischen Zeigefinger von der Südseite des Burghofes bis über das Dorf Brochterbeck hinaus nach, wo die übereinandergeworfenen Felsbrocken des Königssteins liegen, welchem der alte Blücher einst seinen Namen einhauen ließ; im nächsten Vordergrund vor uns liegt der gewaltige Daumen, eine Bergwand, die man den Klee nennt; im Raume zwischen ihm und der Tecklenburg grünt ein liebliches Thal mit den Edelhöfen Mart und Hülfshoff, von einem Bache durchschlängelt, der sieben Mühlen treibt. Jenseits des Klee schaut wie ein dunkler Kern aus den grünen Wald- und Flurenhülsen der Flecken Lengerich herauf, in dessen Pfarrkirche von Osnabrück und Münster her die Gesandten des Westphälischen Friedens zu gemeinsamen Berathungen zusammen kamen: der päpstliche Legat Chigi (später Papst Alexander VII.) residirte dort: man erzählt noch seinen Ausspruch, als man ihm den Stolz des Ortes, das Kräuterbier »Gräfing« crendenzte: adde parum sulphuris et erit potus infernalis. –
Das Geschlecht der Grafen von Tecklenburg, deren Stammbaum Cobbo, Kaiser Ludwigs des Deutschen Grafen in diesen Gegenden und Heerbannsführer in der unglücklichen Normannenschlacht bei Ebsstorf im Lüneburgischen (880), als ersten Ahnen nennt, während es sich geschichtlich nur bis in den Anfang des zwölften Jahrhunderts hinauf verfolgen läßt, wo es, ursprünglich auf der Bardenburg bei Oesede seßhaft, den neugebauten Sitz zu Tecklenburg (etwa 1150) bezog – war einst eines der mächtigsten Westphalens, mächtig insbesondere durch die Schirmvogtei über die Münster'sche Kirche. Der älteste Stamm, der eine Burg im Wappen führte, starb aus mit Heilwigis, der Erbtochter, die 1263 ihrem Gemahle Otto von Bentheim die Grafschaft zubrachte. Der Stamm Otto's von Bentheim zu Tecklenburg, der drei rothe Seerosen als Wappen führte, blühte bis 1557 – zeitlebens ein unruhiges streitlustiges Geschlecht. – Nicolaus III. lag sogar mit dem eigenen Vater Otto VI. in Hader und setzte ihn gefangen; zum Dank setzten dann ihn seine Söhne Otto VII. und Nicolaus IV. wieder gefangen, bis er ihnen Tecklenburg und Rheda abtrat; darauf begannen die Brüder unter sich den Kampf und Otto VII. setzte zur Abwechselung nun Nicolaus IV. gefangen. Otto's VII. Sohn Conrad starb 1557 und hinterließ nur eine Tochter Anna, die ihr Stammgut abermals einem Bentheimer Grafen, Eberwin zubrachte. Aber nicht unbestritten. Denn die älteste Schwester Conrads, vermählte Gräfin von Solms-Braunfels erhob, da es an einer festen Regelung des Erstgeburtsrechtes dem Hause zu seinem Schaden immer gemangelt hatte, Ansprüche, welche ihre Nachkommen siegreich durchsetzten. Das Reichskammergericht sprach ihnen 1686 einen Theil der Erbschaft (¾ von Tecklenburg, ¼ von Rheda) zu, und diesen erstrittenen Theil verkauften sie für 300,000 Gulden an Preußen, das darauf die Tecklenburg und Rheda besetzen ließ. Geordnet wurde die ganze Angelegenheit erst 1729 so, daß Preußen ganz Tecklenburg, die Bentheim-Tecklenburger Grafen dagegen Rheda erhielten.
An Tecklenburg knüpft sich das Andenken eines Mannes, den man zu den größten Wohlthätern der Menschheit zählen muß, das des Johannes Wierus (Wier oder Weyer), des unerschrockenen ersten Streiters wider die Hexen-Verbrennungen, der schon ein Jahrhundert vor Spee alle Kraft seines Geistes daran setzte, die vom Jahre 1484 an überall in Deutschland auflodernden Scheiterhaufen zu ersticken. Der berühmte Verfasser des Buchs: de praestigiis Daemonum, 1515 in Holland geboren, war Leibarzt des Herzogs Wilhelm von Berg und befreundet mit dem Grafen Arnold von Bentheim-Tecklenburg, der zu Wewelinghofen im Rheinlande residirte. Als sein in Geistesschwäche verfallender Herzog ihn nicht mehr schützte und sich auch an ihm das Wort:
Die wenigen, die was davon erkannt,
Hat man seit je gekreuzigt und verbrannt,
bewähren sollte und ihm selbst der Scheiterhaufen drohte, nahm Graf Arnold ihn in seinen Schutz und gab ihm das Bürgerrecht seiner Stadt Tecklenburg, bis das böse Wetter sich verzogen hatte: abwechselnd lebte er dann am herzoglich bergischen Hofe und in Tecklenburg, wo er starb und in der Hauptkirche beigesetzt wurde, am 24. Febr. 1588. –
Die Bürgerschaft Tecklenburg's hat den sie ehrenden Entschluß gefaßt, Wier ein Denkmal zu setzen.
Den nördlichsten Punkt, wohin unsere Wanderung uns führen soll, bilden die Dörenther Klippen bei Ibbenbüren, eine in wilden wunderbaren Formen aufeinander geworfene Reihe von Felsstücken: an den höchsten und am auffallendsten geformten dieser Felsen, das »hockende Weib«, knüpft sich eine Sage, in welcher die Erinnerung an die vorgeschichtlichen Erdrevolutionen nachklingt, denen alle Bergformationen ihre Entstehung verdanken. Einst, als das hohe Wasser noch die Ebene bedeckte, lebte eine arme Frau in dieser Gegend, deren einziger Reichthum zwei fromme Kinder waren: wie sie nun eines Tages sitzt und spinnt, da kommt der älteste Bube in die Hütte gesprungen und schreit: das Wasser, das Wasser! sie schaut erschrocken hinaus und sieht, wie die Fluth sich heran wälzt, bis an die Schwelle schon rauschend; da nimmt sie ihre Kinder auf den Rücken und keucht der nächsten Höhe zu – die Wogen brausen ihr nach, sie netzen ihren Fuß – schon den Saum ihres Kleides – da sinkt sie in die Kniee und betet um ihrer Kinder Leben und der Herr erhört sie und verwandelt sie in den Felsen, auf dessen Rücken die Kinder sicher sind, bis die Fluth sich wieder verlaufen hat.
Von einem der Schlösser und Güter, die zerstreut im Teutoburger Walde liegen, erzählt man die Geschichte vom blonden Waller, der, nachdem er mit andren Gästen den Abend verzecht, in einer Nacht graues Haar bekam. Sie mag, ehe wir das Gebirge verlassen, in poetischer Gewandung folgen.
'ne kleine Burg im Walde steht,
So recht zusammen fest gebaut,
Am Thor das Fensterlein, draus spät
Und früh der Wächter hat geschaut;
Schießscharten lugen rings umher,
Die Brücke wiegt und knarrt im Sturm,
Und in des Hofes Mitte, schwer,
Plump wie ein Mörser, steht der Thurm.
Da siehst du jetzt umhergestellt
Manch feuerrothes Ziegeldach,
Und wie der Stempel steigt und fällt,
So pfeift die Dampfmaschine nach;
Es rauscht die Form, der Bogen schrillt,
Es dunstet Scheidewassers Näh,
Und über'm grauen Wappenschild
Liest man:
Moulin à papier. – – –
Es war tief in die Nacht hinein
Und draußen heulte noch der Sturm,
Schnob zischend an dem Fensterstein
Und drillt den Glockenstrang am Thurm;
In seinem Bette Waller lag
Und las so scharf im Ivanhoe,
Daß man gedacht, bevor es Tag,
Sei England's Königreich in Ruh.
Er sah nicht, daß die Kerze tief
Sich brannt' in seiner Flasche Rand,
Der Talg in schweren Tropfen lief
Und drunter eine Lache stand;
Wie träumend hört' er das Geknarr
Der Fenster, vom Rouleau gedämpft,
Und wie die Thüre mit Geschnarr
In ihren Angeln zuckt und kämpft.
Sehr freut er sich an Bruder Tuck –
Die Sehne schwirrt, es rauscht der Hain –
Da plötzlich, ein gewalt'ger Ruck,
Und hui, die Scheibe klirrt herein!
Er fuhr empor – weg war der Traum –
Und deckte mit der Hand das Licht:
Ha, wie so wüst des Zimmers Raum,
Selbst ein romantisches Gedicht!
Der Sessel feudalistisch Gold,
Am Marmortisch die Greifenklau,
Und über'm Spiegel flatternd rollt,
Ein Banner, der Tapete Blau;
Im Zug, der durch die Lücke schnaubt,
Die Ahnenbilder leben fast
Und schütteln ihr behelmtes Haupt
Ergrimmt ob dem plebejen Gast.
Der blonde Waller mogte gern
Sich machen einen kleinen Graus,
So nickt er spöttisch gen die Herrn,
Als fordert er sie keck heraus.
Die Glocke summt, – schon Eins fürwahr! –
Wie eine Boa dehnt er sich,
Und rückt an dem Pistolenpaar,
Dann rüstet er zum Schlafe sich.
Die Flasche fassend einmal noch
Er leuchtete die Wände an:
Ganz wie 'ne alte Halle doch
In einem Scottischen Roman!
Und – ist das Nebel oder Rauch,
Was durch der Thüre Spalten quillt?
Es wirbelt in des Zuges Hauch,
Und dunstig die Paneele füllt.
Ein Ding – ein Ding wie Grau in Grau,
Die Formen schwanken – sonderbar!
Doch – ob sich schärft der Blick? – den Bau
Von Gliedern nimmt er mählich wahr;
Wie über'm Eisenhammer schwer
Und dicht des Rauches Säule wallt,
Ein Zucken flattert drüber her,
Doch hat es menschliche Gestalt.
Er war ein hitziger Kumpan,
Wenn Wein die Lava hat geweckt:
Qui vive? und leise knackt der Hahn,
Der Waller hat den Arm gestreckt.
Qui vive? – 'ne Pause –
ou je tire!
Und aus dem Lauf die Kugel knallt;
Er hört sie schlagen an die Thür,
Und aufwärts prallen mit Gewalt.
Der Schuss dröhnt am Gewölbe nach
Und, eine schwere Nebelschicht,
Füllt Pulverbrodem das Gemach;
Er theilt sich, schwindet, das Gesicht
Steht in des Zimmers Mitte jetzt,
Ganz wie ein graues Bild aus Stein,
Die Glieder fest und unverletzt,
Die Züge edel, streng und rein.
Auf grauer Locke grau Barett,
Mit grauer Hahnenfeder drauf; –
Der Waller hat so sacht und nett
Sich hergelangt den zweiten Lauf;
Noch zögert er – ist es ein Bild,
Wär's zu zerschießen lächerlich,
Und ist's ein Mensch – das Blut ihm quillt‚
Ein Geck, der unterfänge sich! –
Der Finger zuckt, und wieder Knall
Und Pulverdampf – war das Gestöhn?
Er hörte keiner Kugel Prall,
Es ist vorüber, ist geschehn!
Der Waller seufzt: verdammtes Hirn!
Auf einmal ist er kalt wie Eis;
Der Angstschweiß tritt ihm auf die Stirn,
Er starret in den Nebelkreis.
Ein Aechzen oder Windeshauch,
Doch nein, der Scheibensplitter schwirrt;
O Gott, es zappelt, nein, der Rauch,
Gedrängt vom Zuge, kämpft und wirrt;
Es woget, wirbelt, aufwärts wallt,
Und – wie ein graues Bild von Stein
Steht nun am Bette die Gestalt,
Da wo der Vorhang sinkt hinein.
Und drüber knistert's wie der Brand
Des Funkens, der elektrisch lebt;
Nun zuckt ein Finger, nun die Hand,
Allmählich nun ein Fuß sich hebt,
Hoch, immer höher – Waller sinnt,
Dann macht er schnell gehörig Raum,
Und langsam in die Kissen lind
Es sinkt wie ein gefällter Baum.
Ah je te tiens! er hat's gepackt
Und schlingt die Arme wie 'nen Strick –
Ein Leichnam todeskalt und nackt! –
Er windet sich und will zurück –
Es wälzt sich langsam, schwer wie Blei
Gleich einem Mühlstein über ihn;
Da that der Waller einen Schrei
Und seine Sinne waren hin.
Am nächsten Morgen fand man kalt
Ihn im Gemache ausgestreckt;
's war eine Ohnmacht nur und bald
Ward zum Bewußtsein er geweckt;
Nicht irre war er, nur gepreßt,
Und fragt, ob Keiner ward gestört?
Doch Alle schliefen überfest,
Nicht Einer hat den Schuß gehört.
So ward es für 'nen Traum sogleich
Und alles für den Alp erkannt;
Doch zog man sich aus dem Bereich
Und trollte hurtig über Land.
Sie waren Alle viel zu klug,
Und vollends zu belesen gar;
Allein der blonde Waller trug
Seit dieser Nacht eisgraues Haar. –
Von der Tecklenburg schreiten wir gen Westen fürder, Bentheim zu: ein Weg, der durch »Kämpe« an einzelnen Gehöften der Sassen vorbei und hie und da über eine Haide führt, durch einen Landstrich, der noch heute uns ein Bild des alten Westphalens zeigt, aus den Zeiten, wo man es ungastlich und unwirthlich nannte, eine von der Cultur unerreichte Wüstenei. –
Der Kern Westphalens ist allerdings früher, vor den eingeführten Markentheilungen, in hohem Grade unwirthlich gewesen. Die Abgeschiedenheit von der Welt, diese entfernt und einsam liegenden Höfe, wo jeder auf seiner Gewehre nach allen Seiten die Ellbogen frei hatte, wo er bei allem Thun auf sich selber sich angewiesen sah, der Mangel an aller Anregung von Außen her, pflanzten als Hauptcharakterzüge Selbständigkeit und Unlenksamkeit in das Gemüth der Autochthonen. Sie hatten sich nur um ihren Boden zu kümmern, der stets dieselbe harte Arbeit ihnen abzwang, sahen außer den Ihrigen nur die Eichen ihres Hofes, die einen Tag wie den andern ihre starken Aeste über sie schüttelten, hingen nur vom Wetter bei ihrer Thätigkeit ab, das immer dieselbe Rauhheit gewahren, aber nicht mehr empfinden ließ: in ihr ganzes Leben trat kein einziges Ereigniß, in all ihr Sein kein einziger neuer Gedanke. So wuchsen sie denn wie ihre Eichen auf: stark, harten Holzes und tief in den Boden dessen, was ihnen einmal heimisch geworden, ihre Wurzeln schlagend. Neues trat nicht in ihren Kreis: so wurde das Alte ihnen das Ewige und heilig. – Man muß auf den Haiden und öden Landesstrecken Westphalens Tagelang selber umhergestreift, Stundenlang auf einem seiner Hünensteine sinnend gesessen und der braunen Unendlichkeit mit den Blicken nachgeschweift haben, um ganz empfinden zu können, wie eine solche Umgebung dem Gemüthe eine entschiedene Richtung in seine eigne Tiefe hinein gibt. Ringsum ist nichts als die dunkle Fläche mit schwacher Farbennüanzierung durch die Blüthe des Haidkrauts und des Ginsters; blaue Waldfernen begrenzen den Horizont; hie und da schießt schweren Fluges eine Krähe nahe an der Erde her, als ob sie den gelben Sandstreifen wie eine Schwalbe den Wasserspiegel streifen wolle; eine zerstreute Schafheerde, hinter welcher der Hirt im weißen »Haiken« träumend einherwandelt, dient zur Staffage; in der Entfernung ragt eine verwitterte Buche über einer Wallhecke empor und auf ihrem höchsten dürrsten Aste ruht der Vogel der Melancholie, ein einsamer Storch, von dem euch die Leute erzählen, daß er seit Jahren darauf gesessen und jedes Frühjahr zu ihm zurückkehre, weil ein Jäger einst sein Weibchen herunter geschossen habe – das ist alles, was ihr seht, nebst dem blauen Himmel, der sich darüber dehnt und auf weißen Wölkchen wie in Silbernachen die Frühlingsgeister trägt, die schlummernd über der Haide fortsegeln, um in glücklicheren Gegenden, fern hinter den still heraufduftenden Wäldern am Horizonte zu erwachen. Ihr habt den Boden, um darauf zu leben, aber Leben ist nicht darauf; ihr müßt es anderswo in euch selber suchen. Die todte Natur weckt nicht die glänzenderen Fähigkeiten des Verstandes, sie zwingt nirgends zu vergleichen, zu combiniren, schnell zu erfassen; keine bunten wechselnden Erscheinungen wollen enträthselt, begriffen, durch schnelles Festhalten gewonnen sein, keine Genüsse rasch ausgekostet. Daher kommen dem Volke das die Haide bewohnt, die langsamen trägen Fassungskräfte, die schwer anzuregende Theilnahmlosigkeit. Aber die todte Natur drängt die Gedanken des Menschen in seine eigne innere lebendigere Schöpfung, sie weiset ihn auf sich selbst und auf sein Gemüth an, und wie sie ihn von der Breite, die ringsumher nichts Anziehendes besitzt, ablenkt, führt sie ihn in die Tiefe, wo des Wunderbaren so viel liegt. Das weite, principlose, miscellenartige Umfassen der Dinge, die peripherische Weltanschauung kann auf diesem Boden nicht wachsen, aber die centrale greift desto tiefer Wurzel – die centrale Weltanschauung, deren Centrum der liebe Gott, der seinen Kindern so nahe ist in Westphalen, keine Viertelstunde über den rothglühenden Wolken der Abendsonne. In diesem Centrum sich fest und sich sicher fühlend, weiden sie voll träumerischer Ruhe ihre Schafe und Lämmer auf den grünen »Kämpen«; dem Hirten, der auf dem Rücken liegt und in die Bläue starrt, fehlt nur eine Jacobsleiter, um in den nahen Himmel flugs hineinzusteigen und oben zuzuschauen, was jetzt die lieben Engel wohl machen; er hört das elegische Klingen der Herdenglöckchen an, in welche die langgezogenen Töne ferner Schalmeien sich mischen, und ist selbst eine Art Lamm, das die Diener des Herrn hier weiden, bis einst der Heiland die Sorge übernimmt und die Seraphim auf den Schalmeien von Gold und Diamanten blasen. Darum kennt er auch keine Furcht vor dem Tode, der ihn von dem schweren Mühsal auf undankbarem Boden erlösen wird, denkt viel an den Himmel und betet viel; ja, er kennt keine andere geistige Beschäftigung, und wenn er euch lesen sieht, fragt er: so andächtig?
Die centrale Anschauung gibt Festigkeit und daher das Festhalten an dem einmal Ergriffenen, das Zusammenwachsen mit dem einmal in's Bewußtsein Uebergegangenen, welches die historischen Phänomene erklärt, die Westphalen aufweiset, das zähe Festhalten an althistorischen Bildungen, an den alten Volksgerichten, an alten Sitten, am alten Glauben. Die Fehmgerichte zuförderst waren nichts andres, als die alte karolingische Gerichtsverfassung, wie sie überall galt, aber nur in Westphalen, dem Entstehen der Territorial-Gerichtsbarkeiten so wie Römischem und Canonischem Rechte zum Trotz, festgehalten wurde. Bei den Wiedertäufer-Unruhen konnte die mangelnde Breite der Anschauung, das Unvermögen, sich zu umfassendem Ueberblick auf ihr Verhältniß zur deutschen politischen und religiösen Gesammtheit aufzuschwingen, allein in den Männern von Münster den Gedanken aufkommen lassen, ein Reich in ihrer Stadt zu stiften, das allen Ungläubigen an der neuen Zion zum Trotz, in der Mitte feindlicher Umgebungen, sich werde behaupten können.
Westphalen ist ein Land des Bestandes; sein Fortschritt ein langsamer, aber nachhaltiger; ein Land ruhiger praktischer Vernunft, fast mehr der Realität zugewendet, als gut, fast weniger von Idealität beherrscht, als schön ist; mehr der Historie als der abstracten Theorie hold, mehr der Beharrlichkeit, die ergründet, als der Vielseitigkeit, die umfaßt aber nicht verdaut, zugewendet, – ein Land, wie das verwandte England, aber ohne dessen Thatkraft, – ein Land endlich, das einen entschiedenen ausgeprägten Charakter hat – und das ist auch ein Vorzug in so farblosen Zeiten.
Ich habe eben versucht, den Reiz und die Art von stiller entsagungsvoller Poesie anzudeuten, welche auch eine Westphälische Haide haben kann. Farbenreicher und auch schon anerkannter ist die Poesie, welche in den angebauten, Gehölz-, Wiesen- und Kornreichen Gegenden, dem bei weitem größten Theile unsres Landes, um den stillen vereinzelten Bauernhof sich lagert. Ich brauche hier nur an den patriarchalischen Oberhof zu erinnern, wie Immermann in seinem unvergleichlichen »Münchhausen« ihn schildert. Da habt ihr den ganzen poetischen Reiz solch eines Schulzen-, Meyer- oder Oberhofes, wie es in den verschiedenen Landschaften heißt, wohl etwas im Sonntagsputze, wie eine niedliche Bäuerin in der Operette, aber voller Treue sonst in jedem Detail: da liegt der geräumige, reinlich gehaltene Hof mit seinem großen Strohdach, von einem Blüthenregen des nahen knorrigen Birnbaums bestäubt, an ein Gehölz sich lehnend, dessen auffallend saftiges Grün der üppigste Epheu durchrankt; geschäftig umher werken in Speicher und Backhaus alle die stehenden Charactere solch einer Landwirthschaft; der verdrießlich gutmüthige »Baumeister« oder Großknecht spannt die Pferde ein, der Hofschulze hämmert an einem schadhaft gewordenen Rade und schlägt dem Füllen auf die Schnauze, das ihm schnuppernd Kneifzange und Nägel auseinander stöbert; die Enten auf dem Teiche schreien ihre langgezogenen melancholischen Töne aus, die Lerche trillert gellende Laute, einer der Knechte schärft mit Hammerschlägen seine Sense – überall Geräusch und Lärmen und dennoch eine tiefe Stille, eine wie ruhig schlummernde Natur: es ist, als ob die Töne aus der Natur hervor quöllen, das Geräusch ihres arbeitenden Schaffens wären; die Menschen, die Thiere sind wie eins mit ihr, Theile von ihr, sie stören ihren Willen, ihr Wesen nicht, und ihr Wesen ist ruhige Stille. Setzt eine Fabrik, eine Dampfmaschine hierhin, und das Geräusch wird euch unerträglich scheinen: der Lärm, den der hämmernde Knecht macht, stört euch nicht, und wäre er zehnmal ärger; er stört die friedliche Idylle nicht, die über dem patriarchalischen Hofe schlummert und nur erwacht, und wie eine blühende schmucke Lisbeth mit den kerngesunden Wangen, dem blonden geschniegelten Haare, den Augen so hell und rein blau, wie die blauen Blumen einer holländischen Theeschale, vor euch tritt, wenn ein Immermann sie aus dem Schlafe aufruft. –
In den Bergen ist's eng, es zieht dich hinaus in die Weite,
Endlos schließet sich gern unsere Heimath dir auf,
Gleichend des Meeres Gefilden, des Himmels unendlichen Weiten.
Füllt mit Unendlichkeit sie, labet mit sinniger Lust.
Nimmer die Seele verwirren des Lebens schimmernde Reize,
Einfach der Ginster hier blüht, friedlich hier weidet der Hirt;
Aber du hörst mit inniger Lust das Gezirpe der Grillen,
Oder des Kibitzes Schrei, trittst du zu nahe dem Nest.
Oder die Lerche, sie jubelt so hoch, du siehst nicht die Schwingen:
»Komme zu mir, zu mir!« lautet ihr fröhlicher Ruf.
Bald erscheint dir am Saume des Waldes die einsame Wohnung,
Langsam wirbelt der Rauch auf in die sonnige Luft.
Still ist und lautlos der Hof, beschattet von Eichen und Linden,
Bunt in der Kühle gestreckt liegen die Kühe voll Ruh,
Während der mächtige Wall voll struppiger Eichen und Nussholz
Heget das Feld und den Wald, hemmend den schweifenden Blick.
Ganz ungesehen im Grunde hinrinnet und murmelt das Bächlein,
Und der wachsame Hund gibt dir vom Hof das Geleit:
Geh' nicht hinaus in die Welt, in die Weite, bitten sie alle,
Bleibe bei uns und bei dir, heiter und sinnend allein.
Gehst du zum wallenden Feld, die Aehren jährlich vergehen,
Aber die Eichen rings – weißt du wie lange sie stehn?
Wallst du auf dunkelem Weg von der Wälle Gebüschen umwölbet,
Singt dir das Vögelein gern selige Leiden in's Herz.
Niemand begegnet dir, niemand vernimmst du, wenn nicht die Sonne,
Blickend über den Steg freundlich dich Einsamen an.
Wenn nicht ein Weg, tiefschattig den deinen und lautlos durchkreuzend,
Wenn nicht das schmucklose Kreuz heil'ge Gedanken dir weckt.
So schildert den stillen Reiz seiner Heimath ein Dichter, in dessen Poesien die Eigenthümlichkeit des Landes wie zur Blüthe geworden und der mit der folgenden Ballade uns zu einem andren poetischen Momente Westphalens, seinem Volksglauben, hinüber leiten mag:
Aufspringt aus dem Schlaf die emsige Magd:
»Die Glocke schlägt, gewiß hat's getagt!«
Auf die Haide geht sie eilend hinaus,
Zu lesen die Reiser zum Mittag aus.
Die Haide so weit, die Haide so still,
Ist klar wie am Tag: der Mond scheint nur still.
Die Haid' hat ihr silbernes Kleid angethan,
So wallend und weit, wer mißt ihre Bahn?
Sie allein lebt auf Erden, sie feiert die Nacht;
Die Vögel vergaßen der Morgenwacht.
Das Haidekraut flüstert einander zu;
Die Bäume, der Weg sind in tiefster Ruh.
Der Mond in der Bläue so strahlend weilt,
Als ob er bei ihr in Liebe verweilt;
Kein Wölkchen hemmt seinen schimmernden Pfad,
Tief unten nur Nacht sich gesammelt hat.
Die Maid sieht alles voll tiefstem Graus,
Sieht furchtsam zurück zum niedern Haus;
Das blinkt so glänzend im Mondenschein,
Als lebt es nun auch und für sich allein.
Da in der Helle ein Wagen erscheint:
Vier dunkele Rosse stürmen geeint;
Es kommt kein Rauschen, es tönet kein Huf,
Und niemand lenket, kein eifriger Ruf.
Ueber die Wasser der Tiefe hinsprengt das Gespann,
Nicht rauschen, nicht kräuseln die Fläche begann;
Der Mond sieht wie sonst im Spiegel sich an:
Die Maid erstarret: da krähet der Hahn.
S. Gedichte von W. Junkmann, Münster 1836.
Was unsern Volksglauben betrifft, so kann man ihm nicht nachsagen, daß er just reichere Blüthen aus dem Grunde des räthselhaften Zusammenhangs zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt zu ziehen wisse, als bei andern Stämmen, wo oft eine weit mehr dichterische Phantasie sie befruchtet. Wir haben unsren Geisterglauben, wie jedes andre Volk; aber er ist nicht reich an besondren Momenten, es sind Variationen des alten Thema's, welches dämonische Mystik durch aller sinnigen Menschen Gemüth klingen läßt; grade dämonische Mystik ist es nämlich, welche hauptsächlich im Volke lebt. Und das so vorwiegend, daß es sich zu jenem besondren, Westphalen eigenthümlichen » second sight«, »der Vorgeschichte«, entwickelt hat. Das vorausgesandte Gedicht malt eine der Erscheinungen aus, die man sich in Westphalen erzählt: ich lasse noch eines Von Annette von Droste zu Hülshoff, wie auch das vorhergehende »Der blonde Waller«, und die nachfolgenden: »Kurt von Spiegel«, »Das Fegefeuer des Westphälischen Adels«, »Erzbischof Engelbert«, ursprünglich für die Aufnahme in das vorliegende Buch geschrieben. hier folgen, da man auf diesem, einer kritischen Analyse weniger, als jedes andre, zugänglichen Gebiete am besten das Beispiel für sich selbst reden läßt. Zur Erläuterung des Gedichts muß ich nur die Bemerkung voraussenden, daß den Sarg eines Kindes nach adlichem Gebrauch die Wappen von Vater und Mutter schmücken, Rosen und Pfeile also hier dem schauenden Freiherr seines Sohnes Sarg, die Rosen seines Wappens allein den eignen bezeichnen müssen.
Vorgeschichte.
 ennst du die Blassen im Haideland,
ennst du die Blassen im Haideland,
Mit blonden flächsenen Haaren?
Mit Augen so klar wie an Weihers Rand
Die Blitze der Welle fahren?
O sprich ein Gebet, inbrünstig, echt,
Für die Seher der Nacht, das gequälte Geschlecht!
So klar die Lüfte, am Aether rein
Träumt nicht die zarteste Flocke,
Der Vollmond lagert den blauen Schein
Um des schlafenden Freiherrn Locke,
Hernieder bohrend in kalter Kraft
Die Vampyrzunge, des Strahles Schaft.
Der Schläfer stöhnt, ein Traum voll Noth
Scheint seine Sinne zu quälen,
Es zuckt die Wimper, ein leises Roth
Will über die Wange sich stehlen;
Schaut, wie er woget und rudert und fährt,
Wie Einer, so gegen den Strom sich wehrt.
Nun zuckt er auf – ob ihm geträumt,
Nicht kann er sich des entsinnen –
Ihn fröstelt, fröstelt, ob's drinnen schäumt
Wie Fluthen zum Strudel rinnen;
Was ihn geängstet, er weiß es auch:
Es war des Mondes giftiger Hauch.
O Fluch der Haide, gleich Ahasver
Unterm Nachtgestirne zu kreisen!
Wenn seiner Strahlen züngelndes Meer
Aufbohret der Seele Schleusen,
Und der Prophet, ein verzweifelnd Wild,
Kämpft gegen das mählig steigende Bild.
Im Mantel schaudernd mißt das Parquet
Der Freiherr die Läng' und Breite,
Und wo am Boden ein Schimmer steht,
Weit aus er beuget zur Seite;
Er hat einen Willen und hat eine Kraft,
Die sollen nicht liegen in Blutes Haft.
Es will ihn krallen, es saugt ihn an,
Wo Glanz die Scheiben umbreitet,
Doch langsam weichend, Spann' um Spann',
Wie ein wunder Edelhirsch schreitet,
In immer engeren Kreis gehetzt,
Des Lagers Pfosten ergreift er zuletzt.
Da steht er keuchend, sinnt und sinnt,
Die müde Seele zu laben,
Denkt an sein liebes einziges Kind,
Seinen zarten, schwächlichen Knaben,
Ob dessen Leben des Vaters Gebet
Wie eine zitternde Flamme steht.
Hat er des kleinen Stammbaum doch
Gestellt an des Lagers Ende,
Nach dem Abendkusse und Segen noch
Drüber brünstig zu falten die Hände;
Im Monde flimmernd das Pergament
Zeigt Schild an Schilder, schier ohne End'.
Rechtsab des eignen Blutes Gezweig,
Die alten freiherrlichen Wappen,
Drei Rosen im Silberfelde reich,
Zwei Wölfe schildhaltende Knappen,
Wo Ros' an Rose sich breitet und blüht,
Wie überm Fürsten der Baldachin glüht.
Und links der milden Mutter Geschlecht,
Der Frommen in Grabeszellen‚
Wo Pfeil' an Pfeile, wie im Gefecht,
Durch blaue Lüfte sich schnellen.
Der Freiherr seufzt, die Stirne gesenkt,
Und – steht am Fenster, bevor er's denkt.
Gefangen! gefangen im kalten Strahl!
In dem Nebelnetze gefangen!
Und fest gedrückt an der Scheib' Oval,
Wie Tropfen am Glase hangen,
Verfallen sein klares Nixenaug',
Der Haidequal in des Mondes Hauch!
Welch ein Gewimmel! er muß es sehn,
Ein Gemurmel! er muß es hören,
Wie eine Säule, so muß er stehn,
Kann sich nicht regen noch kehren.
Es summt im Hofe, ein dunkler Hauf –
Und einzelne Laute steigen auf.
Hei! eine Fackel! sie tanzt umher
Sich neigend, steigend im Bogen,
Und nickend, zündend ein Flammenheer
Hat den weiten Estrich umzogen.
All' schwarze Gestalten im Trauerflor,
Die Fackeln schwingen und halten empor.
Und alle gereiht am Mauerrand,
Der Freiherr kennet sie Alle;
Der hat ihm so oft die Büchse gespannt,
Der pflegte die Ross' im Stalle,
Und der so lustig die Flasche leert,
Der war sein Leibbursch, vor Andern werth.
Nun auch den alten Kastellan,
Die breite Pleureuse am Hute,
Den sieht er langsam, schlürfend nahn‚
Wie eine gebrochene Ruthe;
Noch deckt das Pflaster die dürre Hand,
Versengt erst gestern an Heerdes Brand.
Ha, nun das Roß! aus des Stalles Thür,
In schwarzem Behang und Flore;
O, ist's Achill, das getreue Thier?
Oder ist's seines Knaben Medore?
Er starret, starrt und sieht nun auch,
Wie es hinkt, vernagelt nach altem Brauch.
Entlang der Mauer das Musikchor,
In Krepp gehüllt die Posaunen,
Haucht grüßend leise Cadencen hervor,
Wie träumende Winde raunen;
Dann Alles still. O Angst! o Qual!
Es tritt der Sarg aus des Schlosses Portal.
Wie prahlen die Wappen, farbig grell
Am schwarzen Sammet der Decke.
Ha! Ros' an Rose, der Todesquell
Hat gespritzet blutige Flecke!
Der Freiherr klammert das Gitter an:
»Die andere Seite!« stöhnet er dann.
Da langsam wenden die Träger, blank
Mit dem Monde die Schilder kosen.
»O, – seufzt der Freiherr – Gott sei Dank!
Kein Pfeil, kein Pfeil, nur Rosen!«
Dann hat er die Lampe still entfacht,
Und schreibt sein Testament in der Nacht.
Vor den andern deutschen Stämmen ist, glaub' ich, die Vorgeschichte, die Sehergabe der »Spökenkieker«, der »Wicker« (von »wicken,« wahrsagen) den Westphalen eigenthümlich; es ist dasselbe, was das second sight der Inselbewohner des nördlichen Britanniens; unsre blassen Nixäugigen Seher sind ganz, was den Faroe-Insulanern ihre »hohlen Menschen,« deren Geist sich aus dem Leibe entrückt und die Zukunft als Gegenwart sieht, in deren unruhvolle Nächte, wo eine höhere Gewalt sie auf- und hinaustreibt zum Schauen, kommende Ereignisse ihre Schatten werfen. Das mitgetheilte Gedicht: »Die Vorgeschichte« schildert diesen Zustand und all sein Grausiges so, daß ich nichts hinzuzusetzen habe, als die Bezeugung vieler auffallender Beispiele ähnlicher, nicht seltener Vorkommnisse. Wer die stillen ernsten Menschen, die mit der Sehergabe behaftet sind und wie eine Qual betrachten, kennt und sprach, wer Augenzeuge der Erfüllung ihrer Gesichte war, wird sich versucht fühlen, den Zweifel fahren zu lassen, welcher die Lösung des Wunderbaren doch nur durch ein noch Wunderbareres, die ungeheuerliche Einbildungskraft schlichter gewöhnlicher Menschen, zu bewerkstelligen weiß. – Diese Sehergabe stirbt übrigens mehr und mehr aus: in aller ihrer Unheimlichkeit sehe ich sie nur noch durch die Tage meines Knabenalters schreiten, eine hohe gebückte Gestalt mit schmalem blassem Antlitz und starren hellgrauen Augen, die unter dem breitbeschattenden Rande eines runden Bauerhut's hervorstachen. Wir Knaben scheuten diese bohrenden Blicke, des Mannes lahme dürre Hand, mit der er doch stärker war, als viele andre Menschen, am meisten seine Scherze, denn er stack voll schnackischer Einfälle‚ als ob die Heiterkeit seiner Tage das Grauen seiner Nächte übertäuben solle, die ihn unter den Apfelbaum hinter seiner Hütte hinaustrieben, am Horizonte ein flammendes Dorf, in seiner Nähe das Vorüberbewegen eines lautlosen Leichenzugs zu sehen, während weit in die nächtliche Haide hinaus das Geheul seines Hundes erscholl, der seines Herrn Gabe zu theilen schien. – –
Diese Episoden haben uns den Weg verkürzt in's »Heim der Tubanter« oder Bentheim, dem Felsenschloß, das auf so vielen Bildern Ruisdael's die Staffage bildet. Man ist überrascht, hier in der weiten Ebene plötzlich ein mächtiges graues Burggebäu auf hohen Felsen dräuen zu sehen, auch eine Art Episode, die aus ganz andern Bereichen in diese versetzt scheint. Die Burg, durch Alter, Stärke und Schönheit gewiß die merkwürdigste unseres Landes, liegt an der Nordseite des Städtchens Bentheim, welches sich an dem Berg, den jene krönt, entlang zieht; über den freien Raum zwischen beiden steigt man hinauf, durch ein erstes Thor unter dem Amthaus weg, dann links gewendet, zur Rechten die alte, jetzt anders benutzte Katharinenkirche lassend, durch ein zweites Thor in den eigentlichen sehr geräumigen Schloßhof. Hier fällt von noch bewohnbaren Gebäuden südlich, nach dem Städtchen hin, an die Burgmauer sich lehnend das »neue Gebäude« in die Augen, und der links davorstehende mächtige viereckige Thurm, nach der Inschrift erbauet 1418 von Junckherr Everwyn, graven tho Benthem und Tecklenborg. Vor uns in der nordwestlichen Ecke erhebt sich das verfallende Bauwerk, welches die Kronenburg genannt wird und in dem ein altes Gewölbe als Heidentempel bezeichnet wird; in der südwestlichen der große runde Thurm, der in seinen in den Fels gearbeiteten Substructionen Verließe und in großen eisernen Ringen Reste von Folterwerkzeugen enthält. Vgl. über diese und die andern Landesburgen das gründliche Werk: Dr. Nordhoff, der Holz- und Steinbau Westfalens. Münster, 1870. Mauern mit Zinnen umgeben das Ganze; von dem Wehrgang auf ihrem Kamm herab hat man eine schöne und ausgedehnte Aussicht; westwärts sieht man wie zum Schutz vor die Burg mächtige Felsblöcke geworfen; einer davon wird des Drusus Ohrkissen oder das Teufelskissen genannt: er trägt die kaum 200 Jahre alte Inschrift: » Hic Drusus Jura dixit Tubantibus.« Nach Norden, wo die Baumwipfel der Wildbahn über den Rain emporragen, blickt man auf den Bentheimer Wald, in welchem, etwa 20 Minuten von der Stadt entfernt, der bekannte kalte salinische Schwefelquell mit Badeanlagen und Conversationshaus liegt, im Sommer von zahlreichen Gästen aus dem benachbarten Holland besucht.
Daß schon die Römer den Felsen von Bentheim befestigt, ist wahrscheinlich; daß Drusus die Feste erbaut, eine Sage, die sich ebensowenig beweisen als widerlegen läßt; daß in der fränkischen Zeit die Grafen des Gaues »Bursibant« dort gehaust, darf wohl als sicher angenommen werden. Aber sehr schwer ist die älteste Genealogie der Bentheimschen Grafen festzustellen. Das Haus der heutigen Fürsten von Bentheim ist so zu sagen aus drei Quellen zusammengeströmt, von der jede für sich verfolgt werden müßte. Wir finden zuerst ein fränkisches Geschlecht; dann Grafen von Rheineck, deren erster sich mit Gertrud, der Richenza, Kaiser Lothars Gemahlin, Schwester, vermählt, so daß nun Grafen aus dem Rheineckschen Hause die Burg inne haben, freilich nur in der weiblichen Linie durch die Stammmutter Sophie, fortblühend und sich in die Linien der Grafen von Holland und der Grafen von Bentheim theilend. Mit dem Grafen Bernhard stirbt 1421 dieser Stamm in Bentheim aus, und nun folgt das Dynastengeschlecht der durch frühere Heirathen mit Töchtern des Hauses zur Erbschaft berufenen Güterswyck.
Von jener Stammmutter Sophie wird erzählt, daß sie drei Mal nach Jerusalem gepilgert und auf der dritten Wallfahrt gestorben sei, und als weiße Frau auf dem Schlosse umgehe, das Absterben eines Familiengliedes zu verkünden. –
Die Edlen von Güterswyck erwarben durch Heirath ebenfalls die Güter der alten Edlen von Steinfurt, einen Theil der alten Bronckhorst-Solms'schen Güter, die Erbschaft der Nuenar am Rhein und, wie wir bereits sahen, die Erbschaft der Tecklenburgschen Grafen – tu felix Austria nube! –
Aus der neueren Geschichte des fürstlichen Hauses erwähnen wir, daß Graf Friedrich Karl Philipp 1753 seine Grafschaft Bentheim an Hannover verpfändete; daß unter diesem Pfandbesitz die Burg militairisch besetzt und befestigt wurde, daß 1795 eine französische Truppe unter Vandamme von Holland her wider sie vordrang, sie beschoß und grausam verwüstete. Karl Philipp starb 1803 kinderlos auf seinem Landsitz Fontenay bei Paris. Ihm folgte sein Lehnsvetter, Ludwig Wilhelm Geldrisch Ernst, zu Steinfurt, der Schöpfer des Bagno's, unter dem das Haus 1817 von Preußen in den Fürstenstand erhoben wurde, und von dessen zwei Söhnen Alexius sein Nachfolger wurde, Friedrich Belgicus Wilhelm sich als österreichischer Feldmarschalllieutenant Kriegsruhm erwarb, – derselbe, von dem uns Varnhagen von Ense im 7. Theile seiner Denkwürdigkeiten berichtet.
Steinfurt ist die jetzige Residenz des fürstlichen Hauses. Diese Stadt scheint ursprünglich nur der Edelhof gewesen zu sein, worauf als Allodialgut ohne Belehnung und Verleihung die Edlen von Stenvorde saßen, als ein dem hohen Reichsadel angehörendes Geschlecht, wahrscheinlich altsächsischen Adaling-Blutes und wohl von den fränkischen Edelgeschlechtern zu unterscheiden, die durch kaiserliche herübergesandte Beamtete (Grafen) in Sachsen gestiftet wurden, oder von den bloß ritterbürtigen Familien, welche vom Kaiser oder diesen Grafen selbst wieder ein Burglehn inne hatten. Der Name des ersten Dynasten, der bekannt geworden, ist Reinhard, um 1060; er war wie seine Nachfolger Edelvogt von St. Mauritz bei Münster. Er mag auch einer der Erbauer des jetzigen Schlosses zu Steinfurt sein, dessen Alter in den Anfang des 12. Jahrhunderts hinaufreicht. In dem letzten Sprossen Ludolph VII. erhielt das Geschlecht seinen höchsten Glanz durch die Besiegung des mächtigen kriegerischen Bischof's Otto IV. von Münster, der eine Zeitlang in Steinfurt gefangen saß, bis Erich von Hoja und der Bischof von Paderborn durch eine Belagerung seine Befreiung erzwangen (1396). Ludolph's und seiner Gemahlin Locke Tochter Mechtildis brachte Steinfurt im 15. Jahrh. an den Güterswyckschen Stamm der Grafen von Bentheim.
Sehenswürdiger als das Schloß zu Steinfurt oder das fürstliche Museum mit manchen merkwürdigen Besitzthümern aus allen Weltgegenden, von der Egyptischen Mumie bis zum Skalpmesser und Wampum des Huronen, ist die herrliche Gartenanlage, die sich südöstlich von der Stadt eine Stunde weit hinauserstreckt: das Bagno. Es verdankt seine Entstehung zumeist dem Geschmacke des Grafen Ludwig, welchen wir oben Bentheim mit seinen Steinfurtischen Besitzungen vereinigen sahen. Die schönsten Rasen- und Waldpartien gruppiren sich um das Herz der ganzen Anlage, einen See, der groß genug, um mehrere vom mannigfaltigsten Baumschlag bedeckte Inseln tragen zu können, doch nicht so gedehnt ist, daß eine öde Wasserfläche die Anmuth des Uebrigen störte. Die bedeutendste der Inseln trägt auf künstlich aufgethürmten Felsen eine recht hübsche gothische Burg, die mit ihren halbzerstörten schlanken Structuren wie eine versteinerte Matthissonsche Elegie durch düstre Fichtenzweige schaut. Ein großes Conzert-, ein Ballhaus, der Kiosk, die Kettenbrücke, ein zerstörter Tempel beleben andre Partien des Park's; der große Springquell aber ist versiegt und das ungeheure Wasserrad, das, weit in die Gegend hinaus sichtbar, die höchsten Waldeswipfel überragt, ruht gelähmt, wie so viele derartige Anstalten; man weiß Räder und Mechanismen jetzt nützlicher anzuwenden, als Wasserstrahlen damit in die Luft zu schleudern; die Welt hat sich des Spiel's entwöhnt und nennt die Zeit der künstlichen Fontainen, der Memoiren, der Paniers und der Hautelistapeten die des Zopfgeschmacks; diese Menschen mit den Zöpfen und den Rococo-Degen müssen sich das heute gefallen lassen und mit der Tatsache entschädigen, daß sie ihrer Zeit doch weit sorgloser das Leben auskosteten als wir. – Der Fußweg, welcher vom Bagno nach Münster führt, mag lange Zeit nicht gewahren lassen, daß man die Grenzen der Anlagen längst überschritten hat, denn er schlängelt sich durch ein so mannichfach abwechselndes Gelände von Flur und Wald, bergartigem Hügel und Au, Kamp und Gehöfte und wipfelbeschattetem Dorf, daß man noch immer wie in einem englischen Park sich glaubt; es ist eine vielbebaute, fruchtbare, schöne Landschaft, die, außer dem Vorzuge reicher Abwechselung, durch ihre eigenthümlich schönen Buchen- und Eichenwaldungen voll Nachtigallenschlag und dunkelglänzendem Epheu, durch üppige gelbe Kornfelder und schwerüberästete Obstgärten ein besondres Gepräge warmer heimathlicher Behaglichkeit bekommt. Zur Rechten lassen wir das Städtchen Horstmar mit seiner Erinnerung an seinen letzten Grafen Bernhard, den Westphälischen coeur de lion, der im dritten großen Kreuzzuge der glänzendste Vertreter der deutschen Ritterschaft, deutscher Frömmigkeit und Heldenmuthes war. Am Ende der Wanderschaft zeigen sich die ragenden blauen Thürme von Münster, die über einen Kranz von Lindenwipfeln sich erheben, in reicher Zahl, hoch und eigenthümlicher Gestaltung, daß sie imponiren wie das Gethürm größter Städte. Die stumme Größe imponirt ja immer; nur die laute weckt die Kritik und den Widerspruch; das thun auch die Thürme von Münster, wenn sie zu laut werden. Und doch ist so arm, wem die Glocken zu laut werden können, wem sie nicht eine Seite anschlagen, die an den Feiertagen seines Lebens vibrirte, die in die Oster- und Weihnachtsdämmerungen seines Sein's ihre Klangfiguren hauchte, Gestaltungen voll froher Gottesscheue und unerfassbar doch wie die Musik. Wem in seine Tage voll harter Helle das Sonntagsglänzen eines weicheren Lichtes je gefallen und dem Engel, der in seinem Herzen schläft, neue Träume zugeführt hat, dem weckt es die alten Stimmungen wieder, wenn von allen Thürmen die Glocken läuten; aber wie Klänge emportönen aus dem tiefen Grunde des schilfumhegten Weihers, drin einst ein Dom versunken, und von wundersamer Historie und reichem Sagenhort erzählen, die dort begraben sind, müssen die Glocken aus seines Herzens Grunde nachklingen können und dies Echo von einer eben so wundersamen Historie, von eben so reichem begrabenem Horte zu erzählen haben. – Für die, welchen die Glocken zu viel läuten, ist dies nicht geschrieben; der Engel, der in dem Herzen der Menschen schläft, ist oft ein Siebenschläfer: wer die bunten Wachslichter am Weihnachtsbaume seines Lebens Sparens halber unangezündet lassen will, der hätte sie besser beim Lichtzieher gelassen.
Wir betreten Münster von einer Seite her, wo uns wenig noch an das Alterthum der geschichtlich so denkwürdigen Stadt erinnert. Die schönen Lindenalleen der Promenaden nehmen mit ihren Wipfelkronen die Stelle der alten Wallmauern ein: ein großer Platz dehnt sich vor uns aus, rechts prangt das im Geschmacke des vorigen Jahrhunderts erbaute Schloß, an den Hain seines (botanischen) Gartens gelehnt. Es ist hochgebaut, mit vielen Risalits und reichen Steinmetzarbeiten verziert, ein Mittelbau mit zwei nach der Stadt hin vorspringenden Flügeln, und würdig einer königlichen Residenz. Im Innern sind der Fürstensaal mit den Bildnissen der Fürstbischöfe von Münster, gemalt von Stratmann, und in der Kapelle ein Gemälde von einem der Tischbein sehenswerth. Man mag über diese Baukunst à la Mansard oder Bernini urtheilen, wie man will, sie besitzt ihren entschiedenen Charakter, sie ist ein Geschöpf ihrer Zeit und von dieser ausgeprägt; sie hat deshalb auch ihre Romantik, wenn man es so nennen will, sie weckt Gedanken, Erinnerungen, und diese Erinnerungen haben ihre Poesie, wenn auch nur eine Poesie à la Chaulieu oder Gresset. Ihre Verzierungen mögen geschmacklos sein, aber sie sind Symbole üppig überwuchernden Reichthums, wie die Zeit in Ueppigkeit überwucherte; die schlanke Schönheit der Jonischen Säule und ihres Architravs einfach edle Formen mögen entstellt, überladen, verschroben sein von diesem siècle de Louis XIV.; aber machte es nicht auch die Köpfe der Menschen so gut wie die Capitäle der Säule überladen und verschroben, außen durch Alongeperücken und innen durch eine Alongemoral der wunderlichsten Art? Jene Zeit war kräftig genug, ihrem Gehalte eine entsprechende Form zu finden, welche dadurch ihre Berechtigung erhält: sie war darin glücklicher als die unsre mit ihrem fortwährenden Dilettiren in allen möglichen Formen und Stilen. Ich zweifle, daß unsre Baukunst jemals ihre Romantik bekommen wird. – Das Schloß ist 1767 an der Stelle einer von Bischof Bernhard von Galen errichteten Citadelle erbaut, auf Kosten der Landstände, durch den Baumeister General Schlaun, unter der Regierung des Fürstbischofs und Kölnischen Churfürsten Maximilian Friedrich, Graf von Königsegg-Rothenfels, und war lange die Wohnung des Fürsten Blücher. Vom Schlosse her betreten wir nun die Stadt selbst und blicken, wo der erste Platz sich lichtet, erstaunt zu der grandiosen Moles des Thurms der Ueberwasserkirche zu unsrer lieben Frauen empor; er ist in ganz gothischem Style aus großen Sandsteinquadern zu einer Höhe aufgeführt, die trotz seines bedeutenden Umfangs ihm alles Schwerfällige nimmt. Einer Spitze von 100 Fuß Höhe beraubte ihn ein Orkan im Anfange des vorigen Jahrhunderts. Die Kirche selbst zeigt schöne Structuren, aber sie hat nichts von dem außerordentlich Imposanten ihres herrlichen Thurmes. Sie ward 1040 mit großem Pompe und im Beisein Kaiser Heinrichs III. nebst einem dazu gehörenden Benediktinessen-Kloster eingeweiht, dessen erste Abtissin des Kaisers Schwester war. Ihr Inneres schmückt eine Votiv-Tafel über dem Grabe der berühmten Maler Tom Ring, die im 16. Jahrh. ihre Vaterstadt mit Arbeiten von hohem Werthe bereicherten. Vom Hofe der Liebfrauenkirche führt eine Brücke über die Aa uns auf den erhöht liegenden, von hohen Linden überdunkelten Domplatz und vor die westliche Fronte der Cathedrale mit ihren beiden Thürmen und der grauen Giebelfaçade. Der Stil dieser, so wie einer andern nach Süden gerichteten Façade des obern Querbalkens (denn wie gewöhnlich bildet auch hier das ganze Gebäude die Kreuzesform nach), ist gothisch, bei der letztern in den obern Theilen schon Renaissance; sonst prägt sich überall der Uebergang von der vorgothischen zur gothischen Kunst aus. Das Ganze ist großartig und massenhaft, nur etwas schwerfällig im Innern. Auch ist das Innere häßlich verbaut durch einen Lettner aus ganz spätgothischer Zeit, der längst hätte beseitigt sein sollen. Zur Seite des Hochaltars dient jetzt der Spieltisch König Johann's von Leiden zur Aufnahme der bei dem Gottesdienst nöthigen Gefäße.
Wenn wir nun noch die übrigen Merkwürdigkeiten des Doms beschaut haben, die berühmte Uhr, die Bilder und unter ihnen Tom Ring's erstehenden Lazarus, das Plettenberger Monument, (des Münsterländers Gröninger plastisches Meisterwerk), und W. Achtermanns Marmorgruppen, Bernhard's von Galen Kapellen mit der Bronzebalüstrade aus erobertem holländischem Geschütz, müssen wir in das Kapitelhaus des Domes treten, einen Raum mit prächtigem Getäfel voll geschnitzter Wappen und Zierrathen, mit den großen schlechten Bildern, die uns aber die ganze Herrlichkeit der alten Zeit wachrufen, als noch ein großes weites Land hier bei Sankt Paul und dessen Stift seine Sendboten stellte, um zu huldigen und zu prästiren, Lehne zu muthen und aufzutragen, als man Wappen vor ihm aufschwor und aus den Edlen des Landes seine Fürsten kürte, mit stolzer Selbständigkeit des Reichstags Recesse ad acta legte oder Römisch Kaiserlicher Majestät Mandata und eilfertigste Aufgebotte zur Beyhülf gen den grausambst herandrohenden Erbfeind der Christenheit demnächst gnädigst später einmal zu berücksichtigen beschloß. Es war eine wunderbar naive Zeit, als solch ein Stift auf seine gemüthliche Weise souverain über Land und Leute schaltete, oder nicht schaltete! Denn daß es nicht regierte, daß alles patriarchalisch aus Staats- und Regierungsrecht in den Bereich des Privatrechts gezogen wurde, war es allein, was die herrschenden Institute jener Zeit unangefochten ließ. Modernes Vielregieren hätte damals alles in die bunteste Verwirrung gestürzt.

Die Sage läßt eine durch den heiligen Suibertus geheilte Matrone an der Stelle des Domes aus Dankbarkeit die erste Kapelle errichten: im Jahre 792 erbaute der heilige Bischof Ludger die erste Kirche und eine Wohnung für ihre Kanoniker, ein Münster, hier; die wachsende Bevölkerung zwang 992 Bischof Dodo, eine größere südöstlich daneben zu bauen, die aber bei einer Belagerung der Stadt durch Herzog (Kaiser) Lothar von Sachsen 1121 niederbrannte, worauf der jetzige Dom unter mehreren Bischöfen von 1170 etwa an bis zur Einweihung 1261 zu Stande kam. Dann brach man Ludgers alten Dom ab und baute an seiner Stelle 1878 den Kreuzgang, die schöne, »Umgang« genannte offene Halle.
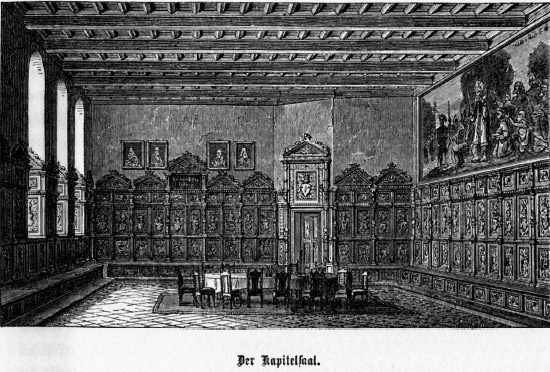
Vom Domhofe gelangen wir auf den Marktplatz der Stadt, deren eigenthümlicher scharf ausgeprägter Charakter voll Würde und stolzen Trutzes auf altbewährte Bestandesart hier am meisten in den schweren Wölbungen der Arkaden mit ihren massiven Pfeilern, den hohen Giebelfronten mit gothischem oder Renaissance-Schmuck sich ausspricht. Vor allen zieht das Rathhaus unsere Blicke auf sich; ich glaube nicht, daß Deutschland irgend eins besitzt, welches wagen dürfte, sich mit ihm zu messen. Das beigefügte Abbild zeigt seine schönen reingothischen Structuren, deren Zierrathen in Statuen, Blätterwerk und Zinkenkronen von einer außerordentlich fleißigen und feinen Arbeit zeugen. Oben über dem deutschen Doppelaar steht die Gestalt des Königs Cambrinus von Flandern, einen schäumenden Pokal voll des Getränks, das er erfand, in seiner Linken. Unter den Arkaden hingen früher hinter einem eisernen Gitter Marterwerkzeuge, die bei der Hinrichtung der Wiedertäufer dienten, und eisernes Falschmünzergeräth aus späterer Zeit. Im hinteren Theile des Rathhauses zu ebener Erde befindet sich der Friedenssaal, ein dunkler echt mittelaltriger Raum mit Getäfel und Schnitzwerk, großem Kamin und Glasmalereien, alten Harnischen und Schwertern von colossaler Gestalt. An den Wänden laufen Bänke umher, auf denen gestickte Polster noch die Plätze der Gesandten während der Verhandlungen des Westphälischen Friedens bezeichnen: alles ist unangetastet geblieben, wie es 1648 war und die ehrenfesten und gestrengen, hochgebornen und durchlauchtigen Herrn da oben an der Wand könnten aus den schwarzen Eichenholzrahmen kühnlich herabsteigen und wieder über das Geschick Europa's und den Titel Excellenz zu delibriren beginnen: es würde uns kein Wunder nehmen, in diesem so völlig einem verschwundenen Jahrhundert angehörenden Raume die schwarzen bauschigen Sammetgewänder, die ungeheuren Halskrägen, die Ordensketten des goldenen Vließes, das rothe Käppchen des Cardinals und den dreist aufgestülpten Herzogshut Longueville's zu erblicken, plötzlich diese markirten, echt spanischen und französischen Physiognomien voll feinen sprechenden Geistes, diese ernsten, gelahrten deutschen Gesichter sich bewegen, aufs neu ihr fürsichtiges Gespräch und abgemüßigtes Anheimstellen beginnen zu sehen. – Die Portraits der Gesandten und ihrer Souveraine sind von Gerhard Terbourg, dem Niederländischen Meister, der außerdem durch seine Behandlung von Seidenstoffen so berühmt geworden ist, mit außerordentlicher Kunst nach der Natur gemalt. – Man zeigt im Friedenssaale unter andern Merkwürdigkeiten noch den Pantoffel der Elisabeth Wandscherer, der von ihrem Gemahl mit eigener Hand enthaupteten Königin Johann's von Leiden und die Nachbildung eines eisernen schweren Halsbands, das inwendig mit vielen Stacheln und mit einer Klappe, um den Mund zu bedecken, versehen, einst einem Herrn von Oer von seinem Feinde Gerhard von Haaren von einem Hinterhalte aus so um den Hals geworfen wurde, daß nichts die fest in einander gesprungenen Federn des künstlichen Mechanismus wieder lösen konnte. Von Oer würde in der wahrhaft diabolischen Klemme verschmachtet sein, wenn nicht endlich ein Schmied mit drei gewaltigen Hammerschlägen das Marterwerkzeug gesprengt hätte.

Das folgende Gedicht, welches ein Besuch des Saales mit F. Freiligrath veranlaßte, mag hier eine Stelle finden.
Zum Friedenssaal! – Es war ein sonn'ger Tag,
Die Lind' im Vorhof hauchte ihre Schatten
Leis auf die bunten Scheiben, und es brach
Das Licht die Strahlen in ein trüb Ermatten:
Nicht in die düstern Schauer wollt es sehn,
Durch diese Bögen, die einst Sachsen schlugen,
Dran Kaiser Karl's und Heinrichs Bilder stehn,
Die Heiligen, die Deutschlands Krone trugen;
Darob der Aar, des Reiches stolz Panier,
Der deutschen Kaiser schreckende Standarte,
Die Flügel schlagend an der Stadt Zimier,
An blanker Zinne ihrer Freiheit Warte.
Es ist ein düstrer, feierlicher Ort!
Viel Bilder schauen aus vergilbten Mienen –
Hier Trautmannsdorff und Oxenstierna dort –
Als ob sie selber sich zu zürnen schienen,
Daß sie in diesem Raum hier die Pracht,
Die Kraft, die Herrlichkeit des Reichs begraben,
Und einen Frieden schmachvoll hier gemacht,
Nach welschem Sinn mit welscher Zunge haben.
Es ist ein düstrer feierlicher Ort,
Durch den verstorbner Tage Schatten schwanken,
Und durch Jahrhunderte so siecht er fort,
Ein letzt Asyl gespenstischer Gedanken.
Rings steht von alten Panzern eine Zahl
Mit Schien' und Tartsch', verborgen und verrostet:
Der lang bestäubten Ritterschwerter Stahl
Hat schon der Väter Blut nicht mehr gekostet.
»Nimm eins zur Hand! Schwing du des Kaisers Schwert!
So wie der Rothbart einst dein Spiel geschlagen,
So bist auch du es, Mann der Lieder, werth,
in deiner Faust des Kaisers Schwert zu tragen!«
»Mir diese Wehr!« – Das mächt'ge Waffen klirrt‚
Wir lassen keck es um die Häupter kreisen:
»Gekreuzt die Klingen!« – Ha, der Funke schwirrt,
Und rasselnd wetzt die Scharten sich das Eisen! –
»Schwang so dein Roland einst mit läß'ger Faust
Um Sarazenenköpfe Durindane?
Hat Rothbart so durchs Schlachtgewühl gebraus't?
Du bist so stark nicht wie dein grimmer Ahne:
Gewalt'ge Wucht! der Arm erlahmt und sinkt:
Da, lass den Flammberg und die Helme stehen;
Sieh, wo im goldnen Sonnenlicht uns winkt
Mit lust'gem Flattern unsres Banners Wehen.
Der Blüthenzweig‚ gewiegt in blauer Luft! –
Die herzgeformten Blätter dieser Linden,
Der Liebe heilig, opfern ihren Duft
Den frischen Stunden nur, bis sie entschwinden.
Und lockt uns Kampf – das doppelschneid'ge Wort
Gilt es wie blinkend hellen Stahl zu biegen,
Zu stehn wie keck behelmte Ritter dort,
Wo Recht und Licht ob altem Dunkel siegen!«

Den Friedenssaal übertrifft an Schönheit der in neuerer Zeit ausgebaute Festsaal im Rathhaus, der nach dem Plane des Berliner Architekten Salzenberg 1862 vollendet wurde. Er enthält zwölf meist trefflich gemalte Bilder von Männern, die sich um die Stadt verdient gemacht haben – leider fehlt darunter tom Ring, der wackere Maler.
Neben dem Rathhause ist der Ausbau vor der Fronte des Stadtweinhauses, der sogenannte Sentenzbogen, ein hübsches Werk des Barockstils und eine Strecke südwärts die Renaissance-Fronte des Stadtkellergebäudes zu beachten, das in seinen Räumen die Sammlungen des Westphälischen Kunstvereins beherbergt, die namentlich durch manches werthvolle Stück altwestphälischer Kunstübung und einige neuere Bilder beachtenswerth sind. Wir dürfen diese Räume nicht verlassen, ohne hier ein Wort über das, was überhaupt Westphalen zur Entwicklung deutscher Kunst beigetragen, einzuschalten.
Wie überall finden wir in der ältesten Zeit Malerei und Bildnerei auch hier der Architektur dienstbar. Diese bildet sich aus im Gleichschritt mit ihrer Entwicklung in den übrigen deutschen Ländern; nur bietet sie hier in unserm Lande zähen Beharrens das einzige Phänomen dar, daß der gothische Baustil bei uns gar nicht ausgeht, auch in der Zeit, wo er überall sonst erstorben ist; noch um 1663 wurden die Galenschen Kapellen am Dom zu Münster, noch am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts wird die Kirche zu Sassenberg in gothischem Stile, ja noch 1773 die Kirche zu Hopsten nach gothischer Construction gebaut!
Mit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts macht sich, während die Entwicklung der Architektur stockt, ein erhöhtes, wie in größerer Freiheit aufathmendes Leben der anderen Künste, die sich vom Dienste der Architektur emancipiren, bemerklich. Und hier tritt uns denn nun sofort der größte Maler entgegen, den Westphalen hervorgebracht hat, der sogenannte Liesborner Meister, wahrscheinlich ein Mönch der ältesten Klosterstiftung des Münsterlandes, der Abtei Liesborn. Er schmückte im Jahre 1465 fünf Altäre der dortigen Klosterkirche mit Gemälden aus, welche eine alte Chronik so reich an Gold- und Farbenpracht nennt, daß ihm unter den Griechen der erste Rang gebührt haben würde. Seine Zeichnung ist correkter, genialer als die der besten Meister seiner Zeit, sein Colorit weich und durchsichtig, seine Auffassung durchaus ideal, er ist so innig, so milde und transcendental, aber reicher und vollendeter als Fra Angelico da Fiesole; er versteht mit vollkommner Kunst ohne Schattendunkel seine lichtglänzenden Gestalten zu modelliren. Leider besitzen wir nur noch sehr wenig Werke des wunderbaren Meisters. Ein fleißiger Sammler hat nach der Aufhebung des Klosters Liesborn einen Theil derselben vor dem Untergange, dem andre bereits verfallen waren, gerettet und sie an die National-Gallerie in London veräußert.
Berühmter als der Liesborner Meister noch ward um seine Zeit der Name Israels van Meckenem (von 1440 bis 1503 ?), der aus der Gegend von Bochold stammt; als sein Hauptwerk gilt die sog. Lyversbergische Passion, eine große aus acht Tafeln bestehende Darstellung. Ob es derselbe Israel van Meckenem, der um dieselbe Zeit als Kupferstecher – vielleicht der erste deutsche – berühmt wurde, oder ein anderer Künstler von gleichem Namen und Stamme, ist bis jetzt nicht klar gestellt.
Nach und um die Zeit dieser Meister beginnt eine realistischere Tendenz sich geltend zu machen, und dies wohl jedenfalls unter dem Einfluß des mächtigen Aufschwungs, den die Kunst in den Niederlanden genommen hat. Wir wissen von einer Menge von Kunstwerken in unsrem Lande, daß sie in den Niederlanden bestellt und ausgeführt wurden. Die prachtvollen Glasmalereien der Stadtkirche zu Unna, welche ein Brand 1723 meistens zerstörte, waren 1461 zu Brügge angefertigt, und wohl nur deshalb sind sie in der Erinnerung verblieben, weil sie eine wunderbare Wirkung hatten. Auch die Domkirche zu Münster besaß vor den wiedertäuferischen Zerstörungen zwei Bilder, welche allem Ermessen nach in Zütphen bestellt und ausgeführt waren. Herm. v. Kerssenbrock meldet darüber in der Geschichte der Wiedertäufer: »Vor dem Chor hingen vordem zwei von dem Bruder Franco aus Zütphen auf Holz gemalte Bilder, wovon das eine die Muttergottes, das andere den heil. Johannes, wie er mit dem Finger auf das Lamm Gottes zeigt, vorstellten. Diese Bilder waren so schön, daß ein jeder geschickte Maler sie nicht ohne Erstaunen ansehen konnte, zur Zeit der Belagerung haben die Wiedertäufer sie durchlöchert und entwürdigt.« Aber wenn die einheimische Kunstübung nun auch dem Einfluß dieser holländischen Kunst unterlag und den Naturalismus der flandrischen Schule annahm, so ließ sie sich dadurch doch nicht in ihrer Thätigkeit hemmen und zahlreich sind die Namen der Künstler, welche uns aus jener Zeit überkommen. Ein Mäcen der Kunst war damals vorzugsweise der Abt Renold (1443–1477) in dem reichen Kloster Marienfeld. Er ließ eine Altartafel, jedenfalls ein Schnitzwerk, ausführen, aufstellen und bemalen, kostbare Gesangbücher anfertigen, eine prächtige Orgel bauen – und zahlte für Orgel und für das Bild des Hauptaltars nicht weniger als 1000 Gulden. Andere Tafeln und Ornamente schenkten seine Klostergenossen. Wo waren diese Werke gemacht? Die Klosterbrüder, wohl die einzigen, welche sich in reichen Klöstern noch mit solchen Arbeiten befaßten, hatten nur die kostbaren Gesangbücher angefertigt; ein Schusterbruder Antonius, aus Osnabrück gebürtig, leistete den Künstlern Handdienste. Ebendort, in Osnabrück, hatten auch die Klosterbrüder einen Magdalenenaltar fertigen lassen; die Bildwerke des hl. Jakobus und Philippus, die sie gleichfalls bezahlten, stammten von einem Meister Korbeck aus Münster.
Münster hatte von Alters her eine Steinmetzschule an einer Reihe Bauwerken großgezogen, die seither noch nicht nach Verdienst gewürdigt ist, eben weil man nicht darauf geachtet hat, in wie enger Aufeinanderfolge hier das eine Werk nach dem andern geschaffen ist. Fangen wir an beim Dome, so folgte ihm kurz vor 1300 ein jetzt zum Durchgange gebrauchtes Bauwerk an der Ostseite des Kreuzganges, anscheinend ursprünglich eine Doppelkapelle, und gleichzeitig mit diesem entstand die Nikolaikirche, beiden folgte 1311 die Johanniterkapelle; als diese fertig war, schritt man zum Giebelbau des Rathhauses, von dort ging es 1340 an die Ueberwasserkirche, 1375 an die Lambertikirche, und kaum mochte diese fertig sein, da meißelte man an den Werksteinen der Minoritenkirche. Und wenn schon neben diesen Werken viele andere Arbeiten in der Stadt und rings her auf dem Lande aufgeführt wurden, die wir nicht genauer verfolgen wollen, so finden wir von 1400–1530 der Kapellen, Anbauten und Bürgerhäuser so viele, daß die Meißel, den die Väter aus den Händen legten, gleich von den Söhnen aufgenommen und fleißig gebraucht sein müssen. Gewiß waren viele Steinmetzen blos Steinhauer nach unsern Begriffen, aber daß viele Steinmetzen zugleich Bildner waren und werden mußten, das ist bei der innigen Verwandtschaft der beiderseitigen Thätigkeit um so weniger zu leugnen, als mehre der genannten Gebäude noch heute mit ihren altehrwürdigen Bildwerken dastehen. Eine langjährige Kunstübung und bildnerische Thätigkeit wird sich also in keinem Falle der Stadt Münster absprechen lassen. Und wenn aus älterer Zeit die Bildwerke selbst auf Meister hinweisen, so werden uns später auch einzelne durch schriftliche Denkmale bekannt. So nennt eine Steininschrift an der Lambertikirche zum Jahre 1394 einen dort begrabenen Hilghensnider Johannes, und einen andern gleichen Namens zum Jahre 1408 – also vermuthlich zwei Bildhauer, die an dieser Kirche Statuen und andere Skulpturen gemacht hatten. Um 1405 wird Meister Kurt aus Münster mit seinen Gesellen nach Bremen berufen, um das dortige Rathhaus zu bauen.
Im Jahre 1492 lud die kunstliebende Stadt Kalkar, welche aus aller Welt die bedeutendsten Meister zur Anfertigung großer Altäre aufbot, zum zweiten Male den Meister Evert von Münster ein, um mit ihm einen neuen Verding von Tafelbildern einzugehen. Evert kam, man besprach sich mit ihm in einem Wirthshause und die Zeche dabei kostete 2 Gulden 8 Kreuzer. Man stellte dann die Bedingungen kontraktlich zusammen, vergütete seine Reise und Versäumnisse, sowie seine Auslagen für's Nachtquartier mit 3 Gulden und 18 Kreuzer. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß das nach unserm Gefühle schönste Altarbild, welches dort heute die Kirche ziert, von diesem Evert in seiner Vaterstadt Münster gemacht worden ist. Zufällig wird dann noch 1554 ein Heinrich Belderschnieder als Aldermann der Stadt Münster bekannt, und aus diesen verhältnißmäßig zahlreichen Benennungen von Bildhauern möchten wir folgern, daß jene großen Altarschnitzwerke, welche 1500 in Münster und der Umgegend aufgestellt sind, großentheils in Münster geschnitzt waren. – Die Stadt Kalkar gab 1491 und 1498 auch einem Meister »Johann van Halderen« (Haltern), sehr ehrenvolle Kunst-Aufträge. Das erste Mal galt es einem bedeutenden Werke. Man ließ ihn kommen, sandte ihn, vielleicht um sich an andern Werken zu bilden, nach Köln und gab ihm dabei für seine Pferde sogar den Hafer mit auf den Weg und als Zehrgeld 56 Gulden. Daneben ist noch eine Gruppe von Künstlern zu nennen, welche zwar mit Holland in der innigsten Verbindung stand und den Wechselverkehr zwischen hier und dort auf's Lebhafteste gefördert hat, aber dennoch in hohem Grade der altdeutschen, idealen Kunstweise Rechnung trug und den niederländischen Einflüssen nur in so fern folgte, als sie die Abwege der Verzerrung vermied, und darum in ihrer Art groß und denkwürdig dasteht. Es sind dies die »Fraterherren«. Sie waren ursprünglich von Holland, von Deventer, gekommen, hatten sich zu Münster auf dem Bispinghofe ein Kloster erbaut, bezogen viele Novizen, wenn der Ausdruck bei Regularherren gestattet ist, von Holland und aus den daran grenzenden Theilen des Münsterlandes, und beschäftigten sich in der freien Zeit mit Studiren, Bücherschreiben und Bücherbemalen. Die bemalten Bücher sind es, die ihnen den Ehrenplatz in der Geschichte heimischer Kunstleistung sichern. Wir erinnern an ihre älteren, großen Büchergemälde, wie sie z. B. den Chorbüchern von Nienborg und Stadtlohn zu Theil geworden sind, und lenken insbesondere die Aufmerksamkeit auf ein jüngeres Bild, das in eine Zeit fällt, wo überall der niederländische Naturalismus gang und gäbe wurde. Es findet sich in einem Antiphonarium zu Ennigerloh und enthält über die Zeit und den Ort seiner Entstehung folgende Inschrift: »Im Jahre des Herrn 1479 ist dieses Buch geschrieben und ausgeführt im Hause der geistlichen Brüder vom gemeinschaftlichen Leben ›zum Springbrunnen in Münster‹. Wer es gebraucht, bete auch für sie«. Das Bild selbst stellt die Passion des Herrn vor auf einem Pergamentblatt von Foliogröße. Sehen wir, welche altdeutsche und welche niederländische Elemente hier der Maler einfließen oder vielmehr in einander fließen läßt. Die lang gezogene Figur des Herrn am Kreuze, der Ausdruck der nebenstehenden Figuren, die Ruhe der Composition, die idealen, edlen Gesichtszüge überhaupt zeigen noch auf die altdeutsche Auffassung, aber, daß die Henker bereits halb weiß, halb blau gekleidet sind, das zeugt schon von einem naturalistischen dem Zeitkostüm huldigenden Geschmack. Der alte Goldgrund hat bereits dem blauen Himmel und in der Mitte einer helleren Zone mit landschaftlichen Theilen, Wolken, Kirchen und Kirchthürmen, weichen müssen. So vermählte also die Fraterherrenkunst das Gute der Neuzeit mit dem Gedanklichen und Edlen der älteren Zeit. Nur wenige Meister mögen diese goldene Mitte innegehalten haben, welche uns unter so vielen Bildwerken rein niederländischen Geschmacks wahrhaftig freudig überrascht. Im Vorstehenden sind wir kunstgeschichtlichen Forschungen des Dr. Nordhoff gefolgt.

Als bedeutendste Meister aus der Zeit der Renaissance sind dann die beiden Ludger und Herrmann tom Ring (letzterer, der bedeutendste geb. 1521, gestorben 1599) in Münster zu nennen; neben ihnen Heinrich Aldegrever in Soest, auf den wir zurückkommen werden und die Brüder Victor und Heinrich Dünwegge, die um 1520 in Dortmund lebten. –
Nach der sterilen Zeit des siebenzehnten Jahrhunderts tritt uns im achtzehnten die Entwicklung einer großen Kunstliebe in unserm Bürgerthume entgegen. Während wir bei dem Adel und auf den Edelhöfen des Landes die Kunst meist nur zur fabrikmäßigen Herstellung schlechter Ahnenbilder herangezogen sehen, mehren sich die Patrizierhäuser der größeren Städte, wo, namentlich in Münster, mehr oder minder bedeutende Gemäldesammlungen den Gesellschaftssaal und die Wohnräume schmücken; bei dem Niederliegen der Kunstthätigkeit in Deutschland ist es natürlich, daß wieder die Niederlande zumeist der Ursprungsort dieser Werke sind.
Zugleich damit entwickelt sich aber auch wieder eine heimische Kunstpflege. Wir finden als achtbare Talente Koppers, Pictorius, König in der Malerei, Gröninger, (Gerdt und seinen berühmten Enkel) als Bildhauer, Schlaun und Lippers als ausgezeichnete Baumeister; aus der Mitte ihrer Zeitgenossen treten danach zwei ausgezeichnete Portraitmaler in den Vordergrund, in Paderborn Stratmann, und in Münster Chr. Rinklake, geb. 1764, der Maler des Kreises der Fürstin Gallitzin, ein Mann von einer seine Zeit überragenden Fülle des Talentes in geistreicher Auffassung der individuellen Natur und in technischer Ausführung. Aus jener Zeit, Mitte und Ende des vorigen Jahrhunderts stammen denn auch die stattlichsten der »Höfe« des Adels in der Stadt, von denen wir den Romberger Hof, gebaut von Lippers, und das Muster reich verzierten Rococos, den Erbdrosten-Hof, gebaut von Schlaun, nennen.
In den dreißiger und vierziger Jahren unseres Jahrhunderts ringt sich dann mit zäher Westphalenausdauer wie ein Phänomen aus einem dreißigjährigen Ackerknecht und Tischlergesellen aus der Umgegend von Münster ein plastisches Talent empor, der Bildhauer W. Achtermann (geb. 1799), der, wenn er auch in dem Schematischen der traditionellen religiösen Kunstrichtung befangen blieb, doch zur achtungwerthesten Meisterschaft innerhalb derselben sich aufschwang und dessen bedeutendstes Werk, die aus fünf überlebensgroßen Gestalten bestehende Gruppe der Kreuzesabnahme der Dom zu Münster umschließt. (Aufgestellt 1858.)
In Münster namentlich könnte man in neuerer Zeit die Sculptur mit Vorliebe gepflegt nennen: Das neugebaute Ständehaus enthält z. B. in seinem Sitzungs-Saale zwölf Statuen berühmter Männer aus der Geschichte des Landes, die, von den heimischen Künstlern B. Allard, Elisabeth Ney, Prange, Stracke entworfen und ausgeführt, das beste Zeugniß für diesen Zweig heimischer Kunstthätigkeit ablegen.
Was den Westphälischen Kunstverein angeht, so hat er den glücklichen Gedanken in's Leben zu führen begonnen, für sein Museum einzelnen Künstlern die Darstellung denkwürdiger Ereignisse aus der Geschichte der Heimath aufzutragen. Eine Scene aus den Tagen der Wiedertäufer, gemalt von E. Görcke, wird diesen Cyclus eröffnen. Wünschenswerth wäre nur, daß auch hier die Künste Hand in Hand gingen und die Baukunst der so schlecht logirten Schwester, der Malerei, ein schöneres und helleres Heim schüfe! –
Eine schöne Aufgabe bietet sich der architektonischen Kunst ebenfalls in der bevorstehenden Restauration und dem vollendenden Ausbau der Lambertikirche, des schönsten Baus Westphalens im rein gothischen Stile. Das Schiff ward 1272 unter Bischof Gerhard von der Mark gebaut, der erste Stein zu dem neuen Chore aber 1375 gelegt, doch zog sich des ganzen Werkes Ausbau bis an's Ende des vierzehnten Jahrhunderts hin, wo dem ältesten Baue des Thurmes auch die zwei höchsten Geschosse aufgesetzt wurden. An dem hochaufsteigenden aber bedenklich westwärts geneigten über 200 Fuß hohen Thurme sind die drei eisernen Käfiche befestigt, in welchen die drei Wiedertäuferhäupter, König Johann zu oberst in der Mitte, rechts Knipperdolling und links Krechting ein luftiges Grab fanden, nachdem man sie in der bekannten haarsträubenden Weise zu Tode gemartert: von der Plattform oben waren schon gleich am Tage nach der Einnahme der Stadt eine große Zahl unglücklicher Schwärmer hinuntergestürzt. –
Von anderen Gebäuden ist noch die Ludgerikirche mit ihrem durchbrochenen Thurme, einem kleinen Juwel architektonischer Kunst, gebaut am Ende des 14. Jahrh. nach dem großen Brande von 1383 und restaurirt seit 1859, zu erwähnen, sodann die Neubauten des Ständehauses und des bischöflichen Museums. – –
Was wir von den ersten Ursprüngen Münsters wissen, ist das Folgende: Da, wo jetzt die Stadt sich erhebt, im Südergau des Bructererlandes, lagen in der Urzeit zwei große alte Sassenhöfe, genannt der Brockhof und der Kampvorderhof; durch das Sumpf- und Wiesland, welches sich westlich von ihnen erstreckte, und das der träge und still fluthende Bach, die Aa, durchschlängelte, führte eine Furth, welche man die Mimigardefurth nannte, denn der Hügel am östlichen Bachufer hieß die Mimigarde oder Mimigardene und war eine alte Malstätte der Sassen aus dem Südergau.
Im achten Jahrhundert wagten sich zuerst Sendboten des Christenthums in diese Gegend vor; es kam Sankt Suibertus, den die Uetrechter Missionsanstalt sandte, dann 779 ein Abt Bernhard, der aus den für die neue Lehre gewonnenen Schulten und Köttern des Brock- und Kampvorderhofes eine christliche Gemeinde bildete; endlich, nach Bernhards Tode, erschien der heilige Ludger, ein Friese und Schüler Alcuins, als erster Bischof des von Karl dem Großen 791 gestifteten Bisthums. Ludger baute seine Kirchenburg auf der Mimigardene auf, und darnach hieß das Bisthum und der um die Burg entstehende Ort Mimigardeford, noch bis auf Bischof Wernher, der 1151 starb. Aber bald nach der Erbauung des Klosters U. L. Frau in Ueberwasser entstand der Name ad Monasterium, zum Münster, Münster und wurde seitdem ausschließlich herrschend.
Der Schulze der beiden Höfe, worauf die Stadt entstand, trat in ein Lehnsverhältniß zu der neugegründeten Kirche; er wurde ihr Ministeriale, aber auch gewissermassen ihr Schützer, ihr Schirmvogt, der Inhaber der Gaugerichtsbarkeit. Seine Nachkommen wohnen (in der entstehenden Stadt?) in einem Hause genannt Sconowe (Schönau), das sie 1268 dem Domkapitel übertragen. Im Jahre 1283 verkaufen sie dem Bischofe den Kampvorderhof, auf dem Sankt Mauritz entsteht; und 1327 verzichten sie auf den Brockhof; sie blühen bis heute unter dem Landesadel als Grafen von Münster fort, und die Stadt hat ihnen ihr Wappen entlehnt.
Wir dürfen nicht weilen bei der weiteren, keine besonders gearteten Erscheinungen darbietenden Entwicklung der Stadt: wir erwähnen nur, daß sie seit 1268 Mitglied der Hansa war, vielfache Handelsverbindungen mit den Ostseeländern und mit England pflegte, daß Männer von Münster den Stahlhof ( the stealyard) in London angelegt haben sollen; daß sie wie alle Städte des Mittelalters in Span und Hader mit der entstehenden und sich kräftigenden landesfürstlichen Gewalt des Bischofs gerieth und eine sie der Reichsunmittelbarkeit nahe stellende Fülle von Rechten und Privilegien gewann, zu deren Schutz Mauern und Thürme von seltener Festigkeit und Wehrhaftigkeit dienten. »Fest wie Münster« lautet ein altes Sprichwort im Lande.
So wurde sie der Schauplatz des großen religiösen Dramas, welches die Geschichte »die Wiedertäufer-Unruhen« nennt, das bei Meyerbeer »der Prophet«, und bei Spindler und Robert Hamerling »der König von Sion« heißt. NachtragDie scharfgeschnittenen und von Geist und Energie zeugenden Gesichtszüge des Königs von Sion hat uns ein Portrait Aldegrevers (im Besitz des Grafen Merveld) aufbewahrt; nach seiner Zeichnung sind auch Johann's Münzen geschlagen. Außerdem gibt es ein vortrefflich gemaltes kleines Portrait König Johann's von Leiden auf dem von Ketteler'schen Schlosse zu Harkotten. Es zeigt in anderer Auffassung vollere und sinnlicher ausgeprägte Züge, mehr den Kopf des Kriegers als des Propheten.
Die Geschichte dieser Unruhen ist so oft erzählt, die merkwürdige und fesselnde Gestalt des wunderlichen und ein psychologisches Räthsel darbietenden Schwärmers Johann von Leyden, der jedenfalls noch mehr verleumdet als begriffen und richtig aufgefaßt ist, so vielfach dargestellt, daß wir hier um so leichter darauf verzichten können, uns in ein Thema zu vertiefen, das uns zu weit abführen würde. Wir verweisen auf die gedrängte Darstellung, welche wir an anderer Stelle davon zu geben versuchten L. Schücking, Eine Eisenbahnfahrt durch Westphalen. Leipzig 1855. und bemerken hier nur, daß man die Wiedertäufer in höchst übertriebener Weise des Vandalismus beschuldigt hat. Die Spitzen der Thürme haben sie abgeworfen nur da, wo es nöthig, um Raum zur Aufstellung ihrer Geschütze zu gewinnen – von dem Lambertithurm, wo sich dieser Raum fand, z. B. nicht. Die Domarchivalien haben nicht sie verbrannt, sondern dies ist bereits 1340, nachdem ein Auszug daraus angefertigt worden, geschehen. In die Entwicklung der Kunst- und Baugeschichte der Stadt haben sie durchaus nicht zerstörend eingegriffen, wer da zerstörend eingriff war Bernhard von Galen. Unsere merkwürdigsten Skulpturwerke, die im Paradiese der Domkirche, einer muthwilligen Zerstörung so leicht erreichbar, stehen heute noch so ungehärmt da wie die alten Figuren auf dem Domchor. – –
Der Regensburger Reichstag von 1640 nahm den Französischen Vorschlag an, die Städte Münster und Osnabrück für eine Friedensversammlung auszuwählen. Die Hamburger, zwischen dem Kaiser und Frankreich geschlossenen Präliminarien erklärten beide Orte für neutral; so zog denn 1643 der erste der Kaiserlichen Gesandten, Graf Ludwig von Nassau, feierlich eingeholt in Münster ein: aber so ermüdet von dem dreißigjährigen Kriege auch die Mächte alle sein mochten, es währte noch lange, bis ihre Boten endlich in ihren sammetbedeckten Kutschen, mit ihrem prunkhaften Gefolge von Edelleuten, Pagen und Hellebardieren, vom Kanonendonner begrüßt, durch die dunklen Thore der beiden Städte einrollten. Die spanische Grandezza z. B. fand es ihrer unwürdig, eher als Frankreichs Ambassadeure zu erscheinen; diese, die Grafen d'Avaux und Servien, wollten dagegen später, als die Spanier Zappada, Don Brun aus Dole, Don Diego Saavedra anlangen; jeder wollte in seiner Sprache reden, keiner den andern zuerst besuchen, und man begreift, wie die Verhandlungen dabei sich förderten. Am bescheidensten zog der päpstliche Nuntius ein: die Franzosen spotteten, daß auf einem Korbe des Gepäckes ein Barfüßermönch gesessen, wie ein schwarzer Hahn auf dem Gepäck eines Marketenders. Der Schwede Oxenstierna ließ sich sogar anfangs gar nicht herab, zu erscheinen: er blieb in Minden, auf seinen Mitgesandten Adler Salvius eifersüchtig, wie den endlosen Hader denn meist die Eifersucht der Gesandten einer und derselben Macht unter sich noch erhöhte. Endlich gab die Ankunft des Herzog's von Longueville und des Grafen Maximilian von Trautmannsdorff einen Anstoß zur Förderung der Geschäfte. Wenn auch die Franzosen anfangs über den langen hagern Trautmannsdorff mit seinen tiefliegenden Augen, seiner aufgezogenen Nase, seiner abscheulichen Perücke lachten, so diente doch sein hoher Ernst, sein Alter, sein prachtvolles Geleite von vielen deutschen Freiherren und Rittern nur dazu, auch ihnen zu imponiren, und bald wußte er durch die Anmuth seiner Rede, die helle Entwicklung des Verworrensten, den tiefen Verstand seines Urtheils, vor allem durch unermüdliche Zähigkeit den rechten Ernst und Willen in die hadernden Gemüther zu bringen. Auch das intriguirende Frondenhaupt, das schöne lockige Haupt Anna's von Bourbon, Herzogin von Longueville, versuchte ihren Einfluß auf die streitenden, erhitzten Männer; daß es nicht ganz erfolglos blieb, bezeugen die Worte, die ein Dichter ihr in den Mund legt:
Ces heros assemblés dedans la Westphalie
Et de France et du Nord, d'Espagne et d'Italie,
Ravis de mes beautés et de mes doux attraits,
Crurent en voyant mon visage
Que j'étais la vivante image
De la concorde et de la paix
Qui descendit des cieux pour appaiser l'orage.
Der hessische gelahrte Doctor Vultejus rieth ihr, die deutsche Sprache zu lernen, um sich zu unterhalten. Darüber ward der arme Doktor Gegenstand der amüsantesten Witze in den Salons von Paris: man konnte von dorther der Herzogin nicht genug ausdrücken, mit welchem Ergötzen man ihre Anmuth im Gespräche mit Monsieur Lampadius, dem Doktor im violetten Atlaskleide, sich vorstelle. – Endlich, nach Jahren, während welcher fortwährend die Heerpauke wüster Kriegsvölker die zertretenen deutschen Lande durchwirbelte und noch Ströme Blutes fließen mußten, zeigte sich ein Sinn der langen Rede, und ein vernünftiges Wort tönte durch die diplomatische Weisheit. Deß entstand eine nicht zu fassende Freude: es war am 5. Mai 1648‚ als man das Rathhaus zu Münster festlich mit Gewinden schmückte, und aus den Fenstern der Häuser umher Symphonien tönen ließ, die Rathsherren ihre schmucksten Halskrausen über das Sammetwamms legten und die Gilden zu den blankgeschliffenen Hellebarden griffen. Gegen Mittag erschien der Graf von Pennerranda, Spaniens Ambassadeur an Zappada's Stelle, mit großer Pracht in sechs Kutschen, jede mit sechs Rossen bespannt, umströmt von Garden und Pagen und Dienern, die reich geschmückt voll castilianischen Stolzes einherschritten; ein glänzendes Reutergeschwader führte den Zug an; so begab sich Penneranda durch die Reihen der aufgestellten Bürgergarde, der Bürgermeister und Rathsherren in den Friedenssaal, wo er sich zu oberst an die goldumfranzte Tafel zwischen die Gesandten der Niederländischen Provinzen setzte und jenes Wort aussprach: die Anerkennung der sieben vereinigten Provinzen als freie und selbstständige Republik. Die Urkunde, die er untersiegelt und beschworen, ward dann von erhöhter Bühne auf dem mit Teppichen und Zweigen geschmückten Marktplatze verlesen, Drommeten und Pauken schmetterten, die Geschütze dröhnten von den Wällen und der reiche Spanier ließ zwei Tage hinter einander Fontainen von Wein dem Volke springen. Diesem Separatfrieden folgte nun nach mäßigem Zwischenraume der allgemeine; er wurde zu Münster (auch von den Schweden, die zu Osnabrück unterhandelt hatten,) am 14. (24.) October 1648 unterzeichnet; des Osnabrücker und des Münsterschen Abschlusses Urkunden wurden auf dem Bischofshofe Dem jetzigen Regierungsgebäude. von den Kaiserlichen Gesandten unterschrieben und gegen die Abendstunde jenes Tages donnerten dreifache Ladungen von den Basteien der Stadt das letzte Echo des schrecklichsten aller Kriege nach.

Für Münster sollte der Friede jedoch nicht lange währen. Am 17. September 1651 füllte die Cathedrale eine Feier, welche die Erhebung des kleinen Landes fast zu einer Macht ersten Ranges, mindestens zu einem bedeutenden Moment in der Wagschaale des Europäischen Gleichgewichts bewirken sollte. Der Domküster Christoph Bernhard von Galen, der Sohn des Erzmarschalls von Kurland und Semgallen, Theodorich von Galen, aber dem Münsterschen Adel angehörend, ward zum Fürstbischofe gesalbt. Man hat ihn oft den kriegerischen genannt; aber Christoph Bernhard war ein Regent, dem es nicht entging, daß seine Aufgabe auch eine friedliche sei, und der sie mit redlichem unermüdlichem Streben für das Wohl seines Landes zu lösen suchte. Er ist ein durch Energie und Klugheit mehr als seine deutsche Gesinnung achtbarer Charakter; er hatte nur, wie viele Fürsten sein Steckenpferd: König Saul liebte die Harfe, Friedrich der Große liebte die Flöte, der Herzog von Sachsen-Merseburg die Geige und Bernhard von Galen liebte den Bass donnernder Geschütze; die ganze Scala der »Arkeley«, von der Quartanschlange bis zur Karthaune zu durchgehen und damit eine Citadelle nach der andren zu bombardiren: das war sein Leben, seine Leidenschaft. Die Bürger seiner Hauptstadt, die sich unabhängig zu machen strebten, hatten erklärt, sie wollten lieber des Türken, ja des Teufels sein, als ihres Bischofes: er versöhnte die widerstrebenden Gemüther‚ ein neuer Orpheus, durch seine Constablekapelle, deren Töne die verstocktesten Herzen, ja Stein' und Thürme weich machten: als er endlich das Siegesbanquet in ihren zerschossenen Mauern zwischen Kugeln und Bomben hielt, die den Grund bedeckten‚ und bei jeder der vielen ausgebrachten Gesundheiten 80 Karthaunen lösen ließ, mochten sie freilich über den Höllenlärm des Teufels zu sein glauben. Ein von den Jesuitenschülern aufgeführtes lustiges Drama »Daniel und Evilmerodach« folgte der großartigen in die Wälle der Stadt Münster gerissenen Ouverture; das Finale machten 50 Kanonen von den Basteien und 24 Feldstücke von der Citadelle her. Dann zog Christoph Bernhard mit der Behauptung, die Holländer haben ihn beleidigt, mit seiner, freilich nicht bischöflichen, Kapelle in das Nachbarland: die Holländer saßen ruhig bei ihren Theetassen, als ihnen plötzlich diese Melodie ihre Japanischen Schalen durch einanderklirren macht, daß eine Stadt nach der andern sich ergeben muß; der grimme Kirchenfürst reitet kurz nach einander vierzehn holländische Festungen mit seinem Steckenpferd nieder. Seit 1675 mit dem großen Churfürsten verbündet, wie früher mit Frankreich und England, hört jetzt der Weserstrom seine Musik an und Stade fällt vor dem umgekehrten Amphion in Trümmer; bei dieser Gelegenheit bescheert ihm der Herr 65 metallene Kanonen als Beute und kann nun kurz darauf seinen Diener in Frieden fahren lassen (1678). Man hat ihn in die Cathedrale zur Erde bestattet; ein Gitter aus Kanonenerz beschützt sein Grab. Seine Armee soll zeitweise 60,000 bis 70,000 Mann betragen haben. Es war ein energischer Mann; hätte er die Macht wie den Willen gehabt, er wäre ein großer Mann geworden; Ludwig XIV. erklärte, er habe ihn gefürchtet.
Der segensreichste Herrscher unter seinen Nachfolgern ist Maximilian Friedrich geworden, weil er Franz von Fürstenberg zum Regenten des Landes machte, und sein Volk in die Hände eines Weisen befahl. Es wäre damals ein glückliches Land geworden, dies Münsterland – hätte es despotischer regiert werden dürfen. – Der letzte Fürstbischof war Maximilian Franz, ein Bruder der unglücklichen Maria Antoinette, von welcher der Dom eine Reliquie bewahrt: ein von ihren Händen für den Bruder gesticktes Meßgewand. – Nach den Beschlüssen des Lüneviller Friedens wurde das Bisthum Münster durch den Reichsdeputationshauptschluß von 1803 säcularisirt; schon am 8. August 1802 hatten 4000 Preußen von der Hauptstadt Besitz genommen. Der Freiherr von Stein und Blücher wurden mit der Verwaltung des Landes beauftragt.

Die bedeutsame Rolle, welche unsre Stadt in der deutschen Culturgeschichte gespielt hat, die gewichtige Förderung des Humanismus, welche von ihr ausging, den Kreis der Fürstin Gallitzin und Stolberg's, das Wirken Fürstenbergs, die Bedeutung Sonnenbergs, von dem Goethe sagte, er habe den Imperator-Mantel unter den deutschen Dichtern tragen können, u. s. w. u. s. w. dürfen wir hier nicht zu schildern unternehmen. Andere Pfade, die noch zu durchwandern sind, erwarten uns. Nur einen Blick werfen wir auf die Umgebung, den Kern des Landes der grünen Kämpe und Wallhecken ringsum, und lassen für einen Augenblick länger als auf andere Stellen unser Auge auf dem kleinen Edelhofe im Norden der Stadt ruhen – das bescheidene von grünen Wipfeln umgebene Dach, unter dem ein großes, reiches und edles Frauenherz seine stillen Tage verlebte, und aus der Fülle seines Denkens und Fühlens der Welt den Schatz von Poesie gab, den die »Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff« enthalten. Geboren zu Hülshoff am 12. Januar 1798 starb sie fern der geliebten Heimath am 24. Mai 1848 auf dem alten Schlosse zu Meersburg am Bodensee. Ihr Lebensbild zu zeichnen haben wir an einer andern Stelle versucht Annette von Droste-Hülshoff. Ein Lebensbild. Hannover, 1858., doch mögen wir von dem theuren Andenken nicht scheiden, ohne die Verse, durch die sie so würdig von E. Ritterhaus gefeiert ward, nachzusprechen:
Mitten im Eichkamp, wo die Drossel baut
Ihr Nest im Lenze unterm grünen Zelt,
Mitten im Eichkamp, wo im Haidekraut
Der Bienen Schaar im Herbst die Ernte hält,
Dort Dir ein Grab auf rother Erde Grund!
Du hast's erfleht, ersehnt in mancher Stund'!
Was Du gehofft, nicht durftest Du's gewinnen,
Du Königin der deutschen Dichterinnen!
Westphälisch Land – wer hat wie Du gekannt
Das Volk mit blondem Haar und blauem Aug'!
Wer hat wie Du in Wort und Reim gebannt
Des Sachsenstammes Denken, Thun und Brauch?
Der Haidespuk, wie ihn der Hirte schaut
Im Felde, wenn mit leisem Klagelaut
Die mitternächt'gen Winde sich erheben –
Du hast im Liede ihm Gestalt gegeben!
O, Deiner Heimath Geister allzumal
Sind Dir zu Dienst gewesen, hohes Weib,
Doch fern der Heimath ragt Dein Todtenmal,
Fern von der Heimath ruht der müde Leib!
Kein wucht'ger Eichstamm recket segnend aus
Den grünen Arm ob Deinem Todtenhaus,
Und Deiner Heimath Asternkränze fehlen
Auf Deinem Grab am Tage Allerseelen!
Am Bodensee, wo flink die Möve kreist
Und in die blaue Fluth nach Fischen taucht,
Da hat der große, der gewalt'ge Geist
Den letzten, schweren Seufzer ausgehaucht.
Der Schweizeralpen Zackenkrone sieht
zum Hügel hin, den Epheu längst umzieht,
Und kommt vom Süd' der Föhn herangeflogen,
Dann singen Dir den Grabgesang die Wogen!
Doch decket Dich nicht dort die Scholle zu,
Wo Du das Licht der Welt zuerst geseh'n,
Doch in der Heimath Boden schlummerst Du! –
So weit der deutschen Zunge Laute weh'n,
So weit nur lebt und fühlet deutscher Sinn,
Ist Deine Heimath, deutsche Dichterin!
Das Heimathrecht hat Dir Dein Sang errungen
Im Herz der Alten, in der Brust der Jungen! –
An Sagen ist Münster und das Münsterland sehr reich, und ebenso an Volksliedern. Durch die Straßen der Stadt wandelt nächtlich der Amtmann Timphoht in langer weißer Perrücke, großem dreieckigem Hute und grünseidnem Rocke. In der Dawert, einem Haide- und Walddistrickt in der Nähe der Stadt, worin die Trümmer der alten Feste eines ausgestorbenen Geschlechts, der Davensberg, liegt, treibt der Teufel sein Wesen, jagt mit Halloh und Rüdengeheul der Hochjäger, spuken Kobolde und Jungfer Eli aus Freckenhorst, der Aebtissin ungetreue Haushälterin, die in ihrem grünen Hütchen mit weißen Federn auf dem Aepfelbaum saß, als der Pfarrer kam, um ihr die Sterbesakramente zu bringen; alle Jahre einmal fährt sie mit schrecklichem Gebrause von der Dawert aus, wohin sie exorcirt ist, über die Abtei zu Freckenhorst und alle Vierhochzeiten kommt sie ihr um einen Hahnenschritt wieder näher. Wenn es Abends stürmt und weht, dann schreitet ein gewaltig großer Mann im weiten Mantel, eiserne Schnallen auf seinen Schuhen, über die Haide. Kommt ein Mädchen daher gegangen, so eilt er mit langen Schritten auf sie zu, nimmt sie unter seinen Mantel und bringt sie, indem er sie immer fester an sich schmiegt, ohne ein Wort zu sagen, über die Haide. Ehe er sie aber gehen läßt, drückt er ganz sanft und innig einen Kuß auf ihren Mund; das arme Mädchen geht sodann erschrocken nach Hause und ist am andern Morgen todt. Ein eben so poetisches Moment wie dieser schöne Mythus von Haidenmann bieten oft die Volkslieder dar z. B. das vom »Leiden Christi«:
Als Christus der Herr im Garten ging
Und da mit ihm sein Leiden anfing,
Da trauert das Laub, das grüne Gras,
Weil Judas sein Verräther was.
Er trägt das Kreuz mit gelaßnem Sinn
Und fällt vor Schmerz zur Erde hin;
An's Kreuze hing man Jesum bald,
Maria ward das Herze kalt.
— — — — — — — —
Die hohen Bäume die beugen sich,
Die hohen Felsen die neigen sich,
Die Sonn' und Mond verlor ihren Schein,
Die Vögel lassen ihr Rufen sein.
Die Wolken schreien Ach und Weh,
Es heulet der Sturm, es brauset die See,
Die Gräber öffnen ihre Thür,
Und sieh, die Todten kommen herfür.
Nun merket an, wie Frau so Mann,
Wer dieses Liedlein singen kann,
Der sing es Tages nur einmal,
Seine Seel' wird kommen in Himmels Saal. –
Die ganze Eigenthümlichkeit des Westphälischen Landvolks spiegelt sich in diesen Sagen und Liedern, jene kindliche Gläubigkeit und Frömmigkeit, die doch wieder ihr schalkhaft Humoristisches hat und durch ihre einfach naturwüchsige Anschauung aller Dinge oft den Schein sehr tiefer oder geistreicher Auffassung bekommt. Die Volkslieder enthalten Liebesklagen oder öfter humoristische Ausfälle gegen Ehe- und Liebesnoth und dann im plattdeutschen Idiom, ein Beweis, daß diese letztere Art der Auffassung dem Volke die eigenthümlichere ist. Die Sagen knüpfen sich zumeist an auffallende Oertlichkeiten; wo ein schöner Weiher ist, da liegt eine Kapelle versunken, an stillen Tagen tönen ihre Glocken aus der Tiefe und alljährlich einmal kommen weiße Schwäne aus dem fernsten Norden und ziehen lautlos ihre Kreise über den durchsichtig klaren Spiegel; wo Hühnensteine liegen, da haben Riesen gehaust; mit schroffen Felsen hat fast immer der Teufel zu thun gehabt. Die Urnen, die man aus den in Menge durch ganz Westphalen zerstreuten heidnischen Gräbern nimmt, nennt das Volk des Niederstifts Münster »Ulkenpötte« und glaubt, sie seien Behausungen des kleinen Geschlechts der Ulken (Zwerge).
Was das Münsterland in seinen kleinern Orten an Sehenswerthem besitzt, müssen wir übergehen: wir können dem Leser nicht zumuthen, zu seinen oft so malerischen alten Edelhöfen, Schlössern und Abteien allen uns zu folgen, zum Stromberge z. B., wie schön er auch auf seiner waldbedeckten Höhe daliegt mit seiner Burgkirche und den Bauresten, die das mächtige Geschlecht der Burggrafen von Stromberg besaß, bis den letzten unruhigen Herrn im 14. Jahrhundert Bischof Florenz von Münster aus dem Erbe seiner Väter und in die Verschollenheit trieb, wie reich er auch an Sagen und Mähren ist, von dem letzten Kampfe um die Burg, von dem einzigen Kinde des Grafen Burchhard, Sophia, deren Geliebter Herrmann von Morrien in der Fehde erschlagen wurde, daß sie in ein Kloster ging, dem ihr gebrochenes Herz den Namen »Herzebrock« gegeben haben soll, von Burchard selbst endlich, den man zuletzt als gebückten Greis in Pilgertracht am heiligen Grabe gesehen. Oder zu der alten Abtei Freckenhorst mit dem merkwürdigen, vielleicht tausendjährigen Grabstein der Stifterin Geva und dem Stabe des heiligen Bonifacius, der schon einmal ein grünender, Früchtetragender Apfelbaum war und dann wieder ein Stab wurde: oder zum Stifte Nottuln, einst der Sitz eines mächtigen Adalings, dessen Burg noch in Spuren der Gräben und Wälle sichtbar, der wider Karl den Großen stritt und, in der Schlacht verwundet, durch sein treues Weib gerettet wurde, die dann in einer Quelle, welche noch heute gezeigt wird, seine Wunden wusch. Nur müssen wir auf die wunderbar Grabschrift in der Kirche zu Borken deuten; » Obiit Dux Johannes de minori egipto V. Cal. Dec. anno 1438,« die das Denkmal des letzten Zigeunerkönigs bildet, welcher auf dem Marktplatze des Städtchens wegen Todschlag eines andren »Heidenkönigs« Nachts bei Fackellicht auf einem ausgebreiteten rothen Scharlaken enthauptet wurde. Nach einer Sage (bei Kuhn, Westf. S. I. 113.) hat dieser letzte Heidenkönig auf dem Hause Ergelrading seinen Wohnsitz gehabt; um der Hinrichtung zu entgehen, hat er vergebens sich erboten, er wolle eine metallene Mauer um Borken ziehen.
Von den Schlössern des Adels wollen wir nur zu einem wandern; das ist Nordkirchen, wenige Stunden südlich von Münster, ein großes schönes Landhaus, erbaut um 1700 von dem Fürstbischofe Friedrich Christian von Plettenberg. An breiten prächtigen Gräben vorbei, die Gartenanlagen umschließen, während dunkle Lindenalleen mit Statuen, Orangerie und Theatergebäude die frühere ungewöhnliche Ausdehnung der Schloßgärten bezeichnen, die jetzt zum Park geworden sind, führt uns der Weg durch mehrere mit Wappenschildern und Panoplien geschmückte Thore auf den nach drei Seiten von Gebäuden im Stil des vorigen Jahrhunderts umschlossenen Hof. Die große Schloßhalle und das Treppenhaus sind mit Ahnenbildern und andren Gemälden, kostbaren China-Vasen und Statuen geschmückt: der Schatz des Schlosses ist eine Gemälde-Galerie mit Bildern von hoher Schönheit, Werken van der Vliets, van Dycks, Rubens, Martins Schön, Rembrandts, mit einem Carton von Leonardo da Vinci endlich, eine heilige Familie darstellend, der alles zu übertreffen scheint, was der Crayon je liebliches und anmuthiges geschaffen. In einem der Gemächer zeigt man auch die Sporen und den Stab Walters von Plettenberg, des gewaltigen Heermeisters des deutschen Ordens in Livland, der 1502 bei Pleskow mit 7000 Ordensrittern und 5000 Livländern ein Heer von 130,000 Moscovitern und Tartaren so aufs Haupt schlug, daß ihrer 40,000 auf dem Wahlplatze blieben, – jenes großen Ordensmeisters, der in der Walhalla eine Stelle fand und von Brantome neben Alexander und Cäsar als Feldherr gestellt wurde. Wenn man durch die freundlichen hellen Gemächer mit ihren Gobelins, Stuccaturen und Supporten schreitet, durch den weiten Bibliotheksaal mit so viel moderner Weisheit, wo Voltaire und Bayle die alten Psalterien voll frommer Miniatürmalereien in den Schatten gedrängt haben, dann ahnt man wohl nicht, daß in diesen Räumen unheimliche Geister hausen mögen; und doch war dem einst so: der böse Rentmeister Schenkewald ging früher im Schlosse um, heulte und lärmte die Treppen auf und ab oder man sah ihn, wie er an einem Tische saß und Geld zählte. Endlich ließ man, um ihn zu bannen, Messen lesen. Da in einer finstern stürmischen Nacht polterte er ärger denn je: plötzlich aber wurde gewaltsam die Klingel gezogen, alle Bedienten sahen zum Fenster hinaus und erblickten eine prächtige Kutsche mit vier kohlschwarzen Rossen vor der Schloßthür. Darin saßen zwei Kapuziner, welche ausstiegen, ruhig und stumm in das Schloß gingen und alsbald mit Schenkewald wieder herauskamen. Alle drei stiegen in den Wagen, Schenkewald saß zwischen den Kapuzinern, eine Peitsche knallte und blitzschnell fuhr der Wagen in die Nacht hinaus, nach der Dawert zu. Da fährt Schenkewald nun seitdem bis auf den heutigen Tag mit den beiden Kapuzinern und in demselben Wagen umher. Eine Menge Leute haben ihn fahren sehen; einige, die glaubten, es sei eine herrschaftliche Kutsche, haben sich hinten auf setzen wollen; kaum aber hatten sie den Wagen berührt, so flog er mit den Rossen hoch durch die Lüfte davon.
![]()