
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Welche sind nun diese Gesetze, die uns in der klaren Luft der Höhen tiefer blicken lassen sollen ins Wesen der Natur, als sonst im flachen Land der Alltäglichkeit? Manches davon trat uns schon fühlbar nahe. Haben nicht Latsche, Zwergweide und Bergnymphe mit ihrer eigenartigen Tracht, haben uns Polsterpflanzen und Geröllblumen nicht schon verraten, daß sie unter besonderen Sorgen seufzen? Und einer der gewohnten Wetterstürze in den Bergen erzählt die Geschichte ihres entbehrungsreichen Lebens. Gestern abends war noch ein unwahrscheinlich schöner Sonnenuntergang. So durchsichtig war die warme Luft, daß auch die fernsten Berge um viele Wegstunden näher gerückt schienen. Im Abendrot zitterten seltene violett-purpurne Farben mit; eine dunkle Glut, zuletzt ein lila Leuchten über allen Dingen, als seien wir im fernen Süden, unter der berühmten Dämmerungspracht von Capri, die ich auch nicht farbenglühender sah als hier um die Schutzhütte an der Nordkette der Alpen. Und noch jetzt, da der Tag schon längst alles Licht ausgetrunken hat, liegt noch ein unbeschreiblich tiefes Blau über den Bergketten und ein weiches laues Flimmern in der kristallklaren ruhigen Luft, als woge sie über Palmen und Orangenhaine und nicht über rauhe Felsberge in zweitausend Meter Höhe.
Der Unkundige spottet unter diesem träumerischen Himmel der Gefahren der Alpen, der Erfahrene geht lieber noch in der Nacht hinunter ins Tal. Er weiß: der Wettersturz ist nun nahe. Und schon in der Nacht beginnt ein dumpfes Sausen, mit unheimlichem Dröhnen wirft sich der Sturm in wütenden Stößen gegen das Haus, rüttelt und braust und stürzt sich heulend in das Tal. Welch ein Morgen! Dunkel, fröstelnd zieht er herauf mitten im Hochsommer. Das Thermometer ist seit gestern abends um 15 Grad gefallen und zeigt nahe dem Gefrierpunkt. Graue Schwaden verhüllen auch das Nächste um das Haus; Wolkenzüge wälzen sich wie ein schwarzes Heer himmlischer Reiter gespenstig von Berg zu Berg und lassen lange zerfetzte Fahnen herabhängen. Noch prasselt schwerer Regen nieder, aber schon wird der Ton der fallenden Tropfen schärfer, trockener. Graupeln sind es, die nun niedergehen. Und auf einmal sendet der Himmel flaumiges, wirbelndes Weiß. In schweren Flocken fällt der wässerige Julischnee, der Sturm nimmt ihn auf zum lustigsten Gestöber und in zehn Minuten sind alle Alpenblumen, die roten Rosen und grünen Latschen erstickt im Weiß der Winterlandschaft.
Die Städter aber lesen im Abendblatt: Der Wetterumschlag hat den Alpen Neuschnee gebracht …
Trocken meint hierzu der Klimaforscher: In Höhen über 1600 m kann es in Europa jederzeit im Jahre schneien. Da berühren sich Frühlings- und Herbstschneefall.
Und noch ein Kennzeichen der Alpennatur ist allen Bergfreunden klar bewußt. Die wochenlangen Sommerregen, die stete Neigung zum »Partieverderben«, die uns mit gemütlicher Ironie von einem »grünen Regenwinter« reden läßt, der den Bergen statt des Sommers beschert sei. Fürchterlich rauh und feucht, das ist also nach dem Gemeinglauben das Los der Bergeshöhe. Aber der Schein trügt und unermüdliche Naturforscher haben uns davon ein anderes Bild entworfen.
Für die Alpentäler stimmt der allgemeine Eindruck allerdings ziemlich mit der Wirklichkeit; für sie gilt das, was H. Christ in seinem unvergänglichen Pflanzenleben der Schweiz mit voller Offenherzigkeit gestand: »Wir Schweizer wissen aus Erfahrung, daß die Alpen im Sommer fast beständig in Wolken gehüllt sind, daß sie von Regen triefen, und wundern uns über die fremden Touristen, daß sie gerade diese Jahreszeit für ihre Reisen wählen, während der Herbst eine so unvergleichlich ruhigere Luft und trockene klare Tage bietet, die, wenn es sich bloß um ästhetischen Genuß handelt, dem Sommer unendlich vorzuziehen sind.«
Aber für die großen Bergeshöhen, die eigentliche Alpenzone, die sonst von keinem der deutschen Gebirge erreicht wird, gelten ganz andere, dem Flachländer unfaßbare Naturgesetze. Natürlich ist es wirklich kälter da oben, wo der Schnee an sonnengeschützter Stelle das ganze Jahr liegen bleibt. Eine allgemeine meteorologische Regel sagt uns: bei je 170 m Steigung sinkt die mittlere Jahrestemperatur um 1° C. Also sollte schon bei 2000 m Höhe ein Klima herrschen wie im rauheren Teile Grönlands. Und doch grünt und sprießt dort oben noch ein üppiges Leben. Denn auch diese Regel wird durchbrochen, vor allem dadurch, daß die Sonne in den Höhen wärmer scheint. Es gab eine Zeit, da unsere naiven Altvorderen glaubten, dies sei deshalb, weil man der Sonne dort oben näher sei. Wir Neueren haben den wahren Grund erfahren. Weil von der dünneren Lufthülle auf den Bergen nicht mehr so viel Wärme und Licht verschluckt wird, ist in der Höhe die »Insolation« stärker. Es ist ein eigenartiger Gedanke, daß uns die Luft den Sonnenschein auch am sonnigsten Tage verkümmert. Aber es ist so, daß sie in der Ebene von Paris 32% der Sonnenwirkung für sich aufzehrt, um sich zu erwärmen und mit Licht zu sättigen. Auf dem Gipfel des Montblanc aber nur 6%. Um 26% scheint die Sonne heißer und heller auf unseren höchsten Bergesgipfeln, als in den angeblich so sonnendurchglühten Ebenen.
Der Photochemiker versichert uns auch, das Höhenlicht sei anders abgestimmt als der Tag der Täler. Namentlich an ultravioletten, also an chemisch wirksamen Strahlen sei es reicher (wovon auch der Photograph im Hochgebirge etwas zu merken bekommt), und das bleibe nicht ohne Einfluß auf die Lebensvorgänge. Dieses Licht trägt sicher bei zu dem geheimnisvollen Segen, der über den Gebirgen ruht und sie zur Kraft- und Mutspenderin macht für die ermatteten und abgearbeiteten Menschen. Auf dem Monte Rosa, in 4600 m Höhe forscht man jetzt in einem Laboratorium diesen Zauberwirkungen nach und schon weiß man, daß sich in den Höhen das Blut merkwürdig rasch regeneriert, daß es sauerstoffreicher ist und ärmer an Kohlensäure, daß es sich im Körper unter dem Einfluß des Höhenlichtes ganz anders verteilt, so daß dadurch der Stoffwechsel mächtig angeregt wird. Wie wunderbar leicht man die größten Anstrengungen im Hochgebirge erträgt, welchen Aufschwung Gefühl und Mut dort nehmen, weiß jeder Hochtourist, freilich auch wie schlaflos die Nächte in Höhen über 2500-3000 m sind und was man … »Hüttenkoller« nennt in Erinnerung an den Tropenkoller.
Unter dem Einfluß dieser mächtigen Besonnung wird auch der Boden der Bergesgipfel merkwürdig warm. Kerner von Marilaun, der in seinem Innsbrucker Arbeitssitz so recht in das Wesen der Alpennatur eindringen konnte, fand, daß schon in einer Höhe von 1900 m der Boden durchschnittlich das ganze Jahr um drei Grad wärmer sei als die Luft. Die Meteorologen des Sonnblickobservatoriums, die in 3100 m Höhe arbeiten, versichern uns, daß sich dort die Luft vom Boden aus dreimal so viel erwärmt als durch die direkten Sonnenstrahlen. Diese scheinbar gleichgültige Tatsache sprengt den Riegel von dem Geheimnis der Alpenflora. Den Pflanzen ist der Boden und das Licht das Reservoir der Kraft. Ihre Wurzeln wühlen also in den Alpen in einem stark durchwärmten Erdreich, ihre Blätter arbeiten in einem fast überirdischen Glanze – kann es uns noch wundernehmen, daß die Alpenpflanzen herrlicher sind, denn alle anderen?
Wo so viel Licht, ist aber auch viel Schatten. Diese Vorzüge des Hochgebirgklimas gelten nur für die Sonnenseite und den Tag. Der Nordabhang der Berge ist gar übel daran. C. Schröter entwirft in seinem klassischen »Pflanzenleben der Alpen« ein anschauliches Bild davon. Er sagt: Ein treffliches Beispiel hierfür ist das Findelental im Wallis. An der sonnigen Südhalde geht dort der Roggen bis 2100 m, daneben deckt die »Walliser Alpensteppe« den verbrannten, dürren Boden; feinblättrige Steppengräser bilden den lückenhaften Rasen und südliche Unkräuter folgen dem Getreide. Und drüben, auf der gegenüberliegenden Nordhalde beschattet düsterer Arvenwald den Boden, und die Lichtungen sind bedeckt von einer arktisch-alpinen Zwergstrauchtundra. Also auf Steinwurfweite ein Gegensatz in der Vegetation, der 30 bis 40 Breitegraden gleichkommt.
Und mit der Abendröte sinkt auch die Sonnenseite des Hochberges nach Norden zurück. Die Höhe kennt nicht die lauen Nächte der Ebene, da alle Blumen süßer duften und in wohliger Erquickung sich recken und dehnen. Ist das Licht tagsüber um ein Drittel stärker gewesen als unten, so ist die »Ausstrahlung« nun des Nachts doppelt so groß. Es ist, so merkwürdig es klingt, auch das Klima des Hochkares fast das der Sahara. Nach dem heißen Tage folgt eine Nacht, in der es fröstelt und oft im Sommer friert.
Was wir erzählten, gilt für den schönen Sommertag. Aber wie viel solche gibt es denn in alpiner Höhe? Der Sommer auf dem Sonnblick ist genau so trüb, wie der Winterhimmel in der Schweizer Ebene. Der 2504 m hohe Gipfel des Säntis in der Schweiz hat im Jahre 226 Nebeltage, davon 127 im Sommer, während in den Alpentälern nur dreizehnmal im Jahre der Nebel brütet und davon höchstens einmal an einem Sommertage.
Welch merkwürdige Welt der Extreme und Überraschungen! Wie anders ist auch der Winter im Hochgebirge, als man gemeinhin denkt! Wer früher im Winter in die Berge ging, brachte sich um seine Reputation, bis man auf einmal entdeckte, daß es dort, »wo in feierlichem Chor die eisigen Hochalpen schweben«, in der rauhesten Jahreszeit über alle Maßen schön und – mild sei.
Wir alle, die wir im Winter, angetan mit der so behaglichen nordischen Sportskleidung, in die Berge eilen, wissen es, welch südlich blauer Himmel dort lacht, wenn die Städte des flachen Landes in Graus und Nebel seufzen, wie warm die Sonne im Januar scheint, so daß man sich ungescheut in den Schnee strecken kann und in dem scharfen Lichte baden. Eine Pracht ist dann aufgerichtet, wenn in Millionen Diamanten die Schneekristalle funkeln und in Weiß und Violett und zartblauen Schatten mit köstlicher Reinheit scharf und merkwürdig klein die Berge ins tiefe dunkle Blau ihr schönstes Bild eingraben, wenn man aus dem Tal nach oben strebend plötzlich dem Nebel entrinnt und nun über dem Wolkenmeere ihre neue reinere Welt vor sich erblickt, – ein Glänzen und Funkeln, ein heiteres Schimmern und Prangen, wie es kein Sommersonnentag freudiger in die entzückten Sinne zu prägen weiß.
In der Sprache der Meteorologie drückt man diese Schönheit so aus: »Das Gebirge hat im Winter durchschnittlich jeden zweiten Tag um Mittag vollen Sonnenschein, im Sommer dagegen nicht einmal jeden dritten Tag.«
Da kann es denn nicht wundernehmen, wenn dort in der angeblich so eisigen Höhe an den Stellen, wo der Steilabfall der Wände dem Schnee die Niederlassung nicht erlaubt oder der Wind den Boden reinfegt, mitten im Winter Blumen üppig blühen. Botaniker versichern uns, daß sie zwischen Weihnachten und Neujahr in der Schweiz in 2200 m Höhe blühende Anemonen, den schönen blauen Frühlingsenzian, ja sogar blühenden Wundklee ( Anthyllis vulneraria) beobachtet haben und viele andere mit grünen Blättern!
Freilich haben wir bisher nur die sonnigste Seite des Alpenwinters hervorgehoben. Es bleiben aber auch der Bergeshöhe die Schrecken des Winters nicht erspart. Zwar fällt auf ihr weit weniger Schnee, als man gemeinhin denkt. Über 2000 m nehmen die Schneefälle rasch ab und wer die Alpen kennt, findet es nicht verwunderlich, wenn ihm Reisende berichten, daß in dem mächtigsten Gebirgsstock der Erde die Hirten im Winter durch tiefen Schnee ihre Herden auf die Berge treiben, denn dort oben in den Hochebenen Zentralasiens, sind in 3400-3700 Meter Höhe ganz schneefreie liebliche Hügellandschaften mit üppigen »Winterwiesen«.
Unter zweitausend Meter ist der Alpenwinter allerdings sehr schneereich. In Davos (1560 m) fällt im Durchschnitt jährlich über fünf Meter Schnee, am Gotthardhospiz (2100 m) über 13½ Meter; am Grimselpaß (1874 m), wo im Totensee die Gebeine der zahllosen darin Begrabenen neun Monate jährlich unter Eis liegen, fällt 17 Meter Schnee im Jahre, dagegen am 3333 m hohen Theodulpaß kaum mehr 2½ Meter!
Und unser klimatisches Bild der Alpen wäre schließlich noch ganz falsch, wenn wir des Sturmes vergessen würden, der über die Berge und Täler braust. Nicht nur der echte Bergwind, der Föhn, der die Schneeschmelze bringt und in vielen Alpentälern durch seine warme Luft sogar das Reifen des Getreides besorgt, sondern auch die Herbst- und Winterstürme, die Steine mit sich führen, auf ihren Fittigen handgroße Platten emporwirbeln und ganze Wälder niedermähen. Statistik prägt auch hierüber mehr ein, als eine noch so schwungvolle Schilderung. In Kremsmünster, im üppig reichen österreichischen Alpenvorlande, ist das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit 3½ m, gar nicht weit davon, auf dem 3110 m hohen Sonnblick, aber 9,3 m. Das entspricht auf der Skala der »Windstärken«, die mit 0 die völlige Windstille, mit 12 aber den alles verwüstenden Orkan bezeichnet, der Stufe 5, dem frischen Wind, der dem Gefühl bereits unangenehm ist. Von diesem Mittel aber steigt der Bergwind vom Dezember bis März zur Kraft eines Zyklons auf, der auf den ausgesetzten Graten und Gipfeln aber auch jedes Sandkorn Erde hinwegzufegen versteht und dort, wo er in einer Mulde sich ins Tal stürzen kann, bis tief hinunter dem Wald die Lebenslust nimmt und keinen Baum mehr duldet.
Aus alledem ergibt sich ein ganz anderes Naturbild, als wir Flachländer es gewohnt sind. Eine Welt mit anderen Jahreszeiten, hochnordisch und tiefsüdlich zugleich, mit dem kurzen Sommer der Polargegenden und dem scharfen Licht der Tropen, mit einer Trockenheit der Luft, die an die Wüsten gemahnt und einem unerhörten Reichtum der Niederschläge. Eine Natur, die mit allen Kontrasten spielt, rauh und mild zugleich, arm und reich, anziehend und abstoßend. Dicht neben dem Schreckhaften das Liebliche, neben dem Großartigen das Idyllische, alles in allem der merkwürdigste Rahmen für den Kampf ums Leben, den man sich auch mit ausschweifendster Phantasie nicht so reich und bunt ersinnen könnte.
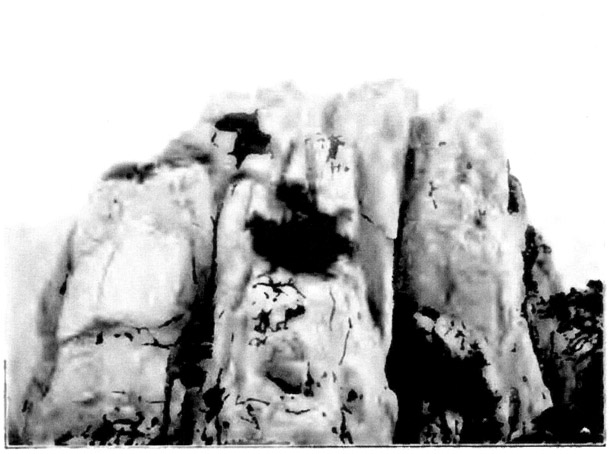
Gratbildung auf dem Plankenstein (Tegernseer Berge).
(Naturaufnahme von H.
Dopfer.)
* * *
Dies alles ist aber erst der Rahmen zu dem Bilde, das zu malen wir uns vorgenommen haben. Wer in solcher Natur ständig lebt, der wird auf das härteste erprobt. Täglich, stündlich treten an ihn Gefahren heran, denen er siegreich begegnen muß. Uns Menschen ist das nicht gelungen, wir haben den Kampf mit den Alpenbergen nicht gewagt. Schon bei kaum 2000 m hören die letzten dauernd bewohnten Dörfer auf. Santa Maria am Stilfser Joch ist mit 2487 m die höchste, auch im Winter bewohnte Ortschaft mit einem Klima wie Spitzbergen. Höher dringt der Alpenbewohner nur mehr als – Wirt Das Hotel du Theodule in 3000 m Höhe, das barbarischer Weise auf dem Gornergrat (3109 m) bei Zermatt erbaute Hotel, das Hotel des Grands Mulets (3100 m) auf dem Mont blanc, sowie die Station Eismeer, sind die höchsten Gaststätten. oder Wissenschaftler, welche Zusammenstellung einem Philosophen des praktischen Lebens viel zu denken und zu lächeln geben mag. Die Sennen im Wallis (Schweiz) beziehen zwar noch in 3100 m Höhe ihre »Hochläger«, aber nur für wenige Sommerwochen und oft genug in den schützenden Wald durch Neuschnee vertrieben. Den Menschen befällt in Höhen von 3000 m die Bergkrankheit, nicht unähnlich dem Übel, wodurch der Ozean sich an den seine Macht erprobenden Menschlein rächt. Das ist ein Zeichen, daß wir nicht die anpassungsfähigsten aller Lebewesen sind. Wir werden von zahllosen Tieren und Pflanzen beschämt, ohne uns Rechenschaft darüber geben zu können, warum jene ohne jeden Nachteil das ständige Leben in verdünnter Luft um so viel besser vertragen, als wir. Welch wunderbares Lebensrätsel birgt doch der vielbestaunte winzige Gletscherfloh ( Desoria glacialis), der ungeachtet aller Unbilden der Witterung auf den Firnfeldern seine lustigen Sprünge ausführt! Warum kann er wochen- und monatelang im Eise (sogar bei -11°) einfrieren, ohne an Lebenskraft einzubüßen, was auch sein Bruder im Flachlande, der Schneefloh ( Degeeria) kann, nicht aber die auf den Weihern umherhüpfenden Formen seines Geschlechtes ( Podura)? Warum treiben die alpinen Poduriden noch in 4000 m Höhe ihr munteres Spiel, nicht aber auch andere Insekten? Gelten für sie denn nicht die gleichen physikalischen Gesetze wie für alles Lebendige, das sonst scheu die großen Höhen meidet? Wir wissen nur zu fragen, aber nicht zu antworten. Wenn nur der Nahrungsmangel die Tierwelt von den Firnen fernhalten würde, dann wäre auch die Arktis nicht belebt und sie birgt doch so reiches höheres Tierleben. Es entbehren übrigens auch die Alpenhöhen dessen nicht ganz. Die reizende Schneemaus wühlt noch in 4000 m Höhe, der Alpenhase treibt seine Kapriolen noch um 3700 m. In gleicher Höhe schwärmen mit heiserem Krächzen die Bergdohlen, welche die Wände der Felsenberge allein beleben, seitdem man die großen Geier und Adler fast vernichtet hat. Im Gestein der Hochberge suchen Bergeidechsen, Alpensalamander und Kreuzotter ihre Beute und verraten damit, daß zwischen 2–3000 m Höhe das Tierleben wahrlich nicht erloschen ist. Und Steinbock, Gemse, Murmeltier, diese aussterbenden Spezialtiere der Alpen, sind zu bekannt, als daß wir ihrer noch besonders zu gedenken brauchten.

In der Kampfregion des Hochgebirgswaldes. Motiv bei Schliersee in Bayern.
(Naturaufnahme von H.
Dopfer. München)
Aber dieses ganze reiche Tierleben könnte für sich nie bestehen. Es beruht im letzten Grunde doch nur darauf, daß die Pflanzen allen Gefahren und Schrecknissen der Hochregion in einem Maße zu trotzen wußten, die uns als das Ehrwürdigste und Rührendste in dem an ergreifenden Schaustücken wahrlich überreichen Bild der Alpen vielleicht am meisten fesselt, wenn wir nur erst das eigenartige Wesen und Leben der Hochalpenpflanzen so recht erfaßt haben. So schön sie sind, so verblaßt doch all der Zauber ihrer Erscheinung vor dem Interesse, das ein Blick in ihr Innenleben jedem Naturfreund einflößen muß.
Dem Durchschnittstouristen, der zu den Höhen emporstrebt, fällt es erst dann ein, einen Blick auf das Pflanzenleben an seinem Wege zu werfen, wenn ihm die ersten wohlbekannten Bergblumen das Nahen der Felsen und Grate künden. Und doch könnte ihm schon lange vorher so viel die Einförmigkeit des Weges kürzen, wenn er es nur sehen würde. Aber gerade im Naturgenuß besteht das alte Wort zu Recht: Man sieht nur, was man kennt.
Dem Kenner erzählt schon der Talblick auf die Berge eine Menge von deren Pflanzenleben. Er merkt schon in der Tiefe allenthalben die Vorbereitungen zu einer neuen Art von Lebensführung. Sogar der Wald verliert das wohlvertraute und nimmt dort, wo er bergan steigt, etwas Unbändiges, Eigenes an. Standen unten im Tal Eiche und Buche oder gar bunt gemischter Auwald, so reißt nun mit jedem Meterhundert Bodenerhebung die Buche bald die Führung an sich. Aber auch sie hat jetzt etwas Knorriges, Hartes, Gedrängtes. Ihre Blätter werden kleiner. In Zahlen ausgedrückt: Bei je 100 m Erhebung haben tausend nebeneinandergelegte Buchenblätter um einen Quadratdezimeter weniger Oberfläche. Aber nach bevor dies augenfällig wird, ist auch schon die Buche verdrängt durch die Fichte und Tanne, die sich nun so stolz und mächtig recken, als hätten sie die Kraft in sich, allen Mächten der Natur zu trotzen. Aber sie ertragen nicht einmal die unwägbaren kleinen Unterschiede in der Luft zwischen tausend bis tausendfünfhundert Meter Höhe, was hat sich da überhaupt inzwischen geändert? Wir wissen es schon: auf je 170 m ist es um einen Grad kühler geworden, die Luftbewegung stärker, das Licht heller – im Sommer fällt mehr Regen, im Winter mehr Schnee und eine Woche dauert es länger, bis es Frühling wird. Solches sind aber für die Riesentannen jene gewissen Kleinigkeiten, an denen auch großer Menschen Wagemut zerschellt. Sie genügen, um ihnen die Lebenslust zu nehmen. In 1500 m Höhe hat der Nadelwald etwas Müdes und Sorgenvolles, wenn Bäume wirklich ihre Physiognomie haben, so muß der die Sprache der Natur verstehende Dichter diesen Wettertannen anmerken, daß sie ein Kummer drückt. Ihre Äste stehen mit einer Gebärde der Entsagung zu Boden, ihr Gipfel ist zerzaust, ihr Nadelkleid zerrissen, mißfarben und von grobem Stoffe, sie halten sich nicht rein und sind von hundert struppigen Flechten überwachsen. Noch höher am Berg werden sie bucklig und klein und sehen alle gealtert aus; da und dort steht ein in Vollkraft abgestorbener Genosse zwischen ihnen, eisengrau, knochenbleich wie ein Skelett. Auf einmal tritt der Weg zwischen den letzten Tannen heraus und alle hohen, die noch vor uns liegen, sind baumfrei.

Ein »Wetterbaum«. Man beachte die zu Boden greifenden Äste, den gebrochenen Wipfel und die einseitig gescherten Zweige. –
(Naturaufnahme von H.
Dopfer. München.)
Wir sind an der Waldgrenze, sagt uns der Botaniker. Und er deutet uns all das Fremdartige an den Bäumen als Kampferscheinungen zwischen der Pflanze und dem Klima. Daß ihre Äste alle in der Richtung des herrschenden Windes abgebrochen sind, daß ihre Wurzeln sich mächtig verankern, erklärt er uns aus der Macht der Stürme. Daß ihre Zweige zu Boden greifen, daß ihre mächtigsten Äste unten am Stamm sich oft geradezu der Erde anschmiegen, bringt er mit dem mächtigen Schneedruck in Zusammenhang, unter dem diese freudlosen Gewächse viele Monate lang im Jahre seufzen. Und daß sie, selbst wenn sie hundertjährig sind, nur klein bleiben, das können wir uns rasch selbst deuten, wenn wir bedenken, daß diese Vorposten des Waldes in einem Klima leben, dessen Jahresmittel nicht weit um den Nullpunkt schwankt. 2,1° C auf dem Rigi, -0,6° C bei Zermatt in der Schweiz. Es bleibt ihnen im kurzen Sommer kaum Zeit zum Wachstum. Oft können sie nicht einmal einen Holzstamm ansetzen. Darum wird im »Kampfgürtel« Fichte und Buche oft nur zum Krüppelbusch.
Aus diesen Ursachen ist jeder hohe Berg nur zum Teil mit Wald umkleidet, wie hoch sein Waldkleid reicht, hängt von hundert Ursachen ab. An der Südseite erlaubt die Sonne auch dem Walde das Bergsteigen; Felswände drängen ihn wieder tief hinab, in Südtirol und der Südschweiz liegt die Baumgrenze um sechshundert Meter höher als in den nördlichen Ketten der Alpen. Und zu guter Letzt vergißt sogar der Mensch aller natürlichen Gesetze und – zündet den Wald an, um größere Weiden zu gewinnen! So taten z. B. die Sennen im Graubünden, und im Wallis oder den Urkantonen war es nicht viel besser. Die Natur hat auf ihre Weise stumm, aber gerecht die Menschen dafür bestraft. Sie sendet Steinströme und Muren in die Täler, wenn die »Bannwälder« fehlen. Uri, Bünden, viele Gegenden in den Zentralalpen sind so waldarm, daß die Dörfler vielfach zum Schicksal der mongolischen Steppenbewohner herabsanken und mit getrocknetem Dünger im Winter ihre Stuben heizen.
Ein guter Teil der »Almen«, der Weideplätze wurde künstlich dem Walde abgerungen und vielleicht ist dieser Mutwillen mit schuld daran, wenn man von einer »Verwilderung« der Alpen sprechen kann.

Schneedruck im Gebirgswald.
(Originalzeichnung von Dr. G
Dunzinger. München)
Schon im Jahre 1820 war die Erscheinung so auffallend, daß die schweizerische naturforschende Gesellschaft eine Preisfrage ausschrieb: »Ist es wahr, daß die hohen schweizerischen Alpen seit einer Reihe von Jahren rauher und kälter geworden sind?« Die preisgekrönte Schrift eines Berner Forstmannes bejahte damals die Frage unbedingt. Und was er an Beweisen beizubringen wußte, an dem ließ sich nur schwer zweifeln, denn an vielen Stellen der Alpen finden sich wirklich weit oberhalb der jetzigen Baumgrenze, mitten zwischen den Sträuchern oder gar auf den Wiesen noch die Strünke einstiger gewaltiger Waldbäume. Besonders auffällig war das am Rothorn oberhalb Brienz. Dort findet man noch an Ort und Stelle stehende Strünke alter Fichten. Jetzt sind dort weit und breit keine Fichten mehr zu sehen, und der nächste Fichtenwald reicht nur in eine 300 m niedrigere Zone. Am Nordabhang der Churfürsten stehen die letzten Wetterbäume der Arven um gute hundert Meter niedriger als die Strünke abgestorbener Exemplare. Die Arven sind daher dort zweifellos in den letzten Jahrhunderten zurückgewichen. Auch in Hochmooren und am Grunde von Seen, die hoch über der Baumgrenze in Matten oder Felskare eingebettet sind, fand man mächtige Baumreste. Es kam dadurch wieder alte Volkserfahrung zu Ehren, die in mündlichen Überlieferungen und Sagen die Erinnerung an verschwundene Hochwälder und üppige Pflanzennatur von Orten aufbewahrte, an denen heute nur ödes Felsgestein ist.
Aber nicht nur solches deutet auf eine Klimaverschlechterung. Die Förster klagen, daß in den Hochlagen der Wälder, besonders an der Baumgrenze der Waldbestand jetzt so schwierig zu erhalten sei, da kein Holz nachwachse und die vorhandenen samenreifen Bäume auffällig wenig Samen ansetzen; die Sennen klagen, daß die Weiden im allgemeinen schlechter seien als ihre frühere Wertung sagte, die Landwirte der Alpentäler klagen, daß Weinbau und Getreidebau sich jetzt bedeutend niedriger ziehe als zu Vorväters Zeiten, eine Klage, deren Berechtigung durch Hunderte von Flurnamen und weite Strecken terrassierten, also einst kultivierten Landes mitten in jetzt unfruchtbaren Gebieten genugsam bezeugt wird. Aber auch der Meteorologe schließt sich diesen Zeugen an und weist – wenigstens für die Schweiz – eine Zunahme der Lawinenhäufigkeit und längeres Liegenbleiben des Schnees, vor allem aber langsames, doch stetiges Vorrücken der Gletscher talabwärts nach.
So war die Sachlage vor achtzig Jahren, und es scheint seitdem nicht besser geworden zu sein. Auch in neuerer und neuester Zeit hat sich eine große Anzahl Forscher mit dem Problem der Alpenverwilderung beschäftigt und fand überall von den Ostalpen bis zum französischen Alpenanteil einen Rückgang der Vegetation. Herrschte darüber Einigkeit, so ist man um so mehr im Unklaren: woher diese scheinbare Verwilderung der Alpen rühre? Im großen ganzen stehen sich da zwei Parteien gegenüber. Die eine mißt dem Menschen alle Schuld an der Erscheinung bei, die andere sieht die Hauptursache in einer Klimaverschlechterung.
Wahrscheinlich wirkt dabei mehreres zusammen. Für den Älpler ist es eine Warnung, seine Heimat nicht als unerschöpflichen Reichtum zu betrachten, mit dem man wüsten darf. Er könnte aus den Schwierigkeiten, mit denen die alpine Weidewirtschaft stets zu kämpfen hat, fürwahr genug gewitzigt sein, daß die Alpennatur keine gütige Mutter ist, sondern herb und streng.
Oberhalb der Waldgrenze erstreckt sich ein Gürtel, bei dessen Durchwandern uns dies jeden Augenblick in Erinnerung gerufen wird. Dies ist die Zone der Alpenmatten. Sie sind es, von denen Albrecht von Haller, dieser universellste Geist, den die Schweiz je hervorgebracht hat, und der seinem Volk als Botaniker, Anatom und Physiologe ebenso wert im Gedächtnis ist, wie als Dichter uns Staatsmann, in seinem berühmten »Anfang einer Geschichte der Schweizerpflanzen« schon vor fast 150 Jahren eine bei aller Kürze so plastische Schilderung gab, daß ich mich nicht scheue, diesen alten Schriftsteller abzuschreiben. Er sagt, daß nach den Fichtenwäldern die strauchigen Holzgewächse kommen: zuerst der Wacholder und die Kiefer mit eßbarer Frucht, dann die Alpenrosen, Vaccinien und Alpenweiden. Mehr und mehr bieten sich dann den Kühen üppigere Triften dar, auf denen vierzig Tage lang die Herden bleiben, während denen sie allein und nicht einmal vollständig von Schnee frei sind. In dieser Region kommen zahlreiche Alpenpflanzen vor, von denen nicht wenige in Lappland, Sibirien und Kamtschatka auch wachsen: einige auch auf den höchsten Bergen Asiens. Die höchsten Berge bringen die meisten dieser Pflanzen hervor. Dann folgen die Weiden, mager, felsig, den Schafen allein zugänglich, auf denen ganz niedrige Kräuter, alle perennierend, meist mit weißer Blüte, kurzen Rasen bilden. Sie sind im ganzen hart, halten die Farbe beim Trocknen gut, und sind so aromatisch, daß selbst die gemeinen Ranunkeln duften. Und dann folgen die Felsen mit ewigem Eis und einigen Gletscherpflanzen. So steht bei Haller zu lesen.
Heute nennt man jene Teile, welche über die letzten Bäume hinausragen, die eigentliche Alpenregion und gliedert sie in eine untere von der Baumgrenze bis zu den untersten Schneeflecken, in eine obere, welche das Gebiet der Schneeflecken selbst umfaßt, auf die dann noch das Land des ewigen Winters aufgesetzt sein kann, jene grausige weiße Wüste des Firnschnees, an dessen unteren Hängen der körnige Schnee sich langsam zu grünem Gletschereis wandelt, das dann tief (oft bis 1800 m) in die Täler herabfließt.
Daß diese Regionen nicht scharf voneinander geschieden sind, daß Alpenrosen und sonstige Alpensträucher schon tief in den oberen lockeren Nadelwald eindringen, daß Mulden Hochalpengewächse manchmal sehr tief herablocken, daß die Schneeflecken in tiefen Schluchten eine eigene Vegetation nach sich ziehen, daß da und dort der eine oder andere Zwischengürtel ausgeschaltet ist, oder sich die Latsche noch als besondere Region einschiebt, das ist jedermann ohne weiteres verständlich, der die Freiheit und Regellosigkeit der Natur, die stets unsere systematischen Begriffe sprengt, aus eigener Anschauung kennt.
Jawohl, es ist eine Welt entzückender Freiheit und Vielgestaltigkeit, diese alpine Region mit ihrer Licht- und Blumenfülle, der herben frischen Luft und den weiten Fernblicken hinunter in die Länder der Menschen. Stets genießt man das Außergewöhnliche, ob man nun im »Knieholz« aufwärts klimmt an einem müßig steilen Hang, oder zwischen den Dickichten der Alpenrosen wandert, die sich so gern mit den Bergföhren verbinden und der Landschaft etwas ungemein Festliches verleihen mit den heiter roten Blütenbüscheln, die oft wie natürliche Dekorationsstücke eines alle Wirkungen fein abwägenden Gärtners in Gruppen gestellt sind, oder ob der düstere und eintönige Ernst des Wacholders, der in der Hochregion eine Zwergform bildet ( Juniperus nana) den Weg umsäumt oder wir nun aus einem Joch hinaustreten auf eine der berühmten Blumenmatten, von deren unbeschreiblicher Pracht selbst ein Gemälde nur eine blasse Vorstellung geben kann. Denn das alles gewährt nur einen Ausschnitt. In der Natur dagegen blendet die Überfülle der Gesamtheit, das Überwältigende eines Farben-, Formen- und Lebensreichtums, der unter Umständen selbst den des Tropenwaldes übertrifft. Dem Eindrucke nach sicherlich.
»Kommst du zu rechter Zeit, so gleicht auch nichts in der Welt dieser wahrhaft berauschenden Herrlichkeit! Die großen Blumen, dicht aneinanderstehend, verdecken förmlich die niedrigen kleinblättrigen Pflanzen, so daß das Grün nur spärlich durch die glänzenden Farben der Blumen hindurchschimmert, die man nur mit zögerndem Bedauern betritt.« Es ist ein sicherer Gradmesser für die Schönheit dieses Naturbildes, daß solche Worte nicht im Buche eines schwärmend schönheitsuchenden Dichters stehen, sondern im gediegen gelehrten Werke des ehrsamen Christ, der für die Schönheit seiner Heimat, oft und oft hingerissen, Worte, vergleiche, Bilder und Gefühle findet, die das Mitempfinden heiß auflodern lassen, als ob wirklich ein echter Dichter spräche.
Die »rechte Zeit« für die Hochwiesen, die er meint, ist der Juni und oft noch der Juli. Da erlebt man eines der holdesten Wunder der Natur. Mitten im Hochsommer, wenn unten schon lange die Erinnerung an das Frühlingwerden verblaßt ist, inmitten reifender Getreidefelder und schwertragender Obstbäume, blühen oben auf der Alpenmatte erst die Frühlingsblumen auf. Da nicken sie, die hell rotlila Döldchen der Mehlprimel zu Hunderten, die Frühlingsenziane mischen darunter ihr durchdringendes Blau, Anemonen und Hungerblümchen und Veilchen, die in den Ebenen um diese Zeit seit schon längst Früchte tragen, entfalten auf dem Hochberg nun erst ihre Blüten. Der prächtigste orientalische Teppich erscheint farblos und eintönig gegenüber der kühnen und satten Farbenpracht der Alpenmatten. Da schimmert weithin in großen Polstern rosig rot das stengellose Blümchen der Silene, das man zu deutsch so häßlich Leimkraut zu nennen pflegt, dort stellen sich Wundklee, Fingerkräuter und allerlei Kreuzblütler zu hochgelben Blumensträußen zusammen, in hellem reinen Blau strahlt das großblumige Alpenvergißmeinnicht, in sattem Orange alle Korbblütler, die im Tiefland gelb sind; hart nebeneinander sind alle Kontraste gesetzt, mit kühner Verachtung jeder Farbenlehre steht weiß neben gelb, und gelb neben rot und dennoch vereint sich dies alles in eine entzückende Harmonie, die unerreichbar bleibt für den Neid des größten Künstlers. Mit den Blumen mengen sich saftige Gräser, bald frischgrün und smaragden leuchtend, bald mit amethystfarbenem Schimmern überhaucht, in feinen Farbenspielen gleißend, in zartesten Formen mit dem Winde spielend, oder derb und kräftigbraun oder auch fahl. Über ihnen gaukeln Falter, die nicht weniger farbenprächtig und bunt sind wie die Alpenblumen. Hummeln brummen tief und melodisch. Der Jochwind nimmt die Töne auf, wirft sie auf seinen Luftwellen durcheinander, daß sie sich in den Tonfall eines fernen Läutens verwandeln und mischt darein wirklichen Glockenklang der werdenden Herden. Das zieht so wundersam um den Berg und einigt sich in ein unvergeßliches Erlebnis: der Duft der fernen Täler, der lichtstarke Himmel, der Wohlgeruch der Würzkräuter, die vielen Farben, die im Winde schwankenden Gräser und das melancholische Klingen und Summen, das den ganzen Felsenhang mit süßen, ruhigen Stimmungen überspinnt. Eine Ruhestunde da oben bei den Almen macht bis zur Wunschlosigkeit glücklich …

Silene acaulis im Geschröf.
(Originalzeichnung von R.
Baworowsky)
Christ, der Dichterbotaniker, hat mit seinem reinen frommen Gemüt auch hier künstlerische Darstellungskraft gefunden, die im ganzen botanischen Schrifttum nicht wiederkehrt und ihm, dem Vergessenen, einen Platz sichert unter den Klassikern der Naturdarstellung. Man wird mir dankbar sein, wenn ich ihn reden lasse von den großen kleinen Schönheiten seiner von ihm so wohl gekannten und heißgeliebten Berge.
»Im großen Ganzen ist unser Hochgebirg – sagt er – ohne Unterschied des Gesteins, wo nicht frisches Geröll und allzu steile Wände anstehen, vom Grün der Alpenweiden geschmückt. Es gibt keinen herrlicheren Anblick, als diesen zarten im hellsten Smaragd erglänzenden Anflug der alpinen Region gegen Mitte Juni. Kaum sind die Schneefelder all der zahllosen Falten und tausendfachen Hochtälchen unserer Bergketten unter dem Strahl der immer höher steigenden Sonne geschmolzen, so erscheint dies ätherische Grün und glänzt im hellen Mittag in jener Glorie, welche die Gipfel umgibt und auch den Felsen und Schneelagern ein unbeschreibliches Kolorit: den Zauber der Höhe und der Ferne verleiht. An einem schönen Junitag aus der Walliser Talsohle all die Höhen ringsum von 1900 bis 2600 Meter im Schmelz dieses jungen Grüns zu betrachten, im Kontrast zu dem Diadem von Schnee, das die obersten Höhen noch immer einnimmt, ist ein hinreißender Genuß.
Man täuscht sich oft über den Höhepunkt der Blütezeit unserer Alpenflora. Im Hochsommer sind es nur noch die höchsten nivalen Standorte, welche einen ganz frischen Flor bieten. Sonst hat der Alpenrasen bereits seinen Hauptschmuck verloren. Im Juni, dem schmelzenden Schnee auf dem Fuße folgend, erblüht die mittlere und selbst die höhere Alpenflora, und wer diese Blumenteppiche in ihrer jungfräulichen Frische nicht geschaut, hat keinen Begriff von der Pracht und Fülle ihrer Blütenwelt.

Aus dem Blumenreichtum der Almen – Gewimperter Enzian
(
Gentiana ciliata).
Die Schynige Platte am 11. Juni, der Pilatus am 18. Juni, das Simplonplateau am 20. Juni, das sind die richtigen Momente, die freilich in ungünstigen Jahren sich um acht bis vierzehn Tage verschieben können. Das zarte Rosa der Mehlprimel, der Silene acaulis, das kalte Weiß der Anemone, das brennende Hochgelb der Hieracien, das tiefe Kupferrot der Bartsien, das ebenso tiefe oder feurige Blau der Gentianen die in mächtigen Büscheln aus dem Grunde lagern, und vor allem das tiefsammtene Violett der in unendlichen Mengen sich öffnenden Veilchen ( Viola calcarata) bilden die Haupttöne in dem schillernden, mit unzählbaren Tautropfen wie Diamanten beperlten Teppich, zu welchen auf dem Simplon noch die seltsame Zier der schneeweißen Rojetten des Senecio incanus mit dem Orange ihrer Blütenköpfchen, der tiefblutroten Semperoiven und Pedicularien, der himmlisch reinen Alpenlilie ( Paradisia), der doppelfarbigen Astern und des grauwolligen Edelweiß, der hochgelben Aretie und des Eritrichium kommt, welches den tief azurnen Himmel der Südalpen an sanfter Kraft der Farbe erreicht.

Lägerflora um eine Sennhütte. Motiv von der Fischbachalm in den Schlierseer Bergen,
(Naturaufnahme von H.
Dopfer. München)
Doch sind die zwei Stufen deutlich unterscheidbar: Das erste Erblühen, welchem die zarten Farben eigen sind, und wobei das Weiß und das errötende Rosa vorherrscht. Es sind die Trocus, die Anemonen, die Schneeranunkeln, die Mehlprimel, die Silene, die mattgelbe Aurikel, die zarten Soldanellen, welche zuerst erwachen. Erst zwei Wochen später treten dann die feurigen Sommerfarben: das brennende hochgelb und Orange der Gemswurz ( Aronicum) und des Kreuzkrautes, das purpurne Schwarz der Nigritellaorchidee, das kräftige Violett des Leinkrautes ( Linaria) und der Leguminosen und der Purpur der Alpenrose hinzu. Es ist derselbe Gegensatz wie bei dem Frühlingsflor und dem Sommerflor unserer Talwiesen: dort Weiß und helles Gelb, das noch an den Schnee erinnert, hier bunte Töne zwischen Blau und Rot, die der höher gestiegenen Sonne entsprechen. In den Alpen folgen sich freilich beide Perioden so rasch, daß sie sich unmittelbar aneinander reihen und häufig in eine einzige verschmelzen. Zu dem Glanz der Blumen kommt als wesentlicher und ganz eigentümlicher Schmuck die Fülle von Gräsern, Seggen und Simsen, die alle mit bunt gescheckten, durch alle Töne von Hochgelb bis Braun bis zum tiefsten Schwarz gefärbten Ährchen über den Blumen nicken und schwanken und der reinen Schönheit der Korollen das Zierliche und Seltsame beifügen.

Edelweiß (Gnaphalium Leontopodium) im Geschröf.
(Naturaufnahme von H.
Dopfer. München.)
So steht die Alpe in ihrem Hochzeitskleid vor uns, die Vorahnung einer reineren höheren Welt, ein Guß unseres Gottes, und alle Herrlichkeit der Welt dort unten ist gegen sie wie Spreu.« …
Aber dieser schönste Alpengürtel ist nicht sehr breit. Um die Almen ist er auch nicht am reichsten entwickelt. Da wird der Blumenschar zu übel mitgespielt; Kühe dezimieren die holde Pracht und verschmähen die häßlichen, stachligen und giftigen Pflanzen, so daß sich da gar bald eine gewisse Auslese geltend macht, die nicht zugunsten des Naturbildes ausfällt. (Es gibt eine besondere »Lägerflora«, welche in der Umgebung der Sennhütten oft alle anderen Gewächse verdrängt und so hoch hinaufsteigt, als der Mensch überhaupt dringt. Die häßliche große Brennessel, der nicht schönere Alpenampfer ( Rumex alpinus), die gewöhnlichen Melden ( Chenopodium bonus Henricus) machen sich darin breit und allerlei Disteln, allerdings auch der schöne Eisenhut ( Aconitum) leisten ihnen Gesellschaft. Auch duldet meist der Berg selbst nicht, daß die alpine Wiese zu mächtig werde, denn an die Baumgrenze schließt sich nur zu bald die Felsflur an, mit ihrem Schuttgürtel und den Karen, die uns das erste über die Bergnatur gesagt haben. In felsigen Stufen, immer seltener durchwachsen von rasigen Stellen, strebt der Berg empor, bald beginnen die starren, haushohen Wände, an denen nichts lebendes mehr Fuß fassen kann, es sei denn an den »Rasenbändern«, an denen auch der Tourist die Höhe gewinnt.
Hier beginnt eine neue Welt. Zwar sind es großenteils noch die Bürger der Hochwiesen, die auch das Geschröf und die Rasenbänder besiedeln, aber sie kämpfen mit ungewohnten Lebensschwierigkeiten und wandeln sich in einen besonderen enggezogenen Lebenkreis, den der Fels-, Geröll- und Spaltenpflanzen. Auch hier entsteht eine Kampfzone der Kräuter, wie es einen Kampfgürtel des Waldes tiefer unten gab. Der geschlossene Heerhaufen der Wiesenblumen und Gräser löst sich auf, zuerst in einzelne Rasenflecke, dann sogar in einzelne Pflanzen, die nun als Plänkler den Kampf mit den Gewalten der Bergeshöhe aufnehmen. Zwergsträucher, hin und wieder noch die Legföhre und Alpenrose leisten ihnen Gesellschaft, oft fliehen sie im Zuge einer Geröllhalde oder eines Lawinenbettes, entlang einem der Sommers über trockenen Sturzbäche, tief hinab mitten unter die Wälder. Manch süßes Kind voll bergfrischer Schönheit wandert dann von oben mit einem Gebirgsfluß an seinen Schotterbänken ins Flachland. So sitzen die unschuldigweißen großen Blumen der Bergnymphe vor Münchens Toren, entlang der Isar. Aber ganz oben auf den unwegsamen Zinnen verbringen sie ein Leben voll Glanz und Schauern und Einsamkeit, hier ist das Revier, wo es wirklich noch Edelweiß ( Gnaphalium Leontopodium) gibt und aromatische Edelrauten ( Ligusticum Mutellina), die des Tirolers Liebste noch höher schätzt als jenes, da es von mehr Unerschrockenheit und Bergtüchtigkeit ihres Verehrers zeugt, Edelrauten selbst zu pflücken, als das, schon auf vielen Vorbergen in trockenen Fluren wachsende Edelweiß. In diesen schmalen Gesimsen schimmert das Weiß der Fingerkräuter ( Potentilla caulescens), hier ist die Heimat der Hauswurze ( Sempervivum) und Fettkräuter ( Sedum), hier nicken noch kleine Glockenblumen, Steinbreche, Primeln, eine Nelke gewährt da und dort noch spärlichen Schmuck, Thymian duftet und die blaulila Kugelblume ( Globularia cordifolia), wohlbekannt von den trockenen Matten unserer Hügel, ist hier einer der kühnsten Kletterer, der in der kleinsten Felsenritze, von ein paar Moospölsterchen begünstigt, noch fröhlich wuchert. Sie sind nicht eben schön diese Felsenpflanzen; wenn das Gipskraut ( Gypsophila repens), eine der gemeinsten unter ihnen, seine sonst eintönig weißen Blütendolden rosigrot färbt, so mag das schon als besondere Zier gelten. Schon das prächtig stahlfarben schimmernde Blaugras ( Sesleria coerulea) gilt als Schönheit inmitten der Horste brauner Seggen und fahler Gräser, an denen der Felskletterer so oft seinen letzten Halt suchen muß und ihn auch findet, da sie gar zäh in den Spalten wurzeln, hier auf diesen »Gemsmättli« und Bändern äst das scheueste Wild der Hochalpen; hier treibt aber auch der urwüchsigste der Älpler sein eigen Wesen. Die Zeiten sind allerdings vorüber, da die Edelweißsucher hier durch Blumenpflücken allsommerlich so viel verdienten, um noch den Winter damit zu überstehen, denn zum Glück schützen jetzt allenthalben strenge Gesetze den Alpenflor, in der Schweiz sogar manchenorts bis zu den Alpenrosen vor Verwüstung. Aber die Wildheuer rufen noch immer mit wildem Jauchzen zu Tal, daß der Mensch in den Alpen so arm ist, daß er sogar diese kleinen schwebenden Gärten nicht ungenützt lassen kann. Das ist ein gar schaurig Handwerk, an den weglosen Wänden den Weg zu den kleinen Rasenplätzen zu erspähen, und an den gähnenden Abgründen zu mähen, dann aber, die schweren Heubündel auf dem Rücken noch an den Abstürzen hinab zu klettern. Und sogar ein solch halsbrecherisches Gewerbe kennt noch Wettbewerb und muß durch Gesetze geschützt werden! Schweizer Schriftsteller erzählen davon, daß diese Freimahden namentlich jenen Gemeindebürgern offen stehen, die zu arm sind, um an der Gemeinalpe Anteil zu haben. Aber sie müssen sich am Jakobstag vor Sonnenaufgang auf der »Freimahd« einfinden und dann hell jauchzen als Zeichen der Besitzergreifung. Antwortet dem Wildheuer oben Einer der früher gekommen ist, so muß er sich ein anderes »Mahd« suchen, wenn jener ihm nicht erlaubt zu teilen. Darum ziehen diese furchtlosen armen Teufel schon den Abend zuvor aus und klimmen auf die schrecklichsten Wände, wo sie, oft auf so schmalen Vorsprüngen, daß sie stehen müssen, die ganze Nacht zubringen, nur damit sie beim Morgengrauen die Ersten sind und das Recht erwerben, das bißchen Heu auf dem Rücken unter Lebensgefahr herabzuschaffen.

Die Edelraute
(Ligusticum mutellina).
(Nach der Natur gezeichnet von Dr. G.
Dunzinger.)
In diesen Höhen offenbart die Natur ein liebreizendes Wunder, das um so schöner ist, weil es nicht zu viele erspähen. Die Wissenschaft bezeichnet es als »Schneetälchenflora« und versteht unter diesem eigenartigen Namen die Erscheinung, daß in Mulden, wo der Schnee meist länger denn drei Viertel des Jahres liegen bleibt, mitten im Hochsommer aus dem eisigen schwarzen, vom Schmelzwasser überfluteten Schlamm unmittelbar, wenn der Schnee weggeschmolzen ist, ein bunter Ring schöner und zarter Blumen sprießt, die im Juli und August die Tage des Vorfrühlings wiederbringen. Dicht neben dem kalten Weiß erscheint, oft über Nacht, das blasse Blau und Weiß des Crocus vernus, die liebliche, metallisch schimmernde Frühlingsanemone, da und dort eine rötliche Primel, herrlich grüne Moose, die weiße Gletscherranunkel ( Ranunculus glacialis), dann all die kleinen und großen blauen Enziane und manch' andere Blume, welche auch die Ebene in den Tagen des scheidenden Winters kennt. Diese Pracht dauert nur wenige Tage, dann sprießt sammetweiches saftiggrünes Gras und verbindet sich mit den an allen erhöhten Stellen dieser Schneekessel wuchernden krautigen Weiden. (Vgl. das Doppelbild S. 56 u. 57.)

Alpenglöckchen (
Soldanella alpina).
(Naturaufnahme von H.
Dopfer. München.)
Ein überaus liebliches Blümchen dieser Schneeflecke hat durch Kerners Pflanzenleben besondere Berühmtheit erlangt. Das ist das zierliche gefranste Alpenglöckchen ( Soldanella pusilla und alpina), dem man die Zähigkeit zuschrieb, mit seiner Eigenwärme den Schnee zu schmelzen. Und wirklich ragen seine violetten Blumenglocken am Rande der Schneelager mitten aus dem harten kalten Weiß, in das ihr Sproß offenbar eine kleine Öffnung gebohrt hat, um die Blume zum Licht zu bringen. Neuere Untersuchungen haben aber ergeben, daß es nicht die »Atemwärme« des kleinen mutigen Blümchens ist, die den Schnee durchschmilzt, sondern daß hier das einfache physikalische Gesetz gilt, wonach der Schnee über einem dunklen Gegenstand (in diesem Fall die Blüten und Stengel) immer rascher schmilzt als über hellen.
Diese eigenartige Lebewelt der Geröll- und Felsen- und Schneefleckpflanzen fehlt an keinem der Bergriesen. Sie reicht bis zu den schwindligsten Höhen, bis 3000 Meter, wenn nur sonst die Umstände günstig sind. Aber sie wird immer auserlesener, je höher sie dringt. Vom Wiener Schneeberg bis zur Ostgrenze der Alpen zählt man in den niederen und hohen Bergen fast siebenhundert Pflanzenarten ( Christ führt 693 an), davon sind nur dreihundert (genau 294) hochalpin. Und auch für diese bilden die Höhen über dreitausend Meter die Scheidewand, welche nur mehr von wenigen überstiegen wird. Bis zu 3000 m reichen nach O. Heer nur mehr 120 Arten von Blütepflanzen. Dann sinkt ihre Zahl rapid. Schon dreihundert Meter höher kennt man nur mehr zwanzig. Auf dem 3333 m hohen Theodulpaß, der das Matterhorn von der Monte Rosakette scheidet, hat man nur mehr dreizehn blühende Pflanzenarten gesammelt. Was bleibt in dieser Eishöhe übrig von der ganzen bunten Gesellschaft der Alpwiesen? Soldanellen, Enziane, Silene, Fingerkraut, Hungerblümchen, Steinbreche, eine Wucherblume, eine Grasart, ein paar Kreuzblütler, die dicken Polster des Gletscher-Mannsschildes ( Androsace glacialis) und des Steinschmückels ( Petrocallis), der gedrungene Gletscherhahnenfuß ( Ranunculus glacialis) und die Nelkenwurz ( Geum reptans). Das ist alles. Die Pflanzenwelt wird endlich von den Felsen besiegt. Hier oben findet sie ein kümmerliches Ende. Zum Schluß zählt der Tourist die Blumen und führt über jede einzelne Buch. Saussure, der erste wissenschaftliche Ersteiger des Montblanc fand dort bei 3469 m einen blühenden Rasen der stengellosen Silene, am Col du Géant bei Chamonix in fast gleicher Höhe noch Blüten des Mannsschildes. Lindt fand am Finsteraarhorn in Höhen über 4000 m noch Steinbreche und die geschwärzte Schafgarbe ( Achillea atrata), und Calberla am Gipfel des gleichen Berges in 4275 m Höhe noch eine Gletscherranunkel mit zwei Blüten. Dann hört die Botanik auf; weiter oben gibt es nur mehr Steine, Firn, ziehende Wolken und die Farben des Todes. »Zwar waren die Blumenblätter etwas verkümmert, die einjährige Pflanze aber sonst normal entwickelt.« So beschrieb man die am höchsten emporgestiegene Blume Europas. Es klingt wie ein Krankenbericht …

Die höchsten Schneepflanzen. Links unten die Eisranunkel (
Ranunculus glacialis), daneben
Gentiana brachyphylla, hinter dem
Achillea atrata blüht. Im Hintergrund
Androsace glacialis,
Saxifraga moschata und
S. muscoides.
(Nach der Natur entworfen von Dr. G.
Dunzinger. München.)
Aber das Leben macht doch immer wieder den verzweifelten Versuch, auch das Reich des Todes zu besiegen. Die Schneepflanzen verändern dabei ihr ganzes Aussehen. Mit winzigen Blättchen, die in Rosetten gestellt sind, bilden sie mit Vorliebe gedrängte Polster, aus denen sich stengellose Blumen nur wenig in die stets eisige Luft erheben. Wer sich auf die Physiognomie der Pflanzen versteht – es gibt nämlich eine, so gut wie eine Physiognomie der Menschen – den spricht dieses Wesen ganz ergreifend an. Es gibt einen Typus junger Mädchen, deren größte Schönheit es ist, daß sie krank sind. Da flackert das Leben in ihnen noch einmal mit aller Kraft auf und in ihrem überzarten Gesicht vereinigt sich die Verklärung der Todgeweihten mit einer unaussprechlich heißen Lebenssehnsucht im Blicke – so muten auch diese Pflänzchen an. Ihre Blüte ist ihr Auge und das blickt fast sprechend und schimmert in unsagbar edlen und reinen Farben. Wie lebendig gewordenes Licht erstrahlt die Schneeflora mit roten, blauen und gelben Blüten. Nur ein Gewächs ist darunter; das wagt auch unter so lebensgefährlichen Verhältnissen häßlich zu sein. Das ist die Eisranunkel. Sie trägt seltsame schwarze Haare und trübe schmutzigweiße Blüten. Mit Recht hat man von ihr gesagt, sie erinnere in allen ihren Teilen an zerfließendes Eis.
Da stehen wir nun auf dem Gipfel inmitten der Leblosigkeit des ersten Schöpfungstages. So mag die Welt ausgesehen haben im Vorsilur. Es gibt zwar nur einige solcher Inseln, die über das Meer des Lebens hinausragen: das Weißhorn (4512 m), das Matterhorn (4482 m), als Ideal schöner Bergesgestalt, der Grand Combin (4317 m), an dessen Fuß die Schweizer ihren schönen Alpenpflanzengarten pflegen, ihre » Linnaea«, die sie gleich einem Nationalheiligtum hochhalten und endlich die Dufourspitze (4658 m) und der Montblanc (4810 m). Nur fünf verlorene Inseln des Todes, mit Firnschnee dick überdeckt, die keusch und unberührt niemals Lebendiges geschaut, bevor der erste Mensch seinen Fuß auf sie setzte.
Aber das gilt nur, wenn wir das Leben auf seinen Alltagsbegriff beschränken. In seinen einfachsten Formen ist es auch vor dem Menschen auf den Montblanc gelangt. Als Alge, Pilz, Bärtierchen und Wurm ist es noch weit höher geklettert als die fünf höchsten Alpenspitzen, ja aufgelöst in sein Atom: in die Zelle, erscheint es dem Naturforscher von heute fast unzerstörbar zu sein. Sonst hätte einer ihrer Bahnbrecher nicht den kühnen Gedanken fassen können, daß das Leben den Weltenraum durchflogen habe und als Einzeller mit Meteoriten von anderen Himmelskörpern auf die Erde gelangt sei. Kann uns solches aberwitzig dünken, wenn wir uns überzeugen, daß auf allen Hochbergen der Erde, in der Firnregion der Polländer, des Himalaya, der südamerikanischen Cordillere, der Alpen, in der kalifornischen Sierra Nevada so gut wie auf den Eisbänken des Südpoles stets die gleichen Algen leben: als roter, grüner und gelber Schnee!
Neben dem blendenden Weiß der Gipfel erstrahlt oft die ganze Halde in einem sanften Rosenrot, bald gesprenkelt mit blutigen Flecken, noch öfter vermischt in Übergängen zu Braun und erdigem Schwarz. Da und dort lebt auch ein blaßgrüner Hauch auf dem Firn, als wär's ein Widerschein der Matten und Wälder aus den Tiefen. Das sind die Schneealgen. Chlamydomonas nivalis Früher bald als Protococcus, bald als Haematococcus, dann wieder als Sphaerella bezeichnet und unter diesem Namen auch in den meisten Büchern beschrieben. heißt die eine welche im roten Schnee steckt, als Ancylonema Nordenskiöldi kennt die Wissenschaft jene, die den Firn purpurbraun färbt. 70 Arten solcher Wesen haben unerschrockene Forscher bisher beschrieben; sie haben aufgedeckt, daß auch in diesem ärmsten Leben, das nur wenige Stunden des Tages aus seiner Erstarrung erwacht, wenn die Sonne jene paar Tropfen Schmelzwasser erzeugt, deren diese Wesen bedürfen um die winzigen Glieder zu rühren, das von dem bißchen Staub vegetiert, welches vom Winde in die Firnhöhen geweht wird, daß auch in diesem bescheidensten Dasein der Wettbewerb, die Qual und Jagd nach dem täglichen Brot nicht fehlt. An den Schneealgen schmarotzen winzige Pilze, ein Älchenwurm ( Anguillula nivalis ) von der Art, wie sie im trübgewordenen Essig leben und ein noch wenig bekanntes Bärtierchen und der Gletscherfloh verzehren die grünen und roten Algen, frieren mit ihnen ein, tauen mit ihnen auf und leben mit ihnen ein unbegreifliches Leben, das mit dem, was uns Menschen als Lebensgenuß vorschwebt, fast nichts mehr gemein hat.


Die Blumenwelt [unleserlich]
(Nach der Natur gemalt von [unleserlich]
on links nach rechts im Gestein: Fettkraut (
Sedum atratum), darüber Wundklee [unleserlich] Hungerblümchen (
Draba aizoides), neben dem Wundklee nach rechts [unleserlich]
alpinus), hinter dem der lebendig gebärende Knöterich (
Polygonum vivipara) [unleserlich] (
Crocus vernus). Im Mittelgrunde des Bildes blühen Alpenglöckchen (
Soldane [unleserlich] Bärwurz (
Meum mutellina), hinter dem Zwergweiden (links
Salix retusa, rechts [unleserlich] (
Sesleria coerulea) wächst.
Rechts in [unleserlich] Schneemulde. [unleserlich] München.) [unleserlich] vulneraria), in der linken oberen Ecke Anemone vernalis, darüber ( Gentiana verna), daneben die weißblühende Alpenranunkel (Ranunculus [unleserlich] Davor steht Riedgras ( Carex firma), noch mehr im Vordergrund Krokus [unleserlich] davor ein Rasen des Widertonmooses ( Polytrichum); daneben nach rechts [unleserlich] reticulata), einen Felsblock umspinnen, auf dem ein Horst des Blaugrases [unleserlich] unteren Ecke Homogyne alpina.