
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
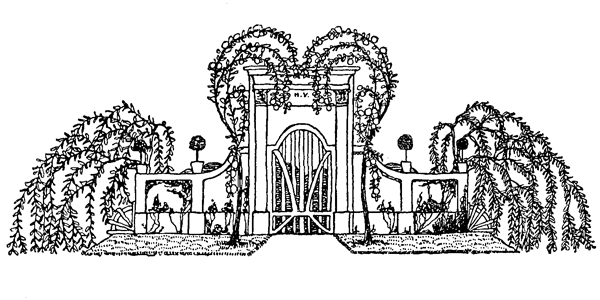
 Die Kinder gingen auf dem kiesbestreuten Gartenweg hin. Sie traten fest auf und schritten wacker aus. Dabei kauten sie mit Hingebung an ihrem Butterbrot, dem zweiten Frühstück.
Die Kinder gingen auf dem kiesbestreuten Gartenweg hin. Sie traten fest auf und schritten wacker aus. Dabei kauten sie mit Hingebung an ihrem Butterbrot, dem zweiten Frühstück.
Der Knabe trug noch Kniehosen; das Mädchen steckte in einem leinenen Schürzenkleid, das bis an die Knöchel reichte.
»Was wollen wir tun?« fragte Horst. »Wozu haben wir heute Lust?«
»Ich bin zuerst für die Mutübungen,« antwortete Hilma.
»Welche?«
»Von den Mauern springen.«
»Gut. Ich bin dafür: wir fangen bei der Mauer am Gewächshaus an und hören mit der Gemüsegartenmauer auf, weil die doch die höchste ist.«
»Ja, das wollen wir.«
Als der letzte Bissen Butterbrot verschwunden war, ließen die beiden wie auf Kommando von Weg und gesetzter Gangart ab und rasten über Wiesengrund und durch Gebüsch.
Der Park war rings umschlossen von einer alten Steinmauer, welche die welligen Unebenheiten des Bodens bald mehr, bald minder hoch überragte. Von den Gartenhügeln aus wurde sie mit Leichtigkeit erklettert. Dann ging man auf den breiten, bemoosten und rissigen Sandsteinplatten, die sie deckten, bis zu den schwierigen Stellen, und stürzte sich in Abgründe, unbekümmert, ob weiche Gartenerde unten lag oder harter Kiesweg.
Das Schöne bei dieser Übung war, daß man ein Gefühl der Furcht, ein leises Gruseln zu überwinden hatte. An den schlimmsten Stellen stachelte man den Mut durch bestimmte Worte an.
»Hab ich denn den Mut verloren?« rief man sich selbst zu und antwortete selbst: »Nein, ich hab ihn nicht verloren!«
Dann galt kein Zaudern mehr. Nach den eigengeschaffenen Ehrengesetzen wäre es eine Schmach sondergleichen gewesen, dann noch zu zögern. Man stürzte sich mit Todesverachtung in die Tiefe.
Es war fast ein Wunder, daß die jungen Helden bei diesem Treiben niemals zu Schaden kamen.
Eher als der Bruder war die Schwester des Springens müde.
»Jetzt wollen wir die Bitternis des Todes kosten,« erklärte Hilma.
Horst stimmte dem gleichmütig zu.
Irgendwo im Gemüsegarten stand ein mannshoher Busch der feinblätterigen Raute. Sie schmeckte bitter wie Wermut, aber Herr Lampert, der Hauslehrer, hatte gesagt, sie wäre gut für den Magen.
Nach diesem Busch schlenderten die Mauerspringer, von der Anstrengung erhitzt und wohlig ermattet.
Sie nannten die Raute »Bitternis des Todes« und aßen davon mit Überwindung. Aber diese freiwillige Kasteiung erschien ihnen löblich. Sie sahen darin eine Art Sündenablaß für später zu vollbringende Übeltaten. Nachdem die Bußübung mit schweigendem Anstand vollbracht war – Grimassen durften nicht dabei geschnitten werden –, versanken beide unter den Stachelbeer- und Johannisbeerbüschen. Nichts war mehr von ihnen zu hören und zu sehen, außer wenn gelegentlich aus Lust am Wechsel ein Strauch mit einem anderen vertauscht wurde.
Die sommerliche Vormittagssonne brannte auf den Gemüsegarten herab, die Küchenkräuter atmeten Würze und die Blumen auf den langen Rabatten süßen Wohlgeruch aus. Zentifolien blühten und gelbe Stockrosen und die fleischfarbene großblätterige Gloire de Dijon und rosa Federnelken.
Jenseits des Mühlbachs, der zwischen Gemüsegarten und Park floß, schatteten die Wipfel alter Bäume, und in buschigem Unterholz zwitscherten beim Nestbau die Singvöglein. Der Bach hüpfte über die Kiesel, plauderte und gluckste leise.
Es war so warm und still, – man hätte schlafen können.
Da kam ein Schritt über die Brücke.
Einen Augenblick tauchte Horsts blonder Kopf mit horchender Wendung auf, duckte sich aber sofort wieder.
»Der Feind naht,« meldete er halblaut.
Hilma nahm die Warnung schweigend auf.
Der Feind hatte den Fluß überschritten und kam nun die langen sonnigen Wege daher zwischen den Blumen, Kräutern und Gemüsebeeten.
Es war ein schmächtiger junger Mann in schwarzem Anzug. Er trug die schmalen Schultern etwas vorgeneigt, verriet im Gang Unsicherheit und machte eigentlich mit seinen zarten Gesichtsfarben und den kurzsichtigen, sanften blauen Augen gar keinen erschreckenden Eindruck.
Suchend spähte er nach allen Seiten und rief von Zeit zu Zeit: »Ho–orst! Hil–ma! Hil–maa!!«
Ein schüchterner Unterton war in diesem Rufen, fast als ob es dem Rufer peinlich wäre, so laut zu werden. Das war nicht der Ton, der sich Gehorsam erzwingt.
Endlich mußte der Feind wohl die Überzeugung gewonnen haben, daß die Gesuchten im Gemüsegarten nicht zu finden wären. Er trat den Rückzug an.
Die beiden jungen Bösewichter unter den Büschen hatten sich nicht gerührt. Jetzt meldete Horst: »Alles sicher.« Und gemütsruhig schmausten sie weiter.
Erst als sie so satt vom Beerenessen war, daß sie nicht mehr konnte, erklärte Hilma: »Nun müssen wir hinein.«
Längst war die Freistunde vorüber.
Als sie endlich mit wirren Locken und dunkelroten Backen in das Schulzimmer gestürmt kamen, empfing sie kein hartes Wort; aber Herrn Lamperts Miene war so vorwurfsschwer und kummervoll, daß sich die beiden Sünder doch nicht behaglich fühlten.
»Wir haben uns wohl ein bißchen verspätet,« sagte Hilma gedrückt.
»Fast eine halbe Stunde.«
Horst konnte des Lehrers Leidensmiene nicht vertragen. ›Warum haut er uns nicht ganz einfach!‹ dachte er.
»Habt ihr mich denn nicht rufen hören?« fragte Lampert sanft.
Es wurde einstimmig verneint.
Da seufzte der Lehrer und begann den Unterricht. Man nahm gerade die Geschichte der Römer durch und war bei Coriolan. Der Vortrag Lamperts war etwas eintönig. Ihn selbst interessierte die Geschichte erst von dem Zeitpunkt an, da sie sich um das Christentum drehte.
Aber Horst liebte die alten Römer mehr als die Christen, deren Glaubenseifer er nicht begriff.
Hilma sah aufmerksam aus, war es jedoch nicht. Sie schaute von der Seite nach dem Gesicht des Lehrers. Es war etwas im Klang seiner Stimme, das sie unglücklich machte.
Er war so dünn und so blaß! Wenn er neben dem Onkel Gustav stand, sah er aus wie ein Junge, der noch wachsen muß. Und einmal hatte sie gehört, daß der Onkel Gustav sagte: »Der arme Schlucker hat gewiß immer nur über den Büchern gesessen und nie ordentlich gefuttert.« Wenn sie daran dachte, daß er nie satt geworden war, tat er ihr furchtbar leid. Und heute mußte sie immer daran denken. Keine Strafpredigt, keine Schläge hätten sie so niederdrücken können, wie dies bekümmerte Gesicht.
Sie liebte ihn nicht, denn er langweilte sie. Sein »lederner« Unterricht verkürzte täglich die kostbare Freizeit und war stets unwillkommen.
Heute aber empfand sie, daß der »Feind« ein Mensch war, dem sie ein wirkliches Leid antun konnte. Das bewegte sie stark.
Also dachte sie nicht an das Benehmen Coriolans, wie Horst, sondern an den Lehrer.
Nach der Weltgeschichte kam das fürchterlich öde Rechnen, das beiden Kindern verhaßt war und dem Lehrer dazu.
Endlich läutete die Hausglocke zum Zeichen, daß man sich für die Mittagstafel bereit zu machen hatte.
Eiligst wurden die Schulsachen zusammengeräumt. Horst stürmte aus dem Zimmer. Hilma zögerte.
»Herr Lampert!«
Lampert, der an seinem Sekretär stand, sah sich fragend nach ihr um.
»Bitte, seien Sie nicht mehr böse.«
»Ich bin nicht böse, aber traurig.«
»Bitte, seien Sie nicht mehr traurig, lieber, guter Herr Lampert! Ich will nie mehr unfolgsam sein! Ich schwöre beim Bart des Propheten« – sie hatte diese Formel aus dem arabischen Märchen behalten, – »daß ich von heute an ...«
Er wehrte ihr mit ausgestreckter Hand: »Weißt Du nicht, daß wir nicht schwören sollen? Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel. – Wo wird uns das gesagt?«
»Ich weiß nicht,« sagte Hilma trotzig.
Sie fühlte sich zurückgestoßen. Ihre Aufwallung von Reue war warm und echt gewesen. Er hätte ihr Entgegenkommen anders aufnehmen müssen!
Aber er verstand sie nicht, jetzt nicht und niemals.
Nun wollte sie sich auch gar nicht besinnen.
»In der Bergpredigt,« sagte Lampert strafend. »Das müßtest Du wirklich wissen.«
Abgekühlt, als hätte eine kalte Dusche ihr warmes Empfinden getroffen, und ohne ein weiteres Wort, ging sie ihres Weges.
Als sie die Tür des Schulzimmers hinter sich geschlossen hatte, richtete sie sich mit einem Ruck auf.
›Wie gut, daß er mich verhindert hat, zu schwören!‹ dachte sie. Nun konnte man also mit gutem Gewissen weiter tun, was man wollte.
Horst und Hilma hatten eine Freundin, die zuweilen kommen und mit den Herrschaftskindern spielen durfte. Sie hieß Anita und war das einzige Kind des Herrn Kirchenrat Mathis aus dessen zweiter Ehe mit einer Holländerin. Der Kirchenrat, Anitas Vater, war bereits seit dreißig Jahren Pfarrer in Zollbrück. Er feierte häufig irgend ein Jubiläum und wurde hochgeehrt, besonders auch von Horst und Hilmas Mama.
Die Kinder hätten eigentlich lieber mit den Bauernjungen gespielt, die stark und furchtlos waren und so vielerlei wußten und konnten. Sie gaben ein ausnehmend brauchbares Heergefolge ab. Besonders der Heinrich von Schafmeisters und der Amand Reisland, und ein blonder schöner Junge, den sie »Malegis« nannten, das waren herrliche Gesellen! Früher hatten sie manchmal mit ihnen gespielt, dann war es auf einmal streng verboten worden. Wenn sie fragten: warum? sagte die Mama: »Ihr lernt von den Dorfkindern nur Dinge, die Ihr nicht zu wissen braucht.«
»Was denn?« forschten sie. Darauf erhielten sie keine Antwort.
»Fragt einem doch keine Löcher in den Leib,« knurrte der Onkel Gustav.
»Ich weiß nur, daß es irgendwas mit Bohnengemüse zu tun hat,« erklärte Hilma.
Sie hatte nämlich einmal arglos gesungen:
»Bohnen, Bohnen eß ich gern,
wenn sie sind gesotten,
und mein Schatzel küß ich gern,
denn es ist verboten.«
Das hatte gerade die Mama gehört und hatte sehr gescholten. Hilma solle sich schämen, und wo sie dies abscheuliche Lied herhabe?
In ihrer Bestürzung hatte sie verraten, daß sie es von ihren Freunden, den Dorfjungen, wußte.
Darauf war das Verbot erfolgt.
Sie begriffen alles dies nicht, und da ihnen auch keine Erklärung ward, hielten sie es für eine Despotenlaune der Erwachsenen, der man sich fügen mußte, weil man nicht die Macht hatte, zu trotzen.
Aber dann sagte die alte Kinderfrau, vor deren Weisheit sie viel Achtung besaßen: »Ihr seid feine Herrenkinder, und die Dorfjungen sind Lausepack, das paßt mal nicht zunander.«
Und da es ihnen oft und eindringlich wiederholt wurde, daß eine Gemeinschaft zwischen ihnen und der Dorfjugend unstatthaft wäre, glaubten sie es schließlich. Eine Scheu bemächtigte sich ihrer, wie vor einer unbekannten Gefahr. So mieden beide Lager einander, und aus der unbefangenen Kameradschaft wurde eine latente Feindschaft.
Aber Anita Mathis war nicht nur erlaubt, sondern die Mama sah den Verkehr gern.
Anita war ein großes, schlankes Mädchen in Hilmas Alter. Ihr Gesicht sah aus wie Biskuitporzellan, so glatt und zart gefärbt. Sie hatte graue Augen unter langen Wimpern und trug das blonde Haar ganz glatt gescheitelt. Auch zarte weiße Hände hatte sie und schmale Füße. Nie war ein Fleckchen oder ein Riß an ihren Sachen, nie bekam sie schwarze Fingernägel. »Immer wie aus dem Ei geschält ist das appetitliche Persönchen,« sagte der Großpapa.
Und die Mama seufzte: »Sie sieht neben meinen Wildfängen aus wie ein Prinzeßchen neben Zigeunerkindern!«
Die Mama beneidete Frau Mathis um solch eine Tochter. Das sagte sie oft.
Es war den Kindern streng anempfohlen, säuberlich mit der Freundin umzugehen. Wenn Anita kam, durften nur zahme Spiele gespielt werden. Gewöhnlich spielten sie Storchennest. Horst und Hilma nisteten als Storch und Störchin im Geäst einer dicken alten Steinlinde. Aus Mamas Nähkorb wurde ein Stopfei aus weißem Alabaster geholt, das mußte die Störchin ausbrüten. Unten in einer Rindenhütte saß Anita und stellte die Bäuerin vor. Sie mußte zuerst in die Kirche gehen, die durch ein nahes Gartentempelchen dargestellt wurde, und, wie Simsons Mutter, um ein Kind beten.
Dann ließ sich Horst vom Nest herab und eilte, die Arme als Flügel schwingend, weit fort nach dem Kinderteich, von wo er mit einer Puppe Hilmas, die er zwischen den Zähnen hielt, zurückkehrte. Die ließ er der hochbeglückten Anita in den Schoß fallen. So spielten sie, wenn sie brav waren.
Aber manchmal prahlten sie vor der Freundin mit ihren Heldentaten. Sie fragten: Kannst Du dies? und: kannst Du das? Und machten ihre Kunststücke vor. Sie erkletterten die höchste Tanne, wie auf einer Treppe von Ast zu Ast steigend, sie sprangen hoch und weit, sie schwangen sich durch die Luft von einem Baum zum andern, wie die Affen.
Anita konnte weder klettern noch springen und mußte sich dafür verachten lassen.
Eines Tages, als man besonders gut miteinander war, überredeten Horst und Hilma die Freundin, sich auch einmal an eine Mutübung zu wagen.
Sie sollte wenigstens einmal mit von der Mauer springen.
Zitternd gab Anita dem Drängen nach.
Horst und Hilma nahmen sie in die Mitte und hielten sie an der Hand. Dann zählten sie laut: »Eins, – zwei, – und – drei!«
Bei »drei« stürzten sie in den Abgrund, die vor Angst aufschreiende Anita mit sich reißend.
Sie hatten voll zarter Rücksicht den allerungefährlichsten Platz gewählt, wo unten ein weicher Komposthaufen lag.
Trotzdem konnte Anita nicht wieder aufstehen, sondern stöhnte und weinte.
Sie war ungeschickt gefallen und hatte den Fuß gebrochen.
Die Geschwister, die aus lauter Freundschaft den Heldenmut Anitas hatten stählen wollen, erhielten lange Strafpredigten und durften einen ganzen Tag lang nicht aus dem Haus. Auch setzte dieser Unfall dem Spiel mit Anita ein Ende. Frau Mathis erlaubte ihrer Tochter nicht mehr, die Wilden zu besuchen.
Aber das alles war noch nicht das ärgste.
Die Kinder schlichen bedrückt herum. Sie fühlten, daß unter den Erwachsenen etwas gegen sie im Gange war. Irgend ein Unheil drohte über ihnen, wie eine Wetterwolke. Es lauerte unsichtbar, ungreifbar, und sie litten unter dem Bewußtsein ihrer Ohnmacht.
Immer waren die mächtigen Erwachsenen gegen sie verbündet! Beschlüsse wurden über sie gefaßt und ausgeführt, niemand kümmerte sich darum, ob sie litten oder nicht.
Die Kinder vertrauten keinem. Sie fühlten sich von den Erwachsenen weder verstanden noch geliebt. Man begriff nichts von dem Leben ihrer Seelen, sondern verlangte und erwartete eine Tugend, die sie nicht aufbringen konnten, nicht einmal wollten. Immer wurde das zur Pflicht gemacht, was man nicht mochte; was man dagegen gern tat, wie spielen und tollen, wurde nur ungern geduldet, am liebsten verhindert.
Alle waren stets unzufrieden: der Großpapa, der Onkel Gustav, die Mama. Herr Lampert, obwohl er von Amts wegen als Feind auftreten mußte, war noch der harmloseste.
Onkel Gustavs Unzufriedenheit machte sich am unangenehmsten bemerkbar. Er konnte so grimmig aussehen und so verdrießlich!
»Dies immerwährende Herumvagabundieren hat doch gar keine Art,« schalt er. »Nie sieht man Euch, nie seid Ihr zu finden! Ich bitte Dich, Hilma, wie siehst Du mal wieder aus? Ein großes Mädchen von zwölf Jahren! So schlecht erzogene Kinder kann man lange suchen.«
Und dann sah er sie so geringschätzig, mit so entschiedenem Mißvergnügen an, daß sie die Empfindung hatten, ihm äußerst widerwärtig zu sein.
Allein wie sehr diese beständige Unzufriedenheit die Kinder auch bedrückte, unbußfertig waren sie doch. Ihre Streifereien durch Park und Flur blieben das Schönste vom Dasein; erst wenn sie sich wieder außer Sicht- und Rufweite wußten, fühlten sie sich wohl. –
Anitas verhängnisvoller Sprung von der Mauer geschah im September. Man konnte jetzt schon draußen über ein weites Stoppelfeld laufen und die Gegend von sonst unzugänglichen Punkten aus überschauen.
Hinter dem Feld war der Fluß, und an seinem hügelansteigenden anderen Ufer lag ein Wäldchen, das sie »das Paradies« nannten.
Im Frühjahr war der Fluß reißend und tief. Dann kam man nur auf einem weiten Umweg über die alte Steinbrücke ins Paradies. Jetzt konnten sie ihn bequem durchwaten.
Das verwilderte Gehölz, – es war Bauernwald, – bedeckte einen ziemlich steilen, von Schluchten durchschnittenen Hang. In einer der Schluchten sprang der starke Quell aus dem Gestein, der dem Dorf das Wasser lieferte. Die Leute nannten ihn den Rollborn, und man sagte, daß die Dorfgroßmutter aus dem Rollborn alle kleinen Kinder holte. Diese Sage umgab den Quell und seine dunkle Waldschlucht mit dem Zauber des Mysteriums. Am Flußufer hatten die Kinder einen Walnußbaum entdeckt, dessen Nüsse eben reif wurden. Nachdem man eingeerntet, setzte man sich zum Schmausen auf das Moos, das dick und weich wie das herrlichste Polster war. Das Ausschälen der Nüsse färbte die Finger mit einem lebhaften Gelbbraun, das nachher tagelang allen Waschbemühungen mit Seife und Bürste trotzte. Aber das war einerlei.
Hilma fragte: »Hörst Du den Rollborn rauschen?«
»Ja.«
»Ich kann mir gar nicht erklären, woher die Dorfgroßmutter immer gleich erfährt, wenn hier ein kleines Kind abzuholen ist. Und ob sie sich selbst ausdenkt, wem sie es bringen soll? Da ist so viel, was ich nicht begreife.«
»Man muß sich nicht drum kümmern,« erklärte Horst.
Zwar war er um ein Jahr jünger als die Schwester, aber sein Knabenblick hatte einige naturgeschichtliche Beobachtungen gemacht, die ihr entgangen waren. Einmal hatte ihm auch einer seiner ehemaligen Freunde aus dem Dorf, während sie als Wegelagerer im Versteck den Rittern auflauerten, eine vertrauliche Mitteilung gemacht. Aber obwohl er der Schwester sonst alles sagte, fühlte er, daß er über diesen Punkt schweigen mußte. –
Der Fluß trieb an einer Biegung seine Wasser quirlend im Wirbel herum, und es bildeten sich kleine Puddings von gelbweißem Schaum. Das war ihre Hexenküche. Dort kochte der böse Geist sein Essen. Dieser Geist war ihr Feind. Er narrte sie, wo er konnte, zerriß ihnen die Kleider, machte, daß sie hängen blieben, versteckte Federmesser und Bleistift, daß man sie nicht finden konnte, er verriet sie den Verfolgern. Vor ihm mußte man stets auf der Hut sein, wie vor dem Rübezahl.
Zum Glück hatten sie auch einen Schutzgeist: das war ihr unbekannter Vater. Ihn rief man an, wenn man in Not war. Seinen Namen durfte man aber nicht nennen. Er hieß einfach »Er«. Nur mußte man edel und tapfer sein, wenn man seines Beistands teilhaftig werden wollte. Sie bemühten sich auch sehr, edel und tapfer zu sein, obwohl dies Streben von den Erwachsenen niemals anerkannt wurde.
Das sanfte Murmeln der Wellchen übertäubte das Zeitbewußtsein, wie das Vöglein zu Heisterbach. Die beiden Kinder lagen im Moos, aßen Nüsse, schauten in die Wipfel und plauderten, d. h. sie führten, wie sie selbst fanden, ernste Gespräche.
Auf einmal fiel ihnen ein, daß der Herr Kantor sie seit einer Stunde vielleicht zum Klavier-Unterricht erwartete.
Zum Glück fand die Klavierstunde nicht im Herrenhaus statt, sondern im Schulhaus, das mitten im Dorf lag.
Während die jungen Sünder nun querfeldein nach Hause trabten, machten sie aus, daß sie von der versäumten Musikstunde nichts erwähnen und im Fall der Not sogar lügen wollten.
Gegen die »Unterdrücker« war List erlaubt.
Aber niemand fragte nach der Klavierstunde, und die Kinder konnten ihre Lüge sparen. Dafür schlug an diesem Abend das Wetter, dessen Nahen sie vorgefühlt hatten, ein:
Um Michaelis, also in wenig Wochen, sollte Horst auf eine Klosterschule gebracht werden. Großpapa und Onkel kündeten es an als unwiderruflichen Beschluß.
Hilma war in Verzweiflung. Ihr ganzes Phantasieleben, all' ihre Spiele, ihr Glück waren von Horst nicht zu trennen. Wenn sie ihn verlor, verlor sie alles. Sie wußte nicht, wie sie ohne ihn noch weiter leben sollte.
Dagegen war Horst, soweit er's vor der trostlosen Schwester zu zeigen wagte, ganz guter Dinge. Es wurden soviel nette neue Sachen für ihn angeschafft, und alle Erwachsenen waren in der Abschiedsstimmung besonders gut zu ihm. Auch freute er sich auf Reiseabenteuer und auf die vielen Schulkameraden. Soviel Jungen, und alles Herrenkinder wie er! Herrlich mußte sich's da spielen lassen. Das einzig Betrübende war, daß Hilma nicht mit durfte. Zu dumm, daß sie ein Mädchen war!
An einem Sonnabend reiste er mit Herrn Lampert, der ihn eskortierte, ab. Er war so schön ausgerüstet und hatte so köstlichen Mundvorrat mit auf den Weg bekommen, daß es ihm schwer fiel, eine traurige Miene zu zeigen, wozu er sich doch Hilma gegenüber verpflichtet fühlte.
Alle standen vor dem Haus und winkten mit Taschentüchern dem davonrollenden Wagen nach.
Als dieser durch die Torfahrt verschwunden war, gingen die anderen ruhig wieder ihren Beschäftigungen nach und ließen die schmerzerstarrte Hilma unbeachtet stehen. Keiner kümmerte sich um ihren Jammer. Und das Kind stand da mit seinem schweren Herzeleid und wußte nicht, wie es nur die nächsten Stunden ertragen sollte.
Es war ein herbstkalter Tag. Der Gärtner fürchtete Frost für die Nacht. Er hatte mit dem Gehilfen die Topfgewächse, die in schönen, steifen Gruppen am Haus standen, heute umgetopft und zum Überwintern ins Glashaus gebracht. Wo sie gestanden hatten, sah es verödet und wüst aus. Verstreute Gartenerde, Blumentopfscherben, vermorschte Holzstäbe und abgeschnittene Schößlinge lagen noch durcheinander.
In dieser Wüstenei kauerte Hilma am Boden, drehte Kugeln aus der feuchten Erde oder starrte stumpfsinnig den welken Blättern nach, die der Wind vor sich her wirbelte, so daß sie übermütig zu tanzen schienen.
Das Übermaß und die Hoffnungslosigkeit ihres Elends lähmten ihren Geist.
Lange kauerte sie so.
Das Leben war erloschen! Das Paradies war tot und der Park auch. Kein frohes Jagen mehr über die Stoppeln! Kein Springen von den Mauern! Verödet, kahl und häßlich war die Welt, wie dieser Platz, auf dem die Gewächshausblumen gestanden hatten.
Der Wagen kam von der Eisenbahnstation zurück und fuhr wieder am Haus vor.
Hilma blickte nicht auf. Ach, sie wußte ja, daß er keinen Horst zurückbrachte, nicht einmal Herrn Lampert!
Dieser letzte Gedanke enthielt aber den ersten kleinen Trost: nun gab es wenigstens keine langweiligen Schulstunden mehr.
Da sagte plötzlich eine fremde Stimme in fremder Sprache: » My dear, what are you about?«
Verstört blickte das Kind auf.
Die fremde Dame, die da neben der Mama stand, war die Engländerin, die nun ihre Erzieherin sein sollte. Mit dem Wagen, der Horst zur Eisenbahn gebracht hatte, war sie geholt worden.
Die Mama in ihrem langen, feinen schwarzen Kleid sah ernst und müde und – wie fast immer, wenn sie Hilma ansah – unzufrieden aus.
»Sie ist leider wild wie ein Gassenjunge,« sagte die Mama, »und ein nicht sehr artiges Mädchen. – Kannst du nicht aufstehen und die Hand geben?«
Hilma musterte die »Neue«, wie man einen noch unbekannten Gegner mustert: mißtrauisch und scharf.
Die Fremde sah streng und mürrisch aus, sie war sicherlich weit weniger nachsichtig und sanft als Herr Lampert.
»Nun, begrüße Miß Moore,« sagte die Mama.
Aber Hilma wagte nicht, die Hand zu geben, denn ihre Hände waren von einer Kruste feuchter Erde bedeckt.
»Nein, wie siehst Du mal wieder aus!« rief die Mama und wurde ganz rot vor Beschämung. »Geh augenblicklich, wasch Dir die Hände und zieh Dir eine reine Schürze an.« –
Die Miß war nicht so schlimm, wie Hilma gefürchtet hatte, nur gab sie noch langweiligere Stunden als Herr Lampert.
Hilma träumte in jeder Nacht, Horst wäre zurückgekommen, und wenn sie dann aufwachte, weinte sie und entsetzte sich vor dem Tag, der sie aus leeren Augen anglotzte. Sie tollte auch gar nicht mehr, sondern hockte in den Winkeln und schlich umher, verlor die Eßlust, bekam eine gelbliche Gesichtsfarbe und magerte ab.
Nur die Engländerin schien es zu bemerken.
»Ich fürchte, das Kind ist nicht ganz wohl, Frau Baronin,« sagte sie eines Tages.
Ungläubig und etwas gelangweilt hoben sich Mamas feine Brauen.
»Was fehlt ihr denn?«
» I think she wants a dose,« sagte Miß Moore.
»So kann sie eine haben.«
Hilma bekam ein abscheuliches Pulver eingerührt, das unbehagliche Wirkungen hatte, aber an ihrem Zustand nichts änderte.
Als man ihr jedoch eine zweite verstärkte Dosis einrührte, goß sie den Sud zum Fenster hinaus. –
Miß Moore war das Urbild der Steifheit. Sie verzog nie eine Miene und erhob nie die Stimme. Ihr Gesicht sah weder jung noch alt aus, es war wie aus Holz geschnitzt. Auch war sie von Gestalt weder dünn noch dick, weder groß noch klein.
An Onkel Gustavs Ton hörte Hilma, daß ihm die Engländerin zuwider war. » Remède contre l'amour« hatte er sie genannt. Hilma verstand den Sinn nur halb, aber in der Seele der Miß fühlte sie sich beinahe gekränkt.
»Bitte, sagen Sie der Mama nicht wieder, ich sei krank,« sagte Hilma zu Miß Moore.
»Aber warum nicht, meine Liebe?«
»Weil sie nicht mag, daß man jemand leidend findet. Sie will nur selbst leidend sein und bedauert werden.«
Miß Moore war entsetzt.
»Es ist sehr unartig, so etwas zu sprechen! Nicht einmal denken darf ein gutes Kind etwas so Unkindliches.«
»Es ist aber doch wahr!« beteuerte Hilma. »Die Mama hat ein großes Unglück gehabt, von dem man nicht sprechen darf. Darum ist sie immer krank und traurig, und alle Menschen bedauern sie. Sie will auch bedauert werden. Und mich hat sie nicht lieb – gar nicht.« –
Miß Moore tadelte und mahnte aufs neue. Aber Hilma war ein störrisches Ding und machte es der armen Erzieherin nicht leicht. Indessen kränkelte sie nach wie vor, und die Engländerin lag der Baronin in den Ohren, daß etwas für das Kind geschehen müßte.
»Was fehlt Dir eigentlich?« fragte die Mama mit ihrem ungläubigen Gesicht.
Hilmas Augen füllten sich mit Tränen. »Mir fehlt der Horst,« antwortete sie weinend.
»Das gibt sich mit der Zeit,« sagte die Mama mit größter Gemütsruhe.
Hilma blickte finster. Sie dachte: ›Das gibt sich nie.‹
Dabei trat sie unruhig von einem Fuß auf den anderen und trachtete danach, möglichst rasch zu entkommen.
Die Mama sagte: »Sie sehen, Miß Moore, das ganze Leiden ist ein bißchen kindischer Trennungskummer. Die beiden waren Inseparables; aber es war höchste Zeit, daß sie auseinander kamen, denn sie verwilderten zu sehr.«
Hilma, die lauernd und düster von der Mama zur Miß schaute, gewahrte im Gesicht der Engländerin einen Ausdruck, der sie betroffen machte. Diese Fremde war in Sorge um sie, belästigte die Mama um ihretwillen! Und die Gleichgültigkeit der Mama, an die Hilma gewöhnt war, setzte Miß Moore in unwilliges Erstaunen! Ja, man konnte es ihr ansehen.
Hilma umarmte plötzlich die Engländerin und sagte leidenschaftlich: »Ich hab' Dich lieb.«
Miß Moore wehrte etwas verlegen ab.
»Du sollst zu Miß Moore doch ›Sie‹ sagen,« tadelte die Mama etwas gereizt.
Hilma fühlte, daß sie die Mama verletzt hatte. Seitdem das Bewußtsein in ihr erwacht war, hatte sie für die Mama noch nie eine Aufwallung von Zärtlichkeit empfunden, und nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, sie zu umarmen.
Natürlich war es der Mama nicht recht, daß sie nun Miß Moore lieb hatte! So dachte das Kind und fühlte die Befriedigung einer kleinen Rache.
Sie wollte von nun an in den langweiligen Stunden und auf den noch langweiligeren Spaziergängen mit Miß Moore artig sein und sich auch Mühe geben, englisch zu sprechen!
»Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so schnell eine Sprache begriffen hätte wie Miß Hilma das Englische,« erklärte Miß Moore.
Worauf die Mama antwortete: »Die Begabung hat sie von unserer Seite.«
In wenig Wochen war Hilma so weit gekommen, daß sie zu ihrem Vergnügen die englischen Bücher las, die Miß Moore ihr gab. Ihr hungernder Geist verschlang diese etwas sentimentalen und süßlichen Geschichten, die von ungeheuer edlen jungen Mädchen handelten, mit gläubigem Entzücken.
Am schönsten war es jetzt, wenn draußen der Schnee stöberte oder der Sturm die alten Baumwipfel hin und her bog, in der großen Bücherei. Da verbreitete der weiße Kachelofen einige Wärme, und das Kaminfeuer in der entgegengesetzten Ecke flammte und glühte so traulich!
Hilma hatte dort einen herrlichen Winkel zwischen zwei gewaltigen Bücherschränken. Hier kauerte sie, solange sie ungerufen blieb, auf dem Fußboden oder lag lang hingestreckt wie Correggios Magdalena, versunken in die Welt ihrer Amy Herbert oder der Ellen aus » The wide wide world«.
Die Erwachsenen saßen auf bequemen Sesseln um den Kamin oder um den Mitteltisch und kümmerten sich nicht um das »Bücherwurm«, das im Halbdunkeln Winkel kleinen englischen Druck las. Sie wußten oft gar nichts von Hilmas Anwesenheit.
Sie unterhielten sich, ohne an das Kind zu denken. Hilma sah und hörte auch nichts, wenn sie »schmökerte«. Aber einmal schlug ein Name an ihr Ohr, der nie in ihrer Gegenwart genannt wurde und der in ihre Traum- und Romanwelt hineinschmetterte, wie ein Posaunenstoß des Jüngsten Gerichts in den Schlaf der Toten.
Sie war mit einem Male ganz wach, ganz Ohr. Man sprach vom Vater!
Die Mama und der Onkel Gustav, die am Kaminfeuer saßen und sich die Füße wärmten, sprachen von »ihm«! Hilma begriff sogleich, daß man von ihrer Anwesenheit nichts wußte. Sie hielt den Atem an. Und da hörte sie ihr Herz so laut klopfen, daß sie fürchtete, sein Schlagen könnte sie verraten.
Nie hatte man ihr und Horst von dem Vater erzählt. Sie wußten nicht, ob er tot war oder in unerreichbar fernen Landen lebte. Die Mama trug lange schwarze Kleider, sprach immer in klagendem Ton und sah traurig und müde aus. Aber nie erwähnte sie den Papa. Auch die anderen nicht. Man hatte den Kindern in geheimnisvollem Flüstern verboten, nach ihm zu fragen oder ihn zu nennen.
»Denn das darf die Mama nicht hören,« hatte die alte Kinderfrau gesagt. »Sie härmt sich gar zu sehre.«
Dies geheimnisvolle Dunkel gab der kindlichen Phantasie unbegrenzten Spielraum. Und weil Horst und Hilma weder die Mama noch den Großpapa noch den Onkel Gustav lieb haben konnten, weil sie sich weder geliebt noch verstanden fühlten, so warf sich ihr ganzer Verehrungsdurst auf den unbekannten Vater, aus dem sie sich ein Idealbild schufen, das sie zu ihrem Schutzgeist ernannten. –
Die Mama hatte aber eben gesagt: »Wenn sie nur nicht die Augen von ihrem Vater hätte! Jetzt hat sie manchmal einen Blick, der mich so stark an die Art erinnert, wie Hilmar mich oft ansah, daß ich erschrecke. Wenn die Kinder in seine Familie schlagen, statt in unsere, das ertrag' ich nicht. Ich kann Hilma oft gar nicht ansehen.«
»Die Hilma, ja,« antwortete der Onkel Gustav, »die hat mehr von den Viernaus als von uns, nicht nur äußerlich, sondern leider auch im Charakter. Aber der Horst hat doch das Utendorfsche Gesicht. Der kann auch noch werden. Hier stand er nur viel zu sehr unter Hilmas Einfluß, und der war kein guter.«
»Wenn ich denke,« fuhr die Mama klagend fort, »wie ich mir immer ein recht blondes, feines und zartes Töchterchen gewünscht habe, mit glatten Scheiteln und frommen blauen Augen, wie die gute kleine Anita Mathis, um die ich Kirchenrats beneide!«
»Häßlich ist Deine Hilma aber nicht,« sagte der Onkel, »wenn die sich erst herausmausert, kann sie eine wirkliche Schönheit werden.«
Die Mama seufzte. »Mir wäre es lieber, sie wäre häßlich und sähe aus wie eine Utendorf. Die Viernausche Schönheit ist eine beauté du diable, die nur Unheil schafft.«
»Hättest Dir halt einen anderen Vater für Deine Kinder aussuchen müssen,« sagte der Onkel etwas ungeduldig.
»Wer hat denn den Hilmar Viernau für mich ausgesucht?« entgegnete die Mama heftig. »Damals, wie er um mich anhielt, habe ich doch nur eingewilligt, weil Ihr alle es wünschtet. Er gefiel Euch allen. Auch Dir, lieber Gustav.«
»Am besten doch wohl Dir, liebe Schwester. Man heiratet einen Mann doch nicht, weil er anderen gefällt.«
»Ich war damals ganz urteilslos und wußte von nichts etwas. Was Ihr gut fandet, das tat ich. Und ihr ließt mich blind in mein Unglück gehen. Ihr wußtet mehr von der Welt und von den Menschen als ich.«
Der Onkel sagte sehr gereizt: »Verzeih mir, beste Maria, Du hast einmal die Schwäche, immer andere Leute für das verantwortlich zu machen, was Dir fehlschlägt. Diese Methode ist sehr bequem, aber sie ist nicht gerade gerecht.«
Auf diese scharfen Worte folgte Schweigen. Nun war die Mama natürlich gekränkt. Für gewöhnlich sprachen die Erwachsenen ungemein höflich untereinander. Die täglichen Anreden waren immer in schöne Redensarten und Komplimente eingewickelt. Eine leise Kritik, ja, eine bloße Unumwundenheit wurde als Beleidigung empfunden.
Hilma wagte nicht aus ihrem Versteck herauszusehen, aber sie konnte sich die wehmütige und vorwurfsvolle Miene der Mama lebhaft vorstellen.
Nach einer kleinen Weile stand der Onkel auf, sagte in einem Ton, der sein Unbehagen verriet, er hätte noch mit dem Inspektor zu sprechen, und verließ das Zimmer. Dann vernahm Hilma der Mama schleifenden Schritt und das Rascheln ihres mit Falbeln besetzten Taft-Unterrocks.
Hilma lugte jetzt aus ihrem Winkel und sah, wie die Mama vor einem der Pfeilerspiegel stehen blieb.
Eine Weile war es nun ganz still. Die Mama stand regungslos vor dem Spiegel, als wäre sie eine Statue. Die Stehuhr tickte laut und langsam, und dann krachte es in irgend einem Möbel. »Holz ist doch immer lebendig,« hatte die alte Kinderfrau gesagt.
Hilma verkroch sich wieder. Sie fürchtete sich. Endlich gingen das Seidenrascheln und der schleifende Schritt weiter. Der Deckel des Flügels wurde aufgeklappt. Eine kurze Stille noch, dann füllten süße, schwermütige Akkorde den Raum.
Hilma konnte nicht wieder lesen. Das wilde Schlagen ihres Herzens beruhigte sich allmählich; aber ein Gedanke erfüllte ihre Seele ganz: »sie liebt mich darum nicht, weil ich ›ihm‹ ähnlich bin!« Das war bitter und doch süß, zugleich Schmerz und Glück; aber das Glück war größer als der Schmerz.
Nachdem die Mama eine Weile musiziert hatte, schloß sie den Flügel und ging fort.
Rasch schlüpfte Hilma aus dem Versteck und tat dasselbe, was vorher die Mama getan hatte: sie stellte sich vor den Spiegel.
Sie starrte die Augen ihres Spiegelbildes an, von dem leidenschaftlichen Wunsch beseelt, darin den Blick zu sehen, der an ihren Vater erinnerte.
Sie starrte sich in eine Art Hypnose hinein, und mit einem Male kam ihr's vor, als wären diese dunkeln, ernsten Augen nicht mehr ihre eigenen, sondern die Augen ihres heimlich vergötterten Vaters. Regungslos, begeistert, verklärt stand sie und schaute.
Da wurde eine Tür geöffnet.
Hilma fuhr zurück, so verwirrt und erschrocken, als wäre sie auf etwas ganz Schrecklichem ertappt worden. In der Tür stand der Großpapa und lachte – ihr schien es ein boshaftes Lachen.
»Sieh mal an, die kleine Jungfer Eva vor dem Spiegel,« spöttelte er. »Fängt die Mamsell an, eitel zu werden?« Sie schämte sich entsetzlich dieses niedrigen Verdachts, gegen den sie sich nicht zu verteidigen wußte.
Tief gedemütigt und gekränkt schlich sie sich weg.
Erst viele Jahre später, wenn sie dieses peinlichen Augenblicks gedachte, wurde ihr klar, daß der Großvater sich ganz harmlos an der kleinen »Evastochter« ergötzt hatte, und daß dies wirklich nichts Furchtbares gewesen war.
Eines Tages, als Hilma in den ungeheizten Saal schlich, in dem die Ahnenbilder und die größten Spiegel hingen, der aber im Winter nicht zu durchwärmen war, fand sie dort eine greuliche Verwüstung. Die hellen Seidenmöbel waren mit Betttüchern überdeckt, die Bilder und Spiegel standen am Boden gegen die Wand gekehrt. Über das Parkett waren alte, verblichene Teppiche gelegt, Eimer mit Farbe standen umher, und von einer Stehleiter aus malte der Tünchermeister Strohl die Wände an.
Hilma wollte eilig fliehen, denn sie war sehr scheu und fürchtete sich vor jedem fremden Menschen. Da sah sie am Fenster einen Jungen stehen, den sie seit langer Zeit liebte, ohne zu wissen, wie er hieß.
Er hatte sich vorzeiten ihren herrlichen Spielen mit den Bauernjungen bisweilen angeschlossen. Horst und Hilma hatten unter sich ausgemacht, daß er Malegis heißen müßte, weil er ganz so blond und so sonnig aussah und so strahlende blaue Augen hatte wie der Malegis aus der Heldensage, der der Freund des Vivian war.
Sie vergaß das Verbot und alles, was man von den schlimmen Folgen des Verkehrs mit der Dorfjugend gesagt hatte, in ihrer Sehnsucht, endlich einmal wieder mit einem Jungen zu tollen.
Wie sie nun den Malegis halb scheu, halb begehrlich anblickte, lächelte der ihr so fröhlich und freimütig zu, daß sie Mut faßte.
»Komm ein bißchen mit in den Garten! Magst Du?« Malegis war bereit.
Auf der Treppe erfuhr sie, daß er des Stubenmalers und Bauern Strohl Sohn war, seinem Vater die Farben trug und mit Rufnamen Louis hieß.
»Louis?« wiederholte sie etwas befremdet. Wie konnte einer Louis heißen, der wie der Malegis aussah?! – Aber dann fiel ihr eine wunderschöne Spukgeschichte ein, die sie neulich in einem alten Kalender gefunden hatte.
Sie erklärte: »Weil Du Louis heißt, kannst Du der Prinz Louis Ferdinand sein, und ich werde Dir als die weiße Frau erscheinen. Das ist nämlich die Gräfin, Orlamünde, die spuken muß, so oft ein Hohenzoller sterben soll, weil der Albrecht von Nürnberg sie nicht als Frau haben wollte und weil sie ihre beiden Kinder totmachen ließ. Und vorher will ich die Königin Luise sein, denn wir wollen jetzt die Schlacht bei Jena spielen.«
Sie führte ihren Freund in das Notwendige ein und fand ihn gelehrig. Bald tobte die Schlacht bei Jena in dem winterlich öden Park, dessen Rasenflächen und Wege eine leichte Schneeschicht bedeckte.
Man gab Signale auf eingebildeten Schlachttrompeten, verfolgte den Feind, machte Gefangene, übernahm jeden Augenblick eine andere Rolle.
Hilma glühte vor Lust und Begeisterung. Ihr blondlockiger Freund war zwar kein Horst, aber er wußte sich ihr mit viel natürlicher Liebenswürdigkeit anzupassen.
Das dauerte, bis die Durchgängerin zur Schulstunde eingefangen wurde.
Malegis kam zum Glück am nächsten Tag wieder, und das aufregende Spiel konnte fortgesetzt werden. Da im Winter selten jemand von den Erwachsenen im Park lustwandelte, ging es wieder unbemerkt vorüber.
Am dritten Tage stürmte und schneite es. Da nahm Hilma ihren Freund mit auf den großen Dachboden hinauf. Hier waren in alten Schränken, Kommoden und Truhen, Kisten und Koffern unermeßliche Kleinodien verborgen: Urgroßväterplunder aus mehreren Menschenaltern.
In diesen Schätzen konnte man wühlen und sich mit ihnen häuslich einrichten.
Es war bitter kalt hier oben, aber Hilma war abgehärtet und Malegis erst recht.
Zuletzt holte Malegis sein Vesperbrot hervor zur gemeinsamen Mahlzeit. Das war ein seltener Genuß! Denn Louis wickelte aus Zeitungspapier schwarzes Bauernbrot und ein großes Stück Backsteinkäse. Etwas so Wohlschmeckendes hatte Hilma noch nie gegessen. Achtungsvoll kauerte sie dem großmütigen Freund gegenüber am Boden, und er schnitt mit seinem gewaltigen Taschenmesser Stücke von seinem Käse herunter, die er abwechselnd sich selber und seiner Freundin in den Mund steckte.
Das lukullische Mahl war noch nicht beendet, als Hilma zur Mama gerufen wurde, die unerwartet Verwandtenbesuch bekommen hatte.
Mit verwirrten Locken und verstaubtem Kleidchen, Hände und Gesicht nicht sehr sauber, trat Hilma in den Salon.
Die Mama empfing sie mit dem gewohnten Schreckensruf: »Aber Hilma, wie siehst Du wieder aus?! Und ... wie ... riechst Du denn?! Du hast doch nicht etwa Käse gegessen?!«
Ein solches Entsetzen lag in den Augen der Mama, als wäre Käse-Essen das Schändlichste, was man tun konnte.
In ihrem Schreck stammelte Hilma: »Der Louis Strohl hat mir ein bißchen abgegeben.«
Die Mama schämte sich ihrer Tochter so sehr, daß sie ganz rot wurde. Das ging dem Kind zu Herzen.
Der Großpapa, dessen leise, harte Stimme die Herzen frieren machte, sagte: »Dies Kind hat merkwürdig degenerierte Neigungen. Sowie sie sich selber überlassen bleibt, passiert irgend etwas Horrendes. Man sollte sie gar nicht ohne Aufsicht lassen.«
Die Mama schüttelte den Kopf wie jemand, der keinen Rat weiß, und seufzte: »Meine armen Nerven sind zu sehr mitgenommen von all dem Schweren in meinem Leben, als daß ich das schwierige Kind um mich haben könnte. Aber Miß Moore muß wirklich mehr auf sie achtgeben.«
So erschüttert war man über ihre Aufführung, daß man fast zu schelten vergaß.
Aber nun mischten sich auch die fremden Tanten ein und gaben Ratschläge, wie, nach ihrer Ansicht, solch ein kleiner Tunichtgut am besten zu bändigen wäre.
Mit heimlichem Zittern um ihr bißchen kostbare Freiheit und mit zorniger Empörung hörte Hilma zu, bis man sie unwirsch fortgehen hieß, um sich zu säubern.
»Vor allen Dingen spüle Dir ordentlich den Mund aus! Du hast doch noch eau de bôtôt?« –
Erst auf der Treppe fing Hilma zu weinen an. Immer fand man sie schlecht! Niemand glaubte an das Gute in ihr! Und alles, was sie liebte, nahm man ihr fort, und jede Freude wurde ihr zerstört!
›Wär' ich doch nur tot!‹ dachte sie und schluchzte aus Mitleid mit sich selber. –
Natürlich war das kurze Freundschaftsglück zu Ende. Vater Strohl bekam die Weisung, seinen Sohn nicht wieder ins Herrenhaus mitzubringen. Also verschwand der sonnige Malegis.
Hilma aber hatte in einem von Miß Moore's Büchern ein Gedicht gefunden, dessen Dichter, Thomas Moore, sie für Miß Moore's Vater hielt, (was sie aber verschwieg, denn sie glaubte, daß man nach einem Vater niemals fragen dürfte). Dies Gedicht liebte sie sehr und sie vergoß mit schmerzlicher Wonne Tränen darüber. Es hieß:
All that's bright must fade,
the brightest still the fleetest,
All that's sweet was made
but to be lost when sweetest.
Who would seek or prize
delights that end in aching?
Who would trust to ties
that every hour are breaking?
Better far to be
in utter darkness lying
Than to be blessed with light and see
that light for ever flying.
Zu diesen Versen dachte sie sich eine traurige Melodie aus, die sie zuweilen – wenn sie für die Stunde beim Kantor üben sollte – auf dem Klavier spielte. Dazu sang sie leise die Worte, bis ihr vor Weinen die Stimme versagte. Sie dachte an das Spiel mit Louis Strohl, an seinen Backsteinkäse und das große Taschenmesser.
Während dieser ganzen Zeit zählte Hilma die Tage bis zu den Weihnachtsferien. Ach, es waren entsetzlich viele, und jeder war angefüllt mit unangenehmen Dingen. Nun aber kamen die Adventsonntage, und Hilma plante Weihnachtsüberraschungen für Horst. Sie hätte die Zeit bis zu seiner Ankunft mit Peitschen vor sich her treiben mögen, so ungestüm freute sie sich auf das Wiedersehen.
Und dann, mit einemmal, war alles aus.
Horst hatte die Einladung eines Schulfreundes angenommen. Statt nach Hause zu kommen, sollte er mit dem Freunde nach dessen Heimat reisen.
Hilma erfuhr das Schreckliche ganz unvorbereitet. Die Mama hatte von dem Vater des Freundes einen Brief bekommen, der ihr sehr gefallen hatte. Die Erwachsenen schienen sich durch diese Einladung geehrt zu fühlen. Der Schulfreund stammte aus sehr vornehmem Haus.
»Ich wüßte nicht, wie ich es abschlagen sollte?« äußerte die Mama im Tone sanfter Nachgiebigkeit.
»Warum auch?« entgegnete der Onkel. »Der Junge ist dort entschieden besser aufgehoben als hier.«
Da fühlte Hilma sich vor Schreck erstarren.
Sie rief entsetzensbleich: »Aber der Horst sehnt sich doch nach mir!«
Über diesen Aufschrei lachten die Erwachsenen.
Ganz verzweifelt bat und flehte das Kind: »Ach bitte, bitte, laßt ihn kommen! Sein Freund hat ihn doch immer in der Schule, und ich habe nichts! Ich will auch so zahm und artig sein, wie noch nie! Das ganze Jahr! Alles will ich tun, was ihr wollt! Ich will jeden Tag eine ganze Stunde an meinem Strumpf stricken, wenn ihr mir nur den Horst laßt!«
Der Großpapa schüttelte mißbilligend den Kopf: » Qu'elle est exaltée cette malheureuse enfant!«
Die Mama war ein wenig gerührt. Sie sagte vorstellend: »Wenn der Horst nun aber doch nicht kommen möchte?«
»Er ... möchte ... nicht?«
»Ja, da machst Du große ungläubige Augen! Er hat selbst um Erlaubnis gebeten, mit zu Hartwigs Eltern zu dürfen.«
Hilma blieb regungslos vor der Mutter stehen und starrte blöde vor sich hin. Sie konnte das nicht fassen.
Der Großpapa zog die Brauen hoch. »Wie sie mal wieder dasteht! Siehst Du, meine liebe Maria, mit diesem Mangel an Haltung wird sie nie eine Figur machen.«
Der Onkel Gustav faßte sie bei den Oberarmen und bog ihre Schultern kräftig zurück.
»Kopf hoch!« kommandierte er. »Frauenzimmerchen, setz' doch nicht diese Jammermiene auf! Das ist wirklich kein erfreulicher Anblick.«
Hilma fühlte Qual und Verzweiflung. Sie war von Gott und Menschen verlassen, von allen, allen! Niemand hatte sie lieb, auch Horst nicht mehr. – Und da sollte sie noch ein erfreulicher Anblick sein? –
Miß Moore ergriff sie bei der Hand und führte sie schweigend aus dem Zimmer.
Draußen sagte sie leise: »Armes kleines Ding!«
Diese Worte lösten Hilmas Erstarrung. Sie warf sich in die Arme der Gouvernante und brach in wildes Weinen aus.
Den ganzen Tag flossen ihre Tränen.
Sie erinnerte sich jetzt, daß der Onkel Gustav einmal zur Mama gesagt hatte, sie, Hilma, hätte Horst beeinflußt, und ihr Einfluß wäre kein guter gewesen.
Sie begriff, daß man sie und den Bruder von einander fern halten wollte. –
Horst verstand sich nicht auf den schriftlichen Ausdruck. Er schrieb selten. Und kam einmal ein Brief, so stand so gut wie nichts darin.
In ihrer Einsamkeit suchte Hilma Trost bei den Büchern. Die Schränke in der Bibliothek waren zum Glück unverschlossen. Sie fand wunderschöne Erzählungen: Novellen von Edmund Hoefer und Spukgeschichten von E. T. A. Hoffmann, Romane von Walter Scott und Edward Lytton Bulwer, auch von Alexander Dumas und Victor Hugo.
Diese schleppte sie alle in ihren Winkel und schwelgte heimlich darin. Vieles verstand sie freilich noch nicht, aber das ergänzte sie mit ihrer Phantasie. Sie fieberte oft über diesen aufregenden Geschichten, verriet sich aber mit keinem Wort. Jede Freude, die sie sich verschaffen konnte, hütete sie als strenges Geheimnis, denn sie war zu der Überzeugung gelangt, daß die Erwachsenen nicht duldeten, daß sie sich an etwas freute. Was man konnte, nahm man ihr weg. Miß Moore war zwar gut, aber sie hatte eine Menge langweiliger Grundsätze.
Hilma wunderte sich kaum mehr, als sie erfuhr, daß Horst auch zu den Osterferien nicht kommen würde. Nur eins kam ihr sonderbar vor: auf ihre Frage, ob er wieder zu den Eltern seines Freundes reiste, hieß es »nein«, und auf ihr: »wohin geht er denn?« antwortete man kurz: »zu Leuten, die Du nicht kennst.« Mehr erfuhr sie nicht.
›Ob er überhaupt nie wieder kommen soll?‹ dachte sie gramvoll. Sie wagte nicht danach zu fragen.
Aber die Sommerferien brachten den Heißersehnten endlich doch!
Anfangs konnte man nicht gleich wieder den vertrauten Ton finden. Eine Fremdheit stand zwischen den Geschwistern. Die Erwachsenen machten in den ersten Stunden viel Wesens um Horst. Er beantwortete munter alle an ihn gerichteten Fragen, tauschte mit Hilma aber nur halb verlegene Blicke.
Endlich durften die Kinder in den Garten hinunter.
Auf den Parkwiesen rechten Bauernweiber das geschnittene Gras, dessen Aroma sich mit dem süßen Duft der Zentifolien mischte. Und die Steinlinde blühte und duftete feiner als alles.
›Nun ist der Garten wieder ein Paradies,‹ dachte Hilma.
Aber die Befangenheit wich doch noch nicht ganz. Hilma hatte dem Bruder so unendlich viel erzählen und klagen wollen; nun kam ihr das alles abgestanden vor und nicht wert, seine frische, heitere Miene zu trüben.
»Wollen wir mal wieder auf unsere Steinlinde klettern?« schlug sie vor.
Er maß die Höhe ihres alten Sitzes im Geäst mit abschätzenden Blicken und sagte: »Das lohnt sich gar nicht.«
»Aber es war doch schön, als wir Storch und Störchin spielten!«
Er lachte verlegen: »Wir waren riesige Kälber damals.«
Sie schwieg verwundert.
»Siehst Du noch manchmal die nette Anita?« erkundigte er sich.
»Fast nie. Ich bin ja zu wild. Frau Mathis fürchtet, ich könnte sie mal zerbrechen. So eine Puppe.«
»Aber für ein Mädchen ist sie grade nett,« meinte er.
Das erstaunte sie wieder.
Bei einer Silberpappel sagte sie: »Weißt Du noch, wie wir uns an den Ast hängten, wenn wir Büßer waren?«
»Jetzt kann ich richtige Klimmzüge machen,« entgegnete er stolz. »Soll ich Dir das zeigen?«
Er machte ihr die Klimmzüge vor.
»Im Turnen bin ich immer einer von den Besten.«
Hilma versuchte, ihm die Klimmzüge nachzumachen, aber da sie ungeübt war, blieb sie weit hinter ihm zurück.
»Ja, das geht nicht so,« lachte er, »dazu muß man sich trainieren.«
Hilma nahm sich vor, in jeder freien Viertelstunde Klimmzüge zu üben.
Nach und nach kam Horst ins Erzählen. Die Klosterschule bestand aus zwei feindlichen Heerlagern: Lehrern und Schülern. Die Lehrer hatten eine Menge von Rechten, dafür waren die Schüler an Zahl weit überlegen, voller Schläue und Kraft und alle miteinander verbündet. In den »Zellen« hielt man abends heimliche Gelage. Draußen in den langen Klostergängen wurden Wachen aufgestellt. Auch war man im Bunde mit den Bauernjungen, die Spionen- und Schmugglerdienste leisteten. Nachts brachen die Verwegensten zuweilen aus dem Kloster aus, kletterten am Spalier hinunter, klommen über die Mauer, durchschwammen den Strom und trabten in den nassen Anzügen eine halbe Stunde weit nach einer Waldschenke, deren Wirt ein Verbündeter war. Dort kneipte man und brachte in den Taschen einige Flaschen Bier den Zellengenossen mit, immer unter Gefahr, verfolgt und abgefaßt zu werden, denn auch der Feind hatte seine Spione. –
Mit Begeisterung und verzehrendem Neid lauschte Hilma diesen kühnen Taten.
Sie sagte plötzlich: »Warum ist der liebe Gott so grausam gewesen, daß er mich nicht auch zu einem Jungen gemacht hat?!«
»Ja, das ist sehr schade,« meinte Horst.
Sie raffte ihren Mut zusammen und erklärte: »Aber ich werde alles lernen. Ich werde alles können.«
Horst traute ihr das zu. Ganz heimlich hatte er doch eine sehr hohe Meinung von ihr.
Die alte Vertrautheit kehrte zurück, und ohne daß Horst sich dessen bewußt wurde, geriet er wieder in den Bann der Einbildungskraft Hilmas. Sie spielten nun doch wieder die alten Spiele.
Eines Tages, im August, lagerten sie am Waldrand beim Rollborn. Es war heiß. Über den reifen Kornfeldern, die sich zwischen ihrem Paradieswald und dem Dorf dehnten, lagen Mittagsstille und weißer Sonnenglast. Glühend leuchteten am Feldrand die Farben der blauen Kornblumen und des Mohns, der Rade und des Rittersporns. Nirgends gab es ein solches Konzert jubelnder Farben, wie dieses zwischen den weißgelben reifen Ähren, die der Sense harrten.
Horst lag auf dem Bauch, stützte sich auf die Ellenbogen und sah den Käferchen zu, die auf Grashalme kletterten, herunterpurzelten und von neuem kletterten. Hilma lag auf dem Rücken, wohlig ausgestreckt, und schaute in den Wipfel einer schlankgewachsenen Waldeiche, deren zackiges Laub sich von dem tiefen Himmelsblau abzeichnete.
In dem verwilderten Gehölz hatten Efeu, Leberkraut und Immergrün den Boden mit dichtem, dunkelgrün glänzendem Teppich übersponnen. Zwischen Moos und feinem Waldgras blühten seltsame Blumen: gefleckte Orchideen und wilder Türkenbund.
»Die Eiche sieht so merkwürdig froh aus,« fand Hilma.
»Froh?« wiederholte Horst.
»Ja. Es fällt mir eben auf. Stark und frei und froh. Mehr als jeder andere Baum. Sie ist ein königlicher Baum! Weißt Du was? Wir wollen die Eiche ›Ihm‹ weihen. Wenn wir mit den Erwachsenen sind, soll ein Eichenblatt, oder ein Zweig bedeuten, daß wir an ›Ihn‹ denken. Soll es so sein?«
»Wenn ich Dir bloß etwas sagen dürfte!« rief der Junge in plötzlich hervorbrechender Lebendigkeit.
»Du darfst mir alles sagen, Horst. Du mußt sogar! Ich würde Dich verachten, wenn Du mir nicht alles sagen wolltest!«
Da platzte sein mühsam verwahrtes Geheimnis heraus: »Ich bin nämlich bei ›ihm‹ gewesen.«
Sie schrie auf: »Horst!!« Und schnellte aus ihrer Ruhelage empor. Am Boden sitzend, sah sie ihn mit Augen an, die ein einziges, heißes Verlangen waren. Aber dann erschien ihr seine Mitteilung zu unwahrscheinlich und unwirklich. Ungläubig fragte sie: »Ist das wirklich wahr?«
»So wahr, wie ich hier liege.«
»Und das sagst Du mir jetzt erst?! Wann denn?«
»Ostern. Die ganzen Osterferien war ich dort.«
»Wie ich Dich fragte, hast Du aber doch gesagt ...«
»Natürlich mußte ich irgend etwas lügen,« fiel er ihr ärgerlich ins Wort. »Weil ich Dir nichts davon sagen sollte.«
Hilma verstummte, von der Wucht des so jäh auf sie Einstürmenden ganz betäubt. Wie ungeheuerlich war das: Horst mit den Erwachsenen gegen sie im Bunde! Und warum sollte sie nicht erfahren, was er wußte?!
Sie war so empört, daß sie endlich mit strengem Ernst erklärte: »Es ist Dein Glück, daß Du endlich beichtest. Sonst müßte ich Dich für einen Verräter halten.«
Horst protestierte lebhaft.
»Mädchen stellen immer alles auf den Kopf,« erklärte er verächtlich. »Einen Verräter könnte man mich höchstens jetzt nennen, weil ich Dir verraten habe, was ich versprochen hatte, nicht zu verraten.«
Hilma, die ihn gekrankt und verletzt hatte, bedachte, daß sie ihn nicht erzürnen dürfte, wenn sie das, was sie über alles in der Welt interessierte, jetzt von ihm hören wollte. Dabei durchzuckte sie aber ein schmerzliches Bedauern darüber, daß sie zum erstenmal genötigt war, auch ihrem liebsten und vertrautesten Menschen gegenüber nicht ganz ehrlich zu bleiben. Denn sie mußte ihn jetzt begütigen, ohne selbst begütigt zu sein.
»Ja, ich sehe ein, daß Du nur aus Redlichkeit geschwiegen hast,« erklärte sie. »Aber Du mußt nicht vergessen, daß wir zwei in unseren Herzen nicht zwei sind, sondern einer. Wenn ich versprechen müßte, irgend etwas keinem Menschen zu sagen, würde ich doch immer bei mir selbst die Klausel machen: außer dem Horst. Du bist wie ich, und für mich nicht ein anderer.«
»Ja,« sagte Horst, »natürlich mache ich es auch so; aber man hat mir doch extra verboten, Dir etwas zu sagen.«
Sie seufzte. »Möchte nur wissen, warum?!« Dann, entschlossen, möglichst viel zu erkunden, setzte sie eifrig hinzu: »Erzähl' mir jetzt aber alles, alles!«
»Wirst Du auch dicht halten?«
»Wie das Grab. Ehe ich Dich verrate, laß' ich mich köpfen. Wie ist er?«
»Sehr nett.«
»Groß?«
»Ja. Ich glaube.«
»Schön?«
»Das weiß ich nicht. Auf so was sieht ein Junge gar nicht. Das tut nur ihr Mädchen.«
Dies ›ihr Mädchen‹ hatte er sich erst in seiner Schule angewöhnt.
»Sind seine Augen so ähnlich wie meine?« Sie fragte es mit heimlicher Scheu.
Er antwortete: »Keine Spur. Er kann doch nicht Augen haben wie ein Mädchen! Er ist alt und dick und hat nicht viel Haare über der Stirn und trägt eine goldene Brille. Das ist alles, was ich weiß.«
Hilma würgte an einer schweren Enttäuschung. Das Bild, das Horst eben entworfen, war ihrem herrlichen Idealbild gar zu unähnlich!
»Ist er denn so alt wie der Großpapa?« fragte sie kleinlaut.
»Nein, so alt nicht. So ungefähr wie der Onkel Gustav und auch ungefähr so dick. Aber sonst ist er viel gemütlicher als der Onkel Gustav. Man fürchtet sich gar kein bißchen vor ihm.«
»Ja, ja,« nickte sie eifrig, »ich denke mir: er ist gut. – Aber erzähle mehr! Du mußt mir alles von Anfang bis zu Ende erzählen!«
Horst konnte nicht schildern, nicht einmal erzählen. Sie mußte ihm alles abfragen, und seine Antworten sättigten ihren Wissenshunger sehr wenig. Und immer begriff er gar nicht, auf was es ihr eigentlich ankam.
Er wiederholte nur unermüdlich, daß dort alles »sehr nett« gewesen sei: Elektrisches Licht und Wasserleitung, die kaltes und heißes Wasser gab, je nach dem Hahn, den man aufdrehte. Und ein Gasofen mit tausend Flämmchen. Auch hatte ihn der Papa mit in den Zoologischen Garten genommen und ins Theater. Am gesprächigsten wurde er über ein Walroß.
»Aber wenn er doch in Deutschland wohnt und es so gut hat,« warf Hilma ein, »warum kommt er niemals zu uns, »und warum darf niemand von ihm sprechen? Wenn ich das begreifen könnte! Ich denke immer, wenn er käme, würde er gut zu mir sein und nicht so wie die anderen.«
»Ja, ich weiß auch nicht.«
»Hast Du ihn nicht gefragt?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Horst errötete. Er konnte sich nicht erklären, wußte selbst nicht, warum.
»Man kann nach so etwas nicht fragen,« behauptete er schließlich.
»Ist er auch traurig?« forschte Hilma.
»Nein, gar nicht. Er ist ein ganz fideles Haus.«
Hilma fand die studentischen Ausdrücke, die Horst von der Schule mitgebracht hatte, sehr forsch und sprach sie nach. Aber daß er den Vater »fideles Haus« nannte, gefiel ihr nicht. Noch viel mehr störte sie die Tatsache selbst: ›Wie kann er vergnügt sein,‹ dachte sie, ›wenn die Mama so unglücklich ist, und sein Kind so einsam und verlassen! Weiß er wohl, daß man mich haßt, weil ich ihm so ähnlich sein soll?‹
»Ist er ganz allein in seinem schönen Haus?« fragte sie.
»Nein, da ist eine Tante Agnes mit ihm,« antwortete Horst ein wenig befangen.
»Die sorgt wohl für sein Essen?«
»Ja ... sie haben Dienerschaft.« Er stand auf und zog seine neue Taschenuhr vor. »Die ist nicht vom Großpapa, sondern von ›ihm‹. Das Werk ist vorzüglich, sagte der Papa. Er hat mir auch ein Petschaft geschenkt mit einem roten Edelstein, auf dem das Viernausche Wappen eingeschnitten ist. Das hab' ich aber im Kloster gelassen, weil ich es dir doch nicht zeigen durfte. Und jetzt müssen wir nach Hause rennen, sonst kommen wir zu spät zu Tisch.«
Seitdem Horst die Uhr mit dem vorzüglichen Werk besaß, dachte er an die Zeit und hielt die verträumte Hilma zur Pünktlichkeit an.
Sie machten sich auf den Weg, und Horst fuhr fort, von den Merkwürdigkeiten des Zoologischen Gartens zu sprechen.
Hilma schaute auf das Haferfeld, das wie ein Meer wogte und schimmerte. Dabei war ihr so schwer ums Herz, als hätte sie in dieser Stunde ihren tiefsten Trost und Halt eingebüßt.
Und Horst hatte keine Ahnung von dem, was sie empfand! Er konnte denken, sie kümmerte sich um Riesenschlangen und Walrosse!
Als er endlich schwieg, wagte sie noch eine zitternde Frage: »Hat er sich gar nicht nach mir erkundigt?«
»Doch. Er wollte alles Mögliche wissen.«
»Von mir?«
»Ja. Von Dir.«
»Was denn?! Lieber, guter Horst, besinne Dich doch darauf und sag' mir alles!«
»Na, er fragte, ob Du gesund wärst, und ob ich eine Photographie von Dir hätte ...«
»Du hast keine!« rief sie bedauernd.
»Und ob wir uns gut vertrügen, fragte er noch.«
»Was sagtest Du ihm?«
»Ich sagte eben, wie es ist.«
»Was denn? Was?« drängte sie.
»Na, daß Du laufen und klettern und springen könntest wie ein Junge, und daß Du ein famoser Kamerad wärst.«
»Freute er sich darüber?«
»Ja.«
»Erzähltest Du ihm auch von der Mama und den anderen?«
»Nein.«
»Gar nicht?«
»Nein. Er fragte nicht.«
Sie gab sich endlich zufrieden. Nun wollte sie erst einmal allein sein, um über all' dies nachzudenken. Wie der Horst es nur ausgehalten hatte, die ganze Zeit zu schweigen! Er war wirklich ein sehr heldenhafter Charakter.
Es war eine neue Erfahrung für Hilma, daß sie's jetzt oft danach verlangte, ganz allein zu sein, um ungestört ihren Gedanken nachhängen zu können oder sich in die geliebten Bücher zu vergraben. Doch kam ihr diese Wandlung noch nicht deutlich zum Bewußtsein. Sie fühlte nur ein leichtes, mit etwas Bedauern und etwas Schuldgefühl vermengtes Befremden.
Aber auch Horst machte neue Erfahrungen.
Der starke Einfluß Hilmas, der ihn leicht aus seiner eigenen Bahn schleuderte, fing an, ihn ein wenig zu belästigen.
Das Schlimmste war, daß sie seit jener unseligen Mittagsstunde am Rollborn gar nicht aufhörte, ihn auszufragen, wodurch er beständig an das erinnert wurde, was er gar zu gern vergessen hätte: daß er schwatzhaft gewesen war, wie ein Waschweib, statt dicht zu halten, wie es Männern ziemte.
Bei der beunruhigenden Leidenschaft und Dringlichkeit ihrer endlosen Fragerei kam ihm jetzt manchmal der Gedanke, daß das Verbot der Erwachsenen nicht so unbegründet gewesen war. Von diesem Punkt aus gelangte er zu weiteren Schlüssen. War es nicht möglich und sogar wahrscheinlich, daß die Erwachsenen überhaupt öfter Recht hatten, als Hilma glaubte? Wenn er die Urteile der Schulkameraden mit denen Hilmas verglich, so erschien ihm jetzt die Denkweise der Jungen der der Erwachsenen doch ähnlicher und der Wirklichkeit näher als die Hilmas. Hilma freilich glaubte bombenfest an das, was sie sich einbildete, und er hatte früher immer blind mitgeglaubt. Jetzt kamen ihm an ihrer Unfehlbarkeit Zweifel, die ihn drückten; denn er empfand sie als eine Art Verrat an ihr, weil er sie nicht bekennen konnte. Sie war ihm mit Worten zu sehr überlegen, so daß er nie gegen sie Recht behalten hätte. Es würde also nur einen fürchterlichen Streit und eine Rauferei geben, denn wenn sie in Zorn gerieten, hauten sie aufeinander los.
So kam es, daß der Abschiedsschmerz diesmal sogar für Hilma ein milderer war.
Sie tröstete sich mit den Büchern.
Eines Tages war sie der vielen Romane überdrüssig. Sie ließ den Schrank, der bisher ihr Schatzhaus gewesen war, verächtlich geschlossen, und öffnete den, aus dem die Mama ihre Erbauungsbücher zu holen pflegte.
Da standen die Bekenntnisse des heiligen Augustin und Mark Aurels Meditationen und das Heimweh von Jung-Stilling und Mamas Lieblingsbuch: Der Thomas a Kempis. Die enthielten aber alle wohl nur schrecklich fromme Ermahnungen. Das konnte sie nicht verlocken, denn sie verabscheute die ewigen Ermahnungen. Sie griff nach einem in Leder gebundenen Bändchen und öffnete es aufs Geratewohl. Es waren Gespräche, die Sokrates, der Mann, der den Schirlingsbecher hatte trinken müssen, mit seinen Jüngern über die Unsterblichkeit der Seele hielt. Dieser Sokrates setzte die unbegreiflichsten Dinge so auseinander, daß sie ganz einfach und klar wurden. War das herrlich! Sie las mit brennender Gier.
Ja, nun wollte sie nur noch diese Bücher lesen, die Weisheit und Erkenntnis lehrten! Denn sie wollte weise werden und durch Wissen mächtig, und dann, wenn sie alles erkannte, wollte sie allen Irrtum ausrotten. Wenn erst die Menschen aufhörten, sich untereinander und alle Dinge falsch zu verstehen, dann mußten alle glücklich werden.
Das war ein wunderschönes Ziel!
Daß es Bücher gab, die das tiefste Wissen vom Leben und von dem, was nachher kam, so einleuchtend lehrten! Und daß diese wunderbaren Helfer jahraus jahrein mucksmäuschenstill in ihrem Schrank standen, als ob sie gar nichts weiter wären, statt zu rufen! Man hätte Glocken an sie binden müssen, die die Bedürftigen mit großem Schall herbeiläuteten, wie die Glocken im Kirchturm!
Sie las und las, bis ihr ganz wirr im Kopf wurde. Zuletzt küßte sie das Buch und stellte es liebevoll an seinen Platz zurück. Ganz berauscht von diesem Erlebnis, rannte sie durch den Garten, kletterte auf die Mauer und sprang in die Dorfstraße hinunter.
Es war ihr verboten, ohne Begleitung den Park zu verlassen, aber wenn es ihr einmal innerhalb der hohen Mauern zu eng wurde, tat sie's doch.
Auf der Dorfstraße war es immer lustig. Enten wackelten hintereinander her, die Bäuerinnen holten Wasser am Brunnen, den der Rollborn speiste, oder trugen die köstlich duftenden Zwiebel- und Kartoffelkuchen vom Backhaus heim, Kälbchen und Schweine sprangen umher.
Ein paar Jungen kamen ihr entgegen, unter denen sich ein einstiger Spielgefährte befand: der Amand Reißland.
Einer von diesen trug ein kleines, weichfelliges Hündchen, das sie entzückte.
Sie überwand ihre Scheu und sprach die Jungen an.
»Was für ein liebes Hündchen! Kann ich es streicheln?«
Die Jungen lachten und hielten ihr das Tierchen hin.
»Wie heißt es denn?«
»Der hot gor kei Nomen.«
»Gehört es euch?«
»'s is vom Bäcker einer. Er soll ins Wasser.«
»Ihr wollt ihn baden?«
»Nä. Dersäuft soll 'r wär'n.«
»Nein! Nein! Das dürft ihr nicht tun!« rief sie vor Entsetzen blaß. »Wenn ich Geld hätte, würd' ich ihn euch abkaufen, aber ich hab' nichts!«
»Wenn du'n haben willst,« sagte der Amand Reißland, »schenken mer'n dir, du kannst'n nähmen.«
Hilma strahlte. »Dürft ihr denn auch?«
»Nu freil'ch. Ob mer das Vieh nu ins Wasser tragen oder 'mer verschenken's, das is eins.«
»Dann dank ich euch sehr! Sehr!« sagte sie ganz verwirrt. »Wenn ich kann, tu ich euch auch mal einen Gefallen dafür.«
Die Jungen gaben ihr den kleinen Hund, der sehr weich war und gar unschuldig und zutraulich um sich blickte, als wüßte er noch gar nicht, daß man ihm etwas zuleid tun könnte.
Hilma trug das Tierchen mit sorglicher, fast ehrfurchtsvoller Zärtlichkeit nach Hause. Es war etwas so Wunderbares, ein lebendiges Geschöpfchen mit einer kleinen Seele als Eigentum zu besitzen!
Freilich fürchtete sie, daß man ihr nicht erlauben würde, den Hund zu behalten. Aber sie hoffte, ihn auf dem Gutshof, wo soviel Ställe waren, heimlich unterbringen zu dürfen. Dann konnte sie ihn immer besuchen und ihm von ihrer Frühstücksmilch bringen.
Der Onkel Gustav stand vor dem Haus und sprach eifrig mit einem der Verwalter.
Hilma näherte sich ihm zaghaft, aber an seinem Lächeln merkte sie zu ihrer großen Erleichterung, daß der kleine Hund ihm Spaß machte.
Daß man ihr Durchbrennen bemerken und sie deshalb zur Rede stellen würde, hatte sie kaum zu befürchten, denn die Gleichgültigkeit der Erwachsenen hatte das Gute, daß man sich meist nicht um sie kümmerte. Mit Ausnahme der Mahlzeiten, der Schulstunden und der arg langweiligen Spaziergänge, die sie täglich mit Miß Moore machen mußte, war sie gewöhnlich ganz sich selbst überlassen.
»Was hast Du denn da für einen Köter aufgegabelt?« fragte der Onkel.
Sie berichtete aufgeregt, daß das Tierchen hätte ins Wasser geworfen werden sollen.
»Sieh doch nur, Onkel Gustav, wie lieb er schaut! Er glaubt, alle Menschen wären gut.«
Der Onkel krauelte dem Tier das Köpfchen und lachte. »Dies dumme Gesicht ist reizend,« sagte er.
Hilma blickte mit flehenden Augen auf. »Sie haben ihn mir geschenkt, und ich möchte ihn so schrecklich gern behalten!«
Zu ihrem freudigen Staunen war der Onkel gar nicht entrüstet.
Er sagte nur: »Wenn der Großpapa und die Mama es erlauben, kannst du ihn schon behalten. Du hast ja einen Mund zum Fragen.«
Auch der Großpapa und die Mama zeigten sich willig. Man stellte nur die Bedingung, daß Hilma selbst für den Hund sorgen müßte, was sie hochbeglückt versprach.
Sie fühlte, daß nicht sie diesen überraschenden Sieg errungen hatte, sondern das Hündchen. Seinem treuherzig zutraulichen Wesen hatte keiner widerstehen können. Aber einerlei: ein ungeheures Glück war es auf alle Fälle.
Sie nannte ihr Hündchen Sokrates.
Nun teilte sie ihre freie Zeit zwischen dem Hündchen Sokrates und den philosophischen Schriften.
Sie las mit immer gleicher Wonne die Gedanken Blaise Paskals und die Meditationen Mark Aurels, Fichtes Reden an die deutsche Nation und die Diätetik der Seele Feuchterslebens.
Zuletzt wagte sie sich sogar an Schopenhauer.
Natürlich verstand sie bei weitem nicht alles, was sie las, aber es ging ihr wie dem Bäuerlein in der Dorfkirche, das die Predigt des Herrn Pfarrers ganz besonders erbaulich findet, wenn sie ihm recht dunkel ist. Das nicht zu Begreifende wirkte auf ihre Einbildungskraft am stärksten. Die ahnungsvollen Ehrfurchtschauer waren das Allerschönste.
Neben der Philosophie pflegte und erzog sie ihren Sokrates. Das kleine zutrauliche Tier wurde ein freundliches Brückchen zwischen ihr und den Erwachsenen, denn alle hatten Vergnügen an dem drolligen Kerlchen.
Aber als das Hündchen sechs Monate in Hilmas Besitz gewesen war, wurde es krank. Hilma pflegte es treu. Sie trug es umher und saß stundenlang neben seinem Lager. Sokrates war heiß und steif und wollte gar nicht fressen. Aber wenn sie ihm die Hand hinhielt, leckte er sie. Da tauchte sie immer wieder den Finger in das Milchschüsselchen, und Sokrates leckte ihn jedesmal ab. So gelang es ihr, ihm etwas Nahrung einzuflößen.
»Er hat die Hundekrankheit,« hieß es.
Sokrates wurde immer kälter und steifer und mochte sich nicht mehr rühren, wedelte auch nicht mehr mit dem Schwänzchen, wenn Hilma liebkosend zu ihm sprach. Und eines Morgens fand sie ihn tot.
»Ich soll nicht froh sein,« sagte sie zu Miß Moore. »Alles was mich froh macht, wird mir genommen: der Horst, der Malegis, die Anita, der Sokrates. Immer muß ich einsam bleiben.«
Im April war ein junges Dorfmädchen ins Haus gekommen, kaum älter als Hilma. Sie mußte in der Küche helfen und die Zimmer rein machen. Das junge Mädchen, sie hieß Amanda, fiel der Mama auf die Nerven, denn sie war noch eckig und täppisch und hantierte etwas geräuschvoll. Auch hatte sie grobe Schuhe und einen schweren Schritt. Man hörte ihr »tapp, tapp, tapp« stets auf der Treppe.
Hilma hätte sich kaum um das Mädchen gekümmert; aber in den schweren Tagen der Krankheit ihres Sokrates hatte diese »Mande« sich für das Hündchen wirklich aufgeopfert. Ganz aus freiem Willen und aus gutem Herzen hatte sie das getan. Und Hilma hatte gemerkt, daß sie sich auf die Amanda verlassen konnte wie auf sich selbst.
Darum nahm sie jetzt gegen die Mama für die Mande Partei und fand die Mama sehr ungerecht.
Denn wenn die Amanda etwas zerschlagen oder sonst ein Versehen gemacht hatte, schalt die Mama und tat, als wäre es mit Absicht und aus bösem Willen geschehen. Immer tat und sagte die Mama das, was die Umkehrung der Wahrheit schien! Wußte sie denn nicht, was doch so klar am Tage lag, daß es natürlich ist, eine Tasse aus Versehen zu zerbrechen, aber sehr unwahrscheinlich, es mit Vorbedacht zu tun? –
Eines Tages fühlte Hilma sich gedrungen, der Amanda unter vier Augen eine Ehrenerklärung zu geben. Sie hatte sich auf dem Spaziergang, – den Miß Moore » constitutional walk« nannte, – nasse Füße geholt, und die Amanda mußte ihr die nassen, festklebenden Stiefel ausziehen.
»Du,« sagte Hilma, während das starkknochige, braune Bauernmädchen vor ihr am Boden kniete, »die Mama hat Dich gescholten wegen der Tasse, als hättest Du sie mit Fleiß zerschlagen. Ich weiß aber, Amanda, daß Du nichts dazu konntest.«
»Nee, gnä' Fräul'n, das Schelten hab ich verdient,« entgegnete die junge Amanda. »Ich muß eben besser aufpassen.«
Hilma wunderte sich über solche Demut. Sie selbst empörte sich immer und immer und haßte beinah diejenigen, die gering von ihr dachten.
Sie fragte: »Bist Du gar nicht böse, wenn man Dich ungerecht ausschilt?«
»Das darf ich doch gar nich, Fräul'n Hilma.«
Hilma sah nachdenklich auf die Amanda nieder und dann erklärte sie: »Wenn Du das kannst, dann hast Du die Macht des Gemüts, über schmerzhafte Vorstellungen Herr zu werden. Der Philosoph Kant sagt, Männer könnten das, Frauen aber nicht; aber Du kannst es doch.«
»Ach, gnä' Fräul'n,« entgegnete die Amanda treuherzig, »das versteh ich nicht. Ich bin doch bloß ein Bauernmädchen.«
»Ja, aber ein gutes!« seufzte Hilma.
Als mit den Sommerferien Horst wieder nach Zollbrück kam, mußte Hilma mit Schreck und Staunen erfahren, daß er ein anderer geworden war. Irgend welche ihr unbekannte Einflüsse seines jetzigen Lebens wirkten dahin, ihn ihr abwendig zu machen. Was im vorigen Jahr nur als bängliches Ahnen spukte, trat diesmal deutlich zutage.
Stumm und mit Worten lehnte der Bruder sich gegen sie auf. Er hatte den Glauben an ihre unbedingte Überlegenheit verloren. »Warum willst Du immer recht haben?« sagte er. »Die Erwachsenen kennen die Welt doch besser als Du.«
»Ich weiß, daß ich recht habe,« erklärte sie.
»Das kannst Du gar nicht wissen. Du bildest es Dir einfach ein.«
Ein andermal, als sie eine Äußerung der Mama ungerecht und sinnlos nannte, wurde Horst dunkelrot und sagte: »Über die Mama mußt Du nicht so sprechen. Ich mag's nicht.«
Sie entgegnete höchst befremdet: »Aber hast Du denn vergessen, wie es hier immer war?«
Worauf er antwortete: »Das ist ganz egal. Die Mama ist mal die Mama. Vor seiner Mutter muß man Respekt haben.«
Er wollte auch nicht mehr die gewohnten Spiele mit Hilma spielen.
»Nein, für diesen Unsinn sind wir jetzt wirklich zu groß,« sagte er.
Sie entgegnete: »Warum soll es denn Unsinn sein? Wir können doch mit Sinn spielen. Das liegt ja nur an uns.«
Aber er hatte keine Lust. »Du denkst Dir doch nur alles Mögliche aus, was nicht wahr ist, und dann sollen wir tun, als ob es Wirklichkeit sei. Dabei kommt ja doch gar nichts heraus.«
Sie dachte seinen Worten etwas nach und meinte dann: »Eigentlich tun die Erwachsenen auch nichts anderes; nur daß sie ihre Spiele immerfort spielen und niemals aufhören.«
Horst rief ärgerlich: »Ist das ein Blech!«
Ach, er war »verständig« geworden! Das hieß für Hilma: Er hatte sich der großen Verschwörung der Erwachsenen angeschlossen, Unwirkliches als wahr hinzustellen und das Unechte dem Echten vorzuziehen. Bewußte Fälscher schienen sie ihr alle miteinander.
Dafür waren die Erwachsenen jetzt mit ihm zufrieden. »Der Junge macht sich recht gut,« hörte Hilma den Onkel Gustav sagen. Und der Großpapa erklärte: »Der Horst wird. In dem kleinen Kerl steckt Utendorfsche Rasse.«
›O Himmel ja!‹ dachte Hilma. ›Das ist es: er ist kein Viernau, sondern ein Utendorf! Und niemals, niemals wieder werden wir uns ganz verstehen!‹
Am schmerzlichsten von allem empfand sie, daß er ihr seine Geheimnisse nicht mehr anvertraute. Sie konnte ihn nicht dazu bringen, ihr auch nur ein einziges Wort über seine Besuche beim Vater zu erzählen. Und doch glaubte sie aus seinem absoluten Schweigen über seine Ferienaufenthalte entnehmen zu können, daß er sowohl Weihnachten als auch Pfingsten und Ostern dort gewesen war.
Horst schwieg nicht, um seine Schwester zu kränken; er hatte sich nur das ganze Jahr lang seiner Plauderhaftigkeit geschämt und war entschlossen, sich ein zweites Mal durch kein Bitten und Flehen und durch keine Gewalt ein ihm anvertrautes Geheimnis entreißen zu lassen.
Einmal durfte Anita Mathis zum Besuch ins Herrenhaus kommen.
Auch sie war nur während der Sommerferien im Pfarrhaus, denn seit einem Jahr weilte sie in einem Töchterpensionat der französischen Schweiz.
Sie war jetzt fünfzehn Jahre alt und trug damenhafte Kleider, die fast bis auf die Füße reichten. Auch ihre Manieren hatten schon etwas Damenhaftes.
Ihr Gesicht mit den wunderzarten Farben erinnerte noch immer an Biskuitporzellan, ihre blonden Haare umrahmten immer noch glatt die reine Stirn, aber die Zöpfe hingen ihr nicht mehr auf den Rücken hinunter, sondern waren am Hinterkopf aufgesteckt. Ihr gesetztes Wesen bedrückte Hilma, die sich neben dieser Altersgenossin wirklich recht zurückgeblieben und zigeunerhaft vorkam.
Auch auf Horst machte Anita Eindruck. Seine Art, mit der Kindheitsgespielin zu verkehren, setzte Hilma in Erstaunen. Er sagte »Fräulein Anita« und »Sie«. Einmal sagte er sogar »gnädiges Fräulein«, aber danach wurden alle drei rot.
Als Anita fort war, erklärte Hilma: »Sie sieht niedlich aus, aber es ist gar nichts mit ihr anzufangen.«
Da meinte Horst verächtlich: »Du möchtest natürlich am liebsten mit ihr von den Mauern springen und auf die Bäume klettern.«
»Einerlei was,« entgegnete Hilma, »nur nicht so 'rumsitzen und dumme Redensarten machen.«
»Anita weiß sich zu benehmen,« sagte er anzüglich.
Hilma seufzte und schwieg. In diesem Augenblick fühlte sie sich dem Bruder so fern, daß ihr jedes weitere Wort verloren schien.
Sie war beinah froh, als die Ferien zu Ende gingen.
Im Herbst begann der Konfirmationsunterricht beim Herrn Kirchenrat Mathis, denn nächste Ostern sollte Hilma eingesegnet werden.
Sie war ganz ungläubig, was sie freilich geheim hielt. Aber sie erwartete in einer mystischen Weise durch den Konfirmandenunterricht überzeugt und gläubig gemacht zu werden.
Darum ging sie voll heimlicher Spannung, denn die Wandlung, die sich da an ihr vollziehen mußte, war gewiß etwas sehr Wunderbares!
Sie wurde enttäuscht!
Das Pfarrhaus, das sie nur betreten hatte, wenn sie einmal Anita hatte besuchen dürfen oder sollen, war ihr immer wie ein kleiner Märchenpalast erschienen, worin Frau Mathis, die Holländerin, als gute Zauberin waltete. Es gab gewiß in der ganzen Welt kein Haus, in dem alles bis aufs Tüpfelchen so glänzend sauber und so peinlich ordentlich und dabei so behaglich schön und fein war. Jedes Möbel, jedes Bild an der Wand, jeder Gebrauchsgegenstand war ein kostbares, sorgsam und liebevoll gehütetes Wertstück.
Anita hatte als kleines Mädchen erzählt, ihre Mutter wäre die einzige Erbtochter eines reichen Amsterdamer Kaufmannshauses gewesen, und in Holland wären die großen Kaufleute so angesehen wie Fürsten.
Das hatte den Herrenkindern imponiert. Und nie konnte Hilma die kleine unscheinbare Frau Mathis sehen, ohne an eine verkappte Fürstin zu denken.
Im Studierzimmer des Herrn Kirchenrats roch es nach ganz feinem holländischen Tabak.
In breiten Ledersesseln saßen sich Hilma und der würdige alte Herr gegenüber.
»Woher weiß man denn, daß gerade die Bibel Gottes Offenbarung ist?« fragte Hilma.
»Jesus Christus sagt im fünften Kapitel Mathäi, Vers 18: Bis daß Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Titel vom Gesetz, bis daß es alles geschehe. Seit 1900 Jahren nun fast ist noch nicht ein Titelchen aus der Heiligen Schrift vergangen.«
»Ich glaube aber, daß Jesus mit dem Gesetz nicht die Bibel gemeint hat, die doch erst halb geschrieben war, sondern das Naturgesetz,« sagte Hilma.
Nun schien das Wort »Naturgesetz« aber für den alten Kirchenrat ungefähr das zu sein, was für den Stier ein rotes Tuch ist. Er fing zu donnern an.
›Ach, ach!‹ dachte Hilma, mehr noch bekümmert als erschrocken, ›wenn ich widerspreche, wird er also böse! Er widerlegt mich nicht, sondern schilt auf die große Sünde des Unglaubens, und alle seine Behauptungen begründet er auf Bibelstellen. Dagegen kann ich nichts machen.‹
Sie schwieg von da ab zu seinem Vortrag, saß tief in dem bequemen Sessel und betrachtete die gepreßte Ledertapete und die altertümlichen Kupferstiche an den Wänden.
Oder sie dachte mit Verwunderung daran, daß Anita nie an den Worten ihrer Eltern gezweifelt hatte, vielmehr ihnen immer glaubte und gern und freudig gehorchte.
Stillschweigend protestierte sie aber weiter.
›Wie kann man denn alles glauben, was in der Bibel steht: daß die Erde mit allem darauf in sechs Tagen gemacht worden ist, statt in Millionen Jahren, und daß die Sonne still gestanden hat, statt um die Erde zu laufen, wo doch in Wahrheit die Sonne garnicht läuft? Wie ist es nur möglich, etwas so Widersinniges zu glauben!‹
Je näher der Palmsonntag rückte, desto beklommener fühlte sie sich in ihrer Glaubensunfähigkeit. Was sollte sie nur tun, um dem Gelübde, das sie nicht ablegen konnte, zu entrinnen.
Der Tauwind wehte. In Eile schmolz der letzte Schnee. Unter ihm kam junggrünes Gras zum Vorschein.
Hilma fand auf der Wiese hinter dem Hause die ersten Schneeglöckchen.
Sie sog entzückt den Duft des Sträußchens ein, das sie gepflückt hatte.
Plötzlich kam ihr ein Gedanke. Sie rannte ins Haus und brachte die Schneeglöckchen der Mama. So etwas hatte sie noch nie getan. Aber heute lag ihr alles daran, die Mama freundlich zu stimmen.
Das Zimmer der Mama war das zierlichste und hellste im ganzen Haus. Und die Mama selbst sah auch so fein und besonders aus in ihrem weichen schleppenden schwarzen Kleid. Man wagte sich kaum an sie heran.
Sie saß in ihrem Erker und malte Blumen auf hölzerne Fächer, die für einen Wohltätigkeits-Verkauf bestimmt waren.
Verwundert schaute sie auf Hilma.
»Schneeglöckchen schon? Und die bringst Du mir?«
Hilma hätte gar zu gerne jetzt irgend etwas Liebes, Zärtliches gesagt, aber zu viel Bitterkeit hatte sich in ihr aufgeschichtet gegen die kalte Mutter, – sie brachte kein Liebeswort über die Lippen.
Trotzdem schien die Mama erfreut. »Danke,« sagte sie und ordnete die weißen Glöckchen mit ihren schlanken Fingern in ein Kelchglas, in dem einige Treibhausblumen vor ihr auf dem Tische standen.
Hilmas Herz klopfte heftig; denn jetzt mußte sie das Schlimme zur Sprache bringen.
Sie beugte sich über die bemalten Fächer und sagte mit schüchterner Bewunderung: »Wie reizend das wird.«
»Du kannst es ja auch,« sagte die Mama. »Diese Begabung hast Du geerbt.«
»So hübsch wie Du kann ich's doch nicht.«
Die Mama malte schweigend weiter, ohne daß Hilmas Zuschauen sie zu stören schien.
Hilma aber stand in Angst und Aufregung und sagte zu sich selbst: ›Hab' ich denn den Mut verloren?‹
Das alte Losungswort tat noch seine Wirkung. Mit halb erstickter Stimme platzte sie heraus: »Ich muß Dir etwas gestehen! Etwas Ernsthaftes.«
Die Mama legte vorsichtig den Pinsel aus der Hand.
»Was gibt es denn mal wieder?« fragte sie.
»Ich kann mich nicht konfirmieren lassen.«
»Du bist nicht bei Sinnen,« sagte die Mama. »Und darf man vielleicht fragen, warum nicht?«
»Weil ich nicht gläubig bin.«
»Was glaubst Du nicht?«
»Was in der Bibel steht und was der Herr Kirchenrat sagt.«
Die Mama starrte das unglückliche Kind in bleichem Entsetzen an. Halb weinend sagte sie: »Etwas so Abscheuliches hat vor Dir ganz gewiß noch nie ein junges Mädchen ausgesprochen! Es ist unstatthaft, sündhaft und sinnlos. Laß mich davon nie wieder einen Ton hören! Nie wieder, verstehst Du?«
»Aber ich kann doch nicht in der Kirche lügen!« rief Hilma.
Die Mama sprang auf, als wollte sie fliehen. Sie blieb aber stehen, griff sich mit beiden Händen an den Kopf und fing an in einer krampfhaften Art zu weinen.
»Wär ich doch nur schon tot!« schluchzte sie.
Hilma war sehr erschrocken; denn wenn die Mutter mit diesem aufgeregten Weinen anfing, bekam sie immer ihre sogenannten Anfälle, die sie für Tage krank machten. Sie mußte die Kammerjungfer der Mama herbeirufen, die die Herrin in solchen Zuständen zu behandeln wußte und sie zu Bett brachte.
Traurig schlich Hilma fort.
Sie fürchtete sich auf das Mittagessen mit Onkel Gustav und dem Großpapa.
Dies wurde ihr indessen erspart. Miß Moore kam und meldete ihr, daß sie bis auf weiteres im Zimmer zu bleiben habe. Ihre Mahlzeiten würden ihr dorthin gebracht werden.
So blieb Hilma allein. Selbst Miß Moores Unterricht war fürs erste sistiert worden. Die junge Sünderin sollte Zeit zum Insichgehen haben.
Nur die Amanda ging ein und aus, brachte die Mahlzeiten und ordnete abends und morgens die Zimmer.
»Weißt Du, warum sie mich eingesperrt haben?« fragte Hilma einmal, da sie des Schweigens gründlich müde war.
Die Amanda schüttelte verneinend den Kopf.
»Glaubst Du an alles, was der Herr Kirchenrat sagt?«
»Das muß ich doch, gnä' Fräul'n, der Herr Kirchenrat weiß ja viel mehr, wie unsereins.«
»Glaubst Du wirklich, daß er selbst alles glaubt, was er sagt?«
»Der Herr Kirchenrat is gar gut, Fräul'n Hilma, das sagen alle Leute im Dorf. Mit jedem is er gut.«
»Findest Du mich sehr schlecht, weil ich nicht glauben kann?«
Die Amanda sagte: »Das is mal so: der Eine denkt sich's so rum und der Andere anders und wer nu recht hat, kann keins sagen. Ich mein immer, wenn's Herz nur gut is.«
»Meins ist nicht gut,« seufzte Hilma.
Dem widersprach die Amanda entschieden: »Das is nu nich wahr, Fräul'n Hilma. Daß Sie gut sind, daran glaub ich wie an den lieben Gott.«
»Du bist die Einzige, die das glaubt,« sagte Hilma.
Am dritten Morgen ihrer Zimmerhaft hielt man sie wohl für mürbe geworden, denn sie wurde zum Großvater gerufen.
Sie kam darüber in einen solchen Paroxysmus von Furcht und Grauen, daß sie sich der, ihr den Befehl überbringenden Miß Moore in die Arme warf und mit halb erstickter Stimme ausrief: »Ich kann nicht! Ich kann nicht!«
So ungefähr mußte einem Verbrecher zumute sein, der zur Hinrichtung abgeführt werden soll!
Miß Moore war grabesernst. Sie machte sich von der zitternden Hilma los und sagte: »Armes Kind, bitte Gott, daß er die falsche Furcht von Dir nimmt und Dir die rechte ins Herz gibt.«
Etwas in der Stimme der Engländerin machte, daß Hilma ihr ins Gesicht schaute: Miß Moore hatte ganz verweinte Augen!
Hilmas Stolz reckte sich. Nein, zu all der Schändlichkeit, die sie auf sich geladen hatte, wollte sie nicht noch feige sein!
Entschlossen trat sie den schweren Gang an.
Sobald man die Tür zu des Großvaters Zimmer öffnete, befand man sich einem ungeheuer großen Stahlstich gegenüber, der goldeingerahmt an der Wand hing.
Das Bild stellte eine Szene aus dem Brigantenleben der Abruzzen dar. Auf einem, von breitgehörnten, weißen Ochsen gezogenen Leiterwagen lag auf Stroh ein gefesselter Brigant. Neben ihm kniete ein Priester, der des Sterbenden Beichte anhörte. Bauern und andere gefangene Banditen knieten tief andächtig auf der Landstraße. Ehrerbietig wohnte auch die Eskorte berittener Karabinieri der feierlichen Handlung bei.
So oft Hilma noch diese Schwelle übertreten hatte, war ihre Phantasie durch dies Bild, auf dem sämtliche Figuren von idealisierter Schönheit waren, gefesselt worden.
Jetzt klammerte sich ihr Blick hülfesuchend an den sterbenden Briganten.
Der Großpapa saß an seinem Schreibtisch. Wunderschöne kostbare Gegenstände standen vor ihm: goldene Leuchter mit Löwenfüßen und geschliffenen Kristallklunkern, eine Barock-Uhr unter Glas, die einen goldenen Hirtenknaben auf einem Bronzefelsen darstellte, besonders aber Dinge aus seltsam schönem dunkelgrünem Stein, die der Großpapa einmal aus Rußland mitgebracht hatte.
Die herrliche Frühlingssonne lachte durch die Fenster. Ihre Strahlen fingen sich in den Kristallklunkern der Leuchter, und diese warfen sie als tanzende Regenbogenlichtflecke zurück auf die Wände.
Alles war hier so voll Pracht, und der Großvater hatte in seiner kalten Unbewegtheit etwas so Vernichtendes!
Ihr fiel ein, daß einmal, als der Sokrates noch lebte und im Zimmer unreinlich gewesen war, der Großpapa seine außerordentliche Nachsicht mit den Worten begründet hatte: »Ein so kleines Hündchen zu schlagen, ist wirklich keine Heldentat für einen Mann.«
Sie hätte ihm gerne gesagt: ›Ich bin auch nur ein kleines Hündchen neben Dir! Es ist keine Heldentat für Dich, mich zu mißhandeln.‹
Aber sie wagte nicht, sich zu regen, so sehr schüchterte er sie ein.
Endlich fing er in seiner kühlen gemessenen Art zu sprechen an.
»Mein Kind, Deine Mutter hat mir mitgeteilt, daß Du vorgestern eine Art Palastrevolution in Szene gesetzt hast.«
Er machte eine Pause, als erwartete er eine Entgegnung.
›Palastrevolution?‹ dachte sie. Was ist das: Palastrevolution!‹ Aber sie schwieg und starrte auf das Muster des Smyrnateppichs zu ihren Füßen.
Da fuhr er fort. »Ich bitte Dich, jetzt genau auf das zu achten, was ich sage: In Deinem Alter hat man nicht zu denken, sondern zu gehorchen. Ein kleines dummes Mädchen von noch nicht sechzehn Jahren hat noch kein Urteil. Was Du da geäußert hast, sind nicht Meinungen, sondern Ungezogenheiten, die Strafe verdienen. Noch bist Du selbst nicht verantwortlich, sondern wir Erwachsenen sind es für Dich. Du hast nur eine Überzeugung zu haben: daß Du uns gehorchen mußt. Ein Urteil über Wahrheit oder Irrtum der Lehre, in der Du unterwiesen wirst, steht Dir nicht zu, denn es liegt völlig außerhalb Deiner Kapazität. Über das Dir Zuträgliche zu entscheiden, wirst Du also gefälligst uns überlassen.«
Sie hatte mit niedergeschlagenen Augen vor dem alten Herrn gestanden, nicht aufzuschauen gewagt. Jedes seiner strengen Worte traf ihren Stolz wie ein Peitschenhieb. Nichts als kindische Unart und lächerliche Anmaßung sah er in dem Bekenntnis, das sie sich aus Gewissensnot abgerungen hatte!
Zuletzt hatte die Entrüstung doch die Angst überwunden, sie sah leidenschaftlich auf und wollte etwas entgegnen.
Aber der Großvater wies sie mit herrischer Geberde zur Ruhe.
»Bitte, keine weiteren Szenen! Wir haben genug davon. Widerspruch gibt es nicht. Tu, was man Dir sagt, und sage, was man Dich zu sagen lehrt. Die Verantwortung dafür überlaß uns. Und damit basta! Kommt mir noch eine einzige Widersetzlichkeit zu Ohren, so schicke ich Dich auf der Stelle und ohne Gnade in ein Korrektionshaus, das ist eine Anstalt, wo unbotmäßige Kinder auf nicht sehr glimpfliche Weise dazu gebracht werden, parieren zu lernen. So! Du weißt jetzt, woran du bist, und kannst gehen.«
So oft später noch Hilma dieser Viertelstunde gedachte, lief ihr etwas kalt über den Rücken.
Ihr Bekennermut war gebrochen. Sie fühlte ein namenloses Grauen bei dem Gedanken, als Sträfling verschickt zu werden. Still wie ein Lamm ließ sie alles über sich ergehen.
Übrigens war niemand weiter hart mit ihr, man behandelte sie vielmehr mit freundlicher Schonung, fast als sei sie eben von einer schweren Erkrankung genesen, nach welcher ein Rückfall sorgfältig vermieden werden mußte.
Und dann erhielt sie ein schwarzseidenes Kleid, welches raschelte wie Mamas Taftröcke und so lang war, daß es beim Ausschreiten gegen die Füße schlug, so daß sie behutsame kleine damenhafte Schritte machen mußte.
Und der Großpapa schenkte ihr eine winzig kleine reizende goldene Uhr.
Als dann der alte Herr Kirchenrat am Altar vor der versammelten Dorfgemeinde laut für das Seelenheil seiner Konfirmandin betete, wurde er so bewegt, daß die Stimme ihm vor aufsteigenden Tränen mehrmals versagte.
Da fingen sämtliche Weiber zu weinen an, so daß ein Chor von Schneuzen und Schnüffeln das Kirchenschiff erfüllte, und auch Hilma mußte weinen.
Sodann gab ihr der geistliche Herr diesen Einsegnungsspruch:
»Desselbigen gleichen, ihr Jungen, seid untertan den Ältesten. Allesamt seid untereinander untertan, und haltet fest an der Demut. Denn Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.« 1. Petri 5, 5.