
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Unter allen bekannten Fischen sehen wir die Stachelflosser als die vollkommensten an, weil sie die regelmäßigste, das heißt von dem allgemeinen Gepräge am wenigsten abweichende Gestalt und Gliederung zeigen und nur ausnahmsweise über diese Ebenmäßigkeit hinausgehen. Sie sind mittelgroß, selten mehr als zwei Meter lang, meist kleiner, stets mit Schuppen bekleidet und gewöhnlich lebhaft gefärbt, ihre Kiemen kammförmig, die vorderen Strahlen der Rückenflosse oder da, wo deren zwei vorhanden, die der ersten ungegliedert, zuweilen frei, stachelartig, die Brustflossen in der Regel vor die Bauchflossen eingelenkt, diese da, wo sie ausgebildet, ebenfalls mit einem Stachelstrahle bewehrt, während solche Gebilde in der Afterflosse gewöhnlich in größerer Anzahl auftreten. Die Beschuppung pflegt rauh zu sein; bei den meisten zeigen die Schuppen gezähnelte oder gekämmte Hinterränder. Eine Schwimmblase ist regelmäßig vorhanden.
Weitaus der größte Teil aller Stachelflosser bewohnt die Meere, insbesondere die unter den niederen Breiten gelegenen, woselbst die Ordnung ihren größten Gestaltenreichtum aufweist; doch fehlt es auch den süßen Gewässern nicht an Mitgliedern unserer Ordnung; gerade von unsern Flußfischen gehören mehrere zum Teil sehr ausgezeichnete Arten ihr an. Alle ohne Ausnahme sind Räuber, viele äußerst gefräßige und mordgierige Geschöpfe, mehrere demungeachtet geschätzte Tafelfische.
Einem unserer häufigsten Flußfische zu Ehren hat man die an Sippen und Arten reiche erste Familie der Ordnung Barsche ( Percidae) genannt. Gemeinschaftliche Merkmale aller hierher gehörigen Fische sind länglicher, stark zusammengedrückter Leib, der gewöhnlich mit harten Kammschuppen bekleidet wird, gezähnelte oder gedornte Kiemendeckelstücke und Zähne in beiden Zwischenkiefern, dem Unterkiefer, dem mittleren, an der Gaumendecke gelegenen Pflugscharbeine und den beiden seitlichen Gaumenbeinen, eine weite Kiemenspalte und sieben Kiemenstrahlen jederseits. Die unter den Brustflossen stehenden Bauchflossen, die weite Mundspalte, der kurze, wenig gewundene Verdauungsschlauch, dessen sackförmiger Magen am Pförtner nur drei bis sechs kurze, schlauchförmige Blinddärme trägt, tragen zur Kennzeichnung dieser Fische noch anderweitig bei. Alle Meere und die meisten Flüsse und Süßwasserbecken der Alten und Neuen Welt beherbergen einzelne Mitglieder unserer Familie. Die Arten zeichnen sich ebensowohl durch die Schönheit ihrer Färbung wie durch ihre Beweglichkeit und Raubsucht aus.
Der Barsch, auch Fluß- oder Buntbarsch genannt ( Perca fluviatilis), vertritt die gleichnamige, über die Alte und Neue Welt verbreitete Sippe ( Perca) und kennzeichnet sich durch zwei mehr oder weniger einander genäherte, auch wohl durch eine niedere Haut verbundene Rückenflossen, den gezähnelten Vordeckel und gedornten Hauptdeckel der Kiemen sowie die vielen kleinen, dichtstehenden, sogenannten Bürstenzähne, die das Maul besetzen. Sein gedrungener Leib ist seitlich zusammengedrückt und auf messinggelbem oder grünlichem, an den Seiten ins Goldgelbe, auf dem Bauche ins Weißliche spielendem, auf dem Rücken dunkelndem Grunde mit fünf bis neun Querbinden gezeichnet, die von der Rückenseite gegen den Bauch herablaufen, ungleich an Länge und Stärke sind und oft auch nur durch schwärzliche verwaschene Flecke angedeutet werden. Die erste Rückenflosse ist bläulichrotgrau und zeigt zwischen den zwei letzten Strahlen einen dunkleren Augenfleck; die zweite Rückenflosse sieht grünlichgelb aus; die Brustflossen sind gelbrot, die Bauch- und Afterflosse mennig- oder zinnoberrot. Männchen und Weibchen lassen sich mit Bestimmtheit nicht unterscheiden. Die Länge übersteigt bei uns selten fünfundzwanzig Zentimeter, das Gewicht ein Kilogramm; doch kommen in gewissen Seen Stücke von anderthalb bis zwei Kilogramm Gewicht vor.
Das Verbreitungsgebiet des Flußbarsches dehnt sich über ganz Europa und einen großen Teil von Nordasien aus. Laut Yarrell soll er in Schottland selten sein und auf den Orkney- und Shetlandinseln gänzlich fehlen; auf der Skandinavischen Halbinsel dagegen bewohnt er alle süßen Gewässer, auch solche, die viel nördlicher liegen als gedachte Inseln. In Deutschland kommt er, mit Ausnahme der höher gelegenen Gebirgswässer und einzelner Gegenden der Tiefebene, in allen geeigneten Flüssen und Seen vor, tritt gewöhnlich auch häufig auf; in den Alpen meidet er fast nur die mehr als tausend Meter über dem Meere gelegenen Gewässer. Seen mit klarem Wasser bilden seinen Lieblingsaufenthalt, und in ihnen gedeiht er am besten; doch fehlt er auch Flüssen oder tiefen Bächen oder Teichen, Brackwässern und selbst schwachsalzigen Meeren, wie der Ostsee, nicht, scheint sich im Gegenteil hier sehr wohl zu befinden, zeichnet sich wenigstens in der Regel durch bedeutende Größe und fettes, schmackhafteres Fleisch vor andern seinesgleichen, die im süßen Wasser gefischt wurden, vorteilhaft aus.
In den Flüssen bevorzugt er die Uferseiten und die Stellen mit geringerem Strome der Mitte und dem lebhaften Strome, in den Seen die oberen Schichten des Wassers, ist jedoch ebensowohl fähig, in größere Tiefen hinabzusteigen, und wird aus solchen nicht selten heraufgefischt, läßt auch an untrüglichen Merkmalen erkennen, daß er hier längere Zeit zugebracht. »Es ist«, sagt schon Geßner, »die sag der Fischer vmb den Genffersee, daß die Eglin winterszeit, so sie in ein Garn gezogen, ein rotes bläterlin zum Maul außhencken, das sie mit gewalt bezwingt, oben in dem Wasser empor zu schwimmen, vermeynen es geschehe jnen von Zorn.« Siebold hat die Wahrnehmung jener Fischer bestätigt. »An allen solchen aus großen Tiefen des Bodensees bei dem Kilchenfang mit heraufgezogenen Barschen«, berichtet er, »sah ich die Rachenhöhle mit einem sonderbaren, einer geschwollenen Zunge ähnlichen Körper ausgefüllt, der bei einigen sich sogar aus dem Munde hervordrängte. Bei näherer Untersuchung überzeugte ich mich, daß dieser pralle, kegelförmige Körper der nach außen umgestülpte Magen dieser Raubfische war. Durch Öffnen der Leibeshöhle überzeugte ich mich ferner, daß die Wandungen der Schwimmblase durch die beim Heraufziehen der Barsche aus einer Tiefe von dreißig bis vierzig Klaftern stark ausgedehnte Luft von innen nach außen zu stark gespannt und zuletzt geborsten waren, wodurch die in die Bauchhöhle ausgetretene Luft Gelegenheit fand, den Magensack nach der Mundhöhle hinaus umzustülpen.«
Gewöhnlich findet man den Barsch zu kleinen Trupps vereinigt, die gesellig miteinander schwimmen und, wie es scheint, auch gemeinschaftlich rauben. In den oberen Wasserschichten schwimmt er sehr schnell, jedoch nur stoßweise, hält plötzlich an und verweilt geraume Zeit auf einer und derselben Stelle, um von dieser aus von neuem dahinzuschießen. In Höhlungen des Ufers, unter überhängenden Steinen und an ähnlichen Versteckplätzen sieht man ihn zuweilen mehrere Minuten lang offenbar auf der Lauer liegen, da er, gestört, gern zu demselben Platze zurückkehrt. Naht sich ein Schwarm kleinerer Fischchen, so stürzt er sich mit Blitzesschnelle auf sie zu und bemächtigt sich ihrer, entweder im ersten Anlaufe oder nach längerer Verfolgung. »Die in zahlreichen Scharen unter der Oberfläche des Wassers ruhig dahinschwimmenden Lauben«, sagt Siebold, »werden oft durch solche Überfälle des Barsches in Schrecken und Verwirrung gesetzt, wobei manche dem gierigen Rachen des Räubers durch einen Luftsprung zu entweichen suchen. Aber die Raubgier des Barsches wird auch zuweilen bestraft, indem derselbe bei dem zu hastigen Verschlingen der Beute das Unglück hat, den erhaschten Fisch von dem weit geöffneten Rachen aus in eine der seitlichen Kiemenspalten hineinzudrängen, in der derselbe steckenbleibt und mit dem Räuber zugleich stirbt.« Ebenso geschieht es, laut Bloch, daß er, unvorsichtig genug, einen Stichling überfällt, und daß dieser ihn durch seine aufgerichteten Rückenstacheln tödlich verwundet. Außer von kleineren Fischen nährt sich der Barsch von allen andern Wassertieren, die er bezwingen zu können glaubt, in der Jugend von Würmern und Kerbtierlarven, später von Krebsen und Lurchen, zuletzt sogar von kleinen Säugetieren, Wasserratten z.B. Seine Raublust und Freßgier ist so groß, daß sie ihm den Namen »Anbeiß« verschafft hat, weil er nach jedem Köder schnappt, auch nicht durch den vor seinen Augen geschehenden Fang seiner Kameraden gewitzigt wird. Gefangene und in ein Wasserbecken gebrachte Barsche nehmen schon wenige Tage später Würmer aus der Hand ihres Pflegers und werden bald bis zu einem gewissen Grade zahm.
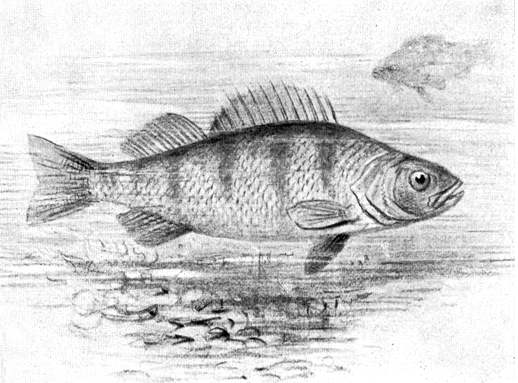
Flußbarsch ( Perca fluviatilis)
Im dritten Jahre seines Alters wird der Barsch fortpflanzungsfähig. Er hat dann ungefähr fünfzehn Zentimeter an Länge erreicht. Seine Laichzeit, die je nach der Lage des Wohngewässers, dessen Wärmehaltigkeit und ebenso nach der herrschenden Witterung einigermaßen schwanken kann, fällt in der Regel in die Monate März, April und Mai; einzelne laichen vielleicht auch schon im Februar, andere noch im Juni oder Juli. Die Rogener suchen sich zum Laichen harte Gegenstände, Steine, Holzstücke oder auch Rohr aus, um an ihnen den Laich auszupressen und die Eier an gedachten Gegenständen anzuhängen. Der Laich geht in Schnüren ab, die netzartig untereinander verklebt und oft einen bis zwei Meter lang sind. Die Eier haben die Größe von Mohnsamen; trotzdem wiegt der Rogen größerer Weibchen von einem Kilogramm Gewicht zweihundert Gramm und darüber, und die Anzahl der Eier beträgt dann gegen ein- bis zweihunderttausend. Wasservögel und Fische fressen viele von ihnen. Hierin sind die Gründe zu suchen, daß der Barsch sich nicht in ungleich größerer Menge vermehrt, als es wirklich der Fall.
Außer dem Hechte hat der Barsch noch im Fischotter, dem Fischadler, in Reihern und Störchen, auch wohl in Lachsen und anderen Raubfischen gefährliche Feinde. Kaum weniger verderblich wird ihm ein kleines Krustentier, eine sogenannte Fischlaus, die sich in dem zarten Gewebe seiner Kiemen einnistet und diese schließlich zerstört.
Alle angehenden Angler haben an dem Barsche ihre wahre Freude, weil er es ist, der auch ihre Ungeschicktheit oft mit Erfolg krönt. Wo er häufig vorkommt, kann man mit der Angel guten Fang tun; in beträchtlicherer Anzahl erbeutet man ihn mit einem nach ihm benannten Netze oder größeren Garne. Weil er außerhalb des Wassers längere Zeit ausdauert, läßt er sich weit versenden, falls er unterwegs von Zeit zu Zeit einmal eingetaucht wird; auch hält er sich Tage und Wochen im engen Fischkasten, gehört also zu den für die Fischer handlichsten seiner Klasse.
*
»Dieser frembder, teutscher Fisch ist mit dem Kopff gleich einem Hecht, vnd mit dem andern Leib vnd Gestalt einem Eglin.« Mit diesen Worten beginnt der alte Geßner seine Beschreibung des Zanders, eines unserer ausgezeichnetsten Süßwasserfische, und rechtfertigt damit die von ihm aufgestellte wissenschaftliche Benennung Hechtbarsch ( Lucioperca), die noch gegenwärtig zur Bezeichnung der Sippe gilt. Außer der gestreckten Gestalt kennzeichnen sich die hierher gehörigen Fische durch zwei getrennte Rückenflossen, einfach gezähnelten vorderen Kiemendeckel und die langen, spitzigen Zähne, die neben seinen Bürsten- und Samtzähnen die Kiefer- und Gaumenbeine besetzen.
Der Zander, auch Sander, Sandel genannt ( Lucioperca sandra), erreicht eine Länge von einhundert bis einhundertdreißig Zentimeter, ein Gewicht von zwölf bis fünfzehn Kilogramm und ist auf dem Rücken grünlichgrau, gegen den Bauch hin silberweiß gefärbt und auf der Oberseite, also vom Rücken nach den Seiten zu, streifig braun gewölkt, zuweilen auch wirklich dunkel gebändert, auf den Kopfseiten braun gemarmelt, auf den Häuten, die die Strahlen der Flossen verbinden, schwärzlich gefleckt.
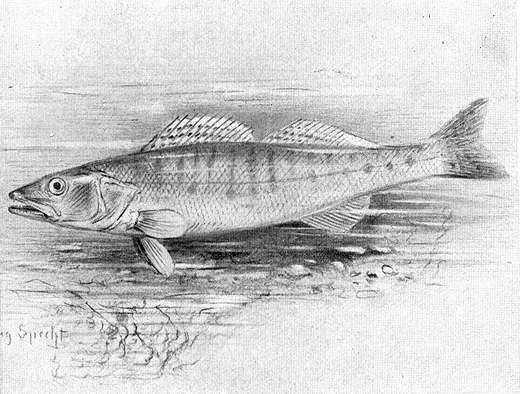
Zander ( Lucioperco sandra)
Der Zander bewohnt die Ströme und größeren Flüsse Nordost- und Mitteleuropas, in Norddeutschland die Elbe-, Oder- und Weichselgebiete und die benachbarten Seen, in Süddeutschland die Donau, fehlt dagegen dem Rhein- und Wesergebiete und ebenso ganz Westeuropa, meidet auch innerhalb seines Verbreitungsgebietes alle schnellfließenden Flüßchen. In den südrussischen Strömen, namentlich der Wolga und dem Dnjestr, wird er durch einen, artlich vielleicht nicht einmal verschiedenen, Verwandten, den Berschik der Russen ( Lucioperca wolgensis), vertreten. Er liebt tiefe, reine, fließende Gewässer, hält sich auch meist in den unteren Wasserschichten auf und erscheint nur während seiner Laichzeit, die zwischen die Monate April und Juni fällt, auf seichteren, mit Wasserpflanzen bewachsenen Uferstellen, um hier seine Eier abzusetzen. Als ein außerordentlich raubgieriger Fisch, der alle kleineren Klassenverwandten gefährdet und seine eigene Brut ebensowenig verschont als andere ihm erreichbare Beute, wächst er ungemein schnell und erreicht, laut Heckel, bei hohem Wasserstande, wenn er sich im Riede aufhalten kann, im ersten Jahre bereits ein Gewicht von dreiviertel, im zweiten ein solches von einem Kilogramm, wogegen er bei niederem Wasser in der Donau selbst im ersten Jahre wesentlich hinter diesem Gewichte zurückbleibt. Seine Vermehrung ist bedeutend. Bloch zählte schon in einem anderthalb Kilogramm schweren Rogener gegen vierzigtausend Eier.
Das Fleisch ist am besten und fettesten vor der Laichzeit, also im Herbste und Winter, muß aber frisch zubereitet werden, weil es geräuchert oder gesalzen sehr an Schmackhaftigkeit verliert.
*
Von dem Flußbarsche und seinen Verwandten unterscheiden sich die Wolfsbarsche ( Labrax) durch etwas gestrecktere Gestalt, kleinere Schuppen, Beschuppung des hinten mit zwei Dornen bewehrten Kiemendeckels, weiter voneinanderstehende Rückenflossen und rauhe Zunge.
Als Vertreter dieser Sippe gilt der Seebarsch ( Labrax lupus), ein schon den Alten wohlbekannter, im Mittelmeere und dem Atlantischen Weltmeere, auch an Englands Küsten vorkommender Fisch von einem halben bis ein Meter Länge und bis zehn Kilogramm Gewicht. Die Färbung ist ein schönes Silbergrau, das auf dem Rücken ins Bläuliche, auf dem Bauche ins Weißliche übergeht; die Flossen sehen blaßbraun aus.
Aristoteles führt den Seebarsch unter dem Namen Labrax, Plinius unter dem Namen Lupus auf. Beide Forscher rühmen ihn mit vollstem Rechte wegen seines kostbaren Fleisches.
Nach Yarrell kommt der Seebarsch an allen südlichen Küsten Englands und ebenso im Bristol- und St.-Georges-Kanal vor, wird auch zuweilen weiter nördlich gefangen. An den irischen Küsten gehört er zu den bekannteren Fischen und wird gelegentlich in zahlreicher Menge in den für die Lachse und Verwandte ausgestellten Netzen erbeutet. Er hält sich gewöhnlich in der Nähe der Küsten auf, seichtes Wasser dem tieferen vorziehend, schwimmt auch oft in die Mündungen der Flüsse und steigt dann in diesen bis zu einer ansehnlichen Entfernung empor. Krebse, Würmer und kleine Fische bilden seine Beute. Wegen der ersteren schwimmt er bei heftigen Stürmen bis dicht an die Küste heran, weil dann durch die brandenden Wogen viele von den Krustern losgerissen und ihm zugeführt werden. Seine Laichzeit fällt in den Hochsommer.
Da der Seebarsch an Gefräßigkeit hinter seinen Verwandten nicht nachsteht, wird auch er leicht mit der Angel gefangen, wendet aber wirklich, wie schon die Römer erzählten, alle Kräfte an, um zu entkommen, schwimmt mit erstaunlicher Kraft hin und her und zwingt den Fänger, alle Kunstfertigkeit aufzubieten, um seiner sich zu versichern.
*
Bei den Schrollen ( Acerina) sind beide Rückenflossen verschmolzen, die Vor- und Hauptdeckel der Kiemen mit Stacheln besetzt, Brust und Bauch mehr oder weniger schuppenlos.
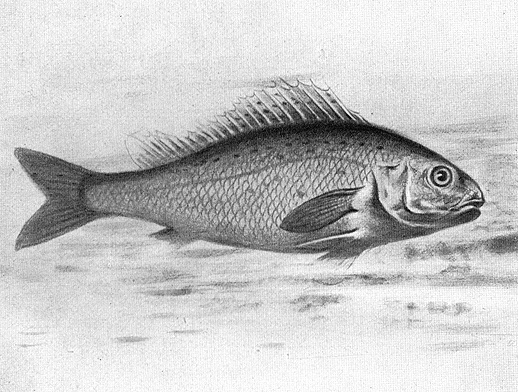
Kaulbarsch ( Acerina cernua)
Der allbekannte Vertreter dieser Gruppe, der Kaulbarsch, auch Goldbarsch genannt ( Acerina cernua), erreicht eine Länge von zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter und ein Gewicht von einhundertzwanzig bis einhundertfünfzig Gramm, hat einen kurzen, gedrungenen Leib, eine stumpfe Schnauze und ist auf dem Rücken und den Seiten olivengrün, durch unregelmäßig zerstreute dunklere Flecke und Punkte, auf Rücken und Schwanzflossen durch in Reihen geordnete Punkte gezeichnet.
Eine zweite, in der Lebensweise mit dem Kaulbarsch übereinstimmende, jedoch auf das Donaugebiet beschränkte Art, der Schrätzer ( Acerina schraetser), unterscheidet sich durch seinen langgestreckten Leib, die verlängerte Schnauze und die fast die ganze Länge des Rückens einnehmende Flosse wie durch die zitrongelbe Grundfarbe der Seiten, längs derer drei bis vier schwärzliche Linien verlaufen. In der Größe übertrifft der Schrätzer oder Schratzen seinen Verwandten um ein beträchtliches. Das Gewicht kann zweihundertfünfzig Gramm betragen.
Der Kaulbarsch verbreitet sich über Mittel-, West- und Nordeuropa, kommt auch, und zwar überaus häufig, in Sibirien vor. In Deutschland fehlt er keinem größeren Flusse oder süßen Gewässer überhaupt; nur den Oberrhein bewohnt er nicht, weil ihm der Rheinfall stromaufwärts eine Grenze setzt: auch in andern Alpengewässern ist er selten. Seine Lebensweise ähnelt der des Flußbarsches. Er zieht klare, tiefe Seen den fließenden, seichteren Gewässern vor, besucht aber letztere während der Laichzeit im April und Mai und wandert dann gewöhnlich truppweise, während er sich sonst mehr einzeln hält. In den Flüssen und Bächen verweilt er bis gegen den Herbst hin; zum Aufenthalt im Winter aber wählt er sich tiefere Gewässer und kehrt deshalb gewöhnlich wieder zu seinen Seen zurück. Seine Nahrung besteht aus kleinen Fischen, Würmern und Kerfen; nach der Angabe eines erfahrenen Fischers, die Heckel und Kner zu der ihrigen machen, frißt er übrigens auch Gras und Ried.
Den Fang betreibt man mit einer durch Regenwürmer geköderten Angel und mit feinmaschigen Netzen, in der Regel während des Sommers, in gewissen Seen jedoch umgekehrt vorzugsweise im Winter. So erzählt Klein, daß man einmal im Frischen Haff bei Danzig unter dem Eise ungemein viele Kaulbarsche und kleine Lachse gefangen und siebenhundertundachtzig Tonnen mit ihnen angefüllt habe. Die Eigentümlichkeit des Kaulbarsches, durch lautes Geräusch sich herbeilocken zu lassen, wird, laut Beerbohm, von den Fischern des Kurischen Haffs zu seinem Fange verwertet, indem man zuerst eine gewisse Anzahl von Stecknetzen in verschiedener Richtung aussteckt und sodann in der Nähe der Netze mittels einer langen, bis auf den Grund herabreichenden Stange, an der an einem Gestelle mehrere eiserne Ringe befestigt sind, möglichst starkes Geräusch verursacht. Auf dieses hin sollen die Kaulbarsche in so großer Menge herbeikommen, daß zuweilen fast in jeder Masche der Netze einer von ihnen gefangen wird. Das Fleisch steht nicht hoch im Preise, wird jedoch geschätzt.
Der Kaulbarsch empfiehlt sich für die Teichwirtschaft. Seine Vermehrung ist zwar nicht sehr bedeutend und sein Wachstum langsam? seine Genügsamkeit, Unschädlichkeit und Zählebigkeit machen ihn trotzdem für die Zucht in hohem Grade geeignet.
*
Alle Meere des heißen und gemäßigten Gürtels beider Halbkugeln beherbergen schön gestaltete Fische, die man Seebarben ( Mullidae) genannt hat. Ihr nur wenig zusammengedrückter Leib ist länglich, im Schnauzenteile gestreckt, das weit unten liegende Maul klein, das Gebiß verschieden, gewöhnlich schwachzahnig, das Kinn mit zwei mehr oder weniger langen Bartfäden ausgestattet, der vordere Teil des Kopfes wie die Kehle nackt, der übrige Kopf wie der ganze Leib mit großen, fein gezähnelten Schuppen bekleidet, der Vorderdeckel der Kiemen ganzrandig, der hintere mit einem Deckelchen versehen, die vordere Rückenflosse in einer Furche eingelassen und durch stachelige, die hintere dagegen durch weichere Strahlen geschützt, die Afterflosse letzterer ähnlich gestaltet, die gegabelte, fünfzehnstrahlige Schwanzflosse weit nach hinten beschuppt, die Bauchflosse weit vorgerückt, so daß sie fast unter die Brustflosse zu liegen kommt, die vorherrschende Färbung ein schönes mattes Kaminrot.
Die Seebarben, höchst gesellige Fische, treten stets in zahlreichen Scharen, gewöhnlich Schwärmen von mehreren tausenden, auf, streichen wenig umher, besuchen aber im Hochsommer flache, sandige Stellen der Küste, oft in zahlloser Menge, um hier zu laichen. Ihre Nahrung, die aus kleinen Krebs- und Weichtieren wie aus verwesenden Stoffen des Tier- und Pflanzenreiches zu bestehen scheint, erwerben sie sich durch Gründeln im Schlamme, halten sich dabei in wagerechter Lage, wühlen sich oft tief ein und trüben das Wasser flacher Stellen auf weithin. Viele Raubfische gefährden die durchschnittlich kleinen Tiere und ziehen deren Schwärmen wochenlang nach; auch der Mensch verfolgt sie allenthalben und erbeutet sie massenhaft in engmaschigen Netzen. Ihr Fleisch wird sehr geschätzt und höchstens kurz nach der Laichzeit minder geachtet. Bei den alten Römern standen die Seebarben nicht allein ihres köstlichen Fleisches, sondern auch ihrer prachtvollen Färbung halber im höchsten Ansehen. Nach ihrem Urteile galt die Seebarbe als der beste aller Fische und Kopf und Leber als der feinste aller Leckerbissen.
Die Rotbarben ( Mullus) kennzeichnen sich als diejenigen Arten, die die Alten so hoch schätzten. In den europäischen Meeren kommen zwei Arten dieser Sippe vor, der Rotbart und die Streifenbarbe. Erstere ( Mullus barbatus) zeichnet sich durch die fast senkrecht abfallende Stirn und die verhältnismäßig schmalen Schuppen aus, erreicht eine Länge von dreißig bis vierzig Zentimeter und ist gleichmäßig kaminrot gefärbt, überall an der untern Seite silbern schillernd; die Flossen sehen gelb aus. Die Streifenbarbe ( Mullus surmuletus) hat ungefähr dieselbe Größe, ist mit großen Schuppen bekleidet und auf schön blaßrotem Grunde mit drei goldenen, zur Laichzeit besonders deutlichen Streifen gezeichnet; die Flossen sehen rot, die Bauch- und Schwanzflossen rotgelblich aus, tragen auch gewöhnlich zwei gelbe oder braune Binden.
Der Rotbart gehört dem Mittelmeere an und bewohnt hier alle Stellen, wo lehmartiger oder schlammiger Boden vorkommt, findet sich auch längs der französischen Küste im Weltmeere, wird aber nur selten in der Nähe Großbritanniens gefangen; die Streifenbarbe hingegen, die ebenfalls im Mittelmeere lebt und hier und da noch häufiger als ihre Verwandte vorkommt, verbreitet sich von hier aus nach Norden hin bis Großbritannien und tritt an den englischen Küsten bisweilen in bedeutender, Anzahl auf. Nach Yarrell trifft man sie in den verschiedensten Schichten des Wassers an. Viele werden in Makrelennetzen in der Nähe der Oberfläche gefangen, obgleich die meisten aus bedeutenden Tiefen emporgezogen werden müssen. In Cornwall nähert sie sich, laut Couch, während des Sommers den Küsten in Menge, zieht sich jedoch mit Beginn des Winters in größere Tiefen zurück und wird dann nur selten gefangen. Ihre Laichzeit fällt in den Frühling; zwölf Zentimeter lange Junge trifft man Ende Oktober an. Die Nahrung scheint aus weichen Krebsen und verschiedenen Weichtieren zu bestehen, zu deren Aufspürung die Bartfäden wahrscheinlich gute Dienste leisten mögen. »Der Rotbart«, versichert Oppian, »frißt gern alles, was im Meere fault und stinkt, namentlich auch die Leichen derer, die bei Schiffbrüchen umgekommen sind. Daher fängt man ihn mit fauligen Ködern und vergleicht ihn mit Recht mit dem Schwein, das wie er von ekelhaften Dingen lebt und dennoch vortreffliches Fleisch liefert.«
*
Brassen ( Sparidae) nennt man eine artenreiche Familie von Seefischen, deren Merkmale die folgenden sind. Der Leib ist länglich, seitlich stark zusammengedrückt, auf der Schnauze und an den Kiefern nackt, übrigens mit ziemlich großen, am hintern Rande gezähnelten Schuppen bekleidet, deren Wachstumslinien dem oberen und unteren Rande in schräger Richtung zulaufen. Am Kiemendeckel findet sich nur ein schuppenartiger, meist stumpfer Ecknagel. Die einzige Rückenflosse erhebt sich aus einer Furche; die Brustflosse ist spitzig, die Schwanzflosse gabelig. Die Brassen verbreiten sich fast über alle Meere, und manche Arten treten hier oder da in sehr großer Anzahl auf. Sie nähren sich von Muschel- und Krustentieren oder Meerpflanzen; einige stellen wohl auch kleinen Fischen nach. Das Fleisch mehrerer Arten wird hochgeschätzt.
Bei den Goldbrassen ( Chrysophrys) sind die Vorderzähne kegelförmig, in jeder Kinnlade zu vier bis sechs gestellt, wogegen die hintern Mahlzähne wenigstens drei Reihen bilden und eine abgerundete Spitze haben. Vertreter dieser Sippe ist die Goldbrasse ( Chrysophrys aurata), ein Fisch von dreißig bis vierzig, ausnahmsweise auch sechzig Zentimeter Länge und vier bis acht Kilogramm Gewicht, prachtvoller Färbung und zierlicher Zeichnung. Ein ins Grünliche schimmerndes Silbergrau, das auf dem Rücken dunkelt und auf der Bauchseite ins Silberglänzende übergeht, bildet die Grundfärbung; ein länglicher, runder, senkrecht stehender Goldfleck schmückt den Kiemendeckel, eine goldgelbe Binde die Stirngegend zwischen den Augen; achtzehn bis zwanzig Längsbänder von gleicher Färbung zieren die Seiten; die Rückenflosse ist bläulich, oben, in der Nähe der Stachelspitzen, braun längsgestreift, die Afterflosse bläulich, die Schwanzflosse schwarz; Brust- und Bauchflossen sehen veilchenfarben aus.
An allen Küsten des Mittelmeeres und an der afrikanischen Küste des Atlantischen Weltmeeres von Gibraltar bis zum Vorgebirge der Guten Hoffnung gehört die Goldbrasse zu den gewöhnlichen Erscheinungen; weiter nach Norden hin zeigt sie sich seltener, obwohl mehrere Fälle bekannt sind, daß sie in England vorgekommen. Nach Rondelet verläßt sie die Küste nicht, drängt sich im Gegenteile oft in die mit ihr zusammenhängenden Salzsümpfe ein und feistet sich hier in kurzer Zeit. Duhamel erzählt, daß sie den Sand an seichten Stellen mit dem Schwanze aufregt, um die in ihm verborgenen Muscheln auszugraben. Nach letzteren ist sie außerordentlich begierig und verursacht beim Zerbrechen derselben ein den Fischern bemerkliches Geräusch. Gefangene, die ich einige Jahre pflegte, haben mir die Richtigkeit vorstehender Angabe tagtäglich bewiesen. Sie fraßen zwar auch Würmer und andere wirbellose Tiere, mit unverkennbarer Vorliebe jedoch Muscheln, namentlich Miesmuscheln. Geschickt lesen sie solche und andere Muscheln vom Grunde auf, nicht minder geschickt pflücken sie diejenigen, die sich festgesponnen haben, vom Felsen ab; unter kauenden Bewegungen bringen sie sodann die mit dem Mundrande gefaßte Beute in den Rachen, legen sie hier zurecht, zertrümmern ihr Gehäuse mit einem einzigen Bisse, scheiden rasch die Schalenstückchen aus, verschlucken das Weichtier und wenden sich nunmehr zur Fundstelle zurück, um mit einer zweiten, dritten, zehnten Muschel zu verfahren wie mit der ersten.
Strenge Kälte wird der Goldbrasse verderblich; sie zieht sich deshalb gegen den Winter hin in die Tiefe zurück und meidet alle seichten Stellen ängstlich, soll auch, wenn sie hier von frühzeitig eintretendem Frostwetter überrascht wird, der Kälte stets erliegen.
An den französischen Küsten stellt man ihr während des ganzen Jahres nach, und zwar mit Netzen und Angeln, die letztere mit Muscheln oder in Ermangelung derselben mit Krebsen und Tunfischstücken geködert werden. Das Fleisch ist zwar etwas trocken, aber bei jeder Art der Behandlung höchst wohlschmeckend und wird deshalb außerordentlich geschätzt. Diejenigen, die in Salzseen am Meere gefangen werden, gelten für vorzüglicher als alle übrigen, mit Ausnahme der im Atlantischen Weltmeere erbeuteten:
»Lob und Preis fürwahr verdienet nicht jeglicher Goldstrich,
Sondern der Muscheln nur frißt aus dem Lucrinischen See«,
singt schon Martial. Bei Venedig zieht man, laut Martens, Goldbrassen mit Sorgfalt in tiefen Teichen, wie dies schon zur Römerzeit üblich war.
*
Panzerwangen ( Cataphracti) nennt man Fische, bei denen die Knochen des unteren Augenrandringes nach abwärts verbreitert, mit dem Vordeckel durch Gelenk verbunden und wie die Deckelstücke und der Kopf mehr oder weniger, das heißt sehr verschiedenartig, bedornt sind. Der Gesichtsausdruck der Panzerwangen erhält durch die vielfachen Rauhigkeiten, die, falls sie zu Dornen sich entwickelt haben, als tüchtige Waffen dienen, etwas höchst Eigentümliches, wozu noch außerdem die mehr oder minder auffallende Bildung der Flossen und ebenso der Schuppen kommt. Der Rückenteil ist entweder mit zwei Rückenflossen ausgestattet, oder die einzige Flosse zerfällt in zwei Abteilungen; die Bauchflossen sind brustständig. Schwache, hechelförmige, selten kegelförmige Zähne bewehren die Kiefer. Eine Schwimmblase fehlt nicht selten.
An dem niedergedrückten, breiten Kopfe, dem gedrungenen und beschuppten Leibe, den verbundenen Rückenflossen und den unter den Brustflossen stehenden Bauchflossen sowie endlich den Samtzähnen im Kiefer und auf dem Pflugscharbeine erkennt man die Flußgroppen ( Cottus). Sie werden in unsern Süßgewässern vertreten durch die Groppe, die wohl auch Greppe, Kroppe, Koppe, Mühlkoppe, Kaulquappe, Kropf- und Grozfisch oder Dickkopf genannt wird ( Cottus gobio), ein Fischchen von zwölf bis vierzehn Zentimeter Länge. Dasselbe ist auf graulichem Grunde mit braunen Punktflecken und Wolken gezeichnet, die sich nicht selten zu Querbinden vereinigen, zuweilen auch auf der weißlichen Bauchseite noch sich zeigen, mit längs der Strahlen braun gestreiften Rücken-, Brust- und Schwanzflossen und gewöhnlich ungefleckter Bauchflosse. Die Färbung ändert übrigens nach der Gegend, dem Grunde des Gewässers, ja der Stimmung des Fisches entsprechend, vielfach ab.
Die Groppe bewohnt alle Süßgewässer Mittel- und Nordeuropas und tritt mit Ausnahme einzelner Bäche fast überall in Menge auf, steigt auch im Gebirge bis über eintausend Meter unbedingter Höhe auf, wird selbst noch in Seen, beispielsweise in dem einzig und allein von ihr bevölkerten Tiroler Lünersee, gefunden, die in einer Höhe von fast zweitausend Meter über dem Meere liegen. Sie liebt klares Wasser, sandigen oder steinigen Grund, da sie sich gern unter Steinen aufhält, und besucht, der Steine halber, sogar die kleinsten, wasserärmsten Bächlein. Ihre Bewegungen sind außerordentlich schnell. »Sie schießt«, wie Geßner sagt, »von einem orth an das ander mit so starckem gewalt, daß hart ein anderer Fisch jnen in solcher bewegnuß zu vergleichen.« An Gefräßigkeit steht sie keinem andern Fische nach, und der alte Geßner hat wiederum recht zu sagen: »allerley Speiß fressen die Groppen, auch sie sich einer den andern, der grösser den kleinern«; denn obwohl sie sich vorzugsweise von Kerbtieren, insbesondere von Libellenlarven, nährt, verschont sie doch keinen Fisch, den sie bezwingen zu können vermeint, und in der Tat auch ihre eigene Brut nicht. Forellenzüchtern ist sie sehr verhaßt, Weil sie als ein sehr schädlicher Feind des Laiches dieser Edelfische angesehen wird. Rücksichtlich des Fortpflanzungsgeschäfts unterscheidet sie sich von den meisten andern Fischen dadurch, daß das Männchen der Brut sich annimmt. Schon Linné berichtet, daß die Groppe ein Nest baue und eher das Leben als die Eier in diesem Neste aufgebe; Marsigli und Fabricius vervollständigen die Linnésche Angabe, indem sie das Männchen als den Wächter der Eier kennzeichnen. Die Laichzeit fällt in den März und April. Das Weibchen setzt den Rogen unter Steinen oder in ein eigens dazu erwähltes Loch ab, und das Männchen übernimmt nun die Brutsorge. Erfahrene Fischer an der Traun berichteten Heckel und Kner folgendes: »Zur Laichzeit begibt sich ein Männchen in ein Loch zwischen Steinen und verteidigt dasselbe gegen jedes andere, das davon Besitz nehmen will, mit lebhaftem Ingrimm, der unter Umständen in langwierige Kämpfe ausarten kann und einem der Streiter nicht selten das Leben raubt. Dem Weibchen gegenüber benimmt sich das Groppenmännchen artig; es wird von ihm ohne Widerstreben aufgenommen, setzt an der betreffenden Brutstelle seinen Rogen ab und zieht hierauf ungefährdet seines Weges davon. Von nun an vertritt das Männchen Mutterstelle und beschützt vier bis fünf Wochen lang die Eier, ohne sich zu entfernen, es sei denn, daß es die notwendige Nahrung suchen muß. Ebenso bewunderungswürdig wie seine Ausdauer ist sein Mut. Es beißt in die Stange oder Rute, mit der man es verjagen will, weicht nur im höchsten Notfalle und läßt sich buchstäblich angesichts seiner Eier erschlagen.«
Gegenwärtig betrachten wir die Groppe, hauptsächlich wohl ihrer geringen Größe halber, als wertlosen Fisch und benutzen sie mehr zum Angelköder denn als Speise.
Nach der Groppe ist uns am besten bekannt der Seeskorpion oder Ulker ( Cottus scorpius), ein häßlicher Fisch von fünfzehn bis fünfundzwanzig Zentimeter Länge und rötlichbrauner, nach unten sich lichtender Färbung, die durch dunklere Flecke gezeichnet wird. Der Seeskorpion ist in der Ostsee fast ebenso gemein wie in der Nordsee, findet sich überhaupt vom Biskayischen Meerbusen an bis Lappland allerorten, in dem Atlantischen wie im Eismeere und den hierzu gehörigen Meeresteilen in Menge.
Die Seeskorpione halten sich am liebsten auf steinigem Grunde, oft in bedeutenden Tiefen, nicht selten aber auch in höheren Schichten des Meeres auf, liegen hier unbeweglich auf den Steinen, zuweilen auch unter ihnen mit dem Rücken sich anlehnend, und lauern auf Beute. Naht eine solche, so schwimmen sie unter lebhaften Bewegungen ihrer gewaltigen Flossen nicht allzu rasch, wohl aber gewandt herbei, öffnen den ungeheuren Rachen und begraben in ihm Tiere, die fast ebenso groß sind wie sie selbst. Ihre Gefräßigkeit ist erstaunlich; sie verschlingen buchstäblich alles Genießbare: neben Fischen Krebse und Krabben, Würmer usw., äußerem auch allerlei Abfall von den Schiffen und Booten. Die Fortpflanzungszeit fällt in die wärmeren Monate des Jahres; einzelne aber laichen erst spät im Herbste, manche im November. Während der Laichzeit beleben sie alle geeigneten Stellen der Küste in außerordentlicher Anzahl; nachdem sie sich ihrer Eier entledigt, ziehen sie sich in tiefere Gründe zurück.
Obgleich man eigentlich nirgends auf diese von vielen Fischern gehaßten Tiere jagt, fängt man sie doch in Menge, ohne es zu wollen. Das Fleisch wird nirgends besonders geachtet, die Leber dagegen sehr geschätzt und der wenig ansehnliche Fisch daher von den Fischern selbst verbraucht. Anderseits gilt auch der Seeskorpion als schädlicher Feind der Brut edlerer Fische, und zudem fürchtet man ihn seiner Waffen halber, weil man die durch ihn verursachten Wunden für gefährlich hält. Pontoppidan sagt, daß man in Norwegen nur die Leber verwende, weil man aus ihr einen vortrefflichen Tran gewinne.
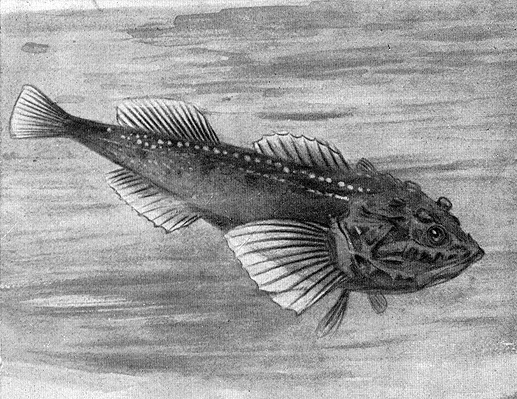
Seeskorpion ( Acanthocottus scorpius var. quadricornis)
Beim Einfangen oder, richtiger, beim Ergreifen verursachen auch die Seeskorpione ein sonderbares Geräusch, ähnlich dem, das ihre größeren Verwandten hervorbringen, nur bedeutend schwächer. Gefangene können längere Zeit außerhalb des Wassers leben und eignen sich deshalb vortrefflich zur Versendung auf weitere Strecken. In unsern Seewasserbecken gehören sie zu den gewöhnlichsten und beliebtesten Fischen, dauern hier auch, selbst in einem kleinen Behälter, vortrefflich aus, da es ihnen eigentlich nur um das Fressen, nicht aber um Bewegung und größeren Raum zu tun ist.
*
In unsern deutschen Meeren lebte eine Art der Panzergroppen ( Agonus). Ihr Leib ist gestreckt und mit Längsreihen großer Knochenschilder gepanzert, erscheint deshalb vielkantig, der Kopf bedeutend stärker als der Leib, oben ebenfalls mit mehreren Spitzen bewehrt, unten abgeflacht, an der Schnauze mit umgebogenen Dornen bewaffnet.
Vertreter dieser Sippe ist der Steinpicker ( Agonus cataphractus), ein achtkantiger Fisch von fünfzehn Zentimeter Länge und brauner, unten lichtbrauner und selbst bräunlichweißer Grundfärbung, von der sich vier breite dunkelbraune Rückenstreifen abheben; die lichtbraunen Rückenflossen sind dunkelbraun gefleckt, die großen Brustflossen braun gebändert.
Schon im Jahre 1624 lieferte Schonevelde, ein deutscher Arzt, eine ziemlich richtige Beschreibung des Steinpickers, den er an der Mündung der Elbe gefangen hatte; gegenwärtig wissen wir, daß unser Fisch in der Nord- wie in der Ostsee vorkommt, während des Sommers in mäßiger Tiefe, am liebsten in der Nähe von Flußmündungen, sich aufhält, gegen den Winter aber in die niederen Gründe des Meeres sich zurückzieht. Die Männchen nähern sich, laut Eckström, den Küsten seltener als die Weibchen, wie es scheint, nur während der Laichzeit, im April oder Mai, dann zuweilen in nicht unbedeutender Anzahl. Die Vermehrung ist schwach; Kröyer fand in einem alten trächtigen Weibchen nur dreihundert Eier. An Gefräßigkeit steht der Steinpicker seinen Familienverwandten kaum nach, obgleich er bloß kleinere Beute bewältigen kann. Sein Fleisch wird ebenfalls gering geschätzt und er deshalb von den Fischern gewöhnlich wieder ins Wasser geworfen oder höchstens als Köder für größere Raubfische verwendet. Im engeren Gewahrsame hält er sich in der Regel nicht lange.
*
In der letzten Sippe endlich vereinigen wir die Seehähne ( Trigla), kleine oder höchstens mittelgroße, vierschrötige Fische mit verhältnismäßig sehr großem, fast vierseitigem, in einen rauhen Panzer gehülltem Kopfe, zwei getrennten Rückenflossen, drei freien, gegliederten Strahlen vor den großen Brustflossen und Samtzähnen in den Kinnladen und am Pflugscharbeine. Sie haben von jeher die allgemeine Aufmerksamkeit erregt; denn sie geben, wenn man sie aus dem Wasser nimmt, einen sonderbar grunzenden oder knurrenden Laut von sich, der durch Aneinanderreihen ihrer Kiemendeckelknochen erzeugt wird.
In der Nordsee lebt der Knurrhahn ( Trigla hirundo), ein Fisch von fünfzig bis sechzig Zentimeter Länge. Er ist auf dem Rücken graurötlich oder bräunlich, auf dem Bauche hell rosenrot oder weißlich gefärbt und durch rote Rücken- und Schwanzflosse, die weiße Bauch- und Afterflosse und die schwarzen, innen blau gesäumten Brustflossen sehr geziert.
Ihm nahe verwandt ist der Gurnard, Seehahn oder graue Knurrhahn ( Trigla gunardus), der ungefähr die Hälfte der angegebenen Länge erreicht und oben auf bräunlichgrauem Grunde weiß getüpfelt, auf den Wangen wie mit Sternchen gezeichnet, auf der Unterseite silberweiß ist. Ein längs der Seiten verlaufendes Band Besteht aus scharfen Spitzen, wie die Zähne einer Säge. Die erste Rückenflosse ist braun, zuweilen schwarz gefleckt, die zweite wie die Schwanzflosse lichtbraun, die verhältnismäßig kurzen Brustflossen sind düstergrau, Bauch- und Afterflosse fast weiß.
Beide Seehähne bewohnen das Mittelländische Meer, das Atlantische Weltmeer, die Nord- und Ostsee. Sie sind gemein an den Küsten Englands, nicht selten auch bei Helgoland, längs der friesischen, oldenburgischen und holsteinischen Küste, seltener auf sandigen Küstenstrecken der südlichen Ostsee, halten sich vorzugsweise in der Tiefe, am liebsten auf sandigem Grunde auf und stellen hier vorzugsweise Krustern, sonst auch Muscheln und andern Weichtieren, auch Quallen nach. Sie schwimmen außerordentlich anmutig, wenn auch nicht besonders rasch, gebrauchen ihre großen Brustfinnen gleichsam als Flügel und entfalten und schließen sie abwechselnd. Wenn sie sich nachts auf seichten Stellen bewegen, sollen sie leuchten »wie funkelnde Sterne« und Lichtstreifen hervorbringen, die sich weit im Wasser, bald längs der Oberfläche, bald nach der Tiefe zu fortziehen. Weit auffallender und ungewöhnlicher aber als ihre Schwimmbewegungen ist ihr Fortkriechen auf dem Grunde. Die drei freien Strahlen vor den Brustflossen sind, ihrer Wirksamkeit nach, tatsächlich nichts anderes als Beine oder Füße und ermöglichen ihnen ein förmliches Gehen. Um sich in dieser Weise fortzubewegen, erheben sie den hintern Teil ihres Leibes etwas über den Boden, wie dies unsere dem Leben abgelauschte und unter meiner Aufsicht gezeichnete Abbildung darstellt, bewegen die drei Strahlen rasch nach, die einzelnen unabhängig voneinander und helfen durch schwache seitliche Bewegungen der Schwanzflosse etwas nach. Da die Flossenstrahlen nur kurz sind, fördert dieses absonderliche Gehen zwar nicht gerade schnell, jedoch immerhin genügend, um binnen wenigen Minuten nicht unerhebliche Strecken zurücklegen zu können. Die Laichzeit fällt in die Monate Mai und Juni; im November fängt man gelegentlich junge Seehähnchen von acht bis zehn Zentimeter Länge, die den Alten bereits in allen Stücken gleichen.
Obgleich das Fleisch beider Seehähne, namentlich des Knurrhahnes, etwas hart und trocken ist, wird es doch gern gegessen, unsern Fischen deshalb auch überall nachgestellt. Zum Fange wendet man in England Schleppnetze von fünf Meter Länge, in Italien vorzugsweise Angeln an. In der Gefangenschaft lassen sich die Seehähne selten lange am Leben erhalten, falls man ihnen nicht ein sehr flaches Becken zum Aufenthalt anweist und in demselben einen beständigen und raschen Wechsel des Wassers unterhält, ihnen damit also die von ihnen benötigte Menge von Sauerstoff zuführt.
*
Die Merkmale der Drachenfische ( Trachinidae) sind: ein seiner Länge und Breite nach auf Kosten des ungeheuren Schwanzes zusammengedrückter, messer- oder trichterförmiger Leib, zusammengeschobener, vorgetriebener Kopf mit schief aufwärtsgestelltem Maule und obenliegenden Augen, zwei Rückenflossen, deren erste von der andern gleichsam vorgedrängt worden ist, auch gänzlich fehlen kann, gewöhnlich vor den Brustflossen eingelenkte Bauchflossen und unverhältnismäßig große, der Länge des Schwanzes entsprechende zweite Rücken- und Afterflosse.
Alle zu dieser Familie zählenden Arten leben auf dem Boden des Meeres, am liebsten auf flachen, sandigen Stellen, nicht selten auch auf solchen, die durch die Ebbe zeitweilig bloßgelegt werden, wühlen sich hier bis auf den Kopf in den Sand ein und erwarten, die spähenden Augen ihrer Stellung gemäß benutzend, eine über ihnen wegschwimmende oder kriechende Beute, locken diese vielleicht durch ein Spiel ihrer Flossen und bezüglich Anhängsel herbei, erheben sich plötzlich aus ihrem sandigen Bette, stürzen sich auf die Beute und ergreifen sie fast unfehlbar.
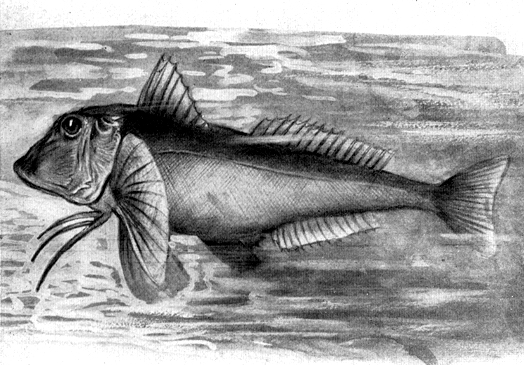
Knurrhahn ( Trigla hirundo)
In den europäischen Meeren wird die Familie vertreten durch die Queisen ( Trachinus). Hier kommen vier einander sehr verwandte, durch ständige Merkmale jedoch sicher unterschiedene Arten vor, von denen auch zwei, das Petermännchen und die Viperqueise, im Norden gefunden werden. Der Leib des erstgenannten ( Trachinus draco) ist sechsmal länger als hoch, auf dem Rücken fast gerade, auf dem Bauche etwas ausgerundet. Hinsichtlich der Färbung kann das Petermännchen mit manch anderem Fische wetteifern. Seine graurötliche Grundfarbe geht gegen den Rücken hin mehr ins Braune, gegen den Bauch hin ins Weißliche über, wird allenthalben mit schwärzlichen Wolkenflecken gemarmelt, zu denen sich in der Augengegend, auf den Schläfen, Kiemendeckeln und Schultern noch krumme Streifen von azurblauer Farbe, auf den Seiten und dem Bauche solche von gelblicher Färbung gesellen. An Länge kann der Fisch bis vierzig Zentimeter erreichen.
Die Viperqueise ( Trachinus vipera) unterscheidet sich durch platteren Kopf und mehr zugerundeten Bauch; auch steht die erste Rückenflosse von der zweiten weiter ab. Die graurötliche Farbe des Rückens geht auf Seiten und Bauch in Silberweiß über; der Rücken ist braun gefleckt, die erste Rückenflosse schwarz, die zweite wie die Schwanzflosse schwarz gesäumt. Die Länge beträgt zwölf bis fünfzehn Zentimeter.
Das Petermännchen, das auf flachen, sandigen Stellen des Atlantischen Weltmeeres, des Mittelmeeres, der Nord- und Ostsee gefunden wird, zieht tiefes Wasser den seichten Stellen vor, lebt aber ebenso wie seine Verwandte auf oder richtiger im Grunde, bis zu den Augen im Sande vergraben. Gegen den Juni hin nähert es sich, um zu laichen, dem flachen Strande, und dann geschieht es, daß es während der Ebbe auch auf den von Wasser entblößten Stellen gefunden wird. Seine Beute besteht vorzugsweise aus Garnelen, vielleicht auch kleinen Fischen, die es bis in nächste Nähe kommen läßt, bevor es aus dem Sande hervorschießt. Letzteres geschieht mit einer überraschenden Schnelligkeit, wie denn überhaupt der so träge erscheinende Fisch ein höchst bewegungsfähiges Tier genannt werden muß. Nicht minder behend gräbt er sich nach geschehenem Fange wieder in den Sand ein. Einige, die ich längere Zeit beobachten konnte, lagen während des ganzen Tages an einer und derselben Stelle ihres Beckens so tief vergraben, daß man nach längerem Suchen eben nur ihre Augen wahrnehmen konnte, erhoben sich, wenn man sie störte, sehr rasch, führten dabei Bewegungen aus, als ob sie mit ihren stacheligen Rückenflossen den Störenfried angreifen wollten, schwammen mehrmals auf und nieder, senkten sich endlich wieder auf den Sand herab, legten die Brustflossen an und bewegten nunmehr die lange Afterflosse wellenförmig, wodurch sie sich sehr rasch die erforderliche Vertiefung aushöhlten.
»Diese Fisch sind auß der zahl der Meerthieren, so den Menschen mit schädlichem gifft verwunden«, sagt der alte Geßner, und eine derartige Meinung, heutigentags noch die aller Fischer, verwundert den nicht, der weiß, daß eine von den Drachenfischen zugefügte Verwundung peinliche Schmerzen und eine heftige Entzündung hervorruft. Nicht bloß der verletzte Teil, sondern das ganze Glied pflegt aufzuschwellen, und erst nach längerer Zeit tritt etwas Linderung der Schmerzen ein. »Ich habe drei Männer gekannt«, sagt Couch, »die von einem und demselben Fische in die Hand gestochen worden waren und wenige Minuten später im ganzen Arme Schmerzen fühlten, jedoch durch Einreibungen mit Öl bald wieder hergestellt wurden.« Andere Fischer wenden nassen Sand, mit dem sie die Wunde reiben, als Gegenmittel an; alle sind überzeugt, daß die Drachenfische vergiften, und fürchten sie deshalb fast ebensosehr wie die Viper.
Das Fleisch des Petermännchens wird gern gegessen, weil es nicht bloß höchst schmackhaft ist, sondern auch für gesund gilt. In der Ostsee fängt man es vom August an bis zum Oktober in Heringsnetzen, in der Nordsee während des ganzen Jahres, bringt es jedoch selten auf den Markt. Seinen Namen soll es daher erhalten haben, daß es die holländischen Fischer als wertlos wegzuwerfen und dem heiligen Petrus zu opfern pflegten.
*
Die älteren Fischkundigen sehen die Stichlinge als Makrelen an, die neueren bilden, Günthers Vorgange folgend, aus ihnen eine besondere Familie ( Gasterosteidae). Der Leib dieser Fischchen ist spindelförmig, seitlich zusammengedrückt, die Schnauze spitzig, der Schwanzteil sehr dünn; die Kinnladen tragen einen schmalen Streifen samtartiger Zähne. Vor der Rückenflosse erheben sich freistehende Stacheln in verschiedener Anzahl; die fast nur aus einem Stachelstrahle bestehenden Bauchflossen stehen annähernd in der Mitte des Leibes. Die Stichlinge leben ebensowohl in Süß- oder Brackgewässern wie in den Meeren der nördlichen Halbkugel und führen eine bei den verschiedenen Arten sehr übereinstimmende Lebensweise, über die uns die heimischen Arten zur Genüge belehren.
Der Stechbüttel, Stichling oder Stachelfisch ( Gasterosteus aculeatus), kenntlich an seinen drei Stachelstrahlen vor der Rückenflosse, von denen der erste über der Brustflosse eingelenkt und der zweite der längste ist, tritt in mehreren, wie es scheint, ständigen Spielarten auf, wird sieben bis acht, höchstens neun Zentimeter lang und ist auf der Oberseite grünlichbraun oder schwarzblau, auf Seiten und Bauch silberig, an Kehle und Brust blaß rosen- oder blutrot gefärbt, ändert aber vielfach ab, trägt auch während der Laichzeit ein weit lebhafteres Kleid als sonst. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über den größten Teil Europas, mit Ausnahme des Donaugebietes, in dem er bisher noch nicht gefunden wurde. Sonst ist er häufig und unter Umständen im süßen Wasser ebenso gemein wie im Meere.
Der Zwergstichling ( Gasterosteus pungitius), einer der kleinsten unserer Süßwasserfische, der höchstens eine Länge von sechs Zentimeter erreicht, unterscheidet sich von jenem durch neun bis elf fast gleich lange Stachelstrahlen vor der Rückenflosse und einen etwas gestreckteren Leib. Die Oberseite ist grünlich, die Unterseite silberglänzend, eine wie die andere oft durch verwaschene Querbänder unregelmäßig gefleckt. Während des Sommers geht bei den Männchen die silberne Färbung der Unterseite oft in eine dunkelschwarze über. Nord- und Ostsee beherbergen den Zwergstichling in namhafter Menge; aber auch er begibt sich häufig in die Flüsse, steigt in ihnen weit empor und scheint sich in süßen Gewässern, ebenso wie andere seiner Verwandten, bleibend anzusiedeln.
Der Seestichling Zwischen dem Seestichling und dem gewöhnlichen Stichling bestehen keine scharfen Artgrenzen. Es handelt sich hier nur um Süß- und Seewasserstandortsvariationen, die sich nach Versuchen von Heinke experimentell ineinander überführen lassen. Herausgeber. oder Dornfisch endlich ( Gasterosteus marinus), das größte Mitglied der Sippe, hat sehr gestreckte Gestalt mit verhältnismäßig spitziger Schnauze und fünfzehn Stacheln auf dem Rücken. Dieser und Oberseite sehen grünlichbraun, die Seiten gelblich, Backen, Kiemendeckel, Kehle und Bauch silberweiß aus; die zweite Rücken- und die Afterflosse zeigen vorn einen dunkeln Fleck. An den schwedischen Küsten kommt eine Spielart vor, die sich durch Pracht der Färbung auszeichnet. Die Länge beträgt fünfzehn bis achtzehn Zentimeter. Die Nord- und Ostsee, erstere im weitesten Sinne des Wortes, bilden die Heimat des Seestichlinges; von hier aus verirrt er sich nach Süden hin bis in den Meerbusen von Gascogne; niemals aber steigt er weit in den Flüssen empor, wie er überhaupt Süßwasser entschieden meidet.
Wenige Fische vereinigen so viele anziehende Eigenschaften in sich wie die Stichlinge. Sie sind lebhaft und bewegungslustig, gewandt, räuberisch und streitsüchtig, mutig im Vertrauen auf ihre anderen Fischen furchtbare Bewaffnung, deshalb auch wohl übermütig, aber zärtlich hingebend in der Fürsorge zugunsten ihrer Nachkommenschaft. All dieser Eigenschaften wegen hält man sie gern in Gefangenschaft, und dies ist Ursache gewesen, daß man sie ziemlich genau kennengelernt hat.
In weiteren Wasserbecken mit reichlichem Zuflusse gelingt es, nach meinen Erfahrungen, stets, sie einzugewöhnen; in kleinen, engen Becken dagegen gehen, wie Evers zu seinem Leidwesen erfahren mußte, anfänglich viele ein. »Fast ohne Ausnahme«, schildert Evers, »gebärden sich alle frisch gefangenen zuerst ganz unsinnig und wütend. Stundenlang konnte so ein Kerl an derselben Stelle hinauf- und hinabrasen, immer den Kopf gegen die Glaswand gerichtet, und kein Leckerbissen, kein Eingriff meinerseits half da: jede Störung machte das Tier nur noch toller. Daß mir viele lediglich infolge dieses Tobens zugrunde gegangen sind, also sich buchstäblich zu Tode geärgert haben, steht mir unzweifelhaft fest. Kam es doch vor, daß besonders gallige Stücke gegen meinen von außen genäherten Finger und gegen ihr eigenes Spiegelbild so heftig gegen die Glaswand fuhren, daß ihnen das Maul blutete!« In weiteren Becken habe ich solches Gebaren nicht beobachtet. Hier schwimmen die frisch eingesetzten Stichlinge zunächst gemeinschaftlich überall umher, um sich heimisch zu machen, und untersuchen jede Ecke, jeden Winkel, jeden Platz. Plötzlich nimmt einer von ihnen Besitz von einer bestimmten Ecke oder einem bestimmten Teile des Beckens, und von nun an beginnt sofort ein wütender Kampf zwischen ihm und jedem andern, der sich erfrechen sollte, ihn zu stören. Beide Kämpfer schwimmen mit größter Schnelligkeit umeinander herum oder nebeneinander hin, beißen und versuchen, ihre furchtbaren Dornen dem Gegner in den Leib zu rennen. Oft dauert der Kampf mehrere Minuten, ehe einer zurückweicht, und sobald dies geschieht, schwimmt der Sieger, anscheinend mit der größten Erbitterung, hinter dem Besiegten her und jagt ihn von einer Stelle des Gefäßes zur andern, bis letzterer vor Müdigkeit kaum weiter kann. Ihre Stacheln werden mit solchem Nachdruck gebraucht, daß oft einer der Kämpfer durchbohrt und tot zu Boden sinkt. Nach und nach wählt jeder einzelne seinen bestimmten Stand, und so kann es kommen, daß in einem und demselben Becken drei oder vier dieser kleinen Tyrannen gegenseitig sich überwachen, jeder bei der geringsten Überschreitung der Gerechtsame über den Frevler herfällt und der Streit von neuem losbricht. »Gefährlich genug«, sagt Evers, »sieht solcher Zweikampf aus, namentlich wenn zwei eifersüchtige Männchen sich minutenlang in blitzschnellen Bewegungen umkreisen. Scheint dann gerade die Sonne durchs Wasser, so blitzen Stacheln und Schuppenkleid wie Waffen und Rüstung. Meistens geht es, wie bei den Strandläufern, ohne ernste Folgen ab; der schwächere Teil ergreift endlich die Flucht, verfolgt von dem wütenden Sieger, bis er über die Grenze hinaus ist und sicheren Unterschlupf gefunden hat. Mehrfach sah ich, wie ein Verfolgter, wenn er in größter Not war, plötzlich anhielt, sich seitwärts legte und dem Verfolger den Bauchstachel drohend entgegenstreckte. Meistens ließ dann der Gegner ab und kehrte um; zuweilen aber fuhr ein besonders erbitterter Kämpe sogar auf den Stachel los und packte ihn mit dem Maule, wahrscheinlich, um ihn herauszureißen; da dies, soweit ich gesehen, niemals gelang, so stand der Sieger nun endlich im Bewußtsein seiner Überlegenheit vom Kampfe ab.«
Mit anderen Beobachtern war ich der Meinung, daß nur die männlichen Stichlinge untereinander kämpfen, die Weibchen dagegen friedlich zusammenleben. Evers widerlegt diese irrtümliche Ansicht. So lebhaft wie die Männchen sind die Weibchen, die gewöhnlich unmittelbar unter der Oberfläche, zu Scharen vereinigt, ihren Stand nehmen, allerdings nicht; ihre scheinbare Gleichgültigkeit bedeutet aber keineswegs Frieden. »Es braucht nicht einmal ein Futterbissen in Sicht zu kommen, um die gesamte Damenwelt in grimmigen Zank ausbrechen zu lassen; nein, auch andere Lappalien haben die gleiche Wirkung; ja, im Grunde liegen die Weibchen beständig auf der Lauer, um bald hierhin, bald dorthin einen Streich zu versetzen.« Gerade sie sind, nach Evers' Beobachtungen, die eifrigsten Verfolger anderer kleinerer Fische, die in ihr Becken gebracht werden, beobachten von oben herab alles auf das schärfste, nehmen keinen Anstand, wütend auch gegen die streitenden Männchen loszufahren und bald den fliehenden noch eins zu versetzen, bald den siegenden drohend entgegenzurücken: sie führen ein förmliches Pantoffelregiment. Zwei von Evers gepflegte besonders große und langstachelige Weibchen warfen sich zu Alleinherrschern auf, achteten gegenseitig nur sich, griffen aber alle übrigen Artgenossen an und wußten sie so in Furcht zu setzen, daß die übrigen Weibchen selbst beim Futternehmen so lange sich verkrochen, bis jene den Löwenanteil vorweggenommen hatten. Selbst die Männchen hatten unter diesen Xanthippen arg zu leiden, und diejenigen unter jenen, die keinen bestimmten Standort erkämpft hatten, kamen aus dem Regen in die Traufe, wenn sie vor ihresgleichen flohen und im Gebiete der Weibchen Schutz suchten.
Innere Erregung der Stichlinge übt den größten Einfluß auf ihre Färbung aus; letztere ändert sich buchstäblich mit der Stimmung. Aus dem grünlichen, silbergefleckten Fische wandelt der zornige Siegesmut einen in den schönsten Farben prangenden um: Bauch und Unterkiefer nehmen tiefrote Färbung an; der Rücken schattiert bis in Rötlichgelb und Grün; die sonst weißliche Iris leuchtet in tiefgrünem Schimmer auf. Ebenso schnell macht sich ein Rückschlag bemerklich. Wird aus dem Sieger ein überwundener, so verbleicht er wieder. Evers hat auch hierüber sorgfältige Beobachtungen angestellt. Die Verfärbung seiner Pfleglinge war stets so genau an seelische Vorgänge gebunden, daß sie einen förmlichen Gradmesser dafür abgab. Jedes Männchen, das einen bestimmten Platz erkämpft hatte, prangte in lebhaften Farben, wogegen die noch nach solchem ringenden, die sich zu den Weibchen halten mußten, an der Farblosigkeit derselben teilnahmen. Tauchte bei dem einen oder anderen ein mattes Rosenrot auf, so durfte der Beobachter mit Sicherheit annehmen, daß von dem betreffenden Fischchen ein Eroberungsversuch ausgeführt werden würde. Seine Färbung nahm dann stetig zu, verschwand aber, sowie das Wagnis mißlungen war. Auch bei den herrschenden Männchen war die Vertiefung der Färbung jedesmal das Vorzeichen eines Unternehmens. Versetzte Evers seine Stichlinge im Höhepunkte des Farbendunkels in andere Behälter, so verschwand ihre Pracht sehr rasch, kehrte auch, solange sie in Ruhe blieben, nicht wieder. Mehrfach zeigten aber solche Einsiedler erhöhte Färbung, und dann war es manchmal schwierig, die Ursache ihrer Erregung zu ergründen. Der eine erboste sich über ein herabgeknicktes, vom Winde bewegtes Schilfblatt, der andere über ein seiner Auffassung nach unrichtig liegendes Sandkorn am Grunde, der dritte über den Schatten des Beobachters.
In sehr weiten Becken oder im freien Wasser schwimmen die Stichlinge rasch und gewandt einher, schnellen sich oft hoch über das Wasser empor, gefallen sich überhaupt in mancherlei Spielen, achten dabei aber auch hier auf alles, was um sie her vorgeht, namentlich auf junge Fischbrut, die den größten Teil ihrer Beute ausmacht. Um stärkere Raubfische kümmern sie sich im ganzen wenig, wohl weil sie von ihrer eigenen Wehrhaftigkeit überzeugt sind: will man doch bestimmt beobachtet haben, daß selbst arge Räuber sie meiden. Sogar der Hecht, dem alles Genießbare recht ist, scheut sich vor ihren Stacheln, nur größere Seefische, z.B. Dorsche und Lachse, füllen unbesorgt mit ihnen den Magen an. Ungeachtet ihrer Wehrhaftigkeit und scheinbaren Achtlosigkeit kennen sie jedoch ihre Feinde recht gut, richten wenigstens gegenüber solchen Fischen, die ihnen gefährlich erscheinen, sofort ihre Waffen auf. Als Evers einen Barsch in einen seiner Behälter setzte, ließen sich die in letzterem lebenden Goldfische gar nicht, die Elritzen kaum in ihren gewöhnlichen Geschäften stören; ganz anders aber faßten sämtliche Stichlinge die Sachlage auf. Während der Barsch in unheimlicher Ruhe, mit den rötlich funkelnden Augen und dem gierigen Rachen, ein rechtes Bild der Mordlust, seine Kreise zog, hatten die Stichlinge sofort nach seiner Ankunft sich eng zusammengeschart, loderten förmlich auf in dunkler Zornesglut und bewachten alle mit drohend aufgerichteten Dornen den Gegner. Jetzt war aller Bruderzwist vergessen: solange der Barsch in dem Behälter blieb, hat Evers keinen Stichling den andern jagen sehen. Vielmehr hielten sie sich in den oberen Schichten des Wassers, namentlich in den dort sich verzweigenden Rankengewächsen, zusammen; die Männchen bildeten gleichsam die äußere Verteidigungslinie, und einer oder der andere der kühnen Gesellen stieß zuweilen vor und jagte dem Feinde eine Strecke weit nach. Ebenso unternehmend wie Raubfischen gegenüber zeigen sich die Stichlinge angesichts einer von ihnen ins Auge gefaßten Beute. Sie jagen auf alles Getier, das sie überwältigen zu können glauben, und legen staunenswerte Freßlust an den Tag. Backer versichert, gesehen zu haben, daß ein Stechbüttel binnen fünf Stunden vierundsiebzig ausgekrochene Fischchen von etwa acht Millimeter Länge verschlang; der Seestichling lauert, nach den Beobachtungen von Couch, zwischen Seegras und Gestein in den verschiedensten Lagen aufgestellt, auf nahende Beute und überfällt solche von einer ihm fast gleichkommenden Größe; Ramage erfuhr, daß junge Blutegel von den Stechbütteln eifrig verfolgt und solche von zwölf Millimeter Länge ohne weiteres verschluckt wurden. Sobald man den Egel in das Glas brachte, das den Stichling beherbergte, kreiste dieser umher, bis er ihn packen konnte; hatte der Egel sich in das Glas angeheftet, so wurde er abgerissen, gebissen und geschüttelt, wie ein Hund mit einer gefangenen Ratte umgeht, und so lange in dieser Weise gemartert, bis er sich nicht mehr wehren konnte, hierauf verschlungen. Couch gab einem seiner Stichlinge einen Aal von acht Zentimeter Länge zur Gesellschaft; kaum war dieser in das Becken gebracht worden, als er auch schon von dem Räuber angegriffen und, den Kopf voran, in Schlund und Magen versenkt wurde. Der Aal aber war für einen Bissen doch zu groß, und der überbleibende Teil hing dem Räuber aus dem Maule heraus; dieser sah sich deshalb genötigt, ihn wieder hervorzuwürgen: doch geschah dies erst, nachdem bereits ein Teil der Beute verdaut war. Motten und andere kleine Schmetterlinge, die auf die Oberfläche des Wassers fielen, wurden sofort gepackt, entflügelt und verschluckt. Sorgsamer beobachtende Fischer erklären alle Stichlinge als überaus schädliche Feinde des Laiches und der jungen Brut fast sämtlicher Fischarten; einzelne Fischpfleger klagen sie an, wehrlose Goldfische anzugreifen, zu beißen, zu entschuppen, selbst zu töten. Die Versicherung der ersteren beruht im allgemeinen wohl auf richtiger Beobachtung, die Anklage der letzteren ist wenigstens teilweise begründet, indem die Stichlinge zuweilen allerdings Gold- und andere Zierfische gefährden, ebensooft aber mit derartigen Genossen sich einleben und sie dann ziemlich unbehelligt lassen. Sie würden, hätten sie nur die Größe eines Barsches, unsere Gewässer entvölkern und uns im höchsten Grade furchtbar werden, so sehr sie uns durch ihre Schönheit entzücken möchten.
Das merkwürdigste in der Lebensgeschichte der Stichlinge ist unzweifelhaft ihr Brutgeschäft. Deutsche und englische Forscher hatten schon vor vielen Jahren über den Nestbau und die Wachsamkeit der Stichlinge geschrieben; aber erst, nachdem ein Franzose seine Beobachtungen der französischen Akademie der Wissenschaften vorgelegt, wurde, wie das in der Regel zu gehen pflegt, die Trommel gerührt und Lärm geschlagen. Denn mehr als hundert Jahre vor Coste, dessen Verdienste ich übrigens nicht im geringsten verkleinern will, hat der Engländer John Hall eine Beschreibung und Abbildung des Nestes unseres Stechbüttels veröffentlicht.
Wenn die Laichzeit herannaht, wählt jedes Männchen einen bestimmten Platz und verteidigt denselben mit der ihm eigentümlichen Hartnäckigkeit und Kampflust gegen jeden anderen Fisch seiner Art und seines Geschlechtes, der den Versuch wagen sollte, ihn zu verdrängen. Der erkorene Platz kann verschieden sein. Die Stichlinge, die im süßen Wasser laichen, suchen gewöhnlich eine seichte Stelle auf kiesigem oder sandigem Grunde auf, über die das Wasser ziemlich rasch rieselt oder doch öfters bewegt wird, und legen ihr Nest entweder auf dem Boden, halb im Sande vergraben, oder freischwebend zwischen Wasserpflanzen an; die Seestichlinge erwählen ähnliche Standorte und benutzen meist längere Tange in der Nähe des Strandes, zwischen denen sie sich überhaupt gern aufhalten, zur Befestigung des Netzes.
Im Freien pflegt der männliche Stichling den größten Teil seines Nestes im Schlamme zu verbergen, und dies mag wohl auch die Hauptursache sein, daß man erst so spät auf seine den Jungen gewidmete Sorgfalt aufmerksam geworden ist. »Als ich«, erzählt Siebold, »im Jahre 1838 in der Umgegend von Danzig einen Teich besuchte, dessen Grund mit Sand bedeckt war, fielen mir darin vereinzelte Stichlinge auf, die fast unbeweglich im Wasser schwebten und sich durch nichts verscheuchen ließen. Ich erinnerte mich sogleich dessen, was ich vor kurzem über den Nestbau des Fisches gelesen hatte, und vermutete, daß auch diese Stichlinge in der Nähe des Nestes Wache hielten, konnte aber bei aller Klarheit des Wassers auf dem sandigen Grunde des Teiches nirgends solche Nester entdecken. Als ich mit meinem Stocke auf dem Grunde umherfuhr, bemerkte ich, daß, wenn ich in die Nähe eines Stichlinges kam, dieser mit größter Aufmerksamkeit den Bewegungen des Stockes folgte. Ich konnte durch diese Bewegungen der Stichlinge voraussehen, daß sie mir ihr wahrscheinlich im Sande verborgenes Nest zuletzt selbst verraten würden, und fuhr deshalb um so emsiger fort, mit meinem Stocke auf dem Grunde herumzutasten. Plötzlich stürzte ein Stichling auf den Stock los und suchte ihn durch heftiges Anrennen mit der Schnauze wegzustoßen, woraus ich schloß, daß ich jetzt die Stelle getroffen hätte, wo sein Nest unter dem Sande versteckt liege; ich streifte mit dem Stocke etwas stärker über den Sand hin und entblößte in der Tat ein aus Wurzelfasern und andern Pflanzenstücken gefertigtes Nest, in dem angebrüteter Laich enthalten war. Auf ähnliche Weise gelang es mir bei den übrigen Stichlingen, mir den Ort ihrer Nester von ihnen anzeigen zu lassen. Einmal auf eine solche Stelle aufmerksam gemacht, war ich dann leicht imstande, auf dem Sandgrunde an einer kleinen Öffnung, aus der Wurzelfasern hervorschimmerten, und die ich früher übersehen hatte, das unter dem Sande vollständig versteckte Nest zu erkennen.«
Warrington, Coste und Evers, die ihre gefangenen Stichlinge beim Bauen beobachteten, haben uns über die Art und Weise ihrer Arbeit unterrichtet. Das Männchen, das während der Laichzeit in den prachtvollsten Farben prangt und seine erhöhte Tätigkeit und Regsamkeit auch in anderer Weise bekundet, schleppt, falls es sich für einen Standort am Boden entschieden hat, zuerst einige Wurzeln und ähnliche Teile verschiedener Wasserpflanzen, auch solche, die länger sind als es selbst, manchmal aus ziemlicher Entfernung herbei, reißt sogar von lebendigen Pflanzen mit vieler Mühe ganze Teile ab, untersucht das Gewicht derselben, indem es sie fallen läßt, und verbaut diejenigen, die rasch zu Boden sinken, wogegen es die zu leicht befundenen wegwirft. Die Stoffe werden stets sorgfältig ausgewählt, geschichtet und nochmals zurechtgelegt, bis der kleine Künstler sie seinen Wünschen entsprechend geordnet findet. Zur Befestigung am Grunde dient Sand oder Kies; die innere Rundung, überhaupt die Gestalt wird hervorgebracht und die Haltbarkeit erzielt, indem der Stichling langsam über die befestigten Teile wegschwimmt und sie dabei leimt und zusammenkittet. Deutlich beobachtete Evers, wie der kleine Baumeister, nachdem er neue Stoffschichten hinzugefügt, die Flossen schüttelte, den Kopf erhob, den Leib auswärts bog, mit dem ganzen Unterleibe über den Bau wegglitt und nunmehr einen im Wasser gut erkennbaren Klebstofftropfen ausschied, dessen Wirkung an den nun zusammengeleimten Baustoffen sofort sich zeigte. Zuweilen schüttelt er an dem Baue und drückt ihn dann wieder zusammen; zuweilen hält er sich schwimmend über ihm, verursacht mit seinen Flossen, die er rasch hin- und herbewegt, einen Strom und wäscht damit die zu leichte Bedeckung und einzelnen Halme des Nestes weg, nimmt sie von neuem auf und versucht, sie passender unterzubringen. Das Herbeischaffen der verschiedenen Baustoffe währt etwa vier Stunden: nach Ablauf dieser Zeit ist auch das Nest in seinen rohen Umrissen vollendet; der Ausbau aber, das Ausscheiden der zu leichten Teile, das Ordnen einzelner Halme, das Verflechten ihrer Enden und das Beschweren derselben mit Sand beansprucht mehrere Tage. Während des Bauens hat der Stichling nur seine Arbeit und die Verhinderung jeglicher Störung im Sinne. Emsig schafft er, und mißtrauisch beobachtet er jeden Ankömmling, sei er ein anderer Stichling, ein Molch, ein Wasserkäfer, eine Larve, und komme er mit böser Absicht oder harmlos in die Nähe des Nestes: ein Wasserskorpion in einem der unter Evers' Pflege stehenden Behälter wurde von dem bauenden Männchen dreißig und mehr Male ergriffen und im Maule bis auf die entgegengesetzte Seite des Beckens getragen. Die Größe des Nestes ist sehr verschieden, da sie ebensowohl durch den Standort wie durch die Baustoffe beeinflußt wird; durchschnittlich mag es Faustgröße haben. Gewöhnlich ist es länglichrund und oben vollständig geschlossen, seitlich dagegen mit einem Ein- und Ausgange versehen. Anfänglich bemerkt man nur den Zugang zum Innern, später ihm gegenüber auch den Ausgang. Wenn nämlich der Stichling seinen Bau vollendet hat, versucht er Weibchen herbeizulocken. Warrington sagt, daß ein fertiges Nest die Aufmerksamkeit des herbeikommenden Weibchens errege, Coste dagegen, daß das Männchen ausgehe, um Weibchen herbeizuschaffen, und sie unter vielfachen Liebkosungen in die Hochzeitskammer einführe. Mit letzterem stimmt auch Warrington überein. Das Männchen legt ersichtlich Vergnügen an den Tag, ein Weibchen gefunden zu haben, umschwimmt dasselbe in allen Richtungen, begibt sich ins Nest, fegt es aus, kehrt einen Augenblick später zurück und trachtet, die Gattin durch Stoßen mit der Schnauze ins Innere zu treiben. Will sie sich nicht gutwillig fügen, so wird auch der Stachel oder wenigstens die Schwanzflosse gebraucht, um womöglich die Sprödigkeit zu besiegen, nötigenfalls aber ein anderes Weibchen herbeigeschafft. Gelingt es dem Männchen, ein Weibchen zum Eingange zu bewegen, so legt dasselbe einige Eier, nach Coste zwei oder drei, bohrt auf der dem Eingange entgegengesetzten Seite ein Loch durch die Nestwandung und entfernt sich. Fortan hat also das Nest zwei Öffnungen, und den Eiern kommt der nunmehr durchgehende Wasserstrom zugute. Am nächsten Tage begibt sich das Männchen wiederum auf die Brautschau, bringt günstigenfalls ein zweites Weibchen herbei, zwingt auch dieses, mit Güte und Gewalt, zu legen, und wiederholt sein Bemühen, bis eine genügende Anzahl von Eiern vorhanden ist. Während oder unmittelbar nach dem Legen begibt es sich in das Nest, reibt seine Seite an der des Weibchens und streicht dann über die Eier hin, um sie zu besamen.
Von nun an verdoppelt es seinen Eifer und seine Wachsamkeit. Es gilt, die Eier vor jedem Angriffe zu bewahren und zu verteidigen. Jeder andere fortan sich nähernde Stichling wird mit Wut angefallen und in die Flucht geschlagen, gleichviel ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt; denn diese gefährden die Eier in demselben Grade wie jene, sind vielleicht noch lüsterner nach ihnen oder den eben ausgeschlüpften Jungen. Bis zum Auskriechen der letzteren bekundet das Männchen auch noch in anderer Art seine Sorgfalt. Es bessert an dem Neste durch Zufall entstandene oder von einem Beobachter hervorgebrachte Unordnung mit der Schnauze wieder aus, stellt sich oft vor oder in dem Brutraume auf, bewegt zitternd seine Brustflossen und erneuert so das Wasser innerhalb des Nestes, gleichsam als wisse es, daß den Eiern frischer Sauerstoff zugeführt werden müsse. Couch beobachtete mit Vergnügen, daß ein Seestichling, der sein Nest oberhalb der niedrigsten Flutmarke angelegt und von der Ebbe vertrieben wurde, jedesmal mit eintretender Flut zurückkehrte, um die Wiege seiner Kinder zu untersuchen, auszubessern und von neuem zu bewachen. Sehr häufig werden die treuen Tiere durch mißgünstige andere Männchen, die ihnen wahrscheinlich das Nest wegnehmen wollen, oder durch die raublustigen Mütter gestört, und so ist ihre Wachzeit eigentlich ein ununterbrochener Kampf.
Nahen sich endlich die Eier der Reife, so machen sich neue Sorgen geltend. Es handelt sich jetzt darum, die ungeschützten Jungen zu behüten und zu bewahren. In Warringtons Becken wurden in der Nacht des achten Mai von einem Weibchen Eier gelegt und die Mutter schon am nächsten Tage von dem Männchen heftig zurückgejagt. Dieses versah nun sein Wächteramt bis zum achtzehnten desselben Monats und begann an diesem Tage plötzlich, das Nest bis auf einige Grundhalme zu zerstören. Aller auf den Eiern liegende Schlamm und Sand wurde auf einer Stelle von acht Zentimeter Durchmesser sorgfältig mit dem Munde weggenommen und fortgeschafft. Als Warrington, verwundert über das Beginnen des so sorgsamen Vaters, ein Vergrößerungsglas zu Hilfe nahm, entdeckte er die eben ausgekrochenen Jungen. Von jetzt an schwamm das Männchen ununterbrochen die Kreuz und die Quer über den gereinigten Raum umher, seine Wachsamkeit gleichsam verdoppelnd, jeden anderen Fisch, der nur bis auf eine gewisse Entfernung nahte, zurücktreibend. Nachdem die Jungen etwas an Größe und Stärke zugenommen hatten, schienen sie sich zerstreuen zu wollen; der Vater aber wußte dies zu verhindern, indem er die Ausreißer mit dem Maule aufnahm, verschluckte und vorsichtig wieder auf das Nest spie. Erst später, als die Brut bereits im Schwimmen sich tüchtig zeigte, nahm die Tätigkeit des Wächters nach und nach ab, und als sie endlich ernährungsfähig waren, bekümmerte der Alte sich gar nicht mehr um sie.
Stichlinge, die Evers im Freien bei ihren Nestern fing und mit diesen in seine Glasbecken brachte, brüteten nicht, erkannten ihr Nest also offenbar nicht und rasten sich zu Tode; wohl aber nahmen sich solche, die in den Becken gebaut hatten, im Freien gesammelter und ihrer Pflege übertragener Eier ebenso getreulich an wie ihrer eigenen. Ein Männchen, das nach dem Ablassen des verdorbenen oder doch genügenden Sauerstoffes entbehrenden Wassers im Becken in die übliche Raserei verfallen war, ließ sich nach Erneuerung des Wassers ebenfalls auf sein Nest aufmerksam machen, erhielt sein Purpurgewand wieder und brütete dann so eifrig, als ob nichts geschehen wäre, gewöhnte sich im Laufe von vierzehn Tagen sogar so vollständig an die von Evers verursachte Ebbe und Flut, daß es in den Zwischenzeiten nicht einmal mehr sein Hochzeitskleid ablegte und, wenn auch eine gewisse Unruhe, so doch nicht mehr die blinde Berserkerwut zeigte. Dieses Männchen wurde eines Morgens über einer kleinen Sandvertiefung an Stelle des zerrissenen und zerstreuten Nestes gesehen, unbeweglich auf demselben Flecke sich haltend und mit Argusaugen einen kleinen Nebelfleck beobachtend, der bei näherer Forschung als ein Heer winzig kleiner Fischchen sich erwies. Tagelang schwamm der treue Vater ununterbrochen die Kreuz und die Quer über der Stelle umher, jedes noch so winzige Wesen, das sich nahte, verjagend und für Hunger und sonstige Bedürfnisse sich ebenso unzugänglich zeigend wie während der Brutzeit selbst. Als nach etwa acht Tagen einige der vier bis fünf Millimeter langen Kinderchen sich hervorzuwagen begannen und je länger, je weiter sich zu entfernen versuchten, folgte ihnen der besorgte Alte, ergriff sie mit dem Maule, verschluckte sie, kehrte zum Nistorte zurück und spie die kleinen Däumlinge heil und unversehrt wieder in die Senkung hinein. Vier Wochen später waren diese Jungen deutlich als Stichlinge erkennbar, hoben auch schon die winzigen Stacheln und bekundeten sich in der Gewandtheit und Raschheit ihrer stoßweisen Bewegungen als echte Kinder ihrer Eltern. Ein Stichlingsmännchen endlich verließ, nachdem es vierzehn Tage eifrig, in der dritten Woche lässiger gebrütet hatte, die Eier, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß dieselben verdorben waren.
Obgleich die Stichlinge nur etwa sechzig bis achtzig, also verhältnismäßig wenig Eier legen und ungeachtet ihrer Wehrhaftigkeit von manchen Feinden, insbesondere von sehr großen Bandwürmern, geplagt und gefährdet werden, auch, nach Angabe Blochs, höchstens drei Jahre leben sollen, vermehren sie sich doch zuweilen in unglaublicher Menge, namentlich in den sogenannten toten Armen der Flüsse, in stehenden Teichen und Seen und in Festungsgräben. In größeren Teichen sieht man sie durchaus nicht gern, weil ihre Gefräßigkeit die Aufzucht der Nutzfische empfindlich beeinträchtigt und sie da, wo sie sich einmal eingenistet, sich nur sehr schwer wieder ausrotten lassen. In Schweden und England fängt man sie in manchen Jahren in so großer Masse, daß man sie zum Schweine-, Hühner- und Entenfutter, zum Trankochen oder als Dung verwendet. Pennant erzählt von einem Manne in Lincolnshire, der längere Zeit hindurch täglich vier englische Schilling mit Stichlingsfang verdienen konnte, obgleich er von den Landwirten nur einen halben Pfennig für den Scheffel dieser Tiere erhielt. Das Fleisch gilt überall für ungenießbar. In Danzig erzählte man Siebold, um die Not zu schildern, die während der letzten Belagerung in der Stadt geherrscht habe, daß die ärmeren Einwohner bei dem Mangel der gewöhnlichen Lebensmittel zu den während der Belagerung in den Festungsgräben überaus häufigen Stichlingen ihre Zuflucht genommen hätten, um ihren Hunger zu stillen. Dieser allgemeinen Mißachtung gegenüber behaupten einige, daß der Stichling keineswegs ein schlechtes Essen wäre, vielmehr, falls er nur recht zubereitet werde, eine sehr wohlschmeckende Speise abgebe.
*
Eine nicht unbeträchtliche Anzahl wohlgebauter Fische mit spindelförmigem, seitlich zusammengedrücktem, gegen den Schwanz hin sehr verdünntem Leibe, der gewöhnlich mit kleinen, kaum wahrnehmbaren Schuppen bekleidet ist und deshalb glatt erscheint, einigt sich naturgemäß zu einer Familie, die wir der hervorragendsten Art zuliebe die der Makrelen ( Scombridae) nennen. Zur besonderen Kennzeichnung derselben mag noch hervorgehoben sein, daß die Deckelstücke glatt, das heißt ohne Stacheln und Zähnelung sind, die Kiemenspalte sich fast schließt, die harten Strahlen der Rückenflosse weniger als die weichen und ebenso minder als die der Afterflosse entwickelt, die ersteren auch wohl getrennt oder in einzelne Teile zerfallen und die brutständigen Bauchflossen zuweilen verkümmert oder gar nicht vorhanden sind.
Bewohner der hohen Meere aller Gürtel der Länge und Breite, dehnen die Makrelen ihr Verbreitungsgebiet meist auch über sehr weite Strecken aus. Fast alle bekannten Arten, mehr als hundert an der Zahl, leben gesellig, einzelne in unzähligen Scharen zusammen, viele von ihnen in bedeutenden Tiefen des Wassers, andere mehr in den höheren Schichten. Alle sind treffliche Schwimmer, alle ohne Ausnahme tüchtige Räuber, obgleich man nicht sagen kann, daß ihre Raubfähigkeit und Raublust im Verhältnisse zu ihrer Körpergröße steht, da gerade die größeren Arten der Familie oft mit sehr kleiner Beute sich begnügen. Die Vermehrung der Makrelen ist meist beträchtlich, ihre Bedeutung für die Fischerei dementsprechend erheblich. Einzelne Arten gelten für gewisse Küstenstrecken als die wichtigsten aller Fische; andere werden eben nur den Heringen nachgestellt.
*
Die gestreckte Gestalt, zwei weit voneinander getrennte Rückenflossen, deren hintere sich in mehrere sogenannte falsche oder Bastardflossen auflösen, schwache Kiele an den Schwanzseiten, spitzenlose Kiemendeckel, kegelförmige Kieferzähne in einfacher Reihe, sieben Kiemenstrahlen und ein aus kleinen Schuppen bestehendes Kleid sind die Merkmale der Makrelen im engeren Sinne ( Scomber), als deren wichtigste Vertreter wir die Makrele ( Scomber scomber) ansehen. Der ebenso schön gestaltete wie gefärbte Fisch erreicht eine Länge von vierzig bis fünfundvierzig, höchstens fünfzig Zentimeter sowie ein Gewicht von durchschnittlich einem Kilogramm und ist oben auf lebhaft blauem, goldig glänzendem Grunde dunkel in die Quere gestreift, unten silberweiß.
Früher war man, irregeleitet durch die Berichte der Fischer und anderer Beobachter, allgemein der Ansicht, daß die eigentliche Heimat der Makrele im Eismeere zu suchen sei und sie von hier aus alljährlich großartige Reisen nach südlicheren Gegenden unternähme. Diese Wanderungen finden auch tatsächlich statt, aber neben ihnen auch noch zahlreiche anders gerichtete, die wieder von den Wanderungen ihrer Nährtiere abhängen. Immerhin findet hierbei eine gewisse, an mehr oder weniger festliegende Meeresströmungen gebundene Regelmäßigkeit statt. An der ostfriesischen Küste finden sie sich vom Frühjahr bis zum Herbst; in der Wesermündung werden sie vom Mai bis zum Juli bemerkt; bei Rügen und Stralsund fängt man sie vom Juni bis zum September; bei Travemünde erscheinen sie in Zügen nur im August. In einzelnen Jahren bleiben sie hier auch wohl ganz aus, ebenso wie sie bei Rügen in größerer Anzahl erscheinen, wenn anhaltend Nordwestwind weht. Dieses Erscheinen an den Küsten wird überall mit Jubel begrüßt; denn die Makrele gehört zu den ausgezeichnetsten und wichtigsten aller Seefische, und ihr Fang hat wie im Altertum heutigentags noch eine großartige Bedeutung.
An den britischen Küsten erscheint dieser Fisch bereits im März, zuweilen sogar schon im Februar; die eigentliche Fangzeit beginnt aber doch erst im Mai oder Juni, weiter nach Norden hin sogar noch einen Monat später. Die Laichzeit für südlichere Gegenden ist der Juni. Die Anzahl der Eier eines Rogeners beträgt etwa eine halbe Million. Junge Makrelen von zehn bis fünfzehn Zentimeter Länge bemerkt man Ende August, halberwachsene schon im November, um welche Zeit sie sich, bis auf wenige, nach den tiefen Gründen der See zurückziehen. Ihre Hauptnahrung scheint in der Brut anderer Fische zu bestehen: so folgen sie den kleinen Arten der Heringsfamilie, von denen einzelne geradezu Makrelenführer genannt werden. Sie sind äußerst gefräßig und wachsen dementsprechend ungemein rasch.
*
Riesenhafte Makrelen, die Tunfische ( Thynnus), durchstreifen die südlichen Meere und werden für manche Küsten, insbesondere für die des Mittelmeeres, von außerordentlicher Bedeutung. Von den Makrelen im engeren Sinne unterscheiden sie sich durch die nahe aneinander stehenden Rückenflossen und eine verhältnismäßig bedeutende Anzahl von Bastardflossen, einen aus großen, ziemlich glanzlosen Schuppen gebildeten Brustpanzer, der nach hinten sich in Spitzen fortsetzt, und einen Kiel neben zwei Kanten des Schwanzes. Die kleinen zugespitzten Kieferzähne stehen in einfacher Reihe.
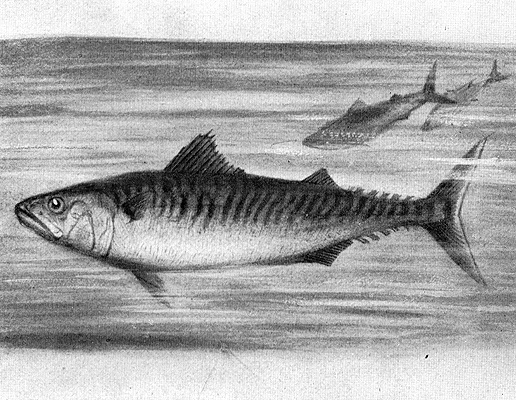
Makrele ( Scomber scomber)
Die Alten kannten und jagten das wichtige Mitglied dieser Sippe, den Tun ( Thynnus vulgaris), den größten aller Fische, der seines wohlschmeckenden Fleisches halber gefangen wird, eine Makrele von zwei bis drei Meter Länge und einem Gewichte von ein- bis vier Zentnern und mehr. Der Rücken ist schwarzbläulich, der Brustpanzer weißblau gefärbt; die Seiten und der Bauch tragen auf graulichem Grunde silberweiße Flecke, die sich zu Bändern vereinigen; die erste Rückenflosse und Afterflosse sehen fleischfarben aus, die falschen Flossen sind schwefelgelb, schwarz gesäumt.
Als die wahre Heimat des Tunes hat man das Mittelmeer anzusehen; im Atlantischen Weltmeere scheint er spärlicher vorzukommen und durch verwandte Arten ersetzt zu werden. Zwar behaupten die Fischer, daß er alljährlich in Menge vom Weltmeere aus durch die Meerenge von Gibraltar nach dem Mittelmeere ziehe, und in früheren Zeiten konnte man sich das plötzliche Erscheinen der Tune an den Küsten des Mittelmeeres gar nicht anders denn als Folge einer ungeheuren Einwanderung vom Weltmeere aus erklären; den gegenwärtigen Anschauungen zufolge müssen wir jedoch glauben, daß er, wie so viele andere Fische auch, zeitweilig in den Tiefen oder inmitten des Meeres verweilt und erst gegen die Laichzeit hin den Küsten sich nähert. Hier hält er allerdings bestimmte Straßen ein, bewogen wahrscheinlich durch untermeerische Täler, in denen er fortzieht; eine Wanderung im Sinne der älteren Berichterstatter findet jedoch gewiß nicht statt. Jahraus, jahrein findet man im Mittelmeere Tune, und zwar häufiger als irgendwoanders. An den Küsten des Atlantischen Meeres tritt dieser geschätzte Fisch überall und immer seltener auf. Ausnahmsweise nur verirrt er sich bis in nördlichere Gegenden, insbesondere bis nach Großbritannien. In unseren Meeren ist er ein seltener Gast; doch wurde im Jahre 1869 ein drei Meter langer Tun an der Jasmunder Küste erbeutet.
Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß der Tun nur, um zu laichen, an den Küsten erscheint. Während seiner Ankunft sind die Eier der Rogener allerdings noch wenig entwickelt; ihre Ausbildung geht jedoch ungemein rasch vor sich. Bei Tunen, die im April gefangen werden, wiegt der Eierstock etwa fünfzehn Unzen, bei solchen, die während des Mai in den Netzen sich verirren, schon mehr als sechs Kilogramm. Die Anzahl der Eier ist oft sehr beträchtlich. »Beim Anblick der Fülle und des Reichtums ihrer Eierstöcke«, sagte der Abt Cetti, dem wir die erste ausführliche Beschreibung des Fisches und seines Fanges verdanken, »habe ich nie gezweifelt, daß das Auge eines Leeuwenhoek eine ebenso ungeheure Anzahl Eier, als er in dem Schellfische fand, angetroffen haben würde«, mit anderen Worten, daß jeder Fisch mehrere Hunderttausende von Eiern zur Welt bringt. Um die Mitte des Juni sieht man Milchner und Rogener in beständiger Bewegung in und über dem Wasser, weil sie sich dann nur in den oberen Schichten aufhalten und sehr oft über die Oberfläche emporspringen. Um diese Zeit findet das Laichen statt. Die Rogener sollen in den Seetang legen, die Milchner unmittelbar darauf das bezügliche Wasser besamen. Im Juli kommen die Jungen aus; einige Tage später wiegen sie anderthalb Unzen; im August dagegen haben sie bereits ein Gewicht von vier und im Oktober ein solches von dreißig Unzen erlangt. Wie schnell sie fürderhin wachsen, weiß man zwar nicht, glaubt aber auch während des nächsten Jahres eine sehr rasche Zunahme ihrer Größe voraussetzen zu dürfen. Die Dauer ihres Wachstumes ist unbekannt; es scheint jedoch, als ob sie schon frühzeitig fortpflanzungsfähig würden, weil man unter den alten und großen auch jüngere und kleine fängt, die doch wahrscheinlich nicht mit jenen ziehen würden, wenn sie nicht fortpflanzungsfähig wären.
Die Art und Weise seines Fanges zu beschreiben, gehört so recht eigentlich zur Lebensschilderung des Tunes, weil sich geradezu auf die hierbei angestellten Beobachtungen unsere Kenntnis des Lebens dieses Fisches gründet. Schon die Alten betrieben die Tunfischerei sehr eifrig, namentlich an beiden Endpunkten des Mittelmeeres, an der Meerenge von Gibraltar und am Hellespont. Der Fang geschieht verschieden, je nach Örtlichkeit und Jahreszeit, am großartigsten jedoch an den italienischen Küsten. Hier sperrt man ihnen die gewohnten Straßen mit ungeheuren Netzen ab und erbeutet günstigenfalls Tausende mit einem Male. Der erwähnte Abt hat diesen Fang in meisterhafter, noch heute gültiger und unübertroffener Weise beschrieben, und seine Schilderung ist es, die ich dem Nachfolgenden zugrunde lege.
Die Fangnetze, wahrhaftige Gebäude aus Stricken und Maschen, heißen Tonaren, und man unterscheidet je nach der Lage derselben Vorder- und Hintertonaren. Das Meer muß da, wo eines dieser kühnen Gebäude errichtet wird, eine Tiefe von mindestens dreiunddreißig Meter haben; die Netzwand selbst besitzt eine solche von fünfzig Meter, da die verschiedenen Kammern desselben keinen Boden haben und ein guter Teil des Netzes auf den Grund zu liegen kommt und in dieser Lage unverrücklich festbleiben muß. Nur die sogenannte Totenkammer hat einen Boden, weil sie mit den gefangenen Tunen aufgehoben wird; sie ist auch, um die Last der Fische und deren Gedränge auszuhalten, ungleich fester als das übrige Netz aus starken, engmaschigen Hanfschnüren gestrickt. Nach beiden Seiten hin verlängern sich zwei Netzwände schweifartig zu dem Zwecke, den Tun ins Netz zu locken. Der sogenannte Schweif führt den Fisch, der sonst zwischen dem Netze und dem Ufer entwischen würde, in die Kammer; die sogenannte Schleppe leitet diejenigen herbei, die sonst im äußeren Meere vorüberstreifen würden. Zuweilen beträgt die Gesamtlänge des Netzes über eine Seemeile.
Die Ufer Sardiniens werden, wenn die Zeit der Fischerei herannaht, durch die Tonaren ungemein belebt. Am Ufer stehen da, wo man seit Jahren gefangen hat, mehr oder weniger große und bequem eingerichtete Gebäude, dazu dienend, Fischer, Käufer und Zuschauer aufzunehmen, die sich während des Fanges hier zusammenfinden. Bis gegen Ende März ist alles still und verlassen; Anfang April aber verwandelt sich der Küstenplatz in einen Markt, auf dem sich Leute aus allen Ständen versammeln. Inländer und Ausländer kommen an, und wenn die Häuser und Buden sich füllen, bedeckt sich auch das Ufer und das Meer an demselben mit Hütten und Fahrzeugen. Allenthalben sind Leute beschäftigt: hier Böttcher und Schmiede, dort Lastträger, die Salztonnen und dergleichen herbeischaffen, dort wiederum zusammengelaufenes Volk, das vollauf Arbeit hat, das ungeheure Netz auszubreiten, zu flicken und zusammenzufügen. Der »Patron« oder Eigentümer der Fischerei läßt sich außer der Aufmerksamkeit, die er auf die Arbeit und Bewirtung seiner Mannschaft wendet, auch den Gottesdienst angelegen sein, weil er glaubt, daß hiervon ein nicht geringer Teil seines guten Erfolges abhänge, überdies begleiten den Patron einige seiner sichersten und treuesten Leute, die die Oberaufsicht haben, die Arbeit überwachen und Bekanntmachung der Verordnungen übernehmen; die Hauptperson aber und der allerwichtigste Arbeiter ist der Rëis oder Oberbefehlshaber der Fischer. Rëis bedeutet im Arabischen soviel wie Vorsteher oder Hauptmann; die Benennung deutet also darauf hin, daß die Araber vordem auch in der Tunfischerei Ausgezeichnetes geleistet haben mögen. Was nur irgend auf den Tunfang Bezug hat, hängt vom Rëis ab. Er muß ein Mann sein von unverbrüchlicher Treue, unfähig, seinem Herrn Schaden zuzufügen dadurch, daß er eine andere Tonare begünstigt, muß ebensoviele Kenntnisse wie Scharfsinn besitzen, das Wesen des Tunes gründlich kennen, auf alles und jedes, auch das Kleinste, auf eine Vertiefung oder Erhabenheit des Meerbodens, eine besondere Farbe desselben, kurz, auf jeden Umstand, der auf die Fischerei Einfluß haben könnte, aufmerksam sein, alles vorher zu untersuchen wissen und außerdem die Begabung haben, das gewaltige Netzgebäude rasch und sicher im hohen Meere aufzubauen, so daß es selbst im Sturme feststehe. Nachdem er diese Arbeit verrichtet, liegt ihm die ununterbrochene Besichtigung desselben ob; denn von ihm hängt es ab, wann der Anfang irgendwelcher Arbeit geschehen soll. Mit der Einsicht eines Lotsen muß er bevorstehende Stürme voraussehen können, damit er nicht während einer Unternehmung zur Unzeit von solchen überfallen werde; am Tage des wirklichen Fanges endlich führt er den alleinigen Befehl. Von seinen Eigenschaften hängt größtenteils der Erfolg der Fischerei ab. Man behandelt ihn deshalb mit größter Höflichkeit, und der Fremde hört oft keinen anderen Namen nennen als den seinen. Gewöhnlich gehen die zu so hohen Posten erhobenen Leute aus einer Fischereischule hervor; diejenigen, die auf Sardinien tätig sind, stammen entweder aus Genua oder aus Sizilien.
Die Vorbereitungen zum Fange beanspruchen den Monat April. Anfang Mai wird die Tonare ausgesteckt, das heißt im Meere eine Linie gezogen, die bei der Auswerfung des Netzes als Richtschnur dient. Dies geschieht vermittels langer Leinen, die miteinander gleichlaufend auf der Oberfläche des Wassers befestigt werden. Am Tage nach der Aussteckung bringt man das vorher von der Geistlichkeit feierlich eingesegnete Netz auf mehreren Fahrzeugen ins Meer hinaus und verankert es nach allen Seiten.
Der Tun zieht mit großer Regelmäßigkeit, wenn auch nicht, wie die Alten glaubten, immer mit der rechten Seite gegen das Ufer gekehrt, laut Aelian »bald nach Art der Wölfe, bald nach Art der Ziegen«, das heißt entweder und gewöhnlich in Trupps von zwei und drei Stück oder in starken Schwärmen. Bei ruhigem Wetter streicht er nicht, sondern geht höchstens seinem Futter nach; sobald das Meer vom Winde bewegt wird, begibt er sich auf die Reise und hält dann meist auch die Windrichtung ein. Deshalb sieht man beim Tunfange weder Stürme noch Windstille gern; jedermann wünscht Wind, und jeder selbstverständlich denjenigen, der seiner Tonare vorteilhaft ist.
Der an eine Netzwand anprallende Fisch gelangt zuerst in die große Kammer, deren Eingang offen steht. Niemals, oder doch höchst selten, besinnt er sich, zurückzukehren, sucht vielmehr allenthalben durchzukommen und verirrt sich dabei in die nächsten Kammern, in denen er entweder schon Gesellschaft vorfindet, oder doch bald solche erhält. Besondere Aufpasser halten sich mit ihren Fahrzeugen in der Nähe der sogenannten Insel am Anfange der Kammer auf und geben Achtung, wie viele Fische in das Netz gehen. Sie unterscheiden die Tune unter dem Wasser mit einer wunderbaren Scharfsichtigkeit, obgleich diese sich in einer so beträchtlichen Tiefe halten, daß ihr Bild oftmals nicht größer als eine Sardelle erscheint; ja, sie können sie zählen, Stück für Stück, wie der Hirt seine Schafe. Zuweilen müssen sie oder der Rëis, der alle Abende sich einfindet, verschiedene Hilfsmittel anwenden, um die Unterwasserschau zu ermöglichen. Sie bedecken das Boot mit einem schwarzen Tuche, um die das Sehen verhindernden Lichtstrahlen zu dämpfen, oder senken einen Stein mit einem Weißen Tunfischknochen, die sogenannte Laterne, in die Tiefe, um das Dunkel derselben zu erhellen. Bemerkt der Rëis, daß eine der vorderen Kammern zu voll ist, so sucht er, um neuen Ankömmlingen den Eingang zu eröffnen, die ersten in die folgende Kammer zu treiben. Dies geschieht gewöhnlich mit einer Handvoll Sand, dessen Körner die äußerst furchtsamen Fische derartig erschrecken, »als fiele ihnen der Himmel auf den Rücken«. Erweist sich der Sand zum Forttreiben nicht kräftig genug, so wird ein als Scheuche dienendes Schaffell in die Tiefe gesenkt, und fruchtet auch dieses nicht, so greift man zum Äußersten, indem man die betreffende Kammer vermittels eines besonderen Netzes zusammenzieht und dadurch den Tun zum Weichen bringt.
Nach jeder Untersuchung erstattet der Rëis dem Eigentümer geheimen Bericht von der Sachlage, gibt die Anzahl der im Netze befindlichen Tune an und bringt ihm die getroffene Einrichtung, die Verteilung der Fische im Netze usw. zur Kunde.
Ist nun das Netz genugsam bevölkert, und tritt an dem Tage, dessen Erscheinen man mit tausend Wünschen und Gebeten zu beschleunigen sucht, Windstille ein, so kommt es zur Metzelei. Die umliegende Gegend teilt die Spannung und Aufregung der Fischer; aus entfernten Teilen des Landes finden sich die Vornehmen ein, um dem aufregenden Schauspiele beizuwohnen. Als Grundsatz gilt bei allen Tonaren, daß der Fremde, der sich einstellt, willig aufgenommen, auf das freundschaftlichste behandelt und bei der Abreise freigebig beschenkt wird. In der Nacht vor dem Fange treibt der Rëis alle Tunfische, deren Tod beschlossen, in die Vor- oder Goldkammer, einen wahren Vorsaal des Todes, Goldkammer genannt, weil der Tun in diesem Teile des Netzes dem Fischer ebenso sicher ist wie das Gold im Beutel. Nun gilt es, noch ein wichtiges Geschäft abzutun, nämlich denjenigen Heiligen, der zum Schutzherrn des folgenden Tages erkoren werden soll, auszuwählen. Zu diesem Zweck wirft man die Namen einiger Heiligen in einen Glückstopf und zieht einen Zettel heraus. Der erwählte wird während des ganzen folgenden Tages einzig und allein angerufen.
Am Schlachttage begibt sich der Rëis vor Sonnenaufgang zur Insel, um die Tune in die Totenkammer zu treiben: eine Verrichtung, die zuweilen viel Schwierigkeiten verursacht und den Rëis in die äußerste Verlegenheit bringt. Unterdes waffnet man zu Lande die Augen und sieht durch Ferngläser nach der Insel hin, den ersten Wink des Rëis zu bemerken. Sobald dieser alles in Richtigkeit gebracht hat, steckt er eine Fahne aus. Ihr Anblick bringt das Ufer in Aufruhr und Bewegung. Mit Fischern und Zuschauern beladene Fahrzeuge stoßen vom Lande ab; am Ufer läuft alles bunt durcheinander und auf und nieder. Die Fahrzeuge nehmen, schon ehe sie der Insel sich nähern, die Ordnung ein, in der sie um die Totenkammer zu stehen kommen; zwei von ihnen, auf welchen sich die Unteranführer befinden, stellen sich an gewissen Punkten auf, die anderen zwischen ihnen. Je der Mitte der Kammer wählt der Rëis seinen Platz; er führt den Befehl zum Angriffe wie der Admiral am Tage der Schlacht.
Zuerst zieht man unter unaufhörlichem Schreien aller Fischer, zwar äußerst langsam, aber möglichst gleichmäßig, die Totenkammer herauf. Der Rëis ist überall, vorn und hinten, auf dieser, auf jener Seite, schnauzt hier den einen an, schmält mit dem andern, wirft diesem einen Verweis, jenem ein Stück Kork an den Kopf. Je näher die Totenkammer zur Oberfläche emporkommt, um so mehr rücken die Fahrzeuge zusammen. Ein an Stärke stetig zunehmendes Aufkochen des Wassers kündigt die Annäherung der Fische an. Nun begeben sich die Totschläger, bewaffnet mit schweren Keulen, an deren Spitze ein eiserner Haken befestigt wird, nach den beiden Hauptbooten, von denen aus die Tune angegriffen werden. Noch ehe sie ihre Arbeit beginnen, macht sich unter ihnen die größte Aufregung bemerklich.
Endlich gibt der Rëis den Befehl zur Schlacht. Es erhebt sich ein fürchterlicher Sturm, hervorgebracht durch das Umherfahren und gewaltige Umsichschlagen der ungeheuren Fische, die sich eingeschlossen, verfolgt und dem Tode nahe sehen; das schäumende Wasser überflutet die Boote. Mit wahrer Wut arbeiten die Totschläger, weil sie einen gewissen Anteil an der Beute erhalten und deshalb soviel wie möglich und hauptsächlich die größten Tune zu töten suchen. Einem Menschen, der in das Meer fiele oder sonst in Gefahr käme, würden sie jetzt gewiß nicht zu Hilfe kommen, so wie man während der Schlacht auf die Verwundeten auch keine Rücksicht nimmt. Man schlägt, schreit, wütet und zieht den Tun so eilig wie möglich aus dem Wasser. Nachdem sich die Fische einigermaßen vermindert haben, wird eingehalten, die Kammer von neuem herangezogen, der noch übrige Fang enger eingeschlossen, und ein neuer Sturm erhebt sich, ein neues Morden beginnt. So wechseln Schlagen und Anziehen des Netzes, bis endlich auch der Boden der Totenkammer nachgekommen und kein Tun mehr übrig ist. Das Blut der Fische färbt auf weithin das Meer.
Nach Ablauf einer Stunde ist die Metzelei vorüber. Die Fahrzeuge segeln und rudern ans Land. Donner der am Ufer aufgestellten Böller empfängt sie. Noch ehe man ans Ausladen geht, trägt jeder Fischer den ihm zugehörigen Teil davon; sodann beschenkt der Patron den Heiligen, der sich bewährte; unmittelbar nach ihm machen auch die Diebe ihre Ansprüche auf die Ausbeute des Fischfanges geltend. »Man kann sagen«, so drückt sich der Abt wörtlich aus, »daß bei der Tonare jedermann Dieb ist. Das Stehlen ist hier weder eine Schande, noch ein Verbrechen. Dem ergriffenen Diebe widerfährt weiter nichts, als daß er das gestohlene Gut wieder verliert; hat er es aber schon in seine Hütte gebracht, so ist es in Sicherheit. Hierin liegt eine gewisse Billigkeit; denn der Lohn, um den der Unternehmer die Arbeiter dingt, steht mit der ihnen aufgegebenen Arbeit in ungleichem Verhältnisse, und um nun einen Ausgleich zu treffen, muß zum versprochenen Lohne noch eine Zugabe kommen. Aus diesem Grunde also läßt der Patron das Stehlen unter der Bedingung zu, daß es geschehe, ohne ihm kundzuwerden. Diese Art von stillschweigendem Übereinkommen und der Gebrauch, daß der Patron sein Eigentum rettet, wenn er den Räuber fängt, macht ihn und seine Beamten außerordentlich aufmerksam, wogegen die Diebe, die weder Beschimpfungen, noch Strafe, sondern nur Verlust des Gutes zu befürchten haben, sich überaus dreist und flink benehmen müssen. Beim Stehlen einzelner Stücke lassen sie es nicht bewenden; das Beutemachen erstreckt sich auf ganze Tune, und sie wissen tausenderlei Kunstgriffe anzuwenden, um solche in Sicherheit zu bringen. Mit der Hurtigkeit eines Taschenspielers lassen sie einen Tun verschwinden, so wie ein anderer eine Sardelle einsteckt.«
Bei jeder Metzelei, falls es nicht die letzte, leert man das Netz niemals gänzlich, läßt vielmehr, gewissermaßen zur Lockung für den folgenden Fang, etwa hundert Tune und darüber zurück. Nach einiger Zeit wiederholt man Heiligenwahl und Totschlag, und so fährt man fort, solange das Streichen des Tuns anhält. In Sardinien währt dies bis Mitte Juni. In einzelnen Tonaren finden alljährlich acht Metzeleien statt, von denen jede etwa fünfhundert Tune liefert, auf anderen deren bis achtzehn, jegliche zu etwa achthundert Stück; der Ertrag der Fischerei ist also sehr bedeutend. Nach beendigtem Fange hebt man die Totenkammer aus, läßt aber auffallenderweise das übrige Netz im Meere zurück.
Die Ausbeute wird oft an Ausländer, die als Käufer sich eingefunden haben, frisch abgelassen und von diesen in ihrer Art und Weise eingesalzen und eingepökelt; einen etwaigen Rest bringt man an einen schattigen Ort, um die Fische zu zerlegen. Zuerst schlägt man den Kopf ab; sodann schneidet man Knochen und Fleisch zwischen den Flossen aus; hierauf hängt man den riesigen Fisch vermittels Stricke auf, die man am Schwanze befestigt, und führt sechs Längsschnitte, zwei vom After bis an die Spitze des Schwanzes, zwei längs des Rückens und zwei nach dem Schwanze zu, letztere so nahe aneinander, daß nur die oberen Bastardflossen abgesondert werden; endlich wird noch längs jeder Seite eingeschnitten: so gewinnt man Fleischstücke, die man für sehr verschieden erachtet. »Es ist unglaublich«, sagt Cetti, »wie vielerlei Arten von Fleisch man bei unserem Fische findet. Fast an jedem Orte, an jeder verschiedenen Tiefe, wo man mit dem Messer versucht, trifft man auch auf ein anderes, bald auf derbes, bald auf weicheres; an einer Stelle sieht es dem Kalbfleische, an einer anderen dem Schweinefleische ähnlich.« Jede Fleischsorte wird auch besonders eingelegt. Am meisten schätzt man den Bauch, ein wirklich köstliches, weiches, saftiges, schmackhaftes, gehaltvolles Stück, für das man frisch oder eingesalzen noch einmal soviel bezahlt wie für das, das man außerdem für das beste ansieht. Das Fleisch, das eingesalzen werden soll, wird in Tonnen eingelegt und bleibt zunächst acht bis zehn Tage in der Sonne unter freiem Himmel stehen. Hierauf nimmt man es aus den Fässern und läßt es auf schiefliegenden Brettern abseihen, bringt es sodann wieder in die Tonnen, tritt es fest, schließt das Faß, schüttet noch in das Spundloch einen Haufen Salz und Salzlake und verfährt so bis zum Einschiffen. Aus den Knochen und der Haut kocht man Öl. Fünf Fässer, mit verschiedenen Fleischsorten gefüllt, gehören zusammen.
So gesund das frische oder ordentlich eingesalzene Fleisch des Tunes, so schädlich ist das faulige. Die Gräten werden dann rot und der Geschmack so scharf, als ob es mit Pfeffer gewürzt wäre. Sein Genuß bringt Entzündung des Schlundes, Magenschmerz und Durchfall hervor, kann selbst den Tod zur Folge haben. Demgemäß untersucht man obrigkeitshalber in mehreren italienischen Städten die Fische in den Barken, noch ehe sie auf den Markt kommen, namentlich bei Sirocco, und wirft das bereits riechende Fleisch ohne weiteres in das Meer.
Vor dem Kochen sieht das Tunfleisch dem des Rindes ähnlich; nach der Bereitung nimmt es eine lichtere Färbung an. Die Kochkunst der Welschen zeigt sich auch in seiner Verwendung. Man bereitet hier vortreffliche Suppen, köstlichen Braten aus dem Fleische, dämpft, schmort und kocht es, genießt es geräuchert mit Salz und Pfeffer wie Lachsfleisch usw.
Eine zweite Art der Sippe ist der allen Seefahrern und Reisenden wohlbekannte Bonito ( Thynnus pelamys). In seiner Gestalt ähnelt er dem Tune, ist aber beträchtlich kleiner und erreicht selten mehr als ein viertel Meter an Länge. Rücken und Seiten schillern aus Stahlblau in Grün und Rot; der Bauch sieht silbern aus und zeigt braune Streifen, vier längs jeder Seite, die von der Kehle bis zur Schwanzflosse verlaufen. Der wunderbare Glanz der Farben und die Schönheit des Fisches sollen übrigens jeder Beschreibung spotten.

Ausschau nach Tunfischen
Im Atlantischen Meere hingegen gehört der Bonito zu den häufigen Fischen. Nach Kittlitz folgt er in Gesellschaft der Tune oft lange Zeit dem Schiffe, das er als seinen Wegweiser durch das Weltmeer zu betrachten scheint, schwimmt zwar neben seinen Verwandten, aber doch in regelmäßig geordneten Haufen und macht sich sehr bemerklich, weil er zu den eifrigsten Verfolgern der fliegenden Fische gehört. Außer diesen nährt er sich auch von andern seiner Klassenverwandten, Tintenfischen, Schaltieren und selbst Pflanzenstoffen; seine hauptsächlichste Jagd aber gilt den Fliegfischen. »Die Tunfische«, sagt Kittlitz, »Tun und Bonito, stürzen sich auf die fliegenden Fische mit gewaltiger Geschwindigkeit; sie ersetzen den Flug derselben zum Teil durch hohe Sprünge, wobei es ihnen nicht selten glückt, die Beute noch in der Luft zu erhaschen. Das Aufspritzen der Wellen, das Geräusch beim Aufsteigen und Niederfallen, verbunden mit der schon durch den Wind verursachten Wellenbewegung, gewährt bei der ungeheuren Menge der jagenden und gejagten Fische ein eigentümliches Schauspiel, bei dem man nicht wenig erstaunt über die Menge der fliegenden Fische, die dem Feinde wirklich in den Rachen fallen.« Die Matrosen wissen dies zu ihrem Vorteil auszubeuten, indem sie einen kleinen Fisch oder ein mit glitzerndem Papiere überzogenes Korkstück mit Federn bekleiden, um ihm das Ansehen eines fliegenden Fisches zu geben, und es an einer Angelleine über das Wasser hängen. Nach diesem Köder springt der Bonito bei raschem Gange des Schiffes meterhoch und fängt sich dann in der Regel sicher. Das Fleisch soll trocken und keineswegs schmackhaft sein, zuweilen sogar giftige Eigenschaften besitzen.
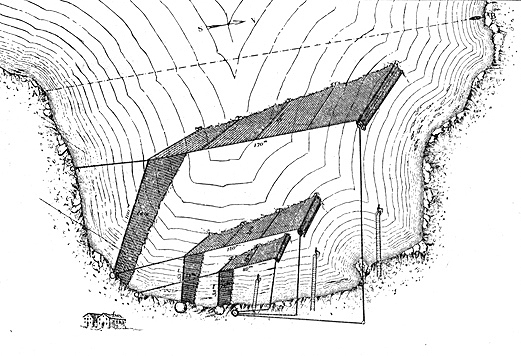
Tunfischtonnare
Mit den Makrelen vereinigte man früher auch die Stöcker ( Crangidae) die Günther neuerdings in einer besonderen Familie zusammenstellt. Sie unterscheiden sich von jenen, denen sie äußerlich ähneln, hauptsächlich durch ihr Knochengerüst, insbesondere die Anzahl der Wirbel, die geringer als bei den Makrelen ist. Der Leib ist meist seitlich zusammengedrückt, lang oder kurz und hoch, mit kleinen Schuppen bekleidet oder nackt, die Beflossung der der Makrelen sehr ähnlich.
Auch diese Fische bewohnen die Meere aller Gürtel und leben im ganzen nach Art der Makrelen, halten sich zumeist in den tieferen Wasserschichten auf, scharen sich in Schwärme und verfolgen kleinere Fische oft mit solchem Eifer, daß sie beim Aufsteigen von unten her mit dem Kopfe über der Oberfläche des Wassers erscheinen. Einzelnen Fischen gehen sie nicht nach; gescharten Schwärmen aber werden sie nicht minder verderblich als die Makrelen. Ihr Fleisch ist geschätzt, obgleich es dem der letzterwähnten Fische an Güte nachsteht.
Die Bastardmakrelen ( Caranx) kennzeichnen sich vornehmlich durch die Bepanzerung ihrer Seiten mit gekielten Schuppenschildern, deren jedes einen Stachel trägt, so daß, laut Geßner, ein Strich entsteht, »so rauh wie eine Sege.« Der Stöcker ( Caranx trachurus) gleicht in seiner Gestalt den Makrelen und hat einen spindelförmigen Leib, spitzigen Kopf und dünnen Schwanz mit starker Flosse wie sie. Seine Länge beträgt etwa dreißig Zentimeter. Die Färbung ist oben blaugrau, unten silbern; die Flossen sehen graulich aus.
Hinsichtlich der Verbreitung kommt der Stöcker ungefähr mit der Makrele überein. Auch er findet sich ebensowohl im Mittelmeer wie im Atlantischen Weltmeer, einschließlich der Nordsee, kommt dagegen in der Ostsee nur sehr selten vor. An den Küsten von Cornwall und Devon gehört er, laut Couch, zu den regelmäßigen Erscheinungen, wird zwar gewöhnlich nur einzeln bemerkt, tritt aber zuweilen in außerordentlichen Massen auf. Vor April trifft man ihn selten, von dieser Zeit an häufig und überall. Sein Lieblingsaufenthalt ist das Wasser unmittelbar am Gestade, zuweilen kommt er so nahe an das Land, daß man ihn von hier aus mit Händen greifen kann. An einem Abend im August wurden etwa zehntausend Stück mit einem Handnetz gefangen. Am folgenden Tage erschien ein anderes Heer am Strande, und Männer und Weiber, alt und jung watete in das Wasser, um Fische zu fangen, während andere am Ufer beschäftigt waren, die erbeuteten und die ihnen zugeworfenen in Sicherheit zu bringen. Im Jahre 1834 näherte sich, laut Bicheno, ein unzählbarer Schwarm der irischen Küste. So weit das Auge reichte, schien die See in Gärung begriffen. Der Schwarm kam ebenfalls bis unmittelbar an das Ufer heran, und diejenigen Leute, die auf einem etwas vorspringenden Felsen Fuß fassen konnten, brauchten nur ihre Hände ins Wasser zu halten und zuzugreifen; ja, jeder geschickte Griff brachte nicht bloß einen, sondern drei bis vier dieser Fische in ihre Gewalt. Badende wurden an allen Stellen ihres Leibes durch die Stöcker belästigt; denn die Oberfläche der See schien mehr aus Fischen als aus Wasser zu bestehen. Man sah die dunkle Masse der ersteren bis weit hinaus auf das Meer die oberen Wasserschichten erfüllend. Jede Art von Netz wurde hervorgesucht und in Anwendung gebracht; nur die wenigsten aber konnte man aufnehmen, weil die Last der gefangenen Fische viel zu groß war, als daß man sie bergen konnte. Mehrere Netze mußte man bis an den Strand ziehen, um sie hier zu entleeren. Ein Heringsnetz mit weiten Maschen erwies sich besonders erfolgreich; jede Masche hielt einen Fisch, so daß eine förmliche Mauer entstand, die ebenfalls bis zum Strande geschleppt werden mußte. An ein Zählen oder Schätzen der gefangenen Stöcker war gar nicht zu denken: man rechnete nach Karrenladungen. Dieses massenhafte Auftreten unserer Fische währte eine Woche lang, und dabei zeigte sich, daß die Morgen- und Abendstunden ihre Futterzeit sein mußten, weil sie gerade dann erschienen, junge Heringe verfolgend und mit ihnen den Magen sich füllend.
Leider läßt sich das Fleisch des Stöckers mit dem seiner Verwandten, der Makrele, nicht vergleichen. In Großbritannien nennt man den Fisch »Roßmakrele«, um die Ungenießbarkeit oder doch Schmacklosigkeit seines Fleisches anzudeuten.
*
Zu den Makrelen zählte man früher auch die Schwertfische ( Xiphidae), weil der innere Bau beider in vielen Punkten übereinstimmt; die Eigentümlichkeit der ersteren erscheint jedoch zu einer Trennung wichtig genug: denn nicht bloß die Bildung der oberen Kinnlade, sondern auch die Gestalt der Flossen und der Mangel an Zähnen sind bedeutsame Merkmale. Der Leib der Schwertfische ist verlängert, seitlich ein wenig zusammengedrückt, hinten fast rund, der vordere Teil des Rückens von der ersten Rückenflosse an nach dem Kopfe zu allmählich eingesenkt, die obere Kinnlade in einen schwertförmigen Fortsatz ausgezogen, der aus einer breiten, mehr und mehr sich verschmälernden, am Ende in eine stumpfe Spitze auslaufenden, an den Rändern schneidigen und feingezähnelten, anfangs gewölbten, gegen die Wurzel hin platten, an ihr sogar eingetieften, oben gestreiften, unten einmal gefurchten Platte besteht, die durch die verlängerten und umgewandelten Kinnladen hergestellt wird.
Vertreter der Meerschwerter ( Xiphias) ist der Schwertfisch, wie er in allen Sprachen genannt wird ( Xiphias gladius), ein gewaltiges Tier von drei bis fünf Meter Länge, wovon das Schwert etwas mehr als den vierten Teil wegnimmt, zwei- bis vierhundert Kilogramm Gewicht und bläulicher, unten lichterer Färbung. Anstatt der Schuppen ist es mit einem rauhen Fell bekleidet.
Der Schwertfisch bewohnt ständig das Mittelländische Meer und ist namentlich um Sizilien nicht selten. Aber er beschränkt sich keineswegs auf dieses Becken, sondern durchschweift auch das Atlantische Meer nach Norden hin bis Großbritannien und Norwegen, dringt selbst in die Ostsee ein und wird anderseits längs der ganzen afrikanischen Küste wie auch im Indischen Meere allerorten beobachtet. Er ist somit ein Weltbürger. Er hält sich fast nur in den oberen Schichten des Wassers auf, so daß seine Rückenflosse gewöhnlich über die Oberfläche hervorragt. Er gehört zu den schnellsten und im Verhältnis ihrer Größe gewandtesten Fischen und ist deshalb fähig, sich kleinerer Klassenverwandten zu bemächtigen, die neben mancherlei Tintenfischen seine bevorzugte, wo nicht ausschließliche Nahrung bilden. Der Schwertfisch wird meist paarweise gefunden.
Die allgemeine Ansicht der neueren Beobachter geht dahin, daß der Schwertfisch eigentlich ein gutmütiges, harmloses und furchtsames Tier ist, jedoch zuweilen Anfälle von einer sonderbaren Wut und Zerstörungslust an den Tag legt und dann wirkliche Gewaltstreiche ausübt. Gelegentlich der Beschreibung des Tunes, sagt der alte Geßner auch, daß letztgenannter Fisch lebhafte Furcht vor dem Schwertfische habe. Diese Angabe wird von Bennett bestätigt. »Oft genug«, sagt er, »sieht man Tunfische in dicken Haufen ein Schiff umgeben, als wollten sie hier Zuflucht suchen vor den gefürchteten Angriffen ihres größten Feindes, des Schwertfisches, der aber gerade unter solchen Umständen sich unter sie stürzt und viele von ihnen durchbohrt. Er ist in der Tat ein gewaltiger Feind aller Tune und ihrer Verwandten, und gar oft sieht man, wie er mit seinem Schwerte mehrere nacheinander durchsticht.« Die Behauptung, daß der Schwertfisch auch Wale angreife, ist neuerdings ebenfalls bestätigt worden, weil es sich höchstwahrscheinlich nicht um unseren Fisch, sondern um den gleichnamigen Wal handelt. »Eines Morgens«, erzählt Crow, »während einer Windstille, die unser Schiff in der Nähe der Hebriden überfiel, wurde die Mannschaft zusammenberufen, um einer Schlacht zwischen Fuchshaien oder sogenannten Dreschern nebst einigen Schwertfischen einerseits und einem riesigen Wale anderseits zuzusehen. Es war im Hochsommer, das Wetter klar und der Fisch nahe bei unserem Schiff; wir hatten also die beste Gelegenheit zur Beobachtung. Sobald der Rücken des Wales über dem Wasser erschien, sprangen die Drescher mehrere Meter hoch in die Luft, stürzten sich mit großer Kraft auf den Gegenstand ihres Hasses und brachten demselben derbe Schläge mit ihren langen Schwänzen bei, Schläge von solcher Heftigkeit, daß es klang, als ob Gewehre in einiger Entfernung abgefeuert würden. Die Schwertfische ihrerseits griffen den unglücklichen Wal von unten an, und so, von allen Seiten umlagert und überall verwundet, wußte sich das arme Geschöpf nicht mehr zu retten. Als wir ihn aus den Augen verloren, war das Wasser ringsum mit Blut bedeckt, und die Marter währte noch fort. An seiner gänzlichen Vernichtung zweifelten wir nicht.« Allerdings gebraucht unser Berichterstatter das Wort » stab«, erdolchen, durchbohren, tödlich verwunden. Ferner ist es bestimmt bewiesen, daß er andere größere Tiere durchstochen hat; und endlich versichert Daniel, daß ein im Severn unweit Worcester badender Mann von einem Schwertfische durchbohrt und der Übeltäter unmittelbar darauf gefangen wurde.
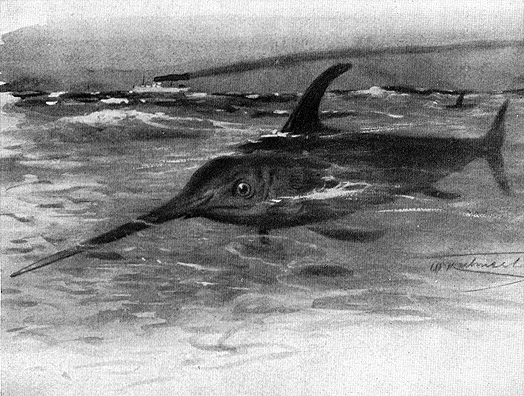
Schwertfisch ( Xiphias gladius)
Schiffe sind von Schwertfischen mehrmals angebohrt und Planken, die noch das Schwert in sich tragen, in mehreren Museen zur Schau ausgestellt worden. Als im Jahre 1725 das britische Kriegsschiff »Leopard« ausgebessert werden mußte, fand man in einer Seitenplanke desselben ein abgebrochenes Schwert unseres Fisches, das die äußere zolldicke Verschalung, eine Pfoste von acht und eine Rippe von zehn Zentimeter Dicke durchbohrt hatte, und ebenso entdeckte man in einem aus der Südsee zurückgekehrten Schiffe die ebenfalls abgebrochene Waffe des gewaltigen Ungetüms, die nicht allein die Verschalung, eine acht Zentimeter dicke Planke, durchstoßen hatte, sondern auch durch einen dreißig Zentimeter dicken gebogenen Balken gedrungen war und noch außerdem den Boden eines Tranfasses zertrümmert hatte. Ein Stoß von solcher Kraft macht den Eindruck, als ob das Schiff auf einen Felsen geraten wäre; die jenem zugefügte Gefahr würde auch annähernd dieselbe sein, wenn es dem Fische möglich wäre, sein Schwert wieder herauszuziehen, was glücklicherweise nicht der Fall zu sein scheint. Immer fand man es abgebrochen, durfte deshalb auch mit Gewißheit annehmen, daß der wütende Gesell seinen verwegenen Versuch mit dem Leben gebüßt hatte. Anders verhält es sich, wenn er seine Kraft an Fischerbooten erprobt: es sollen wirklich mehrere Fälle gerichtlich festgestellt worden sein, daß Boote durch Schwertfische zum Sinken gebracht wurden.
Heutzutage sieht man das Fleisch des jungen Schwertfisches als vorzüglich an. Von den Alten wurden namentlich ein Teil des Schwanzes und die um die Flossen liegenden Muskeln als Leckerbissen betrachtet. Man macht daher eifrig Jagd auf ihn. Der Fang ähnelt dem der Wale.
*
Die Meergrundeln ( Gobiidae) sind größtenteils kleine, langgestreckte Fische mit nackter oder beschuppter, schleimiger Haut, zwei Rückenflossen, deren vordere ebenfalls oft biegsame Strahlen besitzt, zuweilen aber auch mit der zweiten sich vereinigt, und weit vorstehenden Bauchflossen, die entweder an der Wurzel oder ihrer ganzen Länge nach verbunden einen Trichter oder eine hohle Scheibe bilden. In der Kiemenhaut finden sich fünf Strahlen. Bei den Männchen, in einzelnen Sippen auch bei den Weibchen, gewahrt man eine sogenannte Geschlechtswarze an dem After. Bei manchen Arten unterscheiden sich beide Geschlechter sehr auffallend.
Weitaus der größte Teil aller Grundeln lebt im Meere. Sie bevorzugen felsigen Grund, setzen sich hier zwischen Steinen fest und jagen nach Würmern und Garnelen, fressen aber auch Fischeier und Tange, halten sich meist truppweise zusammen und vereinigen sich, wenn sie erschreckt wurden, rasch wieder, um gemeinschaftlich zu fliehen. Im Wasser schwimmen sie mit großer Gewandtheit; aber auch auf schlammigem Grunde verstehen sie trefflich sich zu bewegen, indem sie ihre Brustflossen wie Beine gebrauchen. Gleich den Lungen- und Labyrinthfischen können sie stunden- oder tagelang außerhalb des Wassers verweilen, möglicherweise sogar unmittelbar die Luft zum Atmen gebrauchen. Ihre Vermehrung ist sehr beträchtlich, und die Fortpflanzung hat insofern etwas Eigentümliches, als die Männchen regen Anteil an der Brut nehmen, namentlich die Eier bewachen. Im menschlichen Haushalte spielen sie keine bedeutende Rolle; ihr Fleisch ist nicht besonders geschätzt.
Grundeln im engeren Sinne ( Gobius) nennt man diejenigen Mitglieder der Familie, bei denen die Bauchflossen ihrer ganzen Länge nach verwachsen sind. Eine der verbreitetsten und bekanntesten Arten dieser zahlreichen Sippe ist die Schwarzgrundel ( Gobius niger), ein Fischchen von zehn bis höchstens fünfzehn Zentimeter Länge, düsterer, auf der Bauchseite lichterer Färbung, gezeichnet mit Wolkenflecken, die gewöhnlich dunkelbraun aussehen, zuweilen auch verblassen, auf Rücken- und Schwanzflosse schwärzlich gebändert, auf den ölfarbenen Brustflossen braun gestrichelt.
In namhafter Anzahl tritt die Schwarzgrundel im Mittelmeer und in der Nordsee auf, fehlt aber auch dem Atlantischen Weltmeer, dem Kanal, der Nord- und der Ostsee nicht, obgleich sie in letzterer nur an wenigen Stellen, beispielsweise in der Kieler Bucht und an der neuvorpommerschen Küste, gefangen wird. Sie wohnt auf felsigem Grunde, saugt sich hier jedoch nicht fest, sondern legt sich auf den Boden. In der Nähe der Flußmündungen hält sie sich gern auf; das Süßwasser scheint sie nicht zu besuchen. Kleine Kruster, allerlei Gewürm und ähnliche Stoffe bilden ihre Nahrung. Nach Couch raubt sie von einem versteckten Platze aus und kehrt mit der gefangenen Beute regelmäßig dahin zurück, um sie hier zu verzehren. Ihre Laichzeit fällt in den Mai oder Juni; um diese Zeit verläßt sie die Felsen, die sie bis dahin bewohnte, zieht nach den mit Seegras überwachsenen Stellen der Küste und gräbt hier, wie Olivi beobachtete, eine tiefe, geräumige Wohnung, deren Gewölbe von den Wurzeln gedachter Pflanzen gebildet wird, um die Eier abzusetzen. Wie bei den Stichlingen ist das Männchen der Baumeister, wie bei jenen überwacht es den Eingang seines Hauses und lauert auf die Weibchen, die zum Laichen erscheinen. Jedes ankommende Weibchen wird herbeigelockt, der Zugang in das Innere ihm gestattet und der von ihm gelegte Rogen unmittelbar nach dem Legen befruchtet. Hierauf bleibt das Männchen etwa zwei Monate lang treuer Hüter der anvertrauten Eier, verteidigt sie mutig gegen jeden Feind, magert während dieser Zeit zusehends ab und scheint seiner gänzlichen Erschöpfung nahe zu sein, wenn die heranwachsende Brut das elterliche Haus verläßt und den treuen Wächter aller Sorgen überhebt. Ist der Besuch der Weibchen zahlreich, so wird die Wohnung vergrößert und oft mit mehreren Ausgängen versehen; fehlt es an Einkehr, so wird das Nest verlassen und an einer günstigeren Stelle ein neues angelegt.
Die Schwarzgrundel war von jeher ein Lieblingsgericht der Venetianer, bei den Bewohnern Roms aber verachtet:
»Wenn im Venetischen Land auch prächtig sind die Gelage,
Anfang des Mahles pflegt dennoch die Grundel zu sein«,
spottet Martial. Heutzutage schätzen die Italiener besonders die große und wohlschmeckende Leber, stellen deshalb den Grundeln mit Netzen oder mit der Angel eifrig nach. In geeignet eingerichteten Becken lassen sich Gefangene lange Zeit am Leben erhalten.
*
In den Küstensümpfen und brackigen Gewässern unweit der Meere des heißen Gürtels, insbesondere in West- und Ostafrika sowie vielen Eilanden des Indischen und Stillen Weltmeeres, leben Grundeln, die vermöge des Baues ihrer Kiemen noch länger außerhalb des Wassers leben können als die Verwandten, dementsprechend fast den größten Teil des Tages in feuchtem Schlamme verbringen und hier in sonderbarer Weise sich bewegen. Man nennt sie Schlammgrundeln ( Periophthalmus). Ihre Brustflossen sind sehr lang, sozusagen armförmig und beschuppt, die Bauchflossen verwachsen, die Kopfseiten beschuppt. Die einander nahegestellten, vortretenden Augen lassen sich durch ein unteres Lid bedecken. Die Kiemen bilden nur eine Ritze.
Vertreter der Sippe ist der Schlammspringer ( Periophthalmus koelreuteri), ein Fischchen von etwa fünfzehn Zentimeter Länge und vielfach abändernder Färbung und Zeichnung, meist auf lichtbraunem Grunde mit silbernen und braunen Flecken gezeichnet und durch ein schwarzes, weiß gesäumtes Längsband in der oberen Hälfte der hinteren Rückenflosse sowie Flecke und Tüpfel in den Brust- und Bauchflossen noch besonders geziert.
Wenn irgendein Fisch den Namen Baumsteiger verdient, so ist es der Schlammspringer; denn seine Brustflossen scheinen ganz danach gebaut zu sein, ihm ein Klettern zu ermöglichen. Sie sind eher Füße als Flossen, werden auch vollständig als solche gebraucht. Alle Schlammgrundeln betreiben ihre Jagd weniger im Wasser als auf dem Lande. Sie leben wie Lurche, liegen meistens auf dem Schlamme, laufen hier oder am Strande wie Eidechsen davon und stürzen sich auf ihren Raub mit solcher Schnelligkeit los, daß sie ihn selten verfehlen. Werden sie verfolgt, so fahren sie wie ein Pfeil über den Schlamm hinweg, bohren sich in ihm ein und verstecken sich auf diese Weise. »Ich habe«, so schreibt mir Pechuel-Loesche, »den seltsamen Fisch nur im Brackwasser innerhalb der Flußmündungen und deren Seitenarmen, niemals in abgelegenen oder übermäßig salzhaltigen Lagunen gefunden; mit Vorliebe scheint er sich in den Mangrovenbeständen aufzuhalten. Am eingehendsten habe ich ihn kurz oberhalb der Mündung des Tschiloango und des Kuilu an der Loangoküste beobachtet. Namentlich bei Ebbe und stillem Wetter erscheint er dort zu Dutzenden auf den frei gewordenen flachen, nassen Uferstrecken, gewöhnlich am Rande und im Schatten der Mangrovendickungen, innerhalb deren er jederzeit sein Spiel treiben mag, trockenen sowie mit Gras und Kraut bewachsenen Boden vermeidend. Wie es scheint, halten sich die Fische gleicher Größe in gesonderten, mehr oder weniger zahlreichen Abteilungen zusammen. Fühlen sie sich sicher, so hüpfen sie durch geringes Krümmen und Strecken des Körpers, indem sie sich auf Schwanz und Flossen stützen, in ganz kurzen Sätzen vorwärts und hinterlassen dabei eine bezeichnende Fährte im weichen Schlamme; oder sie liegen behaglich und beliebig zerstreut umher: dann versucht sich der eine oder andere wie aus Übermut in einem Sprunge, und zuweilen hüpfen viele wie spielend und sich jagend durcheinander. Dabei ereignet es sich auch, daß plötzlich ein Fisch vom Boden auf eine Mangrovenwurzel springt und sich dort, etwa um seine eigene Körperlänge von der Erde entfernt, mit seinen Flossen festklammert. Wie die Tiere höher steigen, habe ich nie sehen können, vermute aber, daß sie, da sie nur an schwachen Wurzeln sitzen, durch Umfassen mit den Flossen und Schieben mit dem Schwanze, ähnlich wie auf der Erde, sich hocharbeiten. Jedenfalls habe ich beobachtet, daß erschreckte Fische meterhoch von Mangrovenwurzeln sich herabfallen ließen; ferner habe ich auch die Überzeugung gewonnen, daß die Tiere stundenlang außerhalb des Wassers zubringen können. Sie sind übrigens ziemlich scheu und sichern bei Annäherung von verdächtigen Wesen in drolliger Weise, indem sie sich mittels der Flossen etwas aufrichten; bewegt man sich nicht und überrascht sie durch ein Husten, Pfeifen oder Klopfen, so ducken sie sich wohl auch schnell und regungslos wieder nieder und entfliehen dann in sehr hurtigen Sprüngen ins tiefe Wasser, wo sie im Nu verschwinden. Die Weite der sehr schnell aufeinander folgenden Sprünge mag das Doppelte und Dreifache der Körperlänge, vielleicht auch noch mehr betragen. Bei eiliger Flucht durchmessen sie flaches Wasser, in welchem sie recht wohl schwimmen könnten, dennoch ebenfalls hüpfend und erzeugen dabei ein eigenartiges Geplätscher, namentlich wenn man viele derselben vor sich hertreibt. Unversehrte konnten wir nie erlangen, da aber die schwarzen Knaben dieselben in unserem Auftrage mit leichten Pfeilen schossen, hatten wir mehrmals leicht verwundete Fische, die noch munter auf dem Tische umherhüpften.«
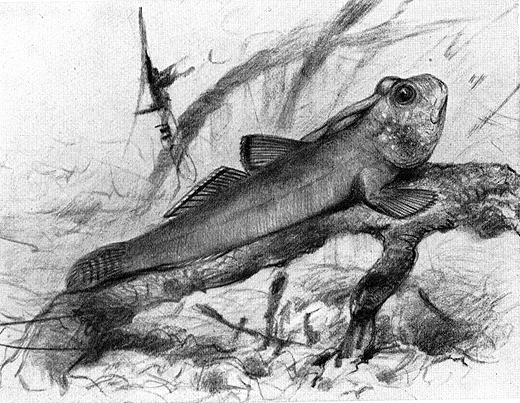
Schlammspringer ( Periophthalmus koelreuteri)
Die Nahrung der Schlammspringer besteht, wie wir durch andere Beobachter wissen, aus Krebsen und Kerbtieren.
*
Cuvier trennte gegen ein Dutzend schuppenlose, grundelartige Fische, deren Bauchflossen zu einer Scheibe zusammengewachsen sind, von den Meergrundeln, erhob sie zu einer besonderen Familie und nannte sie Scheibenbäuche ( Discoboli). In der Lebensweise stimmen die Scheibenbäuche in vieler Hinsicht mit den Grundeln überein, halten sich wie letztere fast nur auf felsigem Grunde auf, saugen sich hier vermittels ihrer Scheibe fest und lassen sich höchstens durch eine sich ihnen nähernde Beute bewegen, den Grund zu verlassen.
Obenan stellt man die Lumpfische ( Cyclopterus), vierschrötige, sonderbar gestaltete Tiere mit einer großen, auf beiden Seiten gespaltenen Scheibe, die durch die Strahlen der um das Becken herum befestigten Bauchflossen gebildet wird, kurzer Rücken- und Afterflosse, weitem Maule, klebriger, mit vielen Knoten besetzter Haut und fast knorpeligem Gerippe. Der bekannteste Vertreter dieser Sippe ist der Seehase, Seebulle oder Lump ( Cyclopterus lumpus), ein Fisch von etwa sechzig Zentimeter Länge, drei bis vier, in seltenen Fällen sogar sechs bis sieben Kilogramm Gewicht und schwarzgraulicher, nach unten gelblicher, übrigens vielfach abändernder Färbung, dessen erste Rückenflosse gänzlich verkümmert ist.
Alle nördlichen Meere, namentlich die Nord- und Ostsee, beherbergen den Seehasen, und man muß wohl annehmen, daß er sehr häufig ist, da seine Vermehrung ins Erstaunliche gehen kann. Gleichwohl wird er infolge seiner eigentümlichen Lebensweise nicht oft gefangen. Er ist ein sehr schlechter Schwimmer, der sich selten und, wenn wirklich, nur langsam, unter wedelnden Bewegungen seines unverhältnismäßig schwachen Schwanzes bewegt, vielmehr an Felsen und Steinen vermittels seiner Bauchflosse, deren er sich wie eines Schröpfkopfes bedient, festheftet und hier der Dinge wartet, die kommen. Der Zusammenhang seiner Scheibe mit den Gegenständen, auf denen er sich befestigt hat, ist ein sehr inniger: Hannox berechnete, daß eine Kraft von sechsunddreißig Kilogramm Gewicht erforderlich sei, um einen zwanzig Zentimeter langen Seehasen loszureißen. Quallen und kleine Fische bilden seine Nahrung.
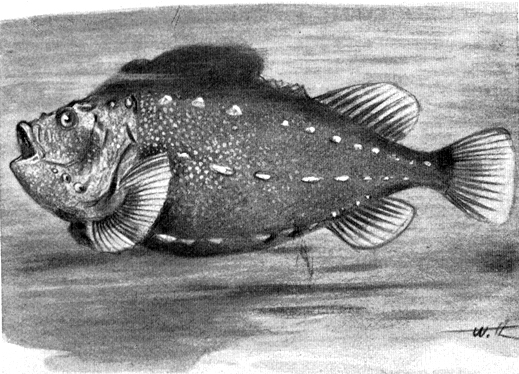
Seehase ( Cyclopterus lumpus)
Gefangene saugen sich sofort an einer geeigneten Stelle des Beckens, auch an der glättesten Glastafel, fest und verweilen in dieser Stellung stunden- und halbe Tage lang, ohne etwas anderes als ihre Kiemen zu rühren, lassen sich durch ihnen zugeworfenes Futter aber doch bewegen, ihren Platz zu verlassen. Im Becken schnappen sie nach Muschelfleisch und Würmern, verschonen aber kleine Fische fast gänzlich.
Gegen den März hin ändern sich Färbung und Wesen des Seehasen, indem erstere ins Rötliche übergeht, letzteres insofern, als der Fisch jetzt sich aufmacht, um seichtere, zum Laichen geeignete Küstenstellen aufzusuchen. Fabricius gibt an, daß der Lump den felsigen Buchten Grönlands zu Ende des April oder im Anfang des Mai sich nähert, daß die Rogener vorausziehen und die Milchner ihnen unmittelbar folgen, daß erstere ihren Laich zwischen größeren Algen, vorzugsweise in Felsspalten, ablegen, die letzteren diesen befruchten und dann dicht neben oder über den Eiern sich festsetzen. Die Vermehrung ist eine ganz außerordentlich starke. Bei einem Weibchen von drei Kilogramm Gewicht wog der Rogen ein Kilogramm; jedes Eichen aber hat die Größe eines mäßigen Schrotkornes: die Gesamtmasse würde also nur nach Hunderttausenden zu berechnen sein. Fabricius erwähnt, daß das Männchen bei den Eiern treue Wacht hält und wirklichen Mut bekundet, sogar dem fürchterlichen Seewolf tödliche Wunden beibringt. Johnston erzählt, daß das Männchen die Eier bedeckt und in dieser Lage verweilt, bis die junge Brut ausschlüpft. Bald, nachdem dies geschehen, heften sich die Jungen an den Seiten und auf dem Rücken des Männchens fest, und nunmehr macht dieses mit der teueren Ladung sich auf, um die Brut in tiefere und sichere Gründe zu tragen. Gegen Ende November haben die Jungen eine Länge von zehn Zentimeter erreicht.
In Grönland und Island erbeutet man ihn mit Netzen oder spießt ihn mit einem gabelförmigen Eisen an, wenn man ihn zwischen den Meerpflanzen liegen sieht. Einen viel schlimmeren Feind als den Menschen hat er an dem Seehunde, der ihn sehr gern zu fressen scheint, obgleich er ihn vorher erst mühsam schälen muß. Das Fleisch der Weibchen ist mager und schlecht, das der Männchen fett und schmackhaft, gilt sogar bei den Isländern, namentlich wenn es einige Tage in Salz gelegen, als Leckerbissen und wird als solcher fremden Gästen vorgesetzt.
Zu den häßlichsten und ungestaltetsten aller Fische gehören die Armflosser ( Pediculati). Als wichtigstes Merkmal der Familie, die nicht mehr als ein Dutzend Arten zählt, müssen die verlängerten Handknochen der Brustflossen angesehen werden, die gewissermaßen einen Fuß bilden und auch wirklich zur Stütze dienen, ja sogar sie befähigen, nach Art der Säugetiere über schlammigen Grund wegzukriechen. Sonderbare Anhängsel, die wirklich gebraucht werden, um andere Fische herbeizulocken, stehen auf dem meist ungeheuerlich verbreiterten Kopfe. Das Maul ist außerordentlich groß, der Magen ein weiter Sack, der Darmschlauch hingegen sehr kurz. In den nördlichen Meeren leben wenige Arten; denn auch diese Familie gehört vorzugsweise den Gleicherländern an und entfaltet hier ihre eigentliche Mannigfaltigkeit.
Geßner nannte »den sonder scheußlich, häßlichen Fisch« Meerteufel, und dieser Name ist ihm bis heute geblieben. Sein und seiner Sippschaftsgenossen ( Lophius) Kopf ist außerordentlich groß, breit, zusammengedrückt und stachelig, der Rachen sehr weit gespalten und mit vielen scharfspitzigen, nach innen gebogenen, beweglichen Zähnen bewehrt. Der Leib verdünnt sich unmittelbar hinter dem Kopfe und ist gegen das Schwanzende hin seitlich stark zusammengedrückt.
Die Färbung der Oberseite des Anglers oder Seeteufels ( Lophius piscatorius) ist ein gleichförmiges Braun, das nur auf den Flossen ein wenig dunkelt; die Unterseite, einschließlich der Bauch- und Brustflossen, sieht weiß, die Schwanzflosse dunkelbraun, fast schwarz aus. An Länge kann das Tier fast zwei Meter erreichen; es werden jedoch selten Stücke von dieser Größe gefangen. Alle europäischen Meere beherbergen den Seeteufel, besonders häufig das Mittelländische und Atlantische Meer; auch an den Küsten Großbritanniens ist er nicht gerade selten. Wie Geßner beschrieben, hält er sich auch auf dem schlammigen Grunde des Meeres auf, wühlt sich hier mit Hilfe seiner Brustflossen in den Schlamm und lauert auf Beute. Naht ihm irgendein Raubfisch, so bewegt er die Fangfäden in verschiedenen Richtungen, lockt dadurch seine Beute heran, stürzt hervor und begräbt sie in seinem weiten Schlunde. Hinsichtlich der Beute macht er keinen Unterschied, ebensowenig was die Größe als was die Art anlangt. Ein Fischer, der einen Schellfisch geangelt hatte und denselben emporzog, fühlte, wie Couch mitteilt, Plötzlich, daß sich das Gewicht desselben vermehrte, und erkannte die Ursache in einem Angler, der den ganzen Schellfisch verschlungen hatte, auch erst durch mehrere heftige Schläge auf den Kopf veranlaßt werden konnte, die Beute loszulassen. Bei einer andern Gelegenheit packte ein Angler einen Meeraal, der eben angebissen hatte; dieser aber versuchte noch, nachdem er in dem ungeheueren Rachen eingeschlossen war, zu entrinnen und zwischen den Kiemenblättern durch zu entkommen, hatte sich auch schon halb durchgewühlt, als beide emporgezogen wurden. Rücksichtlich der Fortpflanzung wissen wir, daß er viele Eier legt, die mit einer harten Hülle umgeben sind; gleichwohl soll seine Vermehrung nicht bedeutend sein, weil diese Eier in Klumpen gelegt und von anderen Fischen verzehrt werden.
Im Norden macht man, wie bemerkt, keinen Gebrauch von gefangenen Fischen dieser Art; am Mittelmeere hingegen wird das Fleisch wenigstens von ärmeren Leuten gegessen.
Die Familie der Schleimfische ( Blenniidae) führt ihren Namen insofern mit vollstem Rechte, als die meisten ihrer Mitglieder eine nackte oder mit sehr kleinen, runden Schuppen besetzte, schleimige Haut haben. Der Leib ist gestreckt, seitlich zusammengedrückt, der Kopf groß und etwas plump. Die Bauchflossen stehen an der Kehle und werden nur aus zwei oder drei biegsamen Strahlen zusammengesetzt; die Rückenflossen sind, obschon ein vorderer und hinterer Teil noch erkennbar, zu einer verschmolzen, ihre Strahlen ebenfalls weich und biegsam, Brust-, After- und Schwanzflosse gewöhnlich groß und kräftig. Das Gebiß besteht aus langen, dicht nebeneinander stehenden Zähnen, die eine einzige, sehr regelmäßige Reihe in jeder Kinnlade bilden. Vor den Augen, zuweilen auch an den Nasenlöchern oder an den Backen, erheben sich verschieden gestaltete Fühlfäden. Beide Geschlechter unterscheiden sich gewöhnlich ziemlich auffällig, die Männchen von den Weibchen namentlich dadurch, daß sie am Ausgange der Samengänge mehr oder weniger hohe Kämme oder einen Haufen von Warzen haben. Auch die Schleimfische gehören fast ausschließlich dem Meere an. Sie sind tüchtige Raubfische, mehrere Arten auch sehr boshafte, bissige und deshalb von den Fischern gefürchtete Tiere. Ihre Nahrung besteht aus anderen Fischen und allerlei wirbellosen Seetieren, namentlich Würmern und Muscheln.
Die Wolfsfische ( Anarrhichas) übertreffen ihre sämtlichen Verwandten an Größe und Bewaffnung. Ihr Leib ist lang und zusammengedrückt; die Rückenflosse verläuft über die ganze Oberseite, vereinigt sich aber ebensowenig wie die kürzere Afterflosse mit der Schwanzflosse; die Brustflosse ist groß; die Bauchflosse fehlt gänzlich. Als eigentümliches, bezeichnendes Merkmal muß das Gebiß gelten, eines der furchtbarsten, das die Klasse der Fische aufzuweisen hat. Es besteht aus gewaltigen Kegelzähnen, die in den Kiefern sitzen, und mehreren Reihen stumpfkegeliger Zähne hinter diesen auf dem Gaumen- und Pflugscharbeine.
Der Seewolf ( Anarrhichas lupus) erreicht eine Länge von zwei Metern; in den südlicheren Meeren findet man jedoch nur selten Stücke, die mehr als einen Meter messen. Der Oberteil des Kopfes, die Seiten, der Rücken und die Flossen sehen braungelb, die unteren Teile weißgrau aus; Rücken- und Afterflosse sind neun- bis elfmal gebändert und, wie der ganze übrige Leib, außerdem dunkel gepunktet.
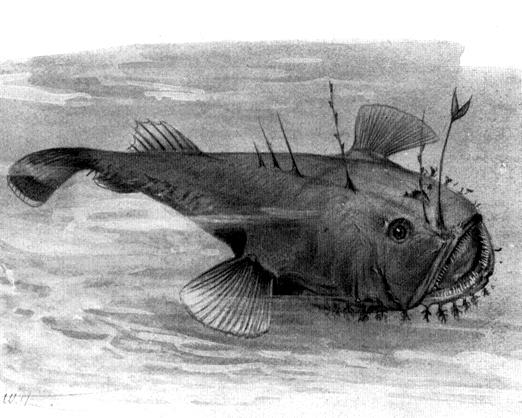
Angler oder Seeteufel ( Lophius piscatorius)
Schon im nördlichen Schottland gehört der Seewolf nicht eben zu den Seltenheiten; an den deutschen, dänischen und norwegischen Küsten findet er sich hier und da; um Island, an der grönländischen und lappländischen Küste ist er gemein, verbreitet sich auch von hier aus durch die Beringsstraße bis in den nördlichen Teil des Stillen Meeres. Nach Art seiner Familienverwandten hält er sich auf dem Boden, am liebsten auf felsigem Grunde auf, hier in Felsspalten auf Beute lauernd oder solche von den Felsen abreißend. Der Hauptteil seiner Nahrung besteht nämlich in Krustern und Muscheln, deren Panzer und Schalen sein fürchterliches Gebiß ohne Mühe zertrümmert. Wahrscheinlich stellt er auch verschiedenen Fischen nach; denn er schwimmt, obschon mit schlängelnder Bewegung, immerhin schnell genug, um den einen oder anderen seiner Klassenverwandten einzuholen. Während des Winters lebt er in den tieferen Gründen des Meeres; im Mai oder Juni nähert er sich den flacheren Küsten, um zu laichen. Einige Monate später sieht man seine grünlich gefärbten Jungen in ziemlicher Anzahl zwischen den Seetangen.
Es ist nicht das fürchterliche Gebiß, das dem Seewolf seinen Namen verschafft hat, sondern die ingrimmige Wut, die er an den Tag legt, sobald er sich bedroht sieht. Der Ausdruck der Augen hat etwas Tückisches, und das Wesen entspricht dem Anscheine. Gefangen, gebärdet sich dieser Fisch wie rasend, tobt in den Netzen umher, versucht sie zu zerreißen und beißt mit schlangenartiger Gewandtheit nach jedem Gegenstande, der ihm vorgehalten wird. Die Fischer nehmen sich wohl in acht, ihn mit den Händen zu fassen, sondern greifen, sobald sie merken, daß sich eines dieser bitterbösen Tiere gefangen, sofort zum Ruder oder zum Handspieße, um es so rasch wie möglich vom Leben zum Tode zu bringen. Entgegengesetzten Falles zappelt der Seewolf noch halbe Tage lang im Boote umher; denn auch er kann ohne Schaden lange Zeit außerhalb des Wassers verweilen und behält seine Wut, solange er lebt.
*
Die englischen Fischer vergleichen einen Schleimfisch mit dem unteren Hauptbalken eines flachen Bootes, » Gunnel« genannt, die schwedischen und norwegischen mit der Klinge eines Schwertes; erstere nennen ihn deshalb Gunnel, letztere Schwert- oder Klingenfisch. Diesen Namen wollen wir beibehalten, weil er in der Tat nicht übel gewählt ist. Vertreter der Klingenfische ( Centronotus) ist der Butterfisch ( Centronotus gunellus), ein Bewohner des Eismeeres und der Nordsee, der zuweilen auch im Atlantischen Weltmeere bis zur französischen Küste gefunden wird. An Länge soll er bis fünfundzwanzig Zentimeter erreichen; die meisten Stücke messen jedoch nicht über zwanzig Zentimeter. Die Grundfärbung ist eine Mischung aus Purpur und Gelbbraun, die an Kehle und Bauch verblaßt und längs des Rückens mit neun bis zwölf deutlichen, runden, weiß eingefaßten Flecken, übrigens mit unbestimmten Wolkenflecken gezeichnet wird. Erstere Flecke stehen bei einzelnen Stücken auf der Rückenflosse, zuweilen aus dieser und dem Rücken.
Wie andere seiner Familie bevorzugt der Butterfisch felsigen Grund zu seinem Aufenthalte, findet sich jedoch zuweilen auch aus Strecken, wo der Boden mit weichem Schlamme bedeckt ist. Bei tiefer Ebbe sieht man ihn in kleinen Pfützen oder unter Steinen und zwischen Seetangen liegen, gleichsam die rückkehrende Flut erwartend. Längerer Wassermangel bereitet ihm keine Unbequemlichkeit; doch setzt er sich minder rücksichtslos als seine Verwandten der trockenen Luft aus, sucht sich vielmehr zwischen den Steinritzen und Tangen die ihm nötige Feuchtigkeit zu verschaffen. Seine Bewegungen im Wasser sind sehr rasch und gewandt; es hält daher auch schwer, ihn hier und selbst in seichten Pfützen zu fangen. Zu seiner Gewandtheit kommt noch die außerordentliche Glätte des Leibes, die es erschwert, ihn festzuhalten; auch ist er klug genug, bei längerer Verfolgung so rasch wie möglich sich in Felsspalten zu Verstecken. Seine Nahrung besteht aus kleinen Weichtieren, Fischbrut und Fischlaich.
Viele Raubfische und Seevögel stellen dem Butterfische nach; Scharben und Taucher verfolgen ihn während der Flutzeit, Möwen und Verwandte während der Ebbe. Einer seiner schlimmsten Feinde soll der Seeskorpion sein, der dieselbe Örtlichkeit bewohnt und mit dem ihm gegenüber wehrlosen Klassenverwandten wenig Umstände macht. Von dem Menschen hat der Butterfisch wenig zu fürchten. Sein Fleisch ist zwar nicht schlecht, er aber zu klein, als daß der Fang die Mühe lohne.
*
Besondere Beachtung verdient die Aalmutter, auch Aalmöwe genannt ( Zoarces viviparus), der die Sippe der Gebärfische ( Zoarces) vertritt und zu den wenigen Fischen gehört, die vollkommen entwickelte, lebensfähige Junge zur Welt bringen. Die Merkmale der Sippe liegen in dem verlängerten, etwas zusammengedrückten Leibe, den kleinen, einzelnstehenden, punktförmigen, unter der Haut zerstreuten Schuppen, der ebenfalls fast die ganze Oberseite einnehmenden Rückenflosse, der aus zwei bis drei Strahlen gebildeten, an der Kehle stehenden Bauchflosse, den langen und schmalen Brustflossen und der über die Hälfte des Unterleibes sich erstreckenden Afterflosse, die, wie die Rückenflosse, unmittelbar in die Schwanzflosse übergeht. Die kegelförmigen Zähne stehen in einer Reihe an den Seiten der Kinnladen; Gaumen und Zunge sind unbewehrt. Die Kiemenhaut hat sechs Strahlen. Erwähnenswert ist noch eine kleine Warze hinter dem After, in dem sich die doppelten Ausführungsgänge für Samen und Eier befinden. Sie schwillt während der Laichzeit auf und scheint als ein Werkzeug der Begattung zu dienen, obgleich man, wie schon bemerkt, hierüber noch keine bestimmten Beobachtungen gemacht hat. Die Länge schwankt zwischen zwanzig und vierzig Zentimeter; Stücke von der letztangegebenen Größe gehören jedoch zu den Seltenheiten. Die Grundfärbung ist ein blasses Braun, das auf dem Rücken und an den Seiten dunkler gefleckt und gebändert, auf der Unterseite hingegen einfarbig wird. Die Wanderung erstreckt sich auch auf die Rückenflosse, die Einfarbigkeit auf Brust- und Bauchflosse.
Man hat die Aalmutter bisher nur in den nordischen Meeren, namentlich in der Nord- und Ostsee und im Kanale gefunden. Ausnahmsweise steigt sie auch in Flüssen empor, ist beispielsweise bei Spandau in der Havel gefangen worden. Sie ist häufig an geeigneten Stellen der englischen Küste, aber auch in der Ostsee ein sehr bekannter Fisch. Zu ihrem Aufenthalt bevorzugt sie ebenfalls steinigen Grund, lebt überhaupt nach Art ihrer Verwandten, vielleicht mit dem Unterschied, daß sie sich mehr als diese zwischen Tangen verbirgt. Zur Nahrung wählt sie sich kleine Fische, Muscheln, Würmer und Laich.
Um die Zeit der Frühlings-Tagundnachtgleiche sind die Eier der Weibchen noch sehr klein, um die Mitte des Mai bedeutend größer, rot von Färbung und weich. Um diese Zeit bemerkt man auch bereits zwei Punkte an ihnen, die Augen des sich entwickelnden Keimes, der in einer besonderen Hülle des Eies eingeschlossen liegt. Gegen den Herbst hin haben die Keime ihre Entwickelung vollendet und werden nun, eines nach dem andern, geboren, das heißt in vollkommen ausgetragenem Zustande, mit dem Kopfe voran, durch die Öffnung des Eierganges ausgestoßen. Yarrell sagt sehr richtig, daß bei einem sehr hochträchtigen Weibchen der geringste Druck genügt, die Jungen aus dem Inneren des Leibes ihrer Mutter hervorzubringen, daß er dies selbst noch an einem Weibchen, das monatelang in Weingeist aufbewahrt worden war, zu tun vermocht habe. Zuweilen verlangsamt sich die Entwicklung, so daß der Satz erst im Februar stattfindet. Die Jungen haben bei der Geburt eine Länge von drei Zentimeter, erreichen aber, nach Neill, fast das Doppelte dieses Maßes, wenn die Mutter selbst eine beträchtliche Größe hat. Obgleich vollkommen lebensfähig, sind sie doch noch so durchsichtig, daß man mit einem wenig vergrößernden Glase den Blutumlauf im Inneren wahrnehmen kann. Sie wachsen rasch heran und erreichen schon in den ersten vierzehn Tagen das Dreifache ihrer ursprünglichen Größe.
In gut eingerichteten Seewasserbecken kann man das Gebären tragender Aalmuttern bequem beobachten. Der ohnehin träge Fisch pflegt schon mehrere Stunden vor der Geburt seiner Jungen einen bestimmten Platz im Becken einzunehmen und verweilt auf diesem fortan regungslos, bis alle oder doch die meisten Jungen zur Welt gekommen sind. Letztere erscheinen, mit dem Kopfe voran, in rascher Folge nacheinander, sinken rechts und links von dem etwas gehobenen Schwanze der Mutter auf den Boden herab und bleiben hier mehrere Stunden, vielleicht auch einen Tag, liegen, ohne sich erheblich zu bewegen oder zu regen. Befinden sich mehrere Aalmuttern in demselben Becken, so kann man, anfänglich gewiß nicht ohne Überraschung, gewahren, daß zwei oder mehrere von ihnen an die Mutter sich herandrängen, sie von beiden Seiten pressen, also förmlich Geburtshilfe leisten, und sodann die Jungen einfach auffressen, sowie sie ins Leben treten. Dasselbe tut übrigens auch die Mutter, falls sie nicht sehr reichlich gefüttert wird.
Für die Fischerei ist die Aalmutter bedeutungslos, obschon ihr Fleisch als schmackhaft gerühmt und hier und da auf den Markt gebracht wird. Beim Kochen nehmen die Knochen eine grüne Färbung an, ein Umstand, dem der Fisch seinen hier und da gebräuchlichen Namen: Grünknochen verdankt.
*
Aristoteles spricht von Fischen aus der Nähe von Heraclea Pontica, die sich, wenn das Wasser der Flüsse und Seen verdunstet, der Feuchtigkeit nachgehend, in den Schlamm eingraben, hier, während die Oberfläche erhärtet, in einem schlafartigen Zustande verweilen, aber lebhaft sich bewegen, wenn sie gestört werden. In dieser Weise, fügt Theophrast der Angabe seines Lehrers hinzu, pflanzen sich diese Tiere fort. In der Tiefe des Schlammes lassen sie ihren Laich zurück, der sich entwickelt, wenn das Bett ihres Gewässers wiederum gefüllt wird. Ebenso gibt es, so bemerken die alten trefflichen Schriftsteller außerdem, Fische in Indien, die zuweilen die Flüsse verlassen und wie Frösche über das Land wandern, um sich ein anderes Gewässer aufzusuchen.
Von vornherein läßt sich annehmen, daß diese Fische mit einer besonderen, anderen Fischen nicht zukommenden Ausrüstung begabt sein müssen. Lungen besitzen sie allerdings nicht, aber Organe, die die Lungen vertreten. Fische, die dem Wasser entnommen werden, sterben, weil ihre Kiemen eintrocknen und der Blutumlauf dadurch gehindert wird: sie ersticken wie ein höheres Wirbeltier, dem man den Hals zuschnürt. Je größer die Kiemenöffnung, je feiner die Verzweigung der Kiemen, um so schneller tritt der Tod ein. Manche sterben fast augenblicklich, nachdem sie das Wasser verlassen haben; andere können stundenlang außerhalb desselben verweilen, unsere Karpfen meilenweit über Land gesandt werden, wenn man sie in feuchte Tücher einhüllt. Das nun, was diese feuchten Tücher bei den Karpfen, sind bei den Labyrinthfischen ( Labyrinthici), von denen Aristoteles und Theophrast sprechen, eigentümliche, in dem Schlundknochen gelegene, vielfach verzweigte Zellen mit blätterartigen Wandungen, die beim Atmen mit Wasser angefüllt werden und dieses Wasser nach und nach auf die Kiemenblättchen abgeben. Im übrigen haben unsere Fische einen länglich-eiförmigen Rumpf, gewöhnlich sehr lange Rücken- und Afterflossen, deren weiche, strahlige Teile beschuppt sind, und entweder regelrecht gebildete Bauchflossen oder solche, in denen der erste Strahl alle übrigen mehrfach an Länge überragt, bezüglich ersetzt.
*
Die Kletterfische ( Anabas) kennzeichnen sich durch länglichrunden, seitlich schwach zusammengedrückten Rumpf, ganzrandige Vor- und am Rande gezähnelte Kiemendeckel, kleine Zähne in den Kiefern, an der Spitze und am hinteren Teile des Pflugscharbeines, lange Rücken- und Afterflossen, deren vorderer Teil von vielen starken, spitzigen Strahlen gespannt wird, und etwas kurze, jedoch regelrecht gebildete Brust-, Bauch- und Afterflossen.
Der Kletterfisch ( Anabas scandens) erreicht eine Länge von einigen fünfzehn Zentimetern und ist auf dem Rücken bräunlichgrün, auf dem Bauche gelblich gefärbt, während Rücken- und Afterflossen violett, Bauch- und Brustflossen rötlich aussehen und die Schwanzflosse die Rückenfärbung zeigt. Einzelne Stücke sind dunkler gebändert und lichter gefleckt, andere ziemlich gleichfarbig. Das Verbreitungsgebiet umfaßt ganz Indien und Indonesien.
Zwei arabische Reisende, Soliman und ein Ungenannter, die Indien zu Ende des neunten Jahrhunderts besuchten, erfuhren hier, daß es einen Fisch gäbe, der aus den Gewässern aufsteige, sich über Land zu den Kokospalmen wende, an ihnen emporklimme, Palmwein trinke und sodann wieder zur See zurückkehre. Neunhundert Jahre später gedenkt ein gewisser Daldorf desselben Fisches, beschreibt ihn und berichtet, daß er ihn auf Tranquebar angetroffen habe, als er gerade in der Ritze einer unweit eines Teiches stehenden Palme in die Höhe geklettert, indem er mit den Stacheln der ausgespreizten Kiemendeckel an den Wänden des Spaltes sich gehalten, den Schwanz hin- und herbewegt, die Stacheln der Afterflosse an die Wand gestützt, sich vorgeschoben, die Deckel von neuem angesetzt und sich in dieser Weise auswärts bewegt habe, auch nach dem Fange noch mehrere Stunden im Sande eines Schuppens umhergelaufen sei. Ein Sendbote der Kirche, John, der Indien bereiste, erlangte mehrere Stück dieser Fische. Fünf »Baumkletterer« sandte er an Bloch und schrieb diesem dabei, daß vorstehender Name die Übersetzung der indischen Benennung sei, weil der Fisch in der Tat mit seinen sägeartigen Deckeln und scharfen Flossen auf die Palmen des Ufers zu klettern suche, während das Regenwasser an ihrem Stamme heruntertröpfle. Mehrere Stunden könne der Baumkletterer im Trocknen leben und sich durch wunderbare Krümmungen des Leibes forthelfen, übrigens halte er sich im Schlamme der Teiche auf, werde hier gefangen und gebe eine beliebte Speise.
Von dem Baumkletterer wissen die späteren Reisenden und Forscher nichts zu berichten, und einzelne stellen auch die Angaben Daldorfs und Johns entschieden in Abrede, der eine, indem er jenen entschuldigt, der andere, indem er diesen bespöttelt: wohl aber stimmen sie mit beiden darin überein, daß der Pannei-Eri, wie die Eingeborenen ihn nennen, wirklich gelegentlich über Land wandert, und bestätigen ebenso die Angaben des Aristoteles und Theophrast über sein Eingraben in den Schlamm der ausgedünsteten Gewässer während der trockenen Jahreszeit. Genaues gibt insbesondere Tennent, der neuere und bestimmte Beobachtungen angestellt oder doch gesammelt hat.
»Letzthin war ich«, so schreibt ein gewisser Morris, Regierungsbevollmächtigter in Trinkonomali, an Tennent, »beschäftigt, die Grenze eines großen Teiches, dessen Damm ausgebessert werden sollte, zu besichtigen. Das Wasser war bis auf einen kleinen Tümpel verdunstet, das Bett des Teiches übrigens allerwärts trocken. Während wir hier auf einer höher gelegenen Stelle standen, um ein Gewitter vorübergehen zu lassen, beobachteten wir am Rande des seichten Tümpels einen Pelikan, der fressend schwelgte. Unsere indischen Begleiter wurden aufmerksam, liefen hinzu und schrien: ›Fische, Fische!‹; Als wir zur Stelle kamen, sahen wir in den durch den Regen gebildeten Rinnsalen eine Menge von Fischen dahinkrabbeln, alle nach aufwärts durch das Gras rutschend. Sie hatten kaum Wasser genug, um sich zu bedecken, machten jedoch trotzdem schnelle Fortschritte auf ihrem Weg. Unser Gefolge las etwa zwei Scheffel von ihnen auf, die meisten in einer Entfernung von dreißig Meter von dem Teiche. Alle bemühten sich, die Höhe des Dammes zu gewinnen, und würden auch, wären sie nicht erst durch den Pelikan und dann durch uns unterbrochen worden, wahrscheinlich wirklich den Höhepunkt erklommen und auf der anderen Seite einen zweiten Tümpel erreicht haben. Es waren offenbar dieselben, die man auch in den trockenen Teichen findet.
»Je mehr die Wasserbecken austrocknen, um so mehr sammeln sich deren Fische in den kleinen, noch wasserhaltigen Tümpeln oder im feuchten Schlamme. An solchen Stellen kann man Tausende von ihnen gewahren und sehen, wie sie sich in dem Schlamme, der die Beschaffenheit von Hirsebrei hat, hin- und herbewegen. Wenn auch dieser Schlamm noch weiter austrocknet, machen sie sich auf, um noch wasserhaltige Teiche zu suchen. An einer Stelle sah ich Hunderte von ihnen von einem just verlassenen Teiche nach verschiedenen Richtungen hin sich zerstreuen und ihren Weg aller Schwierigkeiten und Hindernisse ungeachtet fortsetzen. Da der gedachte Pfuhl den zahmen und wilden Tieren der Nachbarschaft bisher zum Trinken gedient hatte, war die Oberfläche des Grundes überall eingetreten, und nicht wenige dieser Fische fielen in die tiefen, von den Fußstapfen herrührenden Löcher, aus denen es für manche kein Entrinnen mehr gab, so daß Milane und Krähen reiche Lese hielten. Auf mich hat es den Eindruck gemacht, als ob diese Wanderungen nur des Nachts stattfinden; denn ich habe einzig und allein in den Morgenstunden wandernde Fische gesehen, auch beobachtet, daß diejenigen, die ich lebend auflas und in Kübeln hielt, während des Tages sich ruhig verhielten, des Nachts aber Anstrengungen machten, aus ihrem Behälter zu entkommen, oft auch wirklich entkamen.«
Nach Tennents Untersuchungen wissen wir nunmehr, daß es dieselben Fische sind, die sich nötigenfalls auch im Schlamme eingraben. Man findet sie in einer Tiefe von einem halben Meter und darüber, je nach Beschaffenheit des Grundes. Die obere Decke ist oft zerklüftet und so trocken, daß sie beim Aufnehmen in Stücke zerfällt. Die Fische selbst liegen gewöhnlich in einer noch etwas feuchten Schicht; aber auch diese kann austrocknen, scheinbar, ohne sie am Leben zu gefährden. Die Eingeborenen kennen diese Eigentümlichkeit der Fische sehr wohl, begeben sich während der Trockenheit an die Teiche, suchen die tieferen Stellen aus und graben hier einfach nach, gebrauchen also wirklich die Hacke anstatt des Hamens und danken ihr oft reiche Ernte. Die Fische liegen regungslos in dem sie allseitig umgebenden Schlamme, bewegen sich aber sofort, nachdem man sie aus ihrer Umhüllung befreite.
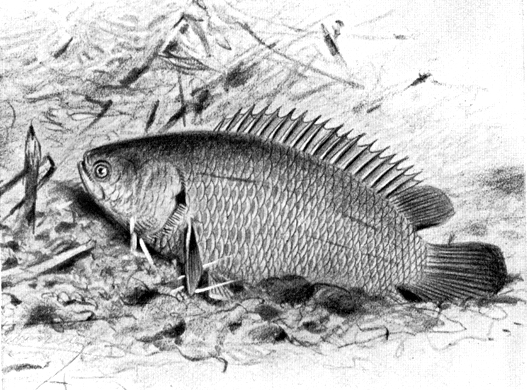
Kletterfisch ( Anabas scandens)
Es erklärt sich somit sehr einfach und natürlich, daß man unmittelbar nach dem ersten Regen in den seit wenigen Stunden oder höchstens Tagen gefüllten Wasserbecken Ceylons die Leute eifrig mit dem Fischfange beschäftigt sieht. Zu diesem Zwecke bedienen sie sich eines oben und unten offenen Korbes, den sie, vor sich hingehend, so in den Schlamm stoßen, daß die unteren Spitzen in diesem steckenbleiben, und von oben mit der Hand ausräumen, wenn sie Fische umgittert hatten. Schon Buchanan erwähnt, daß man die gefangenen Labyrinthfische fünf bis sechs Tage lang in trockenen Gefäßen aufbewahren kann, ohne sie zu töten, weshalb denn auch diese Tiere oft von den Gauklern größerer Städte, deren Bewohnerschaft mit der Natur minder vertraut ist als Bauern und Fischer, angekauft und zur Schau ausgestellt werden.
*
Anfangs der siebziger Jahre sandte der französische Konsul Simon zu Ningpo einen Zierfisch der Chinesen im lebenden Zustande nach Frankreich, der seitdem allgemeine Beachtung der Liebhaber wie der Forscher auf sich gezogen hat. Ersteren noch gänzlich unbekannt, wurde der Fisch von letzteren alsbald als der bereits im Anfange unseres Jahrhunderts von Lacépède beschriebene »Großflosser« bestimmt und damit die erste wirklich gelungene Einbürgerung eines Labyrinthfisches in Europa festgestellt.
Der Großflosser, von den Liebhabern auch wohl Paradiesfisch, gewöhnlich Makropode genannt ( Macropodus viridiauratus), Vertreter der Sippe der Langstrahler ( Macropus), ist gestreckt und seitlich zusammengedrückt, das aus kleinen Zähnen bestehende Gebiß auf die Kiefer beschränkt, die Rückenflosse durch dreizehn stachlige und sieben weiche, die Afterflosse durch siebzehn oder achtzehn harte und fünfzehn weiche, die Bauchflosse durch einen sehr verlängerten stacheligen und fünf weiche Strahlen gestützt, die sehr große zweilappige Schwanzflosse halbmondförmig gestaltet. Die bräunliche Färbung der Oberseite geht nach unten zu in graugrüne über; die Zeichnung besteht aus abwechselnd gelbgrünen oder bläulichen und rötlichen Querbinden; den grünen Kiemendeckel ziert ein gelber Rand. Beim Weibchen sind die Flossen minder entwickelt und die Farben matter. Die Färbung ist im übrigen sehr abhängig von äußeren Umständen. Die Länge beträgt acht bis neun Zentimeter.
Der Großflosser wird in China allgemein gefangengehalten und ebenso wie unser Goldfisch behandelt, schreitet jedoch viel leichter als dieser im engen Raume zur Fortpflanzung. Seine Fähigkeit, in wenig sauerstoffhaltigem Wasser auszudauern, und selbst außerhalb des letzteren zwanzig Minuten und mehr ohne Schaden zu überstehen, lassen ihn zum Haustiere geeigneter erscheinen als jeden andern seiner Klasse. Erhielt doch Geraud von einhundert in China eingeschifften Paradiesfischen, denen er auf der langwierigen Reise weder hinlänglichen Raum, noch passende Nahrung, noch ausreichende Pflege gewähren konnte, zweiundzwanzig am Leben. Über das Gefangenleben der Großflosser ist neuerdings viel geschrieben und manche gute Beobachtung veröffentlicht worden; ich sehe jedoch von fast allem ab, was ich hierüber gelesen, und beschränke mich auf eine ausdrücklich für das »Tierleben« abgefaßte Schilderung Beneckes.
»Im Mai des Jahres 1878«, so schreibt mir der Genannte, »erwarb ich ein Paar Großflosser, um durch sie, die nach den veröffentlichten Mitteilungen während des ganzen Sommers in vierzehntägigen Pausen laichen sollten, fast jederzeit frischen Fischlaich zur Unterstützung meiner entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten zur Verfügung zu haben. Die Tiere kamen wohlbehalten an und gingen, in ein Becken von etwa vierzig Liter Inhalt gebracht, sofort ans Werk, die zwischen der eingepflanzten Wasserpest umherschwimmenden kleinen Krebstierchen, Mückenlarven und Würmer zu verzehren. Ihre Freßlust hatte ich anfänglich bedeutend unterschätzt: dies erfuhr ich, als ich eines Tages keine Krebschen oder Kerbtierlarven hatte bekommen können. Sie fraßen jetzt nicht nur sehr kleine, sondern auch große Regenwürmer, solche von fünf bis acht Zentimeter Länge und zwei Millimeter Dicke, mit ersichtlichem Behagen. Große Regenwürmer gab ich ihnen, nachdem ich sie in Stücke zerschnitten, und es war sehr hübsch zu sehen, wie sie dann den Darminhalt des Wurmes nicht mit verschluckten, sondern das Wurmstück an einem Ende erfaßten, allmählich ins Maul hineinzogen und kauend den Kot aus dem Wurme preßten, dabei jedesmal eine kleine Wolke vor sich hertreibend. Wenn sie Würmer vom Grunde aufnahmen oder stark beschmutzte erhielten, waren sie stets bedacht, fremde Stoffe abzuscheiden: sie schüttelten den Wurm erst ein paarmal, ließen ihn wiederholt los, warfen ihn vom Grund aus nach oben, um anhängenden Sand und dergleichen abzuschütteln, und begannen erst dann, ihn zu verschlingen. Sträubte sich ihre Beute, so schlugen sie dieselbe auch wohl gegen die Wasserpflanzen oder die Wände ihres Beckens.
»Bald, nachdem die Fische in das Becken gesetzt worden waren, und namentlich in den Vormittagsstunden, wenn die Morgensonne ab und zu in ihr Behälter fiel, begannen sie ihre anziehenden Liebesspiele. Als ich sie aus dem Versendungsgefäße herausnahm, waren sie recht unansehnlich, gleichförmig blaßbräunlich; sehr bald aber wurden sie, zuerst das Männchen, später das Weibchen, dunkler, und mit der Kräftigung des Grundtones traten auch die dunkel goldgrünen Streifen lebhafter hervor. Wie bei anderen Fischen erhöht sich die Schönheit und Sättigung ihrer Färbung, während sie miteinander spielen, und verblassen sie, wenn man sie voneinander trennt. Das Männchen hält sich meist zu einem bestimmten Weibchen, gibt sich manchmal aber auch mit mehreren ab. Wenn es sich dem Weibchen nähert, spreizt es den Schwanz und sämtliche Flossen in der Weise, wie die Hauptfigur unseres Bildes ersichtlich werden läßt, und wird dabei zusehends dunkler, während sich das Weibchen entweder ziemlich senkrecht stellt, alle Flossen möglichst zusammenlegt und langsam im Kreise herumdreht, oder die links oben im Bilde veranschaulichte Stellung annimmt und dem Männchen gleichlaufend, jedoch in umgekehrter Richtung, dahinschwimmt. Im letzteren Falle drehen sich beide, den Schwanz vor den Kopf des andern gewendet, das Männchen ebenfalls mit möglichst stark gespreizten Flossen, langsam im Kreise umeinander. Sind sie beim Spielen besonders erregt, so zittert das Männchen, indem es sich spreizt, genau in der Weise wie der Hahn, wenn er um die Henne herumgeht, um ihr seine Liebe zu erklären, und oft ahmt dann auch das Weibchen die zitternden Bewegungen nach.
»Etwa drei Wochen nach Ankunft der Fische wurde der Leib des Weibchens stärker, und das Männchen ging nun ans Werk, um das Nest zu errichten. Zu diesem Zwecke kommt es an die Oberfläche, nimmt das Maul voll Luft und stößt diese dann in kleinen, von einem Speichelhäutchen umgebenen Blasen unter Wasser wieder aus, wodurch sich eine ziemlich fest zusammenhängende Schicht solcher Blasen bildet, die oft durch neue ergänzt wird. Mein Männchen stand nun gewöhnlich unter dieser Luftblasenschicht in der einen Ecke des Beckens, das Weibchen in der gerade entgegengesetzten; beide aber kamen zum Spielen nach der von Pflanzen freien Mitte.
»Meine Hoffnung, die Fische nunmehr bald laichen zu sehen, erfüllte sich zunächst leider nicht; denn eines Morgens fand ich, daß das Männchen den ziemlich hohen Rand des Beckens übersprungen hatte und tot am Boden lag. Ich verschrieb mir daher ein anderes Männchen, konnte jedoch nur ein Paar erhalten und setzte beide neuen Ankömmlinge zu der Witwe. Nach kurzer Zeit hatten sich die Fische so eingerichtet, daß die beiden Weibchen gerade entgegengesetzte Ecken bewohnten und das Männchen bald in der einen, bald in der anderen Ecke zu Gaste war. Beide Weibchen vertrugen sich übrigens ganz gut, spielten sogar manchmal, genau so wie Paare, in der beliebten Gegenfüßlerstellung unter Flossenspreizen und Zittern.
»An einem der nächsten Tage erschien das Männchen sehr aufgeregt, kam fortwährend an die Oberfläche, nahm Luft ins Maul, stieß sie unter Wasser in massenhaften Perlen teils durch den Mund, teils durch die Kiemenöffnungen wieder aus, schwamm währenddem lebhaft und ruckweise umher und richtete beim Stehenbleiben jedesmal die Bauchflossen steil auf. Das eine mit ihm ins Becken gesetzte Weibchen benahm sich in derselben Weise. Nachdem sie eine Weile einander so umspielt hatten, fuhr das Männchen plötzlich auf das Weibchen zu; beide öffneten das Maul und packten je eines eine Lippe des andern mit den Kiefern. So schwammen sie unter lebhaften Schwenkungen mit den Schwänzen, bald mehr auf die linke, bald mehr auf die rechte Seite sich drehend, zehn bis vierzig Sekunden lang festverbunden im Becken umher. Dasselbe Spiel wiederholte sich binnen der beiden nächsten Tage außerordentlich häufig. Bald faßte das Männchen, bald das Weibchen die Oberlippe des anderen Teiles, und wenn sie sich einmal fest gepackt hatten, ließen sie selten vor Ablauf der angegebenen Zeit los. Ihr Spiel wurde mit solcher Heftigkeit betrieben, daß beiden Spielern die Oberhautfetzen um das Maul hingen und das Männchen mehrere Tage lang eine kleine Oberhautwucherung auf der Oberlippe trug. Ich konnte diese Handlung nur als ein Küssen von ganz besonderer Innigkeit ansehen und war daher einigermaßen verwundert, zu erfahren, daß sich dasselbe später, eine Reihe von Monaten hindurch, nicht wiederholte, obgleich die Tiere nach wie vor im besten Zustande waren.
»Im Verlaufe der Zeit änderten die Weibchen ihr Betragen. Sie wurden so unverträglich, daß ich das minder kräftige absondern mußte, um Raufereien, die zerrissene, freilich auch bald wieder heilende Flossen und Schwänze zur Folge hatten, zu vermeiden. Anfänglich versuchte ich, die Absperrung durch eine in das Becken eingeschobene trennende Glaswand zu bewirken; beide Weibchen rannten aber mit solcher Wucht gegeneinander und vergaßen über dem Bestreben, zusammenzukommen, so vollständig alles andere, daß ich daran denken mußte, die Glaswand durch ein vorgehängtes Stück Zeug zu verdunkeln. Bald jedoch hatte das beim Männchen befindliche Weibchen ausgekundschaftet, daß man den recht gut schließenden Vorhang umgehen könne, und nunmehr nahm es seinen Stand zwischen ihm und der Glaswand, um der verhaßten Nebenbuhlerin wenigstens böse Drohblicke zuwerfen zu können. Jetzt setzte ich eine matte Glasplatte ein; allein schon der Schatten der Witwe, der erkennbar wurde, wenn die Sonne ins Becken schien, regte das Paar derartig auf, daß ich die matte Glasplatte noch mit Papier verkleben mußte. Nunmehr hoffte ich, die Ruhe und Ordnung endgültig hergestellt zu haben. Allein was geschah? Eines Tages fand ich beide Weibchen in vollster Rauferei: die Witwe war über die um zwölf Zentimeter die Oberfläche überragende Trennungswand gesprungen. So blieb nichts weiter übrig, als sie in ein besonderes Becken zu setzen.«
Benecke hatte nicht das Glück, seine gefangenen Großflosser zum Laichen schreiten zu sehen, und ich muß deshalb wohl oder übel versuchen, nach den mir bekannt gewordenen Mitteilungen eine Schilderung des Laichgeschäftes zu geben.
Wie zwei Weibchen streiten auch beide Gatten eines Paares nicht selten ernstlich miteinander; das erwählte Männchen wird zuweilen sogar zum grausamen Gewaltherrscher. Ungeduldig, seine Bemühungen beim Nestbaue nicht mit Erfolg gekrönt zu sehen, verfolgt er das Weibchen heftig und meist in sehr roher Weise, zerschleißt ihm die Flossen, reißt ihm die Augen aus und tötet es, falls der Pfleger nicht eingreift, zuletzt unfehlbar. Entwickelt sich jedoch der Rogen im Leibe des Weibchens rechtzeitig oder dem Verlangen des Männchens entsprechend, so denkt dieses nicht an Hader oder Streit, sondern einzig und allein daran, der werdenden Brut Pflege angedeihen zu lassen. Nach den von Benecke geschilderten Spielen legt sich das zur Absetzung des Rogens bereite Weibchen in schräger Stellung auf den Rücken, und das Männchen schwimmt so über jenes, daß sich beider Geschlechtsöffnungen berühren. Hierauf umfassen sich beide mit den langen Schwanzflossen, das Männchen zittert in eigenartiger Weise geraume Zeit, läßt sodann das Weibchen los, dieses sinkt matt zum Boden herab und bringt eine Anzahl von Eiern hervor. Letztere fallen jedoch nur ausnahmsweise auf den Grund herab, steigen in der Regel vielmehr nach oben auf und bleiben an der Unterseite des Schaumnestes, unter dem der Vorgang immer stattfindet, hängen oder schweben. Sind die Eier dennoch zu Boden gesunken, so hebt sie das Männchen auf und trägt sie in das Nest. Nach geraumer Zeit wiederholt sich der eben geschilderte Vorgang und so fort mindestens zehnmal im Laufe des Tages. In den Zwischenpausen und nicht minder später bis zum Ausschlüpfen der Jungen bessert das Männchen fortwährend am Neste, ordnet und regelt auch die Eier so, daß unter jedes Bläschen eines zu liegen kommt, und bewacht nun Nest und Brut mit eifernder Sorgfalt. Etwa vierundzwanzig Stunden nach dem Legen bemerkt man den dunklen Keimfleck im blaßgelben Dotter des Eies, einen Tag später beginnenden Herzschlag; zwölf bis achtzehn Stunden nachher entschlüpft das junge, noch mundlose Fischchen, einer sehr kleinen Kaulquappe vergleichbar, dem Ei; fünf bis sechs Tage später nimmt es die Gestalt seiner Erzeuger an; im achten Monat seines Lebens ist es erwachsen. Solange es elterlicher Hilfe bedarf, widmet ihm das Männchen aufopfernde Obsorge. Wie der männliche Stichling hält auch der Großflosser das junge unreife Völkchen seiner Kinder zusammen und streng in Ordnung. Sobald sich eines der jungen Fischlein entfernt, eilt er ihm nach, ergreift es mit dem Maule, verschluckt es und speit es wieder in das schützende Schaumnest. Sobald die Jungen seiner Hilfe nicht mehr bedürfen, überläßt er sie nicht nur teilnahmslos ihrem Schicksal, sondern nimmt, ebensowenig wie das Weibchen, nicht den geringsten Anstand, sie aufzufressen. Die Jungen ernähren sich anfänglich von dem Schaume des Nestes, später von äußerst kleinen, dem unbewaffneten Auge nicht erkennbaren Aufgußtierchen, hierauf von verschiedenartigem, dem bloßen Auge wahrnehmbarem Gewürm, zuletzt von denselben Tieren wie ihre Eltern.
Nicht allein das geschilderte Betragen, sondern auch überraschende Fruchtbarkeit empfehlen den Großflosser allen Liebhabern aufs wärmste. Ein einziges von Windsteig gepflegtes Paar dieser Fische soll in einem Sommer sechsmal gelaicht, jedesmal vier- bis sechshundert Junge erzielt und so nicht weniger als dreitausend Nachkommen ins Leben gesetzt haben. Nach alledem steht dem Großflosser sicherlich noch eine bedeutsame Zukunft bevor, und möglicherweise ist er bestimmt, den Goldfisch, wenn nicht gänzlich, so doch teilweise zu verdrängen. Was heute schon zu einem großen Teil der Fall ist. Herausgeber.
*
Harder ( Mugilidae) heißen wohlgestaltete Seefische mit gestrecktem, rundlichem Leibe und großen, auch den Kopf bekleidenden Schuppen, zwei durch eine weite Lücke getrennten Rückenflossen, deren erste nur vier Strahlen enthält, kurz hinter den Brustflossen stehenden Bauchflossen, querstehendem, eckigem, dicklippigem Maule und, falls solche überhaupt vorhanden, kleinen, feinen Zähnen. Die Harder leben ebensowohl in den mit dem Meere in Verbindung stehenden Süßgewässern wie in seichteren Seebuchten, Häfen und anderen Küstenteilen der Meere. Auch sie bilden in der Regel zahlreiche Schwärme und vereinigen sich dabei mit Seebarben und anderen Friedfischen. In Gemeinschaft solcher Genossen kommen sie, nach Aussage der Fischer des Roten Meeres, mit der Flut in die Nähe des Ufers und kehren mit der Ebbe in die See zurück, suchen also immer das Niederwasser, wohin ihnen ihre natürlichen Feinde, die größeren Raubfische, nicht folgen können. In die offne See hinaus wagen sie sich nicht, und niemals steigen sie in beträchtliche Tiefen hinab, halten sich vielmehr auch dann, wenn sie das Niederwasser einmal verlassen, in den obern Schichten des Meeres auf. Zuweilen gefallen sie sich hier in Spielen, indem sie streckenweit über die Oberfläche dahinhüpfen. Ihre Nahrung besteht in Schlamm und Sand, beziehentlich den in beiden enthaltenen pflanzlichen und tierischen Stoffen. Da, wo ein trüber oder zeitweilig durch Regen getrübter Bach ins Meer stürzt, sammeln sie sich gewöhnlich in Menge. Sie gründeln wie unsere Karpfen und halten dabei ihren Leib wagerecht. Ihre Laichzeit beginnt im Roten Meer Ende März, an den nordeuropäischen Küsten im Frühsommer und währt etwa zwei Monate. Vor dem Laichen erscheinen sie stets in sehr zahlreichen Schwärmen, nach dem Laichen meist nur in kleinen Trupps von etwa zehn Stück an den gewohnten Plätzen. Ihr Fleisch ist gut und wird ebensowohl frisch wie eingesalzen gegessen. Ihr Fang erfordert geschickte Fischer und besondere Netze, weil sie die für andere Fische verderblichen Garne oft überspringen. Außer dem Menschen stellen ihnen alle fischfressenden Raubtiere nach.
Eine im Mittelländischen und Atlantischen Meere, auch in der Nordsee vorkommende, ausnahmsweise bis in die Ostsee sich verirrende Art, die Meeräsche ( Mugil capito), Vertreterin einer gleichnamigen Sippe ( Mugil), erreicht eine Länge von vierzig bis fünfundvierzig, höchstens fünfzig Zentimeter und ist auf dem Rücken einfach dunkel blaugrau, auf dem Bauche und an den Seiten silberweiß, überall schwarz in die Länge gestreift.
Couch hat die Meeräsche genau beobachtet und eine treffliche Schilderung ihrer Sitten und Gewohnheiten sowie der Art und Weise ihres Fanges gegeben. Diese Art, die von den britischen Fischern Grauäsche genannt wird, kommt massenhaft an den Küsten Cornwalls und Devonshires vor, ist auch sonst allerorten an der Küste Großbritanniens und Irlands gefangen worden. »Niemals«, erzählt Couch, »entfernt er sich weit vom Lande, gefällt sich vielmehr in seichtem Wasser, namentlich bei warmem und schönem Wetter, zu der Zeit man ihn nahe am Strande umherstreifen sieht oder die von ihm in dem weichen Grunde beim Durchschnattern desselben hervorgebrachten Grübchen bemerkt. In den Flüssen steigt er zuweilen zu Berge, kehrt jedoch mit der Ebbe immer wieder ins Meer zurück.« Carew, der Geschichtschreiber von Cornwall, besaß einen mit salzigem Wasser angefüllten Teich, in dem solche Fische gehalten wurden. Da sie jeden Abend an einer und derselben Stelle gefüttert wurden, gewöhnten sie sich so an diese und ihren Pfleger, daß ein bestimmtes Klappern genügend war, sie herbeizurufen. Gewandt wissen sie sich Gefahren zu entziehen. Sobald sie sich in einem Grundnetze eingeschlossen sehen, beeilen sie sich, so schnell wie möglich zurückzukehren, und springen dann gewöhnlich über den oberen Rand der Netze hinweg; und wenn einer der Gesellschaft einen Weg fand, folgen ihm die übrigen unverzüglich nach. Dieses Aufschnellen ist ihnen angeboren; selbst Junge von unbedeutender Größe werfen sich über die Netze. Couch selbst war Zeuge, daß eine Meeräsche von etwa zwei Zentimeter Länge wiederholt über die fast drei Zentimeter über das Wasser emporragende Gefäßwand sprang.
Gar nicht selten schwimmen die Meeräschen in einen mit der See zusammenhängenden großen Teich der Küste Cornwalls, und wenn die größeren von ihnen erst einmal den Weg gefunden haben, halten sie denselben regelmäßig ein; sobald aber die Flut zurücktritt und die Schleusen geschlossen werden, überkommt sie augenblicklich das Gefühl der Gefangenschaft und Furcht. Dann untersuchen sie das Ufer nach allen Seiten, werden immer ängstlicher, versuchen auch wohl, über den Damm sich hinwegzuschnellen, und gehen hierbei oft genug zugrunde. Ähnlich gebärden sie sich in einem weiten Netz, nachdem zwei oder drei von ihnen glücklich entwischt sind, den anderen aber die Flucht verwehrt wurde; sie besichtigen dann gleichsam jede Masche, jede Falte des Netzes, die unten auf dem Grunde liegt, gehen endlich soweit wie möglich zurück und versuchen verzweifelt, die Maschen zu durchdringen, wobei sie sich in der Regel vollständig verwickeln.
Weiche und fettige Stoffe bilden ihre bevorzugte Nahrung, insbesondere solche, die bereits in Verwesung sind. Ihre Lippen scheinen einen sehr feinen Tastsinn zu besitzen; denn die meiste Nahrung holen sie sich aus dem Grunde heraus. Couch meint, daß sie die einzigen Fische seien, die regelmäßig tote, abgestorbene Tiere zur Speise wählen und ausnahmsweise nur den gemeinen Sandwurm verschlingen. An der Angel fangen sie sich selten, weil sie den Köder nicht gleich verschlingen, sondern erst sorgfältig betasten, oft wieder von sich speien, und ihr bedeutendes Gewicht und die Anstrengungen, sich loszumachen, sie außerdem oft befreien, wenn sich die Spitze der Angel wirklich in ihrem Maule befestigt. Am leichtesten noch fängt man sie, wenn man die Angel mit Fischeingeweiden oder in Fleischbrühe abgekochten Kohlblättern ködert. Die Teiche an den Küsten von Languedoc sind ihretwegen berühmt. In die Garonne, Loire, Seine, die Rhone und die Somme steigen sie oft in so namhafter Menge empor, daß der Fluß mit ihnen bedeckt erscheint und die Fischer kaum die von ihnen beschwerten Netze aufziehen können; solcher Überfluß währt jedoch stets nur zwei bis drei Tage. Die Netze, die man anwendet, sind in eine Menge einzelner Säcke geteilt und außerdem mit Wänden versehen, die die Oberfläche des Wassers überragen. Gelegentlich wendet man auch eine Leuchte an, um sie heranzulocken, da Feuerschimmer sie herbeizieht. Das Fleisch wird seiner Zartheit, Fettigkeit und Schmackhaftigkeit halber überall hoch geschätzt und frisch oder eingesalzen genossen. Außerdem sammelt man die Eierstöcke, preßt und falzt sie und bereitet aus ihnen eine, zumal in der Provence, sehr beliebte Speise.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß es der Geschlechtstrieb ist, der die Meeräschen zu so zahlreichen Massen schart und bewegt, Flüsse oder Meeresbuchten aufzusuchen. Im Mittelmeere laichen sie im Frühsommer, an den englischen Küsten gewöhnlich erst im Juli. Junge von zwei Zentimeter Länge sieht man hier im August meist in ungeheuren Schwärmen, an den Flußmündungen oder in den Flüssen selbst, soweit die Flut in ihnen reicht; aber auch sie kehren mit der Ebbe nach dem Meere zurück. Anderseits wissen wir aber auch, daß sich dieser köstliche Fisch auch in Süßwasser sehr wohlbefinden kann. Ein gewisser Arnould setzte eine Menge junger Meeräschen von etwa Fingerlänge in einen Süßwasserteich von etwa drei Acker Oberfläche und fing nach wenigen Jahren erwachsene von zwei Kilogramm Gewicht, die größer und wohlbeleibter, auch etwas anders gefärbt waren als die aus der See erbeuteten. Dieser Versuch verdient die allgemeinste Beachtung, namentlich in Deutschland, wo ein so köstlicher und wenig begehrender Seefisch als eine wertvolle Erwerbung angesehen werden müßte.