
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Nager tragen ihren Namen fast noch mit größerm Rechte als die Raubtiere den ihrigen; denn man braucht ihnen nur in den Mund zu sehen, um sie sofort und unzweifelhaft als das zu erkennen, was sie sind. Zwei große Nagezähne in beiden Kiefern, die nicht allein die Schneidezähne vertreten, sondern auch die Eck- und Lückzähne zu ersetzen scheinen, sind das allen gemeinsame Merkmal. Sie sind bedeutend größer als alle übrigen Zähne des ganzen Gebisses, die oberen immer stärker als die unteren, alle bogenförmig gekrümmt, an der Schneide breit oder spitzmeißelartig, an der Wurzel drei- oder vierkantig, bald flach, bald gewölbt, glatt oder gefurcht, weiß oder gelblich und rot gefärbt. Ihre äußere oder vordere Fläche ist mit stahlhartem Schmelz belegt, und dieser bildet auch die scharfe Spitze oder den breiten, schneidenden Meißelrand. Der übrige Zahn besteht aus der gewöhnlichen Zahnmasse. Bei der ausgedehnten Benutzung dieser Hauptzähne würden sie sich in kurzer Zeit abstumpfen oder abnutzen, hätten sie nicht einen großen Vorzug vor allen übrigen Zähnen des Säugetiergebisses: ihr Wachstum ist unbeschränkt. Die Zahnwurzel liegt in einer Zahnhöhle, die sich weit in dem Kiefer einbohrt, und enthält an dem hinteren, offenen Ende in einer trichterförmigen Einbuchtung einen blendenden Keim, der ununterbrochen den Zahn in demselben Grade ergänzt, wie er vorn sich abnutzt. Die feine Schärfe der Schneide wird durch gegenseitiges Aufeinanderreiben und dadurch bewirktes Abschleifen der Zähne erhalten; beide Kiefer können auch bloß senkrecht von vorn nach hinten wirken. So vereinigen diese Zähne alles Erforderliche, um dem ungeheuren Kraftaufwande, den das Nagen beansprucht, gewachsen zu sein. Von dem beständigen Wachstum der Nagezähne überzeugt man sich leicht, wenn man einem Nager, einem Kaninchen z. B., einen seiner Nagezähne gewaltsam abbricht. Dann wächst der gegenständige, weil er nun nicht mehr abgenutzt wird, rasch weiter, tritt in einem engen Bogen aus dem Maule hervor und rollt sich gehörnartig ein, hierdurch das ganze Gebiß verstümmelnd und die Ernährung des Tiers im höchsten Grade erschwerend.
Der im allgemeinen längliche Schädel ist oben Platt, das Hinterhauptloch an der Hinteren Fläche gelegen, ein geschlossener Jochbogen regelmäßig vorhanden, der Oberkiefer kurz, der Zwischenkiefer bedeutend entwickelt, der Unterkiefer ist fest eingelenkt, daß eine seitliche Bewegung fast unmöglich wird. Die Wirbelsäule besteht außer den Halswirbeln, aus 12 bis 16 rippentragenden, 5 bis 7 rippenlosen, 3 bis 6 Kreuz- und 6 bis 32 Schwanzwirbeln. Das lange, schmale Becken ist mit seltenen Ausnahmen geschlossen, ein Schlüsselbein regelmäßig vorhanden. Bei vielen Nagern öffnen sich an der Innenseite der Lippen Backentaschen, die sich bis in die Schultergegend ausdehnen können und bei Einsammlung der Nahrung als Vorratssäcke dienen. Ein besonderer Muskel zieht diese Taschen zurück, wenn sie gefüllt werden sollen. Die Speicheldrüsen sind gewöhnlich sehr stark entwickelt. Der Magen ist einfach, jedoch bisweilen durch Einschnürung in zwei Abschnitte geteilt. Die Länge des Darmschlauchs beträgt die fünf- bis siebzehnfache Leibeslänge. Die Eileiter der Weibchen gehen jeder für sich in einen Fruchthalter von darmförmiger Gestalt über, der dann in der langen Scheide mündet. Das Gehirn deutet auf geringe geistige Fähigkeiten; die Halbkugeln des großen Gehirns sind klein und die Windungen schwach. Die Sinneswerkzeuge sind gleichmäßig und ziemlich vollkommen entwickelt.
Die Nager verbreiten sich über alle Erdteile und finden sich in allen Klimaten der Breite und Höhe, soweit die Pflanzenwelt reicht. »Mitten in ewigem Schnee und Eise«, sagt Blasius, »wo stellenweise noch ein warmer Sonnenstrahl nur ans wenige Wochen ein kurzes und kümmerliches Pflanzenleben hervorlockt, auf den stillen, einsamen Schneehöhen der Alpen, in den weiten, öden Flächen des Nordens findet man noch Nager, die nicht nach einer schöneren Sonne sich sehnen. Aber je reicher und üppiger die Pflanzenwelt, desto bunter, mannigfaltiger wird das Leben dieser Tierordnung, die kaum ein Fleckchen Erde unbewohnt läßt.«
Höchst verschiedenartig ist die Lebensweise dieser allverbreiteten Geschöpfe. Nicht wenige sind Baum-, viele Erdtiere, diese leben im Wasser, jene in unterirdischen, selbst gegrabenen Höhlen, die einen im Gebüsch, die andern im freien Felde. Alle sind mehr oder weniger bewegliche Säugetiere, die je nach der Verschiedenheit ihrer Wohnorte entweder vortrefflich laufen oder klettern oder graben oder schwimmen. Meist scharfsinnig, munter und lebhaft, scheinen sie doch nicht klug oder besonders geistig befähigt zu sein. Die große Mehrzahl aller ist ein geistarmes Gesindel, das wohl scheu, nicht aber vorsichtig oder listig sein kann, sich auch sonst niemals durch irgendwelche hervorragende geistige Tätigkeit auszeichnet. Manche leben paarweise, andere in Familien und nicht wenige scharenweise zusammen, vertragen sich auch gut mit andern Tieren, ohne sich jedoch mit diesen zu befassen. Bosheit und Tücke, Wildheit und Unverschämtheit, hervorgegangen aus Überlegung, äußern nur wenige. Bei Gefahr ziehen sie sich so schleunig als möglich nach ihren Verstecken zurück; aber nur die allerwenigsten sind klug genug, Verfolgungen auf listige Weise zu vereiteln. Alle Nager nähren sich hauptsächlich von pflanzlichen Stoffen, Wurzeln, Rinden, Blättern, Blüten, Früchten aller Art, Kraut, Gras, mehligen Knollen, ja selbst Holzfasern werden von ihnen verzehrt; die meisten aber nehmen auch tierische Stoffe zu sich und werden zu wirklichen Allesfressern. Eigentümlich ist, daß viele, die zu schwach sind, größere Wanderungen zu unternehmen oder der Strenge des Winters zu widerstehen, Vorräte einsammeln und diese in unterirdischen Kammern aufspeichern. Unter den Säugetieren dürfen die Nager als die Baumeister gelten; denn einzelne von ihnen errichten sich wahrhaft künstliche Wohnungen, die schon seit den ältesten Zeiten die Bewunderung der Menschen erregt haben. Nicht wenige verbringen den Winter in einem totenähnlichen Schlafe, verfallen in Erstarrung und erhalten sich von ihrem im Sommer reichlich aufgespeicherten Fette, das bei den in jeder Hinsicht herabgestimmten Lebenstätigkeiten nun gemachsam verzehrt wird.
Im Verhältnis zu der geringen Größe der Nager ist ihre Bedeutung allerdings eine sehr erhebliche, sie erscheinen uns aber als unsere schädlichsten und gefährlichsten Feinde. Hätten nicht auch sie ein ungezähltes Heer von Feinden gegen sich, und wären sie nicht Seuchen und Krankheiten mancherlei Art in hohem Grade unterworfen, sie würden die Erde beherrschen und verwüsten. Der ununterbrochene Vertilgungskrieg, der gegen sie geführt wird, erhält in ihrer erstaunlichen Fruchtbarkeit und Vermehrungsfähigkeit ein Gegengewicht, das nur zu oft zum überwiegenden wird. Es klingt überraschend und ist dennoch wahr, wenn angegeben wird, daß ein Nagerpärchen binnen Jahresfrist seine Nachkommenschaft auf Tausend bringen kann. Solche erzeugungstüchtige Arten werden oft zu furchtbaren Verwüstern des menschlichen Besitztums. Ihre Wühlerei in Feld und Garten, ihr Zernagen und Abbeißen von allerlei nützlichen Gegenständen und Pflanzen, ihre Räubereien im Speicher und Wohnhaus verursachen einen Schaden, der von dem Nutzen nicht entfernt erreicht werden kann. Der Mensch ist also gezwungen, sich dem Heere der Feinde dieser Tiere anzuschließen, und er übt nur das Recht des selbstsüchtigen Stärkeren, wenn er alle Mittel in Anwendung bringt, um sich solchen Ungeziefers zu erwehren. Wirklich befreunden kann er sich bloß mit höchst wenigen Gliedern dieser zahlreichen Ordnung, und von diesen wenigen sind nur einzelne der Zähmung würdig. Wichtiger als durch ihre Eigenschaften werden die Nager durch ihr Fell und Fleisch, obschon es verhältnismäßig wenige sind, die uns hierdurch nützen. Und auch bei ihnen dürfte der Schaden den Nutzen bei weitem überwiegen.
*
In der ersten Familie vereinigen wir die Hörnchen ( Sciurina), weil wir in ihnen die muntersten und klügsten, also edelsten Nager zu erkennen glauben. Die Hörnchen bewohnen mit Ausnahme von Neuholland die ganze Erde, gehen ziemlich weit nach Norden hinauf und finden sich im heißesten Süden, leben in der Tiefe wie in der Höhe, manche Arten ebenso gut im Gebirge wie in der Ebene. Waldungen oder wenigstens Baumpflanzungen bilden ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, und bei weitem die größere Anzahl führt ein echtes Baumleben, während einige in unterirdischen, selbstgegrabenen Bauen Herberge nehmen. Gewöhnlich lebt jedes Hörnchen für sich: doch holten sich unter Umständen größere und kleinere Gesellschaften oder wenigstens Paare längere Zeit zusammen, und einzelne Arten unternehmen, getrieben von Nahrungsmangel, Wanderungen, während derer sie sich zu ungeheueren, heerartigen Scharen vereinigen.
Alle Hörnchen bewegen sich lebhaft, schnell und behend, und zwar ebensowohl aus den Bäumen als aus dem Boden. Fast alle klettern vorzüglich und springen über große Zwischenräume weg von einem Baum zum andern. Beim Schlafen nehmen sie eine zusammengerollte Stellung an und suchen sich gern bequeme Lagerplätze aus, ruhen daher entweder in einem unterirdischen Bau oder in Baumhöhlen oder endlich in Nestern, die sie sich teilweise hergerichtet oder selbst erbaut haben. Die in kalten Ländern wohnenden wandern, wenn der Winter herannaht, oder fallen in einen ununterbrochenen Winterschlaf und sammeln sich deshalb größere oder kleinere Mengen von Vorräten ein, zu denen sie im Notfälle ihre Zuflucht nehmen. Ihre Stimme besteht in Pfeifen und einem eigentümlichen, nicht zu beschreibenden Brummen, Knurren und Zischen. Die geistigen Fähigkeiten sind gering, für die Ordnung der Nager aber verhältnismäßig bedeutend. Unter ihren Sinnen dürften Gesicht, Gehör und Geruch am meisten ausgebildet sein; einzelne bekunden jedoch auch ein sehr feines Gefühl, wie sich namentlich bei Veränderung der Witterung offenbart. Sie sind aufmerksam und scheu oder furchtsam und flüchten bei der geringsten Gefahr, die ihnen zu drohen scheint. Im ganzen ängstlich und feige, wehren sie sich doch nach Möglichkeit, wenn sie ergriffen werden, und können mit ihren scharfen Zähnen tiefe Verwundungen beibringen.
Die meisten Arten scheinen jährlich mehr als einmal Junge zu Werfen. Um die Zeit der Paarung lebt oft ein Männchen längere Zeit mit dem Weibchen, hilft ihm wohl auch an dem Ausbaue der mehr oder weniger künstlichen Wohnung, in der es später seine Nachkommenschaft beherbergen will. Die Anzahl der Jungen eines Wurfes schwankt zwischen zwei und sieben. Die Kleinen kommen fast nackt und blind zur Welt und bedürfen deshalb eines warmen Lagers und sorgfältiger Pflege und Liebe von seiten ihrer Mütter. Jung aus dem Neste genommene Eichhörnchen lassen sich ohne besondere Mühe zähmen, halten auch die Gefangenschaft lange Zeit ohne Beschwerde aus.
Alle Hörnchen fressen zwar mit Vorliebe und zeitweilig ausschließlich Pflanzenstoffe, verschmähen aber, wie so viele andere Nager, auch Fleischnahrung nicht, überfallen schwache Säugetiere, jagen eifrig Vögeln nach, plündern unbarmherzig deren Nester aus und morden, als ob sie Raubtiere wären.
Obgleich man das Fell mehrerer Eichhornarten als Pelzwerk verwertet, hier und da das Fleisch genießt, kann doch dieser geringe Nutzen den Schaden, den die Hörnchen unsern Nutzpflanzen und den nützlichen Vögeln zufügen, nicht aufwiegen. Im großen, freien Walde mag man sie dulden, in Parkanlagen und Gärten wird man ihrem Wirken Einhalt tun müssen.
Weitaus die meisten Mitglieder der Unterfamilie gehören der nur in Australien fehlenden Sippe der Taghörnchen ( Sciurus) an. Alle Arten dieser Gruppe zeigen in Gestalt, Bau, Lebensweise und Wesen so große Übereinstimmung, daß es vollständig genügt, unser Eichhorn und seine Lebensweise zu schildern, um ein Bild des Lebens der gesamten Sippschaft zu gewinnen. Das Eichhorn oder Eichorn ( Sciurus vulgaris), einer von den wenigen Nagern, mit denen der Mensch sich befreundet hat, trotz mancher unangenehmen Eigenschaften ein gern gesehener Genosse im Zimmer, erscheint sogar dem Dichter als eine ansprechende Gestalt. Dies fühlten schon die Griechen heraus, denen wir den Namen zu danken haben, der jetzt in der Wissenschaft die Eichhörnchen bezeichnet. » Der mit dem Schwanze sich schattende« bedeutet jener griechische Name, und unwillkürlich muß jeder, der die Bedeutung des Wortes Sciurus kennt, an das lebhafte Tierchen denken, wie es da oben sitzt, hoch auf den obersten Kronen der Bäume.
Die Leibeslänge des Eichhorn beträgt etwa 25 Zentimeter, die Schwanzeslänge 20 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 10 Zentimeter und das Gewicht des erwachsenen Tieres etwas über ein halbes Pfund. Der Pelz ändert im Sommer und im Winter, im Norden und im Süden vielfach ab, und außerdem gibt es noch zufällige Ausartungen. Im Sommer ist die Färbung oben bräunlichrot, an den Kopfseiten grau gemischt, auf der Unterseite vom Kinne an weiß, im Winter oberseits braunrot mit grauweißem Haar untermischt, unterseits weiß, in Sibirien und Nordeuropa aber häufig weißgrau, ohne jede Spur von rotem Anfluge, während der Sommerpelz dem unseres Hörnchens ähnelt. Häufig sieht man auch in den deutschen Wäldern eine schwarze Abart, die manche Naturforscher schon für eine besondere Art erklären wollten, während wir mit aller Bestimmtheit sagen können, daß oft unter den Jungen eines Wurfes sich rote und schwarze Stücke befinden. Sehr selten sind Weiße oder gefleckte Spielarten, solche mit halb oder ganz weißem Schwänze und dergleichen. Der Schwanz ist sehr buschig und zweizeilig, das Ohr ziert ein Büschel langer Haare, die Fußsohlen sind nackt.
Unser Eichhörnchen ist den Griechen und Spaniern ebensogut bekannt wie den Sibiriern und Lappländern. Sein Verbreitungskreis reicht durch ganz Europa und geht noch über den Kaukasus und Ural hinweg durch das ganze südliche Sibirien bis zum Altai und nach Hinterasien. Wo sich Bäume finden, und zumal wo sich die Bäume zum Walde einigen, fehlt es sicher nicht; aber es ist nicht überall und auch nicht in allen Jahren gleich häufig. Hochstämmige, trockene und schattige Wälder bilden seine bevorzugtesten Aufenthaltsplätze; Nässe und Sonnenschein sind ihm gleich zuwider. Während der Reife des Obstes und der Nüsse besucht es die Gärten des Dorfes, doch nur dann, wenn sich vom Walde aus eine Verbindung durch Feldhölzchen oder wenigstens Gebüsche findet. Da, wo viele Fichten- und Kieferzapfen reifen, setzt es sich fest und erbaut sich eine oder mehrere Wohnungen, gewöhnlich in alten Krähenhorsten, die es künstlich herrichtet. Zu kürzerem Aufenthalte benutzt es verlassene Elster-, Krähen- und Raubvögelhorste, wie sie sind; die Wohnungen aber, die zur Nachtherberge, zum Schutze gegen üble Witterung und zum Wochenbette des Weibchens dienen, werden ganz neu erbaut, obwohl oft aus den von Vögeln zusammengetragenen Stoffen. Höhlungen in Bäumen, am liebsten die in hohlen Stämmen, werden ebenfalls von ihm besucht und unter Umständen auch ausgebaut. Die freien Nester stehen gewöhnlich in einem Zwiesel dicht an dem Hauptstamme des Baumes; ihr Boden ist gebaut wie der eines größeren Vogelnestes, oben aber deckt sie nach Art der Elsternester ein flaches, kegelförmiges Dach, dicht genug, um dem Eindringen des Regens vollständig zu widerstehen. Der Haupteingang ist abwärts gerichtet, gewöhnlich nach Morgen hin; ein etwas kleineres Fluchtloch befindet sich dicht am Schafte. Zartes Moos bildet im Innern ringsum ein weiches Polster. Der Außenteil besteht aus dünneren und dickeren Reisern, die durcheinander geschränkt wurden. Den festen, mit Erde und Lehm ausgekleideten Boden eines verlassenen Krähennestes benutzt das Hörnchen besonders gern zur Grundlage des seinigen.
Das muntere Tierchen ist unstreitig eine der Hauptzierden unserer Wälder. Bei ruhigem, heiterem Wetter bewegt es sich ununterbrochen, und zwar soviel als möglich auf den Bäumen, die ihm zu allen Zeiten Nahrung und Obdach bieten. Gelegentlich steigt es gemächlich an einem Stamme herab, läuft bis zu einem zweiten Baum und klettert, oft nur zum Spaße, wieder an diesem empor; denn wenn es will, braucht es den Boden gar nicht zu berühren. Es ist der Affe unserer Wälder und besitzt diese Eigenschaften, die an die jener launischen Südländer erinnern. Nur höchst wenige Säugetiere dürfte es geben, die immerwährend so munter sind und so kurze Zeit auf einer und derselben Stelle bleiben wie das Eichhorn bei leidlicher Witterung. Beständig geht es von Baum zu Baum, von Krone zu Krone, von Zweig zu Zweig; selbst auf der Erde ist es nichts weniger als fremd, langsam und unbehend. Niemals läuft es im Schritte oder Trabe, sondern immer hüpft es in größeren oder kleineren Sprüngen vorwärts, und zwar so schnell, daß ein Hund Mühe hat, es einzuholen, und ein Mann schon nach kurzem Laufe seine Verfolgung aufgeben muß. Allein seine wahre Gewandtheit zeigt sich doch erst im Klettern. Mit unglaublicher Sicherheit und Schnelligkeit rutscht es an den Baumstämmen empor, auch an den glättesten. Die langen, scharfen Krallen an den fingerartigen Zehen leisten ihm dabei vortreffliche Dienste. Es häkelt sich in die Baumrinde ein, und zwar immer mit allen vier Füßen zugleich. Dann nimmt es einen neuen Anlauf zum Sprunge und schießt weiter nach oben; aber ein Sprung folgt so schnell auf den andern, daß das Emporsteigen in ununterbrochener Folge vor sich geht und aussieht, als gleite das Tier an dem Stamm in die Höhe. Die Kletterbewegung verursacht ein weit hörbares Rasseln, in dem man die einzelnen An- und Absätze nicht unterscheiden kann. Gewöhnlich steigt es, ohne abzusetzen, bis in die Krone des Baumes, nicht selten bis zum Wipfel empor; dort läuft es dann auf irgendeinem der wagerechten Äste hinaus und springt gewöhnlich nach der Spitze des Astes eines andern Baumes hinüber, über Zwischenräume von vier bis fünf Meter immer von oben nach unten. Wie notwendig ihm die zweizeilig behaarte Fahne zum Springen ist, hat man durch grausame Versuche erprobt, indem man gefangenen Eichhörnchen den Schwanz abschlug; man bemerkte dann, daß das verstümmelte Geschöpf nicht halb so weit mehr springen konnte. Obgleich die Pfoten des Eichhorns nicht dasselbe leisten können wie die Affenhände, sind sie doch immer noch hinlänglich geeignet, das Tier auch auf dem schwankendsten Zweige zu befestigen, und dieses ist viel zu geschickt, als daß es jemals einen Fehlsprung täte oder von einem Aste, den es sich auserwählt, herabfiele. Sobald es die äußerste Spitze des Zweiges erreicht, faßt es sie so schnell und fest, daß ihm das Schwanken des Zweiges nicht beschwerlich fällt, und läuft nun mit seiner anmutigen Gewandtheit äußerst rasch wieder dem Stamme des zweiten Baumes zu. Auch das Schwimmen versteht es vortrefflich, obgleich es nicht gern ins Wasser geht. Man hat sich bemüht, die einfache Handlung des Schwimmens bei ihm so unnatürlich als möglich zu erklären, und gefabelt, daß sich das Hörnchen erst ein Stück Baumrinde ins Wasser trage zu einem Boote, das es dann durch den emporgehobenen Schwanz mit Mast und Segel versähe usw.; das Eichhorn aber schwimmt eben auch nicht anders als die übrigen landbewohnenden Säugetiere und die Nager insbesondere.
Wenn das Hörnchen sich ungestört weiß, sucht es bei seinen Streifereien beständig nach Äsung. Je nach der Jahreszeit genießt es Früchte oder Sämereien, Knospen, Zweige, Schalen, Beeren, Körner und Pilze. Tannen-, Kiefern- und Fichtensamen, Knospen und junge Triebe bleiben wohl der Hauptteil seiner Nahrung. Es beißt die Zapfen unserer Nadelholzbäume am Stiel ab, setzt sich behäbig auf die Hinterläufe, erhebt den Zapfen mit den Vorderfüßen zum Munde, dreht ihn ununterbrochen herum und beißt nun mit seinen vortrefflichen Zähnen ein Blättchen nach dem andern ab, bis der Kern zum Vorschein kommt, den es dann mit der Zunge aufnimmt und in den Mund führt. Besonders hübsch sieht es aus, wenn es Haselnüsse, seine Lieblingsspeise, in reichlicher Menge haben kann. Am liebsten verzehrt es die Nüsse, wenn sie vollkommen gereift sind. Es ergreift eine ganze Traube, enthülst eine Nuß, faßt sie mit den Vorderfüßen und schabt, die Nuß mit unglaublicher Schnelligkeit hin und her drehend, an der Naht mit wenigen Bissen ein Loch durch die Schale, bis sie in zwei Hälften oder in mehrere Stücke zerspringt; dann wird der Kern herausgeschält und, wie alle Speise, die das Tier zu sich nimmt, gehörig mit den Backenzähnen zermalmt. Bittere Kerne, wie z. B. Mandeln, sind ihm Gift; zwei bittere Mandeln reichen hin, um es umzubringen. Außer den Samen und Kernen frißt das Eichhorn Heidel- wie Preißelbeerblätter und Schwämme (nach Tschudi auch Trüffeln) leidenschaftlich gern. Aus Früchten macht es sich nichts, schält im Gegenteil das ganze Fleisch von Birnen und Äpfeln ab, um zu den Kernen zu gelangen. Leider ist es ein großer Freund von Eiern, plündert alle Nester, die es bei seinen Streifereien auffindet, und verschont ebensowenig junge Vögel, wagt sich sogar an alte; Lenz hat einem Eichhorn eine alte Drossel abgejagt, die nicht etwa lahm, sondern so kräftig war, daß sie sogleich nach ihrer Befreiung weit wegflog, und andere Beobachter haben den meist als harmlos und unschuldig angesehenen Nager als mordsüchtigen Räuber kennengelernt, der kein kleineres Wirbeltier der beiden ersten Klassen verschont; Schacht fand sogar einen Maulwurf im Nest eines Eichhorns.

Eichhörnchen ( Sciurus vulgaris)
Sobald das Tier reichliche Nahrung hat, trägt es Vorräte für spätere, traurigere Zeiten ein. In den Spalten und Löchern hohler Bäume und Baumwurzeln, in selbstgegrabenen Löchern, unter Gebüsch und Steinen, in einem seiner Nester und an andern ähnlichen Orten legt es seine Speicher an und schleppt oft durch weite Strecken die betreffenden Nüsse, Körner und Kerne nach solchen Plätzen. In den Waldungen Südostsibiriens speichern die Eichhörnchen auch Schwämme, und zwar in höchst eigentümlicher Weise, auf. »Sie sind«, bemerkt Radde, »so wenig selbstsüchtig, daß sie die Pilzvorräte nicht etwa bergen, sondern an die Nadeln oder in Lärchenwäldern an die kleinen Ästchen spießen, sie dort trocken werden und zur Zeit der Hungersnot diesem und jenem durchwandernden Artgenossen zu Nutzen kommen lassen. Es sind die Kronen alter Stämme oder, und häufiger, das gedrängt stehende Unterholz der Nadelbäume, die zum Aufbewahren der Pilze gewählt werden.«
Durch diese Vorsorgen für den Winter bekunden die Eichhörnchen, wie außerordentlich empfindlich sie gegen die Einflüsse der Witterung sind. Falls die Sonne etwas wärmer strahlt als gewöhnlich, halten sie ihr Mittagsschläfchen in ihrem Neste und treiben sich dann bloß früh und abends im Walde umher; noch viel mehr aber scheuen sie Regengüsse, heftige Gewitter, Stürme und vor allem Schneegestöber. Ihr Vorgefühl der kommenden Witterung läßt sich nicht verkennen. Schon einen halben Tag, bevor das gefürchtete Wetter eintritt, zeigen sie Unruhe durch beständiges Umherspringen aus den Bäumen und ein ganz eigentümliches Pfeifen und Klatschen, das man sonst bloß bei größerer Erregung von ihnen vernimmt. Sobald die ersten Vorboten des schlechten Wetters sich zeigen, ziehen sie sich in ihre Nester zurück, oft mehrere in ein und dasselbe, und lassen, das Ausgangsloch an der Wetterseite sorgfältig Verstopfend und behaglich in sich zusammengerollt, das Wetter vorübertoben. In dem kalten Sibirien tritt nach dem regen Leben im Herbst eine mit dem vorschreitenden Winter sich steigernde Trägheit ein, die zu einem Winterschlaf von kurzer Dauer ausarten kann. Sie verlassen ihr Nest zuerst nur wenige Stunden täglich, später tagelang gar nicht mehr, und die sie verfolgenden Jäger müssen, um ihrer ansichtig zu werden, mit dem Beil an hohle Bäume anklopfen und sie erst aufscheuchen. Auch bei uns zu Lande liegen sie oft tagelang ruhig im Nest? schließlich treibt sie der Hunger aber doch heraus und dann zunächst ihren Vorratskammern zu, in denen sie Schätze für den Winter aufspeicherten. Ein schlechter Herbst wird für sie gewöhnlich verderblich, weil sie in ihm die Wintervorräte aufbrauchen. Folgt dann ein nur einigermaßen strenger Winter, so bringt er einer Unzahl von ihnen den Tod. Manche Speicher werden vergessen, zu andern verwehrt der hohe Schnee den Zugang, und so kommt es, daß die munteren Tiere geradezu verhungern. Hier liegt eins und dort eins tot im Nest oder fällt entkräftet vom Baumwipfel herunter, und der Edelmarder hat es noch leichter als sonst, seine Hauptnahrung zu erlangen. In Buchen- und Eichenwäldern sind die Hörnchen immer noch am glücklichsten daran; denn außer den an den Bäumen hängenden Bücheln und Eicheln, die sie abpflücken, graben sie deren in Menge aus dem Schnee heraus und nähren sich dann recht gut.
Bei uns zu Lande durchwandern die Eichhörnchen nur ausnahmsweise weitere Strecken. Sie begeben sich höchstens von einem Walde nach dem andern, unterwegs so viel als möglich Gebüsche und Bäume aufsuchend und benutzend. Im Norden dagegen, insbesondere in Sibirien, treten sie alljährlich mehr oder weniger regelmäßige Wanderungen an, durchziehen dabei auch baumlose Strecken, überschwimmen reißende Flüsse und Ströme und steigen über Gebirge hinweg, deren Höhen sie sonst meiden. Befremdend erscheint es dem in den Gebirgen Südostsibiriens sich aushaltenden Beobachter, wenn er im Spätherbst Plötzlich Eichhörnchen gewissen Örtlichkeiten, auf denen Zirbelkiefern mit gereiften Zapfen stehen, sich zudrängen sieht; denn eine geringe Abweichung von dem einzuschlagenden Wege führt die Tiere entweder in die Dickichte nahrungsarmer Tannenwälder oder in die lichten Laubholzbestände, in denen die verwandten Erdhörnchen auch nicht viel für sie übrig lassen. Erst wenn der Forscher monatelang an Ort und Stelle verweilt, lernt er erkennen, daß diese Wanderungen nicht zufällig geschehen, daß nicht der sogenannte »Instinkt« die Tiere leitet, daß sie vielmehr nicht allein als vortreffliche Ortskundige, sondern auch als Sachverständige sich erweisen, die Wissen, wo Zirbelnüsse reifen und wie sie gediehen sind.
»Wenngleich«, wie Radde berichtet, »die Eichhörnchen im Herbst ziemlich allgemein, oft in angestrengten Märschen, weite Strecken zurücklegen, trifft man doch selten größere Mengen von ihnen dicht beisammen. Sie rücken nicht wie die Lemminge in wohlgeordneten Zügen vor, sondern schweifen in leicht gruppierten und verteilten Haufen über Berg und Tal, bis der Ort des Rastens gefunden ist. Es gehört zu den seltensten Ereignissen, daß sie, sich näher aneinander drängend, in großen Zügen in der einmal eingeschlagenen Richtung vordringen. Dies geschah im Herbst des Jahres 1847 bei Krasnojarsk, wo viele Tausende von ihnen durch den breiten Jenisseistrom schwammen und in den Straßen der Stadt selbst totgeschlagen wurden.«
Bei Einbruch der Nacht zieht sich das an einem Orte ständig lebende Eichhorn nach seinem Nest zurück und schläft dort, solange es finster ist, weiß sich aber auch im Dunkeln zu helfen. Lenz ließ sich einmal nachts von zwei Tagelöhnern eine hohe Leiter in den Wald tragen und an einen Baum lehnen, auf dem sich ein Nest mit jungen Eichhörnchen befand. Alles geschah so leise als möglich. Die Laterne blieb unten bei den Leuten, und Lenz stieg hinauf. Sobald er das Nest mit der Hand berührte, fuhren die Inwohner mit Windeseile heraus, etwa zwei am Baume in die Höhe, eins am Stamme hinunter, eins durch die Luft zu Boden, und im Nu war alles um ihn her wieder still.
Die Stimme des Eichhorns ist im Schreck ein lautes »Duck, duck«, bei Wohlbehagen und bei gelindem Ärger ein merkwürdiges, nicht gut durch Silben auszudrückendes Murren oder, wie Dietrich aus dem Winckell und Lenz noch besser sagen, ein Murksen. Besondere Freude oder Erregung drückt es durch Pfeifen aus.
Alle Sinne, zumal Gesicht, Gehör und Geruch, sind scharf; doch muß auch, weil sich sonst die Vorempfindung des Wetters nicht erklären ließe, das Gefühl sehr, und ebenso, von Beobachtungen an Gefangenen zu schließen, der Geschmack entschieden ausgebildet sein. Für die geistige Begabung sprechen das gute Gedächtnis, das das Tier besitzt, und die List und Verschlagenheit, mit denen es sich seinen Feinden zu entziehen weiß. Blitzschnell eilt es dem höchsten der umstehenden Bäume zu, fährt fast immer auf der entgegengesetzten Seite des Stammes bis in den ersten Zwiesel hinan, kommt höchstens mit dem Köpfchen zum Vorschein, drückt und verbirgt sich soviel als tunlich und sucht so unbemerkt als möglich seine Rettung auszuführen.
Ältere Eichhörnchen begatten sich zum ersten Male im März, jüngere etwas später. Ein Weibchen versammelt um diese Zeit oft zehn oder mehr Männchen um sich, und diese bestehen dann in Sachen der Liebe blutige Kämpfe miteinander. Wahrscheinlich wird auch hier dem tapfersten der Minne Sold; das Weibchen ergibt sich dem stärkeren, hängt ihm vielleicht sogar eine Zeitlang mit treuer Liebe an. Vier Wochen nach der Paarung wirft es in dem bestgelegensten und am weichsten ausgefütterten Neste drei bis sieben Junge, die ungefähr neun Tage lang blind bleiben und von der Mutter zärtlich geliebt werden. Baumhöhlen scheinen die bevorzugtesten Wochenbetten abzugeben; nach Lenz nisten die Weibchen auch in Starkübeln, die nahe am Walde auf Bäumen hängen und vorher ordentlich ausgepolstert und mit einem bequemen Eingange versehen werden, indem die Mutter das enge Flugloch durch Nagen hinlänglich erweitert. »Ehe die Jungen geboren sind und während sie gesäugt werden«, sagt Lenz, »spielen die Alten lustig und niedlich um das Nest herum. Schlüpfen die Jungen aus dem Nest hervor, so wird etwa fünf Tage lang, wenn das Wetter gut ist, gespielt, gehuscht, geneckt, gejagt, gemurkst, gequiekst; dann ist plötzlich die ganze Familie verschwunden und in den benachbarten Fichtenwald gezogen.« Bei Beunruhigung trägt, wie Knaben recht gut wissen, die Alte ihre Jungen in ein andres Nest, oft ziemlich weit weg. Man muß daher, wenn man Junge ausnehmen will, vorsichtig sein und darf sich nie beikommen lassen, ein Nest, in dem man ein Wochenbett vermutet, zu untersuchen, ehe man die Jungen ausnehmen kann. Nachdem dieselben entwöhnt worden sind, schleppt ihnen die Mutter, vielleicht auch der Vater, noch einige Tage lang Nahrung zu; dann überläßt das Elternpaar die junge Familie ihrem eigenen Schicksal und schreitet zur zweiten Paarung. Die Jungen bleiben noch eine Zeitlang zusammen, spielen hübsch miteinander und gewöhnen sich sehr schnell an die Sitten der Eltern. Im Juni hat die Alte bereits zum zweiten Male Junge, gewöhnlich einige weniger als das erste Mal; und wenn auch diese so weit sind, daß sie mit ihr herumschweifen können, schlägt sie sich oft mit dem früheren Gehecke zusammen und man sieht jetzt die ganze Bande, manchmal zwölf bis sechzehn Stück, in einem und demselben Waldesteile ihr Wesen treiben.
Ausgezeichnet ist die Reinlichkeit des Hörnchens: es leckt und putzt sich ohne Unterlaß. Weder seine noch seiner Jungen Losung legt es im Neste oder im Nachtlager, vielmehr immer unten am Stamme des Baumes ab. Aus diesem Grunde eignet sich das Eichhorn besonders zum Halten im Zimmer. Man nimmt zu diesem Zwecke die Jungen aus, wenn sie halb erwachsen sind, und füttert sie mit Milch und Semmel groß, bis man ihnen Kernnahrung reichen kann. Hat man eine säugende Katze von gutmütigem Charakter, so läßt man durch diese das Hörnchen groß säugen; es erhält durch jene eine Pflege, wie man sie ihm selbst niemals gewähren kann.
In der Jugend sind alle Hörnchen muntere, lustige und durchaus harmlose Tierchen, die recht gern sich hätscheln und schmeicheln lassen. Sie erkennen und lieben ihren Pfleger und bekunden eine gewisse Gelehrigkeit, indem sie dem Rufe solgen. Leider werden fast alle, auch die zahmsten, mit zunehmendem Alter tückisch oder wenigstens bissig, und zumal im Frühjahr, während der Zeit der Paarung, ist ihnen nie recht zu trauen. Freies Umherlaufen im Hause und Hofe darf man ihnen nicht gestatten, weil sie alles mögliche beschnuppern, untersuchen, benagen und verschleppen; man hält sie deshalb in einem Käfige, der innen mit Blech ausgeschlagen ist, damit er nicht allzuschnell ein Opfer der Nagezähne werde. Bedingung für ihr Wohlbefinden ist, daß sie ihre Nagezähne an andern Stoffen abstumpfen können, weil jene sonst übereinander weg wachsen und es ihnen ganz unmöglich machen, Nahrung zu zerkleinern oder überhaupt zu fressen. Man gibt ihnen deshalb unter ihr Futter viele harte Dinge, namentlich Nüsse und Tannenzapfen oder auch Holzkugeln und Holzstückchen; denn gerade die Art und Weise, wie sie fressen, gewährt das Hauptvergnügen, das die Gefangenen überhaupt bereiten. Zierlich ergreifen sie die ihnen vorgehaltene Nahrung mit den beiden Vorderhänden, suchen sich schnell den sichersten Platz aus, setzen sich nieder, schlagen den Schwanz über sich, sehen sich, während sie nagen, schlau und munter um, putzen Maul und Schwanz nach gehaltener Mahlzeit und hüpfen lustig und hübsch in affenartigen Sätzen hin und her. Dieses muntere Treiben und die außerordentliche Reinlichkeit stellen sie mit Recht zu den angenehmsten Nagern, die man gefangen halten kann.
In dem Edelmarder hat das Eichhorn seinen furchtbarsten Feind. Dem Fuchse gelingt es nur selten, ein Hörnchen zu erschleichen, und Milanen, Habichten und großen Eulen entgeht es dadurch, daß es, wenn ihm die Vögel zu Leibe wollen, rasch in Schraubenlinien um den Stamm klettert. Während die Vögel im Fluge natürlich weit größere Bogen machen müssen, erreicht es endlich doch eine Höhlung, einen dichten Wipfel, wo es sich schützen kann. Anders ist es, wenn es vor dem Edelmarder flüchten muß. Dieser mordsüchtige Gesell klettert genau ebensogut wie sein Opfer und verfolgt letzteres auf Schritt und Tritt, in den Kronen der Bänme ebensowohl wie auf der Erde, kriecht ihm sogar in die Höhlungen, in die es flüchtet, oder in das dickwandige Nest nach. Unter ängstlichem Klatschen und Pfeifen flieht das Eichhorn vor ihm her, der gewandte Räuber jagt hinter ihm drein, und beide überbieten sich förmlich in prachtvollen Sprüngen. Die einzige Möglichkeit der Rettung für das Eichhorn liegt in seiner Fähigkeit, ohne Schaden vom höchsten Wipfel der Bäume herab auf die Erde zu springen und dann schnell ein Stück weiter fortzueilen, einen neuen Baum zu gewinnen und unter Umständen das alte Spiel nochmals zu wiederholen. Man sieht es daher, wenn der Edelmarder es verfolgt, so eifrig als möglich nach der Höhe streben, und zwar regelmäßig in den erwähnten Schraubenlinien, bei denen ihm der Stamm doch mehr oder weniger zur Deckung dient. Der Edelmarder klimmt eifrig hinter ihm drein, und beide steigen wirklich unglaublich schnell zur höchsten Krone empor. Jetzt scheint der Marder es bereits am Kragen zu haben – da springt es in gewaltigem Bogensatze vom hohen Wipfel weg in die Luft, streckt alle Gliedmaßen von sich ab und saust zum Boden nieder, kommt hier wohlbehalten an und eilt nun ängstlich, so rasch als es kann, davon, um sich womöglich ein besseres Versteck auszusuchen. Das vermag ihm der Edelmarder doch nicht nachzutun; demungeachtet fällt es diesem doch bald zur Beute, da er so lange jagt, bis das Opfer aus Erschöpfung sich ihm geradezu preisgibt. Junge Eichhörnchen sind weit mehr den Gefahren ausgesetzt als die alten. Eben ausgeschlüpfte kann, wie ich aus eigener Erfahrung versichern darf, sogar ein behender Mensch kletternd einholen. Wir suchten als Knaben solche Junge auf und stiegen ihnen auf die Bäume nach, und mehr als einmal wurde die Gleichgültigkeit, mit der sie uns nahe kommen ließen, ihr Verderben. Sobald wir den Ast, auf dem sie saßen, erreichen konnten, waren sie verloren. Wir schüttelten den Ast mit Macht auf und nieder, und das erschreckte Hörnchen dachte gewöhnlich bloß daran, sich recht festzuhalten, um nicht herabzustürzen. Nun ging es weiter und weiter nach außen, immer schüttelnd, bis wir mit raschem Griff das Tierchen fassen konnten. Auf einen Biß mehr oder weniger kam es uns damals nicht an, weil uns unsere gezähmten ohnehin genugsam mit solchen begabten. Letztere fing ich, wenn sie sich freigemacht hatten und entflohen waren, stets auf die geschilderte Weise wieder ein.
An der Lena leben die Bauern vom Ansang März bis Mitte April ganz für den Eichhornfang, und mancher stellt dort über tausend Fallen. Diese bestehen aus zwei Brettern, zwischen denen sich ein Stellholz befindet, an dem ein Stückchen gedörrter Fisch befestigt ist. Berührt das Eichhorn diese Lockspeise, so wird es von dem oberen Brette erschlagen. Die Tungusen schießen es mit stumpfen Pfeilen, um das Fell nicht zu verderben, oder gebrauchen engläufige Büchsen mit Kugeln von der Größe einer Erbse und töten es durch Schüsse in den Kopf. Nach mündlichen Mitteilungen Raddes ist die Eichhörnchenjagd in Südostsibirien ebenso unterhaltend als aufregend. Die Menge des Wildes befriedigt und belohnt den Jäger, und die außerdem in den Waldungen hausenden Tiere, beispielsweise Tiger und Bär, erhalten ihn noch außerdem fortwährend in Spannung. Die schönsten Felle kommen aus Sibirien und Lappland und sind im Handel unter dem Namen »Grauwerk« bekannt. Der Bauchteil heißt gewöhnlich »Veh-« oder »Feh-Wamme« und gilt für eine kostbare Pelzware, mit deren Handel sich eine große Zahl von Menschen beschäftigt. Außer dem Felle verwendet man die Schwanzhaare zu guten Malerpinseln. Das weiße, zarte, wohlschmeckende Fleisch wird von Sachkennern überall gern gegessen.
Die Alten wähnten, im Gehirn und Fleisch kräftige Heilmittel zu besitzen, und unter dem Landvolke besteht noch heutzutage hier und da der Glaube, daß ein zu Pulver gebranntes männliches Eichhorn das beste Heilmittel für kranke Hengste, ein weibliches für kranke Stuten gäbe. Manche Gaukler und Seiltänzer sollen in dem Wahne leben, durch den Genuß des gepulverten Gehirns vor Schwindel sicher zu sein, und deshalb dem Hörnchen oft nachstellen, um sich bei ihren gefährlichen Sprüngen zu sichern. Doch ist die Verfolgung, die das Tier bei uns seitens des Menschen erleidet, kaum in Anschlag zu bringen. Man hegt es, seiner Niedlichkeit und Munterkeit halber, viel mehr, als es verdient.
»So niedlich das Tierchen«, sagen die Gebrüder Müller trefflich und wahr, »den Augen des vorübergehenden Beobachters in unsern Wäldern, Hainen und Lustgärten sich darstellt, so schädlich erscheint es in den tiefer blickenden des Forschers und Kenners seiner Nahrungsweise: denn diese ist nur eine zerstörende. Im Frühjahre und Vorsommer verübt es die größten Beschädigungen bei Holzwüchsen. Nach unsern Beobachtungen beißt das Eichhörnchen eine Menge Seiten- und Wipfeltriebe an jungen Kiefern und Fichten ab, so daß es deren Wachstum empfindlich hemmt, deren Ausbildung zu regelmäßigen Stämmen entweder sehr beeinträchtigt oder ganz verhindert. Dieses Entwipfeln kann sich über eine beträchtliche Strecke Waldes in mehreren Gemarkungen ausdehnen und Nadelholz-Stangenorte bis zu fünf Meter Höhe treffen. Die Ursache dieser Beschädigung ist immer Mangel an hinreichender Nahrung. Auch geht das Eichhörnchen den Knospen hauptsächlich im Frühjahre nach, weil diese dann durch den Saftandrang nahrungsreicher und verlockender werden. Die Liebhaberei des Tieres für den Bildungssaft des Holzes bekundet sich so recht deutlich an den Ringeln der Stämmchen. Es zernagt an Fichten, Lärchen, Edeltannen und Föhren den Rindenkörper schraubenförmig oder platzweise in Rechteckform, so daß hierdurch namentlich junge Nadelholzstämmchen regelmäßig eingehen. Nur das Eichhörnchen allein ist ferner der Urheber der sogenannten Absprünge, über die man soviel gefaselt hat, indem man sie bald als Unbilden der Kreuzschnäbel, bald als eine Folge von Wind- und Sturmschäden, ja sogar, wie der alte Bechstein naiv meint, als die von dem andrängenden Safte abgestoßenen Triebe betrachtete. Besonders in stillen Morgenstunden beißt das Tier die einjährigen Triebe an Fichten ab, diese seine Beschädigungen in unzähligen den Boden unter den Stämmen oft dicht bedeckenden Trieben verratend.«
Rechnet man hierzu die obenerwähnte Raubsucht und das abscheuliche Nestplündern, das von dem Eichhörnchen mit ebensoviel Geschicklichkeit als Gier geübt wird, so wird man den Gebrüdern Müller wohl recht geben müssen, wenn sie das Tier als ein in jeder Hinsicht schädliches bezeichnen und ernstlich mahnen, seine Verminderung sich angelegen sein zu lassen.
*
An die Taghörnchen reihen sich die nächtlich lebenden Flug- oder Flatterhörnchen ( Pteromys) an. Sie unterscheiden sich von jenen hauptsächlich dadurch, daß ihre Beine und Füße durch eine breite Flatterhaut verbunden werden. Diese, ein Fallschirm, der die Flughörnchen befähigt, mit Leichtigkeit sehr bedeutende Sprünge in schiefer Richtung von oben nach unten auszuführen, besteht aus einer derben Haut, die an den vorderen und hinteren Gliedmaßen und zu beiden Seiten des Leibes befestigt und auf der Rückseite dicht, auf der Bauchseite aber dünn und spärlich behaart ist. Ein knöcherner Sporn an der Handwurzel stützt das vordere Ende der Flatterhaut noch besonders. Der Schwanz dient als kräftiges Steuerruder und ist immer stark.
Der Taguan ( Pteromys Petaurista), das größte Mitglied der ganzen Familie, kommt in seinen Körperverhältnissen einer Hauskatze fast gleich; seine Leibeslänge beträgt 60 Zentimeter, die des Schwanzes 55 Zentimeter und die Höhe am Widerrist 20 Zentimeter. Der Leib ist kurz gestreckt, der Hals ist kurz, der Kopf verhältnismäßig klein und die Schnauze zugespitzt. Die hinteren Beine sind deutlich länger als die vorderen. Die Flatterhaut beginnt an den Vorderbeinen, zieht sich an den Seiten des Leibes hinab und heftet sich an den Hinterbeinen an, von wo aus sie sich noch in einer kleinen Hautfalte gegen den Schwanz hin verlängert. In der Ruhe wird sie an den Leib angezogen und tritt bloß da lappenähnlich vor, wo sie durch den spornartigen Knochen an der Handwurzel gestützt wird. Auf der Oberseite des Kopfes, dem Rücken und an der Schwanzwurzel wird die Färbung des Pelzes, ein Gemisch von Grau und Schwarz, dadurch hervorgebracht, daß einzelne Haare ganz schwarz, andere an der Spitze weißgrau aussehen. Auf der ganzen Unterseite hat der Pelz eine schmutzig weißgraue Färbung, die in der Mitte des Leibes etwas heller wird. Die Flatterhaut ist oben schwarzbraun bis kastanienbraun, lichtaschgrau gerandet, unterseits grau, etwas ins Gelbliche fallend. Die Beine sind rötlichkastanienbraun oder rötlichschwarz; der Schwanz ist schwarz.
Das Festland von Ostindien, und zwar Malabar und Malakka sowie Siam, sind die ausschließliche Heimat des Taguans. Der Taguan lebt nur in den dichtesten Wäldern und beständig auf Bäumen, einzeln oder paarweise mit seinem Weibchen. Bei Tage schläft er in hohlen Bäumen, nachts kommt er hervor und klettert und springt mit außerordentlicher Schnelligkeit, Gewandtheit und Sicherheit in den Baumkronen umher oder in sehr weiten Sätzen nach benachbarten Bäumen, immer von oben nach unten. Dabei breitet er seine Füße wagerecht und spannt hierdurch die Flatterhaut zu einem weiten Fallschirm aus. Der Schwanz wird als Steuerruder benutzt und befähigt das Tier, durch plötzliches Wenden die Richtung seines Fluges mitten im Sprunge zu verändern. Man versichert, daß die Schnelligkeit seiner Sprünge wie überhaupt seiner Bewegungen außerordentlich groß sei, so daß ihnen das Auge kaum folgen könne. Unter seinen Sinnen sind Gehör und Gesicht ziemlich ausgebildet, die übrigen aber weit unvollkommener entwickelt. In seinem geistigen Wesen unterscheidet er sich wesentlich von den eigentlichen Eichhörnchen. Er hat weit weniger Verstand und ist noch viel furchtsamer und scheuer als seine den Tag liebenden Verwandten.
Der Norden beherbergt Flughörnchen mit zweizeiligem, behaartem, langem, buschigem Schwanze. Von ihnen besitzen auch wir eine Art, das Flatterhörnchen, Umki oder Omké der ostsibirischen Völkerschaften ( Pteromys volans), das den nördlichen Teil von Osteuropa und fast ganz Sibirien bewohnt. Das Tier ist bedeutend kleiner als unser Eichhörnchen, sein Leib mißt bloß 16 Zentimeter in der Länge, der Schwanz nur 10 Zentimeter oder mit den Haaren 13 Zentimeter. Der dichte und weichhaarige, seidenweich anzufühlende Pelz ist im Sommer auf der Oberseite fahlbraun, auf der Flughaut und der Außenseite der Beine dunkler graubraun, unten weiß und am Schwanze oben fahlgrau, unten lichtrostfarbig. Das Flatterhörnchen bewohnt größere Birkenwälder oder gemischte Waldungen, in denen Fichten, Föhren und Birken miteinander abwechseln. Letztere Bäume scheinen ihm Lebensbedürfnis zu sein, und hierauf deutet auch die Färbung seines Pelzes, die im ganzen ebensosehr der Birkenrinde gleicht wie die Färbung unseres Hörnchens der Rinde der Föhren und Fichten. Es wird immer seltener und ist schon aus vielen Gegenden, in denen es früher recht häufig war, fast gänzlich verdrängt worden.

Assapan ( Pteromys volucella)
Der Assapan, wie das Flatterhörnchen in Nordamerika genannt wird ( Pteromys volucella), beinahe die kleinste, einschließlich des 10 Zentimeter langen Schwanzes nur 24 Zentimeter lange Art der Sippe, trägt ebenfalls einen überaus weichen und zarten Pelz und ist oberseits gelbbräunlichgrau, an den Seiten des Halses lichter, auf den Pfoten silberweiß und an der ganzen Unterseite gelblichweiß, der Schwanz aschgrau mit bräunlichem Anfluge, die Flughaut schwarz und weiß gerandet, das Auge schwärzlichbraun. Das Tierchen lebt gesellig in den Wäldern des gemäßigten und warmen Nordamerika, wird öfter zu uns gebracht und hält die Gefangenschaft bei entsprechender Pflege jahrelang ohne ersichtlichen Nachteil aus und schreitet im Käfige selbst zur Fortpflanzung.
Über Tag liegen die Flughörnchen so verborgen als möglich in sich zusammengeknäuelt in ihrem Käfige. Schlaftrunken gestatten sie dem Beobachter jede Maßnahme. Erst ziemlich spät nach Sonnenuntergang, selten vor neun Uhr abends, werden sie munter. Nachdem dann zunächst Hunger und Durst gestillt und alle Teile des Pelzes gebührend geordnet worden sind, regt sich die Lust zu freierer und spielender Bewegung. Eine kurze Weile sitzt das Flughörnchen wie überlegend auf einer und derselben Stelle. Dann folgt ein Sprung mit voll ausgebreiteter Fallhaut, quer durch die Weite des Käfigs. Einen Augenblick nur klebt es an der entgegengesetzten Wand; denn unmittelbar nach der Ankunft am Zielpunkte hat es sich rückwärts geworfen, ist, einen Zweig, eine Sitzstange benutzend, zum Ausgangspunkte zurückgekehrt und ebenso rasch irgendwo andershin geeilt. Auf und nieder, kopfoberst, kopsunterst, hin und her, oben an der Decke weg, unten auf dem Boden fort, an der einen Wand hinauf, an der andern herab, durch das Schlafkästchen, an dem Futternapfe vorüber zum Trinkgeschirr, aus diesem Winkel in jenen, laufend, rennend, springend, gleitend, schwebend, hängend, klebend, sitzend: so wechselt das unvergleichlich behende Geschöpf von Augenblick zu Augenblick, so stürmt es dahin, als ob es tausend Gelenke zugleich regen könne, als ob es nicht eine zu überwindende Schwere gäbe. Es gehört eine länger währende und sehr scharfe Beobachtung dazu, um dem sich bewegenden Flughörnchen überhaupt folgen, die einzelnen Bewegungen desselben unterscheiden und deuten zu können, und wenn eine Gesellschaft dieser alle übrigen Kletterer beschämenden Geschöpfe durcheinander rennt, springt und schwebt, ist dies überhaupt gänzlich unmöglich. Überraschend wirkt namentlich die Jähheit des Wechsels von einer Bewegung zur andern. Das Flughörnchen beendet auch das tollste Jagen jederzeit nach Ermessen und Belieben, so daß das Auge des Beobachters, bei dem Versuche ihm zu folgen, noch immer umherschweift, während es bereits wieder auf einem bleistiftdünnen Zweige sitzt, als sei es nie in Bewegung gewesen.
*
Die Murmeltiere ( Arctomina), die die zweite Unterfamilie bilden, unterscheiden sich von den Hörnchen im engeren Sinne durch den plumperen, gedrungeneren Leib, den kurzen Schwanz und das Gebiß, dessen oberer Backenzahn zwar kleiner, jedoch ebenso lang ist als die folgenden, die nach außen breit abgerundet, innen stark verschmälert und mit scharfen, erhöhten Leisten besetzt sind.
Man findet die Murmeltiere in Mitteleuropa, Nordasien und Nordamerika in ziemlich bedeutender Artenmenge verbreitet. Die meisten von ihnen bewohnen das Flachland, einige dagegen gerade die höchsten Gebirge ihrer bezüglichen Heimatsländer. Trockene, lehmige, sandige oder steinige Gegenden, grasreiche Ebenen und Steppen, Felder und Gärten bilden die Aufenthaltsorte, und nur die Gebirgsmurmeltiere ziehen die Triften und Weiden über der Grenze des Hochwuchses oder die einzelnen Schluchten und Felstäler zwischen der Schneegrenze und dem Holzwuchse jenen Ebenen vor. Alle Arten haben feste Wohnsitze und wandern nicht. Sie legen sich tiefe, unterirdische Baue an und leben hier in Gesellschaften, oft in erstaunlich großer Anzahl, beieinander. Manche haben, je nach der Jahreszeit oder den jeweiligen Geschäften, die sie verrichten, mehr als einen Bau, andere halten sich jahraus, jahrein in derselben Höhlung auf. Sie sind Bodentiere, immer noch lebhaft und schnell in ihren Bewegungen, jedoch weit langsamer als die Hörnchen; einige Arten erscheinen geradezu schwerfällig. Gras, Kräuter, zarte Triebe, junge Pflanzen, Sämereien, Feldfrüchte, Beeren, Wurzeln, Knollen und Zwiebeln bilden ihre Nahrung, und nur die wenigen, die sich mühsam auf Bäume und Sträucher hinaufhaspeln, fressen junge Baumblätter und Knospen. Wahrscheinlich nehmen auch sie neben der Pflanzennahrung tierische zu sich, wenn ihnen dieselbe in den Wurf kommt, fangen Kerbtiere, kleine Säugetiere, tölpische Vögel und plündern deren Nester aus. Manche werden den Getreidefeldern und Gärten schädlich; doch ist der Nachteil, den sie unserm Besitzstande zufügen, nicht von Belang. Beim Fressen sitzen sie wie die Eichhörnchen auf dem Hinterteile und bringen das Futter mit den Vorderpfoten zum Munde. Mit der Fruchtreife beginnen sie, Schätze einzusammeln, und füllen sich, je nach der Örtlichkeit, besondere Räumlichkeiten ihrer Baue mit Gräsern, Blättern, Sämereien und Körnern an. Gegen den Winter hin vergraben sie sich in ihren Bau und verfallen in einen ununterbrochenen und tiefen Winterschlaf, der ihre Lebenstätigkeit auf das allergeringste Maß herabstimmt.
Ihre Stimme besteht in einem stärkeren oder schwächeren Pfeifen und einer Art von Murren, das, wenn es leise ist, Behaglichkeit ausdrückt, sonst aber auch ihren Zorn bekundet. Unter ihren Sinnen sind Gefühl und Gesicht am meisten ausgebildet; namentlich zeigen auch sie ein sehr feines Vorgefühl der kommenden Witterung und treffen danach ihre Vorkehrungen. Hinsichtlich ihrer geistigen Fähigkeiten übertreffen sie durchschnittlich die Hörnchen. Höchst aufmerksam, vorsichtig und wachsam, scheu und furchtsam, stellen viele von ihnen besondere Wachen aus, um die Sicherheit der Gesellschaft zu erhöhen, und flüchten sich beim geringsten Verdachte einer nahenden Gefahr schleunigst nach ihren unterirdischen Verstecken. Nur höchst wenige wagen es, einem herankommenden Feinde Trotz zu bieten, die große Mehrzahl setzt sich, ungeachtet ihres tüchtigen Gebisses, niemals zur Wehre, und deshalb sagt man von ihnen, daß sie gutmütig und sanft, friedlich und harmlos seien. Ihr Verstand bekundet sich darin, daß sie sich leicht bis zu einem ziemlich hohen Grade zähmen lassen. Die meisten lernen ihren Pfleger kennen und werden sehr zutraulich, einige zeigen sich sogar folgsam, gelehrig und erlernen mancherlei Kunststückchen.
Ihre Vermehrung ist stark. Sie werfen allerdings durchschnittlich nur einmal im Jahre, aber drei bis zehn Junge, und diese sind schon im nächsten Frühjahre fortpflanzungsfähig.
Man benutzt von einigen das Fell und ißt von den andern das Fleisch, hält sie auch gern als artige Hausgenossen; weiteren Nutzen bringen sie nicht.
Ziesel ( Spermophilus) heißen die kleinsten Arten der Unterfamilie, schmucke Tierchen mit verhältnismäßig schlankem Leibe, gestrecktem Kopfe, im Pelze versteckten Ohren, kurzem, nur an den Endhälften zweizeilig buschig behaartem Schwanze, vier Zehen und einer kurzen Daumenwarze an den Vorder-, fünf Zehen an den Hinterfüßen sowie großen Backentaschen. Die zahlreichen Arten dieser Sippe gehören der nördlichen Erdhälfte an. Unsere heimische Art gibt ein treues Bild der übrigen.
Der Ziesel ( Spermophilus Citillus), ein niedliches Tierchen, fast von Hamstergröße, aber mit viel schlankerem Leibe und hübscherem Köpfchen, 22 bis 24 Zentimeter lang und mit 7 Zentimeter langem Schwanze, am Widerrist etwa 9 Zentimeter hoch und ungefähr ein Pfund schwer, trägt einen lockeren, aus ziemlich straffen, in der Mitte dunkler geringelten Haaren bestehenden Pelz, der aus der Oberseite gelbgrau, unregelmäßig mit Rostgelb gewellt und fein gefleckt, auf der Unterseite rostgelb, am Kinne und Vorderhalse weiß aussieht. Stirn und Scheitel sind rötlichgelb und braun gemischt, die Augenkreise licht, die Füße rostgelb, gegen die Zehen hin heller, die Krallen und die Schnurren schwarz, die oberen Vorderzähne gelblich, die unteren weißlich. Das Wollhaar der Oberseite ist schwarzgrau, das der Unterseite heller bräunlichgrau, das des Vorderhalses einfarbig weiß. Die Nasenkuppe ist schwärzlich, das ziemlich große Auge hat schwarzbraunen Stern. Mancherlei Abänderungen der Färbung kommen vor.
Der Ziesel findet sich hauptsächlich im Osten Europas. Albertus Magnus hat ihn in der Nähe von Regensburg beobachtet, wo er jetzt nicht mehr vorkommt, während er neuerdings in Schlesien immer weiter in westlicher Richtung sich verbreitet. Vor etwa vierzig Jahren kannte man ihn dort nicht, seit dreißig Jahren aber ist er schon im westlichen Teile der Provinz, und zwar im Regierungsbezirke Liegnitz, eingewandert und streift von hier aus immer weiter westlich. Wie es scheint, hat er von allen verwandten Arten die größte Verbreitung. Man kennt ihn mit Sicherheit als Bewohner des südlichen und gemäßigten Rußland, von Galizien, Schlesien und Ungarn, Steiermark, Mähren und Böhmen, Kärnten, Krain und der oberhalb des Schwarzen Meeres gelegenen russischen Provinzen. Daß er in Rußland häufiger auftritt als bei uns, geht aus seinem Namen hervor; denn dieser ist russischen Ursprungs und lautet eigentlich »Suslik«, im Polnischen »Susel«, im Böhmischen »Sisel«. Die Alten nannten ihn » pontische Maus« oder » Simor«. An den meisten Orten, wo sich der Ziesel findet, kommt er auch häufig vor und fügt unter Umständen dem Ackerbau merklichen Schaden zu. Trockene, baumleere Gegenden bilden seinen Aufenthalt; vor allem liebt er einen bindenden Sand- oder Lehmboden, also hauptsächlich Ackerfelder und weite Grasflächen. Neuerdings hat er sich, laut Herklotz, besonders den Eisenbahnen zugewendet, deren aufgeworfene Dämme ihm das Graben erleichtern und vor Regengüssen einen gewissen Schutz gewähren. Doch scheut er auch unter sonst günstigen Lebensbedingungen einen festen Boden nicht und zerlöchert diesen unter Umständen so, daß hier und da fast Röhre an Röhre nach außen mündet. Er lebt stets gesellig, aber jeder einzelne gräbt sich seinen eigenen Bau in die Erde, das Männchen einen flacheren, das Weibchen einen tieferen. Der Kessel liegt 1 bis 1½ Meter unter der Oberfläche des Bodens, ist von länglichrunder Gestalt, hat ungefähr 30 Zentimeter Durchmesser und wird mit trockenem Grase ausgefüttert. Nach oben führt immer nur ein einziger, ziemlich enger und in mancherlei Krümmungen oft sehr flach unter der Erdoberfläche hinlaufender Gang, vor dessen Mündung ein kleiner Haufen ausgeworfener Erde liegt. Der Gang wird nur ein Jahr lang benutzt; denn sobald es im Herbste anfängt, kalt zu werden, verstopft der Ziesel die Zugangsöffnung, gräbt sich aber vom Lagerplatze aus eine neue Röhre bis dicht unter die Oberfläche, die dann im Frühjahre, sobald der Winterschlaf vorüber, geöffnet und für das laufende Jahr als Zugang benutzt wird. Die Anzahl der verschiedenen Gänge gibt also genau das Alter der Wohnung an, nicht aber auch das Alter des in ihr wohnenden Tieres, weil nicht selten ein anderer Ziesel die noch brauchbare Wohnung eines seiner Vorgänger benutzt, falls dieser durch irgendeinen Zufall zugrunde ging. Nebenhöhlen im Baue dienen zur Aufspeicherung der Wintervorräte, die im Herbste eingetragen werden. Der Bau, in dem das Weibchen im Frühjahre, gewöhnlich im April oder Mai, seine drei bis acht nackten und blinden, anfangs ziemlich unförmlichen Jungen wirft, ist immer tiefer als alle übrigen, um den zärtlich geliebten Kleinen hinlänglichen Schutz zu gewähren. »Bewohnte Baue«, schreibt mir Herklotz, »lassen sich sofort durch den Geruch erkennen; denn der Ziesel verabsäumt selten, vor dem Einfahren seinen Harn zu lassen, und dieser hat einen so unangenehm stechenden Geruch, daß man sich selten täuschen kann.
Auffallend ist die Sucht des Tieres, allerlei glänzende Dinge, Porzellanscherben, Glas- und Eisenstückchen z. B., in seinen Bau zu schleppen. Auch an Gefangenen bemerkt man diese Gewohnheit: sie suchen kleinere Porzellangefäße mit Zähnen und Pfötchen zu bewältigen und unter ihrem Heulager zu verstecken.
Der Ziesel besitzt eine Fertigkeit im Graben, die geradezu in Erstaunen setzen und Uneingeweihten vollkommen unglaublich scheinen muß. Ich hatte einmal in meinem Zimmer, und zwar in einem aus Holz und Draht gefertigten Behälter, vier Ziesel untergebracht, die in kürzester Zeit sich durch Zernagen des Holzes freizumachen wußten und zunächst in Stube und Kammer ihr Wesen trieben. Drei von ihnen wurden bald wieder eingefangen, der vierte aber war verschwunden. Nach zwei Tagen sah ich hinter einem größeren Stuhle einen Haufen Ziegelsteinbrocken, Mörtel und Sand liegen und mußte zu meinem Verdrusse wahrnehmen, daß diese Dinge von dem Ziesel herrührten, der sich ein tiefes Loch in die Mauer gearbeitet hatte. Alle Versuche, ihn herauszuziehen, waren vergeblich; er grub noch fünf Tage lang fort und hatte, wie sich durch Messung ergab, ein Loch von über zwei Meter Tiefe in die Ziegelmauer gegraben, als er wieder eingefangen wurde.
Es kann keine angenehmere Unterhaltung gewähren, als in den Nachmittagsstunden eines Frühsommertages Ziesel zu beobachten. Der Geruch hat zehn bis zwölf bewohnte Baue erkennen lassen, in deren Nähe wir uns lagern. Kaum zehn Minuten währt es, und in der Mündung einer Röhre erscheint ein äußerst liebliches Köpfchen, dessen klare Augen unbesorgt ins Grüne spähen; der übrige Leib folgt, unser Tierchen setzt sich auf, macht ein Männchen, vollendet seine Rundschau, fühlt sich sicher und geht an irgend welches Geschäft. Binnen wenigen Minuten ist gewiß die ganze Gesellschaft am Platze, und nunmehr hat das Auge volle Beschäftigung. Einige spielen, andere putzen sich, einige beknabbern eine Wurzel, andere treiben sonst etwas. Da streicht ein Raubvogel vorüber: ein gellender Pfiff, jeder rennt seinem Falloche zu, stürzt sich kopfüber in dasselbe, und alles ist in den Röhren verschwunden. Doch nur geraume Zeit, und das alte Spiel beginnt von neuem.
In seinen Bewegungen ist der Ziesel ein kleines Murmeltier, kein Hörnchen. Er läuft huschend über den Boden dahin, in rascher Folge ein Bein um das andere fürder setzend, führt selten einen Sprung aus und klettert ungern, obschon nicht ganz ungeschickt, jedoch immer nur nach Art der Murmeltiere, nicht nach Art der Eichhörnchen. Auch seine Stellungen beim Sitzen, sein Männchenmachen und endlich seine Stimme, ein dem Locktone des Kernbeißers täuschend ähnlicher Pfiff, erinnern an jene, nicht an diese.
Obgleich der Ziesel sehr mißtrauisch und vorsichtig ist, gewöhnt er sich doch an öfter wiederkehrende Störungen, so daß diese ihn schließlich nicht im geringsten mehr belästigen. Auf einer ungarischen Bahn entdeckte ich am Ende einer im Schotter eingebetteten Schwelle eine in den Bahndamm eindringende Zieselröhre, die mir durch den Geruch verriet, daß sie bewohnt war. Um mich vollends zu überzeugen, legte ich mich auf die Lauer, und gar nicht lange, so erschien der Ziesel. Eine halbe Stunde später brauste der Zug heran, der Ziesel fuhr in seinen Bau, schaute mit halbem Leibe heraus, ließ ruhig den Zug über sich Wegrasseln, kam sodann wieder heraus und trieb es wie vorher.«
Zarte Kräuter und Wurzeln, z. B. Vogelwegetritt und Klee, Getreidearten, Hülsenfrüchte und allerhand Beeren und Gemüse bilden die gewöhnliche Nahrung des Ziesels. Gegen den Herbst hin sammelt er sich von den genannten Stoffen Vorräte ein, die er hamsterartig in den Backentaschen nach Hause schleppt. Nebenbei wird der Ziesel übrigens auch Mäusen und Vögeln, die auf der Erde nisten, gefährlich; denn er raubt ihnen nicht bloß die Nester aus, sondern überfällt ebenso die Alten, wenn sie nicht vorsichtig sind, gibt ihnen ein Paar Bisse, frißt ihnen das Gehirn aus und verzehrt sie dann vollends bis auf den Balg. Seine Nahrung hält er sehr zierlich zwischen den Vorderpfoten und frißt, in halb aufrechter Stellung auf dem Hinterteile sitzend. Nach dem Fressen putzt er sich die Schnauze und den Kopf und leckt und wäscht und kämmt sich sein Fell oben und unten. Wasser trinkt er nur wenig und gewöhnlich nach der Mahlzeit.
Der Schaden, den der Ziesel durch seine Plündereien verursacht, wird nur dann fühlbar, wenn sich das Tier besonders stark vermehrt. Das Weibchen ist, wie alle Nager, äußerst fruchtbar und wirft in den Monaten April oder Mai nach fünfundzwanzig- bis dreißigtägiger Tragzeit auf dem weichen Lager seines tiefen Kessels ein starkes Gehecke. Die Jungen werden zärtlich geliebt, gesäugt, gepflegt und noch, wenn sie bereits ziemlich groß sind und Ausflüge machen, bewacht und behütet. Ihr Wachstum fördert schnell; nach Monatsfrist sind sie halbwüchsig, im Spätsommer kaum mehr von den Alten zu unterscheiden, im Herbste vollkommen ausgewachsen und im nächsten Frühjahr fortpflanzungsfähig. Bis gegen den Herbst hin wohnt die ganze Familie im Baue der Alten; dann aber gräbt sich jedes Junge eine besondere Höhle, trägt Wintervorräte ein und lebt und treibt es wie seine Vorfahren. Wäre der lustigen Gesellschaft nicht ein ganzes Heer von Feinden auf dem Nacken, so würde ihre Vermehrung, obgleich sie immer noch weit hinter der Fruchtbarkeit der Ratten oder Mäuse zurückbleibt, bedeutend sein. Aber da sind Hermelin, Wiesel, Iltis und Steinmarder, Falken, Krähen, Reiher, Trappen, selbst Katzen, Rattenpintscher und andere der bekannten Nagervertilger, die dem Ziesel eifrig nachstellen. Der Großtrappe gehört, laut Herklotz, nicht allein zu den Feinden der Mäuse, sondern auch zu den ihrigen, verfolgt sie mit ebensoviel Eifer als Geschick, tötet sie durch einen Hieb mit dem Schnabel und verzehrt sie mit Haut und Haar. Auch der Mensch wird zu ihrem Gegner, teils des Felles wegen, teils des wohlschmeckenden Fleisches halber, und jagt sie mittels Schlingen und Fallen, gräbt sie aus oder treibt sie durch eingegossenes Wasser aus der Höhle hervor usw. So kommt es, daß der starken Vermehrung des Ziesels auf hunderterlei Weise Einhalt getan wird. Und der schlimmste Feind ist immer noch der Winter. Im Spätherbst hat das frischfröhliche Leben der Gesellschaft geendet; die Männchen haben ausgesorgt für die Sicherheit der Gesamtheit, die nicht nur außerordentlich wohlbeleibt und fett geworden ist, sondern sich auch ihre Speicher tüchtig gefüllt hat. Jeder einzelne Ziesel zieht sich in seinen Bau zurück, verstopft dessen Höhlen, gräbt einen neuen Gang und verfällt dann in Winterschlaf. Aber gar viele von den eingeschlafenen schlummern in den ewigen Schlaf hinüber, wenn naßkalte Witterung eintritt, die die halberstarrten Tiere auch im Baue zu treffen weiß, indem die Nässe in das Innere der Wohnung dringt und mit der Kälte im Vereine rasch den Tod für die gemütlichen Geschöpfe herbeiführt. Selbst Platzregen im Sommer töten viele von ihnen.
Der Ziesel ist nicht eben schwer zu fangen. Der Spaten bringt die Versteckten leicht an das Tageslicht, oder die tückisch vor den Eingang gestellte Falle kerkert sie beim Wiederherauskommen ein. Da benimmt sich nun der Ziesel höchst liebenswürdig. Einige Tage genügen, einen Ziesel an die Gesellschaft des Menschen zu gewöhnen. Junge Tiere werden schon nach wenigen Stunden zahm; bloß die alten Weibchen zeigen manchmal die Tücken der Nager und beißen tüchtig zu. Bei guter Behandlung erträgt der Ziesel mehrere Jahre hindurch die Gefangenschaft, und nächst der Haselmaus ist er wohl eines der hübschesten Stubentiere, die man sich denken kann. Jeder Besitzer muß seine Freude haben an dem schmucken, gutmütigen Geschöpfe, das sich zierlich bewegt und bald Anhänglichkeit an den Wärter zeigt, wenn auch sein Verstand nicht eben bedeutend genannt werden kann. Ganz besonders empfiehlt den Ziesel seine große Reinlichkeit. Die Art und Weise seines beständigen Putzens, Waschens und Kämmens gewährt dem Beobachter ungemeines Vergnügen. Mit Getreide, Obst und Brot erhält man den Gefangenen leicht, Fleisch verschmäht er auch nicht, und Milch ist ihm ein wahrer Leckerbissen. Wenn man ihn vorwiegend mit trockenen Stoffen füttert, wird auch sein sonst sehr unangenehmer Geruch nicht lästig. Nur eins darf man nie versäumen: ihn fest einzusperren. Gelang es ihm, durchzubrechen, so zernagt er alles, was ihm vorkommt, und kann in einer Nacht eine Zimmereinrichtung zerstören.
Außer den Sibiriern und Zigeunern essen bloß arme Leute das Fleisch des Ziesels, obgleich es nach den Erfahrungen von Herklotz vortrefflich, und zwar ungefähr wie Hühnerfleisch schmeckt. Auch das Fell findet nur eine geringe Benutzung zu Unterfutter, zu Verbrämungen oder zu Geld- und Tabaksbeuteln.
*
Der in Nordamerika lebende Präriehund ( Cynomys Ludovicianus) verbindet gewissermaßen die Ziesel mit den eigentlichen Murmeltieren. Der Leib ist gedrungen, der Kopf groß, der Schwanz sehr kurz, buschig, oben und an den Seiten gleichmäßig behaart; die Backentaschen sind verkümmert. Erwachsene Präriehunde erreichen etwa 40 Zentimeter Gesamtlänge, wovon ungefähr 7 Zentimeter auf den Schwanz kommen. Die Färbung der Oberseite ist licht rötlichbraun, grau und schwärzlich gemischt, die der Unterseite schmutzigweiß, der kurze Schwanz an der Spitze braun gebändert.
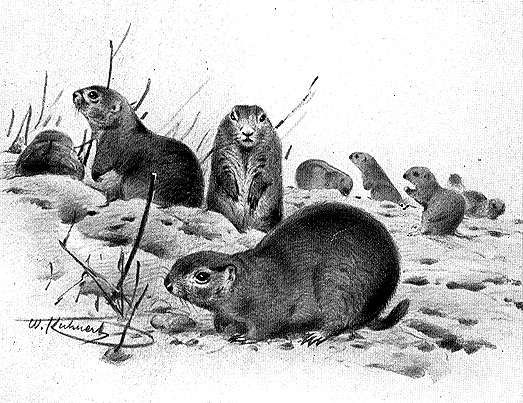
Präriehund ( Cynomis ludovicianus)
Der Name »Präriehund«, der mehr und mehr gültig geworden ist, stammt von den ersten Entdeckern, den alten kanadischen Trappern oder Pelzjägern, her, die unser Tierchen nach seiner bellenden Stimme benannten; in der äußeren Gestalt würde auch die gröbste Vergleichung keine Ähnlichkeit mit dem Hunde gefunden haben. Seine ausgedehnten Ansiedlungen, die man ihrer Größe wegen » Dörfer« nennt, finden sich regelmäßig auf etwas vertieften Wiesen, auf denen ein zierliches Gras einen wunderschönen Rasenteppich bildet und ihnen zugleich bequeme Nahrung gewährt. »Zu welcher unglaublichen Ausdehnung die Ansiedelungen dieser friedlichen Erdenbewohner herangewachsen sind«, sagt Balduin Möllhausen, »davon kann man sich am besten überzeugen, wenn man ununterbrochen tagelang zwischen kleinen Hügeln hinzieht, deren jeder eine Wohnung zweier oder mehrerer solcher Tiere bezeichnet. Die einzelnen Wohnungen sind gewöhnlich fünf bis sechs Meter voneinander entfernt, und jeder kleine Hügel, der sich vor dem Eingange derselben erhebt, mag aus einer guten Wagenladung Erde bestehen, die allmählich von den Bewohnern aus den unterirdischen Gängen ans Tageslicht befördert worden ist. Manche haben einen, andere dagegen zwei Eingänge. Ein festgetretener Pfad führt von einer Wohnung zur andern, und es wird bei deren Anblick die Vermutung rege, daß eine innige Freundschaft unter diesen lebhaften, kleinen Tierchen herrschen muß. Bei der Wahl einer Stelle zur Anlage ihrer Städte scheint ein kurzes, krauses Gras sie zu bestimmen, das besonders aus höheren Ebenen gedeiht und nebst einer Wurzel die einzige Nahrung dieser Tierchen ausmacht. Daß diese Tierchen ihren Winterschlaf halten, ist wohl nicht zu bezweifeln, denn das Gras um ihre Höhlen vertrocknet im Herbste gänzlich, und der Frost macht den Boden so hart, daß es unmöglich für sie sein würde, auf gewöhnlichem Wege Nahrung sich zu verschaffen. Wenn der Präriehund die Annäherung seiner Schlafzeit fühlt, die gewöhnlich in den letzten Tagen des Oktobers geschieht, schließt er alle Ausgänge seiner Wohnung, um sich gegen die kalte Winterluft zu schützen, und übergibt sich dann dem Schlafe, um nicht eher wieder auf der Oberwelt zu erscheinen, als bis die warmen Frühlingstage ihn zu neuem, fröhlichem Leben erwecken. Den Aussagen der Indianer gemäß öffnet er manchmal noch bei kalter Witterung die Türen seiner Behausung. Dies ist alsdann aber als sicheres Zeichen anzusehen, daß bald warme Tage zu erwarten sind.
Einen merkwürdigen Anblick gewährt eine solche Ansiedelung, wenn es glückt, von den Wachen unbeachtet in ihre Nähe zu gelangen. Soweit das Auge reicht, herrscht ein reges Leben und Treiben: fast auf jedem Hügel sitzt aufrecht, wie ein Eichhörnchen, das kleine gelbbraune Murmeltier; das aufwärtsstehende Schwänzchen ist in immerwährender Bewegung, und zu einem förmlichen Summen vereinigen sich die feinen, bellenden Stimmchen der vielen Tausende. Nähert sich der Beschauer um einige Schritte, so vernimmt und unterscheidet er die tieferen Stimmen älterer und erfahrener Häupter; aber bald, wie durch Zauberschlag, ist alles Leben von der Oberfläche verschwunden. Nur hin und wieder ragt aus der Öffnung einer Höhle der Kopf eines Kundschafters hervor, der durch anhaltend herausforderndes Bellen seine Angehörigen vor der gefährlichen Nähe eines Menschen warnt. Legt man sich alsbald nieder und beobachtet bewegungslos und geduldig die nächste Umgebung, so wird in kurzer Zeit der Wachtposten den Platz auf dem Hügel vor seiner Tür einnehmen und durch unausgesetztes Bellen von dem Verschwinden der Gefahr in Kenntnis setzen. Er lockt dadurch einen nach dem andern aus den dunklen Gängen auf die Oberfläche, wo alsbald das harmlose Treiben dieser geselligen Tiere von neuem beginnt. Ein älteres Mitglied von sehr gesetztem Äußern stattet dann wohl einen Besuch bei dem Nachbar ab, der ihn auf seinem Hügel in aufrechter Stellung mit wedelndem Schwänzchen erwartet und dem Besucher an seiner Seite Platz macht. Beide scheinen nun durch abwechselndes Bellen gegenseitig gleichsam Gedanken und Gefühle sich mitteilen zu wollen; fortwährend eifrig sich unterhaltend, verschwinden sie in der Wohnung, erscheinen nach kurzem Verweilen wieder, um gemeinschaftlich eine Wanderung zu einem entfernter lebenden Verwandten anzutreten, der nach gastfreundlicher Aufnahme an dem Spaziergange teilnimmt; sie begegnen andern, kurze, aber laute Begrüßungen finden statt, die Gesellschaft trennt sich, und jeder schlägt die Richtung nach der eigenen Wohnung ein. Stundenlang könnte man, ohne zu ermüden, das immerwährend wechselnde Schauspiel betrachten, und es darf nicht wundern, wenn der Wunsch rege wird, die Sprache der Tiere zu verstehen, um sich unter sie mischen und ihre geheimen Unterhaltungen belauschen zu können.« Präriehunde, Erd- oder Prärieeulen und Klapperschlangen leben seltsamerweise in einem und demselben Bau beisammen. Ausstopfer im fernen Westen wählen das Kleeblatt mit Vorliebe als Vorwurf zu einer Tiergruppe, die unter dem Namen: »die glückliche Familie« bei Ausländern nicht wenig Verwunderung erregt.
*
An die Präriehunde schließen sich die Murmeltiere ( Arctomys) eng an. Was der Präriehund in der neuen, ist der Bobak ( Arctomys Bobac) in der alten Welt: ein Bewohner der Ebenen. Die Leibeslänge des erst in neuerer Zeit von dem Alpenmurmeltier unterschiedenen Bobak beträgt 37 Zentimeter, die Schwanzlänge 9 Zentimeter; der ziemlich dichte Pelz ist fahl rostgelb, auf der Oberseite, infolge der Einmischung einzelner schwarzbrauner Haarspitzen, etwas dunkler, auf dem Scheitel, an der Schnauze, den Lippen und Mundwinkeln sowie in der Augengegend einfarbig bräunlich rostgelb, am Schwanze dunkel rostgelb, an der Schwanzspitze schwarzbraun, der Haargrund oben dunkel graubraun, unten heller braun, an Vorderhals und Kehle grauweißlich.
Von dem südlichen Polen und Galizien an verbreitet sich der Bobak über ganz Südrußland und das südliche Sibirien bis zum Amur und nach Kaschmir. Hier haust er in fruchtbaren Niederungen, in denen während des Sommers eine reichhaltige, aber niedrigwachsende Pflanzenwelt den Boden deckt, dort sucht er die von Fruchterde entblößten Ebenen und Gehänge auf. Immer und überall lebt er in Gesellschaften von betrachtlicher Anzahl und drückt deshalb manchen Gegenden ein absonderliches Gepräge auf: unzählige Hügel, die man in den Grassteppen Innerasiens bemerkt, verdanken ihre Entstehung vornehmlich diesen Murmeltieren, die durch ihr munteres Leben In seiner 1921 erschienenen Reisebeschreibung »Durch die mongolischen Ebenen« teilt der bekannte Neuyorker Zoologe N. C. Andrews eine überaus amüsante Beobachtung über »tanzende« Murmeltiere mit: »Herr Mamen sprach oft von einem ungewöhnlichen Tanz, den er die Murmeltiere hatte vollführen sehen; und auch Herr und Frau MacCallie haben es auf ihrer Rückreise nach Kalgan gesehen. Ich war leider niemals so glücklich, dieselbe Beobachtung zu machen. Mac schilderte, daß zwei auf ihren Hinterfüßen hoch aufgerichtete Murmeltiere einander bei ihren Vorderpfoten faßten und langsam umhertanzten, genau so, als ob sie Walzer tanzten. Er versicherte ebenso wie Mamen, daß dies die ungewöhnlichste und amüsanteste Sache gewesen sei, die er jemals ein Tier habe vollführen sehen. Ich will es gern glauben; denn die Murmeltiere haben allerhand kuriose Gewohnheiten, die wohl ein genaueres Studium verdienten. Dieser Tanz kann unmöglich mit dem Liebesspiel zusammenhängen, denn Mac sah ihn im Spätmai, zu welcher Zeit die Jungen schon geboren sind.« (Aus dem Englischen.) Der Herausgeber. den Reisenden ebenso zu fesseln wissen, wie sie, ihres Fleisches halber, für den Steppenbewohner und verschiedene Tiere bedeutungsvoll werden.
In allen Bobaksiedlungen herrscht während des Sommers ein ungemein reges und betriebsames Leben. Die bereits im April oder spätestens im Mai geborenen Jungen sind um diese Zeit halberwachsen und treiben es schon ganz wie die Alten, wenn sie auch deren Erfahrung noch nicht besitzen. Mit Sonnenaufgang verlassen sie mit den Alten den Bau, lecken gierig den Nachttau, ihre einzige Labung in den meist wasserlosen Steppen, von den Blättern, fressen und spielen dann bis gegen Mittag lustig auf den vor ihren Höhlen aufgeworfenen Hügeln, verträumen den heißen Nachmittag auf wohlbereitetem Lager im Innern des Baues und erscheinen gegen Abend nochmals außerhalb des letzteren, um noch einen Imbiß für die Nacht zu nehmen. Ungern nur weiden sie die in unmittelbarer Nähe ihrer Röhrenmündungen wachsenden Kräuter ab, bilden sich vielmehr zwischen diesen schmale Pfade, die bis zu ihrem oft vierzig bis fünfzig Meter entfernt gelegenen Weidegebiete führen; ebenso ungern aber begeben sie sich auf Stellen, von denen aus sie nicht in kürzester Frist mindestens einen Notbau erreichen können. Solange keinerlei Gefahr droht, geht es in der Siedlung fast genau in derselben Weise her wie in einem Dorfe der Präriehunde, und ebenso verschwinden die Bobaks, sobald sie die Annäherung eines Wolfes, Hundes, Adlers oder Bartgeiers und bezüglich eines Menschen wahrnehmen, auf den bellenden, von vielen wiederholten Warnungsruf eines wachsamen Alten hin, augenblicklich, nach Art ihrer Verwandtschaft kopfüber in ihre Löcher sich stürzend. Im Juni beginnen sie mit dem Eintragen der Wintervorräte, betreiben ihre Heu- und Wurzelernte jedoch noch lässig; später werden sie eifriger und fleißiger. Die zunehmende Kühle belästigt und verstimmt sie ungemein. Schon in der letzten Hälfte des August sieht man sie am Morgen nach einer kühlen Nacht taumelnden Ganges, wie im Schlafe, langsam von ihren Hügeln schleichen, und von ihrer Munterkeit ist fortan wenig mehr zu bemerken. In den Steppen Südostsibiriens ziehen sie sich ziemlich allgemein in der ersten Hälfte des Septembers zurück, verstopfen den Eingang der Hauptröhre mit einem ungefähr meterdicken Pfropfen aus Steinen, Sand, Gras und ihrem eigenen Kote und führen nunmehr bis zum Eintritt des Winters noch ein Halbleben in der Tiefe ihrer Wohnungen.
Die Baue haben, bei übereinstimmender äußerer Form, eine in sehr bedeutenden Grenzen schwankende innere Ausdehnung und sind in der Regel da am großartigsten, wo der Boden am härtesten ist. »Gewöhnlich«, beschreibt Radde, dessen Schilderung ich folge, »beträgt die Entfernung des Lagers von der Mündung des Ausganges fünf bis sieben, selten bis vierzehn Meter. Dieser Haupteingang teilt sich oft schon einen oder anderthalb Meter unter der Oberfläche der Erde gabelförmig in zwei bis drei Arme, deren jeder nicht selten nochmals sich spaltet. Die Nebenarme enden meistens blind und geben die Stoffe zum Verschließen des Haupteinganges her. Alle aber, die nicht blind enden, führen zu der geräumigen Schlafstelle.« Das Nest, in dem sie überwintern, ist ein anderes als jenes, in dem sie zur Sommerzeit lagern. Die mit ihren Sitten sehr vertrauten heidnischen Jäger versichern, daß sie die gesammelten Grashalme, bevor sie dieselben zum Polstern des Winternestes verbrauchen, zwischen dem oberen Teil des Vorderfußes und der Bauchseite weichreiben, um ein möglichst behagliches Lager zu bekommen.
Innerhalb des sorgfältig verschlossenen Baues herrscht stets eine Wärme über dem Gefrierpunkt, die Tungusen sagen, eine solche wie in ihren Jurten, Anfänglich scheinen die Bobaks in ihrer Winterherberge noch ziemlich munter zu sein. Sie müssen von den eingetragenen Vorräten fressen, denn sie erzeugen beträchtliche Kothaufen; sie müssen auch ziemlich spät noch munter sein, weil weder der Tunguse noch der Iltis, welche beiden die Murmeltiere ausgraben, ihrer vor Eintritt des Winters habhaft werden können. Doch endlich fordert die kalte Jahreszeit ihr Recht; vom Dezember bis Ende Februar verfallen auch die Bobaks in todähnlichen Schlaf, und erst im März ermuntern sie sich wieder zu neuem Leben. Sie sind die ersten Winterschläfer, die auferstehen. Sowie sie meinen, daß der Frühling sich naht, graben sie den im vorigen Herbst verschlossenen Eingang ihrer unterirdischen Wohnung auf und kommen, feist wie sie vor dem Einwandern waren, wiederum an das Tageslicht, zuerst, noch von der Kälte unangenehm berührt, nur in den Mittagsstunden, angesichts der belebenden Sonne, später öfter und länger, bis sie es endlich wieder treiben wie früher.
Oben auf den höchsten Steinhalden der Alpen, wo kein Baum, kein Strauch mehr wächst, wo kein Rind, kaum die Ziege und das Schaf mehr hinkommt, selbst auf den kleinen Felseninseln mitten zwischen den großen Gletschern, wo im Jahre höchstens sechs Wochen lang der Schnee vor den warmen Sonnenstrahlen schwindet, ist die Heimat eines schon seit alter Zeit wohlbekannten Mitgliedes der Familie, dessen Leben zwar in allem wesentlichen dem der bereits geschilderten Verwandten gleicht, infolge des Aufenthalts aber doch auch wieder in mancher Hinsicht Abweichendes zeigt. Die Römer nannten dieses Tier Alpenmaus, die Savoyarden nennen es Marmotta, die Engadiuer Marmotella, die Deutschen, beide Namen umbildend, Murmeltier. In Bern heißt es Murmeli, in Wallis Murmentli und Mistbelleri, in Graubünden Marbetle oder Murbentle, in Glarus Munk.
Gegenwärtig ist uns Mitteldeutschen das Tier entfremdeter geworden, als es früher war. Die armen Savoyardenknaben dürfen nicht mehr wandern, während sie vormals bis zu uns und noch weiter nördlich pilgerten mit ihrem zahmen Murmeltier auf dem Rücken, um durch die einfachen, Schaustellungen, die sie mit ihrem ein und allem in Dörfern und Städten gaben, einige Pfennige zu verdienen. Dem Murmeltier ist es ergangen wie dem Kamel, dem Affen und dem Bären: es hat aufgehört, die Freude der Kinder des Dörflers zu sein, und man muß jetzt schon weit wandern, bis in die Alpentäler hinein, wenn man es noch lebend sehen will.
Das Alpenmurmeltier ( Arctomys Marmota) erreicht etwa 62 Zentimeter Gesamtlänge oder 51 Zentimeter Leibes- und 11 Zentimeter Schwanzlänge, bei 15 Zentimeter Höhe. In Gestalt und Bau gleicht es seinen Verwandten. Die Behaarung, die aus kürzerem Woll- und längerem Grannenhaar besteht, ist dicht, reichlich und ziemlich lang, ihre Färbung auf der Oberseite mehr oder weniger braunschwarz, auf Scheitel und Hinterkopf durch einige weißliche Punkte unterbrochen, da die einzelnen Grannenhaare hier schwarz und braun geringelt und weiß zugespitzt sind, im Nacken, an der Schwanzwurzel und der ganzen Unterseite dunkel rötlichbraun, an den Beinen, den Leibesseiten und Hinterbacken noch heller, an der Schnauze und an den Füßen rostgelblichweiß. Augen und Krallen sind schwarz, die Vorderzähne braungelb. Übrigens kommen vollkommen schwarze oder weiße und perlartig weiß gefleckte Spielarten vor.
Die neueren Untersuchungen haben ergeben, daß das Murmeltier ausschließlich in Europa lebt. Das Hochgebirge der Alpen, Pyrenäen und Karpathen beherbergt es, und zwar bewohnt es die höchst gelegenen Stellen, die Matten dicht unter dem ewigen Eise und Schnee, geht überhaupt höchstens bis zum Holzgürtel herab. Zu seinem Aufenthalt wählt es freie Plätze, die ringsum durch steile Felsenwände begrenzt werden, oder kleine enge Gebirgsschluchten zwischen einzelnen aufsteigenden Spitzen, am liebsten Orte, die dem menschlichen Treiben so fern als möglich liegen. Je einsamer das Gebirge, um so häufiger wird es gefunden; da, wo der Mensch schon mehr mit ihm verkehrt hat, ist es bereits ausgerottet. In der Regel wohnt es nur auf den nach Süden, Osten und Westen zu gelegenen Bergflächen und Abhängen, weil es, wie die meisten Tagtiere, die Sonnenstrahlen liebt. Hier hat es sich seine Höhlen gegraben, kleinere, einfachere, und tiefere, großartig angelegte, die einen für den Sommer bestimmt, die andern für den Winter, jene zum Schutz gegen vorübergehende Gefahren oder Witterungseinflüsse, diese gegen den furchtbaren, strengen Winter, der da oben seine Herrschaft sechs, acht, ja zehn Monate lang festhält. Mindestens zwei Drittel des Jahres verschläft das merkwürdige Geschöpf, oft noch weit mehr; denn an den höchstgelegenen Stellen, wo es sich findet, währt sein Wachsein und Umhertreiben vor dem Bau kaum den sechsten Teil des Jahres.
Das Sommerleben ist, laut Tschudi, sehr kurzweilig. Mit Anbruch des Tages kommen zuerst die Alten aus der Röhre, strecken vorsichtig den Kopf heraus, spähen, horchen, wagen sich dann langsam ganz hervor, laufen etliche Schritte bergan, setzen sich auf die Hinterbeine und werden hierauf eine Weile lang mit unglaublicher Schnelligkeit das kürzeste Gras ab. Bald darauf strecken auch die Jungen ihre Köpfe hervor, huschen heraus, werden ein wenig, liegen stundenlang in der Sonne, machen Männchen und spielen artig miteinander. Alle Augenblicke sehen sie sich um und bewachen mit der größten Aufmerksamkeit die Gegend. Das erste, das etwas Verdächtiges bemerkt, einen Raubvogel oder Fuchs oder Menschen, pfeift tief und laut durch die Nase, die übrigen wiederholen es teilweise, und im Nu sind alle verschwunden. Bei mehreren Tierchen hat man statt des Pfeifens ein lautes Kläffen gehört, woher wahrscheinlich der Name »Mistbelleri« kommt. Ob sie aber überhaupt eigentliche Wachen ausstellen, ist nicht entschieden. Ihre Kleinheit sichert sie mehr vor der Gefahr, bemerkt zu werden, und ihr Auge, besonders aber ihr Ohr und Geruch, sind sehr scharf.
Während des Sommers wohnen die Murmeltiere einzeln oder paarweise in ihren eigenen Sommerwohnungen, zu denen ein bis vier Meter lange Gänge mit Seitengängen und Fluchtlöchern führen. Diese sind oft so eng, daß man kaum eine Faust glaubt durchzwängen zu können. Die losgegrabene Erde werfen sie nur zum kleinsten Teil hinaus; das meiste treten sie oder schlagen sie in den Gängen fest, die dadurch hart und glatt werden. Die Ausgänge sind meist unter Steinen angebracht. In ihrer Nähe findet man oft eine ganze Anzahl kurzer, bloß zum Verstecken bestimmter Löcher und Röhren. Der Kessel ist wenig geräumig. Hier paaren sie sich, wahrscheinlich im April, und das Weibchen wirft nach sechs Wochen zwei bis vier Junge, die sehr selten vor die Höhle kommen, bis sie etwas herangewachsen sind, und bis zum nächsten Sommer mit den Alten den Bau teilen.
Gegen den Herbst zu graben sie sich ihre weiter unten im Gebirge liegende Winterwohnung, die jedoch selten tiefer als anderthalb Meter unter dem Rasen liegt. Sie ist immer niedriger im Gebirge gelegen als die Sommerwohnung, die oft sogar 2600 Meter über dem Meere liegt, während die Winterwohnung (im Kanton Glarus »Schübene« genannt) in der Regel in dem Gürtel der obersten Alpenweiden, oft aber auch tief unter der Baumgrenze liegt. Diese nun ist für die ganze Familie, die aus fünf bis fünfzehn Stück besteht, berechnet und daher sehr geräumig. Der Jäger erkennt die bewohnte Winterhöhle sowohl an dem Heu, das vor ihr zerstreut liegt, als auch an der gut mit Heu, Erde und Steinen von innen verstopften, aber bloß faustgroßen Mündung der Höhleneingänge, während die Röhren der Sommerwohnungen immer offen sind. Nimmt man den Baustoff aus der Röhrenmündung weg, so findet man zuerst einen aus Erde, Sand und Steinen wohlgemauerten, mehrere Fuß langen Eingang. Verfolgt man nun diesen sogenannten Zapfen einige Meter weit, so stößt man bald auf einen Scheideweg, von dem aus zwei Gänge sich fortsetzen. Der eine, in dem sich gewöhnlich Losung und Haare befinden, führt nicht weit und hat wahrscheinlich den Baustoff zur Ausmauerung des Hauptganges geliefert. Dieser erhöht sich jetzt allmählich, und nun stößt der Jäger an seiner Mündung auf einen weiten Kessel, oft acht bis zehn Meter bergwärts, das geräumige Lager der Winterschläfer. Er bildet meist eine eirunde, backofenförmige Höhle, mit kurzem, weichem, dürrem, gewöhnlich rötlichbraunem Heu angefüllt, das zum Teil jährlich erneuert wird. Vom August an fangen nämlich diese klugen Tierchen an, Gras abzubeißen und zu trocknen und mit dem Maul zur Höhle zu schaffen, und zwar so reichlich, daß es oft von einem Manne auf einmal nicht weggetragen werden kann. Man fabelte früher von dieser Heuernte sonderbare Sachen. Ein Murmeltier sollte sich auf den Rücken legen, mit Heu beladen lassen und so zur Höhle wie ein Schlitten gezogen werden. Zu dieser Erzählung veranlaßte die Erfahrung, daß man oft Murmeltiere findet, deren Rücken ganz abgerieben ist, was jedoch bloß vom Einschlüpfen in die engen Höhlengänge herrührt.
Außer diesen beiden Wohnungen hat das Murmeltier noch besondere Fluchtröhren, in die es sich bei Gefahr versteckt, oder es eilt unter Steine und Felsenklüfte, wenn es seine Höhle nicht erreichen kann.
Die Bewegungen des Murmeltieres sind sonderbar. Der Gang namentlich ist ein höchst eigentümliches, breitspuriges Watscheln, wobei der Bauch fast oder wirklich auf der Erde schleift. Eigentliche Sprünge habe ich die Murmeltiere, meine gefangenen wenigstens, niemals ausführen sehen; sie sind zu schwerfällig dazu. Höchst sonderbar sieht das Tier aus, wenn es einen Kegel macht; es sitzt dann kerzengerade auf dem Hinterteil, steif wie ein Stock, den Schwanz senkrecht vom Leibe abgebogen, die Vorderarme schlaff herabhängend, und schaut aufmerksam in die Welt hinaus. Beim Graben arbeitet es langsam, gewöhnlich nur mit einer Pfote, bis es einen hübschen Haufen Erde losgekratzt hat; dann wirft es diese durch schnellende Bewegungen mit den Hinterfüßen weiter zurück, und endlich schiebt es sie mit dem Hintern vollends zur Höhle hinaus. Während des Grabens erscheint es häufig vor der Mündung seiner Röhre, um sich den Sand aus dem Fell zu schütteln; hierauf gräbt es eifrig weiter.
Frische und saftige Alpenpflanzen, Kräuter und Wurzeln bilden die Nahrung des Murmeltieres. Zu seiner Lieblingsweide gehören Schafgarbe, Bärenklau, Grindwurzel, Löwenmaul, Klee und Sternblumen. Alpenwegerich und Wasserfenchel, doch begnügt es sich auch mit dem grünen, ja selbst mit dem trockenen Grase, das seinen Bau zunächst umgibt. Mit seinen scharfen Zähnen beißt es das kürzeste Gras schnell ab, erhebt sich auf die Hinterbeine und hält die Nahrung mit den Vorderpfoten, bis es dieselbe gehörig zermalmt hat. Zur Tränke geht es selten; auch trinkt es viel auf einmal, schmatzt dabei und hebt nach jedem Schluck den Kopf in die Höhe, wie die Hühner oder Gänse. Seine ängstliche Aufmerksamkeit während der Weide läßt es kaum einen Bissen in Ruhe genießen; fortwährend richtet es sich auf und schaut sich um, und niemals wagt es, einen Augenblick zu ruhen, bevor es sich nicht auf das sorgfältigste überzeugt hat, daß keine Gefahr droht.
Nach allen Beobachtungen scheint es festzustehen, daß das Alpenmurmeltier ein Vorgefühl für Witterungsveränderungen besitzt. Die Bergbewohner glauben steif und fest, daß es durch Pfeifen die Veränderungen des Wetters anzeigt, und sind überzeugt, daß am nächsten Tage Regen eintritt, wenn das Tier trotz des Sonnenscheins nicht auf dem Berge spielt.
Wie die meisten Schläfer, sind die Alpenmurmeltiere im Spätsommer und Herbst ungemein fett. Sobald nun der erste Frost eintritt, fressen sie nicht mehr, trinken aber noch viel und oft, entleeren sich sodann und beziehen nun familienweise die Winterwohnungen. Vor Beginn des Winterschlafes wird der enge Zugang zu dem geräumigen Kessel auf eine Strecke von ein bis zwei Meter von innen aus mit Erde und Steinen, zwischen die Lehm, Gras und Heu eingeschoben werden, geschickt und fest verstopft, so daß das Ganze einem Gemäuer gleicht, bei dem das Gras gleichsam den Mörtel abgibt. Durch diese Vermauerung wird die äußere Luft abgeschlossen und im Innern durch die Ausstrahlung des Körpers selbst eine Wärme hergestellt, die etwa 8 bis 9°R. beträgt. Der mit dürrem, rotem Heu ausgepolsterte und ringsum ausgefütterte Kessel bildet für die ganze Gesellschaft das gemeinsame Lager. Hier ruht die Familie dicht beieinander. Alle Lebenstätigkeit ist aufs äußerste herabgestimmt, jedes Tier liegt regungslos und kalt in todesähnlicher Erstarrung in der einmal eingenommenen Lage, keines bekundet Leben. Die Blutwärme ist herabgesunken auf die Wärme der Luft, die in der Höhle sich findet, die Atemzüge erfolgen bloß fünfzehnmal in der Stunde. Nimmt man ein Murmeltier im Winterschlaf aus seiner Höhle und bringt es in die Wärme, so zeigt sich erst bei 17 Graden das Atmen deutlicher, bei 20 Graden beginnt es zu schnarchen, bei 22 streckt es die Glieder, bei 25 Graden erwacht es, bewegt sich taumelnd hin und her, wird nach und nach munterer und beginnt endlich zu fressen. Im Frühjahr erscheinen die Murmeltiere in sehr abgemagertem Zustande vor der Öffnung ihrer Winterwohnung, sehen sich sehnsüchtig nach etwas Genießbarem um und müssen oft weit wandern, um an den Ecken und Kanten der Berge, da, wo der Wind den Schnee weggetrieben hat, etwas verdorrtes Gras aufzutreiben. Dieses überwinterte Gras dient ihnen im Anfange zur hauptsächlichsten Nahrung, bald aber sprossen die jungen, frischen, saftigen Alpenpflanzen und verschaffen ihnen wieder Kraft und Fülle.

Alpenmurmeltier ( Arctomys marmota)
Jagd und Fang des Murmeltiers haben mancherlei Schwierigkeiten. Der herannahende Jäger wird fast regelmäßig von irgendeinem Gliede der Gesellschaft bemerkt und den übrigen durch helles Pfeifen angezeigt. Dann flüchten alle nach dem Bau und erscheinen so bald nicht wieder; man muß also vor Sonnenaufgang zur Stelle sein, wenn man ein solches Wild erlegen will, übrigens werden die wenigsten Murmeltiere mit dem Feuergewehr erbeutet. Man stellt ihnen Fallen aller Art oder gräbt sie im Anfang des Winters aus. Schon in alten Zeiten wurde ihnen eifrig nachgestellt, und in der Neuzeit ist es nicht besser geworden. Die Fallen liefern, so einfach sie sind, immer guten Ertrag und vermindern die Murmeltiere um ein Beträchtliches; die Nachgrabungen im Winter rotten sie familienweise aus. Mit Recht ist deshalb in vielen Kantonen der Schweiz das Graben auf Murmeltiere verboten; denn dadurch würde in kurzer Zeit ihre vollständige Vernichtung herbeigeführt werden, während die einfache Jagd ihnen nie sehr gefährlich wird. Im Sommer ist Nachgraben erfolglos, weil die dann vollständig wachen Tiere viel schneller tiefer in den Berg hineingraben, als der Mensch ihnen nachkommen kann. Im äußersten Notfalle verteidigen sich die Murmeltiere mit Mut und Entschlossenheit gegen ihre Feinde, indem sie stark beißen oder auch ihre kräftigen Krallen anwenden. Wird eine Gesellschaft gar zu heftig verfolgt, so zieht sie aus und wandert, um sicher zu sein, von einem Berge zum andern. Hier und da sind, wie Tschudi berichtet, die Bergbewohner vernünftig und bescheiden genug, ihre Fallen bloß für die alten Tiere einzurichten, so z. B. an der Gletscheralp im Walliser Saaßtale, wo die Tiere in größerer Menge vorhanden sind, weil die Jungen stets geschont werden. Dem Alpenbewohner ist das kleine Tier nicht allein der Nahrung wegen wichtig, sondern dient auch als Arzneimittel für allerlei Krankheiten. Das fette, äußerst wohlschmeckende Fleisch gilt als besonderes Stärkungsmittel für Wöchnerinnen; das Fett soll Schwangeren das Gebären erleichtern, Leibschneiden heilen, dem Husten abhelfen, Brustverhärtungen zerteilen; der frisch abgezogene Balg wird bei gichtischen Schmerzen angewandt und dergleichen mehr. Frischem Fleische haftet ein so starker erdiger Wildgeschmack an, daß es dem an diese Speise nicht Gewöhnten Ekel verursacht; deshalb werden auch die frisch gefangenen Murmeltiere, nachdem sie wie ein Schwein gebrüht und geschabt worden sind, einige Tage in den Rauch gehängt und dann erst gekocht oder gebraten. Ein derart vorbereitetes Murmeltierwildbret gilt für sehr schmackhaft.
Für die Gefangenschaft und Zähmung wählt man sich am liebsten die Jungen, obgleich es schwierig ist, diese der Mutter wegzuhaschen, wenn sie den ersten Ausgang machen. Sehr jung eingefangene und noch säugende Murmeltiere sind schwer aufzuziehen und gehen auch bei der besten Pflege gewöhnlich bald zugrunde, während die halbwüchsigen sich leicht auffüttern und lange erhalten lassen. Ihre Nahrung besteht in der Gefangenschaft aus verschiedenen Pflanzenstoffen und Milch. Gibt man sich Mühe mit ihnen, so werden sie bald und in hohem Grade zahm, zeigen sich folgsam und gelehrig, lernen ihren Pfleger kennen, auf seinen Ruf achten, allerlei Stellungen annehmen, auf den Hinterbeinen aufgerichtet umherhüpfen, an einem Stocke gehen usw. Das harmlose und zutrauliche Tier ist dann die Freude von jung und alt, und seine Reinlichkeitsliebe und Nettigkeit erwirbt ihm viel Freunde. Auch mit andern Tieren verträgt sich das Murmeltier gut, erlaubt in Tiergärten Pakas und Agutis in den von ihm gegrabenen Höhlen zu wohnen und wird, obschon es Zudringlichkeit zurückweist, doch nie zum angreifenden Teil. Mit seinesgleichen lebt es nicht immer in gutem Einvernehmen; mehrere zusammengesperrte Murmeltiere greifen nicht selten einander an, und das stärkere beißt das schwächere tot. Im Hause kann man es nicht umherlaufen lassen, weil es alles zernagt, und der Käfig muß auch stark und innen mit Blech beschlagen sein, wenn man das Durchbrechen verhindern will. Im Hofe oder im Garten läßt es sich ebensowenig halten, weil es sich doch einen Ausweg verschafft, indem es sich unter den Mauern durchgräbt. Im warmen Zimmer lebt es im Winter wie im Sommer, in kalten Räumen rafft es alles zusammen, was es bekommen kann, baut sich ein Nest und schläft, aber mit Unterbrechung. Während des Winterschlafes kann man ein wohl in Heu eingepacktes Murmeltier in gut verschlossener Kiste weit versenden. Mein Vater erhielt von Schinz eins zugesandt, noch ehe die Eisenbahn eine schnelle Beförderung möglich machte; aber das Tier hatte die Reise aus der Schweiz bis nach Thüringen sehr gut vertragen und kam noch im festen Schlafe an. Übrigens erhält man selbst bei guter Pflege das gefangene Murmeltier selten länger als fünf bis sechs Jahre am Leben.
*
Eine kleine, aus wenig Arten bestehende Familie eichhornartiger Tiere übergehend, reihen wir den Hörnchen die Bilche oder Schlafmäuse ( Myoxina) an. In Gestalt und Wesen stehen sie den Eichhörnchen nahe, unterscheiden sich von ihnen aber bestimmt durch Eigentümlichkeiten ihres Baues. Sie haben einen schmalen Kopf mit mehr oder minder spitziger Schnauze, ziemlich großen Augen und großen, nackthäutigen Ohren, gedrungenen Leib, mäßig lange Gliedmaßen, zart gebaute Füße mit vorn vier Zehen und einer plattnageligen Daumenwarze, hinten fünf Zehen, mittellangen, dicht buschig und zweiteilig behaarten Schwanz und reichen, weichhaarigen Pelz. Der Schädel ähnelt dem der Mäuse mehr als dem der Eichhörnchen. Hügelige und bergige Gegenden, und hier Wälder und Vorwälder, Haine und Gärten sind ihre Aufenthaltsorte. Sie leben auf und in den Bäumen, seltener in selbstgegrabenen Erdhöhlen verborgen. Bei weitem die meisten durchschlafen den Tag und gehen nur während des Morgen- und Abenddunkels ihrer Nahrung nach. Aus diesem Grunde bekommt man sie selten und bloß zufällig zu sehen. Wenn sie einmal ausgeschlafen haben, sind sie höchst bewegliche Tiere. Sie können vortrefflich laufen und noch besser klettern, nicht aber auch, wie die Hörnchen, besonders große Sprünge ausführen.
In gemäßigten Gegenden verfallen sie mit Eintritt der kälteren Jahreszeit in Erstarrung und verbringen den Winter schlafend in ihren Nestern. Manche häufen sich für diese Zeit Nahrungsvorräte auf und zehren von ihnen, wenn sie zeitweilig erwachen. Ihre Nahrung besteht in Früchten und Sämereien aller Art; die meisten nehmen auch Kerbtiere, Eier und junge Vögel zu sich. Beim Fressen sitzen sie, wie die Eichhörnchen, auf dem Hinterteile und führen die Speise mit den Vorderfüßen zum Munde.
Einige lieben Geselligkeit und halten sich wenigstens paarweise zusammen; andere sind äußerst unverträglich. Das Weibchen wirft während des Sommers in ein zierliches Nest seine Jungen, gewöhnlich vier bis fünf, und erzieht sie mit großer Liebe. Jung eingefangen werden alle Schläfer leidlich zahm; doch dulden sie es nicht gern, daß man sie berührt, alt eingefangene lassen sich dies nie gefallen. Einen irgendwie nennenswerten Nutzen bringen die Bilche uns nicht.
Die erste Sippe wird von dem Siebenschläfer oder Bilch ( Myoxus Glis) und einem Verwandten gebildet. Er gehört zu den Tieren, die dem Namen nach weit besser bekannt sind als von Gestalt und Ansehen. Jeder, der sich mit der alten Geschichte beschäftigt hat, kennt diese Schlafmaus, den besonderen Liebling der Römer, zu dessen Hegung und Pflegung eigene Anstalten getroffen wurden. Eichen- und Buchenhaine umgab man mit glatten Mauern, an denen die Siebenschläfer nicht emporklettern konnten; innerhalb der Umgebung legte man verschiedene Höhlen an zum Nisten und Schlafen; mit Eicheln und Kastanien fütterte man hier die Bilche an, um sie zuletzt in irdenen Gefäßen oder Fässern, »Glirarien« genannt, noch besonders zu mästen. Wie uns die Ausgrabungen in Herkulanum belehrt haben, waren die zur letzten Mästung bestimmten Glirarien kleine, halbkugelige, an den inneren Wänden terrassenförmig abgeteilte und oben mit einem engen Gitter geschlossene Schalen. In ihnen sperrte man mehrere Siebenschläfer zusammen und versah sie im Überflusse mit Nahrung. Nach vollendeter Mästung kamen die Braten als eines der leckersten Gerichte auf die Tafeln reicher Schlemmer. Martial verschmäht nicht, diese kleinen Tiere zu besingen, und läßt sie sagen:
»Winter, dich schlafen wir durch, und wir strotzen von blühendem Fette
Just in den Monden, wo uns nichts als der Schlummer ernährt.«
Den Siebenschläfer, einen Bilch von 16 Zentimeter Leibes- und 13 Zentimeter Schwanzlänge, kennzeichnet hauptsächlich die Gestalt seiner Backenzähne, von denen zwei größere in der Mitte und kleinere vorn und hinten stehen und deren Kaufläche vier gebogene, durchgehende und drei halbe, oberseits nach außen, unterseits nach innen liegende Schmelzfalten zeigt. Der weiche, ziemlich dichte Pelz ist auf der Oberseite einfarbig aschgrau, bald heller, bald dunkler schwärzlichbraun überflogen, an den Seiten des Leibes etwas lichter und da, wo sich die Rückenfarbe von der der Unterseite abgrenzt, bräunlichgrau, auf der Unterseite und der Innenseite der Beine scharf getrennt von der Oberseite, milchweiß und silberglänzend. Der Nasenrücken und ein Teil der Oberlippe zwischen den Schnurren sind graulichbraun, der untere Teil der Schnauze, die Backen und die Kehle bis hinter die Ohren hin weiß, die Schnurren schwarz, die mittelgroßen Ohren außen dunkelgraubraun, gegen den Rand hin lichter. Um die Augen zieht sich ein dunkelbrauner Ring. Der buschig und zweiteilig behaarte Schwanz ist bräunlichgrau, unten mit einem weißlichen Längsstreifen. Verschiedene Abänderungen kommen vor.
Süd- und Osteuropa bilden das wahre Vaterland des Siebenschläfers. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Spanien, Griechenland und Italien an bis nach Süd- und Mitteldeutschland. In Osterreich, Steiermark, Kärnten, Mähren, Schlesien, Böhmen und Bayern ist er häufig, in Kroatien, Ungarn und dem südlichen Rußland gemein; im Norden Europas, schon im nördlichen Deutschland, in England, Dänemark, fehlt er. Er bewohnt hauptsächlich das Mittelgebirge, am liebsten trockene Eichen- und Buchenwaldungen. Den Tag über hält er sich verborgen, bald in hohlen Bäumen, Baumlöchern und Felsklüften, bald in Erdlöchern unter Baumwurzeln, in verlassenen Hamsterhöhlen, Elstern- und Krähennestern hausend; gegen Abend kommt er aus seinen Verstecken hervor, streift nachts umher, sucht sich seine Nahrung, kehrt ab und zu in seinen Schlupfwinkel zurück, um zu verdauen und auszuruhen, frißt nochmals und sucht endlich gegen Morgen, ausnahmsweise auch wohl erst nach Sonnenaufgang, gewöhnlich mit seinem Weibchen oder einem andern Gefährten vereinigt, die zeitweilige Wohnung zum Schlafen wieder auf. Bei seinen nächtlichen Ausflügen zeigt er sich als ein rascher und lebhafter, behender Gesell, der mit Eichhorngewandtheit auf den Bäumen oder an Felsenwänden umherklettert, sicher von Zweig zu Zweig oder auch aus der Höhe zur Tiefe springt und mit kurzen Sätzen rasch umherläuft, wenn er auf die Erde gelangt. Freilich gewahrt man sein Treiben bloß an Orten, die man von vornherein als seine Wohnplätze kennt; denn sonst verbirgt ihn die Nacht vor den Blicken des Menschen und vieler anderer Feinde.
Wenige Nager dürsten es dem Bilche an Gefräßigkeit zuvortun. Er frißt, solange er fressen kann. Eicheln, Bücheln, Haselnüsse bilden vielleicht seine Hauptnahrung, Walnüsse, Kastanien, süßes und saftiges Obst werden aber auch nicht verschmäht, und tierische Kost scheint ihm geradezu Bedürfnis zu sein; wenigstens überfällt, mordet und verzehrt er jedes kleinere Tier, das er erlangen kann, plündert Nester aus, würgt junge Vögel ab, tritt überhaupt nicht selten als Raubtier auf. Wasser trinkt er wenig, wenn er saftige Früchte hat, gar nicht.
Solange der Sommer währt, treibt er sich, falls die Witterung nicht gar zu schlimm ist, allnächtlich in seinem Gebiete umher. Auf seinen Weidezügen setzt er sich fast alle Minuten einmal nach Eichhörnchenart auf das Hinterteil und führt etwas mit den Vorderpfoten zum Munde. Beständig hört man das Knacken von Nüssen, die er zerbricht, oder das Fallen von ausgefressenen Früchten, die er herabwirft. Gegen den Herbst hin sammelt er Nahrungsvorräte ein und speichert diese in seinen Höhlen auf. Um diese Zeit »strotzt er bereits von blühendem Fette«, frißt aber noch so lange als möglich; dann denkt er daran, Herberge für den Winter zu bereiten. Jetzt macht er sich in tiefen Erdlöchern, Rissen und Spalten, Felsen und in altem Gemäuer, wohl auch in tiefen Baumhöhlungen, ein Nest von zartem Moose zurecht, rollt sich, gewöhnlich in Gemeinschaft mit mehreren seiner Genossen, zusammen und fällt schon lange vorher, ehe der Wärmemesser auf dem Nullpunkt steht, in rauheren Gebirgsgegenden bereits im August, in der wärmeren Ebene erst gegen den Oktober hin, in tiefen Schlaf. Er zeigt nunmehr die Gefühllosigkeit aller Winterschläfer und ist vielleicht derjenige, der am tiefsten schläft. Man kann ihn ruhig aus seinem Lager nehmen und wegtragen: er bleibt kalt und regungslos. Im warmen Zimmer erwacht er nach und nach, bewegt anfänglich die Gliedmaßen ein wenig, läßt einige Tropfen seines hellen, goldgelben Harnes von sich und regt sich allmählich mehr und mehr, sieht aber auch jetzt noch sehr verschlafen aus. Im Freien wacht er zeitweilig von selbst auf und zehrt ein wenig von seinen Nahrungsvorräten, gleichsam ohne eigentlich zu wissen, was er tut. Siebenschläfer, die Lenz überwinterte und in einem kühlen Raume hielt, wachten etwa alle vier Wochen auf, fraßen und schliefen dann wieder so fest, daß sie tot schienen; andere, die Galvagni Pflegte, wachten nur alle zwei Monate auf und fraßen. Im Freien erwacht unser Bilch erst sehr spät im Frühjahr, selten vor Ende des April. Somit beträgt die Dauer seines Winterschlafes volle sieben Monate, und er führt demnach seinen Namen mit Fug und Recht.
Bald nach dem Erwachen Paaren sich die Geschlechter, und nach ungefähr sechswöchentlicher Tragzeit wirft das Weibchen aus einem weichen Lager in Baum- oder andern Höhlungen – in der Nähe von Altenburg sehr häufig in den Nistkästen der Stare, die man vermittels hoher Stangen über und auf den Obstbäumen aufzustellen Pflegt – drei bis sechs nackte, blinde Junge, die außerordentlich schnell heranwachsen, nur kurze Zeit an der Mutter saugen und sich dann selbst ihre Nahrung aufsuchen. Niemals steht das Nest des Bilch frei auf Bäumen, wie das unseres Eichhörnchens, wird vielmehr stets nach Möglichkeit verborgen. In Gegenden, wo es viele Buchen gibt, vermehrt sich der Bilch sehr stark, wie sein Wohlleben überhaupt von dem Gedeihen der Früchte abhängt.
Viele Feinde tun dem Siebenschläfer übrigens bedeutend Abbruch. Baummarder und Iltis, Wildkatze und Wiesel, Uhu und Eule sind wohl seine schlimmsten Verfolger, und wenn er auch selbst gegen die stärksten Feinde mit vielem Mut sich wehrt, sie anschnaubt, wütend nach ihnen beißt und sogar die schwachen Krallen bei der Verteidigung zu Hilfe nimmt: er muß ihnen doch jedesmal erliegen. Der Mensch stellt ihm da, wo er häufig ist, teils des Fleisches wegen, teils des Felles wegen eifrig nach, lockt ihn in künstliche Winterwohnungen, Gruben, die man in Wäldern unter Gebüsch und Felsabhängen, an trockenen, gegen Mittag gelegenen Orten für ihn herrichtete, verräterisch mit Moos ausbettete, mit Stroh und dürrem Laube überdeckte und reichlich mit Bücheln bestreute, oder richtet andere Fallen für ihn her. In Bayern fangen ihn die Landleute in gewöhnlichen, mit Hanfkörnern geköderten Meisenkästen.

Siebenschläfer ( Myoxus glis)
Der Siebenschläfer wird verhältnismäßig selten in der Gefangenschaft gehalten. Es läßt sich von vornherein erwarten, daß ein so großer Fresser geistig nicht sehr befähigt sein, überhaupt nicht viele gute Eigenschaften haben kann. Sein Wesen ist nicht gerade angenehm, seine größte Tugend die Reinlichkeit; im übrigen wird er langweilig. Er befindet sich fortwährend in gereizter Stimmung, befreundet sich durchaus nicht mit seinem Pfleger und knurrt in eigentümlich schnarchender Weise jeden wütend an, der sich erfrecht, ihm nahe zu kommen. Dem, der ihn ungeschickt angreift, beweist er durch rasch aufeinanderfolgende Bisse in sehr empfindlicher Weise, daß er keineswegs geneigt sei, sich irgendwie behelligen zu lassen. Nachts springt er wie rasend im Käfige umher und wird schon deshalb seinem Besitzer bald sehr lästig. Er muß auf das sorgfältigste gepflegt, namentlich gefüttert werden, damit er sich nicht durch den Käfig nagt oder einen und den andern seiner Gefährten auffrißt; denn wenn er nicht genug Nahrung hat, geht er ohne weiteres andere seiner Art an, ermordet und verzehrt sie ebenso ruhig wie andere kleine Tiere. Auch die im Käfige geborenen Jungen sind und bleiben ebenso unliebenswürdig wie die Alten.
*
Die Sippe der Gartenbilche ( Eliomys) unterscheidet sich wenig, hauptsächlich durch ihr Gebiß, von der vorhergehenden. Der Gartenschläfer, Gartenbilch oder die große Haselmaus ( Eliomys Nitela) erreicht eine Körperlänge von höchstens 14 Zentimetern, bei einer Schwanzlänge von 9,5 Zentimetern. Der Kopf ist wie die Oberseite rötlichgraubraun, die Unterseite weiß. Um das Auge läuft ein glänzend schwarzer Ring, der sich unter dem Ohre bis an die Halsseiten fortsetzt; vor und hinter dem Ohre befindet sich ein weißlicher, über demselben ein schwärzlicher Fleck. Der Schwanz ist in der Wurzelhälfte graubraun, in der Endhälfte zweifarbig, oben schwarz und unten weiß. Die Haare der Unterseite sind zweifarbig, ihre Wurzeln grau, ihre Spitzen weiß, bisweilen schwachgelblich oder graulich angeflogen. Beide Hauptfarben trennen sich scharf voneinander. Die Ohren sind fleischfarbig, die Schnurren schwarz, weißspitzig, die Krallen lichthornfarben, die oberen Vorderzähne lichtbraun, die unteren lichtgelb. Schön dunkelschwarzbraune Augen verleihen dem Gartenschläfer ein kluges, gewecktes Ansehen.
Der Gartenschläfer, der schon den alten Römern unter dem Namen »Nitela« bekannt war, gehört hauptsächlich den gemäßigten Gegenden des mittleren und westlichen Europas an: Frankreich, Belgien, die Schweiz, Italien, Deutschland, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen und die russischen Ostseeprovinzen sind seine Heimat. In Deutschland ist er in manchen Gegenden, z. B. am Harze, recht häufig. Er bewohnt die Ebene wie das Hügelland, lieber aber doch Berggegenden, und hier vorzugsweise Laubwaldungen, obgleich er auch im Schwarzwalde vorkommt und nicht allzuselten in niederen Gebüschen oder in Gärten sich einstellt. In der Schweiz steigt er im Gebirge bis in die Nähe der Gletscher empor.
Seine Nahrung ist die des Siebenschläfers; doch holt er sich aus den Häusern der Bergbewohner Fett und Butter, Speck und Schinken und frißt junge Vögel und Eier vielleicht noch lieber und mehr als sein langsamerer Verwandter, den er im Klettern und Springen unbedingt überbietet. Sein Nest unterscheidet sich von dem des Siebenschläfers dadurch, daß es frei steht; doch bezieht er unter Umständen auch Schlupfwinkel im Gemäuer, alte Rattenlöcher, Maulwurfgänge und andere Höhlungen im Gestein und in der Erde, bettet sie sich mit weichem Moose aus und macht sie sich so behaglich als möglich. Alte Eichhornhorste werden von ihm sehr gern als Wohnung benutzt; im Notfalle baut er sich auch selbst ein Nest und hängt dieses frei zwischen Baumzweige.
In der ersten Hälfte des Mai paaren sich die Geschlechter. Mehrere Männchen streiten oft lebhaft um ein Weibchen, verfolgen sich gegenseitig unter fortwährendem Zischen und Schnauben und rasen förmlich auf den Bäumen umher. So friedlich sie sonst sind, so zänkisch, boshaft, bissig, mit einem Worte streitlustig, zeigen sie sich jetzt, und die ernsthaftesten Gefechte werden mit einer Wut ausgefochten, die man kaum von ihnen erwarten sollte: häufig genug kommt es vor, daß einer der Gegner von dem andern totgebissen und dann sofort aufgefressen wird. Nach vierundzwanzigtägiger bis monatlicher Tragzeit wirft das Weibchen vier bis sechs nackte, blinde Junge, meistens in einem hübsch zubereiteten, freistehenden Neste, gern in einem alten Eichhörnchen- oder Raben-, sonst auch in einem Amsel- oder Drosselneste, welch letztere unter Umständen gewaltsam in Besitz genommen und sodann mit Moos und Haaren ausgepolstert, auch bis auf eine kleine Öffnung ringsum geschlossen werden. Die Mutter säugt die Jungen längere Zeit, trägt ihnen auch, wenn sie schon fressen können, eine hinreichende Menge von Nahrungsmitteln zu. Kommt man zufällig an das Nest und will versuchen, die Jungen auszunehmen, so schnaubt die sorgende Alte den Feind mit funkelnden Augen an, fletscht die Zähne, springt nach Gesicht und Händen und macht von ihrem Gebisse den allerausgedehntesten Gebrauch. Merkwürdig ist, daß der sonst so reinliche Gartenschläfer sein Nest im höchsten Grade schmutzig hält. Der stinkende Unrat, der sich in demselben anhäuft, bleibt liegen und verbreitet mit der Zeit einen so heftigen Geruch, daß nicht bloß die Hunde, sondern auch geübte Menschen aus ziemlicher Entfernung eine solche Kinderwiege wahrzunehmen imstande sind. Nach wenigen Wochen haben die Jungen bereits die Größe der Mutter erreicht und streifen noch eine Zeitlang in der Nähe ihres Lagers umher, um unter der Obhut und Leitung der Alten ihrer Nahrung nachzugehen. Später beziehen sie ihre eigene Wohnung, und im nächsten Jahre sind sie fortpslanzungsfähig. Bei besonders günstigem Wetter wirft das Weibchen auch wohl zum zweiten Male in demselben Jahre.
Zum Abhalten des Winterschlafes sucht sich der Gartenschläfer trockene und geschützte Baum- und Mauerlöcher, auch Maulwurfshöhlen auf oder kommt an die im Walde stehenden Gehöfte, in Gartenhäuser, Scheuern, Heuböden, Köhlerhütten und andere Wohngebäude, um sich dort zu verbergen. Gewöhnlich findet man ihrer mehrere schlafend in einem Neste, die ganze Gesellschaft dicht zusammengerollt, fast in einem Knäuel verschlungen. Sie schlafen ununterbrochen, doch nicht so fest wie andere Winterschläfer; denn sooft mildere Witterung eintritt, erwachen sie, zehren etwas von ihren Nahrungsvorräten und verfallen erst bei erneuter Kälte wieder in Schlaf. Abweichend von den übrigen Winterschläfern zeigen sie während ihres bewußtlosen Zustandes Empfindlichkeit gegen äußere Reize und geben dies, wenn man sie berührt oder mit einer Nadel sticht, durch schwache Zuckungen und dumpfe Laute zu erkennen. Selten erscheinen sie vor Ende April wieder im Freien, fressen nun zunächst ihre Nahrungsvorräte aus und beginnen sodann ihr eigentliches Sommerleben.
Der Gartenschläfer ist ein verhaßter Gast in Gärten, in denen feinere Obstsorten gezogen werden. Ein einziger reicht hin, eine ganze Pfirsich- oder Aprikosenernte zu vernichten. Bei seinen Näschereien zeigt er einen Geschmack, der ihm alle Ehre macht. Nur die besten und saftigsten Früchte sucht er sich ans, benagt aber oft auch andere, um sie zu erproben, und vernichtet so weit mehr, als er eigentlich frißt. Es gibt kein Schutzmittel, ihn abzuhalten; denn er weiß jedes Hindernis zu überwinden, klettert an den Spalieren und Bäumen hinan, schlüpft durch die Maschen der Netze, die über sie gespannt sind, oder durchnagt sie, wenn sie zu eng gemacht wurden, stiehlt sich selbst durch Drahtgeflechte. Bloß dasjenige Obst, das spät reift, ist vor ihm gesichert; denn um diese Zeit liegt er bereits schlafend in seinem Lager. Da er nun den Menschen nur Schaden zufügt und weder durch sein Fleisch noch durch sein Fell den geringsten Nutzen bringt, wird er von Gartenbesitzern, die am empfindlichsten von ihm gebrandschatzt werden, eifrig verfolgt und vernichtet. Die besten Fallen, die man ihm stellen kann, sind wohl Drahtschlingen, die man vor den Spalieren aufhängt, oder kleine Tellereisen, die man passend aufstellt. Besser als alle solche Fallen schützt den Garten eine gute Katze vor diesem zudringlichem Gaudiebe. Marder, Wiesel, Uhu und Eulen stellen ihm ebenfalls eifrig nach; Gutsbesitzer also, die dem Walde nahe wohnen, tun entschieden wohl, wenn sie diese natürlichen Feinde nach Möglichkeit schonen.
Für die Gefangenschaft eignet sich der Gartenschläfer ebensowenig als der Bilch. Selten gewöhnt er sich an den Menschen, und bei jeder Überraschung bedient er sich sofort seiner scharfen Zähne, oft in recht empfindlicher Weise. Dabei hat er die unangenehmen Eigenschaften des Siebenschläfers, verhält sich still bei Tage und tobt bei Nacht in seinem Käfige umher, versucht Stäbe und Gitter durchzunagen oder durchzubrechen und rast, wenn letzteres ihm gelingt, im Zimmer herum, daß man meint, es wären wohl ihrer zehn, die einander umherjagten. Von dem räuberischen Wesen der Tiere kann man sich an den gefangenen leicht überzeugen. Sie zeigen die Blutgier des Wiesels neben der Gefräßigkeit anderer Bilche, stürzen sich mit wahrer Wut auf jedes kleinere Wirbeltier, das man zu ihnen bringt, erwürgen einen Vogel im Nu, eine bissige Maus trotz aller Gegenwehr nach wenigen Minuten, fallen selbst übereinander her.
*
Die dritte Sippe der Familie, die die Mäusebilche ( Muscardinus) umfaßt, unterscheidet sich ebenfalls hauptsächlich durch das Gebiß von den vorigen. Auch sind die Ohren kleiner als bei den vorigen. In Europa lebt nur eine einzige Art dieser Sippe, die Haselmaus ( Muscardinus avellanarius), eines der niedlichsten anmutigsten und behendesten Geschöpfe unter allen europäischen Nagetieren, ebenso ausgezeichnet durch zierliche Gestalt und Schönheit der Färbung wie durch Reinlichkeit, Nettigkeit und Sanftheit des Wesens. Das Tierchen ist ungefähr so groß wie unsere Hausmaus: seine Gesamtlänge beträgt 14 Zentimeter, wovon fast die Hälfte auf den Schwanz kommt. Der dichte und anliegende, aus mittellangen, glänzenden und weichen Haaren bestehende Pelz ist gleichmäßig gelblichrot, unten etwas Heller, an der Brust und der Kehle weiß, Augengegend und Ohren sind hellrötlich, die Füße rot, die Zehen weißlich, die Oberseite des Schwanzes ist bräunlichrot. Im Winter erhält die Oberseite, namentlich die letzte Hälfte des Schwanzes, einen schwachen schwärzlichen Anflug. Junge Tiere sind lebhaft gelblichrot.
Mitteleuropa ist die Heimat der kleinen Haselmaus: Schweden und England scheinen ihre nördlichste, Toskana und die nördliche Türkei ihre südlichste Grenze zu bilden; ostwärts geht sie nicht über Galizien, Ungarn und Siebenbürgen hinaus. Besonders häufig ist sie in Tirol, Kärnten, Steiermark, Böhmen, Schlesien, Slavonien und in dem nördlichen Italien, wie sie überhaupt den Süden in größerer Anzahl bewohnt als den Norden. Ihre Aufenthaltsorte sind fast dieselben wie die ihrer Verwandten, und auch ihre Lebensweise erinnert lebhaft an die beschriebenen Schläfer. Sie gehört ebensogut der Ebene wie dem Gebirge an, geht aber in letzterem nicht über den Laubholzgürtel nach oben, steigt also höchstens zweitausend Meter über das Meer empor. Niederes Gebüsch und Hecken, am allerliebsten Haselnußdickichte, bilden ihre bevorzugten Wohnsitze.
Bei Tage liegt die Haselmaus irgendwo verborgen und schläft, nachts geht sie ihrer Nahrung nach. Nüsse, Eicheln, harte Samen, saftige Früchte, Beeren und Baumknospen bilden diese; am liebsten aber verzehrt sie Haselnüsse, die sie kunstreich öffnet und entleert, ohne sie abzupflücken oder aus der Hülse zu sprengen. Auch den Beeren der Eberesche geht sie nach und wird deshalb nicht selten in Dohnen gefangen. Sie lebt in kleinen, nicht gerade innig verbundenen Gesellschaften. Jede einzelne oder ihrer zwei zusammen bauen sich in recht dichten Gebüschen ein weiches, warmes, ziemlich künstliches Nest aus Gras, Blättern, Moos, Würzelchen und Haaren, und durchstreifen von hier aus nächtlich ihr Gebiet, fast immer gemeinschaftlich mit andern, die in der Nähe wohnen. Als echte Baumtiere klettern sie wundervoll selbst im dünnsten Gezweigs herum, nicht bloß nach Art der Eichhörnchen und anderer Schläfer, sondern auch nach Art der Affen: denn oft kommt es vor, daß sie sich mit ihren Hinterbeinen an einem Zweige aufhängen, um eine tiefer hängende Nuß zu erlangen und zu bearbeiten, und ebenso häufig sicht man sie gerade so sicher auf der oberen wie an der unteren Seite der Äste hinlaufen, ganz in der Weise jener Waldseiltänzer des Südens. Selbst auf ebenem Boden sind sie noch recht hurtig, wenn sie auch sobald als möglich ihr luftiges Gebiet wieder aufsuchen.
Ihre Fortpflanzungszeit fällt erst in den Hochsommer; selten paaren sich die Geschlechter vor dem Juli. Nach ungefähr vierwöchentlicher Tragzeit, also im August, wirft das Weibchen drei bis vier nackte, blinde Junge in sein kugelförmiges, sehr zierlich und künstlich aus Moos und Gras erbautes, innen mit Tierhaaren ausgekleidetes Sommernest, das regelmäßig im dichtesten Gebüsche und etwa meterhoch über dem Boden zu stehen Pflegt. Die Kinderchen wachsen außerordentlich schnell, saugen aber doch einen vollen Monat an der Alten, wenn sie auch inzwischen schon so groß geworden sind, daß sie ab und zu das Nest verlassen können. Anfangs treibt sich die Familie auf den nächsten Haselsträuchern umher, spielt vergnüglich und sucht dabei Nüsse. Bei dem geringsten Geräusche eilt alles nach dem Neste zurück, dort Schutz zu suchen. Noch ehe die Zeit kommt, wo sie Abschied nehmen von den Freuden des Lichts, um sich in ihre Winterlöcher zurückzuziehen, sind die Kleinen bereits fast so fett geworden wie ihre Eltern. Um die Mitte des Oktober ziehen sie sich wie letztere in den Schlupfwinkel zurück, wo sie den Wintervorrat eingesammelt, und bereiten sich aus Reisern, Laub, Nadeln, Moos und Gras eine kugelige Hülle, in die sie sich gänzlich einwickeln, rollen sich zum Knäuel zusammen und fallen in Schlaf, tiefer noch als ihre Verwandten; denn man kann sie in die Hand nehmen und in derselben herumkugeln, ohne daß sie irgendein Zeichen des Lebens von sich geben. Je nach der Milde oder Strenge des Winters durchschlafen sie nun ihre sechs bis sieben Monate, mehr oder weniger unterbrochen, bis die schöne, warme Frühlingssonne sie zu neuem Leben wachruft.
Es hält schwer, eine Haselmaus zu bekommen, solange sie vollkommen munter ist, und wohl nur zufällig erlangt man sie in dieser oder jener Falle, die man an ihren Lieblingsorten aufstellte und mit Nüssen oder anderer Nahrung köderte. Häufiger erhält man sie im Spätherbste oder Winter beim Laubrechen und Stöckeroden. Entweder frei unter dürren Blättern oder in ihrem Neste liegend und winterschlafend, werden sie mit dem Werkzeuge an das Tageslicht geschleudert und verraten sich durch einen feinen, piependen Laut dem einigermaßen achtsamen Arbeiter, der sie, wenn er sie kennt, dicht in Moos einhüllt, mit sich nach Hause nimmt und bis auf weiteres einbauert oder einem Tierfreunde überliefert. Hält dieser sie einmal in der Hand, so hat er sie auch schon so gut als gezähmt. Niemals wagt sie, sich gegen ihren Bewältiger zur Wehr zu setzen, niemals versucht sie zu beißen; in der höchsten Angst gibt sie bloß einen quietschenden oder hellzischenden Laut von sich. Bald aber fügt sie sich in das Unvermeidliche, läßt sich ruhig in das Haus tragen und ordnet sich ganz und gar dem Willen des Menschen unter, verliert auch ihre Scheu, doch nicht ihre angeborene Schüchternheit und Furchtsamkeit. Man ernährt sie mit Nüssen, Obstkernen, Obst und Brot, auch wohl Weizenkörnern. Sie frißt sparsam und bescheiden, anfangs bloß des Nachts, und trinkt weder Wasser noch Milch. Ihre überaus große Reinlichkeit und die Liebenswürdigkeit und Verträglichkeit, die sie gegen ihresgleichen zeigt, die hübschen Bewegungen und lustigen Gebärden machen sie zum wahren Liebling des Menschen. In England wird sie als Stubentier in gewöhnlichen Vogelbauern gehalten und ebenso wie Stubenvögel zum Markte gebracht. Man kann sie in dem feinsten Zimmer halten; denn sie verbreitet durchaus keinen Gestank und gibt nur im Sommer einen bisamähnlichen Geruch von sich, der aber so schwach ist, daß er nicht lästig fällt.
*
Obgleich in mehrfacher Hinsicht noch mit den bisher geschilderten Nagern übereinstimmend, unterscheidet sich doch der Biber so wesentlich von ihnen und seinen übrigen Ordnungsverwandten überhaupt, daß er als Vertreter einer besonderen Familie ( Castorina) angesehen werden muß. Dieser Familie kann man höchstens vorweltliche Nagerarten, die ihren jetzt lebenden Verwandten vorausgingen, zuzählen; unter den heutigen Nagern gibt es zwar einzelne, die an die Biber erinnern, nicht aber solche, die ihnen wirklich ähneln.
Der Biber hat schon seit den ältesten Zeiten die Aufmerksamkeit der Beobachter auf sich gezogen und wird von den alten Schriftstellern unter den Namen Castor und Fiber mehrfach erwähnt. Doch erfahren wir von den älteren Naturbeobachtern weder viel noch Genaues über sein Leben. Aristoteles sagt bloß, daß er unter die vierfüßigen Tiere gehöre, die wie der Fischotter an Seen und Flüssen ihre Nahrung suchen. Plinius spricht von den Wirkungen des Bibergeils und berichtet, daß der Biber, stark beiße, einen von ihm gefaßten Menschen nicht loslasse, bis er dessen Knochen zerbrochen habe, daß er Bäume fälle wie mit der Axt und einen Schwanz habe wie die Fische, übrigens aber dem Fischotter gleiche. In der berühmt gewordenen Beschreibung des Olaus Magnus, Bischofs von Upsala, der ungefähr im Jahre 1520 über Norwegen und seine Tiererzeugnisse ein merkwürdiges Werk herausgab, wird uns berichtet, daß der Biber, obgleich Solinis nur die Wasser im Schwarzen Meer für seinen Wohn- und Fortpflanzungsort halte, in Menge am Rhein, an der Donau, in den Sümpfen in Mähren und noch mehr im Norden vorkomme, weil hier an den Flüssen nicht so viel Geräusch wäre wie durch die beständige Schiffahrt am Rhein und an der Donau. Im Norden verfertigte er mit wunderbarer Kunst, bloß von der Natur unterrichtet, auf unzähligen Flüssen aus Bäumen seine Häuser.
Diese alten Schriften haben das Gute, daß sie uns über das frühere Vorkommen der Biber Aufschluß geben. Wir ersehen daraus, daß sich kaum ein anderes Tier so rasch vermindert hat als dieser geschätzte Nager. Noch heutigen Tages reicht der Wohnkreis des Bibers durch drei Erdteile hindurch und erstreckt sich über alle zwischen dem 33. und 68. nördlicher Breite liegenden Grade; in früheren Zeiten aber muß er weit ausgedehnter gewesen sein. Man hat geglaubt, den Biber in der ägyptischen Bilderschrift wiederzufinden, und hieraus würde hervorgehen, daß er in Afrika vorgekommen ist. Die Religion der indischen Magier verbot, ihn zu töten, folglich muß er auch in Indien gewohnt haben. Geßner sagt, nach der Forerschen Übersetzung (1583): »Wiewohl in allen Landen diß ein gemein thier, so sind sy doch zum liebsten, wo große wasserflüsß riinnen; die Ar, Reiiß, Lemmat im Schweyzerland, auch die Byrß umb Basel hat dern vil, Hispanien, vast bey allen waßeren, wie Strabo sagt, in Italien, da der Paw ins meer laufst.« In Frankreich und Deutschland kam er fast überall vor. In England wurde er zuerst ausgerottet. Gegenwärtig findet man ihn in Deutschland nur sehr einzeln, geschützt von strengen Jagdgesetzen, mit Sicherheit bloß noch an der mittleren Elbe, außerdem einzeln und zufällig vielleicht noch in den Auen der Salzach an der österreichischbayerischen Grenze und möglicherweise ebenso an der Möhne in Westfalen. Unter den Ländern Europas beherbergen ihn noch am häufigsten Österreich, Rußland und Skandinavien, namentlich Norwegen. Weit zahlreicher als in Europa lebt er in Asien. Die großen Ströme Mittel- und Nordsibiriens bewohnt er in Menge, und auch in den größeren und kleineren Flüssen, die in das Kaspische Meer sich ergießen, soll er ansässig sein. In Amerika war er gemein, ist aber durch die unablässige Verfolgung schon sehr zusammengeschmolzen. Hontan, der vor etwa zweihundert Jahren Amerika bereiste, erzählt, daß man in den Wäldern von Kanada nicht vier bis fünf Stunden gehen könne, ohne auf einen Biberteich zu stoßen. Am Flusse der Puants, westlich von dem See Illinois, lagen in einer Strecke von zwanzig Stunden mehr als sechzig Biberteiche, an denen die Jäger den ganzen Winter zu tun hatten. Seitdem hat die Anzahl der Tiere, wie leicht erklärlich, ungemein abgenommen. Audubon gibt (1849) bloß noch Labrador, Neufundland, Kanada und einzelne Gegenden der Staaten Maine und Massachussets als Heimatländer des Tieres an, fügt jedoch hinzu, daß er in verschiedenen wenig bebauten Gegenden der Vereinigten Staaten einzeln noch gefunden werde.
Der Biber ( Castor Fiber) ist einer der größten Nager. Bei erwachsenen Männchen beträgt die Leibeslänge 75 bis 95 Zentimeter, die Höhe am Widerrist ebensoviel, das Gewicht 20 bis 30 Kilogramm. Der Leib ist plump und stark, hinten bedeutend dicker als vorn, der Rücken gewölbt, der Bauch hängend, der Hals kurz und dick, der Kopf hinten breit, nach vorn verschmälert, plattscheitelig, kurz- und stumpfschnäuzig; die Beine sind kurz und sehr kräftig, die hinteren etwas länger als die vorderen, die Füße fünfzehig und die hinteren bis an die Krallen durch eine breite Schwimmhaut miteinander verbunden. Der Schwanz, der sich nicht deutlich vom Rumpfe scheidet, ist an der Wurzel rund, in der Milte oben und unten platt gedrückt, bis 20 Zentimeter breit, an der Spitze stumpf abgerundet, an den Rändern fast schneidig, von oben gesehen eirund gestaltet. Die länglich runden, fast unter dem Pelze versteckten Ohren sind klein und kurz, innen und außen behaart und können so an den Kopf angelegt werden, daß sie den Gehörgang beinahe vollständig verschließen. Die kleinen Augen zeichnen sich durch eine Nickhaut aus; ihr Stern ist senkrecht. Die Nasenlöcher sind mit wulstigen Flügeln versehen und können ebenfalls geschlossen werden. Die Mundspalte ist klein, die Oberlippe breit, in der Mitte gefurcht und nach abwärts gespalten. Das Fell besteht aus außerordentlich dichten, flockigen, seidenartigen Wollhaaren und dünnstehenden, langen, starken, steifen und glänzenden Grannen, die am Kopfe und Unterrücken kurz, an dem übrigen Körper über 5 Zentimeter lang sind. Auf den Oberlippen sitzen einige Reihen dicker und steifer, nicht eben langer Borsten. Die Färbung der Oberseite ist ein dunkles Kastanienbraun, das mehr oder weniger ins Grauliche zieht, die der Unterseite heller, das Wollhaar an der Wurzel silbergrau, gegen die Spitze gelblichbraun; die Füße sind dunkler gefärbt als der Körper. Den an der Wurzel im ersten Drittel sehr lang behaarten, im übrigen aber nackten Schwanz bedecken hier kleine, länglichrunde, fast sechseckige, Platte Hautgruben, zwischen denen einzelne, kurze, steife, nach rückwärts gerichtete Haare hervortreten. Die Färbung dieser nackten Tiere ist ein blasses, schwärzliches Grau mit bläulichem Anfluge. Hinsichtlich der allgemeinen Färbung des Felles kommen Abweichungen vor, indem sie bald mehr in das Schwarze, bald mehr in das Graue, zuweilen auch in das Rötlichweiße zieht. Sehr selten findet man auch weiße und gefleckte Biber.

Biber ( Castor fiber)
Die sehr großen und starken, vorn flachen, glatten, im Querschnitt fast dreischneidigen, an der Seite meißelförmigen Nagezähne ragen weit aus dem Kiefer hervor; die ziemlich übereinstimmend gestalteten Backenzähne haben oben außen drei, innen eine, unten umgekehrt außen eine, innen drei querlanfende Schmelzfalten. Der Schädel ist ungewöhnlich kräftig ausgebildet. Alle Knochen sind kräftig und breit und dienen sehr starken Muskeln zum Ansatze. Zehn Wirbel umschließen die Brust, 9 bilden den Lendenteil, 4 das Kreuz und 24 den Schwanz. Die Speicheldrüsen, namentlich die Ohrspeicheldrüse, sind ausfallend entwickelt, und auch der lange, eingeschnürte Magen ist sehr drüsenreich. Harnleiter und Geschlechtswerkzeuge münden in den Mastdarm. Bei Heiden Geschlechtern finden sich im Unterteil der Bauchhöhle, nahe am After und den Geschlechtsteilen, zwei eigentümliche, gewöhnlich voneinander getrennte, in die Geschlechtsteile mündende Absonderungsdrüsen, die Geil- oder Castorsäcke. Die inneren Wandungen dieser Drüsen sind mit einer Schleimhaut überzogen, die in schuppenähnliche Säckchen und Falten geteilt ist, sondern das sogenannte Biebergeil oder Gail (Castoreum) ab, eine dunkle rotbraune, gelbbraune oder schwarzbraune, ziemlich weiche, salbenartige Masse von eigentümlich durchdringendem, starkem, nur wenig Leuten angenehmem Geruch und lange anhaltendem, bitterlichem, balsamischem Geschmacke, der in früheren Zeiten als krampfstillendes und beruhigendes Mittel vielfach angewandt wurde.
Versucht man die Naturgeschichte des Bibers von allen Fabeln und Märchen, die noch bis in die neuere Zeit ihr beigefügt wurden, zu entkleiden, so ergibt sich ungefähr folgendes:
Der Biber lebt gegenwärtig meist paarweise und nur in den stillen Gegenden zu größeren oder kleineren Familien vereinigt. In allen bevölkerten Ländern haust er, wie der Fischotter, meist in einfachen, unterirdischen Röhren, ohne daran zu denken, sich Burgen zu bauen. Solche fand man aber noch in neuester Zeit an der Ruthe, unweit der Stadt Barby, in einer einsamen, mit Weiden bewachsenen Gegend, die von einem nur sechs bis acht Schritte breiten Flüßchen durchströmt wird und schon seit den ältesten Zeiten den Namen Biberlache führt. Oberjägermeister von Meyerinck, der viele Jahre dort die Biberansiedlungen beobachtete, sagt folgendes darüber: »Es wohnen jetzt (im Jahre 1822) noch mehrere Biberpaare in Gruben, die, einem Dachsbau ähnlich, dreißig bis vierzig Schritte lang und mit dem Wasserspiegel gleichhochlaufend sind und auf dem Lande Ausführungsgänge haben. In der Nähe der Gruben errichten die Biber sogenannte Burgen. Sie sind 2,5 bis 3 Meter hohe, von starken Knüppeln kunstlos zusammengetragene Haufen, die sie an den benachbarten Bäumen abbeißen und schälen, weil sie davon sich äsen. Im Herbst befahren die Biber die Haufen mit Schlamm und Erde vom Ufer des Flusses, indem sie diese mit der Brust und den Vorderfüßen nach dem Bau schieben. Die Haufen haben das Ansehen eines Backofens und dienen den Bibern nicht zur Wohnung, sondern nur zum Zufluchtsorte, wenn hoher Wasserstand sie aus den Gruben treibt. Im Sommer des genannten Jahres, als die Ansiedlung aus fünfzehn bis zwanzig Jungen und Alten bestand, bemerkte man, daß sie Dämme warfen. Die Ruthe war zu dieser Zeit so seicht, daß die Ausgänge der Röhren am Ufer überall sichtbar wurden und unterhalb derselben nur noch wenige Zentimeter tief Wasser stand. Die Biber hatten eine Stelle gesucht, wo in der Mitte des Flusses ein kleiner Heger war, von dem sie zu beiden Seiten starke Reiser ins Wasser warfen und die Zwischenräume mit Schlamm und Schilf so ausfüllten, daß dadurch der Wasserspiegel oberhalb des Dammes um 30 Zentimeter höher stand als unterhalb desselben. Der Damm wurde mehreremal weggerissen, in der Regel aber die folgende Nacht wieder hergestellt. Wenn das Hochwasser der Elbe in die Nuthe hinaufdrang und die Wohnungen der Biber überstieg, waren sie auch am Tage zu sehen. Sie lagen alsdann meist auf der Burg oder auf den nahestehenden Kopfweiden.«
Zu diesen wahrheitstreuen Angaben kommen die Beobachtungen des Arztes Sarrazin, der mehr als zwanzig Jahre in Kanada gelebt hat, Hearnes, der drei Jahre an der Hudsonsbai zubrachte, Cartwrights, der zehn bis zwölf Jahre in Labrador sich aufhielt, Andubons, der übrigens nur einem Jäger nacherzählt, des Prinzen von Wied, Morgans, Agassiz und anderer, um uns ein Bild der Biberbaue zu geben.
Die Tiere wählen nach reiflicher Überlegung einen Fluß oder Bach, dessen Ufer ihnen reichliche Weide bieten und zur Anlage ihrer Gefchleife und Kessel oder Dämme und Burgen besonders geeignet scheinen. Einzeln lebende wohnen in einfachen unterirdischen Bauen nach Art des Fischotters, Gesellschaften, die aus Familien zu bestehen pflegen, errichten in der Regel Burgen und nötigenfalls Dämme, um das Wasser aufzustauen und in gleicher Höhe zu erhalten. Die Baue haben eine oder mehrere Zugangsröhren oder Geschleife, von verschiedener, ungefähr zwischen zwei bis sechs Meter schwankender Länge, die ausnahmslos unter Wasser münden und zu dem geräumigen mehr oder minder hoch über dem Wasserspiegel liegenden Kessel führen. Letzterer besteht gewöhnlich nur aus einer Wohnkammer, die sorgfältig und nett mit fein zerschleißten Spänen ausgefüllt ist und als Schlafstätte, ausnahmsweise aber auch als Wochenstube dient. In einsamen und stillen Wäldern werden die unterirdischen Baue wahrscheinlich nur als Notröhren benutzt und regelmäßig sogenannte Burgen errichtet, über dem Boden gelegene Wohnräume der Biber, zu denen im tieferen Wasser mündende und von diesem ausgegrabene Geschleife führen. Die Burgen sind backofenförmige, dickwandige, aus abgeschälten Holzstücken und Ästen, Erde, Lehm und Sand zusammengeschichtete Hügel, die im Innern außer der Wohnkammer noch Nahrungsspeicher enthalten sollen. Wechselt der Wasserstand eines Flusses und Baches im Laufe des Jahres ziemlich erheblich ab, oder hat ein Bach nicht die erwünschte Tiefe, so ziehen die Biber mehr oder minder lange und hohe, je nach der Strömung stärkere oder schwächere Dämme quer durch das Gewässer, stauen dieses und bilden sich so oberhalb des Dammes freies Wasser von sehr verschiedener Ausdehnung. Morgan hat neuerdings in den pfadlosen Wäldern an den Ufern des Oberen Sees in Nordamerika mehr als fünfzig solcher Dämme untersucht, photographiert und in einem besonderen Werke über den Biber und seine Bauten ausführlich beschrieben. Einzelne dieser Dämme sind anderthalb bis zweihundert Meter lang, zwei bis drei Meter hoch und im Grunde vier bis sechs, oben noch ein bis zwei Meter dick. Sie bestehen aus arm- und schenkeldicken ein bis zwei Meter langen Hölzern, die mit dem einen Ende in den Boden gerammt wurden, mit dem andern in das Wasser ragen, mittels dünnerer Zweige verbunden und mit Schilf, Schlamm und Erde gedichtet werden, so daß auf der Stromseite eine fast senkrecht abfallende feste Wand, auf der entgegengesetzten Seite aber eine Böschung entsteht. Nicht immer führen die Biber den Damm in gerader Linie quer durch den Strom, und ebensowenig richten sie ihn regelmäßig so ein, daß er in der Mitte einen Wasserbrecher bildet, ziehen ihn vielmehr oft auch in einem nach unten sich öffnenden Bogen durch das Wasser. Von den oberhalb der Dämme sich bildenden Teichen aus werden schließlich Laufgänge oder Kanäle angelegt, um die notwendigen Bau- und Nährstoffe leichter herbeischleppen und beziehentlich herbeiflößen zu können.
Ohne die höchste Not verlassen die Biber eine von ihnen gegründete Ansiedlung nicht. Man trifft daher in unbewohnten Wäldern auf Biberbauten von sehr hohem Alter. Agassiz untersuchte den Damm eines noch bevölkerten Biberteiches, fand, daß alte von den Tieren benagte Baumstumpfen und Aststücke von einer drei Meter hohen Torfschicht überlagert waren, und zog daraus den Schluß, daß diese Ansiedlung seit mindestens neunhundert Jahren bestanden haben müsse.
Biberbauten üben, wie derselbe Forscher hervorhebt, in Amerika einen merklichen Einfluß auf die landschaftliche Gestaltung einer Gegend aus. Die Dämme verwandeln kleine Bäche, die ursprünglich ruhig im dunklen Waldesschatten dahinflossen, in eine Kette von Teichen, von denen einzelne einen Flächenraum von vierzig Acker bedecken. In ihrer Nähe entstehen infolge des Fällens der Bäume durch die Biber Blößen, sogenannte Biberwiesen, von zwei- bis dreihundert Acker Flächenraum, die oft die einzigen Lichtungen in den noch jungfräulichen Urwaldungen bilden. Am Rande der Teiche siedeln sich rasch Torfpflanzen an, und so entstehen nach und nach an allen geeigneten Stellen Torfmore von mehr oder weniger Ausdehnung.
Alle Arbeiten der Biber hängen mit ihren Gewohnheiten und Bedürfnissen so innig zusammen, daß man die Lebensweise schildert, wenn man diese Arbeiten beschreibt. Wie die meisten Nager während der Nacht tätig, treiben sie sich nur in ganz abgelegenen Gegenden, wo sie lange Zeit keinen Menschen zu sehen bekommen, auch während des Tages umher. »Kurz nach Sonnenuntergang«, sagt Meyerinck, »verlassen sie die Gruben, pfeifen laut und fallen mit Geräusch ins Wasser. Sie schwimmen eine Zeitlang in der Nähe der Burg, gegen den Strom so schnell wie abwärts, und kommen, je nachdem sie sich sicher glauben, entweder mit Nase und Stirn oder mit Kopf und Rücken über das Wasser empor. Haben sie sich gesichert, so steigen sie ans Land und gehen fünfzig Schritte und noch weiter vom Flusse ab, um Bäume zur Äsung oder zu ihren Bauten abzuschneiden. Sie entfernen sich von der Burg schwimmend bis eine halbe Meile, kehren aber immer in derselben Nacht zurück. Auch im Winter gehen sie des Nachts ihrer Nahrung nach, verlassen jedoch zuweilen acht bis vierzehn Tage die Wohnung nicht und äsen sich mit der Rinde der Weidenknüppel, die im Herbste in die Gruben getragen, und mit denen die Ausgänge nach der Landseite zu verstopft werden.« Zweige von der Dicke einiger Zentimeter beißt der Biber ohne weiteres ab, Stämme bringt er zu Falle, indem er den Stamm ringsum und dann besonders auf der einen Seite nach dem Flusse zu benagt, bis er dahin sich neigt und in das Wasser stürzt. Die Spur seiner Arbeiten besteht in unzähligen, schuppenförmigen Einschnitten, die so glatt und scharf ausgemeißelt erscheinen, als ob sie mit einem stählernen Werkzeug gemacht worden wären. Es kommt vor, daß der Biber selbst Stämme von mehr als mannsdickem Durchmesser abhaut und zum Fallen bringt. »Unsere Forstleute«, sagt Prinz Max von Wied, »würden mit den Zerstörungen, die die Biber in den amerikanischen Wäldern anrichten, schwerlich zufrieden sein. Wir haben Pappeln von 70 Zentimeter Durchmesser gesehen, die sie abgenagt hatten. Kreuz und quer lagen die Stämme durcheinander.« Die Bäume werden zuerst ihrer Äste beraubt, dann in beliebig große Stücke zerschnitten und diese als Pfähle verwandt, während die Äste und Zweige mehr zum Bau der Wandungen einer Burg dienen. Am liebsten wählt der Biber Weiden, Pappeln, Eschen und Birken zu seiner Nahrung und bezüglich zum Bauen, seltener vergreift er sich an Erlen, Rüstern und Eichen, obgleich auch diese seinem Zahne verfallen. Nur um Bäume zu fällen oder um zu weiden, betritt er das Land, im Freien stets sehr vorsichtig und auf möglichst kurze Zeit. »In der Dämmerung«, sagt Dietrich aus dem Winckell, der eine Bibermutter mit ihren Jungen beobachtete, »kam die Familie rasch im Wasser herangezogen und schwamm bis zum Anstiege. Hier trat die Mutter zuerst allein an das Land und ging, nachdem sie, den Schwanz noch im Wasser hängend, einen Augenblick gesichert hatte, in das Weidicht. Eilig in ihrer Art folgten ihr die drei Jungen, die ungefähr die Größe einer halbwüchsigen Katze haben mochten. Kaum waren auch sie im Holze, als das durch schnelles Schneiden veranlaßt«, schnarrende Getöse hörbar wurde, und nach Verlauf einiger Minuten fiel die Stange. Noch eiliger und vollständiger wurde nun der erwähnte Laut, weil die ganze Familie in Tätigkeit war, um die Zweige abzusondern, vielleicht auch, um gleich auf der Stelle Schale davon zu äsen. Nach einiger Zeit kam die Alte, das Ende einer Weidenstange mit der Schnauze erfaßt, jedoch auf allen vier Läufen gehend, zum Vorschein. Gleichmäßig waren sämtliche Junge hinter ihr zu beiden Seiten des Stabes verteilt und emsig beschäftigt, ihn an und in das Wasser zu schaffen. Nach einer kurzen Ruhe wurde er dann von der ganzen Gesellschaft wieder mit der Schnauze gefaßt, und höchst eilig und ohne auszuruhen, schwammen sie mit ihrer Beute denselben Weg zurück, aus dem sie gekommen waren.«
Besser als diese und andere Mitteilungen haben mich gefangene Biber, die ich pflegte und durch die Anlage von Geschleifen zum Erbauen von Burgen veranlaßte, über die Art und Weise ihrer Arbeiten belehrt. Einmal mit der Örtlichkeit und dem Getreibe um sie herum vertraut geworden, erschienen die in Rede stehenden Biber bereits in den letzten Nachmittagsstunden außerhalb ihres Baues, um zu arbeiten. Eingepflanzte Stämme wurden lose hingeworfenen Schößlingen vorgezogen und stets gefällt. Zu diesem Ende setzt sich der Biber neben dem betreffenden Bäumchen nieder und nagt ringsum solange an einer bestimmten Stelle, bis der Baum niederstürzt, wozu bei einer acht Zentimeter dicken Weide oder Birke fünf Minuten erforderlich sind. Nunmehr packt der Biber den gefällten Baum an seinem dickeren Ende mit den Zähnen, hebt den Kopf und watschelt vorwärts. Bisweilen sieht es aus, als wolle er die Last über den Rücken werfen; doch geschieht dies niemals. Ist der Schößling leicht, so trägt ihn der Biber ohne Aufenthalt dem Ziele zu; ist die Last schwerer, so bewegt er sie absatzweise, indem er das aufgeladene Holzstück mittels eines kräftigen Ruckes des Kopfes vorwärts zu bringen sucht. Astreiche Schößlinge werden vor dem Wegschleppen genau besichtigt, unter Umständen geteilt, hindernde Aststummel weggeschnitten, alle Holzstücke aber zunächst ins Wasser geschleppt und hier entrindet oder für spätere Zeiten aufgespeichert. Erst nachdem der Knüppel geschält worden ist, verwendet ihn der Biber zum Bauen, holt ihn aus dem Wasser heraus, schleppt ihn nach der nächsten Burg und bringt ihn hier unter. Von einer regelmäßigen Anordnung der Bauhölzer läßt sich nichts wahrnehmen. Den Bedürfnissen wird in überlegter Weise abgeholfen, an eine regelmäßige Schichtung und Ordnung der Baustoffe jedoch nicht gedacht. Einige Knüppel liegen wagerecht, andere schief, andere senkrecht, einzelne ragen mit dem einen Ende weit über die Wandungen der Burg vor, andere sind gänzlich mit Erde überdeckt; es wird auch fortwährend geändert, vergrößert, verbessert. Meine Pfleglinge scharrten sich zunächst ein muldenförmiges Loch vor dem Ende des Geschleifes aus, bildeten aus der losgekratzten Erde ringsum einen festen, hohen und dichten Damm und kleideten den Boden der Mulde mit langen, feinen Spänen aus, die eigens zu diesem Zwecke zerschleißt wurden. Nunmehr erhielt die Mündung des Geschleifes eine Decke aus Astwerk; sodann wurde der Hintere Teil der Wände erhöht und ebenfalls mit einem Kuppeldache überdeckt und, als auch dieses vollendet war, das Ganze mit Erde gedichtet. Alle erforderlichen Dichtungsstoffe, als Erde, Sand, Lehm oder Schlamm, werden in verschiedener Weise, jedoch immer nur mit dem Maule und den Händen bewegt und ausschließlich mit letzteren verarbeitet. Rasenstücke oder fette, lehmige Erde bricht der Biber ballenweise los, indem er Hände und Zähne benutzt, packt den Klumpen mit den Zähnen, drückt von unten die Hände, mit den Handrücken nach oben gekehrt, dagegen und watschelt nun, auf den Hinterfüßen gehend, zeitweilig mit der einen Vorderpfote sich stützend, bedächtig der Baustelle zu; losere Erde oder Sand gräbt er auf, scharrt sie auf ein Häufchen zusammen, setzt beide Handflächen hinten an dasselbe und schiebt es vorwärts, erforderlichenfalls mehrere Meter weit. Der Schwanz wird dabei höchstens zur Erhaltung des Gleichgewichts, niemals aber als Kelle benutzt.
Wie bei den meisten Tieren ist das Weibchen der eigentliche Baumeister, das Männchen mehr Zuträger und Handlanger. Beide arbeiten während des ganzen Jahres, jedoch nicht immer mit gleichem Eifer. Im Sommer und im Anfang des Herbstes spielen sie mehr, als sie den Bau fördern; vor Eintritt strenger Witterung dagegen arbeiten sie ununterbrochen während der ganzen Nacht. Sie besitzen, wie aus den von Fitzinger mitgeteilten Beobachtungen Exingers hervorgeht, ein feines Vorgefühl für kommende Witterung und suchen sich nach Möglichkeit dagegen vorzubereiten.
Die von Exinger gepflegten und in einem ziemlich großen Teiche gehaltenen Biber lebten mehr noch als meine Gefangenen nach Art und Weise ihrer freien Brüder, errichteten sich zwar keine Burgen, gruben sich aber große und ausgedehnte Baue aus und legten sich in mehreren Abteilungen oder Kammern geschiedene Kessel an. In diesen Kammern, deren Boden mit zerschlissenen Holzspänen ausgefüttert wurde, brachten sie den ganzen Tag und bei starkem Winde auch die Nacht zu, holten sich dann aber Weiden und andere Zweige herein. Stieg das Wasser oder drang dasselbe in ihre Wohnungen ein, so gruben sie sich rasch eine neue Höhle oberhalb der früher von ihnen bewohnten; nahm das Wasser ab, so errichteten sie sich unverzüglich einen tieferen Gang-, ereignete es sich, daß die Erdschicht über ihrem Kessel durchbrach, so vereinigten sie sich, um noch in der auf den Unfall folgenden Nacht den Schaden wieder auszubessern. Einige sorgten für die Zerkleinerung des hierzu nötigen Holzes, andere schafften Holz an die beschädigte Stelle und legten es in mannigfacher Kreuzung übereinander, während ein Teil der Familie damit beschäftigt war, Schlamm aus dem Wasser zu holen, ihn mit Rohr und Graswurzeln zu mengen und damit die übereinander aufgeschichteten Holzstücke zu dichten, bis jede Öffnung verschlossen war. Vor Eintritt der Kälte zogen die Biber alle früher angefahrenen Weiden und Pappeln in den Teich, steckten die dickeren und stärkeren Stämme in schräger Richtung und mit der Krone nach oben gekehrt nebeneinander in den Schlamm und verflochten sie mit den Zweigen der Stämme, die sie in verschiedensten Richtungen über dieselben legten, so daß ihr Bau einem verankerten Floße glich und ein selbst den stärksten Stürmen trotzendes Flechtwerk bildete. Eines Abends erschienen sie wie gewöhnlich außerhalb ihres Kessels und machten sich, obgleich die Witterung noch ebenso gut schien, als sie vorher gewesen war, plötzlich mit Hast an die Arbeit, Stämme in ihren Teich zu schleppen. Binnen einer einzigen Nacht hatten sie 186 Stämme von 2 bis 3 Meter Länge und 8 bis 11 Zentimeter Dicke ins Wasser geschafft, und 24 Stunden später war der ganze Teich fest zugefroren und bereits mit einer 7 Zentimeter dicken Eiskruste überdeckt.
Die Hauptnahrung der Biber besteht in Rinden und Blattwerk verschiedener Bäume. Unter allen Zweigen, die ich meinen Gefangenen vorwerfen ließ, wählten sie zuerst stets die Weide, und nur in Ermangelung derselben Pappel, Schwarzpappel, Espe, Esche und Birke, am wenigsten gern Erle und Eiche. Sie fressen nicht bloß Rinde, sondern auch Blätter und die weichen Schößlinge, und zwar mit entschiedenem Behagen. Härtere Zweige entrinden sie äußerst zierlich und geschickt, indem sie dieselben mit den Händen fassen und beständig drehen; sie schälen so sauber, daß man auf dem entrindeten Zweige keine Spur eines Zahneindrucks wahrnimmt. Dann und wann nehmen sie übrigens auch frisches Gras zu sich, indem sie dasselbe in plumper Weise abweiden, nämlich einen Grasbüschel mit den Händen packen und so den Zähnen etwas Körperhaftes zu bieten suchen.
Die Stellung der Biber ist verschieden, im ganzen aber wenig wechselvoll. Im Sitzen sieht das Tier wie eine große, plumpe Maus aus. Der dicke, kurze Leib ruht mit dem Bauche auf dem Boden, der Schwanz leicht auf dem Grunde; von den Füßen bemerkt man kaum etwas. Um sich aufzurichten, drückt der in dieser Stellung sitzende Biber die Schwanzspitze gegen den Boden und erhebt sich nun langsamer oder rascher, wie er will, ohne dabei einen der Füße zu bewegen. Er kann sich beinahe, aber nicht ganz senkrecht stellen und ruht dann auf den Hinterfüßen und auf dem Schwanze so sicher, daß es ihm leicht wird, beliebig lange in dieser Stellung zu verharren. Beim ruhigen Liegen und beim Schlafe wird der Schwanz unter den Leib geklappt und so dem Blick vollständig entzogen. Der Biber kann sich aber auch jetzt ohne Anstrengung oder Gliederbewegung erheben und in den verschiedensten Lagen erhalten, beispielsweise um sich zu kratzen, eine Beschäftigung, die oft und mit sicherer Behaglichkeit, niemals aber hastig ausgeführt wird. Wenn er auf dem Bauche liegt, streckt er sich lang aus, wenn er auf der Seite ruht, rollt er sich. Beim Gehen wird ein Bein um das andere bewegt; denn der fast auf der Erde schleifende Bauch läßt eine rasche, gleichmäßige Bewegung nicht zu. Bei größter Eile führt der Biber Sätze aus, die an Plumpheit und Ungeschicklichkeit die aller übrigen mir bekannten Landsäugetiere übertreffen und ein wechselndes Aufwerfen des Vorder- und Hinterteils hervorbringen, trotz alledem aber fördern. Ins Wasser fällt er bloß dann mit Geräusch, wenn er geängstigt wurde; beim gewöhnlichen Verlauf der Dinge gleitet er lautlos in die Tiefe. Schwimmend taucht er das Hinterteil so tief ein, daß nur Nasenlöcher, Augen, Ohren und Mittelrücken über dem Wasser bleiben, die Schwanzwurzel aber überflutet wird. Er liegt auf den Wellen, ohne ein Glied zu rühren, hebt auch oft noch die Schwanzspitze, die sonst gewöhnlich auf der Oberfläche ruht, in schiefer Richtung empor. Die Fortbewegung geschieht durch gleichzeitige, seltener durch wechselseitige Stöße der Hinterfüße, die Steuerung durch den Schwanz, der jedoch niemals senkrecht gestellt, sondern immer ein wenig schief gedreht, oft auch in entsprechender Richtung kräftig und stoßweise bewegt wird; die Vorderfüße nehmen beim Schwimmen keinen Anteil. Bei raschem Eintauchen stößt der Biber mit seinen breitruderigen Hinterfüßen kräftig nach oben aus und schlägt gleichzeitig den Schwanz auf die Oberfläche des Wassers, hebt und dreht also den Hinterteil seines Leibes, taucht den Kopf ein und versinkt rasch in fast senkrechter Richtung. Er kann fast zwei Minuten im Wasser verweilen, bevor die Atemnot ihn zum Auftauchen zwingt. Die Stimme ist ein schwacher Laut, der am richtigsten ein Gestöhn genannt werden möchte; man vernimmt sie bei jeder Erregung des Tieres und lernt bald die verschiedenen Bedeutungen der ausgestoßenen Laute verstehen, da ihre Stärke und Betonung den genügenden Anhalt hierzu gibt. Unter den Sinnen scheinen Gehör und Geruch obenan zu stehen; die kleinen Augen sehen ziemlich blöde aus, das Gesicht ist jedoch ebensowenig verkümmert wie der Geschmack, und auch das Gefühl kann dem Tiere nicht abgesprochen werden.
Über den Grad des Verstandes des Bibers kann man verschiedener Meinung sein; so viel wird man zugestehen und anerkennen müssen, daß er innerhalb seiner Ordnung die höchste Stelle einnimmt. Eher als jeder andere Nager fügt er sich in veränderte Umstände und lernt aus ihnen bestens Vorteile ziehen, und mehr als irgend einer seiner Ordnungsverwandten überlegt er, bevor er handelt, folgert er und zieht Schlüsse. Seine Bauten sind nicht kunstvoller als die anderer Nager, stets aber mit richtigem Verständnis der Örtlichkeit angelegt; Beschädigungen an ihnen werden immer mit Überlegung beseitigt. »Daß der Biber ein denkendes Tier sein muß und beinahe vernünftig zu Werke geht«, sagt ein Bericht des Wittingauer Forstamtes, »läßt sich durch eine hier beobachtete Tatsache bestätigen. Der Bach, in dem die Biber leben, geht durch einen Teich, der nach Verlauf einiger Jahre zur Abfischung kommt. In dieser Zeit werden sämtliche Wasser abgelassen, und der Bach bleibt für einige Tage trocken. Bei dem letzten Wasserabzuge behufs der Abfischung ist der Fall vorgekommen, daß der Biber bei dem eingetretenen Wasserabfall die Ursache des Abnehmens ergründete und, nachdem er gefunden, daß das Wasser durch das Zapfenhaus abrinne, dieses durch Schilf und Schlamm derartig verbaute, daß kein Tropfen durchkam. Auf diese Weise wollte er sich das Wasser erhalten. Es kostete nicht geringe Mühe, die Verdammung zu beseitigen.« Angesichts dieser Tatsache wird wohl niemand ein Folgern, Überlegen und verständiges Handeln des Bibers in Abrede stellen können. Sein Betragen anderen Tieren gegenüber ist unfreundlich, dem Menschen gegenüber mindestens zurückhaltend; aber er gewöhnt sich bald an eine ihm anfänglich unangenehme Nachbarschaft und fügt sich der Herrschaft seines Pflegers. Jung eingefangene Biber können sehr zahm werden. Die Schriftsteller, die über Amerika berichten, erzählen von solchen, die sie in den Dörfern der Indianer gewissermaßen als Haustiere fanden oder selbst zahm hielten. »Ich sah«, sagt La Hontan, »in diesen Dörfern nichts Merkwürdigeres als Biber so zahm wie Hunde, sowohl im Bache wie in den Hecken, wo sie ungestört hin- und herliefen. Sie gehen bisweilen ein ganzes Jahr lang nicht in das Wasser, obschon sie keine sogenannten Grubentiere sind, die bloß um zu trinken an den Bach kommen und, nach der Meinung der Wilden, ihrer Faulheit halber von den anderen weggejagt wurden.« Hearne hatte mehrere Biber so gezähmt, daß sie auf seinen Ruf kamen, ihm wie ein Hund nachliefen und sich über Liebkosungen freuten. Buffon bekam einen aus Kanada und hielt ihn jahrelang, anfangs ganz im Trocknen. Dieser schloß sich zwar niemand an, war aber sanft und ließ sich aufnehmen und umhertragen. Bei Tische verlangte er mit einem schwachen, kläglichen Ton und mit einem Zeichen seiner Hand auch etwas zu fressen, trug das Empfangene jedoch fort und verzehrte es im Verborgenen. Prinz Max von Wied fand einen zahmen Biber auf Fort Union, »so groß, wie ein zweijähriges Schwein, aber blind. Er ging im ganzen Hause umher und war gegen bekannte Personen sehr zutraulich, versuchte aber, alle ihm unbekannten Leute zu beißen.«
Je nach dem Wohnorte des Bibers fällt die Paarung in verschiedene Monate. Einige setzen sie in den Anfang des Winters, andere in den Februar oder März. Bei dieser Gelegenheit soll das Geil zur Geltung kommen und dazu dienen, andere Biber anzulocken. Audubon erfuhr von einem Jäger, daß ein Biber seine Geilsäcke an einem bestimmten Ort entleere, daß hierdurch ein zweiter herbeigelockt werde, der das abgesetzte Geil mit Erde überdecke und auf diese wieder das seinige ablege und so fort, so daß oft hohe, stark nach Geil riechende Hügel gebildet würden. Männchen und Weibchen benehmen sich, wie man dies an gefangenen wiederholt beobachtete, sehr zärtlich, setzen sich nebeneinander hin, umarmen sich buchstäblich und wiegen sich dann mit dem Oberleibe hin und her. Nach mehrwöchentlicher Tragzeit wirft das Weibchen in seinem trockenen Baue zwei bis drei behaarte, aber noch blinde Junge, nach acht Tagen öffnen diese die Augenlider, und die Mutter führt nunmehr schon, bisweilen aber auch erst am zehnten Tage, ihre Nachkömmlinge mit sich ins Wasser. Eymouth gibt als Setzzeit April und Mai an; der späteste Wurf fand am 10. Juli statt. Schon im September kämpften im Rothenhof gezüchtete Junge nicht selten mit den Alten und mußten paarweise abgesondert werden; nur ausnahmsweise gelang es, die Jungen bis zum zweiten Jahre bei ihren Eltern belassen zu können.
Außer den Menschen hat der frei lebende Biber wenig Feinde. Dank seiner Vorsicht entgeht er auch dem geschickten Jäger oft noch glücklich. Einmal beunruhigt, sucht er bei der geringsten Gefahr das ihn ziemlich sichernde Wasser. Die nordamerikanischen Trapper behaupten, daß er da, wo er in Menge wohnt, Wachen ausstellt, die durch lautes Aufschlagen mit dem Schwänze gegen die Oberfläche des Wassers die übrigen von der herannahenden Gefahr benachrichtigen sollen. Diese Angabe ist so zu verstehen, daß bei einer Gesellschaft von vorsichtigen Tieren mehrere leichter einen Feind sehen als der einzelne, somit also jedes Mitglied der Ansiedelung zum Wächter wird. Da das klatschende Geräusch nur erfolgt, wenn ein Biber jählings in die Tiefe taucht, und dies in der Regel dann geschieht, wenn er eine Gefahr zu bemerken vermeint, achten allerdings alle auf das weit vernehmbare Geräusch und verschwinden, sobald sie es vernehmen, von der Oberfläche des Wassers. In bewohnten Gegenden nutzt dem Biber übrigens, wie die Erfahrung dartut, auch die größte Vorsicht nichts; der beharrliche Jäger weiß ihn doch zu berücken, und bei dem Werte der Beute lohnt die Jagd viel zu sehr, als daß der Biber selbst da, wo er durch strenge Jagdgesetze geschützt wird, nicht ausgerottet werden sollte. Erzbischof Johann Ernst von Salzburg setzte auf die Erlegung eines Bibers Galeerenstrafe, und seine Biber wurden doch weggeschossen. So geht es allerorten. Die wenigen Biber, die Europa noch besitzt, nehmen von Jahr zu Jahr ab und werden sicherlich das Los ihrer Brüder teilen. In Amerika erlegt man den Biber hauptsächlich mit dem Feuergewehr, fängt ihn außerdem aber in Fallen aller Art. Das Schießen ist langweilig und unsicher, Fallen, die man durch frische Zweige ködert oder mit Geil verwittert, versprechen mehr. Im Winter haut man Wuhnen in das Eis und schlägt die Biber tot, wenn sie dahin kommen, um zu atmen. Auch eist man wohl in der Nähe ihrer Hütten ein Stück des Flusses oder Baches auf, spannt ein starkes Netz darüber, bricht dann die Burgen auf und jagt die erschreckten Tiere da hinein. Der Nutzen, den der Biber gewährt, gleicht den Schaden, den er anrichtet, fast aus. Man muß dabei festhalten, daß er vorzugsweise unbevölkerte Gegenden bewohnt und am liebsten nur dünne Schößlinge von Holzarten fällt, die rasch wieder nachwachsen. Dagegen bezahlt er mit Fell und Fleisch und mehr noch mit dem Bibergeil nicht bloß den angerichteten Schaden, sondern auch alle Mühen und Beschwerden der Jagd sehr reichlich.
Die uns hier zunächst beschäftigende Familie der Springmäuse erinnert in ihrem Bau lebhaft an die Känguruhs. Dasselbe Mißverhältnis des Leibes wie bei diesen zeigt sich auch bei ihnen. Der hintere Teil des Körpers ist verstärkt, und die hinteren Beine überragen die vorderen wohl dreimal an Länge; der Schwanz ist verhältnismäßig ebenso lang, aber gewöhnlich am hinteren Ende zweizeilig bequastet. Dagegen unterscheidet sich der Kopf der Springmäuse wesentlich von dem der Springbeuteltiere. Er ist sehr dick und trägt die verhältnismäßig längsten Schnurren aller Säugetiere überhaupt: Schnurren, die oft ebenso lang sind als der Körper selbst. Große Augen deuten auf nächtliches Leben, sind aber lebhaft und anmutig wie bei wenig andern Nachttieren; mittelgroße, aufrechtstehende löffelförmige Ohren von ein Drittel bis zur ganzen Kopflänge bezeichnen das Gehör als nicht minder entwickelten Sinn. Der Hals ist sehr dick und unbeweglich, der Rumpf eigentlich schlank. An den kleinen Vorderpfoten finden sich gewöhnlich fünf Zehen, an den hinteren drei, zuweilen mit einer oder zwei Afterzehen. Der Pelz ist dicht und weich, bei den verschiedenen Arten und Sippen sehr übereinstimmend, nämlich dem Sande ähnlich gefärbt. Auch der innere Leibesbau hat manches ganz Eigentümliche. Das Gebiß ist nicht besonders auffällig gebildet. Den Schädel kennzeichnen der breite Hirnkasten und die ungeheuren Gehörblasen. Die Halswirbel, mit Ausnahme des Atlas, verwachsen oft in ein einziges Knochenstück. Die Wirbelsäule besteht aus elf bis zwölf Rückenwirbeln, sieben bis acht Lendenwirbeln und drei bis vier Kreuzwirbeln; die Anzahl der Schwanzwirbel steigt bis auf dreißig.
Die Springmäuse bewohnen vorzugsweise Afrika und Asien; einige Arten reichen aber auch nach Südeuropa herüber, und eine Sippe oder Unterfamilie ist Nordamerika eigen. Sie sind Bewohner des trockenen, freien Feldes, der grasreichen Steppe und der dürren Sandwüsten, also eigentliche Wüstentiere, wie auch die Färbung augenblicklich erkennen läßt. Aus lehmigem oder sandigem Boden, in den Niederungen, seltener auf Anhöhen oder an dichten, buschigen Wiesensäumen und in der Nähe von Feldern, schlagen sie ihre Wohnsitze aus, selbstgegrabene, unterirdische Höhlen, mit vielen verzweigten, aber meist sehr seichten Gängen, die immer mit zahlreichen Ausgängen münden. Bei Tage in ihren Bauen verborgen, erscheinen sie nach Sonnenuntergang und führen dann ein heiteres Leben. Ihre Nahrung besteht in Wurzeln, Zwiebeln, mancherlei Körnern und Samen, Früchten, Blättern, Gras und Kräutern. Einige verzehren auch Kerbtiere, ja selbst kleine Vögel, gehen sogar das Aas an und fressen unter Umständen einander auf. Die Nahrung nehmen sie zu sich, in halb aufrechter Stellung auf das Hinterteil und den Schwanz gestützt, das Futter mit den Vorderpfoten zum Munde führend.
Ihre Bewegungen sind eigentümlicher Art. Der ruhige Gang unterscheidet sich von dem des Känguruh insofern, als sie in rascher Folge ein Bein vor das andere setzen; bei eiligem Laufe aber fördern sie sich sprungweise, indem sie sich mit den kräftigen Hinterfüßen hoch emporschnellen, mit dem zweizeiligen Schwanze die Richtung regeln und so das Gleichgewicht des Körpers erhalten. Dabei legen sie die Vorderbeine entweder an das Kinn oder, wie ein schnellaufender Mensch, gekreuzt an die Brust, scheinen dann auch wirklich nur zwei Beine zu besitzen. Die größeren Arten vermögen gewaltige Sätze auszuführen; denn man kann von allen sagen, daß diese das Zwanzigfache ihrer Leibeslänge betragen. Ein Sprung folgt unmittelbar auf den andern, und wenn sie in voller Flucht sind, sieht man eigentlich bloß einen gelben Gegenstand, der in seichtem Bogen wie ein Pfeil die Luft durchschießt. Mit ebenso großer Behendigkeit graben sie im Boden, trotz der schwachen Vorderfüße, die diese Arbeit hauptsächlich verrichten müssen. Während sie weiden, gehen sie, ebenfalls wieder wie Känguruhs, auf vier Beinen, jedoch sehr langsam und immer nur auf kurze Zeit. Im Sitzen ruhen sie auf den Sohlen der Hinterfüße.
Alle Arten sind scharfsinnig, namentlich feinhörig und fernsichtig, wissen daher drohenden Gefahren leicht zu entgehen. Äußerst furchtsam, scheu und flüchtig, suchen sie sich bei jeder Störung so eilig als möglich nach ihrem Bau zu retten oder ergreifen, wenn ihnen dies nicht möglich wird, mit rasender Schnelligkeit die Flucht. Gefangene Springmäuse sind überaus angenehme und anmutige Gesellschafter des Menschen; ihre Gutmütigkeit, Sanftmut und Harmlosigkeit erwirbt ihnen jedermann zum Freunde.
Fast alle Arten sind durchaus unschädlich.
Die Sippe der Wüstenspringmäuse ( Dipus) kennzeichnet sich dadurch, daß die oberen Schneidezähne eine mittlere Längsfurche zeigen, daß vor die drei regelmäßig vorhandenen Backenzähne des Oberkiefers zuweilen noch ein kleiner einwurzeliger tritt, und daß die Hinterfüße drei Zehen haben.
Als Vertreter der Gruppe erwähle ich die Wüstenspringmaus, Djerboa der Araber ( Dipus aegyptius), ein allerliebstes Tierchen von 17 Zentimeter Leibes- und (ohne die Quaste) 21 Zentimeter Schwanzlänge, oberseits graulich sandfarben mit schwarzer Sprenkelung, unterseits weiß gefärbt, mit einem breiten weißen Schenkelstreifen, der sich von rückwärts über die Schenkel zieht, und oben blaßgelbem, unten weißlichem Schwanze, dessen Quaste weiß und pfeilartig schwarz gezeichnet ist.
Die Wüstenspringmaus verbreitet sich über den größten Teil Nordostafrikas sowie das angrenzende westliche Asien und kommt nach Süden hin bis Mittelnubien vor, woselbst der Verbreitungskreis einer andern ähnlichen Art beginnt. Offene, trockene Ebenen, Steppen und Sandwüsten sind ihre Wohnplätze: sie bevölkert die dürrsten und ödesten Landschaften und bewohnt Orte, die kaum die Möglichkeit zum Leben zu bieten scheinen. Auf jenen traurigen Flächen, die mit dem scharfschneidigen Riedgrase, der Halsa, bedeckt sind, findet man sie zuweilen in größeren Gesellschaften. Sie teilt diese Orte mit dem Wüstenhuhne, der kleinen Wüstenlerche und dem isabellfarbenen Läufer, und man begreift kaum, daß auch sie dort Nahrung findet, wo jene, die neben dem Gesäme doch auch viele Kerbtiere fressen, sich nur dürftig ernähren. In dem harten Kiesboden gräbt sie sich vielverzweigte, aber ziemlich seichte Gänge, in die sie sich bei der geringsten Gefahr zurückzieht. Nach den Versicherungen der Araber arbeitet der ganze Trupp an diesen unterirdischen Wohnungen. Die Tiere graben mit den scharfen Nägeln ihrer Vorderfüße und benutzen wohl auch die Nagezähne, wenn es gilt, den harten Kiesboden zu durchbrechen.
Trotz ihrer Häufigkeit gewahrt man die schmucken Geschöpfe ziemlich selten. Man kann nicht gerade sagen, daß sie sehr scheu wären; aber sie sind unruhig und furchtsam und eilen bei dem geringsten Geräusche und beim Sichtbarwerden eines fremden Gegenstandes schleunigst nach ihren Löchern. Auch fallen sie nur in geringer Entfernung ins Auge, weil ihre Färbung der des Sandes vollständig gleicht und man ziemlich nahe herankommen muß, ehe man sie bemerkt, während ihre scharfen Sinne sie die Ankunft des Menschen schon auf große Entfernungen hin wahrnehmen lassen. Wohl darf man sagen, daß es schwerlich ein anmutigeres Geschöpf geben kann als diese Springmäuse. So sonderbar und scheinbar mißgestaltet sie aussehen, wenn man sie tot in der Hand hat oder regungslos sitzen sieht, so zierlich nehmen sie sich aus, wenn sie in Bewegung kommen. Erst dann zeigen sie sich als echte Kinder der Wüste, lassen sie ihre herrlichen Fähigkeiten erkennen. Ihre Bewegungen erfolgen mit einer Schnelligkeit, die geradezu ans Unglaubliche grenzt; sie scheinen zu Vögeln zu werden. Bei ruhigem Gange setzen sie ein Bein vor das andere und laufen sehr rasch dahin, bei großer Eile jagen sie in Sprungschritten davon, die sie so schnell fördern, daß ihre Bewegung dann dem Fluge eines Vogels gleicht; denn ein Sprung folgt so rasch auf den andern, daß man kaum den neuen Ansatz wahrnimmt. Dabei tragen die Springmäuse ihren Leib weniger nach vorn übergebeugt als sonst, die Hände mit den Krallen gegeneinander gelegt und nach vorn gestreckt, den Schwanz aber zur Erhaltung des Gleichgewichts gerade nach hinten gerichtet. Wenn man das Tier aus einiger Entfernung laufen sieht, glaubt man einen pfeilartig durch die Luft schießenden Gegenstand zu gewahren. Kein Mensch ist imstande, einer im vollen Laufe begriffenen Springmaus nachzukommen, und der sicherste Schütze muß sich zusammennehmen, will er sie im Laufe erlegen. Sogar in einem eingeschlossenen Raume bewegt sich das zierliche Tierchen noch so schnell, daß ein Jagdhund es kaum einholen kann. Bruce erzählt, daß sein Windhund sich eine Viertelstunde abhetzen mußte, ehe er Herr über sein gewandtes und schnelles Opfer wurde.
Fühlt sich die Springmaus ungestört und sicher, so sitzt sie aufrecht auf dem Hinterteile wie ein Känguruh, oft auf den Schwanz gestützt, die Vorderpfoten an die Brust gelegt, ganz wie Springbeuteltiere es auch zu tun pflegen. Sie weidet in ähnlicher Weise wie Känguruhs; doch gräbt sie mehr als diese nach Knollen und Wurzeln, die wohl ihre Hauptnahrung zu bilden scheinen. Außerdem verzehrt sie mancherlei Blätter, Früchte und Samen, ja sie soll selbst Aas angehen oder wenigstens den Kerbtieren gierig nachstellen.
Obgleich die Wüstenmaus ein echtes Nachttier ist und ihre Wanderungen erst nach Sonnenuntergang beginnt, sieht man sie doch auch zuweilen im hellsten Sonnenschein, selbst während der größten Hitze vor ihrem Bau sitzen und spielen. Sie zeigt dann eine Gleichgültigkeit gegen die Mittagsglut der afrikanischen Sonne, die wahrhaft bewunderungswürdig ist; denn man muß wissen, daß sich kaum ein einziges anderes Tier um diese Zeit in der Wüste bewegt, weil die brennende Hitze selbst den eingeborenen Kindern jener erhabenen Landschaft geradezu unerträglich wird. Gegen Kälte und Nässe dagegen ist sie im höchsten Grade empfindlich, bleibt daher bei schlechtem Wetter stets in ihrem Bau verborgen und verfällt wohl auch zeitweilig in eine Erstarrung, die an den Winterschlaf der nördlichen Tiere erinnert.
Über die Fortpflanzung der Wüstenspringmaus ist nichts Sicheres bekannt. Die Araber erzählten mir, sie baue sich in einem tieferen Kessel ihrer Höhle ein Nest, kleide dasselbe wie Kaninchen mit Haaren ihres Unterleibes aus, und darin finde man zwei bis vier Junge: – ob dies richtig ist, wage ich nicht zu behaupten, obwohl ich anerkennen muß, daß jedenfalls die Araber diejenigen Leute sind, die das Tier am besten kennen. Sie stellen ihm, weil sie das Fleisch genießen und ziemlich hochschätzen, eifrig nach und fangen es ohne sonderliche Mühe lebendig oder erschlagen es beim Herauskommen aus den Bauen. Ihre Jagdweise ist sehr einfach. Sie begeben sich mit einem langen und starken Stocke nach der Ansiedlung der Springmäuse, verstopfen den größten Teil der Röhren und graben nun einen Gang nach dem andern auf, indem sie ihren starken Stock in den Gang stecken und dessen Decke durchbrechen. Die geängstigten Wüstenmäuse drängen sich nach dem innersten Kessel zurück oder fahren durch eine Fluchtröhre nach außen und dann in ein vorgestelltes Netz oder selbst einfach in den Ärmel des Obergewandes, das der Araber vorgelegt hat. So können zuweilen zehn bis zwanzig Stück auf einmal gefangen werden; wenigstens macht es gar keine Mühe, eine solche Anzahl lebend zu erhalten: jagdkundige Araber bringen auf Verlangen so viele Springmäuse, als man haben will.
Außer dem Menschen haben diese Tiere wenig andere Feinde. Fenek und Karakal, vielleicht auch eine oder die andere Eule sind die schlimmsten Räuber, die ihnen auflauern; gefährlicher dürfte ihnen die ägyptische Brillenschlange werden, jene bekannte Giftschlange Afrikas, die die ägyptischen Gaukler zu allerlei Kunststückchen benutzen. Sie lebt an ähnlichen Orten wie die Springmäuse, dringt mit Leichtigkeit in die Gänge ein, die letztere sich graben, und tötet viele von ihnen.
Die naturkundigen Europäer, die in Ägypten und Algerien wohnen, halten die Springmaus oft in der Gefangenschaft. Ich kann aus eigener Erfahrung versichern, daß das Tier im Käfige oder im Zimmer viele Freude macht. Während meines Aufenthalts in Afrika brachte man mir oft zehn bis zwölf Springmäuse zugleich. Ich räumte solchen Gesellschaften dann eine große Kammer ein, um ihre Bewegungen beobachten zu können. Vom ersten Augenblicke an zeigten sich die Gefangenen harmlos und zutraulich. Ohne Umstände ließen sie sich berühren, machten auch nicht Miene, dem Menschen auszuweichen. Beim Umhergehen in ihrem Zimmer mußte man sich in acht nehmen, sie nicht zu treten, so ruhig blieben sie sitzen, wenn man auf sie zukam.
Unter sich sind die Springmäuse auch in der Gefangenschaft bewunderungswürdig friedlich und gesellig. Sie schmiegen sich dicht aneinander und verschlingen sich zuweilen förmlich ineinander, namentlich, wenn es am Morgen kühl ist; denn schon die geringste Abnahme der Wärme wird ihnen auffallend und lästig. Trockene Körner, Reis, Möhren, Rüben, andere Wurzeln und manche Früchte scheinen ihnen besonders zu behagen; auch Kohl und Kraut, selbst Blumen-, z. B. Rosenblätter, fressen sie gern; allein man kann sie mit ausschließlich saftigen Pflanzen nicht erhalten. Sie sind an dürftige und dürre Kost gewöhnt. Wenn ihnen trockene Nahrung gänzlich fehlt, werden sie traurig, verkümmern sichtlich und sterben endlich dahin. Gibt man ihnen Weizen, Reis, etwas Milch und dann und wann eine Weinbeere, ein Stückchen Apfel, eine Möhre oder sonst eine andere Frucht, so befinden sie sich wohl und halten sich sehr lange. Nach Europa kommen sie neuerdings nicht allzuselten. Ich habe auch in Deutschland viele erhalten und will versuchen, das Betragen dieser höchst liebenswürdigen und anmutigen Geschöpfe so genau als möglich zu schildern, weil in den meisten Werken Bewegungen und Wesen der Springmäuse falsch beschrieben sind.
Die Springmäuse, die ich zahm hielt, waren zuweilen auch bei Tage in Bewegung, bewiesen aber schlagend genug, daß die Nacht die wahre Zeit ihres munteren Treibens ist. Jede Springmaus schläft den ganzen Tag, vom frühen Morgen an bis zum späten Abend, kommt, wenn man sie nicht stört, auch nicht einen Augenblick aus ihrem Neste hervor, sondern schläft gute zwölf Stunden in einem Zuge fort. Bewegungslos liegt das Tier in dem warmen Nestchen, bis der Abend ordentlich hereingebrochen. Nunmehr macht sich ein leises Rascheln und Rühren im Neste bemerklich. Die Langschläferin putzt sich, glättet die Ohren, läßt einen leisen, wie schwacher Husten klingenden Ton vernehmen, springt plötzlich mit einem einzigen Satze durch die Nestöffnung hervor und beginnt nun ihr eigentümliches Nachtleben. Das erste Geschäft, das sie jetzt besorgt, ist das Putzen. In der Reinlichkeit übertrifft die Springmaus kein anderer Nager. Fast alle ihre freie Zeit wird verwandt, um das seidenweiche Fell in Ordnung zu halten. Härchen für Härchen wird durchgekämmt und durchgeleckt, jeder Teil des Körpers, selbst der Schwanz, gehörig besorgt. Einen wesentlichen Dienst leistet dabei feiner Sand. Dieser ist ihr überhaupt ganz unentbehrlich; sie wälzt sich mit förmlicher Wollust in ihm herum, kratzt und wühlt in ihm und kann sich gar nicht von ihm trennen. Beim Putzen nimmt sie die verschiedensten Stellungen an. Viel Mühe, Arbeit und Zeit kostet ihr das Reinigen des Mundes und der Wangen, namentlich des Teiles, wo die langen Schnurrenhaare sitzen, und erst nachdem sie hiermit zustande gekommen, setzt sie sich vollends aus und nimmt nun auch das übrige Fell ihres Leibes vor. Sie packt ein Stückchen Fell mit beiden Händen, kämmt es mit den Zähnen des Unterkiefers durch und leckt es dann mit der Zunge gehörig glatt. Recht nett sieht es aus, wenn sie den Unterleib putzt; denn sie muß dann die Fußwurzeln sehr breit voneinander biegen und den Leib kugelrund zusammenrollen.
Der ruhige Gang des Tieres ist ein schneller Schritt. Die Beine werden beim Gehen am Fersengelenk gerade ausgestreckt und so gestellt, daß sie unter das dritte Fünftel oder unter die Hälfte des vorn etwas erhobenen Leibes, der durch den Schwanz im Gleichgewicht gehalten wird, zu stehen kommen. Nun setzt die Springmaus in rascher Folge ein Bein um das andere vor. Die Vorderhände werden, in der gewöhnlichen Weise zusammengelegt, unter dem Kinn getragen. Da sich die gefangene Springmaus an den Menschen gewöhnt, macht sie nur höchst selten einen größeren Sprung, hauptsächlich dann, wenn es gilt, ein Hindernis zu überwinden, z. B. über ein großes ihr vorgehaltenes Buch zu springen. Dabei schwingt sie sich ohne den geringsten Ansatz durch bloßes Aufschnellen ihrer Hinterbeine fußhoch und noch mehr empor. Als ich eine bei ihren Nachtwandlungen durch eine plötzliche Bewegung erschreckte, sprang sie senkrecht über einen Meter in die Höhe. Wenn man sie auf den Tisch setzt, läuft sie rastlos umher und sieht sorgsam prüfend in die Tiefe hinab, um sich die beste Stelle zum Herunterspringen auszuwählen. Kommt sie an die Kante, so stemmt sie sich mit ihren beiden Vorderarmen auf, sonst aber nie. Sie kommt, selbst wenn sie aus Höhen von einem Meter und mehr zu Boden springt, immer auf die Hinterfüße zu stehen und läuft dann, ohne sich nur nach vorne zu bücken, so ruhig weiter, als habe sie bloß einen gewöhnlichen Schritt gemacht. Stehend kann sie, dank der starken Hinterläufe und des stützenden Schwanzes, ihren Leib ebensowohl wagerecht wie senkrecht halten, vermag sich auch vorn bis auf die Erde niederzubeugen. Wie wichtig ihr der Schwanz zur Erhaltung des Gleichgewichts ist, sieht man deutlich, wenn man sie in der Hand hält und rasch herumdreht, so daß sie mit dem Rücken nach unten zu liegen kommt. Dann beschreibt sie sofort Kreise mit dem Schwanze, sicher in der Absicht, ihren Leib wieder herumzuwerfen.
Beim Fressen setzt sie sich auf die ganzen Fußsohlen nieder, biegt aber den Leib vorn weit herab und nimmt nun die Nahrung mit einem raschen Griffe vom Boden auf. Aus einem Näpfchen mit Weizenkörnern holt sie sich in jeder Minute mehrere Körner. Sie verzehrt die erhobenen aber nicht ganz, sondern beißt bloß ein Stückchen von ihnen ab und läßt sie dann wieder fallen. In einer Nacht nagt sie manchmal fünfzig bis hundert Körner an. Allerliebst sieht es aus, wenn man ihr eine Weinbeere oder ein Stückchen fein geschnittene Möhre, Apfel und dergleichen Früchte hingibt. Sie packt solche Nahrung sehr zierlich mit den Händen, dreht sie beständig hin und her und frißt sie auf, ohne sie fallen zu lassen. Bei weichen, saftigen Früchten, wie z. B. bei Weinbeeren, braucht sie sehr lange Zeit, ehe sie mit ihrer Mahlzeit zu Ende kommt. An einer Weinbeere fraß eine Gefangene von mir sieben Minuten lang. Sie öffnet die Beere bloß mit einem einzigen Bisse und taucht in dieser Öffnung fort und fort ihre unteren Nagezähne ein, um sie sodann wieder abzulecken. So fährt sie fort, bis der größte Teil des Inhalts entleert ist. Ein Kohlblatt nimmt sie mit beiden Händen, dreht es hin und her und schneidet dann am Rande in zierlicher Weise Stückchen nach Stückchen ab. Besonders hübsch ist auch ihre Weise, Milch zu trinken. Sie bedarf nur höchst wenig Getränk und kann solches, falls man ihr nebenbei saftige Wurzeln reicht, monatelang entbehren; täglich ein halber Teelöffel voll Milch genügt ihr. Auch Flüssigkeiten muß sie mit den Händen zu sich nehmen, taucht daher in rascher Folge ihre Hände ein und leckt die Milch dann ab.
Sie ist mäßig, braucht aber viele Nahrung, weil sie von jedem Nährstoffe nur wenig frißt. Ihre Losung ähnelt der mancher Mäuse. Ihr Harn hinterläßt keinen üblen Geruch; seine Menge ist dazu auch viel zu gering. Im Sande bemerkt man überhaupt nichts von den natürlichen Ausleerungen des Tieres.
Es scheint, daß alle Sinne des Tieres hoch entwickelt sind. Welchen unter den drei edleren ich als den höchsten ansehen soll, weiß ich nicht. Die Springmaus sieht und hört, wie die großen Augen und Ohren bekunden, sehr gut, riecht und fühlt aber auch fein. Denn wenn sie ein Korn oder ein Stückchen Möhre oder andere Nahrung zu Boden fallen läßt, sucht sie es immer vermittels des Geruchs, vielleicht auch der tastenden Schnurrhaare, und nimmt es dann mit größter Sicherheit wieder auf. Süße Früchte verzehrt sie mit so viel Vergnügen, daß man gar nicht in Zweifel bleiben kann, wie angenehm ihr Geschmacksinn gekitzelt wird. Das Gefühl offenbart sich als Empfindung und Tastsinn in jeder Weise. Die Springmaus tastet sehr fein mit den Schnurren auf den Lippen und dann noch mit ihren Vorderhänden, hauptsächlich wohl mit Hilfe der Fingerkrallen. Ihre geistigen Fähigkeiten will ich nicht eben hochstellen; so viel aber ist zweifellos, daß sie sehr bald sich an einem bestimmten Orte eingewöhnt, Leute, die sich mit ihr abgeben, gut kennenlernt und eine gewisse berechnende Kunstfertigkeit an den Tag legt. Der Bau ihres Nestes beschäftigt sie an jedem Morgen längere Zeit. Wenn man ihr Heu, Baumwolle und Haare gibt und den Grundbau des Nestes vorzeichnet, arbeitet sie verständig weiter, holt sich die Baumwollklumpen herbei, zieht sie mit den Vorderhänden auseinander und legt sie sich zurecht, schiebt die Haare an den betreffenden Stellen ein und putzt und glättet die runde Nesthöhle, bis sie den erforderlichen Grad von Ordnung und Sauberkeit zu haben scheint. Hervorspringende Halme werden dann auch wohl noch ausgezogen oder abgebissen, bis das Ganze in einen möglichst behaglichen Zustand versetzt worden ist.
Unter allen Nagern, die ich bis jetzt in der Gefangenschaft hielt, hat mir die Springmaus das meiste Vergnügen gewährt. Ihrer Eigenschaften wegen muß sich jedermann mit ihr befreunden. Sie ist so außerordentlich harmlos, so freundlich, zahm, reinlich und, wenn einmal vom Schlafe erweckt, so munter und so lustig, jede ihrer Stellungen so eigentümlich, und sie weiß so viel Abwechselung in dieselben zu bringen, daß man sich stundenlang mit ihr beschäftigen kann. Gegen ihren Pfleger benimmt sich die Springmaus sehr liebenswürdig. Niemals fällt es ihr ein, den zu beißen, der sie aufhebt. Man darf sie berühren, streicheln, umhertragen: sie läßt sich alles gefallen. Man könnte, glaube ich, die Springmaus in jedem Putzzimmer halten, so groß ist ihre Gutmütigkeit, Harmlosigkeit und Reinlichkeit. Gegen Liebkosungen zeigt sie sich sehr empfänglich. Setzt man sie auf eine Hand und streichelt sie sanft mit dem Finger, so schießt sie wie verzückt die Augen zur Hälfte, rührt minutenlang kein Glied und vergißt Freiheit und alles andere.
Der Nutzen, den die Wüstenspringmäuse bringen, ist nicht unbedeutend. Die Araber essen ihr ziemlich schmackloses Fleisch sehr gern und bereiten sich wohl auch aus den glänzenden Fellen kleine Pelze für Kinder und Frauen oder verwenden sie sonst zur Verzierung von Sätteln, zum Besatz von Decken usw.
*
Keine andere Abteilung der Ordnung versteht es, so gründlich uns zu belehren, was Nager sind, als die, die die Mäuse ( Murina) umfaßt. Die Familie ist nicht bloß die an Sippen und Arten reichste, sondern auch bei weitem die verbreitetste. Ihre Mitglieder sind durchgängig kleine Gesellen; aber sie ersetzen durch ihre Anzahl, was den einzelnen an Größe abgeht, mehr als vollständig.
Die Ur- und Vorbilder der Familie, die Mäuse im engeren Sinne ( Murina), sind infolge ihrer Zudringlichkeit als Gäste des Menschen in ihrem Treiben und Wesen nur zu bekannt. Unter ihnen finden sich jene Arten, die sich mit den Menschen über die ganze Erde verbreitet und gegenwärtig auch auf den ödesten Inseln angesiedelt haben. Es ist noch nicht so lange her, daß diese Weltwanderung der Tiere stattfand; ja man kennt an vielen Orten noch genau die Jahreszahl, in der sie zuerst auftraten: gegenwärtig aber haben sie ihre Rundreise um den Erdball vollendet. Nirgends dankt ihnen der Mensch die unverwüstliche Anhänglichkeit, die sie an seine Person, an sein Haus und seinen Hof an den Tag legen, überall verfolgt und haßt er sie auf das schonungsloseste, alle Mittel setzt er in Bewegung, um sich von ihnen zu befreien: und dennoch bleiben sie ihm zugetan, treuer noch als der Hund, treuer als irgendein anderes Tier. Leider sind diese anhänglichen Hausfreunde abscheuliche Hausdiebe, wissen sich mit ihren spitzbübischen Werkzeugen überall einzunisten und bereiten ihrem Gastfreunde nur Schaden und Verlust. Hieraus erklärt sich, daß alle wahren Mäuse schlechtweg häßliche, garstige Tiere genannt werden, obgleich sie dies in Wahrheit durchaus nicht sind, im Gegenteil vielmehr als schmucke, anmutige, nette Gesellen bezeichnet werden müssen.
Im allgemeinen kennzeichnen die Mäuse, die man in einer zweiten Unterfamilie vereinigt, die spitze, behaarte Schnauze, die breite, gespaltene Oberlippe, die in fünf Reihen geordneten, langen und starken Schnurren, die großen, runden, tiefschwarzen Augen, die frei aus dem Pelze hervorragenden Ohren und vor allem der lange, nackte, bloß spärlich mit steifen Härchen bekleidete, anstatt der Behaarung mit viereckigen und verschoben viereckigen Schuppen bedeckte Schwanz. Die Vorderfüße haben vier Zehen und eine Daumenwarze, die Hinterfüße sind fünfzehig. Im Gebisse finden sich drei Backenzähne in jedem Kiefer, die von vorn nach hinten zu an Größe abnehmen. Der Pelz besteht aus kurzem, wolligen Grundhaar und längeren, steifen Grannen, die abgeplattet erscheinen. In der Pelzfärbung sind Schwarzbraun und Weißgelb vorwiegend.
Schon im gewöhnlichen Leben unterscheidet man zwei Hauptgruppen, die Ratten und Mäuse, und diese Unterscheidung nimmt auch die Wissenschaft an. Die Ratten sind die plumperen und häßlicheren, die Mäuse die leichteren und zierlicheren Gestalten. Bei jenen hat der Schwanz zwischen 200 und 260 Schuppenringe, bei diesen nur zwischen 120 und 180; dort sind die Füße dick und kräftig, hier schlank und fein; die Ratten werden im ausgewachsenen Zustande über 30 Zentimeter, die Mäuse nur gegen 24 Zentimeter lang; jene haben geteilte Querfalten im Gaumen, bei diesen sind die Querfalten erst von der zweiten an in der Mitte geteilt. Man ersieht hieraus, daß diese Unterscheidungsmerkmale immerhin einer ziemlich sorgfältigen Prüfung bedürfen und eigentlich nur für den Forscher von Fach besonderen Wert haben. In ihrem Leben dagegen unterscheiden sich die eigentlichen Ratten von den wahren Mäusen auffallend genug.
Mit ziemlicher Sicherheit dürfen wir annehmen, daß die Ratten, die gegenwärtig in Europa hausen, ursprünglich hier nicht heimisch waren, vielmehr einwanderten. Nachweislich fand sich die Hausratte zuerst in Europa und Deutschland ein oder vor; ihr folgte die Wanderratte und dieser endlich in der neuesten Zeit die aus Ägypten stammende Dachratte. Zurzeit wohnen die erstgenannten beiden, hier und da auch wohl alle drei Arten noch nebeneinander; die Wanderratte, als die stärkste von allen, vertreibt und vernichtet jedoch die beiden Verwandten und bemächtigt sich mehr und mehr der Alleinherrschaft.
Die Hausratte ( Mus Rattus) erreicht 16 Zentimeter Leibes-, 19 Zentimeter Schwanz-, also 35 Zentimeter Gesamtlänge und ist oberseits dunkel braunschwarz, unterseits ein wenig heller grauschwarz gefärbt. Das an der Wurzel schwarzgraue Haar zeigt grünlichen Metallschimmer. Die Füße haben graubraune, seitlich etwas lichtere Färbung. An dem verhältnismäßig schlanken Schwanze zählt man 260 bis 270 Schuppenringe. Weißlinge sind nicht selten.
Wann diese Art zuerst in Europa erschienen ist, läßt sich mit Gewißheit nicht bestimmen. Albertus Magnus ist der erste Tierkundige, der sie als deutsches Tier aufführt; demnach war sie also im zwölften Jahrhundert bereits bei uns heimisch. Geßner behandelt sie als ein Tier, das »manchem mer bekannt dann jm lieb«; der Bischof von Autun verhängt, anfangs des fünfzehnten Jahrhunderts, den Kirchenbann über sie; in Sondershausen setzt man ihretwegen einen Buß- und Bettag an. Möglicherweise stammt sie aus Persien, wo sie noch gegenwärtig in unglaublicher Anzahl vorkommt. Bis in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts genoß sie in Europa die Alleinherrschaft; von dieser Zeit an hat ihr die Wanderratte das Gebiet streitig gemacht. Anfangs haben beide eine Zeitlang nebeneinander gewohnt; bald aber ist jene überwiegend geworden und sie in demselben Maße verschwunden, wie die Wanderratte vordrang. Doch ist sie zurzeit noch so ziemlich über alle Teile der Erde verbreitet, kommt aber nur selten in geschlossenen Massen, sondern fast überall einzeln vor. Auch sie folgte dem Menschen in alle Klimate der Erde, wanderte mit ihm zu Lande und Meere durch die Welt. Unzweifelhaft war sie früher in Amerika, Australien und Afrika nicht heimisch; aber die Schiffe brachten sie an alle Küsten, und von den Küsten aus wanderten sie weiter und weiter ins Innere. Gegenwärtig findet man sie auch in den südlichen Teilen von Asien, zumal in Persien und Indien, in Afrika, vorzüglich in Ägypten und der Berberei, sowie am Kap der guten Hoffnung, in Amerika aller Orten und in Australien nicht nur in jeder europäischen Ansiedlung, sondern auch auf den Inseln des Stillen Weltmeeres.
Die Wanderratte ( Mus decumanus) ist um ein beträchtliches größer, nämlich einschließlich des 18 Zentimeter messenden Schwanzes 42 Zentimeter lang, und ihre Färbung auf der Ober- und Unterseite des Leibes verschieden. Der Oberteil des Körpers und Schwanzes ist bräunlichgrau, die Unterseite scharf abgesetzt grauweiß, die Mittellinie des Rückens gewöhnlich etwas dunkler als die Seite des Leibes, die mehr ins Gelblichgraue spielt. Der Haargrund ist oben braungrau, unten lichter, meist blaßgrau. Der Schwanz hat etwa 210 Schuppenringe. Auch kommen Weißlinge mit roten Augen vor.
Mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen, daß das ursprüngliche Vaterland der Wanderratte Mittelasien, und zwar Indien oder Persien, gewesen ist. Möglicherweise hat bereits Aelian ihrer gedacht, indem er erzählt, daß die »kaspische Maus« zu gewissen Zeiten in unendlicher Menge einwandert, ohne Furcht über die Flüsse schwimmt und sich dabei mit dem Maul an dem Schwanz des Vordermannes hält. »Kommen sie auf die Felder,« sagt er, »so fällen sie das Getreide und klettern auf die Bäume nach den Früchten, werden aber häufig von Raubvögeln, die wie Wolken herbeifliegen, und von der Menge der dortigen Füchse vertilgt. Sie geben in der Größe dem Ichneumon nichts nach, sind sehr wild und bissig und haben so starke Zähne, daß sie damit selbst Eisen zernagen können, wie die Mäuse Canautanes bei Babylon, deren zarte Felle nach Persien geführt werden und zum Füttern der Kleider dienen.« Erst Pallas beschreibt die Wanderratte mit Sicherheit als europäisches Tier und berichtet, daß sie im Herbst 1727 nach einem Erdbeben in großen Massen aus den kaspischen Ländern und von der kumänischen Steppe aus in Europa eingerückt sei. Sie setzte bei Astrachan in großen Haufen über die Wolga und verbreitete sich von hier rasch nach Westen hin. Fast zu derselben Zeit, im Jahre 1732 nämlich, wurde sie auf Schiffen von Ostindien aus nach England verschleppt, und nunmehr begann sie auch von hier aus ihre Weltwanderung. In Ostpreußen erschien sie im Jahre 1750, in Paris bereits 1753, in Deutschland war sie schon 1780 überall häufig; in Dänemark kennt man sie erst seit ungefähr siebzig Jahren und in der Schweiz erst seit dem Jahre 1809 als einheimisches Tier. Im Jahre 1775 wurde sie nach Nordamerika verschleppt und erlangte hier ebenfalls in kürzester Zeit eine unglaublich große Verbreitung; doch war sie im Jahre 1825 noch nicht weit über Kingston hinaus in Oberkanada vorgedrungen, und noch vor wenigen Jahren hatte sie den oberen Missouri noch nicht erreicht. Wann sie in Spanien, Marokko, Algerien, Tunis, Ägypten, am Kap der guten Hoffnung und in andern Häfen Afrikas erschien, läßt sich nicht bestimmen; so viel aber steht fest, daß sie gegenwärtig auf über alle Teile des großen Weltmeeres verbreitet und selbst auf den ödesten und einsamsten Inseln zu finden ist. Größer und stärker als die Hausratte, bemächtigt sie sich überall der Orte, wo diese früher ruhig lebte, und nimmt in demselben Grade zu, wie jene abnimmt. Gegenwärtig ist jedoch mehrfach wieder eine Zunahme der Verbreitung der Hausratte konstatiert worden, auch in Gegenden, wo sie angeblich durch die Wanderratte verdrängt sein sollte. Die reine Verdrängungstheorie ist somit hier so wenig wie auch sonst in der Biogeographie allein ausreichend, die Verbreitung und besonders die Wanderungen der Organismen zu erklären. Herausgeber. Glaubwürdige Beobachter versichern, daß sie noch gegenwärtig zuweilen in Scharen von einem Orte zum andern zieht. »Mein Schwager«, schreibt mir Dr. Helms, »traf einmal an einem frühen Herbstmorgen im Vördenschen einen solchen wandernden Zug, den er auf mehrere tausend Stück schätzen mußte.«
In der Lebensweise, in den Sitten und Gewohnheiten, im Vorkommen usw. stimmen beide Ratten so sehr überein, daß man die eine schildert, indem man die andere beschreibt. Wenn man festhalten will, daß die Wanderratte mehr in den unteren Räumlichkeiten der Gebäude und namentlich in feuchten Kellern und Gewölben, Abzugsgräben, Schleusen, Senkgruben, Fleten und an Flußufern sich eingenistet hat, während die Hausratte den obern Teil des Hauses, die Kornböden, Dachkammern usw. vorzieht, wird nicht viel mehr übrig bleiben, was beiden Arten nicht gemeinsam wäre. Die eine wie die andere Art dieses Ungeziefers bewohnt alle nur möglichen Räumlichkeiten der menschlichen Wohnungen und alle nur denkbaren Orte, die Nahrung versprechen. Vom Keller an bis zum Dachboden hinauf, vom Prunkzimmer an bis zum Abtritt, vom Palast an bis zur Hütte, überall sind sie zu finden. An den unsaubersten Orten nisten sie sich ebensogern ein als da, wo sie sich erst durch ihren eigenen Schmutz einen zusagenden Wohnort schaffen müssen. Sie leben im Stalle, in der Scheuer, im Hofe, im Garten, an Flußufern, an der Meeresküste, in Kanälen, den unterirdischen Ableitungsgräben größerer Städte usw., kurz überall, wo sie nur leben können, obschon die Hausratte ihrem Namen immer Ehre zu machen sucht und sich möglichst wenig von der eigentlichen Wohnung der Menschen entfernt. Ausgerüstet mit allen Begabungen in leiblicher und geistiger Hinsicht, die sie zu Feinden des Menschen machen können, sind sie unablässig bemüht, diesen zu quälen, zu plagen, zu peinigen, und fügen ihm ohne Unterbrechung den empfindlichsten Schaden zu. Gegen sie schützt weder Hag noch Mauer, weder Tür noch Schloß; wo sie keinen Weg haben, bahnen sie sich einen; durch die stärksten Eichenbohlen und durch dicke Mauern nagen und wühlen sie sich Gänge. Nur, wenn man die Grundmauern tief einsenkt in die Erde, mit festem Zement alle Fugen zwischen den Steinen ausstreicht und vielleicht zur Vorsorge noch zwischen dem Gemäuer eine Schicht von Glasscherben einfügt, ist man vor ihnen ziemlich sicher.
Und dieses Zerstören der Wohnungen, dieses abscheuliche Zernagen und Durchwühlen der Wände ist doch das geringste Unheil, das die Ratten anrichten. Weit größern Schaden verursachen sie durch ihre Ernährung. Ihnen ist alles Genießbare recht. Der Mensch ißt nichts, was die Ratten nicht auch fräßen, und nicht beim Essen bleibt es, sondern es geht auch an das, was der Mensch trinkt. Es fehlt bloß noch, daß sie sich in Schnaps berauschten, dann würden sie sämtliche Nahrungs- und Genußmittel, die das menschliche Geschlecht verbraucht, aufzehren helfen. Nicht zufrieden mit dem schon so reichhaltigen Speisezettel, fallen die Ratten ebenso gierig über andere Stoffe, zumal auch über lebende Wesen her. Die schmutzigsten Abfälle des menschlichen Haushalts sind ihnen unter Umständen noch immer recht; verfaulendes Aas findet an ihnen Liebhaber. Sie fressen Leder und Horn, Körner und Baumrinde, oder besser gesagt, alle nur denkbaren Pflanzenstoffe, und was sie nicht fressen können, zernagen sie wenigstens. Es sind verbürgte Beispiele bekannt, daß sie kleine Kinder bei lebendigem Leibe angefressen haben, und jeder größere Gutsbesitzer hat erfahren, wie arg sie seinen Hoftieren nachstellen. Sehr fetten Schweinen fressen sie Löcher in den Leib, dicht zusammengeschichteten Gänsen die Schwimmhäute zwischen den Zehen weg, junge Enten ziehen sie ins Wasser und ersäufen sie dort, dem Tierhändler Hagenbeck töteten sie drei junge afrikanische Elefanten, indem sie diesen gewaltigen Tieren die Fußsohlen zernagten.
Wenn sie mehr als gewöhnlich an einem Orte sich vermehren, ist es wahrhaftig kaum zum Aushalten. In Paris erschlug man während vier Wochen in einem einzigen Schlachthause 16000 Stück, und in einer Abdeckerei in der Nähe dieser Hauptstadt verzehrten sie binnen einer einzigen Nacht fünfunddreißig Pferdeleichen bis auf die Knochen. Sobald sie merken, daß der Mensch ihnen gegenüber ohnmächtig ist, nimmt ihre Frechheit in wahrhaft erstaunlicher Weise zu; und wenn man sich nicht halb zu Tode ärgern möchte über die nichtswürdigen Tiere, könnte man versucht sein, über ihre alles Maß überschreitende Unverschämtheit zu lachen. Während meiner Knabenzeit hatten wir in unserer baufälligen Pfarrwohnung einige Jahre lang keine Katzen, die auf Ratten gingen, sondern nur schlechte, verwöhnte, die höchstens einer Maus den Garaus zu machen wagten. Da vermehrten sich die Ratten derart, daß wir nirgends mehr Ruhe und Rast vor ihnen hatten wenn wir mittags auf dem Vorsaal speisten, kamen sie lustig die Treppe herabspaziert, bis dicht an unsern Tisch heran, und sahen, ob sie nicht etwas wegnehmen könnten. Standen wir auf, um sie zu vertreiben, so rannten sie zwar weg, waren aber augenblicklich wieder da und begannen das alte Spiel von neuem. Nachts rasselte es unter allen Dächern und unter dem Fußboden, als ob ein wildes Heer in Bewegung wäre. Im ganzen Hause spukte es. Das waren Hausratten, also noch immer die bessere Sorte dieses Ungeziefers; denn die Wanderratten treiben es noch viel schlimmer. Las Cases erzählt, daß Napoleon am 27. Juni 1816 nebst seinen Gefährten ohne Frühstück bleiben mußte, weil die Ratten in der vergangenen Nacht in die Küche eingedrungen waren und alles fortgeschleppt hatten. Sie waren dort in großer Menge vorhanden, sehr böse und außerordentlich unverschämt. Gewöhnlich brauchten sie nur wenige Tage, um die Mauern und Bretterwände der armseligen Wohnung des Kaisers zu durchnagen. Während der Mahlzeit Napoleons kamen sie in den Saal, und nach dem Essen wurde förmlich Krieg mit ihnen geführt. Als der Kaiser einst abends seinen Hut wegnehmen wollte, sprang eine große Ratte aus diesem heraus. Die Stalleute wollten gern Federvieh halten, mußten aber darauf verzichten, weil die Ratten es wegfraßen. Diese holten das Geflügel nachts sogar von den Bäumen herunter, auf denen es schlief. Seeleute sind dieser Nager halber oft sehr übel daran. Es gibt kein größeres Schiff ohne Ratten. Auf den alten Fahrzeugen sind sie nicht auszurotten, und die neuen besetzen sie augenblicklich, sobald die erste Ladung eingenommen wird. Als Kanes Schiff bei seiner Polarreise in der Nähe des 80. Breitengrades festgefroren war, hatten die Ratten so überhand genommen, daß sie fürchterlichen Schaden taten. Endlich beschloß man, sie zu Tode zu räuchern. Man schloß alle Luken und brannte unten im Schiff ein Gemisch von Schwefel, Leder und Arsenik an. Die Mannschaft brachte die kalte Nacht des letzten September auf dem Deck zu. Am nächsten Morgen sah man, daß dieses furchtbare Mittel gar nichts geholfen hatte. Die Ratten waren noch munter. Jetzt brannte man eine Menge von Holzkohlen an und gedachte, die Tiere durch das sich entwickelnde Gas zu vergiften. In kurzer Zeit war auch der geschlossene Raum so stark mit Gas erfüllt, daß zwei Leute, die sich unvorsichtigerweise hinabgewagt hatten, sofort besinnungslos zu Boden fielen und nur mit großer Mühe aufs Deck gebracht werden konnten. Eine hinabgesenkte brennende Laterne verlosch augenblicklich; allein plötzlich geriet an einer andern Stelle des Fahrzeugs ein Kohlenvorrat und mit ihm ein Teil des Schiffes in Glühen, und nur mit der größten Anstrengung, ja mit wirklicher Lebensgefahr des Schiffsführers, gelang es, das Feuer zu löschen. Am folgenden Tage fand man bloß achtundzwanzig Rattenleichen, und die überlebenden vermehrten sich bis zum nächsten Winter in so großer Menge, daß man nichts mehr vor ihnen retten konnte. Sie zerfraßen Pelze, Kleider, Schuhe, nisteten sich in die Betten, zwischen die Decken und Handschuhe ein, nahmen Herberge in Mützen und Vorratskisten, verzehrten die Vorräte und wichen allen Nachstellungen mit List und Schlauheit aus. Man verfiel auf ein neues Mittel. Der klügste und tapferste Hund wurde in ihre eigentliche Herberge, in den Schiffsraum, hinabgelassen, um dort Ordnung zu stiften; aber bald verriet sein jämmerliches Heulen, daß nicht er über die Ratten, sondern sie über ihn Herr wurden. Man zog ihn heraus und fand, daß die gehaßten Nager ihm die Haut von den Fußsohlen abgefressen hatten. Später erbot sich ein Eskimo, die Ratten allmählich mit Pfeilen zu erschießen, und war auch so glücklich, daß Kane, der sich die Beute kochen ließ, während des langen Winters beständig frische Fleischbrühe hatte. Zufällig fing man einen Fuchs und sperrte ihn in den Schiffsraum; dieser endlich räumte auf.
In allen Leibesübungen sind die Ratten Meister. Sie laufen rasch und geschickt, klettern vortrefflich, sogar an ziemlich glatten Wänden empor, schwimmen meisterhaft, führen mit Sicherheit ziemlich weite Sprünge aus und graben recht leidlich, wenn auch nicht gern ausdauernd nacheinander. Die stärkere Wanderratte scheint noch geschickter zu sein als die Hausratte, wenigstens schwimmt sie bei weitem besser. Ihre Tauchfähigkeit ist beinahe ebenso groß wie die echter Wassertiere. Sie darf dreist auf den Fischfang ausgehen; denn sie ist im Wasser behend genug, den eigentlichen Bewohnern der feuchten Tiefe nachzustellen. Manchmal tut sie gerade, als ob das Wasser ihre wahre Heimat wäre. Erschreckt, flüchtet sie sich augenblicklich in einen Fluß, Teich oder Graben, und wenn es sein muß, schwimmt sie in einem Zuge über die breiteste Wasserfläche oder läuft minutenlang auf dem Grunde des Beckens dahin. Die Hausratte tut dies bloß im größten Notfalle, versteht jedoch die Kunst des Schwimmens ebenfalls recht gut.
Unter den Sinnen der Ratten stehen Gehör und Geruch obenan; namentlich das erstere ist vortrefflich, aber auch das Gesicht nicht schlecht, und der Geschmack wird nur allzuoft in Vorratskammern betätigt, wo die Ratten sicher immer die leckersten Speisen auszusuchen wissen. Über ihre geistigen Fähigkeiten brauche ich nach dem Angegebenen nicht mehr viel zu sagen. Verstand kann man ihnen wahrlich nicht absprechen, noch viel weniger aber eine berechnende List und eine gewisse Schlauheit, mit der sie sich den Gefahren der verschiedensten Art zu entziehen wissen.
Die Paarung geht unter lautem Lärmen und Quieken und Schreien vor sich; denn die verliebten Männchen kämpfen heftig um die Weibchen. Ungefähr einen Monat nach der Begattung werfen die letzteren fünf bis einundzwanzig Junge, kleine, allerliebste Tierchen, die jedermann gefallen würden, wären sie nicht Ratten. »Am 1. März 1852«, berichtet Dehne, »bekam ich von einer weißen Ratte sieben Junge. Sie hatte sich in ihrem Drahtkäfig ein dichtes Nest von Stroh gemacht. Die Jungen hatten die Größe der Maikäfer und sahen blutrot aus. Bei jeder Bewegung der Mutter ließen sie ein feines, durchdringendes Piepen oder Quietschen hören, am 8. waren sie schon ziemlich weiß; vom 13. bis 16. wurden sie sehend. Am 18. abends kamen sie zum ersten Male zum Vorschein; als aber die Mutter bemerkte, daß sie beobachtet wurden, nahm sie eine nach der andern ins Maul und schleppte sie in das Nest. Einzelne kamen jedoch wieder aus einem andern Loche hervor. Allerliebste Tierchen von der Größe der Zwergmäuse, mit ungefähr drei Zoll langen Schwänzen! Am 21. hatten sie schon die Größe gewöhnlicher Hausmäuse, am 28. die der Waldmäuse. Sie saugten noch dann und wann (ich sah sie sogar noch am 2. April saugen), spielten miteinander, jagten und balgten sich auf die gewandteste und unterhaltendste Weise, setzten sich auch wohl zur Abwechslung auf den Rücken der Mutter und ließen sich von derselben herumtragen. Sie übertrafen an Possierlichkeit bei weitem die weißen Hausmäuse. Am 9. April trennte ich die Mutter von ihren Jungen und setzte sie wieder zum Männchen; am 11. Mai warf sie abermals eine Anzahl Junge.
Von den am 1. März zur Welt gekommenen hatte ich seit Anfang April ein Pärchen in einem großen Glase mit achtzölliger Mündung abgesondert gehalten, und schon am 11. Juni nachmittags, also im Alter von hundertunddrei Tagen, gebar das Weibchen sechs Junge. Trotz der Weite des Glases schien der Raum für ihre Jungen zu eng zu sein. Sie bemühte sich vergebens, ein weiteres Nest zu machen, wobei sie öfter die armen Kleinen so verscharrte, daß man nichts mehr von ihnen sah; doch fand sie dieselben immer bald wieder zusammen. Sie säugte ihre Jungen bis zum 23. ganz gut, und sie wurden bereits etwas weiß; auf einmal aber waren sie alle verschwunden: die Mutter hatte sie sämtlich gefressen!«
Am Tage und nach Mitternacht schlafen die Wanderratten; früh und abends sieht man sie in größter Tätigkeit. Sehr gern trinken sie Milch: Kürbiskerne und Hanf gehören zu ihren Leckerbissen. Für gewöhnlich bekommen sie Brot, das mit Wasser oder Milch oberflächlich angefeuchtet wurde; dann und wann erhalten sie auch gekochte Kartoffeln, letztere fressen sie sehr gern. Fleisch und Fett, Lieblingsgerichte für sie, entziehe ich ihnen sowie allen andern Nagern, die ich in der Gefangenschaft ernähre, gänzlich, da nach solchen Speisen ihr Harn und selbst ihre Ausdünstung stets einen widrigen, durchdringenden Geruch bekommt. Der eigentümliche, so höchst unangenehme Geruch, den die gewöhnlichen Mäuse verbreiten und allen Gegenständen, die damit in Berührung kommen, dauernd mitteilen, fehlt den weißen Wanderratten gänzlich, wenn man sie in der angegebenen Weise hält.
Sie lieben die Gesellschaft ihresgleichen. Oft machen sie sich ein gemeinschaftliches Nest und erwärmen sich gegenseitig, indem sie darin dicht zusammenkriechen; stirbt aber eine von ihnen, so machen sich die übrigen gleich über sie her, beißen ihr erst den Hirnschädel auf, fressen den Inhalt und verzehren dann nach und nach die ganze Leiche mit Zurücklassung der Knochen und des Felles. Die Männchen muß man, wenn die Weibchen trächtig sind, sogleich absperren; denn sie lassen diesen keine Ruhe und fressen auch die Jungen am ersten. Die Mutter hat übrigens viel Liebe zu ihren Kindern; sie bewacht dieselben sorgfältig, und diese erwidern ihr die erwiesene Zärtlichkeit auf alle nur mögliche Weise.
Außerordentlich groß ist die Lebenszähigkeit dieser Tiere. Einst wollte ich eine ungefähr ein Jahr alte weiße Wanderratte durch Ersäufen töten, um sie von einem mir unheilbar scheinenden Leiden, einer offenen, eiternden Wunde, zu befreien. Nachdem ich sie bereits ein halbes dutzendmal in eiskaltes Wasser mehrere Minuten lang getaucht hatte, lebte sie noch und putzte sich mit ihren Pfötchen, um das Wasser aus den Augen zu entfernen. Sie erholte sich bald so weit, daß man sah, das kalte Bad habe ihr nichts geschadet. Nach einigen Tagen bemerkte ich nun, daß der offene Schaden von Tag zu Tag kleiner wurde; die Entzündung schwand immer mehr, und nach ungefähr vierzehn Tagen war die Heilung vollständig erfolgt. Hier hatte also offenbar das eiskalte Bad die Entzündung behoben und dadurch die Genesung bewerkstelligt.
Solche, im engen Gewahrsam gehaltene, gut gepflegte Ratten werden so zahm, daß sie sich nicht bloß berühren oder von Kindern als Spielzeug verwenden, sondern auch zum Aus- und Eingehen in Haus, Hof und Garten gewöhnen lassen, ihren Pflegern wie Hunde nachfolgen, auf den Ruf herbeikommen, kurz zu Haus- oder Stubentieren im besten Sinne werden.
Im Freileben kommt unter den Ratten zuweilen eine eigentümliche Krankheit vor. Mehrere von ihnen verwachsen untereinander mit den Schwänzen und bilden dann den sogenannten Rattenkönig, den man sich in früheren Zeiten freilich ganz anders vorstellte als gegenwärtig, wo man ihn in diesem oder jenem Museum sehen kann. Früher glaubte man, daß der Rattenkönig, geschmückt mit goldener Krone, auf einer Gruppe innig verwachsener Ratten throne und von hier aus den ganzen Rattenstaat regiere. So viel ist sicher, daß man zuweilen eine ganze Anzahl fest mit den Schwänzen verwickelter Ratten findet, die, weil sie sich nicht bewegen können, von Mitleidigen ihrer Art ernährt werden müssen. Man glaubt, daß eine eigentümliche Ausschwitzung der Rattenschwänze ein Aufeinanderkleben derselben zur Folge habe, ist aber nicht imstande, etwas Sicheres darüber zu sagen. In Altenburg bewahrt man einen Rattenkönig auf, der von siebenundzwanzig Ratten gebildet wird; in Bonn, bei Schnepfenthal, in Frankfurt, in Erfurt und in Lindenau bei Leipzig hat man andere aufgefunden. Es ist möglich, daß derartige Verbindungen öfter vorkommen, als man annimmt; die wenigsten aber werden gefunden, und an den meisten Orten ist der Aberglaube noch so groß, daß man einen etwa entdeckten Rattenkönig gewöhnlich sobald als möglich vernichtet.
Unzählbar sind die Mittel, die man schon angewandt hat, um die Ratten zu vertilgen. Fallen aller Art werden gegen sie aufgestellt, und eine Zeitlang hilft auch die eine und die andere Art der Rattenjagd wenigstens etwas. Merken die Tiere, daß sie sehr heftig verfolgt werden, so wandern sie nicht selten aus, kommen aber wieder, wenn die Verfolgung nachläßt. Und wenn sie sich einmal von neuem eingefunden haben, vermehren sie sich in kurzer Zeit so stark, daß die alte Plage wieder in voller Stärke auftritt. Die gewöhnlichsten Mittel zu ihrer Vertilgung bleiben Gifte verschiedener Art, die man an ihren Lieblingsorten aufstellt; aber ganz abgesehen davon, daß man die vergifteten Tiere auf eine greuliche Weise zu Tode martert, bleiben diese Mittel immer gefährlich; denn die Ratten brechen gern einen Teil des Gefressenen wieder aus, vergiften unter Umständen Getreide oder Kartoffeln und können dadurch andern Tieren und auch den Menschen sehr gefährlich werden.
Die besten Vertilger der Ratten bleiben unter allen Umständen ihre natürlichen Feinde, vor allen Eulen, Raben, Wiesel, Katzen und Pintscher, obgleich es oft vorkommt, daß die Katzen sich nicht an Ratten, zumal an Wanderratten, wagen. Dehne sah in Hamburg in den Fleten Hunde, Katzen und Ratten untereinander herumspazieren, ohne daß eines der betreffenden Tiere daran gedacht hätte, dem andern den Krieg zu erklären, und mir selbst sind viele Beispiele bekannt, daß die Katzen sich nicht um die Ratten bekümmern. Es gibt, wie unter allen Haustieren, auch unter den Katzen gute Familien, deren Glieder mit wahrer Leidenschaft der Rattenjagd obliegen, obgleich sie anfangs viele Mühe haben, die bissigen Nager zu überwältigen. Eine unserer Katzen fing bereits Ratten, als sie kaum den dritten Teil ihrer Größe erreicht hatte, und verfolgte dieselben mit solchem Eifer, daß sie sich einstmals von einer starken Ratte über den ganzen Hof weg und an einer Mauer emporschleppen ließ, ohne ihren Feind loszulassen, bis sie endlich mit einem geschickten Biß denselben kampfunfähig machte. Von jenem Tage an ist die Katze der unerbittlichste Feind der Ratten geblieben und hat den ganzen Hof von ihnen fast gereinigt. Übrigens ist es gar nicht so notwendig, daß eine Katze wirklich eifrig Ratten fängt; sie vertreibt dieselben schon durch ihr Umherschleichen in Stall und Scheuer, Keller und Kammer. Es ist sicherlich höchst ungemütlich für die Ratten, diesen Erzfeind in der Nähe zu haben. Sie sind da keinen Augenblick lang sicher. Unhörbar schleicht er herbei im Dunkel der Nacht, kein Laut, kaum eine Bewegung verrät sein Nahen, in alle Löcher schauen seine unheimlich leuchtenden, grünlichen Augen, neben den bequemsten Gangstraßen sitzt und lauert er, und ehe sie es sich recht versehen, fällt er über sie her und packt mit den spitzen Klauen und den scharfen Zähnen so fest zu, daß selten Rettung möglich. Das erträgt selbst eine Ratte nicht; sie wandert lieber aus und an Orte, wo sie unbehelligter wohnen kann. Somit bleibt die Katze immer der beste Gehilfe des Menschen, wenn es gilt, so lästige Gäste zu vertreiben.
Weit lieblicher, anmutiger und zierlicher als diese häßlichen, langgeschwänzten Hausdiebe sind die Mäuse, obwohl auch sie trotz ihrer schmucken Gestalt, ihres heitern und netten Wesens arge Feinde des Menschen sind und fast mit demselben Ingrimm wie ihre größeren und häßlicheren Verwandten von ihm verfolgt werden. Man darf behaupten, daß jedermann eine im Käfig eingesperrte Maus reizend finden wird, und daß selbst Frauen, die gewöhnlich einen zwar vollkommen ungerechtfertigten, aber dennoch gewaltigen Schrecken empfinden, wenn in der Küche oder im Keller eine Maus ihnen über den Weg läuft, diese, wenn sie genauer mit ihr bekannt werden, für ein hübsches Geschöpf erklären müssen. Aber freilich, die spitzigen Nagezähne und die Leckerhaftigkeit der Mäuse sind zwei Dinge, die auch ein mildes Frauenherz mit Zorn und Rachegefühlen erfüllen können. Es ist gar zu unangenehm, für alle Lebensmittel beständig fürchten zu müssen, selbst wenn dieselben unter Schloß und Riegel liegen; es ist gar zu empörend, eigentlich gar keinen Ort im Hause zu haben, wo man allein Herr sein darf und von den zudringlichen, kleinen Gästen nicht belästigt wird. Und weil nun die Mäuse sich überall einzudrängen wissen und sich selbst an den den Ratten unzugänglichen Orten einfinden, haben sie gegen sich einen Verfolgungskrieg heraufbeschworen, der schwerlich jemals enden wird.
In Deutschland leben vier echte Mäuse: die Haus-, Wald-, Feld- und Zwergmaus. Namentlich die erstere und die letztere verdienen eine ausführlichere Beschreibung, obgleich auch Feld- und Waldmaus nur zu oft dem Menschen ins Gehege kommen und ihre Kenntnis deshalb notwendig erscheint. Die drei ersteren werden überall ziemlich schonungslos verfolgt; die letztere aber hat, solange sie sich nicht unmittelbar dem Menschen aufdrängt, wegen ihrer ungemein zierlichen Gestalt, ihrer Anmut und ihrer eigentümlichen Lebensweise Gnade vor seinen Augen gefunden.
Alle diese Mäuse ähneln sich in ihrem Aufenthalt, ihrem Wesen und Betragen ungemein, obgleich die eine oder die andre ihr Eigentümliches hat. In einem stimmen alle vier überein: sie zeigen, wenigstens zeitweilig, große Vorliebe für den Menschen. Alle Arten, wenn auch die Hausmaus regelmäßiger als die übrigen, finden sich, zumal im Winter, häufig in den Häusern, vom Keller an bis zum Boden hinauf. Keine einzige ist ausschließlich an die Orte gebunden, auf die ihr Name hindeutet: die Waldmaus lebt ebensowohl zeitweilig in der Scheuer oder im Hause wie auf dem Felde, und die Feldmaus ist ebensowenig allein aufs Feld beschränkt wie die Hausmaus auf die Wohnung des Menschen.
Die Hausmaus ( Mus musculus) soll schon seit den ältesten Zeiten der treueste Genosse des Menschen gewesen sein. Bereits Aristoteles und Plinius tun ihrer Erwähnung, Albertus Magnus kennt sie genau. Gegenwärtig ist sie über die ganze Erde verbreitet. Sie wanderte mit dem Menschen und folgte ihm bis in den höchsten Norden und bis in die höchstgelegenen Alphütten. Ihre Aufenthaltsorte sind alle Teile der menschlichen Wohnungen. Auf dem Lande haust sie zeitweilig auch im Freien, d. h. im Garten oder in den nächsten Feldern und Wäldchen, in der Stadt beschränkt sie sich auf das Wohnhaus und seine Nebengebäude. Hier bietet ihr jede Ritze, jede Höhle, mit einem Wort jeder Winkel, wo sie sich verstecken kann, genügendes Obdach, und von hier aus unternimmt sie ihre Streifzüge.
Mit größter Schnelligkeit rennt sie auf dem Boden dahin, klettert vortrefflich, springt ziemlich weit und hüpft oft längere Zeit nacheinander in kurzen Sätzen fort. An zahmen kann man beobachten, wie geschickt sie alle Bewegungen unternimmt. Läßt man sie auf einem schief aufwärts gespannten Bindfaden oder auf einem Stöckchen gehen, so schlingt sie, sobald sie zu fallen fürchtet, ihren Schwanz schnell um das Seil, nach Art der echten Wickelschwänzler, bringt sich wieder in das Gleichgewicht und läuft weiter; setzt man sie auf einen sehr biegsamen Halm, so klettert sie auf demselben bis zur Spitze empor, und wenn der Halm sich dann niederbiegt, hängt sie sich auf der unteren Seite an und steigt hier langsam herunter, ohne jemals in Verlegenheit zu kommen. Beim Klettern leistet ihr der Schwanz wesentliche Dienste; zahme Mäuse, denen man, um ihnen ein drolliges Aussehen zu geben, die Schwänze kurz geschnitten hatte, waren nicht mehr imstande, es ihren beschwänzten Mitschwestern gleichzutun. Ganz allerliebst sind auch die verschiedenen Stellungen, die sie einnehmen kann. Schon wenn sie ruhig sitzt, macht sie einen ganz hübschen Eindruck; erhebt sie sich aber, nach Nagerart auf das Hinterteil sich stützend, und putzt und wäscht sie sich, dann ist sie geradezu ein bezauberndes Tierchen. Sie kann sich auf den Hinterbeinen aufrichten wie ein Mensch und sogar einige Schritte gehen. Dabei stützt sie sich nur dann und wann ein klein wenig mit dem Schwanze. Das Schwimmen versteht sie auch, obwohl sie nur im höchsten Notfalle in das Wasser geht. Wirft man sie in einen Teich oder Bach, so sieht man, daß sie fast mit der Schnelligkeit der Zwergmaus oder der Wasserratte, die wir beide später kennen lernen werden, die Wellen durchschneidet und dem ersten trockenen Orte zustrebt, um an ihm emporzuklettern und das Land wieder zu gewinnen. Ihre Sinne sind vortrefflich: sie hört das feinste Geräusch, riecht scharf und auf weite Entfernungen, sieht auch gut, vielleicht noch besser bei Tage als bei Nacht. Ihr geistiges Wesen macht sie dem, der das Leben des Tieres zu erkennen trachtet, zum wahren Liebling. Sie ist gutmütig und harmlos und ähnelt nicht im geringsten ihren boshaften, tückischen und bissigen Verwandten, den Ratten; sie ist neugierig und untersucht alles mit der größten Sorgfalt; sie ist lustig und klug, merkt bald, wo sie geschont wird, und gewöhnt sich hier mit der Zeit so an den Menschen, daß sie vor seinen Augen hin und her läuft und ihre Hausgeschäfte betreibt, als gäbe es gar keine Störung für sie. Im Käfig benimmt sie sich schon nach wenigen Tagen liebenswürdig; selbst alte Mäuse werden noch leidlich zahm, und jung eingefangene übertreffen wegen ihrer Gutmütigkeit und Harmlosigkeit die meisten andern Nager, die man gefangen halten kann. Wohllautende Töne locken sie aus ihrem Versteck hervor und lassen sie alle Furchtsamkeit vergessen. Sie erscheint bei hellem Tage in den Zimmern, in denen gespielt wird, und Räume, in denen regelmäßig Musik ertönt, werden zuletzt ihre Lieblingsaufenthaltsorte. In neuerer Zeit ist über sogenannte »Singmäuse« berichtet worden. Alle Berichte stimmen darin überein, daß hier und da und dann und wann Hausmäuse beobachtet werden, die ihr natürliches Piepen und Zwitschern in einer an Vogelgesang erinnernden Weise vernehmen lassen. Lehrer Schacht, ein ebenso verläßlicher als kenntnisreicher Beobachter, pflegte längere Zeit eine solche Singmaus, die ihren Gesang meist in der Dämmerung, oft auch erst in der Nacht, ertönen ließ. Mit dem hellen Schlage eines Kanarienvogels oder mit dem tiefen Rollen eines Sprossers hatte derselbe nicht die geringste Ähnlichkeit. Es war nur »ein Gezwitscher, ein Mischmasch von ziehenden, surrenden und quietschenden Tönen,« die man in der Stille der Nacht noch auf zwanzig Schritte vernehmen konnte. »Um einen Vergleich zwischen dem Gesange des Vierfüßlers und dem eines Vogels zu ziehen,« meint Schacht, »läßt sich sagen, daß das Gepräge der Weise die größte Ähnlichkeit mit den leisen Tönen einer jungen Klappergrasmücke hatte, die im Nachsommer, tief im Gebüsch versteckt, ihr Liedchen einübt.«
Alle angenehmen Eigenschaften unserer Hausgenossin werden leider durch ihre Lüsternheit und Naschhaftigkeit sehr beeinträchtigt. Man kann sich schwerlich ein naschhafteres Geschöpf denken als eine Hausmaus, die über eine gut gespickte Speisekammer verfügen kann. Sie sucht sich sicher immer die besten Bissen aus und beweist dadurch auf das schlagendste, daß der Sinn des Geschmackes bei ihr vortrefflich entwickelt ist. Süßigkeiten aller Art, Milch, Fleischspeisen, Käse, Fette, Früchte und Körner werden von ihr unbedingt bevorzugt, und wo sie die Wahl hat, kürt sie sich unter dem Guten immer das Beste. Die spitzen Nagezähne kommen hinzu, um sie verhaßt zu machen. Wo sie etwas Genießbares wittert, weiß sie sich einen Zugang zu verschaffen, und es kommt ihr eben nicht darauf an, eine oder mehrere Nächte angestrengt zu arbeiten und selbst feste, starke Türen zu durchnagen. Findet sie viele Nahrung, die ihr besonders mundet, so trägt sie sich auch noch einen Vorrat davon in ihre Schlupfwinkel und sammelt mit der Hast eines Geizigen an der Vermehrung ihrer Schätze. »An Orten, wo sie wenig Störung erleidet,« sagt Fitzinger, »findet man zuweilen ganze Haufen von Wal- oder Haselnüssen bis zu einer halben Elle hoch in Winkeln aufgetürmt und so regelmäßig und zierlich fest aneinander geschlossen und mit allerlei Abfällen von Papier oder Kleiderstoffen überdeckt, daß man hierin kaum ein Werk der Hausmaus vermuten möchte.« Wasser trinkt sie, wenn sie andere saftige Stoffe haben kann, gar nicht und auch bei trockenem Futter nur selten, schlürft dagegen süße Getränke aller Art mit Wollust aus.
Der Schaden, den die Hausmaus durch Wegfressen verschiedener Speisevorräte anrichtet, ist im ganzen gering; ihre hauptsächliche Schädlichkeit beruht in dem abscheulichen Zernagen wertvoller Gegenstände. In Bücher- und Naturaliensammlungen hausen die Mäuse auf die verderblichste Weise und können, wenn ihrer Zerstörungslust nicht mit allen Kräften Einhalt getan wird, unschätzbaren Schaden anrichten. In Bibliotheken haben sie es besonders auf den beim Bucheinband verwendeten Kleister abgesehen. Hier ist der beste Schutz gegen Mäuse und Ratten immer das Halten von Katzen, deren bloße Anwesenheit genügt, die Plagegeister zu vertreiben. Herausgeber.
Die Hausmaus vermehrt sich außerordentlich stark. Sie wirft 22 bis 24 Tage nach der Paarung vier bis sechs, nicht selten aber auch acht Junge und in Jahresfrist sicherlich fünf bis sechsmal, so daß die unmittelbare Nachkommenschaft eines Jahres mindestens dreißig Köpfe beträgt. Eine weiße Maus, die Struve in der Gefangenschaft hielt, warf am 17. Mai sechs, den 6. Juni sechs, den 3. Juli acht Junge. Sie wurde am 3. Juli vom Männchen getrennt und am 23. Juli wieder mit ihm zusammen getan. Nun warf sie am 21. August wieder sechs Junge, am 1. Oktober ebenfalls sechs und am 24. Oktober fünf. Während des Winters ging sie gelte. Am 17. März kamen wieder zwei Junge zur Welt. Eins von den am 6. Juni geborenen Weibchen bekam die ersten Jungen, und zwar gleich vier, am 18. Juli. Die Mutter schlägt ihr Wochenbett in jedem Winkel auf, der ihr eine weiche Unterlage bietet und einigermaßen Sicherheit gewährt. Nicht selten findet man das Nest in ausgehöhltem Brote, in Kohlrüben, Taschen, Totenköpfen, ja selbst in Mausefallen. Gewöhnlich ist es aus Stroh, Papier, Federn und anderen weichen Stoffen sorgfältig zusammengeschleppt; doch kommt es auch vor, daß bloß Holzspäne oder selbst Nußschalen die Unterlage abgeben müssen. Die Jungen sind, wenn sie zur Welt kommen, außerordentlich klein und förmlich durchsichtig, wachsen aber rasch heran, bekommen zwischen dem siebenten und achten Tag Haare, öffnen aber erst am dreizehnten Tage die Augen. Nun bleiben sie nur noch ein paar Tage im Neste; dann gehen sie selbständig auf Nahrungserwerb aus. Die Alte behandelt sie mit großer Zärtlichkeit und gibt sich ihrethalben selbst Gefahren preis. Weinland erzählt ein rührendes Beispiel ihrer Mutterliebe. »In dem weichen Bette, das eine Hausmaus ihren Jungen bereitet hatte, entdeckte man sie und ihre neun Kinder. Die Alte konnte entrinnen, aber sie macht keine Bewegung zur Flucht! Man schiebt die Jungen auf eine Schaufel und die Alte mit ihnen, sie rührt sich nicht. Man trägt sie frei auf der Schaufel fort, mehrere Treppen hinunter, bis in den Hof, und sie harrt zu ihrem Verderben bei ihren Kindern aus.«
Der schlimmste aller Feinde der Hausmaus ist und bleibt die Katze. In alten Gebäuden hilft die Eule dem Vierfüßler treulich mit, und auf dem Lande leisten Iltis und Wiesel, Igel und Spitzmaus gute Dienste, bessere jedenfalls als Fallen aller Art.
Wald- und Feldmaus ( Mus sylvaticus) teilen die meisten Eigenschaften der Hausmaus. Erstgenannte ist, etwa mit Ausnahme der hochnordischen Gegenden, durch ganz Europa und Mittelasien verbreitet und steigt im Gebirge bis zu 2000 Meter über das Meer empor. Sie lebt in Wäldern, an Waldrändern, in Gärten, seltener auch in weiten, baumleeren Feldern und kommt im Winter gern in Häuser, Keller und Speisekammern, steigt aber baldmöglichst nach oben hinauf und treibt sich in Bodenkammern und unter den Dächern umher. In ihren Bewegungen ist sie mindestens ebenso gewandt wie die Hausmaus, unterscheidet sich jedoch dadurch von ihr, daß sie meist in Bogensprüngen dahinhüpft, nach Art der Springmäuse mehrere Sätze nacheinander macht und erst dann ein wenig ruht. Nach Raddes Beobachtungen scheint der Gesichtssinn nicht besonders entwickelt zu sein; denn man kann sich ihr, vorsichtig vorwärts schreitend, bis auf etwa 60 Zentimeter nahen und sie ohne besondere Mühe töten. Im Freien frißt sie Kerbtiere und Würmer, selbst kleine Vögel, oder Obst, Kirschkerne, Nüsse, Eicheln, Bucheckern und in der Not wohl auch die Rinde junger Bäume. Sie trägt sich ebenfalls einen Wintervorrat ein, hält aber keinen Winterschlaf und nascht bloß an trüben Tagen von ihren aufgespeicherten Schätzen. »Als wir unsere Wohnung im Bureja-Gebirge vollendet hatten«, erzählt Radde, »stellte sich die Waldmaus für den Winter in großer Anzahl bei uns ein und spielte uns manchen Streich, indem sie selbst die Tische besuchte und Unfug auf ihnen trieb. Sie vermied die gelegten, vergifteten Talgpillen und hielt sich am meisten zu den Buchweizenvorräten in unserem Speicher; auch war sie es, die die Erbsen verschleppte und sich davon starke Vorräte anlegte. Am Tage wurde sie nie angetroffen, in der Dämmerungsstunde aber war sie sehr lebhaft und ungemein dreist.« Auch bei uns zu Lande bringt sie im Hause oft empfindlichen Schaden und hat ganz eigene Gelüste: so dringt sie nachts in Käfige, tötet Kanarienvögel, Lerchen, Finken. Häuschen von Leckerbissen, die sie nicht gut wegschleppen kann, bedeckt sie mit Halmen, Papierstückchen und dergl. Von ihrem guten Geschmacke erzählt Lenz ein hübsches Beispiel. Eine seiner Schwestern hörte abends im Keller ein eigenes, singendes Piepen, suchte mit der Laterne und fand eine Waldmaus, die neben einer Flasche Malaga saß, der hereinkommenden Dame freundlich und ohne Scheu ins Gesicht sah und sich in ihrem Gesange dabei gar nicht stören ließ. Die junge Dame ging fort, holte Hilfe, und es wurde mit Heeresmacht in den Keller gezogen; die Maus war mit ihrem Liedchen noch nicht fertig, blieb ruhig sitzen und war sehr verwundert, als sie mit einer eisernen Zange beim Schopfe gefaßt wurde. Bei weiterer Untersuchung fand sich nun, daß die Flasche etwas auslief, und daß um den Fleck, wo die Tropfen herausliefen, ein ganzer Kranz von Mäusemist lag, woraus der Schluß gezogen wurde, daß die hier als Trunkenbold verhaftete Maus schon länger ihre Gelage gefeiert haben mochte.
Die Waldmaus wirft jährlich zwei oder dreimal vier bis sechs, seltener auch acht nackte Junge, die ziemlich langsam wachsen und den schönen, rein rotgelben Anflug des Pelzes erst im zweiten Jahre erhalten.
Die Brandmaus ( Mus agrarius) ist auf einen geringeren Verbreitungskreis beschränkt als die verwandten Arten: sie lebt zwischen dem Rheine und Westsibirien, Nord-Holstein und der Lombardei. In Mitteldeutschland ist sie überall gemein, im Hochgebirge fehlt sie. Ihre Aufenthaltsorte sind Ackerfelder, Waldränder, lichte Gebüsche und im Winter die Getreidefeimen oder die Scheuern und Ställe. Beim Mähen des Getreides sieht man sie im Herbste scharenweise über die Stoppeln flüchten. Pallas erzählt, daß sie in Sibirien zuweilen regellose Wanderungen anstellt. In ihren Bewegungen ist sie ungeschickter, in ihrem Wesen weit gutmütiger oder dümmer als ihre Verwandten. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Getreide, Sämereien, Pflanzen, Knollen, Kerbtieren und Würmern. Sie trägt sich ebenfalls Vorräte ein. Im Sommer wirft sie drei bis viermal zwischen vier und acht Junge, die, wie die der Waldmaus, erst im folgenden Jahre vollständig ausgefärbt sind. Über ihre Fortpflanzung erzählt Lenz folgendes: »Vor nicht langer Zeit nahm ich ein Brandmausweibchen nebst seinen Jungen, die eben zu sehen begannen, in die Stube, tat die Familie ganz allein in ein wohl verwahrtes Behältnis und fütterte sie gut. Die Alte machte sich ein Nestchen und säugte darin ihre Jungen sehr eifrig. Fünfzehn Tage nach dem, an dem die Familie eingefangen und eingesperrt worden war, als eben die Jungen selbständig zu werden begannen, warf die Alte unvermutet wieder sieben Junge, mußte sich also schon im Freien, nachdem sie die vorigen geheckt, wieder gepaart haben. Lustig war es mit anzusehen, wenn ich die alte Brandmaus, während sie die Jungen säugte, so störte, daß sie weglief. Die Jungen, die gerade an ihren Zitzen hingen, blieben dann daran, sie mochte so schnell laufen, wie sie wollte, und sie kam mit der bedeutenden Last doch immer schnell vom Flecke. Ich habe auch im Freien Mäuse gesehen, die ihre Jungen, wenn ich sie störte, so wegschafften.«
So schmuck und nett alle kleinen Mäuse sind, so allerliebst sie sich in der Gefangenschaft betragen: das kleinste Mitglied der Familie, die Zwergmaus ( Mus minutus), übertrifft jene doch in jeder Hinsicht. Sie ist beweglicher, geschickter, munterer, kurz ein viel anmutigeres Tierchen als alle übrigen. Ihre Länge beträgt 13 Zentimeter, wovon fast die Hälfte auf den Schwanz kommt. Die Pelzfärbung wechselt. Gewöhnlich ist sie zweifarbig, die Oberseite des Körpers und der Schwanz gelblich braunrot, die Unterseite und die Füße scharf abgesetzt weiß; es kommen jedoch dunklere und hellere, rötlichere und bräunlichere, grauere und gelbere vor; die Unterseite steht nicht so scharf im Gegensatze mit der oberen; junge Tiere haben andere Körperverhältnisse als die alten und noch eine ganz andere Leibesfärbung, nämlich viel mehr Grau auf der Oberseite.
Von jeher hat die Zwergmaus den Tierkundigen Kopfzerbrechen gemacht. Pallas entdeckte sie in Sibirien, beschrieb sie genau und bildete sie auch ganz gut ab; aber fast jeder Forscher nach ihm, dem sie in die Hände kam, stellte sie als eine neue Art auf, und jeder glaubte in seinem Rechte zu sein. Erst fortgesetzte Beobachtung ergab als unumstößliche Wahrheit, daß unser Zwerglein wirklich von Sibirien an durch ganz Rußland, Ungarn, Polen und Deutschland bis nach Frankreich, England und Italien reicht und nur ausnahmsweise in manchen Gegenden nicht vorkommt. Sie lebt in allen Ebenen, in denen der Ackerbau blüht, und keineswegs immer auf den Feldern, sondern vorzugsweise im Schilfe und im Rohre, in Sümpfen und in Binsen usw. In Sibirien und in den Steppen am Fuße des Kaukasus ist sie gemein, in Rußland und England, in Schleswig und Holstein wenigstens nicht selten. Aber auch in den übrigen Ländern Europas kann sie zuweilen häufig werden.
Während des Sommers findet man das niedliche Geschöpf in Gesellschaft der Wald- und Feldmaus in Getreidefeldern, in Winter massenweise unter Feimen oder auch in Scheuern, in die sie mit der Frucht eingeführt wird. Wenn sie im freien Felde überwintert, bringt sie zwar einen Teil der kalten Zeit schlafend zu, fällt aber niemals in völlige Erstarrung und trägt deshalb während des Sommers Vorräte in ihre Höhlen ein, um davon leben zu können, wenn die Not an die Pforte klopft. Ihre Nahrung ist die aller übrigen Mäuse: Getreide und Sämereien von verschiedenen Gräsern, Kräutern und Bäumen, namentlich aber auch kleine Kerbtiere aller Art.
In ihren Bewegungen zeichnet sich die Zwergmaus vor allen anderen Arten der Familie aus. Sie läuft, ungeachtet ihrer geringen Größe, ungemein schnell und klettert mit größter Fertigkeit, Gewandtheit und Zierlichkeit. An den dünnsten Ästen der Gebüsche, an Grashalmen, die so schwach sind, daß sie mit ihr zur Erde beugen, schwebend und hängend, läuft sie empor, fast ebenso schnell an Bäumen, und der zierliche kleine Schwanz wird dabei so recht geschickt als Wickelschwanz benutzt. Auch im Schwimmen ist sie wohlerfahren und im Tauchen sehr bewandert. So kommt es, daß sie überall wohnen und leben kann.
Ihre größte Fertigkeit entfaltet die Zwergmaus aber doch noch in etwas anderem. Sie ist eine Künstlerin, wie es wenige gibt unter den Säugetieren, eine Künstlerin, die mit den begabtesten Vögeln zu wetteifern versucht; denn sie baut ein Nest, das an Schönheit alle anderen Säugetiernester weit übertrifft. Als hätte sie es einem Rohrsänger abgesehen, so eigentümlich wird der niedliche Bau angelegt. Das Nest steht, je nach des Orts Beschaffenheit, entweder auf zwanzig bis dreißig Riedgrasblättern, deren Spitzen zerschlissen und so durcheinandergeflochten sind, daß sie den Bau von allen Seiten umschließen, oder es hängt, zwischen ½ bis 1 Meter hoch über der Erde, frei an den Zweigen eines Busches, an einem Schilfstengel und dergleichen, so daß es aussieht, als schwebe es in der Luft. In seiner Gestalt ähnelt es am meisten einem stumpfen Ei, einem besonders rundlichen Gänseei z. B., dem es auch in der Größe ungefähr gleichkommt. Die äußere Umhüllung besteht immer aus gänzlich zerschlitzten Blättern des Rohrs oder Riedgrases, deren Stengel die Grundlage des ganzen Baues bilden. Die Zwergmaus nimmt jedes Blättchen mit den Zähnen in das Maul und zieht es mehrere Male zwischen den nadelscharfen Spitzen durch, bis jedes einzelne Blatt sechs-, acht- oder zehnfach geteilt, gleichsam in mehrere besondere Fäden getrennt worden ist; dann wird alles außerordentlich sorgfältig durcheinandergeschlungen, verwebt und geflochten. Das Innere ist mit Rohrähren, mit Kolbenwolle, mit Kätzchen und Blütenrispen aller Art ausgefüttert. Eine kleine Öffnung führt von einer Seite hinein, und wenn man da hindurch in das Innere greift, fühlt sich dieses oben wie unten gleichmäßig geglättet und überaus weich und zart an. Die einzelnen Bestandteile sind so dicht miteinander verfitzt und verwebt, daß das Nest einen wirklich festen Halt bekommt. Wenn man die viel weniger brauchbaren Werkzeuge dieser Mäuse mit dem geschickten Schnabel der Künstlervögel vergleicht, wird man jenen Bau nicht ohne Verwunderung betrachten und die Arbeit der Zwergmaus über die Baukunst manches Vogels stellen.
Jedes Nestchen wird immer zum Hauptteile aus den Blättern derselben Pflanzen gebildet, die es tragen. Eine notwendige Folge hiervon ist, daß das Äußere auch fast oder ganz dieselbe Färbung hat wie der Strauch selber, an dem es hängt. Nun benutzt die Zwergmaus jeden einzelnen ihrer Paläste bloß zu ihrem Wochenbette, und das dauert nur ganz kurze Zeit: so sind die Jungen regelmäßig ausgeschlüpft, ehe das Blätterwerk um das Nest verwelken und hierdurch eine auffällige Färbung annehmen konnte.
Man glaubt, daß jede Zwergmaus jährlich zwei- bis dreimal Junge wirft, jedesmal ihrer fünf bis neun. Gewöhnlich verweilen sie so lange in ihrer prächtigen Wiege, bis sie sehen können. Die Alte hat sie jedesmal warm zugedeckt oder vielmehr die Tür zum Neste verschlossen, wenn sie die Wochenstube verlassen muß, um sich Nahrung zu holen. Sie ist inzwischen wieder mit dem Männchen ihrer Art zusammengekommen und gewöhnlich bereits von neuem trächtig, während sie ihre Kinder noch säugen muß. Kaum sind dann diese soweit, daß sie zur Not sich ernähren können, so überläßt sie die Alte sich selbst, nachdem sie höchstens ein paar Tage lang ihnen Führer und Ratgeber gewesen ist.
Falls das Glück einem wohl will und man gerade dazukommt, wenn die Alte ihre Brut zum ersten Male ausführt, hat man Gelegenheit, sich an einem der anziehendsten Familienbilder aus dem Säugetierleben zu erfreuen. So geschickt die junge Schar auch ist, etwas Unterricht muß ihr doch werden, und sie hängt auch noch viel zu sehr an der Mutter, als daß sie gleich selbständig sein und in die weite, gefährliche Welt hinausstürmen möchte. Da klettert nun ein Junges an diesem, das andere an jenem Halme; eines zirpt zu der Mutter auf, eines verlangt noch die Mutterbrust: dieses wäscht und putzt sich, jenes hat ein Körnchen gefunden, das es hübsch mit den Vorderfüßen hält und aufknackt; das Nesthäkchen macht sich noch im Innern des Baues zu schaffen, das beherzteste und mutigste Männchen hat sich schon am weitesten entfernt und schwimmt vielleicht bereits unten in dem Wasser herum: kurz, die Familie ist in der lebhaftesten Bewegung und die Alte gemütlich mittendrin, hier helfend, dort rufend, führend, leitend, die ganze Gesellschaft beschützend.
Man kann dieses anmutige Treiben gemächlich betrachten, wenn man das ganze Nest mit nach Hause nimmt und in einen enggeflochtenen Drahtbauer bringt. Mit Hanf, Hafer, Birnen, süßen Äpfeln, Fleisch und Stubenfliegen sind die Zwergmäuse leicht zu erhalten, vergelten auch jede Mühe, die man sich mit ihnen gibt, durch ihr angenehmes Wesen tausendfach. Allerliebst sieht es aus, wenn man eine Fliege hinhält. Alle fahren mit großen Sprüngen auf sie los, packen sie mit den Füßchen, führen sie zum Munde und töten sie mit einer Hast und Gier, als ob ein Löwe ein Rind erwürgen wolle; dann halten sie ihre Beute allerliebst mit den Vorderpfoten und führen sie damit zum Munde. Die Jungen werden sehr bald zahm, aber mit zunehmendem Alter wieder scheuer, falls man sich nicht ganz besonders oft und fleißig mit ihnen abgibt. Um die Zeit, wo sie sich im Freien in ihre Schlupfwinkel zurückziehen, werden sie immer sehr unruhig und suchen mit Gewalt zu entfliehen, geradeso, wie die im Käfige gehaltenen Zugvögel zu tun pflegen, wenn die Zeit der Wanderung herannaht. Auch im März zeigen sie dasselbe Gelüste, sich aus dem Käfige zu entfernen. Sonst gewöhnen sie sich bald ein und bauen lustig an ihren Kunstnestern, nehmen Blätter und ziehen sie mit den Pfoten durch den Mund, um sie zu spalten, ordnen und verweben sie, tragen allerhand Stoffe zusammen, kurz, suchen sich so gut als möglich einzurichten.
Eine der schönsten Arten der Unterfamilie ist die Streifen- oder Berbermaus ( Mus barbarus), ein Tierchen, das einschließlich des 12 Zentimeter langen Schwanzes etwa 22 Zentimeter an Länge erreicht. Ein schönes Gelblichbraun oder Rötlichlehmgelb ist die Grundfarbe des Körpers. Vom Kopfe, der schwarz gesprenkelt ist, zieht sich ein schwarzbrauner Längsstreifen bis zur Schwanzwurzel herab, und viele ähnliche Streifen verlaufen längs der Seiten, aber in etwas ungerader Richtung. Die Unterseite ist rein weiß. Die Ohren sind rötlichgelb behaart, die schwarzen Schnurren endigen größtenteils in eine weiße Spitze. Der Schwanz ist oben schwarzbraun, unten gelblichbraun. Die Streifenmaus lebt in Nord- und Mittelafrika, besonders häufig in den Atlasländern, kommt jedoch auch in den inneren Steppen nicht selten vor. Ich beobachtete sie mehrmals in Kordofan, sah sie jedoch immer nur auf Augenblicke, wenn sie zwischen dem hohen Grase der Steppe dahinhuschte. In den Gehängen der Hügel gräbt sie sich Röhren, die zu einer tiefer liegenden Kammer führen; in dieser speichert sie sich im Herbst Vorräte, Kornähren und Gräser auf und zehrt von ihnen nach Bedürfnis bei kaltem oder nassem Wetter. Die beim Zernagen der Ähren abfallende Spreu wird zur Ausfütterung der Kammer benutzt. Früchte, namentlich Obstsorten, sind ihr ein gesuchter Leckerbissen.
Die letzte Sippe, die wir berücksichtigen können, enthält die Hamstermäuse ( Criceti), mehr oder weniger plump gebaute, meist auch große Mäuse mit gespaltenen Lippen, großen Backentaschen und drei Backenzähnen in jedem Kiefer.
Unser Hamster bildet mit noch etwa einem Dutzend gleichgestalteten und gleichgesinnten Tieren die bekannteste Sippe ( Cricetus); deren hauptsächlichste Kennzeichen liegen in dem plumpen, dicken Leibe mit dem sehr kurzen, dünnhaarigen Schwanze und den kurzen Gliedmaßen, von denen die Hinterfüße fünf, die Vorderfüße vier Zehen und eine Daumenwarze besitzen. Das Gebiß besteht aus sechzehn Zähnen, zwei Paar auffallend großen Nagezähnen und drei Backenzähnen in jeder Reihe, die einfach sind und eine höckerige Kaufläche haben. Getreidefelder in fruchtbaren Gegenden des gemäßigten Europa und Asien bilden die Aufenthaltsorte dieser Tiere. Hier graben sie sich tiefe Baue mit mehreren Kammern, in denen sie im Herbst Nahrungsvorräte aufspeichern, und in diesen Bauen bringen sie ihr Leben hin, dessen Lust und Leid wir kennenlernen, wenn wir das unseres einheimischen Hamsters erforschen.
Dieses leiblich recht hübsche, geistig aber um so häßlichere, boshafte und bissige Geschöpf ( Cricetus frumentarius) erreicht eine Gesamtlänge von ungefähr 30 Zentimeter, wovon auf den Schwanz etwa 5 Zentimeter kommen. Der Leib ist untersetzt, der Hals dick, der Kopf ziemlich zugespitzt; die häutigen Ohren sind mittellang, die Augen groß und hell, die Beine kurz, die Füße und Zehen zierlich, die lichten Krallen kurz; der Schwanz ist kegelförmig zugespitzt, aber etwas abgestutzt. Die dichte, glatt anliegende und etwas glänzende Behaarung besteht aus kürzeren und weichen Wollhaaren und längeren und steiferen, auch dünner stehenden Grannenhaaren. Gewöhnlich ist die Färbung des Oberkörpers ein lichtes Braungelb, das wegen der schwarzspitzigen Grannen ins Grauliche spielt. Die Oberseite der Schnauze und Augengegend sowie ein Halsband sind rotbraun, ein Fleck auf den Backen ist gelb, der Mund weißlich, die Unterseite, auch die Beine bis zu den Füßen herab und die Hinterbeine, wenigstens innen, sowie ein Streifen über der Stirn sind schwarz, die Füße dagegen weiß. Meist stehen noch gelbe Flecken hinter den Ohren und vor und hinter den Vorderbeinen. Es gibt aber die verschiedensten Spielarten: manche sind ganz schwarz, andere schwarz mit weißer Kehle, grauem Scheitel, die hellen Spielarten blaß graugelb mit dunkelgrauer Unterseite und blaßgelbem Schulterfleck, andere oben matt fahl, unten lichtgrau, an den Schultern weißlich: auch vollständige Weißlinge werden zuweilen gefunden.
Fruchtbare Getreidefelder vom Rhein bis an den Ob gewähren dem Hamster Aufenthalt und Nahrung. In Deutschland fehlt er in den südlich und südwestlich gelegenen Ländern und Provinzen, ebenso in Ost- und Westpreußen, ist dagegen häufig in Thüringen und Sachsen. Ein Boden, der mäßig fest, trocken und dabei fruchtbar ist, scheint die Hauptbedingung für sein Wohlbefinden zu sein. Er verlangt, daß die Baue, die er gräbt, dauerhaft sind, und meidet aus diesem Grunde alle sandigen Gegenden; aber er will sich auch nicht sehr anstrengen beim Graben und verschont deshalb sehr festen und steinigen Boden mit seinen Ansiedlungen. Gebirge und Waldungen meidet er, auch wasserreiche Niederungen liebt er nicht. Wo er vorkommt, tritt er manchmal in ganz unglaublichen Scharen auf.
Seine Baue bestehen aus einer großen Wohnkammer, die in einer Tiefe von 1 bis 2 Meter liegt, einer schrägen Ausgangs- und einer senkrechten Eingangsröhre. Durch Gänge steht diese Wohnkammer mit dem Vorratsraum in Verbindung. Je nach Geschlecht und Alter des Tieres werden die Baue verschieden angelegt, die junger Hamster sind die flachsten und kürzesten, die des Weibchens bedeutend größer, die des alten Rammlers die größten. Man erkennt den Hamsterbau leicht an dem Erdhaufen, der vor der Ausgangsröhre liegt und gewöhnlich mit Spreu und Hülsen bestreut ist. Das Falloch geht immer senkrecht in die Erde hinein, bisweilen so gerade, daß man einen langen Stock in dasselbe stecken kann; doch fällt es nicht in die Kammer ein, sondern biegt sich nach unten bald in wagrechter, bald in schiefer Richtung nach derselben hin. Das Schlupfloch dagegen läuft selten in gerader Richtung, sondern mehr gebogen der Kammer zu. An den Gängen kann man sehr leicht ersehen, ob ein Bau bewohnt ist oder nicht. Findet sich in ihnen Moos, Schimmel oder Gras, oder sehen sie auch nur rauh aus, so sind sie entschieden verlassen: denn jeder Hamster hält sein Haus und seine Haustür außerordentlich rein und in Ordnung. Länger bewohnte Gänge werden beim Aus- und Einfahren so durch das Haar geglättet, daß ihre Wände glänzen. Außen sind die Löcher etwas weiter als in ihrem Fortgange; dort haben sie meistens 5 bis 8 Zentimeter im Durchmesser. Unter den Kammern ist die glattwandige Wohnkammer die kleinere, auch stets mit sehr feinem Stroh, meistens mit den Scheiden der Halme angefüllt, die eine weiche Unterlage bilden. Drei Gänge münden in sie ein, der eine vom Schlupf-, der andere vom Falloch und der dritte von der Vorratskammer kommend. Diese ähnelt der ersten Kammer vollständig, ist rundlich oder eiförmig, oben gewölbt, inwendig glatt und gegen den Herbst hin ganz mit Getreide ausgefüllt. Junge Hamster legen bloß eine an, die alten aber, namentlich die Rammler, die den ganzen Sommer Hamster.
hindurch nur einschleppen, graben sich drei bis fünf solche Speicher, und hier findet man denn auch ebensoviele Metzen Frucht. Manchmal verstopft der Hamster den Gang vom Wohnzimmer aus zur Vorratskammer mit Erde, zuweilen füllt er ihn auch mit Körnern an. Diese werden so fest zusammengedrückt, daß der Hamstergräber, wenn er die Kammern ausbeuten will, sie gewöhnlich erst mit einem eisernen Werkzeug auseinanderkratzen muß. Selten sind sie ganz rein von Ährenhülsen oder Schalen. Wenn man in einem Bau die verschiedenen Getreidearten wirklich getrennt findet, rührt dies nicht von dem Ordnungssinn des Tieres her, sondern weil es zur betreffenden Zeit eben nur diese und dann nur jene Getreideart fand. In dem Gange, der nach dem Schlupfloch führt, weitet sich oft kurz vor der Kammer eine Stelle aus, wo der Hamster seinen Mist abzulegen Pflegt. Der Nestbau des Weibchens weicht in mancher Hinsicht von dem beschriebenen ab; er hat nur ein Schlupfloch, aber zwei bis acht Fallöcher, obgleich von diesen, solange die Jungen noch klein sind, gewöhnlich nur eins recht begangen wird. Das Wochenbett ist rundlich, hat ungefähr 3V Zentimeter im Durchmesser, ist 8 bis 13 Zentimeter hoch und besteht aus sehr weichem Stroh. Von der Nestkammer aus gehen zu allen Fallöchern besondere Röhren, manchmal verbinden auch wieder Gänge diese unter sich. Vorratskammern finden sich sehr selten im Nestbau; denn das Weibchen trägt, solange es Junge hat, nichts für sich ein.

Hamster ( Cricetus frumentarius)
Der Hamster ist trotz seiner scheinbaren Plumpheit ein ziemlich gewandtes Tier. Sein kriechender, dem des Igels ziemlich ähnlicher Gang, bei dem der Unterleib fast auf der Erde schleppt, besteht aus kleinen Schritten. Im Zorn bewegt er sich heftiger und vermag dann auch ziemlich weite Sprünge und hohe Sätze auszuführen. Wo er Widerhalt findet, namentlich an solchen Stellen, wo er sich auf beiden Seiten anstemmen kann, klettert er in die Höhe, in den Ecken von Kisten z. B. oder zwischen Schränken und der Wand, auch an Vorhängen klimmt er sehr rasch empor. Meisterhaft versteht er das Graben. Wenn man ihn in ein Faß mit Erde steckt, geht er augenblicklich ans Werk. Er bricht mit den Vorderfüßen oder, wenn der Grund hart ist, mit diesen und den Zähnen Erde los, wirft sie zuerst unter den Bauch, holt sie dann mit den Hinterbeinen hervor und schleudert sie hinter sich. Kommt er in die Tiefe, so schiebt er, rückwärtsgehend, ganze Haufen auf einmal heraus; niemals aber füllt er mit ihr seine Backentaschen an, wie fälschlich behauptet wurde. Im Wasser bewegt er sich nicht ungeschickt, obwohl er dasselbe ängstlich meidet. Wirft man ihn in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, so schwimmt er rasch umher, knurrt aber wütend dabei und beweist überhaupt, daß er sich höchst ungemütlich fühlt. Der Hamster ist mit seinen Vorderfüßen ungemein geschickt und versteht sie ganz wie Hände zu benutzen. Mit ihnen führt er die Nahrung zum Munde, mit ihnen hält und dreht er die Ähren, die er enthülsen will, um die Körner in seinen Backentaschen aufzuspeichern, und mit ihrer Hilfe bringt er auch seinen Pelz in Ordnung. Sobald er aus dem Wasser kommt, schüttelt er sich erst tüchtig ab, setzt sich sodann auf die Hinterbeine und beginnt nun eifrig zu lecken und zu putzen. Zuerst kommt der Kopf daran. Er legt beide Hände bis an die Ohren und zieht sie nach vorwärts über das Gesicht, wie er tut, wenn er sich sonst wäscht; dann nimmt er einen Haarbüschel nach dem andern und reibt ihn so lange zwischen den Händen, bis er den erforderlichen Grad von Trockenheit zu haben scheint. Die Haare der Schenkel und des Rückens weiß er auf sehr sinnreiche Art wieder zu ordnen. Er setzt sich dabei ans die Schenkel und den Hintern und leckt und kämmt mit den Zähnen und Pfoten gemeinschaftlich, wobei er letztere außerordentlich rasch von oben nach unten bewegt; die Hauptarbeit scheint hier aber mit der Zunge zu geschehen. Wenn er überrascht wird, erhebt er sich augenblicklich auf die Hinterbeine und läßt dabei die Vorderbeine herabhängen, eine Hand gewöhnlich etwas tiefer als die andere. So starrt er den Gegenstand, der ihn in Aufregung versetzte, scharf an, augenscheinlich bereit, bei einer sich bietenden Gelegenheit auf ihn loszufahren und von seinen Zähnen Gebrauch zu machen.
Die höheren Sinne des Hamsters scheinen ziemlich gleich ausgebildet zu sein; wenigstens bemerkt man nicht, daß der eine vor dem andern besonders entwickelt wäre. Die geistigen Eigenschaften sind nicht gerade geeignet, ihn zu einem Lieblinge des Menschen zu machen. Der Zorn beherrscht sein ganzes Wesen in einem Grade wie bei kaum einem andern Nager von so geringer Größe, Ratten oder Lemminge etwa ausgenommen. Bei der geringsten Ursache stellt er sich trotzig zur Wehre, knurrt tief und hohl im Innern, knirscht mit den Zahnen und schlägt sie ungemein schnell und heftig aufeinander. Ebenso groß wie sein Zorn ist auch sein Mut. Er wehrt sich gegen jedes Tier, das ihn angreift, und so lange, als er kann. Ungeschickten Hunden gegenüber bleibt er oft Sieger; nur die klugen Pintscher wissen ihn zu packen und schütteln ihn sodann fast augenblicklich zu Tode. Alle Hunde hassen den Hamster beinahe ebenso wie den Igel. »Sobald er merkt«, sagt Sulzer, »daß es ein Hund mit ihm zu tun haben will, leert er, wenn seine Backentaschen mit Getreide vollgestopft sind, solche erstlich aus; alsdann wetzt er die Zähne, indem er sie sehr geschwind aufeinander reibt, atmet schnell und laut, mit einem zornigen Ächzen, das sich mit dem Schnarchen eines Schlafenden vergleichen läßt, und bläst zugleich die Backentaschen dergestalt auf, daß der Kopf und Hals viel dicker aufschwellen als der hintere Teil des Leibes. Dabei richtet er sich auf und springt in dieser Stellung gegen seinen Feind in die Höhe, und wenn dieser weicht, ist er kühn genug, ihn zu verfolgen, indem er ihm wie ein Frosch nachhüpft. Die Plumpheit und Heftigkeit seiner Bewegungen sehen dabei so lustig aus, daß man sich des Lachens kaum erwehren kann. Der Hund wird seiner nicht eher Meister, als bis er ihm von hinten beikommen kann. Dann faßt er ihn sogleich bei dem Genick oder im Rücken und schüttelt ihn zu Tode.« Nicht allein gegen Hunde wehrt sich der Hamster, sondern greift auch kühn den Menschen an, selbst den, der gar nichts mit ihm zu schaffen haben mag. Es kommt nicht selten vor, daß man ruhig an einem Hamsterbaue vorübergeht und plötzlich das wütende Tier in seinen Kleidern hängen hat. An Pferden beißt er sich ebenfalls fest, und gegen Raubvögel, die ihn vom Boden erhoben, wehrt er sich noch in der Luft. Wenn er sich einmal eingebissen hat, hält er so fest, daß man ihn totschlagen kann, ehe er nachläßt.
Daß ein so jähzorniges Tier nicht verträglich sein kann, ist erklärlich. Die eigenen Kinder mögen nicht mehr bei der Mutter bleiben, sobald sie größer geworden sind; der männliche Hamster beißt den weiblichen tot, wenn er außer der Paarungszeit mit ihm zusammenkommt. In Gefangenschaft leben die Hamster nur selten miteinander in Frieden, alte wahrscheinlich niemals. Junge, die noch nicht ein Jahr alt sind, vertragen sich besser. Ich habe längere Zeit in einer Kiste drei Stück gehabt, die sich niemals zankten, sondern im Gegenteil recht verträglich beieinander hockten, meistens noch einer auf dem andern. Junge Hamster aus verschiedenen Nestern fallen aber augenblicklich übereinander her und beginnen den Kampf auf Leben und Tod. Äußerst lustig ist es, wenn man ihm einen Igel zur Gesellschaft gibt. Zuerst betrachtet er neugierig den sonderbaren Kauz, der seinerseits sich nicht viel um ihn kümmert und ruhig seines Weges geht. Doch die Ruhe wird bald gestört. Der Igel kommt zufällig in die Nähe seines Mitgefangenen, ein ärgerliches Grunzen begrüßt ihn, und erschreckt rollt er sich zur Kugel ein. Jetzt geht der Hamster auf Erforschungsreisen aus. Der Stachelballen wird berochen und – seine blutige Nase belehrt ihn gründlich von der Vielseitigkeit der Horngebilde. Wütend stößt er die Kugel von sich – o weh, auch die Hand ist verwundet! Jetzt wetzt er die Zähne, quiekt, faucht, hüpft auf den Ball, springt entsetzt wieder herab, versucht, ihn mit dem Rücken wegzuschieben, sticht sich in die Schulter, wird immer wütender, macht neue vergebliche Anstrengungen, des Ungeheuers sich zu entledigen, holt sich neue Stiche in Händen und Lippen und stellt sich endlich, mehr erstaunt als erbost, vor dem Stachelhelden auf die Hinterbeine und betrachtet ihn mit unendlich komischer Scheu und mit verbissener Wut, oder läßt diese an irgendwelchem Dinge aus, auch an einem ganz unschuldigen mitgefangenem Hamster, dem er die dem Igel zugedachten Bisse beizubringen sucht. Sooft der Igel sich rührt, geht der Tanz von neuem an, und der Beschauer möchte bersten vor Lachen.
Mit andern kleineren Tieren verträgt er sich natürlich noch weniger als mit seinesgleichen, ja, er macht förmlich Jagd auf solche; denn seine Nahrung besteht zum guten Teil auch aus lebenden Geschöpfen. Kleine Vögel, Mäuse, Eidechsen, Blindschleichen, Ringelnattern und Kerbtiere frißt er noch lieber als Pflanzenstoffe, und wenn man ihm einen lebenden Vogel in seinen Käfig wirft, springt er blitzschnell zu, zerbeißt ihm zuerst die Flügel, tötet ihn dann mit einem einzigen Biß in den Kopf und frißt ihn nun ruhig auf. Das Pflanzenreich muß ihm alles, was irgendwie genießbar ist, zur Nahrung liefern. Er verzehrt grüne Saat- und andere Kräuter, Hülsenfrüchte, Möhren, Kartoffeln u. dgl., auch Wurzeln von manchen Kräutern, sowie Obst, es mag unreif oder reif sein. In der Gefangenschaft nährt er sich auch von allerlei Gebackenem, wie Kuchen und Brot, von Butter, Käse usw., kurz, er zeigt sich als wahrer Allesfresser.
Auch der Hamster ist ein Winterschläfer. Er erwacht, sobald die Erde aufgetaut ist, oft schon im Februar, sicher im März. Anfangs öffnet er seine verstopften Löcher noch nicht, sondern hält sich still unten im Bau und zehrt von seinen eingetragenen Vorräten. Gegen die Mitte des März erschließen die alten Männchen, Anfang April die alten Weibchen das Falloch. Jetzt suchen sie sich bereits außen Nahrung, tragen auch von frischbesäten Ackerstücken, wo sie die Körner sorgfältig auflesen, Getreide in ihren Bau ein. Junge Pflanzen behagen ihnen bald mehr als die Körner, und nunmehr gehen sie dieser Nahrung nach oder nehmen ab und zu auch wohl ein ungeschicktes Vögelchen, eine Maus, einen Käfer, eine Raupe als willkommene Beute mit hinweg. Zu derselben Zeit pflegen sie sich einen neuen Bau zu graben, in dem sie den Sommer zu verleben gedenken, und sobald dieser fertig ist, paaren sich die Geschlechter. Der Sommerbau ist gewöhnlich nur 30, höchstens 60 Zentimeter tief, und der Kessel mit einem weichen Nest ausgefüttert, neben welchem dann eine einzige Kammer angelegt wird, falls es viel Saatgetreide in der Umgegend gibt. Ende April begeben sich die Männchen in die Behausung der Weibchen und leben, wie es scheint, friedlich einige Tage mit ihnen; beide zeigen sogar insofern eine gewisse Anhänglichkeit aneinander, als sie sich gegenseitig beistehen, wenn es gilt, eines oder das andere zu verteidigen. Kommen zwei Männchen zu einem Weibchen, so beginnt ein heftiger Zweikampf, bis der schwächere der Gegner unterliegt oder entweicht; man findet oft genug Rammler, die auf ihrem Leibe tiefe Narben tragen, die Zeichen von solchem Strauß in Liebessachen. Zum ersten Male gegen Ende des Mai, zum zweiten Male im Juli, wirst das Weibchen in seinem weich und warm ausgefütterten Nest sechs bis achtzehn Junge. Diese kommen nackt und blind zur Welt, bringen aber ihre Zähne schon mit, wachsen auch außerordentlich schnell. Unmittelbar nach der Geburt, nachdem sie abgetrocknet sind, sehen sie fast blutrot aus und lassen ein Gewimmer vernehmen, wie es kleine Hunde auszustoßen pflegen. Sie erhalten mit dem zweiten oder dritten Tage ein feines Flaumhaar, das sich aber bald verdichtet und den ganzen Körper einhüllt. Ungefähr mit dem achten oder neunten Tage ihres Lebens öffnen sie die Augen und beginnen nun auch im Neste umherzukriechen. Die Mutter behandelt ihre Brut mit viel Liebe, duldet es auch, daß man ihr andere Junge zum Säugen anlegt, selbst wenn diese nicht die gleiche Größe wie ihre Kinder haben. Am vierzehnten Tage ihres Alters fangen die jungen Hamster schon zu wühlen an, und sobald sie dies können, denkt die unfreundliche Alte daran, sie selbständig zu machen, d. h. sie jagt sie einfach aus dem Bau und zwingt sie, auf eigene Faust für ihren Unterhalt zu sorgen. Dies scheint den Hamsterchen nicht eben schwer zu werden; denn bereits mit dem fünften oder sechsten Tage, wenn sie kaum behaart und noch vollständig blind sind, wissen sie recht hübsch ein Weizenkorn zwischen ihre Vorderpfötchen zu fassen und die scharfen Zähnchen zu benutzen. Bei Gefahr huschen die kleinen Tierchen, so erbärmlich sie aussehen, behend im Bau umher, und das eine hat sich bald aufs geschickteste in diesem, das andere in jenem Winkel zu verbergen gewußt, wenn auch die meisten der Alten nachgefolgt sind. Diese, sonst so wütend und boshaft, so mutig und tapfer, zeigt sich feig, wenn es gelten sollte, ihre Brut zu verteidigen, entflieht auf erbärmliche Weise, sobald sie spürt, daß man ihr oder jenen nahe kommt, und verkriecht sich mit ihren Sprößlingen in das blinde Ende eines Ganges, den sie so schnell als möglich nach dem Nest zu mit Erde zu verstopfen sucht, oder mit erstaunlicher Geschicklichkeit und Schnelligkeit weitergräbt. Die Jungen folgen ihr durch Dick und Dünn, durch den Hagel von Erde und Sand, den sie hinter sich wirft. Doch brauchen sie immer ein ganzes Jahr, ehe sie ihre vollständige Größe erreichen.
Sobald die Felder sich gilben und die Körner reifen, haben die Hamster viel zu tun mit der Ernte. Jeder einzelne schleppt, falls er es vermag, bis zu einem Zentner an Körnern in seinen Bau. Leinknoten, große Puffbohnen und Erbsen scheinen allen übrigen Früchten vorgezogen zu werden. Ein Hamster, der in einem Flachsstück liegt, wird nicht leicht etwas anderes einernten als die Knollen davon; ebenso ist es im Erbsenfelde; doch wissen sich die Tiere recht wohl in andere Arten von Feldfrüchten zu schicken. Man hat beobachtet, daß die alten Rammler, die Zeit genug haben, das Getreide auslesen, es viel sorgfältiger aufschichten als die Hamsterweibchen, die nach der letzten Brut noch rasch einen Bau graben und hier die Speicher füllen müssen. Nur wo der Hamster ganz ungestört ist, verrichtet er seine Ernte bei Tage; gewöhnlich ist die erste Hälfte der Nacht und der Morgen vor Sonnenaufgang seine Arbeitszeit. Er biegt mit den Vorderhänden die hohen Halme um, schneidet mit einem Biß die Ähre ab, faßt sie mit den Pfoten, dreht sie ein paarmal hin und her und hat sie nun nicht bloß entkörnt, sondern die Körner auch gleich in den Backentaschen geborgen. So werden die weiten Schleppsäcke gefüllt bis zum Übermaß; manchmal schafft einer bei fünfzig Gramm Körner auf einem Gange nach Hause. Ein so beladener Hamster sieht höchst spaßhaft aus und ist das ungeschickteste Tier der Welt. Man kann ihn mit den Händen ohne Furcht anfassen; denn die vollgepfropften Taschen hindern ihn am Beißen; nur darf man ihm nicht Zeit lassen, sonst streicht er die Körner heraus und setzt sich in Verteidigungszustand.
Anfangs Oktober, wenn es kalt wird und die Felder leer sind, denkt der Hamster ernstlich daran, sich seine Winterwohnung herzurichten. Zuerst verstopft er das Schlupfloch von der Kammer an bis oben hinauf so dicht als möglich mit Erde, dann vermauert er sein Falloch, und zwar von innen heraus, manchmal nicht ganz bis zur Oberfläche der Erde. Hat er noch Zeit oder fürchtet er den Frost, so gräbt er sich ein tieferes Nest und tiefere Kornkammern als bisher und speichert hier seine Vorräte auf. Das Lager ist sehr klein und wird mit dem feinsten Stroh dicht ausgepolstert. Nunmehr frißt sich der faule Gauch fett und legt sich endlich zusammengerollt zum Schlafen nieder. Gewöhnlich liegt er auf der Seite, den Kopf zwischen den Hinterbeinen an den Bauch gedrückt. Alle Haare befinden sich in der schönsten Ordnung, stehen aber etwas steif vom Körper ab. Die Glieder fühlen sich eiskalt an und lassen sich schwer beugen, schnellen auch, wenn man sie gewaltsam gebogen hat, wie bei toten Tieren, sofort wieder in die frühere Lage zurück; die Augen sind geschlossen, sehen aber hell und klar aus wie beim lebenden und schließen sich auch von selbst wieder. Ein Atemholen oder ein Herzpochen fühlt man nicht. Das ganze Tier stellt ein lebendes Bild des Todes dar. Gewöhnlich schlägt das Herz in der Minute vierzehn- bis fünfzehnmal. Vor dem Aufwachen bemerkt man zunächst, daß die Steifigkeit nachläßt. Dann fängt der Atem an, es folgen einige Bewegungen; der Schläfer gähnt und gibt einen röchelnden Laut von sich, streckt sich, öffnet die Augen, taumelt wie betrunken umher, versucht, sich, zu setzen, fällt um, richtet sich von neuem auf, besinnt sich und läuft endlich langsam umher, frißt auch sofort, wenn man ihm etwas vorwirft, putzt und streichelt sich und ist endlich ganz munter. Übrigens muß man sich immer vorsehen, wenn man einen solchen Erweckungsversuch mit einem Hamster macht; denn der scheinbar ganz Leblose belehrt einen manchmal in der allerempfindlichsten Weise, daß er nicht tot ist. Auch im Freien müssen die Hamster mitten im Winter aufwachen; denn zuweilen öffnen sie ihre Löcher im Dezember bei einer Kälte von mehreren Graden unter Null und laufen ein wenig auf den Feldern umher. In einer Stube, die beständig geheizt wird, kann man sie das ganze Jahr hindurch wach erhalten; sie befinden sich aber doch nicht wohl und sterben bald.
Es ist ein wahres Glück, daß der Hamster, der sich zuweilen wahrhaft furchterweckend vermehrt und dann ungeheuren Schaden anrichtet, so viele Feinde hat. Bussarde und Eulen, Raben und manche andere Vögel, vor allem aber Iltis und Wiesel, sind ununterbrochen auf seiner Fährte und töten ihn, wo und wann sie können. Der Iltis und das große Wiesel folgen ihm auch in seine unterirdischen Wohnungen und müssen deshalb als die schlimmsten aller seiner Feinde angesehen werden. Diesen gewandten Räubern muß der bissige Nager regelmäßig erliegen, obgleich es ohne heftige Kämpfe nicht abgeht. Jeder Landwirt müßte diese beiden nützlichen Raubtiere, wenn er seinen Vorteil erkennen wollte, nach allen Kräften schonen und hegen und pflegen; statt dessen aber schlägt der unwissende Bauer jeden Iltis und jedes Wiesel ohne Gnade und Barmherzigkeit nieder, gewöhnlich ohne zu wissen, warum.
In einigen Gegenden zieht der Mensch regelrecht gegen den Hamster zu Felde. In Thüringen z. B. gibt es Leute, die sich ein Geschäft daraus machen, die Hamster auszugraben und umzubringen. Daß Mühe und Arbeit dieser Leute vergeblich, sondern ebenso ersprießlich als lohnend ist, geht aus einer Angabe von Lenz hervor. Auf der zwölftausend Acker umfassenden Stadtflur von Gotha wurden in zwölf Jahren über eine Viertelmillion Hamster erbeutet und an die Stadtbehörde zur Einlösung abgeliefert. Alle Gemeinden in von Hamstern bevölkerten Gegenden pflegen für jeden eine Kleinigkeit zu zahlen, für einen Rammler und einen Jungen weniger, für ein Weibchen mehr. Den Hauptgewinn der Jagd aber bilden die Vorräte, die dieses eigentümliche Wild sich eingetragen hat; die Leute waschen die Körner einfach ab, trocknen sie wieder und vermahlen sie dann wie anderes Getreide. Auch die Felle werden benutzt, obgleich noch nicht in der Ausdehnung, als sie es verdienen; denn nach allen Erfahrungen geben sie ein ganz vortreffliches, leichtes und dauerhaftes Pelzwerk. In manchen Gegenden wird das Fleisch der Hamster gegessen, und es ist auch wirklich nicht der geringste Grund vorhanden, gegen solche Nahrung etwas einzuwenden; denn das Fleisch ist jedenfalls ebenso gut, wie das des Eichhörnchens oder anderer Nager, deren Wildbret man mit Behagen verzehrt.
*
Die Familie der Wühlmäuse ( Arvicolina) umfaßt eine erhebliche Anzahl von kleinen, einander sehr ähnlichen Nagetieren, die noch vielfach an die Mäuse erinnern und ihnen deshalb früher untergeordnet wurden. Äußerlich unterscheiden sie hauptsächlich der plumpe Körperbau, der dicke Kopf, die ganz versteckten oder nur wenig aus dem Kopfhaar hervorragenden Ohren und der kurze Schwanz, der höchstens zwei Drittel der Körperlänge erreicht. Hierzu treten noch Eigentümlichkeiten des Knochengerüstes. Der Schädel ist am Stirnteil sehr verengt, der Jochbogen weit abstehend. Die Wühlmäuse bewohnen den Norden der Alten und Neuen Welt, fehlen daher in Australien. Sie leben ebensowohl in der Ebene wie im Gebirge, auf bebautem Lande wie auf ziemlich wüstem, auf Feldern, Wiesen, in Gärten, an den Ufern von Flüssen, Bächen, Seen, Teichen und wohnen in selbstgegrabenen Höhlen und Löchern. Fast alle meiden die Nähe des Menschen.
Die Bisamratte oder Ondatra ( Fiber zibethicus) bildet gleichsam einen Übergang von den Bibern zu den Wühlmäusen. Man kann sie als eine große Wasserratte mit langem Schwanze, breiten Hinterfüßen, stumpfer Schnauze und kurz behaarten und verschließbaren Ohren bezeichnen. Der Schwanz ist nur hinten gerundet, übrigens seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende zweischneidig und mit kleinen Schuppen besetzt, zwischen denen an den Seiten, diese besäumend, kurze, ziemlich dünnstehende, aber glatt anliegende Härchen hervortreten. In der Nähe der Geschlechtsteile befindet sich eine Drüse von der Größe einer kleinen Birne, die nach außen mündet und eine weiße, ölige, sehr stark nach Zibet riechende Flüssigkeit absondert. Das Fell ist dicht, glatt anliegend, weich und glänzend; die Oberseite hat braune, bisweilen gelbliche Färbung, die Unterseite ist grau, hier und da rötlich angeflogen, der Schwanz schwarz. Häufiger kommen Weißlinge vor. Erwachsene Männchen werden etwa 58 Zentimeter lang, wovon auf den Schwanz ungefähr die Hälfte kommt.
Die Ondatra bewohnt die zwischen dem 30. und 69. Grade nördlicher Breite gelegenen Länder Nordamerikas. Am häufigsten findet sich das Tier in dem wasserreichen Kanada. Die grasigen Ufer größerer Seen oder breiter, langsam strömender Flüsse, stiller Bäche und Sümpfe, am liebsten aber nicht allzu große, mit Schilf und Wasserpflanzen bedeckte Teiche, bilden die Aufenthaltsorte der als Pelztier geschätzten Ratte. Hier bewohnt sie familien- oder volkweise eine bestimmte Stelle und bildet mit anderen ihrer Art ziemlich feste Verbindungen. In ihrer Lebensweise ähnelt sie in mancher Hinsicht dem Biber; die Indianer nennen deshalb beide Tiere Brüder und behaupten, daß der Biber der ältere und gescheitere, die Bisamratte aber der dümmere sei. Die Baue sind, wie bei dem Biber, entweder einfache Kessel unter der Erde mit mehreren Ausgangsröhren, die sämtlich unter Wasser münden, oder Burgen über der Erde. Letztere, die vorzüglich im Norden angelegt werden, sind rund und kugelförmig oder kuppelartig und stehen auf einem Schlammhaufen, so daß sie den Wasserspiegel überragen. Ihre Wandungen werden aus Schilf, Riedgräsern und Binsen hergestellt und mit Schlamm gekittet; doch behaupten einige Beobachter, daß die ganze Hütte nur aus Schlamm bestände und nach und nach mit einer dünnen Schicht von angetriebenem Grase und Binsen sich bedecke. Im Innern enthält die Burg eine einzige Kammer von 40 bis 69 Zentimeter Durchmesser. Zu ihr führt eine Röhre, die auf dem Boden des Wassers mündet. Andere, blinde Röhren laufen von ihr aus und gehen ein Stück unter der Erde fort, werden auch nach Umständen mehr oder weniger verlängert; denn sie dienen eigentlich bloß dazu, um die Wurzeln der Wassergewächse einzuernten. Im Winter füttert die Ondatra ihre Kammern mit Wasserlilien, Blättern, Gräsern und Schilf weich aus und sorgt, nach Audubon, dadurch für Luftwechsel, daß sie die Kuppelmitte ihrer Hütte mit lose zusammengeschichteten Pflanzen bedeckt, die eben genug frische Luft zu- oder die verbrauchte ablassen. Solange der Sumpf oder Teich nicht bis auf den Grund ausfriert, lebt sie höchst behaglich in der warmen, durch die dicke, über ihr liegende Schneedecke noch besonders geschützten Wohnung. Dringt die Kälte so tief ein, daß der Bisamratte freier Ausgang verwehrt wird, so leidet sie erheblich von dem Ungemach der Verhältnisse, und manchmal gehen viele Hunderte einer Ansiedlung zugrunde, weil es ihnen nicht gelingt, Atmungslöcher durch die Eisdecke zu brechen und diese durch Auskleidung von Schlamm für längere Zeit offen zu erhalten.
Richardson, der diese Angaben über die Baue macht, fügt hinzu, daß nur in sehr strengen Wintern die Tiere in wirkliche Not geraten; denn sie bauen meist in tiefere Sümpfe und Teiche oder in die Nähe von Quellen, wo das Wasser nicht zufriert. Ist der Grund, auf dem der Bau errichtet werden soll, zu tief, so wird er durch Anhäufung von Schlamm und Erde erhöht, ist er zu seicht, besonders ausgegraben. Dabei hält die Ondatra immer darauf, daß sie auch zu Zeiten der Überschwemmung gesichert ist und in der Nähe etwas zu fressen hat. Deshalb wählt sie am liebsten Gewässer, die einen möglichst gleichmäßigen Stand haben und reich an Gewächsen sind.
Die Nahrung besteht fast ausschließlich in Wasserpflanzen, obgleich man in den Bauen von mehreren auch ausgeflossene Muschelschalen gefunden hat. An Gefangenen beobachtete Audubon, daß sie Muscheln sehr gern verzehrten. Die weichschaligen wußten sie mit scharfen Bissen zu öffnen, bei den hartschaligen warteten sie, bis sie sich selbst aufschlössen, fuhren dann schnell zu und töteten durch Bisse den Bewohner des festen Gehäuses. Wenn in der Nähe einer Ansiedlung Gärten und andere Pflanzungen liegen, erhalten diese oft Besuch von Biberratten und werden dann in empfindlicher Weise gebrandschatzt. Auch diese Wühlmäuse verwüsten weit mehr, als sie verzehren, weil sie zwischen den Wurzeln tiefe Höhlen graben und außer den Pflanzen, die sie abbeißen, noch viele entwurzeln und umwerfen.
Man lockt die Biberratte in Fallen, die man mit Äpfeln ködert, stellt Schlageisen vor ihre Baue oder tötet sie in ihren Hütten. Die Indianer wissen sehr genau, welche Hütten bewohnt sind, nahen sich unhörbar und stoßen einen scharfen Speer mit aller Kraft durch die Wände der Burg, die innensitzenden Zibetratten gewöhnlich anspießend. Die Fallen stellt man so, daß sie ins Wasser stürzen müssen, um die Gefangenen zu ersäufen.
*
An die Bisamratten können wir die Wühlratten ( Arvicola) anreihen. Unter den Mitgliedern der Sippe macht sich uns keines mehr bemerklich und verhaßt als die Wasserratte oder Schermaus ( Arvicola terrestris, einer der schädlichsten deutschen Nager, ein den Naturforschern wohlbekanntes Tier und noch heute der Zankapfel zwischen ihnen. Die einen behaupten nämlich, daß es nur eine Art von Wasserratten gäbe, die andern nehmen an, daß die Scher-, Woll- oder Reutmaus, die allen Gartenbesitzern nur zu bekannt zu sein pflegt, wegen ihrer verschiedenen Lebensweise, trotz ihrer großen Ähnlichkeit mit der Wasserratte, als selbständige Art betrachtet werden müsse.
Auffallend bleibt die Verschiedenheit der Lebensweise eines und desselben Tieres immerhin. Die Wasserratte lebt, wie ihr Name sagt, am und im Wasser, namentlich an stillstehendem, wohnt hier in selbstgegrabenen unterirdischen Bauen, die vom Wasserspiegel aus schief nach oben ansteigen und in einen weiten Kessel münden, und ihr eigentliches Wohnzimmer geht von hier aus gewöhnlich nach dem Wasser hinab; sie treibt sich in diesem umher, sucht hier ihre Nahrung und denkt nicht daran, größere Reisen zu unternehmen; die Schermaus dagegen lebt unter Umständen wochen- und monatelang fern vom Wasser und scheint sich wenig um dasselbe zu bekümmern, gräbt lange, flache Gänge nach Maulwurfsart, wirft dabei die Pflanzen um, die über den Gängen stehen, verzehrt die Wurzeln und schadet dadurch weit mehr, als der Maulwurf jemals durch seine Wühlereien schaden kann.
Der Gegenstand des Streites ist 21 bis 24 Zentimeter lang, wovon auf den Schwanz 6,5 bis 8,3 Zentimeter kommen. Der Pelz kann einfarbig genannt werden; denn die graubraune oder braunschwarze Oberseite geht allmählich in die etwas hellere, weißliche oder graue bis schwarze oder schwarzgraue Unterseite über. Von der Hausratte unterscheidet die Wasserratte sofort der dicke, runde, kurze Kopf mit auffallend kurzen, nicht aus dem Pelze hervortretenden, kaum ein Viertel der Kopfeslänge erreichenden Ohren und der kurze Schwanz, der zwischen 130 und 140, ringsum gleichmäßig und ziemlich dicht mit kurzen, steifen Haaren besetzte Schuppenringe trägt. Mancherlei Abweichungen in der Färbung kommen vor. Die Wasserratte ist sehr weit verbreitet und eigentlich nirgends selten. Ihr Wohngebiet reicht vom Atlantischen bis zum Ochotskischen, vom Weißen bis zum Mittelländischen Meere, und sie findet sich ebensowohl in der Ebene wie in gebirgigen Gegenden, kommt selbst im Hochgebirge vor.
Wasserratten und Schermäuse erinnern in ihrer Lebensweise vielfach an die Maulwürfe, aber auch an die Bisamratten und andere im Wasser lebende Nager. Die Baue in der Nähe der Gewässer sind regelmäßig einfacher als die in trockneren Gärten und Feldern. Dort führt, wie bemerkt, ein schiefer Gang zu der Kammer, die zu Zeiten sehr weich ausgefüttert wird, hier legen sich die Tiere Gänge an, die viele hundert Schritte lang sein können, werfen Haufen auf, wie die Maulwürfe, und bauen die Kammer in einem der größeren Hügel. Meist ziehen sich die langen Gänge dicht unter der Oberfläche des Bodens dahin, höchst selten tiefer, als die Pflanzenwurzeln hinabreichen, oft so flach, daß die Bodendecke beim Wühlen förmlich emporgehoben wird und die Bedeckung des Ganges aus einer nur zwei bis drei Zentimeter dicken Erdschicht besteht. Solche Gänge werden sehr oft zerstört und unfahrbar gemacht; aber die Schermaus ist unermüdlich, sie auszubessern, selbst wenn sie die gleiche Arbeit an einem Tage mehrere Male verrichten müßte. Manchmal laufen ihre Gänge unter einem Fahrwege hin und dauern eben nur so lange aus, als der Weg nicht benutzt wird; gleichwohl ändert das Tier die einmal gewählte Richtung nicht, sondern verrichtet lieber ununterbrochen dieselbe Arbeit. Man kann die Gänge von denen des Maulwurfs leicht dadurch unterscheiden, daß die Haufen viel ungleichmäßiger sind, größere Erdbrocken haben, nicht in einer geraden Reihe fortlaufen und oben niemals offen gelassen werden. In diesen Bauen lebt die Schermaus paarweise; aber ein Paar wohnt gern dicht neben dem andern. Das Tier läuft nicht besonders schnell, gräbt jedoch vorzüglich und schwimmt mit großer Meisterschaft, wenn auch nicht so ausgezeichnet wie die Wasserspitzmaus. An stillen Orten steht man sie ebensowohl bei Tage wie bei Nacht in Tätigkeit; doch ist sie vorsichtig und entflieht, sowie sie sich beobachtet sieht, in ihren Bau. Nur wenn sie sich zwischen dem Schilfe umhertreibt, läßt sie sich leicht beobachten.
Unter ihren Sinnen scheinen namentlich Gesicht und Gehör vortrefflich ausgebildet zu sein. Ihr geistiges Wesen unterscheidet sie zu ihrem Vorteile von den Ratten. Sie ist neugierig, sonst aber beschränkt und ziemlich gutmütig. Ihre Nahrung wählt sie vorzugsweise aus dem Pflanzenreiche, und dadurch wird sie oft überaus schädlich, zumal wenn sie in Gärten ihren Wohnsitz ausschlägt. Ungeachtet ihrer Neugier läßt sie sich nicht so leicht vertreiben, und wenn sie sich einmal eingenistet hat, geht sie freiwillig nicht eher weg, als bis sie alles Genießbare aufgefressen hat. »Einst«, erzählt mein Vater, »hatte sich eine Schermaus in dem hiesigen Pfarrgarten angesiedelt. Ihre Wohnung lag in einem Wirsingbeete, aber so tief, daß man das ganze Beet hätte zerstören müssen, wenn man sie dort hätte ausgraben wollen. Mehrere Gänge führten von der Kammer aus in den Garten. Wenn es besonders still war, kam sie hervor, biß ein Kohlblatt ab, faßte es mit den Zähnen, zog es zum Loche hinein und verzehrte es in ihrer Höhle. Den Bäumen fraß sie die Wurzeln ab, und zwar selbst solche, die bereits eine ziemliche Größe erlangt hatten. Ich hatte auf einem Feldrosenstamme Weiße Rosen okulieren lassen und zu meiner Freude in dem einen Jahre 153 Stück Rosen an dem Stamme erblühen sehen. Plötzlich verdorrte er, und als ich nachgrub, fand ich, daß alle Wurzeln nicht nur ihrer Schale beraubt, sondern fast ganz durchgefressen waren. Man kann sich leicht denken, wie sehr diese Verwüstungen meinen Haß gegen das böse Tier vermehrten. Aber es war sehr schwer, die Maus zu erlegen. Ich sah sie täglich vom Fenster aus meine Kohlstöcke brandschatzen; allein von dort aus war es zu weit, um sie zu erschießen, und sobald sich jemand sehen ließ, verschwand sie zur Erde. Erst nach vierzehn Tagen gelang es, sie zu erlegen, und zwar von einem ihretwegen angelegten Hinterhalte aus. Sie hatte mir aber bis dahin fast den ganzen Garten verwüstet.«
An Teichen tut die Wasserratte verhältnismäßig viel weniger Schaden, den einen freilich abgerechnet, daß sie die Dämme durchwühlt und so dem Wasser einen unerwünschten Ausfluß verschafft. Dort besteht ihre Nahrung vorzugsweise aus Rohrstengeln. Neben diesen verzehren die an Teichen wohnenden Wasserratten allerlei Pflanzenwurzeln und saftige Gräser, unter Umständen auch Früchte; die Reut- und Schermäuse aber gehen alle Gemüse ohne Unterschied an und vernichten weit mehr, als sie wirklich brauchen.»Es sind Beispiele bekannt,« sagt Blasius, »daß durch dieses Tier in einzelnen Feldern und Feldmarken über die Hälfte der Getreideernte umgekommen ist. Sie fressen die Halme über der Wurzel ab, um die Ähre zum Falle zu bringen; doch holen sie, als geschickte Kletterer, ebenso die Maiskörner aus den Ähren oder reifes Obst vom Spalier und den Bäumen herab. Tierische Nahrung verschmähen sie auch nicht. Im Wasser müssen Kerbtiere und deren Larven, kleine Frösche, Fische und Krebse ihnen zur Mahlzeit dienen, auf dem Lande verfolgen sie Feld- und andere Mäuse, den im Grase brütenden Vögeln nehmen sie die Eier weg, den Gerbern fressen sie ganze Stücke von den eingeweichten Tierhäuten ab usw. Im Herbste erweitern sie ihren Bau, indem sie eine Vorratskammer anlegen und diese durch Gänge mit ihrem alten Nest verbinden. Die Kammer füllen sie aus nahe gelegenen Gärten und Feldern mit Erbsen, Bohnen, Zwiebeln und Kartoffeln an und leben hiervon während des Spätherbstes und Frühjahres oder solange das Wetter noch gelinde ist.
Erst bei starkem Froste verfallen sie in Schlaf, ohne jedoch dabei zu erstarren. Nur selten gewahrt man die Fährte einer Wasserratte oder Schermaus auf dem Schnee; in der Regel verläßt sie den Bau während der kälteren Jahreszeit nicht.«
Die Vermehrung der Wasserratten und Schermäuse ist bedeutend. Drei- bis viermal im Jahre findet man in dem unterirdischen warmen, weich ausgefütterten Neste zwei bis sieben Junge, oft in einem Neste solche von verschiedener Färbung zusammen. »Die Tiefe der Erdhöhle, in der das Nest errichtet wird,« sagt Landois, »schwankt zwischen 30 bis 60 Zentimeter. Zu derselben führen stets mehrere Gänge. Das Nest selbst füllt die Erdhöhle vollständig aus, ist kugelig, hat einen Durchmesser von 15 bis 20 Zentimeter und besteht aus einer Unzahl äußerst feiner trockener Wurzelfäserchen. Dickere Wurzelfasern und Wurzeln werden beim Baue vermieden und somit ein Nest hergestellt, das in bezug auf seine Weiche und Wärme viele Vogelnester beschämen könnte.« Zuweilen findet man die Nester in dichtem Gestrüpp unmittelbar über der Erde, manchmal auch im Rohre.
Der Begattung gehen lang anhaltende Spiele beider Geschlechter voraus. Namentlich das Männchen benimmt sich sehr eigentümlich. Es dreht sich manchmal so schnell auf dem Wasser herum, daß es aussieht, als ob es von einer starken Strömung bald im Wirbel bewegt, bald herumgewälzt würde. Das Weibchen scheint ziemlich gleichgültig zuzusehen, erfreut sich aber doch wohl sehr an diesen Künsten; denn sobald das liebestolle Männchen mit seinem Reigen zu Ende ist, schwimmen beide gewöhnlich gemütlich nebeneinander, und dann erfolgt fast regelmäßig die Begattung. Die Mutter pflegt ihre Kinder mit warmer Liebe und verteidigt sie bei Gefahr. Wenn sie die Kleinen in dem einen Neste nicht für sicher hält, schleppt sie dieselben im Maule nach einer anderen Höhle und schwimmt dabei mit ihnen über breite Flüsse und Ströme. Die eigene Gefahr vergessend, läßt sie sich zuweilen mit der Hand erhaschen; aber nur mit Mühe kann man dann das Junge, das sie trägt, ihren Zähnen entwinden.
Die gefährlichsten Feinde der Schermaus sind Hermelin und Wiesel, weil diese in die unterirdischen Gänge und selbst in das Wasser nachfolgen. Beim Verlassen ihrer Röhren wird sie auch vom Waldkauze und von der Schleiereule, dem Iltis und der Katze erbeutet; im allgemeinen aber ist sie gegen die Räuber ziemlich gesichert und fordert um so dringender unnachsichtliche Verfolgung von seiten des Menschen heraus. Fallen oder eingegrabene große Töpfe, deren glatte Wände ihr, wenn sie bei ihren nächtlichen überirdischen Spaziergängen hineingefallen ist, das Entkommen unmöglich machen, schützen ebenfalls wenig gegen sie, weil sie beide möglichst vermeidet, und so bleibt nur ein Mittel zur Abwehr übrig. Dieses besteht darin, ihre Gänge zu öffnen, so daß Licht und Luft in dieselben fällt. »Schon einige Minuten nachdem dies geschehen«, sagt Schacht, frühere Angaben von Landois bestätigend, »kommt sie herbei, steckt neugierig den Kopf zur Tür heraus, schlüpft wieder zurück und fängt bald darauf an, unter der eröffneten Röhre eine neue zu graben. Um sie hervorzulocken, legt man ihr auch wohl eine Petersilienwurzel, ihre Lieblingsspeise, vor die Öffnung. Beim Hervorkommen bläst man ihr das Lebenslicht aus.«
Das für uns neben der Wasserratte wichtigste Mitglied der Sippe der Wühlratten ist die Feldmaus ( Arviola arvalic) ein Tierchen von 14 Zentimeter Gesamt- oder 11 Zentimeter Leibes- und 3 Zentimeter Schwanzlänge. Der Pelz ist undeutlich zweifarbig, auf der Oberseite gelblichgrau, an den Seiten heller, auf der Unterseite schmutzig rostweißlich; die Füße sind reiner weiß.
Ganz Mittel- und ein Teil von Nordeuropa sowie der westliche Teil von Mittel- und Nordasien sind die Heimat dieses kleinen und für den menschlichen Haushalt so überaus bedeutsamen Geschöpfes. In Europa reicht die Feldmaus bis in die nördlichen Provinzen Rußlands, in Asien südlich bis nach Persien, westlich bis jenseits des Ob. Sie gehört ebensowohl der Ebene wie dem Gebirge an, obgleich sie im Flachlande häufiger auftritt. In den Alpen steigt sie bis 2000 Meter über das Meer empor. Baumleere Gegenden, Felder und Wiesen, seltener Waldränder und Waldblößen sind ihre bevorzugten Wohnplätze, und nicht allein das trockene, bebaute Land, sondern auch die feuchten Sumpfniederungen müssen ihr Herberge geben. Hier legt sie sich in den trockenen Bülten ihre Gänge und Nester an, dort baut sie sich seichte Gänge mit vier bis sechs verschiedenen Eingangslöchern, die außen durch niedergetretene, vertiefte Wege verbunden werden. Im Herbste zieht sie sich unter Getreidehaufen zurück oder kommt in die Wohnungen, in Scheuern, Ställe und Keller. In den Häusern lebt sie vorzugsweise in den Kellern, nicht auf dem Boden wie die eigentlichen Mäuse. Im Winter gräbt sie lange Gänge unter dem Schnee. Sie sammelt, wo sie kann, Vorräte ein, namentlich Getreide und andere Sämereien; bei eintretendem Mangel aber wandert sie gesellig aus, gewöhnlich bloß nach einem benachbarten Felde, zuweilen aber auch scharenweise aus einer Gegend in die andere, und setzt dabei über Bergrücken oder schwimmend über breite Flüsse. Sie läuft gut, schwimmt vortrefflich, klettert aber wenig und unbeholfen. Das Graben versteht sie meisterhaft. Sie wühlt schneller als irgend eine andere Maus und scheint im Höhlenbauen unermüdlich zu sein. Ihrer Lebensweise nach ist sie fast ebensosehr Tag- als Nachttier. Man sieht sie auch während des heißesten Sonnenbrandes außerhalb ihrer Baue, obschon sie die Morgen- und Abendzeit dem heißen Mittage vorzuziehen scheint. Wärme und Trockenheit sind für sie Lebensbedingungen; bei anhaltender Feuchtigkeit geht sie zu Grunde.
Ihre Nahrung besteht aus allen möglichen Pflanzenstoffen. Wenn sie Sämereien hat, wählt sie nur diese, sonst begnügt sie sich auch mit frischen Gräsern und Kräutern, mit Wurzeln und Blättern, mit Klee, Früchten und Beeren. Bucheckern und Nüsse, Getreidekörner, Rüben und Kartoffeln werden arg von ihr heimgesucht. Wenn das Getreide zu reifen beginnt, sammelt sie sich in Scharen auf den Feldern, beißt die Halme unten ab, bis sie umstürzen, nagt sie dann oben durch und schleppt die Ähren in ihre Baue. Während der Ernte folgt sie den Schnittern auf dem Fuße von den Winter- zu den Sommerfeldern nach, frißt die ausgefallenen Körner zwischen den Stoppeln auf, trägt die beim Binden der Garben verlorenen Ähren zusammen und findet sich zuletzt noch auf den Hagefeldern ein, auch dort noch Vorräte für den Winter einsammelnd. In den Wäldern schleppt sie die abgefallenen Hagebutten und Wacholderbeeren, Bucheckern, Eicheln und Nüsse nach ihrem Baue. Während der rauhesten Jahreszeit verfällt sie in einen ununterbrochenen Winterschlaf; bei gelinder Witterung erwacht sie wieder und zehrt dann von ihren Vorräten. Sie ist unglaublich gefräßig und bedarf sehr viel, um sich zu sättigen, kann auch das Wasser nicht entbehren.
Im hohen Grade gesellig, lebt die Feldmaus ziemlich einträchtig mit ihresgleichen, mindestens paarweise zusammen, häufiger aber in großen Scharen, und deshalb sieht man Bau an Bau gereiht. Ihre Vermehrung ist außerordentlich stark. Schon im April findet man in ihren warmen Nestern, die 40 bis 60 Zentimeter tief unter dem Boden liegen und mit zerbissenem Grase, fein zermalten Halmen oder auch mit Moos weich ausgekleidet sind, vier bis acht Junge, und im Verlauf der warmen Jahreszeit wirft ein Weibchen noch vier- bis sechsmal. Höchst wahrscheinlich sind die Jungen des ersten Wurfes im Herbste schon wieder fortpfanzungsfähig, und somit läßt sich die zuweilen stattfindende erstaunliche Vermehrung erklären.
»Unter günstigen Umständen«, sagt Blasius, »vermehren sich die Feldmäuse in unglaublicher Weise. Es sind viele Beispiele bekannt, daß durch ihre übermäßige Vermehrung auf weite Länderstrecken hin ein großer Teil der Ernte vernichtet wurde und mehr als tausend Morgen junge Buchenschonungen durch Abnagen der Rinde zerstört worden sind. Wer solche mäusereiche Jahre nicht erlebt hat, vermag sich schwerlich eine Vorstellung von dem fast unheimlichen, buntbeweglichen Treiben der Mäuse in Feld und Wald zu machen. Oft erscheinen sie in einer bestimmten Gegend, ohne daß man einen allmählichen Zuwachs hätte wahrnehmen können, wie plötzlich aus der Erde gezaubert. Es ist möglich, daß sie auch stellenweise plötzlich einwandern. Aber gewöhnlich ist ihre sehr große Vermehrung an der Zunahme der Mäusebussarde schon wochenlang voraus zu vermuten. In den zwanziger Jahren trat am Niederrhein wiederholt diese Landplage ein. Der Boden in den Feldern war stellenweise so verlöchert, daß man kaum einen Fuß auf die Erde stellen konnte, ohne eine Mäuseröhre zu berühren, und zwischen diesen Öffnungen waren zahllose Wege tief ausgetreten. Auch am hellen Tage wimmelte es von Mäusen, die frei und ungestört umherliefen. Näherte man sich ihnen, so kamen sie zu sechs bis zehn auf einmal vor einem und demselben Loche an, um hineinzuschlüpfen, und verrammelten einander unfreiwillig ihre Zugänge. Es war nicht schwer, bei diesem Zusammendrängen an den Röhren ein halbes Dutzend mit einem Stockschlage zu erlegen. Alle schienen kräftig und gesund, doch meistens ziemlich klein, indem es großenteils Junge sein mochten. Drei Wochen später besuchte ich dieselben Punkte. Die Anzahl der Mäuse hatte noch zugenommen, aber die Tiere waren offenbar in krankhaftem Zustande. Viele hatten schorfige Stellen oder Geschwüre, oft über den ganzen Körper, und auch bei ganz unversehrten war die Haut so locker und zerreißbar, daß man sie nicht derb anfassen durfte, ohne sie zu zerstören. Als ich vier Wochen später zum drittenmal diese Gegenden besuchte, war jede Spur von Mäusen verschwunden. Doch erregten die leeren Gänge und Wohnungen einen noch viel unheimlicheren Eindruck als die früher so lebendig bewegten. Man sagte, plötzlich sei das ganze Geschlecht wie durch einen Zauber von der Erde verschwunden gewesen. Viele mochten an einer verheerenden Seuche umgekommen sein, viele einander gegenseitig aufgefressen haben, wie sie es auch in der Gefangenschaft tun; aber man sprach auch von unzählbaren Scharen, die am hellen Tage an verschiedenen Punkten über den Rhein geschwommen seien. Doch hatte man nirgends in der weiten Umgebung einen ungewöhnlichen Zuwachs gesehen; sie schienen im Gegenteil überall gleichzeitig verschwunden zu sein, ohne irgendwo wieder aufzutauchen. Die Natur mußte in ihrer übermäßigen Entwicklung auch gleichzeitig ein Werkzeug zu ihrer Vernichtung geschaffen haben. Die Witterung, ein schöner warmer Spätsommer, schien sie bis zum letzten Augenblick begünstigt zu haben.«
Um für die Massen der Mäuse, die manchmal in gewissen Gegenden auftreten, Zahlen zu geben, will ich bemerken, daß in dem einzigen Bezirk von Zabern im Jahre 1823 binnen vierzehn Tagen 1 570 000, im Landratsamt Nidda 590 327 und im Landratsamt Putzbach 271 941 Stück Feldmäuse gefangen worden sind. »Im Herbst des Jahres 1856«, sagt Lenz, »gab es so viele Mäuse, daß in einem Umkreise von vier Stunden zwischen Erfurt und Gotha etwa zwölftausend Acker Land umgepflügt werden mußten. Die Aussaat von jedem Acker hatte nach damaligem Preise einen Wert von 2 Talern; das Umackern selbst war aus einen halben Taler anzuschlagen. und so betrug der Verlust mindestens 20 bis 30 000 Taler, aber wahrscheinlich weit mehr. Auf einem großen Gute bei Breslau wurden binnen sieben Wochen 200 000 Stück gefangen und an die Breslauer Düngerfabrik abgeliefert, die damals für das Dutzend einen Pfennig bezahlte. Einzelne Mäusefänger konnten der Fabrik täglich 1400 bis 1500 Stück liefern.« Im Sommer des Jahres 1861 wurden in der Gegend von Alsheim in Rheinhessen 409 523 Mäuse und 4707 Hamster eingefangen und abgeliefert. In den Jahren 1872 und 73 war es nicht anders. Fast aus allen Teilen unseres Vaterlandes erschallten Klagen über Mäusenot. Es war eine Plage, der bekannten ägyptischen vergleichbar. Selbst in dem dürren Sande der Mark zählte man auf einzelnen Feldstücken Tausende von Feldmäusen; in dem fetten Ackerlande Niedersachens, Thüringens, Hessens hausten sie furchtbar. Halbe Ernten wurden vernichtet, Hunderttausende von Morgen umgepflügt, viele Tausende von Mark und Talern für Vertilgungsmittel ausgegeben.
Gänzlich abzuwenden vermag man die Mäuseplage ebensowenig wie eine die Menschheit heimsuchende Seuche, aber mildern, abschwächen kann man sie wohl. Man breche endlich mit Vorurteilen und gewähre den natürlichen Mäusevertilgern freies Gebiet, Schutz und Hege, und man wird sicherlich früher oder später eine Abnahme der Mäusepest wahrnehmen. Wer sich gewöhnt, Nutzen und Schaden der Tiere gegeneinander abzuwägen, gebärdet sich, wenn der Fuchs einen Hasen fängt oder ein Haushuhn davonträgt, nicht mehr, als ob dadurch alles Lebende vernichtet würde, sondern erinnert sich der unzähligen Mäuse, die derselbe Fuchs vertilgte, und wer den Bussard bei seiner Mäusejagd beobachtete, stempelt es nicht zum unsühnbaren Verbrechen, wenn dem Raubvogel die Jagd auf ein Rebhuhn einmal glückte. Nach den gegenwärtig geltenden Ansichten werden die Felder nicht der Hasen halber bestellt, sondern diese sind höchstens geduldete Gäste des Landwirts, denen er weit mehr nachsieht, als er, streng genommen, verantworten kann. Von einem wirklichen Schaden, den die Raubtiere durch Wegfangen besagter Gäste der Landwirtschaft zufügen sollten, kann im Ernst nicht gesprochen werden; wohl aber läßt sich deren nutzenbringende Tätigkeit leicht beweisen. Füchse und Bussarde müssen als die ausgezeichnetsten aller Mäusevertilger bezeichnet werden, weil sie nicht allein als geschickte, sondern auch als vielbedürfende Fänger sich bewähren, während die übrigen, also Iltis, Wiesel, Igel, Spitzmäuse, Weihen, Turmfalken, die verschiedenen Eulen- und Rabenarten, so tüchtig sie auch sein mögen, doch mit wenig Beute zufriedengestellt sind. Wer also der Mäuseplage steuern will, sorge zunächst dafür, daß die genannten Raubtiere ungestört tätig sein können. Dem Fuchse wie dem Iltisse oder dem Hermeline und Wiesel belasse man ihre Schlupfwinkel oder richte ihnen solche her, schone und hege sie überhaupt; für den Bussard und seine gefiederten Raubgenossen stelle man hohe Stangen mit einem Querholz als Warten oder Wachtürme in den Feldern auf. Man wird dafür reichlich belohnt werden und vielleicht einige Hasen, nicht aber die halbe Ernte verlieren. Je beharrlicher man der Mäuseplage vorzubeugen sucht, um so seltener wird man unter ihr zu leiden haben. Ist sie einmal da, so kommt die Abwehr in den meisten Fällen zu spät.
*
Die Lemminge( Myodes) sind unter den Wühlmäusen in Gestalt und Wesen dasselbe, was die Hamster unter den eigentlichen Mäusen: besonders gedrungen gebaute, stutzschwänzige Mitglieder der Gesamtheit. Der verhältnismäßig große Kopf ist dicht behaart, die Oberlippe tief gespalten, das rundliche Ohr klein und ganz im Pelz versteckt, das Auge ebenfalls klein; die fünfzehigen, auch auf den Sohlen dicht behaarten Füße tragen, zumal vorne, große Scharrkrallen. Das Urbild der Sippe, der Lemming ( Myodes Lemmus), erreicht eine Gesamtlänge von 15 Zentimeter, wovon höchstens 2 Zentimeter auf das Stutzschwänzchen kommen. Der reiche und lange Pelz ist sehr ansprechend gezeichnet. Von der braungelben, im Nacken gewässerten Grundfärbung heben sich dunkle Flecken ab; von den Augen laufen zwei gelbe Streifen nach dem Hinterkopfe. Der Schwanz und die Pfoten sind gelb, die Unterteile einfach gelb, fast sandfarbig.

Lemming ( Myodes lemnus)
Der Lemming ist unbedingt das rätselhafteste Tier ganz Skandinaviens. Olauf Magnus erzählt, daß er im Jahre 1518 in einem Walde sehr viele Hermeline gesehen und den ganzen Wald mit ihrem Gestanke erfüllt gefunden habe. Hieran wären kleine vierfüßige Tiere mit Namen Lemar schuld gewesen, die zuweilen bei plötzlichem Gewitter und Regen vom Himmel fielen, man wisse nicht, ob aus entfernten Stellen herausgetrieben oder in den Wolken erzeugt. Erst Linné schilderte in den Schwedischen Abhandlungen vom Jahre 1740 den Lemming der Natur gemäß und so ausführlich, daß man seiner Beschreibung nicht viel hinzufügen kann. Ich selbst habe Lemminge im Jahre 1860 namentlich auf dem Dovrefjeld zu meiner Freude in großer Menge angetroffen und mich durch eigene Anschauung über sie unterrichten können. Wie ich in Norwegen erfuhr, finden sie sich auf allen höheren Gebirgen des Landes und auch auf den benachbarten Inseln, falls diese bergig sind. Weiter oben im Norden gehen sie bis in die Tundra herab. In den ungeheuren Morästen zwischen Altenfjord und dem Tanaflusse fand ich ihre Losung auf allen trockenen Stellen in unglaublicher Menge, sah aber nicht einen einzigen Lemming mehr. Auf dem Dovrefjeld waren sie im Mai überall sehr gemein, am häufigsten im höchsten Gürtel zwischen 1000 bis 2000 Meter über dem Meere, oder von der Grenze der Fichtenwälder an bis zur Grenze des ewigen Schnees hinauf. Einige fand ich auch in Gulbrandsdalen, kaum 100 Meter über dem Meere, und zwar in wasserreichen Gegenden in der Nähe des Laugen. Auf dem Dovrefjeld wohnte einer neben dem anderen, und man sah und hörte oft ihrer acht bis zehn zu gleicher Zeit.
Die Tiere sind ganz allerliebst. Sie sehen aus wie kleine Murmeltiere oder wie Hamster und ähneln namentlich den letzteren vielfach in ihrem Wesen. Ihre Aufenthaltsorte sind die verhältnismäßig trockenen Stellen des Morastes, der einen so großen Teil von Norwegen bedeckt. Sie bewohnen hier kleine Höhlungen unter Steinen oder im Moose; doch trifft man sie auch oft umherschweifend zwischen den kleinen Hügeln an, die sich aus dem Sumpfe erheben. Selten bemerkt man ausgetretene Wege, die von einer Höhle zu der anderen führen; größere Gänge schürfen sie sich nur im Schnee. Sie sind bei Tag und bei Nacht munter und in Bewegung. Ihr Gang ist trippelnd, aber rasch, wenn auch der Mensch sie leicht einzuholen vermag. Auf der Flucht zeigen sie sich überaus geschickt, indem sie, selbst in dem ärgsten Sumpfe, jede trockene Stelle herauszusuchen und als Brücke zu benutzen wissen. Das Wasser meiden sie mit einer gewissen Scheu, und wenn man sie in ein größeres Wasserbecken oder in ein Flüßchen wirft, quieken und knurren sie sehr ärgerlich, suchen auch so schnell als möglich das trockene Land wiederzugewinnen. Gewöhnlich verraten sie sich selbst. Sie sitzen oft ruhig und wohlversteckt in ihren Löchern und würden sicherlich nicht von den Vorübergehenden bemerkt werden; aber die Erscheinung eines Menschen erregt sie viel zu sehr, als daß sie schweigen könnten. Mit lautem Grunzen und Quieken nach Meerschweinchenart begrüßen sie den Eindringling in ihr Gehege, gleichsam, als wollten sie ihm das Betreten ihres Gebietes verwehren. Nur während sie umherlaufen, nehmen sie, wenn man auf sie zugeht, die Flucht, eilen nach irgendeinem der unzähligen Löcher und setzen sich dort fest. Dann gehen sie nicht mehr zurück, sondern lassen es darauf ankommen, totgeschlagen oder weggenommen zu werden. Mir machten die mutigen Gesellen unglaublichen Spaß; ich konnte nie unterlassen, sie zum Kampfe herauszufordern. Sobald man in nächste Nähe ihrer Höhle gelangt, springen sie aus derselben hervor, quieken, grunzen, richten sich auf, beugen den Kopf zurück, so daß er fast aus den Rücken zu liegen kommt, und schauen nun mit den kleinen Augen so grimmig auf den Gegner, daß man wirklich unschlüssig wird, ob man sie aufnehmen soll oder nicht. Wenn sie einmal gestellt sind, denken sie gar nicht daran, wieder zurückzuweichen. Hält man ihnen den Stiefel vor, so beißen sie in denselben, ebenso in den Stock oder in die Gewehrläufe, wenn sie auch merken, daß sie hier nichts ausrichten können. Manche bissen sich so fest in meine Beinkleider ein, daß ich sie kaum wieder abschütteln konnte. Bei solchen Kämpfen geraten sie in große Wut und ähneln dann ganz den bösartigen Hamstern. Wenn man ihnen recht rasch auf den Leib kommt, laufen sie rückwärts mit aufgerichtetem Kopfe, solange der Weg glatt ist, und quieken und grunzen dabei nach Leibeskräften; stoßen sie aber auf ein Hindernis, so halten sie wieder tapfer und mutig stand und lassen sich lieber fangen, als daß sie durch einen kleinen Umweg sich freizumachen suchten. Zuweilen springen sie mit kleinen Sätzen auf ihren Gegner los, scheinen sich überhaupt vor keinem Tier zu fürchten, weil sie sogar tolldreist jedem Geschöpf entgegentreten. In den Straßen werden viele überfahren, weil sie sich trotzig in den Weg stellen und nicht weichen wollen. Die Hunde auf den Höfen beißen eine Menge tot, und die Katzen verzehren wahrscheinlich so viele, daß sie immer satt sind; wenigstens könnte ich mir sonst nicht erklären, daß die Katzen der Postwechselstelle Fogstuen auf dem Dovre ganz ruhig neben den Lemmingen vorübergehen, ohne sich um sie zu bekümmern. Im Winter schürfen sie sich, wie bemerkt, lange Gänge in den Schnee, und in diesen hinein bauen sie sich auch, wie ich bei der Schneeschmelze bemerkte, große dickwandige Nester aus zerbissenem Grase. Die Nester stehen etwa 20 bis 30 Zentimeter über dem Boden, und von ihnen aus führen lange Gänge nach mehreren Seiten hin durch den Schnee, von denen die meisten halb bis auf die Moosdecke sich herabsenken und dann, wie die Gänge unserer Wühlmäuse, halb zwischen dem Moose und halb im Schnee weitergeführt werden. Aber die Lemminge laufen auch auf dem Schnee umher oder setzen wenigstens über die großen Schneefelder in der Höhe des Gebirges.
Ihre Jungen werden nach Versicherung meines alten Jägers in den Nestern geworfen, die sie bewohnen. Mir selbst glückte es nicht, ein Nest mit Jungen aufzufinden, und fast wollte es mir scheinen, als gäbe es zur Zeit meines Aufenthaltes auf dem Dovrefjeld noch gar keine solche. Linné sagt, daß die Tiere meistens fünf bis sechs Junge hätten, und Scheffer fügt hinzu, daß sie mehrere Male im Jahre werfen. Weiteres ist mir über ihre Fortpflanzung nicht bekannt.
Die Hauptnahrung der Lemminge besteht aus den wenigen Alpenpflanzen, die in ihrer armen Heimat gedeihen, namentlich aus Gräsern, Renntierflechten, den Kätzchen der Zwergbirke und wahrscheinlich auch aus allerlei Wurzeln. Lemminge finden sich ebenso hoch, als die Flechtendecke reicht, und nirgends da, wo sie fehlt: dies deutet darauf hin, daß diese Pflanzen wohl den Hauptteil ihrer Mahlzeiten bilden dürften. Soviel ich erfuhr, tragen sie sich nicht für den Winter ein, sondern leben auch dann von dem, was sie unter der dicken Schneedecke finden, zumal von den Knospen der bedeckten Gesträuche. Großen Schaden bringen sie nicht; denn da, wo sie wohnen, gibt es keine Felder, und in die Häuser kommen sie auch nicht herein. Wenn sie sich wirklich einmal in den Höfen sehen lassen, ist das wohl nur Zufall: sie haben sich bei einer ihrer Lustwandlungen verirrt. Doch sagte mir ein Bewohner der Lofoten, daß die Kartoffelfelder in manchen Jahren von den Lemmingen gebrandschatzt würden. Die Tiere wühlen sich lange Gänge in den Feldern und bauen sich ihre Höhlen unmittelbar zwischen die Wurzelknollen, von denen sie dann in aller Gemächlichkeit leben. Ihre Heimat ist übrigens, so arm sie auch scheinen mag, reich genug für ihre Ansprüche und bietet ihnen alles, was sie bedürfen. Nur in manchen Jahren scheint das nicht der Fall zu sein; dann sehen sich die Lemminge genötigt, Wanderungen anzustellen.
Ich muß bei Erwähnung dieser allbekannten Tatsache hervorheben, daß die Leute auf dem Dovrefjeld nicht das geringste von den Wanderungen wußten, und daß die Bewohner Lapplands mir ebensowenig darüber sagen konnten. Auch Finnländer, die ich fragte, wußten nichts, und wäre nicht Linné der Gewährsmann für die bezüglichen Angaben: ich würde sie kaum der Erwähnung wert halten. Aus dem Linnéschen Berichte scheint übrigens hervorzugehen, daß der große Naturforscher die Lemminge selbst auch nicht auf der Wanderschaft gesehen, sondern nur das Gehörte wiedererzählt hat. Neuere Reisende haben der wandernden Lemminge Erwähnung getan und dabei gesagt, daß der Zug der Tiere einem wogenden Meere gliche; aber ihre Angaben sind keineswegs so ausführlich und bestimmt, daß wir über die Wanderung selbst ein klares Bild bekommen sollten. Martins, einer der letzten Berichterstatter, der über die Wanderungen spricht, erzählt, daß er in einem Fichtenwalde am Ufer des Muonio Lemminge zahlreicher auffand als irgendwo zuvor, und daß es ihm unmöglich gewesen wäre, alle diejenigen zu zählen, die er in einem Augenblick gesehen habe. Je weiter er und sein Begleiter im Walde vordrangen, desto mehr vergrößerte sich fortwährend die Anzahl der Tiere, und als man zu einer lichten Stelle gekommen war, erkannte man, daß sie alle in derselben Richtung liefen, indem sie die des Flüßchens einhielten. Eine Ursache der Wanderung vermochte Martins ebensowenig zu erkennen wie Linné.
Meiner Ansicht nach muß die Ursache solcher Wanderungen ebenso wie bei andern Wühlmäusen in zeitweilig sich fühlbar machendem Mangel an Nahrung beruhen. Obwohl diese Lemminge, wie oben bemerkt, zuweilen in die Niederung herabkommen, müssen sie doch als Gebirgstiere bezeichnet werden; denn auch die Tundra im hohen Norden von Skandinavien trägt durchaus das Gepräge der breiten, abgeflachten Rücken südlicherer Gebirge. Wenn nun auf einen milden Winter ein gutes Frühjahr und ein trockener Sommer folgen, sind damit alle Bedingungen zu einer Vermehrung gegeben, die, wie bei andern Wühlmäusen auch, als eine grenzenlose bezeichnet werden darf. Die Trockenheit bewirkt aber gleichzeitig ebenso ein Verdorren oder doch Verkümmern der bevorzugten Nahrungspflanzen, das ausgedehnte Weideland reicht für die Menge der wie alle Nager freßgierigen Geschöpfe nicht mehr aus, und sie sehen sich nunmehr gezwungen, anderswo Nahrung zu suchen. Unter solchen Umständen rotten sich bekanntlich nicht allein Nagetiere, sondern auch andere Pflanzenfresser, beispielsweise Antilopen, in Scharen zusammen, wandern, nehmen unterwegs ihre Artgenossen mit sich und ziehen schließlich gleichsam sinnlos ihres Weges fort, da sie weder eine bestimmte Richtung einhalten, noch auch solchen Gegenden sich zuwenden, wo es wirklich etwas für sie zu fressen gibt. Erst nachdem Hunderttausende durch Mangel, Krankheiten, Reisemühen und Reisegefahren ihren Untergang gefunden haben, versuchen die Überlebenden wieder die Höhen zu gewinnen, die ihr eigentliches Wohngebiet bilden, und dabei kann es allerdings vorkommen, daß sie, wie Hoegstroem beobachtete, wiederum in gerader Linie fortziehen. Somit erscheinen mir die Wanderungen der Lemminge durchaus nicht wunderbarer oder minder erklärlich als die andrer Wandersäugetiere, insbesondere andrer Wühlmäuse.
Nach allen Nachrichten, die ich erhielt, ist es sicher, daß die Lemminge zuweilen versuchen, von einer Insel zur andern zu schwimmen; doch hat man auch diese Wanderungen sehr übertrieben. Oft vergehen viele Jahre, ehe sich einmal Lemminge in großen Haufen zeigen: so waren sie auf dem Dovresjeld seit fünfzehn Jahren nicht so häufig gewesen als im Sommer des Jahres 1860. Dieses plötzliche Erscheinen gibt dem Aberglauben und der Fabelei vielen Anlaß. Man kann sich nicht erklären, daß auf einer einsamen Insel mit einem Male Tausende von Tieren, die früher nicht gesehen wurden, erscheinen und sich jedermanns Blicken aufdrängen, vergißt aber dabei die einzelnen wenigen, die sicherlich jahraus, jahrein ihr Wesen treiben und unter günstigen Umständen sich, dank ihrer außerordentlichen Fruchtbarkeit, in das Unglaubliche vermehren können.
Ein Glück ist es immerhin, daß die Lemminge so viele Feinde haben; denn sonst würden sie bei ihrer ungeheuren Häufigkeit das ganze Land überschwemmen und alles Genießbare auffressen. Jedenfalls ist das Klima selbst der beste Vertilger der Tiere. Ein nasser Sommer, ein kalter, frühzeitiger, schneeloser Herbst tötet sie millionenweise, und dann bedarf es, wie erklärlich, längerer Jahre, bis die Vermehrung ein solches pestartiges Hinsterben wieder einigermaßen ausgleicht. Außerdem verfolgt die Lemminge eine Unzahl von lebenden Feinden. Man darf wohl sagen, daß sich alle Raubtiere ganz Skandinaviens von ihnen mästen. Wölfe und Füchse folgen ihnen meilenweit und fressen, wenn es Lemminge gibt, nichts anderes; der Vielfraß stellt, wie ich selbst beobachtete, unsern Tieren eifrig nach; Marder, Iltisse und Hermeline jagen zur Lemmingszeit nur sie, die Hunde der Lappen sehen in einem Lemmingsjahre Festtage, wie solche ihnen, den ewig hungrigen, nur selten wieder kommen; die Eulen folgen den Zügen; die Schnee-Eule findet sich fast ausschließlich an Orten, wo es Lemminge gibt; die Bussarde, namentlich der Rauhfußbussard, sind ohne Unterlaß bemüht, die armen Schelme zu vertilgen; Raben füttern mit ihnen ihre Jungen groß, und Krähen und Elstern suchen die bissigen Geschöpfe, so gut es gehen will, auch zu vernichten.
Die Familie der Stachelschweine ( Aculeata) bedarf keiner langen Beschreibung hinsichtlich der äußerlichen Kennzeichen ihrer Mitglieder. Das Stachelkleid läßt sämtliche hierher gehörige Tiere sofort als Verwandte erscheinen, so verschieden es auch ausgebildet sein mag. Der Leib ist gedrungen, der Hals kurz, der Kopf dick, die Schnauze kurz, stumpf und an der Oberlippe gespalten, der Schwanz kurz oder sehr verlängert und dann greiffähig; die Beine sind ziemlich gleich lang, die Füße vier- oder fünfzehig, breitsohlig, die Zehen mit stark gekrümmten Nägeln bewehrt, die Ohren und Augen klein. Die hinsichtlich ihrer Länge und Stärke sehr verschiedenen Stacheln stehen in geraden Reihen zwischen einem spärlichen Unterhaar oder umgekehrt einem längeren Grannenhaar, das so überwiegend werden kann, daß es die Stacheln gänzlich bedeckt. Bezeichnend für letztere ist eine verhältnismäßig lebhafte Färbung.
Alle Stachelschweine bewohnen gemäßigte und warme Länder der Alten und Neuen Welt. Dort finden sich die kurzschwänzigen, hier die langschwänzigen Arten. Die altweltlichen sind an den Boden gebunden, die neuweltlichen sind Baumtiere. Dementsprechend leben sie in dünn bestandenen Wäldern und Steppen oder in großen Waldungen, die ersteren bei Tage in selbst gegrabenen Gängen und Höhlen verborgen, die letzteren zusammengeknäuelt auf einer Astgabel dichter Baumwipfel oder in einer Baumhöhlung sitzend. Ungesellig wie sie sind, vereinigen sie sich nur während der Fortpflanzungszeit zu kleinen Trupps, die mehrere Tage miteinander verbringen können; außerdem lebt jedes einsam für sich. Ihre Bewegungen sind langsam, gemessen, träge; zumal die kletternden Arten leisten Erstaunliches in der gewiß schweren Kunst, stunden- und tagelang bewegungslos auf einer und derselben Stelle zu verharren. Jedoch würde man irren, wenn man behaupten wollte, daß die Stachelschweine rascher und geschickter Bewegungen unfähig wären. Wenn einmal die Nacht eingetreten ist und sie ordentlich munter geworden sind, laufen die einen trippelnden Ganges sehr rasch auf dem Boden hin und die andern klettern, wenn auch nicht mit der Behendigkeit des Eichhorns, so doch immer gewandt genug, in dem Gezweige auf und nieder. Die Bodenbewohner verstehen das Graben meisterhaft und wissen allen Schwierigkeiten, die ihnen harter Boden entgegensetzt, zu begegnen. Unter den Sinnen scheint ausnahmslos der Geruch obenan zu stehen, bei den Kletterstachelschweinen auch noch der Tastsinn einigermaßen ausgebildet zu sein, Gesicht und Gehör dagegen sind bei allen schwach. Ihre geistigen Fähigkeiten stehen auf einer tiefen Stufe. Sie sind dumm, vergeßlich, wenig erfinderisch, boshaft, jähzornig, ängstlich scheu und furchtsam, obgleich sie bei drohender Gefahr durch Sträuben ihres Stachelkleides und ein eigentümliches Rasseln mit den Schwanzstacheln Furcht einzuflößen suchen. Mit andern Geschöpfen halten sie ebensowenig Freundschaft wie mit ihresgleichen: ein beliebter Bissen kann selbst unter den Gatten eines Paares ernsthaften Streit hervorrufen. Niemals sieht man zwei Stachelschweine miteinander spielen oder auch nur freundschaftlich zusammen verkehren. Jedes geht seinen eigenen Weg und bekümmert sich so wenig als möglich um das andre, und höchstens um zu schlafen legen sich ihrer zwei nahe nebeneinander nieder. Mit dem Menschen, der sie gefangen hält und pflegt, befreunden sie sich nie, lernen auch ihren Wärter von andern Personen nicht unterscheiden. Ihre Stimme besteht in grunzenden, dumpfen Lauten, in Schnauben, leisem Stöhnen und einem schwer zu beschreibenden Quieken, das wahrscheinlich zu dem im übrigen gänzlich unpassenden Namen » Schwein« Veranlassung gegeben hat.
Allerlei Pflanzenteile, von der Wurzel an bis zur Frucht, bilden die Nahrung der Stachelschweine. Nach andrer Nager Art führen sie das Futter mit den Vorderpfoten zum Munde oder halten es, während sie fressen, damit am Boden fest. Das Wasser scheinen fast alle längere Zeit entbehren zu können; wahrscheinlich genügt ihnen der Tau aus den Blättern, die sie verzehren.
Für den Menschen sind die Stachelschweine ziemlich bedeutungslose Wesen. Die erdbewohnenden Arten werden zuweilen durch das Graben ihrer Höhlen in Feldstücken und Gärten lästig, nützen aber dafür durch ihr Fleisch und durch ihr Stachelkleid, dessen schön gezeichnete, glatte Horngebilde zu mancherlei Zwecken Benutzung finden. Die kletternden Arten richten als arge Baumverwüster nur Unfug an und nützen gar nichts. In den reichen Gegenden zwischen den Wendekreisen können die dort lebenden Arten ebensowenig schaden wie nützen.
*
In der nördlichen Hälfte Amerikas werden die Kletterstachelschweine durch den Urson ( Erethizon dorsatum) vertreten. Er erreicht eine Länge von 80 Zentimeter, wovon der Schwanz 19 Zentimeter wegnimmt. Der Kopf ist kurz, dick und stumpf, die Schnauze abgestutzt, die kleinen Nasenlöcher sind durch eine halbmondartige Klappe mehr oder weniger verschließbar. Die Vorderfüße sind vierzehig und daumenlos, die hinteren fünfzehig, die Krallen lang und stark, die Sohlen nackt, mit netzförmig geriefter Haut bekleidet. Ein dicker Pelz, der auf dem Nacken bis 11 Zentimeter lang wird und an der Unterseite und Schwanzspitze in scharfe Borsten sich verwandelt, bedeckt den Leib. Zwischen den Haaren und Borsten stehen auf der ganzen Oberseite bis 8 Zentimeter lange Stacheln, die größtenteils von den Haaren überdeckt werden. Die Färbung ist ein Gemisch von Braun, Schwarz und Weiß. Das Tier bewohnt die Waldungen Nordamerikas, vom 67. Grad nördl. Breite an bis Virginien und Kentucky, und von Labrador bis zu den Felsgebirgen. In den Waldgegenden westlich vom Missouri ist es nicht gerade selten, in den östlichen Ländern dagegen fast ausgerottet.
»Der Urson«, sagt Cartwright, »ist ein fertiger Kletterer und kommt im Winter wahrscheinlich nicht zum Boden herab, bevor er den Wipfel eines Baumes entrindet hat. Gewöhnlich bewegt er sich im Walde in einer geraden Linie, und selten geht er an einem Baume vorüber, es sei denn, daß derselbe zu alt sei. Die jüngsten Bäume liebt er am meisten: ein einziger Urson richtet während des Winters wohl Hunderte zugrunde. Der mit den Sitten dieser Tiere Vertraute wird selten vergeblich nach ihm suchen; denn die abgeschälte Rinde weist ihm sicher den Weg.« Audubon versichert, daß er durch Wälder gekommen sei, in denen alle Bäume vom Urson entrindet worden waren, so daß der Bestand aussah, als ob das Feuer in ihm gewütet habe. Namentlich Ulmen, Pappeln und Tannen waren arg mitgenommen worden. Mit seinen braunen, glänzenden Zähnen schält er die Rinde so glatt von den Zweigen ab, als hätte er die Arbeit mit einem Messer besorgt. Man sagt, daß er regelmäßig auf dem Wipfel der Bäume beginne und niederwärts herabsteige, um die Zweige und zuletzt auch den Stamm abzuschälen. Man darf mit ziemlicher Sicherheit rechnen, ihn monatelang alltäglich in derselben Baumhöhlung zu finden, die er sich einmal zum Schlafplatz erwählt hat. Einen Winterschlaf hält er nicht; doch ist es wahrscheinlich, daß er sich während der kältesten Wintertage in gedachte Schlupfwinkel zurückzieht.
In solchen Baumlöchern oder in Felsenhöhlen findet man auch das Nest und in ihm im April oder Mai die Jungen, gewöhnlich zwei an der Zahl, seltener drei oder vier. Die Jungen, die aus dem Nest genommen und in Gefangenschaft gehalten werden, gewöhnen sich bald an ihren Herrn und an die Umgebung. Man ernährt sie mit allerhand Pflanzenstoffen, auch verzehren sie Brot sehr gern. Wenn man sie im Garten frei umherlaufen läßt, besteigen sie die Bäume und fressen hier Schale und Blätter. Audubon erzählt, daß ein von ihm gepflegter Urson nur dann sich erzürnt habe, wenn man ihn von einem Baume des Gartens, den er regelmäßig bestieg, entfernen wollte. Unser Gefangener war nach und nach sehr zahm geworden und machte selten von seinen Spitzen Gebrauch, konnte deshalb auch gelegentlich aus seinem Käfig befreit und der Wohltat eines freien Spazierganges im Garten teilhaftig gemacht werden. Er kannte uns; wenn wir ihn riefen und ihm eine süße Kartoffel oder einen Apfel vorhielten, drehte er sein Haupt langsam gegen uns, blickte uns mild und freundlich an, stolperte dann langsam herbei, nahm die Frucht aus unserer Hand, richtete sich auf und führte die Nahrung mit seinen Pfoten zum Munde. Oft kam er, wenn er die Tür geöffnet fand, in unser Zimmer, näherte sich uns, rieb sich an unsern Beinen und blickte uns bittend an, in der Absicht, irgendeine seiner Leckereien zu empfangen. Vergeblich bemühten wir uns, ihn zu erzürnen: er gebrauchte seine Stacheln niemals gegen uns. Anders war es, wenn ein Hund sich näherte. Dann hatte er sich augenblicklich in Verteidigungszustand gesetzt. Die Nase niederwärts gebogen, alle Stacheln aufgerichtet und den Schwanz hin und her bewegend, zeigte er sich vollkommen fertig zum Kampf.
»Ein großer, wütender, im höchsten Grade streitlustiger Bullenbeißer aus der Nachbarschaft hatte die Gewohnheit, sich unter der Umzäunung unseres Gartens durchzugraben und hier von Zeit zu Zeit seine unerwünschten Besuche zu machen. Eines Morgens sahen wir ihn in der Ecke des Gartens einem Gegenstande zulaufen, der sich als unser Urson erwies. Dieser hatte während der Nacht einen Ausflug aus seinem Käfig gemacht und trollte noch gemütlich umher, als der Hund sich zeigte. Seine gewöhnliche Drohung schien den Bullenbeißer nicht abzuhalten; vielleicht glaubte er auch, es mit einem Tier zu tun zu haben, das nicht stärker als eine Katze sein könne: kurz, er sprang plötzlich mit offenem Maul auf den Gewappneten los. Der Urson schien in demselben Augenblick auf das Doppelte seiner Größe anzuschwellen, beobachtete den ankommenden Feind scharf und teilte ihm rechtzeitig mit seinem Schwanz einen so wohlgezielten Schlag zu, daß der Bullenbeißer augenblicklich seinen Mut verlor und schmerzgepeinigt laut aufschrie. Sein Mund, die Zunge und Nase waren bedeckt mit den Stacheln seines Gegners. Unfähig, die Kinnladen zu schließen, floh er mit offenem Maul unaufhaltsam über die Grundstücke. Wie es schien, hatte er eine Lehre für seine Lebenszeit erhalten; denn nichts konnte ihn später zu dem Platz zurückbringen, auf dem ihm ein so ungastlicher Empfang bereitet worden war. Obgleich die Leute ihm sofort die Stacheln aus dem Munde zogen, blieb der Kopf doch mehrere Wochen lang geschwollen, und Monate vergingen, bevor der Mund geheilt war.«
Prinz Max von Wied fing einen Urson am oberen Missouri. »Als wir ihm zu nahe kamen,« sagt er, »sträubte das Tier die langen Haare vorwärts, bog seinen Kopf unterwärts, um ihn zu verstecken, und drehte sich dabei immer im Kreise. Wollte man es angreifen, so kugelte es sich mit dem Vorderleib zusammen und war alsdann wegen seiner äußerst scharfen, ganz locker in der Haut befestigten Stacheln nicht zu berühren. Kam man ihm sehr nahe, so rüttelte es mit dem Schwanz hin und her und rollte sich zusammen. Die Haut ist sehr weich, dünn und zerbrechlich, und die Stacheln sind in ihr so lose eingepflanzt, daß man sie bei der geringsten Berührung in den Händen schmerzhaft befestigt findet.«
An die Nahrung stellt der Urson keine Ansprüche, und seine Haltung verursacht deshalb keine Schwierigkeiten; doch verträgt er größere Hitze nicht. »Als der Frühling vorschritt,« berichtet Audubon, »überzeugten wir uns, daß unser armes Stachelschwein nicht für warme Länder geschaffen war. Wenn es heiß wurde, litt es so, daß wir es immer in seine kanadischen Wälder zurückwünschten. Es lag den ganzen Tag über keuchend in seinem Käfig, schien bewegungslos und elend, verlor seine Freßlust und verschmähte alle Nahrung. Schließlich brachten wir es nach seinem geliebten Baum, und hier begann es auch sofort, Rinde abzunagen. Wir betrachteten dies als ein günstiges Zeichen; aber am andern Morgen war es verendet.«
Der Urson wird von Jahr zu Jahr seltener. »Im westlichen Connecticut«, so erzählte William Case unserm Audubon, »war das Tier noch vor einigen Jahren so häufig, daß ein Jäger gelegentlich der Eichhornjagd sieben oder acht im Laufe eines Nachmittags erlegen konnte, und zwar in einer Entfernung von drei oder vier Meilen von der Stadt, während man jetzt vielleicht nicht ein einziges dort finden würde. Sie werden mit erstaunlicher Schnelligkeit ausgerottet, hauptsächlich aus Rache von den Jägern wegen der Verletzungen, die sie den Jagdhunden beibringen. Außer dem Menschen dürften nur wenige Feinde dem wohlgewaffneten Tier gefährlich werden. Audubon erhielt einen kanadischen Luchs, der den Angriff auf ein Stachelschwein schwer hatte büßen müssen. Das Raubtier war dem Tode nahe, sein Kopf heftig entzündet und der Mund voll von den scharfen Stacheln. Derselbe Naturforscher hörte wiederholt, daß Hunde, Wölfe, ja selbst Kuguare an ähnlichen Verletzungen zugrunde gegangen sind.
Den erlegten Urson wissen nur die Indianer entsprechend zu benutzen. Das Fleisch des Tieres wird von ihnen sehr gern gegessen und soll auch den Weißen munden. Das Fell ist, nachdem die Stacheln entfernt sind, seiner angenehmen Weiche halber brauchbar! die Stacheln werden von den Wilden vorzugsweise zum Schmuck ihrer Jagdtasche, Stiefeln usw. verwendet.
*
Die Stachelschweine ( Hystrix) endlich lassen sich an ihrem kurzen, gedrungenen Leibe, dem dicken, stumpfschnäuzigen, auf starkem Halse sitzenden Kopfe, dem kurzen, mit hohlen, federspulartigen Stacheln besetzten Schwanz, den verhältnismäßig hohen Beinen, den fünfzehigen Vorderfüßen und dem außer allem Verhältnis entwickelten Stachelkleide leicht erkennen. Das Stachelkleid bedeckt hauptsächlich die letzten zwei Dritteile oder die Hinterhälfte des Leibes, während der Vorderteil mit Haaren oder Borsten, meist mähnig, bekleidet ist. Die Stacheln sind die größten, die überhaupt vorkommen.
Das Stachelschwein ( Hystrix criststa) übertrifft unsern Dachs an Größe, nicht aber an Länge und erscheint wegen seines Stachelkleides viel dicker und umfangreicher, als es wirklich ist. Seine Länge beträgt 65 Zentimeter, die des Schwanzes 11 Zentimeter und die Höhe am Widerrist 24 Zentimeter: das Gewicht schwankt zwischen 15 bis 20 Kilogramm. Längs des Halses erhebt sich eine Mähne, die aus starken, nach rückwärts gerichteten, sehr langen, gebogenen Borsten gebildet wird und willkürlich aufgerichtet und zurückgelegt werden kann. Diese Borsten sind ansehnlich lang, dünn und biegsam, teils weiß, teils grau gefärbt, und endigen meistens mit weißen Spitzen. Die übrige Oberseite des Leibes bedecken nebeneinander gestellte, lange und kurze, glatte und scharf gespitzte, abwechselnd dunkel- oder schwarzbraun und weiß gefärbte, lose im Fell festsitzende und deshalb leicht ausfallende Stacheln, zwischen denen überall borstige Haare sich einmengen. An den Seiten des Leibes, auf den Schultern und in der Kreuzgegend sind die Stacheln kürzer und stumpfer als auf der Mitte des Rückens, wo sie auch in scharfe Spitzen enden. Die dünnen, biegsamen erreichen eine Länge von 40 Zentimeter, die kurzen und starken dagegen werden nur 15 bis 30 Zentimeter lang, aber 5 Millimeter dick. Alle sind im Innern hohl oder mit schwammigem Mark angefüllt, Wurzel und Spitze regelmäßig weiß gefärbt. Die kürzeren Stacheln sind schwarzbraun und geringelt, aber an der Wurzel und Spitze ebenfalls weiß. An der Schwanzspitze stehen verschieden gebildete Stacheln von etwa 5 Zentimeter Länge, aber fast 7 Millimeter Dicke. Sie bestehen aus abgestutzten, dünnwandigen, am Ende offenen Röhren und gleichen angeschnittenen Federkielen, ihre Wurzeln dagegen langen, dünnen und biegsamen Stielen. Alle Stacheln können mittels eines großen, kräftigen Muskels, der sich unter der Haut des Tieres ausbreitet und einer starken Zusammenziehung fähig ist, willkürlich aufgerichtet und zurückgelegt werden. Die Unterseite des Leibes ist mit dunkelbraunen, rötlich gespitzten Haaren bedeckt: um die Kehle zieht sich ein weißes Band. Die Krallen sind dunkel hornfarbig, die Augen schwarz. Gegenwärtig findet man das Tier längs der Küste des Mittelmeeres, zumal in Algerien, Tripolis, Tunis, bis Senegambien und Sudan. In Europa lebt es häufig in der Campagna von Rom, in Sizilien, Kalabrien und in Griechenland.

Stachelschwein ( Hystrix cristata)
Das Stachelschwein führt ein trauriges, einsames Leben. Bei Tage ruht es in langen, niedrigen Gängen, die es sich selbst in den Boden wühlt; nachts kommt es heraus und streift nach seiner Nahrung umher. Diese besteht in Pflanzenstoffen aller Art, Disteln und andern Kräutern, Wurzeln und Früchten, der Rinde verschiedener Bäume und mancherlei Blättern. Es beißt die Nahrung ab, faßt sie mit den Vorderzähnen und hält sie mit den Vorderpfoten fest, solange es frißt. Alle Bewegungen sind langsam und unbeholfen; der Gang ist träge, bedächtig, der Lauf nur wenig rasch. Bloß im Graben besitzt das plumpe Tier einige Fertigkeit, aber keineswegs genug, um einem gewandten und behenden Feinde zu entfliehen. Im Winter soll es mehr als gewöhnlich im Bau verweilen und manchmal tagelang dort schlafend zubringen. Einen wirklichen Winterschlaf hält es nicht.
Überrascht man ein Stachelschwein außerhalb seines Baues, so richtet es Kopf und Nacken drohend auf, sträubt alle Stacheln seines Körpers und klappert in eigentümlicher Weise mit ihnen, zumal mit den hohlen Stacheln des Schwanzes, die es durch seitliche Bewegungen so aneinander reibt, daß ein absonderliches Gerassel entsteht, durchaus geeignet, einen unkundigen oder etwas furchtsamen Menschen in Angst zu jagen. Bei hoher Erregung stampft es mit den Hinterfüßen auf den Boden, und wenn man es erfaßt hat, läßt es ein dumpfes, dem des Schweines ähnliches Grunzen vernehmen. Bei diesen Bewegungen fallen oft einzelne Stacheln aus. Trotz des furchtbaren Klapperns und Rasselns ist das Tier ein vollkommen ungefährliches, harmloses Geschöpf, das leicht erschrickt, jedem aus dem Wege geht und kaum daran denkt, von seinen scharfen Zähnen Gebrauch zu machen. Auch die Stacheln sind keineswegs Angriffswaffen, sondern nur das einzige Verteidigungsmittel, das der arme Gesell besitzt. Wer ihm unvorsichtig naht, kann durch sie verwundet werden; der gewandte Jäger ergreift das Tier an der Nackenmähne und trägt es mit Leichtigkeit fort. Freilich biegt es sich, wenn man herankommt, mit dem Kopf zurück, hebt die Stacheln des Rückens vorwärts und läuft einige Schritte auf den Gegner los; allein ein vorgehaltener Stock wehrt die Lanzen ab, und ein großes Tuch genügt, um das Tier zu entwaffnen. In der äußersten Not rollt es sich wie ein Igel zusammen, und dann ist es allerdings schwierig, es aufzuheben. Im allgemeinen aber kann man sagen, daß es, so furchtbar bewehrt es auch scheint, jedem geschickten Feinde erliegt. Der Leopard z. B. tötet den armen Stachelhelden durch einen einzigen Tatzenschlag auf den Kopf, ohne sich Schaden zuzufügen.
Die geistigen Eigenschaften unseres Stachelschweines sind ebenso gering wie die seiner Verwandten; man kann kaum von Verstand reden, obgleich eine gewisse Begabung sich nicht verkennen läßt. Unter den Sinnen dürfte der Geruch der entwickeltste sein; Gesicht und Gehör sind stumpf.
Nach dem verschiedenen Klima der Heimatsorte ändert sich auch die Zeit der Paarung. Man kann annehmen, daß sie überall in den Anfang des Frühlings fällt, in Nordafrika in den Januar, in Südeuropa in den April. Um diese Zeit suchen die Männchen ihre Weibchen auf, und beide leben mehrere Tage zusammen. Sechzig bis siebzig Tage nach der Begattung wirft das Weibchen in seiner Höhle auf ein ziemlich weiches und mit Blättern, Wurzeln und Kräutern ausgepolstertes Nest zwei bis vier Junge. Die Tierchen kommen mit offenen Augen und kurzen, weichen, eng an dem Körper anliegenden Stacheln zur Welt, diese aber erhärten sehr bald und wachsen außerordentlich rasch, obschon sie ihre volle Länge erst mit dem höheren Alter erreichen. Sobald die Jungen fähig sind, ihre Nahrung sich zu erwerben, verlassen sie die Mutter.
Man kann eigentlich nicht sagen, daß das Stachelschwein dem Menschen Schaden bringt; denn es ist nirgends häufig, und die Verwüstungen, die es zeitweilig in den seiner Höhle nahegelegenen Gärten anrichtet, kommen kaum in Betracht. Da, wo es lebt, hält es sich in Einöden auf und wird deshalb selten lästig. Gleichwohl verfolgt man es eifrig. Die Stacheln finden vielfache Anwendung, und auch das Fleisch wird hier und da benutzt. Man fängt den ungeschickten Wanderer entweder in Schlagfallen, die man vor seiner Höhle aufstellt, oder läßt ihn durch eingeübte Hunde bei seinen nächtlichen Ausgängen festmachen und nimmt ihn einfach vom Boden auf oder tötet ihn vorher mit einem Schlag auf die Nase. In der römischen Campagna gilt seine Jagd als ein besonderes Vergnügen; es läßt sich auch gar nicht leugnen, daß die Art und Weise, wie man dem Tier hier nachstellt, etwas Absonderliches und Anziehendes hat. Das Stachelschwein legt seine Höhlen am liebsten in den tiefen Gräben an, die die Campagna durchfurchen, und streift, wenn es zur Nachtzeit ausgeht, selten weit umher. In dunkler Nacht nun zieht man mit gut abgerichteten Hunden zur Jagd hinaus, bringt diese auf die Fährte des Wildes und läßt sie suchen. Ein lautes, zorniges Bellen verkündet, daß sie einem der Stachelhelden auf den Leib gerückt sind, und zeigt zugleich die Gegend an, in der der Kampf zwischen beiden stattfindet – falls man überhaupt von Kampf reden kann. Jetzt zünden alle Jäger bereitgehaltene Fackeln an und nähern sich damit dem Schauplatz. Sobald die Hunde die Ankunft ihrer Herren bemerken, heulen sie laut vor Freude und gehen wütend auf ihren Widerpart los. Das Stachelschwein seinerseits sucht sie zurückzutreiben, indem es in allen Tonarten rasselt, grunzt und knurrt und sich soviel wie möglich durch seine nach allen Seiten abstehenden Speere zu schützen sucht. Schließlich bildet die Jagdgenossenschaft einen Kreis um das Tier und seine Verfolger, und bei der grellen Beleuchtung der Fackeln wird es leicht, es in der vorher angegebenen Weise zu bewältigen und entweder zu töten oder lebend mit nach Hause zu nehmen. Italiener ziehen mit gezähmten Tieren von Dorf zu Dorf und zeigen das auffallende Geschöpf dort für Geld. Bei nur einiger Pflege ist es leicht, das Stachelschwein acht bis zehn Jahre lang in der Gefangenschaft zu erhalten. Wenn man es gut behandelt, wird es auch leicht zahm. Jung eingefangene lernen ihre Pfleger kennen und folgen ihnen nach wie ein Hund.
*
Als äußerliche Kennzeichen der Familie der Hufpfötler oder Ferkelhasen ( Caviina) gelten ein mehr oder weniger gestreckter, auf hohen Beinen ruhender Leib, vierzehige Vorder- und drei- bis fünfzehige, mit großen, hufartigen, oben gekielten Nägeln bekleidete, nacktsohlige Füße, ein stummelhafter Schwanz, mehr oder minder große Ohren und grobe Behaarung. Alle Ferkelhasen bewohnen ausschließlich Süd- und Mittelamerika, hier aber die verschiedensten Gegenden: die einen Ebenen, die andern Wälder und trockene Strecken, Sümpfe, Felsenwände und selbst das Wasser. Diese verbergen sich in den Löchern hohler Stämme, Felsenritzen, in Hecken und Gebüschen, jene in selbstgegrabenen oder verlassenen Höhlen andrer Tiere. Fast alle leben gesellig und sind mehr des Nachts als bei Tage rege. Ihre Nahrung besteht aus Pflanzenstoffen aller Art: aus Gräsern, Kräutern, Blüten und Blättern, Wurzeln, Kohl, Samen, Früchten und Baumrinde. Beim Fressen sitzen sie in aufrechter Stellung auf dem Hinterteil und halten die Nahrung zwischen den Vorderpfoten fest. Ihre Bewegungen sind gewandt, wenn auch der gewöhnliche Gang ziemlich langsam ist. Einzelne gehen in das Wasser und schwimmen mit großer Geschicklichkeit und Ausdauer. Alle sind friedlich und harmlos, scheu, die kleinen sehr schüchtern, ängstlich und sanft, die größeren etwas mutiger; doch flüchten sie auch bei herannahender Gefahr, so schnell sie können. Unter ihren Sinnen sind Geruch und Gehör am besten ausgebildet, ihre geistigen Fähigkeiten gering. Sie lassen sich leicht zähmen, gewöhnen sich an den Menschen und lernen ihn auch wohl kennen, ohne sich jedoch inniger mit ihm zu befreunden. Ihre Vermehrung ist sehr groß; die Zahl der Jungen schwankt zwischen eins und acht, und manche Arten werfen mehrmals im Jahre.
Unser allbekanntes Meerschweinchen ( Cavia cobaya) teilt das Schicksal vieler Haustiere: man vermag seine Stammeltern mit Sicherheit nicht zu bestimmen. Soviel wir wissen, ist das Tierchen bald nach der Entdeckung Amerikas, im sechzehnten Jahrhundert also, und zwar durch die Holländer, zu uns gebracht worden. Geßner kennt es bereits. »Das Indianisch Känele (Kaninchen) oder Seuwle«, sagt sein Übersetzer in dem im Jahre 1583 erschienenen Tierbuche, »ist bey kurzen jaren auß dem neüwerfundenen land in vnsern teil deß erdtreichs gebracht worden, jetz gantz gemein: dann es ist ein überaus fruchtbar thier, dieweyl es acht oder neun Junge in einer burt harfür gebiert usw.« Von jener Zeit an hat man es fort und fort gezüchtet, noch heutigen Tags aber über den Stammvater sich nicht entscheiden können. Wahrscheinlich stammt es von einer heute noch in Peru wildlebenden Meerschweinchenart ( Cavia cutlari) ab.
Unser Meerschweinchen gehört zu den beliebtesten Haustieren aus der ganzen Ordnung der Nager, ebensowohl seiner Genügsamkeit wie seiner Harmlosigkeit und Gutmütigkeit halber. Wenn man ihm einen lustigen und trockenen Stall gibt, ist es überall leicht zu erhalten. Es frißt die verschiedensten Pflanzenstoffe, von der Wurzel an bis zu den Blättern, Körner ebensogut wie frische, saftige Pflanzen, und verlangt nur etwas Abwechselung in der Nahrung. Wenn es saftiges Futter hat, kann es Getränk ganz entbehren, obwohl es namentlich Milch recht gern zu sich nimmt. Es läßt sich überaus viel gefallen und verträgt selbst Mißhandlungen mit Gleichmut. Deshalb ist es ein höchst angenehmes Spielzeug für Kinder, die sich überhaupt am eifrigsten mit seiner Zucht abgeben. In seinem Wesen erinnert es in mancher Hinsicht an die Kaninchen, in andrer wieder an die Mäuse. Der Gang ist eben nicht rasch und besteht mehr aus Sprungschritten; doch ist das Tier nicht tölpelhaft, sondern ziemlich gewandt. In der Ruhe sitzt es gewöhnlich auf allen vier Füßen, den Leib platt auf den Boden gedrückt; es kann sich aber auch auf dem Hinterteil aufrichten. Beim Fressen führt es oft seine Nahrung mit den Vorderfüßen zum Munde. Es läuft ohne Unterbrechung in seinem Stalle umher, am liebsten längs der Mauern hin, wo es sich bald einen glatt getretenen Weg bahnt. Recht hübsch sieht es aus, wenn eine ganze Anzahl beisammen ist. Dann folgt eins dem andern, und die ganze Reihe umkreist den Stall vielleicht hundertmal ohne Unterbrechung. Die Stimme besteht aus einem Grunzen, das ihm wohl den Namen Schwein verschafft hat, und aus einem eigentümlichen Murmeln und Quieken. Das Murmeln scheint Behaglichkeit auszudrücken, während das Quieken immer Aufregung anzeigt.
Männchen und Weibchen halten sich zusammen und behandeln einander zärtlich. Reinlich, wie die meisten Nager es sind, leckt eins das andere und benutzt auch wohl die Vorderfüße, um dem Gatten das Fell glattzukämmen. Schläft eins von dem Paar, so wacht das andre für seine Sicherheit; währt es ihm aber zu lange, so sucht es durch Lecken und Kämmen den Schläfer zu ermuntern, und sobald dieser die Augen auftut, nickt es dafür ein und läßt nun sich bewachen. Das Männchen treibt sein Weibchen oft vor sich her und sucht ihm seine Liebe und Anhänglichkeit auf jede Weise an den Tag zu legen. Auch die gleichen Geschlechter vertragen sich recht gut, solange die Freßsucht nicht ins Spiel kommt oder es sich nicht darum handelt, den besten Platz beim Fressen oder Ruhen zu erhalten. Zwei verliebte Männchen, die um eine Gattin streiten, geraten oft in Zorn, knirschen mit den Zähnen, stampfen auf den Boden und treten sich gegenseitig mit den Hinterfüßen, packen sich auch wohl an den Haaren; ja, es kommt sogar zu Kämpfen, bei denen die Zähne tüchtig gebraucht werden und manchmal ernste Verwundungen vorkommen. Der Streit und jeder Kampf enden erst dann, wenn sich ein Männchen entschieden in den Besitz eines Weibchens gesetzt hat oder in dem Kampf Sieger geblieben ist.
Wenige Säugetiere kommen dem Meerschweinchen an Fruchtbarkeit gleich. Das Weibchen wirft zwei- oder dreimal im Jahre zwei bis drei, selten mehr Junge. Die Kleinen kommen vollständig entwickelt zur Welt, werden mit offenen Augen geboren und sind schon wenige Stunden nach ihrer Geburt imstande, mit ihrer Mutter umherzulaufen. Am zweiten Tage ihres Lebens sitzen sie manchmal bereits mit bei der Mahlzeit und lassen sich die grünen Pflanzen, ja sogar die Körner, fast ebenso gut schmecken wie jene. Gleichwohl säugt sie die Mutter vierzehn Tage lang und zeigt während dieser Zeit viel Liebe und Sorgfalt für sie, verteidigt sie, hält sie zusammen, leitet sie zum Fressen an usw. Sowie die Kleinen verständiger werden, erkaltet diese heiße Liebe, und nach ungefähr drei Wochen, zu der Zeit die Alte regelmäßig schon wieder sich gepaart hat, bekümmert sie sich gar nicht mehr um die früheren Sprößlinge. Der Vater zeigt sich von allem Anfang an sehr gleichgültig, sogar feindselig, und oft kommt es vor, daß er sie tot beißt und auffrißt. Nach ungefähr acht Monaten sind die Jungen ausgewachsen und fortpflanzungsfähig, nach acht bis neun Monaten haben sie ihre vollkommene Größe erreicht. Bei guter Behandlung können sie ihr Leben auf sechs bis acht Jahre bringen.
Wenn man sich viel mit Meerschweinchen beschäftigt, kann man sie ungemein zahm machen, obwohl sie ihre Furchtsamkeit nie gänzlich ablegen und bei ihrer geringen geistigen Fähigkeit auch kaum dahin gelangen, den Wärter von anderen zu unterscheiden. Niemals versuchen sie zu beißen oder sonst von ihren natürlichen Waffen Gebrauch zu machen. Das kleinste Kind kann unbesorgt mit ihnen spielen. Oft legen sie eine wahrhaft merkwürdige Gleichgültigkeit gegen äußere Gegenstände an den Tag. So lieb und angenehm ihnen auch ihr Stall zu sein pflegt, so wenig scheinen sie nach ihm zu verlangen, wenn sie wo anders hingebracht werden; sie lassen sich warten und pflegen, auf den Schoß nehmen, mit umherschleppen usw., ohne sich deshalb mißvergnügt zu zeigen. Gegen kalte und nasse Witterung sehr empfindlich, erkranken sie, wenn man sie rauhem Wetter aussetzt, und gehen dann leicht zu Grunde. Eigentlichen Schaden können die Meerschweinchen nie bringen; es müßte denn sein, daß man sie im Zimmer hielte, wo sie vielleicht manchmal durch Benagen unangenehm werden können.
*
Die Agutis oder Gutis ( Dasyprocta) erinnern durch ihre Gestalt auffallend an die Zwergmoschustiere; denn sie sind hochbeinige, untersetzte Nager mit langem, spitzschnäuzigem Kopfe, kleinen runden Ohren, einem nackten Schwanzstummel und Hinterbeinen, die merklich länger als die vorderen sind. Im ganzen haben die Agutis einen leichten, feinen und gefälligen Bau, machen daher einen angenehmen Eindruck. Wir lernen das Leben aller kennen, wenn wir die Beschreibungen über die häufigste Art zusammenstellen.

Aguti ( Dasyprocta aguti)
Der Aguti, Guti oder, wie er seines hübschen Felles wegen auch wohl heißt, der Goldhase ( Dasyprocta Aguti), eines der schmucksten Mitglieder der ganzen Familie, hat dichte und glatt anliegende Behaarung; das rauhe, harte, fast borstenartige Haar besitzt lebhaften Glanz und rötlich-zitronengelbe, mit Schwarzbraun untermischte Färbung, ist drei- bis viermal dunkelschwarzbraun und ebensooft rötlich-zitronengelb geringelt und endet bald mit einem hellen, bald mit einem dunklen Ringe, wodurch eben die gemischte Färbung hervorgerufen wird. Je nach den Jahreszeiten ändert sich die allgemeine Färbung; sie erscheint im Sommer heller und im Winter dunkler. Die Leibeslänge eines erwachsenen Männchens beträgt 40 Zentimeter, die des Schwanzstummels bloß 1,5 Zentimeter.
Guyana, Surinam, Brasilien und das nördliche Peru bilden die Heimat des Guti. An den meisten Orten ist er recht häufig, besonders an den Flußniederungen Brasiliens. Hier wie überall bewohnt er die Wälder, die feuchten Urwälder ebenso wie die trockeneren des inneren Landes, treibt sich aber auch an den angrenzenden grasreichen Ebenen herum und vertritt dort die Stelle der Hasen. Im freien Felde kommt er nicht vor. Gewöhnlich findet man ihn über der Erde, in hohlen Bäumen nahe am Boden, und öfter allein als in Gesellschaft. Bei Tage liegt er ruhig in seinem Lager, und nur da, wo er sich vollkommen sicher glaubt, streift er umher. Mit Sonnenuntergang geht er auf Nahrung aus und verbringt bei guter Witterung die ganze Nacht auf seinen Streifzügen. Er hat, wie Rengger berichtet, die Gewohnheit, seinen Aufenthaltsort mehrmals zu verlassen und wieder dahin zurückzukehren; hierdurch entsteht ein schmaler, oft hundert Meter langer Fußweg, der die Lage des Wohngebietes verrät. Bringt man einen Hund auf diese Fährte, so gelingt es, falls das Lager sich nicht im Dickicht befindet, fast regelmäßig, des Tieres habhaft zu werden.
Der Aguti ist ein harmloses, ängstliches Tierchen und deshalb vielen Gefahren preisgegeben, so daß ihn eigentlich nur die außerordentliche Gewandtheit seiner Bewegungen und die scharfen Sinne vor dem Untergange retten können. Im Springen erinnert er an kleine Antilopen und Moschustiere. Sein Lauf besteht aus Sprungschritten, die aber so schnell aufeinanderfolgen, daß es aussieht, als eile das Tier im gestreckten Galopp dahin. Der ruhige Gang ist ziemlich langsamer Schritt. Unter den Sinnen scheint der Geruch am schärfsten entwickelt, aber auch das Gehör sehr ausgebildet, das Gesicht dagegen ziemlich blöde und der Geschmack keineswegs besonders sein zu sein. Die geistigen Fähigkeiten sind sehr gering. Nur ein gewisser Ortssinn macht sich bemerklich.
Die Nahrung besteht in den verschiedenartigsten Kräutern und Pflanzen, von den Wurzeln an bis zur Blüte oder zum Korn hinauf. Den scharfen Nagezähnen widersteht so leicht kein Pflanzenstoff, sie zerbrechen selbst die härtesten Nüsse. In bebauten Gegenden wird der Guti durch seine Besuche in den Zuckerrohranpflanzungen und Gemüsegärten lästig; doch nur da, wo er sehr häufig ist, richtet er merklichen Schaden an.
Über die Fortpflanzung der freilebenden Agutis fehlen noch genaue Nachrichten. Man weiß, daß sich das Tier ziemlich stark vermehrt, daß die Weibchen in allen Monaten des Jahres trächtig werden und gleichzeitig mehrere Junge zur Welt bringen können. Ein und dasselbe Tier soll zweimal im Jahre werfen, gewöhnlich im Oktober, d. h. zu Anfang der Regenzeit oder des Frühjahrs, das zweitemal einige Monate später, doch noch vor Eintritt der Dürre. Bald nach der Begattung lebt jedes Geschlecht einzeln für sich. Das Weibchen bezieht sein altes Lager wieder und richtet es zur Aufnahme der Jungen ein, d. h. polstert es möglichst dicht mit Blättern, Wurzeln und Haaren aus, bringt aus diesem weichen Lager die Jungen zur Welt, säugt sie mehrere Wochen mit großer Zärtlichkeit und führt sie schließlich noch einige Zeit mit umher, um sie bei den ersten Weidegängen zu unterrichten und zu beschützen. Unter den vielen Feinden, die den Aguti bedrohen, stehen die größeren Katzen und brasilianischen Hunde obenan.
*
Die Paka ( Coelogenys Paca) kennzeichnet sich durch eigentümlich dicken Kopf, große Augen und kleine Ohren, stummelhaften Schwanz, hohe Beine, fünfzehige Vorder- und Hinterfüße, borstiges, dünnanliegendes Haarkleid und besonders durch den merkwürdig ausgedehnten, nach innen mit einer Höhle versehenen Jochbogen. Das Fell besteht aus kurzen, eng am Körper liegenden Haaren, die oben und an den äußeren Teilen gelbbraun, auf der Unterseite der Beine gelblichweiß sind. Fünf Reihen von gelblichweißen Flecken von runder oder eiförmiger Gestalt laufen zu beiden Seiten von der Schulter bis zum hinteren Rande des Schenkels. Die untere Reihe vermischt sich zum Teil mit der Farbe des Körpers. Um den Mund und über den Augen stehen einige steife, rückwärts gerichtete Fühlborsten. Das Ohr ist kurz und wenig behaart, die Sohlen und die Fußspitzen sind nackt. Ausgewachsene Männchen werden 70 Zentimeter lang und etwa 35 Zentimeter hoch.

Paka ( Coelogenys paca)
Die Paka ist über den größten Teil von Südamerika, von Surinam und durch Brasilien bis Paraguay hinauf verbreitet, kommt aber auch auf den südlichen Antillen vor. Je einsamer und wilder die Gegend, um so häufiger findet man sie; in den bevölkerten Teilen ist sie überall selten geworden. Der Saum der Wälder und die bebuschten Ufer von Flüssen oder sumpfige Stellen bilden ihren Aufenthaltsort. Hier gräbt sie sich eine Höhle von ein bis zwei Meter Länge in die Erde und bringt in ihr den ganzen Tag schlafend zu. Mit der Dämmerung geht sie ihrer Nahrung nach und besucht dabei wohl auch die Zuckerrohr- und Melonenpflanzungen, in denen sie bedeutenden Schaden anrichtet. Sonst nährt sie sich von Blättern, Blumen und Früchten der verschiedensten Pflanzen. Sie lebt paarweise und einzeln, ist, laut Tschudi, ungemein scheu und flüchtig, schwimmt auch mit Leichtigkeit über breite Flüsse, kehrt aber gern wieder auf frühere Standorte zurück. Das Weibchen wirft mitten im Sommer ein einziges, höchstens zwei Junge, hält sie, wie die Wilden behaupten, während des Säugens in der Höhle versteckt und führt sie dann noch mehrere Monate mit sich herum.
Die Haut der Paka ist zu dünn und das Haar zu grob, als daß das Fell benutzt werden könnte. In den Monaten Februar und März ist sie außerordentlich fett, und dann ist das Fleisch sehr schmackhaft und beliebt. Die Paka liefert so das vorzüglichste Wildbret Brasiliens, das an Feinheit und Zartheit vielleicht von keinem anderen übertroffen wird. Sie hat eine so dünne und schwache Haut, daß man diese nicht abzieht, sondern das ganze Tier brüht wie ein Schwein.
*
Das Wasserschwein ( Hydrochoerus capybara) darf in einer Hinsicht als der merkwürdigste aller Nager angesehen werden: es ist das größte und plumpeste Mitglied der ganzen Ordnung. Seinen deutschen Namen trägt es mit Recht; denn es erinnert durch seine Gestalt und die borstengleiche Behaarung seines Körpers entschieden an das Schwein. Seine Kennzeichen sind: kleine Ohren, gespaltene Oberlippe, Fehlen des Schwanzes, kurze Schwimmhäute an den Zehen und starke Hufnägel sowie der höchst eigentümliche Zahnbau. Die riesenhaft entwickelten Schneidezähne haben, bei geringer Dicke, mindestens 2 Zentimeter Breite und aus der Vorderseite mehrere flache Rinnen; unter den Backenzähnen ist der letzte ebenso groß wie die drei vorderen. Der Leib ist auffallend plump und dick, der Hals kurz, der Kopf länglich, hoch und breit, stumpfschnäuzig und von eigentümlichem Ausdruck. Ziemlich große, rundliche Augen treten weit hervor; die Ohren sind oben abgerundet und am vorderen Rande umgestülpt, hinten abgeschnitten. Die hinteren Beine sind deutlich länger als die vorderen, die Vorderfüße vierzehig, die hinteren dreizehig. Von einer bestimmten Färbung des dünnen, groben Pelzes kann man nicht reden; ein ungewisses Braun mit einem Anstrich von Rot oder Bräunlichgelb verteilt sich über den Leib, ohne irgendwo scharf hervorzutreten. Ein erwachsenes Wasserschwein erreicht ungefähr die Größe eines jährigen Hausschweines und ein Gewicht von beinahe einem Zentner. Die Körperlänge beträgt über einen Meter, die Höhe am Widerrist 50 Zentimeter und mehr.

Wasserschwein ( Hydrochoerus capybara)
Neuere Beobachter haben das Tier ausführlich beschrieben. Die Capybara ist über ganz Südamerika verbreitet und findet sich vom Orinoko bis zum La Plata oder vom Atlantischen Meer bis zu den Vorbergen der Andes. Niedere, waldige, sumpfige Gegenden, zumal Flüsse und die Ränder von Seen und Sümpfen bilden ihre Aufenthaltsorte. Am liebsten lebt sie an großen Strömen, verläßt diese auch niemals, und wenn es geschieht, nur, indem sie dem Laufe kleiner einmündender Bäche oder Gräben folgt. Hier und da ist sie ungemein häufig, an bewohnten Stellen begreiflicherweise seltener als in der Wildnis. Dort wird sie nur abends und morgens gesehen, in menschenleeren, wenig besuchten Flußtälern dagegen bemerkt man sie auch bei Tage in Massen, immer in nächster Nähe des Flusses, entweder weidend oder wie ein Hund auf den zusammengezogenen Hinterbeinen sitzend. In dieser Stellung scheinen die sonderbaren Zwittergeschöpfe zwischen Nagern und Dickhäutern am liebsten auszuruhen, wenigstens sieht man sie nur höchst selten auf dem Bauche liegend.
Der Gang ist ein langsamer Schritt, der Lauf nicht anhaltend; im Notfalle springt das Tier aber auch in Sätzen. Dagegen schwimmt es vortrefflich und setzt mit Leichtigkeit über Gewässer, tut dies jedoch bloß dann, wenn es verfolgt oder wenn ihm die Nahrung an der einen Seite des Flusses knapp geworden ist. So fest es an einem bestimmten Gebiete hält, so regelmäßig verläßt es dasselbe, wenn es Verfolgungen erleidet. Ein eigentliches Lager hat es nicht, obwohl es sich an bevorzugten Plätzen des Ufers regelmäßig aufhält. Seine Nahrung besteht aus Wasserpflanzen und aus der Rinde junger Bäume, und nur da, wo es nahe an Pflanzungen wohnt, fällt es zuweilen über Wassermelonen oder Mais, Reis und Zuckerrohr her und richtet dann unter Umständen sehr bedeutenden Schaden an.
Das Wasserschwein ist ein stilles und ruhiges Tier. Schon auf den ersten Anblick wird es jedermann klar, daß man es mit einem höchst stumpfsinnigen und geistesarmen Geschöpfe zu tun hat. Niemals sieht man es mit anderen seiner Art spielen. Entweder gehen die Mitglieder einer Herde langsamen Schrittes ihrer Nahrung nach oder ruhen in sitzender Stellung. Von Zeit zu Zeit kehren sie den Kopf um, um zu sehen, ob sich ein Feind zeigt. Begegnen sie einem solchen, so eilen sie nicht, die Flucht zu ergreifen, sondern laufen langsam dem Wasser zu. Ein ungeheurer Schrecken ergreift sie aber, wenn sich plötzlich ein Feind in ihrer Mitte zeigt. Dann stürzen sie mit einem Schrei ins Wasser und tauchen unter. Wenn sie nicht gewohnt sind, Menschen zu sehen, betrachten sie diese oft lange, ehe sie entfliehen. Man hört sie keinen andern Laut von sich geben als jenes Notgeschrei, das Azara durch »Ap« ausdrückt. Dieses Geschrei ist aber so durchdringend, daß man es viertelstundenweit vernehmen kann.
Das Weibchen wirft nur einmal im Jahre fünf bis sechs Junge. Ob dieses in einem besonders dazu bereiteten Lager geschieht, hat man nicht ermitteln können. Die Ferkelchen folgen ihrer Mutter sogleich, bekunden jedoch nur wenig Anhänglichkeit an sie. Nach Azaras Beobachtungen soll ein Männchen zwei oder drei Weibchen mit sich führen.
Die weißen Eingeborenen Südamerikas jagen das Wasserschwein zu ihrer Belustigung, indem sie es unvermutet überfallen, ihm den Weg abschneiden und es mit ihren Wurfschlingen zu Boden reißen. Häufiger jagt man es vom Strome aus. »In einem jener leichten Kanoes«, sagt Hensel, »das nur einen Menschen faßt, pirscht man ohne hörbaren Ruderschlag in den stillen Buchten der großen Gewässer, wo die Capybara häufiger ist. Schon in einiger Entfernung hört man das Knirschen und Raspeln der mächtigen Backenzähne, die die Wasserpflanzen verarbeiten, und kann man sich ohne Geräusch nähern, so gewahrt man bald das plumpe Tier, wie es, halb im Wasser stehend, an den Pontederien sich gütlich tut.« Wird das Wasserschwein bloß angeschossen, so stürzt es sogleich ins Wasser, sucht aber bald wieder das Land zu gewinnen, wenn es durch die Verwundung sich nicht entkräftet fühlt. Im Notfalle verteidigt sich das angeschossene Wasserschwein noch kräftig mit den Zähnen und bringt seinem Gegner nicht selten schwere Wunden bei. Auf das im Wasser schwimmende Tier zu schießen, ist nicht ratsam, weil es, wenn es rasch getötet wird, unter- und verlorengeht. Außer dem Menschen dürfte der Jaguar der schlimmste Feind der Capybara sein. Tag und Nacht ist dieser schlaue Räuber auf ihrer Fährte, und an den Flußniederungen ist sie wahrscheinlich die häufigste Beute, die der Katze überhaupt zum Opfer fällt.
Erst in der Neuzeit ist man bekannter geworden mit den Mitgliedern einer kleinen Familie amerikanischer Tiere, deren Felle schon seit alten Zeiten von den Ureingebornen Südamerikas benutzt und auch seit Ende vorigen Jahrhunderts in großen Massen nach Europa übergeführt wurden. Die Hasenmäuse oder Chinchillen [sprich Tschintschiljen] ( Chinchillina) scheinen Mittelglieder zu sein zwischen den Mäusen und Hasen. Wenn man sie Kaninchen mit langem Buschschwanze nennt, hat man ihre kürzeste Beschreibung gegeben. Doch unterscheidet sie von den Hasen scharf und bestimmt das Gebiß. Der feinste Pelz, den Säugetiere überhaupt tragen, deckt ihren Leib. Seine Färbung ist ein lichtes Grau mit Weiß und Schwarzbraun oder Gelb. Alle Chinchillen bewohnen Südamerika, und zwar größtenteils das Gebirge noch in bedeutender Höhe zwischen den kahlen Felsen unter der Schneegrenze. Ihre Vermehrung ist ungefähr ebenso groß wie die der Hasen. Sie ertragen die Gefangenschaft leicht und erfreuen durch Reinlichkeit und Zahmheit. Alle Arten nützen durch ihr Fleisch und ihr wahrhaft kostbares Fell.
Die Chinchillas ( Eriomys) zeichnen sich durch dicken Kopf, breite, gerundete Ohren, fünfzehige Vorder-, vierzehige Hinterfüße und den langen, außerordentlich weichen und seidenhaarigen Pelz vor ihren Verwandten aus. Man kennt bloß zwei Arten dieser Tiere, die Chinchilla ( Eriomys Chinchilla) und die Wollmaus ( Eriomys lanigera). Erstere wird 30 Zentimeter lang und trägt einen 13 Zentimeter, mit den Haaren aber 20 Zentimeter langen Schwanz. Der gleichmäßige, feine, überaus weiche Pelz ist auf dem Rücken und an den Seiten mehr als 2 Zentimeter lang; die Haare sind an der Wurzel tiefblaugrau, sodann breit weiß geringelt und an der Spitze dunkelgrau. Hierdurch erscheint die allgemeine Färbung silberfarben, dunkel angeflogen. Die Unterseite und die Füße sind rein weiß; der Schwanz hat oben zwei dunkle Binden; die Schnurren sehen an ihrer Wurzel schwarzbraun, an der Spitze graubraun aus. Die großen Augen sind schwarz.
Der Reisende, der von der westlichen Küste Südamerikas die Kordilleren emporklimmt, gewahrt, wenn er einmal eine Höhe von zwei- bis dreitausend Meter erreicht hat, oft meilenweit alle Felsen von dieser Chinchilla bedeckt. Auch bei hellen Tagen sieht man die Chinchillas vor ihren Höhlen sitzen, aber nie auf der Sonnenseite der Felsen, sondern immer im tiefsten Schatten. Noch häufiger gewahrt man sie in den Früh- und Abendstunden. Sie beleben dann das Gebirge und zumal die Grate unfruchtbarer, steiniger und felsiger Gegenden, wo die Pflanzenwelt nur noch in dürftigster Weise sich zeigt. Gerade an den scheinbar ganz kahlen Felswänden treiben sie sich umher, ungemein schnell und lebhaft sich bewegend. Mit überraschender Leichtigkeit klettern sie an Wänden hin und her, die scheinbar gar keinen Ansatz bieten. Sie steigen sechs bis zehn Meter senkrecht empor, mit einer Gewandtheit und Schnelligkeit, daß man ihnen mit dem Auge kaum folgen kann. Obwohl nicht gerade scheu, lassen sie sich doch nicht nahe auf den Leib rücken und verschwinden augenblicklich, sobald man Miene macht, sie zu verfolgen. Eine Felswand, die mit Hunderten bedeckt ist, erscheint noch in derselben Minute tot und leer, in der man einen Schuß gegen sie abfeuert. Jede Chinchilla hat im Nu eine Felsenspalte betreten und ist in ihr verschwunden, als ob sie durch Zauber dem Auge entrückt wäre. Manchmal kommt es vor, daß der Reisende, der, ohne den Tieren etwas zuleide zu tun, oben in jenen Höhen Rast hält, geradezu umlagert wird von diesen Felsenbewohnern. Das Gestein wird nach und nach lebendig; aus jeder Ritze, aus jeder Spalte lugt ein Kopf hervor. Die neugierigsten und vertrauendsten Chinchillas wagen sich wohl auch noch näher herbei und laufen schließlich ungescheucht unter den Beinen der werdenden Maultiere herum. Ihr Lauf ist mehr eine Art von Springen als ein Gang, erinnert aber an die Bewegungen unserer Mäuse. Wenn sie ruhen, sitzen sie auf dem Hinterteil, mit an die Brust gezogenen Vorderbeinen, den Schwanz nach hinten gestreckt; sie können sich jedoch auch ganz frei auf den Hinterbeinen erheben und eine Zeitlang in dieser Stellung erhalten. Beim Klettern greifen sie mit allen vier Füßen in die Ritzen des Gesteins ein, und die geringste Unebenheit genügt ihnen, um mit vollständiger Sicherheit Fuß zu fassen. Alle Beobachter stimmen in der Angabe überein, daß dieses Tier es meisterhaft verstehe, auch die ödeste und traurigste Gebirgsgegend zu beleben und somit dem Menschen, der einsam und verlassen dort oben dahinzieht, Unterhaltung und Erheiterung zu bieten.
Über die Fortpflanzung der Chinchilla ist noch nichts Sicheres bekannt. Man hat zu jeder Zeit des Jahres trächtige Weibchen gefunden und von den Eingeborenen erfahren, daß die Anzahl der Jungen zwischen vier und sechs schwanke. Die Jungen werden selbständig, sobald sie die Felsenritzen verlassen können, in denen sie das Licht der Welt erblickten, und die Alte scheint sich von dem Augenblicke des Auslaufens an nicht mehr um ihre Nachkommenschaft zu kümmern.
In ihrem Vaterlande wird die Chinchilla oft zahm gehalten. Die Anmut ihrer Bewegungen, ihre Reinlichkeit und die Leichtigkeit, mit der sie sich in ihr Schicksal findet, erwerben ihr bald die Freundschaft des Menschen. Sie zeigt sich so harmlos und zutraulich, daß man sie frei im Hause und in den Zimmern umherlaufen lassen kann. Nur durch ihre Neugier wird sie lästig; denn sie untersucht alles, was sie auf ihrem Wege findet, und selbst die Geräte, die höher gestellt sind, weil es ihr eine Kleinigkeit ist, an Tisch und Schränken emporzuklimmen. Nicht selten springt sie den Leuten plötzlich auf Kopf und Schultern. Ihre geistigen Fähigkeiten stehen ungefähr auf gleicher Stufe mit denen unseres Kaninchens oder Meerschweinchens. Niemals legt sie ihre Furchtsamkeit ab. Mit trockenen Kräutern ist sie leicht zu erhalten. Im Freien frißt sie Gräser, Wurzeln und Moose, setzt sich dabei auf das Hinterteil und bedient sich der Vorderpfoten, um ihre Speise zum Munde zu führen.
In früheren Zeiten soll die Chinchilla bis zum Meere herab auf allen Bergen ebenso häufig vorgekommen sein als in der Höhe; gegenwärtig findet man sie bloß hier und da, und immer nur sehr einzeln, in dem tieferen Gebirge. Die unablässige Verfolgung, der sie ihres Felles wegen ausgesetzt ist, hat sie in die Höhe getrieben. Man hat schon von alters her ihr eifrig nachgestellt und wendet auch jetzt noch fast genau dieselben Jagdweisen an als früher. Die Europäer erlegen sie zwar ab und zu mit dem Feuergewehr oder mit der Armbrust; doch bleibt diese Jagd immer eine mißliche Sache, denn wenn eine Chinchilla nicht so getroffen wird, daß sie augenblicklich verendet, schlüpft sie regelmäßig noch in eine ihrer Felsenritzen und ist dann für den Jäger verloren. Weit sicherer ist die Jagdart der Indianer. Diese stellen gut gearbeitete Schlingen vor allen Felsenspalten auf, zu denen sie gelangen können, und lösen am anderen Morgen die Chinchillas aus, die sich in diesen Schlingen gefangen haben. Außerdem betreibt man leidenschaftlich gern die Jagd, die wir ebenfalls bei den Kaninchen anwenden. Die Indianer verstehen es meisterhaft, das peruanische Wiesel zu zähmen und zur Jagd der Chinchillas abzurichten; dann verfährt man genau so wie unsere Frettchenjäger. In seinen »Reisen durch Südamerika« erwähnt Tschudi, daß ein einziger Kaufmann in Molinos, der westlichsten Ortschaft der Platastaaten, früher alljährlich zwei- bis dreitausend Dutzend Chinchillafelle ausführte, schon im Jahre 1857 aber nur noch sechshundert Dutzend in den Handel bringen konnte.
In Nord- und Mittelchile wird die Chinchilla durch die Wollmaus ersetzt. In der Lebensweise scheint diese Art ganz der vorigen zu ähneln, wie sie ihr auch in der äußeren Gestaltung und der Färbung des Pelzes nahe steht. Sie ist aber viel kleiner; denn ihre gesamte Länge beträgt höchstens 35 bis 40 Zentimeter, wovon der Schwanz ungefähr ein Drittel wegnimmt. Das Fell ist vielleicht noch schöner und weicher als das ihrer Verwandten. Die Südamerikaner essen das Fleisch beider Chinchillas sehr gern, und auch europäische Reisende scheinen sich mit ihm befreundet zu haben, obwohl sie sagen, daß man es mit dem unseres Hasen nicht vergleichen könne.
*
An das Ende der Ordnung stellen wir die Hasen ( Leporina), eine so ausgezeichnete Familie, daß man dieser den Wert einer Unterordnung ( Leporida) zuspricht. Sie sind die einzigen Nager, die mehr als zwei Vorderzähne haben; denn hinter den scharfen und breiten Nagezähnen stehen zwei wirkliche Schneidezähne, kleine, stumpfe, fast vierseitige Stifte. Hierdurch erhält das Gebiß ein so eigentümliches Gepräge, daß die Hasen geradezu einzig dastehen. Die allgemeinen Kennzeichen der Hasen sind: gestreckter Körper mit hohen Hinterbeinen, langer, gestreckter Schädel mit großen Ohren und Augen, fünfzehige Vorder- und vierzehige Hinterfüße, dicke, höchst bewegliche, tief gespaltene Lippen mit starken Schnurren zu beiden Seiten und eine dichte, fast wollige Behaarung. So wenig Arten die Familie auch enthält, über einen um so größeren Raum der Erde ist sie verbreitet. Mit alleiniger Ausnahme Neuhollands und seiner Inseln beherbergen alle Erdteile Hasen. Sie finden sich in allen Klimaten, in Ebenen und Gebirgen, in offenen Feldern und Felsenritzen, auf und unter der Erde, kurz überall, und wo die eine Art aufhört, beginnt eine andere, die Gegend, die von dieser nicht ausgebeutet wird, besitzt in einer anderen einen zufriedenen Bewohner.
Lampe, der Feldhase ( Lepus vulgaris), ein derber Nager von 75 Zentimeter Gesamtlänge, wovon nur 8 Zentimeter auf den Schwanz kommen, 30 Zentimeter Höhe und 6 bis 9 Pfund Gewicht, ist der bei uns heimische Vertreter dieser Sippe. Die Färbung seines Balges ist mit wenig Worten schwer zu beschreiben. Der Pelz besteht aus kurzen Wollen- und langen Grannenhaaren; erstere stehen sehr dicht und sind stark gekräuselt, die Grannen stark, lang und auch etwas gekräuselt. Das Unterhaar ist auf der Unterseite der Kehle rein weiß, an den Seiten weiß, auf der Oberseite weiß mit schwarzbraunen Enden, auf dem Oberhalse dunkelrot, im Genicke an der Spitze weiß, das Oberhaar der Oberseite grau am Grunde, am Ende braunschwarz, rostgelb geringelt; doch finden sich auch viele ganz schwarze Haare darunter. Hierdurch erhält der Pelz eine echte Erdfarbe. Er ist auf der Oberseite braungelb mit schwarzer Sprenkelung, am Halse gelbbraun, weißlich überlaufen, nach hinten weißgrau, an der Unterseite weiß. Nun ändert die Färbung auch im Sommer und Winter regelmäßig ab, und die Häsin sieht röter aus als der Hase; es kommen verschiedene Abänderungen, gelbe, gescheckte, weiße Hasen vor, kurz, die Färbung kann eine sehr mannigfache sein. Immer aber ist sie vortrefflich geeignet, unseren Nager, wenn er auf der Erde ruht, den Blicken seiner Gegner zu entrücken. Schon in einer geringen Entfernung ähnelt die Gesamtfärbung der Umgebung so, daß man den Balg nicht von der Erde unterscheiden kann. Die jungen Hasen zeichnen sich häufig durch den sogenannten Stern oder eine Blesse auf der Stirn aus; in seltenen Fällen tragen sie diese Färbung auch in ein höheres Alter hinüber.
Lampe führt mehrere Namen, je nach Geschlecht und Vorkommen. Man unterscheidet Berg- und Feldhasen, Wald- und Holzhasen, Grund-, Sumpf- und Moorhasen, Sandhasen usw. Der alte männliche Hase heißt Rammler, der weibliche Häsin oder Satzhase; unter Halbwüchsigen versteht man die Jungen, unter Dreiläufern die, die drei Viertel ihrer vollkommenen Größe erreicht haben. Die Ohren heißen in der Weidmannssprache Löffel, die Augen Seher, die Füße Läufe; das Haar wird Wolle, der Schwanz Blume, die Haut Balg genannt. Im übrigen wendet man auf sein Leben noch folgende Ausdrücke an. Der Hase äst oder nimmt seine Weide, er sitzt oder drückt sich, er rückt ins Feld, um Äsung zu suchen, und ins Holz, um zu ruhen, er fährt ins Lager oder in die Vertiefung, in der er bei Tage schläft, und fährt aus derselben heraus. Er wird von den Menschen aufgestoßen, von den Hunden aufgestochen; er rammelt, die Häsin setzt; er ist gut oder schlecht; er klagt, verendet, wird ausgeweidet und gestreift usw.
Ganz Mitteleuropa und ein kleiner Teil des westlichen Asiens ist die Heimat unseres Hasen. Im Süden vertritt ihn der Hase des Mittelmeers, eine verschiedene Art von geringer Größe und rötlicher Färbung, auf den Hochgebirgen der Alpen-, im hohen Norden der Schneehase, der vielleicht eine von dem Alpenhasen verschiedene, jedenfalls aber sehr ähnliche Art ist. Seine Nordgrenze erreicht er in Schottland, im südlichen Schweden und in Nordrußland, seine Südgrenze in Südfrankreich und Norditalien. Fruchtbare Ebenen mit oder ohne Gehölze und die bewaldeten Vorberge der Gebirge sind die bevorzugten Aufenthaltsorte; doch steigt er in den Alpen bis zu einer Höhe von 1500 Meter über dem Meere und im Kaukasus bis zu 2000 Meter empor. Er zieht gemäßigte den rauhen Ländern entschieden vor und wählt aus Liebe zur Wärme Felder, die unter dem Winde liegen und gedeckt sind. Alte Rammler zeigen sich weniger wählerisch in ihrem Aufenthaltsort als die Häsinnen und Junghasen, lagern sich oft in Büschen, Rohrdickichten und hochgelegenen Berghölzern, während jene in der Wahl ihrer Lager immer sehr sorgfältig zu Werke gehen.
»Im allgemeinen«, sagt Dietrich aus dem Winckell, dessen Lebensschilderung Lampes ich für die gelungenste halte, »ist der Hase mehr Nacht- als Tagtier, obwohl man ihn an heitern Sommertagen auch vor Untergang der Sonne und noch am Morgen im Felde umherstreifen sieht. Höchst ungern verläßt er den Ort, an dem er aufgewachsen und groß geworden ist. Findet er aber in demselben keinen andern Hasen, mit dem er sich paaren kann, oder fehlt es ihm an Äsung, so entfernt er sich weiter als gewöhnlich. Aber der Satzhase kehrt, wenn die Paarungszeit herannaht, wie der Rammler zur Herbstzeit wieder nach der Geburtsstätte zurück. Fortwährende Ruhe hält ihn besonders fest, fortgesetzte Verfolgung vertreibt ihn für immer. Der Feldhase bewohnt größtenteils die Felder und verläßt sie, wenn es regnet. Wird das Stück, in dem er seine Wohnung gebaut hat, abgehauen, so geht er an einen andern Ort, in die Rüben-, Saat-, Krautfelder usw. Hier, überall von kräftiger Äsung umgeben, schwelgt er im Genuß derselben. Alle Kohl- und Rübenarten sind ihm Leckerspeise. Der Petersilie scheint er besondern Vorzug zu geben. Im Spätherbst wählt er nicht zu frische Sturzäcker, nicht zu feuchte, mit Binsen bewachsene Vertiefungen und Felder mit Ölsaat, die nächst dem Wintergetreide den größten Teil seiner Weide ausmacht. Solange noch gar kein oder wenig Schnee liegt, verändert er seinen Wohnort nicht; nur bei Nacht geht er in die Gärten und sucht den eingeschlagenen und aufgeschichteten Kohl auf. Fällt starker Schnee, so läßt er sich in seinem Lager verschneien, zieht aber, sobald das Unwetter nachläßt, in die Nähe der Kleefelder. Bekommt der Schnee eine Eisrinde, so nimmt der Mangel immer mehr überhand, und je mehr dies geschieht, um so schädlicher wird der Hase den Gärten und Baumschulen. Dann ist ihm die Schale der meisten jungen Bäume, vorzüglich die der Akazie und ganz junger Lärchen, sowie der Schwarzdorn, ebenso willkommen wie der Braunkohl. Vermindert sich durch Tauwetter der Schnee oder geht er ganz weg, so zieht sich der Hase wieder zurück, und dann ist grünes Getreide aller Art seine ausschließliche Weide. Bis die Wintersaat zu schossen anfängt, äst er diese; hierauf rückt er vor Sonnenuntergang oder nach warmem Regen etwas früher aus und geht ins Sommergetreide. Auch diese Saat nimmt er nicht an, wenn sie alt wird, bleibt aber in ihr liegen, besucht abends frisch gepflanzte Krautfelder, Rübenstücke u. dgl. Der Buschhase rückt nur abends auf die Felder und kehrt morgens mit Tagesanbruch oder bald nach Sonnenaufgang wieder ins Holz zurück. Er wechselt aber während des Sommers seinen Aufenthalt am Tage zuweilen mit hochbestandenen Getreidefeldern oder, wenn Regen fällt, mit Brach- und Sturzäckern. Im Herbst, wenn die Sträucher sich entlauben, geht er ganz aus dem Walde heraus, denn das Fallen der Blätter ist ihm entsetzlich; im Winter zieht er sich in die dichtesten Gehölze, mit eintretendem Tauwetter aber kehrt er wieder in das lichtere Holz zurück. Der eigentliche Waldhase zeigt sich während der milden und fruchtbaren Jahreszeit in den Vorhölzern und rückt von hier aus, wenn ihm die Äsung auf den Waldwiesen nicht genügt, gegen Abend in die Felder. Bei starkem Winter geht er in die Dickichte und immer tiefer in den Wald hinein. Er läßt sich auch durch das fallende Laub nicht stören.
Außer der Rammelzeit, während der alles, was Hase heißt, in unaufhörlicher Unruhe ist, bringt dieses Wild den ganzen Tag schlafend oder schlummernd im Lager zu. Nie geht der Hase gerade auf den Ort los, wo er ein altes Lager weiß oder ein neues machen will, sondern läuft erst ein Stück über den Ort, wo er zu ruhen gedenkt, hinaus, kehrt um, macht wieder einige Sätze vorwärts, dann wieder einen Sprung seitwärts, und verfährt so noch einige Male, bis er mit dem weitesten Satze an den Platz kommt, wo er bleiben will. Bei der Zubereitung des Lagers scharrt er im freien Felde eine etwa 5 bis 8 Zentimeter tiefe, am hinteren Ende etwas gewölbte Höhlung in die Erde, die so lang und breit ist, daß der obere Teil des Rückens nur sehr wenig sichtbar bleibt, wenn er in derselben die Vorderläufe ausstreckt, auf diesen den Kopf mit angeschlossenen Löffeln ruhen läßt und die Hinterbeine unter den Leib zusammendrückt. In diesem Lager schützt er sich während der milden Jahreszeit leidlich vor Sturm und Regen. Im Winter höhlt er das Lager gewöhnlich so tief aus, daß man von ihm nichts als einen kleinen, schwarzgrauen Punkt gewahrt. Fast möchte es scheinen, als habe die Natur den Hasen durch Munterkeit, Schnelligkeit und Schlauheit für die ihm angeborene Furchtsamkeit und Scheu zu entschädigen gesucht. Hat er irgendeine Gelegenheit gefunden, unter dem Schutze der Dunkelheit seinen sehr guten Appetit zu stillen, und ist die Witterung nicht ganz ungünstig, so wird kaum ein Morgen vergehen, an dem er sich nicht gleich nach Sonnenaufgang auf trockenen, zumal sandigen Plätzen entweder mit seinesgleichen oder allein herumtummelt. Lustige Sprünge, abwechselnd mit Kreisläufen und Wälzen, sind Äußerungen des Wohlbehagens, in dem er sich so berauscht, daß er seinen ärgsten Feind, den Fuchs, übersehen kann. Der alte Hase läßt sich nicht so leicht überlisten und rettet sich, wenn er gesund und bei Kräften ist, vor den Nachstellungen dieses Erzfeindes fast regelmäßig durch die Flucht. Dabei sucht er durch Widerhaken und Hakenschlagen, das er meisterhaft versteht, seinen Feind zu übertölpeln. Nur wenn er vor raschen Windhunden dahinläuft, sucht er einen andern vorzustoßen und rückt in dessen Wohnung, den vertriebenen Besitzer kaltblütig der Verfolgung überlassend, oder er geht gerade in eine Herde Vieh, fährt in das erste beste Rohrdickicht und schwimmt im Notfalle auch über ziemlich breite Gewässer. Niemals aber wagt er, sich einem lebenden Geschöpf anderer Art zu widersetzen, und nur, wenn Eifersucht ihn reizt, läßt er sich in einen Kampf mit seinesgleichen ein. Zuweilen kommt es vor, Satz ihn eine eingebildete oder wahre Gefahr derart überrascht und aus der Fassung bringt, daß er, jedes Rettungsmittel vergessend, in der größten Angst hin und her läuft, ja wohl gar in ein jämmerliches Klagen ausbricht.« Vor allen unbekannten Dingen hat er überhaupt eine außerordentliche Scheu, und deshalb meidet er auch sorgfältig alle Scheusale, die in den Feldern aufgestellt werden, um ihn abzuhalten. Dagegen kommt es auch vor, daß alte, ausgelernte Hasen sich außerordentlich dreist zeigen, nicht einmal durch Hunde vertreiben lassen und, sobald sie merken, daß diese eingesperrt oder angehängt sind, mit einer Unverschämtheit ohnegleichen an die Gärten herankommen und sozusagen unter den Augen der Hunde äsen.
Die Schnelligkeit des Hasen im Laufe rührt größtenteils daher, daß er stark überbaut ist, d. h., daß seine Hinterläufe länger als die vorderen sind. Hierin liegt auch der Grund, daß er besser bergauf als bergab rennen kann. Wenn er ruhig ist, bewegt er sich in kurzen, langsamen Sprüngen, wenn ihm daran liegt, schnell fortzukommen, in sehr großen Sätzen. Beim Entfliehen hat er die Eigentümlichkeit, daß er ohne besondern Grund in einiger Entfernung von seinem Lager einen Kegel macht, d. h. die Stellung eines aufrechtsitzenden Hundes annimmt; ist er dem ihm nachjagenden Hunde ein Stück voraus, so stellt er sich nicht nur auf die vollständig ausgestreckten Hinterläufe, sondern geht auch wohl so ein paar Schritte vorwärts und dreht sich nach allen Seiten um.
Gewöhnlich gibt er nur dann einen Laut von sich, wenn er sich in Gefahr sieht. Dieses Geschrei ähnelt dem kleiner Kinder und wird mit »Klagen« bezeichnet.
Unter den Sinnen des Hasen ist, wie schon die großen Löffel schließen lassen, das Gehör am besten ausgebildet, der Geruch recht gut, das Gesicht aber ziemlich schwach. Unter seinen geistigen Eigenschaften steht eine außerordentliche Vorsicht und Aufmerksamkeit obenan. Der leiseste Laut, den er vernimmt, der Wind, der durch die Blätter säuselt, ein rauschendes Blatt genügen, um ihn, wenn er schläft, zu erwecken und im hohen Grade aufmerksam zu machen. Eine vorüberhuschende Eidechse oder das Quaken eines Frosches kann ihn von seinem Lager verscheuchen, und selbst, wenn er im vollsten Lauf ist, bedarf es nur eines leisen Pfeifens, um ihn aufzuhalten.
Die Rammelzeit beginnt nach harten Wintern anfangs März, bei gelinderem Wetter schon Ende Februar, im allgemeinen um so eher, je mehr der Hase Nahrung hat. »Zu Anfang der Begattungszeit«, sagt unser Gewährsmann, »schwärmen unaufhörlich Rammler, Häsinnen suchend, umher und folgen der Spur derselben, gleich den Hunden mit zur Erde gesenkter Nase. Sobald ein Paar sich zusammenfindet, beginnt die verliebte Neckerei durch Kreislaufen und Kegelschlagen, wobei anfangs der Satzhase immer der vorderste ist. Aber nicht lange dauert es, so fährt dieser an die Seite, und ehe der Rammler es versieht, gibt ihm die äußerst gefällige Schöne Anleitung, was er tun soll. In möglichster Eile bemüht sich nun der Rammler, seine Gelehrigkeit tätlich zu erweisen, ist aber dabei so ungezogen, im Augenblick des höchsten Entzückens mit den scharfen Nägeln der Geliebten große Klumpen Wolle abzureißen. Kaum erblicken andere seines Geschlechtes den Glücklichen, so eilen sie heran, um ihn zu verdrängen oder wenigstens die Freude des Genusses zu verderben. Anfänglich versucht es jener, seine Schöne zur Flucht zu bewegen; aber aus Gründen, die sich aus der unersättlichen Begierde derselben erklären lassen, zeigt sie nur selten Lust dazu, und so hebt jetzt ein neues Schauspiel an, indem die Häsin von mehreren Bewerbern verfolgt und geneckt, endlich von dem behendesten, der sich den Minnesold nicht leicht entgehen läßt, eingeholt wird. Daß unter solchen Umständen nicht alles ruhig abgehen kann, versteht sich von selbst. Eifersucht erbittert auch Hasengemüter, und so entsteht ein Kampf, zwar nicht auf Leben und Tod, aber höchst lustig für den Beobachter. Zwei, drei und mehrere Rammler fahren zusammen, rennen aneinander, entfernen sich, machen Kegel und Männchen, fahren wieder aufeinander los und bedienen sich dabei mit in ihrer Art ganz kräftigen Ohrfeigen, so daß die Wolle umherfliegt, bis endlich der Stärkste seinen Lohn empfängt, oder noch öfters sich betrogen fühlt, indem sich das Weibchen mit einem der Streiter oder gar mit einem neuen Ankömmling unbemerkt entfernt hat.«
Dreißig Tage etwa geht die Häsin tragend. Gewöhnlich setzt sie zwischen Mitte und Ende des März das erste, im August das vierte und letztemal. Der erste Satz besteht aus mindestens einem oder zwei, der zweite aus drei bis fünf, der dritte aus drei und der vierte wiederum aus ein bis zwei Jungen. Höchst selten nur und nur in sehr günstigen Jahren geschieht es, daß eine Häsin fünfmal setzt. Das Wochenbett ist eine höchst einfache Vertiefung an einem ruhigen Ort des Waldes oder Feldes: ein Misthaufen, die Höhlung eines alten Stockes, angehäuftes Laub oder auch ein bloßes Lager, eine tiefe Furche, ja endlich der flache Boden an allen Orten. Die Jungen kommen mit offenen Augen und jedenfalls schon sehr ausgebildet zur Welt. Die Mutter verweilt nur während der ersten fünf bis sechs Tage bei ihren Kindern, dann aber überläßt sie sie, neuer Genüsse halber, ihrem Schicksal. Nur von Zeit zu Zeit kommt sie noch an den Ort zurück, wo sie die kleine Brut ins Leben setzte, lockt sie durch ein eigentümliches Geklapper mit den Löffeln und läßt sie säugen, wahrscheinlich nur, um sich von der sie beschwerenden Milch zu befreien, nicht etwa aus wirklicher Mutterliebe. Bei Annäherung eines Feindes verläßt sie ihre Kinder regelmäßig, obwohl auch Fälle bekannt sind, daß alte Häsinnen die Brut gegen kleine Raubvögel und Raben verteidigt haben. Im allgemeinen trägt wohl die Lieblosigkeit der Hasenmutter die Hauptschuld, daß so wenige von den gesetzten Jungen auskommen. Von dem ersten Satze gehen die meisten zu Grunde: der Übergang aus dem warmen Mutterleib auf die kalte Erde ist zu grell, das kleine Geschöpf erstarrt und geht ein. Und wenn es wirklich auch das schwache Leben noch fristet, drohen ihm Gefahren aller Art, selbst vom eigenen Vater. Der Rammler benimmt sich wahrhaft abscheulich gegen die jungen Häschen. Er peinigt sie, wenn er kann, zu Tode. »Ich hörte«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »einst einen jungen Hasen klagen, glaubte aber, da es in der Nähe des Dorfes war, ihn in den Klauen einer Katze und eilte dahin, um dieser den Lohn mit einem Schusse zu geben. Statt dessen aber sah ich einen Rammler vor dem Häschen sitzen und ihn mit beiden Vorderläufen von einer Seite zur andern unaufhörlich so maulschellieren, daß das arme Tierchen schon ganz matt geworden war. Dafür mußte aber der alte seine Bosheit mit dem Leben bezahlen.«
Bei keinem andern wildlebenden Tier hat man so viel Mißgeburten beobachtet wie bei den Hasen. Solche, die zwei Köpfe oder wenigstens eine doppelte Zunge haben oder herausstehende Zähne besitzen, sind keine Seltenheiten.
Eine junge Hasenfamilie verläßt nur ungern die Gegend, in der sie geboren wurde. Die Geschwister entfernen sich wenig voneinander, wenn auch jedes sich ein anderes Lager gräbt. Abends rücken sie zusammen auf Äsung aus, morgens gehen sie gemeinschaftlich nach dem Lager zurück, und so währt ihr Treiben, das mit der Zeit ein recht fröhliches und frisches wird, fort, bis sie halbwüchsig sind. Dann trennen sie sich voneinander. Nach fünfzehn Monaten sind sie erwachsen, schon im ersten Lebensjahr aber zur Fortpflanzung geeignet. Sieben bis acht Jahre dürfte die höchste Lebensdauer sein, die der Hase bei uns erreicht; es kommen aber Beispiele vor, daß Hasen allen Nachstellungen noch längere Zeit entgehen und immer noch nicht an Altersschwäche sterben. Im ersten Viertel dieses Jahrhunderts war in meiner Heimat ein Rammler berüchtigt unter den Jägern: mein Vater kannte ihn seit acht Jahren. Stets war es dem Schlaukopf gelungen, sich allen Nachstellungen zu entziehen; erst während eines sehr strengen Winters wurde er von meinem Vater auf dem Anstande erlegt. Beim Wiegen ergab sich, daß er ein Gewicht von achtzehn Pfund erreicht hatte.
Über die weid- und nicht weidgerechte Jagd des Hasen sind Bücher geschrieben worden, und kann es daher nicht meine Absicht sein, auf verschiedene Jagdarten näher einzugehen. Nach meinem Geschmack gewähren dem Jäger die Suche und der Anstand das meiste Vergnügen. Sie halten immer in Spannung und sind des Jägers am meisten würdig. Dieser hat auf der Suche Gelegenheit, sich als Weidmann zu zeigen, und schöpft auf dem Anstande manche Belehrung, weil er die Tiere, nicht die Hasen allein, sozusagen noch in ihrem Hausanzuge antrifft und ihr Benehmen im Zustande gänzlicher Ruhe und Sorglosigkeit beobachten kann. Mancher Jäger zieht den Waldanstand jeder anderen Jagd vor; denn das Süßeste, die Hoffnung, ist hier des Weidmanns treue, unzertrennliche Gefährtin.
Gefangene Hasen werden leicht zahm, gewöhnen sich ohne Weigerung an alle Nahrung, die man den Kaninchen füttert, sind jedoch zart und sterben leicht dahin. Wenn man ihnen nur Heu, Brot, Hafer und Wasser, aber nie Grünes gibt, leben sie länger. Bringt man junge Hasen zu alten, so werden sie regelmäßig von diesen totgebissen. Anderen schwachen Tieren ergeht es selten besser: im Gehege von mir gepflegter Hasen fand ich eine getötete, halb aufgefressene Ratte. Mit Meerschweinchen vertragen sich die Hasen gut, mit Kaninchen und Schneehasen paaren sie sich und erzielen Blendlinge, die wieder fruchtbar sind. Neuerdings wendet man auch in Deutschland der Hasenkaninchenzucht größere Aufmerksamkeit zu und erzielt Erfolge, die den Züchtern genügen.
Jung eingefangene Hasen gewöhnen sich so an den Menschen, daß sie auf dessen Ruf herbeikommen, die Nahrung aus den Händen nehmen und trotz ihrer Dummheit Kunststückchen ausführen lernen; alte dagegen bleiben immer dumm und gewöhnen sich kaum an ihren Pfleger. Die Gefangenen sind nett und munter, verlieren ihre Furchtsamkeit jedoch nicht. »Lächerlich steht es aus«, sagt Lenz, »wenn man in den Stall eines Hasen mit einem weißen Bogen Papier oder sonst einem ähnlichen Dinge eintritt. Der Hase gerät ganz aus der Fassung und springt wie verrückt meterhoch an den Wänden in die Höhe. Anderseits gewöhnen sich Hasen jedoch auch nach und nach selbst an ihre erklärten Feinde. Revierförster Fuchs zu Wildenberg in Unterfranken besaß, wie die Jagdzeitung erzählt, einen ausgewachsenen gezähmten Hasen, der mit den Jagdhunden eine und dieselbe Lagerstätte teilte und besonders die Zuneigung eines auf der Jagd scharfen, jungen Hühnerhundes sich in dem Grade erworben hatte, daß dieser ihm durch Belecken usw. alle Freundschaftsbezeigungen angedeihen ließ, obgleich der Hase ihn und andere Hunde durch Trommeln auf Kopf und Rücken oft sehr rücksichtslos behandelte, auch bald mit diesem, bald mit dem anderen Hunde aus einer Schüssel fraß. Als bemerkenswert fügt der Beobachter noch hinzu, daß besagter Hase nichts lieber fraß als Fleisch jeder Gattung und nur in Ermangelung dessen grünes Futter zu sich nahm. Kalb- und Schweinefleisch, Leber- und Schwartenwurst brachten ihn in Entzücken, so daß er förmlich tanzte, um dieser Leckerbissen teilhaftig zu werden.
Über Nutzen und Schaden des Hasen herrschen verschiedene Ansichten, je nachdem man vom wirtschaftlichen oder jagdlichen Standpunkt urteilt. Der unbefangene Richter wird den Hasen unbedingt als schädliches Tier bezeichnen müssen und behaupten dürfen, daß er mindestens das Doppelte von dem gebraucht, was er auf dem Markt einbringt. In den meisten Gegenden unseres Vaterlandes macht sich dies aus dem Grunde wenig fühlbar, weil der Hase überall zu naschen pflegt und somit seine Plünderungen auf einen großen Raum sich verteilen; wegstreiten aber läßt sich der von ihm verursachte Schaden nicht. Daß dieser gerade an den besten Feld- und Gartenerzeugnissen in hasenbevölkerten, mit wenig oder gar keinem Wald versehenen Feldebenen kein eingebildeter zu nennen ist, wird jedem, der in dieser Angelegenheit tiefer zu schauen Gelegenheit hatte, klar bewußt sein. Der Hase geht nach unseren eingehenden Beobachtungen die besten, zartesten Futtergewächse, wie Klee und Runkelrüben, Kohl, vorzüglich auch Gemüsearten und ebenso die jung ausgepflanzten Gewächse gerade in ihrer Entwicklung an, äst die Ähren der Gerste und des Hafers sehr gern und wird durch seine oft eine Strecke durchs Getreide gehenden Pfädchen mittels Abbeißens und Niedertretens der Halme nachteilig. Dieser Schaden kann bei großer Vermehrung sehr empfindlich Platz greifen, während er bei mäßigem Hasenstande, wie ihn unsere vaterländischen Gegenden aufweisen, nicht erkennbar wird. Denn der Hase liebt es, genäschig, wählerisch und unruhig, wie er ist, hier und da nur weniges zu äsen, auch nie einzeln an einem und demselben Ort länger zu verweilen, und das Zerstörende seiner Tätigkeit beschränkt sich deshalb nicht etwa auf einen Acker, sondern stellt sich als örtlich verschwindende Wirkung von einem Wenigen über weite Strecken dar.
Darf nun auch die Schädlichkeit des Hasen als bewiesen gelten, so ist damit noch keineswegs gesagt, daß man ihn ausrotten soll. Unsere Bauernjäger und Raubschützen sorgen ohnehin für seine Verminderung, und diejenigen, denen er ersichtlich schädlich und lästig wird, haben es in der Hand, seinen Bestand nach Belieben zu verringern. Mit Großgrundbesitzern, die die Freuden der Jagd höher stellen als den Wert der Äsung der aus ihren Grundstücken befindlichen Hasen, ist überhaupt nicht zu rechnen; aber auch denjenigen, die für unbedingte Vertilgung des Nagers sich aussprechen, läßt sich erwidern, daß das Jagdvergnügen und das wohlschmeckende Wildbret des Hasen doch ebenfalls Berücksichtigung verdienen. Somit finde ich es vollkommen begreiflich, daß Großgrundbesitzer neuerdings mit ungleich mehr Sorgfalt als früher Vorkehrungen zur Vermehrung der Hasen treffen.
Außer dem mit Recht geschätzten Wildbret des Hasen nutzt man auch dessen Balg. Von der von Haaren entblößten und gegerbten Haut des Hasen verfertigt man Schuhe und eine Art Pergament, oder benutzt sie zur Leimbereitung. In der alten Arzneikunde spielten Haar, Fett, Blut und Gehirn, selbst Knochen, ja sogar der Kot des Hasen eine bedeutende Rolle, und noch heutigestags wenden abergläubische Menschen Lampes Fell und Fett gegen Krankheiten an. Der Hase genoß denn auch längere Zeit die Ehre, als ein verzaubertes Wesen zu gelten. Die Pfädchen, die er sich im hohen Getreide durchbeißt, werden noch oft für Hexenwerk angesehen und mit dem Namen Hexenstiege belegt.
Der Alpenhase, oft auch Schneehase genannt ( Lepus timidus), unterscheidet sich im Körperbau und Wesen ganz bestimmt vom Feldhasen. »Er ist«, sagt Tschudi, »munterer, lebhafter, dreister, hat einen kürzeren, runderen, gewölbteren Kopf, eine kürzere Nase, kleine Ohren, breitere Backen; die Hinterläufe sind länger, die Sohlen stärker behaart, mit tief gespaltenen, weit ausdehnbaren Zehen, die mit langen, spitzen, krummen, leicht zurückziehbaren Nägeln bewaffnet sind. Die Augen sind nicht, wie bei den krankhaften Spielarten der weißen Kaninchen, weißen Eichhörnchen und weißen Mäuse, rot, sondern dunkler braun als die des Feldhasen. In der Regel ist der Alpenhase etwas kleiner als der Feldhase.«
Nach meinen Beobachtungen an Schneehasen härt er nur einmal, und zwar im Frühjahre, während er gegen den Herbst hin sein Winterkleid durch einfache Verfärbung des einheitlich dunkelbraunen Sommerkleides erhält. Wie beim Eisfuchs und Hermelin währt auch nach der Verfärbung das Wachstum der Haare fort, und es wird deshalb der Pelz mit vorschreitendem Winter immer dichter, bis im Frühjahre das Abstoßen der alten Haare durch die neu hervorsprossenden beginnt. Je nach Gegend und Lage mag die Ausbleichung des Haares früher oder später eintreten; eine Mauserung aber, wie Tschudi meint, findet im Herbst gewiß nicht statt. Die Verfärbung geschieht von unten nach oben, derart, daß zuerst die Läufe und zuletzt der Rücken weiß werden. Sie begann bei dem von mir beobachteten Tiere am zehnten Oktober und war bis zu Ende des Monats so weit fortgeschritten, daß die Läufe bis zu den Knien oder Beugegelenken, der Nacken und der hintere Teil der Schenkel weiß waren, während die Haare des übrigen Leibes zwar lichter als anfangs erschienen, aber doch noch nicht eigentlich an der Umfärbung teilgenommen hatten. Das Fell sah um diese Zeit aus, als ob es mit einem durchsichtigen, weißen Spitzenschleier überdeckt wäre. Im November nahm das Weiß außerordentlich rasch, und zwar auf der ganzen Oberseite gleichmäßig zu, die inzwischen grau gewordene Sommerfarbe verschwand mehr und mehr, und Weiß trat überall an die Stelle der früheren Färbung. Von einem Ausfallen der Haare war nichts zu bemerken.
»Der Schneehase«, berichtet Tschudi weiter, »ist in allen Alpenkantonen sicher in der Höhe zu treffen, und in der Regel wenigstens ebenso zahlreich wie der braune in dem unteren Gürtel. Am liebsten hält er sich zwischen der Tannengrenze und dem ewigen Schnee auf, ungefähr in gleicher Höhe mit dem Schneehuhne und dem Murmeltier, zwischen 1600 bis 2600 Meter über dem Meere; doch streift er oft viel höher. Lehmann sah einen Hasen dicht unter dem obersten Gipfel des Wetterhorns bei 3600 Meter über dem Meere. Der hohe Winter treibt ihn etwas tiefer den Alpenwäldern zu, die ihm einigen Schutz und freie Stellen zur Äsung bieten, doch geht er nicht gern unter 1000 Meter über Meer und zieht sich sobald als möglich wieder nach seinen lieben Höhen zurück.
Im Sommer lebt unser Tierchen ungefähr so: Sein Standlager ist zwischen Steinen, in einer Grotte oder unter den Leg- und Zwergföhren. Hier liegt der Rammler gewöhnlich mit aufgerichtetem Kopfe und stehenden Ohren. Die Häsin dagegen pflegt den Kopf auf die Vorderläufe zu legen und die Ohren zurückzuschlagen. Frühmorgens oder noch öfters schon in der Nacht verlassen beide das Lager und werden sodann auf den sonnigen Grasstreifen, wobei die Löffel gewöhnlich in Bewegung sind und die Nase herumschnuppert, ob nicht einer ihrer vielen Feinde in der Nähe sei. Seine liebste Nahrung besteht in den vielen Kleearten, den betauten Muttern, Schafgarben und Violen, in den Zwergweiden und in der Rinde des Seidelbastes, während er den Eisenhut und die Geranienstauden, die auch ihm giftig zu sein scheinen, selbst in den nahrungslosesten Wintern unberührt läßt. Ist er gesättigt, so legt er sich der Länge nach ins warme Gras oder auf einen sonnigen Stein, auf dem er nicht leicht bemerkt wird, da seine Farbe mit der des Bodens übereinstimmt. Wasser nimmt er nur selten zu sich. Auf den Abend folgt eine weitere Äsung, wohl auch ein Spaziergang an den Felsen hin und durch die Weiden, wobei er sich oft hoch auf die Hinterbeine stellt. Dann kehrt er zu seinem Lager zurück. Des Nachts ist er der Verfolgung des Fuchses, der Iltisse und Marder ausgesetzt. Mancher aber fällt den großen Raubvögeln der Alpen zu. Unlängst haschte ein auf einer Tanne lauernder Steinadler in den Appenzeller Bergen einen fliehenden Alpenhasen vor den Augen der Jäger weg und entführte ihn durch die Luft.

Alpen- oder Schneehase ( Lepus timidus)
Im Winter geht's oft notdürftig her. Überrascht ihn früher Schnee, ehe er sein dichteres Winterkleid angezogen, so geht er oft mehrere Tage lang nicht unter seinem Steine oder Busche hervor und hungert und friert. Ebenso bleibt er im Felde liegen, wenn ihn ein starker Schneefall überrascht. Er läßt sich, wie die Birk- und Schneehühner, ganz einschneien, oft 60 Zentimeter tief, und kommt erst hervor, wenn ein Frost den Schnee so hart gemacht hat, daß er ihn trägt. Bis dahin scharrt er sich unter demselben einen freien Platz und nagt an den Blättern und Wurzeln der Alpenpflanzen. Ist der Winter völlig eingetreten, so sucht er sich in den dünnen Alpenländern Gras und Rinde. Gar oft gehen die Alpenhasen auch in diesen Jahreszeiten zu den oberen Heuställen. Gelingt es ihnen, durch Hüpfen und Springen zum Heue zu gelangen, so setzen sie sich darin fest.
Ebenso hitzig in der Fortpflanzung, wie der gemeine Hase, bringt die Häsin mit jedem Wurfe zwei bis fünf Junge, die nicht größer als rechte Mäuse und mit einem weißen Fleck an der Stirn versehen sind, schon am zweiten Tage der Mutter nachhüpfen und sehr bald junge Kräuter fressen. Der erste Wurf fällt gewöhnlich in den April oder Mai, der zweite in den Juli oder August. Es ist fast unmöglich, das Getriebe des Familienlebens zu beobachten, da die Witterung der Tiere so scharf ist und die Jungen sich außerordentlich gut in allen Ritzen und Steinlöchern zu verstecken verstehen.
Die Vermischung des gemeinen Hasen mit dem Alpenhasen und die Hervorbringung von Bastarden wird durch genaue Nachforschung bestätigt. So wurde im Januar im Sernstale ein Stück geschossen, das vom Kopfe bis zu den Vorderläufen braunrot, am übrigen Körper rein weiß war, in Ammon ob dem Möllensee vier Stücke, alle von einer Mutter stammend, von denen zwei an der vorderen, zwei an der Hinteren Körperhälfte rein weiß, im übrigen braungrau waren. Im bernschen Emmentale schoß ein Jäger im Winter einen Hasen, der um den Hals einen weißen Ring, weiße Vorderläufe und eine weiße Stirn hatte. Nach eigenen Beobachtungen kann ich bestätigen, daß mindestens gefangene Hasen beider Arten miteinander fruchtbar sich vermischen. Ein Schneehase, den ich über Jahresfrist pflegte, setzte am zweiten Juni drei Junge, Blendlinge von ihm und dem Feldhasen. Ich kam gerade dazu, als das Tier eben geboren hatte und die Jungen trocken leckte. Die Mutter deckte diese dabei sehr geschickt mit beiden Beinen zu, so daß man sie erst bei genaustem Hinsehen wahrnehmen konnte. Alle drei Junge gediehen und blieben am Leben, kamen mir später jedoch aus den Augen, so daß ich über ihr ferneres Verhalten nichts mitteilen kann.
Von den eigentlichen Hasen unterscheidet sich das Kaninchen ( Lepuscuniculus) durch weit geringere Größe, schlankeren Bau, kürzeren Kopf, kürzere Ohren und kürzere Hinterbeine. Die Körperlänge des Tieres beträgt 40 Zentimeter, wovon 7 Zentimeter auf den Schwanz kommen, das Gewicht des alten Rammlers 2 bis 3 Kilogramm. Das Ohr ist kürzer als der Kopf und ragt, wenn man es niederdrückt, nicht bis zur Schnauze vor. Der Schwanz ist einfarbig, oben schwarz und unten weiß, der übrige Körper mit einem grauen Pelze bekleidet, der oben ins Gelbbraune, vorn ins Rotgelbe, an den Seiten und Schenkeln ins Lichtrostfarbene spielt und auf der Unterseite, am Bauche, der Kehle und der Innenseite der Beine in Weiß übergeht. Der Vorderhals ist rostgelbbraun, der obere wie der Nacken einfarbig rostrot. Spielarten scheinen seltener als beim Feldhasen vorzukommen.
Fast alle Naturforscher nehmen an, daß die ursprüngliche Heimat des Kaninchens Südeuropa war, und daß es in allen Ländern nördlich von den Alpen erst eingeführt wurde. Plinius erwähnt es unter dem Namen Cuniculus, Aristoteles nennt es Dasypus. Alle alten Schriftsteller bezeichnen Spanien als sein Vaterland. Strabo gibt an, daß es von den Balearen aus nach Italien gekommen sei; Plinius versichert, daß es sich zuweilen in Spanien ins zahllose vermehre und auf den Balearen Hungersnot durch Verwüstung der Ernte hervorbringe. Die Inselbewohner erbaten sich vom Kaiser Augustus Soldaten zur Hilfe gegen diese Tiere, und Kaninchensänger waren dort sehr gesuchte Leute.
Gegenwärtig ist das wilde Kaninchen, Karnickel, Kunelle, Murkchen und wie es sonst noch heißt, über ganz Süd- und Mitteleuropa verbreitet und an manchen Orten überaus gemein. Die Länder des Mittelmeeres beherbergen es immer am zahlreichsten, obgleich man dort keine Schonung kennt und es verfolgt zu jeder Jahreszeit. Bei uns kommt es auch auf den ostfriesischen Inseln in den Dünen vor. Doch handelt es sich hier nachweislich um verwilderte, ursprünglich eingeführte Formen. Herausgeber.
Das Kaninchen verlangt hügelige und sandige Gegenden mit Schluchten, Felsklüften und niederem Gebüsch, kurz Orte, wo es sich möglichst verstecken und verbergen kann. Hier legt es sich an geeigneten, am liebsten an sonnigen Stellen ziemlich einfache Baue an, gern in Gesellschaft, oft siedlungsweise. Jeder Bau besteht aus einer ziemlich tiefliegenden Kammer und in Winkel gebogenen Röhren, von denen eine jede wiederum mehren Ausgänge hat. Diese sind durch das häufige Aus- und Einschlüpfen gewöhnlich ziemlich erweitert; die eigentliche Röhre aber ist so eng, daß ihr Bewohner gerade durchkriechen kann. Jedes Paar hat seine eigene Wohnung und duldet innerhalb derselben kein anderes Tier; wohl aber verschlingen sich oft die Röhren von mehreren Bauen. In seinen Höhlen lebt das Kaninchen fast den ganzen Tag verborgen, falls das Buschwerk um den Bau herum nicht so dicht ist, daß es fast ungesehen seiner Nahrung nachgehen kann. Sobald der Abend anbricht, rückt es auf Äsung, aber mit großer Vorsicht, indem es lange sichert, ehe es den Bau verläßt. Bemerkt es Gefahr, so warnt es seine Gefährten durch starkes Ausschlagen mit den Hinterläufen, und alle eilen so schnell als möglich in ihre Baue zurück.
Die Bewegungen des Kaninchens unterscheiden sich wesentlich von denen des Hasen. Im ersten Augenblicke übertrifft es diesen an Schnelligkeit, immer an Gewandtheit. Es versteht das Hakenschlagen meisterlich und erfordert einen vortrefflich eingeübten Hetzhund, bezüglich einen guten Schützen. Ungleich verschmitzter und schlauer als der Hase, läßt es sich höchst selten auf der Weide beschleichen und weiß bei Gefahr fast immer noch ein Schlupfloch zu finden. Wollte es geradeaus forteilen, so würde es von jedem mittelmäßig guten Hunde schon nach kurzer Zeit gefangen werden; so aber sucht es in allerlei Genist, in Felsenritzen und Höhlen Schutz und entgeht meist den Nachstellungen seiner Feinde. Die Sinne des Äugens, Vernehmens und Witterns sind ebenso scharf, vielleicht noch schärfer als bei den Hasen. In seinen Sitten hat es manches Angenehme. Es ist gesellig und vertraulich, die Mütter pflegen ihre Kinder mit warmer Liebe, die Jungen erweisen den Eltern große Ehre, und namentlich der Stammvater einer ganzen Gesellschaft wird hoch geachtet. In den Monaten Februar und März beginnt die Rammelzeit der Kaninchen. Wie bemerkt, hält das Paar treu zusammen, wenigstens viel treuer als das Hasenpaar; doch kann man nicht behaupten, daß das Kaninchen in Einweibigkeit lebe.
Wie die Häsin geht das Kaninchen dreißig Tage tragend, ist aber geneigt, sogleich nach dem Wurfe sich wieder zu begatten, und bringt deshalb seine Nachkommenschaft schon binnen Jahresfrist auf eine bedeutende Höhe. Bis zum Oktober setzt es alle fünf Wochen vier bis zwölf Junge in einer besonderen Kammer, die es vorher mit seiner Bauchwolle reichlich ausgefüttert hat. Einige Tage bleiben die Kleinen blind, und bis zum nächsten Satze der Mutter verweilen sie bei ihr im warmen Neste und säugen. Die Alte ist sehr zärtlich und verläßt die Familie nur so lange, als sie braucht, um sich zu ernähren. Bei dieser Gelegenheit sucht sie den Gatten auf, um mit ihm, wenn auch nur kurze Zeit, süßer Vertraulichkeit zu pflegen. Bald aber kehrt sie zu den früheren Pfändern ihrer Liebe zurück und erfüllt mit Aufopferung alles geselligen Vergnügens die Mutterpflichten treulich. Selbst dem Gatten wird der Zugang zu den gesetzten Jungen nicht gestattet, weil wahrscheinlich die sorgsame Mutter wohl weiß, daß er in einem Anfalle von Raserei oder aus übertriebener Zärtlichkeit das Leben derselben zu rauben fähig ist. Bosheit treibt ihn dazu gewiß nicht an; denn er empfängt seine Kinder, wenn er sie zum ersten Male erblickt, mit Äußerung echter Zärtlichkeit, nimmt sie zwischen die Pfoten, leckt sie und teilt mit der Gattin die Bemühung, sie Äsung suchen zu lehren.
In warmen Ländern sind die Jungen bereits im fünften, in kalten im achten Monate zeugungsfähig, doch erreichen sie erst im zwölften Monate ihr völliges Wachstum. Pennant hat sich die Mühe gegeben, die mögliche Nachkommenschaft eines Kaninchenpaares zu berechnen. Wenn man annimmt, daß jedes Weibchen in einem Jahre siebenmal setzt und bei jedem Satze acht Junge bringt, würde diese Nachkommenschaft binnen vier Jahren die ungeheure Zahl von 1 284 940 Stück erreichen können, wenn sie sämtlich am Leben blieben, was natürlich nicht im geringsten der Fall ist.
Die Äsung des Kaninchens ist durchaus die des Hasen. Aber es verursacht viel ersichtlicheren Schaden als dieser, nicht allein, weil es sich auf einen kleineren Raum beschränkt, sondern auch wegen seiner Liebhaberei für Baumrinden, wodurch es oft ganze Pflanzungen zerstört. Man kann sich kaum denken, welche Verwüstung eine Ansiedlung bei einer so ungeheuren Fruchtbarkeit ihrer Mitglieder anzurichten vermag, wenn man der Vermehrung nicht hindernd in den Weg tritt. Besonders gilt das von seinen Zerstörungen im Walde, von denen jeder aufmerksame Forstmann beredtes Zeugnis ablegen kann. Von der Hollunderstaude bis zu den edelsten Forstgewächsen verfällt das junge Wachstum, besonders die Rinde, seinem ewig beweglichen Nagezahne. Was das Eichhorn auf dem Baume, ist das Kaninchen auf dem Boden, den es siedlungsweise nach allen Richtungen unterhöhlt, hierdurch allein schon den Waldbeständen, namentlich dem Nadelholze, aus sehr lockerem Boden Schaden verursachend. Zudem vertreiben Kaninchen durch ihr unruhiges Wesen auch das andere Wild; denn selten findet man da Hasen, wo jene die Herrschaft errungen haben. Wo sie sich sicher fühlen, werden sie unglaublich frech. Im Wiener Prater hausten sie früher zu Tausenden, liefen ungescheut auch bei Tage umher und ließen sich weder durch Rufen noch durch Steinwürfe im Äsen stören. Man hegt sie nirgends, sondern erlegt sie, wo man nur immer kann, selbst während der allgemeinen Schonzeit. Demungeachtet sind sie ohne Hilfe des Frettchens nicht auszurotten; nur wenn sich in einer Gegend der Iltis, das große Wiesel und der Steinmarder stark vermehrt haben, oder wenn es dort Uhus und andere Eulen gibt, bemerkt man, daß sie sich vermindern. Die Marderarten verfolgen sie bis in ihre Baue, und dann sind sie fast immer verloren, oder die Uhus nehmen sie bei Nacht von der Weide weg. Das Wildbret ist weiß und wohlschmeckend; der Pelz wird wie der des Hasen benutzt.
Unser zahmes Kaninchen, das wir gegenwärtig in verschiedenen Färbungen züchten, ist unzweifelhaft ein Abkömmling des wilden; denn dieses kann man in kurzer Zeit zähmen, jenes verwildert binnen wenigen Monaten vollständig und wirft dann auch gleich Junge, die die Färbung des wilden an sich tragen. Spielarten sind das silberfarbene, das russische und das angorische oder Seidenkaninchen. Ersteres ist größer als das unserige, gewöhnlich von bläulichgrauer Farbe mit silberfarbenem oder dunklem Anfluge. Das russische Kaninchen ist grau, der Kopf mit den Ohren braun, und zeichnet sich durch eine weitherabhängende Wamme an der Kehle aus. Das angorische oder Seidenkaninchen endlich hat kürzere Ohren und einen sehr reichlichen, weichen Pelz; sein langes, gewelltes Haar reicht oft bis zum Boden herab und hat seidenartigen Glanz. Leider ist es sehr zart und verlangt deshalb sorgfältige Pflege. Das Haar eignet sich zu feinen Gespinsten und hat deshalb einen ziemlich hohen Wert.