
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Frederik Paludan-Müller.
Bildquelle: es.wikipedia.org
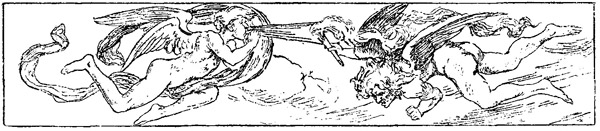
(1881.)
 Oft habe ich von Deutschen, die der dänischen Sprache mächtig waren, die Aeusserung gehört: »Nicht Oehlenschläger, sondern Paludan-Müller ist der grösste Dichter Dänemarks in diesem Jahrhundert; sonderbar, dass dies nicht anerkannt ist.«
Oft habe ich von Deutschen, die der dänischen Sprache mächtig waren, die Aeusserung gehört: »Nicht Oehlenschläger, sondern Paludan-Müller ist der grösste Dichter Dänemarks in diesem Jahrhundert; sonderbar, dass dies nicht anerkannt ist.«
Es wird nicht anerkannt werden, denn es verhält sich nicht so. Man verwechselt eine geistige Ueberlegenheit mit einer dichterischen, oder man zieht die persönliche Reife der genialen Ursprünglichkeit vor. In Meyer's Konversations-Lexikon heisst es: »Paludan-Müller ist unbedingt der bedeutendste dänische Dichter unseres Jahrhunderts, sowol was die Fülle der Ideen, als was die Tiefe des sittlichen Ernstes und die formelle Schönheit der Darstellung betrifft.« So zweifelhaft die Richtigkeit dieser Behauptung mir erscheint, so unzweifelhaft ist es, dass Paludan-Müller (geb. 7. Februar 1809, gest. 28. December 1876) weit mehr als irgend ein anderer neuerer dänischer Dichter fremde Leser ansprechen muss, und sein tiefer, grübelnder Geist ist besonders dem deutschen Geiste verwandt. Da nun sein Hauptwerk, das in den scandinavischen Ländern so berühmte Epos »Adam Homo«, bald in einer (von Fräulein Emma Klingenfeld besorgten) vorzüglichen Uebersetzung vorliegen wird, so bietet sich eine Gelegenheit dar, die edle und bedeutende Persönlichkeit des Dichters dem deutschen Publicum zu schildern.
Ich brauche nur meine Augen zu schliessen um ihn vor mir zu sehen, wie er im Leben ging und stand; ich sehe das heitere Lächeln, mit welchem er einem Gast guten Tag sagte, ich höre die Schalkhaftigkeit, mit welcher er im lebhaften Gespräch, fast im Style Mercutio's bei Shakespeare, sich an irgend ein neckendes Wortspiel klammerte. In den letzten Jahren seines Lebens hatte eine harte Krankheit seine Kraft gebrochen und das Alter seine schöne Gestalt gezeichnet; ich kann ihn aber eben so leicht in der Frische und Gesundheit seiner rüstigen Jahre sehen, so wie er war, als ich ihn kennen lernte.
An einem Augusttage 1863 sah und sprach ich ihn zum ersten Mal. Auf einer Fussreise mit jungen Verwandten von ihm kam ich nach Fredensborg auf Seeland und betrat mit klopfendem Herzen die Schwelle seiner Sommerwohnung. Jedes Gedicht, das er geschrieben hatte, war mir bekannt, und ich empfand ein mit Unruhe vermischtes Glücksgefühl darüber, dem Manne so nahe zu sein, den ich in der Entfernung lange bewundert hatte. Wir warteten eine Weile in der ländlich niedrigen Stube, ich hatte eben Zeit einen Blick auf das bescheidene Hausgeräth zu werfen, als die Thüre zum Nebenzimmer aufging, und der, den wir suchten, hereintrat und mit seiner sonderbar hohen und feinen Stimme uns willkommen hiess. Ein aristokratisches Gesicht – die Züge wie von dem Meissel eines idealistischen Künstlers zugehauen; die sensibeln, beweglichen Naselöcher und die tiefen, kräftig blauen, schön liegenden Augen unter den starken Brauen gaben dem Gesichte Leben; eine ganz schwache Schwerhörigkeit theilte demselben etwas Horchendes und Aufmerksames mit. Auf dem Kopfe trug Paludan-Müller eine hohe, eckige Mütze, die ihn vorzüglich kleidete und dem edlen Gesicht einige Aehnlichkeit mit einem altflorentinischen Portrait gab; das Lächeln machte den feingeformten, sarkastischen Mund doppelt schön; die weisse Binde gab der Haltung des Kopfes etwas Aufrechtes und Würdiges – man könnte nach einem distinguirteren Aeusseren lange suchen; er sah in gleich hohem Grade vornehm und liebenswürdig aus.
Die Rede fiel nach den ersten Begrüssungen auf das Verhältniss zwischen dem Schönen in der Natur und in der Kunst, und eifriger Idealist, wie er war, behauptete er, dass man in der Natur entweder Alles oder Nichts schön nennen müsse. Es war eine Art Nachhall der Hegel'schen Lehre von der Schönheit als Menschenwerk allein.
Wir waren während des Gesprächs in den Schlossgarten Fredenborgs hineingewandert; er sass am Ufer des Esromsees, zeigte mit seinem Stock auf eine grosse, dicke Kröte und sagte: »Voltaire hat Recht, wenn er seine Kröte sagen lässt: ›Le beau idéal, c'est ma crapaude‹. Er hatte eine gewisse naive Freude daran, einen derben, neckenden Satz wie diesen zu gebrauchen. Es fand sich in seiner Conversation ein interessanter Gegensatz: bald wandte er solche abstracte und feierliche Wendungen an, die dem jüngeren Geschlecht fremd geworden sind, sprach z. B. von »den Verehrern des Schönen« und desgleichen, bald amüsirte es ihn einen recht cynischen Ausdruck für seinen Gedanken zu ergreifen. Man findet diesen Wechsel des Tons in seinen humoristischen Poesien wieder. Derselbe machte in seiner Unterhaltung eine eigenartige Wirkung; es war wie wenn ein Schwan sein stilles königliches Segeln unterbricht um den Steiss in die Höhe zu strecken. Doch dies war eigentlich nur der erste Eindruck, er verlor sich, wenn man Paludan-Müller genauer kennen lernte; man verstand dann, dass die hermelinartige Reinheit seines Wesens und die Scheu vor dem Schmutzigen und Platten in dem Eintagswesen der Zeit, die ihn zum Einsiedler gemacht hatte, ihre Ergänzung fand in dem Witzigen, polemisch Spielenden seines Geistes, in dem spöttischen Blick auf vieles von Andern höchlich Bewundertes und in dem scharfen Sinn für das Komische, der ihn zum satyrischen Dichter gemacht hatte.
Er wohnte im Sommer in Fredensborg und im Winter in Ny-Adelgade in Kopenhagen, und es kam mir bisweilen vor, als ob der doppelte Aufenthaltsort verschiedenen Seiten seines Wesens und seiner Poesie entsprach. Er passte für seine Sommerheimath. Es gab in seinem Wesen etwas, das mit den schlanken, stolzen Alleen, mit der reinen Luft und strengen Zucht des regelmässigen Gartens verwandt war. Die weissen Statuen von griechisch-ungriechischen Göttern und Göttinnen zwischen den Bäumen erinnerten an seine mythologischen Gedichte und stimmten mit dem Wesen des Dichters, der so oft Venus und Aurora bei ihrer Morgentoilette belauscht und geschildert hatte. Mit all' seinen grossen und seltenen Dichtergaben fehlte Paludan-Müller in seiner Poesie das Naive; er war eigentlich nie der Dichter der Natur; deshalb eignete sich ein Garten fast besser für seine poetische Stimmung wie ein Wald. Das kleine Schloss, in welches die neue Königsfamilie bald hineinzog, war ihm lieb. Er war dem Königthum ergeben wie wenige seiner Zeitgenossen, loyal wie ein Mann von der Zeit Friedrichs VI. Er war erfreut und geehrt, wenn er bisweilen von den jungen Prinzessinnen einen Besuch empfing; sie gewannen durch ihr liebenswürdiges und schlichtes Wesen sein Herz; er war ganz aufgeräumt als eines Tages die Prinzessin Dagmar ihm ihr Bild mit einigen freundlichen Zeilen geschenkt hatte. Endlich passte der Ort für sein Bedürfniss, einsam zu leben. Er wohnte in Fredensborg lange vor und lange nach allen andern Gästen aus Kopenhagen; er verliess die Stadt, wenn der Kalender Frühling versprach, und kam erst zurück, wenn die letzten Blätter gefallen waren. So konnte er sich draussen einer tiefen Einsamkeit erfreuen.
Besuchte man ihn im Winter in Kopenhagen, so fand man ihn in sehr verschiedenartigen Umgebungen. Seine Strasse gehörte einem der damals schlechtesten und berüchtigtsten Stadtviertel. Seine nicht sehr reichlichen Vermögensumstände hatten ihn wahrscheinlich veranlasst seine Wohnung hier aufzuschlagen. Es war ein sonderbares Zusammentreffen, dass der reine und strenge Dichter des »Kalanus« nie einen Winterabend vor seine Thür treten konnte ohne zahlreiche und laute Zeugnisse menschlicher Schmach und Elends vor Augen zu haben. Manchen Abend hab' ich ihn in diesen Strassen gesehen, wenn er an seinen Stock gestützt, ohne weder rechts noch links zu sehen, an den vielen rohen und lärmenden Paaren vorbeiging. Ich dachte dann, dass der Dichter des »Kalanus« zugleich der Dichter »Adam Homo's« war, und – waren es nicht die Staffagefiguren aus »Adam Homo«, die Originalen der schönen Line und der schwarzen Trine, welche der Dichter Tag aus Tag ein vor Augen hatte. Es war insofern nicht ganz ungereimt vom Schicksal, Paludan-Müller hier im Mittelpunkt der erbärmlichsten und hässlichsten Laster Kopenhagens seinen Platz anzuweisen. War man indessen über die Schwelle gekommen, so war die unheimliche Nachbarschaft wahrlich vollständig vergessen. Ein altes, kerngetreues, und seiner Herrschaft äusserst ergebenes Dienstmädchen, dessen Gunst man nicht entbehren konnte, da sie nach der scherzhaften Behauptung des Dichters das Haus tyrannisirte, schloss die friedliche Wohnung auf, und hier war Alles von dem guten Geist und der guten Laune des Dichters beseelt.
Man erfuhr im Gespräch von Paludan-Müller wenig über sein Leben. Wie er der Oeffentlichkeit niemals Mittheilungen darüber machte, so war es auch nicht seine Sitte über Begebenheiten zu sprechen, die er persönlich erlebt hatte. Er war überhaupt nicht Erzähler. Er erörterte mit grossem Interesse jedes Problem; aber Thatsachen als solche beschäftigten nur in geringem Grade seinen Geist. Seine Redeweise war raisonnirend, nicht bildlich; das Dichterische erschien in geistvollen Blitzen, fast nie in einem malerischen Ausdruck. In einer entscheidenden oder auch nur heftig bewegten Situation habe ich Paludan-Müller nicht gesehen, weiss nicht einmal, ob sein äusseres Leben jemals verhängnissvolle, entscheidende Situationen dargeboten hat. Das äussere Leben der dänischen Dichter seiner Zeit war in der Regel ziemlich leer. Sie wurden in einer gelehrten Schule erzogen, verbrachten an der Universität zu Kopenhagen einige Jahre mit vergeblichen Versuchen sich die eine oder andere Fachwissenschaft anzueignen, gaben ihre ersten Poesien heraus, unternahmen eine grössere Reise in's Ausland und erhielten ein Amt oder eine Dichterpension. Bei einzelnen kommt hierzu der lange und hartnäckige Kampf für Anerkennung. Aber sogar dieses dramatische Element fehlt in dem Leben Paludan-Müllers. Er nahm an keinem geistigen Feldzug Theil. Er wurde zwar eine Zeit lang nicht nach Verdienst geschätzt, aber er wurde nie verkannt. Sein Leben scheint also eben so wenig hervorspringende Ecken wie das der meisten modernen Talente gehabt zu haben.
Er wurde 1809 in einem Pfarrhof auf Fünen geboren, wurde 1828 Student, machte 1835 ein mittelmässiges juridisches Examen, heirathete 1838 und bereiste 1838–40 Mittel- und Süd-Europa. 1851 wurde er Ritter von Danebrog und erhielt 1854 den Professortitel. Uebrigens war er als reifer Mann Dichter und Einsiedler.
Was er als Jüngling war, das muss man aus seinen Werken errathen. Ich denke mir ihn nach dem, was ich gehört habe, stark gefeiert im geselligen Leben, der entschiedene Löwe auf fünischen Herrschaftsgütern; es ist mir gesagt worden, dass er einen solchen Humor und solche Fähigkeit, aus dem Stegreif zu erfinden, besass, dass er bisweilen in Gesellschaften ganze kleine Schauspiele ersann und sie völlig allein spielte, indem er, um seine eigenen Repliken zu beantworten, von der einen Seite der improvisirten Bühne zur andern lief. Ich erinnere mich auch gehört zu haben, dass er in jungen Jahren ein Herzeleid hatte, indem ein junges Mädchen, das ihm lieb war, durch den Tod fortgerafft wurde. Sehr früh hat jedenfalls die Reihe bitterer Erfahrungen, ohne welche er nicht den ersten Theil von »Adam Homo« in seinem 31. Jahr hätte schreiben können, seine ursprüngliche Lebenslust gedämpft, und noch jung zog er sich ganz von der Welt zurück, entfernte sich vollständig von dem öffentlichen, fast vollständig von dem geselligen Leben – und weihte sich ausschliesslich seinem Heim, seiner Kunst und seinen theologisch-philosophischen Studien. Seine Ehe war kinderlos, so dass auch in seinem häuslichen Leben nichts seine Blicke nach aussen hinzog. Je mehr Fäden er durchhaute, die ihn ursprünglich mit seiner Umgebung verbunden hatten, um so beherrschter und contemplativer wurde sein Gemüth. Nur durch zufällige Aeusserungen, durch Worte, die er ab und zu in Gesprächen hinwarf, ohne zu ahnen, welchen Eindruck sie auf einen Jüngling machen mussten, wurde die Beschaffenheit der Resultate mir klar, die er in Folge seiner Lebenserfahrung und Menschenkenntniss immer bereit hatte. Sie waren nicht optimistischer Art.
Nie vergesse ich z. B. den Tag, da ich ihm ein Exemplar meiner ersten Schrift, einer Brochüre überbrachte. »Ich danke Ihnen. Es wird mir lieb sein, das Buch zu lesen. Bis wann wollen Sie es zurück haben?« – »Ich bitte Sie, es zu behalten.« – »Sie wollen mir's schenken. O Unschuld! Er bringt selbst den Leuten seine Bücher. Geben Sie es auch Andern? ... Wie? Ihren Freunden und näheren Bekannten? Nun, glauben Sie mir, damit werden Sie nicht lange fortfahren. Das thut man nur, wenn man sehr jung ist.« Zu jener Zeit reizte eine solche Replik mich zur Opposition, ungefähr wie die kalte und blutige Ironie in »Adam Homo« es damals machte; später lernte ich besser die Freiheit von Illusionen und die Abgeschlossenheit, der sie entsprang, verstehen – und heutzutage scheint mir Paludan-Müller's Reservirtheit nur natürlich.
Der beissende Argwohn, den er bisweilen an den Tag legen konnte, war eher rührend als kränkend, denn Paludan-Müller war nicht für sich argwöhnisch, sondern nur für diejenigen, die sich seiner Gunst erfreuten. Er fürchtete immer, dass die schlechte Welt, besonders die schlimmen Frauen seine Lieblinge ins Verderben locken würden, und liess es an Warnungen nicht fehlen. Es fand sich in seinen Vorschriften diese halb bürgerliche, halb christliche Mischung von wohlberechnetem Egoismus und regulärer Moral, die so vernünftig ist und von der Jugend so ungern gehört wird. Eines Tages im Jahr 1867 sagte er z. B.: »Was erzählen Sie da? Italienische Damen, in deren Haus Sie in Paris viel verkehrten, haben Sie eingeladen während der Weltausstellung bei ihnen zu wohnen? Das dürfen Sie nicht annehmen!« »Und weshalb nicht? Ich kann Sie versichern, dass diese Damen nicht nur untadelhaft, sondern von der feinsten Bildung sind.« »Gleichviel, gleichviel, ich sage ja nichts anderes, ich sage nur, Sie sollen sich mit solchen Italienerinnen nicht abgeben. Gebrauchen Sie Ihre Zeit und Ihre Anlagen zu ganzen Verhältnissen; das soll man; man soll säen wo man selbst ernten wird; man soll seine Zeit zum besten seiner Mutter, seiner Schwester, seiner Frau u. s. w. in ganzen Verhältnissen anwenden, das andere ist nur verlorene Zeit.« Er sagte dies mit grossem Ernst und auf eine sonderbar dominirende Weise als wollte er jede Einwendung überhören; es ärgerte mich ein bischen, weil die unschuldige Einladung jener fremden Damen zu dieser Expectoration so ganz und gar keine Veranlassung gab; wenn ich jetzt daran denke, so ist es nur weil dieses Misstrauen mir ein Symptom des seelischen Zustandes scheint, aus welchem »Adam Homo« hervorgegangen ist.
Nur verhältnissmässig selten kam jedoch diese negative Seite seines Wesens zum Vorschein. Weit mehr Eindrücke bewahre ich von dem Liebevollen und Sorgsamen bei Paludan-Müller, von der fürstlichen Feinheit seines Wesens. Sein Verhältniss zu seiner um zehn Jahre älteren Frau war die vollendete Ritterlichkeit, und eine ähnliche Ritterlichkeit prägte seinen Verkehr mit den nicht sehr vielen, und mit äussern Vorzügen nicht stark ausgestatteten Damen, die sein Haus besuchten. Für die Bewunderung und die Schmeicheleien schöner Frauen war er absolut unempfänglich. Ich erinnere mich eines Falles, wo eine ausgezeichnet schöne Dame, die es einmal erreichte, neben ihm in einer Gesellschaft zu sitzen, ihn mit aufrichtig gemeinten und durchaus nicht kritiklosen Danksagungen für »Adam Homo« überschüttete; sie gewann nicht die Gunst Paludan-Müller's dadurch; denn alles, was er mir später über sie sagte, war: »Sie hat gewiss in ihrem nicht langen Leben schon ein gutes Stück Unheil angerichtet.« Umgekehrt nahm er sich unter den Damen mit besonderer Wärme der demüthigen und zurückgesetzten an. Es fand sich in der Familie eine alte unverheirathete Tante, hoch in den sechziger Jahren, die gewiss gutherzig und brav, aber ein in hohem Grad unansehnliches Wesen war, das sich so zu sagen immer selbst auslöschte. Zum Ritter dieser alten Dame machte sich Paludan-Müller; er erzeigte ihr immer eine ausgesuchte Aufmerksamkeit und er, der fast nie Jemand zu Mittag einlud, feierte jeden Sommer ihren Geburtstag mit einer kleinen Mittagsgesellschaft und brachte jedes Mal auf's neue den Toast für sie in herzlichen Worten aus.
Frederik Paludan-Müller war der Sohn eines fein und philosophisch gebildeten dänischen Bischofs. Er erbte die Anlagen des Vaters zur idealistischen Reflexion. Er gehört nicht wie Grundtvig und Ingemann, Heiberg und Poul Möller, Hauch und Christian Winther, Aarestrup und Bödtcher zur grossen Oehlenschläger'schen Gruppe. Er gehört wie Henrik Hertz dem Kreise J. L. Heiberg's an. Unzweifelhaft war Heiberg der dänische Meister der Dichtkunst, zu dem er vom Anfang an empor sah. Er war, erzählte er mir einmal selbst, in seiner Jugend von Heiberg's Person und Unterhaltung so entzückt, dass dieser bisweilen nach langem Zusammensein spät in der Nacht, um ihn los zu werden, die Formel anwenden musste: »Ja, hören Sie einmal, Paludan-Müller, gehen Sie jetzt nicht, so lasse ich Ihnen hier auf dem Fussboden ein Bett machen.« Er sprach auch nur mit der grössten Wärme über Heiberg's Poesie. Sie war ihm lieb durch ihre Klarheit, ihren Gedankenreichthum und ihren romantischen Flug; er freute sich ihrer Satyre, die verwandte Saiten in seiner eigenen Seele anschlug, und ihre speculativen Tendenzen stimmten mit seinem eigenen Hang überein, das Allgemeingültige, Allgemeinmenschliche zu schildern. Seine Urtheile über andere Dichter waren nur insofern lehrreich als sie einen Einblick in die Natur seines eigenen Talents eröffneten. Er, der die Reflexion in der Dichtkunst so hoch schätzte, konnte mit Oehlenschläger nicht sympathisiren. Als die Rede eines Tages auf Oehlenschläger fiel, sagte er mit höchst possierlichem Ernst: »Kurz und gut, Oehlenschläger war dumm.« Ich lachte und frug: »Halten Sie von ›Axel und Walburg‹ gar Nichts?« Er antwortete: »Es kann ja viel Hübsches darin sein, aber nur Stimmung und Gefühl, gar keine Gedanken.« Der Gedanke, den Théophile Gautier einmal als »das letzte Mittel definirte, zu welchem der Poet seine Zuflucht nimmt, wenn er weder Leidenschaft noch Farbe hat,« war Paludan-Müller die Hauptsache, wenn nicht in seiner Poesie, so doch in seiner Aesthetik. Selbst suchte er immer die Idee darzustellen, dies Wort im platonischen Sinn als das ewig Vorbildliche genommen. Deshalb schrieb er »Amor und Psyche,« deshalb »Adam Homo« und »Ahasverus«. Wo er aber nicht dies Allgemeine, Vorbildliche fand, da fand er keine Poesie von Werth. Er mochte z. B. ganz und gar nicht Björnson's Bauernnovellen leiden: »So etwas kann ja im kleinen Maasstab ganz nett sein. Es geht aber doch nicht an ein ganzes Buch auf das, was in der Seele einer kleinen Hühnerwärterin vor sich geht, zu verwenden.« Das Eigenthümliche dieser Aeusserung war, scheint mir, dass er keine kritische Einwendung gegen die Behandlungsweise zu machen hatte, sondern dass er gegen den Stoff als Stoff, gegen die Neigung, ein ungebildetes Seelenleben weitläufig zu schildern, protestirte. Der Sinn für das Naive fehlte ihm ganz. Andererseits hatte er einen wahren Abscheu vor dem Theatralischen und fand es in seiner eifrigen Antipathie manchmal, wo andere es nicht entdeckt hatten. Er nannte z. B. Runeberg theatralisch, und mit kritischer Sicherheit citirte er eine der äusserst wenigen Strophen, wo man einen Schimmer davon bei dem finnischen Dichter finden kann. »Was für ein Theaterheld ist sein Sandels!« sagte er
»Mein Pferd! lass satteln mein edler Bijou!
Wer anders als ein Coulissenheld redet so? und nun die Beschreibung, wo er auf der Redoute hält:
Er blieb auf dem Platz, er rührte sich nicht,
Stolz sass er in sicherer Ruh,
Und sein Auge war fest, die Stirne war klar
Und er strahlt' auf dem edlen Bijou!«
Paludan-Müller hasste das Theatralische, weil er immer auf seiner Hut gegen die Grösse war, die sich in ästhetischen Formen äussert. Er fand den grossen Alexander klein und den indischen Asketen Kalanus erhaben. Für ihn schränkte sich die menschliche Grösse zu der sittlichen ein, und die sittliche Grösse ging für ihn wieder ganz in der sittlichen Reinheit auf.
War er in seiner ästhetischen Totalansicht von Heiberg ausgegangen, so brach er sich doch bald seine besondere Bahn. Heiberg war nur im Namen der wahren Bildung, des guten Tons und Geschmacks Moralist gewesen, Paludan-Müller wurde es im Namen der strengen religiösen Zucht. Heiberg hatte in den religiösen Fragen für das hegelisch-speculative Christenthum Partei ergriffen, Paludan-Müller wurde rechtgläubiger Theologe. So lief seine Bahn eine nicht ganz kurze Strecke mit derjenigen Sören Kierkegaards parallel. Nicht dass er von dem einsamen Denker beeinflusst war. Er hegte für denselben sehr wenig Sympathie und wurde von seiner breiten, unklassischen Form zurückgestossen, deren Vorzügen er kein Verständniss entgegenbrachte, und deren innigen Zusammenhang mit dem Geist des Schriftstellers er nicht empfand. Es war der veränderte Zeitgeist, welcher die geistige Gemeinschaft der zwei einsamen Züchtiger ihrer Zeitgenossen erschuf. Schritt für Schritt hatte die dänische Literatur sich von den Idealen der Aufklärungsperiode enfernt, die noch in den Dichtungen Oehlenschläger's wie in den populärwissenschaftlichen Werken Hans Christian Oersted's gelebt hatten. Ihr Leben war von kurzer Dauer gewesen. Der dänische Geistliche, der Schleiermacher entsprach, war Mynster, aber es liegt eine Kluft zwischen Schleiermacher's Freisinn und Mynster's Orthodoxie. Ein einzelner Theologe, Clausen, war noch am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der Wortführer des Rationalismus gewesen, er machte aber bald der angehenden religiösen Reaction gegenüber eine abschwenkende Bewegung. Der Rationalismus schien zwar eine kurze Zeit, zur Hegel'schen Religionsphilosophie umgestaltet und weiter gebildet, sich geltend machen zu wollen, aber auch dieser Anlauf hatte keinen Erfolg. Heiberg, der ihn leitete, schloss sich dem speculativen Theologen von der Hegel'schen Rechte, Martensen, an, und Martensen bekehrte sich allmälig vollständig zum hochkirchlichen Dogmatismus. Es war nur noch zur Vollendung dieser geistigen Bewegung übrig, die praktischen, ethischen Consequenzen des Dogmenglaubens zu ziehen. Das geschah, als das Geschlecht Oehlenschläger's und Oersted's das Geschlecht Kierkegaard's und Paludan-Müller's erzeugt hatte.
In Kierkegaard's »Entweder-Oder« steht der Satz: »Es gibt Dichter, die durch das Dichten sich selbst gewonnen haben«. Man kann diesen Ausdruck auf Paludan-Müller anwenden. Denn was anderes macht ein Dichter, der den Weg vom Gefallsüchtigen zum Einfachen, vom Geistreichen zum Wahren, vom Spielenden und Glänzenden zur durchsichtigen Klarheit, und von dem Anmuthigen zum Grossen zurücklegt!
Paludan-Müller erschien Anfangs als der Virtuose unter den zeitgenössischen Dichtern in Dänemark. Die Themata seiner ersten Werke waren unter den Trillern der Laune und den Coloraturen des Witzes fast begraben. In »Liebe bei Hofe« (1832, deutsch von E. v. Zoller) ein halb von Shakespeare, halb von Gozzi inspirirtes Lustspiel nach dem Schnitt der damaligen Zeit, klangen Hirtenpoesie und lyrische Hofsprache, Wortspiele und Wortwitze, Schwärmerei und Narrenschellen durch einander; eine reichbegabte, sorgenfreie und planlose Jugend hatte dies Buch aus ihrem Füllhorn geschüttet. In dem formell an Byron's »Beppo« oder Alfred de Musset's »Namouna« erinnernden Gedicht »Die Tänzerin« war die Virtuosität noch ausgelassener und eigensinniger; die leichtströmenden Stanzen erzählten, klagten, lachten, spotteten, trieben Possen und glitten mit einer plauderhaften Geschmeidigkeit in einander über, die an die Weise erinnert, auf welche eine Arabeske in die andere übergeht. Das Ernste, das erzählt wird, macht nicht den Eindruck, wirklich geschehen zu sein; das Satyrische, das gesagt wird, macht keinen Eindruck des ernstlich Gemeinten. Wenn aber hier z. B. eine Aufforderung zum Glauben an die Unsterblichkeit der Seele mit einer Empfehlung des Thees, mit einer Warnung vor wässerigen Poeten und andern Warnungen verfänglicherer Art verflochten ist, so hat das weniger seine Ursache in leichtfertiger Gesinnung als in dem jugendlichen Muthwillen, der den Dichter von dem Augenblick an erfüllt, da er zum ersten Male seine Lieblingsstrophe, die Ottave, unter sich galoppiren und sich bäumen fühlt. »Die Tänzerin« ist eine Mischung von Geist und Begeisterung, aus welcher sich weder klare Farben noch deutliche Formen entwickelt haben. Es ist ein Musikstück, das bald den leichten Tanz der Freude, bald die Sehnsucht der Schwermuth ausdrückt, wie sie in den Jahren der Pubertät mit ihren kühnen Hoffnungen, ihrem unverstandenen Entbehren und ihrem leichtsinnigen Vergeuden der Lebenskraft wechseln. Der »Tänzerin« folgte im Jahre danach »Amor und Psyche«, ein neues Werk der künstlerischen Virtuosität, im höchsten Grade harmonisch einschmeichelnd, das aber noch nicht Gestalten oder Bilder ins Gemüth des Lesers hinein brennt. Es ist eine Musik, die sofort aufgefasst wird, die aber fast eben so schnell in Vergessenheit geräth; ein ewiger melodischer Solo- und Chor-Gesang von Genien, Zephyren und Nymphen, dessen einziger Fehler der ist, allzu künstlerisch vollendet, allzu geschliffen und glatt zu sein. Das ganze grosse dramatische Gedicht enthält keine Eigenheit oder Sonderbarkeit, weder im Vortrag noch im Gang der Handlung, und doch würde etwas Eigenes, d. h. etwas ungewöhnlich Ausgeprägtes oder Eckiges hier höchst wohlthuend gewirkt haben. So Staunen erregend die Technik auch ist, sie ist selten gefühlt, und erst da, wo sie gefühlt ist, beginnt in strengerem Sinn der Styl. Nicht die metrisch prunkendsten Partien enthalten hier die lebendigsten Strophen, die am deutlichsten den Stempel des Dichtergeistes tragen; sie finden sich in folgender Replik der Sorge, wo diese ihren dunkeln Schleier über die ohnmächtige Psyche wirft.
Um der Erdenkinder Wiege,
Vor dem Mutterlager dicht,
Schwebt der Sorgen Heer im Siege,
Düstern Ernst im Angesicht.
Weinen trübt des Kindes Züge
Tilgt des Lächelns erste Stunde,
Und ein Schrei bebt auf dem Munde
Mit dem ersten Morgenlicht.
Ist die Kindheit rasch entschwunden,
Fort der Jugend Augenblick,
Welk der Kranz, den sie gebunden,
Schied der Liebe Zauberglück;
Ach, entfloh'n die holden Stunden,
Die ein schönes Loos geboten –
Bleibt selbst in dem Glück, dem todten,
Noch des Todes Gram zurück.
In diesen Strophen ist schon die ganze für Paludan-Müller eigenthümliche Melancholie vorhanden. Hier verräth sich schon der Blick für den Tod, der sich zu einem Verweilen bei dem Tode entwickeln und der zuletzt als eines Tithon's, eines Kalanus', eines Ahasverus' Liebe zum Tode hervortreten sollte. Hier spürt man schon das Interesse für das Gesetz des Unterganges, das später das Gedicht »Abels Tod« hervorbrachte, die Einsicht, dass das todte Glück alle Sorgen des Todes verschliesst, die ihren Ausdruck in »Tithon« fand, und das Gefühl, dass die Vernichtung überall an der Schwelle des Lebens und der Freude lauert, das so oft in seinen Gedichten durchbricht. Man höre z. B. das folgende, welches den Titel »Tanzmusik« führt:
Sieh die Sonne golden glühen,
Hoch in Blau, so licht und schön!
Sieh die Wolke weiterziehen,
Wie ein Vogel schwebt in Höh'n!
Horch den Klängen,
Den Gesängen
Die mit hellen
Tönen durch die Zweige schwellen –
All' der Jubel wird vergeh'n.
Man kann, wenn man will, diesen Ton kreischend nennen; dem Ohr Paludan-Müller's erklang er aber nicht wie ein Misston; im Gegentheil, er fand eine Art Befriedigung, eine Art Beruhigung darin, sich und andern das unerbittliche und unvermeidliche Schicksal des Endlichen vor Augen zu halten. Als die Sitte aufkam, die Photographieen berühmter Männer mit einigen Zeilen herauszugeben, schrieb er unter das Bild, das ihn in einem Buche lesend darstellt, die charakteristischen Worte:
Hier steht, dass Alles in der Welt
Stets auf und nieder geht;
Drum weiss auch, wer sich oben hält,
Was bald bevor ihm steht.
Man hat indessen dem Drama »Amor und Psyche« nicht Gerechtigkeit erwiesen, wenn man nur im allgemeinen hervorhebt, dass es schon die schönsten und tiefsten Arbeiten des Dichters ankündigt. Es hat als Gedankenpoesie eine zusammenhängende und durchgeführte Symbolik, die den Dichter zwang, seinen Stoff strenger als vorher zu componiren, und es zeichnet sich durch das ganz besondere Colorit aus, das für die mythologischen Gedichte Paludan-Müller's eigentümlich ist. Es ist kein starkes Colorit; bald Grau in Grau, bald Licht in Licht, aber das Gedicht ist deshalb nicht farblos; sein Colorit besteht aus Perlenreflexen, Perlmutterglanz, ein schwachbuntes Farbenspiel, wie es von der Innenseite der Muschelschaale leuchtete, in der Venus aus dem Meere empor stieg. Bei Paludan-Müller malt Phantasus das Bild Psyche's für Amor auf einer solchen »perlenweissen Schaale«; es ist fast symbolisch für die Weise, in welcher der Dichter selbst die Gestalt Psyche's ausgeführt hat. Diese Gestalten sind ja nicht irdischer Natur; ihre wahre Heimath ist nicht die Erde und selbst die unter ihnen, die wie Psyche irdischer Herkunft sind, sagen der Erde ein endgültiges Lebewohl.
Psyche (niederkniend):
Gäa, du heilige Mutter,
Die mich gebar und mich nährte;
Du, deren zärtliche Lippen
Worte des Lebens mir sangen –
Abschied von dir nimmt dein Kind!
Nimmermehr werd ich dich schauen;
Nie wird mein Fuss mehr die Stätten
Trauter Erinnrung betreten
– – – – – – –
Dort in den himmlischen Sälen
Wird alles Erdenleid schwinden.
Das ganze dichterische Streben Paludan-Müller's in diesem Zeitraum ist im Grunde nur ein einziger, grossartiger, mannigfach nuancirter Abschied von Gäa. Die Romantik war ja nichts anderes; sie scheute und vermied das Leben, das sie um sich sah, und die charakterlose Zeit, in die hinein ihre Dichter sich mit Trauer geboren sahen. Paludan-Müller theilte von Herzen diesen Widerwillen der Romantiker gegen die wirklichen Umgebungen des Dichters und ihre Abneigung, sogar in der Phantasie bei der schweren dunkeln Erdkugel zu verweilen, die, der Dichter möge es wollen oder nicht, sich mit ihm und all' seinen Luftschlössern herumdrehte. Seine eigene Zeit ekelte ihn an, und er hat das Seine dabei gedacht, als er Tithon von seinen Zeitgenossen sagen liess:
Was glaubst du, dass aus dieser Zeit entspriesst?
Der Zeit, die eines mächt'gen Sturms bedarf,
Der sie aus ihrem tiefen Schlaf erweckt;
Der Zeit, die statt der Werke Träume hat
Und Spiel und Wettkampf nur statt kühner Thaten;
Der Zeit wo man sich selber Kränze flicht
Und gross sich sieht in Helden aus der Vorzeit;
Wo Menschen hoch wie Götter leben wollen
Und sind voll Knechtsinns doch – mich ekelt vor ihr!
Diese Schilderung gilt zwar Kleinasien zur Zeit des Trojanerkrieges; die Beschreibung stimmt aber merkwürdig gut mit der, welche in »Adam Homo« von der Regierungszeit Christians VIII. in Dänemark gegeben wird:
Es war 'ne Zeit, da mittelmäss'ge Köpfe
Sich allenthalben breit und laut gemacht,
Da sich in Haufen schaarten schwache Tröpfe,
Die etwas Grosses gern sich ausgedacht,
Und »Hurra!« schrie'n die albernen Geschöpfe,
Wenn sie am Ende Nichts zu Stand gebracht.
und es ist an und für sich leicht verständlich, dass ein Dichter mit diesem Blick auf seine Umgebung, wie Tithon, den Aufenthalt »in dem Reich der Morgenröthe« demjenigen unter seinen Zeitgenossen vorzog.
Das Eigenthümliche war aber, dass er mit seiner Vorliebe für diese höheren Sphären durchaus nicht allein stand; all' die besten Köpfe der damaligen Zeit hatten denselben Vergleich angestellt und dieselbe Wahl getroffen wie er; es fand sich etwas Dichterisches in den meisten von ihnen; und so geschah es, dass der Dichter im Reich der Morgenröthe sich bald in zahlreicher Gesellschaft befand.
Dies veranlasst einen Umschlag in der dichterischen Tendenz Paludan-Müller's. Er stockt plötzlich in seiner Flucht aus der Wirklichkeit und nimmt die Richtung zurück zur Erde: In dem Gedichte »Tithon« malt er das Leben auf der Insel der Morgenröthe, an den Küsten des Aethermeeres, zu welchen die Liebe Aurora's Tithon erhoben hat. Es ist ein Dasein wie Rinaldo's in den bezauberten Gärten Armida's; ein Rosenschleier hat sich über alles, über den Himmel wie über die schönen Frauen ausgebreitet; es ist ein Leben mit Gesang und Becherklang, Liebe und Musik und Segeln auf dem Aethermeere in ewiger Jugend während eines ewigen Frühlings. Und doch ist dies Leben nie geistlos, die Genüsse desselben sind nie gewöhnlich; es sind selige Genüsse. Es ist verwandt mit dem Leben, von welchem so viele edle Schwärmer unter den dänischen Zeitgenossen des Dichters träumten, das z. B. Carsten Hauch vorschwebte, als er sang von »dem Meere der Milchstrasse, wo die erlösten Geister, selig träumend, ohne Angst und Sorge, die Augen vom Glanz der Unsterblichkeit leuchtend, durch unbekannte Wolken dahin gleiten«; es ist jenes Alibi des Genusses, das Ludwig Bödtcher und so viele andere Künstlernaturen dieses Geschlechts während der besten Jahre ihres Lebens unter der Sonne Italiens suchten; es ist der niemals endigende Frühling und die ewige Jugend, die Christian Winther und Hans Christian Andersen und alle die Männer dieser Generation, die wie sie nicht alt zu werden verstanden, festzuhalten oder hervorzuzaubern vermocht hatten. Es war aber die Grösse Paludan-Müller's als Geist, dass dies Leben und diese Schönheit ihn nicht lange anzogen. Er dichtet, dass Tithon, mitten unter all diesem Vergessen des Irdischen und all diesem Schwelgen im Genuss, von halbbewusster Sehnsucht nach seinem Lande, seinem Volke, seinem Geschlecht, der ganzen unidealen Wirklichkeit, die er verlassen hat, verzehrt wird. Und seine Sehnsucht ist gewiss nicht grundlos, denn nichts Geringeres als die Thronbesteigung des Priamos, die Entführung Helena's, der zehnjährige Krieg, den Homer besingen sollte, und die spurlose Zerstörung Troja's ist geschehen, während er im Wolkenland der Morgenröthe schwelgte. So hatten einmal, während die französische Revolution ihr ganzes grossartiges Drama zu Ende spielte, gewisse Leute an den Küsten des Sunds Trinklieder und Klublieder gesungen. So hatte Kopenhagen während der Schlacht bei Waterloo Privatkomödie gespielt, und Dänemark während der Julirevolution in schönen Versen geschwelgt und sich über ästhetische Kampfspiele gefreut.
Paludan-Müller lässt Tithon sich die Erlaubniss Aurora's zur Rückkehr erzwingen, und die Worte, die er in dem Augenblick sagt, wo seine Füsse nach so langer Zeit die Erde wieder betreten, bezeichnen vielleicht den bedeutungsvollsten Wendepunkt in dem Entwicklungsgange des Dichters:
O Erde, deine Luft ist schwer! Mit Wucht
Fällt sie auf meine Brust und meine Glieder;
Wie eine Last drückt sie auf meine Schulter.
Unfreundlich ist dein Gruss – kalt, eisig scharf
Schickst du mir deinen rauhen Wind entgegen
Und hüllst dich schon in deine Wintertracht.
Wohin ich seh', sind deine Fluren öde –
Im Walde hängt am Zweig das dürre Laub.
Dein Gras ist welk; mit deinem Kranz von Schnee
Hast du des fernen Berges Haupt geschmückt.
Willst du mich schrecken? Ist so streng dein Antlitz
Weil ich dir treulos war und dich verliess? –
O sei gegrüsst mir, theure Muttererde!
Mit diesem Kuss nimm meine Freudenthränen;
Bist du auch todt, so füllst du doch mein Herz.
Der Grund und Boden, den Paludan-Müller hier mit Tithon betritt, ist der Grund und Boden Adam Homo's. In dem Augenblick, da die Luft der Erde sich schwer um Tithon's Schulter legt, begrüsst die Poesie Paludan-Müller's Gäa wieder. Er hatte damals schon den ersten Theil »Adam Homo's« ausgearbeitet.
»Dies ist Fleisch von unserm Fleisch, Blut von unserm Blut« hätten die Zeitgenossen sagen können, als Adam Homo erschien. Derselbe Dichter, der als Jüngling Nebelbilder in die Wolken gemalt hatte, und der als Greis, zu der Ansicht seiner Jugend zurückgekehrt, schrieb: »Man verlangt Fleisch und Blut von der Poesie, Fleisch und Blut sind in den Schlachthäusern zu haben; von der Dichtkunst können nur Gefühl und Geist gefordert werden« – dieser selbe Dichter gab auf der Mittagshöhe seiner Mannesjahre der Mit- und Nachwelt das wahrste und lebendigste Gedicht, das die dänische Literatur bis dahin hervorgebracht hatte, ein Werk, dessen Held weit davon, wie die früheren des Dichters ein poetisch angezogener Gedanke zu sein, der leibliche Bruder des Lesers war, und dessen Wesen eine blutige Satyre ist. Dem Shylock'schen Pfund Fleisch vergleichbar, war das Buch dem lebenden Geschlechte, seinem Herzen zunächst, mit dem Messer des unerbittlichen Sittengesetzes ausgeschnitten.
Fast widerstrebend schien der Dichter an seine Aufgabe gegangen zu sein. Da die Epoche des Realismus bei ihm von kurzer Dauer gewesen ist, hat man den Eindruck, dass er der Wirklichkeit eigentlich nur deshalb so nahe auf den Leib rückte, um durch seinen bitteren Spott und sein vernichtendes Urtheil ein für alle Mal mit ihr abzurechnen, und sie dann eiligst zu verlassen. Es ist, als hätte er sagen wollen: »Ihr habt mir vorgeworfen, dass ich keinen Blick für das Heimathliche hätte, ihr habt mir immer die Fremdartigkeit meiner Schilderungen vorgehalten, wohlan, ich werde es euch einmal recht machen, ich werde Einen gerade aus eurer Mitte herausgreifen und ihn mir zum Helden erwählen«. Kierkegaard, der sich in ähnlicher bitterer Verachtung seiner Zeitgenossen erging, schrieb ungefähr gleichzeitig in »Stadien auf dem Lebenswege«: »Ein Schritt ist noch zu thun, ein wahres non plus ultra, wenn nämlich solch eine kannegiessernde Generation von Lebens-Versicherer es der Poesie als Ungerechtigkeit auslegt, dass sie ihren Helden nicht unter den würdigen Zeitgenossen wähle. Aber man thut der Poesie Unrecht, oder vielmehr, man hetze sie nicht zu lange, sonst möchte es damit enden, dass sie aristophanisch den ersten, besten Wursthändler beim Schopfe nimmt und ihn zum Helden macht«. Dieser Schritt ist eben hier gethan. Die nackte Wirklichkeit, das Hässliche in der Aussenwelt, das Ideenlose in dem gesellschaftlichen Leben, das Schwache, Erbärmliche, Schlechte, Verächtliche in dem inneren Menschenleben ist ohne Scheu und ohne Gnade entblösst worden. Die Muse des Dichters, die vorher in der »Tänzerin« coquet in Flor und Gaze gehüllt, in dünnen Schuhen über den glatten Fussboden dahinflog, hat sich zur barmherzigen Schwester verwandelt, die, zugleich streng und milde, sich mit festem Schuhwerk in's schlimmste Wetter hinauswagt; sie geht, ohne das Elend, wo es sich auch findet, zu scheuen, für jegliche Ansteckung unempfänglich, durch schmutzige und armselige Strassen, sie steht, von Glanz und Flitter nicht geblendet, in den Häusern der Vornehmen, die Herzen mit ihrem erhabenen und überlegenen Blick durchschauend. Sie nennt Alles mit Namen, die feine Lüge sowol wie die plumpe Erbärmlichkeit.
Das Gedicht war ein Stück Dänemark, ein Stück Geschichte – ein Stück lebendiges Gewebe von dem grossen Webstuhl der Zeit geschnitten. Das metaphysische Spiegelbild des menschlichen Wesens, das die Mythendichtung gegeben hatte, war hier von dem psychologischen und ethischen Studium des einzelnen Menschen verdrängt. Der Ort war nicht mehr ein Hof im Lande der Romantik, noch ein Luftschloss im Aetherreich, die Handlung spielte in Jütland, auf Seeland und Fünen, die Zeit war nicht mehr der ewige Augenblick oder das phantastische »Es war einmal«, sondern die Jahre 1830-48, die goldenen Jahre der Bourgeoisie in Westeuropa und diejenigen, in welchen sie ihre Herrschaft in Nordeuropa begründete. Zum ersten Mal waren Raum und Zeit als bedeutende Mächte von Paludan-Müller anerkannt worden.
Doch während die Aufgabe solchergestalt individualisirt und durch Linien in der Zeit und im Raum begrenzt wurde, war sie doch nicht minder auf das allgemein Gültige gerichtet. Adam Homo – das sollte, wie der Titel sagte, der Mensch selbst sein und der Held war nicht weniger vorbildlich gemeint als die früheren mythischen Helden des Dichters. Er ist im Grunde selbst eine mythische Gestalt; seine Geschichte ist der Lebenslauf der dänischen Bourgeoisie als Mythus.
Ein Ausdruck kam immer in den Gesprächen Paludan-Müller's wieder, wenn er von Wissenschaft oder Kunst sprach, es war der Ausdruck: »grosse Aufgaben«. In diesen Worten fasste er seine Ansprüche an sich selbst und andere Mitstrebenden zusammen. Er selbst suchte sich immer grosse Aufgaben, weil es sein Glaube war, dass nur diese die Kräfte entwickeln und einer Kraftanstrengung werth seien, und uns Jüngere spornte er immer an, uns grosse Aufgaben zu stellen, weil nur durch die Lösung derselben das Werk sich einen bleibenden Platz in der Literatur erobere. »Es gibt, sagte er, in allen Literaturen mehr als genug, das wie Spreu aus einander stiebt, streben Sie immer danach, etwas zu leisten, das stehen bleibt und die Zukunft vor sich hat.« Das sicherste Mittel, dies zu erreichen, war nach seiner Ansicht in seiner eigenen Kunst das Streben, in den Charakteren und Schicksalen der individuellen Persönlichkeiten den allgemein menschlichen Typus darzustellen. Die Dichter, bei welchen das Zufällige eine gewisse Rolle spielt, erheben sich zwar nicht so hoch, erhalten aber zum Ersatz oft ein flüchtigeres, mehr spielendes Leben, einen bestrickenderen Reiz; denn Zufall heisst in der Dichtkunst das Bizarre, das anmuthig Ueberraschende, die unberechenbare und doch natürliche Unregelmässigkeit. Paludan-Müller ist in der Wahl seiner Pläne in einem seltenen Grad der Feind des Zufalls. Sein Sinn für das Grundmenschliche nicht weniger als ein Mangel an eigentlicher Erfindungsgabe, hinderten ihn daran, sich jemals psychologisch absonderliche Stoffe zu wählen. Das Geschlecht, der normale homo sapiens in seiner ganzen Thorheit, war der einzige Stoff, der für ihn volle Anziehungskraft hatte.
In »Adam Homo« stellte sich der Dichter die Aufgabe zu zeigen, wie ein Mensch aus der Menge, weder von den am besten noch am schlechtesten Ausgerüsteten, von Jugend an wie alle Besseren voll idealer Hoffnungen und Vorsätze, damit verfahre, sein ganzes geistiges Vermögen hindurchzubringen, um zuletzt als seelenloser Spiessbürger zu enden; er wollte gleichzeitig schildern, wie der Held für jede Stufe, die er geistig und sittlich herunterstieg, gesellschaftlich eine Stufe erklomm und erklimmen müsse.
Paludan-Müller war wenig geneigt Aufklärungen über die Geschichte seiner Werke zu geben; als ich ihn aber einmal ohne jegliche Einleitung frug: »Was haben Sie zuerst geschrieben von ›Adam Homo‹?«, antwortete er ohne Bedenken: »Die Grabschrift, die einzigen Zeilen, die im Gedichte gesperrt gedruckt sind:
Die ew'ge Ruh' hier Adam Homo fand,
Baron, Geheimrath, Ritter von dem weissen Band.«
Hätten die Zeitgenossen diese Aufklärung, die mich durchaus nicht wunderte, besessen, so würden sie in ihren Versuchen, die sechs ersten Gesänge des Gedichts, die 1841 erschienen, und die erst sieben Jahre später fortgesetzt und vervollständigt wurden, zu verstehen, nicht so umhergetappt haben. Sogar Heiberg, der erste dänische Kritiker der damaligen Zeit, dachte nach dem Erscheinen des ersten Theils an die Möglichkeit, dass der Dichter Adam als glücklichen Ehemann in einem idyllischen Pfarrhof auf dem Lande wollte enden lassen. So sehr war man Anfangs davon entfernt, den Entrüstungspessimismus und die überlegene Ironie, aus denen das Dichterwerk hervorgegangen war, zu begreifen. Man ahnte nicht, dass von dem Augenblick an, wo Paludan-Müller die Feder ansetzte, es seine Absicht gewesen war, diesen Vertreter der dänischen Bourgeoisie, der mit jugendlicher Liebenswürdigkeit und jugendlichen Schwärmereien beginnt, allmälig alles, woran er geglaubt hat, aufgeben, alle, die an ihn glaubten, verrathen zu lassen; man ahnte nicht, dass Adam Homo's Bestimmung die war, als Volksmann und Volksredner aufzutreten, um gleich darauf umzusatteln, »das Ideal« und die Volkstümlichkeit fallen zu lassen, sich zum »feinen Manne« zu entwickeln, unter der Sonne des Hofes eine Zuflucht zu suchen, und endlich mit Titeln bedeckt, mit Orden behängt, als Baron, Geheimrath, Ritter und so weiter, feierlich beerdigt zu werden.
Und wenn Heiberg dies nicht ahnte, kann man sich dann wundern, dass das Publikum Anfangs ganz ohne Verständniss für die Bedeutung des Gedichtes dastand. Das Buch hatte keinen Erfolg, man fand es platt. Die Lesewelt, die an keine so derbe Kost gewohnt war, und die so oft von Paludan-Müller an die Tafel der Götter auf dem Olymp zu Gaste geladen worden, fand einige Stellen anstössig, andere zu alltäglich und meinte überhaupt, dass Paludan-Müller sich dies Mal einen Stoff gewählt hätte, der ausserhalb des rechten Gebiets seiner Begabung läge. Und doch sollte dieser so überlegen beurtheilte »Adam Homo« nicht viele Jahre später als das typischste und bedeutendste dänische Werk der erzählenden Gattung vollendet vorliegen.
Die doctrinäre Aesthetik wird nicht wenig gegen ein Epos einzuwenden haben, dessen Totalbild so wenig erbaulich und dessen Totalstimmung so unvollkommen, eigentlich nur theologisch versöhnt ist. Aber auch von einem nicht doctrinären Standpunkte aus lässt sich eine Haupteinwendung machen. Die von dem Stoffe bedingte Schwierigkeit war die, dass Paludan-Müller nicht, wie so unendlich viele andere Dichter gethan haben, uns den fertigen Spiessbürger in seiner ganzen Herrlichkeit vorzuführen beabsichtigte, um ihn sodann der scharfen Examination des Ideals gegenüber durchfallen zu lassen, sondern dass er uns das Werden des Spiessbürgers zeigen wollte. Die meisten Spiessbürger in der Poesie wie im Leben haben kein oder fast kein Werden gehabt, sie sind geborene Philister. In derartigen Gestalten löst das Hässliche sich ohne den geringsten disharmonischen Nachhall in's Komische auf. Ein solcher Spiessbürger ist z. B. der Vater Adam Homo's, der deshalb so vollendet komisch ist. Aber das Entstehen des komischen Charakters darzustellen ist überhaupt ein Stein des Anstosses für die moderne Poesie. Aristophanes liess sich darauf nicht ein; wie die griechische Tragödie mit der Katastrophe, so beginnt die griechische Komödie sogleich mit der verkehrten Welt. In »Adam Homo« ist die Folge davon, dass der Held komisch wird und nicht am Anfang ist, kurz gefasst die, dass er Anfangs durch seine Liebenswürdigkeit Sympathie, schliesslich durch seine Komik Heiterkeit erweckt. Aber der Uebergang selbst, der darin besteht, dass ein wol angelegter Mensch zu Grunde geht, ist widerlich traurig, und doch ist derselbe die Pointe des Ganzen.
Adam Homo ist ein schwacher Mensch, aus Schwäche treulos in der Liebe und unzuverlässig in der Politik. Er ist aber nicht schwach, wie so viele der Goethe'schen Hauptcharaktere, nicht wie Weislingen, Fernando, Clavigo, Eduard es sind; denn er ist nicht in seiner Schwäche liebenswürdig. Goethe hat, wie die Mehrzahl der Neueren, der Schwäche oft den Zauber der Liebenswürdigkeit verliehen, wie überhaupt in der neueren Poesie die Schwäche nur zu häufig das Geheimniss der Liebenswürdigkeit ist. Nichts ist aber Gegenstand einer bitteren Ironie von Seiten Paludan-Müller's als eine Vertheidigung Adam Homo's, die, wie diejenige des advocatus hominis in dem letzten Gesang, sich auf die Liebenswürdigkeit des Helden stützt.
Ohne direct liebenswürdig zu sein, kann die Schwäche als humoristisch etwas Reizendes haben. Es gibt sogar ein altes, in der Natur der Sache begründetes Mittel, durch welches sie am sichersten gefällt. Die persönliche Liebenswürdigkeit kann der Schwäche immer nur für eine Zeit den Schein der Freiheit und die Form der Kraft verleihen, und sie beständig immer auf dem Sprung sich zum Niedrigen oder Hässlichen zu verwandeln; gegen diesen Fall kann sie sich aber durch die Annahme eines unerbittlichen Schicksals sichern; als fatalistisch erweckt sie nur Lachen und verfällt vollständig der Komik. Diese allgemeine Wendung hat Paludan-Müller mit Erfolg, vielleicht tiefer und psychologisch richtiger, als es früher geschehen ist, angewendet. Sein Adam ist ein Theoretiker, dem halbbewusste Sophistik immer zu Gebote steht; abwechselnd muss sein ganzes Leben hindurch der Zufall und die harte Nothwendigkeit die Verantwortung für seine Erbärmlichkeit tragen.
Wenn der Totaleindruck dennoch nicht unbedingt komisch wird, so beruht dies auf einem Verhältniss, das Mendelssohn in seinen »Rhapsodien« scharf und richtig bezeichnet hat: »Wir lachen«, sagt er, »nicht über Personen, die uns lieb sind oder uns nahe stehen, sobald ihre Fehler oder Thorheiten einen irgendwie bedeutenderen Charakter annehmen.« Jeder ist aber sich selbst der nächste, und wird ein »Du bist der Mann« uns fortwährend zugerufen, so wird es uns unmöglich zu lachen.
Im Laufe der Erzählung hat der Dichter indirekt uns unaufhörlich gesagt was er im letzten Gesang ganz direkt ausspricht:
Auch du musst ja dieselbe Strasse gehen,
Drum, wie man Probe hält im Schauspielhaus,
So übe deine Rolle jetzt voraus!
Betracht' in Homo dir dein eignes Bild,
Und in den Dingen, die ihm widerfahren,
In jedem Wort, das seinem Mund entquillt
Wird sich dein künftig Loos dir offenbaren.
Selbst das Lächerlichste wird in diesem Fall nicht rein lächerlich, und besonders den jugendlichen Leser ergreift leicht ein wahrer Schrecken vor den Möglichkeiten, die in seiner eigenen Seele ruhen, an Stellen, wo der Dichter eine rein poetische Wirkung beabsichtigt hatte. So z. B. wo Homo Kammerherr geworden ist:
Hier, einsam, fühlt er Dankbarkeit sich regen,
Fühlt seine Seele frei von jedem Band.
Im Stillen preist er jene güt'ge Hand,
Die ihn geleitet auf des Lebens Wegen,
Ihm Wunden wol geschickt, jedoch auch Segen
Und alles Leid zum Guten noch gewandt.
Ja, eine Vorsehung erkennt er klar
Und bringt gerührt ihr seinen Dank nun dar.
Der ätzende Spott in diesem Dank für den Kammerherr-Schlüssel wirkt fast peinlich. Der Dichter nimmt die Sache zu ernst, um uns zum Lachen über seinen Helden zu reizen; er wagt nicht, ihn liebenswürdig zu zeichnen, denn Adam soll im vollsten Ernste verurtheilt werden; er will ihn nicht der Komik preisgeben, denn Adam soll – der theologisirenden Weltansicht des Dichters gemäss – doch immer einen Anknüpfungspunkt für die Gnade bewahren.
Der Standpunkt Paludan-Müller's ist kein Humor, sondern eine ethische Ironie, denn was die Ironie vom Humor trennt, das ist ihr Mangel an Mitgefühl mit dem Objecte. Dieser Standpunkt ist nicht der rein künstlerische, der mit derselben liebevollen Vertiefung bei dem Kranken wie bei dem Gesunden, bei dem Laster wie bei der Tugend, bei dem, was der Künstler in der wirklichen Welt hassen und dem, was er lieben würde, verweilt. Diese Anschauungsweise ist eben so wenig die rein humane, die von Liebe zum Menschengeschlecht getragen, milde, überlegen und harmonisch verbleibt, und die ein Lachen erzeugt, das ohne Bitterkeit ist. Paludan-Müller's Satyre ist kalt und vernichtend, und hat dadurch ihre eigenthümliche Gewalt. Man achte nur darauf, wie der brennende Spott des Dichters fast unmerklich sich durch ein Adjectiv oder eine Nebenbemerkung Bahn bricht, so oft es gilt, die so wenig dauerhaften guten Regungen des Helden zu verspotten.
Ein paar Beispiele: Ein Brief von Hause meldet Adam, dass seine Mutter, die lange gekränkelt, im Sterben liege, und um sie noch einmal zu sehen, reisst er sich von seiner Braut los und tritt die Reise nach Jütland an. Aber schon unterwegs erfährt er ihren inzwischen erfolgten Tod. Tief ergriffen theilt er in einem Briefe seiner Geliebten die Trauerbotschaft mit, indem er sie gleichzeitig seines Glaubens an die Zukunft und seiner unerschütterlichen Treue versichert. Der Brief ist nicht unaufrichtig, kaum hohl zu nennen, nur naiv. Der Dichter aber, der lange vor dem Leser weiss, wie Adam enden wird, kann kaum den Augenblick seines Umschlags erwarten; schon eine Weile bevor Adam die satyrischen Peitschenhiebe verdient hat, schwingt Paludan-Müller mit Hohngelächter die Geissel des Spottes über seinen Kopf:
Auf seinen Glaubens-Brief drückt Homo kräftig
Das Siegel ab, indem er sich erhebt;
Er trägt den reichen Schatz zur Post geschäftig,
Wo er die Franko-Marke darauf klebt.
Adam geht an Bord um zur Beerdigung rechtzeitig in seiner Heimath zu sein. Auf dem Dampfschiffe trifft er aber unvermuthet seine erste Flamme wieder, die Comtesse Clara, die, um sich Adam als Begleiter auf ihr Landgut zu sichern, ihn ihrem Gemahl, dem dicken, geistlosen Kammerherrn Thor vorstellt. Vergeblich sträubt Adam sich, die Einladung anzunehmen, mit der Einwendung, dass seine Mutter eben gestorben sei; Clara erklärt es für ihre Pflicht, ihn in seinem Schmerze zu trösten. Seine Verlobung hat er schon verschwiegen oder verläugnet. Er lässt sich überreden die Beerdigung zu versäumen. Clara und er gehen zusammen aus um Einkäufe zu machen; sie will eine Feder für ihren Hut, er Trauerflor für den seinen kaufen. Clara befestigt zuerst ihre Straussfeder,
Wonach um Adam's Hut den Flor sie wand,
Versicherte, dies kleid' ihn ganz charmant.
Da rollten vor dem Hause schon die Räder
Des Wagens. Thor stieg ein mit unserm Paare,
Mein Held im Flor, im Federschmuck Frau Clare.
Wenn man sich nun erinnert, dass dieser Flor der Trauerflor für seine eben verstorbene, herrliche und heissgeliebte Mutter ist, so wird man schmerzlich von dieser blutigen Ironie berührt. »Wenn es wahr ist«, bricht man unwillkürlich aus, »dass wir bis zu diesem Grade die Kinder des Augenblicks, der Stimmung, des Selbstbetruges sind, dass unsere besten Gefühle, unsere ernstesten Vorsätze und reinsten Erinnerungen in Dunst verdampfen, wie Rauch verschwinden, o Dichter! wie kannst Du dann bei dem Gedanken daran Dein satyrisches Gesicht machen, hast Du denn keine Thräne für die sonderbare und unheimliche Mischung unserer Menschennatur, die ein solches Elend unmöglich macht?« Der Fragende muss sich mit Gewalt darauf besinnen, dass dieser Dichter vor allem ein entrüsteter Moralist ist, der eine religiös-poetische Tendenz mit seinem Gedichte verfolgt. Das Persönlich-Moralische ist ihm alles; er sieht es nicht als ein Glied des grossen Ganzen, betrachtet es nicht als eine besondere organische Function des Weltorganismus, derjenigen der Leber oder des Herzens im menschlichen Körper vergleichbar; er hat nur Auge dafür; wo es sich findet, verdunkelt es alles andere seinem Blick, und wo es fehlt, da sieht er nur die Abwesenheit desselben, und »eo ipso profulget, quod non videtur.«
Adam hat im Ganzen drei Perioden: in der ersten ist er naiv, in der zweiten ist er schlecht, in der dritten ist er dumm. In der ersten und dritten ist die Meisterschaft der Schilderung nur ergötzlich, in der mittleren Periode der Selbsttäuschungen und des langsamen inneren Verderbens und Verfaulens kann dieselbe Meisterschaft dem weicheren Leser, besonders der Leserin beängstigend vorkommen. Aber derartige Einwendungen können den Werth eines Gedichts nicht beeinträchtigen, wenn es den Vorzug besitzt, dass es lebt, und »Adam Homo« hat das Leben in sich, das die Existenz einer Reihe von Menschengenerationen überlebt. Die Werke, die mit diesem Gedicht zusammen genannt wurden als es erschien, sind schon vergessen, und vermuthlich wird man in einigen hundert Jahren dazu noch zurückkehren wie zu einem der klassischen Werke der dänischen Literatur; denn »Adam Homo« ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern eine historische Urkunde ersten Ranges.
Gewiss haben die Ansichten eines vergangenen Zeitalters in dieser Satyre, die sich eben über jenes Zeitalter erheben und es richten will, starke Spuren hinterlassen. Aber ohne einen so kräftigen Halt in der ganzen überlieferten theologischen und socialen Lebensanschauung würde der Dichter andererseits kaum die nie versagende Sicherheit des moralischen Urtheils bewahrt haben können, die jetzt das Gedicht so klar und durchsichtig macht. Für ihn wie für seine Zeitgenossen in Dänemark ist Strauss ein Schrecken und George Sand eine Lächerlichkeit. Er ist so eifrig, dem ersteren zu Leibe zu gehen, dass ihn die Pathen schon im ersten Gespräch bei Adams Taufe nennen, – obwol Adam beim Erscheinen des Gedichts 1841 ungefähr 25 Jahre alt sein musste und »Das Leben Jesu« von Strauss erst 1835 erschien. Und will er eine Vertreterin des weiblichen Typus, den er verabscheut, schildern, so weiss er nichts besseres als sie die Frauen-Emancipation karikiren und das Bild George Sand's an ihrer Wand haben zu lassen. Man darf sich aber nicht an ein einzelnes unverständiges Urtheil oder an eine Beschränktheit in einem einzelnen Punkt hängen, wo so viel sich findet, das von dem durchdringendsten und umfassendsten Geiste Zeugniss ablegt. Mögen die metaphysischen Fäden, die sich durch die Erzählung winden, die vielen Erwägungen über Freiheit des Willens, Zufall und Nothwendigkeit, uns schon jetzt ein bischen veraltet vorkommen; sie nehmen im ganzen so wenig Raum ein, dass sie die Wirkung der Totalität keinem empfänglichen Gemüth beeinträchtigen können. Und welche Fülle tiefer und klarer Eindrücke ist nicht übrig!
Mir scheint es unzweifelhaft, dass dies das männlichste Dichterwerk ist, das in dänischer Sprache geschrieben worden. Wie viele andere Dichter der modernen Zeit sind Kinder oder blinde Schwärmer oder muthwillige Jungen oder eitle Egoisten gewesen, der Dichter, der »Adam Homo« geschrieben hat, war ein Mann. Wer hatte gedacht, dass Paludan-Müller, wenn er sich endlich einmal entschloss von dem elfenbeinernen Thurm, in welchem er sich bisher aufgehalten hatte, herunter zu steigen, auf dem Pflaster der Wirklichkeit seine Füsse mit so kühnen Schritten setzen würde! Andere Dichterwerke der dänischen Literatur zeichnen sich durch Anmuth, durch Schönheit, durch romantische Begeisterung oder durch Naturauffassung aus; dies Buch ist wahr – und dies Eine macht es lehrreicher und tiefer als alle früheren. Man lese es nur immer wieder, und man wird sich von der Wahrheit überzeugen.
Die sechs letzten Gesänge des Gedichts erschienen in einem ungünstigen Augenblick, im December 1848, eben als ein erwachendes volksthümliches Leben eine Heerschaar lichter Hoffnungen und schöner Illusionen erzeugte, in deren Glanz dieses Buch in seiner Entfernung vom Augenblick nicht mehr zu bedeuten schien als das Licht eines Sterns für einen Ball bedeutet, der im Freien unter der Beleuchtung von tausend Fackeln abgehalten wird. Aber einige Nächte später, wenn die Fackeln längst ausgebrannt sind, so sieht man den Stern. Oder sieht die jetzt lebende Generation der gebildeten Jugend in Dänemark ihn vielleicht nicht? Oft kann man nicht umhin sich zu fragen, wozu die Jugend eines Volks wol ihre vorzüglichsten Bücher gebraucht. Sind sie wirklich nur dazu da um hübsch gebunden, in Bücherschränken zur Schau gestellt zu werden? Woran liegt es sonst, dass man so geringe Wirkung von ihnen spürt? Oder hat »Adam Homo« vielleicht den Einfluss gehabt, dass andere Adamssöhne in ihm eine Art von Bädeker für die Reise durch's Leben gefunden haben, mit Angabe des Ziels, das es zu erreichen gilt, der Mittel, deren man sich bedienen, und der Klippen, die man umsegeln muss, wenn man von den Herrlichkeiten des Erdenlebens eben so viel wie der Held des Gedichtes erlangen will?
»Adam Homo« ist mehr als alles andere, das Paludan-Müller geschrieben hat, ein nationales Gedicht. Es unterliegt keinem Zweifel, dass es, wie Puschkin's »Eugen Onägin« durch Byron's »Don Juan« hervorgerufen oder angeregt worden; die Form des Werks, das Versmaass, der Stimmungswechsel, das barocke Hin- und Herschwanken zwischen Ironie und Pathos, endlich Einzelnheiten wie Adam Homo's Verliebtheit als Schuljunge oder gewisse Details der Hochzeit erinnern an die berühmte englische Epopöe; aber obwol »Adam Homo« nicht seine jetzige Gestalt hätte gewinnen können, wenn das Byronsche Gedicht nicht vorausgegangen wäre, so hat das dänische Dichterwerk doch einen solchen Duft und Erdgeruch des Bodens, der es erzeugte, dass es unter den wenigen epischen Gedichten ersten Ranges, die Europa in diesem Jahrhundert hervorgebracht hat, schon durch seine Originalität einen Platz behaupten kann. Es ist eine in der Gesammtliteratur alleinstehende Dichtung.
Nach »Adam Homo« ist »Kalanus« das interessanteste Werk Paludan-Müller's. Es ist der positive Ausdruck für sein Ideal wie »Adam Homo« das negative. Nirgends ist seine geistige Tendenz verwandter mit der ursprünglichen seines grossen Zeitgenossen Kierkegaard als hier. Die Aufgabe, welche »Kalanus« zu lösen strebt, ist ganz dieselbe, an deren Lösung Kierkegaard in »Entweder-Oder« ging, nämlich die, zwei Persönlichkeiten einander gegenüber zu stellen, von denen die eine die unmittelbare Genialität, die genusssüchtige, äusserlich thatkräftige Lebensansicht, die andere die ethische Vertiefung, die sittliche Grösse incarnirt, sie mit einander kämpfen zu lassen und dem Leser die Ueberzeugung von der entschiedenen Niederlage der unmittelbar natürlichen Lebensansicht beizubringen. Bei Kierkegaard sind die zwei entgegengesetzten Weltanschauungen von einem Aesthetiker und einem Obergerichtsassessor, bei Paludan-Müller von berühmten historischen Namen vertreten; es ist kein geringerer Mann als der Welteroberer, Alexander der Grosse, der hier die »ästhetische« Lebensansicht repräsentirt, und ihm ist als Gegner der Philosoph Kalanus zugetheilt. Das ideale Verhältniss bei der Darstellung eines derartigen geistigen Ringkampfs würde sein, dass es dem Dichter gelungen wäre, beide kämpfende Parteien gleich vorzüglich auszustatten. Das wirkliche Verhältniss ist in diesem Fall, dass bei Kierkegaard der Aesthetiker mit geistigen Gaben verschwenderisch ausgestattet ist, die Eingaben des Ethikers dagegen etwas hölzern und schwach erscheinen, und dass bei Paludan-Müller umgekehrt der Ethiker ein nicht weniger geistvolles als begeistertes Wesen, ein Mensch von der reinsten Seelenschönheit ist, während der grosse Alexander nicht auf der Höhe seines historischen Namens steht. Dieser Alexander hätte Asien nicht bezwungen. Paludan-Müller scheint in seiner Begeisterung für den indischen Denker den lebendigen Eindruck verloren zu haben, dass Alexander ein Genie war, nicht blos heroisch wie Achilleus, sondern gross wie Cäsar. Und wie bei Alexander so ist überhaupt der griechische Geist in eine niedrigere Sphäre hinuntergezogen worden. Die Männer, die hier als Vertreter der griechischen Philosophie in ihrer Glanzperiode stehen, haben bisweilen so unbedeutende und gedankenarme Repliken, dass der indische Einsiedler leichte Siege über ihre Raisonnements gewinnt. So ist allerdings der Eroberer noch der einzige, der wenigstens einigermassen dem Asketen würdig gegenübersteht.
Der Gang der Handlung ist der, dass der indische Eremit Kalanus in Alexander, der auf seinem Triumphzug durch Asien Indien erreicht, eine Offenbarung von Brama's ewigem Licht zu sehen glaubt, sich in demüthiger Anbetung dem König nähert und ihm zu Fuss auf seinem Wüstenmarsch bis zu Pasargadä folgt, wo er das Glück hat wieder dem König vorgeführt zu werden, den er kniend mit den Namen »Gott, Herrscher, Fürst der Weisheit, König der Kraft« begrüsst. Alexander, der den seltenen Werth des Mannes einsieht, knüpft ihn durch Güte an seine Person und lässt ihn an dem Fest theilnehmen, das er denselben Abend feiert. Bei dieser Feier, die dem Dichter vortrefflich gelungen ist, finden sich schöne griechische Hetären ein, die das Lob Alexanders singen und unter Jubel seinen Juwelenschrein plündern, und hier entdeckt zu seinem Staunen und Schrecken allmählig Kalanus, dass der grosse Fürst, in dem er den fleischgewordnen Gott sah, weder den Rausch scheut, der am Grund des Bechers schlummert, noch den Dämon beherrscht, der sich hinter der Larve der Frauenschönheit verbirgt. In dem Entsetzen des ersten Augenblicks stösst er mit seinem Messer nach der einen Hetäre, wird aber entwaffnet. Wie gelähmt und versteinert steht er, als das Gelage zu Ende ist, nicht nur bitter enttäuscht in seinem Glauben sondern zerknirscht darüber, Brama mit einem schwachen und sterblichen Menschen, wie er selbst, verwechselt zu haben. Er kann nur durch Selbstvernichtung die Sünde sühnen und zum Gott zurückkehren. Er beschliesst, sich auf indische Weise selbst zu verbrennen.
Als aber Alexander am folgenden Tage seinen Festrausch ausgeschlafen hat und Kalanus' Entschluss erfährt, fürchtet er, dass er am Abend vorher vielleicht zu strenge gegen seinen fremden Anbeter gewesen ist, und geht zu ihm um ihn durch die Versicherung zu erfreuen, dass er noch immer die Gnade des Königs besitze. Er kommt, als Kalanus, aufs Aeusserste vollständig gefasst, schon von seiner Mutter für den Tod gesalbt worden. Er will Kalanus beruhigen und erfährt zu seinem Erstaunen, dass dieser keine Furcht gehabt habe, der König könne erzürnt sein. Er bittet ihn von seinem Vorsatz abzustehen, aber vergeblich. Der Tyrann in ihm erwacht; Alexander droht Kalanus, er befiehlt ihm zu leben; aber die Drohungen prallen ab an dem, der eben sterben will. Die Verwunderung über den Trotz des Inders ruft den Zorn des Gebieters hervor; und als der immer in gleichem Grad gefasste und stille Denker zur Antwort nur das Unwürdige darin betont, das Gemüth vom Zorn hinreissen zu lassen, glaubt Alexander Hohn auf den Trotz folgen zu sehen und hebt mit dem Ausbruch »Sklav!« die Hand zum Schlage. Der Schlag wird abgewehrt und die Erbitterung von ruhigen, gefühlvollen Ueberredungsversuchen, von edlen Bitten, grossmüthigen Versprechungen abgelöst – Alles vergeblich. Alexander bittet Kalanus zu leben aus Freundschaft für ihn, bittet ihn die Reiche mit ihm zu theilen, Krone und Scepter aus seiner Hand anzunehmen – es macht so wenig Eindruck wie die Drohungen vorher. Dann geschieht das Erhabene: Alexander wirft sich vor Kalanus auf die Knie und fleht ihn um sein Leben an.
Diese Situation ist die schönste, die dramatischste, die geistvollste, die Paludan-Müller in seinem Leben gedichtet hat. Es ist die Hauptscene in all' seinen Dramen. Es ist die Summe all' seiner Gedanken und Träume. In dem Augenblick, als Paludan-Müller hier Alexander auf's Knie sinken liess, warf er alle Grösse der Welt, ihren Glanz und ihre Ehre, das Genie und den Ruhm der sittlichen Reinheit vor die Füsse. Dieser Kniefall wiegt den Kniefall Kalanus' vor Alexander im ersten Akte auf. Aber sogar diese äusserste Selbsterniedrigung des Helden geschieht vergeblich. Und das Stück endigt damit, dass Kalanus' Geist, in den heiligen Flammen geläutert, vom Scheiterhaufen in den Himmel Brama's hinaufsteigt. Mit all' seinem Aufbieten von Geistesanstrengung, Witz, Gelehrsamkeit, Dialektik und moralischer Begeisterung bereitete Kierkegaard in »Entweder – Oder« der ethischen Weltanschauung keinen so glänzenden Triumph wie Paludan-Müller ihr in jener einen Scene.
Und wie man das hartnäckige Festhalten Tithon's an seinem Entschluss, zur Erde zurückzukehren, als ein Symptom des Eintretens der wenig dauerhaften aber so glücklichen Tendenz Paludan-Müller's zum Realismus auffassen kann, so kann man in dem ebenso hartnäckigen Festhalten des Kalanus an dem Vorsatz, das Erdenleben zu verlassen, ein Symptom seiner Rückkehr zur abstracten Poesie seiner Jugend sehen. Das heidnisch Mythische kehrt in seinen Werken »Das Paradies« und »Ahasverus« als biblischer Mythus zurück. Und zwar ist in den Arbeiten, die auf »Adam Homo« folgen, eine weit tiefere Psychologie als in denen seiner ersten Jugend; die in den Jahren der männlichen Reife gewonnene psychologische Einsicht konnte ja nicht verloren gehen; aber diese späteren Werke behandeln nicht mehr das Leben in seiner Breite und mit seinen Farben, sie ziehen sich von der Wirklichkeit zurück und münden in das Mönchsleben, das Eremitideal, den Sühnopfertod oder den Weltuntergang; es ist eine Poesie des Entsagens, der Selbst- und Weltvernichtung.
Das kraftvollste Produkt dieser letzten Periode ist das dramatische Gedicht »Ahasverus«, es ist ein nachdrücklicher Prolog des jüngsten Gerichts. Wir erleben mit dem Schuster aus Jerusalem den letzten Tag der Welt, erfahren von ihm den Lebenslauf der Welt, seit die Humanität das Christenthum ablöste: wie die Bestialität der Humanität auf der Ferse folgte, bis das Regiment des thierischen Wesens von dem des Antichrists, das im Gedicht geschildert wird, abgelöst wurde. Es ist ein Drama, das Joseph de Maistre mit Entzücken unterzeichnet hätte, dessen Ausfälle wider den Constitutionalismus und die Toleranz ein versificirter Commentar zum Syllabus des Vatikans bildet. Das Gedicht bezeichnet im Verein mit einigen der späteren Schriften Kierkegaard's den Gipfel der Reaction gegen das achtzehnte Jahrhundert in der dänischen Literatur. Es hat in seinen Monologen ermüdende Partien; aber es hat blendend prachtvolle und zugleich ergreifende Stellen in den Chorgesängen, welche die Angst der Menschen vor dem kommenden Unglück ausdrücken, und nicht minder in dem anmuthigen Gesang der Engel, der Ahasverus in die ewige Ruhe hineinwiegt. Doch das Eigenthümlichste in dem Gedicht, das fast Michel-Angelo-artig Grosse darin, das sind die Posaunentöne, welche die Vernichtung über all' das Endliche herabrufen. Ich führe die ersten paar Strophen an:
Die Posaune (aus den Wolken)
Knie', knie', o Welt, und büss' in Sack und Asche!
Den Stolz, die Herrlichkeit vom Antlitz wasche!
Dir wird noch heut' – der Tag ist angebrochen –
Gericht gesprochen.
Sink', sink' in Staub, was trotzt auf seine Stärke:
Fels der Natur, der Kunst gewalt'ge Werke!
Ihr hohen Thürme müsst mit euren Zinken
In Trümmer sinken.
Stürzt, stürzt in Staub, des Todes Trank zu leeren!
Entsagt der Hochmuth Plänen, Glanz und Ehren!
Stürzt nieder, wie sie all' zu Falle kamen,
Die grossen Namen!
Diese Posaunentöne resumiren die Poesie Paludan-Müller's.
Dem reuigen ewigen Juden gegenüber ist in »Ahasverus« der Antichrist gestellt. Leider thut die Schwäche dieser Gestalt der Wirkung des Gedichts einigen Abbruch. Dieser Antichrist stimmt mit der kirchlichen Tradition überein, er ist kein Lucifer, kein gefallener Engel, er erinnert in seiner gemeinen Haltungslosigkeit lebhaft an den unsicheren, verlogenen Antichrist Luca Signorelli's in dem Dom zu Orvieto, und es ist leicht verständlich, dass Paludan-Müller ausserdem in seinem Festhalten an den orthodoxen Eindrücken seiner Kindheit den Teufel nicht schwarz, oder richtiger nicht flach genug malen zu können gemeint hat. Aber um dem Drama Spiel, Gegenspiel und innere Spannung zu geben, war es nothwendig den Antichrist mit mächtigen und glänzenden Eigenschaften, die seine Herrschaft erklärten, auszurüsten. Kam jedoch schon Alexander zu kurz, so kommt Antichrist noch weniger zu seinem Recht. Und wie mit diesem Antichrist, so geht es mit dem Lucifer Paludan-Müller's in dem Doppeldrama »Das Paradies«. Dieser Lucifer ist zwar unternehmend und scharfsinnig; er hat z. B. den genialen Einfall, den Kern zu spalten, aus welchem der Baum der Erkenntniss emporwachsen wird; aber ein derartiger Lucifer nach Byron ist doch nur eine Ilias nach Homer. Die erste Hälfte des »Paradieses« enthält eine überaus schöne Lyrik. Es findet sich hier in dem Wechselgesang zwischen Geist und Natur und in dem Lied der Engel auf dem Morgenstern, eine kosmische Poesie, die in ihrer Reinheit und Frische nicht von derjenigen Shelley's übertroffen wird; aber die Unbedeutsamkeit Lucifer's im Verein mit der misslungenen, allzu kindischen Naivetät Adam's und Eva's schwächen den Eindruck des grossen Plans der Dichtung. Die Orthodoxie Paludan-Müllers hemmte sowol in »Ahasverus« wie im »Paradies« den Flug seiner Einbildungskraft: in majorem gloriam dei wurde Antichrist ein Schwätzer, Lucifer ein Geist zweiten Ranges.
Paludan-Müller bietet als Künstler den Widerspruch dar, dass er in seiner ganzen Geistesrichtung ein erklärter Spiritualist mit durchgreifendem Hang zum Ueberirdischen und Abstracten, aber in seinem unzweifelhaft bedeutungsvollsten und lebendigsten Werk, das geschrieben zu haben seinen Namen vor Vergessenheit bewahren wird, ein entschiedener Realist war und mit einer Festigkeit, die in dänischer Poesie höchst selten ist, der Wirklichkeit in's Gesicht sah. Doch dieser Widerspruch deutet einen anderen an:
Nur widerstrebend näherte er sich in der Regel der Erde, aber nur äusserst selten liess er sich auf die im überlieferten Sinn geistige Dichtung ein. Sein Pegasus führte ihn eben so oft nach dem heidnischen Elysium wie nach dem christlichen Himmel, und selbst wo er mittelbar das christliche Ideal auszudrücken scheint, tangirt er es nur um im selben Athemzug sich davon zu entfernen. »Kalanus« z. B. scheint beim ersten Blick ein eigentlich christliches Gedicht genannt werden zu müssen; denn es kommt dem Leser als unzweifelhaft vor, dass, wenn Kalanus, anstatt der Zeitgenosse Alexanders zu sein, ein Zeitgenosse von Christus gewesen wäre, und wenn dieser, wie die Orthodoxie behauptet, sich selbst Gott genannt hätte, so wären all' seine Hoffnungen und Erwartungen erfüllt worden. Sieht man aber genauer zu, so enthält das Gedicht eine mehr indische als christliche Begeisterung für den Tod; der Selbstmord, den das Christenthum immer verurtheilt hat, ist als die unbedingt ideale Handlung dargestellt, und selbst wenn die Flammen des Scheiterhaufens wie ein Fegefeuer aufgefasst werden, dem ähnlich, mit welchem »Adam Homo« schliesst, so ist es doch höchst eigenthümlich, dass das einzige Dogma, von welchem dieser protestantische Dichter begeistert zu werden scheint, das von dem Protestantismus verworfene Dogma vom Fegefeuer ist, wie der einzige sittliche Typus, den er leidenschaftlich preist, der des Einsiedlerlebens ist, den der Protestantismus hat fallen lassen.
Es war ein ehrliches und wahrheitsliebendes Wort, das von dem Bruder des Dichters an seinem Sarg gesprochen wurde, nachdem von dem Bischof Martensen der Versuch gemacht worden war, Paludan-Müller als Dichter für die officielle protestantische Kirche zu beanspruchen, dass man doch nicht ganz unbedingt den einen christlichen Dichter nennen könne, der niemals seine Poesie in den Dienst der Kirche gestellt habe. Mit all seiner privaten Orthodoxie hat Paludan-Müller keinen einzigen Psalm geschrieben. Mit all seiner poetischen Vorliebe für Bibel und Legende, kehrte er immer wieder zum heidnischen Mythus wie zum Spiegel seines Gedankens zurück. Er war Christ, weil er von Natur Spiritualist war, nicht umgekehrt, und sein Spiritualismus stimmte deshalb eben so harmonisch mit dem irdischen Sich-Verlieren in das heilige Nirvana und mit der klassischen Schwärmerei für Venus Urania, wie mit der christlichen Begeisterung für Heilige und Märtyrer zusammen. Unter allen Formen war die Verläugnung, Kasteiung oder Tödtung von Fleisch und Blut ihm lieb.
Er hätte wie jener griechische Philosoph den Zunamen Peisithanatos führen können. Er gehörte wie Leopardi der kleinen Gruppe von Geistern an, die man die Liebhaber des Todes nennen könnte. Als sein Zeitgenosse, der grosse dänische Liebesdichter Christian Winther alt wurde, schrieb er ein Gedicht, in welchem er seiner Liebe zum Leben Ausdruck gab und die Worte sagte, dass er, wenn seine Stunde einmal schlüge, sich »sauer und verdriesslich in das Boot Charon's setzen würde«; Paludan-Müller schien ganz umgekehrt, wie jener Adonis, über den er sein letztes Gedicht schrieb, Charon ein »Nimm mich mit!« zurufen und bevor der Fährmann unterschied, woher die Stimme käme, in das Boot springen zu wollen.
Ich spreche hier nicht von seinem persönlichen Glauben als Mensch; ich weiss, dass er an ein Leben nach dem Tode glaubte; ich erinnere mich sogar, wie er eines Tages, als er erfuhr, dass David Strauss dem Andenken seines verstorbenen Bruders ein Buch gewidmet hatte, in seiner naiven Orthodoxie dies als einen Beweis auffasste, dass Strauss sich nicht von der Vorstellung einer persönlichen Unsterblichkeit der Seele hätte losreissen können. Aber ich spreche hier nur von Paludan-Müller als Geist, als Dichter. Und als solcher liebte er den Tod, nicht die Unsterblichkeit. Wie ist Tithon müde, todtmüde von dem Leben! Mit welchem Ernste fragt Kalanus Alexander: »O rede, was ist besser als der Tod?«, mit welchem Entzücken verbirgt sich Ahasverus in seinem geschützten Grab in dem Augenblick, wo all die andern armen Menschen aus ihren Gräbern aufstehen müssen, und mit welch' seliger Freude wiederholt er seinen Refrain »In die ewige Ruhe hinein!«
Als Greis schrieb Paludan-Müller seinen grossen Roman »Ivar Lykke«, der schöne Zeugnisse seiner warmen Vaterlandsliebe und seiner rechtschaffenen Denkweise enthält, der aber im übrigen ein Product von geringem dichterischen Werth ist. Er, der dreissig Jahre lang als Einsiedler gelebt hatte, konnte nicht Romane schreiben. Der colossale dreibändige Roman wird vollständig von dem kleinen, einen Bogen umfassenden, Gedicht »Adonis« aufgewogen, das sein letztes Wort an die Lesewelt war. Es ist eine heidnische Apotheose des Todes. Von Venus und ihren unruhigen Freuden ermüdet, nimmt Adonis zum Reich Proserpina's seine Zuflucht und ruht in der ewigen Betrachtung aus. Proserpina sagt ihm die liebevollen Worte:
Darum suche Trost bei mir!
Nicht der Leidenschaften Wähnen,
Nicht Vermissen, Seufzen, Sehnen –
Nur Betrachtung üb' ich hier.
Und das Gedicht endet mit der feierlichen und schönen Strophe:
So im Reich, dem Tod geweiht,
Sassen, nah der Lethe Fluthen,
Beide Liebende und ruhten,
Wie in Ruh' der Ewigkeit.
Nicht ein Laut erklang umher.
Droben mit dem Sterngewimmel
Wölbte sich der offne Himmel;
Und der Mond sank sanft ins Meer.
In dieser träumerischen Stellung am Fusse der Todesgöttin will ich den Schatten des edlen Dichters festhalten.
Da sitzt er, und wie Nebelgestalten gleiten all' seine schönsten Dichtervisionen seinem Auge vorbei. Er sieht den Fluss Styx. Venus Urania und Endymion segeln in einem Boot den Fluss hinab, und die Krone, die Venus trägt, wirft einen hellen Sternenschein über die dunkeln Wellen und Ufer; er sieht Amor und Psyche selig an der hohen Kassiopeia und dem stolzen Orion vorbei schweben, er erblickt Adam und Alma wie sie eben so innig verschlungen durch die läuternden Flammen des Fegefeuers vorüber gleiten, schaut Alexander vor Kalanus kniend, und die schlanke feine Gestalt des Inders mit der weissen Stirnbinde, den Schwanengesang singend, unter dem Siegeshymnus von dem Scheiterhaufen durch den Rauch und die schwarzen Wolken zu Brama empor steigen.
Also zu der Göttin Fuss
Sitzet in des Todes Raum
Still der Glückliche im Traum,
während seine Werke ihn überleben und seinen Namen bewahren.
Es war immer viel Himmel in seinen Gemälden, aber sein Name wird sich am dauerndsten mit dem in seinen Bildern verknüpfen, das die Erde und das Irdische darstellt.
