
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In träger, schwerer Ruhe lag der Ozeandampfer »Merkuro« im Hafen. Der gewaltige Schiffskoloß glich einem unersättlichen Rachen wie dem des Moloch, der immer neue Menschenopfer in sich aufnimmt.
Schmale, dünne Rauchfahnen zogen von den drei kurzen, plumpen Schornsteinen nach Süden.
Über die Passagierbrücke, die auf den Dampfer führte, eilten immer neue Menschenmassen, als könnten diese gar kein Ende finden; da sah man elegant gekleidete Damen, die von Kavalieren begleitet wurden, als führte dieser Weg in einen Festsaal, dann wieder in auffallendem Kontrast dazu ärmliche Gestalten, die in einem kleinen Bündel ihre ganze Habe mit sich brachten, jene unglücklichen Zwischendeckspassagiere, die Schiffbruch am Leben litten und deren letzte Hoffnung das fremde Land ist, in das sie der Dampfer führen soll. In den Gesichtern dieser Müden und Verzweifelten war all das Elend, das sie hinter sich ließen, herauszulesen, während die Inhaber der ersten Kajüten lachend und mit Scherzworten die Brücke überschritten, die sie noch vom Lande trennte.
Zwischen den einzelnen Passagieren eilten die Gepäckträger mit Koffern und Kisten.
Auf dem Schiffe selbst standen manche der Schiffsmannschaft und sahen diesem bewegten Bild zu. Die einzelnen Bilder boten für diese nicht viel neues, denn all dies Treiben wiederholte sich für sie in jedem Hafen.
Unter den Kofferträgern befand sich auch eine gebückte Gestalt, die auf dem Rücken einen großen Rohrplattenkoffer von gelbbrauner Färbung und mit Messingbeschlägen trug, dessen Last ihn ziemlich stark niederdrückte; neben diesem folgte eine große, schlanke Erscheinung mit bartlosem Gesichte und einem Klemmer; die graubraunen Augen blickten immer wieder zu dem Koffer hin, von dessen Seite er nicht weichen zu wollen schien.
Ab und zu rief er auch dem Träger einige Worte zu, wie:
»Geben Sie acht, daß der Koffer nicht von Ihrer Schulter gleitet.«
»Gehen Sie mehr nach dieser Seite herüber, damit Sie weniger beachtet werden können.«
Und einmal meinte er:
»Dort drüben bringt jemand genau solchen Koffer. Er ist auch fast genau so groß.«
Die ganze Sorge dieses Passagiers schien nur diesem Koffer zu gelten, denn auf seine weiteren Gepäckstücke, die ein zweiter mitbrachte, achtete er fast nicht.
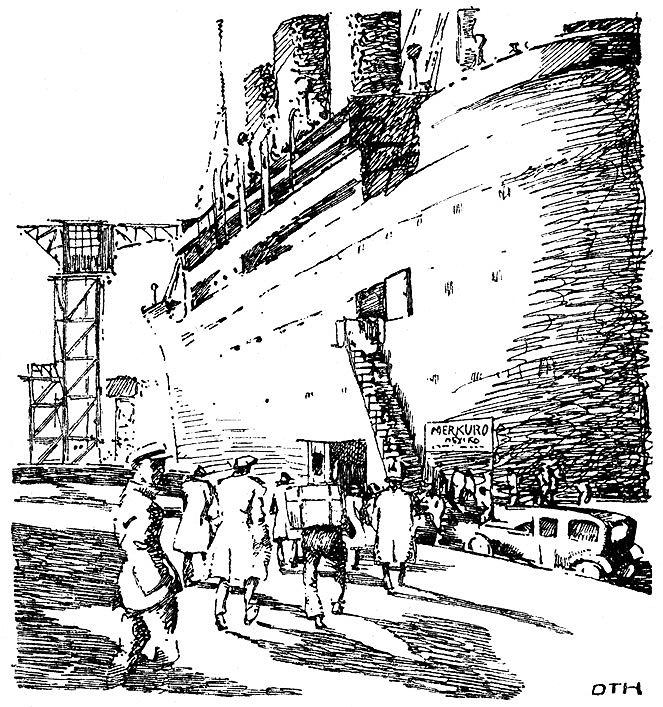
Auf dem Schiffe selbst wandte er sich fragend an einen Burschen:
»Wo geht es zur ersten Kajüte?«
»Welche Nummer?«
»Achtzehn?«
»Dort drüben rechts die Treppe.«
Der Fremde entfernte sich nach der gewiesenen Richtung, immer neben seinem Kofferträger. In den Kajütenräumen trat dann ein Steward an ihn heran und fragte ihn wieder nach der Kajütennummer; auf die Antwort wies derselbe dann auf die Türe, durch die der Kofferträger mit dem Fremden eintrat. Der Steward folgte und fragte:
»Auf welchen Namen?«
Der Fremde, der Besitzer jenes gelbbraunen Rohrplattenkoffers, antwortete darauf:
»Freiherr von Sassen.«
»Stimmt, das ist die reservierte Kajüte. Soll Ihnen jemand zum Auspacken der Koffer zur Verfügung gestellt werden? Die Träger dürfen nicht bleiben.«
Aber da wehrte der Fremde in lebhafter Weise ab:
»Nein, ich mache das ganz allein!« Dann wandte er sich an den Träger: »Stellen Sie den Koffer hier hin!«
Als dies geschehen war und auch noch die anderen Gepäckstücke in die Kajüte gebracht worden waren, entlohnte er die zwei Träger, die sich mit schwerfälligen Verbeugungen wieder entfernten.
Nur der Steward war geblieben:
»Haben Sie noch besondere Wünsche, Herr Baron?«
»Nein! Ich möchte allein und ungestört bleiben.«
»Um sieben wird das Souper serviert. Haben Sie einen bestimmten Wunsch nach einem Platz?«
»Ich möchte möglichst wenig belästigt werden. Wenn mir abseits ein kleines Tischchen reserviert werden kann, dann wäre ich Ihnen dankbar.«
»Ich werde darauf achten, aber am ersten Abend ist dies wohl kaum möglich.«
»Es ist gut.«
»Hilfe brauchen Sie also keine?«
»Nein, ich danke!«
Darauf entfernte sich auch der Steward, der dieser Kajütenreihe zugeteilt war. Freiherr von Sassen blieb einen Augenblick lauschend an der Türe stehen und schloß diese dann mit rascher Bewegung ab, als wollte er sich damit vor jeder Störung sichern; dann trat er zurück und ließ sich auf jenem Rohrplattenkoffer nieder, dem seine ganze Aufmerksamkeit gegolten hatte.
Manchmal hob er lauschend den Kopf in der Richtung zur Türe hin, vor der immer wieder eilende Schritte von Vorüberkommenden zu hören waren.
Von dem Kajütenfenster her fiel ein scharfbeleuchtendes Licht auf das glattrasierte Gesicht jenes Freiherrn von Sassen, das sich deutlich als das jenes Direktor Streitter aus dem Alpenhotel »Adlerhorst« erkennen ließ. Es war auch der gleiche Koffer, der schon die Aufmerksamkeit und den Angriff durch Daisy Frommel, beziehungsweise Anita Wronker gefunden hatte.
»Wieder eine dreimonatliche Irrfahrt, um auch die letzte Spur abzuschütteln. Dann aber werde ich auch ausruhen können,« murmelte er vor sich hin.
Und seine Gedanken mochten dabei mit jener Wanderung mit dem Heiner Much über die Kammhöhe der Veltlinerwand zur nächsten Landesgrenze über Schnee und Gletscher beschäftigt sein, die in der Nacht und unter solchen Schwierigkeiten erfolgte, daß manchmal das Leben selbst bedroht war; aber nur dieser tollkühne Marsch ermöglichte es, daß er sich einer Verfolgung entziehen konnte, da mit einer solchen Möglichkeit nicht gerechnet wurde. Nach der Entlohnung des Heiner Much war wieder eine Hetzjagd von einem Hotel in das andere gekommen, immer wieder nach verschiedenen Richtungen, um eine Verfolgung zu verwirren und unmöglich zu machen.
Auf Zickzackwegen, da und dort einige Tage verweilend und immer wieder den Namen wechselnd, war er schließlich nach der Küste gekommen; von hier aus hoffte er völlig untertauchen zu können, daß er nichts mehr befürchten mußte.
Bei den Gedanken an die überstandene Zeit mit dem rastlosen Hasten furchten sich die Brauen über seinen Augen und die Lippen schlossen sich fest aufeinander.
Was mochte dabei in ihm vorgehen? Der Mund verriet nichts und auch die hohe Stirn ließ die Gedanken dahinter nicht erraten.
Nur die wenigen Worte, die sich unwillkürlich über die Lippen drängten, verrieten ein weniges, aber noch nicht alles. Bei einem ingrimmigen Auflachen geschah es:
» Le roi est mort, vive le roi! So hieß es einst und ich kann so ähnlich wiederholen: Direktor Streitter ist tot, es lebe Baron von Sassen. Es ist immer das gleiche. Aber nicht mehr lange, denn einmal werde ich die Hetzjagd doch zu Ende bringen.«
Damit erhob er sich und schob dann den Koffer in einen Winkel der Kajüte, in der er am wenigsten bemerkt und beachtet werden mochte. Und wie nach einem persönlichen Feind stieß er wie schon einmal mit dem Fuße nach diesem Koffer.
Dann machte er sich daran, die übrigen Gepäckstücke auszupacken.
Unterdessen verschlang der schier unersättliche Rachen des Ozeanriesen immer neue Menschenmengen.
Verschiedene Anzeichen ließen bereits erkennen, daß die Abfahrt bald erfolgen werde. Die entsprechenden Signale waren schon gegeben worden.
Eilig verließen diejenigen, die ihre Angehörigen an Bord begleitet hatten, das Schiff. Die Passagiere aber standen in langen Reihen auf Deck und winkten mit weißen Tüchern die letzten Grüße ans Land.
Noch ein Signal.
Der Kapitän stand auf der Kommandobrücke.
Ein Flaggenzeichen und dann ein Böllerschuß.
Die Brücke zum Schiff wurde gesperrt.
In diesem letzten Augenblick fuhr noch mit Rattern und Tuten ein Auto auf der Rampe vor und hielt vor der Brücke. Ein Angestellter auf Deck winkte ab.
Doch da war auch schon aus dem Auto eine schwarzgekleidete, tiefverschleierte Frauengestalt herausgesprungen und hatte ebenso rasch noch die Bordbrücke betreten.
Vergebens suchte sie noch jemand zurückzuhalten.
»Ich muß noch mit!«
Und mit einer Energie, die dieser zart erscheinenden Gestalt kaum zuzutrauen war, schob sie diesen zur Seite. Ein Bursche eilte mit zwei großen Reisetaschen hinter ihr her.
»Zurück!«
So klang es ihr noch warnend entgegen.
Der schwere, träge Koloß erzitterte unter der ersten Einwirkung der beginnenden Umdrehungen der Schiffsschraube.
Der letzte Augenblick war es.
Aber die Dame in Trauer hatte doch noch das Bord erreicht; der Bursche warf die Reisetaschen hinüber und lief dann zurück.
Ein Schiffsoffizier trat zu der Dame im Schleier hin und redete in barschem Tone auf sie ein:
»Sie durften das nicht mehr wagen, denn die Verantwortung wäre nur uns zugefallen, wenn sich dabei ein Unglück ereignet hätte.«
»Es hat sich nichts ereignet! Im übrigen verzeihen Sie, mein Herr, aber ich mußte mit.«
Hinter dem dichtmaschigen Schleier sah man auffallend nur das weiße Haar der Unbekannten im schwarzen Kleid; und dies Weiß stand in auffälligem Gegensatz zu den so verhältnismäßig jungen und zarten Zügen ihres Gesichtes. Groß und schlank war die Gestalt, die Haut aber war von einer Zartheit wie die von Blütenblättern. Die großen Augen waren von tiefem Schwarz und leuchteten leidenschaftlich.
Der Schiffsoffizier gab sich aber mit ihrer Erklärung doch nicht zufrieden und entgegnete:
»Es könnte da immer noch jemand mit der nämlichen Entschuldigung eintreffen. Dann aber würde der Dampfer schließlich mit Verspätung abgehen.«
Ein Lächeln zeigte sich hinter dem Schleier, das versöhnend wirken mußte:
»Hat das Schiff eine Verspätung?«
»Das nicht, aber ...«
Da unterbrach sie ihn:
»Dann dürfen Sie mir verzeihen, wofür ich Ihnen besonders dankbar sein werde; ich mußte wirklich mit!«
»Haben Sie Ihre Kajütenanweisung?«
»Nein! Selbst dazu war es schon zu spät, mir eine solche besorgen zu lassen. Das hoffte ich an Bord des Schiffes auch noch erledigen zu können. Dürfte ich an Ihre Liebenswürdigkeit vielleicht noch die Bitte stellen, mir den Weg dazu zu weisen?«
»Selbst dazu war es für Sie zu spät? Verzeihen Sie, meine Gnädigste, wann faßten Sie dann erst den Entschluß, an Bord des Schiffes zu gehen?«
»Allerdings etwas überraschend plötzlich! Vor einer halben Stunde habe ich mich entschieden. Nur das Auto brachte mich noch rechtzeitig genug.«
Überrascht hob bei diesem Zugeständnis der Schiffsoffizier den Kopf:
»Wirklich? Vor einer halben Stunde? Dann allerdings, meine Gnädigste, bewundere ich Ihre Energie. Die Kajütenkarte wird Ihnen eine der Stewardessen liefern; ich werde Ihnen eine zuschicken. Welchen Namen darf ich eintragen lassen?«
»Luci Contessa Pregoli-Amati.«
»Ich danke! Hoffentlich ist noch eine Kajüte frei, die Ihren Wünschen entspricht. Ich eile, damit Sie bald beruhigt sein können.«
Als der Schiffsoffizier fort war, huschte über das schmale Oval ihres Gesichtes ein flüchtiges Lächeln. Sie mochte mit diesem Ende zufrieden sein; sie achtete dabei nur wenig auf die vielen bewundernden Blicke, die ihr folgten. Ihre schwarzen Augen schienen selbst prüfend zu suchen, als sie den Weg nach dem Promenadendeck einschlug. Nach allen Seiten hin glitten ihre Blicke, ohne daß sie den Schleier von ihrem Gesichte löste.
Es dauerte aber nicht lange, als auch schon eine der bekannten Erscheinungen der Schiffsstewardessen an sie herantrat und mit diskreter Stimme fragte:
»Vielleicht die Contessa Pregoli-Amati?«
»Allerdings!«
»Man wies mich zu Ihnen. Die Luxuskabine 6 wäre noch frei! Falls Sie diese besichtigen wollen, führe ich Sie hin.«
»Gut! Würden Sie so liebenswürdig sein und mein Gepäck übernehmen?«
»Sehr gerne, meine Gnädigste.«
And mit den beiden großen Reisetaschen der Contessa ging die Stewardesse voran, während die in so letzter Sekunde an Bord kommende Dame nachfolgte.
Der Kabinenraum, in den die Stewardesse sie führte, gehörte zu den elegantesten des »Merkuro«.
Aber die Contessa achtete nur wenig darauf und warf flüchtig die Frage hin:
»Wollen Sie mich vielleicht jetzt gleich beim Auspacken meiner Sachen unterstützen?«
»Gewiß, meine Gnädigste. Was soll zuerst geschehen?«
And während sie dann die an sie gerichteten Weisungen ausführte, richtete die Contessa immer wieder neue Fragen an sie, die den Eindruck zufälliger Einfälle machten.
»War es schwer, mir noch die Kabine zu besorgen?«
»Allerdings, Contessa, denn die ›Merkuro‹ wird gerade von Passagieren, erster Klasse bevorzugt. Sie können hier alles haben, was Sie an Land wünschen.«
»So ist die ›Merkuro‹ gut besetzt?«
»Sehr gut! Nummer 6 ist lediglich deshalb frei, weil die ursprüngliche Inhaberin in der letzten Stunde noch wegen Krankheit die Fahrt aufgeben mußte.«
»Dann habe ich all diese Bequemlichkeit nur diesem Krankheitsfall zu verdanken?«
»Gewiß!«
»Wurde mein Name auch schon in die Passagierliste eingetragen?«
»Nein! Das habe ich dann zu besorgen.«
»Dabei können Sie wohl alle Namen nachprüfen?«
»Ja!«
»Es interessiert mich begreiflicherweise, wer sonst noch an Bord ist.«
»Darin kann ich die Gnädigste vollkommen verstehen. Sie dürfen jedoch überzeugt sein, daß Sie die beste Gesellschaft finden werden. Es ist sogar für die Überfahrt ein besonderes Ballfest geplant.«
»Reizend! Wenn Sie aber meine ganze Zufriedenheit erwerben wollen, dann würde ich Sie ersuchen, ob Sie in der Liste nicht nach einem Namen sehen möchten, für den ich mich interessiere.«
»Gewiß kann ich das besorgen, meine Gnädigste! Wie lautet der Name?«
Contessa Pregoli-Amati hob den Kopf:
»Wie war es gleich? Ja, richtig! Manfred Freiherr von Sassen.«
»Ich werde es nicht vergessen.«
»Und sehen Sie auch welche Kajütennummer er hat.«
»Gewiß!«
Und erst als die Stewardesse die Kabine verlassen hatte, nahm die Contessa Pregoli-Amati den, dichten Schleier ab und trat vor den Spiegel über dem zierlichen Toilettentisch der Kabine, aus dem ihr dies junge Gesicht mit dem Weiß ihres hochaufgesteckten Haares lächelnd entgegenschaute.
Die schmalen, roten Lippen, die in dem fahlschimmernden Ton der zarten Haut um so brennender schienen, bewegten sich unmerklich wie in einem Flüstern, aber kein Wort ihrer Gedanken, die sich dabei regten, war zu verstehen. Nur der Ausdruck in ihrem Gesichte hatte es von einem überlegenen Triumph, etwas Siegerhaftes.
*
Prächtige Herbsttage waren der Fahrt des »Merkuro« beschieden. Fast wellenlos und unbewegt lag die See. Tiefblau wölbte sich der Himmel.
Nur sehr wenige an Bord hatten Anfälle einer Seekrankheit, so daß sich fast alle Passagiere der ersten Klasse auf dem Promenadendeck einfanden, um die Schönheit der Fahrt von einem Korbstuhl aus zu genießen, während die Schiffskapelle ihre schmeichelnden. Weisen erklingen ließ. Dabei ließ sich plaudern, während man nebenbei noch zusehen konnte, wie andere an den Reihen der Korbstühle vorüberpromenierten.
Die Damen an Bord trugen dabei ihre elegantesten Toiletten wie auf der Kurpromenade eines beliebten Badeortes. Wenn dann die Dunkelheit einbrach, wurde der große Festsaal beleuchtet und das kokettierende Spiel vom Promenadendeck fand nun im Saal seine Fortsetzung.
Wieder einer dieser prächtigen Herbstabende.
Die See zeigte jene wundervolle Beleuchtung, wie man sie nur selten sieht.
Trotz des Septemberabends lag noch eine wohlige Wärme in der Luft.
Der Westen glühte wie in brennenden Flammen, wie in purpurne Glut getaucht. And die Lichter zuckten wie kleine Flämmchen über das leise Wellenspiel.
Unter den Bummlern auf dem Promenadendeck befand sich auch Freiherr von Sassen, der sonst seine Kajüte nur selten verließ; aber die Wärme des Herbstabends hatte auch ihn heraufgelockt. Während er sonst wie menschenscheu jeder Gesellschaft auswich, hatte er sich diesmal auch auf Deck gewagt.
Aber wie es stets seine Art war, hielt er sich auch diesmal abseits von allen und schaute mehr aus der Ferne dem Treiben zu, das ein ganz verschiedenes Bild von dem auf Zwischendeck bot. Hier Luxus und Verschwendungsbedürfnis, dort Elend und verbitterte Sehnsucht.
Vielleicht dachte Freiherr von Sassen an diese Gegensätze, denn man sah ihn öfter in den Teilen des Zwischendecks als hier, Es schien fast, als fühlte er. daß er im Zwischendeck verborgener bleiben würde als auf dem Promenadendeck.
Die meisten Mitreisenden hatte er schon unten im Speisesaal beobachtet. Welche Namen sie trugen, war ja völlig gleichgültig; er selbst hatte unter allen doch kein Gesicht gefunden, das ihm bekannt erschienen wäre.
Ein müder abgespannter Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Es war die Teilnahmslosigkeit an all diesen Erscheinungen. Doch plötzlich hob sich sein Kopf und ein jäher Wechsel trat in seinen Zügen ein. Es war, als hätte ihn mit einem Male eine unerwartete Begegnung mit allen Sinnen gepackt.
Starr lagen seine Augen auf einer Dame mit weißem Haar und doch noch jugendlichen Formen in dem schmalen Oval ihres feinen Gesichtes; sie trug ein schwarzes Kleid aus Voile und Taft. Eine Dame in Trauer. Vielleicht eine Witwe? Das weiße Haar machte sie erst schön.
So gebannt aber war der starre Blick aus den Augen dieses Freiherrn von Sassen, als wäre er einer unerwarteten Gespenstererscheinung begegnet. Wie gelähmt stand er da und regte sich nicht und sah nur zu, wie die Gestalt der Dame in Schwarz und mit dem weißen Haar immer näher kam.
Nur seine Lippen bewegten sich, als flüsterten sie einen Namen.
Die Dame, die diesen Zauber auf ihn ausübte, war in Begleitung eines Schiffsoffiziers.
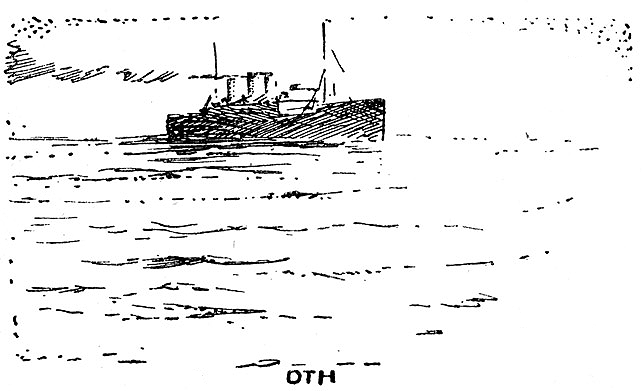
Als sie dann so nahe an ihm vorbeistreifte, daß der leichte Voile seine Gestalt berührte, da huschte ein Blick aus ihren schwarzen Augen flüchtig über ihn hin.
Nur flüchtig, und dabei unterbrach sich ihre Stimme nicht, die eben ihrem Begleiter etwas zu erklären schien. Kein Erkennen war dabei in ihren Augen, nur ein völliges Fremdsein wie bei sonst einer Zufallsbegegnung.
Ihr Kopf wandte sich auch nicht mehr zu ihm zurück, als sie an ihm schon vorüber war.
Am so unverwandter folgten ihr die Blicke des Freiherrn von Sassen. Seine Hand hob sich sogar und fuhr sich über die Augen hin, als gelte es von diesen einen Schleier fortzunehmen, der seinen Blick vielleicht verwirrte.
Täuschte er sich? Narrte ihn nur eine Ähnlichkeit? Aber dies weiße Haar?
Als dann ein Steward an ihm vorbeieilte, hielt ihn Freiherr von Sassen fest und stellte die Frage an ihn:
»Können Sie mir vielleicht sagen, wer jene Dame dort im weißen Haar und in der Trauerkleidung ist?«
»Gewiß, mein Herr! Das ist die Contessa Pregoli-Amati.«
Und dann eilte der Steward, der wohl einen noch dringlicheren Auftrag auszuführen hatte, wieder davon.
Eine Contessa Pregoli-Amati! Also doch eine Witwe. Und damit eine Täuschung.
War dies möglich?
Und wie unter dem Zwange einer unwiderstehlichen Macht folgte er aus der Ferne der Dame im weißen Haar und in Trauer.
*
Als Freiherr von Sassen an diesem Abend in den Speisesaal des Dampfers kam, in dem für ihn auf einem kleinen Seitentischchen gedeckt war, fragte er den bedienenden Steward sofort:
»Kennen Sie hier an Bord auch eine Contessa Pregoki-Amaii?«
Der Steward nickte sofort:
»Das ist doch die Dame aus Kabine 6! Die junge schöne Witwe mit dem weißen Haar.«
»Ja! Die meine ich! Warum sah ich diese nie hier?«
»Sie läßt sich nur in der Kabine servieren; nur höchst selten ist sie hier zu sehen.«
»Wissen Sie sonst etwas über diese Contessa?«
»Nein! Aber sie ist doch die Dame, die eben noch in der letzten Sekunde an Bord kam. Haben Sie das nicht auch beobachtet?«
»Nein! Reist diese Contessa allein?«
»Ja!«
Das war schließlich alles, was Freiherr von Sassen auf seine Fragen in Erfahrung bringen konnte.
Aber mit um so größerer Unruhe suchte er jetzt immer den Teil des Verdecks auf, in dessen Nähe jene Kabine 6 war. Es war, als lebte in ihm kein anderes Verlangen mehr, als nochmals dieser Contessa zu begegnen. Wenn er in der Nähe der Kabine war, ließ sich in seinen bartlosen Zügen ein gespannter Ausdruck wie vor einer außergewöhnlichen Entscheidung erkennen.
Am Nachmittage des folgenden Tages war es dann, daß er die bekannte Erscheinung nach dem Musikzimmer des Ozeanriesen gehen sah. Wieder trug sie jenes Kleid in Schwarz und wieder wollte sie so teilnahmslos wie an einem gleichgültigen Fremden an ihm vorübergehen.
Da trat er mit einem höflichen Grüßen vor sie hin und schaute ihr dabei unbewegt in die Augen, als gelte es aus diesen auch die geheimsten Gedanken herauszuholen:
»Verzeihung, meine Gnädigste, wenn ich Sie mit einer Frage belästige.«
»Sie belästigen mich damit keineswegs, mein Herr! An Bord eines Schiffes muß man sich mehr oder minder doch zu einer großen Familie rechnen, die für eine gewisse Zeit zusammengehört. Da ist selbst mehr als eine Frage erlaubt.«
Ihr Nicken war dabei wie eine liebenswürdige Aufforderung, die aber den Freiherrn von Sassen noch mehr zu verwirren schien. Seine Stimme bekam dadurch etwas Unsicheres:
»Ich reiste viel und dabei sah ich viele Menschen. Mein Gedächtnis für Begegnungen ist sehr stark.«
Während er so nach erklärenden Worten zu suchen schien, hatte sie aber seine Absicht schon erraten und antwortete auch gleich:
»Ich verstehe Sie! Sie vermuten, mir schon einmal begegnet zu sein. Ist es nicht das?«
»Allerdings! Deshalb fragte ich.«
»Dann ist jedenfalls das Erinnern nur auf Ihrer Seite. Ich entsinne mich Ihrer nicht. Darf ich um Ihren Namen bitten?«
Kein Erkennen! Ihre Augen schauten ihn mit beherrschter Ruhe an.
Die Sicherheit, die aus jedem ihrer Worte herauszufühlen war, verwirrte ihn:
»Verzeihen Sie! Das hätte allerdings zuerst geschehen sollen. Manfred Freiherr von Sassen.«
Sie schüttelte den Kopf:
»Nein, den Namen habe ich nie gehört. An ihn müßte ich mich doch bestimmt erinnern. Contessa Pregoli-Amati, geborene Wickramsberg.«
Da mußte auch Freiherr von Sassen den Kopf schütteln, denn beide Namen waren ihm fremd.
Aber wenn sie ihn erkannt hätte, wenn sie wirklich die sein würde, die er in ihr vermutete, dann müßte etwas in ihrem Auge aufgeleuchtet sein, dann hätte sie sich doch nicht so beherrschen können.
And wieder machte er eine liebenswürdige Verbeugung:
»Verzeihen Sie, gnädigste Contessa! Aber es hatte mich anscheinend doch nur eine Ähnlichkeit genarrt.«
»Bitte! Derartiges ist immer zu entschuldigen.«
Und sie nickte herablassend und verzeihend lächelnd; dann schritt sie an Freiherr von Sassen vorbei, ohne noch etwas zu fragen, vollständig interesselos für diese Begegnung.
Er aber blieb am Eingang zu dem Musiksalon stehen und folgte ihrer eleganten Gestalt.
Seine Hand faßte dabei nach rückwärts und griff in die Falten des schweren Vorhanges, der den Raum abschloß. Die starken Brauen über den graubraunen Augen schoben sich dicht zusammen, während er ihrer Erscheinung wie einem Gespenst nachfolgte.
And von der zitternden Bewegung seiner Lippen waren die leisen Worte zu verstehen:
»Ist sie es nicht doch? Oder narrt mich nur meine Phantasie oder gar mein Herz? Doch das hat nichts zu sagen, denn sie suchte ja weiter nichts als den Mörder.«
Und wie über dies Wort selbst erschrocken schaute er scheu um sich, ob es auch niemand erlauscht haben konnte.
*
Hinter den Kassenschaltern des Schiffahrtsbureaus waren die Angestellten emsig bei der Arbeit. Die Wände waren mit großen Reklameplakaten von Reisegesellschaften und Dampferlinien bedeckt.
Es war um die sogenannte stille Zeit, so daß man um diese Stunden wenige Kunden antraf.
Da kam mit erregter Hast die Gestalt eines schmalen, engbrüstigen Mannes mit hängenden Schultern hereingestürmt, der sofort an einen der Schalter eilte. Ein Buchhalter trat hin und fragte nach den Wünschen des Fremden.
»Wurde bei Ihnen nicht der Passagierdampfer ›Merkuro‹ abgefertigt?«
»Allerdings! Er ging gestern nachmittag ab.«
»Haben Sie die Passagierlisten des Dampfers zur Einsicht?«
»Die Liste ist Wohl hier, aber sie wird nicht ausgegeben. Sie steht nur auf Wunsch den Behörden zur Verfügung.«
Da schob der Fremde seinen Rock auf und ließ auf der Innenseite die Legitimation der internationalen Polizei sehen. Dabei erklärte er:

»Mein Name ist Wendland, Inspektor Wendland! Ich folge der Spur eines Mörders und fürchte, daß dieser den ›Merkuro‹ für seine weitere Flucht benützte.«
Als der Buchhalter die Legitimation erkannte, antwortete er sogleich:
»In diesem Falle steht Ihnen die Liste selbstverständlich zur Verfügung. Kennen Sie vielleicht den Namen, unter dem sich der Verfolgte schließlich eintragen ließ?«
»Zuletzt war er hier in einem Hotel unter dem Namen eines Freiherrn Manfred von Sassen abgestiegen.«
Der Buchhalter trat zurück und ließ den Inspektor allein; dieser trippelte unruhig von einem Fuße auf den anderen.
Endlich war es ihm nach langer erfolgter Jagd gelungen, die Spur des mutmaßlichen Doktor Steffen, des wahrscheinlichen Mörders des Professors Marschall, wieder zu finden. Ihm war diese schwierige Aufgabe gestellt worden, nachdem der Chef der Sicherheitspolizei, Alexis Marlan, die letzte Spur verloren hatte. Als der Verfolgte unter dem Namen eines angeblichen Direktor Streitter aus Rotterdam in dem Kurhotel »Adlerhorst« ausfindig gemacht worden war, hatte Alexis Marlan die Verhaftung selbst vornehmen wollen. Aber noch in der Nacht vorher war dieser entwischt und Marlan nahm dabei eine falsche Fährte auf, indem er die nächsten Bahnstationen überwachen und kontrollieren ließ, während sich allerdings für eine Verfolgung schon zu spät herausstellte, daß dieser mit Unterstützung eines verwegenen Burschen den Weg über die Kammhöhe der Veltlinerwand durch Gletschereis nach der nächsten Landesgrenze gesucht hatte, wobei auch jener verhängnisvolle Koffer mitgenommen wurde. Es schien wie ein Fluch auf diesem Mörder zu liegen, daß er sich von diesem furchtbaren Beweisstück nicht zu trennen vermochte. So war durch Alexis Marlan die Spur verloren worden, die Inspektor Wendland dann wieder aufnehmen sollte.
Erst nach vielen erfolglosen Versuchen war ihm dies schließlich doch gelungen.
Nun war er hier und wartete ein neuerliches Ergebnis ab.
Wenn es sich bewahrheitete, daß er an Bord des »Merkuro« sein sollte, dann mußte er endlich doch zur Strecke gebracht werden. Von Bord eines Dampfers ließ sich nicht so leicht entwischen wie aus dem Hotel »Adlerhorst«.
Da kam der Buchhalter wieder und brachte die Schiffsliste des »Merkuro«.
Mit einem lebhaften Nicken erklärte er:
»Das stimmt allerdings! Ein Freiherr von Sassen hat die Kajüte 18 belegen lassen.«
»Ist er aber auch mit dem Dampfer abgefahren?«
»Gewiß! Andernfalls hätten wir doch Mitteilung erhalten.«
»Und gestern nachmittag verließ die ›Merkuro‹ den Hafen?«
»Wissen Sie nicht, ob vielleicht ein anderer Dampfer abgeht, der den ›Merkuro‹ schließlich überholt?«
»Nein, das ist ganz ausgeschlossen, denn der ›Merkuro‹ ist ein Doppelschraubendampfer mit achtzehn Knoten Geschwindigkeit. Ein Überholen ist vollständig ausgeschlossen.«
»Wie heißt dann der erste Hafen, in dem der ›Merkuro‹ einläuft? Das wissen Sie doch.«
»Gewiß!«
And als Inspektor Wendland den Namen dieses ersten Hafens erfahren hatte, verließ er auch schon das Schifffahrtsbureau, in dem es für ihn nichts mehr zu erreichen gab; sein Weg führte jetzt wo anders hin.
Im Polizeipräsidium dieser Stadt erstattete er einen ausführlichen Bericht über seine Nachforschungen.
Und nach diesem wurde dann an die nächste Hafenstation, in der der Dampfer »Merkuro« einlaufen mußte, ein amtliches Telegramm aufgegeben, das folgenden Wortlaut hatte:
»Dampfer ›Merkuro‹, dessen Einlaufen Donnerstag zu erwarten ist, hat einen angeblichen Freiherrn Manfred von Sassen an Bord, in dem der Mörder Doktor Edwin Steffen vermutet wird; als Beweisstück findet sich bei ihm ein gelbbrauner Rohrplattenkoffer mit Messingbeschlägen, in dem die einbalsamierte und konservierte Leiche des Toten versteckt sein dürfte. Ein Öffnen dieses Koffers überführt den angeblichen Freiherrn von Sassen. Am empfehlenswertesten ist es, wenn ein Polizeiboot dem Dampfer ›Merkuro‹ bei der Hafenfahrt entgegenfährt und den Schuldigen noch an Bord stellt, da mit dessen Fluchtversuch schließlich gerechnet werden muß. Signalement des Flüchtlings: Hohe, schlanke Erscheinung, glattrasiertes Gesicht, meist leicht gepudert, dunkles Haar, graubraune Augen, etwas kurzsichtig, starke Brauen. Polizeipräsidium.«
Als diese Depesche aufgegeben war, flog ein zufriedenes Lächeln über das harmlos fröhliche Gesicht des Inspektors Wendland.
Nun war er sicher!
Jetzt konnte er selbst den nächsten Dampfer nach jener Hafenstadt benützen.
Dort erwartete ihn dann der Gesuchte in sicherem Gewahrsam. Das Telegramm mußte wirken. Dann aber würde er dem Chef der Sicherheitspolizei die so viel begehrte Nachricht geben können:
»Endlich zur Strecke gebracht.«
*
Die Contessa Pregoli-Amati ging unruhig in ihrer Kabine auf und nieder; die Glühbirnen des kleinen Lüsters erfüllten jeden Winkel des Raumes mit verschwenderischer Lichtfülle. Immer wieder glitten ihre Blicke zur Türe hin, als erwartete sie jemand.
Dabei lag auf den sonst etwas fahlen Wangen ein dunkleres Rot, das gleichfalls ihre Erregung verriet.
Erst als die Stewardesse, die ihr zur Bedienung zugeteilt war, eintrat, empfing sie diese gleich mit einem fragenden:
»Nun?«
»Natürlich hat das Fest schon begonnen und alles befindet sich auf Deck. Es sieht auch wirklich herrlich aus. Alle die bunten Lampions, diese zuckenden Lichter und dabei das fahle Mondlicht. Die Damen tragen die schönsten Roben, die sie mit sich haben. Ich begreife Sie nicht, Contessa, daß Sie sich bei einem solchen Feste hier einsperren.«
In den schwarzen Augen der Contessa Pregoli-Amati war dabei ein Aufleuchten, als sie darauf die Frage stellte:
»So ist unten in den Kabinenräumen wohl kaum jemand anzutreffen?«
»Nein! Alles wird doch bei einem Fest an Bord oben sein. Die Kapelle spielte eben › La Paloma‹. Ich sah dem ersten Tanz zu. Sie müßten wirklich auch dabei sein, Gnädigste. Sie sind dann sicher die Schönste, und die Herren werden sich nur um Sie bewerben.«
»Bei meinem weißen Haar?«
»Oh, das macht Sie erst schön! Daß Sie nicht so alt sind, wie das Haar vortäuschen möchte, das erkennt der erste Blick. And daher ist dies Weiß nur ein Reiz mehr.«
»Ich bin in Trauer! Ich darf mich an solchen Festen nicht beteiligen.«
»Wie schade, gnädigste Contessa! Aber Zusehen sollten Sie wenigstens. Das ist doch erlaubt.«
»Es geht nicht.«
»Nur von der Ferne zusehen. Sogar alle Stewards und natürlich auch die Stewardessen haben sich die Treppen hinaufgeschlichen, von denen aus das Promenadendeck zu übersehen ist. Hier unten bin ich keinem Menschen begegnet. Was soll hier unten auch jemand?«
»Wen sahen Sie oben?«
»Sogar unser Kapitän tanzt. Er führt die kleine Baronesse Friediger mit dem roten Haar. Und der erste Offizier, der doch sonst so gerne mit Ihnen plaudert, tanzt mit der Sängerin aus Budapest, die für eine australische Tournee verpflichtet ist. Auch den Monsignore Fratelli sah ich und den hübschen, eleganten Franzosen. Auch die Berliner Tänzerin, die so knabenhaft zart aussieht, und die Fürstin Odescalchi, die Reinherz und die Marquise Sarong sind oben. Es fehlt wirklich niemand.«
Die Contessa hörte dem begeisterten Bericht der Stewardesse zu, ohne sie zu unterbrechen; dabei verschärfte sich aber der gespannte Ausdruck in ihrem Gesichte, als erwartete sie etwas Bestimmtes zu hören, das aber doch nicht kam. Sie ließ sich in einen Stuhl fallen und zerrte dabei ungeduldig an den Handschuhen, die sie gerade in der Hand hielt.
Die Stewardesse aber plauderte unermüdlich weiter:
»Der rumänische Hauptmann trägt sogar seine Uniform und sieht darin entzückend aus; der Vikomte hat natürlich alle Orden auf seiner Knabenbrust und sieht deshalb auch nicht begehrenswerter aus. Fesch ist dagegen Ricolo. Sie sollten wirklich selbst hinaufgehen, gnädigste Contessa.«
»Es geht nicht, ich sagte es Ihnen doch schon.«
»Das Zusehen ist doch auch in Trauer erlaubt. Und das ist allein schon verlockend genug. Wirklich!! Es ist, als habe sich der Mond selbst für dies Fest herausgeputzt, so prächtig ist die Nacht.«
Da hob die Contessa den Kopf; aus dieser impulsiven Bewegung war zu erkennen, daß sie sich nun für irgendeinen Entschluß entschieden haben mußte. Und in langsamem Aufstehen fragte sie:
»Dann bemerkten Sie wohl auch jenen Freiherrn von Sassen? Dieser wird doch bei einem Fest an Bord nicht fehlen.«
Die Stewardesse nickte eifrig dazu:
»Natürlich sah ich ihn. Aber er tanzte nicht. Er saß bei der Kapelle und schaute auch nur zu. Die gnädigste Contessa würde sicher an dem Herrn Baron einen guten Gesellschafter finden. Sie kennen ihn gewiß schon?«
Rasch antwortete die Contessa:
»Nein! Ich hatte mich im Namen geirrt. Mir war lediglich der Name eines Freiherrn von Sassen bekannt erschienen; aber als ich ihn dann selbst sah, erkannte ich erst, daß ich mich geirrt hatte.«
»Sie erzählten mir das schon. Aber deshalb würden Sie an ihm doch einen hübschen Gesellschafter bekommen.«
»Ich habe keine Lust, an Bord Bekanntschaften zu machen, die doch keine Fortsetzung finden. Nein, nein! Ja, wenn Herr von Sassen der gewesen wäre, den ich in ihm vermutete, wie ich nach ihm fragte, dann würde es anders sein.« Und nach einem sekundenlangen Zögern fragte sie nochmals: »Aber er befindet sich auch oben?«
»Gewiß! Ich sah ihn ja selbst.«
Da ging die Contessa wieder mehrere Male in der Kabine auf und nieder und schien mit Entschlüssen zu kämpfen. Ihre Unterlippe klemmte sich zwischen den Zahnreihen ein und zwischen den Brauen hatte sich eine kleine Querfalte gebildet.
Und die Stewardesse plauderte:
»Sie sollten sich das Bild oben wirklich selbst ansehen. Eine so schöne Nacht ist gerade im Herbst sehr selten. Allein die Beleuchtung der See ist wundervoll.«
Da blieb die Contessa dicht vor der Stewardesse stehen und fragte ganz unvermittelt:
»Würden Sie mir dazu Ihre Schürze und Ihre Haube leihen?«
Erstaunt fragte diese:
»Wozu?«
»Am einen Blick nach oben zu werfen. Um einen flüchtigen Blick nach dem Festtrubel zu erhaschen.«
Die Stewardesse verstand den Zusammenhang noch immer nicht:
»Aber Sie können doch auch so hinauf!«
»Gerade das will ich nicht! Ich will vermeiden, daß man mich erkennt. In Ihrer Kleidung achtet niemand auf mich.«
»Aber das ist doch ganz unmöglich!«
»Weshalb? Im höchsten Fall ist es ein Scherz. Ich zahle gern und reichlich, wenn Sie damit einverstanden sind und mir Ihre Kleidung überlassen.«
»Aber wenn man Sie dann doch erkennt?«
»Das ist gewiß nicht der Fall. Ich will nur ganz von weitem zusehen. Hundert Mark! Nur für die Zeit einer Viertelstunde. Ihnen kann dabei doch nichts geschehen.«
Schon zögerte die Stewardesse:
»Ich weiß nicht ...«
»Nur rasch! In einer Viertelstunde bin ich ja wieder zurück. Ich lege, wenn ich zurück bin, noch das gleiche zu. Schließlich ist es dann ein Karnevalsscherz, der zu dem Feste paßt. Sie haben dabei doch gar nichts zu tun, als hier auf meine Rückkehr zu warten.«
Und als die Contessa Pregoli-Amati ihr dann das Geld in die Hand drückte, da sträubte sich die Stewardesse nicht mehr länger und erklärte sich einverstanden.
Kaum zehn Minuten später verließ die Contessa Lucie Pregoli-Amati in der Kleidung der Stewardesse die Kabine sechs. Ihr weißes Haar war dabei von dem Häubchen bedeckt und bei irgendeiner flüchtigen Begegnung würde in ihr niemand sofort die Contessa erraten haben.
Vor der Kabine stand sie eine Weile still. Flink huschten ihre Augen suchend nach allen Seiten.
Der Ausdruck ihres Gesichtes verriet gespannteste Aufmerksamkeit wie vor einem gewagten Spiel.
Behende eilte sie darauf weiter, in der Richtung zur Treppe nach dem Promenadendeck empor. Als sie aber die Höhe erreicht hatte, von der ein Blick über das Verdeck möglich war, blieb sie bereits stehen.
Sie wollte sich nicht weiter wagen, denn sie sah schon die Gestalten anderer Stewards und sonstiger Angestellten des Schiffes, von dienstfreien Matrosen, die von oben aus dem Fest und dem Tanz zuschauten.
Was sie selbst sehen wollte, das ließ sie erkennen.
Die Kapelle.
Auf einem erhöhten Podium saßen die acht Musiker mit ihrem schwarzlockigen, ungarischen Kapellmeister, der die Geige führte und in temperamentvoller Leidenschaft die schwellenden Weisen der lockenden Donauwellen des Altmeisters der Walzerkomponisten begleitete.
Und in der Nähe der Kapelle saß an einem Tische der Freiherr Manfred von Sassen; er war eben in einem Gespräch mit einem Schiffsbeamten.
Scharf beleuchtet hob sich das bartlose Gesicht des Freiherrn von Sassen ab.
Da kehrte die Contessa schon wieder auf der Treppe um und eilte mit noch rascheren Schritten, als sie gekommen war, zurück.
Aber es war ein anderer Weg, den sie nun einschlug. Dabei kam sie aber nicht nach der Kabine 6 zurück, woher sie doch gekommen war.
Hier waren die Kajüten der Backbordseite.
Und als sie wie erschöpft und tiefaufatmend stehenblieb, da stand sie gerade vor der Kajüte 18.
War das nicht die des Freiherrn von Sassen?
Hatte sich die Contessa Pregoli-Amati so im Wege geirrt?
Oder wie hatte es sonst geschehen können, daß sie nun nach der Kajütentüre von achtzehn griff und diese öffnete?
War es ein Irrtum, ein Zufall, oder was sonst, daß die Contessa Pregoli-Amati in diese Kajüte 18 hineinverschwand?
*
Die Stewardesse in der Kabine 6 hatte schon zu wiederholten Malen nach der Uhr gesehen.
Die Viertelstunde, von der die Contessa zu ihr gesprochen hatte, war längst vorüber, aber die Contessa war noch immer nicht zurück. Die Stewardesse rieb sich die Hände und spähte immer wieder nach der Uhr.
Eine halbe Stunde!
Es war doch auch zu seltsam, was für Launen oft solche Herrschaften hatten. Es wäre doch wirklich ganz gleichgültig gewesen, wenn diese Contessa auf das Promenadendeck gegangen wäre; selbst in Trauer hätte sie dem Fest wenigstens zusehen dürfen. Warum sie dies nun gerade in ihrer Schürze und Haube wollte?
Für die Summe, die sie hierfür erhalten hatte, konnte sie ja warten und die wunderliche Laune einer solchen Dame erfüllen.
Da endlich kam die Contessa wieder zurück.
Hastig wurde von ihr die Türe aufgerissen und ebenso rasch wieder geschlossen.
»Wie war es, Gnädigste? Habe ich wirklich zu viel versprochen?«
Die Stewardesse eilte auf die Eintretende zu, die bei der Türe stehengeblieben war.
Die Contessa Lucie Pregoli-Amati lehnte mit dem Rücken wie erschöpft an der Seitenlehne des Türstockes und hielt die beiden Hände gegen das Herz, als gelte es dessen ungestümes Pochen zu beschwichtigen. Ganz fest waren die schmalen Lippen aufeinandergepreßt und in ihren großen, schwarzen Augen glomm ein verräterisches Feuer.
Aber was verriet dieser Ausdruck ihres Gesichtes?
Die Stewardesse fuhr unwillkürlich vor diesem Ausdruck zurück und fragte bestürzt:
»Was ist Ihnen denn begegnet? Wie sehen Sie nur aus? Hat Sie jemand erkannt?«
Da richtete sich die Contessa mit rascher Beherrschung auf und schüttelte den Kopf:
»Nein, nein, es ist nichts! Ich bin nur etwas zu rasch gelaufen und dabei macht mein Herz immer Schwierigkeiten. Ich darf nicht laufen, das ist alles.«
Und schon lächelte der Mund der Contessa, während sie die Haube von ihrem Haar nahm.
Da begann auch die Stewardesse wieder lebhafter zu sprechen:
»Haben Sie etwas sehen können? Wie gefiel Ihnen Ricolo, und. dann der rumänische Hauptmann? Beobachteten Sie den Monsignore? Mit wem tanzte unser Kapitän?«
Lebhaft wehrte die Contessa ab:
»Das weiß ich wirklich nicht alles! Ich sah nur zu flüchtig zu.«
»Trafen Sie vielleicht den Baron von Sassen?«
Da reckte sich die Contessa:
»Was wollen Sie mit ihm? Ich sagte Ihnen doch, daß ich diesen gar nicht kenne, daß es nur der Name war, der mich interessierte.«
»Verzeihen Sie, gnädigste Contessa.«
Und wie erschrocken schwieg die Stewardesse und fragte jetzt auch nichts mehr. Schweigend nahm sie die Schürze entgegen und murmelte auch nur einen kurzen Dank, als sie dann von der Contessa das für die Überlassung der Kleider versprochene Geld erhielt.
Ehe sie dann die Kabine verließ, bemerkte die Contessa noch wie erklärend:
»Es hat mich niemand gesehen oder gar erkannt. Sie haben also nichts zu fürchten. Natürlich dürfen Sie auch niemand von dieser meiner Laune erzählen.«
»Ich werde gewiß nichts erzählen, Gnädigste.«
Die Contessa zog wie gleichgültig die Schultern hoch:
»Schließlich hat es auch nichts zu sagen; ich wünsche nur nicht, daß man über meine Laune Glossen macht.«
»Ich verstehe, die gnädigste Contessa dürfen sich auf mich verlassen.«
Und mit dieser Zusicherung verließ jetzt die Stewardesse die Kabine.
*
»Sie, meine Gnädigste, hatten bei dem Feste doch gefehlt. Von mir wenigstens kann ich behaupten, daß ich Sie vermißte. Wiederholt habe ich Sie auch gesucht, natürlich vergebens.«
Die Worte des Kapitäns galten der Contessa Pregoli-Amati, die in einem Korbsessel saß und auf das weite Meer hinausschaute, dem Spiel von Möven zu, die den Dampfer auf seiner Fahrt begleiteten.
Der Kapitän schob dabei auch für sich einen Sessel heran, um eine Weile mit der auf Deck so selten sichtbaren Schönheit, der »Dame in Trauer«, zu plaudern, wie die Contessa meist genannt wurde und unter welcher Bezeichnung sie bekannter als unter ihrem Namen war.
»Sie vergessen, Herr Kapitän, daß ich Trauer habe und deshalb zu derartigen Festen nicht gehöre.«
Der Kapitän, eine breitschultrige Erscheinung mit sonnverbranntem Gesicht und blauen Augen, mit rötlichblondem Vollbart, beugte sich leicht vor und antwortete in liebenswürdigem Tone:
»Ein unersetzlicher Verlust für uns.«
Mit silbern klingendem Lachen entgegnete die Contessa:
»Ich danke für dies Kompliment, mein Herr!« Dann mit einem zweifelnden Hochziehen ihrer Schultern: »Allein mir fehlt der Glaube.«
»Oh, das dürfen Sie nicht behaupten.«
»Doch! Ich habe mir aus zuverlässiger Quelle erzählen lassen, daß Sie selbst, Herr Kapitän, nicht einen Tanz ausgelassen haben. Es wäre demnach für mich gar keiner frei geblieben.«
»Das tat ich gewiß nur in der Verzweiflung, weil ich Sie, meine Gnädigste, nicht finden konnte.«
»Still, still!«
Dabei wehrte sie lachend mit beiden Händen ab.
Diese scherzhafte Plänkelei erhielt durch das Dazwischentreten des dienstversehenden Marconitelegraphisten, der sich an Bord des »Merkuro« befand, eine unerwartete Unterbrechung.
Es war dies noch ein junger Mann mit schwarzem, kleinem Schnurrbärtchen, der in der Nähe vor dem Kapitän stehen blieb und dabei einen schmalen Meldestreifen in der Hand hielt. Er schien zu zögern, ob er nähertreten dürfe.
Der Kapitän aber hatte ihn schon bemerkt und rief ihn auffordernd heran:
»Was ist denn los, Weller? Haben Sie eine besondere drahtlose Nachricht abgefangen?«
»Eine Depesche für den Merkuro selbst, Herr Kapitän!«
»Oho! Es wird doch nichts schlimmes sein? Erzählen Sie mal.«
Da warf der Telegraphist einen flüchtigen Blick auf die Contessa und erwiderte zögernd:
»Ich ... ich weiß doch nicht, Herr Kapitän!«
»Schon gut! Geben Sie nur die Nachricht her!«
Da reichte ihm der Telegraphist den Meldestreifen hin, worauf der Kapitän erklärte:
»Sie können wieder in Ihre Station zurück, Weller.«
Der Telegraphist ging auch wieder, während der Kapitän einen flüchtigen Blick zuerst auf den Streifen warf und dann gegen die Contessa erklärte:
»Nur ein paar Augenblicke Geduld, dann stehe ich wieder ganz zu Ihrer Verfügung.«
»Das ist doch selbstverständlich, daß Dienstliches jedes Vorrecht beanspruchen kann.«
»Ich danke!«
Dann las der Kapitän den Streifen in seiner Hand; aber schon während des Lesens verfinsterten sich seine Züge, und das selbstzufriedene Lächeln verschwand aus seinem Gesichte. Auch seine Lippen kniffen sich zusammen und die buschigen Brauen über den blauen Augen schoben sich hoch.
So auffallend war die Veränderung, daß die Contessa Pregoli-Amati an ihn die Frage stellte:
»Es scheint doch eine unangenehme Nachricht zu sein, die Ihnen gebracht wurde?«
Der Gefragte machte eine wegwerfende Bewegung:
»Nur eine ärgerliche Sache.«
»Jedenfalls hat sie Ihre Laune gründlich verdorben, Herr Kapitän. Sollten Sie in solcher Situation nicht einmal einem Trost zugänglich sein?«
»Doch! Schließlich brauche ich mir kein Kopfzerbrechen zu machen. Als Kapitän des Schiffes bin ich doch nicht dafür verantwortlich, welche Passagiere ich an Bord bekomme.«
»Wieso? Haben Sie Passagiere an Bord, die Ihnen Unannehmlichkeiten machen?«
»Das allerdings!«
»Oh! Was für Unannehmlichkeiten können das sein und was für Passagiere?«
»Lassen wir das!«
»Wollen Sie mir nichts davon anvertrauen?«
Da lachte der Kapitän ärgerlich auf und antwortete:
»Ich erkenne Ihre gutgemeinte Absicht ja vollständig an, meine Gnädigste, aber schließlich gehört die Sache zu den sogenannten Berufsgeheimnissen. Sie verzeihen, aber ich darf darüber nicht sprechen, jedenfalls werde ich mir die gute Laune nicht ganz verderben lassen.«
Mit diesen Worten ballte er in der Hand den ihm gebrachten Meldestreifen zusammen und schob ihn in die Seite seines Rockes; wenigstens wollte er das tun.
In dem Arger aber achtete er zu wenig darauf und er verfehlte die Tasche, und der zerdrückte, zusammengeballte Meldestreifen fiel dicht neben ihm auf den Boden, ohne daß er dies bemerkte.
Aber die schwarzen Augen der Contessa Pregoli-Amati, die jeder seiner Bewegungen gefolgt waren, hatten dies beobachtet. Und sie schwieg.
Wie unwillkürlich rückte sie nur den Korbsessel und zwar so, daß sie dichter an den Kapitän herankam; dabei erklärte sie in einem kokettierenden Ton:
»Vermag meine Gesellschaft wirklich so viel, daß Sie einen kleinen dienstlichen Arger vergessen können? Dann glaube ich auch, daß Sie bei dem Feste mich doch vermißt haben, Herr Kapitän.«
Sie lächelte und beugte sich in ihrem Korbsessel etwas vor.
Gleichzeitig streckte sich aber auch unbemerkt ihr Fuß aus und trat auf den auf dem Boden liegenden zerknüllten Meldestreifen, der dadurch unsichtbar wurde und nicht mehr bemerkt werden konnte.
Es war dies das Spiel einer Sekunde.
»Diesen Glauben sollen Sie haben, meine Gnädigste. Kein Wort mehr soll von dem Ärger über meine Lippen kommen und wenn Sie es verlangen, werde ich sogar lachen.«
Und in dem gleichen harmlos plaudernden Ton vergingen die nächsten Minuten. Die Contessa Pregoli-Amati schien von seltener Fröhlichkeit.
Schließlich mußte der Kapitän aber doch die Erklärung geben:
»So verlockend es auch wäre, dieses Plauderviertelstündchen unendlich fortzusetzen, es gibt Dinge, die darüber doch nicht vergessen werden dürfen. Der Dienst ruft mich wieder.«
»Womit Sie genügend entschuldigt sind, Herr Kapitän.«
Und sie reichte ihm die Hand, die er in gleicher liebenswürdiger Form an seine Lippen führte.
Lange sah sie ihm nach, bis seine Gestalt vollständig aus ihrem Gesichtskreise verschwunden war.
Dann glitten ihre Augen erst wie prüfend umher, denn sie wollte sich vergewissern, ob sie sich auch unbeobachtet halten durfte; da und dort promenierten wohl ein paar Bummler, einige Stewards liefen geschäftig hin und her, aber niemand war darunter, dessen Nähe in diesem Augenblicke schließlich zu befürchten war.
Da bückte sie sich mit rascher Bewegung, der Fuß zog sich zurück, und der Meldestreifen, den der Kapitän daneben gesteckt hatte, befand sich in ihrer Hand.
Auch jetzt beherrschte sie sich noch und wartete; dann aber faltete sie wie nachlässig den Streifen auf und las die Meldung, die der Marconitelegraph des Schiffes gebracht hatte.
Schon nach den ersten Zeilen hob sie den Kopf und blickte auf; dabei leuchteten ihre schwarzen Augen wie in besonderer Erregung, die nur durch die Meldung hervorgerufen sein konnte.
Und wieder beugte sie sich dann über den Streifen.
Das aber war der Wortlaut dieser Nachricht:
»Passagierdampfer Merkuro hat so lange vor dem Hafen zu kreuzen, bis ihn ein Polizeiboot anfährt; vorher ist die Hafeneinfahrt nicht erlaubt. Besonders zu achten ist auf einen angeblichen Freiherrn von Sassen, in dem ein gesuchter Verbrecher verhaftet werden soll. Es empfiehlt sich, ihn überwachen zu lassen, damit er das Schiff vorher nicht verlassen kann. Hafenpolizei.«
Die Meldung trug noch den Namen des zunächst anzulaufenden Hafens, der mit dem übernächsten Tag erreicht werden mußte.
Langsam ballte nun die Hand der Contessa Pregoli-Amati den Streifen wieder zusammen.
Und sie lehnte sich weit in den Korbsessel zurück und schloß wie überlegend oder vor sich hinträumend die Augen. Bewegungslos blieb sie so einige Sekunden lang.
Nur das wiederholte Zucken der Brauen und der Mundwinkel verriet, wie lebhaft ihre Gedanken dabei arbeiteten, offenbar nach etwas suchten.
Aber mit keinem verräterischen Wort erzählten die fest zusammengepreßten Lippen etwas von diesen Gedanken, die hinter ihrer weißen Stirne stürmen mochten.
Dann richtete sie sich auf. Ihre Augen öffneten sich.
Langsam trat sie an die Brüstung und beugte sich über diese; dabei öffnete sich nun auch die immer noch geballte Hand und der weiße, schmale Meldestreifen fiel über Bord und flatterte in die Tiefe. Er schaukelte etwas vom Winde getragen, bis er auf die Wellen fiel, eine Weile noch von diesen getragen und verschwand dann vollends dem Auge.
Nun erst erhob sich die Contessa Pregoli-Amati wieder und begab sich langsam schlendernd nach ihrer Kabine.
*
Am Abend, wenn es auf Verdeck still wurde und sich die Mehrzahl der Passagiere in ihre Kabinen und Kajüten zurückzogen, oder höchstens noch im Saal beisammensaßen oder in der Weinabteilung tranken, dann erst suchte Freiherr von Sassen das Promenadendeck auf.
Am liebsten schaute er in die schweigende, stille Nacht hinaus und hörte dem Rauschen der Wogen zu, dieser gewaltigsten aller Melodien.
Oft würde dies ja nicht mehr der Fall sein, denn schon in der nächsten Nacht, oder mehr um die Morgenstunde wurde die Hafenstadt erreicht, in der er das Schiff verlassen wollte, um völlig zu verschwinden und in Vergessenheit spurlos unterzutauchen.
Dann war auch Freiherr von Sassen wie der Direktor Streitter erledigt, und er konnte wieder als ein anderer endlich Ruhe finden.
Damit und mit weiteren Zukunftsgedanken mochte er bei dem Hinausträumen in die Nacht und auf die weite See beschäftigt sein.
Dabei war es wieder einmal spät geworden, bis er in seine Kajüte zurückkam.
Eine Weile hielt er sich dort im Dunkeln auf, ehe er das Licht einschaltete. Als er darauf zu dem Tische hin ging, sah er erst auf diesem einen verschlossenen Briefumschlag liegen, der keine Aufschrift trug, aber doch für ihn bestimmt sein mußte.
Wie hätte er auch gerade in seine Kajüte kommen sollen?
Aber woher kam dieser Brief?
Was enthielt er?
Freiherr von Sassen hielt ihn wie abwägend in der Hand.
Seine Brauen schoben sich zusammen.
Was bedeutete das?
Dann riß er wie in raschem Entschluß den Umschlag auf und nahm daraus einen zusammengefalteten Brief.
Mit aufeinandergepreßten Lippen las er folgendes:
»Sehen Sie sich vor, der Merkuro darf nicht in den Hafen einfahren, ehe er nicht von den Beamten des Polizeiboots durchsucht ist. Ihnen gilt es! Vielleicht finden Sie doch einen Weg, der Sie noch vorher über Bord bringt.«
Kein Name darunter, kein Buchstabe, kein Fingerzeig, der vielleicht hätte erraten lassen, woher diese Warnung kommen konnte.
Aber doch eine Warnung!
Ein Polizeiboot auf seiner Spur. Und eine Flucht sollte ihm dadurch unmöglich gemacht werden, daß der Dampfer nicht früher in den Hafen einlaufen durfte.
So war auch der Freiherr von Sassen wieder ausfindig gemacht worden wie jener Direktor Streitter.
Damit aber mußte er an eine neue Flucht denken! Es gab keine andere Möglichkeit, wenn sein Spiel nicht verloren sein sollte.
Wieder Flucht.
Er klemmte die Unterlippe zwischen den Zahnreihen ein und biß sich fest.
Da aber kam erst der andere, noch unerklärlichere Gedanke: Wer hatte ihn hier an Bord dieses Schiffes gewarnt? Wer wußte, daß er auf einer Flucht war und daß ihm eine Verfolgung galt?
Sollte ...
Und die Lippen des Freiherrn von Sassen murmelten nur einen Namen:
Contessa Lucie Pregoli-Amati, geborene Wickramsberg.
So hatte sie sich selbst genannt.
Sollte sie es doch sein, die er schon in der ersten Begegnung in ihr vermutet hatte? Aber das weiße Haar?
Konnte dieses nicht falsch sein, um ihn irre zu führen, damit er sie nicht wiedererkennen sollte?
War diese Contessa Pregoli-Amati nicht doch jene Daisy Frommel aus dem Hotel »Adlerhorst« und damit auch Anita Wronker?
Und wenn sie es war, dann suchte sie doch nur einen Mörder, dann war sie doch seine erbittertste Gegnerin, dann war sie ihm nur deshalb auf den Merkuro nachgefolgt und hatte sich auch deshalb nur vor ihm verleugnet.
Aber sie konnte es dann am wenigsten sein, die ihn warnte.
Oder ...?
Mit raschem Ruck hob er den Kopf und dabei flammte ein Leuchten in seinen graubraunen Augen auf.
Die Contessa!
Wenn sie jene andere war, dann hatte er diese doch selbst belauscht, wie sie in seinen Koffer einzudringen versucht hatte.
Wie war es dann zu erklären, daß diese ihn mit einem Male warnen sollte?
Oder ...?
Und der gleiche Gedanke wie vorher schon drängte sich in ihm auf.
Dann schüttelte er wie über etwas unmögliches den Kopf:
Und er murmelte vor sich hin:
»Das kann nicht sein! Wie wäre das auch denkbar?«
Doch wer hatte ihn dann gewarnt?
Was konnte es ihm nützen, darüber nachzudenken?
War jetzt nicht das andere von größerer Wichtigkeit, wie er sich nun rettete? Jenen Weg zu finden, der ihn über Bord und in Sicherheit brachte, ehe das Polizeiboot anlegte?
Wie aber konnte das möglich sein?
Darauf galt es zuerst die Antwort zu finden ...
*
In der Kabine des Marconitelegraphisten herrschte Stille. Der Apparat, der zur Aufnahme der drahtlosen Telegramme bestimmt war, lag in Ruhe.
Der Telegraphist, der den Nachtdienst hatte, durfte sich daher schon Ruhe gönnen, zumal der Dienst oft anstrengend genug war. Und so lag er auf der Ottomane in dem einen Winkel der Station und träumte mit offenen Augen vor sich hin.
Es war dies der Telegraphist Weller, der damals an Bord dem Kapitän jenen Meldestreifen über die Benachrichtigung durch die Hafenpolizei gebracht hatte.
Er wollte diese letzte Nacht vor der Hafeneinfahrt auch ausruhen.
Aber als sich dann die Türe seiner Station öffnete, fuhr er doch erschrocken hoch.
Sollte ihn der Kapitän im Dienst kontrollieren? Das war zwar während der ganzen Fahrt bisher nie geschehen, aber man konnte doch nie wissen, was schließlich nicht doch möglich war.
Als aber sein Blick zur Türe hin fiel, da erkannte er, daß es irgendein Fremder war, einer von den Passagieren des Merkuro.
Da es ab und zu vorkam, daß ein Fahrgast mit einer Frage zu ihm kam oder auch eine drahtlose Nachricht hinausgehen ließ, so war er nicht zu sehr überrascht und richtete sich langsam von seinem Lager auf.
Nur das war verwunderlich, daß ihn jemand so spät noch aufsuchte und in der letzten Nacht vor der am Morgen folgenden Hafeneinfahrt.
Etwas mürrisch fragte er nach den Wünschen des Fremden, den er nicht kannte.
Dieser ließ seine graubraunen Augen neugierig hin und Hergleiten und erklärte darauf mit dem Tone eines naiven Erstaunens:
»Verzeihen Sie, ich sah noch nie einen Apparat, mit dem man auf hoher See schließlich immer noch mit dem Land verbunden ist und Nachrichten von überallher bekommen kann. Mir war es immer, als müßten Sie deshalb die wichtigste Person an Bord sein. Entschuldigen Sie, wenn ich mit meiner Neugierde störe.«
Das unverhohlene Erstaunen, das sein Besucher so deutlich erkennen ließ, amüsierte den Telegraphisten; außerdem war er während seines Nachtdienstes für eine kleine Gesellschaft dankbar, wenn für ihn schließlich nicht noch mehr zu holen war.
Der Gehalt war nicht so groß, daß er einem Trinkgeld abgeneigt gewesen wäre.
Aber bei solchen Bewunderern war ein solches vielleicht zu erwarten, wenn er nur entgegenkam und die Neugierde seines Besuchers stillte.
»In der letzten Nacht ist nichts los. Wir sind schon zu nahe am Hafen und es schwärmen schon manche Schiffe um uns. Mit einer Störung ist es daher nicht so schlimm.«
Da zeigte die Hand des Fremden auf den Apparat:
»Und dort kann man wirklich von überallher Nachrichten erhalten und auch lesen?«
»Freilich!«
»Aber das ist doch eigentlich nur ein kleines Tischchen.«
Über diese Unbefangenheit seines Besuchers, der über die Gesetze der drahtlosen Telegraphie völlig unerfahren und ahnungslos schien, lachte der Telegraphist und antwortete dann, während er an den Tisch selbst trat:
»Für meine Zwecke ist er groß genug.«
Da kam auch der Fremde näher:
»Eigentlich ist es ganz unbegreiflich, daß man an so einem unscheinbaren Apparat Mitteilungen von irgendwoher bekommen kann. Ja, wenn man schließlich mit einem Draht verbunden ist wie beim Telephon, da verstehe ich es noch. Aber so ganz ohne Draht! Ich begreife das nicht. Wie macht man denn so etwas?«
Der Telegraphist gab seinem Besucher nun einige Erklärungen, zeigte auch die Bedeutung der einzelnen Teile, mußte aber dabei an dem fassungslosen Ausdruck erkennen, daß der Fremde jedenfalls nicht das geringste davon verstand. Dieser nickte zwar bei jedem Satz, aber die erste Bemerkung, die er dann machte, war ahnungslos.
Telegraphist Weller fand nun ein besonderes Vergnügen darin, in möglichst unverständlichen Fachausdrücken zu sprechen, um das Erstaunen dieses Laien dadurch noch mehr zu steigern.
Er erreichte dies Ziel auch, wie sich an den Zügen und aus den Worten des Fremden erkennen ließ.
Dieser erklärte darauf:
»Und Sie müssen nun die ganze Nacht hier bleiben?«
»Freilich! Ich werde erst um neun Uhr morgens wieder abgelöst.«
»Da hätte ich Sie gerne zu einer Flasche Wein eingeladen. Aber das geht wohl nicht?«
»Die Station hier darf ich nicht verlassen.«
Mit einem lächelnden Gesicht erklärte nun der Fremde:
»Aber wenn ich die Flasche hierher brächte?«
Mit einem Hochziehen seiner Schultern antwortete der Telegraphist:
»Dagegen würde schließlich nichts einzuwenden sein.«
»Gut, gut, ich bringe Ihnen eine Flasche. Weil Sie mir das so schön erklärt hüben. Aber dann müssen Sie mir das auch noch vormachen.«
Und damit war der Fremde schon wieder zur Türe hinaus.
Telegraphist Weller lachte behaglich; da hatte er ja eine Nacht, die vielversprechend begann. Vielleicht wurde aus der einen Flasche Wein eine zweite oder gar noch eine dritte. Wenn er diesem Besucher schließlich die Abnahme eines wirklichen Gespräches zeigen konnte, dann knauserte er sicher nicht.
Er mußte auch nicht lange warten.
Der Fremde kam wieder und trug unter dem Arme zwei Flaschen und zwei Gläser; die Flaschen waren schon offen.
»Wo kann ich sie hinstellen?«
»Nur gleich hierher!«
Als die Flaschen dann auf dem Tisch standen, erklärte der Fremde:
»Trinken Sie jetzt nur! Ich werde gleich wieder kommen! Ich habe nur noch meine Rechnung zu bezahlen und will sehen, ob ich nicht auch noch einige Leckerbissen zum Wein bekommen kann.«
Und mit freundlichem Lächeln ging er wieder hinaus.
Da ließ sich der Telegraphist von den Flaschen nicht lange locken. Zuerst füllte er ein Glas nur versuchsweise. Die Probe fiel aber so gut aus, daß ein zweiter Versuch nachfolgte.
Ein weiteres Glas wurde der zweiten Flasche entnommen.
Der Wein war wirklich vorzüglich. Wenn sein Gastgeber jetzt auch noch Leckerbissen brachte – Weller dachte dabei an getrüffelte Pasteten –, dann konnte er mit einer solchen Nacht wirklich zufrieden sein.
Nur öfters wiederholen müßten sich derartige!
Noch ein Glas!
Der Wein war auch schwer! Das hätte er gar nicht für möglich gehalten. Eine schwere, bleierne Müdigkeit drückte auf seine Augen. Ob das der Wein ausmachte?
Und versuchsweise leerte er ein weiteres Glas.
Wenn erst der Fremde wiederkam und die versprochenen Leckerbissen brachte, dann wollte er rasch wieder munter sein.
Aber als dann die Türe ganz leise und wie mit gesteigerter Vorsicht geöffnet wurde, als sich durch diese dann wie lauschend und spähend der Kopf des Fremden hereinschob, dessen Augen wie suchend waren, da saß der Telegraphist schon in tiefem Schlaf an seinem Tische vor den beiden Weinflaschen.
Ein triumphierendes Aufleuchten huschte jetzt über das Gesicht dieses Fremden.
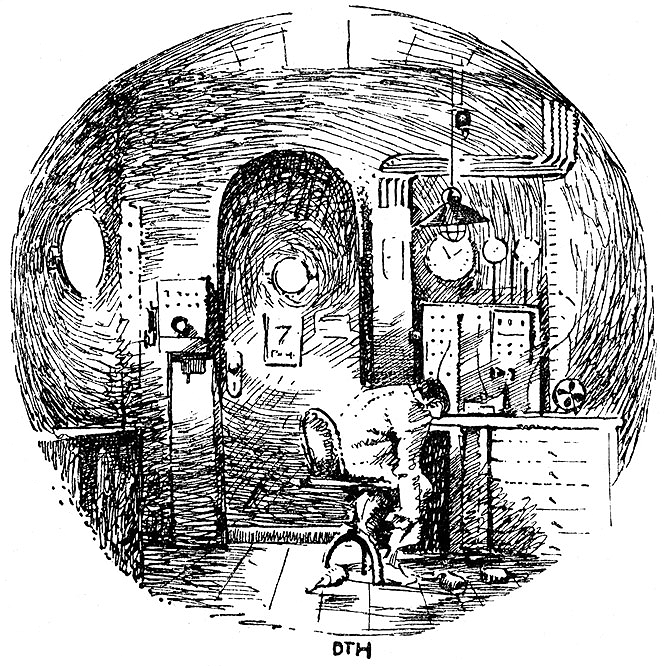
Dann trat er erst vollends in die Station ein und schloß sorgfältig die Türe hinter sich zu.
Der Telegraphist aber erwachte selbst dann nicht, als ihn jener Fremde unter den Armen faßte und auf die Ottomane hinschaffte, auf die er ihn niederfallen ließ.
Mit lauten Schnarchtönen schlief dieser auf dem viel bequemeren Lager weiter.
Wie aber würde der Telegraphist Weller erst erstaunt gewesen sein, wenn er nun hätte zusehen können, wie sich dieser Fremde jetzt an den Apparat setzte und wie er mit diesem umzugehen verstand, ebenso gut wie ein erfahrener Marconitelegraphist.
Das war jetzt nicht mehr der ahnungslose Laie, der alles erklärt wissen will und schließlich von allem doch nichts versteht, das war nur einer, der genau wußte, was er wollte und was es jetzt galt.
Der Fremde aber mit dem bartlosen Gesicht war kein anderer als der Freiherr von Sassen.
*
Als der »Merkuro« die Hafeneinfahrt erreichte, etwa gegen fünf Uhr morgens, war die Luft von einem fast undurchdringlichen Nebel erfüllt. Alle Lichter an Bord brannten und von verschiedenen Richtungen her waren die Signale so mancher Schiffe zu hören. Turbinen heulten, schrille Pfiffe schwirrten, dazwischen Glockensignale.
Aus dem bläulichgrauen Nebeldunst flammten überall Lampen mit verschiedenfarbigen Lichtern.
Der Kapitän stand auf seinem Posten und spähte in die Dunkelheit, als schaute er nach einem Boot aus.
Neben ihm stand der erste Offizier.
An diesen wandte sich jetzt der Kapitän:
»Sahen Sie ihn gestern in seine Kajüte gehen?«
»Ja! Ich beobachtete ihn selbst.«
»Aber den Morgen hat er sie noch nicht verlassen?«
»Bei solchem Nebel geht niemand an Deck, wenn es sich einigermaßen vermeiden läßt. Außerdem habe ich den Wenzel zu den Kajüten auf Backbordseite geschickt, damit er es sofort meldet, wenn er sie verlassen sollte.«
»Das haben Sie gut gemacht, Mertens! Wenn es auch keine sympathische Aufgabe ist, den Polizeispitzel zu spielen, aber in solchem Falle läßt sich nichts anderes machen. Nebel genug herrscht ja, so daß man fast die Hand nicht vor den Augen sehen kann. Eigentlich ein Wetter wie zur Flucht geschaffen.«
»Da müßte er aber davon wissen, was gegen ihn im Werke ist. Außerdem steht ja der Wenzel auf Wache.«
Eine Weile war es stille. Der Kapitän bemühte sich wieder, den Nebel zu durchdringen.
Auf dem Deck war außer den Leuten, die Dienst hatten, niemand zu sehen.
»Hoffentlich läßt sich das Polizeiboot bald blicken, damit wir nicht zu lange im Nebel herumlavieren müssen.«
Der erste Offizier nickte und ließ seine Augen gleichfalls in den Nebel hineinspähen.
Da wandte sich der Kapitän wieder an ihn:
»Sehen Sie doch mal da zum Steuerbordlicht hinüber! Sieht das nicht aus, als hätte sich die Contessa Pregoli-Amati schon auf Deck gewagt?«
Der Blick des Offiziers folgte der bezeichneten Richtung, worauf er lebhaft nickend zustimmte:
»Das ist sie auch! Was mag sie nur so früh an Deck getrieben haben?«
Aber er bekam auf diese Frage keine Antwort mehr, denn fast gleichzeitig rief ihm der Kapitän die Warnung zu:
»Vorsicht! Wenn mich nicht alles betrügt, dann sind das die Signallichter des Polizeibootes.«
»Wahrhaftig! Müssen die es aber eilig haben.«
»Um so besser für uns! Immerhin ein unangenehmes Gefühl, einen Mörder an Bord zu wissen.«
»Wenn er es auch ist.«
Der Kapitän nickte lebhaft:
»Er ist es! Ich habe mich nun mehr um diesen Baron gekümmert. Er hat sich doch immer für sich gehalten und ist jedem Verkehr aus dem Wege gegangen. Sein Steward hat mir zudem anvertraut, daß er mit einem großen, gelbbraunen Koffer an Bord kam, daß er sich beim Auspacken von niemandem unterstützen lassen wollte. Sehen Sie nur! Es ist wirklich das Polizeiboot.«
Bald erfolgte dann auch schon von diesem aus ein Anruf, den der Kapitän beantworten ließ.
Und eine Viertelstunde später kamen zwei Kriminalbeamte an Bord.
Der Kapitän hatte sich unterdessen von dem ersten Offizier ablösen lassen und ging den beiden Beamten selbst entgegen.
Der erste stellte auch gleich die Frage an ihn:
»Haben Sie die drahtlose Verständigung erhalten?«
»Gewiß, Herr Kommissar.«
»Und jener Freiherr von Sassen?«
»Der schläft noch in seiner Kajüte. Ich habe vor diese einen Burschen als Wache hingestellt.«
»Um so besser! Wissen Sie, ob dieser unter seinem Gepäck einen gelbbraunen Rohrplattenkoffer hat?«
»Natürlich, den hat er!«
Und er fügte wieder hinzu, was er darüber von dem Steward erfahren hatte.
Da nickte der eine der beiden Beamten und erwiderte:
»Dann ist er sicher der Gesuchte! Führen Sie uns nur gleich zu ihm.«
»Kajüte 18!«
Als dann die beiden Beamten mit dem Kapitän zu der genannten Kajüte kamen, trafen sie vor dieser einen alten, rotbärtigen Matrosen an, an den der Kapitän die Frage richtete:
»Haben Sie irgend etwas beobachtet, Wenzel?«
»So viel kann ich sagen, Herr Kap'tän, daß aus der Türe auch nicht eine Maus herausgekommen ist.«
»Schon gut!«
Auf den Versuch des einen der beiden Beamten hin zeigte sich die Kajütentüre unverschlossen.
Als aber auf einen Zuruf dann von innen keine Antwort erfolgte, trat dieser vollends in die Kajüte, wobei ihm der zweite und der Kapitän nachfolgten. Die Blicke irrten zu dem Bette hin.
Da rief auch schon der Kriminalbeamte:
»Das Bett ist ja unberührt und die Kajüte leer. Es ist ja niemand da!«
Dabei wandte er sich fragend an den Kapitän, der rasch näher kam und wie erschrocken zurückfuhr:
»Wo soll er dann sein? Mein erster Offizier Mertens sah ihn ja am Abend in die Kajüte gehen.«
»Aber hier ist er nicht! Hat er denn das Schiff, verlassen können?«
»Das ist ganz unmöglich! Wie sollte er das können?« Ist denn nicht sein Koffer da?«
Auf diese Bemerkung hin suchten sofort die Augen von dreien durch den Raum.
Nichts! Der gelbbraune Koffer war genau wie der Freiherr von Sassen verschwunden.
Ein paar Stimmen hörte man gleichzeitig rufen:
»Der Koffer ist fort.«
»Aber wie kann er noch den Koffer mitgenommen haben? Es hätte ihn doch irgend jemand sehen müssen.«
»Er muß vielleicht noch irgendwo auf dem Schiffe versteckt sein.«
Und die drei verließen bestürzt die Kajüte.
Kaum aber waren sie auf Verdeck gekommen, um sich nun über einen Entschluß zu einigen, was nach dieser Entdeckung geschehen müsse, als der zweite Marconitelegraphist auf den Kapitän zugeeilt kam und wie auf eine Anfrage wartend stehen blieb.
Ungeduldig rief ihn dieser an:
»Was wollen Sie jetzt noch?«
»Verzeihen Sie, Herr Kapitän, ich komme gerade von der Station.«
»Weiter!«
»Weller liegt bewußtlos oder auch betrunken drinnen und auf dem Tisch stehen zwei Weinflaschen und Gläser.«
»Ein Skandal! Mit dem Burschen werde ich später noch ein ernstliches Wort sprechen. Jetzt habe ich dafür keine Zeit.«
»Aber es ist auch der Apparat beschädigt, so daß weder eine Nachricht hinausgegeben werden kann, noch eine solche zu erhalten ist.«
»Der Apparat zerstört? Wie ist das wieder möglich?«
Der eine Kriminalbeamte, der dieser Auseinandersetzung zugehört hätte, wandte sich nun an den Kapitän:
»Das kann vielleicht durch den Entschwundenen geschehen sein. Vielleicht verschaffte er sich aus diese Weise die Möglichkeit einer Flucht.«
»Aber wie?«
»Das muß sich dann erst noch zeigen. Jedenfalls gilt es zunächst, diesen Telegraphisten wieder zur Besinnung zu bringen. Ich irre mich gewiß nicht, wenn ich behaupte, daß er schließlich der einzige ist, der uns vielleicht einen Aufschluß geben kann.«
Und als dann der Kapitän mit den beiden Kriminalbeamten und dem zweiten Telegraphisten in der Richtung zur Marconistation eilten, da kamen sie dicht an der Contessa Lucie Pregoli-Amati vorüber, die als einziger Passagier schon zu so früher Stunde auf dem Deck bummelte.
Lächelnd nickte sie dem Kapitän einen Gruß zu, der aber nur flüchtig antwortete.
Deshalb sah und beobachtete er auch nicht, wie die Blicke aus den großen, schwarzen Augen ihnen nachfolgten und wie dabei der Ausdruck in ihrem Gesichte einen überlegenen und wie triumphierenden Zug annahm.
Langsam folgte sie diesen dann in der gleichen Richtung nach.