
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Wer den Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande gehen«, sagt jenes Goethesche Wort. Für wen gilt es mehr, als für den Dichter des Dialekts? Schon sein Erscheinen bedeutet, daß die Eigenart, gleichsam die Persönlichkeit einer originellen Minderheit sich aussprechen will; daß irgend eine langverschwiegene, ungewußte, geheimnisvolle Wechselwirkung von Land und Volk, Natur- und Menschengeschichte, die still für sich gewaltet, nach Selbstvergegenwärtigung ringt. Als in Fritz Reuter das Auge zu sehen und der Geist aufzufassen begann, der diese originelle Volkspersönlichkeit in sich vergegenwärtigen und aus sich nachformen sollte, lag Mecklenburg noch ungekannt, wie eine von der Flut zurückgelassene Muschel am Meeresstrande da; abgesondert nach außen, noch zwischen Mittelalter und Neuzeit geschichtslos dahinlebend, leicht zu regieren, schwer umzuformen, bald von Not gedrückt, bald von Segen getragen, immer aber eines alten Erbteils gewiß: des heiteren Lebenssinns, mit dem der Mecklenburger sich das Dasein erkämpft. Das Leben seiner Nachbarn ging ihn wenig an, er atmete durch seine beiden (ungleichen) Lungen Rostock und Wismar, und das nährende Blut in seinen Adern gewann er seinem Weizenboden und seinen Viehweiden ab. Denn die Landwirtschaft war – und ist – sein vornehmster Beruf. In seinem ebenen, nur hier und da sanft gehügelten Land, in dem er jede sichtbare Erhöhung einen »Berg« getauft hat, zwischen herrlichem Weizenland und elendem »Klas Hahn«, zwischen brauner Haide und mächtigem Buchenwald, zwischen fett grünenden Wiesen und meilenweit blauenden Seen (mehr als dreihundert Seen zählt das kleine Land) lebte er sein ackerbauendes Leben; der an die Scholle gebundene Tagelöhner, der Bauer auf seiner Hufe, der kleine Ackerbürger der Städte, der Pächter im »Domanium«, der große Grundherr auf oft unabsehbaren Gütern mit vornehmen Herrensitzen, alle derselben innigen Gemeinschaft mit der Mutter Erde ergeben. Eben dieser Gemeinschaft entwuchs seine besondere Art. Es ist etwas Erdiges in ihm; er grübelt nicht hoch hinauf und nicht weit hinaus; sein »Wille zum Leben« wird ihm nicht leicht getrübt; es ist ihm wohl in dem frischen Schollengeruch, dessen Kraft er atmet, unter dem luftigen Gewölbe, dessen Glut oder dessen Regen seine geliebte flache Erdscheibe ernährt. Freilich kommt auch weniger Kultur zu ihm auf seinen Acker hinaus. Die Einschränkung seines Daseins hat ihn noch bedächtiger, schwerfälliger, formloser als die andern Genossen der deutschen Familie gemacht. Man könnte sagen: wie das auskriechende Küchlein noch ein Stück Eierschale, so trägt der Mecklenburger, auch wenn er zum Städter ward, noch etwas Ackerkrume mit sich herum. Mehr treuherzig (oder bauernschlau) als weltgewandt; mehr »mutterwitzig« als geistreich; mehr empfänglich als erfinderisch; mehr gesellig als politisch; mehr für gewohnten Genuß als für neues Erschaffen; mehr tüchtig als groß.
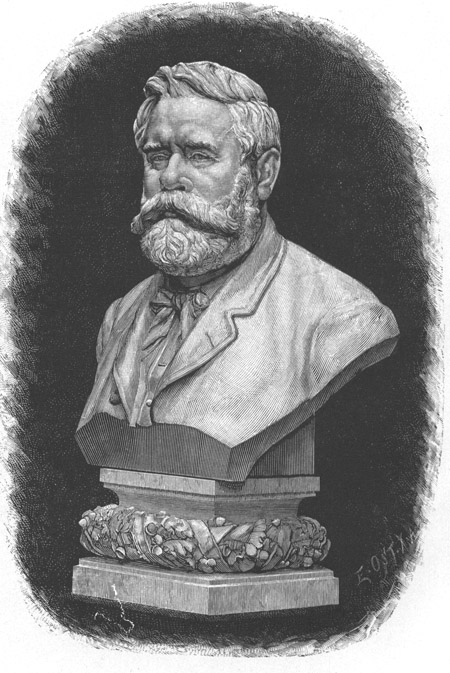
Doch was ist Größe? – Dieser genügsame, lebensfrohe Ackerbauer hat einige Eigenschaften, die, so oft die günstige Stunde schlägt, die rechte Mischung erfolgt, zur Größe werden. Der Mecklenburger ist vielleicht der bescheidenste Menschenschlag auf dieser Erde; bescheiden, weil er ohne vordringende Eitelkeit, weil er einsichtig, gerecht ist. Er hat eine kindlich warme, männlich treue Liebe zu seinem Beruf; eine Liebe, die der wunderbaren Unverdorbenheit seines Charakters entquillt. Er hat endlich noch eins, das ihm Tiefsinn, Kunstgenie, leidenschaftliche Thatkraft ersetzt, das ihm die Erde so lieb und ihn auf der Erde so liebenswürdig macht: einen lachenden, herzlichen, goldenen Humor. Mit jenen andern Eigenschaften konnte – unter preußischer Zucht – ein volkstümlicher Held wie Blücher, ein klaräugiger Schlachtendenker wie Moltke entstehn; mit dieser letzten gelang es der mecklenburgischen »Ackerkrume«, uns in Fritz Reuter den größten deutschen Humoristen des Jahrhunderts zu geben.
Die kleine Stadt Stavenhagen, in der Fritz Reuter am 7. November 1810 zur Welt kam, liegt in Mecklenburg-Schwerin, doch unweit der preußischen Grenze; vom Stavenhagener Kirchturm sieht man nach Norden, Westen und Osten in pommersches Land hinein. Dennoch wuchs der Knabe ganz in mecklenburgischer Luft, Gesinnung und Empfindung heran; denn die Welt des »Stemhäger Börgers« ging damals kaum über das Weichbild der Stadt hinaus. Noch gab es keine Kunststraßen, die ihn mit seinen Nachbarn verbanden; was man Wege nannte, waren lebensgefährliche Abwechselungen von Berg, Thal und See; die langen Winter hindurch kam oder ging kaum ein Mensch. Man nahm das hin, denn es war so; man lebte um so mehr mit seinem Wandnachbar, seinem Gegenüber, seinem Gesinde, und das kleine Stückchen von der Welt, das man überblickte, sog man denn auch mit Neugier und Anteil, mit Haß und Liebe ganz in sich auf. Der Sturm der Befreiungskriege unterbrach diesen Kleinstädtertraum; das tapfere Mecklenburger Blut nahm und gab seinen Anteil an Not, Krieg und Sieg; dann erzählte man sich Jahre lang von dem, was man erlebt hatte, und die Jungen auf der Straße spielten »Napoleon auf der Insel Elba« und »die Schlacht bei Leipzig«; dann sank man wieder in den behaglichen Winterschlaf des Provinzlebens zurück. Das sonderbare Gemisch von patriarchalischem Absolutismus und Feudal-Aristokratie, das diesen Winterschlaf bewachte und zuweilen wie ein Alp, oder »Mort«, auf ihn niederdrückte, ertrug man mit ähnlichem Gleichmut, wie man die schlechten Wege ertrug; noch hatte man nicht vom Baum der politischen Erkenntnis gegessen; und die Regierer waren Mecklenburger wie die Regierten, auch sie waren der Regel nach gutmütige, gemütliche Tyrannen, auch sie »nahmen es nicht so schwer«. Wie jener Rostocker Nachtwächter, von dem Julius Wiggers in seinem Buch »Vierundvierzig Monate Untersuchungshaft« erzählt – der gegen einen polizeiwidrigen Raucher einzuschreiten mit der Entschuldigung ablehnte: »Seggt man wat, so is glik de Spittakel (der Lärm) im Gang« – so war wohl ungefähr der Geist dieser patriarchalischen Regierung überhaupt; gefördert durch den Charakter des regierenden Herrn, Friedrich Franz des Ersten, in dem alle liebenswürdigen Eigenschaften des Mecklenburgers der absolutistischen Denkart seiner Zeit das Gleichgewicht hielten.
Was war das Stavenhagen von damals? – Fritz Reuter hat es in seiner herzlich-anschaulichen Art in »Schurr-Murr« geschildert. Die kleine Ackerbürger-Stadt, deren einzige »Romantik« das alte Schloß auf dem Hügel, der Wohnsitz seines Paten, des unsterblich gewordenen Amtshauptmanns Weber, und unten auf dem Marktplatz der alte Pranger oder »Kaak« mit seinem unheimlichen Halseisenschmuck und seinen ernsten Kettenguirlanden war; auf deren Kirchenplatz man noch in Fritz Reuters Knabenzeit die Toten begrub; eine Stadt ohne Konditor, ohne Stadtmusikus, ohne »Königsschüsse«, nur von Zeit zu Zeit durch einen jüdischen Hausierer, noch seltener durch einen Jahrmarkt belebt; eine Stadt, in deren »Becker-Schule« man bis in die Fibel, in der »Küster-Schule« bis in den Katechismus, in der »Rektor-Schule« bis in die Bibel und das mecklenburgische Gesangbuch kam: diese gute Stadt war vierzehn Jahre lang der Umkreis, in dem er »ward«. Doch mit was für Augen er – damals ein zartes, ein »knendlich« Kind – seine Welt betrachtete, zeigt sein erster schriftstellerischer Versuch, die Schilderung seiner Reise nach Braunschweig. Als Reuters Vater, der Bürgermeister und Stadtrichter von Stavenhagen, eine dreiwöchentliche Reise ins Ausland unternahm, um – als aufstrebender, thätiger Landwirt und Neuerer, der er war – sich über diesen und jenen Betrieb zu unterrichten, nahm er seinen zwölfjährigen Knaben unter der Bedingung mit, daß er auf alles wohl acht gebe und nach der Rückkehr seine Erlebnisse und Beobachtungen für den Amtshauptmann, seinen Paten, niederschreibe. Die Bedingung ward erfüllt; er schrieb ein kleines Buch mit höchst sauberer, großer, weitläufiger Schrift, und der zwölfjährige Knabe zeigt schon in seiner sicheren Beobachtung, seinem treffenden Ausdruck, seinem neckischen Humor den zukünftigen Mann. Diese Entwickelung zu fördern, waren die Elemente in seiner nächsten Umgebung nicht ungünstig gemischt. Die Mutter zwar kränkelte, so lange sie noch lebte, in Folge einer schweren Krankheit gelähmt; »ich habe sie nicht anders gekannt«, sagt er in der »Franzosentid«, »als daß sie in ihren guten Zeiten auf einem Stuhl saß und nähte, so fleißig, so fleißig, als wären ihre armen schwachen Hände gesund, und daß sie in ihren schlimmen Zeiten zu Bett lag und unter Schmerzen Bücher (erbauende und poetische Bücher) las«. Doch sie hatte »einen sehr beweglichen Geist und eine lebendige Phantasie«; sie begeisterte ihren Knaben früh für die großen Dichter deutscher Nation; – und aus diesen seinen eigenen Mitteilungen muß man vermuten, daß ihm durch der Mutter Blut hindurch seine dichterische Begabung zufloß: denn vom Vater hat er nur Intelligenz und Charakter erben können. Nicht aus dem Blut, aber aus der geistigen Einwirkung kam dem Knaben viel vom » Onkel Herse« zu, in dessen buntscheckiger und kindlich ausschweifender Phantasie etwas von der poetischen Lebenskraft spukte, die in dem Bürgermeistersohn Fleisch und Blut werden sollte. Die »embryonische Genialität« dieses Ratsherrn Herse – der übrigens nur ein sogenannter Onkel war – lernt man nicht aus der »Franzosentid«, aber aus »Meine Vaterstadt Stavenhagen« kennen. Denkt man sich den hohen, breiten, mächtig ausgepolsterten Mann, der eigentlich ein altes Kind ist; der denn auch von ganzem Herzen, als Allerweltsonkel, mit den Kindern lebt, sie die herrlichsten Spiele lehrt, ihnen die Drachen bemalt und über diese aufsteigenden »Medusengesichter« ebenso glücklich ist wie das kleine Volk; der alles weiß, alles kann, in dem die Kleinen blättern wie in ihrem Konversations-Lexikon; der seinen Zöglingen – Fritz darunter – die orthographische Stunde zur liebsten macht, weil er ihnen zu Gefallen Dichter wird und einen vollständigen Roman erfindet und diktiert; der sie bei sich daheim seiner alten Violine, im Wald dem Vogelgesang horchen, ihn nachempfinden, ihn ausdeuten lehrt: denkt man sich diesen »Onkel Herse«, so fühlt man, wie viel Fritz Reuter von dem Mann empfangen hat. »Hürt Ji woll, Jungs, sagte er, wenn er uns auf den Schnepfenfang mitnahm, und der Krammetsvogel beim Sonnenuntergang lustig in den Aesten der Bäume umhersprang und sein abgebrochenes Liedlein in den dunstigen Herbstabend herniedersang, – sei ropen mi orndlich. Hürt Ji woll: Ratsherr Hers' – kumm hir her! – kumm hir her! – Scheid mi dod! – Ick bün hir – wo's Grischow? – Wo's Grischow? – Scheit mi dod!« – Wem, wenn er Fritz Reuter dies erzählen hört, fällt nicht der Dichter des Hanne Nüte ein; und wer denkt nicht den stillen, verborgenen Wassern nach, die aus »der Jugend Land« auf den Acker unserer Erntejahre fließen.
Aus ganz anderem Holz war Reuters Vater geschnitzt; ein ernster, strenger, rastloser, charaktervoller, doch höchst unkindlicher Mensch; zum Beamten und Verwalter geboren (von 1805 bis 1845 hat er Stavenhagen regiert), in seiner nicht unbedeutenden Feldwirthschaft unternehmend wie wenige im Lande, der erste, der in Mecklenburg die bairische Bierbrauerei einführte, der erste, der »Handelsgewächse« zu bauen versuchte, und in den furchtbaren Not- und Armutsjahren, die den Kriegsjahren folgten, so sehr der Fürsorger für alle, daß, wie der Sohn erzählt, »in jenen gedrückten Zeiten in meiner Vaterstadt keine eigentliche Armut zu finden war.« Ihm lag denn auch vor allem am Herzen, seinen einzigen Sohn früh mit allen nützlichen Kenntnissen auszurüsten und zum Charakter zu bilden; für diese Erziehungszwecke ward weder Zeit, Geld, noch Mühe gespart. Aber er war offenbar den Musen und Grazien so fremd, wie der Vater eines Poeten selten gewesen sein wird; er hat offenbar die Eigenart seines Sohnes nie verstanden, er hat sie bekämpft und gehemmt. Nur ein gewisses Talent zum Zeichnen sagt der Sohn ihm nach; unter Riepenhausens Leitung hatte er in Göttingen tüchtige Kreidestudien gemacht. Dagegen hat er nach Fritz Reuters Meinung in seinem ganzen Leben keinen Roman gelesen; und vor allem war ihm die heitere, lebensfrohe Mecklenburger Art, der Humor seines Stammes versagt. Jedes ungewöhnliche, neue Vergnügen, das an den Knaben herantrat, die erste Tanzstunde, der erste »Maskenball«, der Besuch des Schauspiels oder der »Kemedi« im Rathaussaal, mußte dem heftigen Widerstreben des Vaters von der Mutter oder der Tante Christiane abgerungen werden; man apellierte an das Gutachten des alten Amtshauptmanns Weber, und diesem alltäglichen Gast in der behaglichen »Theestunde« fiel dann nicht selten die Entscheidung zu.
Fritz Reuter wuchs im Elternhause mit seiner Schwester Lisette und zwei Vettern (Ernst und August) auf; eine unverheiratete Schwester der Mutter, Tante Christiane, half das Hauswesen leiten und die Kinder erziehen. Von jenen öffentlichen sogenannten »Schulen« blieben Fritz und seine Gefährten fern; der Vater ließ sie zu Hause unterrichten, und mehr als ein Dutzend der »allerverschiedensten Lehrerkräfte, die Stavenhagen aufzuweisen hatte«, ward nach und nach auf diesem schwierigen Versuchsfelde verbraucht. Von seiner Mutter hatte der Knabe Lesen und Schreiben gelernt; dann kam er in das Fegefeuer einer Mädchenschule, bei Mamsell Schmidt, er der einzige Junge, »Eule unter Krähen«, wie er selber erzählt, und mit seinem »noch sehr schwächlichen Mannesmut« unter diesen »kleinen gebildeten Megären«, die ihn beständig schurigelten und befehdeten, ein unglücklicher Mensch. Eine Weile ließ man ihn dann von einem Schneidergesellen, der sieben Jahre in Paris gearbeitet hatte, ein etwas verunreintes Französisch lernen, bis dieser Meister Geselle von einem wirklichen Franzosen, dem Uhrmacher Droz aus Neufchatel, abgelöst ward, den jeder Leser der »Franzosentid« kennt. Geschichte und Lateinisch brachten ihm der Apotheker Fritz Sparmann, der Student Julius Caspar, der Rektor Schäfer (ein sächsisches Original) bei; der Geographie nahm sich der Vater selber an, noch abends nach Tische, nach allen Mühen seiner rastlosen Tage; für Schönschreiben, Orthographie, Rechnen und Zeichnen trat der gutmütig hilfreiche Onkel Herse ein, der, als ein eifriger Maler in Aquarell, Gouache, Öl und Email, die Knaben vermutlich auch gleich zum Malen verführt hätte, wäre nicht der Vater mit seinem Veto zur Hand gewesen. »Erst gehen und nachher tanzen, war seine Meinung (erzählt Fritz Reuter), und als ich ihm einmal einen in Rotstift und schwarzer Kreide nach meiner Meinung sehr schön ausgeführten Hund brachte und seiner Bewunderung schon gewiß war, fing er auf eine schreckliche Weise an, mit einem schwarzen Stifte in meine rote Couleur hineinzuarbeiten, so daß von dieser nichts mehr zu sehen, dafür aber auch die Zeichnung korrekt war – wie er sagte.«
Endlich schloß mit diesem bunten Durch- und Nacheinander von Lehrmeistern die Kinderzeit; ein salarierter candidatus theologiae ward als Lehrer ins Haus genommen, eine strenge Disciplin begann, und »mit starken Schritten ging es ins ernste Leben hinein«. Fritz Reuter war noch nicht fünfzehn Jahre alt, als die Mutter starb, die er innig liebte. Schon ein Jahr vorher, 1824, hatte sich der Vater entschlossen, ihn aus der häuslichen Erziehung weg auf das Gymnasium der kleinen Stadt Friedland zu schicken, die in Mecklenburg-Strelitz an der pommerschen Grenze liegt. Mehr als drei Jahre sollte er hier verleben; aus seiner Jugend die unbedeutendste und wohl auch unfroheste Zeit. Nie und nirgends erwähnt er ihrer mit einem gemütlichen Wort; er klagt nur einmal über das geistlose Auswendiglernen von Regeln, mit dem man ihm auf der Friedländer Schule die französische Sprache zu verleiden suchte. Auch klingt, bei allem Humor, wohl noch etwas »Ach und Weh« aus jener Zeit in der lebendigen Schilderung des Schullebens in »Dörchläuchting« nach, mit all seiner Lust und mit all seiner Roheit, die der vierzehnjährige Knabe nun erst kennen lernte. Er war überdies – den meisten seiner Kunstgenossen gleich – »nie ein sehr eifriger Besucher der Schule«, wie er in »Meine Vaterstadt Stavenhagen« bekennt; und dieses Unbehagen hat auch ihn bis in den Schlaf seiner späten Jahre verfolgt: in bösen Träumen »hatte er sich entweder nicht präpariert, oder irgend einer seiner vielen Lehrer hielt ihm ein schrecklich rot perlustriertes Exercitium unter die Nase, das er ihm dann schließlich um die Ohren schlug.«
Nur von einer glücklichen, festlichen Episode aus der Schulzeit weiß ich zu sagen; von einer Fußwanderung nach der Insel Rügen, die er viele Jahre später, 1867, im »halben Mond« zu Eisenach, vor einer befreundeten Gesellschaft in einem schriftlichen, launigen Vortrag beschrieben hat. »Ich hatte«, erzählt er darin (das Ganze mitzuteilen, dazu ist es zu harmlos), »ich hatte meinem Vater einmal eine ziemlich gute Zensur vom Gymnasium zusenden können – was überall bei jedem Gymnasiasten sehr wünschenswert sein soll, bei mir es aber in Wirklichkeit sehr war – da griff dieser mein Vater in seine väterliche Tasche, holte drei Friedrichs'dor hervor und sandte sie mir mit dem Bedeuten, ich könne dafür eine Reise nach Rügen machen. Wer da weiß, welche Bedeutung das Wort »Rügen« in der Phantasie einer mecklenburgischen oder pommerschen Gymnasiasten-Seele zu der damaligen Zeit hatte, kann sich denken, wie sehr ich von wahren Freunden beglückwünscht und von unwahren beneidet wurde. Denn leider ist es schon in den ersten Lebensjahren so wie in den letzten: man muß diesen Unterschied schon machen.« Er zog denn also aus, bald in guter, bald in schlechter Gesellschaft, die er in seiner Unschuld nicht durchschaut; »rollt als rosenrote Caroline über das grüne Billardtuch der unabsehbaren Ebene von Schwedisch-Pommern«, kommt über Stralsund nach Rügen, landet, und steht nun auf der Insel, »der schönen Insel, dem Ziel meiner heißen Wünsche«. »Aber was nun? Ging ich rechts an der Ostküste entlang, dann hatte ich alles Schöne wie auf dem Präsentierteller: Bergen, Putbus, die Granitz, Saßnitz, und am Ende die Krone von Rügen, die Stubbenkammer; auf der Westseite, links, hatte ich verhältnismäßig langweilige Gegenden; da ich nun aber von Kindheit an ein sehr verständiger Junge gewesen bin und stets beim Butterbrot die schwach beschmierten Stellen zuerst und zuletzt erst die fetten Bissen verzehrt habe, so schlug ich den Weg links zur Westküste ein. – Ja, die Gegend war nur schwach; gut und sehr gut wohl für die Mark Brandenburg, für Rügen und meine Sehnsucht aber nur schwach, es war trocken Brot, und das bißchen durchsichtige Butter, was darüber geschmiert war, war das durchsichtige, blaue Meer zu meiner Linken.«
So wandert er denn allein dahin, den Butterstellen entgegen, und endlich an der schönsten Stelle erlebt er »einen Vorgeschmack der Zukunft«: er macht sein erstes Gedicht. Schon in Stavenhagen hatte er einen, aber, wie er (in »Meine Vaterstadt Stavenhagen«) versichert, nur einen Versuch gewagt, seinem einzigen ortsanwesenden Vorbild nachzueifern, der Frau Tiedten, die er »den ersten Dichter von Stavenhagen« nennt: »er war Schneiderwitwe und Nähterin, und wenn er dichtete, nähte sie, und wenn sie nähete, dichtete er«. Doch da jener Versuch verunglückte und er wahrnahm, daß »das Dichten eine wahre Pferdearbeit sei«, so genügte ihm, daß er auf der kleinen Bühne im Rathaussaal den »armen Poeten« spielen sah, um, unter furchtbarer Rührung (»ich habe geweint, als wenn mir Vater und Mutter gestorben wäre«), von einer so kummervollen Laufbahn aufs eindringlichste abgeschreckt zu werden. Nun aber steht er mitten auf Rügen, überschaut »das lieblichste Ländchen in Sommermorgen-Pracht, umgürtet vom sonnenbeglänzten Meer, in unendlicher Mannigfaltigkeit durch seine Buchten und Bodden und Wyken«; es übermannt ihn, er dichtet. Was für ein Gedicht? – Es existiert nicht mehr; es ist untergegangen; »1833 hat es die Untersuchungskommission auf der Hausvogtei, wie so manches Andre, aufgefressen. Es war ein sehr bedeutendes Gedicht; es hatte nur für die Leser einen kleinen Fehler, es litt an Überschwänglichkeiten; für den Leser gewiß ein Fehler, für den Poeten nicht«.
Doch kehren wir nach Friedland und zu des jungen Fritz Reuter Studien zurück; Studien, die schon damals den inneren Konflikt zwischen Vater und Sohn erzeugen sollten, der seitdem bis an des Alten Tod als dritter Mann zwischen ihnen einherging. Mehr als die andern »Wissenschaften« hatte Reuter in Friedland Geschichte, Geographie und Mathematik, mehr als diese sein besonders geliebtes Zeichnen betrieben; er rückte auf der Klassenleiter langsam vor, er glaubte sich zum Maler berufen und wünschte die Gelehrtenschule mit der Kunstschule zu vertauschen. Hier stieß sein harter Kopf auf den härteren des Vaters, der an seiner Begabung zweifeln mochte (und allerdings wohl mit Recht), und der vor allem seinen Plan durchsetzen wollte, den einzigen Sohn auch als Rechtsgelehrten, gleichsam als Fortsetzung seines eigenen Ich, auf Erden thätig zu sehn. Die gelehrte Laufbahn ward also fortgesetzt; doch nicht mehr in Friedland, das damals zwei seiner besten Lehrer verlor, sondern in Parchim, einer der Mittelstädte von Mecklenburg-Schwerin, deren neugeschaffenes Gymnasium eben jene Beiden – den Konrektor Gesellius und den nachmaligen Direktor Zehlicke – an sich zog und die übrigen Schulen des Landes zu überflügeln versuchte.
Ein harter Zwang sollte den Zweck dieser »Versetzung« fördern helfen: der Unterricht im Zeichnen ward dem Sohn hier versagt, er sollte sich einzig auf die hohe Schule vorbereiten. Dennoch war Reuter hier glücklich; in einem späteren Brief an seinen Freund Fritz Peters nennt er die Jahre, die er in Parchim verlebte, den »schönsten Abschnitt seiner Jugendzeit«. Bei seinen Lehrern fand er Anregung und Wohlwollen; im Hause seines Pensionsvaters, des Direktors Zehlicke, wie in dem des Konrektors Gesellius, herzliches Familienleben und dauernde Freundschaft; endlich am runden Theetisch der »Frau Hofrätin« seine Adelheid. Er war im beginnenden Jünglingsalter, als er nach Parchim kam; die Natur konnte also von ihm verlangen, daß er sich verliebte. Doch in jenen Jahren wendet sich unser Herz, vom elementaren Frühlingswind getrieben und mit seinen wächsernen Flügeln ein steuerloser Ikarus, mehr an die Gattung als an das einzelne Ich; und die neuen Gefühle, die wir erleben, sind für die Geschichte unsrer Seele wichtiger als der Magnet, der sie in uns erregte. Eine Jugendliebe dieser Art war offenbar auch die »Flamme«, die des Hofrats Töchterlein in Fritz Reuter entzündete, indem sie ihm Thee einschenkte; sie hieß Adelheid, er besang sie, und sie ward nicht seine Frau. Wenige zerstreute Andeutungen in der »Festungstid«, im »gräflichen Geburtstag« zielen darauf hin: wenn er erzählt, daß er »auch einmal eine schöne blaue Schleife von einem schönen blonden Kopf unter der Weste trug«; daß er zur Zeit seiner ersten Liebe den Mond »vielfach kultivierte, ja sogar mit sentimentalen Gedichten inkommodierte«. In dem hochdeutschen Vorläufer der »Festungstid«, der (1855) in Fritz Reuters »Unterhaltungsblatt« erschien: »eine heitere Episode aus einer traurigen Zeit«, bekennt er seinem Kameraden, dem »Kapitän«: »Ich habe, wenn auch ohne viel Glück, doch schon Versuche in der Liebe gemacht. Auf der Schule zumal ...« Und später: »Ich habe einmal einen guten Freund gehabt, den ich beinahe so gut kenne, wie mich selbst, – ich sage dir – das arme Geschöpf hat einmal in einer Nacht, so um diese Zeit des Jahres [Winter] herum, unter Sturm und Regen in vollem Ballstaat mit schwarzen baumwollenen Strümpfen und einem Operngucker, in den dornigen Zweigen eines jungen Pflaumenbaumes drei Stunden lang gesessen, bloß um sich aus einer Entfernung von zweihundert Ruten an dem Nachtlichte aus dem Fenster seiner Geliebten satt zu sehen.« Indes die humoristischen Verzierungen, mit denen er dieses nächtliche Abenteuer seines eigenen Ich in der »Festungstid« (S. 244) weiter ausgeführt hat, und die handgreiflichen Widersprüche zwischen beiden Berichten bestätigen, was sich ohnehin bei jeder sorgfältigen Untersuchung seiner Schriften ergiebt: daß er, mit dem Recht des humoristischen Erzählers, in seinen Rückblicken fast immer Dichtung und Wahrheit mischt. Und so bleibt nur unzweifelhaft bestehen: er liebte sie, er besang sie, und sie ward nicht seine Frau.
Auch nachdem er die Schule verlassen und die Schwelle der Rostocker Universität überschritten hatte, fuhr er freilich noch fort, sich an dieser Flamme zu wärmen; zwei Musen halfen ihm: denn auch die heimlich fortbetriebene »schwarze Kunst« des Zeichnens zauberte ihm die entfernte Geliebte wenigstens aufs Papier. Julius Wiggers, mit dem er sich damals befreundete, besitzt noch ein Bildnis von ihr in schwarzer Kreide, das der junge Student aus dem Gedächtnis zeichnete und bei seinem Abgang von Rostock ihm als Andenken zurückließ. Hierher, an die Landes-Universität, hatte ihn der Wille des Vaters im Herbst 1831 geschickt; hier begann er, als schon fast einundzwanzigjähriger »Fuchs«, das ihm aufgenötigte Studium der Rechtswissenschaft. »Die Seestadt Rostock«, erzählt er selbst (am Anfang der »Reis' nah Konstantinopel«), »ist der ›Up- und Dal-Sprung‹ für jeden richtigen Mecklenburger. Auch mein Aufsprung ist sie einmal gewesen, als ich von den großen Schulen eine Sprosse höher auf die Universität hüpfte; doch das ist schon lange her, und wir wissen uns nicht mehr recht darauf zu besinnen, vor allem nicht auf Professor Elvers' Institutionen. Aber das weiß ich noch, daß wir Studenten ein kreuzfideles Leben führten, daß wir uns bei nachtschlafender Zeit mit den »Krebsen« herumjagten, diesen alten braven städtischen Kriegsknechten, und daß wir Fenster einwarfen. Wir lösten die große sociale Frage und stifteten eine »Allgemeinheit« unter uns, die die Konstantisten und Vandalen schändlicherweise die »Gemeinheit« nannten. Wir lösten noch andere sehr wichtige Fragen, wenn wir in unsern Kränzchen beisammensaßen, zum Beispiel auf meiner Stube die wichtige Frage: »Was ist die Ehre?« wurden aber nicht so bald darüber schlüssig, wie Sir John; aber mir zogen sie dabei einen Backzahn aus, denn als meine allgemeinen Freunde von mir gingen, hatte ich als Fuchs »die Ehre«, die Zeche zu bezahlen.«
Schon nach einem Semester verließ er Rostock, um nach Jena zu gehen; an diesen Sitz der jugendlich vaterländischen Gefühle, der burschenschaftlichen Gährung, die für Fritz Reuters Leben so verhängnisvoll ward. Will man die edle Tollheit dieser Studenten-Verschwörung und die vernunftlose Wut ihrer Verfolger verstehn, so vergegenwärtige man sich den verbitternden, blutvergiftenden Übergangs-Charakter der Zeit: da die deutsche Jugend zugleich gegen die Misere des vielköpfigen deutschen Bundes und gegen den überlebten Absolutismus der deutschen Großmächte, der Absolutismus aber – mit der argwöhnischen Reizbarkeit eines greisenhaften Herrschers – um sein Dasein kämpfte. Die »allgemeine deutsche Burschenschaft«, aufgekeimt aus dem vaterländischen Idealismus, den der große Befreiungskrieg ausgesäet hatte, auf dem Wartburgfest 1817 als fester Organismus begründet, nach der Ermordung Kotzebues durch einen ehemaligen Burschenschafter feierlich unterdrückt, heimlich fortwuchernd allen Verboten zum Trotz, bis sie sich endlich 1827 wieder neu zu organisieren, sich neue Ziele aufzurichten begann, war, als Fritz Reuter um Ostern 1832 nach Jena kam, schon auf die Höhe ihrer politischen Entwickelung gelangt; und allerdings muß man sagen, daß ihrer idealen Gesinnung ein hochroter Tropfen revolutionären Blutes beigemischt war. Auf den »Burschentagen« von 1827 an hatte die unternehmendere Partei der Germanen gegen die friedlichere der Arminen gekämpft und den Sieg gewonnen; auf dem Frankfurter Burschentag im September 1831 hatte sie diesen Sieg formuliert. Es galt bisher als Tendenz der Burschenschaft: »Vorbereitung zur Herbeiführung eines frei und gerecht geordneten und in Volkseinheit gesicherten Staatslebens mittelst sittlicher, wissenschaftlicher und körperlicher Ausbildung auf der Hochschule«; nach langer Beratung war in Frankfurt der verhängnisvolle Zusatz beschlossen worden: »Im Falle eines Aufstandes solle unter Umständen jeder Burschenschafter verpflichtet sein, selbst mit Gewalt den Verbindungszweck zu erstreben, und sei deshalb zur Teilnahme an Volksaufständen gehalten, die zur Erreichung desselben führen könnten.«
In diese gärende Jugend trat nun Fritz Reuter ein; jung wie sie, mit seinem warmen Drang nach Begeisterung und Befreiung, mit seiner kernigen, ausgeturnten Gestalt; man wird sich nicht verwundern, daß er sich zu den Unternehmenden gesellte. Im Januar 1832 hatte zwar ein Fest, das man durchziehenden polnischen Flüchtlingen (darunter Dombrowski) gab, die Arminen und die Germanen noch einmal mit einander versöhnt; sie saßen und tranken wieder beisammen in dem alten Burschenhaus, dem »Burgkeller«, und gaben gemeinsam dem alten Dichterfürsten, Goethe, zur Weimarer Fürstengruft das letzte Geleit. Indessen die politische Erregung der jungen Köpfe ward von außen – von unten und von oben – genährt. Das Hambacher Fest am 27. Mai 1832, auf dem man die »vereinigten Freistaaten Deutschlands« und das »conföderierte republikanische Europa« mit Hochrufen begrüßte, rief neuen Unwillen der Regierungen und schon am 28. Juni reaktionäre Bundesbeschlüsse hervor. Sollte man diese Bedrückung ruhig ertragen, und mit den sanftblütigen Arminen sich am Kopfschütteln, Singen, Kollegienhören und »sittlicher Ausbildung« ein Genüge thun? Mit diesen »Gemütlichen«, auf die das Spottlied gedichtet war:
'S giebt nichts Gemütlichers,
Als die Gemütlichkeit!
Kneipen und Singen
In stiller Zufriedenheit,
Kneipen und Singen
Fern von den Klingen,
Das ist gescheit!
Die Verbrüderung war unhaltbar; im Sommer 1832 brach der Krieg zwischen Germanen und Arminen wieder aus. Die Germanen wanderten vom »Burgkeller« in den »Fürstenkeller« aus, und Fritz Reuter mit ihnen.
Daß dieses unruhige Treiben, aus politischer Erhitzung und studentischer Kraftlaune gemischt, dem Studium der Rechtswissenschaft nicht zu gute kam, sagt Jeder sich selbst. Zwar gehörte Fritz Reuter nicht zu den Feuerköpfen, nicht zu den Eiferern; nie ward er (wie er später aus der Gefangenschaft an seinen Vater schrieb) von seinen Genossen mit einer politischen Mission betraut, nie hat er dergleichen »privatim ausgerichtet«. Sein mecklenburgisches Temperament, sein gemütlicher Humor stellten ihn zu denen, die über dem Burschen-Haß die Burschen-Lust nicht vergaßen. Ein Jenenser Student, sagt er später (in der »Festungstid«) in seiner heiteren Selbstverspottung, war für die menschliche Gesellschaft »en sihr unverdaulichen Happen«; er schildert sich (in der Vorrede zur Reis' nah Belligen) als »einen mageren, lang aufgeschossenen Burschen mit langem Halse und langem Haar (wobei man freilich dem langen Hals die humoristische Verlängerung wieder abziehen muß), bedeckt mit einer schwarz-rot-gold verbrämten Mütze; in der Hand trug er einen Ziegenhainer und hatte in seinem Wesen etwas Antediluvianisches, jetzt Untergegangenes«. Doch dieser noch magere, noch vorsündflutliche Kraftmensch war jeder Lust gewachsen: auf der Mensur (denn die Germanen waren eifrige Duellanten), auf dem Markt, wo sie mit ihren Stoßdegen fochten, als wären sie da zu Haus, beim Bier und beim Gesang. Es existiert eine »Ballade«, die er dem bekannten alten Bierschenken »Samiel« auf der Rudelsburg zu Liebe dichtete und dort ins Fremdenbuch schrieb; jugendlich unfertig als Gedicht, aber durch ihre humoristische Spitze und durch ihr Schicksal der Erwähnung wert. »Der Burggeist auf der Rudelsburg« war sie betitelt: ein wilder Ritter hat dort vor Zeiten gehaust, allen Menschen feind; aus Neid auf seinen Schenken und dessen stattlichen Bart, mit dem seine eigene Oberlippe sich nicht messen kann, stößt er ihm sein Schwert durch den Leib. Da richtet noch einmal der sterbende Schenke sich auf:
»Du hast mich zwar getötet in schnödem Übermut,
Doch nimmer wird's Dir gehen auf Erden wieder gut;
Du wirst Dich nicht mehr freuen am wilden Schlachtgeschrei,
Es steht ein krankes Jahr nur zu leben Dir noch frei.
»Und wenn Du dann gestorben, so eilt dein Geist nicht fort,
Der stolze Ritter bleibet als Schenk an diesem Ort.
Vom Bier, das Du getrunken, trinkst Du dann nimmermehr,
Es trinken die
Studenten dann Deine Fässer leer.
»Und diesen mußt Du dienen und hören auf ihr Wort,
So lange Schenke bleiben, als dauert dieser Ort.
Zur Warnung aller Herren, die stolz wie Du und hart,
Sollst
Samiel Du heißen und tragen einen Bart.«
Ich hab' Euch jetzt erzählet die Mär so wunderbar;
Ihr könnt sie sicher glauben, sie ist gewißlich wahr.
Wer sie von Euch nicht glaubet, der ruf' nur »
Samiel!«
Dann kommt er mit dem Humpen und mit dem Bart zur Stell'.
Diese Ballade ist im »Gedenkbuch der Rudelsburg« (herausgegeben von J. Stangenberger) abgedruckt; nach Fritz Reuters Tode suchte die Witwe das Buch unter seinen Papieren, doch da sie es nicht fand, übernahm der Sohn eines Freundes, auf der Rudelsburg selber nachzuforschen. Auch dort fand sich das Gedenkbuch nicht; die alten Fremdenbücher waren längst verbrannt. Aber Samiels Tochter, die jetzige Wirtin der Rudelsburg, half aus dieser Not. Sie wußte die Ballade noch auswendig; sie diktierte sie dem jungen Mann, und vollkommen getreu, wie das nun aufgefundene Gedenkbuch beweist.
Singende, dichtende, ahnungslose Jugend! – Der in Wahrheit ungefährliche Zorn und Trotz, mit dem diese lebensfrohen Jünglinge ihre Lieder gegen die Fürsten sangen, ihre Umwälzungsgedanken besprachen, ihre Widersacher unter den Kommilitonen mit Schlägern und Ziegenhainern zu widerlegen suchten, – er sollte furchtbar empfinden, wie ernst der Kampf politischer Mächte ist. Ein blutiges Vorspiel, das sie selber unter einander aufführten, schien zwar der ganzen »Verschwörung«, und mit ihr der Gefahr, schon ein Ende zu machen. Die Reibungen zwischen Germanen und Arminen arteten im Januar 1833 in wilde, erbitterte Schlägereien aus; ein starkes Militärkommando der weimarischen »Laubfrösche« rückte in Jena ein, man verhaftete, relegierte, gab scharfe Verbote aus: das Führen von Stockdegen und anderen Waffen, das Beherbergen fremder Studenten, das Tragen von Farbenbändern und Kokarden außer den Landesfarben, endlich studentische Vereine mit politischen Tendenzen seien nicht länger zu dulden. Die Germanen wie die Arminen lösten sich auf. Fritz Reuter »trat freiwillig aus«, wie er später schreibt, entwich im Februar in das nahe Städtchen Camburg im Herzogtum Sachsen-Meiningen, und kehrte im Frühling 1833 ins Vaterhaus nach Stavenhagen zurück. Inzwischen aber ereignete sich, was ihn und so viele andere ohne Mitschuld verderben sollte: das sogenannte Frankfurter Attentat.
Ein wunderbares Unternehmen: ein kleiner Haufe junger Männer zu Frankfurt am Main, von wenigen mitverschworenen und dorthin beschiedenen Studenten, von noch wenigeren auswärtigen Demagogen, endlich von den Bauern des Frankfurter Fleckens Bonames unterstützt, stürmen (am Abend des 3. Juli 1833) – und zwar obwohl man sie benachrichtigt, daß ihr Anschlag schon verraten ist – stürmen die Hauptwache und die Constablerwache der Stadt Frankfurt, überrumpeln die Wachmannschaften, und fordern die zusammenlaufende Menge auf, sich ihrer unbekannten Sache, ihren unbekannten Personen anzuschließen. Man läßt sie allein; der Angriff der alarmierten Truppen erfolgt; Widerstand, Gefecht, Verwundungen und Tote, endlich Flucht der Verschworenen nach allen Seiten. Doch nicht alle entkommen; bei den Verhafteten spürt man die Fäden auf, die nach andern Orten, zumal nach mehreren Universitäten laufen: teilweise Mitwissenschaft, unbestimmte Verabredungen, theoretische Zustimmung. Auf dem letzten Burschentag zu Tübingen, wenige Monate vorher – den indessen nur sechs Abgeordnete ebenso vieler Hochschulen besucht hatten – war überdies ausgesprochen worden: »die allgemeine deutsche Burschenschaft solle ihren Zweck, Einheit und Freiheit Deutschlands, auf dem Wege der Revolution erstreben und deshalb dem Vaterlandsverein zu Frankfurt sich anschließen.« Diese Thatsachen genügen den gereizten Regierungen, den geängsteten Fürsten, den verbrechenwitternden Spürtalenten. Eine wahnsinnige Verfolgung beginnt. Nicht nur sämtliche Theilnehmer der allgemeinen deutschen Burschenschaft – obwohl doch nur einzelne der Gesinnung jenes Attentates mit Worten zugestimmt hatten – auch die Mitglieder anderer, unpolitischer, in jedem Sinn unbeteiligter Studenten-Vereine werden verhaftet, festgehalten, durch unwürdige Inquirenten-Künste zu Mitschuldigen gemacht. Eine »Zentraluntersuchungsbehörde«, im Juni desselben Jahres vom Bundestag eingesetzt, soll all diese Untersuchungen im Zusammenhang auffassen; als hätte sich schon ein Netz des Verderbens über Deutschland gebreitet. Weit über tausend junge »Verbrecher« werden nach und nach von den langen, ausdauernden Armen dieser Verfolgung ergriffen; endlich auch Fritz Reuter.
Frühling, Sommer und Herbst hatte er daheim in Mecklenburg in aller Stille verbracht; die Regierung seines Landes hatte ihn unangetastet gelassen; er mochte glauben, daß nun auch auswärts, wenigstens in Preußen, das über ihn kein Recht hatte, nichts mehr für ihn zu fürchten sei. Nachdem er in Berlin und Leipzig um seine Immatrikulation nachgesucht hatte, aber als ehemaliger Jenenser zurückgewiesen worden, kam er auf der Heimreise, in den letzten Tagen des Oktober (zum zweitenmal) nach Berlin. Am einunddreißigsten sah er sich verhaftet. Der Großstaat Preußen kümmerte sich um seine Eigenschaft als »Ausländer«, als Mecklenburger nicht. Die Macht entschied; die Macht, die in diesem ganzen Prozeß – wie in den meisten politischen Prozessen – das Recht nach sich färbte.
Wer Reuters »Festungstid« kennt, kennt seinen Anteil an diesem schmachvollen Unglück, das die deutschen Regierungen und mit ihnen das deutsche Volk entwürdigte; – denn wie sehr er auch, in bewundernswerter, vergessender Seelengüte, sein Elend später verklärt und »von den Disteln Feigen gepflückt« hat, die wahnsinnige Härte dieser Verfolgung schildert er treu und beredt genug. Nichts ist grausamer als die Furcht. Der Justizminister Kamptz, der Inquirent »Onkel Dambach«, der Referent, Herr von Tzschoppe, der dann dem Wahnsinn verfiel, der Präsident des Kammergerichts, der »blutige« Kleist – furchtsame und furchtbare Menschen vereinigten sich, diesen Prozeß zur Zufriedenheit eines künstlich verblendeten Monarchen und eines schwindsüchtigen, um jeden Preis leben wollenden Staatenbundes zur Staatsgefahr aufzublasen. Stammbuchblätter, die von »Freiheit« sprachen, wurden zu Zeugnissen für Schuld und Mitschuld; man inquirierte in die unerfahrenen Jünglinge hinein, was nicht in ihnen war; man schmiedete die Schwächeren unter ihnen zu Denuncianten um, denen man die Namen neuer Mitschuldiger – ehemaliger Burschenschafter aus längstvergangener Zeit – entlockte. Fritz Reuter, zuerst auf der Stadtvogtei, dann auf der Hausvogtei in härtester Untersuchungshaft gehalten, wird von seiner Landesregierung reklamiert; man liefert ihn nicht aus. Man versagt ihm Feder und Tinte; aus seinem hölzernen Fußboden schneidet er sich einen Spahn, aus diesem Spahn macht er sich eine Schreibfeder, und mit einer »Tusche«, die er aus gebrannten Wallnußschalen erzeugt, schreibt er »schlechte Gedichte«, in denen sein Grimm, seine Verzweiflung sich entladet, schreibt er Byronsche Gedichte aus dem Gedächtnis auf, um die Stunden zu füllen. Jene eignen Ergüsse existieren nicht mehr; Byrons »Tochter Jephthas«, mit diesem Kienspahn in blasser Schrift auf vergilbtes Papier gebracht und mit an den Rand gezeichneten Philisterköpfen geziert, hab' ich vor Augen, da ich dieses schreibe. Ein volles Jahr geht dahin; noch erfolgt kein Urteil. Man schafft ihn nach Silberberg in Schlesien fort; »lassen Sie sich immerhin auf die Festung abführen«, sagt ihm Dambach, der Inquirent, »Sie müssen entschieden in Ihr Vaterland ausgeliefert werden.« Am 15. November 1834 verläßt er Berlin, wird als Verbrecher von Ort zu Ort durch den harten Winter geschleppt, lernt das Elend einer düsteren Kasematte kennen, die sein Augenlicht schwächt; das Jahr 1835 endet, 1836 vergeht, der Tag seiner Verhaftung jährt sich zum dritten Mal; man liefert ihn nicht aus, und kein Erkenntnis kommt. Drei volle Jahre seiner blühendsten Jugend sind schon, in Elend und Verzweiflung, dahin, und noch kein Erkenntnis!
»Mein lieber Vater!« schreibt er aus Silberberg am 31. Oktober 1836, »wenn ich dem obigen Dato fluchen sollte, so wäre es mir wenigstens zu verzeihen, und ich würde es thun, wenn ich nicht bedächte, daß der Tag, der mich vor drei Jahren in den Kerker warf, vielleicht eine Menge von Menschen beglückte; mich hat er namenlos unglücklich gemacht, er hat mir Gesundheit und Lebensglück und – was noch schlimmer ist – auch Lebensmut geraubt. Darum bitte ich Dich herzlich, laß Deinen Bestrebungen, mir die Freiheit zu verschaffen, nur noch einen letzten Versuch folgen, und dann höre auf, Deine Zeit und Dein Gemüt mit einer Chimäre zu plagen, die ebenso fabelhaft und monströs ist wie die der Mythologie. Ich bin auf dem Wege, mir einen passiven Mut zu verschaffen, dessen Höhepunkt völlige Apathie sein wird, und wenn dies Bestreben für einen Menschen, der im Genusse seiner Freiheit ist, etwas Schreckliches oder gar Sündliches enthält, so ist es für einen Gefangenen nicht allein zuträglich, sondern – wie ich glaube – mit der Moral völlig übereinstimmend, wenigstens für einen Gefangenen meiner Klasse.
»Um Dich aber in den Stand zu setzen, diesen letzten Versuch zu machen, so will ich Dir – so gut es geht – alle möglichen Materialien zusammengefaßt kurz angeben. Die Mecklenburger sind zu zwei Jahren verurteilt, aber in Preußen ist es anders. Gleich nach unserer Abführung nach Silberberg fragte Bohl bei seinem Vertheidiger an: wie das Urteil wohl lauten könne, und erhielt zur Antwort: zwei von den Greifswaldern würden wahrscheinlich zum Tode verurteilt, er selbst zu dreißig Jahren, die andern zu fünfundzwanzig und fünfzehn. Die Jenenser sind nun vielleicht noch ärger inculpiert, und so komme ich zu dem Schlusse, daß ich wohl ihr Geschick teilen werde; übrigens bin ich vielleicht weniger oder doch nur ebenso stark beteiligt wie die übrigen Mecklenburger. Fast perpetuierliche Sprecher in der Verbindung waren von der Hude in Lübeck und Frank in Neu-Strelitz (ersterer ist, so viel ich weiß, gar nicht bestraft, und der andere mit einem halben Jahr Arrest); im Vorstande haben viele gesessen, ich aber nicht ... Unsere Absichten waren auf keinen bestimmten Staat gerichtet, sondern auf alle Staaten in Deutschland ... Ich bin der einzige Ausländer in Preußen, der verhaftet ist, ohne in Preußen studiert zu haben ... Sollte nun der neueste Bundestagsbeschluß in Anwendung gebracht werden, so habe ich keine Hoffnung zur Auslieferung, was aber wohl einen alten Rechtsgrundsatz umstoßen heißt, und was natürlich eine unüberwindliche Bitterkeit in meinem Herzen zurücklassen muß.
»... Und nun noch einmal die Bitte: schlägt dieser Versuch fehl, so lass' es gehn, wie es geht, es wäre unrecht gegen Dich selbst und gegen die Schwestern gehandelt, wenn Du Deine Kräfte auf eine hoffnungslose Sache verwenden wolltest, und die, wenn sie gelänge, Dir nur einen Schatten von Deinem früheren Sohn zurückbringen würde.
»Schreib' mir Neuigkeiten fernerhin von unserer Familie, ich werde Dir darauf antworten, und Dein, sowie ihr Andenken wird die einzige Freude für mich sein. Unser Erkenntnis wird hoffentlich künftiges Jahr erscheinen, da wird sich ja vieles lösen und aufklären. – Am siebenten kommenden Monats ist mein Geburtstag (der vierte im Gefängniß), ich werde dann freundlich an Euch denken und an die vielen kleinen Beweise von Liebe, die ich in den Jahren der Kindheit von Euch erfuhr, die gewiß mehr wert sind als alle die schönen Versprechungen, die ich Dir an diesem Tage gemacht habe, und von denen so wenige verwirklicht sind.«
In der That zeigt dieser herzbeklemmende Brief, daß der sechsundzwanzigjährige Jüngling, der ihn schrieb, von jenem Höhepunkt »völliger Apathie« damals nicht fern war. Doch wenn er sich verloren glaubte, war es zu verwundern? Nutzlos war und blieb, was der Vater für ihn versuchte. Dreimal verlangte die mecklenburgische Regierung seine Auslieferung; dreimal ward sie verweigert. Endlich kommt das Urteil: das königliche Kammergericht, den Sophismen seines Referenten folgend, erkennt auf Versuch des Hochverrats, und 39 von 204 Angeklagten werden – zum Tode verurteilt; der Mecklenburger Fritz Reuter mit ihnen. Todesurteil, weil man die deutschen Farben trug und an zukünftige Aufstände dachte! – Friedrich Wilhelm III. verändert die Strafe »kraft oberstrichterlicher Gewalt«: vier dieser Unglücklichen sollen auf Lebenszeit, die andern dreißig Jahre in Festungshaft büßen; unter diesen andern Fritz Reuter. Dreißig Jahre lang; also lebendiger Tod!
»Ihr müßt bald frei kommen«, sagt ihnen zwar jedermann. Die Verteidiger sagen es ihnen, die Gerichtspersonen, die Eltern; »ihr müßt ja bald frei kommen – appelliert nicht – versucht nicht zu entfliehen –: die Gnade des Königs!« Falsche Hoffnungen, falsche Verheißungen; der König begnadigt sie nicht. Von Festung zu Festung wird Fritz Reuter durch das Land geschleppt, das kein Recht über ihn hat; im Februar 1837 von Silberberg – der geschwächten Augen wegen – nach Glogau (wo ihn, den der Welt Entwöhnten, selbst der Anblick eines Leichenwagens erfreut), sechs Wochen später von Glogau nach Magdeburg, – widerrechtlich, statt auf die Festung, ins Inquisitoriat, und unter die Herrschaft eines Kommandanten (des Grafen Hacke), der alles thut, was er vermag, um diese unglücklichen, gebrochenen, zum Theil schon ergrauten Jünglinge durch erfinderische Härte, durch Entziehung von »Luft, Licht und Wärme« (wie später durch eine behördliche Untersuchung festgestellt ward) vollends zu verderben. Um seiner schwachen Augen willen hierher versetzt, wird Reuter Bewohner einer Zelle, die nie ein direkter Lichtstrahl treffen kann; Miasmen, ungenießbares Trinkwasser (alles dies ward bei jener Untersuchung entdeckt und beglaubigt) thun das Ihre, das Lazarett fort und fort mit diesen elenden Menschen zu bevölkern. Endlich stirbt Graf Hacke, und Fritz Reuter ist – mit dem »Kapteihn« – der Erste, den man aus dieser Hölle entläßt. Inzwischen haben die Gnadengesuche des Vaters und die Verwendung der mecklenburgischen Regierung wenigstens soviel erwirkt, daß der König von Preußen ihn zu achtjähriger Festungshaft begnadigt. Aber noch erwartet ihn das Ärgste: auf dem Transport nach Graudenz nochmals in die Berliner Hausvogtei gesperrt, der scheußlichen Nichtswürdigkeit jenes – inzwischen zum Kriminaldirektor avancierten – »Onkel Dambach« preisgegeben, muß er vier Nächte bei furchtbarer Kälte (es war im Februar 1838) in ungeheizter Zelle, hungernd, nur mit seinen Kleidern zugedeckt, auf dem nackten Fußboden den Schlaf suchen. Doch sein fester Körper überwindet auch das. Die Erlösung aus dieser letzten Hölle rettet ihn vor Verzweiflung. Er kommt ins Fegefeuer, nach Graudenz; er kommt von neuem unter die niedere Wölbung einer Kasematte, aber unter die gelinde Hand eines menschlichen Kommandanten, und die besseren Zeiten seines Elends beginnen.
Wer hat nicht die tragikomischen, drolligen, von hineindichtendem Humor vergoldeten Geschichten aus diesem Graudenzer Jahr in der »Festungstid« gelesen! Wie, um wieder ein Bruchstück dieser verlorenen Jahre zu töten, von dieser bunten Leidensgenossenschaft unreifer Jugend geliebt, gemalt, gestritten, gekocht, gebuttert und entsagt wird; wie diese »Königsmörder« sich an unschuldigen Kindereien ergötzen, an Nichtigkeiten erhitzen, das Kleine groß nehmen, da vom Großen Schloß und Riegel sie trennt. Es waren einfache, unwichtige Menschen, mit denen Reuter hier hauste. Aber »in der dumpfen Gefangenenluft«, sagt er in jener früheren hochdeutschen Schilderung dieser Zeit, »schießen Freundschaftskeime auf, wie grüne Triebe unter der Glasglocke«. Mit wem sollte er denn leben, als mit ihnen? – Mit seiner Kunst, wird man sagen, mit seiner Wissenschaft. Dem erwidert er, glaube ich, mit Recht: »Sehr gut kann ich mir denken, daß ein Mensch im Gefängnis es in allerlei Handfertigkeiten sehr weit bringen kann; aber nie und nimmer kommt aus einem Gefängnis ein Künstler heraus oder ein Gelehrter, der der Welt wirklich etwas bedeutet.« Wo das Gemüt zwischen Verzweiflung und Stumpfsinn hin- und hertaumelt, jede Anleitung fehlt, jede Ermutigung, jeder Lohn versagt ist, wird ein noch werdender Mensch nur zu leicht Weg und Willen verlieren. Fritz Reuter malte, aber er kam nicht vorwärts, denn niemand konnte ihm helfen. Er warf sich – schon damals an eine landwirtschaftliche Zukunft denkend – auf die Wirtschaftslehre und ihre Hilfswissenschaften; doch was konnte er in seiner Abgeschiedenheit von ihnen erfassen, als die graue Theorie. Er erhielt endlich die Erlaubnis, ein paar »lütte nüdliche Jungs« zu unterrichten; auch das war mehr Zeitvertreib als Gewinn. Sollte er sich nun gar an der Jurisprudenz aufrichten, die er nur nach seines Vaters Willen auf sich genommen hatte? Er führte zwar sein Corpus juris, Höpfners Institutionen, Thibauts Pandekten und andere gelehrte Herren mit sich herum; aber welche Art von Nutzen er aus ihnen sog, bekennt er mit Humor in der schon erwähnten »heiteren Episode aus einer traurigen Zeit«. »... Ich warf mich aufs Bett«, erzählt er, »und las in Höpfners Kommentar; ein unschätzbares Buch, welches mir in meiner Festungskarriere die wesentlichsten Dienste geleistet hat, nicht sowohl durch bedeutende Förderung meiner juristischen Kenntnisse, als seiner kalmierenden Wirkung wegen. Ich brauchte es stets nur in kleinen Dosen einzunehmen, um in selige Vergessenheit meiner Lage zu versinken, und obgleich ich sieben Jahre hindurch jeden Tag zweimal einige Tropfen davon einnahm, habe ich das Quantum nicht ganz verbraucht und bin nur bis zur unvordenklichen Verjährung gelangt.«
Auch Gedichte zu machen fuhr er wohl fort; doch auf diesem Wege konnte er seinen Dichterberuf nicht finden. Er war kein subjektiv lyrisches Talent; was er war, ahnte er damals nicht. Entwickelte er sich schon von Hause aus, nach Mecklenburger Art, langsam und bedächtig, so nahm ihm nun das Schicksal vollends »Luft, Wärme und Licht«, und um lange Jahre ward sein Wachstum betrogen. Es existieren noch Lieder und Balladen aus dieser und nächster Zeit; warm empfunden, aber ohne poetische Originalität. Ich erwähne nur eins, 1839 in Graudenz gedichtet; schmerzliche Erinnerung des Gefangenen an sein »Liebchen«, die »weite Welt«, das er einst besaß; der Sonnenstrahl sein Schmuck, der Wald sein Gemach, der kühle Bach sein Bett. Nun ist er der Liebsten so fern:
Der Wasserkrug ist mein Pokal,
Das dumpfe Stroh mein Bett,
Der Kerker ist mein Rittersaal,
Mein Schmuck die schwere Kett'.
Doch wenn mein Lieb vom Schlaf erwacht,
Sich Blumen flicht ins Haar;
Wenn sie in grüner Kleider Pracht
Verkünd't das neue Jahr,
Da hör' ich längst entschwundnen Sang,
Schreck' aus dem Schlaf empor,
Ich beiße in die Eisenstang'
Und rüttle an dem Thor.
Doch fest ist Gitter, fest ist Thür,
Vergebens ist mein Mühn!
Der Sang, er ist verhallet mir –
Ich sink' aufs Lager hin.
Endlich, nach mehr als fünfeinhalb Jahren, endlich – noch nicht Befreiung – aber Auslieferung! Die persönliche Fürbitte des Großherzogs von Mecklenburg, Paul Friedrich, bei seinem Schwiegervater Friedrich Wilhelm III. hatte es endlich erreicht; mit dem Zusatz freilich: begnadigen durfte der Großherzog seinen Unterthan nicht, das Begnadigungsrecht behielt der fremde König sich vor. Doch Fritz Reuter kommt in die Heimat; auf der kleinen sogenannten »Festung« Dömitz findet er (im Juni 1839) die ganze Gemütlichkeit seiner Landsleute, ein Zimmer ohne »eiserne Gardinen«, ein Kommandantenhaus mit »einem ganzen Nest voll Töchter, eine immer schöner als die andere«, und in diesem Hause herzliche Gastfreundschaft. Im September ward ihm auch gestattet (noch existiert die von dem fast 80jährigen Kommandanten, Oberstlieutenant von Bülow, mit ungleicher Hand geschriebene »Ordre«), von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags »zum Essen nach der Stadt von der Festung heruntergehen zu dürfen«; und in einer Nachschrift setzte der menschenfreundliche alte Herr hinzu: »Bis auf weiteren Befehl soll dem Studiosus Reuter noch erlaubt sein, von 3 bis 5 Uhr zum Baden gehen zu dürfen: um 5 Uhr muß er aber wieder an der Wache sein.« Kurz, man that ihm alles zu gute, was geschehen konnte; es fehlte nichts, – als die Freiheit.
Über diese Zeit ist Reuter in seiner »Festungstid« kurz hinweggegangen, aus Dankbarkeit gegen jene Familie, bei der er »wie Kind im Hause« war, auf eine seiner fruchtbarsten humoristischen Aufgaben verzichtend. Ihm hätte, wie sein vertrautester Freund (in Erinnerung an Reuters mündliche, unerschöpflich ergötzliche Mitteilungen) versichert, die überaus originelle Gestalt des Kommandanten Stoff zu einem ganzen Buche geliefert. Ich füge hinzu: und vielleicht auch die Liebe zur Tochter des Kommandanten, die er in einer flüchtigen Andeutung der »Festungstid« erwähnt. Zu welcher von den fünf Töchtern, wüßte ich nicht zu sagen; wenn ich aber an die Adelheid zurückdenke, die ihm den Thee einschenkte, und wenn ich in den Julklapp-Versen, die Fritz Reuter für den Weihnachtsabend im Dömitzer Kommandantenhause machte (und die noch erhalten sind), Fräulein Emma als Hebe gefeiert, und am Schluß gleichsam eine schüchterne Geberde des Verschweigens finde, so bin ich versucht, mir das Meine zu denken. Diese Verse, nach der in Mecklenburg gebräuchlichen neckenden Art mit dem noch versiegelten Geschenk von Adresse zu Adresse weiterwandernd, bis endlich dem Letzten das Geschenk in den Händen bleibt, erzählen, als sie zu Fräulein Emma kommen, von den Göttern des Altertums, die in Fülle und Herrlichkeit lebten, bis sie ihren großen Bankerott machten und herunterkamen:
Frau Venus aus Not ward 'ne Wäscherin;
Vulkan beschlägt jetzt die Pferde;
Apollo durchziehet jetzt her und hin
Mit dem Dudelkasten die Erde.
Der Kriegsgott Mars, als Volontair,
Bei den Preußen ist einrangieret;
Minerva führet die Schneider-Scheer',
Und Jupiter selber rasieret.
Von Allen hatt' Hebe mit freundlichem Sinn
Das herrlichste Los sich erkoren,
Sie ward auf der Erd' Kellermeisterin,
Da sie oben den Posten verloren.
Hier spendet sie reichlich den lieblichen Trank
Und erfreut die durstigen Gäste.
Drum freundliche Hebe empfange den Dank
Und tröste damit Dich aufs beste!
Denn böt' ich Dir mehr, so sagtest Du wohl:
»Ich danke schönstens, mein Bester!«
Drum biete, eh' solch eine Nas' ich mir hol',
Ich lieber das Päckchen der Schwester. –
Die Liebe eines neunundzwanzigjährigen Studenten, der noch Jahre lang sitzen soll, zu der Tochter seines Kommandanten! – – Doch endlich naht ihm die Freiheit. Friedrich Wilhelm III. stirbt, und sein Sohn, der ihm am 7. Juni 1840 folgt, erläßt eine allgemeine, vollständige Amnestie für jene politischen Opfer. Es ist Wahrheit: Fritz Reuter selber liest's in den Zeitungen; er liest, wie seine Freunde allerorten entlassen werden; – nur ihn, den Mecklenburger, hat man vergessen. Nach bittrer Pein schlägt endlich auch seine Stunde: der Großherzog Paul Friedrich, nachdem er vergebens gemahnt hat, giebt ihn frei auf seine eigene Hand. Acht Tage später erst kommt ein Brief des preußischen Justizministers Kamptz an Reuters Vater, dem er darin meldet, sein Sohn werde nun auch bald heimkommen: da sitzen Sohn und Vater miteinander bei Tische.
Was nun? – Was nun? – Wunderbar ergreifend hat Fritz Reuter am Schluß der »Festungstid« diese herzbeklemmende Rückkehr in die Freiheit geschildert, diesen langen, harten Kampf mit der Frage: »Was nun?« »Sieben Jahre lagen hinter mir, sieben schwere Jahre, sie lagen mir schwer wie Zentner-Steine auf dem Herzen ... Was sie mir etwa genützt haben, das lag tief unten im Herzen begraben unter Haß, Fluch und Grauen; ich mochte nicht daran rühren; es war, als sollte ich Gräber aufreißen und mit Totenknochen Spaß treiben ... Was war ich? Was wußte ich? Was konnte ich? Nichts. Was hatte ich mit der Welt zu thun? Nichts, gar nichts. Die Welt war ihren alten, schiefen Gang ruhig weiter gegangen, ohne daß ich ihr gefehlt hatte; um ihretwillen konnte ich noch immer fort sitzen – und meinetwegen auch ... Auf den Festungen hatten sie mich geknechtet; aber sie hatten mir ein Kleid gegeben, das feuerfarbne Kleid des grimmigen Hasses; nun hatten sie mir das ausgezogen, und ich stand nun da – frei! – aber auch splitterfadennackt, und so sollte ich nun hinein in die Welt.«
Doch zu alledem kam noch ein schweres, verhängnisvolles Unglück hinzu, das er dort nicht, und das er begreiflicherweise nirgends erwähnt; die traurige Krankheit, die ihm die sieben Festungsjahre mit auf den Weg gaben, um ihm Freiheit und Leben zu vergiften. Über diese Krankheit sind so verworrene, und oft so niedrige Anschauungen verbreitet, daß es mir, der ich Fritz Reuters Leben erzähle, als eine unausweichbare und heilige Pflicht erscheint, auch von ihr mit vollkommener Offenheit zu reden. Die edle, makellose Führung seines Lebens, seine dem schweren Schicksal abgerungenen weltfrohen Werke, seine eigene herzgewinnende Gestalt scheinen gleichsam zu fordern: laß nicht aus falscher Scheu den Schatten einer falschen Meinung auf uns ruhen; zeig' ihnen den ganzen Mann, wie er war, was er litt! – Man hielt und hält Fritz Reuter hier und da – wie drück' ich es am treffendsten aus – für einen Trinker gleichsam von Profession; man hielt und hält ihm gleichsam aus Gnade, um seiner Dichtungen willen, diesen Makel zu gute. Es liegt in dem sittlichen Drang, aber auch in der Erbärmlichkeit der menschlichen Natur, daß wir so oft, wo tiefes Mitleid mit einem wehvollen Übel uns ergreifen sollte, mit leichtfertiger, unwissender oder hämischer Verurteilung das zur Schuld des einzelnen Menschen machen, was eine schmerzliche Folge der gebrechlichen Welteinrichtung ist. Fritz Reuter, ein Mensch von urkräftiger, auf kraftvolle Nahrung angewiesener und an sie gewöhnter Konstitution, nun im Kerker Jahre lang schmaler Kost, harten Entbehrungen preisgegeben, dazu durch die Trübsal geschwächt, suchte sein Elend durch aufheiternde Getränke zu betäuben, – und traf damit die wunde Stelle, die jene schwächenden Leiden in seinen Organen vorbereitet hatten. Eine »Neurose«, eine krankhafte Verstimmung der Nerven des Magens und der Speiseröhre bildete sich aus; ein Übel, das, rein physischer Natur wie es ist, wohl zu Zeiten durch erhöhten Gemütszustand günstig beeinflußt, aber durch keine moralische Macht, keinen Vorsatz des »Willens« aus den Organen wieder hinausgeschafft werden kann. Was ist die Folge dieser örtlichen Neurose? Daß sie dauernd oder – wie bei Fritz Reuter – periodisch eine wohl von der Naturheilkraft geforderte, aber unüberwindliche Begierde nach jenem spirituosen Reiz erzeugt; eine Begierde, die nicht eher gestillt wird, als bis mit Erbrechen und Ekel die qualvolle, aber rettende Krisis erfolgt.
Mit dieser traurigen, bemitleidenswerten, für jeden Zuschauer freilich abstoßenden Krankheit – die die Wissenschaft bis jetzt mit schlechtem Erfolg bekämpft – kehrte der Unglückliche in die Welt zurück. Wer von diesen unwissenden Menschen sollte ihn gerecht beurteilen und mit Weisheit behandeln? Die Perioden, in denen die wilden Anfälle wiederkehrten, waren ungleich, ihre Dauer desgleichen; nur ein Grund mehr, ihre Natur zu verkennen. Es vergingen Wochen, dann Monate, später (es scheint, weil die Natur bei gesundem und zufriedenerem Leben sich gekräftigt hatte) fünf, sechs, einmal neun volle Monate, eh' das krankhafte Bedürfnis wiederkehrte; zuweilen war der ganze Anfall in ein paar Tagen überstanden, zuweilen kam die Krisis erst nach langem Ringen herbei. In solchen Fällen (wie sein vertrautester Freund aus jener Zeit, Fritz Peters, mir mitgeteilt hat) begann Reuter damit, oft unter künstlichen Veranstaltungen, bis zur Erschöpfung zu trinken; mitunter erst am vierten, am fünften Tage kam der Unglückliche so weit, daß er das Bett nicht mehr verlassen konnte; aber auch da noch weigerte sich die Natur, befreiend zu reagieren, er mußte trinken – bis endlich unter unaussprechlichen Qualen das Erbrechen erfolgte. Doch dieses Erbrechen hielt dann oft Tage lang an; furchtbare Todesangst marterte den Gequälten, er war jedesmal des sicheren Glaubens, zu sterben, und wer ihn sah, glaubte, er habe recht. Kam er dann zu sich, so war sein Gemüt verwüstet, sein Magen krank; er nahm nichts an als Sodawasser, gekochtes Backobst, etwas schleimige Nahrung, später Bouillon. Plötzlich entwickelte sich dann aber die ganze Heilkraft seiner riesigen Natur. Mit ungeheurer Eßlust stellte er sich wieder her. Sein Geist lebte wunderbar auf; seine höchsten Gaben entfalteten sich, sein Leben schien von neuem zu beginnen. Auch focht ihn, während jenes Leiden ruhte, kein andres Übel oder Gebrechen an. Er schien, sagt sein Freund, durch solche »Anfälle« den Körper förmlich zu reinigen und gegen andre Krankheiten unempfänglich zu machen.
Aber wie verderblich, wie zerstörend diese Krankheit damals auf seinem Leben lag, wie sie ihn mit Beruf, Vaterhaus, Liebe, vielleicht auch mit sich selber in tiefsten Widerspruch setzte, das sagt die Geschichte seiner nächsten zehn Jahre, in denen er sich ein Dasein suchte, ohne es zu finden. Der Vater, gegen diese »Trunksucht«, wie ihm die Krankheit seines Sohnes erschien, mit wohlbegreiflicher Strenge empört, verwehrt ihm aufs neue, sich als Maler auszubilden, macht noch einen Versuch, ihn auf die juristische Laufbahn zurückzudrängen, und läßt ihn im Herbst 1840 zuerst nach Tübingen, wo er nicht aufgenommen wird, dann nach Heidelberg gehen; doch da er hier, von diesem Studium abgestoßen, sich nur tiefer in jenes Übel hineinstürzt, ruft der Vater ihn im nächsten Frühsommer zurück, und noch in demselben Jahr beginnt Fritz Reuters »Stromtid«. In Demzin bei Malchin erlernt er die Landwirtschaft; es hilft ihm sein mecklenburger Blut, auch sein früheres Studium der Chemie und wirtschaftlich reformatorischer Werke, er entwickelt sich schnell (nach dem Zeugnis bedeutender Berufsgenossen) und steht bald unter ergrauten, erfahrenen Landwirten als ein Ebenbürtiger da. Aber die »Trunksucht«! ... Er lernt in Demzin Luise Kuntze kennen, die (selbst eine Predigerstochter) bei einem Prediger in der Nachbarschaft als Erzieherin lebt; ihre Gestalt, ihre Anmut und Denkart, ihre schöne Stimme bezaubern und fesseln ihn, daß er sie nicht wieder zu vergessen vermag: er beginnt um sie zu werben, – und jenes sein Unglück tritt auch zwischen diese edle, reine, unerfahrene Seele und ihn. Wer konnte ihr damals auch sagen, daß ein so fürchterliches Übel seinen erstaunlich kräftigen Organismus nicht zerstören, seinen Geist, seine Gaben nicht zu Grunde richten, daß er noch mehr als dreißig Jahre lang damit hausen und ein so geordnetes, klares, reines Leben wie Wenige führen werde? – Er wirbt um sie, und noch ohne Erfolg. Er hat inzwischen (1844) als Landwirt ausgelernt, und ihn drückt nun die Frage: wird mir dieser Beruf, nun da ich mein Brot von ihm essen soll, auch Befriedigung geben? Und was wird aus mir, mittellos wie ich bin?
Hier half ihm zunächst die Freundschaft, – die hingebendste und aufopferndste, die er, wie es scheint, in seinem Leben gefunden: die Freundschaft des Schwagers seines Lehrherrn, des Gutsbesitzers Fritz Peters, den er im Jahre 1841 kennen gelernt hatte. Im Herbst 1844 wird ihm dessen aufblühendes Haus ein liebevolles Asyl; zu Thalberg bei Treptow an der Tollense, auf pommerschem Boden, doch nahe an der Grenze und nur ein paar Meilen von Stavenhagen entfernt. Nicht lange danach – 1845 – stirbt sein Vater; der Tod löst vollends das innerlich schon zerrissene Band: denn der alte Mann hatte ihn aufgegeben, ahnungslos, welche Zukunft in diesem unglücklichen Sohn noch verborgen lag. Sein Erbteil – fünftausend Thaler – soll ihm nur zufallen, wenn er sich vier Jahre nacheinander von dem Laster der Trunksucht freigehalten habe; bis dahin soll er nur die Zinsen erhalten. Wer leiht ihm Geld, um eine eigene Landwirtschaft zu unternehmen? Die vielen guten Freunde »zogen mit der Schulter«, der Eine gute Freund »konnte ihm nicht helfen, er hatte selbst kaum genug«. Wer hilft ihm? »Ut em ward nicks«, ist ja das allgemeine Wort. »Ut em ward nicks«; denn er trinkt.
So kehrt der, wie es scheint, zukunftslose Mensch denn immer wieder in jenes Asyl zurück; und dort – wo er bis zur Revolution von 1848 sein Daheim hatte – schafft er sich, unter stillen, zaghaften schriftstellerischen Versuchen, ein Leben, so gut er es vermag. »Er war«, sagt Fritz Peters in dankbarster Erinnerung, »für die Freundschaft geschaffen«. Er wirkt, an sich selber bildend, auch bildend und fördernd auf alles in seiner Umgebung ein; er läutert den Geschmack seiner Hausgenossen, liest und spielt ihnen vor, wirbt sie für seine Lieblinge, Walter Scott, Boz und Shakespeare, erteilt seinem Freund Unterricht in der Chemie, im Schachspiel (das er sehr liebte), pflegt die edle Gärtnerei, die Blumenzucht, beschäftigt sich als liebevoller Seelenpfleger mit den Kindern des Hauses, die dem »Onkel Eute« ihre Herzen öffnen, spielt mit ihnen wie ein Kind, und erquickt in guten Stunden sie alle durch seinen unerschöpflichen, phantasievollen, goldenen Humor. Wie manches Zeugnis dafür liegt noch in seinen Briefen aus dieser Zeit! Wenn der Hausherr und die Hausfrau verreisten, trat Fritz Reuter als Patriarch an ihre Stelle; er sah dann alles mit dem »Auge des Herrn, sorgte für Groß und Klein, für Mensch und Hund, und sendete den Verreisten seine langen, ausführlichen, zuweilen gereimten oft humoristisch übermalten Berichte nach. Seine erfinderische Phantasie spielte dann mit; es war ihm gleichsam ein schriftstellerisches Bedürfnis, Dichtung und Wahrheit übermütig zu mischen. »Für die Sicherheit Deines Hauses«, schreibt er einmal (in etwas späterer Zeit, Oktober 1849), »ist von mir mit gewohnter Umsicht Sorge getragen. Höpper ist wieder instruiert zu bellen, um die Spitzbuben graulich zu machen, Schröder geht als mitternächtliche Streifpatrouille um und bellt auch, was sich schrecklich genug anhört; ich schlafe in der Vorstube; in meinem Bette liegen zwei ungeladene Pistolen, das Bett selbst steht vor Deinem Geldschrank und ich liege auf Deinen Schätzen, wie der Fafnirs-Drache. Adon [der Hund] ist mein treuer Helfershelfer bei meinen Bemühungen, er dient mir zu den mannigfachsten Vorrichtungen zur Erreichung meines Zwecks; bald lasse ich ihn des Nachts mit einer Schweinsblase im Hause umhertoben, um alle munter zu erhalten, bald geht er in angepichten Nußschalen spazieren; diese letzte Nacht hat er vor dem Fenster der Vorstube gesessen, wo ich ihn mit dem Schwanze zwischen die Fensterflügel geklemmt hatte, um ihn etwas ausfrieren zu lassen, weil ich gefunden, daß er dann lauter schreit ... So kannst Du also ruhig schlafen, dieweil wir wach sind.« Dann im nächsten Brief: »... Im Übrigen leben wir hier sehr gut und zwar durch meine Fürsorge und auf Deine Kosten. Es hätte freilich sehr schlecht ausfallen können, denn kaum wart Ihr fort, als Großmama [Fritz Peters' Schwiegermutter] einen conventus omnium ac singulorum berief und den Vorschlag machte, von nun an recht schlecht und sparsam zu leben und zum Zeugnis dessen das magerste Schaf in der ganzen Herde zu schlachten. Dem widersetzte ich mich unter Anführung keines anderen Grundes, als dessen: Ihr könntet uns dies verdenken oder uns gar für dumm halten. Ich wußte meine Ansicht so bündig vorzutragen, daß ich in einer feierlichen Abstimmung Sieger blieb. Die Elert stellte zu dem ersten Satz: »soll gut (oder schlecht) gelebt werden?« das Amendement, zu setzen: »soll lustig gelebt werden?« Was aber allgemeine Mißbilligung fand; weil ich in einer anderthalbstündigen Rede nachwies, daß wir unmöglich bei Eurer Abwesenheit lustig sein könnten, daß wir pflichtmäßig traurig sein müßten, aber zur Stärkung der Kreatur gut leben müßten. Mein Antrag ging durch und nun leben wir gut und sind traurig, mit Ausnahme der Kinder, die gut und lustig leben, weil die armen Würmer es nicht besser verstehen, es fehlt ihnen noch die Cultur der Welt.«
Auch mit Versen schmückte er bei jedem Anlaß dieses ländliche Leben; wie er als Maler-Dilettant das ganze Haus portraitierte, fehlte er auch als Hausdichter nie, nicht wenn er mit Adon zusammen (Beide mit Blumen geziert) zum Geburtstag der Hausfrau gratulieren kam, nicht wenn er als »Onkel Eute« den Kindern seinen Kopf leihen mußte. Unter diesen alten Papieren findet sich auch folgendes Gedichtchen, für eines der Kinder gemacht, das erste in plattdeutscher Sprache:
Wo b'os Papa is,
Wo hei b'os b'iwt,
B'os – in der Kindersprache – für bloß = nur; b'iwt für bliwt = bleibt.
Ick wull em gewen dies
Lütten Gedicht.
Hebben Sei nich seihn Mama
Unsen liepen Papa
Petersen, wo hei is b'ewen?
Alisa wull em dit gewen!
Unkel Eute hett't schrewen.
Inzwischen verlor Fritz Reuter das Mädchen, das er liebte, nie aus dem Sinn; nur aus den Augen, da sie aus seiner Gegend hinwegzog. Er erbat sich die Erlaubnis, ihr von Zeit zu Zeit zu schreiben, damit sie ihn näher kennen lerne; endlich gestattete sie ihm, sie zu besuchen; – das Jahr darauf, 1847, gab sie ihm ihr Ja. Doch daß sie es noch mit unsicherem Herzen gab, wird niemand verwundern. Welche Gegenwart konnte er sein nennen, welche Zukunft sich und ihr versprechen? – Sein unglückseliges Leiden zu heilen, unternahm er im nächsten Winter (1847 auf 48) eine Kur in der Wasser-Heilanstalt zu Stur am Plauer See; auch darin seinem »Bräsig« gleich, in dessen Leinwandkittel und gelben Stulpen er als »Strom« die Welt beschritten hatte. Die tiefen Leiden seines Gemüts brachen nicht seinen elementaren Humor; auch die Briefe aus der Wasserkur an seine Thalberger geben dafür Zeugnis, sie sind nicht minder ergötzlich als Bräsigs Schilderung in der »Stromtid«, sie gestatten sich nur eine Unerschrockenheit der Phantasie und des Ausdrucks, die Manches der Mitteilung entzieht. »... So viel von mir,« schreibt er unter anderm, »der ich sehr wohl und gesund bin, alle Morgen schwitze, sitze und spritze, des Mittags nässe, esse und fresse und des Abends wasche, platsche und klatsche ... Es herrscht hier ein heiterer und gemütlicher Ton, der nur dadurch auffällt, daß man sich hier zu allerlei krankhaften Erscheinungen Glück wünscht, daß man folgende Fragen an einander richtet: Wie viel Geschwüre haben Sie jetzt? Was macht Ihr Schorf? Was macht der Ausschlag an Ihren Beinen? Haben Sie heute noch zu arbeiten? (d. h. zu baden, zu douchen, zu schwitzen, zu brausen, zu wickeln, zu sitzen) ... Einige haben mir auch schon mit vieler Güte prophezeit, daß ich die besten Anlagen zu einem köstlichen Grind in mir trage, auch würde ich nach Möglichkeit stinken. Ich thue denn auch alles Mögliche, um auf solche Stufe der allgemeinen Achtung zu gelangen ... Ein Ocean umgiebt mich hier, den Regen über mir und unter mir die Wellen; ein Strom hat sein Bette durch meine Eingeweide gewühlt ... Ich bin eine ambulante Wasserkunst geworden und gehe damit um, mich auf Actien an die Treptusen (die Treptower) zur Zierde für ihren Markt zu verkaufen. Mein ganzer Lebenslauf ist Wasser, ich werde damit begossen wie ein Pudel, werde darin ersäuft wie junge Katzen, sitze darin wie ein Frosch und saufe es wie ein Ochs«.
Er kam nicht geheilt zurück; aber die Weltgeschicke sorgten zunächst dafür, ihn seinem persönlichen Unglück zu entreißen. Der März 1848 brach herein, eine Welle der Revolution schlug auch nach Mecklenburg hinüber. Sich aus verrotteten und empörenden Zuständen zu befreien, rührten sich Stadt und Land; – mit wie viel Ungeschick freilich, Unreife und Unverstand, hat Reuter in der »Stromtid« mit unwiderstehlichem Humor geschildert. Doch sein Herz, sein Kopf gaben sich mit ganzem Feuereifer dem Ernst der Bewegung hin. Welche Gefühle für ihn, der an dieselbe Sache seine blühendste Jugendzeit verloren hatte! – Er ging nach Stavenhagen zurück, seine Mitbürger wählten ihn (Ende März) als Deputierten zum Güstrower Städtetag: »dei kann reden,« sagten sie, »un dei ward för uns reden«. Im Mai willigte der »außerordentliche Landtag« in die Zumutung der Landesfürsten, die bisherigen »grundgesetzlichen Landstandschaftsrechte zu der Folge aufzugeben, daß künftig nur gewählte Repräsentanten die Stände-Versammlung bilden«; ein neues provisorisches Wahlgesetz ward im Juli erlassen, und die danach gewählte Versammlung der Abgeordneten beider Mecklenburg am 31. Oktober in Schwerin eröffnet. Auch Fritz Reuter war unter den Gewählten. Neben den Hoffnungen für Land und Volk mochte er auch Hoffnungen für sich selber hegen; sollte nicht irgend eine dauernde Stellung zu gewinnen sein? Die Braut hatte inzwischen auf seinen Wunsch sich nach Thalberg begeben; herzliche Freundschaft entspann sich auch zwischen ihr und den Thalbergern; seine Sehnsucht wuchs, ein eigenes Haus zu begründen. Indes noch sollte sein Kreislauf um den fernen Mittelpunkt des Glücks nicht enden. Die Entwickelung der politischen Begebenheiten belehrte ihn, daß für Mecklenburgs Freiheit nichts zu hoffen sei. Enttäuscht kehrt er zurück. Nicht um sich ein Dasein zu schaffen, nur dem Freund zu Liebe wird er noch einmal – zum letzten Mal – »Strom«: er tritt für den zum preußischen Heer einberufenen Thalberger Wirtschafter als Stellvertreter ein (nachdem die Braut Thalberg verlassen und in der Nachbarschaft wieder eine Stelle als Erzieherin angenommen hatte), und während die siegreiche Reaktion die alten Mächte und Zustände in Mecklenburg wieder einsetzt, ißt er sein im Schweiß verdientes Brot auf pommerscher Erde und sieht sein vierzigstes Lebensjahr sich vollenden.
Noch ein unfruchtbares Amt hatte er in der Zeit der politischen Bewegung bekleidet: in jenem Stavenhäger Reformverein, den die »Stromtid« unsterblich gemacht hat (denn Rahnstädt ist Stavenhagen), hatte man ihn zum Präsidenten gewählt. Er ergriff – wie ich nach der Mitteilung eines Freundes berichte – die Leitung des Vereins mit Wärme, mit Eifer, nachdem sein Vorgänger, ein ehrbarer Meister Handwerker, um allzu großer Dummheit willen abgesetzt worden war; doch er gewahrte bald, daß diesen Männern von Stavenhagen nicht zu helfen sei. Endlich hält er ihnen eine Abschiedsrede, legt sein Amt nieder und erklärt seinen Austritt aus dem Verein. Hiermit nicht einverstanden, umringt ihn die Versammlung, bittet ihn zu bleiben, oder doch anzugeben, was ihn etwa verletzt habe; ihm solle Genugthuung werden. Fritz Reuter weicht aus; die Thür zu erreichen, ist alles, was er begehrt. Endlich hat er den Thürdrücker gefaßt; »ich will euch sagen,« ruft er nun mit seiner vollen Stimme, »warum ich aus dem Verein trete!« Allgemeine Stille und Erwartung. »Ji sid mi all tau dumm, ji Schapsköpp!« – Und er ist aus der Thür.
Er kehrte denn auch einstweilen nicht nach Stavenhagen zurück; nicht dort, sondern jenseits der Grenze, in Treptow an der Tollense ließ er sich nieder, nachdem er endlich – 1850 – das Landleben aufgegeben hatte, um es mit dem trockenen Brot des Schulmeisters zu versuchen. Die Liebe trieb ihn zu diesem verzweifelten Versuch; denn für zwei gute Groschen die Stunde Unterricht zu geben, war für seine Bildung, seine Jahre, seine Geistesgaben wohl ein verzweifeltes Beginnen. Als Privatlehrer »that er sich auf«; er erteilte Turn- und Zeichen-Unterricht, er übernahm auch sonst in allen Fächern (selbst die Schwimmkunst nicht ausgeschlossen), was man von ihm begehrte. In seinem Nachlaß findet sich noch ein Blatt, mit mathematischen Aufgaben und Berechnungen aus einer dieser Unterrichtsstunden bedeckt; – auf der Rückseite hat derselbe Mann, zehn, zwölf Jahre später, die mit Riesenschnelle wachsenden Einnahmen aus den sich jagenden Auflagen seiner Dichtungen berechnet. Welcher Gegensatz zwischen dieser und jener Mathematik! Hätte ihm ein guter Geist, ein ahnender Gedanke damals sagen können, was für einen Zahlensegen diese selbe gequälte, abgemüdete, zahlenkritzelnde Hand noch auf eben dasselbe graue Blatt hinschreiben würde!
Indessen er plagt sich, er erwirbt Groschen um Groschen, – und hofft. »Die Hoffnung,« sagt er einmal, »ist so dreist wie die Biene, sie drängt sich an jede Blume und trägt aus jeder ihren Honig davon«. Nur jener eine böse Geist steht ihm noch immer im Wege: seine Krankheit. Jahre lang hatte die Geliebte Neigung, Hoffnungen, Pläne mit ihm geteilt, Jahre lang hatte sie immer wieder geschwankt. Ein stilles Grauen, scheint es, lähmte ihr stets von neuem den Mut. Endlich entschloß sich der Thalberger Freund zu einem seltsamen, zu bewundernden Schritt. Er führte sie eines Tages nach Treptow (Thalberg liegt vor der Stadt), in Fritz Reuters Zimmer, als er in den peinlichen Zuständen dieser Krankheit daniederlag. Fürchterlich war ihr der Anblick; sie litt lange und viel. Aber ein höheres, ein weiblich edles, wahrhaft schönes Gefühl wuchs darüber empor: sie hoffte, wie es scheint, daß sie es über ihn vermögen werde, das Übel zu besiegen, wenn sie sein Weib sei. Und sie ward sein Weib. Im Frühjahr 1851 gründeten sie in Treptow ihren gemeinsamen Herd.
Sie hat es nicht erreicht, einen Feind zu besiegen, den wohl keine menschliche Macht bezwingen konnte; aber sie half ein Leben retten, das von noch unerkanntem, unvergänglichem Wert war. Was ich hier erzählt habe, weiß ich nicht durch sie; auch nicht durch sie, wohl aber durch andre wahrhafte Zeugen, mit welcher unüberwindlichen Liebe, Sorge, Geduld und Selbstverleugnung sie ihn nun dreiundzwanzig Jahre lang in jedem Anfall seiner Leiden pflegte und bewachte. Warum sollte ich nicht davon reden? Ist es doch ein herrliches Zeugnis für den vielgeprüften Mann, daß er ein solches Weib, und in ihr solche Liebe fand. Doch für das Opfer ward ihr auch der Lohn. Er, dem das Wesen der Liebe tiefste Innigkeit war, dessen kindlich reines Gemüt die Liebe als »tiefes Mitleid mit sich selbst, als heimliches Sehnen nach einem besseren Herzen« faßte, »das wie ein Mondscheinstrahl, aus Ahnung und Dämmerlicht gewebt, in uns fällt«, – er zeigte ihr auch in diesen herzbrechenden Leiden die Idealität seiner Seele. Gegen die Freunde, auch die nächsten, schwieg er von seinem Übel und verlangte Schweigen; ihr schloß er sich in rührenden Klange über das grausame Unglück seines Lebens, doch auch in heiligen Entschlüssen, feierlichen Gelöbnissen, verdoppelter Liebe auf. Es erschien ihr dann jede solche Pein wie ein Bad der Reinigung, eine innere Wiedergeburt; sie sah neues Leben, neues Glück beginnen, und neue Hoffnung – freilich unerfüllbare – trug sie empor. Höher noch trug sie dann der Anblick seines dichterischen Schaffens, als er endlich sich selbst gefunden hatte: denn alles Beste, was er je geschrieben, entstand nach solch einer Leidenszeit. Schon während dieser Zeiten, in schlaflosen Nächten, schuf sein Geist. Es blieb oft unzerstörbare Klarheit in ihm; nicht nur, daß er im Bette las und im Gedächtnis behielt, auch glückliche Gedanken, fruchtbare Phantasien suchten ihn auf. Er sah zuweilen die Gestalten seiner Dichtungen so lebendig vor sich, daß er rief: »Sieh, sieh, sieh! Du mußt sie sehen! Mit Händen könnt' ich sie greifen!« – Doch es kamen freilich auch finstere Gestalten zu ihm. Als er noch der arme, unbekannte, ja sich selber noch unbekannte Mann war, in den ersten Jahren seiner Ehe, dichtete er in solch' einer Schmerzensnacht folgendes Gedicht:
Ich habe nicht Fürsten und Kön'gen gedient,
Ich war mein eigener König;
Und hab' ich auch vieles auf Erden geschafft,
Für's Ende schafft' ich zu wenig.
Nun klopft an die Thür eine bleiche Gestalt;
»Herein Du alter Geselle!
Ich hab' Dich schon einmal im Kerker gekannt,
Komm, Hunger, komm setz Dich zur Stelle!
Beiß ein! Beiß ein mit dem wilden Zahn
und hilf mir die Mahlzeit verzehren;
Du hast es vordem ja schon öfters gethan,
Komm, bring mir mein Schwarzbrot zu Ehren.«
Und er setzte sich 'ran an den nackten Tisch
Und da draußen da klopft's wie Gespenster:
»Herein, herein Du, Winter frisch,
Herein Du Sturm an dem Fenster!
Ich habe Euch beide auf öder Haid'
Am Meeresstrande getroffen,
Ihr findet lust'ge Gesellschaft heut',
Die Thüren stehen Euch offen.«
Sie treten ein, sie setzen sich,
Die beiden herben Burschen.
Der Wintersturm, der schüttelt mich,
Vor Frost die Zähne gnurschen.
Da tritt mit lahmem, leisem Fuß
Ein Weib, das ich nicht kannte.
Zur Thür hinein. »Einen schönen Gruß!
Ich bin der Dreien Tante.
Ich bin die Seuche, bin die Pest,
Ich bin die alte Krankheit!
Was ich gepackt, das halt ich fest
Eine Zeile fehlt.
– – –
Und nestelt sich an mich heran
Und packt mich wie mit Krallen:
»Ja, wehr sich, wer sich wehren kann,
Ich muß ihm doch gefallen.
Komm her, mein Schatz, komm her, mein Kind,
Was willst Du mit mir hadern?«
Es glüht wie gift'ger Höllenwind
Mir durch Gehirn und Adern.
Der Hunger, Wintersturm und Frost,
Die halten mich zurücke;
»Gesellen helft! Gesellen reißt
Sie 'runter vom Genicke!«
Und wildes Lachen um und um!
Und wilde, wilde Schmerzen!
Selbst Hunger, Sturm und Frost wird stumm,
Sie saugt an meinem Herzen. –
– Da wird es hell in dem Gemach,
Da zittern leise Schimmer,
Da wird zum hellen Gottestag
Das enge dunkle Zimmer!
Er hat es selber aufgeschrieben, dieses erschütternde Gedicht von der »alten Krankheit«, die ihn nicht mehr läßt; – sonst rief er oft seine Luise, daß sie sogleich zu Papier brächte, was die Muse seiner Leidensnächte ihm eingab. In einer Nacht kam ihm der Gedanke, seine Grabschrift zu machen; er ließ sie niederschreiben:
Der Anfang, das Ende, o Herr, sie sind Dein,
Die Spanne dazwischen, das Leben war mein.
Und irrt' ich im Dunkeln und fand mich nicht aus,
Bei Dir, Herr, ist Klarheit und licht ist Dein Haus!
Mach' auch mir meine Grabschrift, bat sie ihn. »Nein«, antwortete er; »das erregt mich zu sehr.« – Da will ich sie Dir geben: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. – »O nein nein!« rief er aus; »die nicht! Das thut mir weh. Deine Grabschrift soll sein:
Sie hat im Leben Liebe gesäet,
Sie soll im Tode Liebe ernten.«
*
Fritz Reuters »Lehrjahre« sind zu Ende; seine dichterische Laufbahn beginnt.
Es ist ein seltsamer Irrtum, den man lange genährt hat und wohl auch heute noch nährt: daß dieser plattdeutsche Dichter, von einem glücklichen Instinkt geführt, plötzlich, gleichsam mit Naturburschen-Humor, sich aufs Schnurren-Erzählen und Versemachen geworfen habe und nach dem ersten Erfolg, durch eben denselben Instinkt, als naiver Naturdichter, so zu sagen ohne sein eigenes Dazuthun, dieser humorreiche Erzähler geworden sei, der er ist. Wie anders, als diese Legende, lautet die Geschichte! Als Fritz Reuter bei seiner Liebeswerbung zu seiner Luise sagte: »ich kann ja auch 'mal ein Buch schreiben«, klang ihr dies »etwas ungeheuerlich«, wie sie selber erzählt; aber schon damals wirkte in aller Stille der Dichter-Ehrgeiz, der Dichter-Gedanke in ihm. Nur lag ihm der plattdeutsche Vortrag im Anfang noch so fern, wie irgend einem seiner dichtenden Zeitgenossen. Die Wiederbelebung dieser litterarisch toten Mundart war noch nicht geschehen. Seine Bildung, seine Vorbilder wiesen ihn auf die hochdeutsche Sprache hin, in der er seine Freuden und Leiden bisher besungen hatte, in der er nun die gewonnene Braut besang:
Gieb mir wieder
Frühlingslieder,
Gieb mir wieder
Grüne Au;
Gieb mir wieder
Westwinds Kosen,
Gieb mir wieder
Frühlingsrosen,
Gieb mir wieder
Himmelsblau.
Alles ist in Dir enthalten,
Reif zum glühendsten Genuß,
Alles wird sich mir entfalten
In dem heißen Liebeskuß.
Gieb ihn mir, Du Holde, Süße,
Gieb ihn glühend, heiß und frei,
Daß ich endlich es auch wisse,
Wie der Götter Wonne sei.
Ein Dichter zu werden – nachdem sich die andre Muse, die der Malerei, ihm versagt hatte! Denn obwohl er noch mit ihr verkehrte, in dieser oder jener Gestalt, obwohl er in Bildnissen die Ähnlichkeit, wie man mir bezeugt, gut zu treffen wußte, und nie aufgehört hat, sich mit Bleistiftphantasieen und Köpfe-Zeichnen zu unterhalten (wobei ihm in späterer Zeit die besten poetischen Gedanken kamen), so blieb er doch immer nur ein begabter Dilettant. Sollte ihm nicht ein großes Dichtwerk gelingen, ihn innerlich und äußerlich frei machen? – Er träumte in diesen Jahren des Suchens unter anderm von einem frei erfundenen epischen Gedicht, das, auf mecklenburgischem Boden, den »Kampf des Heidentums gegen das Christentum, aber zugleich auch den der Vaterlands- und Freiheitsliebe gegen die Knechtschaft« darstellen sollte; »wie uns ein solcher Kampf in unserer Geschichte bei den Wenden und Sachsen entgegentritt, wo die Aufdringung des Christentums leider nur sehr eigennützigen Gründen entsprang«. Im Mittelpunkt der Handlung sollte der sogenannte »Heidenkirchhof« bei Jabel (nahe am Müritz-See) stehn; und in der Einleitung suchte er zunächst diese düstere Stätte, das Grab der für ihr Vaterland Gefallenen, zu schildern, dem, wie die Sage geht, noch bei Nacht zuweilen die Geister jener Heidenscharen entsteigen. Scheu flüstern es die Alten ihren Söhnen zu:
Wie sich dann Sturm erhebt, und wie die Fichten
Rings um die kahlen Hügel sich erheben,
Wie sich die Wurzeln in die Höhe richten,
Und wie die Wipfel an der Erde beben,
Wie sich dem Sturmgeheule Schlachtruf mengt,
Wie sich Erscheinung an Erscheinung drängt,
Wie's ängstlich hierhin dorthin irrt,
Und sich zum krausen Knäu'l verwirrt;
Bis endlich alles jach verschwindet,
Wenn sich dem nahen See ein Ton entwindet,
Tief unten aus dem kühlen Grunde,
Aus dem krystallenen Verließ,
So trostlos trüb' und doch so süß,
Wie Lebewohl aus Liebchens Munde.
Indes nur ein Bruchstück dieser Einleitung entstand; im Grau in Grau der Betrachtung gemalt, an Reuters früheren Lieblingsdichter Byron erinnernd, deskriptiv, ohne Plastik der Form. Er sandte dieses Bruchstück seiner Freundin zu; es blieb Anfang und Ende. Ein andrer harmloserer Plan, in dem zuerst sein Humor zu dichten wagte, trat ihm näher ans Herz: schon im Jahre 1845 begann er die Reise nach Belgien zu schreiben. Doch nicht in ihrer jetzigen, sondern in hochdeutscher Gestalt; – wie er denn gleichfalls hochdeutsch das Buch zu schreiben begann, das er viele Jahre später unter dem Namen » Ut Mine Stromtid« neu bearbeiten sollte. Das Manuskript existiert noch, und zeigt neben schwachen und unreifen Teilen auch bedeutende Anläufe; freilich fehlt Bräsig noch ganz, und auch bei Fritz Tiddelfitz und Pomuchelskopp, die neben dem eigentlichen Helden Habermann schon ihre Rolle spielen, fehlt jene wunderbare Kraft der Pinselführung, die uns in der »Stromtid« bezaubert. Immer aber bricht doch das Talent des Erzählers, die Fülle der Anschauung hervor; als Vertreter des »Missingsch« wirkt der »Dorfschulmeister« mit reizvollem Humor und behaglichster Breite, und die einfache Handlung entwickelt sich zuletzt (ehe sie fragmentarisch abbricht) mit unerwarteter Kraft. Man sieht, der Dichter der »Läuschen und Rimels« von 1853 war lange Jahre vorher von größeren, kunstvolleren Entwürfen erfüllt. Warum fehlte ihm der Mut, sie ans Licht zu schaffen? – Es fehlte offenbar der Vater des Muts, das Selbstvertrauen; wohl auch die Mutter, die Ermutigung.
Nur eine seiner Arbeiten aus dieser Zeit kam ans Licht der Welt; die humoristische, zum Teil wahrhaft geistreiche Satire » Ein gräflicher Geburtstag«, die er 1845 oder 46 schrieb. Er hatte die seltsame Geburtstagsfeier der Gräfin Hahn, die er darin schildert, 1842 als »Strom«, von Demzin aus, mit erlebt; seine Satire ward in den Jahrgängen 1846 und 1847 des von W. Raabe herausgegebenen »Mecklenburgischen Volksbuchs« Der Titel des Jahrgangs 1847 lautet: » Mecklenburg Ein Jahrbuch für alle Stände.« (Bei Hoffmann und Campe in Hamburg.), noch unter der Herrschaft der Zensur, gedruckt. Dieses Volks- und Jahrbuch, von den Führern der mecklenburgischen Liberalen geleitet und geschrieben, von entschiedenen satirischen Talenten unterstützt, war das litterarische Sprachrohr der Gebildeten, die nach Verbesserung der heimatlichen Zustände seufzten und drängten. Mit Reuter erstand ihnen nun ihre beste humoristische Kraft; doch sein Name blieb noch unbekannt, der Aufsatz erschien anonym. Ob aus Bescheidenheit oder aus einer anderen Rücksicht, wüßte ich nicht zu sagen. Wer ohne das Vorurteil, das uns der Zauber seiner reifsten plattdeutschen Werke ins Ohr geschmeichelt hat, an diese hochdeutsche Satire herantritt (und zugleich den Einfluß der Censur-Rücksichten auf den Vortrag bedenkt), der wird sich auch hier an dem großen Talent erbauen, das, an guten Mustern genährt und doch original, mit den Früchten seiner Bildung wie mit vergoldeten Weihnachtsäpfeln spielt; das behaglichen Humor, feine Ironie und wahrhaft vernichtende Verurteilung als bunte Früchte an demselben Weihnachtsbaum durcheinander blinken und schillern läßt, und zum Schluß diese ganze Pyramide von Spott und Hohn durch den Gegensatz, den rührenden Gesang des wandernden Webegesellen, sinnvoll beleuchtet.
Einige Jahre später, Ende 1849, als schon die Reaktion gegen die neue freiheitliche Entwickelung Mecklenburgs begonnen hatte, entstand noch eine zweite Satire ähnlicher Art: die Schilderung des feierlichen Einzugs derselben gräflich Hahn'schen Familie in demselben Basedow (bei Malchin), wie er nach längerer Abwesenheit am 20. Oktober 1849 erfolgte. Dieser kürzere Aufsatz, obwohl für den Druck geschrieben, ward nie gedruckt; es scheint, die schnell hereinbrechende Woge der Reaktion schwemmte ihm den Boden, auf dem er fußte, hinweg. Eine von freundlicher Hand mitgeteilte Abschrift liegt vor mir; doch der Gegenstand des Spottes ist zum Teil so lokaler Natur, der damalige Zustand der Dinge so rasch vorübergegangen, auch der Vortrag so ungleich, daß man dem gestorbenen Dichter Unrecht thäte, die Satire in den Nachlaß aufzunehmen. Daß es an gelegentlichen guten Einfällen nicht fehlt, brauche ich nicht zu sagen; wie denn unter anderm, zur richtigen Würdigung des ehelichen Verhältnisses, das gräfliche Paar stets nur als »Frau und Herr Gräfin« eingeführt wird. Auch die Schilderung des Vorspiels der feierlichen » Audienz« ist vom ächten Reuter: »... Nächst dem Vergnügen, Gimpel zu fangen und junge Hunde abzurichten, kenne ich kein größeres, als ehrsame Spießbürger [hier Bürger aus Malchin] antichambrieren zu sehn. Es ist 'ne wahre Wonne, sie anzuschauen, wie sie auf dem gebohnten Fußboden einherglitschen wie die Esel auf dem Glatteis, wie sie sich wie Orgelpfeifen in Reih' und Glied stellen und ihre Kopfbedeckungen in den Händen drehen, diese geziert mit Glacéhandschuhen, von denen jeder einzelne aus einem Paar gewöhnlicher für ihre Fäuste zusammengenäht ist; wie sie voll Verlegenheit nur flüstern, und sich gegenseitig auf das, was anständig ist, aufmerksam machen, wie sie sich räuspern, und endlich doch alle aus Gewohnheit gradezu in die Stube spucken ...« Doch das Beste und gewissermaßen das Thema, für das die ganze voraufgehende Introduktion geschrieben ward, ist der gereimte Schluß; eine Art von Bänkelsänger-Ballade, die damals auf einem Umwege, ohne Nennung des Verfassers, (wie ich mich selber sehr wohl erinnere) zu hohem Ergötzen in der Rostocker Zeitung abgedruckt ward. »Am Nachmittage«, heißt es am Schluß, »fuhren die Herrschaften ins Dorf, um von den Unterthanen ferneren Tribut an Ehrenbezeugungen einzusammeln; es passierte ihnen aber hier etwas, das wert ist, in Versen, gut oder schlecht, aufbewahrt zu werden. Das Gefühl der Unterthanen regte sich, und:
Als die Fahrt beinah geendet
Und sich nach dem Schloß gewendet,
Ward ein schönes Stück vollführet
Und der Wagen arretieret;
Zu der Gräfin größtem Schreck
Traten zwei ihr in den Weg.
Denn zu dieses Tages Feier
Hatt' der junge Münchenmeier
Und der alte Kannengießer
Die beiden
ächten Namen: Fritz Reuter hatte an ihre Stelle »Mützendreier« und »Pfannenschießer« gesetzt.
(Sechzig Jahr schon alt ist dieser)
Sich ein Stücklein ausgedacht,
Das ihnen viel Ehre macht.
Beide traten an den Wagen,
Um die Gräfin zu befragen,
Ob sie's gnädigst wollt' vergönnen,
Daß sie selber sich anspönnen,
Wie die Pferde aufgeschirrt?
Beide reden sehr verwirrt.
Und die Gräfin lächelt zierlich,
Spricht zu ihnen ganz manierlich,
Daß es angenehm ihr wär',
Wenn der Wagen nicht zu schwer.
Und der Graf, der sitzet da,
Sagt zu allen Dingen »Ja«!
Als die Herren Inspektoren
Die Verwalter der gräflichen »Begüterung«.
Das vernommen mit den Ohren,
Stellen sie sich Mann für Mann,
Und der Kutscher spannt sie an.
Daß für Unglück Hülfe sei,
Steht der Tierarzt auch dabei.
Und die Herren Inspektoren,
Als sie angeschirret woren,
Fangen Hurrah! an zu rufen,
Wiehern, scharren mit den Hufen;
Und der Kutscher rufet: »Jüh«!
Und nun ziehe, Schimmel, zieh!
Da der Weg ganz frei von Sande,
Alle sie ganz gut im Stande,
Und der Wagen nicht zum schwersten,
Und die Peitsch' vor'm Allerwertsten,
Und der Kutscher ziemlich grob,
Geht es immerfort Galopp.
Hier ist viele Ehr' zu holen!
Alle springen wie die Fohlen,
Selbst der alte Kannengießer
(Sechzig Jahr schon alt ist dieser),
Und die Gräfin freut sich sehr,
Daß der Wagen nicht zu schwer.
Vor dem Schlosse angekommen,
Sind die Sielen abgenommen;
Doch dem jungen Münchenmeier
Ist bekommen schlecht die Feier,
War gebadet ganz in Schweiß,
Und voll Striemen war sein Steiß.
Alle sind sie außer Atem,
Sagen aber alle: »'t schad't em
Nich, wenn wi ok all krepieren,
'T schüht de Gräwin man tau Ihren.«
Und der Tierarzt nimmt den Topf,
Pulver giebt er gegen Kropf.
Will sich Keiner lassen führen
Morgen vor der Gräfin Thüren
Und mit unterthän'ger Bitte
Flehn, daß sie zur Jagd ihn ritte,
Ihn, geschmückt mit der Schabrack',
Und die Gräfin huckepack? –
Von der treuen Wahrheit wird sich
Jeder können instruieren:
Achtzehnhundertneunundvierzig
Thät man dieses Stück aufführen
In dem Mecklenburger Land!
'S ist für's ganze Land 'ne Schand'!
Nutzanwendung.
Ja, Ihr seid mir wackre Deutsche!
Wie gemacht für Zaum und Peitsche,
Für Karbatsche und für Sättel,
Wie gemacht für solchen Bettel,
Wie gemacht für Spott und Hohn,
Wie gemacht für
Hundelohn!«
Die Partei des »Hundelohns« siegte, die Satire ward stumm; Fritz Reuter verließ Mecklenburg, und in Treptow an der Tollense, im Idyll der jungen Ehe, begann seine plattdeutsche Zeit, begann die Zeit des Erfolgs. Zu dem stillen Ehrgeiz, der nun schon so lange unbefriedigt träumte und schrieb, kam, wie in tausend gleichen Fällen, die alte »Mutter der Dinge«, die Not. »Sind jemals Menschen genügsam gewesen,« bezeugt zwar der Freund Fritz Peters, »so war es das junge Reutersche Ehepaar«; bei höchst kärglichen Einnahmen hielten sie sich doch von drückenden Schulden frei, Beide zum Sparen und zur Ordnung geschaffen. Dennoch mußten sie wünschen, den so unmäßig sauer verdienten Erwerb zu erhöhen. Claus Groth's »Quickborn« erschien 1852; der rasche Erfolg dieses plattdeutschen Lyrikers lehrte zu allgemeinem Erstaunen, daß in der bescheidenen Mundart nicht nur Vergangenheit, auch noch urlebendige Gegenwart sei. Vielleicht Zukunft, – wenn der Rechte käme. Ob er dieser Rechte sei, fragte sich Fritz Reuter freilich damals noch nicht. Sein Glaube war gering. Er wußte nur, daß er zuweilen – schon seit manchem Jahr – sich in plattdeutschen Polterabendscherzen versucht hatte, die mehr als ihre Nebenbuhler gefielen; daß er ein begabter, gesuchter Erzähler plattdeutscher Schnurren war, die er mit schlagender Nachahmung, mit unwiderstehlichem Humor gleichsam dramatisch-lebendig zu machen wußte. Wie den Italiener die conversazione, den Perser und Araber der Vortrag seiner phantastischen Märchen beglückt, so ist es des Mecklenburgers tiefstes Urbehagen, drollige »Geschichten« erzählen zu hören. Sie seien so alt, wie sie wollen, jedermann kenne sie: der lebendige, künstlerisch humoristische Vortrag macht sie ihm neu. Darin ist er, wenn auch nur Hörer, der Embryo eines Künstlers; das beste Publikum für den besten Erzähler. Wie, wenn Fritz Reuter die alten Schnurren – selbsterlebte wie allbekannte – mit denen er so manchen lustigen Abend geschmückt, nun auch für den Leser niederschrieb? in plattdeutsche Reime gebracht? – Er setzte sich hin und begann. Fast allabendlich, erzählt seine Frau In einer Schilderung des Anfangs von Reuters Schriftstellerleben, die Friedrich Friedrich in der »Gartenlaube« mitgeteilt hat., nach Beendigung von sechs bis sieben Privatstunden, wurden von acht bis zehn Uhr »Läuschen« geschrieben. »Will doch sehn, Wising,« sagte er, »wie sich die Dinger auf dem Papier ausnehmen, wie sie sich da anhören.« War so ein »Ding« fertig, vorgelesen, gebilligt, so sprang er vergnügt herum, rieb sich die Hände: »Sonntag les' ich's in Thalberg vor; gefällt's da auch, schreib' ich ruhig weiter; – hab' noch 'ne Menge solcher Dinger am Bändel.« Er schrieb weiter; sie saß am Nebentisch bei ihrer Arbeit, »mäuschenstill«, sah, wie die Feder flog, wie er ihr dann und wann zunickte, auch wohl murmelte: »Nein, so nicht – so ist's besser«; und: »das wird dir gefallen« ... Welch reines, ungetrübtes Glück, setzt sie hinzu, umschloß diese stillen Abendarbeitsstunden! Ich glaube, man konnte nicht glücklicher sein, als wir zwei Menschen. – Endlich, eines Abends, sagt er: »So! Nach meiner Rechnung wären es jetzt etwa dreihundert Druckseiten; – ich geb' die Dinger heraus. Ich wag's; in Mecklenburg und Pommern wird's gelesen, vielleicht auch gekauft.«
Er wendet sich an einen Buchhändler in Anklam, an einen zweiten in Neubrandenburg; man antwortet ihm, man werde das Buch »vielleicht verlegen«, wenn der Verfasser das Risiko trüge. In ihm ist der Glaube erwacht. »Ich geb's im Selbstverlag heraus«, erklärt er der Frau mit plötzlich festem Entschluß. »Justizrat Schröder leiht mir zweihundert Thaler zum Druck, die Kosten werden gedeckt; heut Mittag gleich fahr' ich nach Neubrandenburg zur Druckerei.«
Er kommt zurück: »Erschrick nicht, Luising! Ich lass' gleich zwölfhundert Exemplare abziehn statt der gewollten sechshundert.« – Aber, Fritz, Du stürzest uns in Schulden! – »Nein, Kind, es ist vorteilhafter so; glaub', ich hab' mir's überlegt.« – Die schriftlichen Anfragen an alle mecklenburgischen und einige pommersche Buchhandlungen ergehn; Bestellungen erfolgen, doch meist natürlich zur Ansicht; die Exemplare kommen von der Druckerei, die Packerei beginnt. Tagelang arbeitet die Hausfrau mit Latzschürze und Zuckerhammer, dem sich das steife Packpapier besser fügt als der bloßen Hand; der Mann sitzt daneben, schreibt die Begleitbriefe, siegelt und signiert. »Laß Dich's nicht verdrießen, Luising,« ruft er ihr zuweilen zu, »wenn's auch Quesen (Schwielen) giebt! Kriegst 'n neu' Seidenkleid!« – Und Fritz Reuters » Läuschen un Rimels« gehen in die Welt.
So konnte er denn erfüllen, was er ein Jahr vorher, am Weihnachtsabend 1852, seinem Fritz Peters in folgenden Versen verheißen hatte:
Mein Freund, ich bin ein armer Schlucker,
Und meine Schätze liegen in dem Mond;
Auch hab' ich viele, schöne Güter
Im Lande, wo die Hoffnung thront.
Von dorten her bring' ich Dir eine Gabe;
Ich hoffe, daß sie wichtig Dir erscheint,
Denn sie ist heiter wie die Morgensonne,
Und der Dir's bringet, ist Dein Freund.
Es ist ein köstliches Geschenk,
Ihr Alle könnt Euch meine Großmut merken:
Es ist die Dedikation
Zum ersten Band von »Reuters Werken«.
Den Erfolg dieses ersten Bandes – der nun die versprochene Widmung an der Stirn trug – kennt jedermann; er war wie der des »Quickborn«: schnell und unzweifelhaft. Die erste Auflage verschwand in sechs Wochen; täglich kamen Nachbestellungen; die beiden überraschten, glücklichen Menschen »lachten und weinten«. Freilich blieb – das Sprichwort umkehrend – der Ruhm des Propheten noch im Vaterlande; nach Hochdeutschland kamen die gereimten »Geschichten« nicht hinaus. So sehr sich der Mecklenburger, der Pommer an ihnen ergötzte, diese »Kongregation kleiner Straßenjungen«, wie der Dichter selbst sie in der Vorrede nennt, »die in ›roher Gesundheit‹ lustig über einander purzeln, unbekümmert um ästhetische Situationen, die fröhlichen Angesichts unter Flachshaaren hervorlachen und sich zuweilen mit der Thorheit der Welt einen Spaß erlauben«, diese scheinbar kunstlos improvisierten, oft derbkomischen Gestalten blieben vor dem Schlagbaum an der hochdeutschen Grenze stehen, den Klaus Groths »Quickborn« übersprang. Es war allerdings auch an ihrer Kleidung Dies und Das, was sie kulturwidrig zu machen schien. Nicht daß so mancher gewagte, regellose Reim mit unterlief, – was jeder volkstümlichen Dichtung gestattet bleiben muß, wie denn auch Klaus Groth es weder verschmäht noch vermieden hat; aber ein gleichsam unentschiedener Kampf zwischen dem Recht des Verses, des Rhythmus und dem Drang nach Natur-Abschreibung geht durch das ganze Buch. Ja er wiederholt sich in allen späteren Versdichtungen Reuters; zu Gunsten des Rhythmus abgeschwächt in »Kein Hüsung«, auch in »Hanne Nüte«, doch nirgends zu vollem Friedensschluß gebracht; so daß der Versdichter Fritz Reuter gegen den Prosadichter gleichen Namens immer im Nachteil bleibt. Das Stilgefühl in ihm ist schwächer als das Naturgefühl. Dies giebt seinen Prosa-Erzählungen jene eigene Poesie der höchsten, natürlichsten, freiesten Behaglichkeit; dies giebt seinen gereimten Dichtungen die eigentümlich prosasüchtige Vortragsweise, die dann plötzlich in Stimmungsbildern, in lyrischen oder dramatischen Momenten ein melodievoller Aufschwung unterbricht.
Dem entspringt denn auch dieser andere Mangel, der ihm von Anfang an, auch in der Heimat, oft zum Vorwurf gemacht worden ist: daß seine Verse gleichsam die Narben aus jenem Kampfe tragen, daß bald dem naturwahren Ausdruck zu Liebe der Rhythmus zerhackt, bald dem Vers zu Liebe der Sprache Gewalt angethan wird; bald, und oft, geschieht beides zugleich. Es ist und bleibt unplattdeutsch, wenn der Dichter sagt: »so lang ick kann man denken«, oder: »dat Ji för Brillen keine Näs'« (wo, wie nur zu häufig, uns das Zeitwort unterschlagen wird), oder: »dat ick up ehr gaww ümmer Paß«, oder: »un as nu in den Tog irst is 'e«; – wobei jedes dieser Beispiele für Dutzende seinesgleichen steht. Auch in hochdeutscher Sprache würden wir darin Härten empfinden und Verfehlungen tadeln; der Dialekt macht sie nicht sündenfrei, denn auch er verlangt Kunst und er schreit nach Natur.
Doch, wenn jeder Mensch »die Fehler seiner Tugenden« hat, für wen gilt dies mehr als für Reuter! Hinter der Sorglosigkeit, die ihn so sündigen ließ, steht, wie der Körper hinter seinem Schatten, die wahrhaft elementar zu nennende Kraft, die nach Verlebendigung des rund und ganz Angeschauten ringt. Diese seine höchste Gabe, die ihn sofort über Hunderte sogenannter Dichter hinwegtrug, sie hat auch schon an den »Läuschen un Rimels« mitgedichtet, so harmlos und vor allem so ungleich sie sind. Ungleich im Wert des Stoffs, ungleich in der Form. Es sind Anekdoten darunter, die nach meinem Gefühl, schon ihrer epigrammatischen Natur nach, diese künstlerische Ausführung nicht vertragen; andere, die umgekehrt erst durch diese Ausführung geworden, geschaffen sind. Wie viel belauschtes Leben und psychologischer Humor steckt aber in den besten dieser Läuschen, in denen der Erzähler Raum und Anlaß fand, höchst ergötzliche Gestalten wirklich auszukneten und in dramatischer Bewegung vor uns hinzustellen. Mit immer neuem Behagen lese ich Geschichten wie »De Bullenwisch«, »De Ihr un de Freud«, »De Wedd«, »Moy inricht«, »De Gaus'handel«, »Dat Küssen ut Leiw«, »Dat Johrmark«, »De goldene Hiring«; um nur die zu nennen, die mir als die lebendigsten Menschenbilder vor Augen stehen. Aber man lese sie nicht; man höre sie. Reuters plastische Kraft würdigt man erst ganz, wenn man ihn mit Kunst, mit dramatischer Wahrheit sich vortragen läßt; wenn, so zu sagen, das in den Lettern eingefrorene lebendige Wort zwischen zwei Lippen wieder aufthaut. Denn er war ein Epiker nach ältester Art, nach dem Willen der Natur: er war ein Mann, der erzählte, dann formte, endlich niederschrieb.
Der rasche Erfolg dieser bescheidenen Versuche gab ihm den Mut, den Glauben, der ihm so lange versagt hatte. Vielleicht die schönste Zeit seines Lebens begann: hoffnungsfrohes Schaffen, junges Eheglück, blühendste Jahre, gebesserte Gesundheit, und mit alten und neuen Freunden behaglichster, heiterster Verkehr. »Wat nich surt, dat säut't ok nich«, sagt er einmal; die Zeit des »Süßens« war für ihn gekommen. Er konnte seine Unterrichtsstunden kürzen, dann aufgeben: nachdem er auch aus ihnen nach seiner Art Honig gesogen, an Schülern und Schülerinnen sich Freunde fürs Leben gewonnen, seinen Mangel an streng methodischer Schulung durch den innerlich bildenden, seelenwerbenden Zauber seiner Person ersetzt hatte. Auch diese Zeit hätte uns ohne Zweifel goldene Früchte getragen, wenn Fritz Reuter sein im Entwurf begonnenes Werk » Ut mine Schaulmeistertid« ausgeführt hätte, in dem seiner Lieblingsschülerin, der Tochter des Justizrats Schröder, die Hauptrolle bestimmt war; doch beim Entwurf ist es geblieben. Eben dieser Justizrat Schröder hatte am eifrigsten die Entstehung der »Läuschen un Rimels« gefördert, die Herausgabe durch seinen Vorschuß möglich gemacht; mit ihm, dem geborenen Helfer aller Bedrängten, dem jovialen Gesellschafter (den das 29. Kapitel der »Stromtid« humoristisch übermütig schildert), mit den treuen Thalbergern, dem trefflichen Superintendenten Schumacher und anderen Freunden genoß das Reutersche Paar die Freuden niederdeutscher, bequemster Geselligkeit. »Die heitersten Stunden unseres Lebens«, schreibt Fritz Peters, »haben wir verlebt, wenn Reuter uns von Treptow aus besuchte und uns seine Produktionen bei einem Glase Wein vorlas«. Lustige Gedichte und Trinksprüche zeugen noch von diesen guten Zeiten: sei's, daß der dankbare Poet den großen »Borger«, den Justizrat feiert, oder daß er den ersten Blumenkohl, den er in seinem Gärtchen selbst gezogen, der Herrin von Thalberg darbringt, oder sie als »Du Rose vom Thal, Du Lilie vom Berg« besingt, um sich auf eine geräucherte Wurst zu Gaste zu bitten. Und mit welcher Liebe schildert er in der »Stromtid« (in dem eben erwähnten 29. Kapitel) die Freuden der Weihnachtszeit, die sie auch später noch, von Neubrandenburg aus, bei diesen Getreuesten auf dem Landsitz zu verbringen pflegten, – kinderlos wie ihre eigene, nur darin nicht gesegnete Ehe blieb. Selbst ein Schachklub entstand in dem kleinen Treptow, durch Reuters Vorliebe für dieses edle Spiel ins Leben gerufen. Indessen das Spiel, die Feste, die Ferien waren nicht mehr sein bestes Glück: die entfesselte Schaffenslust bewährte auch an ihm ihre Magie. Kaum erwacht, begann er schon im Bett zu dichten, seine Gedanken zu ordnen; »ich durfte ihn nicht stören, nicht sprechen«, erzählt (in ihren für den Biographen verfaßten Aufzeichnungen) seine in der Erinnerung noch rührend beglückte Frau. »Mit der gestopften Pfeife setzte er sich dann zum Schreibtisch nieder; ich schob stillschweigend die große Tasse Kaffee auf ein Seitentischchen und verschwand. Um zehn Uhr wieder leise, stillschweigend, ein Butterbrot; – und wenn dann erschallte: »kannst hierbleiben, will Dir's vorlesen«, war ich so glücklich. – »Na, was meinst Du?« – Natürlich meinte ich das Allerbeste; doch wenn ich einmal Dies und Das nicht meinte, hieß es, »nein, nein, mußt nicht mäkeln«; und nach einer kleinen Weile, so recht gutmütig schmeichelnd: »will mir's überlegen, jetzt laß mich allein; will weiter schreiben« ... Wie froh, wie innerlich befriedigt fühlte er sich beim Schaffen! Anfangs sagte er wohl oft: Ja, wenn ich dies Buch vollendet habe, was dann? – Später dagegen: Der Stoff wächst mir über den Kopf; könnt' ich nur alles schreiben, was ich weiß!« –
So entstand zunächst » De Reis' nah Belligen«; nachdem er, als schwächeren Nachklang der Läuschen un Rimels, seine seit 1842 verfaßten Polterabendgedichte in hochdeutscher und niederdeutscher Mundart gesammelt und herausgegeben hatte, um sie für gleiche Anlässe nutzbar zu machen. Wie sie gelegentlich und ohne Zweifel oft rasch entstanden sind, oft auch wohl für mittelmäßige Darsteller zu berechnen waren, haben sie denn auch für Reuters Dichterwert wenig zu bedeuten, und sind – vollends da sie in seine gesammelten Werke nicht aufgenommen wurden Sie erschienen zuerst im Selbstverlag, dann (1863) in zweiter vermehrter Auflage bei A. Hildebrand, Schwerin, unter dem Titel: »Julklapp!« – wenig bekannt. Wenn ich einiges wahrhaft Humoristische oder Gemütvolle ausnehme (Eine alte Kinderfrau; Der Bräutigam; Vorspiel; Ein Orgeldreher mit seiner Frau), so wüßte ich weder von der ersten Sammlung, noch von dem späteren Zuwachs mehr zu sagen, als daß ein Mensch von Talent flüchtige Einfälle aus dem Ärmel geschüttelt hat, die er dann drucken ließ, nicht weil er eitel, sondern weil er bescheiden war.
Übrigens sind keineswegs alle seine Polterabendscherze, auch nicht alle besten veröffentlicht worden; so sind mir durch Freundeshand zwei ungedruckte (in Abschrift) zugekommen, die, für die Hochzeiten der Töchter seines alten Lehrers und Freundes, des Konrektors Gesellius in Parchim, geschrieben, sein Herz und seinen Witz in liebenswürdigster Kameradschaft zeigen. Zum Beispiel in dem ersten dieser Gedichte (von »Kutscher« und »Dienstmädchen« dramatisch dargestellt), wo er den alten Herrn, der ihn nicht ohne Nutzen in der Mathematik unterrichtet hatte, den Ehebund seiner Toni mit dem Bräutigam, einem jungen Gutsbesitzer C. Krull, in mathematischem Tiefsinn überdenken läßt:
... Der macht ein ganz dreikantiges Gesicht
Und sagt: Die Formel find' ich nicht.
Wer kann bei fehlenden Prämissen
In solchem Fall die Lösung wissen? ...
Doch eins, ihr Kinder, ist mir klar:
Wird p gesucht schon manches Jahr,
Und sitzet x im vollen Brote,
So wird das ganze keine Asymptote;
Denn 6 x 6 ist 36
Und meine Toni, die ist fleißig,
Und diese Zahl addiert zu Krull
Giebt alles andre, nur nicht Null.
Und wie liebenswürdig drollig ist das angebliche Gedicht der Braut, das durch den indiskreten Kutscher der versammelten Polterabendgesellschaft mitgeteilt wird:
Gefühle bei seinem Anblick in der Ferne.
Mein Schatz geht über'n Acker
In seinem grauen Kittel,
Hier scheint eine Zeile ausgefallen zu sein.
In gelben Stulpen hin.
Da geht der arme Stacker,
Er geht wohl auf den Acker,
Ach, wie ich selig bin!
Mein Schatz tritt seine Kluten
Erdklöße, Schollen. »Klutenpedder« (Klutentreter) ist ein Spitzname für den Landmann.,
Die Saaten zu empfangen;
Und ist er ausgegangen,
So schau ich nur nach ihm.
Es will mich fast gemuten,
Mein'n Schatz schiebt über Kluten
Ein leichter Seraphim.
Mein Schatz kehrt bald zurücke,
Wir spielen den »Kalifen«
Der »Kalif von Bagdad«, ein Klavierstück, das für dieses Liebespaar den Kuppler gespielt hatte.,
Und hat er A gegriffen,
So greife ich gleich B.
Das g'hört zum Liebesglücke,
Mein Schatz kehrt bald zurücke
Zum Liebes-ABC.
»... Ich bitte mir aber auf das ernstlichste aus,« schreibt Fritz Reuter in einem andern Fall an eine liebenswürdige junge Verwandte, die seinem guten Herzen nochmals so ein Gelegenheits-Drama abgewonnen hatte, »daß meine Autorschaft verschwiegen bleibt; denn ich will dies als das letzte Mal angesehen wissen, daß ich mich zu solchen Dingen verstehe. Verstehen Sie mich, mein Fräulein?« – Er hatte wohl Recht: der Mann, der mit vierundvierzig Jahren sein erstes größeres Werk, » De Reis nah Belligen«, der Öffentlichkeit übergab, mußte wohl fortan sich selber leben, dem erkannten Beruf sich ganz hingeben dürfen. Und mit welchem schwierigsten aller Hindernisse kämpfte noch der vierundvierzigjährige Mann! Die sehr interessante Vorrede zu dieser »Reis' nah Belligen« zeigt es: die Meinung der Menschen – selbst naher Freunde – daß er doch eigentlich kein Dichter sei, stand ihm im Wege. Ja es giebt wohl auch jetzt noch Menschen genug, die »de Reis' nah Belligen«, weil darin auch derbe Possen, handgreifliche Bauern-Späße vorgetragen werden, nicht so recht für ein Dichtwerk halten. So sonderbar unsicher ist der deutsche Geschmack; an das Erhabene, Tragische haben ihn unsere großen Dichter gewöhnt, aber wie weit das Komische gehen darf, ohne die »Litteraturfähigkeit« zu verlieren, darüber sind ihm die Regeln noch nicht verbrieft und verbucht, und so glaubt er gern einstweilen aus Vorsicht, daß schon das » Stark« das » Zu stark« sei. Ich für meine Person bekenne, daß nicht eine einzige dieser derben Scenen mich an dem Kunstwert des Ganzen irre macht; daß mir nicht eine zu derb ist. Alle aber fließen sie – die zarten wie die derben – aus Einer Quelle: aus der tiefen Erkenntnis der Bauernseele, die nach meiner Meinung nie so reich, heiter und wahr dargestellt worden ist. Mir steht »De Reis' nah Belligen« höher als »Hanne Nüte«, und dem tragischen Gegenbild »Kein Hüsung« nicht in der Tonart, aber an Reichtum gleich; – wie denn diese beiden Werke zusammen erst der ganze Mann sind. Was kann von vornherein humoristischer sein, als diese Bauernreise nach der »höheren Kultur« so ganz ins Blaue hinein; und wie weiß sie der Erzähler in rastlosen Erfindungen bis zu der Höhe zu steigern, wo die beiden Jungen, Corl und Fritz, bei Nacht in die Berliner Stadtvogtei eingeliefert, dort ihre würdigen Väter wiederfinden! sodaß der selber eingesperrte »Vader Swart« in höchster Entrüstung ausruft:
»Ih, Jung', wo, son'ne Schan'n
Makst Du mi hir in frömden Lan'n?«
Wie lebendig-gemütlich führt uns gleich der Anfang in die Bauernwelt hinein; wie setzt sich diese Kunst, Stimmung zu erzeugen, in der heißen, schlafmüden Fahrt am Tannenwald, in der Vogelpoesie der Waldeskühle, dann im Sonntagsglockenläuten des Küsters, in dem Lied vom »Strohdach«, in der überaus kunstvoll abschließenden Hochzeitsschilderung fort!
Viel später, an der »Franzosentid«, hat man Fritz Reuters ganzes Kompositions-Talent erkannt und bewundert; doch ich finde, er tritt schon mit seiner »Reis' nah Belligen« als fertiger Meister der Komposition in die Thür; er hatte nicht umsonst in langer, schweigsamer Lehrzeit sich geübt und gebildet. Wer ihn behorchen will, wie er dieses unscheinbare Bauern-Gedicht durch Wechsel der Stimmung, durch Bewegung und Ruhe, durch gelinde Steigerung, zu unserm nie ermüdenden Behagen belebt, der wird mir zustimmen, denk' ich; worauf er wohl auch mit mir bedauern mag, daß einige zu »poetische« Versteigungen in Fritz Swarts Bauernjungenbrust, und die auch hier nicht fehlenden Vers- und Sprach-Gebrechen, in den reinen Genuß einige Trübung bringen.
In demselben Jahre 1855, in dem die »Reis' nah Belligen« erschien, begann Fritz Reuter auch ein kühnes journalistisches Unternehmen, da er nun ganz und rückhaltslos das geworden war, was Bräsig (in Schurr-Murr) über ihn aussagt: ein Mann, »der sich im zurückgezogenen ökonomischen Zustand mit Schriften befleißigt, indem daß er davon seine Nahrung sucht«. Von seinem kleinen Treptower Winkel aus, fast ganz ohne Mitarbeiter, nur auf seine Feder und die erlaubte Ausnutzung andrer Zeitschriften angewiesen, unternahm er die Herausgabe eines » Unterhaltungsblattes für beide Mecklenburg und Pommern;« einer Wochenschrift, die in vier Folioseiten jeden Sonntag, zum erstenmal am 1. April 1855 erschien. »Der Zweck des Blattes«, sagte er im Programm, »würde Unterhaltung sein, und zwar Unterhaltung, die sich durchaus fern von politischen und religiösen Fragen hält, die jeden Angriff auf Personen, der über den Scherz hinausgeht, aus ihrem Kreise verbannt, und als Hintergrund, so viel als möglich, lokale Verhältnisse benutzt.« Ein Jahr hindurch gelang es seiner Fruchtbarkeit, die Schwierigkeiten dieser Aufgabe zu besiegen. Es erschien hier eine lange Reihe seiner kleineren Schriften; fast alle in Hochdeutsch, setze ich hinzu. Es erschien der erste Teil von » Meine Vaterstadt Stavenhagen« (bis zum Schluß der Jahrmarktsfreuden); die ungleich längere Fortsetzung dieser liebenswürdigen, von einigen kritischen Köpfen arg unterschätzten Plaudereien hat Reuter später, für »Schurr-Murr«, geschrieben. Es erschien die rührende Geschichte » Haunefiken«, von der er 1849 in Thalberg Einiges erlebt hatte; die geistvolle Satire » Memoiren eines alten Fliegenschimmels«, in der er das öde Dasein so manches mecklenburgischen »Vollbluts« parodierte, zugleich als wahrer Poet sich in die Leidensgeschichte eines armen Pferdelebens versenkend. Es erschien jener hochdeutsche Vorläufer der »Festungstid«, die Schilderung der Graudenzer Erlebnisse unter dem Titel: » Eine heitere Episode aus einer traurigen Zeit«; ähnlichen Inhalts, wie der entsprechende Teil der »Festungstid«, doch von Anfang bis zu Ende anders behandelt und geschrieben, in der plattdeutschen Gestalt behaglicher, liebenswürdiger, kernhafter erzählt; – jedenfalls ein noch lebendiges Zeugnis, daß Reuter den hochdeutschen und den plattdeutschen Poeten in sich gesondert hielt, daß sein Kunstgefühl sich nie dazu verstand, in der einen Sprache ebenso wie in der andern zu schreiben. Es erschien hier ferner ein politisch-humoristisches Sendschreiben » An meinen Freund R...« (Reinhard) über die höchst mühevoll durchgesetzte Wahl des liberalen Grafen Schwerin, an der er selbst als Treptower Wahlmann, als eifriger Gegner der Reaktion, sich betheiligte; ein mit frischer Laune geschriebener Aufsatz, der auch als Flugschrift »Wie der Graf Schwerin schwer in die Kammer kam. Die Wahl zu Ückermünde am 8. Oktober dieses Jahres.« (Neubrandenburg, C. Lingnau'sche Verlagsbuchhandlung. 1855.) erschien, doch zu lokal und zu »vergangen« ist, um noch jetzt neben Reuters andern Schriften zu wirken. Es erschienen Kleinigkeiten der verschiedensten Art: eine Schilderung des Jubiläums des ersten Bürgermeisters von Neubrandenburg (zu lokal, wie jene Flugschrift); zahlreiche »Läuschen un Rimels«, die später im zweiten Bande ihre Stelle fanden; nicht minder zahlreiche Schnurren und Anekdoten in Prosa, zum Teil von überwältigendem Humor. Endlich erschien hier auch die größte von Fritz Reuters Gestalten, der alte Bräsig, in seiner ersten Fassung. Es erschienen Briefe dieses bis dahin unbekannten »immeritierten Inspektors« an den Herausgeber des Unterhaltungsblattes; Plaudereien über alles und nichts, von an Bräsig gerichteten Briefen unterbrochen, auf die er antwortet, zuletzt mit dem Unterhaltungsblatt selber endend ohne Ende; unbedeutend im Inhalt, aber schon hoch ergötzlich und ganz originell durch dieses plattdeutsche Hochdeutsch, das man »Messingsch« (oder Missingsch) nennt, dessen einziger Meister Fritz Reuter, und dessen größter unsterblicher Vertreter »Onkel Bräsig« ist.
Indem ich diese »Briefe« hier nenne, die der Nachlaß mitteilt, drängt sich mir auf, von der Geschichte der Bräsig-Gestalt zu sagen, was ich von ihr weiß. Vielleicht durch den Erfolg der »Briefe«, vielleicht durch die innere Fruchtbarkeit des Gegenstandes angeregt, faßte Reuter schon damals (lange bevor er an die plattdeutsche Bearbeitung der »Stromtid« kam) den Gedanken, Bräsigs Memoiren zu schreiben, von ihm selbst erzählt. Er begann auch das erste Kapitel, oder vielmehr die »erste Pfeife Toback«: denn der Verfasser der Memoiren, der Inspektor Bräsig, muß auf »'ne Einteilung nach stündlicher Verfertigung dieser Geschichte« verzichten, weil er seine Uhr an seinen Neffen Cörling gegeben hat und sich nun »mit Pfeifen Toback durch die Zeitverhältnisse durchschlagen muß, indem daß er des Morgens 5 und 6, Nachmittags auch 5 raucht«. »Ich komme«, setzt er hinzu, »noter Weis' damit durch; dat einzigst Schlimme is man dabei, dat ich, wenn ich's Morrns um 5 Uhr aufsteh und rauch bis Mittag, was 7 Stunden sünd, dat ich dann ümmer nich weiß, ob 'ne Pfeif Toback 5/7 oder 7/5 Stunden is. Mit die verfluchte Bruchrechnung!«
»Geboren bün ich«, fährt Bräsig dann (nach einiger Einleitung) fort, »un zwarsten in der Gänse-Schlachter-Zeit, um Martini aus; anno is mich nich bekannt geworden, indem daß die dazumalige Frau Pastern Spickgänse ins Kirchenbuch gewickelt hätte: aber es muß in die vorigen achtziger Jahren gewesen sein, weil ich mir schon lange als Siebziger zu betrachten geneigt bin. Sie freuten sich Alle hellschen, als ich als Junge ankam, denn sie hatten geglaubt, ich wäre ein Mädchen, und meine Wäschen (so nannte man dazumal diese armen alten Geschöpfe, nu heißen sie Tantens) meine Wäschen holte 'ne Wachtschale und band mir an's eine Ende und an's andere 'ne fette Gans, denn sie hatten grade geschlacht und hatten keine Pfundgewichte. Und was meinen Sie, ich war mit dat Biest parallel, wog also 'n Pundner dreizehn bis vierzehn, schlecht gerechnet. Dies Allens haben sie mich woll man bloß erzählt; aber es steht mich so deutlich vor die Augen, als wär ich dabei gewesen, – wollt' ich sagen: als hätt ich's mit angesehen, – wollt' ich sagen: als hätt ich einen Verstand davon gehabt.«
Indessen bei dieser Feststellung von Bräsigs Gewicht blieb der Verfasser stehn; gleich jener »Schaulmeistertid« starben die »Memoiren« vor der Geburt. Es splitterte von dem Entwurf nur ein derber, lustiger Splitter ab: die erst 1861 geschriebenen, in »Schurr-Murr« erschienenen » Abendteuer des Entspekter Bräsig, von ihm selbst erzählt«; diese oft grausam komische, von guten Einfällen durchwachsene Reise nach Berlin, die freilich, gegen Reuters Art, zuweilen in possenhafte Unwahrscheinlichkeit ausartet und Bräsigs Gestalt, statt sie zu vertiefen, nur zum Mittelpunkt äußerlicher Lustigkeit macht. Ich verwerfe darum diese Reise-Posse nicht; es wäre sehr undankbar, da sie mich, und andre mit mir, so vielfach ergötzt hat; aber die Poesie der Bräsigschen Gestalt, in der sie jetzt, in all ihrer Lächerlichkeit, so wunderbar verklärt vor uns dasteht, schuf erst der völlig gereifte Mann, der die » Stromtid« schrieb; der die rührenden und die ergötzenden Elemente, den Lach- und den Wein-Stoff, einen messingschen Kopf und ein goldenes Herz, zu diesem unvergänglichen Menschenbild zusammenmischte, das nun ebenso typisch wie originell, ebenso durchsichtig wie unergründlich ist. Jene »Memoiren« blieben ungeschrieben; dennoch kann man sagen, daß sie in der »Stromtid« für uns enthalten sind: denn mit leiser Hand, mit bewundernswerter Kunst hat der Dichter den alten Bräsig zum beständigen Spiegel, Dolmetsch, Chor und Mittelpunkt dieser ganzen menschenreichen Geschichte gemacht, und es ereignet sich nichts, was wir nicht auch mit ihm und durch ihn erlebten. Daß dies sein künstlerischer Wille war, sagt denn auch Fritz Reuter selber am Schluß, auf seine stille, neckische, scheinbar harmlose Art. »Segg mal«, fragt Fritz Tiddelfritz ihn, den Verfasser, der auf das berühmte »Rendezvous« in dem großen Wassergraben angespielt hat, »wer hett Di de Geschicht vertellt?« – »»Bräsig««, segg ick. – »Heww ick mi dacht«, seggt hei, »Bräsig is de Hauptperson in de ganze Geschicht.« – »Dat is hei««, segg ick. – –
Das »Unterhaltungsblatt« lebte nur ein Jahr: »es fand«, wie Reuter selbst einmal darüber schreibt, »zuerst Anklang, aber fast gar keine Unterstützung, und mußte 1856 bei der Nachlässigkeit des (Neubrandenburger) Verlegers aufgegeben werden, der schließlich denn auch ohne Rechnungsablage nach Amerika durchging«. Am 1. April sagte Fritz Reuter in der letzten Nummer des Blattes dem Publikum Lebewohl:
»Denn ein Jahr hab' ich's ertragen,
Trag's nicht länger mehr;
Hab' die Schreiberei im Magen,
Bleib' nicht Redakteur.«
Zugleich sandte er auch den Treptowern, den Pommern seinen Abschiedsgruß: er verließ Stadt und Land, um sich zwei Meilen weiter, in Neubrandenburg (im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz), eine neue Heimat zu suchen. So wohl ihm manches Jahr lang in Treptow gewesen war, und so eifrig er sich auch als Stadtverordneter der städtischen Angelegenheiten angenommen hatte (unter anderm des »Tuchmachergrabens«, den er in scherzhaften Versen und auch im letzten der Bräsigschen Briefe erwähnt), so entführten ihn doch der größere Verkehr und die reizende Gegend, die er in dem am Tollenser See gelegenen aufblühenden Neubrandenburg fand.
Hier verlebte er, von 1856 bis 1863, die wichtigste Zeit seines Schaffens. Hier entstanden »Kein Hüsung«, »Ut de Franzosentid«, »Hanne Nüte«, »Ut mine Festungstid«, die ersten Bände der »Stromtid«; hier auch der größte Teil der »Urgeschicht von Meckelnborg«, die er dann bis an seinen Tod im Schreibtisch bewahrte. Hier entstanden auch – um mit seinen eigenen Worten, aus einem biographischen Brief an einen Freund, zu reden – »einige unbedeutende Lustspiele und Possen, die beim gänzlichen Mangel aller Bühnenkenntnis, vielleicht auch bei mangelhafter dramatischer Befähigung, nur einen sehr zweifelhaften Erfolg hatten. Wenn auch einige auf dem Wallnerschen Theater in Berlin zur Aufführung kamen, so ist doch der Verfasser selbst sehr schlecht mit ihnen zufrieden.« Ich citiere ihn selbst, weil man aus dem anfangs starken dramatischen Ehrgeiz, der diese Versuche hervorrief, auf eine dauernde Selbstverkennung schließen könnte. Er glaubte in der That eine Zeit lang – wohl durch die dramatische Lebendigkeit seiner Gestalten, seiner Dialoge verführt – zum Bühnendichter berufen zu sein. In diesem Glauben schrieb er, sogleich in den ersten Neubrandenburger Zeiten, das dreiaktige Lustspiel » Der 1. April 1856, oder Onkel Jakob und Onkel Jochen« (worin von den verschiedenen Personen, je nach ihrer Herkunft und Lebensstellung, Hochdeutsch, Messingsch, Berlinisch gesprochen wird), den einaktigen Schwank » Fürst Blücher in Teterow« Diese beiden Stücke erschienen zusammen, 1857, in Greifswald und Leipzig, C. A. Kochs Verlagsbuchhandlung (Th. Kunike). und das dreiaktige Lustspiel » Die drei Langhänse«; dieses hochdeutsch (nach der bekannten Geschichte von dem herrschaftlichen Beamten, der drei Ämter, drei Bureaus und drei Uniformen hatte), den Schwank fast durchweg im Messingsch, da er in dem mecklenburgischen Schilda, der Stadt Teterow, spielt. Fritz Reuter reiste nach Berlin, um den »Fürsten Blücher« und die »drei Langhänse« dem Direktor Franz Wallner persönlich zu überreichen; beide Lustspiele wurden angenommen, beide in sehr verkürzter und veränderter Gestalt Über diesen Punkt, wie fast über alles andere, hat Franz Wallner in einem Feuilleton der Wiener »Neuen Freien Presse« aus ungenauer Erinnerung berichtet. im März und im April 1858 zur Aufführung gebracht. Reusche spielte die Hauptrollen; indessen der Erfolg versagte: die »drei Langhänse« wurden nur fünf mal, »Des alten Blücher Tabackspfeife« (diesen Namen hatte der Schwank in der Theater-Bearbeitung, als »Bühnen-Manuskript«, erhalten) nur drei mal gespielt. Den Stücken geschah nicht Unrecht; denn in beiden ist der dramatische Stoff und Gehalt so gering, daß nur der Reiz der Kleinmalerei, die behagliche, breite Ausführung ihn lebendig machte; schnitt man nun diese der Bühne zu Liebe fort, so schnitt man die Pulsader mit durch. So ist denn die Theater-Bearbeitung »Des alten Blücher Tabackspfeife« nur noch eine Verstümmelung des ursprünglichen, ergötzlichen Kleinstädter-Schwanks »Fürst Blücher in Teterow«; und so würde auch »Onkel Jakob und Onkel Jochen«, wenn man dieses »Lustspiel« etwa für die Bühne herrichten wollte, den gemütlichen Schlafrock seiner Redseligkeit verlieren und in seiner undramatischen Blöße dastehen.
Der Dichter war denn auch hellsichtig genug, seinen Irrtum zu erkennen; wie er mir 1862 (nachdem er einen von mir veröffentlichten Aufsatz über ihn gelesen) in seiner edlen Offenheit schrieb: »Was Sie da über die verfehlte dramatische Carriere sagen, ist durchaus richtig, und der Grund, den Sie dafür anführen, nicht weniger; ich nahm die Sache bei völliger Bühnenunkenntnis zu leicht.« Nachdem er noch (gleichfalls 1858) in Rostock einen Mißerfolg mit einer aus dem Ärmel geschüttelten Posse erlitten hatte, verließ er diesen Seitenweg, der ihn seinem eigenen entführte. Er blieb bei dem Wort, das er, durch einen bestimmten Anlaß aufgefordert, einem seiner Freunde sagte: »Theaterstücke und Polterabendstückschen schriw ick nich wedder.«
Dagegen hatte er mittlerweile (1857) die Dichtung veröffentlicht, die ihm – bis an sein Ende, wie es scheint – vor allen wert war: » Kein Hüsung«; unter seinen lebensfrohen Werken das einzige, das in die Unterwelt des Tragischen und Trostlosen hinabführt. »Ich habe dieses Buch,« sagt er in einem seiner zutraulichen, mitteilsamen Briefe, »einmal mit meinem Herzblut im Interesse der leidenden Menschheit geschrieben; ich halte es für mein bestes«. Dies sagte er, nachdem er alle seine Hauptwerke vollendet hatte; und dies auch von Andern, Berufenen bestätigt zu hören, war sein Wunsch, sein Glück. Ich für meine Person werde immer die »Franzosentid« und die »Stromtid« für seine vollendetsten und erfreuendsten Schöpfungen halten. Gleichwohl bewundre ich an »Kein Hüsung« nicht nur das leidenschaftlich mitfühlende, edle Herz, die reine Glut des Hasses, die Innigkeit, mit der er das Leben der Niedrigen im Staube verklärt; ich bewundre auch die starke Melodie, die durch die zweihundert Seiten dieses Gedichts erklingt, die poetische, fortreißende Gewalt, mit der sein »Herzblut« sich ausströmt. Die Melodie ist so herrschend, daß hier dem Naturalismus selten, sie zu brechen, gelingt; die Natur- und Stimmungsbilder sind in so tiefe, warme Farben getaucht, Schilderungen wie die des Brandes, der Hirschjagd, des Festes im Herrenhaus, der Flucht, der gespenstischen Nacht, endlich des stillen, milden Wahnsinns, so groß und stilvoll empfunden, daß ihnen nichts Ähnliches in Reuters anderen Dichtungen gleichkommt; daß ich mich an Walter Scotts schönste epische Dichtungen erinnert fühle. Auch erreicht er vielleicht nirgends so starke lyrische Wirkungen wie hier, durch den freien Wechsel im Versmaß; und selten wird man etwas Rührenderes lesen als den sanften, schmeichelnden, gleichsam elementaren Tod, den die arme wahnsinnige Marie im Teichwasser sucht. Doch wenn ich zum Inhalt komme, finde ich den Dichter, aus allzu großem Gerechtigkeitstrieb, nicht gerecht. Sein tragischer Held, der Knecht Johann, kann die Geliebte nicht zu seinem ehrlichen Weib machen, weil der Herr ihm »kein Hüsung« geben, aus tyrannischem Eigenwillen auf seinen Gütern nicht freien lassen will; alles Bitten, jede Beschwerde, jede Anrufung anderer Mächte ist nutzlos. Von furchtbaren Gesetzen und einem noch furchtbareren Herrn zu Boden getreten, in jeder guten Regung verwundet, aus der Liebe heraus in den Haß gehetzt, endlich nur noch von der Wut der Verzweiflung erfüllt, steht er im gefährlichsten Augenblick diesem Unmenschen, der noch sein »Herr« ist, gegenüber, fühlt dessen Peitsche in seinem Gesicht, – und stößt ihn nieder. Ein einziger, blinder Stoß; doch der Stoß ist Tod. Vor welchem Tribunal hieße das »Mord«? Dieser Totschlag – mit so sicherer, fester Hand als etwas Unausweichbares vom Dichter herbeigeführt – warum wird er nun wie ein Mord gebüßt? Warum verfolgt er den Flüchtling wie ein unsühnbarer Fluch; warum darf seine Geliebte, die Mutter seines Kindes, nicht mit ihm über den Ocean fliehn? Weil es heißt: Herr und Knecht? Danach darf der Dichter nicht fragen, der nicht nach dem geschriebenen, sondern nach dem unsichtbaren Gesetze richtet. Ein wackrer, unverdorbener, zerquälter Mensch schlägt einen Unmenschen, Streich mit Streich erwidernd, in blindem Ungefähr tot; diese Schuld ist so klein, daß kein ehrliches Weib darum schaudern sollte, dem geliebten Mann in die Verbannung zu folgen. Schaudert sie dennoch – oder läßt sie sich durch Andrer Meinung zurückschrecken – so ist mein tragisches Mitgefühl dahin: so sehe ich eben nur die arme Seele einer Dorfmagd, die das Schicksal zertritt. Dies, und was daraus folgt, hat wohl auch der Dichter gefühlt; denn er spricht, innerlich schwankend, mehr als eine Meinung über That und Schuld aus, und der Schluß, poetisch schwach und gebrochen wie er ist, läßt uns leider den Riß, der durch die Dichtung geht, nur um so tiefer erkennen.
Dennoch war Reuter mit dieser Schöpfung auf eine Höhe gelangt, die schwerlich irgend ein Leser der »Läuschen un Rimels« geahnt hatte; und er sollte mit seinem nächsten größeren Werk den Gipfel ersteigen, auf dem er endlich auch den Hochdeutschen sichtbar ward. Denn bis dahin blieb sein Name, sein Erfolg noch innerhalb der plattdeutschen Grenzen. Ende 1857 erschien die erste Rezension »draußen im Reich«, in Prutz' Deutschem Museum, die ihn mit warmer Anerkennung begrüßte; aber noch auf Jahre hinaus ward es wieder still. Als er 1858 den zweiten Band seiner » Läuschen un Rimels« gesammelt hatte und für den Debit seines Selbstverlags (den er noch betrieb) einen Hamburger Buchhändler suchte, fand sich keiner, der sich auch nur zu diesem ungefährlichen Geschäft gewinnen ließ: so wenig glaubte man selbst in dem plattdeutschen Hamburg damals an seinen Erfolg. Denn Claus Groth galt noch allein; Claus Groth griff Fritz Reuter mit starkem Widerspruch, ja mit herber Verurteilung an; Grund genug für die Hamburger Buchhändler, kein »Stück Brot« von ihm anzunehmen. In gerechtem Unwillen und mit seiner kräftigen Beredsamkeit trat freilich Reuter dieser Verunglimpfung entgegen, in der kleinen Schrift: » Abweisung der ungerechten Angriffe und unwahren Behauptungen, welche Dr. Claus Groth in seinen Briefen über Plattdeutsch und Hochdeutsch gegen mich gerichtet hat.« Berlin 1858, bei Rudolph Wagner. Bei dieser Polemik zu verweilen, ist heute kein Anlaß mehr. Reuters Größe ist längst auch von Claus Groth erkannt und anerkannt worden, und niemand wird mehr die einstigen »Nebenbuhler« mit einander vergleichen. Damals aber wehrte sich Fritz Reuter noch mit der Energie eines Menschen, der für sein litterarisches Dasein kämpft. Er fand endlich den Stoff und die Form, die ihn zu einem Schriftsteller deutscher Nation machen sollten. Er schrieb, in Prosa, den Roman: » Ut de Franzosentid«.
Ich erinnere mich noch, wie damals – Anfang 1860 – mein Exemplar dieser »Ollen Kamellen« zu mir nach München kam und mich in staunendes, wachsendes, unbeschreibliches Behagen versetzte. Schon die kleine Erzählung » Woans ick tau 'ne Frau kamm« (die ich damals wohl auch für ein Stück Wirklichkeit hielt, während sie nur ein scherzhafter Mißbrauch der eigenen Person ist) entzückte mich durch ihren Vortrag, durch diese neckisch gemütliche, geistreich-schlichte vollkommene Simplizität, in der nichts zu viel, nichts zu wenig ist; die scheinbar nur plaudert wie von Mund zu Mund, und doch den unendlichen Genuß eines Kunstwerks in uns zurückläßt. Aber wie sehr steigerte sich noch dieser Genuß, als ich an das Größere, an die »Franzosentid« kam. Eine wunderbare Wirklichkeit, unmerklich, doch mit Künstlerhand idealisiert; rührend und Lachthränen hervorrufend oft in derselben Sekunde; die Menschen alle so leibhaftig, daß man sie nicht mehr vergißt, und alle auf dem Prüfstein eines großen weltgeschichtlichen, herzergreifenden Vorgangs erprobt; und diese durch und durch erfreuende Geschichte mit wahrhaft klassischem Behagen erzählt, so kunstvoll erzählt, daß der höchste Ruhm und Lohn des Künstlers, die vollkommene Selbstverständlichkeit erreicht ist. Ich gab das Buch an Paul Heyse, an Windscheid, an andere ästhetisch feinfühlige Freunde; sie gerieten alle in dasselbe Entzücken, und wir faßten den Gedanken, dem Dichter (den die Meisten unter ihnen nun erst kennen lernten) in einem gemeinsamen Schreiben unsern Dank, unsere Bewunderung auszusprechen. Wie so viele gute Regungen ward leider auch diese nicht zur That, jeder Tag gab sie an den folgenden weiter, bis sie, wie die Fackel bei jenem Gesellschaftsspiel, erlosch; aber eine Münchener Reuter-Gemeinde hatte sich gebildet, die gleichsam durch neue Zellenknospung fort und fort wuchs, und zwei Jahre später entlud ich mich der auf meinem Herzen lastenden Schuld, den Lesern der »Süddeutschen Zeitung« von diesem niederdeutschen Poeten, und ihm selbst von unserer »Gemeinde« zu erzählen.
Fritz Reuter eroberte sich mit den »Ollen Kamellen« seine Stellung in der deutschen Litteratur; gleichzeitig hatte er auch, nach allerlei Fehlversuchen und nach manchen tragikomischen Erfahrungen des Selbstverlags (wie ihm denn einmal ein Stettiner Buchhändler statt barer Zahlung geräucherte Eßwaren schickte) in Hinstorff den Verleger gefunden, mit dem er nun bis an sein Ende verbunden blieb. Schon als Gymnasiast, in Parchim, hatte er ihn kennen gelernt. Er übergab ihm jetzt die neuen Werke und die neuen Auflagen der alten, und offenbar hat Hinstorffs Rastlosigkeit das ihre gethan, den äußeren Erfolg dem inneren gleich zu machen. Die Zeit des Gedeihens begann. Gegen den Gewinn des Verlegers kam der Dichter mit dem seinigen nicht zu kurz; – und ich sollte vielleicht bei dieser Gelegenheit bemerken, daß die »fünfhundert Thaler« Honorar, von denen die Einleitung zur »Urgeschicht von Meckelnborg« erzählt, nur eine humoristische Arabeske sind, die an der ungleich höheren Säule der Wirklichkeit hinaufrankt.
Der »Franzosentid« folgte 1860 » Hanne Nüte un de lütte Pudel« nach; diese Vogel- und Menschengeschichte, in der Fritz Reuter noch einmal zur Versdichtung zurückkehrte. Schon als Knabe hatte er, wie ich ihm nacherzählt habe, durch den »Onkel Herse« die Vögel behorchen gelernt; er ward »vogelsprachekundig« wie wenige Dichter, alle Singvögel seiner Heimat kannte er an ihren Stimmen so gut wie an ihren Federn. Wie viele Stimmungsbilder in seinen Dichtungen geben davon Kunde! An der äußeren Mauer seines Hauses in Neubrandenburg, dem sogenannten Zwischenhäuschen, hatte ein Sperling sein Nest gebaut; das Gezwitscher der Familie, in allen Tonarten, lag ihm solange im Ohr, bis es die Phantasie ergriff und sie antrieb, das Ineinanderwirken von Vogel- und Menschenleben dichterisch zu gestalten. So entstand »Hanne Nüte«. Wie viel lyrischen und humoristischen Reiz er dieser Idee gegeben hat, ist bekannt: vielleicht bestreitet man mir aber auch ebenso wenig, daß sein dichterisches Vorhaben ihm nicht ganz gelungen ist. Ich will gelten lassen (obwohl mein Gefühl der Ausführung nicht überall zustimmt), daß er mit dem Recht des phantastischen Humors seine Vögel gleichsam zu einer märchenhaften Menschenart machte, die sich nicht bloß unserer Sprache, auch unserer Sitten und unserer Denkart bedient. Er mochte sich dafür auf eines seiner Lieblingsbücher, auf das alte Thierepos Reineke Fuchs berufen, dem (wahrscheinlich) ein Landsmann, der Rostocker Stadtschreiber Hermann Barkhusen, seine berühmte niederdeutsche Gestalt gegeben hatte; das dann durch Goethes Bearbeitung – nach Reuters Urteil – nicht ohne einige Schädigung verhochdeutscht worden war. Sollte nicht einem neuen niederdeutschen Poeten vergönnt sein, den Geist der Tierfabel noch einmal, mit freier Originalität, lebendig zu machen? – Ich widerstreite dem nicht. Auch diesen Nachteil, in den er sich begab, daß er Tierfabel und Menschenwirklichkeit neben einander stellte, so daß eine reine Märchenstimmung nie entstehen kann, auch diesen Nachteil will ich nicht gegen ihn zu Felde führen; es wäre vielleicht moderne Pedanterie. Aber die Erfindung scheint mir unzulänglich. Die Aufgaben, die er seiner Nachtigall, seinem Storch, seiner Sperlingsfamilie giebt, um in das Schicksal der menschlichen Helden einzugreifen, treten nicht so bedeutend, so phantasievoll oder so plastisch vor mich hin, daß sie der großen Maschinerie entsprächen, die der Dichter aufwendet. Der zweite Teil des »Hanne Nüte« dehnt sich noch fort und fort, und schon ist meine Stimmung erlahmt. Ich lese, ich bewundere diesen oder jenen einzelnen Reiz, aber ich sage mir: Es müßte die Lösung kommen, – oder ein neuer, großer schöpferischer Gedanke.
So hat mich denn, so oft ich »Hanne Nüte« las, die erste Hälfte unvergleichlich viel mehr, als die zweite, gefesselt und gefangen; in jener ersten aber – wie viel Reiz, Wahrheit und Poesie! Schon sogleich die frische, frühlingsselige Introduktion; die vier wunderbaren Abschiedsscenen des jungen Gesellen von Küster, Pfarrer, Vater und Mutter; dann die Tierwelt in Wald, Feld und Teich, wie von einem gutartigen Zauberer behorcht und für die unkundigen Menschen in heitere Reime gebracht. Hier zeigt Fritz Reuter noch einmal seine eigentümliche, aus der Welle des Epischen emportauchende lyrische Kraft; – zum letztenmal. Denn er war fortan der Prosadichtung verfallen. Er hatte zu viel zu sagen, das nur in der geschmeidigsten aller Formen, in der einfachen Erzählung, im Roman ganz zu sagen ist.
Zuerst erschien (1861) » Schurr-Murr«; eine Sammlung, deren Überschrift sich selber erklärt:
»Wat tausamen is schrapt ut de hochdütsche Schöttel,
Ut den plattdütschen Pott und den missingschen Ketel.«
Was diese Sammlung außer den früher schon erwähnten Erzählungen noch enthält, ist im Inhalt unbedeutend, im Vortrag vortrefflich: das kleine » Von 't Pird up den Esel« und die ergötzliche Geschichte » Wat bi 'ne Aewerraschung 'rute kamen kann.« Schon im »Unterhaltungsblatt« hatte Reuter diese Geschichte als kurzgefaßte Anekdote erzählt; doch spielte sie dort in Jena (vermutlich der Wahrheit getreu) und entbehrte noch des Pfeffers, nämlich des vierten Bocks: der vom Schwager fehlte. Man nahm auch dieses Buch, wie »Hanne Nüte«, mit Anteil und Wärme auf; doch erst das nächste sollte wieder die volle, rückhaltlose Gunst des Publikums, und auch dem Gemüt des Dichters alle warmen Herzen gewinnen. Ich meine das Buch » Ut mine Festungstid«, das er 1862 herausgab.
»Mein lieber Bruder«, schreibt er darüber an Julius Wiggers, der nicht lange vorher sein auf den Berlin-Rostocker Hochverratsprozeß bezügliches Werk »Vierundvierzig Monate Untersuchungshaft« veröffentlicht hatte: »Du hast die an Dir begangenen Niederträchtigkeiten noch im frischen Gedächtnis, so daß Du dieselben pragmatisch niederschreiben konntest, zwischen meinem Jetzt und Damals liegen aber schon 25 Jahre Er denkt offenbar zunächst an die Glogauer und Magdeburger Zeit von 1837, womit seine Erzählung beginnt., die mich manche Bitterkeit vergessen lassen konnten, und mich in den Stand setzten, sogar diese Zeit meines Lebens in die rosigen Fluten des Humors zu tauchen. Aber alle Momente wollen sich nicht heiter färben lassen, sie bleiben in ihr scheußliches Grau gekleidet stehen, und wenn ich die heiteren auch ein wenig mit erfundenem Spaß auflasiert habe, die grauen habe ich ehrlich in ihrer trübseligen Wahrheit stehen lassen.« Diese Worte sagen, wie das Buch entstand. Fritz Reuter war ein freier, glücklicher und zufriedener Mensch; der Haß, der sich rächen möchte, war in ihm erloschen; nur noch der Haß gegen Unrecht, Grausamkeit, Gemeinheit, den jedes gesunde Herz ewig fühlen soll, ward in ihm heiß, wenn er jener Zeiten gedachte. Eine wirklich historische Darstellung der sieben Jahre zu schreiben, war ihm nicht mehr möglich: dazu lagen sie selbst seinem treuen Gedächtnis zu fern. So entschloß er sich denn zu dieser Mischung von Dichtung und Wahrheit, von Ernst und Scherz, die seinem schriftstellerischen Naturtrieb, seiner heiteren Gemütsverfassung entsprach. Wahrheit, wo er seine Leiden, – Dichtung und Wahrheit, wo er die kleinen Freuden dieses Elends erzählte. Es giebt denn auch keinen beredteren Zeugen für die Milde, Güte und Heiterkeit seiner Seele, als dieses im Zorn so reine, im Scherz so harmlose Buch; das zugleich wieder die ganze Kunst dieses geborenen Erzählers bewährt: plaudernd zu unterrichten, plaudernd zu erschüttern, plaudernd ans Zwerchfell, plaudernd ins Herz zu greifen.
Er lebte inzwischen in seiner kleinen Welt, seines häuslichen Glücks und seiner Erfolge froh, leidlich genügsam hin; den dürftigen sozialen Freuden, die ihm der »Klub«, ein gelegentliches Fest, zu Zeiten das Theater gewährte, half der Verkehr mit den alten Freunden nach, die er über die Grenze hinüber gern und oft besuchte. Ja er übernahm noch zuweilen seinen alten Freundesposten als »Statthalter von Thalberg«, wenn der Gutsherr und die Gutsherrin verreisten; so im August 1857, wo er dann mit glücklichstem Humor den Abwesenden über den Stand der Dinge berichtet. »Unsre Wirtschaft«, schreibt er im ersten dieser Briefe, »geht sehr gut; wir machen's aber auch gerade so wie die ältesten, erfahrensten Landknüppel, wir machen sehr viel kluge Streiche und wahrscheinlich auch viele Dummheiten, wissen aber jedesmal, wenn wir die letzteren gemacht haben, sehr gediegene Gründe dafür anzuführen ... Die Rollen in der Wirtschaft sind gut verteilt. Ein Jeder repräsentiert in dem großen Uhrwerk des Thalberger Hoflebens etwas. Clemens [der eigentliche sogenannte »Statthalter«] ist die große Welle, um die sich alles dreht, mit der ganzen Wucht seiner jetzigen Stellung wälzt er sich herum von Scheunthür zu Scheunthür; um die große Reibung seines dermaligen Gewichts zu vermindern, hat er seine Zapfen in gefettetes Leder eingelassen, die der Techniker »Kanonen« zu nennen pflegt. Der Doktor P. ist unsere Unruh, er ist die laufende Spindel des Gewerks; ich repräsentier' das Element der Trägheit, das Gewicht; ich fall' des Morgens aus der grauen Stube in die Vorstube und von da in die Laube, dann wieder rückwärts, und gehe eigentlich immer so lange, bis ich wieder aufgezogen werde, was fünfmal des Tages geschieht, und immer zu spät. Mutting ist der Weiser an der Uhr; meine teure Ehegattin der Kukuk, der in das ruhige Tick Tack störend eintritt, und Höpper ist der Wecker. Alle Andern sind Räder und Schrauben, und die teure Mamsell [die Wirthschafterin] ist die Schmiere, die alles im Gange halten sollte; aber! aber! – – – Sieh hier die Umrisse zweier dicker Thränen, die mir auf das Papier getropft sind; sie gelten den edlen geschiedenen Mamsellen, wahren Vollblutmamsellen gegen diesen Mamsellenklepper. Sie mag in einer guten Schule gewesen sein; aber es ist kein Zungenschlag darin, und dann, lieber Fritz, glaube ich, sie bockt. Keine Tugend für 'ne Mamsell!«
Ein schweres, doch zum Glück nicht unwiderrufliches Schicksal traf ihn im November 1858: er starb durch die Feder eines Journalisten, und lebte erst durch ein berichtigendes Inserat wieder auf. Die Stralsunder Zeitung brachte die Nachricht seines Todes; – es ist nie aufgeklärt worden, warum. Fritz Reuter nahm sich seiner mit großer Energie an. Er ersuchte, sowie er davon erfuhr, die Stralsunder Zeitung um Aufnahme folgender Mitteilung: »Da ich einen leicht begreiflichen Widerwillen gegen das Lebendigbegrabenwerden habe, sind Sie wohl so freundlich, mich aus Nr. 268 Ihrer geehrten Zeitung wieder auszugraben, zumal mich besondere Gründe veranlassen, wenn's Gott gefällt, noch länger unter den Lebenden zu weilen.« Gleichzeitig schickte er an die Stettiner Zeitung, die die falsche Nachricht weiter verbreitet hatte, folgendes »Inserat zur Berichtigung«:
»Ih, woans – dod? – Ick denk nich dran,
Dat föllt mi gor nich in;
Ne, ne! So lang' ick leben kann,
Will 'ck nich begraben sin.«
Mittlerweile gingen ihm von vielen Seiten teilnehmende Anfragen zu; er gab Antworten, so viel er konnte; unter anderm in folgendem humoristischen Brief: »Lieber Freund! Man geht nicht mit mir um, wie recht ist: Sie lassen mir Seite 24 Ihres neuen plattdeutschen Kalenders vor aller Leute Augen Maulschellen geben, ein andrer Quidam versucht es, mich litterarisch totzuschlagen, und nun kommen die Zeitungen und schlagen mich physisch tot. Ich komme mit einer Gegenerklärung ... Was hilft mir das? Wer glaubt's? Die Leute sagen: »er spaßt nur, er sitzt schon in der Übergangsstation der Seherin von Prevorst, dem Monde, und korrespondiert nur noch kümmerlich mit einigen Sternwarten; die Nachricht von seinem Tode ist echt, die Nachricht von seinem Leben ist ein »Läuschen«, eine Ente.« Ich setze mich hin und schreibe an alle Freunde, Bekannte, Verwandte; ich bezahle Postgeld, daß man mich dafür dreimal mit vollem Geläute hätte begraben können; ich erkläre, ich stille, ich beruhige: »Kinder, ich bitte Euch; mein Ende ist die Ente, und daß ich noch schaue der Sonne Glanz, ist der Wirklichkeit süße gebratene Gans«. Gottlob, denke ich, nun ist alles wieder in der Reihe, nun hast Du wieder ein unbestrittenes Recht, diese schönen Erdennebel einzuatmen, kannst mit gutem Gewissen aufs Glatteis fallen, und keiner macht es Dir streitig, zu Neujahr Deine Rechnungen zu bezahlen. – Da kommen Sie, mein teurer Freund, und bitten um ein Lebenszeichen. – Gott im Himmel, Herr Doktor, wo sollen denn diese Lebenszeichen alle herkommen? Ich schieße mich ja tot, wenn ich die galvanische Batterie, die wir Lebenskraft nennen, so oft entlade.«
Schon vor diesem ungefährlichen Zeitungstod, im Sommer 1858, hatte er den Ort wiedergesehn, dem er damals sein wirkliches Todesurteil und sein wahres Unglück zu verdanken gehabt hatte: Jena, – bei dem dreihundertjährigen Jubiläum der Universität. Andre Reisen, die ihn anregten und mit Deutschland in Beziehung brachten, folgten nach; so im Jahre 1861 ein größerer Ausflug mit seiner Frau, der ihn über Schwerin, Wismar, Lübeck nach Westfalen, an den Rhein, in die Pfalz, nach Thüringen, endlich über Leipzig und Berlin in die Heimat führte. In Westfalen sah er seinen besonders geliebten Leidensgefährten aus Magdeburg, Grashof, wieder; »das war eine Freude des Wiedersehens«, schreibt er an einen Freund (Hobein in Schwerin), »von der Ihr andern Menschen, die Ihr nie mit einem Freunde zusammen hinter Schloß und Riegel gesessen habt, keine Vorstellung haben könnt. Wir stiegen im Gasthofe ab, aber sowie ich aus dem Wagen getreten war, stürzte aus dem gegenüber liegenden Hause ein Mensch auf mich los: »»Mensch! Mensch! wo kommst Du her!«« und wir lagen uns nach 23 Jahren Der Brief nennt eine andere, irrtümliche Zahl. zum erstenmale wieder in den Armen.« In Bonn lernte er Jahn (der »Kein Hüsung« für sein bestes Werk erklärte), in Leipzig Julian Schmidt kennen, der nicht lange vorher in den »Grenzboten« mit Wärme auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Endlich in Berlin besuchte er den alten Jakob Grimm; »er hat viel und mancherlei«, schreibt Reuter, »mit mir über Plattdeutsch geredet und alles so milde besprochen, so freundlich beurteilt, daß mir das ganze Herz aufging. Ich wollte, Du sähest einmal in diese treuen Augen und fühltest Dich einmal durch dieses ermutigende Lächeln gekräftigt.«
Schon auf und nach dieser Reise rührte sich das Verlangen Reuters und seiner Frau, eine neue Heimat aufzusuchen. Die doch allzu abgelegene Existenz genügte ihnen nicht mehr; andere, schönere Gegenden hatten sie gereizt. Der durch Universität und Seefahrt belebten Hauptstadt Rostock, an die sie eine Zeit lang dachten, fehlte die schöne Natur, fehlte auch der eigentümliche, idyllische Zauber, der sie endlich an den Fuß der Wartburg, nach Eisenach zog. Es wirkte wohl auch der Wunsch mit, freiere Luft zu atmen; nicht fort und fort diese erbvergleichliche Erbweisheitsluft, die ihn in diesen Jahren noch einmal zum Satiriker gemacht und ihm seine » Urgeschicht von Meckelnborg« eingegeben hatte. Schon 1859 hatte er sie begonnen; 1862 vollendete er sie ungefähr so weit, wie sie druckreif geworden ist. »Ich habe,« schrieb er mir damals (auf eine Anfrage wegen bruchstückweiser Verhochdeutschung), »ich habe die ernstesten Dinge unseres armen Vaterlandes des komischen Kontrastes wegen in einer so derben, hausbackenen Tagelöhnersprache geschrieben, daß ich für meine Person durchaus daran verzweifeln muß, dieselbe auch nur annähernd durch das Hochdeutsche wiedergeben zu können. Es ist, oder besser, wird mein plattdeutschestes Buch.« Wenigstens kann man es wohl die originellste seiner Schriften nennen; scharfe, herbe Satire in dem gemütlichsten aller Dialekte, mit einer Einleitung voll harmlosester, allerbester Laune; liebenswürdige Schalkhaftigkeit auch da, wo er schlägt, doch jeder Schlag kommt aus fester Hand und trifft seinen Mann.
Übrigens blieb sein Herz, aller gerechten Bitterkeit der Satire zum Trotz, nicht nur ein mecklenburgisches Herz, so lange es schlug: es hatte auch einen stillen Zug zur regierenden Dynastie. Dafür zeugt nicht sowohl die menschlich schöne Dankbarkeit, die er seinem Befreier Paul Friedrich bewahrte, als die herzliche Schilderung Friedrich Franz des Ersten im letzten Teil von »Dörchläuchting«, und der fast anmutig zu nennende Verkehr, in dem er mit dem jetzt regierenden Großherzog stand. In Briefen und Versen an ihn erging sich sein Humor wie sein Gemüt; und die Einleitung zur »Urgeschicht« hat er dem Fürsten selber vorgelesen.
Nichts aber zeigt uns sein mecklenburgisches Herz besser, leibhaftiger, als sein größtes Werk, dessen erste Bände er (mit teilweiser Benützung jenes ersten hochdeutschen Versuchs) noch in Neubrandenburg vollendete, sein Roman » Ut mine Stromtid«. In diese Dichtung hat er mit vollem epischen Behagen alles niedergelegt, was die zehnjährige »Irrfahrt« seiner Landmannszeit ihm an Stoff hinterließ; bis auf die verrückten Verse aus dem »gräflichen Geburtstag«, die beim festlichen Einzug der Pümpelhäger Herrschaften in Marie Möllers Munde wiederkehren, und bis auf die Boston-Partie im letzten »Bräsig-Brief«, die sich in breiterer, wunderbarster Ausführung im 22. Kapitel der »Stromtid« verjüngt. Wie anders ist denn auch die Architektur dieses Romans, mit der der »Franzosentid« verglichen! Dort gedrungene Einheit, in kurzem Zeitraum, der sich nur in der Nachgeschichte verbreitert; hier ein langsames, bequemes Sichweiterschieben von Menschen und Dingen, das kritisch anzufechten gleichwohl ganz nutzlos ist, weil es durch die erstaunliche Lebensfülle und Wahrheit der Erzählung als die natürlichste und berechtigtste Kunstform erscheint. 1829 spielt die »Einleitung« oder Vorgeschichte; von 1840 bis 48 leben wir dann im eigentlichen Roman; das Schlußkapitel führt uns noch wieder über achtzehn Jahre hinweg. Mit welchen kleinen Künsten, in Ernst und Scherz, doch auch mit wie ehrlicher Naivität der Dichter sich dieser Freiheit bedient, die dem Talent von Gottes Gnaden zusteht, wird ein aufmerksamer Leser mit Vergnügen verfolgen. Man kann meines Erachtens nur eines an der »Stromtid« nachdrücklich tadeln: die sonderbar akademische, unlebendige Weise, in der zuweilen die Vornehmen, insbesondere Ida und einmal auch Franz, sich aussprechen; ja selbst Luise, eine nach meinem Gefühl etwas zu zarte, zu humorlose Gestalt, läuft mitunter Gefahr, uns durch unpersönliche Redeform zu erkälten. Dies befremdet um so mehr, da sonst alles eitel Leben und Wahrheit ist. Auch erlebte Wirklichkeit? – Man hat es vielfach geglaubt. Gleichwohl irrt man, wenn man die einzelnen Gestalten, so wie sie nun dastehen, unter den Lebenden oder Gestorbenen sucht. In einem Brief an mehrere warme Verehrer, die mit Ungeduld nach dem noch nicht erschienenen dritten Bande verlangten, berichtigt er diesen Irrtum mit folgenden Worten (ich zitiere sie hochdeutsch): »Mit Ausnahme von dem Spitzbuben, dem Notarius Slus'uhr, und dem alten Moses hat keiner von diesen Menschen gelebt. Aber – Gott sei Dank – die Art lebt noch in Deutschland, und die Art habe ich beschreiben wollen.«
Unter den unzähligen Zeugnissen der Verehrung, die diese »Ollen Kamellen« und insbesondere die »Stromtid« ihm eintrugen, erfreute ihn wohl keines mehr als das Doktor-Diplom, das ihm honoris causa die Rostocker Universität 1863 verlieh. Die Motivierung lautet: » Qui vir et dialectum patriam et sensus animi patrios callet; quem eundem gratiae ipsae musis conjunctae jocis miscere seria docuerunt; cujus scriptoris quum alia opera tum etiam librum aureolum huncce »Olle Camellen« Germania laudat universa.« In diesem neuen Kleid der Ehren siedelte er im Sommer desselben Jahres nach Eisenach über; dort vollendete er die »Stromtid«; dort verweilte er nun bis an seinen Tod.

Villa Reuter in Eisenach.
(Nach einer Photographie des Hofphotographen G. Jagemann in Eisenach.)
Indem er die Sonnenhöhe des Ruhmes erstieg, begann auch schon die lange, langsame Dämmerung seiner Lebenskraft; so viel Freude auch noch seine genußfähige Seele aus dem geliebten Dasein saugen sollte. Nach dem fruchtbaren Schaffen der sieben Neubrandenburger Jahre kam die herbstliche Zeit; Ernte, Ruhe, Genuß. Er unternahm im Frühjahr 1864 die Reise nach Konstantinopel, die er in dem gleichbenannten Roman verwertet hat; er suchte im Januar und Februar 1865 die Heimat wieder auf und ward auf einer Rundreise durch Mecklenburg von seinen Landsleuten so herzlich gefeiert, daß dieser Triumphzug ihn im innersten Herzen erquicken mußte. Eben hatte er dann 1866 seinen Roman » Dörchläuchting« vollendet und veröffentlicht – ein aus übermütiger Satire und kleinstädtischer Poesie sehr anziehend gemischtes Buch, das große Verdienste hat, doch damals durch seine größeren Vorgänger fast erdrückt ward – als der Krieg von 1866 hereinbrach und, in allem Elend des »Bruderkampfs«, sein emporringendes vaterländisches Gefühl entflammte. Er stand von vornherein auf der Seite der Kraft, die etwas schaffen konnte. Den Kampf für einen so hohen Zweck scheute seine männliche Gesinnung nicht; wie er denn zur Fahnenweihe des Treptower Männerturnvereins, einige Jahre früher, im Namen der die Fahne stiftenden Frauen und Jungfrauen gedichtet hatte:
... Ihr sollt sie tragen auch wenn Stürme dräuen,
Wenn Wetterwolken auf zum Himmel ragen,
Das Beste sollt ihr für sie wagen
Und selbst den Tod sollt ihr nicht scheuen.
Die Freiheit ist ein wundersames Bild:
Wer einst gekniet zu seinen Füßen,
Der trotzt den Schwertern und den Spießen,
Ist er nicht Sieger, legt ihn auf den Schild. –
Und faßt darob Euch banges Grauen,
Dann gebt uns nur zurück das Zeichen,
Wir wollen's dann als alte Frauen
Dereinstens Euren Kindern reichen,
Die machen dann, wie spät's auch sei,
Die deutschen Lande siegreich, einig, frei!
Er sah nun die Einigkeit Deutschlands aus heißer Zwietracht hervorwachsen; daß Bruderblut dabei floß, schmerzte ihn freilich sehr. Hier zeigte er sich als der barmherzige Samariter, der in dem frohsinnigen Humoristen als geräuschloser Stubenkamerad wohnte. Er that sich mit einem Landsmann und Freund, dem Buchhändler Erhard Quandt in Leipzig, zusammen und erließ nach Mecklenburg eine plattdeutsche Ansprache an »min leiwen Landslüd' un gauden Frün'n«, worin er um Geld und Leinwand bat, zur Hälfte nach Eisenach, zur Hälfte nach Leipzig zu schicken, um den unglücklichen Opfern der Schlachtfelder so viel wie möglich zu helfen. »Ji hewwt mi oftmals seggt«, schreibt er in dieser Ansprache, »dat Ji Spaß an min Schriweri hatt hewwt; ditmal kam ick nich mit Spaß an Jug heran, ditmal is dat de allerbitterste Irnst, de mi tau Jug driwwt ... So'n Jammer gegenäwer ist nich de Red' von Partei un Partei, nich von Fründ un Find: dütsche Landslüd' sünd't allerwegen ...« Auf seinen Ruf fließen ihm sogleich, aus allen Teilen Mecklenburgs, reichliche Gelder zu; er wird Händler, er kauft Zigarren, Wein, Bier, Graupen und Gries, Sodawasser, Schinken und Würste, Zucker und Kaffee ein, schickt seine Sendungen nach Dermbach und Kissingen, Aschaffenburg und Würzburg, berichtet darüber in öffentlichen plattdeutschen, mit Humor plaudernden Briefen; er zieht mit einem Transport von Lebensmitteln selber nach Frankfurt am Main. »Nu bidd ick äwer einen üm allens in de Welt«, schreibt er in einem dieser Zeitungsbriefe, »wat is dit? Wat is dat mit Jug Packeri? Ick weit recht gaud, wenn einer Kuhneneier Truthennen-Eier. äwer Feld schickt, denn nimmt hei irst 'ne olle Fru un denn en Korf mit Hackels Häcksel., in dat Hackels packt hei de Kuhneneier un de olle verstännige Dam schickt hei mit den Korf äwer Feld; äwer wecker Minsch packt lütte Hawens mit Inmakels Häfen mit Eingemachtem. in Hackels un schickt sei mit de Iserbahn dörch dat taukünftige dütsche Kaiserreich? Hackels? – Oh ja, dat gew ick Bifall – alaboncoeur! – äwer denn hürt dor ok noch 'ne olle Fru tau, denn de Iserbahners känen doch nich för olle, sachte Frugens gellen. – Na, dat was denn nu en schönen Klackeierkauken.«
Daß Fritz Reuters Frau bei diesen rastlosen Liebeswerken seine Gehülfin war, brauche ich nicht zu sagen. Krieg und Not waren zu Ende, Deutschlands Zukunft begann sich zu lichten; nun enthielt er sich nicht, dem zu danken, der das Meiste dazu gethan. Er schickte im September seine gesammelten Werke an den Grafen Bismarck, mit folgendem Brief:
»Es treibt mich, Ew. Excellenz, als dem Manne, der die Träume meiner Jugend und die Hoffnungen des gereiften Alters zur faßbaren und im Sonnenschein glänzenden Wahrheit verwirklicht hat, ich meine die Einheit Deutschlands, meinen tiefgefühlten Dank zu sagen. Nicht Autoren-Eitelkeit, sondern nur der lebhafte Wunsch, für so viel schöne Realität, die Ew. Excellenz dem Vaterlande geschenkt haben, auch etwas Reales zu bieten, veranlaßt mich, diesem Danke den Inhalt des beifolgenden Packets beizufügen. – Möchten Ew. Excellenz diesen meinen etwas zudringlichen Kindern ein bescheidenes Plätzchen in Ihrer Bibliothek gönnen, und möchten die dummen Jungen im stande sein, mit ihren tollen Sprüngen Sie auf Augenblicke die schweren Sorgen und harten Mühen Ihres Lebens vergessen zu lassen.
»Gott segne Sie für Ihr Thun! Sie haben sich mehr Herzen gewonnen, als Sie ahnen, so zum Beispiel auch das Ihres ergebensten
Fritz Reuter, Dr.«
Graf Bismarck antwortete am 17. September:
»Euer Hochwohlgeboren sage ich herzlichen Dank für die freundliche Sendung, mit welcher Sie Ihre inhaltvolle Zuschrift vom 4. d. M. begleiteten.
»Als alte Freunde habe ich die Schar Ihrer Kinder begrüßt und sie alle willkommen geheißen, die in frischen, mir heimatlich vertrauten Klängen von unseres Volkes Herzschlag Kunde geben.
»Noch ist, was die Jugend erhoffte, nicht Wirklichkeit geworden; mit der Gegenwart aber versöhnt es, wenn der auserwählte Volksdichter in ihr die Zukunft gesichert vorschaut, der er Freiheit und Leben zu opfern stets bereit war.«
Dieser Brief des ersten Ministers von Preußen an den Mann, den Preußen damals zum Tode des Hochverräters verurteilt hatte, war wohl denkwürdig genug, um ihn an dieser Stelle mitzuteilen. Ich setze nichts hinzu, er sagt alles selbst.
Fritz Reuter hat dann noch einmal dem Begründer des deutschen Reiches seine Verehrung ausgesprochen; doch diesmal im Namen eines andern, eines ihm befreundeten Gutsbesitzers, der dem Grafen (1867 oder 68) einen Truthahn zum Geschenk machte; er schrieb dazu das begleitende Gedicht:
As hei up sin twei Beinen
Up minen Hof spaziert,
Dunn süll ein Jeder meinen:
En
Franzmann wir dat Dirt.
Grad as de Franzmann bullert
Um unsern dütschen Rhin,
So hett hei rümmer kullert,
As wir de Welt all sin;
Krus plus't hei sick tau Höchten
Un trampelt mit de Bein,
Mit Jeden wull hei fechten,
De em mal scheiw anseihn;
Un Dickdauhn was sin Lewen,
Stolz flog sin Rad hei rund; –
Doch Murrjahn müßt sick gewen,
Un't was en dollen Hund.
Nu is vörbi sin Prahlen;
Doch Franzmann prahlt noch fett;
Den ward sick einer halen,
De Tähn taum Biten
Zähne zum Beißen. hett.
Du hest s', un wardst nich liden
Den Franzmann sine Nück,
Dat sünd jitzt ann're Tiden
Un't hett en annern Schick.
Un lat Di dat nich beiden!
Brock em wat in de Supp!
Un bliwwt he unbescheiden
Bedeutet im Plattdeutschen auch: dreist, frech.,
Denn frett em up!
Auch Das ist denn, mit weltgeschichtlicher Gerechtigkeit, drei Jahre später geschehen.
Mittlerweile war Fritz Reuter zu den allertraulichsten Werken des Friedens zurückgekehrt: er hatte sich aus den neuen Auflagen seiner Werke die (in diesen Blättern veranschaulichte) Villa zu Füßen der Wartburg erbaut, in der er noch die letzte Poesie des sinkenden Lebens genießen sollte. 1866 erwarb er einen Bau- und Gartenplatz auf einem Ausläufer der Hainsteinfelsen am Ausgang des Hellthals in das Marienthal; ein herrlich gelegenes, aber wüstes, felsiges Grundstück, dem erst jahrelange Arbeit, zahlreiche Sprengungen den Baugrund und fruchtbare Gartenterrassen abgewannen. Der Großherzog von Sachsen-Weimar, ein warmer Verehrer des Dichters, der nun sein Nachbar geworden, bot ihm aus freien Stücken eine Ecke zu seinem Garten an, damit er einen Umwendeplatz gewänne. »Die Lage«, schreibt Reuter in einem seiner zahlreichen, ausführlichen und sachverständigen Briefe über den Bau, »ist so schön, wie man sie sich nur wünschen kann; die Fronte des Hauses liegt fast gerade gegen Süden mit einer kleinen Wendung nach Osten; gegen Westen sind wir durch Bäume geschützt, gegen Norden durch steilen Berg und Fels und Bäume, gegen Osten durch Bäume und eine höher liegende Villa. Meine Frau hat vom Erker aus die Aussicht auf die Wartburg, vor uns liegt ein schöner grüner Grund mit einigen Teichen; auf der anderen Seite nach Osten zu sehen wir in das prächtig grün bewachsene Johannisthal und die Chaussee des Marienthals mit der Felsenkuppe des Breitengescheids.« In dieser Lage entstand denn 1867 das Haus, von dem zu Gotha lebenden Architekten Bohnstedt in einfacher, aber durch die Reinheit der Verhältnisse und die malerische Verteilung der Räume sehr wirksamer Renaissance erbaut; mit sinnigen Einzelheiten der Einrichtung, die der Dichter und seine Frau selber entworfen hatten. Doch ganz Reuters Schöpfung war der Garten; in blühenden Terrassen um das Haus gelegt, – sein Glück, seine Arbeit und sein Stolz. Er hatte den unfruchtbaren Boden urbar gemacht, den Entwurf zur Anlage gezeichnet, jedes Bäumchen, jeden Strauch zur Anpflanzung bestimmt, den Aufbau der Terrassen beordert; er hatte die Entfernung jedes einzelnen Spalier-Zwergbäumchens von den Nachbarn selber bemessen, die Tiefe der Löcher, die Menge der einzufüllenden guten Erde, die Reihenfolge der Pflanzen angegeben, dann ihre Pflege geleitet. Vor allem wuchsen ihm die Zwergbäume auf den Terrassen ans Herz; er wußte ihre Reihenfolge auswendig, er kannte jeden Zweig, jedes Blatt. Für diese seine kleine Welt hatte er in einem alten Freund, dem Kunstgärtner Jühlke, der kurz zuvor als Hofgarten-Director des Königs von Preußen nach Sanssouci übergesiedelt war, den teilnehmendsten und freigebigsten Mitpfleger gefunden, den er wünschen konnte. Künstlerischer Beirat, reiche Sendungen gingen von Sanssouci nach Eisenach. »Der Raum ist nur klein,« schrieb zwar Reuter an Jühlke, »und wird Dir den Unterschied zwischen Königs-Anlagen und Schriftstellers-Anlagen recht deutlich zu Gemüte führen.« Aber dieses kleine »Sorgenfrei« ward ihm groß genug. Dem kinderlosen Mann ward es gleichsam ein blühender Ersatz für versagte Freuden. Sein Herz, voll kindlicher Liebe zur Natur, hing an seinem selbstgeschaffenen Paradiesgärtlein bis zum letzten Tag.
Zu Ostern 1868 zogen sie in die Villa ein; sechs Jahre lang hat er sie noch bewohnt; anfangs in reicher, zuweilen allzu reicher Geselligkeit, zuletzt in notgedrungener Vereinsamung, mit der geliebten Pflegerin allein. Schon damals hatte das Wachstum, die um sich greifende Wirkung seiner alten Leiden traurige Fortschritte und auf seine Riesennatur ernste Angriffe gemacht; schon seit 1865 hatte er durch sein altes Mittel, die Wasserkur, in Laubbach (bei Coblenz, am Rhein), dann in Elgersburg, in Stur sich zu stärken gesucht. Seine schriftstellerische Fruchtbarkeit erlosch; nur langsam und mühevoll brachte er noch den im December 1866 begonnenen Roman: » De meckelnbörgschen Montecchi un Capuletti, oder de Reis' nah Konstantinopel« 1868 zu Ende. Nach mühsamer Arbeit ein verkümmerter Erfolg; denn bei einem Stoff, dem es schon von vornherein etwas an Lebensfülle gebricht, leidet die Komposition an der Ungunst des Reise-Motivs, und versagt in der Ausführung oft die sonst so bewundernswerte plastische Kraft. Immer bleibt es ein Buch voll angeschauter Gestalten, unter denen Jochen Klähn eine seiner unterhaltendsten und »Tanten Line« eine seiner liebenswürdigsten ist; aber es ist doch der »alte Fritz« nicht mehr, ich sehe zuweilen mit Wehmut zwischen den Zeilen ein lächelndes, doch hippokratisches Gesicht, aus dem nicht jene reine, volle, goldne Freude in des Lesers Herz strahlt.
Er hat nach diesem Buch keines mehr geschrieben; nur noch in den großen Tagen von 1870 – in denen auch der Samariter noch einmal lebendig ward – die beiden gemütvollen Dichtungen, die in Lipperheides »Liedern zu Schutz und Trutz« erschienen: » Ok 'ne lütte Gaw' för Dütschland« und » Großmutting, hei is dod«. Er begann zwar im März desselben Jahres noch eine Bauern-Geschichte: »Wurans [wie] Franz Zunkel tau 'ne Dochter kamm«; angeregt durch ein wahres Erlebnis eines Bauernsohns, der, zum erstenmal in Berlin, sich in seiner Unerfahrenheit ein hülfloses Kindchen in den Arm drücken läßt und, ebenso mitleidig wie ratlos, diese Ausbeute seiner großstädtischen Studien seinen wohlhabenden Eltern ins Haus bringt. Ein gutes Stück der Einleitung, die noch im Dorf spielt, entstand; behaglich und angenehm nach alter Weise erzählt; aber noch ehe wir mit Franz Zunkel nach Berlin kommen, bricht es ab. Reuter selber fand darin zu viel Ähnliches mit früheren Schöpfungen, sein Interesse ermattete und er ließ davon ab. Die Feder des »Geschichten-Erzählers« rührte sich nicht mehr.
Vielleicht waren es seine letzten Verse, die er dann im April 1873 zur Jubelfeier der »Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag« als Festgruß sandte:
Kein Preis
Ohn' Fleiß,
Ohn' Kampf kein Sieg,
Kein Fried' ohn' Krieg;
Drum kämpfet wacker Ihr deutschen Böhmen!
Kein Teufel soll den Sieg Euch nehmen.
*
Viel und schwer hat Fritz Reuter in seiner schönen Villa am Fuß der Wartburg gelitten; viel und tröstlich träufelte freilich auch der Balsam des Ruhmes und der Ehren in sein dankbares Herz. Seiner »Stromtid« ward (1867) der Tiedge-Preis zu teil; – die einhundert Dukaten, die ihm damit zufielen, wendete er menschenfreundlichen Stiftungen zu. Seine Vaterstadt Stavenhagen pflanzte 1867 eine Reuter-Eiche und richtete ihm 1873 im Rathause, in dem er zur Welt kam, eine Gedenktafel auf; – er seinerseits, der sich fort und fort als »Stavenhäger Stadtkind« betrachtete, hat ihnen für die Errichtung eines Krankenhauses, einer Volksbibliothek reiche Gaben, für andere harmlose Anlässe herzliche Zeichen seines Anteils gesandt. Ein Reuter-Felsen ward ihm bei Elgersburg im Thüringer Wald, nicht weit vom »Goethe-Felsen«, geschenkt und geweiht. Die »Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde« zu Leiden ernannte ihn 1869 zu ihrem Mitglied. Die Großherzöge von Mecklenburg und von Sachsen-Weimar, der König von Bayern suchten ihn durch Verleihung ihrer Orden zu ehren. Hölzerne und eiserne, Rostocker und Hamburger Schiffe, »Fritz Reuter« getauft, trugen seinen Namen über den Ocean. Seine beliebtesten Werke wurden ins Französische, ins Englische, ins Holländische übersetzt. Maler und Bildhauer (Schlöpke, Butkowsky, Afinger) bemühten sich, sein Bild für die Nachwelt festzuhalten. Vereine, wie der plattdeutsche »Schurr-Murr« in Dresden, wuchsen aus seinen Werken auf; eine Reihe von Vorlesern erstand, die durch öffentlichen Vortrag, nach Art alter Rhapsoden, sein gedrucktes Wort lebendig machten. Ihm selbst versagten dazu Neigung und Talent; er wehrte denn auch alle Versuchungen solcher Art von sich ab. »Es ist wahr«, schrieb er 1868 an einen dieser Versucher, »ich habe in Gotha [im Schauspielhaus] zweimal eine Vorlesung gehalten; das war aber zum Besten des Gustav-Adolf-Vereins, und es hat mich genug Überwindung gekostet. Ich hasse dergleichen Präsentation und Ostentation ... Poetische Produktionen werden bessere Vorleser finden, als den Dichter selbst.«
Es kamen endlich die Zeiten, da ihn auch der Krückstock nicht mehr trug; da sein gefaßtes Herz mit den ihn niederwerfenden, langsam auflösenden Leiden rang. Ein unheilbares Herzübel schritt seit Ostern 1874 schneller und schneller fort; doch es schien seine alte Krankheit von ihm zu nehmen, die nun spurlos verschwand. Wunderbar klärte sich in diesen letzten Monaten sein Geist; er war umsichtiger, frischer als in den letzten Jahren, sein von Jugend auf bewundernswertes Gedächtnis zeigte sich lebendiger als je. »Bin noch immer Dein ›Konversationslexikon‹ nicht wahr?« sagte er dann wohl scherzend zu seiner Luise, der treuesten Pflegerin. Auch die Liebe zu seiner grünen Schöpfung konnte nicht erlöschen; als er sie nicht mehr betrat, ließ er sich jeden Morgen vom Gärtner berichten, wie es seinen Bäumchen ergehe. Wenige Tage vor seinem Ende war's, daß er, im Rollwagen von seiner Frau an das Fenster geschoben, von dem er die Terrassen überschauen konnte, diese blühende Welt betrachtete; lange sah er sehnsuchtsvoll hinüber; »ach!« seufzte er, »sollte ich wohl je wieder hinauf können, meine Bäumchen wachsen zu sehen?« – Der Tod, der schon vor der Schwelle stand, ließ ihn nicht mehr hinaus. Langsam trat er herein, mit seinem Fittich die dunklen Ahnungen in der todgeweihten Seele erregend. Mehr als einmal kam es dem Kranken über die Lippen, daß seine Tage gezählt seien. Er war bereit. Endlich am 12. Juli, nachmittags – nachdem er der Gefährtin seines Lebens noch am Tage zuvor rührendste Worte der Liebe und des Dankes gesagt – hörte das müde Herz zu schlagen auf, und in sanftem, traumhaftem Verscheiden erloschen ihm die irdischen Gefühle.
Er hatte gelebt und er starb, wie er es in dem letzten seiner gedruckten »Polterabendgedichte« (zu einer silbernen Hochzeit) in seiner schlichten Melodie gesungen hatte:
Und so wandelt heiter
Immer berghinab,
Immer, immer weiter
Bis ans kühle Grab.
Und dann drückt Euch still die Hände,
Muß geschieden sein,
In dem Herzen bis ans Ende
Treue Lieb' allein.
Treue Liebe geleitete ihn am 15. Juli an sein von Achtung, Ruhm und Verehrung umstandenes Grab. Unverändert waren seine Züge geblieben, bis der Sarg sich schloß; in wahrhaft ergreifender Weise – wie die Photographie es festgehalten – hatte der Todesschlaf sein Antlitz verklärt. Aus dem Wohnzimmer der Gattin, in das sie ihn nach seinem Verscheiden hatte bringen lassen, trugen Schriftsteller, denen ein Schuldirektor sich anschloß, am Nachmittage des 15. den eichenen, unverhüllten Sarg über die Terrasse hinaus, bis sie ihn den Trägern übergaben; während das alte »Es ist bestimmt in Gottes Rat«, vom Eisenacher Kirchenchor gesungen, durch den sonnenbeglänzten Tag erklang. Abgesandte der drei Jenaer Burschenschaften, im Sammetwams und Lorbeerkränze in der Hand, führten den Zug; es folgten die Schüler der Gymnasien, die Offiziere der Garnison, Leidtragende von nah und fern, die Deputationen der Stadt Eisenach, der Vaterstadt Stavenhagen, des Großherzogs von Weimar, die Verwandten des Geschiedenen; mit ihnen die Witwe, die ihn bis zum letzten Augenblick nicht verließ. Zahllose Kränze hatten den Sarg und den Wagen geschmückt; die meisten aus der Ferne (auch ein Gymnasiast in Höxter hatte einen Lorbeerkranz gesendet); darunter ein Eichenkranz, von der »Reuter-Eiche« zu Stavenhagen gepflückt. Reuters alter Freund, der Generalsuperintendent Petersen zu Gotha, hatte am Sarg gesprochen und sprach nun am Grab; Worte aus einem liebevollen, begeisterten und erschütterten Herzen. In der südlichen Ecke des Friedhofs war ihm sein Ruheplatz gewählt; man blickt von da über die Stadt, auf die Berge und Wälder, die ihn aus der Heimat hierher gelockt, die sein naturfrohes Auge so oft erquickt, seine von Leiden ermattete Seele getröstet hatten.
Dort ruht er nun, – ein Toter, der sich dichtend und schaffend dem Tode abgerungen, der mit uns Lebenden lebt. Seine gereiften Werke werden nicht vergehen; auch nicht die Freude an seiner schlichten, bescheidenen, menschenliebenden, liebenswerten Gestalt. Wie seine körperliche Erscheinung nicht schön war – stattlich, kraftvoll, behaglich; klar und herzlich aus sinnigen Augen blickend; doch ohne den idealen Reiz, den unsre Meinung von einem Dichterkopf erwartet – so steht freilich auch sein Lebensbild nicht in dem Glanz und Zauber eines Lieblings der Götter vor uns da. Wenn man ihn mit dem geistesverwandten englischen Zeitgenossen, mit Boz vergleicht, – wie verschieden hat das Schicksal hier und dort die Farben gemischt! Die Gestalt dieses Andern scheint ihn zu erdrücken: ein scheinbar grenzenloses Talent, von allen günstigen Winden des Erfolgs getragen, mit vierundzwanzig Jahren ein fruchtbarer Schriftsteller, mit fünfundzwanzig berühmt; von der größten und merkwürdigsten Stadt der Erde, dem lebensvollsten Land mit unendlichem Stoff der Beobachtung, des Humors, der Tragik versehen; von einer wahrhaft geflügelten Phantasie emporgerissen, die mit Jugendfeuer in den großstädtischen Lebensrausch versinkt, an ihm sich begeistert und in ihm sich verzehrt. Dagegen Fritz Reuter, der schlichte Mann des Dialekts, der Provinz, unfähig zu blenden und zu glänzen, erst in den reifsten Mannesjahren auf den Schauplatz tretend; einer von diesen bedächtig, spät sich entwickelnden Menschen, von denen er selbst einmal sagt: »wir Niederdeutschen sind ein hartes Holz, das langsam Feuer fängt, dann aber auch Glut giebt«. Dauernde, wärmende Glut, setze ich hinzu. Eine Glut, die ebenso lange Menschen erwärmen wird, wie jenes blendende Feuer, das in Boz entbrannte. Die geniale Subjektivität der Phantasie war Reuter nicht gegeben, die aus dem englischen Humoristen in seinen guten Stunden so unwiderstehlich hervorbricht; aber die sinnige Objektivität seines einfacheren Geistes hat ihn zu einem treueren Spiegel der Natur gemacht. Es ist ein klassischer Zug in ihm, der ihn still und hoch neben jenem modernsten aller Menschen erhebt.
Die Welt der »Unbeachteten«, der »Kleinen« war seine Welt. »Ich glaube,« sagt er im »Schurr-Murr« (in »Haunefiken«), »daß uns in den niedern Ständen Tugend wie Laster in größerer Nacktheit entgegentreten, frei von jenen verhüllenden Gewändern, die man »Rücksichten«, »Verhältnisse«, ja sogar »Bildung« zu betiteln pflegt, und daß sie uns deshalb poetischer erscheinen müssen«. Ihm wenigstens erschienen sie so, weil sich sein Auge an ihnen und für sie gebildet hatte, weil er den Beruf in sich fühlte, ihre Poesie zu offenbaren. Wie entwickelte sich in seinem verlangsamten, gehemmten Lebenslauf dieser Beruf? Auch darüber sagt er selbst, in einem biographischen Brief, den er 1861 an den Sohn eines Freundes, einen seiner Zöglinge aus der Treptower Zeit, schrieb: »Soll ich noch hinzufügen, welchen besonderen Umständen ich meine etwaige poetische Ader zu verdanken habe, so bin ich der Meinung, daß meine Mutter in der ersten Jugendzeit hierauf den größten Einfluß geübt hat, daß später die Festungszeit durch die fortwährenden Phantasiespiele, die man in Ermangelung unterhaltender Wirklichkeit herauf zu beschwören gezwungen ist, der Klarheit und Deutlichkeit der Vorstellungen förderlich gewesen ist, und daß sie mich befähigt hat, den Menschen kennen zu lernen. Im regen Verkehr mit vielen Menschen mag man die Menschen besser explorieren, ist man aber Jahre lang auf einen Umgang angewiesen, glaube ich, lernt man den Menschen besser kennen. Meine landwirtschaftliche Carriere, meine in einer kleinen ackerbautreibenden Stadt hingebrachte Jugendzeit, sowie auch der stete Verkehr mit plattdeutsch redenden Landsleuten auf Universität und Festung hat sicherlich mir meine Richtung als plattdeutscher Dichter vorgeschrieben; meine Liebe zu dem Volke, wie's nun einmal ist, auch das Glück, welches ich mit meinen ersten Versuchen hatte, haben das Ihre dazu gethan.«
Wie viel Glück und Ruhm ihm auf diesem Wege zum plattdeutschen Parnaß auch zugefallen ist, er blieb bis an sein Ende, seiner reinen Natur getreu, ein bescheidener Mensch. Ich berufe mich dafür nicht auf jenes Wort, das man ihm nacherzählt: als einige exaltierte Damen ihm erklärten, er stehe über Goethe und Schiller, habe er einfach geantwortet mit einem »Adjüs, Madams!« Ich berufe mich auf alles und jedes, was seiner wahrhaften Seele entfloß; auf das ganze Bild seines Wesens, wie es dem Leser nun vor Augen steht. In ihm war alles, was ihm gegeben war, mit gutem, gleichsam mit gerechtem Maße gemischt; diese glückliche Harmonie, die ihn selber wärmte, strahlte ihre Wärme auch auf die Andern aus. Ihr entfloß seine ruhige Tüchtigkeit, Klarheit, innere und äußere Ordnung; ihr auch seine Menschenliebe und Güte; ihr das tiefe, herzliche, heitere Behagen, das ihm die Herzen gewann. Vor allem aber entfloß ihr die unerschütterlich gleiche, reine Mäßigung, mit der er die ihm heiligsten Angelegenheiten seines Lebens betrieb: sein Verhältnis zum Staat und sein Verhältnis zu Gott. Er, der durch eine grausame, vernunftlose Politik so furchtbar gelitten hatte, blieb allezeit – in Leben und Dichtung – seinen Idealen, allezeit aber auch der Stimme der Einsicht und Gerechtigkeit in seinem Herzen getreu. Er, der am persönlichen Gott, am Fortleben im Jenseits mit unanfechtbarer Überzeugung festhielt, hat nie seinen Haß gegen unduldsame Gläubigkeit, nie seine schlichte, herzliche Achtung vor der fremden Meinung verleugnet. Er kannte die Welt zu gut, und daß sie aus Rechts und Links besteht, aus Himmel und Erde, aus Bewußtem und Unbewußtem, – wie aus Freud' und Leid. Er, der – als der ächte, innige Humorist, der er war – in einem seiner Bücher schreibt: »Wer kann sagen, wo Freud' und Leid sich scheiden? Sie spielen zu wunderlich im Menschenherzen in einander hinüber; sie sind Aufzug und Einschlag, und wohl dem, bei dem aus beiden ein festes Gewebe wird!« In ihm waren sie beide fest, unlösbar verwebt; darum kannte er die Natur der Dinge; darum war er gerecht, liebevoll und gut.
Seine Dichtungen, seine Briefe, seine Freunde, seine Thaten, alles sagt und bezeugt, daß er ein wahrhaft guter, reiner Mensch war. Und so werden denn auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht aufhören, ihn und sein aus ihm nachgeschaffenes zweites Ich, seine Werke zu lieben.
