
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Im Herbst 1812 erbat ich für mich und meine Frau wieder Urlaub zu einer Kunstreise, der auch nach einigem Widerstreben von Seiten der Herzogin bewilligt wurde. Wir nahmen diesmal die Richtung nach Wien, als die vom Krieg und Truppendurchzügen am wenigsten beunruhigte. Unser erster Aufenthalt war zu Leipzig, wo wir in einem Concerte Hermstedt's mitwirkten und wo ich darauf mein neues Oratorium aufführte. Ueber jenes berichtet die Musikalische Zeitung folgendermaßen:
»Das Concert des Herrn Hermstedt war schon von Seiten der aufgeführten Compositionen eines der ausgezeichnetsten, die man hören kann. Bis auf die Ouvertüre von Mozart und die Scene von Righini waren alle Stücke vom Concertmeister Spohr und, das Clarinetten-Concert abgerechnet, ganz neu geschrieben. Dies Concert, das erste aus C-moIl und als Composition an sich wohl das vortrefflichste aller Concerte für dieses Instrument, wurde auch diesmal mit großem Vergnügen gehört. Eine große Sonate für Violine und Harfe, gespielt von Herrn Spohr und seiner Gattin, deren erster Satz in Erfindung und Ausarbeitung meisterhaft genannt werden muß, deren zweiter in einem allerliebsten Potpourri aus glücklich zusammengestellten und sehr gefällig behandelten Melodien der »Zauberflöte« besteht, – dieses sowie jedes der übrigen Stücke wurde mit dem lautesten Beifall aufgenommen. Wir hörten aber noch ein Violinconcert Es wird das sechste, Op. 28, gewesen sein., gespielt von Herrn Spohr, und ein Potpourri für die Clarinette mit Orchester. In jenem hat uns das erste Allegro, was Composition und Vortrag anlangt, am wenigsten gefallen wollen. Es schien uns hin und wieder verkünstelt und überladen, auch für seinen Gehalt zu lang; der Vortrag des Virtuosen aber nicht überall klar und deutlich genug. Allein das Adagio gehört in Composition und Vortrag unter das Schönste, was wir je auf diesem Instrumente gehört haben und wir dürfen sagen unter das Allerschönste, was je von einem Virtuosen geleistet worden ist.«
Auch über das Oratorium wurde im Ganzen günstig berichtet. Es enthalte »der originellen, einnehmenden, zum Theil wirklich hinreißenden, aber auch einander so sehr drängenden, so schnell verdrängenden Details sehr viele.« Jeder Zuhörer – möge er mit Spohr in seinen Ansichten vom Oratorium übereinstimmen oder nicht, möge er namentlich die Weise desselben, fast alle Gattungen der Behandlung und des Styles zu vermischen oder vielmehr sie im Wechsel auftreten zu lassen, billigen oder nicht – jeder Zuhörer werde dies Werk nicht ohne lebhafte Theilnahme und mehrere der Hauptpartien nicht ohne Bewunderung und wahre Freude hören können.
In Dresden scheine ich mich auf dieser Reise, nach einem Berichte der Musikalischen Zeitung vom 8. November, nicht aufgehalten zu haben. In Prag aber gab ich schon am 12. November ein Concert und führte dann acht Tage später im Theater mein Oratorium auf. Ueber ersteres findet sich in der Musikalischen Zeitung ein sehr lobender Bericht. Namentlich wird die »entzückende Einheit« des Vortrags, woraus »die vollkommenste harmonische Vermählung des vortrefflichen Künstlerpaares deutlich zu erkennen gewesen sei«, hervorgehoben.
Von der Aufführung des Oratoriums erinnere ich mir nur noch, daß Fräulein Müller, später Madame Grünbaum, entzückend schön darin sang und daß das Werk vom Publikum sehr gut aufgenommen wurde.
Ich eilte nun dem Hauptziel meiner Reise entgegen. Wien war damals unbestritten die Hauptstadt der musikalischen Welt. Die beiden größten Componisten und Reformatoren des Kunstgeschmackes, Haydn und Mozart, hatten dort gelebt und ihre Meisterwerke geschaffen. Noch lebte die Generation, die sie entstehen sah und an ihnen ihren Kunstgeschmack herangebildet hatte. Der würdige Nachfolger dieser Kunstheroen, Beethoven, weilte noch daselbst und befand sich eben im Glanzpunkte seines Ruhmes und der Kraft seines Schaffens. In Wien wurde daher bei Kunstleistungen stets der höchste Maßstab angelegt, und dort gefallen, – hieß sich als Meister bewähren.
Ich fühlte mein Herz klopfen, als wir über die Donaubrücke fuhren und ich an mein bevorstehendes Debüt dachte. Meine Befangenheit wurde noch durch den Gedanken gesteigert, daß ich mit dem größten Geiger der Zeit würde wetteifern müssen; denn in Prag hatte ich erfahren, daß Rode eben aus Rußland zurückgekehrt sei und in Wien erwartet werde. Lebhaft gedachte ich noch des überwältigenden Eindrucks, den Rode's Spiel vor zehn Jahren in Braunschweig auf mich gemacht hatte, und wie ich Jahre lang bemüht gewesen war, dessen Methode und Vortragsweise mir anzueignen. Ich war daher im höchsten Grade gespannt, ihn nun wieder zu hören, um hiernach meine eigenen Fortschritte bemessen zu können. Meine erste Frage, als ich aus dem Wagen stieg, war deshalb auch, ob Rode schon angekommen sei und bereits ein Concert angekündigt habe. Man verneinte dies, setzte aber hinzu, er werde schon seit längerer Zeit erwartet.
Es lag mir nun sehr daran, noch vor Rode gehört zu werden, und ich beeilte daher so viel als möglich mein Concert. Es gelang mir auch, zuerst aufzutreten; doch war Rode schon angekommen und wohnte dem Concert bei. Zu meinem Erstaunen fühlte ich mich dadurch weniger geängstigt, als begeistert und spielte so gut, als ich es vermochte. Die Musikalische Zeitung berichtete über mein Auftreten bei »gedrängt vollem Hause« wie folgt:
»Am 17. December hatten wir das Vergnügen, Herrn Louis Spohr und seine Gattin in einem Concert zu bewundern. Referent unterschreibt gern die über dies brave Künstlerpaar in Ihrer musikalischen Zeitung gefällten Urtheile und kann nur hinzusetzen, daß auch hier ihr meisterhaftes Spiel allgemein entzückte. Herr Spohr spielte ein Violinconcert mit spanischem Rondo, und am Schlusse einen Potpourri, beides von seiner Composition; mit seiner Frau aber eine von ihm gesetzte Sonate für Pedalharfe und Violine. Die Composition sowohl des Concertes, als dieser Sonate, war bedeutend, und zeichnete sich nicht wenig vor den wässerigen, zusammengestoppelten Produkten aus, womit viele ausübende Tonkünstler, ohne Talent und ohne Beruf zur Composition, hier auftreten.«
Auf den Rath wohlwollender Freunde verzichtete ich darauf, mein Oratorium auf eigene Rechnung zu geben, wie ich anfangs in einem zweiten Concerte beabsichtigte, weil bei den bedeutenden Kosten, die ein großes Orchester und ein zahlreicher Chor noch über die gewöhnlichen Concertkosten verursachen mußten, nicht zu hoffen stand, daß etwas gewonnen werden könne. Da ich jedoch dieses Werk, welches ich noch immer für eines der großartigsten seiner Gattung hielt, gern auch in Wien zu Gehör bringen wollte, so trug ich es der musikalischen Wittwen- und Waisengesellschaft zu einer Aufführung für ihren Fond an, und stellte nur die Bedingung, daß diese Aufführung eine stark besetzte und von den vorzüglichsten Sängern und Instrumentalisten Wiens unterstützte sein müsse. Die Gesellschaft kam diesem Verlangen auch vollständig nach, indem sie ein Personal von dreihundert Mitwirkenden aus den besten Künstlern der Stadt zusammenbrachte. Das Werk wurde in zwei großen Proben sorgfältig eingeübt und ging bei der Aufführung so gut, wie ich es noch nicht gehört hatte. Ich begeisterte mich von neuem für meine Schöpfung, und mit mir auch viele der mitwirkenden Musiker, unter diesen besonders der Orchesterdirektor des Theaters an der Wien, Herr Clement. Dieser hatte sich in das Werk so hineingehört, daß er mir am folgenden Tage nach der Aufführung mehrere große Nummern, Note für Note, mit allen Harmoniefolgen und Orchesterfiguren auf dem Piano vorspielen konnte, ohne je die Partitur gesehen zu haben. Clement besaß aber auch ein musikalisches Gedächtniß, wie vielleicht nie ein anderer Künstler. Man erzählte sich damals in Wien, daß er »die Schöpfung« von Haydn, nachdem er sie mehreremale gehört hatte, so auswendig wußte, daß er mit Hülfe des Textbuches einen vollständigen Clavierauszug davon machen konnte. Diesen brachte er dem alten Haydn zur Ansicht, der nicht wenig darüber erschrocken war, weil er im ersten Augenblick glaubte, man habe ihm seine Partitur entwendet oder heimlich kopirt. Er fand bei näherer Ansicht den Clavierauszug so getreu, daß er ihn, nachdem Clement noch eine Durchsicht nach der Partitur vorgenommen hatte, zur Herausgabe adoptirte.
Bevor mein Oratorium zur Aufführung kam, hatte ich noch einen Strauß mit der Censur, wodurch das ganze Unternehmen beinahe gescheitert wäre. Man wollte die Namen von Maria und Jesus in dem Personen-Verzeichnisse des Textbuches und als Ueberschrift über das, was sie zu sagen haben, nicht dulden. Nur mit dieser Auslassung wurde, nach langen Verhandlungen, endlich der Druck des Textes genehmigt. Ich konnte mir diese Aenderung gefallen lassen, weil aus dem Inhalte leicht zu entnehmen war, wer die betreffende Person sei.
So sehr nun auch das Werk den Musikern gefiel und ihre Achtung vor meinem Compositions-Talente steigerte, so war die Aufnahme beim Publikum doch bei weitem nicht so glänzend, als die, welche mein Spiel und meine Concert-Compositionen gefunden hatten. Zwar fehlte es auch diesmal nicht an Beifallsbezeugungen, die Theilnahme war aber nicht so allgemein, um zur zweiten Aufführung, die drei Tage später stattfand, wieder ein zahlreiches Auditorium herbeizuziehen. Diese zweite Aufführung in Wien war die letzte, welche das Werk erlebt hat; denn in späteren Jahren sah ich die Schwächen und Mängel desselben zu gut ein, als daß ich es hätte über mich gewinnen können, es nochmals öffentlich vorzuführen.
Ueber die erste Wiener Aufführung am 21. Januar hat die musikalische Zeitung ziemlich eingehend berichtet.
Der Hofkapellmeister Salieri hatte die Leitung des Ganzen, Herr Umlauf den Platz am Clavier und ich selbst die Direktion der Violinen übernommen. Die Hauptpartien sangen: Demoiselle Klieber, Madame Auenheim, Demoiselle Flamm und die Herren Anders, Wild und Pfeiffer. »Es ist schwer,« sagt der Bericht, »hier in Wien mit der Komposition eines Oratoriums aufzutreten, damit Aufsehen zu erregen oder dem Werke bleibende Dauer zu verschaffen – hier, wo so große gediegene Meisterwerke dieser Art zuerst ans Tageslicht getreten, Jedermann bekannt worden sind und ihrem Schöpfer bei der musikalischen Welt bleibenden Ruhm verschafft haben. Schon Herr Eibler versuchte es, die »vier letzten Dinge« ... in Musik zu setzen. Doch wurde sein Werk nur zweimal öffentlich aufgeführt, weil es ihm an einem durchaus gleichen und originellen Styl fehlte und dasselbe die Parallele mit den Werken des großen Vorgängers in dieser Gattung nicht halten konnte. Auch von Herrn Spohrs »jüngstem Gericht« dürfte dasselbe gesagt werden, obgleich der Componist dieses Werkes vorzüglich im strengen Satz entschieden noch mehr leistete, als der Verfasser der »vier letzten Dinge«. Alle im strengen Styl gehaltenen Chöre und Fugen, gegen die man wohl nur in Nebendingen etwas aussetzen kann, haben wahren Kunstwerth, sind mit großem Fleiß bearbeitet und wurden auch allgemein laut und mit Enthusiasmus gewürdigt. Die Arien, Duetten und einzelnen Gesangstellen weichen aber zu sehr von dem ächten Style des Oratoriums ab, sind durchaus im Texte zu oft wiederholt und neigen sich mehr oder weniger zum italienischen Opernstyle. Einige gar zu auffallende Reminiscenzen aus der »Schöpfung« und vorzüglich aus der »Zauberflöte« vermindern den Werth des Werkes in Hinsicht der Originalität. Der Chor der Teufel am Ende des ersten Theils würde in einem Ballette anschaulich dargestellt an seinem Platze sein. Herr August Arnold, Verfasser des Textes, hat freilich auch kein Stück Arbeit geliefert, das dem Componisten zur musikalischen Bearbeitung genügen konnte ... Der Saal war kaum zur Hälfte voll. Am 24. wurde dies Oratorium wiederholt vor kaum zweihundert Zuhörern. Ein Werk dieser Art sollte aber auch in einer so lebenslustigen Stadt nicht in der Carnevalszeit aufgeführt werden!« –
Vierzehn Tage nach meinem ersten Auftreten kam denn auch Rode's Concert an die Reihe. Er hatte, gestützt auf seinen europäischen Ruf, das größte Concertlokal Wiens, den großen Redoutensaal, gewählt und fand ihn auch ganz gefüllt. Ich erwartete in fast fieberhafter Aufregung den Beginn von Rode's Spiel, welches mir vor zehn Jahren als höchstes Vorbild gegolten hatte. Doch schon nach dem ersten Solo schien es mir, als sei Rode in dieser Zeit zurückgeschritten. Ich fand jetzt sein Spiel kalt und manierirt, vermißte die frühere Kühnheit in Besiegung großer Schwierigkeiten und fühlte mich besonders unbefriedrigt vom Vortrage des Cantabile. Auch die Composition des neuen Concertes schien mir weit hinter der des siebenten in A-moll zurückzustehen. Bei dem Vortrage der E-dur-Variationen, die ich schon vor zehn Jahren von Rode gehört hatte, überzeugte ich mich vollends, daß dieser an technischer Sicherheit viel eingebüßt habe; denn nicht nur hatte er sich mehrere der schwierigsten Stellen vereinfacht, er trug auch diese erleichterten Passagen noch zaghaft und unsicher vor. Auch das Publikum schien unbefriedigt; wenigstens wußte er es nicht bis zum Enthusiasmus zu erwärmen. Der Berichterstatter der Musikalischen Zeitung sagt ebenfalls, daß Rode die Erwartung des Publikums »nicht ganz« befriedigt habe. »Sein Bogenstrich«, fährt der Bericht fort, »ist lang, groß und kräftig, sein Ton voll und stark – ja fast zu stark, schneidend, er hat eine richtige, reine Intonation und ist in Sprüngen bis in die entfernteste Höhe sicher; seine Doppelgriffe, obgleich dieselben nur sparsam vorkommen, sind gut und er überwindet im Allegro mit Leichtigkeit große Schwierigkeiten: dagegen mangelt ihm das, was alle Herzen elektrisirt und hinreißt – Feuer und jene Annehmlichkeit, die sich weiter nicht beschreiben läßt, jener Zauber, der Alles entzückt und begeistert. Im Adagio war das Scharfschneidende seines Tones noch fühlbarer, als im Allegro; er ließ daher kalt. Auch die Composition wollte nicht recht Eingang finden; man fand sie gesucht und manierirt. Vielleicht mag die Größe des großen Redoutensaales Herrn Rode verleitet haben, den Ton so scharf herauszuheben, daß darüber die Annehmlichkeit verloren ging.«
Acht Tage nach Rode's Concert gab ich im kleinen Redoutensaal mein zweites. Die Musikalische Zeitung sagt darüber: » Spohr bekundete sich ganz als großer Meister des Violinspiels. Er spielte von seiner Composition ein neues Violinconcert aus A-dur ( als zehntes gestochen), welchem eine Einleitung aus A-moll feierlich und langsam voranging. Das Adagio war aus D-dur. Ein allerliebstes Rondo endigte. Spohr ist unstreitig im Angenehmen und Zarten die Nachtigall unter allen jetzt lebenden, wenigstens uns bekannten Violinspielern. Es ist kaum möglich, ein Adagio mit mehr Zartheit und doch so deutlich, verbunden mit dem geläutertsten Geschmacke vorzutragen; dabei überwindet er im geschwinden Zeitmaße sehr schwere Passagen und die größtmöglichste Spannung mit einer unglaublichen Leichtigkeit, wozu ihm freilich die Größe seiner Hand wohl zu statten kommt. Er erhielt heute abermals allgemeinen und ungetheilten Beifall und wurde wiederholt hervorgerufen, welche Ehre im Concerte – so viel wir uns erinnern – nur Herrn Polledro widerfuhr. Mit seiner Frau spielte Herr Spohr ein Allegro, welches sie mit viel Fertigkeit, Geschmack und Ausdruck auf der Harfe vortrug. Es dünkt uns, von allen uns bekannten Virtuosinnen auf diesem Instrumente besitze keine so viel Schule und so viel inniges Gefühl im Ausdrucke, als Madame Spohr; dafür aber möchte Demoiselle Longhi mehr Kraft und Demoiselle Simonin-Pollet mehr Gleichheit im Spiele haben.«
Ueber Rode's zweites Concert enthält die Musikalische Zeitung die Nachricht, daß er »bei sehr besuchtem Saale ungleich mehr Beifall gefunden, als neulich; im Cantabile aber auch diesmal den Erwartungen des Publikums nicht genugsam entsprochen habe.«
Am 28. Januar spielte ich mit Seidler aus Berlin in dessen Concert und trug, wie ein Bericht sagt, »den Preis davon, obgleich das Spiel des Herrn Seidler lobenswerth war«.
Ich konnte daher mit der Aufnahme, die ich als Künstler in Wien gefunden hatte, vollkommen zufrieden sein; denn auch die einheimischen Blätter erkannten mir den Preis zu. In Privatgesellschaften, wo ich in der Regel nicht nur die genannten Geiger, sondern auch den ausgezeichnetsten der einheimischen, Herrn Mayseder, antraf und mit allen diesen zu wetteifern hatte, wurde meinen Vorträgen ebenfalls besondere Anerkennung und Aufmerksamkeit geschenkt. Es gab dann immer erst einen Streit, wer beginnen sollte, denn Jeder wollte der Letzte sein, um seine Vorgänger zu verdunkeln. Ich aber, der überhaupt viel lieber ein gediegenes Quartett, als ein Solostück vortrug, weigerte mich niemals, den Anfang zu machen und wußte durch meine mir eigenthümliche Auffassungs- und Vortragsweise der klassischen Quartetten auch stets die Aufmerksamkeit und Theilnahme der Gesellschaft zu gewinnen. Hatten dann die Anderen ein Jeder sein Paradepferd vorgeritten und bemerkte ich nun, daß die Gesellschaft mehr Sinn für dergleichen als für klassische Musik hatte, so holte ich zum Schlusse noch einen meiner schweren und brillanten Potpourri's herbei und wußte dann in der Regel auch die Bravour im Vortrage meiner Vorgänger noch zu überbieten.
Bei diesen häufigen Gelegenheiten, Rode zu hören, überzeugte ich mich immer mehr, daß dieser der vollkommene Geiger der früheren Zeit nicht mehr war. Durch die ewige Wiederholung derselben und immer derselben Compositionen, hatte sich in den Vortrag nach und nach eine Manier eingeschlichen, die nun nahe an Karrikatur grenzte. Ich hatte die Unverschämtheit, ihm dies anzudeuten, indem ich ihn fragte, ob er sich denn gar nicht mehr erinnere, wie er seine Compositionen vor zehn Jahren gespielt habe. Ja, ich steigerte meine Impertinenz so weit, daß ich die Variationen in G-dur auflegte und ihm sagte, ich wolle sie ihm genau in der Weise vortragen, wie ich sie vor zehn Jahren so oft von ihm gehört hätte. Nach beendetem Spiel brach die Gesellschaft in großen Jubel aus, und so mußte mir denn auch Rode Schicklichkeitshalber ein Bravo zurufen; doch sah man deutlich, daß er sich durch meine Indelikatesse verletzt fühlte. Und das mit vollem Recht. Ich schämte mich bald derselben und erwähne des Vorfalles jetzt nur, um zu zeigen, wie sehr ich mich damals als Geiger fühlte.
In hohem Grade mit Wien zufrieden, dachte ich nun an meine Weiterreise, als mir ganz unerwartet vom Grafen Palffy, dem damaligen Besitzer des Theaters an der Wien, der Antrag zu einem Engagement bei demselben auf drei Jahre als Kapellmeister und Orchesterdirektor gemacht wurde. Da ich mich nicht entschließen konnte, meine und meiner Frau Anstellung auf Lebenszeit aufzugeben, lehnte ich es anfangs entschieden ab. Als mir aber Herr Treitschke, der den Unterhändler machte, mehr denn dreimal so viel Gehalt, als ich bisher gemeinschaftlich mit meiner Frau in Gotha bezogen hatte, antrug; als er mir erzählte, das Theater an der Wien werde bald das erste Deutschlands sein, da es dem Grafen gelungen sei, die vorzüglichsten jetzt lebenden Sänger dafür zu gewinnen und er nun die Bildung des Orchesters aus den vorzüglichsten Künstlern Wiens mir zu übertragen gedenke; als er mir ferner vorstellte, ich werde bei einem so vortrefflichen Theater die herrlichste Gelegenheit finden, mich auch als dramatischer Componist auszubilden und auszuzeichnen: da konnte ich der Versuchung nicht länger widerstehen, erbat mir eine Frist, um mich mit meiner Frau zu benehmen und versprach, in einigen Tagen entscheidende Antwort zu sagen.
Bei dem großen Gehalte, der mir geboten und welcher den der beiden Hofkapellmeister Salieri und Weigl bedeutend überstieg, durfte ich hoffen, ein Drittheil, vielleicht die Hälfte davon zurücklegen zu können. Ferner konnte ich bei dem Ansehen, das ich mir als Künstler in Wien erworben hatte, mit Zuversicht darauf rechnen, durch Concerte, Komposition und Unterrichtgeben noch ein Bedeutendes außerdem zu verdienen. Mithin war ich auch für den Fall, daß die gebotene Stellung nach drei Jahren aufhören sollte, für die nächste Zukunft gesichert und konnte dann einen von frühester Jugend an gehegten Lieblingsplan, nämlich den einer Reise nach Italien, in Gesellschaft von Frau und Kindern zur Ausführung bringen.
Mehr jedoch noch als Alles dieses bestimmte mich die mit erneueter Kraft erwachte Lust, für das Theater zu schreiben, die Vorschläge des Grafen anzunehmen. So wurde denn, nachdem auch Dorette ihre Zustimmung, wiewohl mit Kummer über die nun nothwendige Trennung von Mutter und Geschwistern, gegeben hatte, der schriftliche Vertrag unter Zuziehung eines befreundeten Notars abgeschlossen und unterzeichnet. Ich verpflichtete mich, als Orchesterdirektor bei allen großen Opern vorzuspielen, die Violinsoli in Opern und Balletten zu übernehmen und als Kapellmeister aus der Partitur zu dirigiren, wenn der andere daran verhindert sein sollte. Von kleineren Opern, Balletten und Schauspiel-Musiken war ich befreit. Ich trat nun zunächst in Verbindung mit dem Grafen Palffy und meinem neuen Kollegen, dem Kapellmeister von Seyfried, um die Umgestaltung des Orchesters zu bewirken. Der Graf war in Bestimmung der Gehalte nicht knauserig; es gelang deshalb sehr bald, die begabtesten jungen Künstler für dasselbe zu gewinnen und ein Ensemble herzustellen, welches mein Orchester nicht nur zu den besten in Wien, sondern auch zu einem der vorzüglichsten von ganz Deutschland erhob.
Unter den neu angestellten Mitgliedern befand sich auch mein Bruder Ferdinand, sowie einer der begabtesten meiner anderen Schüler, Moritz Hauptmann aus Dresden. Dieser war eben in Wien angekommen und wünschte sich dort zu fixiren. Mein Bruder aber trat erst im Frühjahre ein.
Ich hatte mir einen vierwöchigen Urlaub für den nächsten Frühling ausbedungen, um meine Angelegenheiten in Gotha zu ordnen und meine Kinder abzuholen. Vorher aber mußte ich mir noch eine Wohnung einrichten, um nach meiner Rückkehr eine eigene Haushaltung beginnen zu können. Dabei ereignete sich ein Vorfall, der nicht nur auf dieses Geschäft, sondern auch auf meine künstlerischen Arbeiten in Wien großen Einfluß hatte. Es war nämlich kaum in der Stadt bekannt geworden, daß ich dort bleiben werde, als eines Morgens ein angesehener Fremder bei mir eintrat, der sich als Herrn von Tost, Fabrikbesitzer und leidenschaftlichen Musikfreund, vorstellte und die Zudringlichkeit seines Besuches damit entschuldigte, daß er mir einen Antrag zu machen habe. Nachdem er Platz genommen, und ich mich ihm erwartungsvoll gegenübergesetzt hatte, erging er sich erst in Lobeserhebungen über mein Compositions-Talent und sprach dann den Wunsch aus, daß ich ihm Alles, was ich in Wien schreiben werde und etwa schon geschrieben habe, gegen ein angemessenes Honorar auf drei Jahre als Eigenthum überlassen möge, doch so, daß ich ihm die Original-Partituren überliefere und selbst keine Abschrift davon behalte. Nach drei Jahren wolle er die Handschriften zurückgeben, und ich könne sie dann veröffentlichen oder verkaufen. Nachdem ich einen Augenblick über diesen sonderbaren und räthselhaften Antrag nachgedacht hatte, warf ich zuerst die Frage auf, ob denn die Werke in diesen drei Jahren gar nicht zur Aufführung kommen sollten? Worauf Herr von Tost erwiederte: »O ja, so oft wie möglich, doch jedesmal von mir dazu hergeliehen und nur in meiner Gegenwart.« Er wolle, setzte er noch hinzu, mir die Gattung der Compositionen nicht vorschreiben; doch wünsche er vorzugsweise solche, die sich in Privatzirkeln aufführen ließen, also Quartetten und Quintetten für Streich-Instrumente und Sextette, Oktette und Nonette für Streich- und Blas-Instrumente. Ich möge mir seinen Vorschlag überlegen und das Honorar für jede Compositions-Gattung bestimmen. Darauf übergab er mir seine Karte und empfahl sich.
Meine Frau und ich versuchten vergebens, zu ergründen, was Herr von Tost mit seinem Antrag bezwecke, und ich beschloß daher, ihn geradezu darüber zu befragen. Vorher zog ich Erkundigungen über ihn ein und erfuhr, daß er ein reicher Mann sei, bei Znaim bedeutende Tuchfabriken besitze, Musik leidenschaftlich liebe und kein öffentliches Concert versäume. Dies klang ganz beruhigend, und ich beschloß, auf den Antrag einzugehen. Als Honorar für das dreijährige Abtreten meiner Handschriften setzte ich für ein Quartett dreißig, für ein Quintett fünfunddreißig Dukaten und so verhältnißmäßig mehr für die übrigen Kunstgattungen an. Als ich nun zu wissen wünschte, was Herr von Tost während der drei Jahre mit den Werken anzufangen gedenke, wollte er anfangs nicht mit der Sprache heraus und meinte, dies könne mir gleichgültig sein, sobald er sich schriftlich anheischig mache, meine Compositionen nicht zu veröffentlichen; als er jedoch bemerkte, daß ich noch immer nicht beruhigt war, setzte er hinzu: »Ich beabsichtige zweierlei. Erstlich will ich zu den Musikpartien, in welchen Sie Ihre Compositionen vortragen werden, eingeladen sein, deshalb muß ich diese in meinem Verschlusse haben; und zweitens hoffe ich auf Geschäftsreisen im Besitze solcher Kunstschätze ausgebreitete Bekanntschaften unter den Musikfreunden zu machen, die mir dann für mein Fabrikgeschäft wieder von Nutzen sein werden.«
Wenn mir auch die Spekulation des Herrn von Tost nicht recht einleuchten wollte, so mußte ich mir doch sagen, daß dieser jedenfalls eine hohe Idee von dem Werthe meiner Compositionen habe. Dies bestach mich sehr und ließ keine weiteren Bedenklichkeiten aufkommen. Da nun auch Herr von Tost gegen die angesetzten Honorare und die Bestimmung, daß sie bei Ablieferung der Manuskripte auszuzahlen seien, nichts einzuwenden hatte, so wurde das Geschäft sogleich schriftlich abgeschlossen.
Ich hatte bereits ein Manuskript mit nach Wien gebracht, ein Solo-Quartett für Violine, welches ich auf der Reise vollendet hatte. Mit der Composition eines zweiten war ich eben beschäftigt. Dieses beschloß ich noch vor der Abreise nach Gotha fertig zu machen und dann beide an Herrn von Tost abzugeben.
Unterdessen war es mir geglückt, ganz in der Nähe des Theaters an der Wien eine passende Wohnung, die Bel-Etage in dem Hause eines Tischlers, zu finden. Da sie etwas verwohnt war, so ließ ich dieselbe neu malen und aufputzen und war nun im Begriff, sie auch zu möbliren. Ich lieferte daher meine beiden Quartetten an Herrn von Tost und erbat mir das Honorar von sechszig Dukaten, dabei bemerkend, daß ich des Geldes zu meiner häuslichen Einrichtung bedürfe. »Die werde ich Ihnen vollständig lieferen,« entgegnete er, »und zwar viel wohlfeiler, als wenn Sie selbst einkaufen; denn ich stehe mit allen Leuten, mit denen Sie zu thun haben werden, in Geschäftsverbindung und kann daher billigere Preise erwirken, als Sie. Auch finde ich dabei Gelegenheit, noch alte Schuldenreste einzuziehen. Nennen Sie mir daher einen Tag, wo ich Sie nebst Ihrer Frau Gemahlin abholen kann, um gemeinschaftlich alles Nöthige auszusuchen.«
So geschah es. Zuerst fuhren wir in die neue Wohnung, wo Herr von Tost mit großer Sachkenntniß ein Verzeichniß der nöthigen Gegenstände entwarf. Dann ging es von einem Gewölbe und Magazine zum anderen und meine Frau und ich hatten nur immer abzuwehren, daß er nicht zu viel und nicht immer gerade das Reichste und Prächtigste auswählte. Doch konnten wir es nicht hindern, daß für die Putzstube Möbeln von Mahagoni mit Seide überzogen und Vorhänge von gleichem Stoffe, und für die Küche eine Masse von Tafel- und Küchengeschirr angeschafft wurden, wie sie besser für einen Kapitalisten, als einen anspruchslosen Künstler gepaßt hätten. Vergebens stellte Dorette vor, wir würden keine Gastereien geben und bedürften daher eine solche Menge von Geschirr nicht. Er ließ sich nicht irre machen und als ich die Befürchtung aussprach, die Einrichtung werde für meine Verhältnisse zu viel kosten, erwiederte er: »Sein Sie unbesorgt, es wird Ihnen nicht zu viel kosten; auch werde ich keine Baarzahlung verlangen. Sie können nach und nach Alles mit Ihren Manuscripten ausgleichen.«
Dagegen ließ sich weiter nichts erinnern und so sahen wir uns im Besitze einer so glänzenden und zugleich geschmackvollen Einrichtung, wie sie gewiß keine andere Künstler-Familie der Stadt aufzuweisen hatte.
Ich ordnete nun Alles zu meiner Abreise. Meine Frau wurde von einer Dame ihrer Bekanntschaft, der Schwester des Advokaten Zizius, eines großen Musikfreundes, in dessen Hause wir oft musicirt hatten, eingeladen, bei ihr während meiner Abwesenheit zu wohnen, so daß ich sie ohne Besorgniß zurücklassen konnte.
Ich hatte erfahren, daß ein Leipziger Kaufmann im Begriffe nach seiner Heimath im eigenen Wagen mit Extrapost zurückzukehren, einen Reisegefährten suche; ich eilte daher, mich ihm als solchen anzutragen und wurde auch sogleich über die Bedingungen mit ihm einig. Ich erinnere mich nicht mehr seines Namens, wohl aber, daß er ein gebildeter und teilnehmender Gesellschafter war, von dem ich im besten Vernehmen schied. Wir fuhren ohne Aufenthalt bis Prag, blieben aber dort einen vollen Tag, um uns wieder zu erholen. Ich verbrachte ihn sehr angenehm im Hause meines Freundes Kleinwächter. Von Prag aus mußten wir die große Straße über Dresden verlassen, weil sich dort die Heere der kriegführenden Mächte gegenüberstanden und die Elbebrücke nicht zu passiren war, da einige Bogen derselben durch die Franzosen gesprengt waren. Wir mußten uns einen Weg über das Erzgebirge suchen, auf dem wir zwar auch Truppen-Abtheilungen antrafen, von denen wir aber weder angehalten, noch zurückgewiesen wurden. So kamen wir ohne weitere Abenteuer glücklich bis Chemnitz. Hier aber sollte ich etwas erleben, wodurch ich dermaßen in Schrecken versetzt wurde, daß ich darüber in Ohnmacht fiel, was mir, bei meinem kräftigen Körperbau, weder vorher noch nachher je wieder geschehen ist.
Wir kamen um die Mittagszeit in Chemnitz an, als sich im Hôtel so eben eine zahlreiche Gesellschaft zum Mittagsessen niedersetzte. Wir schlossen uns an und ich fand meinen Platz zwischen meinem Reisegefährten und der Wirthin des Hauses. Während diese die Suppe vorlegte, wollte ich mir nach dem Beispiele der übrigen Gäste von einem vor mir liegenden großen schwarzen Brode ein Stück abschneiden. Ich setzte das Messer an, welches aber nicht von der Stelle wollte, weil es, wie sich nachher zeigte, auf einen kleinen, in die Rinde des Brodes mit eingebackenen Stein gerathen war. Ich glaubte daher, das Messer sei stumpf und steigerte die Kraft des Druckes. Nun sprang es aber plötzlich ab, fuhr mir in die Kuppe des linken Zeigefingers und schnitt ein bedeutendes Stück Fleisch davon ab, welches auf den Teller vor mir niederfiel. Ein Blutstrom folgte. Dieser Anblick, oder vielmehr der Gedanke, daß es nun mit meinem Violinspiele zu Ende sei, und ich nicht mehr im Stande sein werde, mich und die Meinigen zu ernähren, erschreckte mich so, daß ich bewußtlos vom Stuhle sank. Als mir nach etwa zehn Minuten die Besinnung zurückkehrte, sah ich die ganze Gesellschaft in Aufruhr und um mich beschäftigt. Mein erster Blick fiel auf meinen Finger, den ich mit einem großen Stück englischen Pflasters, das die hülfreiche Wirthin herbeigeholt hatte, umwickelt fand. Es hatte sich fest in die durch den Schnitt entstandene Vertiefung hineingelegt, und ich konnte nun zu meiner Beruhigung sehen, daß nicht die ganze Fingerkuppe abgeschnitten war, wie ich im ersten Schrecken gefürchtet hatte. Doch war fast die Hälfte derselben nebst einem großen Stück vom Nagel fort. Da ich fast gar keinen Schmerz empfand, so ließ ich den Verband unangerührt und suchte erst in Leipzig einen Wundarzt auf, der das Pflaster aber ebenfalls liegen ließ und nur sorgfältige Vermeidung aller unsanften Berührung des Fingers rieth.
So kam ich denn ziemlich getröstet bei den Meinigen in Gotha an. Den Hof fand ich sehr verstimmt über die beabsichtigte Uebersiedelung nach Wien; die Herzogin war so böse, daß ich große Mühe hatte, sie zu besänftigen, was mir um so schwerer fiel, da ich nicht einmal mehr, was sie so sehr gewünscht hatte, bei Hofe zum Abschiede spielen konnte. Auch meine Schwiegermutter war in hohem Grade betrübt. Ich beeilte mich daher, soviel als möglich, aus diesen unangenehmen Verhältnissen herauszukommen. Meinem alten Freunde Bärwolf hatte ich schon einige Wochen früher den Auftrag ertheilt, die Möbeln und Geräthe, die ich nicht mitzunehmen gedachte, unter der Hand zu verkaufen. Dies war nach Wunsch geglückt. Ich ließ daher das Zurückbehaltene, hauptsächlich Betten, Spiegel, Musikalien, Kleider, Wäsche u. dgl. einpacken und schickte es als Fracht nach Regensburg voraus. Acht Tage später folgte ich mit meinem Bruder Ferdinand, meinen beiden Kindern und einem jungen Mädchen, einer Waise, die meine Schwiegermutter aufgenommen und erzogen hatte und mir nun als Kindermädchen überließ.
Der Abschied von den Verwandten und dem lieben Gotha war ein sehr trüber; doch erheiterten wir uns, vom herrlichsten Reisewetter begünstigt, bald wieder, und ich ergötzte mich sehr an den naiven Bemerkungen der Kinder über die vielen, noch nie gesehenen Gegenstände. So kamen wir zwar sehr ermüdet, aber seelenvergnügt in Regensburg an. Dort verweilten wir einige Tage, während welcher ich Alles zur Donaufahrt nach Wien vorbereitete. Ich miethete um mäßigen Preis ein eigenes Schiff und ließ meine bereits angelangten Frachtstücke darauf bringen. Die Betten wurden ausgepackt und zum Nachtlager unter dem Bretterhäuschen des Schiffes ausgebreitet. Die Koffer dienten als Sitzplätze. Da die Fahrt ohne anzuhalten, Tag und Nacht fortdauern sollte, so wurde auf vier bis fünf Tage Proviant eingekauft. Die Schiffsgesellschaft bestand außer mir und den Meinigen aus dem Schiffer, seiner Frau, welche die Küche besorgte, dem Schiffsknechte und drei Handwerksburschen, welchen ich freie Fahrt und Kost gab, wofür sie sich anheischig gemacht hatten, fleißig zu ruderen.
Es war im Mai zur Zeit des Vollmonds und der tiefblaue Himmel war über die reizenden Gegenden ausgebreitet. Der Frühling hatte so eben die ganze Natur in sein erstes saftiges Grün gekleidet und die Obstbäume standen noch in der prächtigsten Blüthe. Die buschigen Ufer des herrlichen Stromes waren von zahlreichen Nachtigallen bewohnt, die besonders während der stillen, hellen Nächte unaufhörlich schlugen. Es war eine Fahrt zum Entzücken, und ich habe mich fortwährend durch mein ganzes, langes Leben hindurch bestrebt, sie unter ähnlichen günstigen Umständen noch einmal machen zu können; doch leider vergeblich.
Als wir den berühmten Strudel und den Wirbel passirten, was zu jener Zeit noch nicht ganz gefahrlos geschehen konnte, wurde unser bis dahin sehr jovialer Schiffer plötzlich ernst und ermahnte die Ruderer eindringlich, seinen Anordnungen auf das Pünktlichste nachzukommen. In dem Augenblicke, als uns der reißende Strom ergriff, erblaßte er, die Frau warf sich auf die Knie und heulte mehr, als sie es sprach, ein Gebet an die heilige Jungfrau; auch selbst mir schien der Moment voll großer Gefahr zu sein. Ich ermahnte daher meinen Bruder, der wie ich ein geübter Schwimmer war, im Falle eines Unglücks mir bei Rettung der Kinder beizustehen. Doch kamen wir die abschüssige Stromschnelle glücklich hinab und wichen auch dem Wirbel, der übrigens nur für ganz kleine Kähne gefahrdrohend ist, mit Erfolg aus.
Auf dem Felsen, der am Ende des Strudels mitten im Strome liegt und durch das Zurückwerfen der Fluthen den Wirbel erzeugt, wohnte damals ein alter Einsiedler, der von den Gaben der Vorbeireisenden lebte. Er fuhr in seinem kleinen Kahne zum großen Ergötzen der Kinder, die noch keinen Eremiten gesehen hatten, auch an unser Schiff heran und empfing die übliche Spende.
Am vierten Tage unserer Wasserfahrt kamen wir gegen Abend in Wien an und sahen schon von weitem Doretten in Gesellschaft ihrer Wirthe am Landungsplatze unserer harren. Das war ein beglückendes Wiedersehen! Noch an demselben Abende wurde das Gepäck in die neue Wohnung gebracht, die wir Tags darauf bezogen.
Meine Wunde war bei meiner Ankunft in Wien fast geheilt. Zu meinem Erstaunen und noch viel mehr zu dem der Wundärzte, denen ich davon erzählte, war unter dem englischen Pflaster, welches noch immer den Finger umhüllte, neues Fleisch an der Stelle des ausgeschnittenen gewachsen und hatte sich nach und nach bis zu dem früheren Umfange der Fingerkuppe ausgedehnt. Auch das fehlende Stück Nagel war wieder gewachsen, doch nur nothdürftig mit dem übrigen Nagel verbunden, so daß eine Vertiefung zurückgeblieben war, die noch jetzt sichtbar ist und den Umfang des damals Weggeschnittenen deutlich erkennen läßt. Mit Hülfe eines Ueberzuges von Leder konnte ich meinen Finger wieder gebrauchen und wenn auch nicht gleich Solo spielen, doch meinen Dienst im Orchester beginnen.
Ich führte nun ein sehr thätiges, im Genusse des Familienglückes auch höchst zufriedenes Leben. Der frühe Morgen fand mich schon am Clavier oder am Schreibtische, und auch jede andere Tageszeit, die mir der Orchesterdienst und mein Unterrichtgeben frei ließ, wurde der Composition gewidmet. Ja, mein Kopf gährte und arbeitete damals so unaufhörlich, daß ich selbst auf den Wegen zu meinen Schülern, sowie auf Spaziergängen fortwährend componirte und dadurch bald die Fertigkeit gewann, lange Perioden, ja ganze Musikstücke, im Kopfe vollständig auszuarbeiten, die dann ohne weitere Nachhülfe niedergeschrieben werden konnten. Sobald dies geschehen, waren sie im Gedächtnisse wie ausgelöscht, und ich hatte wieder Raum für neue Combinationen. Dorette schmälte oft auf unseren Spaziergängen über dieses unaufhörliche Denken und war froh, wenn das Geplauder der Kinder mich davon abzuziehen vermochte. War dies einmal geschehen, so gab ich mich gern den äußeren Eindrücken hin; nur durfte man mich nicht wieder in mein Grübeln zurückfallen lassen, was Dorette auch stets mit großer Gewandtheit zu verhüten wußte.
Wir lernten schon im ersten Sommer unseres Aufenthaltes zu Wien die herrliche Umgebung der Stadt recht genau kennen, da wir fast jeden schönen Abend, in welchem ich im Theater unbeschäftigt war, im Freien zubrachte. Dann suchten wir, unser einfaches Abendessen in einem vom Kindermädchen getragenen Körbchen mit uns führend, irgend eine schöne Aussicht auf, um den Sonnenuntergang zu sehen. So haben wir manchen glücklichen Abend bei »der Spinnerin am Kreuz«, wo man eine besonders herrliche und reiche Uebersicht der Stadt hat, verlebt. Sonntags nahmen wir dann auch wohl an der Linie einen Zeiselwagen und machten weitere Ausflüge nach dem Leopoldsberge oder der Brühl, oder nach Laxenburg und Baden.
Der Lieblings-Spaziergang der Kinder war aber immer nach Schönbrunn zur Menagerie oder in den Prater zum sogenannten »Dörfl«, wo sie die Caroussele, die Puppen- und Hunde-Komödien und andere Herrlichkeiten immer mit neuem Entzücken erfüllten. Ich und meine Frau, im Gemüth selbst noch halbe Kinder, nahmen an der Freude unserer Lieblinge den innigsten Antheil. Es war eine schöne, frohe und sorgenlose Zeit!
Meine erste Arbeit nach der Rückkehr von Gotha war die Composition des »Faust.« Ich hatte vor der Reise einen anderen Stoff im Auge, den mir Theodor Körner als Oper bearbeiten wollte. Bald nach meiner Ankunft in Wien machte ich die Bekanntschaft des jungen Dichters, der schon damals wegen seiner Liebenswürdigkeit sowohl, als des Erfolges seiner Theaterstücke sehr gefeiert wurde. Ich traf ihn fast in allen Gesellschaften, wo ich spielte, und da Körner die Musik sehr liebte, so schlossen wir uns bald an einander an. Als es dann entschieden war, daß ich in Wien bleiben werde, bat ich Körner, mir eine Oper zu schreiben, wozu ich ihm die Sage vom Rübezahl vorschlug. Körner, der beide Aufführungen des »jüngsten Gerichts« mit angehört und von meinem Compositions-Talent eine gute Meinung hatte, sagte ohne Bedenken zu und ging gern auf den ihm vorgeschlagenen Stoff ein. Doch plötzlich hieß es, Körner wolle als Freiwilliger unter Lützow's Reiterschaar gehen und für die Befreiung Deutschlands kämpfen. Ich eilte zu ihm und versuchte, wie viele andere meiner Freunde, ihm diesen Vorsatz auszureden; doch ohne Erfolg. Bald schon sahen wir ihn scheiden. Später wurde es bekannt, daß ihn nicht allein die Begeisterung für den deutschen Befreiungskampf, sondern eine unglückliche, unerwiderte Liebe zur schönen Schauspielerin Adamberger von Wien vertrieben und in den frühen Tod gestürzt hatte.
So sah ich meine Hoffnung, von dem jungen begabten Dichter ein Opernbuch zu bekommen, leider vereitelt und mußte mich nun nach einem anderen umsehen. Es kam mir daher gelegen, daß Herr Bernard seine Bearbeitung des Faust mir zur Composition antrug und bald hatten wir uns über die Bedingungen geeinigt. Einige Abänderungen, die ich wünschte, wurden vom Dichter während meiner Reise nach Gotha vorgenommen, so daß ich nach meiner Rückkehr augenblicklich beginnen konnte. Aus dem Verzeichnisse meiner Kompositionen ersehe ich, daß ich diese Oper in weniger als vier Monaten, von Ende Mai bis Mitte September, geschrieben habe. Noch jetzt ist mir erinnerlich, mit welcher Begeisterung und Ausdauer ich daran arbeitete. Hatte ich einige Nummern vollendet, so eilte ich damit zu Meyerbeer, der sich damals in Wien aufhielt und bat ihn, sie mir aus der Partitur vorzuspielen, worin dieser sehr excellirte. Ich übernahm dann die Singstimme und trug sie in ihren verschiedenen Charakteren und Stimmlagen mit großer Begeisterung vor. Reichte meine Kehlfertigkeit nicht aus, so half ich mir mit Pfeifen, worin ich sehr geübt war. Meyerbeer nahm großes Interesse an dieser Arbeit, welches sich bis in die neueste Zeit erhalten zu haben scheint, da er während seiner Leitung der Berliner Oper den »Faust« von neuem in Scene setzte und mit großer Sorgfalt selbst einübte.
Aber auch Pixis der Jüngere, der damals bei seinen Eltern in Wien wohnte, sowie Hummel und Seyfried, zeigten große Vorliebe für diese Oper, so daß ich sie mit den schönsten Hoffnungen auf einen glänzenden Erfolg dem Theater an der Wien zur Aufführung antrug. Graf Palffy, mit dem ich damals noch in gutem Vernehmen war, nahm sie auch sogleich an und versprach, sie baldmöglichst zu vertheilen und zur Aufführung zu bringen. Ich hatte bei der Arbeit das Personal meines Theaters zwar im Auge gehabt, den Faust für Forti, den Mephistopheles für Weinmüller, den Hugo für Wild, den Franz für Gottdank, die Kunigunde für Madame Campi und das Röschen für Demoiselle Teiner geschrieben; es war mir aber doch, abgesehen davon, daß ich damals überhaupt noch nicht verstand, mich immer in den Schranken des natürlichen Stimmumfangs zu halten, allerlei aus der Feder geflossen, was für die genannten Sänger nicht paßte, wie z. B. die langen Coloraturen in der Arie des Hugo für Wild, der damals noch wenig Geläufigkeit besaß. Dies wurde später vom Grafen, als ich mich mit ihm entzweit hatte, als Vorwand benutzt, um seine Zusage zurückzunehmen, und wirklich kam die Oper, so lange ich in Wien war, gar nicht zur Aufführung. Einige Jahre später wurde sie dann mit vielem Erfolge gegeben und in neuerer Zeit mit noch gesteigertem Beifall von neuem in Scene gesetzt. Ich, der ich mich von jeher nur so lange für meine Compositionen interessirte, als ich daran arbeitete und von ihnen erfüllt war, ertrug es mit großer Gemüthsruhe, daß meine Partitur in der Theaterbibliothek ungenützt ruhte und machte mich sogleich an neue Arbeiten. Selbst den Clavierauszug der Oper, den Pixis mit großer Liebe verfertigt hatte, ließ ich erst viele Jahre später bei Peters in Leipzig stechen.
Nach Beendigung des »Faust« glaubte ich nun zunächst meiner Verpflichtung gegen Herrn von Tost nachkommen zu müssen. Ich fragte deshalb bei ihm an, welche Kunstgattung ihm für diesmal die liebste sein werde. Mein Kunst-Mäcen sann ein wenig nach und meinte dann, ein Nonett, concertirend für die vier Streich-Instrumente, Violine, Viola, Violoncell und Contrabaß, und die fünf vornehmsten Blas-Instrumente, Flöte, Oboë, Clarinette, Horn und Fagott, so geschrieben, daß jedes dieser Instrumente seinem Character und Wesen gemäß hervortrete, möchte doch wohl eine eben so interessante, wie dankbare Aufgabe sein, und da er gar nicht zweifle, daß ich sie mit Glück lösen werde, so gebe er anheim, sie als die nächste Arbeit zu wählen. Ich fühlte mich durch die Schwierigkeit der Ausgabe angezogen, willigte mit Freuden ein und machte mich sogleich an die Arbeit. So entstand das bekannte Nonett, welches als Op. 31 bei Steiner, in Wien erschienen und bis jetzt das einzige seiner Gattung geblieben ist. Ich vollendete es in kurzem und lieferte die Partitur an Herrn von Tost ab. Dieser ließ es ausschreiben und lud dann die ausgezeichnetsten Künstler Wiens zu sich ein, um es unter meiner Anleitung einzuüben. Dann wurde es in einer der ersten, mit dem Winter beginnenden, Musikpartien aufgeführt und erhielt so lebhaften Beifall, daß es im Laufe desselben noch oft wiederholt werden mußte. Herr von Tost erschien dann jedesmal mit der Musikmappe unter dem Arme, legte die Stimmen selbst auf die Pulte und schloß sie nach beendigtem Vortrage sogleich wieder ein. Er fühlte sich durch den Beifall, den das Werk fand, so beglückt, als wäre er selbst der Componist. Auch die beiden Quartetten, die er im Manuscripte besaß, spielte ich häufig in Gesellschaften, und so wurde sein Wunsch, zu recht vielen Musikpartien eingeladen zu werden, vollständig erfüllt. Ja, bald war man es so gewohnt, wo ich spielte, auch Herrn von Tost mit seiner Musikmappe zu sehen, daß er eingeladen wurde, auch wenn ich keines seiner Manuscripte vortrug.
Vor dem Schlusse des Jahres 1813 schrieb ich noch ein Rondo für Harfe und Violine für meine Frau und mich, und ein Streichquartett für Herrn von Tost. Es ist das in G-Dur, Op. 33, welches der Verleger aus Versehen als Nr. 2 bezeichnet hat. Es ist jedoch sechs Monate früher, als das in Es-dur, geschrieben worden.
Wegen dieses Quartettes wurde ich in eine literarische Fehde verwickelt, welche die erste und auch die letzte gewesen ist, die ich meiner Compositionen halber je geführt habe. Es fand bei den Künstlern und Kunstkennern Wiens eine besonders günstige Aufnahme, und auch ich hielt es, und mit Recht, für das Beste, was ich bis dahin geschrieben hatte. Um so kränkender mußte es für mich sein, daß der Recensent eines damaligen Wiener Kunstblattes gar nichts Gutes daran finden wollte. Besonders fühlte ich mich durch die hämische Weise verletzt, womit derselbe von der theoretischen Bearbeitung des ersten Satzes sprach, die mein Stolz war und die Bewunderung der Kenner erregt hatte. Noch jetzt, nach so langer Zeit, erinnere ich mich jener Worte, die ungefähr so hießen: »Dieses ewige Wiederkäuen des Thema in allen Stimmen und Tonlagen kommt mir vor, wie wenn man einem dummen Bedienten einen Auftrag zu geben hat, den er nicht begreifen kann und den man daher unzählige Male in den verschiedensten Sprachwendungen wiederholen muß, damit er klar werde. Für solche dumme Bedienten scheint der Componist seine Zuhörer zu halten!«
Ich erfuhr bald, daß der ungenannte Recensent Herr von Mosel sei, der Componist einer lyrischen Tragödie »Salem«, von der ich allerdings sehr vorlaut gesagt hatte: »Ich habe im Leben nichts Langweiligeres gehört.« Dieses Urtheil war unglücklicher Weise dem Komponisten zu Ohren gekommen und hatte seine Galle in so hohem Grade erregt. Herr von Tost, der auf meine Compositionen, besonders solche, die er in seiner Mappe hatte, stolzer war, als der Componist selbst, ließ nicht nach, bis ich eine Antikritik geschrieben hatte. Was ich zur Abwehr und besonders zur Vertheidigung meiner thematischen Durchführung sagte, erinnere ich mich nicht mehr, wohl aber, daß ich es an Seitenhieben auf »Salem« nicht fehlen ließ. Dies goß Oel in's Feuer, und so entspann sich eine Fehde, die noch lange fortgesetzt worden wäre, hätte nicht die Censur einen Riegel vorgeschoben, indem sie dem Redakteur des Blattes verbot, Weiteres in der Sache aufzunehmen. Da mich solche Zänkereien sehr anwiderten, so war ich froh, zu meinem harmlosen Componiren zurückkehren zu können.
Im Herbste des Jahres 1813 hatte mir Dorette einen Knaben geboren. Unser Glück über diesen Familien-Zuwachs war leider von kurzer Dauer; denn der Knabe fing bald zu kränkeln an und starb, ehe er noch drei Monate alt geworden war. Die arme Mutter suchte und fand Trost bei ihrer Harfe; sie übte zu meinem im December bevorstehenden Benefiz-Concerte das neue Rondo mit mir ein. Nach der Musikalischen Zeitung fand dies Concert im kleinen Redouten-Saale statt, und mein Bruder Ferdinand trat darin in einem Violinduett mit mir auf.
Unterdessen war die große Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen. Die verbündeten Heere hatten den Rhein überschritten, und man hoffte, sie bald in Paris einziehen zu sehen. In Wien wurden zur Feier dieses Einzuges, sowie für die Rückkehr des Kaisers und seines siegreichen Heeres, große Festlichkeiten vorbereitet. Sämmtliche Theater ließen Festspiele dichten und componiren, und die kürzlich errichtete Gesellschaft der Musikfreunde des Oesterreichischen Kaiserstaates unter dem Protektorate des Erzherzogs Rudolph machte Anstalten zu einer kolossalen Aufführung des »Samson« von Händel in der kaiserlichen Reitschule, wozu Herr von Mosel die Instrumentirung vermehrte. Andere Gesellschaften unternahmen Aehnliches. So kam auch Herr von Tost auf die Idee, eine große Musik-Aufführung bei der Rückkehr des Kaisers zu veranstalten und befragte mich, ob ich ihm dazu eine Cantate schreiben wolle, deren Inhalt die Befreiung Deutschlands sein müsse. Ich sagte gern zu, bemerkte jedoch, daß dieser Stoff an sich dem Componisten nur wenig dankbare Momente darbieten werde, und ihn deshalb ein guter Dichter bearbeiten müsse, um solche zu schaffen.
»O, daran soll es nicht fehlen«, war die Antwort. »Ich gehe sogleich zur Frau von Pichler und zweifle nicht, daß sie es übernehmen wird, Ihnen den Text zu liefern!« Und so geschah es auch. Ich besprach mich mit der Dichterin über Inhalt und Form, und sie lieferte mir dann ein Textbuch, das im reichen Wechsel häuslicher und kriegerischer Scenen eine Reihe sehr günstiger Momente für Composition darbot.
Ich machte mich sogleich an die Arbeit und beendete diese Cantate, die zwei Stunden dauert, bei allen meinen übrigen vielen Arbeiten, in drittehalb Monaten, von Januar bis Mitte März 1814.
Herr von Tost hatte unterdessen für die Solopartien die vier besten Sänger Wiens, die Damen Buchwieser und Milder, und die Herren Wild und Weinmüller, engagirt, und wollte zur Aufführung der Chöre sämmtliche Kirchen- und Chorsänger der Theater vereinigen. Die Stimmen wurden ausgeschrieben und vertheilt, und ich war bereits einigemale zu Madame Milder gegangen, um ihr beim Einüben ihrer Partie behülflich zu sein. Da stürzte eines Morgens Herr von Tost in mein Zimmer und rief voll Verzweiflung: »So eben ist mir der große Redouten-Saal zu unserer Aufführung unter dem nichtigen Vorwande abgeschlagen worden, er könne wegen der Vorbereitungen zu den Hof-Festen nicht entbehrt werden! Daran ist nur die Eifersucht der Musik-Gesellschaft Schuld, die außer ihrer Aufführung in der Reitschule keine andere großartige will zu Stande kommen lassen. Was ist nun zu thun? Seit der Zerstörung des Apollo-Saales gibt es in Wien außer dem großen Redouten-Saale kein Lokal mehr für solch' eine Musik-Aufführung.«
Mir fiel noch der Circus des Herrn de Bach im Prater ein. Sogleich fuhren wir hinaus, um zu sehen, ob die Reitbahn in der Mitte des Gebäudes wohl Raum genug darbieten werde, um unser Orchester- und Theater-Personal aufstellen zu können. Ich glaubte es und versprach mir von der Aufstellung der Mitwirkenden im Mittelpunkte des Gebäudes eine großartige Wirkung. Leider war aber auch dieses Lokal, ich weiß nicht mehr aus welchem Grunde, nicht zu haben, und so scheiterte das ganze Unternehmen zum größten Leidwesen des Herrn von Tost.
Es ging mit dieser Cantate wie mit dem »Faust.« Auch sie kam erst zur Aufführung, als ich Wien schon längst verlassen hatte. Ich hörte sie zuerst beim Musikfeste in Frankenhausen, am Jahrestage der Leipziger Schlacht, im Jahre 1815.
Wie mir, so ging es auch Beethoven mit einer ähnlichen Festarbeit; sie kam damals ebenfalls nicht zur Aufführung. Sie hieß »Der glorreiche Augenblick« und wurde später mit verändertem Texte bei Haslinger in Wien gestochen.
Bei der Erwähnung Beethoven's fällt mir ein, daß ich meines freundschaftlichen Verhältnisses zu diesem großen Künstler noch nicht erwähnt habe und ich beeile mich daher, das Versäumte nachzuholen.
Nach meiner Ankunft in Wien suchte ich Beethoven sogleich auf, fand ihn aber nicht und ließ deshalb meine Karte zurück. Ich hoffte nun, ihn in irgend einer der musikalischen Gesellschaften zu finden, zu denen ich häufig eingeladen wurde, erfuhr aber bald, Beethoven habe sich, seitdem seine Taubheit so zugenommen, daß er Musik nicht mehr deutlich und im Zusammenhange hören könne, von allen Musikpartien zurückgezogen und sei überhaupt sehr menschenscheu geworden. Ich versuchte es daher nochmals mit einem Besuche; doch wieder vergebens. Endlich traf ich ihn ganz unerwartet in dem Speisehause, wohin ich jeden Mittag mit meiner Frau zu gehen pflegte. Ich hatte nun schon Concert gegeben und zweimal mein Oratorium aufgeführt. Die Wiener Blätter hatten günstig darüber berichtet. Beethoven wußte daher von mir, als ich mich ihm vorstellte, und begrüßte mich ungewöhnlich freundlich. Wir setzten uns zusammen an einen Tisch, und Beethoven wurde sehr gesprächig, was die Tischgesellschaft sehr verwunderte, da er gewöhnlich düster und wortkarg vor sich hinstarrte. Es war aber eine sauere Arbeit, sich ihm verständlich zu machen, da man so laut schreien mußte, daß es im dritten Zimmer gehört werden konnte. Beethoven kam nun öfter in dieses Speisehaus und besuchte mich auch in meiner Wohnung. So wurden wir bald gute Bekannte. Beethoven war ein wenig derb, um nicht zu sagen roh; doch blickte ein ehrliches Auge unter den buschigen Augenbrauen hervor. Nach meiner Rückkehr von Gotha traf ich ihn dann und wann im Theater an der Wien, dicht hinter dem Orchester, wo ihm der Graf Palffy einen Freiplatz gegeben. Nach der Oper begleitete er mich gewöhnlich nach meinem Hause und verbrachte den Rest des Abends bei mir. Dann konnte er auch gegen Dorette und die Kinder sehr freundlich sein. Von Musik sprach er höchst selten. Geschah es, dann waren seine Urtheile sehr streng und so entschieden, als könne gar kein Widerspruch dagegen stattfinden. Für die Arbeiten Anderer nahm er nicht das mindeste Interesse; ich hatte deshalb auch nicht den Muth, ihm die meinigen zu zeigen. Sein Lieblingsgespräch in jener Zeit war eine scharfe Kritik der beiden Theater-Verwaltungen des Fürsten Lobkowitz und des Grafen Palffy. Auf Letzteren schimpfte er oft schon überlaut, wenn wir noch innerhalb seines Theaters waren, so daß es nicht nur das ausströmende Publikum, sondern auch der Graf selbst in seinem Büreau hören konnte. Dies setzte mich sehr in Verlegenheit, und ich war nur immer bemüht, das Gespräch auf andere Gegenstände zu lenken.
Das schroffe, selbst abstoßende Benehmen Beethoven's in jener Zeit rührte theils von seiner Taubheit her, die er noch nicht mit Ergebung zu tragen gelernt hatte, theils war es Folge seiner zerrütteten Vermögens-Verhältnisse. Er war kein guter Wirth und hatte noch das Unglück, von seiner Umgebung bestohlen zu werden. So fehlte es oft am Nöthigsten. In der ersten Zeit unserer Bekanntschaft fragte ich ihn einmal, nachdem er mehrere Tage nicht in's Speisehaus gekommen war: »Sie waren doch nicht krank?« – »Mein Stiefel war's, und da ich nur das eine Paar besitze, hatte ich Hausarrest«, war die Antwort.
Aus dieser drückenden Lage wurde er aber nach einiger Zeit durch die Bemühungen seiner Freunde herausgerissen. Die Sache verhielt sich so:
Beethoven's »Fidelio«, der 1804 (oder 1805) unter ungünstigen Verhältnissen, während der Besetzung Wiens durch die Franzosen, einen sehr geringen Erfolg gehabt hatte, wurde jetzt von den Regisseuren des Kärnthnerthor-Theaters wieder hervorgesucht und zu ihrem Benefize in Scene gesetzt. Beethoven hatte sich bewegen lassen, nachträglich dazu eine neue Ouvertüre (die in E), ein Lied für den Kerkermeister und die große Arie für Fidelio (mit den obligaten Hörnern) zu schreiben, so wie auch einige Abänderungen vorzunehmen. In dieser neuen Gestalt machte nun die Oper großes Glück und erlebte eine lange Reihe zahlreich besuchter Aufführungen. Der Componist wurde am ersten Abend mehreremale herausgerufen und war nun wieder der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit. Diesen günstigen Augenblick benutzten seine Freunde, um für ihn ein Concert im großen Redouten-Saale zu veranstalten, in welchem die neuesten Compositionen Beethoven's zur Aufführung kommen sollten. Alles, was geigen, blasen und singen konnte, wurde zur Mitwirkung eingeladen, und es fehlte von den bedeutenderen Künstlern Wiens auch nicht einer. Ich und mein Orchester hatten uns natürlich auch angeschlossen, und ich sah Beethoven zum erstenmale dirigiren. Obgleich mir schon viel davon erzählt war, so überraschte es mich doch in hohem Grade. Beethoven hatte sich angewöhnt, dem Orchester die Ausdruckszeichen durch allerlei sonderbare Körperbewegungen anzudeuten. So oft ein sforzando vorkam, riß er beide Arme, die er vorher auf der Brust kreuzte, mit Vehemenz auseinander. Bei dem piano bückte er sich nieder, und um so tiefer, je schwächer er es wollte. Trat dann ein crescendo ein, so richtete er sich nach und nach wieder auf und sprang beim Eintritte des forte hoch in die Höhe. Auch schrie er manchmal, um das forte noch zu verstärken, mit hinein, ohne es zu wissen.
Seyfried, dem ich mein Erstaunen über diese sonderbare Art zu dirigiren aussprach, erzählte von einem tragi-komischen Vorfalle, der sich bei Beethoven's letztem Concerte im Theater an der Wien ereignet hatte.
Beethoven spielte ein neues Pianoforte-Concert von sich, vergaß aber schon beim ersten tutti, daß er Solospieler war, sprang auf und fing an, in seiner Weise zu dirigiren. Bei dem ersten sforzando schleuderte er die Arme so weit auseinander, daß er beide Leuchter vom Clavierpulte zu Boden warf. Das Publikum lachte, und Beethoven war so außer sich über diese Störung, daß er das Orchester aufhören und von neuem beginnen ließ. Seyfried, in der Besorgniß, daß sich bei derselben Stelle dasselbe Unglück wiederholen werde, hieß zwei Chorknaben sich neben Beethoven stellen und die Leuchter in die Hand nehmen. Der eine trat arglos näher und sah mit in die Clavierstimme. Als daher das verhängnißvolle sforzando hereinbrach, erhielt er von Beethoven mit der ausfahrenden Rechten eine so derbe Maulschelle, daß der arme Junge vor Schrecken den Leuchter zu Boden fallen ließ. Der andere Knabe, vorsichtiger, war mit ängstlichen Blicken allen Bewegungen Beethoven's gefolgt und es glückte ihm daher, durch schnelles Niederbücken der Maulschelle auszuweichen. Hatte das Publikum vorher schon gelacht, so brach es jetzt in einen wahrhaft bacchanalischen Jubel aus. Beethoven gerieth dermaßen in Wuth, daß er gleich bei den ersten Accorden des Solo ein halbes Dutzend Saiten zerschlug. Alle Bemühungen der ächten Musikfreunde, die Ruhe und Aufmerksamkeit wieder herzustellen, blieben für den Augenblick fruchtlos. Das erste Allegro des Concertes ging daher ganz für die Zuhörer verloren. Seit diesem Unfalle wollte Beethoven kein Concert wieder geben.
Das von seinen Freunden veranstaltete hatte aber den glänzendsten Erfolg. Die neuen Kompositionen Beethoven's gefielen außerordentlich, besonders die Symphonie in A-dur (die siebente); der wundervolle zweite Satz wurde da capo verlangt; er machte auch auf mich einen tiefen, nachhaltigen Eindruck. Die Ausführung war eine ganz meisterhafte, trotz der unsicheren und dabei oft lächerlichen Direktion Beethoven's.
Daß der arme, taube Meister die piano seiner Musik nicht mehr hören konnte, sah man ganz deutlich. Besonders auffallend war es aber bei einer Stelle im zweiten Theile des ersten Allegro der Symphonie. Es folgen sich da zwei Halte gleich nach einander, von denen der zweite pianissimo ist. Diesen hatte Beethoven wahrscheinlich übersehen, denn er fing schon wieder an zu taktiren, als das Orchester noch nicht einmal diesen zweiten Halt eingesetzt hatte. Er war daher, ohne es zu wissen, dem Orchester bereits zehn bis zwölf Takte vorausgeeilt, als dieses nun auch, und zwar pianissimo begann. Beethoven, um dieses nach seiner Weise anzudeuten, hatte sich ganz unter dem Pulte verkrochen. Bei dem nun folgenden crescendo wurde er wieder sichtbar, hob sich immer mehr und sprang hoch in die Höhe, als der Moment eintrat, wo, seiner Rechnung nach, das forte beginnen mußte. Da dieses ausblieb, sah er sich erschrocken um, starrte das Orchester verwundert an, daß es noch immer pianissimo spielte, und fand sich erst wieder zurecht, als das längst erwartete forte endlich eintrat und ihm hörbar wurde.
Glücklicherweise fiel diese komische Scene nicht bei der Aufführung vor, sonst würde das Publikum sicher wieder gelacht haben.
Da der Saal überfüllt und der Beifall enthusiastisch war, so veranstalteten die Freunde Beethoven's eine Wiederholung des Concertes, welche eine fast gleich große Einnahme abwarf. Für die nächste Zeit war daher Beethoven seiner Geldverlegenheit enthoben; doch soll sie aus gleichen Ursachen noch einigemale vor seinem Tode wiedergekehrt sein.
Bis zu diesem Zeitpunkte war eine Abnahme der Beethoven'schen Schöpfungskraft nicht zu bemerken. Da er aber von nun an, bei immer zunehmender Taubheit, gar keine Musik mehr hören konnte, so mußte dies nothwendig lähmend auf seine Phantasie zurückwirken. Sein stetes Streben, originell zu sein und neue Bahnen zu brechen, konnte nicht mehr, wie früher, durch das Ohr vor Irrwegen bewahrt werden. War es daher zu verwundern, daß seine Arbeiten immer barocker, unzusammenhängender und unverständlicher wurden? Zwar gibt es Leute, die sich einbilden, sie zu verstehen und in ihrer Freude darüber sie weit über seine früheren Meisterwerke erheben. Ich gehöre aber nicht dazu und gestehe frei, daß ich den letzten Arbeiten Beethoven's nie habe Geschmack abgewinnen können. Ja, schon die viel bewunderte neunte Symphonie muß ich zu diesen rechnen, deren drei erste Sätze mir, trotz einzelner Genie-Blitze, schlechter vorkommen, als sämmtliche der acht früheren Symphonien, deren vierter Satz mir aber so monströs und geschmacklos und in seiner Auffassung der Schiller'schen Ode so trivial erscheint, daß ich immer noch nicht begreifen kann, wie ihn ein Genius wie der Beethoven'sche niederschreiben konnte. Ich finde darin einen neuen Beleg zu dem, was ich schon in Wien bemerkte, daß es Beethoven an ästhetischer Bildung und an Schönheitssinn fehle.
Da Beethoven zu der Zeit, wo ich seine Bekanntschaft machte, bereits aufgehört hatte, sowohl öffentlich als in Privatgesellschaften zu spielen, so habe ich nur ein einziges mal Gelegenheit gefunden, ihn zu hören, als ich zufällig zu der Probe eines neuen Trio ( D-dur ¾-Takt) in Beethoven's Wohnung kam. Ein Genuß war's nicht; denn erstlich stimmte das Pianoforte sehr schlecht, was Beethoven wenig kümmerte, da er ohnehin nichts davon hörte, und zweitens war von der früher so bewunderten Virtuosität des Künstlers in Folge seiner Taubheit fast gar nichts übrig geblieben. Im forte schlug der arme Taube so darauf, daß die Saiten klirrten, und im piano spielte er wieder so zart, daß ganze Tongruppen ausblieben, so daß man das Verständniß verlor, wenn man nicht zugleich in die Clavierstimme blicken konnte. Ueber ein so hartes Geschick fühlte ich mich von tiefer Wehmuth ergriffen. Ist es schon für Jedermann ein großes Unglück, taub zu sein, wie soll es ein Musiker ertragen, ohne zu verzweifeln? Beethoven's fast fortwährender Trübsinn war mir nun kein Räthsel mehr.
Das nächste, was ich nach Vollendung der Cantate schrieb, war ein Violin-Quartett (das zehnte, Op. 30, bei Mechetti in Wien). Sehr brillant für die erste Violine, wurde es alsbald mein Paradepferd, und ich trug es unzähligemale in Privat-Gesellschaften vor. Dann folgte das Octett, in welches ich auf den Wunsch des Herrn von Tost, der damals eine Reise nach England vorhatte, ein Händel'sches Thema aufnahm, variirte und thematisch bearbeitete, weil derselbe glaubte, es werde dadurch für jenes Land an Interesse gewinnen. Auch diese Composition trug ich wiederholt vor, wobei außer mir hauptsächlich die drei Bläser: der Clarinettist Friedlowsky und die Hornisten Herbst, und einer, dessen Namen mir entfallen ist, Gelegenheit fanden, sich auszuzeichnen.
Im Herbst 1814 versammelten sich in Wien die Fürsten Europa's und ihre Minister, und es begann jener berühmte Congress, von dem die deutschen Völker die Erfüllung der bei ihrer Erhebung gemachten Zusagen erwarteten. Eine Masse Neugieriger und Müßiger strömte herbei, um den Festen beizuwohnen, die der Kaiser seinen Gästen in noch nie gesehener Pracht geben wollte. Vor der Rückkehr des Kaisers nach Wien hatten schon einige stattgefunden, die durch ihren Glanz die Erwartung auf die folgenden noch mehr spannten. Bei einem derselben war auch ich thätig gewesen. Es war eine großartige Nachtmusik in dem Hofe der Burg, die, ich erinnere mich nicht mehr, ob dem Kaiser oder dem Fürsten Schwarzenberg gebracht wurde. In der Mitte des nicht großen aber von hohen Gebäuden umgebenen Platzes war eine Erhöhung für das große Chor- und Orchester-Personal aufgeschlagen worden. Den Sängern gegenüber auf einem Balkone befand sich der Hof und der Hofstaat. Ein zahlreiches Publikum, dem der Eintritt nicht verwehrt wurde, füllte den übrigen Raum.
Ich erschrak, als ich die Lokalität und das zu Tausenden angewachsene Publikum sah, denn ich hatte mich anheischig gemacht, ein Violin-Concert vorzutragen, und fürchtete nun, meine Töne würden in dem weiten Raume ungehört verhallen. Ein Zurücktreten, jetzt noch, war indessen nicht mehr möglich; und so ergab ich mich in mein Schicksal. Es lief jedoch Alles besser ab, als ich erwartet hatte. Schon bei der Ouvertüre bemerkte ich, daß die hohen Gebäude den Schall recht gut zurückwarfen, und trat daher mit erneuetem Muthe vor. Die ersten Töne meines Solo befreiten mich auch von der Besorgniß, daß die Nachtfeuchtigkeit nachtheilig auf meine Saiten einwirken werde; denn meine Geige klang kräftig und hell wie gewöhnlich. Da nun auch das Publikum während meines Spieles in lautloser Stille verharrte, so wurden selbst die feinsten Nüancen meines Vortrages allenthalben deutlich gehört. Die Wirkung war daher eine sehr günstige und gab sich durch lebhafte Beifallsbezeugungen zu erkennen. Ich habe nie vor einem zahlreicheren, aber auch nie vor einem empfänglicheren Publikum gespielt.
Unter den vielen durch den Congreß herbeigezogenen Fremden befanden sich mehrere Künstler, die den Zeitpunkt für sehr günstig hielten, um in Wien Concert zu geben. Hierin täuschten sie sich jedoch. Denn da auch alle einheimischen Künstler Concerte gaben, so drängten sich diese so sehr, daß sie unmöglich alle besucht sein konnten. Eine Ausnahme machte das von mir und meiner Frau am 11. December gegebene, welches ein zahlreiches und glänzendes Publikum herbeigezogen hatte. Ich gab in demselben auch die Ouvertüre zum »Faust«, die mit großem Beifall aufgenommen wurde. Der Berichterstatter der Musikalischen Zeitung sagte: »sie steigerte in uns den Wunsch, diese Oper, die bereits seit einem Jahre fertig ist, nun endlich aufgeführt zu sehen.«
Mehrere Kunstfreunde unter den Gesandten und fremden Diplomaten, die mich in meinem Concerte zum erstenmale gehört hatten, besuchten mich und sprachen den Wunsch aus, mich auch im Quartettspiel zu hören. Dies war die Veranlassung, daß ich während des Congresses bei mir einige Musikpartien veranstaltete und in diesen den fremden Kunstfreunden meine neuen für Herrn von Tost geschriebenen Compositionen zu hören gab. Noch immer erinnere ich mich mit großer Genugthuung des allgemeinen Entzückens, mit dem diese Vorträge aufgenommen wurden. Freilich wurde ich dabei auch von den ersten Künstlern Wiens unterstützt, so daß in Bezug auf Ausführung wohl nichts zu wünschen übrig blieb. Ich begann gewöhnlich mit einem Quartett, ließ dann ein Quintett folgen und schloß mit meinem Octett oder Nonett.
Außer mir gaben auch noch Andere den Congreßfremden Musikpartien, unter denen sich besonders die meines Freundes Zizius auszeichneten. Bei ihm ließen sich alle fremden Künstler einführen und es gab daher in seinen Musikpartien oft einen wahren Wettkampf zwischen einheimischen und fremden Virtuosen. Ich hörte dort zum erstenmale Hummel sein herrliches Septett vortragen, sowie andere seiner damaligen Compositionen. Am meisten zogen mich aber seine Improvisationen an, worin ihn bis jetzt noch kein anderer Clavier-Virtuose erreicht hat. Mit großem Vergnügen erinnere ich mich besonders eines Abends, wo er so herrlich phantasirte, wie ich ihn später weder öffentlich noch privatim je wieder gehört habe. Die Gesellschaft dachte schon an den Aufbruch, als einige Damen, denen es noch zu früh war, Hummel baten, ihnen noch einige Walzer zu spielen. Gefällig und galant, wie er gegen Damen war, setzte er sich ans Piano und spielte die verlangten Walzer, wonach die jungen Leute im Nebenzimmer zu tanzen anfingen. Ich und einige andere Künstler, gruppirten uns, von seinem Spiele angezogen, schon die Hüte in den Händen, um das Instrument und hörten aufmerksam zu. Kaum bemerkte dies Hummel, so ging sein Spiel in eine freie Phantasie über, die sich aber fortwährend im Walzer-Rhythmus erhielt, so daß die Tanzenden nicht gestört wurden. Nun nahm er von den von mir und Anderen an dem Abende vorgetragenen Compositionen einige leicht faßliche Themen und Figuren, verwebte sie in seine Walzer und variirte sie bei jeder Wiederkehr immer reicher und pikanter. Ja, zuletzt mußte sich das eine sogar zum Fugen-Thema hergeben, und er ließ nun alle seine contrapunktischen Künste los, ohne die Walzenden in ihrer Lust zu stören. Dann kehrte er zum galanten Styl zurück und entwickelte zum Schlusse eine Bravour, wie man sie auch noch nicht von ihm gehört hatte. Dabei klangen in dieses Finale immer noch die aufgenommenen Themen hinein, so daß das Ganze sich ächt künstlerisch abrundete. Die Zuhörer waren entzückt und priesen die Tanzlust der jungen Damen, die ihnen zu einem so reichen Kunstgenusse verholfen hatte.
Unter den fremden Künstlern, die vor und während des Kongresses nach Wien kamen, waren auch drei meiner früheren Bekannten, die Herren Carl Maria von Weber, Hermstedt und Feska. Weber spielte mit großem Beifall und folgte dann einem Rufe als Operndirektor nach Prag. Hermstedt kam in einer Zeit, wo die Concerte sich dergestalt drängten, daß er ein eigenes nicht zu Stande bringen konnte. Er trat jedoch mit außerordentlichem Beifall in einem Concerte des Flötisten Dreßler auf, in welchem er die Arie mit obligater Clarinette aus »Titus« begleitete und einen Potpourri von mir vortrug, den ich ihm so eben erst nach einer neuen Composition für Harfe und Violine, die Hermstedt besonders gefiel, bearbeitet hatte. Beide Compositionen sind später gestochen worden, die für Clarinette mit Quartett-Begleitung als Op. 81 bei Schlesinger in Berlin, die für Harfe und Violine als Op. 118 bei Schuberth in Hamburg.
Feska, der seit der Zeit, daß ich ihn in Magdeburg gekannt hatte, Mitglied der westphälischen Kapelle in Cassel geworden und nun, nach deren Auflösung, als Concertmeister in Carlsruhe angestellt war, hatte sowohl als Componist wie als Geiger große Fortschritte gemacht. Seine Quartetten und Quintetten, von ihm rein, fertig und mit Geschmack vorgetragen, gefielen sehr in Wien und fanden bei den dortigen Verlegern guten Absatz. Eins derselben begann in einem seiner Sätze mit den Tönen, die des Componisten Namen enthalten:

Die Zuhörer fanden das sehr hübsch und verspotteten die anderen anwesenden Componisten Hummel, Pixis und mich wegen unserer unmusikalischen Namen. Dies brachte mich auf den Gedanken, mit Hülfe der ehemals gebräuchlichen Abbreviatur des piano in po. und einer Viertelpause, die in der Notenschrift wie ein r aussieht, doch etwas Musikalisches aus meinem Namen zu Stande zu bringen. Es nahm folgende Gestalt an:
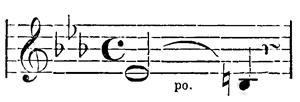
und wurde nun sogleich als Thema zu einem neuen Violin-Quartett benutzt, welches das erste von den drei Quartetten ist, die in Wien bei Mechetti als Op. 29 gestochen und Andreas Romberg gewidmet sind. Als ich es zum erstenmale bei meinem Freunde Zizius vortrug, fand es großen Beifall und man rühmte besonders das originelle Thema mit seiner herabfallenden, verminderten Quarte. Ich rief nun Die, welche mich früher wegen meines unmusikalischen Namens verspottet hatten, herbei und zeigte ihnen, (denn gehört hatten sie es natürlich nicht), daß das gerühmte Thema aus meinem Namen gemacht sei. Man lachte sehr über meinen Kunstgriff und verspottete nun um so mehr Hummel und Pixis, die mit allem Aufwande von Kunst nichts Musikalisches aus ihrem Namen zu Stande bringen konnten.
* * *