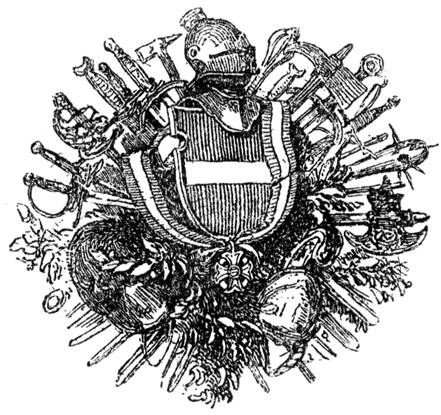|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Friedrich Fürst von Schwarzenberg. Nach einem Aquarell von Haala
Eine biographische Skizze
Minder glücklich als sein älterer Standesgenosse, der Fürst Hermann von Pückler-Muskau, hat Friedrich Fürst von Schwarzenberg, der »verabschiedete Lanzknecht«, in den meisten Literaturgeschichten seinen Platz noch nicht angewiesen erhalten. Selten genannt, kaum gekannt, ist er heute für Deutschland ein Verschollener, für Österreich ein Vergessener. Trotz mancher gerechten Würdigung, die dem Menschen und Schriftsteller zu seinen Lebzeiten – auch aus den Reihen der Bewegungs- und Fortschrittsmänner – zuteil geworden ist, blieb auf ihm der Bann des Illiberalismus, aber wohl noch mehr der des Österreichertums und jener echtösterreichischen Bescheidenheit lasten, die aus lauter Anerkennung für die Leistungen des Auslands das Eigenwüchsige geringschätzt, sich selbst gern in den Schatten stellt, verdeckt und versteckt.
Während die »Briefe eines Verstorbenen«, »Semilassos Weltgang« und die andern belletristischen Reisewerke Pücklers so leicht zugänglich sind, daß sie gelegentlich immer wieder von strebsamen jungen Literarhistorikern und stoffbedürftigen Tagesschriftstellern ausgebeutet werden können, gehören die Bücher des »Lanzknechts« zu den überaus seltenen und teuren Antiquaria; sind sie doch, bis auf eines, »als Manuskript gedruckt«, ausschließlich vom Verfasser an Freunde verschenkt oder zu wohltätigen Zwecken abgegeben worden; stehen sie daher doch noch heute, mehr als fünfzig Jahre nach dem Heimgang des Fürsten, unter dem Schutz des Urheberrechtes, weshalb auch ein während des großen Krieges in der inzwischen wieder eingestellten »Österreichischen Bibliothek« des Insel-Verlages erschienenes Bändchen mit »Bildern aus Alt-Österreich« überaus mager und wenig bezeichnend ausgefallen ist. Glücklicherweise findet sich aber in der von Friedrich Witthauer trefflich geleiteten »Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode« eine Reihe von Beiträgen des Fürsten aus den Vierzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, für welche die Schutzfrist schon längst erloschen ist. Sie sind es, für die wir in dem vorliegenden Bande die Lesewelt aufs neue interessieren wollen, in ihrer Vereinigung ein Skizzenbuch gar seltsamer Art von einem Augenzeugen aus der Biedermeierzeit, die wir uns herkömmlichermaßen so stillvergnügt, gemütlich und heimelig vorstellen und in der doch die schärfsten Gegensätze aneinander geraten und allenthalben in der Welt Ströme von Blut geflossen sind.
Und überall, wo die Gewehre losgingen, war der Fürst dabei, nicht als sensationslüsterner Schlachtenbummler oder als feder- und geschäftsgewandter Kriegskorrespondent, sondern als tapferer Mitstreiter, als leidenschaftlicher Parteigänger, immer auf der Seite derer, die das historische Recht für sich und – das Schicksal gegen sich hatten …

Geburt, Erziehung und Beruf drückten ihm das Schwert in die Faust, aber ein nicht minder starker persönlicher Antrieb ließ ihn, der doch oft schmerzlich fühlte, zwischen die Zeiten gefallen zu sein, dann wieder die Feder ergreifen. »Ich bin«, gesteht er 1843 Betty Paoli, »zu dem Schreiben gekommen, ich weiß nicht wie, denn wahrhaftig, ich war dazu nicht gemacht und noch jetzt kömmt mir, lasse ich mich dazu verleiten, vor, als thäte ich etwas unrechtes, als stünde ich in schmutzigen Reisekleidern in einem Prunksaal, als wandle ich in einem Garten, wo Blumen und Früchte andern gehören, und aus welchem ich urplötzlich mit Schimpf und Schande hinausgejagt werden sollte. Manchmal ist es mir wieder Bedürfniß, die Ergebnisse und Bilder meines bewegten, bunten Lebens auf dem Papier zu fixieren, ich buhle mit der holden Fantasie, mit der Litteratur, – die nicht wie mein legitimes Eheweib, sondern als holde Trösterin zuweilen kömmt, meine wunde Brust zu verbinden, meine mürben Glieder zu laben, – wir lieben und kosen, – und siehe da, es ist das ungerathene, außereheliche Kindlein fertig, welches dann zu meiner großen Angst und Noth in die Welt hinaus, und in derselben herumläuft, so gerne ich es auch nach der Hand verläugnen möchte! Einen einzigen Entschuldigungsgrund habe ich dabey, nämlich, daß ich es gut meine, ich liebe um zu lieben, und so schreibe ich auch zuweilen um zu schreiben, – ich liebe und schreibe, weil ich zuweilen lieben und schreiben muß, und es nicht unterlassen kann!«
Fürst Friedrich wurde am 30. September 1800 als der älteste Sohn des Fürsten Carl Philipp und der Fürstin Nanni (Maria Anna, geborenen Gräfin Hohenfeld, verwitweten Fürstin Eßterházy) in der Nähe von Preßburg geboren, jedoch in Wien, wo der Vater damals als Divisionsgeneral sein Standquartier hatte, auf den Namen seines 1795 bei Mannheim gefallenen Oheims getauft. Neben ihm wuchsen zwei jüngere Brüder heran, die Fürsten Karl und Edmund. Da der Vater bald in militärischer, bald in diplomatischer Verwendung vielfach abwesend war, oblag die Leitung der Söhne der Mutter (jener geistig außerordentlich hochstehenden Dame, die Stifter als Marschallin in seinem »Nachsommer« verewigt hat,) und Männern, die – bezeichnend für die Richtung des österreichischen Hochadels jener Zeit – eher freimaurerisch als kirchlich gesinnt waren. Naturgemäß waren französisch die Grundlagen der Bildung, militärisch die Erziehung, partikularistisch die Staatsgesinnungen des jungen Grandseigneurs. Früh ward ihm aber auch das Wort eingeprägt: Noblesse oblige. »Mein Sohn,« heißt es in einem wahrhaft väterlichen Brief vom Jahre 1812, »fahre fort, Deine kostbaren Jugendjahre zu Deiner Bildung zu verwenden, übe Dich in den Tugenden, die den Menschen im allgemeinen adeln, denn als Soldat bedarfst Du ihrer vorzüglich, wenn Du nicht den Vorwurf auf Dir willst haften lassen, daß Deine Geburt den Mangel an Verdienst zu bemänteln scheint. Die höhere Klasse, die der Zufall dem Menschen am Tage seiner Geburt anweiset, ist eine schwere Schuld, die er von dem ersten Momente an, wo er zu seinem vollkommenen Selbstbewußtsein gelangt, abzuzahlen bedacht sein muß. Lieber Fritz, lerne gehorchen, das heißt: sprich zwar stets freimüthig, schweig aber, wenn Deine Rede nicht nur allein nicht nützen, sondern schaden kann; Gehorsam ist der Cement des Staatsverbandes, ohne den das Gebäude bei der geringsten Erschütterung zerfällt; lerne dulden; sei redlich und treu bis in den Tod, heiter und standhaft im Unglücke, bescheiden im Glück, beschütze Deine guten Brüder, sei nur glücklich in ihrem Glücke, ehre die Gesetze und befolge sie genau, sei standhaft in Erfüllung Deiner Pflichten, nur dann kannst Du ruhig schlafen, sei wohlthätig, ohne zu verschwenden, scheue stets das Laster und nie den Tod.«
Der Neunjährige, in Ulanenuniform, steht neben seinem Vater, damals Botschafter in Paris, vor Napoleon; der Zwölfjährige bittet, den russischen Feldzug mitmachen zu dürfen; auf den Fünfzehnjährigen fallen die Strahlen des Ruhms und der Ehren, mit denen die dankbare Mitwelt den Lebensabend des Siegers von Leipzig vergoldet.
Nach seiner Ausbildung im Bombardierkorps und als Privatkadett in dem Ulanenregiment seines Vaters unter der Leitung von Clam-Martinic erhält Fürst Friedrich 1818 das Leutnants-Patent mit folgendem Brief:
»Mein lieber Fritz! Der Kaiser hat Dich zum Offizier ernannt, und ich übergebe Dir das Abzeichen Deiner neuen Charge. Du bist hiermit der Vorgesetzte und Führer einer Abtheilung tapferer Männer, braver Ulanen meines Regiments, welche, wie Du, die Ehre haben, die grüne Czapka zu tragen. Vergiß nicht, daß selbst in dem ganzen zweiten Gliede kein Mann steht, der nicht an Verdienst Dir gleich, mancher auch höher stünde. Deine Charge und deren Abzeichen sind nur eine à conto Zahlung, welche Kaiser und Staat für Deine künftigen Verdienste und Leistungen vorausbezahlt. Laß Dir das Los und die Ausbildung Deiner Untergebenen angelegen sein, und wenn Du erst Deine Obliegenheiten als Offizier gewissenhaft erfüllt haben wirst, verdienst Du, nicht bloß ein Vorgesetzter zu heißen, sondern auch einer zu sein. Das Gold, mit welchem man die Waffen der Offiziere schmückt, muß ein echtes, edles Metall sein, damit dessen Wert nie und nirgends in Zweifel gezogen werden könne. Und nun, mein Sohn, gehe hin und thue Deine Schuldigkeit und mache Freude.
Deinem Vater und Regimentsinhaber.«
Bei einem Regimente, in welchem der wissenschaftliche Unterricht sehr eifrig behandelt und geübt wurde, außerdem ein Freund der Lektüre und in einer einsamen Winterstation ohnehin auf solche hingewiesen, hatte er in den Jahren 1816, 17, 18 die ganze Regiments- und seine eigene Privatbibliothek verschlungen. Dazu kam noch, daß er zuweilen selbst von der grassierenden Schreibwut umsomehr befallen war, als in den einsamen Landstationen manche andere Zerstreuung abging. Zahllose Ausarbeitungen und Themata, ganze Dispositionen für Armeekorps und Armeen wanderten zum löblichen Eskadrons-, Divisions- und Regimentskommando und von da zuweilen belobt – wohl schwerlich gelesen – wieder zurück in die Mappe des Verfassers. Gelegenheit zu praktischen Erfahrungen fand er zuerst als Adjutant des Generals Langenau beim Beobachtungsheer am Rhein, dann als Ordonnanzoffizier des Erzherzogs Ferdinand d'Este in Ungarn.
Nach dem Tode seines Vaters (15. Oktober 1820) beim Ausbruch des Feldzuges 1821 gegen Neapel wurde er als Oberleutnant zum dritten Husarenregiment Erzherzog Ferdinand befördert und rückte auf dem Marsche ein. »Über Bologna, Florenz, Rom ging der Zug; schwelgend in der Freude der neuen kriegerischen Tätigkeit, endlich entronnen dem einförmigen Garnisonsleben, träumend von herrlichen uns erwartenden Kämpfen und Abenteuern, trabten wir über die Apenninen, bewunderten das herrliche Florenz, begrüßten St. Peters Dom, rückten immer weiter in die Abruzzen und bezogen endlich ein Lager unweit von St. Germano, uns gegenüber stand der neapolitanische General Carascosa mit zwanzigtausend Mann.« Eine Episode aus diesem Scheinfeldzug hält die erste Skizze unseres Bandes, das Schicksalsdrama »Teresa«, fest.
Seine weitere militärische Laufbahn (Herbst 1822 Kapitänleutnant im ungarischen Infanterieregiment Baron Duka Nr. 39, Sommer 1824 Eskadronskommandant beim zehnten Husarenregiment König Wilhelm von Preußen, 1828 Major im Chevaulegerregiment Prinz Hohenzollern) führte den Fürsten nach Ungarn und Galizien.
Des langweiligen Garnisonsdienstes müde, ließ er sich endlich beurlauben, und nachdem er bereits die Majoratsrechte an seinen zweiten Bruder abgetreten und das Malteserkreuz empfangen hatte, schloß er sich 1830 der französischen Expedition nach Algier an. Über sie berichtet sein erstes, ohne den Namen des Verfassers erschienenes Werk »Rückblicke auf Algier und dessen Eroberung durch die königlich französischen Truppen im Jahre 1830« (Wien 1831). Noch unmittelbarer als diese streng geschichtsmäßige, aber ungemein lebendig gehaltene Darstellung wirken die in unseren Band aufgenommenen »Erinnerungen aus Algier« und die Schilderung der mißglückten »Expedition von Belida«. »Am 7. Juli 1830 erschien Hussein Pascha, der ehemalige Dei, in der Kasauba, um dem General Bourmont seinen Besuch abzustatten. Er wurde mit allen Ehren empfangen, die Wachen traten ins Gewehr und ein Teil des Generalstabes ging ihm bis zum Eingange entgegen. Jedermann war durch den Anblick des Greises gerührt, der in seine ehemalige Burg mit dem schmerzlichsten Gefühle trat, sie von Christen, von fremden Siegern entweiht zu sehen.« Hussein Pascha bemerkte auch den Fürsten mit seinem Malteserkreuz und sprach ihn bei seinem Austritte an: »Du bist der erste Soldaten-Derwisch, Malteserritter, der diese Räume lebend und frei betritt, ich der letzte Muselmann, der sie verläßt. Die Deinen und die Meinen haben sich viele Jahrhunderte bekämpft, aber Eure Flagge weht nicht mehr auf der Insel Malta und die unsrige wird jetzt herabgenommen. Wir beide sind die letzten in diesem Kampfe zwischen den Rechtgläubigen und Eurem Orden. Mash Allah! Gott ist groß! Sein Wille geschehe!« »Das Schicksal aber, ihm unbewußt, bewahrte ihm hinter dem dunklen Vorhange der Zukunft baldige Vergeltung; denn wenige Wochen später flüchtete der mächtige König, zu dessen Füßen man in diesem Augenblicke die erbeuteten Roßschweife und Flaggen sendete, entblößt und verlassen aus seinem Königsschlosse übers Meer in ein fremdes Land; – und der siegreiche Feldherr, in dessen Schutz sich Hussein Pascha ergab, sollte bald flüchtig und arm die Küste verlassen, deren Herrschaft Hussein Pascha niederlegte. Die Stunde, in welcher Karl X. von Frankreich über die Schwelle des Prager Schloßtores trat, wäre eine tröstliche Vision für Hussein Pascha gewesen, als er aus den Bogengängen der Kasauba zum letztenmal herausschritt.«
Noch vor dem Eintreffen der Nachrichten über die Julirevolution nötigten schwere Fieberanfälle den Fürsten zur Rückkehr, deren Abenteuer und Stimmungen auf den folgenden Blättern nachgelesen werden können.
Die tiefe Erschütterung seiner Gesundheit wurde auch durch eine Reise nach England und Schottland 1832 nicht wieder hergestellt, so daß der Fürst den aktiven Militärdienst mit Oberstleutnantscharakter verließ.
Ein Badeaufenthalt in Teplitz führte ihn mit der Familie des Fürsten Anton Radziwil zusammen, dessen Tochter Elisa (die Jugendliebe des Prinzen Wilhelm von Preußen, späteren Kaisers) eine unerwiderte Leidenschaft in ihm erweckte. Ebenso brachte er der Gräfin Ida Hahn-Hahn eine schwärmerische Verehrung entgegen; sie ist vermutlich jene Esmeralda, deren Bild ihn als schöner Stern in den Orient geleitete und auf dem Titelblatt seiner »Fragmente aus dem Tagebuche während einer Reise in die Levante«, gedruckt als Manuskript von 1837, prangt.
Schon 1820 war der Monarchenhügel bei Leipzig dem Fürsten von Schwarzenberg gegen einen Erbzins von fünf Talern für alle Zeiten überlassen und die Schenkung »als ein Familienkleinod« angenommen worden. Jetzt (1835) ward hier ein mächtiger Granitblock aufgestellt mit der einfachen Inschrift:
Dem
Fürsten Carl von Schwarzenberg,
dem Führer der am 18. Oktober 1813 auf den
Ebenen Leipzigs für Europa's
Freiheit kämpfenden Schaaren
setzten diesen Denkstein
seine Gattin Marianne, und seine Söhne
Friedrich, Carl, Edmund.
Im Herbst 1838 lockte der Carlistenaufstand den Fürsten nach Spanien. Wieder bieten uns »Fragmente aus dem Tagebuche eines Facciosos« scharf geschaute und lebendig aufgefaßte Momentaufnahmen von jener blutgedüngten Erde, auf der auch er in dem erbarmungslos geführten Kleinkrieg vielleicht sein Ende gefunden hätte, wenn er nicht durch einen Sturz mit dem Pferde gezwungen gewesen wäre, durch Frankreich nach Österreich heimzukehren. In Wien erhielt er seine Ernennung zum carlistischen Brigadier in einem Zeitpunkt, da durch Marottos Verrat der Carlismus bereits ausgespielt hatte.
Nun verwandelte sich der »verabschiedete Lanzknecht« in einen Landwirt und Weidmann. Er kaufte das Gut St. Mariathal bei Preßburg, ein aufgehobenes Paulanerkloster, und fand einen lieben Jagdgenossen an dem Fürsten Gustav Lamberg, einem der Hauptführer in der Ständebewegung des Vormärz. Sowohl in Wien wie auf seinen Reisen trat er den deutschen Schriftstellern, die ihn als einen der Ihren ansahen, näher. Auf Helgoland war er mit Gustav Kühne zusammengetroffen, der es als Glück bezeichnete, ihn kennen gelernt zu haben. »Er ist eine jener edlen Naturen, den das Unglück versagter Neigung zum Sonderling umschuf … könnte ich etwas tun, um diese edle Natur, die aus den Fugen ging, zurückzubannen in die Stille eines harmlosen Glückes! Mitunter ergreift ihn der Fluch der Unruhe, dann ist er wieder weich und hingebend wie ein Kind, oft indifferent und skeptisch.« In Karlsbad schloß er Freundschaft mit Heinrich Laube, der ihm nach jahrzehntelangem Verkehr vollen Liberalismus, volle Menschenfreundlichkeit zubilligte, wenn er ihn auch als Vertreter der konservativ-historischen Richtung des österreichischen Hochadels ansah. Einen höchst bedeutenden Menschen nennt ihn der gerade nicht anspruchslose Hebbel; er hatte an den memoirenartigen Schriften des Fürsten nur auszusetzen, daß hie und da eine allzugroße Scheu begegne, sich selbst als Mittelpunkt hinzustellen. In gleicher Weise hat der Fürst auch auf geistvolle Frauen wie Ottilie von Goethe, Betty Paoli, Gräfin Ida Hahn-Hahn, Ida von Düringsfeld u. a. seine Anziehungskraft ausgeübt.
Noch immer hoffte er, daß die Zeit und eine gerechte Sache seinen Degen brauchen werde. Vorläufig begleitete er als militärischer Tourist im Oktober 1841 den Erzherzog Ferdinand in das preußische Lustlager bei Liegnitz, im Herbst 1842 zu den berühmten Manövern Radetzkys um Verona. Der galizische Aufstand im Februar 1846 rief ihn wieder an die Seite des Erzherzogs, der in guten Zeiten stets mit nachsichtsvoller Güte wie ein zweiter Vater an ihm gehandelt hatte. Als ein würdiges Gegenstück zu seinen spanischen Erinnerungen hat er um vieles später (in dem sechsten Faszikel seiner »Ante-diluvianischen Fidibus-Schnitzel«) Mitteilungen »Aus dem Tagebuche über die Ereignisse in Galizien, 1846« veröffentlicht.
Bald darauf wandten sich Vertrauensmänner der Urkantone an Metternich um die Unterstützung des katholischen Sonderbundes; man verlangte von Österreich einen Befehlshaber, Geld und Waffen. Metternich war bereit, unter der Hand, aber nicht offen, die Sonderbundleute zu unterstützen. Auf die Empfehlung des Erzherzogs Johann hin wurde ihnen Fürst Friedrich als Befehlshaber vorgeschlagen. Es stellte sich aber, als der Fürst im Herbst 1846 in die Urkantone kam, rasch heraus, daß die Schweizer nur unter einem ihrer Landsgenossen fechten wollten. Fürst Friedrich, überzeugt, daß der Radikalismus, sobald er den Gotthard in seine Hand bekommen habe, diesen als Hypomochlion benutzen werde, um die beiden Hebelarme, den Rhein und den Po, in kurzer Frist in Bewegung zu setzen, entschloß sich trotzdem, als Privatmann den katholischen Kantonen seine Erfahrungen zu leihen. Er nahm an dem Gefecht bei Airolo am 17. November 1847 teil, trat als Beisitzer in den Kriegsrat ein, erhielt Rang und Titel eines Obersten und Generaladjutanten des Generals von Salis, erkannte aber nur zu bald, daß der Sonderbund in der Lage einer belagerten, und zwar schlecht konstruierten Festung sich befinde, und riet – vergeblich – zu Verhandlungen. Schon am 23. November mußte Salis den Scheitelpunkt der sonderbündlerischen Stellung, die Gislikonbrücke, aufgeben, und damit war der Feldzug entschieden. Mit unendlicher Gefahr und Beschwerde kämpfend, stets den Feind mit Strang und Kugel hinter sich, die Eisfelsen und Schneewände vor sich, überstieg der Fürst den Gotthard, die Furka und den Simplon (26. November) und rettete sich nach Mailand.
Daß man auch hier vor dem Ausbruch der Revolution stehe, war ihm seit dem Tabakkrawall Gewißheit. Als er seine nur zu sehr begründeten Besorgnisse laut werden ließ, schalt man ihn einen schwarzsehenden Narren!
Im Februar 1848 kehrte Fürst Friedrich mit vertraulichen Aufträgen des Generals Ficquelmont nach Wien zurück – an das Totenbett seiner Mutter. Am 2. April 1848 verschied die Marschallin, achtzig Jahre alt. »Mein liebes Mütterlein ist gestorben,« schreibt der Fürst in sein Tagebuch, »somit auch dieses liebe Band gelöst, – und ich kann frei die Anker lichten, die mich an diesen fluchbeladenen Boden knüpfen! – Auch die Sündflut ist bereits in vollen Strömen hereingebrochen. – Wohl dem, der noch einen Regenschirm an der linken Seite trägt. Ich suche den meinen wieder hervor, der mich bereits bei manchem Gewitter begleitet. Gehe nach Tirol. Dort ist wohl der Berg Ararat zu suchen, da muß die Arche Noah der Rettung zu finden sein, in welcher Treue und Ehre der Flut von Schande und Schmach entzogen wird, welche hier sprudeln!«
Wie Fürst Vinzenz Auersperg, die Grafen Colloredo, Waldstein, der Prinz Coburg, zwei Brüder Paar ließ auch er sich »bei den Tiroler Landesschützen einreihen, um, den Stutzen in der Hand, an den bedrohten Grenzen Tirols zu kämpfen, da man ihres Degens irgendsonstwo nicht zu bedürfen schien und sie hierdurch wenigstens der Notwendigkeit enthoben wurden, eine Rolle in der Soldatenspielerei der Nationalgarde zu übernehmen«. Als einfacher Landesschütze zog er mit Hauptmann Mörl in das Chiusatal. »Ein geistvoller Mann,« erzählt sein Mitkämpfer Adolf Pichler, »wußte er sein Gespräch durch manche feine Beobachtung, durch Erzählung manchen Abenteuers anziehend zu machen. Dessenungeachtet wurde er von sehr vielen meiner Kompanie scheel angesehen; es war keine Ursache dazu, vielmehr verdiente er unsern Dank für die Freigebigkeit, mit der er in Wien zu unserer Ausrüstung beitrug. Einige alberne Bürschlein konnten es gar nicht verzeihen, daß er ein Fürst war und nicht mit der Revolution kokettierte.«
Nach glücklicher Abwehr der Crociati machte er, im Hauptquartier Radetzkys zur Disposition des FML. Schönhals gestellt, den italienischen Feldzug mit. Im Sommer 1849 nahm er an den Operationen Haynaus, als dessen Ordonnanzoffizier, in Ungarn teil. Im Herbst dieses Jahres wurde er dem in Bregenz stehenden Hauptquartier des vierten Armeekorps unter FML. Fürst Karl Schwarzenberg zugeteilt, mit dem er noch einmal nach Mailand ging. Am 20. März 1851 wurde ihm die Charge eines Generalmajors verliehen.
Wieder zog er sich nach St. Mariathal zurück und griff zur Feder. Die Jahreszahlen 1844 bis 1848 tragen die vier Bände »Aus dem Wanderbuche eines verabschiedeten Lanzknechtes« mit dem Supplement »Aus den Papieren eines verabschiedeten Lanzknechtes«. Mit der Jahreszahl 1850 sind die sechs Faszikel »Ante-diluvianische Fidibus-Schnitzel von 1842 bis 1847« versehen, mit der Jahreszahl 1859 »Jagdausflüge«, mit der Jahreszahl 1862 die »Post-diluvianischen Fidibus-Schnitzel« (erstes Faszikel von 1849 bis 1854, zweites Faszikel von 1855 bis 1860).
Das Diluvium, die Sündflut, war ihm die Revolution, auf die er begreiflicherweise nicht gut zu sprechen war. Aber ebensowenig wollte er von den staatsmännischen Konzeptionen seines Vetters, des Fürsten Felix Schwarzenberg, wie von den politischen Methoden des Ministers Bach wissen.
Nach seiner Überzeugung hatten gerade die deutschen Elemente der Revolution den meisten Vorschub gewährt, die nichtdeutschen Nationalitäten Österreich gerettet. »Der arme Grenzer, der auf der Brandstätte seiner Heimat trauert, und bei seiner Rückkehr aus Italiens Fluren nur Schutt und das Grab seiner Kinder findet; der böhmische Grenadier, der verstümmelt aus Ungarn der Heimat zuhinkt, vor allem aber der Russe, der a tempo zu Hilfe kam, als Deutschland in Schleswig-Holstein oder sonstwo viel zu sehr beschäftigt war, als daß es sich um uns bedrängte Ostländer hätte bekümmern können, denen müßte gedankt werden, daß nicht Kossuth und Mazzini am Isonzo und an der March ihre Zolltarife angeschlagen haben, wenn überhaupt Dank noch Sitte und Pflicht wäre.«
Darum hielt er es für ganz unrichtig, »daß in Neu-Österreich das deutsche Element vorherrschen und bevorzugt werden müsse.« Aber noch mehr!
»Ein System, welches allen Nationalitäten sich feindlich gegenüberstellt, – in jeder Mütze und jedem Hut, – in jeder bunten Weste ein sichtbares Zeichen eines Empörungsgelüstes wittern muß, – dem die Töne jedes Volksliedes, – als wehmütige Klage über eine geliebte zerfallene Vergangenheit, oder als verpönte Hoffnung einer wieder zu belebenden Zukunft entgegenklingen, – dem jedes Ammenmärchen und jede Prophezeiung drohend entgegentreten, – ein solches System hat sich eine unlösliche Aufgabe gestellt. Das Josephinische System, mit den Mitteln des Absolutismus ausgeführt, scheint mir als Knechtung jeder Selbstständigkeit, als Ignorierung der heiligsten Gefühle, nämlich: Religion, Vaterland, als Verletzung jeder Tradition und Gepflogenheit, als Beseitigung der Geschichte und ihrer Ergebnisse eine jedenfalls antipathische, despotische, das echte nationale Selbstgefühl des Volkes so wie jenes des Individuums erniedrigende, sehr schwere – aber am Ende nicht in dem Reiche der Unmöglichkeit liegende Aufgabe. Dasselbe aber auf sogenannte konstitutionelle Formen gründen wollen, scheint mir eine contradictio in adjecto, – ein reiner Widerspruch, nicht leichter zu lösen, als die Aufgabe, einen viereckigen Kreis konstruieren zu wollen.«
Am Geburtstage des jungen Kaisers 1852 wagt er den Satz niederzuschreiben: »Es ist nicht möglich, auf den Federspitzen der Beamten die Gesellschaft zu balancieren und zu stützen. Das haben die Mandarine selbst eingesehen, und trotz ihrer Kasteneifersucht die Bajonette als Hilfsmittel herbeigezogen. Aber Feder und Bajonett sind keine soliden Stützpunkte.«
Und wenige Tage später weissagt er sorgenvoll: »Wenn die Kette, welche die Herzen der Völker an die Dynastien bindet, zu Ringen nur das Heer, die Beamten und Gendarmen und deren Treue und Pflichterfüllung hat, genügt eine verlorne Schlacht, um sie zu lösen!«
Als Aristokrat im wahren Sinne des Wortes fühlte er sich in Gegensatz zu den Bureaukraten und dem von ihnen geschaffenen zentralistischen Staat. »Keine Eigentümlichkeit, keine Nationalität, kein Stand ist mehr bezeichnet, alles verflacht, nivelliert, – nur mehr oder weniger jährlich zufallende Rente erkennbar!« »Solange der Adel noch seine landständische Uniform hatte, bezeichnete diese noch seinen Ursprung, und er führte sein Symbol, den Degen, es war ein Waffenkleid. – Der Waffenrock des Beamten dagegen ist nur eine Maskerade, er soll aber bezeichnen, daß der Mandarin des Bureaus an die Stelle des Adels getreten, was auch de facto wirklich der Fall ist. Der schwarze Rock dagegen ist das Leichenkleid jedes Kastengeistes, so wie jedes Nationalgefühles. Wenn aber das Landvolk und die Proletarier der Stadt dieselbe Uniform tragen werden, nämlich Fetzen mit Löchern im Ellenbogen als Distinktionszeichen, dann – gute Nacht, Schnepf!« – »Ein Zivil- oder Militär-Gouvernement kann man oktroyieren, – damit ist aber noch kein Vaterland geschaffen.« Das war wohl auch der Grund, warum er selbst 1849 die Übernahme einer Distriktskommissärsstelle in Ungarn mit Generalsrang abgelehnt hatte.
Aufs schärfste verurteilte er die Einschränkung der persönlichen Freiheit auf das Minimum eines Schulknaben, das Aufgebot von Polizei, Soldaten und Gendarmen, die täglichen Strafsentenzen, Hinrichtungen, Exekutionen. »Man sollte bedenken, daß jeder ungerecht, – zwecklos, – oder überflüssig verspritzte Tropfen Blut, oder jede vergossene Träne zum ätzenden Scheidewasser wird, welches die Pietät der Völker untergräbt. Die meinen es nicht gut, die diesen bösen Stoff in die Herzen der Völker gießen!«
Ein Greuel war ihm die Aufsaugung und Bevormundung der individuellen Tätigkeit in und durch die allgemeine Staatstätigkeit.
Das Bachsche System machte 1859 Bankerott. Der Fürst hatte dem Vaterland seine Dienste wieder angeboten, aber der Feldzug war früher zu Ende, als sein Akt erledigt war.
Was er gegen die Schmerlingsche Interessenvertretung einzuwenden hatte, eröffnete er rückhaltlos jenen, die ihm eine Wahl in den böhmischen Landtag anboten. »Ich kann und werde nicht vergessen, daß ich auf der Herrenbank des böhmischen Landtages berufen war, nach Pflicht und Gewissen meine Stimme für das Wohl und Wehe des Vaterlandes zu erheben, und um so weniger lernen können, Interessen zu vertreten; ich werde nie vergessen, daß ich ein Landstand des Königreiches Böhmen war, und habe bis jetzt noch nicht gelernt, was ein Kronland eigentlich heißt, welches Wort ich trotz meiner halbjahrhundertlangen Lebenszeit nie gehört oder gelesen hatte. Ich werde es nicht dahin bringen, die alten geographischen, politischen, finanziellen Beziehungen zu vergessen und die seit dem Antritt des Ministeriums des Freiherrn von Bach eingetretenen politischen Formen gründlich genug zu erlernen, um mich nicht mannigfaltigen Verstößen und Irrungen auszusetzen. Ich werde es nie dahin bringen, die Krone Böhmens nicht als ein kostbares heiliges Juwel, sondern nur als ein historisches, in einer Antikensammlung aufzubewahrendes Kuriosum zu betrachten, und glaube daher, mit meinen Ansichten, Gefühlen und Überzeugungen in den jetzigen Verhältnissen mir eine Stimme in der Beratung der Interessen meiner Herren Kommittenten nicht anmaßen zu dürfen.«
Als ihn Alfred Meißner fragte, warum man ihn stets in dem Lager des Widerstandes finde gegen das, was man Zeitgeist nenne, schrieb er ihm: »Ich könnte darauf antworten, daß es Fische gibt, deren Natur es mit sich bringt, immer gegen den Strom schwimmen zu müssen, und daß es z. B. von einem Lachsen oder Huchen nicht abhängt, ein Hecht oder Karpfen zu werden, um mit dem Strom gemächlicher herab, als seiner Natur nach, gegen denselben hinaufzuschwimmen. Am Ende, wenn beide gesotten und gekocht sind, ist es für beide einerlei gewesen. Solange ich im Geiste der Zeit nur einen Stempel der Zerstörung sehe, werde, oder vielmehr habe ich versucht, das noch Lebende zu schützen und zu erhalten; wohl bemerkt, das Lebende, nicht das bereits Gestorbene, dessen Grab ich aber nicht beschimpfen und besudeln lassen will. Wo mir aber aus der Zukunft wirklich neues frisches Leben entgegenduftet, will ich es freudig begrüßen. Ich befand mich letzthin im Theater und wohnte der Vorstellung des ›Götz von Berlichingen‹ bei. Aufs Gewissen, lieber Doktor, wenn einmal der Vorhang über beide gefallen ist, wären Sie lieber der alte treuherzige Götz gewesen, der mit seiner Zeit unterging, als der weitsehende kluge Weislingen? Sie ist untergegangen die Sonne von Morgarten, aber lieber bin ich doch unter dem Banner von Uri und den Urkantonen gestanden, als unter jenem der Majorität, welches am Ende doch vorzüglich Lord Palmerstons Arm entfaltete. Ich bitte Sie, lieber Doktor, aus diesen Zeilen das Bedürfnis zu ersehen, nicht unverstanden unser Gespräch zu beendigen, und meinen Wunsch, vorzüglich in Ihren Augen für das zu gelten, was ich wirklich bin, für einen vielleicht beschränkten oder überspannten und veralteten, aber ehrlichen und aufrichtigen alten Lanzknecht.«
In den Sechzigerjahren verschlimmerte sich der Gesundheitszustand des Fürsten unaufhaltsam. »Im Jahre 1866,« erzählt Graf Thürheim, »war der letzte Mönch von Mariathal bereits ein kranker gebrochener Mann, der mit seinem oft erprobten Ritterschwerte in der Faust nicht mehr dienen konnte; doch reichte ›der alte Guerillero‹ in fortwährender geistiger Tätigkeit noch einen meisterhaften Plan über Organisation und Verwendung des Landsturmes dem Kriegsministerium ein.«
Seine Opposition gegen die politische Entwicklung in Österreich ließen ihn die Gewalthaber in grausamer Weise entgelten. Zu der feierlichen Enthüllung des Schwarzenbergdenkmales in Wien am 20. Oktober 1867 erhielt er, der älteste Sohn des Helden, keine Einladung. »Sie begreifen,« sagte er zu Bernhard von Meyer, »daß ich gebrochener kranker Greis, der am Rande des Grabes steht, nicht mehr nach Ehre und Auszeichnung geize; aber so vergessen zu werden, als wäre ich der unwürdige Sohn eines gefeierten Vaters, das tut weh, unendlich weh.« Schon sterbend gedachte er in ingrimmigem Humor dieser Beleidigung. »Als er sein Ende herannahen fühlte, ließ er alle Beamten und Bediensteten an sein Bett kommen, bat sie um Verzeihung, falls er sie gekränkt oder verletzt haben sollte. In Tränen aufgelöst standen sie umher; als ihr gnädiger Herr mit dieser seiner mit schwacher Stimme vorgebrachten Abbitte zu Ende war, blickte er noch alle einmal freundlich an und rief dann lauter: ›Nun, meine Freunde, geht und grüßt mir noch den – Giskra!‹« Wenige Stunden später verschied er, am 6. März 1870. Er ward mit militärischen Ehren in Wien eingesegnet und in der Familiengruft in Worlik bestattet. Weder die amtliche »Wiener Zeitung« noch die führenden Tagesblätter Wiens schwangen sich zu einem Nachruf auf, der der Persönlichkeit des Verstorbenen einigermaßen angemessen, geschweige denn gerecht gewesen wäre.
Die Welt der von ihm so tief verachteten Bureaukraten und Geldbarone hatte keinen Sinn für einen Mann, dessen hervorstechendster Charakterzug Pietät war, dessen Tragik darin lag, daß er neben das eherne Denkmal seines Vaters nichts anderes zu stellen hatte als eine Reihe von Büchern, von denen er in seiner Selbstbescheidenheit nicht recht wußte, ob sie aere perennius …