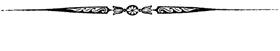|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fürst Friedrich zu Schwarzenberg
Ungewöhnlichen Menschen ist es beschieden, kraft der Eigenart ihrer starken Natur, sich selber ihre meist auch ungewöhnlichen Schicksale zu prägen. Daher sieht es mitunter aus, als herrsche über ihnen ein ehern vorbestimmtes Fatum, das selbst nach ihrem Tode, in gleichem Sinne noch, über ihrem Andenken zu walten scheint. Solche genial Veranlagte, reich an Begabung wie an inneren Widersprüchen, bei denen die Phantasie den Verstand und beide das warme, rasche Herz überflügeln, sie vom zielbewußten Weg abdrängend, um sie dann dem Gefühle bitterster Enttäuschung anheimzugeben, finden sich am leichtesten im Kreise der geistreichen Alt-Österreicher. Eine der originellsten Erscheinungen unter ihnen war die des Fürsten Fritz Schwarzenberg, mit seinem Schriftstellernamen als »der Landsknecht« bekannt.
Er war der älteste Sohn des Fürsten Carl Philipp zu Schwarzenberg, am 30. September 1801 geboren, und war noch ein Kind, als sein Vater auf dem Leipziger Schlachtfeld unsterblichen Ruhm errang, aber in seiner jungen Seele lebte bereits die unstillbare Sehnsucht nach gleichen glänzenden Heldentaten und selbsterkämpftem Lorbeer. Als er herangewachsen, hatte Europa den langentbehrten Frieden, und nur in dem 1821 ausgebrochenen Revolutionskrieg in Neapel konnte er den ersten ernsten Waffengang bestehen. Der darauf folgende friedliche Garnisondienst, in der Weltabgeschiedenheit einer ungarischen Pußta, genügte weder seinem Tatendrang noch seiner Abenteuerlust, so daß er die Feldzüge, die die Heimat ihm versagte, in anderen Landen, sogar in einem fremden Weltteil suchte. Doch ob er in Afrika, in Spanien oder in den Schweizer Bergen focht, sein Herz wurzelte mit jeder Faser in Österreich allein, und ein Geständnis, das er in reiferen Jahren, an den Ufern des Bosporus, seinem Tagebuch anvertraute, gab den Schlüssel zu seinem Tun: »… Ich las heute europäische Zeitungen. Es scheint mir, daß die Felder, welche man mit Blut düngt, um Lorbeer darauf zu pflanzen, nicht unbebaut bleiben werden. Sollte auf denselben für meinen verachteten, unnützen Degen keine Arbeit zu finden sein? … So entstand Laudons, Mansfelds, Prinz Eugens Lebenslauf! …« Wenn der Fürst von seinen kriegerischen Ausflügen heimkam, drängte es ihn, seine Erlebnisse niederzuschreiben. Das gab dann doppelt wertvolle Bilder, nicht nur die tatsächlichen Ereignisse spiegelten sich darin, auch seine politischen Bekenntnisse, seine Naturliebe, seine Jagdfreude und sein weiches, großmütiges Herz, trotz seiner scharfen, satirischen Ausfälle. Das eigentümlichste dabei ist aber sein eigenrichtiger Geist, dessen klares Urteil mehr als einmal einen fast prophetischen Blick bewies, dessen paradoxe Äußerungen und beharrlich verfochtene Vorurteile dagegen oftmals Widerspruch erweckten. Die schriftstellerische Tätigkeit war jedoch weit davon entfernt, ihn zu befriedigen. Der Dichterin Betty Paoli, die fünf Jahre lang die Gesellschafterin seiner von ihm zärtlich geliebten Mutter gewesen, schrieb er wiederholt über dieses Thema, das sein Denken beherrschte: »… Ich war zum Mann der Tat geboren, – gelähmt und gebunden hat mich das Schicksal, jetzt ersticke ich am Wort! – Fordern Sie mich nicht auf, wenn Sie mir wirklich gut sind, mich viel in dieser Sphäre zu bewegen …« Als die Dichterin einmal meinte: »Der Gedanke steht hoch über der Tat, und unser Ziel soll nur ein geistiges sein …«, antwortete er: »Denken und Handeln, Fühlen und Wirken sind sehr verschiedene Dinge, … nur der Gedanke, der eine wirkliche Form verlangt, ist eine Wirkung, – und es strebt auch jeder Gedanke dahin, so wie jeder Körper in der Natur, jede Formenbildung dahin strebt, Leben, Bewußtsein zu erlangen. Daß meine äußere Tätigkeit gelähmt ist, im Widerspruche steht mit dem schaffenden Elemente in mir, das tötet, das erstickt mich. Ein gepflanzter Baum, eine mit drei Zwanzigern getrocknete Träne, ein erlegter Wolf – sind mehr wert als eine Reihe der tiefsten und schönsten Gedanken!«
Nun, 45 Jahre nach des Fürsten Tod, da in seiner Heimat sein Name aufs neue genannt werden soll unter den treuesten österreichischen Geistern und Herzen, da sein Vaterland in Waffen starrt, die Kriegsfurie ihre Brandfackel um den halben Erdball schwingt, und des Landknechts »unnützer Degen« Arbeit genug fände, nun kann – sein Fatum will es so – eben nur mehr sein Wort zu Landsleuten und Verbündeten hinüberklingen! – Und weil sein Sinn, auf dem Schlachtfeld oder am Schreibtisch, stets nur der Heimat zugewendet war, soll diese kleine Auswahl aus seinen Schriften durchaus Bilder aus Alt-Österreich zeigen; doch möge dem ganzen Gebiet seines Schaffens hier ein kurzer Überblick gewidmet sein.
Die von 1831 bis 1862 als Manuskript gedruckten und darum sehr selten gewordenen 17 Bände, hell kartoniert, mit Vignetten, die meist von Nepomuk Geyger stammen, präsentieren sich so individuell, daß sogar manches Kriegerbild darauf des Landsknechts Züge trägt. Die erste Publikation »Rückblicke auf Algier« schildert die 1830 erfolgte Eroberung durch die französischen Truppen, denen Fritz Schwarzenberg sich angeschlossen. Es waren die letzten Monate unter Karls X. kurzer Regierung. Der Fürst, der viele Gefechte und die Belagerung des Kaiserschlosses von Algier mitgemacht, focht als Adjutant des Grafen Bourmont bei Belida so todesmutig, daß er noch auf dem Schlachtfelde vom Marschall selbst das Kreuz der Ehrenlegion erhielt. Alle Strapazen in der afrikanischen Sonnenglut lähmten ihm weder Tatkraft noch Beobachtungsgabe, dafür sprechen jene Kriegsbilder, die er mit dem ganzen exotischen Hintergrund, auf dem sie sich abspielten, so scharf und lebendig gezeichnet hat, daß Stifter, des Fürsten und seiner Mutter langjähriger Freund, Schilderungen jener Küstenstriche in seiner Novelle »Abdias« verwertete. Die Heimfahrt, von der der Fürst erst 1844 in seinen »Erinnerungen aus Algier« etwas erzählte, war für ihn nicht minder abenteuerreich als der Feldzug selbst, während dessen Verlauf die Julirevolution ausgebrochen war. Der Schiffskapitän, der mit der weißen Fahne der Bourbonen die afrikanische Küste verlassen, erfuhr unterwegs durch eine aus Toulon kommende Korvette die schwerwiegende Nachricht, und wie verschiedenartig diese auf die einzelnen Mitfahrenden wirkte, schilderte der Landsknecht mit fast dramatischer Kraft und beißender Satire. Die politische Wandlung und der Wunsch, Land und Leute auf das unmittelbarste kennen zu lernen, veranlaßten ihn, in der Tracht eines einfachen Matrosen, unter dem Namen Jacques Reiter, marin en congé, Südfrankreich zu durchwandern. Er schrieb darüber: »Das Wetter begünstigte diese meine romantische, statistische, sentimentale, politische, ökonomische, sanitäre Fußpromenade, infolge deren ich gegen Mitte Oktober in Lyon anlangte, dort den Postwagen bestellte und rasch gegen Paris fortrollte.« Nun gab der Fürst die abenteuerliche Laune auf, im Kreise des Adels und der Künstlerwelt wurde er wieder er selbst; die Spuren jener für ihn glücklichen Tage leben nicht nur in seinen eigenen Tagebüchern, sondern auch durch Balzacs Widmung der Novelle »Adieu«, deren furchtbare Kriegsszenen den Erlebnissen des Fürsten nicht ferne standen; und da er Kontraste liebte, so brachte er nun, nach überstandenen Kämpfen und Entbehrungen, alles, was Geist und Geltung hatte, in den Bann seiner hinreißend glänzenden geselligen Talente.
Die nächste Orientfahrt des Fürsten über Korfu und Griechenland war eine durchaus friedliche, doch hätte er lieber eine kriegerische unternommen; in Ermangelung eines anderen Gegners begab er sich ohne zwingenden Grund in den Kampf mit der in Konstantinopel und Kleinasien herrschenden Pest. Das Rätsel solch überraschenden Beginnens lösten einige Worte seines Reisetagebuches, das er 1836 veröffentlichte: »… Genußreich für mich ist hier nur das Abenteuerliche dieses Lebens. Es ist dies das einzige Land, wo man spazieren reitet mit den Pistolen in den Halftern, spazieren fährt mit Segel und Steuerruder, spazieren geht unter Pest und bissigen Hunden; wo nicht jeder Schritt, jede Stunde, jedes Ereignis schon in der Frühe abgezirkelt und im Programm des Tages angezeigt vor uns liegt. Das einzige Land, wo nicht jede Handlung von einer väterlichen Autorität schon vorhinein erlaubt oder verboten, wo nicht jeder Weg und Steg schon durch die Katastral-Vermessungslinien vorgezeichnet, ja sogar von der löblichen Polizeibehörde jeder Fleck bezeichnet sein muß, wo man in dringenden Fällen hinspucken darf!« –
So überschwenglich seine Phantasie in des Orients bunter Pracht gespielt, so klar und kühl wurde sein Blick auf des Rheines grünen Wogen, derart daß die Beobachtungen, die er dort gemacht, fast zu einer Voraussage wurden: »Ein einziger Vogel schwebte von Mainz herab von unserm Schiff, wie der Rabe aus der Arche Noah, – frisch und rastlos; es war der schwarze preußische Adler auf unserer Flagge. Er hat auf dem Rhein, dem deutschen Grenzstrome, den doppelten um so mehr ersetzt, als er gerade nur einen statt mehrerer Köpfe hat, dagegen scharfe und geübte Klauen besitzt, die ihn zum Grenzwächter eignen, wovon ich in Mainz bei Besichtigung der dortigen Besatzung mich zu überzeugen Gelegenheit hatte. Es ist ein kühner, gewaltiger, kluger und, was viel bedeutet, ein junger Vogel, der noch weit und viel fliegen und Deutschlands Gaue wohl umkreisen mag, wie der neue Zollverband beweist …« In Berlin spricht vor allem sein Soldatenherz: »Ich bekomme täglich mehr Respekt vor der preußischen Militärverfassung. Es ist die beste Art, durch das Heer ein ganzes Volk zu disziplinieren und andererseits das Heer zu einem Volk zu machen. Verteidigungskriege müssen mit solchen Mitteln unüberwindlich sein …« Dies steht im ersten der fünf Bände von des Landsknechts »Wanderbuch«, das uns allein schon ein treues Bild des Autors geben könnte durch seine Reisetagebücher, Kriegserinnerungen und Stimmungsbilder; auch seine Sympathien und Antipathien kommen zu Wort, und die meisten seiner Novellen sind darin gesammelt. Diese haben durchaus einen autobiographischen Kern oder waren beeinflußt durch Geschehnisse in seiner nächsten Umgebung; so war er in der Wahl der Stoffe glücklich, aber bei der Durchführung versagte sein Können öfters, das mehr in der temperamentvollen Improvisation lag, weshalb er die Tagebuchform mit Vorliebe pflegte. Treffend und fein sind – durch den Pulsschlag des eigenen warmen Herzens belebt – seine kleinen Charakteristiken und Porträts. Ernste Fachmänner wissen auch seine Vorschläge und Kritiken auf dem Gebiete militärischer Angelegenheiten und Probleme zu rühmen. In diesem Sinne besprachen übereinstimmend zwei so verschiedene Persönlichkeiten wie der Malteserritter Major Graf Thürheim und der Wiener Ministerialrat und einstiger Luzerner Tagsatzungsgesandte Bernhard v. Meyer seinen 1866 verfaßten »meisterhaften Plan über Organisation und Verwendung des Landsturmes«, den der Fürst dem Kriegsministerium eingereicht. Der vierte Band seines »Wanderbuches« führt uns in das Kampfgetümmel des Bürgerkrieges jenseits der Pyrenäen, wo der Landsknecht 1838 unter unsäglichen Gefahren und Entbehrungen für Don Carlos' historisches Recht gegen die Christinos eintrat; »… um Spanien zu beweisen, daß die in Europa verlassene Sache des legitimen Königs bei einigen ritterlichen Herzen noch Anklang fände …« »Nebstbei«, so schrieb er, »möchte ich ein Land sehen, wo man noch zu lieben, zu hassen und zu glauben versteht … Ja, da muß ich hin –, will mitbeten, mitschießen, mittanzen, will Pulver und Jasmin riechen, Orgeln, Musketenschüsse und Gitarren hören und Faktiosos, Mañolas, Kapuziner und Guerillas sehen …« Nach dem Kriege, der für den Landsknecht mit einer Verwundung am Knie, für Don Carlos mit dem Verrat seines Generals Marotto endete, ließ der Fürst die Waffen längere Zeit ruhen. Erst 1846, als der galizische Bauernaufstand ausbrach, eilte er nach Lemberg, an die Seite seines alten Freundes und Gönners, des Erzherzogs Ferdinand d'Este; in Bochnia traf er mit seinem »lieben, alten Bekannten, dem Oberstleutnant von Benedek, zusammen, dessen umsichtiges, entschiedenes, selbständiges Einwirken« er besonders hervorhob. Die erschütternden Eindrücke dieses Kriegsschauplatzes verzeichnete er in seinem »Tagebuch über die Ereignisse in Galizien«. Die aus unmittelbarer Anschauung geschöpften Mitteilungen sind für Historiker jenes Zeitabschnittes heute noch von Bedeutung, und Friedjung erwähnt dieselben auch in seiner Biographie Benedeks. Derselbe Band, der noch mehr denkwürdige Eintragungen des Fürsten enthält, schließt mit sorgenvollsten Ausblicken in die Zukunft. Ende 1847 schrieb er: »Sündflut naht! – Wetterleuchten! – Untergang des Sonderbundes! –« Davon konnte er wohl viel erzählen, denn er focht mit, als jener Untergang in den Kämpfen am St. Gotthard und bei Gislikon besiegelt wurde. Er hatte, noch ehe der Krieg der sieben katholischen Kantone mit der Gegenpartei ausbrach, die Schweizer Verhältnisse gründlich studiert, von dem Gesichtspunkte ausgehend: »… daß am Vierwaldstätter See und am St. Gotthard auch die Sache Österreichs mitbekämpft und verteidigt würde, und daß die Diplomaten der konservativen Mächte diesen Vorposten so ohne Verteidigung ließen, war nicht nur ein politischer, sondern ein strategischer Fehler …« Erzherzog Johann hat Fritz Schwarzenberg zum Kommandanten der Sonderbundstruppen vorgeschlagen, doch die Bedingungen, die der Fürst zur Ausrüstung jener Truppen stellte, stießen bei Metternich auf Widerstand, so daß er vorzog, als Freiwilliger und Adjutant von Salis-Soglio den Feldzug mitzumachen.
Am 2. April 1848, an jenem Sonntagmorgen, an dem vom Stefansturm die von einigen Studenten dort des Nachts befestigte schwarzrotgoldene Fahne herniederwehte, zeigte des Fürsten Wiener Tagebuch die schmerzlichen Zeilen: »Mein Mütterlein ist gestorben, somit auch dieses liebe Band gelöst, und ich kann frei die Anker lichten, die mich an diesen fluchbeladenen Boden knüpfen! – Auch die Sündflut ist bereits in vollen Strömen hereingebrochen.« Er eilte nach Tirol, wo er aufatmend schrieb: »Gott sei Dank! Grüne und weiße Kokarden, – Landesschützen gesehen, – Männer, – Berge, – Herzen gefunden! – Vielleicht läßt der Himmel auch nach dieser Sündflut den Regenbogen der Hoffnung emporsteigen.« Als Radetzkys Siege in Italien die Verteidigung Tirols überflüssig machten, ging der Fürst ins Feldlager nach Mailand, 1849 nach Ungarn, wo er als Ordonnanzoffizier Haynaus die Schlachten bei Raab und Komorn mitmachte. Bis 1851 beteiligte er sich noch an verschiedenen militärischen Aktionen und zog sich dann, mit dem Range eines Generalmajors, auf seine Besitzung St. Mariathal bei Preßburg zurück. Die letzten Publikationen, die er in seiner lieben Waldeinsamkeit vorbereitete, waren der 1859 herausgegebene Band »Jagdausflüge«, die den leidenschaftlichen Jäger ins schöne Ennstal, auf die Stallbruckeralm und in das unvergleichliche Jagdschloß Steyer seines Freundes, des Fürsten Gustav Lamberg, führten, dem das Büchlein mit fröhlichem Weidmannsgruß gewidmet ist; ferner 1862 zwei Bände »Postdiluvianische Fidibusschnitzel«. Im ersten Band erschien die – in diesen Blättern aufgenommene – biographische Skizze über seinen Vater, dem Umfange nach schmächtig genug. Doch jedes Wort zählt als Dokument der Wahrheit und Treue, und zwischen den knappen Zeilen ist viel Unausgesprochenes zu erraten, das ihm den Mund geschlossen für ausgreifenderen Bericht. Freunde und Parteigänger des Fürsten hatten, wenn auch nicht ein volles Lebensbild des Siegers bei Leipzig – dazu fehlte dem Sohn in jeder Beziehung die Distanz –, doch eine Fülle grundlegenden Materials für künftige Biographien erwartet. Heinrich Laube, ein ebenso passionierter Jäger und entschiedener Autokrat als der Landsknecht selbst, war jahrelang mit ihm befreundet und sprach unumwunden aus: »… Hoffentlich hinterläßt sein (des Marschalls) Sohn Fritz einst eine Lebensgeschichte des Vaters, welche, unbekümmert um Widerspruch, in einfachen Worten diesen Führer und dessen Weg schildert, einen Führer von edler Gesinnung und schöner Bildung, einen Weg durch Dornen und peinliche Schluchten …« Über Fritz Schwarzenberg meinte er: »Für den Dichter ist er eine unerschöpfliche Quelle, er kennt alle Dinge bis an die fernste Wurzel und ist imstande, alles naiv anzusehen wie ein unverdorbenes Kind …«, und aus eigener Erfahrung setzt der einstige Vertreter des »jungen Deutschland« hinzu: »Dem Gegner versagte er nie ein Atom von Gerechtigkeit …« Dies letztere hätte Hebbel in seiner Beurteilung des Fürsten nicht gelten lassen, obwohl er ihn sonst als ritterlichen Charakter wie als Talent hoch einschätzte. Fritz Schwarzenberg, der mit einem Haß, der ihm tief im Blute saß, alle Revolution unbarmherzig verfolgte, sprach 1848 in einem seiner Aufsätze sein Bedauern aus, daß Windisch-Grätz ganz Wien nicht in Flammen hatte aufgehen lassen. Dies Manuskript schickte er, wie so manches frühere, dem Dichter zu, der die leidenschaftliche Anklage gegen eine, wie er antwortete: »harmlose, von ihren natürlichen Beschützern im Stich gelassene Stadt …« nicht minder energisch widerlegte, was aber beider Beziehungen in keiner Weise trübte. Hebbel wurde nicht müde, dem Fürsten vorzuhalten: »Niemand in Deutschland ist berufener, zusammenhängende Memoiren zu schreiben, wie Sie, und niemand hat das dazugehörige Talent der Selbstbeobachtung im dramatischen Detail des Lebens glänzender bewiesen …« Eine der vielen eigenartig fesselnden mündlichen Erzählungen des Landsknechts über seine Jugenderlebnisse in der Pußta veranlaßten Hebbel zu dem Gedicht »Husarenwerbung«, das dem Fürsten gewidmet ist.
Im Gegensatz zum strengen Holsteiner brachte der Tiroler Dichter Adolf Pichler dem antirevolutionären Standpunkte des Fürsten ein menschlich tieferes Verständnis entgegen, obwohl er als Student und einer der wehrhaften Vorkämpfer der Freiheit die Wiener Märztage begeistert mitgemacht. Unmittelbar danach – von seinen engeren Landsleuten zum Hauptmann in der Aula gewählt – eilte er in die von dem Feinde bedrohten heimatlichen Berge. Er focht dort in den Reihen der Wiltauer an Fritz Schwarzenbergs Seite und erwähnte in seinen Erinnerungen an das »Sturmjahr« jenes Zusammentreffen folgendermaßen: »… Er war in einfacher Schützentracht mitgezogen, ohne irgendeine Charge oder besonderen Einfluß zu verlangen. Ein geistvoller Mann, wußte er sein Gespräch durch manche feine Beobachtung, durch Erzählung manchen Abenteuers anziehend zu machen. Dessenungeachtet wurde er von sehr vielen meiner Kompagnie scheel angesehen; es war keine Ursache dazu, vielmehr verdiente er unsern Dank für die Freigebigkeit, mit der er in Wien zu unserer Ausrüstung beitrug. Einige alberne Bürschlein konnten es gar nicht verzeihen, daß er ein Fürst war und nicht mit der Revolution kokettierte … Ich selbst traf öfters mit ihm zusammen. Er sprach mir unverhohlen sein Leid über die Märztage aus. Die Beziehungen, unter denen er sich bisher wohl befunden, waren zerrissen, ihm Hochverehrtes in den Staub getreten oder im Begriffe, es zu werden; wie konnte man von ihm verlangen, daß er dem gewalttätigen Umschwunge der Dinge Beifall zujauchzte? …«
Über des Landsknechts Memoiren urteilte Eichendorff ebenso warm als Hebbel, er meinte, »diese setzten nicht sowohl einen fertigen Poeten, als eine poetische Natur überhaupt voraus, und eine solche durch und durch poetische Natur trete uns in seinem ›Wanderbuche‹ keck und überraschend entgegen.« Eichendorff bringt Fritz Schwarzenberg in Gegensatz zu Pückler-Muskau, sehr zum Nachteile des letzteren, und vergleicht ihn mit dem »unvergänglichen Simplizissimus. Wie dieser zwischen rauchenden Trümmern im verhallenden Donner des Krieges aufgewachsen, steht auch unser Landsknecht auf der Wetterscheide einer untergehenden und einer werdenden Zeit und zeichnet diese Übergangszeit mit ihren großen Erinnerungen, Torheiten, Irrtümern und all ihrer ungeheueren Konfusion in kecken Genrebildern auf den Goldgrund eines unverwüstlichen religiösen Gefühls …«
Wenn man des Fürsten tatenreiches, buntbewegtes Leben überblickt, wie es sich in seinen Tagebüchern spiegelt, so wirkt als eine der eigenartigsten Seiten seines Wesens sein ungewöhnlicher Vergangenheitskultus. Gewiß überraschend bei einem Mann, den alle großen und kleinen Fragen des Augenblicks mit regem, oft leidenschaftlichem Interesse erfüllten, der die geringfügigste Tat höher einschätzte als »die tiefsten und schönsten Gedanken«, – und der sich dennoch unablässig in unfruchtbares Grübeln über Gewesenes und Verlorenes versenkte. Oder war es gerade der Ausdruck stärksten Lebensgefühles, daß er vom Reichtum seines inneren und äußeren Erlebens nichts missen wollte durch Vergessen und Verschmerzen? – mit einer Art Heimweh sein Jugendland »mit der Seele suchend«, trotz herber Liebesschmerzen und einschneidender Enttäuschungen, die es umschloß. Er konnte die Verse, die als Leitmotiv das Empfinden seiner vom Schicksal allerdings vielgeprüften Freundin Betty Paoli begleiteten, auch zu seinem Bekenntnis machen: »Wir wissen stets nur, daß wir glücklich waren, doch daß wir glücklich sind, wir wissen's nie.« Auf der Basis solch übereinstimmender Lebensauffassung fanden sich beide immer; so verschieden die Grundbedingungen ihrer Schicksale auch waren, blieben sie im Innersten einander verwandt bis ans Ende, wovon ihr reicher Briefwechsel noch über das Grab hinaus Zeugnis ablegt. –
Die Vielgestaltigkeit seines Wesens wußte Fritz Schwarzenberg nicht einmal auf eine einheitliche Formel durch die Wahl eines Pseudonyms zu bringen, denn er wählte der Namen viele, und doch entsprach keiner vollkommen seiner Persönlichkeit. Mit besonderer Vorliebe nannte er sich »der verabschiedete Landsknecht« und bezeichnete sich zwar damit als den unter fremden Heerführern ebenso tapfer wie für die Heimat kämpfenden Soldaten, doch taten die Landsknechte dies ihrerzeit nur um Sold und Beute, nicht um des Krieges Zweck und Ziele. Daß Fritz Schwarzenberg aber anders als für seine eigene Überzeugung den Degen gezogen und jemals eigenen Vorteil bedacht hätte, lag nicht in seiner Natur. Sein selbstloser Opfermut, sich gerade dort mit Leib und Leben einzusetzen, wo er das gute, d. h. legitime Recht des Schwächeren bedroht glaubte, unbekümmert um die sonstige politische Konstellation, ging so weit, daß sein Vetter Felix Schwarzenberg ihm als Ministerpräsident einmal klipp und klar den Vorwurf machte, er sei ein Phantast, der seine Haut stets nur für eine verlorene Sache zu Markte getragen. So taugte jener romantischen Seite seines Wesens der Name des »letzten Ritters«, den er sich oft beilegte, besser; auch wußte er nach Minnesängerart manches Lied zu reimen, zum Preise schöner Frauen, zu Ehren von Kampf und Sieg und der guten, alten Zeit. »Letzter Mohikan« schrieb er ebenfalls gern, wenn er sich als Sonderling und Vertreter von Lebensformen einer edlen, aussterbenden Art gefühlt. Während es wehmütig klingt, wie ein Abschied von den Freuden dieser schönen Welt, wenn er sich den »letzten Mönch von Mariathal« nennt, den einsamen Herrn seiner auf den Resten eines alten Klosters in seinem Sinne wieder aufgebauten Besitzung. »Alter Kapitän Wolf« unterschrieb er die Widmung seiner »Ante-diluvianischen Fidibusschnitzel« an seinen Freund Gustav Kühne, aus dem Kreise des »jungen Deutschland«, geistreich und gemütlich als erprobter Raucher, an dem Unterschied zwischen der neuen Zigarre und dem alten Pfeifenrohr die Gegensätze ihrer einander ablösenden politischen Richtungen exemplifizierend. Auch »Leo« signierte er mitunter in der Stimmung wahrhaft wüstenköniglicher Unzufriedenheit mit allen menschlichen Einrichtungen. – –
Aber als Fritz Schwarzenberg war er alles zugleich und mehr noch, als seine vielen Namen sagen konnten. In erster Linie ist er der würdige Sohn seines großen, edlen Vaters und seiner bedeutenden, in ihrer großmütigen Gesinnung ihm so ähnlichen Mutter gewesen. Er war in jeder Beziehung ein seltener Mensch, auch darin, daß das schwächliche Fazit, mit dem die Charakteristik der meisten hervorragenden Persönlichkeiten lobend und tadelnd abschließt: sie waren Kinder ihrer Zeit, bei ihm nicht gilt, – da keine Zeit die seine hätte sein können, der von jeglicher Zeitströmung unabhängig, einzig und allein er selbst gewesen und geblieben.