
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Gesang an meine Vaterstadt Glogau
Es hebt sich aus den letzten Dämmerweiten
Der Heil'genschein von meinen Kinderzeiten
Und taucht die Welt von damals tief in Glanz. –
Und alles war mir Licht: Wälder und Gauen,
Juwelenfarben leuchteten die Auen
Und boten ihre Blumen mir zum Kranz ...
Noch kannt ich nicht die wilde Welt da draußen;
Am blüh'nden Wall der Stadt ist alles Brausen
Wie Schaum an einem schönen Fels zerschellt.
Und jene Jahre waren mir wie Lenze –
Ich war umhegt gleichwie von sel'ger Grenze –
Denn diese helle Stadt war meine Welt.
Und sie war damals eine stolze Feste,
Durch ihre Tore ritten Königsgäste,
Und Roß und Wagen gaben dumpfen Schall.
Zugbrücken schwankten, und die Ketten klirrten –
Und lustig am Gemäuer Schwalben schwirrten,
Und Veilchen dufteten am Rasenwall ...
Ich hätt' die Welt mit meinem Kinderarme
Umfassen mögen, daß sie voll erwarme
An meines Herzens junger, erster Glut.
Die Mauern alle, und die weiten Gassen,
Es schien, als könnten sie den Strom nicht fassen,
Der meine Seele schwellte und mein Blut ...
Ein Kind noch, mußt ich dann von hinnen ziehen.
Aus Freuden wars in Ernst und Not ein Fliehen
In eine fremde, riesengroße Stadt –
Berlin! ich bin ihm immer fremd gewesen,
Es konnt' in mir und ich in
ihm nicht lesen –
Wir blieben uns ein schriftlos, leeres Blatt ...
Doch meine Heimat lebte von Gestalten,
Und wie sie in verschollenen Kleidern wallten,
Ward eine ganze, bunte Welt mir wach – – –
Heißblütige Hengste sah ich jäh sich bäumen;
An den mit Edelstein besetzten Zäumen
Führt sie ein Edelknecht dem Zuge nach ...
Und hier sind dunkle Römer einst gezogen.
Die edlen Stirnen von Gelock umflogen,
Die Faust wie Erz, und Sieg in ihrem Blick ...
Und Völker und Geschlechter kamen, gingen,
Und füllten rings das Land mit Kampf und Ringen,
Und alle wurden wechselnd ihm Geschick.
Und Sklavenfürsten, Trotz in ihren Mienen,
Sie brachten dieses freie Land zum Dienen
Und zogen stolz mit Herrscherlüsten ein.
Vom Land der feurigen, der süßen Frauen,
Polnische Herrscher konnte ich erschauen,
Die liebten kühne Tat und Glutenwein.
In fernen, mittelalterlichen Zeiten
Erstand dir auch ein Dichter. Heiterkeiten
Und Schwermut schuf sein ernstes Künstlertum,
Gryphius, der Träumer, der zu spät Erkannte,
Den seine Zeit, sein Land nur wenig nannte,
Dem nach Jahrhunderten erst ward sein Ruhm ...
Mein Geist ersah Gestalten und Gesichte –
Ein langer Zug aus toter Weltgeschichte
Ward Leben mir und rege Gegenwart!
Da! ein Gewalt'ger naht, – die Polen weichen –
Sie beugen sich vor seinem Schwerterzeichen –
Im Winde weht sein feuerfarb'ner Bart ...
's ist Barbarossa! – Seine Scharen wogen,
Von Feuerbrand ist Glogau überflogen –
Die Polen kämpfen wütend Reih' an Reih'; –
Doch, ob der Rotbart noch so stark gestritten,
Vom Polenjoch hat Glogau tief gelitten,
Bis es der erste Heinrich machte frei ...
Du vielumworb'ne Stadt! Du sahst Piasten
Jahrhundertlang in deinen Gauen rasten,
Und wurdest unter Conrad Herzogtum.
Ein Kampfspiel zwischen Böhmen, Ungarn, Polen,
So heftet das Geschick an deine Sohlen
In wildem Wechsel: Elend, Sieg und Ruhm.
Sachsen beherrschten dich nach wilden Fehden, –
Und dich bezwangen einst die blonden Schweden,
Zweimal der düst're Feldherr Wallenstein.
Dann warst du Habsburgs mehr denn ein Jahrhundert,
Bis Einer, viel gefürchtet, viel bewundert,
Ein Zollern zog in deine Mauern ein ...
Ein dionysisch Leuchten in den Blicken,
Einer, der niemals sich gelernt zu bücken,
So mannhaft schritt des alten Fritz Gestalt!
Zwiefach ein König, denn auf Preußens Throne
Trug er die selt'nere, des Genius Krone,
Und war von ihrem Königtum umwallt.
Als einer seiner besten Edelsteine
Wardst du und dieses blüh'nde Land das seine –
Die Oder rauscht den Sieg zur Ostsee hin –
Und mit ihm kam ein reicher, tiefer Frieden.
Nur
ein mal ward dir Grauses noch beschieden,
Als dich bezwang des Korsen wilder Sinn.
Jedoch, das Satyrspiel verging. Die Gauen
Die kriegszerstampften, wurden blüh'nde Auen,
Und immer stolzer wuchs die deutsche Kraft.
Bis endlich jene gold'nen Tage kamen,
Die schrieben in die Sterne unsern Namen
Und haben Schönstes vom Geschick errafft ...
Nun bist du in dem allgewaltigen Ringe –
Nun überrauscht ganz Deutschland jene Schwinge
Des einzigen, des kaiserlichen Aar.
Als Feste fielest du, doch du wardst freier,
Du ferne Heimat, die mir innig teuer,
Dir bring' ich heilige Gedanken dar.
Und wenn ich nimmerdar dich wiedersehe,
Mein erstes Lachen und mein erstes Wehe,
Hat dir gehört in ferner, ferner Zeit –
Und nie vergeß' ich deines Stromes Fluten,
Nie jene Gärten, die in Rosengluten
Gestanden und in Duft und Trunkenheit ...
Ich liebe dich! nimm dieses Herz entgegen!
Auf der Jahrhunderte verschlung'nen Wegen
Folgt dir erinnernd meine Phantasie.
In deinen Kämpfen hab' ich mitgestritten.
Mit dir gejubelt und mit dir gelitten,
Und lasse dich nun, heilige Heimat, nie! ...
Die göttliche Kraft, allgegenwärtig zu sein, liegt in aller echten Phantasie. Damit durchdringt ein reger und leidenschaftlicher Dichtergeist in einem sehr schönen Sinne: Zeit und Raum und Form und Wesen. Die Bilder des Lebens können daher in aller Farbenherrlichkeit und Linienstärke aus längst entrückten Vergangenheiten gehoben und in die Zukunft hin gezeichnet werden ... In meinen einleitenden Strophen habe ich nun die ganze Kraft der persönlichen Erinnerungen aus Kindheit und späterer Zeit und die geschichtlichen gegeben, wie sie in meinen erinnernden Gedanken stehen ...
Glogau hat das Anheimelnde, Holdbehagliche einer deutschen Mittelstadt. Unwillkürlich denkt man sich seine Nächte mondlichtvoll und sternenüberfunkelt, so daß, alle Umrisse der Giebel, Häuser, Kirchen, Gassen wie mit zarten Goldbändern geschmückt sind ... Eine kleine Wohnung dort, im Dachgiebel, die arme Verwandte bewohnten, kam mir wie ein Ausguck ins Märchenland vor; denn man sah weit und hoch über die in der Stadtenge wogenden Menschen hinweg. Die Dächer leuchteten wie kostbare Topase im Sonnenlicht, die hellen Wolken fuhren wie frohe Boote in einem blauen Reich, und Tauben umflatterten uns, wie Amoretten ... Eine schöne, ernste Tante waltete dort, die immer Köstliches zu erzählen wußte, daß es mich wie leise Fieberschauer durchbebte. Ich weiß noch heute jeden Winkel der kargen Wohnung, und erinnere mich vor allem, als einer Merkwürdigkeit, eines alten Spinetts, das in umgekehrter Weise, wie man gewohnt ist, und zwar die sieben unteren Tasten tiefschwarz zeigte und die fünf oberen schneeweiß. Das hatte ja natürlich gar keinen Einfluß auf den Klang, aber es ist mir dennoch in der Erinnerung, als hatten dem Spinett ganz sphärenhafte Klange innegewohnt.
Allgegenwärtig geht meine Phantasie wandern, und da steigt der alte Markt empor, man nannte ihn »Ring«, weil er wie ein geschlossener Reif um den Platz lag, wo Handel und Wandel, die wirtschaftlichen Pulse der Stadt, rege waren ...
Da ich mit meinem fünften Jahr mit meiner Mutter und Schwester nach Berlin zog und meine geliebte Heimat verließ, entstammen alle Bilder und Eindrücke späteren Zeiten, wo ich freilich auch noch ein Kind war, und jedes Jahr zum Ferienbesuch bei meiner Großtante auf deren reichen, weiten Gütern, nicht weit von Glogau, weilte.
Ich kam dann auch alljährlich in meine Vaterstadt. Der »Ring« von Glogau! ja, das war ein Wunderland für mich. Der Ferienbesuch fiel immer in die Sommer-und Frühherbstwochen, – und so ist mir alles dort wie in einer unwandelbaren Sommerherrlichkeit im Erinnern. Über dem »Ring« lagen bald zarte, bald starke Duftwellen von reifen Früchten, erlesenen Gemüsen und von kunstlos zusammengebundenen, herb und kräftig duftenden Blumensträußen aus Bauergärten. So fröhlich gespendet, so einfach dargeboten schien mir alles, daß es fast war, als bringe das Land die Erzeugnisse seines Bodens, als Geschenke einem dar ... Wir Dichter werden ewig die – Reichen des Lebens sein, selbst wenn wir ganz arm wären und »unser Brot mit Tränen essen« müßten. Wir sind doch die Reichen, denn uns gehören, über alle Dinge hinaus, noch die von uns geschaffenen Werte, – und über alle Menschen hinaus, noch die Liebe und das Verstehen, das sie verklärt zeigt.
Der Dichter ist ein Gestalter und Bildner, und weiß die Zeiten, kraft seiner Phantasie glücklich zu vermählen. Der gewöhnliche Sterbliche lebt mehr in der fordernden Gegenwart. Wer gedenkt noch der alten Piastengeschlechter der Herzöge, der Reiche, die Schlesien wechselnd besaßen? ehe es 1814 endgültig an Preußen kam? Wer anders als Chronisten, Geschichtschreiber und Dichter?
Und wissen noch viele von der einzigen Dichterberühmtheit der alten Stadt, von Andreas Gryphius, mehr, als was sie in Literaturstunden von ihm lernten?
Von allen, die dies hier lesen werden, wer kennt den »Peter Squenz«, – »Cardenio und Clinde«, – »Catharina von Georgien«, »Carolus Stuardos«? Wer kennt die Gryphiussche Lyrik, »die Kirchhofsgedanken«, den »Horribiliskribifaxe«, oder »das verlipte Gespenst«? Wer weiß auch von der »Fruchtbringenden Gesellschaft« und von den damals wirkenden Poetenverbindungen, die so viel mehr »Beckmesser«sches Wesen als »Stolzing«sches enthielten?
Sehr eigentümlich und wie dem Geist unserer Zeiten entrückt, wirkt auch in Gryphius' Leben seine »Krönung« zum Poeten, durch einen großen Herrn, in dessen Haus er Lehrer war, – und zwar des Grafen Schönborn, der im nahen Fraustadt, das schon zur Provinz Posen gehört, residierte. Fraustadt ist übrigens ein kleines, unbedeutendes Städtchen, in dem ich zufällig die ersten Jahre meiner Ehe verlebte. Es ist mir nicht ganz klar, wie ein großer Herr, offenbar mit einem großzügigen Haushalt und reichen Mitteln, sich dieses nüchterne Landstädtchen Fraustadt als Wohnort aussuchen konnte, das nicht einmal den Reiz des Landschaftlichen hat. Mir wenigstens ist z. B. die Umgegend Berlins, mit ihrem etwas wehmütig-ernsten, aber doch stimmungsvollen Charakter, viel reizender erschienen. Und dennoch ist sie berüchtigt (recht fälschlicherweise) für ihre sandige, farblos klare Ebenheit, mit eintönigem Kiefernwuchs ...
Das einfache Land schaut übrigens auch aus vielerlei Augen, blauen, schimmernden, zu seinem feingetönten Himmel: aus schönfarbigen Seen, die, um im Bilde zu bleiben, gleichsam reich bewimpert sind mit zarten Rohrstauden und lieblichen Büschen ...
Die Kiefernwälder der Mark haben auch eine eigenartige und erlesene Schönheit; denn sie sind schöner gefiedert, fächerartiger und zarter als ihre zu Unrecht berühmteren Schwestern der italienischen Landschaft: die Pinien! Und wer sie im Morgen- oder Abendrot sah, weiß, daß ihre Stämme mit ihrem metallisch gleißenden Harzgetropf dann wie herrlich getriebenes Kupfer glänzen. Von dieser, ich möchte es nennen: »keuschen Pracht« der märkischen Landschaft, deren Reize man nur erkennt, wenn man sich liebend in sie vertieft, ist nicht ein Zug in der Landschaft, die Glogau oder Fraustadt umgibt. – –
Für die damalige Zeit (die Dichtkunst lag in recht engen Fesseln) ist Gryphius' Talent und Schaffen relativ bedeutend. Der Dichter ist 1616 geboren, und der schwermütige, zerrissene Zug, der durch den Dreißigjährigen Krieg über Deutschland und seiner Kultur und Kunst lag, ist auch in des Glogauer Dichters Werken zu spüren. Geist und Sprache lagen wie geknebelt da unter den brutalen und leidenschaftlichen Griffen und der Unrast einer kriegerischen Zeit. Gryphius, der auch ein Jahr in Straßburg und Berlin lebte, ist ziemlich jung, jedenfalls in voller Männerkraft gestorben, und zwar in Fraustadt, das er wohl um schöner Jugenderinnerungen willen, geliebt hat. Die Stadt Glogau hat ihrem immerhin bedeutenden Sohn ein wenig schönes Denkmal gesetzt: eine etwas unkünstlerische Büste auf dem in seiner Architektur ziemlich geschmacklosen Theater. Wenigstens habe ich kein anderes Denkmal entdecken können ...
Schleier von Wehmut, aber auch von einer wunderzarten Poesie liegen für mich über der alten Stadt. Meine Mutter ward, einige Monate ehe ich geboren wurde, Witwe. Eine plötzliche, tückische Krankheit entriß ihr den jungen, hochbegabten, schönen, geistreichen Mann nach einer kurzjährigen Ehe. Sie ist, mitten aus einem großen, wolkenlosen Glück gerissen, dann fast nie mehr von Herzen froh geworden. Auf meine Kindheit fielen unablässig Tränen und Tropfen von Wermut. Dennoch ist sie nicht dadurch vergiftet worden, sondern hat nur jenen eigentümlich schwermütigen, sinnenden Zug bekommen, der auch durch meine höchsten Glück- und Glanzzeiten später immer wie ein leise anklingender Seufzer tönte. Meine ganze Geistesart ist sehr früh auf das Tiefnachdenkliche, Philosophische gestimmt gewesen; sie ist aber nie in einen mißtönenden oder auch nur schrillen Akkord mit dem andererseits so jauchzenden Aufschwung meines Herzens und meiner Phantasie gekommen. Schiller sagt einmal, er habe immer unter dem Zwiespalt zweier seelischen Neigungen, die fast Weltanschauungen waren, gelitten. Er sagt: »denn gewöhnlich übereilte mich der Poet, wo ich philosophieren sollte, und der philosophische Geist, wo ich dichten sollte.« (Briefe an Goethe, Cotta.)
Ich kann von mir nun nicht sagen, daß ich die Grenzen dieser grundverschiedenen Gaben resp. Neigungen je zu einer Dissonanz hätte werden lassen. Ob das aus einem gewissen Zugerichtsitzen über meine geistigen Gaben so wurde, oder aus andern schwerer zu erkennenden Gründen, vielleicht aus einem Zusammenwirken von Begabung, Erziehung und Erfahrung, ich kann es nicht sagen; jedenfalls ist, trotz stürmischen inneren Drängen, nie ein noch so kleines Werk, sei es in Poesie oder Prosa, aus mir gelöst worden, wenn es nicht langsam und voll in mir reif geworden war. Ich habe solange ich mit der Form, vielleicht auch mit dem künstlerischen Problem rang, nie etwas aus mir herausgestellt; oder richtiger: was ich als Halbkind, als junges Mädchen oder als ganz junge Frau (ich heiratete mit achtzehn Jahren) geschrieben, habe ich alles den Flammen geopfert; obgleich mein Mann, der eine sehr künstlerische Natur neben seinen bedeutenden staatsmännischen Gaben hatte, meinte, es sei eine Tempelzerstörung. Ich blieb aber unweigerlich fest: ich fühlte, mein Können war noch nicht auf seiner natürlichen Höhe. Als ich dann 1885 meinen ersten Dichtungsband erscheinen ließ, hatte ich die befriedigende Freude, daß die gesamte ernste Kritik aussprach, ich hatte schon ganz Reifes und in Form und Inhalt Meisterliches gebracht. Menschlich und künstlerisch ist es ja immer interessant, in die Werkstätte eines geistig Schaffenden zu sehen – in die Dämmerwinkel und in die Sonnenplätze. Wie dann ein Wind, ein Sturm, eine liebende Hand oder eignes Suchen und Finden Samenkörner in die Seele legt, und wie sie, von den Gnaden oder Ungnaden getrieben, früher oder später Wurzel fassen und von Blätterarabesken umgeben, eine Blüte bringen, deren letzte Krone eine duftige Frucht ist. Anregungen, die Jahre, oft Jahrzehnte zurückliegen, haben bei mir manchmal die heißblütigsten, gegenwartstärksten Dichtungen ausgelöst. Das Stärkste, was ich geben kann, ruht oft lange in mir, nicht wie im Schlaf, aber wie im wachen Warten – und wenn ich fühle, daß seine »Zeit erfüllt ist«, dann steht es in frischer Urlebendigkeit auf, – und ich weiß, daß dann viele meinen, ich hätte es erst gestern erlebt. Andere Früchte freilich reiften wie in Treibhausschwüle ... Fast alle, nein sage ich lieber: sehr viele meiner leidenschaftlichsten und sehnsuchtswehesten Herzens- und Landschaftsdichtungen stammen aus Anregungen meiner Kinder- und Halbkinderzeit. Meine Mutter war damals schon aus herben Familiennotwendigkeiten mit uns beiden kleinen Mädchen, meiner einzigen Schwester und mir, von ihrem geliebten Glogau nach dem ihr ganz wesensfremden Berlin gezogen. Sie hat das Heimweh nach Schlesien nie aus sich löschen können. Ihr Vater (ich habe meinen Großvater nie gekannt, aber er soll ein besonders milder, vornehmer und kluger Mann gewesen sein), war Oberbürgermeister von Glogau, und hatte seine Frau, eine geborene von Ploetz, die ihm fünf Töchter geschenkt hatte, früh verloren. Meine Mutter war deshalb von der einzigen Schwester dieses Großvaters, einer Frau von Lucke, auf deren Gütern fast ganz erzogen worden. Dies Leben nahe der Natur, etwas patriarchalisch-feudal, aber von schöner Herzenswärme erfüllt, war ihr unendlich lieb, und mit allen Triebkräften ihrer Seele hat sie immer dahin zurückgestrebt; – besonders, als die steinernen Fesseln von Berlin und von einer gänzlich anderen, sehr engherzigen Familienumwelt dort sie umgaben. Wir sind dann von Berlin aus in jeder Sommerferienzeit nach dem Hauptgut meiner Großtante gegangen. Die Sommer dort haben einen geradezu beherrschenden und bezaubernden Einfluß auf mein gesamtes inneres Leben gehabt. Die Güter meiner Großtante lagen durch stundenlange Wagenfahrt entfernt von einer Eisenbahn, an der Grenze von Schlesien und Posen. Über der Landschaft und dem Land lag etwas ganz Weltentrücktes, wenigstens vom heiß und schnell pulsierenden Welt verkehr Entrücktes. Dort lebte sich alles: Bauerngeist, Herrschaftsgeist, ich möchte sogar sagen, der Geist der Landschaft vollständig eigen aus, – ohne die heilsamen und unheilsamen Reibungen des Weltlebens draußen. Ich habe selten ausgeprägtere Eigenarten gesehen als in diesem stillen, doch interessanten Winkel. Sogar der Krämer des Großdorfs, der, wie dort überall, wo schon der polnische Jude der Walter des Handels ist, ein Israelit war, stellte eine charakteristische Eigenart dar. Starr und stolz an den Satzungen und dem Geist seines Talmud festhaltend, vereinte er, trotz dieser aufrechten Haltung in seinem Jehovaglauben dennoch damit das demütige Bücken und Gleiten im bürgerlichen Verkehr. Auf der sozialen und staatlichen Stufenleiter hätte er den engsinnigsten Bauerntölpel als sich übergeordnet anerkannt, während er ihn im geistigen und sittlichen Leben tief unter seiner Würde und seinem Wert empfand. Die Frauen seines Hauses, sein Weib und seine Töchter, waren herrliche orientalische Typen, die ganz wie fremd und abgesondert in der engherzigen, von alten Vorurteilen beherrschten Bauernschaft der Gegend standen. Mit großen, immer wie von Tränen feuchten Blicken schauten sie verständnislos zu den Verständnislosen. Wenn ich der Stelle des Alten Testaments gedachte: »An den Wassern Babylons saßen sie und weinten«, standen immer jene schlanken, schwermütigen Gestalten der Dorfjüdinnen von Strunz in mir auf ... Das Schloß lag in einem leuchtenden Weiß, wie verklärt in dem schweren Grün des vor ihm weithin gedehnten Parks und der lichteren Rasenflächen. Zwischen diesen und dem Park lief es wie eine schwingende Grenze hin: Granitpfähle, die mit hängenden Erzketten verbunden waren. Pfauen wiegten sich darauf. Das wirkte sehr malerisch und sehr feudal. Viele feudale Züge waren überhaupt, als sie schon in der Welt, nach den großen Revolutionen und Freiheitskriegen, keinen Raum mehr hatten, hier noch wurzeltief versenkt. Der Mann meiner Großtante (ich habe ihn nicht mehr gekannt), soll ein wilder Junker von ungemein herrischen Sitten, despotischen Gedanken und hartem Willen gewesen sein. Sporenklirrend und mit der Hetzpeitsche durch die Luft fahrend, war er in Hof und Feld bekannt, und er muß mehr vom russischen Grandseigneur als von einem deutschen Edelmann in seinem Wesen gehabt haben. In der Gesellschaft sei er von höfischer Geschmeidigkeit gewesen. Seine Frau hatte ein sanftes, etwas geducktes Wesen, ein wenig altertümlich gespreizt vornehm, mit einigen feudalen Zügen, die aber nicht wie eigen gewachsen, aus ihrer Natur kamen, sondern wohl mehr aus dem Zusammenleben mit dem herrschgewohnten Gemahl erworben waren. Ihre lange Witwenschaft hat dann später die sanfteren Urelemente ihrer Natur, sogar etwas wie Gefühlsschwärmerei, aus ihr befreit. In ihrer kleinen Bibliothek zum Beispiel waren die abgegriffensten Büchlein die Dichter aus dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, also ihrer Jugendzeit: besonders waren es Österreicher, wie Halm, Beck, Grün, Lenau. – – Noch heut' erinnere ich mich der Ergriffenheiten, die »Der Sohn der Wildnis« in mir erregte und wie ich an die einsamsten Parkplätze das Geheimnis des ersten Entzückens über die Liebesleidenschaft von Parthenia und Ingomar trug. Was für ein kostbarer Rahmen dieser märchenstille Park aber auch war! Viel später, als ich die Böcklinsche Kunst kennenlernte, habe ich mir »Das Schweigen im Walde«, jenes geisterleis tastende Einhorn, das eine wundersame Frauengestalt reitet, nur unter diesen dunkelnden Parkbäumen vorstellen können. Die gartenlandschaftlichen Anlagen waren wohl gedacht und gewollt wie eine Welt für sich – und das Ganze war auch von einem sinnig-träumerischen Wesen, das jeden, der in diesen Zaubergarten eintrat, gefangennahm. Dagegen kamen mir später Klingsors Zaubergarten in Bayreuth, trotz seiner Formen- und Farbenreize, nur wie recht papierne Pracht vor. Vor der einen Seite des großen Parks lag ein Ziergarten in Rokokogeschmack, in wunderliche Formen geschnittene Bäume und Hecken, altmodisch gezirkelte Beete, mit einer Fülle von schlanken, hochgerichteten Blumen. Gedenk ich des stillen, vornehmen Gartens, dann steigt auch jener Duft auf, der immer über den Beeten lag: von Heliotrop, Reseda und Rosen. Nietzsche spricht einmal das merkwürdig stimmungsvolle Wort aus: »vom Rosenduft des Unwiederbringlichen.« Dieses zauberhafte Duften weht durch meine ganze Kindheit: glückselige Wehmut. – Von diesem Winkel zwischen Schlesien und Posen hat sich ja dann mein ganzes späteres Geschick, das des Interessanten, Bewegten so überviel brachte, entwickelt. Ich lernte meinen Mann, der damals als Kreisrichter in dem Städtchen Fraustadt stand, auf einem Ball bei meiner Großtante kennen. Er machte mit seinem nicht schönen, aber höchst ausdrucksvollen Kopf, seiner schlanken, eleganten Gestalt und seinem geistreichen, gewandten Wesen einen durchaus eigenartig bedeutenden Eindruck. Es war eine – Persönlichkeit, inmitten der mehr schematischen und in hergebrachten Allgemeinheitszügen gezeichneten Gestalten, der Leutnants und jungen Gutsbesitzer ... Und ich!? war wohl auch ganz anders als die Töchter des kleinstädtischen und ländlichen Adels. Wir fanden uns auch sehr bald, und ich war siebzehn Jahre, als ich mich mit ihm verlobte, und achtzehn, als ich als seine Frau von Berlin nach Fraustadt kam. Doch wenn ich von den Ergebnissen und von der Ernte eines ganzen, sehr reichen Lebens berichte, möchte ich auch von den seelen- und geistbildenden Lehr- und Studienjahren und den Leiden und Freuden meiner Kindheit und der Übergangszeit zum Jungmädchentum sprechen. Mit den Bildern aus dem Entwicklungsleben einer rastlos strebenden, sehr ernst gerichteten Denkerin und Dichterin (wie ich das doch wohl von mir sagen darf), werden sich ganz natürlich auch Kulturgemälde der damaligen Zeit entrollen, die von allgemeinem Interesse sein dürften. Schon in der Geschichte des Schulkomplexes an der Kreuzung der großen Friedrich- und Kochstraße lag ein kleines Kapitel der Geistesgeschichte des damaligen pädagogischen Berlin. Da war das merkwürdige Problem Tatsache geworden (aber Problem geblieben), das mir später erst in seiner ganzen Fragwürdigkeit klar wurde: die Leitung eines Gymnasiums, einer Realschule, einer Vorschule und einer höheren Mädchenschule, also Lehranstalten von höchst verschiedener Richtung, Strebung und Wesensart, die doch mindestens jede eine vollsaftige, bedeutende Eigenart als Leiter gefordert hätten, waren in eine Hand gelegt. Und noch dazu war dieser Direktor ein sehr weichmütiger, verträumter Idealist, der halb Gelehrter, halb Schwärmer, wenig Blick für die Forderungen des Lebens hatte. Er trug den in der Wissenschaft berühmten Namen: Ranke, und war ein Bruder von Leopold, dem prachtvollen Historiker. Meine Mutter mit uns beiden Kindern bewohnte, nachdem sie das höchst originelle, aber ach so engherzige Familienhaus in der Friedrichstraße verlassen hatte, im Direktorialgebäude das Erdgeschoß. Und durch dies Zusammenleben unter einem Dach mit Ranke, hatte der alte Herr, der eigentlich immer mit entrücktem Blick in den Himmeln seiner Gelehrsamkeit und seiner stark kirchlichen, philanthropischen Aspirationen schwebte, und wie über den Dingen zu schreiten schien, wohl ein lebendigeres Interesse an uns beiden kleinen Mädchen. Sonst interessierte ihn alles, was Kinderwelt, aufstrebende, wachsende Menschheit hieß, in der Allgemeinerscheinung mehr als in einzelnen Eigenarten und deren Rechten und Offenbarungen. In seiner Gelehrsamkeit von fast pharisäerhafter Würde und Haltung, im Hause von einem engen, kirchlich orthodoxen Geist, hatte er als Lehrer etwas Mildgewährendes wie ein freundschaftlicher Berater. Doch neben seiner weichmütigen Versonnenheit traten manchmal Ausbrüche flammenden Zornes auf, wenn irgend etwas in Schule und Haus nicht in dem Geist getan wurde, den er unweigerlich forderte. Er war sehr gelehrt und gehörte unter anderem zu dem kleinen Häuflein der Pädagogen in Berlin, die das klassische Altgriechisch geläufig sprechen konnten. Dieses hochgelehrte Häuflein hatte sich als »Griechische Gesellschaft« zusammengefunden, und diese Gesellschaft kam alle Monat oder alle Halbmonat, das weiß ich nicht mehr, bei einem ihrer Mitglieder zusammen und verbrachte den Abend, bei heiterem Mahle, die grauen, weißen oder kahlen Häupter in Wolken von Rauch und Würde gehüllt, nur in griechischer Sprache sich unterhaltend. Wir kleinen Mädchen, meine Schwester und ich, und die Rankeschen Töchter horchten dann, wie atemlos und unter geheimnisvollen, geistigen Schauern, vom Nebenzimmer aus auf eine Sprache, die uns bisher nur für Helden und Götter zu sein schien. Die Rhythmen und Töne der Sprache erklangen meinem Ohr und meiner Seele so hochfeierlich, daß sie ganz fremd im Alltag des Geschehens wirkten. Der alte Direktor Ranke gab uns in der Königlichen Elisabethschule, in der ersten Klasse, Geographieunterricht und ließ einen Teil dieser Erdkunde, merkwürdig genug, Himmelskunde sein. Er gab uns nämlich Astronomiestunde, und zwar, um sie recht eindringlich und verständlich für uns zu gestalten, sehr oft abends, wenn der Himmel sternenvoll war. Das war nun jedenfalls sehr eigenartig, wenn der alte Herr, der mit seinen flatternden, schneeweißen Locken und seinem weltabgewandten Blick ohnehin eine auffallende Erscheinung war, durch die Straßen Berlins spätabends mit einer Schar junger Mädchen zog. Das ging hinaus, bis wo die Häuser aufhörten und das weite Feld auch einen freieren Blick zum Himmel ließ. Ich war dann sehr stolz, wenn ich dem alten Träumer den Arm geben durfte, und wir beide gewissermaßen die Anführer der leichtfüßigen Schar hinter uns waren, der das Ganze mehr wie ein lustiges Abenteuer schien. Aber unser Geleiter nahm es heilig ernst mit der Sternstunde unter freiem Himmel. Er hatte es uns auch manchmal vermittelt, auf der Berliner Sternwarte die ewigen Lichter da oben durch die ausgezeichneten Instrumente unsern Blicken näherzubringen. Der alte Ranke war eine durchaus bemerkenswerte, eigenartige Erscheinung, so gar nicht typisch, nicht in irgendeine bestimmte Art einzuordnen, sehr zusammengesetzt, teils aus ganz widersprechenden Elementen. Das alles ist mir natürlich erst viel später klargeworden, als ich die Eindrücke meiner Schul- und Werdejahre rückschauend sonderte, klärte und entwickelte. Neben ihm und um ihn zu verstehen, und auch die seelischen Verschiedenheiten zu vermitteln und zu verbinden, hätte eine Lebensgenossin von bedeutendem Geist und tatkräftiger Seele gehört; denn er war eine Natur, die etwas Anschmiegsames und Verständnisheischendes hatte. Aber die »Direktorin« Ranke war selbst ein schwankes Zweiglein im Lebenswind. Sie war eine auf äußerste Einfachheit, fromme Beschaulichkeit, demütig dienende Wirksamkeit gerichtete Persönlichkeit. Sie hatte wenig Autorität bei ihren acht Kindern, denn sie gab sich selbst die Stellung einer frommen Magd der Häuslichkeit. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, die ich öfters im Leben beobachtete, daß Männer, deren Beruf die Erziehung junger Menschen ist, sei es nun im Schul-, Militär- oder Hochschuldienst, und die diesen Beruf auch meist mustergültig erfüllen, die Erziehung der eigenen Kinder lässig behandeln. Ich könnte recht berühmte Namen als Beispiele anführen, aber ich fürchte, daß die noch lebenden Nachkommen sich verletzt fühlen würden. Ich muß es dem Leser überlassen, die Wahrheit meiner Behauptung an seinen eigenen Beobachtungen über diese interessante Frage zu prüfen; die dann erkannten Tatsachen werden mir recht geben.
Die Königliche Elisabethschule, die unter dem Schutz der damaligen Königin Elisabeth von Preußen stand, und vom Staat subventioniert wurde, hatte einige recht hervorragende Lehrer, andere aber auch, die wirklich mehr in handwerkliche oder subalterne Berufe gepaßt hätten, und den Lehrstunden etwas Nüchternes, Saftloses, geistig Armes gaben. Es war wohl die Herzensgüte des alten Ranke, die sie in ihrer Unzulänglichkeit duldete, weil ihre bürgerlich finanziellen Verhältnisse vielleicht Förderung erheischten. Unter den hervorragenden Lehrkräften der Hervorragendste war wohl der Professor Flashaar, der eigentlich neben Ranke der Hauptleiter der Elisabethschule war. Er war ein Mann von durchaus eigenen großen Gedanken, von breitem Wissen, ein im besten Sinne humanistisch Gebildeter. Seine Literaturstunden, die den mächtigen Geistesstoff voll beherrschten, haben für meine spätere Kunst große Bedeutung gehabt; sie haben ernste Strebungen hoch angeregt. Flashaar war scharf gegen alles Kleinliche, Zerfahrene, Nachlässige und Unschöne; gerecht und sachlich, wo es zu wägen und richten galt, gütig, wenn er edle, starke Gedanken und schöne Triebe erkannte. Selbst im umwuchernden Gerank oder Unkraut entdeckte er jede feine Blüte, pflegte und hob sie zum Licht. Ihm dankten die strebsamsten seiner Schülerinnen einen goldnen Hort von wahrer Geistes- und Herzensbildung, den sie unvergeßlich mit hinnausnahmen in die Schule, die keine Ferien kennt, das Leben. Unter den Gestalten, die bestimmend durch meine Kindheit und erste Mädchenzeit gehen, steht die kleine Gestalt des Professors Flashaar an ragendem Platz. Mit dem klugen Kopf, den geistreichen, scharf geschnittenen Zügen, dem tiefsinnenden Ausdruck der Augen und dem eigentümlichen Lächeln seiner Lippen, das seltsam aus Güte und Ironie gemischt war, ging er hoch und bedeutsam durch die Jahre meiner Schulzeit. Für meine Natur, die besonders in ihrer ersten Entwickelungszeit zu Hingerissenheiten des Gefühls, Überschwenglichkeiten in der Auffassung von Natur und Menschen neigte, mußte die Umwelt des damals ziemlich kleinstädtischen Berlin und der Familie, in der ich lebte, Bedrückendes und Quälendes auslösen. So war es denn auch, und es ist nur natürlich, wenn ich mit meiner schwärmerischen Hinneigung zu aller Poesie des Lebens im Hohen und Schönen meine beste Heimat fand. Das waren »selige Inseln« für mich und wo ich sie fand, genoß ich sie mit besonders tiefer Hingabe. Zu diesen »seligen Inseln« gehörte der Garten des Familienhauses, in dem wir, gleich nach der Übersiedlung von Glogau nach Berlin, lebten, gehörte auch die Ferienreise nach Schlesien und der Mark, das Puppentheater im Hause meines Vormundes, die Musik, die sehr früh in mein Leben trat, und meine geliebten Bücher. Ein Band Byron oder Bulwer, die ich damals besonders liebte, im alten Fliederbaum (in dem ich hoch oben einen Sitz hatte) umhangen im Lenz von den duftenden lila Blütenbüscheln, das war meine seligste Insel. Überhaupt dieser Garten! Er verdiente eine ganze Geschichte – es würde ein Band erlauchtester Lyrik werden ... Er lag hinter dem großen Hause in der Friedrichstraße, eingebettet in andere Gärten und einen Zimmerhof, wo es immer nach frisch geschnittenen Waldstämmen duftete. Eine Mauer trennte am Ende des Gartens den Zimmerhof von uns; das rührige Arbeiten dahinter, das man nur hörte und nicht sah, so hoch war die Mauer und das herrlich duftende Holz, zauberten eine fremde Welt herauf. Am Eingang des Gartens standen zwei uralte Nußbäume, die im Frühjahr feine Blütentrauben von herbem Geruch und im Herbst köstliche, weißkernige Nüsse herabwarfen, sie kamen mir immer wie gütige Türhüter vor. Und dann wie schön die üppigen Weingeländer zur Seite, die guten Fruchtbäume, die lieben, steifen Blumen in den Rabatten und der stark duftende Buchsbaum – – – und – der große Zentifolienstrauch mitten im Garten, der mir, wenn er mit roten Blumen überschüttet war, wie der »flammende Dornenbusch« erschien! Eine Gottheit sprach ja für mich auch aus ihm: geheime, gottselige Poesie! Um so mehr empfand ich die Gnaden dieses Gartens, als das Haus, zu dem er gehörte und in dem meine Mutter in der Familie ihres toten Gatten leben mußte, einen engen, kleingeistigen Eindruck machte. Es waren gut bürgerliche Typen des alten Berlin, deren Schilderung eigentlich den freundlichen Griffel und den kostbaren Humor, mit einem Anflug von Satire von Julius Stinde forderten. Nur einer ragte aus dieser rechtschaffenen aber sehr nüchternen Familie hervor. Das war der sogenannte »Onkel Karl«. Er war Professor der Musik; sein besonderes Fach war Theorie und Kontrapunkt, in denen er ein damals hoch anerkannter Meister war. Er hatte einen so bedeutenden Ruf, daß jeder große Künstler, schaffender oder reproduzierender, der in Berlin lebte oder es zu kurzem Kunstaufenthalt suchte, zu ihm kam. Dort habe ich schon als Kind Liszt, Rubinstein, Wagner, Ole Bull, Bülow, Tausig, Bendel und andere gesehen. Es wurde in meines Onkels Hause ein unwiderruflicher Kultus mit Wagner getrieben, der wie eine Art Gesetz war, dem sich jeder, der in jenen Kreis trat, fügen mußte. Damals, in der Zeit zwischen meiner Kindheit und meinen Mädchenjahren, da ich doch schon mehr als dämmernde Erkenntnisse in der Musik hatte, war es wie ein leidenschaftlicher Kampf entbrannt unter den Wissenden der Musik. Die »Zukunftsmusik« wurde wie eine neue Lehre, fast wie eine neue Religion heilig und hoch gehalten gegen eine Welt von Ungläubigen und anstürmenden Ketzern. Die Offenbarungen des neuen Geistes in der Musik mußten durch alle Kalvarienstationen schreiten, wie nur je die Offenbarungen neuen Geistes in der Wissenschaft oder Religion und deren Meister es mußten. Von den Gegnern der Wagnerschen Musik wurde diese als gefährliche Irrlehre behandelt und die Anhänger des genialen Mannes und er selbst wurden als im tollen Wahn Befangene angesehen, verlacht, verspottet und so gut es ging, niedergeschrien. Heut, in der gegenwärtigen Zeit, wo die Wagnersche Musik ihre strahlende, gewaltige und meisternde Kraft über Deutschland hinaus, in die ganze Welt getragen hat, kommt uns der wilde Kampf dagegen verblendet und kurzsichtig vor. Trotzdem gehörten zu den leidenschaftlichsten Vorkämpfern gegen Wagner sehr gelehrte und geistreiche Männer, wie zum Beispiel Professor Engel, Otto Gumprecht und Hanslik, die bis zu ihrem Tod scharfe Verneiner und Unüberzeugte blieben, sogar als Wagners Triumphzug schon königlich durch die Welt brauste. Sie hielten das für eine ungesunde Episode, für einen fieberwilden Rausch und sahen nicht das Ewige, Immergültige in Form und Inhalt der Musik des großen deutschen Heroen ...
Er hat die schaffenden Geister, ebenso wie die Jünger und Laien, wie die Bekenner und Gläubigen seiner Kunst mit einer hinreißenden Macht beherrscht und wird es voraussichtlich in alle Fernen tun, wie nur die Gottgewalt eines Genies es vermag.
Doch zu meiner Kindheit zurück! Ich war in beiden feindlichen Lagern, hörte die leidenschaftlichen Für und Wider und klärte am Ende daraus und aus dem andächtigen Hören der neuen, kostbaren Klänge, ein eigenes Urteil. Ich habe überhaupt früh gelernt, im Toben von gegensätzlichen Meinungen mir ein ruhiges, unbeeinflußtes Schauen zu bewahren. Das ist mindestens eine kostbare Übung für Geist, Phantasie, Gemüt und Charakter. Der vorhin genannte Doktor Otto Gumprecht, der unüberzeugbare Gegner Wagners, war übrigens für mein gesamtes geistiges Leben eine der bedeutungsvollsten Erscheinungen. Er war blind, und ich habe ihn als vierzehn- bis sechzehnjähriges Mädchen oft in Konzerte, in Opern und auf Spazierwegen begleitet. Er war ein ganz ungewöhnlich geistreicher Mann von der umfassendsten Bildung und schrieb Musikkritiken für die Nationalzeitung. Diese wurden für so stilschön und gedankentief geachtet wie die von Hanslik in Wien. Es hat mich in meinem Kräftebewußtsein wie überhaupt in der Entwicklung meiner Gaben sehr gehoben, daß ich die kleine Freundin des bedeutenden Mannes sein durfte. Ich habe ihm viel später, als er längst tot war, ein Denkmal gesetzt in meinem Dichtungsbuch »Offenbarungen«. Die ihm geweihte Dichtung ist in freien Rhythmen geschrieben und heißt »Der blinde Führer.« Er hat meinen Entwicklungsgang in künstlerischer Beziehung vorausgesehen. Wie oft hat er der Fünfzehnjährigen gesagt: »Alberta, in Ihnen kündet sich mir eine große Dichterin, denn Sie sprechen in so schöner, natürlicher Diktion und mit so dichterischem Schwung, daß Sie gewiß auch schöne Dichtungen schreiben können«. Und er bat so lange, bis ich ihm ein Gedicht schrieb. Ich habe, wie ich eingangs schon sagte, wenig geschrieben in den Jahren schwärmerischer Erstjugend, wie andere gemeiniglich tun, und das wenige, was ich schrieb geheim gehalten und bald vernichtet, denn ich hatte immer eine instinktive Abneigung gegen Halbreifes oder Unvollkommenes. Das Gedicht, welches ich damals auf des Doktor Gumprechts Bitte hin schrieb, erregte bei ihm Entzücken, bei mir Unbefriedigung. Ich habe es längst vernichtet – aber er hat recht behalten: meine innerste Berufung ist die zur Dichtung; – freilich daneben auch zum geschichtlichen, philosophischen und literarischen Essay ... Die »seligen Inseln«, deren gelobtes Land ich immer gewinnen konnte, ließen mich die anbrandenden, häßlichen Wellen von Berlin ertragen. Eine dieser seligen Inseln war auch das Puppentheater im Hause meines Vormundes, des Staatsanwalts Sterling. Wenn wir Sonntags (da waren wir immer zu des Vormunds Familie eingeladen) Ali Baba und die vierzig Räuber oder den Freischütz spielten, kam ich mir wie entrückt aus der bekannten Umwelt vor. In Ali Baba wurde der ganze Schmuck der Frau meines Vormundes blitzend in die papierne Höhle der Räuber gelegt und erregte jedesmal (und o wie oft haben wir das fragwürdige Räuberopus gespielt) das gleiche Entzücken. Und – das Hexenpulver, das wir vom Krämer jedesmal mitbrachten und dessen höchst poesielose Herkunft wir doch kannten, war in der Wolfsschlucht das Überraschendste. Mittler des Grauens, das uns eigentlich mit ganz gemütlichen Schauern durchrann. Vielleicht ist das Puppentheater deshalb so mächtig anziehend für phantasiebegabte Kinder, weil es ihnen einen so offenen Raum zur Betätigung ihrer Gestaltungskraft gibt. Der größte aller dichterisch Begabten, Goethe, hat die Bedeutung und den Einfluß des häuslichen Puppentheaters ja auch für sehr groß gehalten, und seine Kindheit hat auch unter jenem Zauber und Reiz gestanden. – Das Haus meines Vormundes lag in der Neuen Friedrichstraße, damals einer höchst unschönen, engen Straße, dessen Hintere Zimmer auf einen riesigen Hof, den Sammelplatz für mindestens acht Hinterhäuser, hinaussahen. Eingeschlossene, dumpfe Bilder aus dem Hintertreppenwesen von Berliner Häusern (man weiß, was das heißt!) waren nach rückwärts in den Hof hinaus zu schauen, und nüchterne, farblose nach vorn auf die Straße hinaus. Dennoch steht das Haus, das heißt vielmehr die Wohnung meines Vormundes, mit den großen, dämmerigen, mit altmodischem Prunk eingerichteten Räumen im Goldlicht einer unvergeßlichen Poesie. Dies Goldlicht ging freilich wohl mehr von meiner Seele aus, aber jedenfalls waren seine Erwecker, der regsame, verständnisvolle Geist meines Vormundes und – das Puppenspiel. Nur bemaltes Papier, Kleister und Hölzchen, auf denen die Figuren standen, und ein Paar Drähte waren der Rohstoff, aber uns Kindern ward es zur Auferstehung einer Welt ...
Samiel und Max (im Freischütz), obgleich sie nur Bilderbogentypen waren, sehe ich heut noch vor mir, gleichsam als die Darsteller des bösen und tugendhaften Prinzips. Alle Eindrücke im Kinderleben sind wohl deshalb von so ungemein starker und tiefer Prägung, weil die Dinge uns noch meistern und wir nicht die Dinge. Wir sind gewissermaßen umklammert von ihnen, in ihrer meist bezwingenden Umarmung, – aber wir können uns noch nicht betrachtend über sie erheben. So machen uns z. B. die kleineren Leiden des Kindheitslebens viel haltloseren Schmerz, als die großen Leiden der späteren Jahre. Ich erinnere wich einer kleinen Szene, die vielleicht die konzentrierteste und tränenvollste Sehnsucht meines ganzen Lebens darstellt; und doch war es ein so einfacher Vorgang. Wir waren zum Besuch auf dem Lande und wohnten, meine Schwester und ich mit meiner Mama in einem Zimmer, das im ersten Stock lag und in den Garten hinausschaute. Es war Juni, aber doch schon glühender Hochsommer, und das gesellige Leben der »Großen« begann eigentlich erst abends wenn wir Kinder zu Bett gebracht waren. Ich mochte damals sieben bis acht Jahre zählen ... wir wurden eingeschlossen (das war immer ein Schrecken meines in jeder Beziehung auf Freiheit gerichteten Wesens) und in das Fenster wurde ein sogenanntes Fliegenfenster gesetzt; das ließ die Luft in den Schlafraum und wehrte doch dem geflügelten Nachtgetier. Von draußen kamen wundersame Düfte von jungen Rosen und nachtbetautem Laub. Nachtigallen hatten leise Jubeltöne, in denen doch Klage war. Die seinen Stimmen kamen aus den Büschen unter den Fenstern – und plötzlich erklang ein Chorgesang der »Großen«, den die Mitternachtluft wie einen seligen Ruf nach Glück trug ... Leise erhob ich mich vom Lager und lehnte meine heiße Stirn an das Gazefenster. Mein kleines Herz kam wie in einen trunkenen Lebensrhythmus und die Tränen liefen mir am Gesicht herab. Sehnsucht nach Glück, nach Leben, nach Entfaltung alles Knospenden in mir, war in dieser einsamen Nachtstunde, und ich kam mir wie ausgeschlossen und wie in Haft vor, – gegenüber dem freien Bewegen aller Schönheit da draußen. Jene Sehnsucht aber war wie ein großer, großer Schmerz, denn sie befing mich ganz, und ich sah keinen Weg zur Erlösung. Niemals später habe ich eine fassungslosere Sehnsucht empfunden – – selbst nicht in den mächtigen Schauern erster Liebesleidenschaft ... Als einer eigenartigen Poesie meiner Kindheit erinnere ich mich der Postfahrten; die ganze holde Romantik Eichendorffscher Gedichte scheint mir jetzt in der Rückerinnerung in ihnen heimlich zu leben. Ich habe viel später in meinem zweiten Dichtungsbuch (Akkorde und Gesänge 1889) eine Stimmung jener Tage in Verse gefaßt, die Strophen lauten:
»Manchmal ist es mir, das träge Rollen
Ferner Räder hört ich in den Feldern; – –
Und doch ist das Tönen längst verschollen
Tief in den verlorenen Heimatwäldern.
Und verschollen ist das Horngeschmetter,
Das im freien Wanderglück die Lieder
Weithin rief in Licht und dunkle Wetter ...
Hebt sie keiner aus den Tiefen wieder?
Ach mir ist, als trüg der schwere Wagen
Wieder mich durch Städte, die da schlafen,
Und durch fernes Nachtigallenschlagen
In das Schloß, da wir zuerst uns trafen ...
Und als küßten mich die Tannenzweige,
Die von wildem Harz und Würze tropfen ...
Atemlos standst du am Heckensteige,
Und dein Knabenherz vernahm ich klopfen.
Und ich sprang in Jugendhast hernieder – –
Hinter uns entglitt der träge Wagen – –
Aus dem Schloßhof brach ein Duft von Flieder,
Denn es war in frühen Lenzestagen ...
Eine Kinderliebe erblühte da in ihrem rührenden wehen und doch so lachenden Reiz – sommerlang auf dem etwas weltabseits gelegenen Schloß in der Lausitz. Die Gegend war noch von keiner Eisenbahn berührt damals. Nur eine Post ging dorthin. Mitten aus dem Herzen von Berlin fuhr die Post durch kleine Dörfer und schlummerstille Städtchen. Das war nun ganz märchenhaft und von einem starken und neuen Reiz. Morgens um fünf Uhr ging die Post vom großen Posthof, der sogenannten alten Post, in der Königstraße ab. Um vier Uhr mußten wir in der Kochstraße aufbrechen zu dem sehr weiten Weg durch die Stadt. Tags vorher war ein Eckensteher, so hießen damals die Dienstmänner, mit einem Wägelchen aufgeboten, der das Gepäck zur Post brachte. Er begleitete uns im ersten Dämmerlicht. Berlin kam mir wie eine andere, ganz neue Stadt vor in der Totenstille der ersten Frühe. In diesem fahlen gelben Dämmerlicht, bewegungslos wie mit schlafender Seele und schlafendem Leib. Die Tritte hallten in den leeren, leeren Straßen, und es schien mir mehr Grauen in dieser Stille zu sein, als in Mitternachtsstunden. Aber im Posthof begann dann ein reges Morgenleben; Pferdehufe klirrten, Ketten der Ladewagen rasselten, anordnende Stimmen hin und her; – – und endlich saß man dann in der wiegenden, hohen Postkutsche, mit fremden Menschen, die einem aber in der Enge, die mehr als einen halben Tag uns alle vereinte, ganz behaglich nahekamen. Dann ging's lustig mit Peitschenknall und Posthornliedern aus der Stadt hinaus, die nun schon, noch trunken von Schlaf und Traum, die Augen zum Leben aufschlug. Damals war Berlin noch eine Kleinstadt gegen das Berlin von heut; man lebte das Straßenleben ins Haus hinein und das häusliche Leben in die Straße hinaus. Freundnachbarliche Stimmungen und Verbindungen, eine Art Familieninteresse für den Nachbarn war noch lebendig. Das ergab den Geist, den man die Gemütlichkeit der Straße nennen könnte. Sie ist längst in dem ungeheuren Rhythmus des hastigen Verkehrslebens untergegangen, und hat einem rücksichtslosen Vordrängen der einzelnen Person Platz gemacht, welche sich Ellbogenfreiheit schafft für ihre Lebenskampfinteressen. Denn das Leben ist ein viel schärferer Wettbewerb und ein Ringkampf geworden, vorzüglich in allen Weltstädten. Es hat die Beschaulichkeit und Behaglichkeit in ganz ferne, wenige Winkel verbannt. Durch die Lindenstraße, wo sie sich breit zum Belle-Alliance-Platz öffnet, ging die Fahrt durchs Hallesche Tor, das noch ein altes Torgebäude mit »Akzise« war ...
In Klara Viebigs prächtig lebensvollem und plastischem Roman: »Das Eisen im Feuer« steht die Schmiede, in der der junge Geselle wie ein Meister der Kraft und des Feuers waltet, auch in der oberen Lindenstraße. Rückschauend ist es mir, als hörte ich das tatkräftige Hämmern auf den gewaltigen Ambossen und sähe die Funken, wie sie um des Berliner Siegfried Heldengestalt tanzen! Eben dort, wo ich als Kind »des Weges« gefahren. Die breite Lindenstraße hatte für mein Gefühl etwas so Lebensoffenes; sie kam mir wie die Stätte bürgerlicher Dramen vor. Sie führte damals mit der Post hinaus in die weite, weite märkische Ebene. Wie herrlich frei einem das nach den Fesseln der Stadt vorkam! Jedes Feld mit seinem leuchtenden, holden Unkraut von blauen und roten Blumen, jeder schwermütige Kiefernwald, jeder karge Wasserlauf mit seinen schmiegsamen Rohren und seinen Vergißmeinnichtkränzen erregte unser Entzücken. So eine schaukelnde Postfahrt mit den behaglichen Rastorten zur Mahlzeit, die man sich meist mitbrachte, wo es dann für die verschollenen Städtchen ein Ereignis wurde, wenn die »Fremden« ankamen, das war von ganz eigenartigem Reiz. Viel später, als ich Storm und Fontane las, die das Kleinleben der Städtchen so wunderbar beseelt haben, mußte ich an diese Postfahrten durch die schlummerstillen Orte meiner Kindheit denken. »Grete Winde«, diese herbe, prachtvolle Prosadichtung, gibt in der Zeichnung von Angermünde und dessen Bürgerfamilien den Geist dieser Zeiten und Orte wieder. Auch ihre architektonischen und landschaftlichen Linien erstehen in anmutendster Gestalt ...
Wenn ich meiner bilder- und eindrucksreichen Kindheit gedenke, möchte ich auf die Gestalten meiner lieben Mutter und meines einzigen Geschwisters, meiner geliebten Schwester Lucie, etwas näher eingehen. Meine Mutter war eine mehr auf Praktisches, Positives gerichtete Natur, von reinstem, rechtschaffenem Charakter; tapfer und kräftig im Lebenskampf, der für sie oft hart und bitter war, besonders im Vergleich zu ihrer hellen, glückvollen Mädchenzeit. Sie war viel von körperlichen Leiden heimgesucht, und erst nachmals habe ich erkannt, was für ein Aufgebot von Willen und Zielkraft sie machen mußte, um die oft widrigen realen Verhältnisse ihres Lebens zu meistern. Kinder nehmen ja meist als selbstverständliche Gaben Dinge entgegen, die große und ernste Opfer darstellen ... Meine Mutter war eine lebenskluge Frau, aber sie war ohne künstlerischen Schwung, und ohne tieferes Verständnis für Naturen, die »in Schönheit leben«, möchte ich mit einer Variante von Ibsens berühmtem Ausspruch sagen. Alles, was nun an Schwärmerei, brausendem Künstlerempfinden, hochstrebender Geistigkeit in mir war, und weit über die umgebende engbürgerliche Sphäre hinausging und anderseits auch über die engfeudale, in denen beiden ich abwechselnd lebte, wurde mit dem einfachen Schlagwort »überspannt« abgetan. Es lag ein leiser Spott darin, der mir wehe tat und mich einsam machte. Aber es war keine düstere Einsamkeit, denn ein goldener Falter, eine Psyche, ein Seelchen gaukelte darüber. Das war meine sonnige Schwester Lucie. Ja, sie ist wirklich einer der herrlichsten Sonnenstrahlen meiner Kindheit gewesen. Sie hatte den Humor, von dem Heine das schöne Wort sagt: »Die lachende Träne im Wappen«. Sie konnte den holdesten Frohsinn aus allem Erleben lösen, der von Neckgeisterchen manchmal prickelnd begleitet war. Das freilich, die Neckereien entlockten meiner weichen, sehr sensitiven Seele oft Tränen. Ich wurde deshalb scherzend »der Tränenkrug« genannt. Empfindlichkeit ist übrigens allezeit mein Fehler gewesen. Ich selbst fand mein tränenreiches Wesen unschön, und habe es später so energisch bekämpft, daß ich dann oft trockenen Auges litt, während meine Seele nur die Tränen weinte. Aber, ich gestehe, es ist schmerzlicher, als wenn die Augen weinen ... Meine Schwester Lucie, die von hoher Intelligenz ist, hat gern und mit Genuß von allen geistigen Quellen, welche die Hauptstadt Berlin gab, getrunken. Sie hat viel später geheiratet als ich und weilte deshalb viel länger in Berlin. Übrigens hat nachmals ihre (sehr glückliche) Ehe mit Adolf Dominicus, welcher in der Verwaltung von Elsaß-Lothringen die Stellung eines Geheim- und Oberregierungsrats einnahm, viel dazu beigetragen, ihr musikalisches Können und Verständnis stark zu erhöhen. Mein Schwager, ein sehr feiner und liebenswürdiger Mann, war selbst eine bemerkenswerte Künstlernatur. Er war einer der feinsinnigsten Pianisten und Kenner der Musikliteratur. Brahms und Beethoven gehörten für ihn zu den herrlichsten Offenbarungen edelmusikalischen Geistes. Übrigens hatte er auch hohes Verstehen für die leidenschaftlichere und nervösere Richtung von Wagner und Liszt ... Meine Schwester Lucie war also sehr kunstbegeistert für Musik, und das stellte noch ein besonderes Bindeglied zwischen uns dar. Wir hatten beide schöne Stimmen und machten unsre Gesangsstudien zusammen; es sind da in unserm musikalischen Leben durch Kunstgenuß und Studien feste Grundlagen des Könnens und des Verstehens gelegt worden. Die zwei Jahre vor meinem fünfzehnten Jahre, dem Schluß der Schulstudien, bis zu meinem siebzehnten Jahre, das dann meine Verlobung und Hochzeit brachte, sind erfüllt vom regsten Kunstleben. Dazu hat auch der obengenannte »Onkel Karl« mit dem höchst interessanten Treiben, das in seinem Hause war, sehr viel beigetragen. Denn er eröffnete uns nicht nur tiefe, köstliche Ausblicke ins musikalische Kunstleben, sondern auch in das Künstlerleben. Freilich das Künstlerische und Menschliche sind sich selten kongenial ... und ich lernte dadurch sehr früh erkennen, daß bedeutende, höchst ideale Künstler, dabei recht unbedeutende, eitle Menschen sein können. Ich bin dadurch den Schwärmereien, die vom Künstler auf den Menschen in jenem Alter so gern übertragen werden, immer stolz ausgewichen. Ich bin ja später in meinem Leben vielen hochberühmten, auch bedeutenden Künstlern begegnet, und bin vielen freundschaftlich nahe gekommen, – aber es sind nur ganz wenige Ausnahmen, die auch als Menschen ebenso bedeutend waren. Bei den meisten verdarb eine scharfbetonte Eitelkeit, ein Hinausstellen des eignen Ich, gleichsam in den Mittelpunkt und als den Mittelpunkt der Welt, den großen Eindruck ihrer künstlerischen Bedeutung. Meine Schwester hat diese Wahrheit allezeit viel optimistischer angeschaut als ich; vielleicht hat auch die gute Erfahrung, die sie mit ihrer Schwärmerei für Désirée Artôt machte, dazu beigetragen. – – –
Meine Mutter lebte als Witwe in sehr einfachen finanziellen Verhältnissen, aber sie hat in ihrer zarten und fürsorgenden Weise es mit ihren beschränkten Mitteln immer verstanden, uns aller möglichen Bildungsquellen teilhaft zu machen; und ihre fleißige Hand bat uns so zierliche Gewänder genäht und gestickt, daß wir immer so hübsch gekleidet waren wie unsre reicheren Genossinnen. Wir sollten die Armut nie als einen demütigenden Druck empfinden, denn unsere Mutter lehrte uns die beschaulichen und schönen Seiten der Beschränkung. Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit hat sie tief in unsere jungen Seelen gelegt, und die habe ich später, sogar in den Zeiten sehr hohen, äußeren Glanzes, nie verlernt. Sie sind ein goldenster Schatzhort unsres Lebens geblieben ... Ich war eine überaus fleißig, ja ehrgeizig Lernende in der Schule, so daß ich die Studien dort erschöpfend vollendet hatte mit fünfzehn Jahren. Die Schule ist allezeit nur eine Anregung für mich gewesen, denn mein eigentliches Lernen und Studieren begann erst, als ich völlig frei von den geistigen und äußerlichen Schulregeln ward. Mein Leben ist ein rastloses und beglückendes Streben und Erraffen von geistigen Werten gewesen; und daneben ein köstliches Genießen aller Schönheit und aller Reize. Seltsamerweise hat der Meister, der dann mein ganzes intellektuelles Leben, einschließlich aller Kräfte der Phantasie und des Gemüts, geleitet hat: Goethe, verhältnismäßig spät, seine dann allerdings nie rastende Wirkung geübt. Meine freie Jungmädchenzeit vom fünfzehnten bis siebzehnten Jahr, wo ich mich verlobte, war eben sehr kurz und stand ganz unter dem Einfluß englischer Dichter. Bulwer, der meinem Urteil nach, so sehr viel bedeutender, lebensgewaltiger und doch dabei feiner als der über ihn gestellte Scott ist, hatte meine junge Seele ganz in seinem Zauber gefangen. Es ist ja auch wohl möglich, daß das parlamentarische Leben, welches in großartigen Bildern durch alle epischen Dichtungen Bulwers schillert, mir sie besonders anziehend machte. Denn es hat immer in mir, damals natürlich unbewußt, Hinneigung zu parlamentarischem und politischem Leben gelegen. Das ist dann mächtig geweckt worden durch die staatsmännischen Interessen und Betätigungen meines späteren Gemahls. Bulwers Romangestalten in ihrer so durchaus vornehmen Prägung sind in meinem frühsten Mädchenalter wirklich neben mir gegangen. Sie haben mehr Einfluß auf mich gehabt als meine damals gegenwärtigen Genossinnen. Auch Byron hat mich stark beeinflußt, aber mehr dichterisch, als mit Lebensgewalten. Es begann nun mit meiner Verlobung und bald darauf folgender Ehe ein ganz neuer Abschnitt meines Daseins, auch an geistigem Gehalt.
Max von Puttkamer, den ich aus großer Liebe und inniger Schätzung geheiratet habe, wurde eine bedeutende Kraft in meinem Leben, mit stillen Meisterhänden an meiner jungen Seele wirkend. Aber in der wahrhaft grandiosen Bescheidenheit, die ihn auszeichnete, tat er immer so, als ob er nur die Entwicklung meines Innern frei gewähren ließe. Wenn ich ihm sagte, wie gut er es verstände, alles Bedeutsame in mir ins Licht zu heben, daß die Sonne der Liebe und des Verstehens alles Tiefe, Knospenschöne entwickelte, meinte er immer in seiner maßvollen Art: »Ich lasse ja doch nur deine geniale Natur sich entwickeln.« Ich danke ihm sehr, sehr viel – – – Ich war damals achtzehn Jahre und er vierunddreißig. Wir lebten in dem kleinen posenschen Grenzstädtchen Fraustadt; ich skizzierte schon seinen reizlosen landschaftlichen und sozialen Charakter, als ich von Gryphius' Aufenthalt dort erzählte. Alles wies darauf, die Reize im inneren Leben und im Heim zu finden, da sie aus der Umwelt so gar nicht sich entwickeln wollten.
Fraustadt! Das elende, halb noch polnische Nestlein, wie ist es doch von Bedeutung für unser Leben geworden! Denn von hier aus begann der Aufstieg zu der parlamentarischen und staatsmännischen Laufbahn meines Mannes. Hier ward er für den (damals norddeutschen) Reichstag und für den preußischen Landtag gewählt. Er wurde lange Zeit nach seinem Wahlkreis von Puttkamer-Fraustadt genannt. Der Kreis Fraustadt war damals in zwei Lager geteilt, in das deutsche und das polnische. Es standen sich nicht Parteien gegenüber, sondern Nationen, völkische Verschiedenarten. Es wurde eben ein polnischer und ein deutscher Kandidat aufgestellt. Auf den deutschen vereinigten sich alle Parteien; dadurch kam ein stärkerer vaterländischer Zug in das bewegte Wahlbild. Kleinliche Parteinörgeleien wurden vermieden, freilich wurde dafür der Gegensatz der altpolnischen, noch wirksamen Elemente zu den Deutschnationalen vertiefter. Jene, die altpolnischen Interessen, lagen hauptsächlich in den Händen der katholischen Geistlichkeit, die einen gewaltigen Einfluß bei der Bauernschaft und Landbevölkerung hatte. Die katholische Landgeistlichkeit wirkte auch in einer gesellschaftlichen sehr beliebten und anziehenden Form, z. B. auf die Gutsbesitzer. Und zwar durch die sogenannte »polnische Stunde«. Da kam man um die Dämmerung, zur Vesperzeit, bei den katholischen Geistlichen zu einer Flasche herben Ungarweins zusammen. Der schönste, herbe Ungarwein lagert ja bekanntlich in den Großweinhäusern der Provinz Posen. Dort ist noch heute die rührigste Nachfrage, der bedeutendste Verbrauch, und auch wohl das feinste Verständnis für diesen vornehmen, herrlichen Wein. Er erwies sich auch in den kleinen Pfarrhäusern der katholischen Geistlichkeit Posens als starke Anziehung und als feuriges Bindemittel bei den Zusammenkünften, die politisch-parlamentarischen Charakter hatten.
Zwei Jahre nur war es uns vergönnt, ein Leben der Beschaulichkeit, geistiger und seelischer, innigster Gemeinsamkeit zu führen, dann trat mit despotischen Ansprüchen die Politik dazwischen, und sie zog den ausgezeichneten Mann immer herrschender und kraftheischender in ihre Kreise. Ich habe es damals wie einen grausamen Schmerz gefühlt, daß ich ihn hingeben mußte an die große Allgemeinheit des Staatslebens; daß er nicht bestimmt war für die enge, selige Zweisamkeit der Ehe. Ich habe das Gefühl der Entfremdung dann niemals wieder aus mir bannen können. Es war, als ob der Weg, den wir gingen, nun nicht mehr ganz gemeinsam sei ... In jenen ersten beiden Jahren standen wir ganz unter englischen geistigen und kulturellen Einflüssen. Für den Parlamentarismus, der meinen Gemahl besonders lebhaft interessierte, und der in Deutschland (es war vor 1870) noch in seiner Kindheit stand, war ja England vorbildlich. Und damit eng verbunden war die Geschichtschreibung und der Kultus des politischen Essays. Wir lasen Carlyle und Macaulay, und ich erinnere mich, daß sich an Macaulays Studien über die beiden Pitts interessante Unterhaltungen und Disputationen schlossen. Es hat mich damals stolz gemacht und mein Kraftbewußtsein sehr gestärkt, daß ich, noch nicht zwanzigjährig, als gleichberechtigt für derlei Diskussionen anerkannt und überhaupt »sehr ernst« genommen wurde. Dasselbe geschah mir später, als ich, nach der Wahl meines Mannes zu den beiden Parlamenten, mit ihm nach Berlin ging, und dort im Kreise sehr bedeutender Parteigenossen »mitreden« durfte. Mein Mann gehörte der damals mächtigen Partei der Nationalliberalen an, deren Häupter, Bennigsen, Miquel, Laster, Stauffenberg, er sehr nahe stand.
In der kurzen Lebenszeit des Norddeutschen Reichstages (1867-1870), denn dann ward er ja wiedergeboren als »Deutscher Reichstag«, waren wir vom Herbst 1868 an nach Berlin übergesiedelt, weil die politischen Funktionen meines Mannes im Reichstag und Landtag fast das ganze Jahr dauerten. Da habe ich dann, so jung ich war, sehr ernste Einsicht in die Politik, besonders in die damals so bedeutsame Partei der Nationalliberalen gehabt. Sie hatte sich ja 1866 konsolidiert zur Unterstützung Bismarckscher Politik und sich von der Fortschrittspartei getrennt. Durch den Verkehr mit den bedeutenden Führern und immer unter der Leitung und in der Schulung meines Mannes ist meine Anteilnahme und mein Verständnis für politisches Leben und geschichtliche Strömungen begründet und wohl auch mächtig gefördert worden. Es waren interessante Gestalten jene Führer und würdig, eines Bismarcks Stützen und Mitarbeiter zu sein, wie sie es damals waren. Sie sind nun alle längst gestorben – gestorben wie jene Zeit, die so viel Gewaltiges schuf und – zerbrach ... Bennigsen, Miquel, Lasker sind Gestalten gewesen, die sich einem, der sie erkennen und erfassen konnte, zu tiefst einprägten. Besonders Bennigsen und Miquel hatten eine große historische Prägung. Sie haben ja auch nachmals, als Bismarck noch eine Allmachtstellung in der Politik hatte, viel Einfluß im Staatsleben, in hohen Ämtern gehabt ... – Ich habe sie weiter unten, wo speziell von der Bedeutung der nationalliberalen Partei, etwa in den Jahren 1870-80, die Rede ist, eingehend geschildert.
Es war in jener Zeit der geläuterten Flammenkraft Deutschlands nach 1870. Die Funken entlohten den Geistern stark in Worten und Taten, und man wußte nicht, was an diesem Funkenspiel schöner war: die Leichtigkeit oder die Kraft des Sprühens. Der gewaltige Reichsschmied stand an seinem Amboß und ließ die Welt den Hammer seines Willens fühlen.
Bismarck war die Signatur der Zeit – und in allen Geschehnissen und in allen größeren Geistern ist seines Wesens eine Spur zu merken ... Die Ausstrahlungen seiner Geistesart waren zu mächtig und zu hell, als daß sie nicht bis in alle Winkel des Reiches ihre Leuchtkraft wirksam gemacht hatten. Selbst Geister von ganz bestimmter Eigenart zeigten Spuren seines Einflusses. Einige auserlesene staatsmännische Talente, die selbst dem Gewaltigen imponierten, traten mit ihm in rege Wechselwirkung. Und das waren hauptsächlich Mitglieder der nationalliberalen Partei. Sie stand schon dadurch Bismarck nahe, daß sie, wie er, praktische Politik machte, im Gegensatz zu anderen Parteien, die oft etwas starr Doktrinäres zeigten und zu sehr von Theorien sich binden ließen ...
Zu Häupten der Nationalliberalen standen als deren Führer: Rudolf von Bennigsen, Johannes Miquel und Eduard Lasker. Ich kannte sie alle genau. Mein Mann, der als jüngere Kraft in enger Fühlung mit ihnen lebte, war, wie gesagt, vom Kreise Fraustadt (Posen) gegen den polnischen Kandidaten gewählt und vertrat diesen Wahlkreis in beiden Parlamenten, Reichstag und Landtag, von 1867-1881. Max von Puttkamer war von Anbeginn an in der nationalliberalen Partei und stand deren Führern besonders nahe. Er war an Jahren der jüngste. Bennigsen und Lasker waren sieben Jahre, Miquel vier Jahre älter als er.
Wir aßen, da wir zuerst kein festes Heim hatten, sehr oft gemeinsam zu Mittag in einem Restaurant Unter den Linden, das nicht mehr existiert, und dessen Namen mir leider entfallen ist. Diese Mahlzeiten zu fünfen (Miquel, Lasker, Bennigsen, Puttkamer und ich) hatten einen ganz merkwürdig intimen geistigen Reiz. Es wurden meist aktuelle politische Fragen behandelt, die mit den zeitweiligen Abstimmungen und Beratungen in dem betreffenden Parlament in Zusammenhang standen. Und ich lebte so ganz in dem politischen Interessenkreis meines Mannes, daß ich von den Herren als berechtigte Stimme in ihrem Chorus behandelt wurde. Es hat mich damals sehr stolz gemacht, denn wenn ich auch in richtiger Bescheidenheit erkannte, daß die Ritterlichkeit einen großen Teil an dem liebenswürdigen, schmeichelhaften Urteil hatte, so fühlte ich doch auch, daß die ernste Richtung meines Geistes und meine politische »Divinationsgabe« (wie sie es nannten)hoch gewertet wurden ... Standen jene Männer damals, den Jahren nach, in der Blütekraft ihres geistigen Wesens, so stand ich nur erst im Vorlenz, und ich fühlte mich in eine reifere, feinere Sphäre gehoben durch die Schätzung jener Edlen. So verschieden diese Herren nun auch an Geistes- und Charakterart waren, so hatten sie doch zwei Dinge gemeinsam: die juristische und die englisch-parlamentarische Schulung. Bennigsen, Lasker, Miquel und Puttkamer waren beruflich Juristen. Miquel, der 1851 als Rechtsanwalt in Göttingen begann, zweigte dann in verschiedene Berufe ab. 1865 trat er in kommunalen Dienst als Oberbürgermeister von Osnabrück. Dann trat er 1870 ins praktische Finanzwesen und ward Direktor der Discontogesellschaft in Berlin bis 1876. Dann wieder 1876-90 im städtischen Dienst wirksam in Osnabrück und Frankfurt am Main, bis er 1890 zum preußischen Finanzminister ernannt wurde.
Bennigsen, der auch seine Laufbahn als Richter und Staatsanwalt begonnen hatte, war damals (nach 1870 zur Zeit unserer intimen Bekanntschaft) Landesdirektor von Hannover.
Lasker, der als Rechtsanwalt anfing, war Syndikus des Pfandbriefamtes in Berlin.
Sehr charakteristisch für Bennigsen war der Grund seines Ausscheidens aus der juristischen Laufbahn; man hatte ihm den Urlaub für das Abgeordnetenhaus verweigert! ... Das politisch Berufliche stand ihm eben viel höher als das bürgerlich Berufliche ... Die beiden Hannoveraner, Miquel und Bennigsen, hatten, schon lange vor der Schöpfung des Deutschen Reiches, ihre Meinung mit besonderer Berücksichtigung Preußens ausgesprochen. Sie waren schon 1859 mit dem Entwurf einer Erklärung aufgetreten: des Bedürfnisses eines deutschen Parlaments unter Preußens Führung. Es wurde dann auch der deutsche Nationalverein in Frankfurt gegründet, an dessen Spitze Bennigsen trat und kraftvoll wirkte.
Eduard Lasker war mir besonders lieb. Der »kleine Jude«, wie ihn Bismarck nannte, war in der äußeren Erscheinung und im Gebahren der Unansehnlichste. Er sprach im hebräischen Tonfall, so habe ich es immer genannt, im scharf abgegrenzten Daktylus (
![]() ). Das tat seinen Parlamentsreden, die an Gedankengehalt, scharfer Dialektik und Stil ganz mustergültig waren, doch einigen Abbruch. Wohl war Lasker auch bedeutend in der aufbauenden Rede, aber viel größer war er in der Replik. Er spitzte die Gegengründe wie glänzende Pfeile und schoß wirkungsvoll scharf gegen seine Ziele. Lasker war von den drei Häuptern der Nationalliberalen der am meisten theoretische Politiker, während die andern in den praktischen Erfolgen der Staatskunst deren echteste Lebenswerte erkannten. Eduard Lasker war unverheiratet und war im Verkehr mit Frauen etwas unbeholfen. Man merkte ihm an, daß sein ganzes Leben in ernstester geistiger Arbeit, in Studien und in der Betätigung höherer Staatskunst sich vollzog. Er hielt sein Gefühlsleben stolz verschlossen; ich glaubte aber aus einigen Gesprächen (er war mit mir beredt und bis zu einem gewissen Grade vertraut) entnehmen zu können, daß er Idealist und tiefgefühlvoll war ... Die von Auerbach herausgegebenen »Erlebnisse einer Mannesseele«, die übrigens bald von
Lasker selbst aus dem
Buchhandel zurückgezogen wurden, lassen das auch erkennen ...
). Das tat seinen Parlamentsreden, die an Gedankengehalt, scharfer Dialektik und Stil ganz mustergültig waren, doch einigen Abbruch. Wohl war Lasker auch bedeutend in der aufbauenden Rede, aber viel größer war er in der Replik. Er spitzte die Gegengründe wie glänzende Pfeile und schoß wirkungsvoll scharf gegen seine Ziele. Lasker war von den drei Häuptern der Nationalliberalen der am meisten theoretische Politiker, während die andern in den praktischen Erfolgen der Staatskunst deren echteste Lebenswerte erkannten. Eduard Lasker war unverheiratet und war im Verkehr mit Frauen etwas unbeholfen. Man merkte ihm an, daß sein ganzes Leben in ernstester geistiger Arbeit, in Studien und in der Betätigung höherer Staatskunst sich vollzog. Er hielt sein Gefühlsleben stolz verschlossen; ich glaubte aber aus einigen Gesprächen (er war mit mir beredt und bis zu einem gewissen Grade vertraut) entnehmen zu können, daß er Idealist und tiefgefühlvoll war ... Die von Auerbach herausgegebenen »Erlebnisse einer Mannesseele«, die übrigens bald von
Lasker selbst aus dem
Buchhandel zurückgezogen wurden, lassen das auch erkennen ...
Er war von lauterstem Charakter, gänzlich intakt von dem damals in Berlin üppig wuchernden Gründerschwindel, und seine Reden gegen die Politik des preußischen Ministers von Itzenplitz waren doch von solch wirksamer Kraft, daß die Einsetzung einer Kommission die Folge war; sie bewirkte den Zusammenbruch des Gründerschwindels. Die nationalliberale Partei hatte bisher in reger Wechselwirkung mit Bismarck rührig geschaffen. Sie war seine bedeutende Stütze (Septennat, Idemnität für die ohne Staatshaushaltsgesetz geführte Verwaltung, Kampf gegen das Zentrum, der sogenannte »Kulturkampf«, und überhaupt für eine großdeutsche Politik). Doch trat sie 1879 in Gegensatz zu ihm, veranlaßt durch die neue Zoll- und Wirtschaftspolitik des Reichskanzlers. Lasker wandte sich am entschiedensten ab. Es kam nun, wie bekannt, zum offenen Kampf zwischen Bismarck und der nationalliberalen Partei, und immer waren des Kanzlers schärfste Kampfwaffen hauptsächlich mit ihren Spitzen gegen Lasker gerichtet. Als dann noch Mißverständnisse und Spaltungen in der eigenen Partei kamen, zog sich der »große Kleine«, fast als sei er persönlich verwundet, aus dem parlamentarischen Leben zurück. Die weniger radikalen, mehr politisch-praktischen Politiker lösten sich von Lasker als Sezession. Lasker fühlte sich seelisch und körperlich tief erschöpft ... Wohl um neue, frische Eindrücke auf sich wirken zu lassen, ging er nach – Amerika, nach New York, im Jahre 1883. Als er 1884 nach Europa heimkehren wollte, ereilte ihn ein Herzschlag ... Er starb, ein Einsamer, mit dem großen, ungestillten Heimweh in der Seele nach der Erfüllung seiner Ideale ...
Merkwürdig, wenn ich an den kleinen Mann mit den hellen, scharfsichtigen Augen, die aber manchmal verträumt blicken konnten, und seiner raschen, frischen, geistreichen Rede denke, erfaßt es mich immer wie ein großes Mitleid, ein tragisches Erschüttern ... Er ist ja auch der einzige von den vieren gewesen, der nur Negatives von all seinem Streben, idealen Wollen und Wirken als Endergebnis hatte. Wohl ist auch in dem Leben der anderen drei viel Kampf, viel Enttäuschung und ein trüber Ausklang gewesen, aber sie hatten auch Positives geerntet: Erfolge, äußere Ehren, Siege ...
Bennigsen hat mich immer mehr als eine kühle Größe angemutet. Sehr vertrauenerweckend, sehr sicher, sehr eindrucksvoll – überzeugend in seinen Gründen und durch seinen Wert – aber etwas trocken und durchaus nicht hinreißend. Er war der geborene Vertrauensmann, und es erscheint einem natürlich, fast selbstverständlich, daß er 1870 ins Hauptquartier nach Versailles berufen ward zu den Beratungen der Vertreter der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund.
Bismarck maß Bennigsen eine hohe Bedeutung zu, die er ja auch nach jeder Richtung hin hatte; denn er war nicht nur ein starker und wohlgeschulter Geist von politischem Weitblick, eine hohe staatsmännische Begabung, sondern er war auch durch Charakter und Erscheinung imponierend, das Ideal eines liberalen Edelmannes!
Als der Reichskanzler 1877-78 mit ihm Verhandlungen pflog wegen Eintritts in das Ministerium, scheiterten sie nur daran, daß Bennigsen einige Mitglieder seiner Partei mitberufen sehen wollte, die Bismarck nicht paßten ... Bennigsens lauterem, festen Charakter stand das Sachliche aber viel höher als jeder persönliche Vorteil, jede individuelle Ehrung. Er hatte in seinem Wesen etwas Patriarchalisches und behandelte z. B. auch mich etwas wohlwollend väterlich, während Miquel und Lasker einen Ton schöner, eigenartiger Kameradschaftlichkeit fanden, mit einer feinen Schattierung ritterlicher Verehrung. Der Temperamentvollste und darum unmittelbar Wirksamste aus dem kleinen Kreise war ohne Zweifel Miquel.
Wenn Bennigsen hauptsächlich mit staatsmännischer Überlegenheit und Überzeugungskraft sprach, Lasker mit glänzender Dialektik und scharfen Beweisgründen, so wirkte Miquel durch das Feuer seiner Rede, durch den Gedankenschwung, der mit seiner Flügelkraft emporhob und hinriß ... Daß die drei, ebenso wie mein Mann, sich an den Vorbildern von englischem Parlamentsleben und englischer Staatskunst geschult hatten, war ersichtlich. Besonders nahe schien ihrem politischen Geist die Gestalt des genialen Whigbarons, des jüngeren William Pitt, zu stehen.
Vorzüglich Miquel erinnerte in der fortreißenden Kraft seiner Rede an Pitts glänzende Wirkungen, die er ebenso im Parlament als auf den König und das Volk hatte ...
Wenn Miquel, der nur mittelgroß war, im Reichstag redete, wenn sein edelgeschnittener Kopf sich mit einer stolzen Geste hob und seine Augen, die dunkel leuchteten, Blitze zu flammen schienen, dann war's, als wüchse er einem vor den Augen. Dann hatte seine Haltung etwas Gebietendes, schön Diktatorisches ... Mit seinem Geist zwang er die gebildeten Massen in seinen Bann, mit seinem Temperament hätte er die Volksmassen hinreißen können ... Wie ich schon oben sagte: die Männer aus dem kleinen Kreise sind, außer Lasker, alle auch zu hohen äußeren Ehren gelangt. Bennigsen war Oberpräsident (und hätte Minister sein können), Miquel war Minister und Max von Puttkamer Staatssekretär im Reichsland Elsaß-Lothringen.
Sie sind nun alle vier dahingegangen und haben ein mit geistigem Inhalt, edler und erfolgreicher Hingabe an politische Ziele erfülltes Leben geschlossen. Lasker, mit dem tragischen Ausklang politischer Enttäuschungen, Miquel und Puttkamer mit der wehen Note, die ein jähes, unerwartetes Ende ihrer Laufbahn gab, und Bennigsen in Gelassenheit und philosophischem Bescheiden ...
Es war damals die große Zeit der nationalliberalen Partei, die auch einen Braun (-Wiesbaden), Freiherrn von Stauffenberg, Marquardsen und noch viele andere bedeutende Männer umschloß. Das brachte auch die Volksmeinung in den Wahlen zum Ausdruck, denn die Partei war aus den Wahlen 1874-76 mit 155 Mitgliedern hervorgegangen. Sie wirkte damals parlamentarisch-politisch weniger in Negationen und Opposition, sondern mehr positiv und affirmativ in praktischer Betätigung. Und in dieser Bejahung zum Leben lag etwas sehr Junges und Kräftiges. – Für die Schulung meines Geistes und die Richtung meines gesamten seelischen Lebens sind jene Jahre sehr fruchtbringend gewesen. Wir lasen auch viel Bulwer und Byron, und allgemach begann in diese englische Geistessphäre: Carlyle, Macauly, Bulwer, Byron, ein hoher deutscher Genius hineinzublicken. Er gewann mit den Jahren dann immer größere Gewalt über mich: Goethe! Es war mir eine Entrückung vom Nationalen zum Allgemeinmenschlichen, die wahrlich nicht der Größe entbehrte ... Indessen war in der preußischen Geschichte die Gestalt Bismarcks immer ragender geworden, bis er zu der reckenhaften, ja riesenhaften Größe wuchs, die er nach dem Deutsch-Französischen Krieg und der Schöpfung des Deutschen Reiches erlangte. Die nationalliberale Partei war ja damals seine Stütze, wie schon gesagt, wenn er auch in persönlicher, oft sehr scharfer Fehde mit dem »kleinen«, geistreichen, aber sehr negierenden Lasker stand.

Alberta von Puttkamer
Jugendbild
Und dann kam das sieghafte, wundervolle Morgenrot für die deutsche Geschichte! In seinem Lichte hob sich die adlige Schönheit deutschen Wesens und deutscher Kraft voll hervor. Sie wurden von diesem Morgenrot wahrhaft ins rechte Licht gestellt: diese Helden, diese bescheidenen Großen, diese machtvoll aufstrebende Kultur! Und wie damals die besten Elemente aus der deutschen Seele zum Licht gehoben wurden, so heut durch das Teuflische unserer Feinde und der Verhältnisse: die schlechteren Elemente ...!
Den Einzug unserer siegreichen Truppen in Berlin im Sommer 1871 sah ich dort, und zwar im Hause des bekannten Abgeordneten Braun-Wiesbaden. Er hatte eine Häuslichkeit, die in großem Stil der Gastfreundschaft geöffnet war, und die nicht nur ihren Reiz seiner charakter- und eindrucksvollen Persönlichkeit, die dabei von sonnigstem Humor durchstrahlt war, verdankte, sondern auch den Frauen seines Hauses. Seine Frau, eine bewegliche, zierliche, glutäugige Kreolin, hatte sich in die deutschen, auch speziell politischen Verhältnisse ganz eingelebt. Sie war hochintelligent und lebhaft, so daß es wie frischer, reger Sommerhauch von ihr ausging. Seine eine Tochter war eine eigentümliche Erscheinung, von einem fremdartigen Reiz. Sie hatte etwas Wildes, Sprunghaftes, schmeichelnd Schmiegsames in ihrem Wesen, etwa wie ein edles Panterkätzchen. Braun nannte sie scherzend einen »avitischen Rückfall«. Mit ihren glühend dunklen Augen, der Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen und der bräunlichen Haut stellte sie einen schönen Typus einer – Halbwilden vor, gezähmt von europäischer Kultur. Die ältere Tochter Guste war schöner und rosig, aber sie hatte nicht den exotischen Reiz von Aletta. Diese beiden Mädchen und die Mutter waren eine prachtvolle Illustration des Hauses. Da Braun auch finanziell sehr glänzend gestellt war (er hatte als Rechtsanwalt in Wiesbaden fürstliche Einnahmen gehabt), konnte die bunteste, kostbarste Lebenslust dort ein siegendes Szepter führen. Die Geselligkeit war auch von einer Frische, dabei geistigen Belebtheit und in so reizenden Formen, daß sie gar nicht anziehender gedacht werden kann. Dort bin ich auch Hans Hopfen begegnet, der damals hoch in Mode war; merkwürdigerweise mit seinen, meiner Ansicht nach, weniger starken Leistungen, den Romanen. Als Lyriker war er dagegen groß, und ein Band seiner Lyrik scheint mir fast alle Bände seiner Romanschöpfungen aufzuwiegen. Aber das ist erst viel später, und nur von feineren Literaturkennern gewürdigt worden ...
Nie vergesse ich jenen Tag des siegreichen Einzuges der Truppen. Es war ein brausender Aufschwung in der damaligen Zeit. Es rauschte und strömte gleichsam von tausend Quellen aufgewachter Kraft. Mir mit meiner empfänglichen Phantasie und meinem regsamen Geist war es, als ob ich Adlerfittiche rauschen hörte in den Sommerwolken, die am blauen Himmel gingen. Und als drunten in der breiten Straße (Königgrätzer Straße) die jauchzenden Soldaten vorbeizogen, die Sonne in ihren Helmspitzen funkelte und mächtige Marschmelodien sie wie mit Flügeln trugen, da war das alles wie eine glorreiche Allegorie, umtönt von Hymnen höherer Heerscharen. Das war inkarnierte Geschichte, was da unten vorbeizog mit Jugendschritten, und die ganze Welt war damals so jung, so neugeboren im Heldentum, so verklärt von frohem Stolz, daß es eine »Lust war zu leben«. Und es blieb auch eine Lust zu leben, – denn in alle Kreise des Wissens, Könnens, Erkennens, Handelns und Denkens kam dieser starke Aufschwung. Die deutsche Kraft, der deutsche Geist, sie fühlten sich zu Gipfeln gehoben. Es ward nun ein so rühriges Schaffen im neuen Reich, eine solche Einigkeit des Strebens, daß wir schnell aus einer Großmacht zur Weltmacht wuchsen. Diese wundervolle Erscheinung in der Menschheitsgeschichte: das Anwachsen der Kräfte eines starken Volkes zu seinem Höchstkönnen, ließ aber auch Gegengewalten aufstehen, die heimlich, doch in bewußter Bosheit, einen Neidhaß gegen den großen Sieger nährten, – der – – in der gegenwärtigen Zeit zu dem fürchterlichsten Weltgeschehen sich gestaltet hat. Ein Neidhaß, der so »rot« sieht, daß er nur Verzerrung der Wahrheit, Entstellung der Tatsachen, Totschlag und Vernichtung bewirkt. Er hatte ein Chaos heraufbeschworen, wogegen das Ringen, die blutigen Ereignisse von 1870 nur wie starke, fast spielend geleitete Kraftübungen erscheinen. Und dennoch waren sie gewaltig genug ...
Ja! sie waren gewaltig! – gewaltig wie die Zeit und ihre Kraft. Denn es waren nicht nur die führenden und schöpferischen Geister gewaltig, – wie Bismarck, Moltke, Roon und viele Generäle, Politiker und Minister, sondern es war überhaupt im Volksgeist und im Geist der »Intellektuellen« alles, was an verborgener Kraft in ihnen lebte, zu einer Hochblüte gewachsen. Was nur irgend Blühenswertes im Grund des Wesens lag, strebte empor. Wie der Sommer aus dem Kelchgrund der Natur alle schönen Entwicklungsmöglichkeiten emporhebt, so auch die fruchtbare Glut der Zeit damals ... Es war wie der köstlichste, weckende Hochsommer der Geschichte für die Deutschen. Mut und Liebe zum Leben beseelten alle. Eine starke Bejahung klang sieghaft im Rhythmus der Neugestaltung Deutschlands.
Elsaß-Lothringen war unter anderem der Kriegsgewinn des Deutschen Reiches ... Im Frühjahr 1871 waren die deutschen Regimenter in ihre Standorte im Reichsland eingezogen, und im Oktober desselben Jahres zog die deutsche Zollverwaltung ein. Mit ihr kamen wir, mein Mann und ich, auch dorthin. Und zwar in die offene Landstadt (früher Reichsstadt) Kolmar. Der Sitz des Oberlandesgerichts war dort (der frühere Cour d'appel). Mein Mann wurde zu einem seiner Räte ernannt; er war kaum vierzig Jahre damals, und ich ganz Anfang der Zwanzig. – Wie seltsam diese Stadt war, als wir einzogen! Stumme Hauser, geschlossene Läden (gewöhnlich nur zwei Fenster nach der rückwärtigen Gartenseite geöffnet), mißtrauische Gesichter, auch offene Kampfmienen! Als ob der Feind beobachtend hinter allen Mauern wartete. Und doch, und doch! Das versteckte, böse Wesen, die drohenden Feindseligkeiten, die aber geduckt waren vor der deutschen Militär- und Zivilmacht, das alles war nicht fähig, den köstlichen Schwung herabzudämmen, den unser lebensstolzes Wesen und unsere tatbereite Kraft immer flugbereit hielten.
Kolmar lagert freundlich zu den Füßen der Vogesen, das heißt, eine weite, etwas wehmütig und eintönig gestimmte, fruchtbare Ebene liegt zwischen den Vogesen und den ersten Mauern und Türmen der Stadt. Die Vogesen wirken mehr wie ein ferner, reicher Kranz, mit zarten und mit wilden Linien, mit dunkeln Hochwäldern und blumenvollen Auen und mit üppigem Weinland und güldenen Feldern. Aber die Ebene ist auch begnadet mit reichem Boden und mit Gärten voll kostbarer Früchte und Blumen.
Ich bin im ganzen dreißig Jahre im Elsaß gewesen, und ich kann wohl sagen, daß ich das Land bis in den Herzgrund erkannt habe. Ich war ja auch später in einer einflußreichen Stellung dort: in Straßburg als Gattin des leitenden Ministers, Staatssekretärs in Elsaß-Lothringen. Da hatte ich Einsicht in das gesamte Leben des Landes und seine alt- und neuelsässische, alt- und neudeutsche Bevölkerung. Da sind mir die Politik, die sozialen Verhältnisse, die Kultur, die Kunst und die Gesellschaft vertraut bekannt geworden; – und wie sie auf mich Einfluß übte, so soll auch ich bedeutenden Einfluß auf sie gehabt haben. Doch zu den ersten Jahren in Kolmar zurück!
Das war nun wirklich ein Jugendaufschäumen, ein harmlos frohsinniges Genießen des Neuen, Großen, meist Anziehenden, oft auch ein ernstes Betrachten von finster Bedrohlichem in dem Neulande. Für uns Norddeutsche besonders war hier eine wahrhaft neue Welt aufgetan. Wir waren so jung, so jung, so glücklich und mutig damals, wir hätten die ganze Welt umarmen mögen; – ich glaube, den finstern, negierenden Altelsässern, die in ihrer Geburtsheimat geblieben und nicht nach Frankreich ausgewandert waren, war auch dieser stolzfreudige Zug in den »fremden Eroberern« nicht unsympathisch.
Es war so viel Ritterlichkeit, so viel starkes Können und Vollbringen, so viel edelmännisches Wesen, so viel feine Bildung in diesen Männern – – und sehr viel Schönheit, Geist, Anmut und Liebreiz unter den Frauen zu finden ...
Und, die Elsässer gestanden es später: sie hatten sich die Deutschen als plump, ungewandt, doktrinär, steif, – und die Frauen langsam an Geist und Bewegung, – unschön von Gestalt und ungeschickt in der Gewandung vorgestellt. Und sahen uns nun so ganz anders in der Erscheinung als in ihrer Vorstellung.
Damals haben wir wohl auch ein wenig das Land erobert ... Etwas wie süße Trunkenheit, die junger Wein gibt, war in jenen ersten Jahren im Elsaß. Wir lebten noch in dem großen patriotischen Rausch von 1870!
Nicht in einem Rausch, der erschlafft und müde Zustande im Gefolge hat (man nennt das studentisch so wenig schön »Katzenjammer«), sondern in einem, der erhöhte Lebenslinien schafft, der sieghaft über den Alltag hinwegträgt.
So gewannen die Menschen und alles Erleben damals etwas Festliches. Und wenn die Männer auch ernst ihren Beruf übten, sogar mit dem eindrucksvollen Willen, in den neuen Verhältnissen nun auch Vorbildliches schaffen zu wollen (was sie auch taten), und wir Frauen den Elsässern eine schöne Darstellung des Begriffs: deutsche Frau gaben, so legten wir doch alle noch etwas Fröhlich-Feierliches in diese Elsässer Jahre. In jene Zeit fällt übrigens eine wundervolle Freundschaft, die später bei unserer fortschreitenden dichterischen Entwicklung auch eine literarische Freundschaft wurde: die innigen Geistes- und Herzensbeziehungen zwischen Prinz Emil Carolath und mir. Carolath war damals im 14. Kurmärkischen Dragonerregiment, dessen Standort Kolmar war, Fahnenjunker und Leutnant. Er war ein Jüngling, wenige Jahre jünger als ich, – noch mit dem ganzen schäumenden Gären einer kraftvoll drängenden Natur; ungeläutert, oft wild, oft maßlos, aber schon in dem schillernden Reichtum eines großen Talents glänzend. Seine Kameraden hatten weniger Verständnis und auch Schätzung für seine geistigen Vorzüge als für seine äußeren: Namen, Vermögen, Beziehungen. Kaum volljährig, hatte er das große Vermögen seines früh gestorbenen Vaters geerbt, und er war nun in jenen ersten Freiheitsjahren auch ein wenig Verschwender. Nie im Unschönen, im Unmäßigen, im Banalen, sondern ich möchte es nennen: ein Schwelger im Schönen, im Romantischen, in der süßen Lebenspoesie. In einer meiner Dichtungen ist die Stimmung jener Elsaßtage gezeichnet; ich glaube mit glücklichen und erschöpfenden Worten: »Wir hätten uns mit Sternen mögen kränzen« – Gedenke ich jener schwärmerischen Tage mit Carolath, wenn wir Ausflüge in die Vogesen machten (ich fuhr im leichten Wagen, und er ritt auf seinem feurigen Schimmel), so ist es mir, als wären wir in lauter Rosenduft und Rosen gewandelt. St. Gilgen hieß ein Ort, nahe dem alten Reichsstädtchen Türkheim, hart an den Vogesenfüßen, – dort waren weite Auen und Felder und ein laubverhangener Platz an einem alten Brunnen. Da lagerten wir im blumigen Rasen und lasen einander unsre ersten Strophen vor. Die Welt nannte unsere Beziehungen mit ihrer oberflächlichen Alltäglichkeit: »Der Prinz macht der schönen Frau den Hof« – aber es war ja ganz, ganz anders ... Wer möchte es messen und ermessen in einem großen Empfinden, aus welchen Urelementen es gebildet ist!? Es ist eben da, und es war schön und rein, und – so – ungesellschaftlich wie möglich. Nur schön-menschlich, schön-künstlerisch. Damals ist auch das kleine Lied an mich entstanden, das er aber nicht veröffentlicht hat. Es spiegelt die ganze Überschwenglichkeit seiner Empfindungen wider und ist leidenschaftlich bewegt. Hier sind die Strophen:
»Du bist die Sphynx mit wundervollen Augen,
In denen Fragen und Erlösung sind,
Ein Lächeln von Gewähren und Entsagen
Steht um den Mund, so strenge und doch lind, –
Du schönes Rätsel, das hienieden keiner,
Der je in Sehnsucht ihm genaht, vergißt,
Und keiner doch errät, weil er inmitten,
Des Sinnens schon vor Lieb' gestorben ist« ...
Damals haben wir auch zum erstenmal erkannt, daß die Richtlinien unsres Höhenweges die gleichen würden: sie gingen zum Parnaß. Die Linien unsres äußeren Lebens gingen ja bald auseinander, aber sie fanden sich immer wieder, oft nach jahrelangen Umwegen und Abschweifen. Prinz Carolath machte eine Weltreise, die ihn lange von Deutschland, ja von Europa fernhielt, dann ging er auf seine jütländischen Besitzungen. In den Jahren bis zu seiner Ehe hatte er etwas von dem kosmopolitisch-romantischen Wesen eines Lord Byron. Er war ein wilder Kavalier, leidenschaftlich aller Kunst, aller Schönheit und den Frauen ergeben.
Hier möchte ich auch Worte des Dankes, der Schätzung und der Erinnerung für einen Mann einflechten, der meinen und Carolaths ersten dichterischen Schritten eine führende Hand bot. Es ist Maximilian Bern. Er ist eine ganz besonders feinsinnige Erkennernatur für aufstrebende junge Talente. Selbst dichterisch begabt (er ist der Verfasser sehr zarter Novellen, die psychologisch Bedeutendes geben, die Umwelt seiner Helden prachtvoll schildern, und von feinem Kolorit und vornehmen Umrissen sind), trat er auch sehr wirkungsvoll als Mittler fremder Poesien und Poeten auf ...
Mein Freund, der Dichter Prinz Emil Schönaich-Carolath, und ich, wir können als von Bern in die Literatur Eingeführte betrachtet werden. In selbstloser und lebhaft feuriger Weise ist er für unsere ersten Schöpfungen eingetreten. Carolath bewahrte ihm bei Lebzeiten eine große Dankbarkeit dafür, wie auch ich es in aufrichtig warmer Weise immer tat und tun werde. –
Zwei Liliputbändchen, in denen Dichtungen von Carolath und die »Lieder an einen fahrenden Ritter« von mir zuerst erschienen, haben damals, besonders in Berliner literarischen Kreisen, Aufsehen gemacht. – Bern hat übrigens auch mit sehr wählerischer und sinniger Hand Anthologien zusammengestellt. Unter anderem »Deutsche Lyrik seit Goethes Tode«, welche zu den besten und umfassendsten Sammlungen lauterer Poesie gehört.
Leider haben die Lebensverhältnisse, die mich ganz im Südwesten Deutschlands hielten, mich weit ab von Bern geführt, der, eigentlich ein Deutschrusse, zuerst in Österreich, dann viele Jahre in Berlin seine geistige Heimat fand. Er hätte meinem regen und begeisterten Schaffen gewiß viel neue Anregung und seine Wertung gegeben, so wie ich allezeit Verstehen und Sympathie für seine Psyche ihm entgegengebracht habe und hatte. In meinen Lebenserinnerungen möchte ich ihm mit diesen Worten einen warmen, festen Platz geben ...
Carolaths erste Versbücher »Lieder an eine Verlorene«, »Angelina«, »Don Juans Erlösung«, die Novelle »Tauwasser« sind von einer oft stark hinreißenden Lyrik, in welcher Leidenschaft und Jugend als starke Pulse sich regen. Er hatte indessen längst seinen Abschied als Offizier genommen (er war zuletzt Garde-Dragoner gewesen) und lebte vor allem seiner Dichtkunst. Gewiß, seine Poesien wurden maßvoller, aber sie wurden auch gedämpfter; keine schöne Überschwenglichkeit mehr, keine holde Hingerissenheit über alle Grenzen. Allgemach trat ein gewisser zahmer, frommer Zug in seine dichterischen Schöpfungen – übrigens auch in sein bürgerliches Leben. Der Carolath, den ich 1872 in Kolmar kannte, den ich 1877 in Nizza und Villefranche sah, und den ich 1886 in Homburg (verheiratet, glücklich verheiratet und Vater mehrerer Kinder) wiedersah, sie sind wie drei verschiedene Menschen ... 1872 der überschwengliche Jüngling, der nach romantischen Idealen griff in leidenschaftlicher Hast, 1877 der junge Mann, der den geistreichen, heißblütigen Kavalier mit der feinen Dichternatur so glücklich vereinte, – und 1896 der reife Mann, der soviel tugendhafter als der manchmal unbändige Dichterjüngling und doch soviel weniger interessant war, der christlich ernste Familienvater, dessen Kunstschöpfungen nun auch die fromme Prägung seines Lebens trugen ... 1908 ist er gestorben nach qualvollen Leiden im kräftigen Mannesalter von fünfundfünfzig Jahren, als ein Frühgealterter. Sein Leben ist in Familienglück an der Seite einer lieblichen, lieben Frau friedlich schön ausgeklungen; – – – aber – die ersten angeschlagenen Akkorde seiner frühesten und mittleren Schaffens-Periode haben doch nicht den mächtigen Ausklang gefunden, den sie verhießen ... In meinem Erinnern steht er in dem unverwelklichen Rosengarten einer wundervollen lyrischen Freundschaft, die weniger als Liebe und dennoch viel, viel mehr war ... – Ich bin in meinem Leben vielen Künstlern begegnet und nahegetreten, aber selten war deren Menschen- und Künstlertum gleichwertig; der Unterschied zwischen beiden war oft verletzend groß. Bei Carolath stand beides auf der Höhe. Die große Liebe (die jeder echte Künstler haben muß), die sich in seinen Jünglings- und frühen Mannesjahren in schön- und feinsinnlicher Weise äußerte als Leidenschaft für alles Lebensschöne: Frauen, Kunst und Natur, hatte sich, wie ich schon andeutete, gemodelt in eine allgemeine Menschenliebe, mit stark kirchlich-religiösem Einschlag. Er fühlte dann nicht nur die Neigung, sondern auch die Pflicht, alle Menschen zu lieben, sie zu beglücken, ihnen mitzuteilen von seinen irdischen Glücksgütern. Er hatte eine prachtvolle, großherzige Freigebigkeit, besonders für Künstler, die im Kampf mit der Not des Lebens standen oder – sich ihm so darstellten. Viele Dichter aus jener Zeit hat er so aus der Häßlichkeit des Alltags emporgehoben. Zwei, die längst tot sind und von äußerst verschiedener Begabung und Bedeutung waren, sind mir da besonders erinnerlich, – auch, weil ich ihnen in ähnlicher Weise dienen durfte, als Carolath es in größerem Maßstabe tat. Das waren Elise Polko und Detlev von Liliencron ... Beide hatten, wie grundaus verschieden sie auch waren, das gemeinsam, daß sie nicht das leiseste wirtschaftliche Talent besaßen. Sie waren beide durchaus nicht bedrückend mittellos, aber das Geld flog ihnen wie goldene Vögel aus der Hand ...
Mit Detlev Liliencron habe ich nur in Briefwechsel gestanden, wir haben uns leider nie gesehen. Ein leises Kokettieren mit einem genialen Zigeunertum, aber mit edelmännisch liebenswürdigem Anstrich, machte sich manchmal bei ihm geltend. Er war eine brodelnde Kraftnatur, oft mit grandioser Nichtachtung der Form, aber – er war doch – »Auch einer!«
Das war nun Elise Polko wirklich gar nicht. Sie war eine überzarte, für meinen Geschmack zu sentimentale, allzu schwärmerische Dame, aber mit Talent, besonders wenn die Musik mit in die Dichtkunst hinüberklang. Die »Musikalischen Märchen«, die ihren Ruf als Schriftstellerin begründeten, sind wohl das beste, was sie geschrieben hat. Da spricht eben die Leidenschaft und das Verständnis für Musik und Musiker mit einer vollen Skala von echten Tönen. Die feinen Gehörorgane ihrer dichterischen Seele scheinen da noch verfeinert durch das Gehör der musikalischen Seele ...
Als ich sie zuletzt in Frankfurt a. M. im Sommer 1897 sah (sie war damals fünfundsiebzig Jahre), hatte sie im Äußeren etwas an ernste, blasse Blumen Erinnerndes; wie seltsam das auch für eine Frau höheren Alters klingen mag. Ihre schlanke Gestalt hatte etwas anmutig Bewegtes; ihr seiner Kopf mit leidvollen Zügen (nicht schön aber anziehend), dazu die sanfte Stimme und die milde Redeweise, das hatte nichts Welkes, höchstens etwas Müdes. Nicht ganz zwei Jahre danach ist sie dann in München gestorben. Sie hat eine schwärmerische Sympathie für mich gehabt und sie in Worten geäußert, die für meinen Geschmack allzu süß und überschwenglich waren ... In der Erscheinung und in ihrem ganzen leisen vornehmen Wesen hat in unsern Tagen Frieda Schanz Ähnlichkeit mit ihr. In ihrem geistigen Wesen freilich nicht, denn Frieda Schanz ist viel geistreicher (siehe ihre gedankenvollen glänzend geschliffenen Stücke Lebensweisheit in den Vierzeilen) und ist überhaupt von vielseitigerer und kräftigerer Art ...
– – – Die Erinnerung an Liliencron ist mir wertvoll, trotzdem sie nie lebendig-persönlich wurde, – – – d. h. wir sahen und sprachen uns nie ... Bei so ausdrucksfähigen, ich möchte sagen: stark ausstrahlenden Naturen, wie der holsteinische Baron und ich sind, vibriert ja im Briefverkehr zwischen den Zeilen so viel Imponderabiles, das aber innigst verstanden wird. Ich gebe hier einige Auszüge aus den Briefen von Liliencron an mich. Sie lassen tiefe Blicke in seine heiße Kampfnatur tun, die immer groß war, auch in ihren Irrungen und Abschweifungen. Ich möchte auch hier mein Urteil über seine literarische Bedeutung einflechten, das ja gewiß nicht ausschlaggebend ist, aber jedenfalls: maßvoll und nicht parteiisch von der Vorliebe für seine kraftstrotzende, ritterliche Eigenart bestimmt. Gewiß ist es z. B. richtig, daß sogar ein idealistischer Dichter sich voll auf den Boden der Wirklichkeit stellt, dem Leben frei ins Auge blickt, und die Dinge frisch beim natürlichen Namen nennt. Wir leben nicht mehr wie zur Zeit der Romantiker, teils auch der Klassiker (Schillers Gedichte der ersten Periode) in Wolkenkuckucksheim. Schwülstiges, Überschwenglichkeiten, Überspanntes, Verstiegenheiten haben wir größtenteils abgestreift in der herben und klareren Luft der Zeit. Ich meine nun aber, Liliencron ginge, in natürlicher Auflehnung gegen gewisse romantische Poesie, etwas zu weit. Er zieht oft den Alltag und recht kleine, nicht allgemein interessierende und nicht eigentlich ins heilige Reich der Kunst gehörige Dinge des gewöhnlichen Lebens zu breit in seine Dichtungen. Besonders geschieht dies z. B. im »Pooggfred«, das ist störend und hängt kleine Gewichte an einen Flug, der immer zu den Sternen gehen sollte. Auch vernachlässigt Liliencron in genialer Fahrigkeit manchmal die Form und den Reim, und man stolpert darüber, wie über Steine in einem herrlichen Weg. Daneben hat er aber auch meisterhaft die Form beherrscht, eben wenn er sein Genie mit großer Kraft des Willens zusammenhält. Seine Sicilianen z. B. sind prächtig und von ungetrübtem, ungestörtem Fluß ...
Die Not des Lebens hatte ihn, besonders in der Blütenhöhe seines Könnens, zu zwingend in der Faust, und das scharfe Auf und Ab von Schön und Häßlich, von grausamem und gnadenreichem Erleben hat bei dieser impulsiven und eindrucksstarken Natur wohl auch die Ungleichheit im Schaffen bewirkt.
So hoch, wie ihn jetzt die Kritik nach seinem Tode stellt, so hoch ist er für mich nicht, dazu sind mir seine Werke zu unverglichen und maßlos. Aber ich liebe seine edle, reiche, trotzige Muse vielleicht mehr, und verstehe sie wohl auch besser als die meisten, die nur nachsprechen und – – – ihn bei Lebzeiten fast hungern ließen, und ihn oft pharisäerhaft ablehnten ...
Die Kritik, die an ihm geübt wurde, war, als er lebte und dichtete zu herb, – und ist jetzt, da er tot ist und anerkannt wird, zu rückhaltlos lobend. Hier einiges aus seinen Briefen:
»Verehrte Exzellenz und Dichterin! Wenn ich einmal längere Zeit nicht geschrieben habe, so mag es in der Hauptsache darin seinen Grund finden, daß ich, dem unglückseligen »teutschen Tichter« angemessen – in unerhörter Weise materiell zu leiden, zu dulden, zu kämpfen habe. –
Nach wie vor bin ich Ihr aufrichtigster, glühendster Verehrer, – und oft, oft spreche ich von Ihnen und Ihrer Genialität. Sie sind mir die einzige Nachfolgerin der unsterblichen Annette Droste.« –
Teile aus einem Brief, der sehr tief in Liliencrons Welt- und Literaturanschauung einsehen lehrt, möchte ich hier anführen. Diese Briefe sind übrigens vor seiner Verheiratung und der Besserung seiner Lage geschrieben; seine Gedanken und Empfindungen waren noch von schwerer Bitternis durchtränkt ... Der eine sehr charakteristische Brief beginnt mit einer Schilderung seiner Lage und einer größeren Geldbitte; ich war sehr froh, sie damals gewähren zu können. Die Einzelheiten möchte ich verschweigen aus Rücksicht für den verehrten toten Dichter; nur das, was grelle Feuerscheine auf Literatur und Kritik, wie sie sich ihm darstellten, wirft, gebe ich hier wieder. Er schreibt da unter anderm auch zwei Sicilianen, von denen ich nicht genau weiß, ob sie anderswo veröffentlicht sind. Da sie für des Dichters Seelenstimmung in jenen Jahren charakteristisch sind, seien sie hier erwähnt.
» Der teutsche Tichter in Abdera.
Du hattest heute wieder nichts zu essen,
Dafür aß jeder Straßenstrolch sich satt.
Die gute Stadt, in der du eingesessen,
Bringt dir sogar ein wütend Pereat, –
Und möchte dich mit Haut und Haaren fressen:
Ganz recht auch, daß er keine Suppe hat,
Sein Hochmut scheint uns gänzlich zu vergessen –
Er schreibt nicht mal für unser Wochenblatt ...«
Qualvollstes Sterben.
Der Hungertod im Schnee auf Heiden ist
Ein lustig Schwelgerfest in Hochgenüssen;
Viel Klaftern tief im Sarg erwachen ist
Ein fröhlich Augenauf zu Glücksergüssen,
Der ewigen Verdammnis Schrecken ist
Ein Rosengarten unter Frühlingsküssen,
Denk ich der Schmach, wie grauenhaft es ist,
Täglich mit Pfennigsorgen kämpfen müssen.
»Ja ekelhaft, ekelhaft! Alles im Leben ertrage ich, weil ich unser Leben nur als eine Kette von Greueln ansehe; aber diese Geldnot, die tötet mich endlich .. »
Doch nun zu anderem! Annette Droste, bedenken Sie das Wunderbare: niemals hat sie ein Liebeslied veröffentlicht. Diese ihre Liebeslieder, die sie verbrannt hat, sollen von hinreißender Heiligkeit gewesen sein. Und das grade bringt Sie mir wieder so nahe zu Annette Droste: daß Sie das erste haben, was ein Dichter haben muß: stürmische Leidenschaft, Blut, Rasse. Man spricht jetzt viel von Maria Janitscheck, – aber Sie, Exzellenz, stehen mir tausendmal höher ... – – – Ich selbst habe bis jetzt nichts von meiner Dichterei gehabt. Vor allen Dingen keine materiellen Vorteile. Zwei Manuskripte faulen seit zwei Jahren, weil ich sie nicht wieder an W. Fr. (soll wohl sein damaliger Verleger W. Friedrich sein. Anmerk. der Verfasserin) für nichts vergeben will. Erst ein langer Prozeß wird mich von meinem Verleger trennen, dem ich durch einen blödsinnigen Vertrag auf Lebenszeit verpflichtet bin. Und sonst? Unsere Literatur etwa? Lese ich nie! Das ist ja gräßliches Zeug meistens. Und die Kritik? Welche Unsummen von Albernheit und Dummheit! Da tue ich denn das beste: Verkehre so wenig wie möglich mit Literaten und lebe so einsam und abseits und versteckt ich kann; mühsam mir die paar Brocken Glückes (für mich: die Liebe) sammelnd. Manchmal kommt's noch über mich: Anerkennung! ›Da geht der Dichter Liliencron!‹ und ähnliche Eitelkeiten ... Aber dann denke ich an die alles übertreffende Nüchternheit und Poesielosigkeit (besser: Poesieunkenntnis) unseres Volkes der Söffer und Skatspieler und fader Assessoren pp. – und – lächelnd gebe ich das Rennen auf ... Ja, ich werde feuerrot und sehe es als eine Beleidigung an, wenn man mich ›Dichter‹ nennt. Ich glaube, ich sterbe noch an der grenzenlosen Unvornehmheit, die wir paar Dichter ertragen müssen. Ach, alles, alles so unvornehm, so plump, so banal!«
– – – An sich war Detlev Liliencron eine Grandseigneur-Natur; die umgebenden Lebensbedingungen aber standen in so ungeheuerlichem Gegensatz dazu, daß sich naturgemäß Bitterkeit, Trotz, leidenschaftliche Auflehnung daraus entwickelten. Seine heiße Natur ließ ihn dann das richtige Maß verlieren im Urteil. Die Linien seiner Auffassung sind außerordentlich übertrieben. Seine sonnige, reiche Natur forderte auch einen Sonnenplatz in reicher Schönheit – und doch war ihr den größten Teil des Lebens: enge Kargheit, Kleinlichkeit, fast Ärmlichkeit der Verhältnisse, und oft auch Not zuteil geworden.
Das Schicksal seiner Jugend- und ersten Mannesjahre gemahnt mich an das Wort von Hebbel: »Das ist das Leben; bald fehlt uns der Becher, bald fehlt uns der Wein« ... Er hatte den Wein, den schäumenden, funkelnden, berauschenden des genialen Geistes, – aber – der schöne Becher, aus dem er ihn hätte genießen mögen: die leichten Lebensbedingungen, die Glücksguter, die fehlten. So ist denn vieles verschäumt und verbraust – oder in irdene oder gar brüchige Schalen gefüllt worden ...
Liliencron war auch eine Kampfnatur, auch buchstäblich eine kriegerische Natur. Er war freudig und leidenschaftlich Soldat gewesen. Wäre er in die richtige Zeit und an den richtigen Platz gerückt worden, – er hätte viel hinreißender, kräftiger und einheitlicher wirken können. Ich habe ihn mir oft jetzt im Weltkrieg gedacht: er wäre ein Herrlicher gewesen. Dann hätte er auch nicht in trübem Unmut unser im Grunde prachtvolles Volk verkannt und es ein Volk der »Söffer, der Skatspieler und fader Assessoren pp.« genannt.
Gerade, weil er eine kerndeutsche Natur war, mit allen erlauchteren Eigenschaften unseres Volkes; darum berühren seine Bitterkeiten, die ihn und sein Volk verkleinern, besonders schmerzlich.
Über Carolath dachte er sehr groß; er war ihm als Dichter bedeutsam und als Mensch »hilfreich und gut« gewesen.
In der »Gesellschaft«, die in München 1885 zuerst erschien (in W. Friedrichs Verlag) und von Michael Georg Conrad geleitet wurde, erstand der ganzen ringenden Literaturbewegung jener Zeit eine weite Halle der Vereinigung mit starkem Resonanzboden. Die Talente der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts begegneten sich alle darin. Die Strömungen und der Geist, die Theorien und der Geschmack waren ungemein fluktuierend im Bereich dieser Zeitschrift. Man begegnete in den verschiedenen Jahren ganz gegensätzlichen Meinungen und höchst verschiedenen Helden und Heldinnen, die auf den Schild gehoben und weithin sichtbar getragen wurden. Oft war mehr eine auflehnende gegenseitige Kampfstimmung als eine einheitliche in der »Gesellschaft«: aber vielleicht war gerade dies Aufeinanderplatzen verschiedener Auffassungen von Kunst und Literatur kraftfördernd. Zeitweise ward von Conrad dem Naturalistischen allzu breiter Raum gewährt. Dem Naturalismus, der, wie ein damaliger Schriftsteller recht bezeichnend sagt, besser »Trivialismus« genannt werden sollte. (Troll-Borostyani?) Die »Gesellschaft« hatte eigentlich eine von Conrad verkündete Richtung, der sie hätte einheitlich treu sein sollen; – aber dadurch, daß allen Talenten und modernen Geistern Bewegungsraum in ihr gegeben wurde, ward ihre Haltung oft schwankend, das heißt hin und her geworfen von scharf betonten Meinungen; und es war daher nicht selten, daß ein Dichter, der zuerst zu ihrer gläubigsten Gemeinde gehört hatte, später ein Widersacher wurde, und dann auch ein von Conrad und der »Gesellschaft« Befehdeter. Wie zum Beispiel Wolfgang Kirchbach.
Conrad war eine kraftvolle Anführernatur; neben seinem Dichtertum auch Beschützer, Mittler, Führer von Poeten und dichterischen Strömungen.
Er steht in der gärenden und sich klärenden Zeit der Literatur der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts als eine bedeutsame Kraft. Wir alle schaffende Dichter jener Zeit haben ihm viel zu danken; er lehrte uns glauben an die Kraft unserer Eigenart. Einige haben wohl nicht gehalten, was ihr kräftig aufschäumendes Wesen versprach, andere sind in gleichmäßiger Entwicklung weitergewachsen, noch andere aber haben eine glänzende Hochentwicklung genommen, die ein Blühen und Fruchtbringen zeitigte, welches man in solcher Schönheit nicht hätte weissagen können. Wir sind dann aus der engeren »Gesellschaft« in die Welt hinausgegangen; jeder den durch sein Talent bestimmten Weg. Viele sind auf breiter, fröhlicher Landstraße geblieben –; viele aber auch sind auf Höhenwege gestiegen, wo die Luft würziger und der Himmel näher war, – und das teilte sich ihren Dichtungen mit ...
Die Zeit vom Oktober 1871-1879 lebte ich mit meiner Familie in Kolmar, meine einzige Tochter ist dort geboren. In diese Zeit fallen Begegnungen und Freundschaften mit einigen bedeutenden, in ihrer Art sehr verschiedenen Schriftstellern; ich nenne davon die bedeutendsten. Ich möchte sie zuerst betrachten, ehe ich die politisch, sozial und kulturell hervorragende Periode schildere, die 1879 mit meines Mannes Ernennung zum Unterstaatssekretär im neuen Ministerium für Elsaß-Lothringen begann ...
Die drei, jeder in seiner Art bedeutsamen Dichter, Auerbach, Jensen und Bodenstedt, sind tot. Das Bild ihres Schaffens und Lebens ist also geschlossen. Als die liebenswürdigste, ausgeglichenste Dichtererscheinung von ihnen möchte ich Jensen bezeichnen. Er lebte damals in dem Kolmar nahen Freiburg und hatte dort ein von allen guten Geistern beseeltes Dichterheim. Auch die Frauen seines Hauses, seine Gattin und seine Töchter, machten, reizvoll in ihrer Erscheinung und ihrem Wesen, die schöne Harmonie besonders wirkungsvoll ... Ich bin einmal eine Woche lang Gast in Jensens Haus gewesen. Das war etwa im Jahr 1878. Es ist also eine lange Strecke Lebensweges seitdem von mir geschritten worden, die überreich an Bildern und Geschehnissen war; aber jene stillen Tage in dem weißen Hause an der Dreisam ruhen noch in starker und bunter Eindruckskraft in mir.
Jensen gehörte als Künstler und Mensch zu denen, die abseits vom großen Strom der Menschen einen ganz eigenen, beschaulichen Weg gehen. Als Künstler war er deshalb besonders liebenswert, weil er ohne jede Eitelkeit war. Nur ein natürliches und stolzes Selbstbewußtsein hatte er, das sich aber in feiner und zarter Form gab. Bescheidenheit ist bei Künstlern eine ganz außerordentliche Seltenheit, und ich liebe und achte sie, wo ich ihr begegne. Darin waren auch zum Beispiel Auerbach und Bodenstedt der unschönste Gegensatz zu Jensen. Doch davon später!
Jensens Dichterart war der von Th. Storm wesensverwandt, – vielleicht auch ein wenig von ihr beeinflußt. Er war in der Malerei des Landschaftlichen und Dekorativen bedeutender als Storm; auch malt er gern seine köstlich feinen Seelenschilderungen auf geschichtlichen Hintergründen, – während Storm sie gewöhnlich im engeren Rahmen und auf dem einfacheren Hintergrund von kleinen, traumstillen nordischen Städtchen und abseitigen Wald- und Dorflandschaften gibt. Über beider Dichter Wesensart liegt jenes unbeschreibliche Etwas, das man wohl am besten: dichterische Stimmung nennt. Eine Geisblattlaube in einem alten Stadtgarten, altväterische Zimmer in verschollenen Patrizierhäusern, eine stille Düne am Meer, ein weltentrückter Raum in einem Leuchtturm (wie in Eddystone), die werden unter der schildernden Dichterhand dann solche Stimmungsträger, daß sie uns wie durch Zauber in die Sphäre heben, die vom Denken, Fühlen und Erleben seiner Helden erfüllt ist.
Die Novellen von Storm und Jensen sind im schönsten Sinne: dichterische Novellen, und man wird sie erst ganz tief ausgenießen, wenn man auf dem Wege der Lyrik beider Dichter zu ihrem Genuß gelangt. In der reinen Lyrik, in den Gedichten, steht Storm über Jensen; unerreichbar schön sind viele, tief ans Herz greifend, mit einfachen und deshalb gerade erschütternden Tönen.
Die Dichtung zum Beispiel, die anhebt:
»Fern hallt Musik, doch hier ist stille Nacht –
Mit Schlummerduft anhauchen mich die Pflanzen –
Ich habe immer, immer dein gedacht –
Ich möchte schlafen, aber du – mußt tanzen«
die ist eine feine und doch gewaltige Geschichte einer Liebe; in ganz einfachen, aber den Herznerv treffenden Tönen. Oder das wundervolle Gedicht, das von einem in heiterer Freundesrunde erzählt, – und wie dann plötzlich dem harmlos Frohen im Erinnern eine Liebesgestalt der Jugend aufersteht und ihn anschaut mit toten Augen und die wenigen Worte sagt:
»Was lärmst du so, und weißt doch, daß ich schlafe!?«
Ist das nicht wundervoll und aus dem Tiefsten der Menschenseele geschöpft?
Man mag Storm eine begrenzte Dichternatur nennen, weil die Probleme und Stoffe seiner Novellen eine enge Welt umfassen, aber es haftet ihnen, und besonders seinen Dichtungen, dennoch Ewigeres an, als den dichterischen Schöpfungen vieler, die die ganze große Welt spiegeln wollen und – doch nur kleine und flache Bilder geben ... Ein Zug unverwelklicher Jugend ist Storms Muse eigen, – einer Jugend aber, die mehr Tränen als Lachen kennt ... Wilhelm Jensen war, wie ich schon oben andeutete, als Mensch so liebenswürdig und bedeutend wie als Künstler, und ohne jene unschöne Beimischung persönlicher Eitelkeit, die zum Beispiel Auerbach und Bodenstedt in so verletzendem, oft lächerlichem Grade eigen war, und der immer etwas Kleingeistiges anhaftet.
Berthold Auerbach habe ich nur einige Male in meinem Leben gesehen; dennoch meine ich, ihn besonders tief und gut gekannt zu haben. Es gibt natürlich viele noch Lebende, die ihm durch jahrelange Freundschaft, durch literarische Beziehungen sehr viel näherstanden als ich und ihn teils wohl auch in allen geistigen Entwicklungsphasen beobachtet und gekannt haben. Ich habe ihn nur im letzten Jahrzehnt seines Lebens gesehen. Er war schon ein Gewordener, nicht mehr ein Werdender ... Wie ein köstlicher Waldbaum, der aller Wurzeln und aller Triebe Kraft in Blättern, Blüten und Ästen, Wohl auch in Knorren und harter Rinde bis zur letzten Entfaltungsmöglichkeit gegeben hat. In jener Gnadenzeit des Höchststandes vor dem Welken, da kannte ich ihn. Ich sagte oben: »ich hab ihn besonders tief und gut gekannt, obwohl ich ihm nur ein paarmal in diesem Vorübergleiten, das wir ›Leben‹ nennen, begegnet bin«.
Dies tiefe Erkennen ist aber bald erklärt, wenn man eine Eigentümlichkeit meines Wesens kennt und deren geheime Wirkungen ermißt ...
Freilich, ich habe ja auch Briefe gewechselt mit Auerbach, aber meine Erkenntnis seiner gesamten Geistigkeit hat sich dadurch weder vertieft noch hat sie irgend eine wesentliche Läuterung erfahren. Es ist nicht mehr Sonne hineingekommen dadurch. Das große Licht lag doch wohl in meinem liebevollen Anschauen ... Eine lustige, kluge Freundin, die in kurzen Kraftsätzen oft große Wahrheiten prägte, hat mich einmal einen »Quellenfinder« genannt.
Sie meinte damit, ich könne mich mit so viel Liebe und Verständnis in andere Naturen vertiefen, daß ich irgendeinen Born des Guten oder Schönen in vielen fände. Vielleicht ist das begründet in einer subtilen Feinhörigkeit und Sehergabe, im dunklen Erdgrund: Menschenseele just die geheime Stelle zu finden, wo irgendein feiner Quell der Schönheit oder Kraft rauscht und dann den Besitzer und den Finder damit zu erfrischen ... – Und wo das gewisse feine Rauschen verborgener Bronnen nicht zu vernehmen ist, da tut man besser, sich abzuwenden.
Nun, bei Auerbach war es für mich ein ganz reiches unversiegendes Quellensprudeln und darum habe ich tief aufgehorcht und wohl auch alles Beste und Feintönigste dem Urborn seines Dichtens und Wesens vernommen.
Wie bedeutsam sind übrigens Stunde und Stimmung bei dem Begegnen zweier starker Persönlichkeiten! Mir fällt da die sehr sinnvolle Grabschrift eines Papstes ein, welche lautet: »Wieviel trägt es aus, in welche Zeit das Leben, auch das des besten Mannes, fällt!« Man könnte dem Ausspruch eine Variante geben, die dann für solche erste Begegnungen kennzeichnende Geltung hatte: »Wieviel trägt es aus, in welche Zeit und Stimmung das Kennenlernen eines bedeutenden Menschen für uns fällt!«
Und sie war wunderbar, diese Stunde: die ganze Innerlichkeit unserer Naturen emporregend, Gedanken und Empfindungen mächtig anrührend. Sie hat mir den ganzen Auerbach in seiner Größe und Frische gezeigt: in seiner fast naiven Freude an sich selbst, neben dem stark lehrhaften Zug seines geistig scharf pointierten Wesens, mit seinen Eitelkeiten und seiner Künstlerweichheit und Liebenswürdigkeit. Es war der Eröffnungstag der Universität Straßburg nach dem Deutsch-Französischen Kriege; ein historisch bedeutsamer Tag.
Freiherr von Roggenbach, der vormalige badische Minister, hatte die Mission, die Geistesstätte zu bereiten und die wissenschaftlichen Kräfte zu berufen. Man hatte das Bewußtsein, daß er mit feinfühliger Hand und mit lichtem Geiste aus allen Stämmen und von allen Städten deutscher Herzogtümer und Königreiche das Auserlesenste an Lehrkräften gefunden und hier zu gewaltigem Zusammenschluß in einer Einheit gebracht habe. Wenn je das Wort eine Wahrheit gewesen, daß man von dem Wehen großen Geistes berührt werden kann, so war das an jenem Tage. Alles war wie zur Offenbarung innerster Kräfte gestimmt. Es war ein Maitag; ein Triumph von Licht lag über der alten Stadt. Soviel Morgenrot, soviel Aufgang, soviel stürmisches Hoffen und reiches Knospenstreben war in der Natur und in den Seelen ...
Da trat mir Berthold Auerbach zum erstenmal entgegen an einem liebkosend linden Abend ... Die große Feier vom Morgen war längst vorüber. Durch alle Gassen ging ein Brausen und Sausen von Stimmen, wie in zitternder Erwartung. Ich war mit einer Gesellschaft von mir bekannten hohen Staatsbeamten, Künstlern, Professoren, Offizieren. Auerbach trat als ein völlig Neuer in den Kreis; aber – seltsam, es fügte sich ganz natürlich, daß er an meine Seite kam, mir seinen Arm gab und mich führte. Zur Beleuchtung des Münsters strebte alles. Und wie die Lenzabendschatten immer schleierdichter niederfielen, leuchteten die Umrisse der Kathedrale flammender auf. Redend und deutend schienen die Apostel und Heiligengestalten aus ihren Spitzbogenrahmen herauszutreten in das quellende Licht. Die wundervolle Ornamentik der gotischen Kunst hing in den bunten Feuern wie unsäglich feine Spitzengewebe, und Linien von vornehmster Führung, die man am Tage und bei der entrückten Höhe des Baues kaum angedeutet gesehen, ließen nun die bengalischen Feuer in aller Kraft und Lauterkeit hervortreten. Dazwischen waren die Raketen und Leuchtkugeln nur wie ein übermächtiges Spiel der Freude über soviel ins Licht getretene Kunst. Übermut begleitet ja fast jede große Freude, so wie etwa der übersprudelnde Schaum zum echten Freudentrunk gehört ... Bei einer Biegung der Gasse lag plötzlich das ganze lichtumronnene Münster vor uns.
Auerbach hielt im Schritt an und fand sehr lebendige Worte für die reiche Stunde und alles, was sie aus besten Seelentiefen emporweckte. Ich sprach auch: Junges, Beflügeltes, Heiligwarmes ... Er nickte manchmal mit seinem ausdrucksvollen Kopf. Dann blieb er stehen, schaute mich mit einem eigentümlich glänzenden Blick an und sprach die Worte, die ich nie vergessen habe. Sie waren bezeichnend für Auerbachs Wesen: »Wissen Sie auch mit wem Sie gehen?« Das klang ja nun hochmütig und war ein Ausfluß sehr großer Eitelkeit, als ob er sagen wollte: »Ich bin so bedeutend und wertvoll, daß meine Nähe jeden erheben und adeln muß«. – – –
Unter diesem Eindruck antwortete ich ernst: »Gewiß mit Herrn Auerbach!«, mehr seine gesellschaftliche als künstlerische Stellung betonend. Er mochte es fühlen, daß er in seiner Anmaßung zu weit gegangen war, und sagte nun mit viel weicherem Ton: »Wohl, Sie verstehen mich schon« – – – Und – ich verstand ihn, verstand das, was ich zwischen den Worten zittern hörte; es war Höheres, als gewöhnliche Eitelkeit.
Auerbachs Eitelkeit war nicht eine, die zurückstieß und zum Widerspruch anregte, – auch nicht eine leere hinter der nur Spreu und Wind ist; sie war vielmehr fast rührend, weil sie eine Kindlichkeit der Seele zeigte und eine feine, verklärte Freude, an den eigenen Gaben, die als eine Göttergunst, ein Kraftlehen dankbar empfunden wurden. Eine Eitelkeit, die sagt: »Sieh, ich bin ein von der Gottheit Gezeichneter! ich trage das Mal des Genius – ein zarter Strahlenreif liegt auf meiner Stirn. – Siehst du ihn? Weißt du's auch? Freust du dich mit mir?«
So habe ich Auerbachs Eitelkeit aufgefaßt und ihn in dieser schönen und höheren Auslegung auch wohl besser verstanden als viele. – – – Ich habe mich mit ihm gefreut an der genialen Verbindung verschiedenartigster Kräfte in ihm. Und, sie waren verschieden genug. In all sein reiches, weiches Empfindungsleben spielte immer die Kritik eines logisch aufbauenden und aus bestimmten Wurzeln Folgerichtigkeiten schauenden Verstandes, das Lehrhafte ging bei ihm neben dem naiv Gefundenen her.
Seine Betätigung in der Literatur und die Studien, sein Entwicklungsweg, den er genommen, sie sind kennzeichnend für das vorwiegend Verstandesmäßige in Auerbachs Kunst. Ehe er die Form und den Inhalt der Dichtung fand, welche ihn lebendigen Einfluß auf die Geister und Herzen seiner Zeitgenossen gewinnen ließ, ging er ganz andere Wege, streifte und durchdrang er ganz andere Gebiete: Forschung in Wissenschaft! Die sichtende, sondernde, prüfende Arbeit des Verstandes füllte die schäumendsten Tage seiner Jugend. Es haftete ihm auch später, in den reifen Dichterwerken seines Mannesalters immer an, daß er durch die Schule spinozistischer Philosophie gegangen, – daß er die Erscheinungen seines Lebens bis in ihren Wurzelgrund zerlegt und erforscht und ihre vernünftige Entwicklung konstruiert hatte.
Auerbach hatte bekanntlich Geschichte und Philosophie studiert, und sich besonders mit Spinoza und der Geschichte seines und dessen Stammes (der Juden) beschäftigt. Er hatte nicht nur in »Dichter und Kaufmann« Spinozas Charakterbild in der Form des Romans gezeichnet, sondern er hatte dessen sämtliche Werke übersetzt und mit einer Kritik und Lebensbeschreibung herausgegeben. Der strenge und gewaltige Denker von Amsterdam beherrschte Auerbachs geistige Welt in den Aufgangstagen von deren Gestaltenbildung. Die Werke, die des Dichters Ruhm begründeten, die mit den »Schwarzwälder Dorfgeschichten« 1843 beginnen und mit »Brigith« 1880 enden, sind im eminenten Sinne Kunstpoesie. Es ist ein Beweis eines außerordentlich scharfen Denkprozesses und eindringlichster Beobachtung, daß er Volksbücher bot, lebendig klare Typen aus dem Volk hinstellte und sie urwüchsig reden und handeln ließ, während er doch seine Werke nicht aus dem unmittelbaren Drang und Zwang dichterischer Phantasie, die mit sonst unbewußter Triebkraft bildet, schuf, sondern sie auf dem Umwege des beobachtenden und aufbauenden Denkens gewann. Ein trockener Ton des Didaktischen klingt bei Auerbach oft scharf an, inmitten frischer Schilderung und klarquellender Erzählungsweise.
Er ist etwa Einem zu vergleichen, der in den Gärten der Kunst frei pflanzt und schafft und reiche Früchte pflückt, aber dabei niemals vergessen läßt, daß er Naturgeschichte studierte; – und der als Naturforscher die Staubfäden der Blumen uns aufzählt und das streng Gesetzmäßige, der Pflanzenentwicklung verkündet, während er uns deren Duft und Blüte gibt!
Um in einer modernen Wendung zu sprechen: er ist immer etwas Beckmesser, dem freien Preislied der Kunst gegenüber ...
Scheint es nicht überhaupt eine Eigentümlichkeit des semitischen Geistes, wenn er sich schaffend in der Kunst erweist, daß er mehr Richter als Dichter ist? Die Kritik und der scharf ins Innerste der Dinge dringende Verstand, der die bestehende Welt (die gegenständliche und die geistige) erkennend in ihre einzelnen Teile zerlegt, prüft und Weisheit daraus zieht, sie sind dem semitischen Geiste besonders eigen.
Das Volk Israel ist gewiß ganz außerordentlich hoch zu werten mit der Großzügigkeit seines Intellekts und mit seiner lauteren, moralischen Begabung und Entwicklung, – aber fehlt nicht seiner seelischen Eigenart oftmals das Eine, das im Fluge ergreift, das emporträgt und kühne Verbindungen findet und das Schwingen verleiht, wo der Verstand nur auf zwei festen Füßen zu gehen erlaubt? Ich meine: die Begeisterung, der Schwung, die Phantasie, die eigentlich lyrische Hingerissenheit, die erst den echten Künstler weihen. Bei der vornehmen Höhe, der Kraft, Schärfe und Geschmeidigkeit des Geistes dieses bedeutenden Volksstammes muß es auffallen, daß er verhältnismäßig wenige Künstler hervorgebracht hat.
Wohl große Gelehrte, große Forscher, bedeutende Kritiker und Lehrer, Politiker und Staatsmänner, aber viel weniger schaffende Künstler von Bedeutung.
Die unbewußte Unmittelbarkeit des schöpferischen Geistes, die aus dem Vollen greift, weil sie bedingungslos dazu getrieben wird, ist wohl dem semitischen Geist weniger eigen, als die bewußt konstruierende Gedankenarbeit, die das auf dem Umwege der Forschung und Beobachtung Gewonnene gestaltet. Im Künstler ist da zugleich auch der Kritiker wirksam, und wägt, wo der kühn Schaffende wagt ... Das ist zum Beispiel bei Heine, Börne, Auerbach deutlich zu spüren! Auerbach stellt in seinen Erzählungen und Romanen vielleicht den höchsten Triumph einer auf dem Wege der Kritik und Beobachtung erreichten Volkskunst dar. Gewisse naive Züge und ein inniges Empfindungsleben läutern dann das künstlich Gewonnene zum Künstlerischen.
Wie ich vorhin schon sagte: Auerbach war sich seiner bedeutenden Gaben sehr bewußt und hatte eine lebhafte Freude daran. Er sprach einmal in tiefem Ernst den Satz aus: »Jedes Wort, das ich spreche oder schreibe, ist Gold ...« Die Bedeutung, die er sich und der Berührung eines andern mit seinem Genius beimaß, kommt in einem Briefe, den ich noch von ihm bewahrt habe, besonders klar aber in schöner Fassung zum Ausdruck ...
Ich bin im allgemeinen eine Feindin der Veröffentlichung von Privatbriefen eines Künstlers. Etwas eigenst Persönliches, das einem andern eigenst Persönlichen gewidmet ist, darf nicht ohne zwingenden Grund, allen zugänglich und offenbar werden. Es kommt mir wie eine Entblößung der Innerlichkeit vor, die als eigenste Hingabe geweiht ist und deren Stätte die keusche Heimlichkeit sein soll ... Ich besitze viele Briefe bedeutender Persönlichkeiten, aber ich habe nur ganz selten welche davon veröffentlicht (trotz oftmaliger Bitten) und nur, wenn etwa, wie hier, das intime Persönliche hinter dem künstlerisch Interessierenden zurücktritt. Jener Auerbachsche Brief aber lautet:
»Tarasp (Engadin, Schweiz), 8. Juli 1874.
Sie haben ein Schönes und Gutes getan, an sich selber und an mir. Wenn je eine Trübung sich Ihres Gemütes bemächtigen wollte, so muß Sie der Gedanke durchklären, daß Sie eine reine Tat vollzogen haben, die nimmer getilgt werden kann. Ihre Erfassung meines Denkens, Empfindens und Gestaltens hat mich mit einem Wohlgefühl ohnegleichen erfüllt ... Wunderbar, wie gerade dieses mein eigenstes Buch »Waldfried« mir verständnishohe Seelen erweckte und mir auch Feinde meiner ganzen Weltbetrachtung enthüllte, wie ich solche nie geahnt hatte. Als ich Ihren Brief gelesen hatte, wurde mir das Wort Goethes zum persönlichen Erlebnis: ›Sie sieht die Welt, wie sie ist, aber durch das Medium der Liebe.‹
Ihr Brief wurde mir sicher nachgeschickt, wo ich seit dem vierten bin, und drei bis vier Wochen bleibe. Man ist hier wenig geeignet zum Schreiben, und ich hätte doch so viel zu sagen, was mir die Kundgebung einer reingestimmten Seele voll edlen Gehaltes ist. Ich will Ihnen also nur sagen, daß ich höchst wahrscheinlich auf der Rückreise durch das Elsaß komme und dann natürlich nach Kolmar. Mein damaliger Aufenthalt. Bitte schreiben Sie mir sicher zwei Zeilen, wo Sie Ende dieses und Anfang kommenden Monats sein werden ... Sie erinnern mich an den 2. Mai 1872 in Straßburg vor dem erleuchteten Münster. Ich hatte damals bereits ›Waldfried‹ in der Seele, und hatte den Gedanken, den Schluß des Ganzen auf diesen Tag oben auf der Plattform zu verlegen ... Über dies und vieles hoffentlich bald mündlich.
Ihr
Berthold Auerbach.«
Auch durch diese Kundgebung Auerbachschen Wesens geht der große Stolz auf die eigene Bedeutung, denn in der einfachen Tatsache, daß einer (in diesem Falle: ich) des Dichters Eigenart tief und warm erfaßte und erkannte, sieht er eine Tat, »die nie getilgt werden kann«, und der er eine verklärende und läuternde Kraft in etwa kommenden Trübungen des Gemüts zuschreibt. Es sind ja einige Goldkörnlein Wahrheit in jenen seherischen Worten starken Dichterstolzes; denn das Verständnis der Seelen bedeutet eine Gemeinschaft, und die Gemeinschaft hochgestimmter Geister hat etwas lebendig Fortwirkendes. Er gehörte damals schon in den erlesenen Reigen derer, die das Schöne in der Kunst bilden und schaffen. Sei es auf welchem Wege es immer mag: auf breitsonnigem Pfad, auf tastenden Umwegen oder in vorwärtsstürmendem Drang, der oft irrt, aber auch rasch erobert: diese geheime Gemeinschaft der Hochgestimmten treibt es zu den Gipfeln ... Ich war nur damals erst eine strebende, noch nicht schaffende Kraft. Aber er schaute vielleicht in meinem Blick das lichte Erkennungszeichen der Gemeinschaft jener Geister, und darum suchte er mich mit den etwas überschwenglichen Worten in seine Sphäre, in die ich mit liebender Erkenntnis gedrungen war, zu bannen. Und daß er das mit stark betontem Bewußtsein seines Wertes tat, als » maëstro di color che sanno«, hat mir seine eigentümliche Gestalt nicht verdunkelt. Ich habe seine großen Seiten immer bewundert und für seine Schwächen, seine wohl allzusehr betonte Eigenschätzung ein warmes Lächeln der Entschuldigung gefunden.
Von den Dichterbegegnungen aus diesen Jahren und bis zum Beginn der Straßburger Epoche, die 1879 begann, hat mir die Bekanntschaft mit Fr. Bodenstedt geistig und überhaupt seelisch am wenigsten gegeben. Das war in verschiedenen Dingen begründet. Bodenstedt war fraglos ein gedankenreicher, hoch- und weitgebildeter Mann. Er hatte durch seine jahrelangen Reisen und Stellungen in mehreren Weltteilen einen gewissen kulturumfassenden Blick. Ihm waren reiche Bilder aus den Landschaften und dem Volkswesen uns fremder oder wenig bekannter Nationen vor die Augen der Seele getreten, und er konnte sie auch in klaren, reinen Farben geben. Er hatte ein glänzendes Wissen und eine meisterliche Beherrschung der Formen in der Sprache – in der gebundenen und ungebundenen Rede. Das alles war sichtlich und fühlbar da – – – aber sein dichterisches Können stand nicht auf gleicher Höhe mit seinem Wissen von Kunst, Welt und Leben. Die göttliche Flamme fehlte! Sein Geist war weise, aber trocken, – sein Empfinden nicht ursprünglich, sondern mehr ein Anempfinden, seine Phantasie: nie hingerissen oder hinreißend, sondern immer gezügelt und zu sehr gedämpft von belehrenden Tönen.
Mit einem Wort: er war viel zu didaktisch und doktrinär. Neben seiner allzubewußten Weisheit kamen reinlyrische oder epische Gestaltungen nicht auf; sie erhielten zu künstliche, bewußte Linien, um starkkünstlerisch zu wirken. Selbst seine Mirza-Schaffy-Lieder, die ja seinen Ruhm machten und nachher inmitten schwächerer Leistungen erhielten, – selbst diese wirken im letzten Eindruck lehrhaft ... Sie singen von den berauschendsten Dingen der Welt: von Liebe, Gesang und Wein – und dennoch erzeugen sie nie jene süße Trunkenheit der Seele, die jeder echte Künstler mit seinem Gesang erregt, sondern sie bringen in den wohlgemessenen, etwas dürr klappernden Dreisilbenreimen der orientalischen Poesie als Schluß immer eine kleine Weisheitslehre oder gar ein ernstes moralisches Mäntelchen. Ich persönlich habe nie den Beifallssturm begreifen können, den die Mirza-Schaffy-Lieder erregten. Ein herzbezwingendes, seelenergreifendes Element lag jedenfalls nicht in dieser didaktischen Lyrik verborgen. Es mag das Schillernde, Fremde der orientalischen Poesie gewesen sein, das Bodenstedt sich anempfinden konnte. Freilich gab er mehr das Äußere, gewissermaßen den Faltenwurf des orientalischen Gewandes, die lachende Farbenfröhlichkeit, als das seelische Wesen des Orients! Man lese nur einmal den »West-östlichen Divan«, wo Goethe, wenn er Weisheit predigt, didaktisch wirkt, aber wo er lyrisch singt, auch voll urquellender Empfindung ist, während Bodenstedt immer die großen Gegensätze zusammengibt, indem er die beflügelte Psyche: Lyrik in den schweren Mantel des Lehrhaften hüllt. Was Bodenstedt später an deutschen eigenen Dichtungen gegeben hat, in Drama und Lyrik, ist nicht starkkünstlerisch. Wäre er mit diesen Poesien zuerst hervorgetreten, so hätte man ihn wohl nur als einen Dichter von mittlerem Können gewertet. So aber stand er schon in dem strahlenden Licht eines durch die Mirza-Schaffy-Lieder geschaffenen Ruhmes, – und das verklärte nun auch die schwächeren Leistungen. Alles, was er an Prosa geschrieben, das die Kultur, die Landschaft, die Sitten der fremden Völker betrifft, unter denen er lange Jahre lebte und studierte, ist bedeutend. Auch seine Übersetzungen sind sehr fein, geistreich und verdienstvoll. Alles, was er von Rußland (auch vom Asiatischen), von Persien, Kleinasien usw. sagt, öffnet uns glänzende Tore zu wertvollem Wissen. Er war eben kein im höchsten Sinne selbstschöpferischer Künstler, sondern einer – der Anlehnung. Er war ein glänzender Plauderer, der am liebsten – Monologe sprach, da er sich am Hören seiner eigenen Gedanken berauschte ... Der schnelle Ruhm hatte ihn wohl geblendet und ihm sein Können in anderen Dimensionen und anderem Wesen erscheinen lassen als er war. Daraus folgte seine ungewöhnliche Eitelkeit. Er schien es geradezu zu fordern, daß eine Atmosphäre von Weihrauch, Myrrhen und Lorbeerduft ihn umgab. Wenn man ihm nicht gleich den Tribut zollte: ihm mit Überzeugung von seiner Größe zu reden, dann erzählte er einem selbst so eingehend davon, bis er glaubte, daß man es nun wisse.
Bodenstedt war immer sehr liebenswürdig zu mir; – ja, er verwöhnte mich sogar, aber er unterließ es nie, mich seine Bedeutung fühlen zu lassen. Ich war damals noch sehr, sehr jung und hatte kaum begonnen, erste Schritte auf jenen »Götterhügel Griechenlands« zu machen. Ich möchte hier nur eine Geschichte erzählen, die ich mit Bodenstedt erlebte, und die ganz charakteristisch für ihn ist. Es war in einer Gesellschaft in Wiesbaden, wo Bodenstedt damals wohnte. Es wurde geistreich und töricht geplaudert, musiziert, vorgetragen und heiter getafelt. Nach Tisch wurde ich gebeten, zu singen. Musik, besonders Gesang, war immer meine zweitgeliebte Kunst. Ich sang Robert Franz' erschütternd schönes Lied: »Die Haid ist braun, einst blühte sie rot« – – – Als ich geendet und zuerst eine Stille ward, ehe der Beifall losbrach, trat Bodenstedt auf mich zu und sagte: »Diese Frau ist so schön und talentvoll, und singt so schön, daß – – – sie einen Kuß von mir verdient« (!!) Er hielt das wahrscheinlich für eine höchste Ehrung. Ich sah ihn einen Augenblick groß an, und – – – reichte ihm dann stolz meine Hand zum Kusse ... Ich weiß nicht, ob andere den Vorgang bemerkt haben. Bodenstedt trat etwas verdutzt zurück, nachdem er meine Hand geküßt hatte ... Der Eindruck, den seine Werke machten, wurde durch den Eindruck, den seine Persönlichkeit hervorrief, entschieden herabgemindert; denn seine Eitelkeit war nicht wie die von Auerbach, naiv, und auch nicht auf ein so bedeutendes Können gestützt, wie bei dem Schwarzwälder Semiten, – und dazu war sein Äußeres nicht sympathisch. Dieser weise und jedenfalls auf Edles gerichtete Mann hatte etwas faunische Züge. Er ist nun längst tot, aber er gehört mit seinen persischen Dichtungen, Nachdichtungen und Übersetzungen zu denen, die man nicht vergißt, denn hierin war er ein ganz Großer. Ihn gekannt zu haben und mit ihm in freundschaftlichen Beziehungen gestanden zu haben, ist eine liebe Erinnerung, deren Bedeutung und Schönheit nur ein wenig getrübt ist durch – jene Schwächen. Aber es war dennoch ein Starkgeistiger, der sie hatte. Damals war auch die Blütezeit der Schriftstellertage. Ich habe ihnen zwar nie eine große Bedeutung zuerkannt, weder für die Förderung der Literatur, noch der Literaten. Der sachlich-berufliche Wert scheint mir gering, – dafür war aber ihr sozialer Wert groß. Die Schriftstellertage boten einen gemeinsamen Fruchtboden für das gegenseitige seelische Erkennen und Verstehen. Manch eine schriftliche Freundschaft oder gar eine Briefliebe (wie ich das nenne), fand hier durch persönliche Berührung, ihr Emporblühen oder ihr jähes Welken ... Ich habe da manche seltsame Dinge mitangesehen. Eines besonders eindrucksvollen Falles erinnere ich mich. Ein berühmter Schriftsteller hatte mit einer berühmten Dichterin einen literarischen Briefwechsel angefangen, der immer persönlichere und wärmere Grade bekommen und den am Ende Sehnsucht und Leidenschaft durchbebten. Jedoch waren diese Empfindungen noch nicht auf persönliches Erleben gestützt. Man hatte außer den Briefen nur gegenseitig die Bilder ausgetauscht. Da kam die langersehnte Begegnung und damit die – Enttäuschung, die das jähe Welken der schönen Seelenblüte brachte ... Er – sah statt eines reizvollen, jugendlichen Wesens eine wohlbeleibte Matrone vor sich, die das Gegensätzliche des jungen Feuers ihrer Briefe zu der verglimmenden Wärme ihrer alternden Persönlichkeit wohl fühlte, – und sie sah einen erwartungsvollen, enttäuschten, alten Herrn ... Sie hatten einander ihre Jugendbildnisse geschickt und hatten in ihren Briefen nicht ihr warmes, wahres Leben gegeben, sondern Schöpfungen ihrer Phantasie, die sie mit ihren eigenen Jugendidealen erfüllt hatten. Ich war eingeweiht in die Geschichte jener – Briefliebe und muß gestehen, daß, wie tragisch und peinlich sie auch für die beiden Beteiligten sein mochte, sie doch für den Beobachter etwas unwiderstehlich Komisches hatte, – die beiden sind längst tot, – und es wäre nicht indiskret, ihre Namen zu nennen, aber ich möchte den außer dieser Eitelkeitsschwäche durchaus ernsten und hochzuwertenden Schriftstellern nicht den Stempel der Lächerlichkeit aufdrücken; er wirkt oft vernichtender als Taten und Worte, die Haß und Geringschätzung diktieren.
Das mag etwa 1878 gewesen sein, als die Lebensbedingungen meiner neuen Heimat Elsaß-Lothringen zu einer direkten und schärferen Wendung dem Deutschen Reiche zudrängten ...
Das Reichsland war eben bisher von Berlin aus geleitet worden, – und Bismarck strebte eine lebendigere Zusammenwirkung der altelsässischen und der neudeutschen amtlichen und außeramtlichen Elemente an. Das parlamentarische Leben allein konnte diese Annäherung, diesen Zusammenschluß nicht bringen; es mußte eine fundamentalere Umgestaltung der Landesverwaltung eintreten ... Mein Mann hatte indessen außerordentlich regsam im öffentlichen politischen Leben des neuen deutschen Reiches gestanden, und seine staatsmännischen Gaben waren durch seine Wirksamkeit in den Parlamenten zu hoher Entwicklung gekommen. Bismarck war auf ihn aufmerksam geworden. Mein Mann gehörte ja auch zu den hervorragenden Mitgliedern der Partei, welche die realpolitischen Bestrebungen des Kanzlers jahrelang unterstützt hatte.
So ausgezeichnete Männer dem Fürsten Bismarck in den Personen des Staatsministers Delbrück und des Chefs des Reichskanzleramts für Elsaß-Lothringen, Herrn Herzog, auch zur Seite standen: es fehlte ihnen allen die intime Kenntnis der Personen und Verhältnisse im Reichslande und der Einzelheiten der laufenden Verwaltung, – und daraus ergab sich ein Gefühl der Inferiorität an derjenigen Stelle, die doch zur Vertretung der Politik, dem Parlament gegenüber, berufen war.
Auch an Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Oberpräsidenten (damals der höchste Verwaltungsbeamte des Landes) und dem Reichskanzleramt sowie zwischen dem ersteren und einigen Bezirkspräsidenten mangelte es nicht und es mochte dem Fürsten, wenn er dann zur Entscheidung angerufen wurde, wohl die Empfindung sich aufdrängen, daß es der maßgebenden Stelle an hinreichender Information fehle, und daß er seine Verantwortlichkeit für Verfügungen einsetze, deren Tragweite ganz zu übersehen, ihm unmöglich war. – In Besprechungen, die der Reichskanzler mit meinem, damals als Reichstagsabgeordneten einen großen Teil des Jahres in Berlin weilenden Mann über die Lage in Elsaß-Lothringen hatte, trat dieser Gesichtspunkt scharf hervor. Es knüpften sich daran Erörterungen, ob es nicht richtiger gewesen wäre, von der Schaffung des Oberpräsidiums ganz abzusehen und unter Beibehaltung der Departemental- und Präfekturverfassung, ein dem Reichskanzler untergeordnetes Ministerium in Berlin zu errichten. Das hätte dann auch zur Folge gehabt, daß für alle geschäftlichen Interessen der Landesbewohner, die eine Mitwirkung der Zentralinstanz erforderten, die Beziehungen zwischen der Reichshauptstadt und dem Lande viel enger und mannigfaltiger sich ausgebildet hätten, und somit Berlin dieselbe politisch leitende Bedeutung für das Reichsland gewonnen hätte, die in der französischen Zeit Paris für das Elsaß und dessen Verwaltung besaß. Auf eine so gestaltete Organisation zurückzugreifen, konnte freilich nicht mehr in Frage kommen, nachdem im Jahre 1874 der Landesausschuß berufen und 1877 mit erweiterten legislativen Befugnissen ausgestattet worden war. Denn neben der Landesvertretung in Straßburg müßte notwendig die Zentralinstanz stehen. Je mehr aber die Mitwirkung jener an der Gesetzgebung sich entwickelte und die des Reichstags zurücktrat, desto mehr mußte das Schwergewicht der parlamentarischen Vertretung die Verwaltung in das Land hineinziehen ... Auch entsprach diese dezentralisierende Entwicklung wohl mehr den Anschauungen des Fürsten Bismarck als eine straffe Zentralisation in Berlin.
Die Äußerungen des Fürsten Bismarck über die Heranbildung partikularistischen Geistes in Elsaß-Lothringen sind bekannt und mehrfach deutete er Puttkamer an, daß ein Reichskanzler an der Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten im Reichslande nur insofern Interesse habe, als er versichert sein müsse, daß diese mit der Reichspolitik im Einklang stehe, und insbesondere die Kreise der auswärtigen Politik nicht störe, – daß aber unter dieser Voraussetzung der Reichskanzler um die Verwaltung der Landesangelegenheiten im einzelnen nicht weiter sich zu kümmern brauche ... Über die Gesichtspunkte, die Bismarck veranlaßten, 1879 die Teilung der ministeriellen Befugnisse zwischen dem Reichskanzleramt und dem Oberpräsidium zu beseitigen und die Landesregierung mit dem Sitz in Straßburg einheitlich zu gestalten, hat er sich im Reichstag (Rede vom 21. März 1879) ausführlich ausgesprochen. Es würde aber irrig sein, aus den Worten des Fürsten, »er habe sich vorgenommen, den betreffenden Verfassungsfragen nicht eher näherzutreten, als bis sie aus dem Lande selbst angeregt würden; dies sei jetzt durch die Anträge Schneegans geschehen«, zu schließen, als habe Bismarck dabei dem Drängen der Autonomisten, die ihn für ihre Ideen gewonnen hätten, nachgegeben. Diese in der Allgemeinheit damals viel verbreitete, irrtümliche Anschauung scheint auch Petersen in seinem Buch »Deutschtum in Elsaß-Lothringen« zu teilen. In Wahrheit verdankt das Verfassungsgesetz von 1879 seine Entstehung und Ausgestaltung einzig und allein der Initiative des Fürsten – und der Antrag des Abgeordneten Schneegans wurde im Reichstag erst gestellt, als dieser sich vergewissert hatte, daß der Antrag dem Wunsche und der Ansicht des Kanzlers entspreche, und also auf Entgegenkommen zu rechnen habe ... Das Reichskanzleramt in Berlin war, entgegen der Ansicht des Fürsten, sehr zentralistisch gesonnen, aber Bismarck ließ sich durch keinerlei Bedenken in seiner Anschauung beirren. Er hatte seit Jahren den Gang der Dinge im Reichsland genau verfolgt und dabei Vertrauen in die loyale Haltung des Landesausschusses gewonnen. Daß er auf die Mitwirkung der deutschfreundlichsten Partei der Autonomisten, zählen konnte, war ihm selbstverständlich erwünscht. Er rechnete aber keineswegs allein mit der Haltung dieser, eigentlich nur im Unterelsaß festgewurzelten Partei. Genaue, an nichtamtlichen Stellen erhobene Informationen gaben ihm die Gewähr, daß die einflußreichsten politischen Persönlichkeiten auch im Oberelsaß es an ehrlicher Unterstützung der Landesregierung nicht fehlen lassen würden ... So kam das Gesetz vom 3. Juli 1879 zustande. Nach der Ansicht wohl aller bei dieser Formulierung Beteiligten hatte es nur den Charakter eines Übergangsgesetzes, wie auch der Fürst im Reichstag andeutete. Niemand hätte ihm eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren zuerkannt ... Der Einrichtung der Statthalterschaft war Bismarck anfänglich nicht geneigt. Er hielt sie für unnötig und wollte sich auf ein Ministerium in Straßburg beschränken, analog dem in Karlsruhe, mit einem leitenden Staatsminister und Ressortchefs ... Die Verbindung zwischen der Allerhöchsten Stelle und dem Ministerium sollte durch einen höheren Beamten mit dem Amtssitz in Berlin hergestellt werden.
Allein, es wurde geltend gemacht, daß die Zahl der dem Souverän zur Unterschrift vorzulegenden Entscheidungen über größtenteils unbedeutende Sachen viel erheblicher sei, als sonst in den deutschen Staaten gebräuchlich. Eine Entlastung des Kaisers und eine Beschleunigung des Geschäftsganges erscheine wünschenswert, indem einem Statthalter diese Gegenstände zur landesherrlichen Erledigung überwiesen würden.
Solche und andere Erwägungen bestimmten den Fürsten Bismarck, auf seiner ersten Ansicht nicht zu beharren. So kam in das Gesetz die Statthalterschaft als eine fakultative Institution. Es wäre wohl genügend gewesen, dem Statthalter verantwortliche Ressortchefs zur Seite zu stellen und die nun nicht mehr erforderliche Stelle des Staatssekretärs fallen zu lassen. So war es auch gedacht. Daß diese Stelle dennoch beibehalten wurde, hatte wohl überwiegend persönliche Gründe, nachdem entschieden war, daß ein hoher Militär zum ersten Statthalter des Reichslandes bestimmt wurde.
Das waren die Konstellationen, unter denen Manteuffel 1879 sein Amt antrat.
Das Ministerium war in folgender Weise zusammengesetzt. Der politische Leiter, der die landesherrlichen Akte des Statthalters gegenzuzeichnen hatte, verantwortlicher Minister war und übrigens auch ein Ressort im Ministerium führen konnte, hatte den Titel »Staatssekretär« und war erwählt in der Person des bisherigen Unterstaatssekretärs im Reichskanzleramt, Herrn Herzog. An der Spitze jedes Ressorts stand ein Unterstaatssekretär, und zwar hatte die Verwaltung des Inneren und Kultus: Herr von Pommer-Esche (bisher vortragender Rat im Reichskanzleramt). Die Finanzen hatte Dr. G. von Mayr (bisher Professor und Ministerialrat in München) und die Verwaltung der Justiz hatte mein Mann, Max von Puttkamer (bisher Erster Generaladvokat in Kolmar im Elsaß). Die Abteilung für Handel, Gewerbe usw. war noch unbesetzt, und es waren Verhandlungen im Gange, die dem Präsidenten des Bezirkstags vom Unterelsaß, Herrn Julius Klein, einem Elsässer, die Übernahme dieses Postens anbieten sollten. Fürst Bismarck hatte die bestimmte Absicht geäußert, Klein einen Platz als Unterstaatssekretär anzubieten.
Die Verhandlungen wurden durch den Unterstaatssekretär von Pommer-Esche geführt. Klein hatte sich im Prinzip zur Annahme bereit erklärt und nur um Bedenkzeit gebeten, um die Meinung seiner politischen Freunde (von der Autonomistenpartei) über diese wichtige Frage zu hören. Es erschien diesen sympathisch und auch staatsmännisch richtig, wenn einer der Ihren, ein hervorragend begabter Politiker und Verwaltungskundiger, durch Annahme des Unterstaatssekretärpostens direkten Einfluß auf die Angelegenheiten des Landes gewönne. Sogar aus den Kreisen der sogenannten Protestler, der Partei der stärksten Frontmacher gegen die geschichtliche Wendung der Dinge, soll Klein geraten worden sein, das Anerbieten der Regierung anzunehmen. Die Angelegenheit war durch die von Klein geäußerten Bedenken und die Verhandlungen darüber etwas vertagt worden. Anscheinend wurde die Zurückhaltung Kleins und das Aufwerfen von Bedenken als eine Ablehnung aufgefaßt – oder vielleicht erwartet, daß weitere Schritte zur Förderung der Angelegenheit von Klein ausgehen müßten. Jedenfalls wurde die Sache nicht weitergeführt und im negativen Sinne als erledigt betrachtet.
Klein selbst hat später zu Puttkamer (der übrigens nicht bei den Verhandlungen beteiligt war) geäußert, er habe seinerseits den Entschluß gefaßt gehabt, wenn die Verhandlungen, fortgesetzt worden wären, anzunehmen – und er hätte sich von der bestimmten persönlichen Empfindung nicht losmachen können, als wären seine Bedenken (deren Endstadium, den Entschluß, man nicht abgewartet habe) von manchem beteiligten Herren als Vorwand genommen worden, um seine Kandidatur totzumachen.
Klein stand überhaupt in den vordersten Reihen der politisch beachteten und gewürdigten Elsässer. Der Reichskanzler war auf Julius Klein, der in der Straßburger Stadtverwaltung wie auch im Landesausschuß und Bezirkstag eine bedeutende Rolle spielte, aufmerksam geworden. Klein, ein politisch und kirchlich liberaler Protestant, der eine umfassende und gründliche Kenntnis von Personen und Dingen, insbesondere in der Landeshauptstadt und im Unterelsaß, besaß, hatte jederzeit in uneigennütziger Weise erbetenen politischen Rat erteilt und hatte ein großes sehr verdientes Ansehen unter seinen Landsleuten sowie auch in Beamtenkreisen. Fürst Bismarck hatte auch den Gedanken gehabt, bei einer Vakanz im Bezirkspräsidium des Unterelsaß, Klein diese Stelle anzuvertrauen. Bei der vertraulichen Umfrage, die in Bismarcks Auftrag von meinem Mann gehalten wurde, begegnete er einer fast einmütigen Abgeneigtheit ... Der staatsmännischen Begabung und den ausgezeichneten persönlichen Eigenschaften Kleins wurde zwar ausnahmslos eine volle Anerkennung gegeben, aber man fand sachliche Gründe gegen seine Ernennung. Man argumentierte so: Klein ist im Oberelsaß ein unbekannter Mann, er kennt die Interessen und Bedürfnisse des Bezirks nicht und es wird keine gesunde Wechselwirkung zwischen ihm und dem Bezirk eintreten.
Außerdem war ihnen noch eine Erwägung von mehr allgemeinpolitischem Charakter ausschlaggebend: die Zeit sei noch nicht reif dafür, daß Elsässer in die höhere Verwaltung des Landes einträten, ihre persönlichen Beziehungen könnten zu leicht in Konflikt kommen mit ihren amtlichen Pflichten.
Später, viel später, als einmal Puttkamer über jenen Wunsch Bismarcks zu Klein sprach, äußerte letzterer, daß er damals die Stellung eines Bezirkspräsidenten, wenn sie ihm angeboten worden wäre, entschieden abgelehnt hätte, während er dagegen, wie schon oben angedeutet, den Posten eines Unterstaatssekretärs angenommen haben würde.
Mit dem 1. Oktober 1879 begann also nun die neue Ära für das Reichsland unter der Führung eines so bemerkenswerten und eigenartigen Staats- und Kriegsmannes wie Manteuffel.
Es würde zu weit führen, wenn ich in diesen Blättern meine, wie ich glaube, tiefe Erkenntnis von Manteuffels Psyche und überhaupt eine ganz eingehende Charakteristik seines Wesens geben wollte; das habe ich in meinem historischen Buch »Die Ära Manteuffel« getan, und ich verweise diejenigen, die besonderes Interesse für Manteuffel und seine Wirksamkeit (auch speziell in Elsaß-Lothringen) haben, auf dieses mein Buch. Vieles daraus werde ich natürlich übernehmen in diese Lebenserinnerungen und dem neuere Betrachtungen und Gedanken anfügen ...
Eine Natur wie Manteuffel mußte mit ihrer sehr scharf geprägten Eigenart, die viel mehr beherrschende Elemente in sich hatte, als solche, die sich anschmiegen, fügen oder unterordnen konnten, mehr zur Führerschaft als zur Gefolgschaft sich eignen; er strebte die erstere sogar, bewußt oder unbewußt, immer an. Ein ungemein starkes Selbstbewußtsein regierte all sein Denken und Handeln.
Das Selbstbewußtsein aber ist ein seelischer Zustand, der die mannigfachsten Ausgestaltungen in Eigenschaften erfahren kann: durch einige vergröbernde Linien ins Unschöne hin und durch verfeinernde ins Edle und Große hin. Die Entwicklung durch vergröbernde Linien würde aus dem Selbstbewußtsein etwa erzeugen: Herrschsucht, Eitelkeit, Dünkel, Ichsucht, Rechthaberei – und die Entwicklung durch verfeinernde Linien: Ehrgeiz, hohe Anforderungen an sich selbst, scharfes Pflichtgefühl, Fleiß, Anspannung aller Kräfte.
Gerade um dieses starken Selbstbewußtseins willen ist Manteuffel von seinen Zeitgenossen außerordentlich verschieden und mehr scharf als freundlich beurteilt worden. Aber dies Selbstbewußtsein darf auch nicht nur in seinen minder guten Wirkungen betrachtet werden, denn es war bei ihm zugleich das treibende Element, das ihn sehr früh schon hinaushob über das Mittelmaß. Es trieb alle seine geistigen Fähigkeiten zu regster Wirksamkeit empor, und so wurde das Strebende in ihm sehr bald zum Aufragenden ... Vorzüglich in den Kreisen seiner Fachgenossen, der Offiziere, wurde Edwin von Manteuffel nachsichtslos kritisiert.
Wenn ich zu einem ganz andern Urteil gekommen bin als hervorragende Militärs, wie z. B. General-Admiral von Stosch in seinen »Denkwürdigkeiten«, die zuerst in der »Deutschen Revue« veröffentlicht und dann auch in Buchform erschienen sind, so liegt das vor allem daran, daß ich den Marschall erst in der Periode kennenlernte und ihm nahetrat, wo sein Selbstbewußtsein in einem Läuterungsstadium erschien. Die Stellung eines Statthalters in Elsaß-Lothringen, die teils mit Herrscherbefugnissen ausgestattet ist, und die dem jedesmaligen Inhaber zum Repräsentanten des Kaisers macht, befriedigte den Ehrgeiz des Marschalls Manteuffel ganz. Darin liegt des Rätsels Lösung und die Erklärung dafür, daß mir, die ich ihn einzig als Statthalter kannte, sein Selbstbewußtsein in gemilderter Gestalt entgegentrat.
Unbefriedigter Ehrgeiz ist wie der Hunger. Die Gier des Trachtens schließt jedes ruhevolle Moment aus. Manteuffels stark bewußte Natur war ehrgeizig. Es war deshalb natürlich (wenn auch nicht immer schön), daß dieser Ehrgeiz, solange er hastig nach einer Herrenstellung in der Zeitgeschichte strebte, eine ganze Reihe unruhiger, unharmonischer Eigenschaften auslöste und auch Reibungen und Konflikte mit Personen erzeugte, die auf seiner rastlos vorwärts drängenden Bahn ihm den Weg kreuzten. Als er aber dann die herrschende Stellung, die seinen Ehrgeiz befriedigte, erlangt hatte, da entfalteten sich die großen Seiten seiner Natur frei, und die schrofferen wurden milder. – Aus den Aufzeichnungen des Generals von Stosch springt Manteuffels Bild in den unliebsamsten Linien hervor; die Auffassung ist scharf und unbarmherzig in ihrem Licht. Sein Urteil stammt eben, wie das der meisten Offiziere, aus der Zeit, wo der brennende Ehrgeiz nach historischer Herrenstellung noch unbefriedigt und unruhig flackerte und oft trübe Schlacken und grelle Lichter auswarf.
In einem Brief an Freytag sagt Stosch: »Ich wollte, Sie hätten mal vier Wochen unter Manteuffel zu leben. Sie würden es auch fast beleidigend empfinden, wenn Ihre Freunde glauben könnten, solche Naturen könnten Sie auf die Dauer beeinflussen. Fürstliche Gnade und Liebenswürdigkeit besitzt er, hat auch vielen Geist und erzählt vortrefflich aus seinen intimen Erlebnissen; aber, sobald man ihn näher kennt, wird er durchsichtig wie Glas, und man sieht, daß Mache und Reklamebedürfnis in ihm absolut überwiegen. Solchem Menschen kann man sich gar nicht hingeben. Sein Abschied von hier war wie an Aktschluß auf dem Theater.«
Der Vorwurf der Schauspielerei ist ein so weit verbreitetes und übernommenes Urteil geworden, daß wir es sogar von Leuten, die den Marschall gar nicht kannten, mit unfehlbarer Sicherheit hinstellen hörten. Um den schweren moralischen Vorwurf der »Schauspielerei«, also der bewußten Ausübung einer gespielten Rolle, erheben zu dürfen, muß man ihn doch wohl anders beweisen können als mit persönlichen Eindrücken. Es müßte zwischen Gesinnung und Handlung der Widerspruch bewiesen werden; es müßte bewiesen werden, daß das Dargestellte nur eine Maske der wahren Natur gewesen wäre, – und das ist niemals und nirgends geschehen ... Das etwas Gespreizte, Bewußte in Manteuffels Haltung und Rede hat wohl die Urteilenden dazu geführt, Absichtlichkeit und Berechnung auf Effekt darin zu sehen. Manteuffel war aber viel zu sehr Gefühlsmensch (man hat ihm ja auch immer seine Gefühlspolitik vorgeworfen) und viel zu sehr der inneren Nötigung großer Empfindungsströmungen Untertan, als daß er Zeit und Raum für die Berechnung hätte finden können. Eine Rolle, die man spielen will, muß man sich zurechtlegen und ausklügeln; – dazu aber war seine Natur viel zu eruptiv-sentimental.
Die Elemente seiner sehr komplizierten natürlichen Begabung waren so merkwürdig in ihrer Mischung, daß sie öfters widerspruchsvolle Handlungen zeitigten. Das Widerspruchsvolle ist aber in seiner Auflehnung gegen Regel und logische Berechnung oft das Interessanteste. Ob es in der Politik wirkungsvoll und fruchtbar für den Erfolg ist, steht dahin.
Der geistreiche Geschichtsschreiber Treitschke sagt einmal: »Die Größe der historischen Helden besteht in der Verbindung von Seelenkräften, die nach der Meinung des platten Verstandes einander ausschließen.«
Nun, das war bei Manteuffel der Fall, und ich bin allerdings geneigt, zu glauben, daß sich in diesem Ringen einander widerstrebender Gewalten, in diesem Wettstreit um die Oberherrschaft, die einzelnen Kräfte in der Übung maßen und reger zu großen Aktionen blieben.
Aus diesem lebhaften Kraftbewußtsein wuchs ihm wohl der Glaube an seine unfehlbare persönliche Wirkung auf andere. Es war immer einer seiner obersten Glaubenssätze im Leben und in der Politik gewesen, durch den persönlichen Kontakt intensive Einflüsse zu erzielen und dann auch in Wechselwirkung die Anregungen durch die andere Persönlichkeit als lebendige Erfahrung und Gewinn für sich zu erobern. So maß er dem Gespräch, sowohl in der Gesellschaft wie auch im politischen Leben, einen ganz besondern Wert bei. Überhaupt gingen seine Entschließungen oft mehr aus persönlichen Neigungen und Impulsen, als aus sachlichen Gründen und Erwägungen hervor. Dafür war seine Stellung zum Bischof von Metz, Monseigneur Dupont des Loges, die viel kritisiert worden ist, ein besonders plastisches Beispiel. Es würde über den Rahmen dieser Lebensaufzeichnungen hinausgehen, wenn ich die ganze Geschichte der Beziehungen zwischen Manteuffel und dem Metzer Bischof darlegen wollte. Ich möchte hier nur skizzieren, daß Manteuffel in seiner Sympathie und Verehrung für den klugen, vornehmen, feinen Kirchenfürsten sich oft viel zu weit hinreißen ließ und über die Grenzen des staatlich und politisch Heilsamen hinausging. Einigen Erfolgen, wie z. B. die Wahl des Koadjutors Fleck für den Metzer Bischof war, und des Bischofs Korum Wahl zum Bischof von Trier, standen auch mannigfache Fehlschläge entgegen, wie z. B. die Zulassung der Oblaten in Elsaß-Lothringen. Korum ward als hervorragende geistige Kraft besonders hoch von Manteuffel geschätzt, und er hielt ihn auch besonders befähigt zur Bischofswürde. Er hatte durch seine Fürsprache in Berlin die Wahl Korums entscheidend gefördert, aber er hatte sich aufs energischste dagegen verwahrt, denselben als Bischof in Elsaß-Lothringen zu sehen. Von Dupont des Loges wurde diese Wahl übrigens sehr enthusiastischerweise als ein Sieg der katholischen Sache im Kulturkampf aufgefaßt. Er schrieb: » On peut voir dans cet événement le commencement de la fin du »Culturkampf«. Le premier pas pour »aller à Canossa«, était le plus difficile, – et – le voilà fait.« Manteuffel wies dem Metzer Bischof eine solche Autorität zu, daß er ihm gegenüber, auch in wichtigen kirchlichstaatlichen Fragen, oft fast demütig sich unterordnend agierte und dann zu vergessen schien, daß er, als Repräsentant des Kaisers, selbst eine sehr bedeutende und ausschlaggebende Macht darstellte. Die Geschichte seiner Beziehungen mit dem Bischof von Metz ist leider sehr beweiskräftig dafür, daß er sich öfters zu starker Gefühlspolitik hinreißen ließ ...
Manteuffel führte überhaupt eine sehr, man könnte es am richtigsten bezeichnen: individuelle Verwaltung, die wohl von ernst erwogenen, aber so selbstherrlichen Gesichtspunkten ausging, als sie sich nur mit den festen Satzungen und Gesetzen vereinbaren ließen. Das Autokratische war bei ihm höchst seltsam gepaart mit dem strengen Gefühl für Disziplin und Subordination gegenüber dem Staat und dem Herrscher.
Sehr charakteristisch bei ihm war auch die Auffassung seiner Lebenssendung. Er war von dem Gottesgnadentum seiner Stellung und seiner Aufgaben überzeugt. Das ist starker, alter Glaube der Könige, und er gab ihm auch etwas zugleich Stolzes und Frommes. Er fühlte sich als Werkzeug der Göttlichkeit, aber auch als Vollstrecker höchsten, vorbestimmten Willens der Gottheit. Seine Ämter erschienen ihm weniger Belohnungen von weltlichen Herrschern als von einem überweltlichen, – was übrigens nicht ausschloß, daß er einer der königstreuesten Männer war.
Das preußisch-soldatische Selbstbewußtsein mit dessen hohen Rechten und Pflichten war stark ausgebildet bei Manteuffel; hatte er doch auch sein langes Leben (er war siebzig Jahre, als er als Statthalter nach Straßburg kam) von früher Kindheit (als Kadett) an, durch alle Grade eines Offiziers bis zu dem höchsten Ehrengrad des Generalfeldmarschalls, im Heere gestanden. Aus allen Stellungen hatte er das siegende Gefühl mitgenommen, daß das kleine Preußen Friedrichs des Großen vor allem durch seine soldatische Schulung und seine strenge und starke Militärkraft gewachsen war zu seiner Bedeutung im neuen Deutschen Reich. Das gab sich auch kund in seiner Auffassung der Entwicklung der Dinge durch den Deutsch-Französischen Krieg, in der er der hervorragenden Staatskunst Bismarcks nicht ganz den gebührenden Teil gegenüber den Verdiensten der Militärmacht und den Leistungen der Armeen zugestand. Er hat auch in Privatgesprächen wiederholt hervorgehoben, daß die öffentliche Meinung in Bismarck allzusehr den alleinigen Schöpfer der deutschen Einheit erblicke und die großen Geister und Mitschöpfer neben ihm, die Kriegshelden und Schlachtenlenker, dagegen ein wenig in den Schatten stelle.
Übrigens war diese an Mißgunst leise gemahnende Anschauung damals in Kreisen hochstehender Militärs sehr verbreitet.
Ein starker, dokumentarischer Beweis dafür findet sich niedergelegt in den Briefen Roons, die aus Anlaß von dessen hundertstem Geburtstag (30. April 1903) in der »Deutschen Revue« veröffentlicht sind. Eine Stelle dieser Korrespondenz, die an Roons Freund, Moritz von Blankenburg, einen der Führer der strengkonservativen Partei, gerichtet ist, kann als besonders kennzeichnend gelten. Sie wird relativ noch viel bedeutsamer, wenn man erwägt, daß Roon allezeit eine sehr hohe Schätzung für Bismarck hatte, und daß seinem Einfluß bei König Wilhelm zuzuschreiben ist, wenn dieser Bismarck (1862) als Leiter des Staatsministeriums nach Berlin berief.
Die Stelle in Roons Brief lautet: »Alle seine (d. h. Bismarcks) Klugheit, Energie und Gewandtheit wären ja ohne Moltke und die Armee bloßes diplomatisches Geklingel geblieben, über das Mit- und Nachwelt etwa wie über die Beustsche Großmannssucht geurteilt haben würden. Ob er sich dessen wohl klar bewußt geblieben ist auf dem hohen Piedestal, auf das ihn die närrische Welt gestellt hat? Ich zweifle. Sein König steht anders zu der Frage und zu seinen Erfolgen. Er weiß, wem er es zu danken hat, und sagt es öfters, als es grade nötig wäre. Bismarck erwähnt dessen nie, vielleicht weil er es als selbstverständlich, für überflüssig hält. Er gefällt sich in der allgemeinen Vergötterung und vermeidet daher alles, was sie beeinträchtigen könnte!«
Ganz ähnlich, vielleicht noch akzentuierter war Manteuffels Urteil über Bismarck. Des Marschalls Gerechtigkeitssinn und sein historisches Gefühl erkannten dem außerordentlichen Staatsmann wohl seine Größe zu, aber Manteuffel suchte doch öfters in Gesprächen und einmal in der Tat (Verbot des Fackelzugs zu Bismarcks siebzigstem Geburtstag) darzutun, daß er des Kanzlers Leistungen gegenüber denen des Heeres und seiner Führer von der Allgemeinheit für überschätzt hielt.
In Manteuffels Natur lag auch neben den bisher schon geschilderten Zügen eine starke Hinneigung und Begabung für diplomatische Verhandlungen. Und in der richtigen Erkenntnis dieses seines Talents hatte ihn sein König öfters mit diplomatischen Sendungen beauftragt. Der Feldmarschall hatte dabei einen hervorragenden historischen Sinn und auch Weitblick für geschichtliche Entwicklungen. Von seiner Berliner Zeit her war er aufs wärmste mit dem bekannten Historiker Ranke befreundet, dessen feiner und starker Geistigkeit er einen gewissen Einfluß auf sein Leben und seine Gedanken gönnte. Aus dieser innigen Geistesbeziehung haben die Kritiker, die seine Persönlichkeit im ungünstigen Licht schauten, die Behauptung hergeleitet, daß der große Berliner Geschichtschreiber dem Marschall Manteuffel für all seine politischen Missionen und überhaupt in bedeutenden Momenten, wo dessen Person in der Öffentlichkeit redend oder handelnd hervortrat, Direktiven geschrieben hätte ... Daß Manteuffel mit dem befreundeten Gelehrten über interessante Fragen seines beruflichen Lebens gesprochen hat, auch vielleicht hie und da Rankes Urteil und Rat einigen Einfluß gönnte, wäre nur natürlich gewesen, und man kann gern geneigt sein, das zu glauben, – aber es hätte ganz außerhalb der Möglichkeit von Manteuffels Natur gelegen, sich wie eine Puppe an den starken Fäden des Willens eines anderen leiten zu lassen. Schon als Rittmeister (und damals Adjutant des älteren Prinzen Albrecht von Preußen) hatte er mit feurigem Anteil die Vorlesungen Rankes besucht. Daran schloß sich die persönliche Bekanntschaft, die dann zu inniger Freundschaft wuchs. Die beiden Männer waren in ihrer geschichtlichen und Weltanschauung durchaus auf gleicher Basis. So war zum Beispiel die Erfassung der sittlich-religiösen und politischen Bedeutung Preußens und der Glaube an dessen Bestimmung, die Suprematie in Deutschland zu haben, beiden gemeinsam ... Manteuffel las stets in freien Stunden mit großer Vertiefung und »fast leidenschaftlicher Hingabe« Rankes historische Werke, von denen ihm eines der liebsten Bücher das war, welches den Helden des Dreißigjährigen Krieges, Wallenstein, behandelt. Der große Historiker hatte übrigens nicht nur Einfluß auf den Marschall, sondern dieser hatte, wie es wenig bekannt ist, Einfluß auf Rankes Arbeiten, wie dieser es in Tagebuchblättern besonders ausspricht und ihm dafür dankt. Es war ein lebendig regsamer, unaufhörlicher geistiger Kontakt zwischen beiden Männern. Eine wechselseitige Beeinflussung ist stets von beiden Herren anerkannt worden; aber nie und nirgends ist, wie von Gegnern des Feldmarschalls behauptet wurde, ein Beweis gegeben, daß Manteuffel von Ranke Anleitungen oder geschichtliche Direktiven erhalten hätte. Im Gegenteil finden sich in Rankes Tagebuchblättern, anläßlich Manteuffels Tode am 17. Juni 1885, Sätze, die beweisen, daß der Berliner Historiker den gestorbenen Freund nicht nur für einen seiner verständnisvollsten Leser, sondern auch für einen geistig an seinen Arbeiten Mitwirkenden betrachtete. Ranke schreibt nämlich: Manteuffel hatte mehr Verständnis für meine Schriften, eine größere geistige Sympathie, als mir sonst in der Welt zuteil geworden ist. Bei meinem weltgeschichtlichen Unternehmen glaubte ich, wenn es mir gelänge, es so weit zu führen, für den letzten Teil auf seine Teilnahme rechnen zu können, denn er hatte in den schwierigsten Verwicklungen mitgearbeitet und war mit einem vortrefflichen, sehr präzisen Gedächtnis begabt. Er hätte mir da unendlich nützlich werden können. Aber Gottes Wille war das auch nicht. Wie weit bin ich noch selbst von diesen Regionen entfernt. Schwerlich werde ich sie erreichen. Aber auch für den bisher zurückgelegten Weg war mir seine Teilnahme und sein Beifall von unschätzbarem Wert.« ... Hierbei sei auch ein Streiflicht darauf geworfen, wie sympathisch dem Marschall überhaupt die Gestalt des »Friedländers« war. In des Reichskanzlers Bismarck Familie wurde im vertrauten Kreise Manteuffel nur der »Friedländer« genannt. (So erzählt Keudell in seinem Buch: »Fürst und Fürstin Bismarck«.) Manteuffel war den schönen Künsten gegenüber eine nur wenig verständnisvolle Natur. Die Gebiete seiner stärksten geistigen Entfaltung und Betätigung waren eben die Kriegs- und Staatskunst. Schiller war der einzige Künstlergeist, der ihn hinüberzog in seine Kunst: und auch dies nur um eines geschichtlichen Grundes willen: weil Schiller die Wallensteingestalt in Meisterdramen lebendig gemacht hatte für die Nachwelt. Wallenstein aber war, wie schon gesagt, die historische Lieblingsgestalt des Marschalls. Ich habe das eigentlich nie ganz verstanden, denn der große Herzog ist doch eine stark autokratische Figur, die sich in bewußter Eigenherrlichkeit gegen den Kaiser auflehnt und eigenste Herrengelüste gegen Gesetz und Ordnung mit Waffen des Geistes und des rauhen Kriegskampfes durchsetzte. Manteuffel dagegen war die denkbar königs- und gesetzestreueste Natur; dazu von einer tiefen Frömmigkeit, die sich beugte vor den von Gott eingesetzten Obrigkeiten. Er liebte die Wallenstein-Persönlichkeit, das Schillersche Drama, und auch alles, was zu dem Herzog von Friedland in Beziehung stand. Manteuffel hatte zum Beispiel wenig Verständnis für Musik, aber das Schubertsche Lied: »Der Eichwald brauset« liebte er schwärmerisch, und ich hab' es ihm viele, viele Male singen müssen, weniger, wie ich glaubte, der herrlichen Komposition oder meines Gesanges wegen, als: weil es Theklas Lied aus »Wallenstein« ist ... Nur selten kam der Marschall zu den »Kleinen Abenden« seiner Tochter, der Freiin Isabella, in die oberen Säle. Nur wenn irgendeine durchreisende interessante Persönlichkeit anwesend war, der seine besondere Sympathie gehörte, – vielleicht auch manchmal, wenn es ihm zu einsam in seinem ernsten Arbeitszimmer ward ... Seine Gemahlin, eine bedeutende, feingeistige Frau, die mit ihm in verständnisvollster, glücklicher Ehe lebte, war im ersten Monat seiner Statthalterschaft gestorben, und er fühlte sich nun, mitten im hochwogendsten geselligen Treiben und im dauernden Kontakt mit interessanten politischen Persönlichkeiten und Aufgaben doch tief vereinsamt.
Die verhältismäßig wenigen Male, daß der Marschall bei den »Kleinen Abenden« erschien, sind mir tief in die Erinnerung geprägt, denn nie gab sich des stolzen Mannes Wesen reicher und anziehender als in solchen Stunden ... Da war er nicht mehr die entrückte historische Gestalt, die gleichsam über der Zeit wandelte, er mutete nicht mehr etwa wie eine bedeutende Abstraktion an, sondern er stand menschlich warm mitten in der lebendigen Stunde. Seiner Gestalt war dann gleichsam das Monumentale genommen. In den herben Zügen, die sonst leicht etwas statuenhaft wirkten, leuchtete dann ein herzgewinnendes Lächeln. Jugendstrahlen gingen von dem grauumbuschten Haupte aus. Ich erinnere mich sogar einer heiteren reizenden Szene mit dem ernsten Mann. Eines Abends (ich trug ein rötliches Atlasgewand, mit goldenen Blümchen eingewebt), mochte ihm wohl mein Kleid besonders gefallen oder mich vielleicht besonders gut kleiden. Er sah mich lange an und sagte dann, heiter sinnend: »Haben Sie eigentlich einen Orden?« Als ich lächelnd verneinte, meinte er: »Ach, warten Sie einen Augenblick, ich muß Ihnen etwas holen!« Er verschwand dann auch wirklich und brachte einen Kasten in Maroquinleder. Er öffnete ihn; es lag eine kunstvoll gearbeitete goldne Ordenskette mit einem Orden darin. Diesen Schmuck legte er mir um den Hals mit den Worten: »Derlei kleidet eine schöne junge Frau viel besser als einen alten Feldmarschall!« Ich mußte dann die Kette den Abend über umbehalten, – und Manteuffel hatte eine fast kindliche Freude bei dem Anblick. Leider habe ich den Namen des Ordens vergessen. Ich glaube, es war ein italienischer oder russischer Orden. Manteuffel war ja übrigens auch russischer Feldmarschall. In der kleinen »Hofhaltung und Regierung« des Statthalters waren nicht nur interessante Persönlichkeiten, sondern sie zog auch viele bemerkenswerte und vornehme Personen von draußen in den Bannkreis von Straßburg. Die Gesellschaft dort stellte damals ein reich bewegtes und buntes Gemälde dar; wie ein großes historisches und soziales Gruppenbild. Das Kulturgemälde einer hochbedeutsamen Geschichtsepoche! Einige Gestalten von allgemeinerem Interesse möchte ich hier nachzeichnen und ihr Bild in diesen Blättern lebendig erhalten.
In dem kleinen »Civil- und Militärcabinet«, wie man es nannte, war die hervorragendste Gestalt: des großen Kanzlers Sohn, Graf Wilhelm Bismarck. Er war in seiner temperamentvollen Beweglichkeit eine sehr aktive Gestalt. Sorglose, leichtherzige Studentenfröhlichkeit, vereint mit edelmännischen Allüren, machte ihn für jeden Salon zu einer sympathischen Gestalt. Der Kopf gemahnte an die charaktervollen Züge seines herrlichen Vaters. Besonders anziehend an ihm waren die Augen: große, leuchtende, feuchte Blicke ... Angeli, der berühmte Wiener Maler, der damals in Straßburg war und Manteuffels Bild für die Nationalgalerie malte, nannte Wilhelm Bismarcks Augen »Seelöwenaugen«. Graf Wilhelm Bismarck, von liebenswürdigem, oft hinreißendem Humor, war ein sehr gescheiter und lebhafter Mann, aber es fehlte ihm damals doch an der nötigen geschlossenen Konzentration um seine Intelligenz in bedeutender Weise wirksam zu machen. Ich habe Bismarcks anderen Sohn, Herbert, nicht gekannt, aber aus dem gewöhnlich sehr treffsicheren Urteil meines Mannes, der beide gut kannte, möchte ich schließen, daß die ursprünglich reiche Begabung, die starke rasche Auffassung größer bei Graf Wilhelm war, während bei seinem älteren Bruder die geistige und ethische Schulung ernster und strenger war. Graf Wilhelm gemahnte jedenfalls in seiner urwüchsigen, heißen, außerordentlich regsamen Art an seinen großen Vater; auch äußerlich war die Ähnlichkeit auffallend ... Seine Berufung in das Statthalterbureau, in Manteuffels nächste Nähe, ist von Kreisen, die dem Marschall übelwollten und seine Stellung zu Bismarck als scharf gegensätzlich hervorzuheben bemüht waren, gedeutet worden als eine Überwachung durch den Reichskanzler, der als von stetem Mißtrauen gegen Manteuffel erfüllt dargestellt wurde. Diese Auffassung trat wohl aus allgemein deutschen politischen Wohlfahrtsgründen nur in privaten Unterhaltungen hervor. In der Öffentlichkeit wurde ihr nur in den ausländischen Zeitungen, zum Beispiel im »Temps«, Ausdruck gegeben. In Wahrheit hatte Graf Bismarcks Berufung als Manteuffels »Ziviladjutant« wohl den Grund, dem Sohn des Reichskanzlers, der zur Verwaltungslaufbahn bestimmt war, in das neue und interessanteste Gebiet deutschen Verwaltungsdienstes direkten Einblick zu gewähren und ihm dadurch ein wichtiges »Erfahrungskapital« zu beschaffen. Übrigens war Graf Wilhelm nur einige Jahre in Straßburg und wurde dann zu seinem Vater nach Berlin in die Reichskanzlei berufen.
Eine sehr interessante Gestalt war der damalige Chef des Generalstabs des XV. Armeekorps, von der Burg. (Er war auf besonderen Wunsch des Marschalls, der ihn schon als Chef des Generalstabs in Nancy gehabt hatte, in der neuen Stellung.) Burg war einer der Generale mit internationaler Bildung und einer interessanten Vergangenheit. Er hatte den Feldzug in Mexiko, attachiert der französischen Armee, mitgemacht, war längere Zeit in Paris bei der Botschaft und im Französisch-Deutschen Krieg mit besonderen und ausgezeichneten Aufträgen betraut gewesen. Burg war eine sehr charakteristische Erscheinung mit kräftiger Adlernase und scharfblickenden Augen, sehr aufrecht und martialisch von Haltung. Bei den Offizieren und überhaupt in der Gesellschaft war er etwas gefürchtet durch seinen derb-offenen Ton und seine oft beißend sarkastischen Reden. Er war später Kommandierender General, und ist nun – schon seit langen Jahren tot ... Er war großen, geselligen Festen sehr abhold, und da er solche in seiner Stellung geben mußte, ließ er auf die Einladungskarten seinen Willen drucken, daß sie pünktlich und bald beendet sein möchten. Bei Balleinladungen war zum Beispiel unten die Notiz beigedruckt: »Ende halb eins!« Wehe, wenn sich dann noch ein Offizier oder eine Offiziersfamilie fünf Minuten länger verweilt hätte! Ich, als »Zivildame« und ein Liebling von ihm, habe mir manchmal das kleine Vergnügen gemacht, eine Viertelstunde länger zu bleiben. Dann kämpfte Ritterlichkeit und Sympathie mit dem Widerwillen gegen Geselligkeit, und es war lustig, die kleinen Kampfgeisterchen auf den ehernen, kühnen Zügen spielen zu sehen ...
Eine interessante Gestalt, die in den letzten Jahren von Manteuffels Tätigkeit im Reichslande, von 1883 an, unter seinen militärischen Adjutanten wirkte, war Graf Hutten-Czapski, damals Rittmeister der Gardehusaren. Er entstammt einer alten Familie und hatte, als überzeugter Katholik, unter anderem auch viele Beziehungen zu Rom und zum Vatikan. Er besuchte in Paris einige Jahre das » Lycée Bonaparte«, und ward dann von einem protestantischen Pfarrer bis zu seinem siebzehnten Jahr erzogen. Reich, unabhängig, unverheiratet, von starkem Interesse und Verständnis für politische und diplomatische Fragen, ward er besonders vom Fürsten Hohenlohe, dessen Person er noch als Adjutant beigegeben war, öfters mit wichtigen kirchlichen und diplomatischen Missionen betraut. Er ist von hoher Intelligenz, von kosmopolitischer Bildung und ein tadelloser Edelmann. Vor Jahren nahm er seinen Abschied als Oberstleutnant. Er verlegte dann seinen Wohnsitz nach Berlin, wo er als Mitglied des Herrenhauses politisch sich wirkungsvoll betätigte. In dem Schauspiel: Das neue Reich Polen, das von Deutschland und Österreich so selbstlos und in schöner Freiheit inszeniert wurde, hat er, solange es unter deutscher Verwaltung stand, eine edle und eifrige Tätigkeit entfaltet, als Kurator der neuen Universität und der Technischen Hochschule. Das Schauspiel hat längst tragische und ins Häßliche verzerrte Linien bekommen und alles deutsche, edle Wesen ist aus ihm entfernt worden. Graf Czapski, der übrigens auch Schloß-Hauptmann von Posen war, lebt nun wieder in Berlin; er ist vor längeren Jahren auch zum Wirklichen Geheimrat mit dem Titel Exzellenz ernannt.
Der leitende Minister des elsässisch-lothringischen Ministeriums, Staatssekretär Herzog, erinnerte in seiner Erscheinung an einen Marquis aus der Rokokozeit. Sein grauweißes Haar, wie mit Puder bedeckt, seine funkelnd schwarzen Augen und die etwas gespreizte Art seines Wesens, die bewußt zierliche Haltung erweckten äußerlich jenen Eindruck. Sein geistiges Wesen freilich erinnerte durchaus nicht an einen Rokokomarquis ... Wohl hatte Herzog feinhumanistische Bildung und war ein sehr gescheiter Mann, – aber er war dabei ein starrer Bureaukrat mit dem Dogma der Unfehlbarkeit eines hohen Beamten.
Er war aus einfacher kleiner Familie (in Schlesien) hervorgegangen und hatte die natürlichen Gaben von Talent und Intelligenz scharf in die autodidaktische Schule seiner Energie und eines großen Ehrgeizes genommen und dadurch eine starke Ernte von Kenntnissen und Erfahrungen gewonnen.
Da sein geistiges Wesen und alles, was er mit ihm an äußeren Ehren und staatlichen Ämtern und Würden erlangt hatte, Ergebnis strenger Selbstschulung und einer rastlos hohe Ziele erstrebenden Kraft war, so ist es psychologisch verständlich, daß er auf sein Selbst stolz war.
Jemand, der seinem Leben gegenüber immer Meister gespielt hat, fühlt sich auch leicht als Meister andern gegenüber. Herzog betonte gern das Herrschende, das er durch die Höhe seiner Stellung gewonnen hatte; aber er übertrieb es, weil er, wie alle eitlen Naturen, sein Ich als eine inkommensurable Größe gegenüber allen andern Menschen empfand. Seinem etwas steifen und eigenwilligen Wesen waren Schmiegsamkeit und Anpassungsfähigkeit fremd. Das wurde ihm bald zur Schicksalswendung in seiner stolzen Laufbahn.
Er begegnete in dem Feldmarschall-Statthalter einer auch stark selbstbewußten Persönlichkeit, ohne aber deren große Züge zu besitzen: den weiten historischen Blick und den idealistischen Schwung – vor allem aber war er auch ohne den Hintergrund einer unvergeßlichen geschichtlichen Vergangenheit.
Beide hohen Ämter, des Statthalters und des Staatssekretärs, waren mit Machtbefugnissen belehnt; das des Statthalters seiner Bestimmung nach mit viel höheren.
Herzog war unverheiratet, mithin fehlte ihm das große erzieherische Moment des Familienlebens; denn die tägliche Übung von Rechten und Pflichten in großen und kleinen Fragen des Lebens bewahrt Geist und Charakter vor dem Erstarren in unfruchtbarer Ichsucht. Herzog machte den Eindruck einer hochintelligenten, aber im engen Kreis seines Ichs starren und eigensinnigen Kraft. In der Gesellschaft wirkte er denen gegenüber, die er sich überhaupt nahekommen ließ, sehr anregend, – und als Erscheinung war er vornehm-sympathisch. – Die Dinge und Verhältnisse im Reichsland waren in neuer, fester Bahn, und überall machte sich die starke Wechselwirkung geltend zwischen dem edlen Willen und lebendigen Geist dessen, der an Landesherrn Statt waltete, und den Bewohnern des Reichslandes.
Manteuffel tat durch seine fortdauernden Fahrten ins Land kund, daß er sich organisch verbunden fühlte mit dessen reich entfaltetem Leben und der gesamten Kultur. Und weil dem Lande dies stets lebendig ins Bewußtsein geführt ward, wuchsen ihm naturgemäß auch Vertrauen und Sympathie.
Während sich so die Beziehungen zwischen Statthalter und Land enger und klarer gestalteten, zogen in der inneren Verwaltung, das heißt zwischen dem Statthalter und dem Leiter des Ministeriums, Trübungen und Wolken auf, die rasch anwuchsen zu einem Wetter, das bald mit Blitz und Schlag sein stark explosives Wesen zeigte. Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, wie ausgeprägt autokratisch die beiden Persönlichkeiten der höchsten Regierungsverweser im Reichsland waren. Die Kreise ihrer Machtbefugnisse grenzten, wenn auch die des Statthalters natürlich größer waren, eng aneinander und gingen teils ineinander über. Kollisionen und Konflikte konnten leicht eintreten, wenn der Wille des Höheren nicht entgegenkommend und der des ihm Untergeordneten nicht schmiegsam genug war. Und solche Konflikte entstanden zwischen Manteuffel und Herzog. Es ist nicht bekannt geworden, in welchen Prinzipienfragen etwa sich der Gegensatz so zum Scheiden schroff bemerkbar machte, und ob der Konfliktsgrund überhaupt in solcher Gegensätzlichkeit lag. Ich bin geneigt zu glauben, daß er sich aus der grundverschiedenen geistigen Eigenart der beiden Herren ergab und aus der daraus resultierenden Welt- und Menschenauffassung. Manteuffel, die energische, tatfreudige Soldatennatur, ein Staatsmann, dessen Verwaltungskenntnisse empirischen Wesens waren, und dessen Taten und Entschlüsse mehr dem impulsiv lebendigen Gefühl als der besonnen erwägenden Verständigkeit entsprangen, und daneben Herzog, der kühle, gemessene Bureaukrat, der korrekte Theoretiker, der Denker vom grünen Tisch! Und der einzige ihrem geistigen Wesen gemeinsame Zug, der autokratische, mußte diese so verschiedenen Männer nur noch mehr voneinander entfernen.
Bei Herzogs im Frühling 1902 erfolgtem Tod, als sich die Presse eingehender mit den Verdiensten des bedeutenden Beamten beschäftigte, ist mehrfach die Ansicht laut geworden, daß Herzog bei seinem kurzen Zusammenwirken mit Manteuffel (neun Monate war ersterer Staatssekretär in Elsaß-Lothringen) sich absolut nicht einverstanden erklären konnte mit der sogenannten »Notabelnpolitik« des Statthalters, – daß er im Gegenteil das große Entgegenkommen Manteuffels als eine sentimentale Schwäche gemißbilligt habe, und daß dies der eigentliche Grund des Konfliktes und Bruches zwischen den beiden Herren und der Demission Herzogs gewesen sei. Doch erscheint diese Auffassung nicht recht wahrscheinlich und zutreffend, weil jene Richtung in Manteuffels Politik in der ersten Zeit seiner Statthalterschaft noch gar nicht besonders scharf hervortrat. Viel eher ist anzunehmen, daß gewisse Maßregeln des Statthalters, wie z. B. die Wiederherstellung des Kleinen Seminars in Zillisheim und die Behandlung der Optantenfrage, einen so großen Gegensatz der prinzipiellen Auffassung mit der des Staatssekretärs bekundeten, daß ein weiteres Zusammenwirken der Herren unmöglich und Herzogs Abschied nötig gemacht wurde. Indessen gehört auch dies nur ins Reich der Vermutungen, und ich komme auf meine erste Ansicht zurück, daß die Gegensätzlichkeit zwischen Statthalter und Staatssekretär sich ganz naturgemäß aus ihrem fundamental verschiedenen geistigen Wesen ergab. Jeder sah in dem andern seinen geborenen Antipoden und zugleich eine gewisse feindliche Macht, die die Grenzen der Wirksamkeit des andern beschränken wollte.
Die Bestätigung dieser Auffassung wurde mir in direkten persönlichen Unterhaltungen, die ich (ein interessantes Zusammentreffen!) an demselben Nachmittag, am 10. Juli 1880, mit dem Statthalter und mit dem Staatssekretär anläßlich von Besuchen der beiden Herren bei mir hatte.
Manteuffel war am 8. Juli von seiner alljährlichen Karlsbader Frühlingskur, mit Nachkur auf dem Dotationsgut Topper, nach Straßburg zurückgekehrt. Die Dinge hatten sich so rasch entwickelt, daß eine eigentliche Staatssekretärkrisis gar nicht bemerkbar wurde, sondern fast mit dem Auftreten der Rücktrittsgerüchte auch schon die Lösung der Frage im negativen Sinne erfolgte. Am 10. Juli wurde die Verabschiedung Herzogs offiziell bekanntgemacht. Am gleichen Tage empfing er eine Deputation der Universität und tags vorher die Herren vom Ministerium, die ihm Lebewohl zu sagen kamen. In der Ansprache, die er den letzteren hielt, lag eine herbe Kritik des ihm unfreiwillig gekommenen Abschiedes. Am 11. Juli verließ Herzog bereits Straßburg und das Elsaß.
Ich, die ich zu Manteuffel und Herzog in besonders freundlichen Beziehungen stand, empfing also am 10. Juli nachmittags erst den Besuch des Staatssekretärs, seinen Abschiedsbesuch; und als Herzog kaum eine halbe Stunde fort war, fuhr der Marschall Manteuffel vor, wohl zur Begrüßung nach monatelanger Abwesenheit.
Beide Herren kannten mein verständnisvolles Interesse für alle Fragen elsaß-lothringischen Lebens, und beide konnten auch auf meine warm persönliche Anteilnahme zählen. So kam es denn, daß jeder der Herren mit mir die »aktuelle Frage« in höchst individueller Beleuchtung behandelte, und es hat wohl keiner der Zeitgenossen jeden der beiden Beteiligten der Landesregierung unter dem frischen Eindruck des Geschehenen mit solcher Unmittelbarkeit und in so vertraulichem Ton über diese Fragen reden hören.
Herzog war, aus der gemessenen, etwas kühl wirkenden Art, die ihn sonst kennzeichnete, gedrängt, von einer Erregung, die alle seine inneren Kräfte gewissermaßen aus den Grenzen rückte, die seine Selbstdisziplin sonst als fest gegeben zeichnete. Sein Selbstbewußtsein war tief verletzt. Er sprach es in bitteren Worten aus, daß man ihm, der Kenntnis und Verständnis für die reichsländischen Fragen in deren jahrelanger Behandlung als Direktor im Reichskanzleramt für Elsaß-Lothringen bewiesen habe, in Straßburg keine Mitberaterschaft gönne. Man habe ihn zur ausführenden Hand eines selbstherrlichen Willens herabdrücken wollen, – eines Willens, der weder Widerspruch noch Einmischung dulde. Und doch fühle er sich nicht nur als Berater des an Stelle des Landesherrn Regierenden, sondern es liege in seinen Amtsbefugnissen, auch Mitwirkender im Rat zu sein. Offenbar war es auch Edleres als nur ein verletztes starkes Selbstgefühl, das den Staatssekretär bei seinem Abschied bewegte, und das er der ihm freundschaftlich gesonnenen Frau in bewegter Rede aussprach. Es war das Gefühl, jäh unterbrochen zu sein in einem Lebenswerk durch – einen ihm überlegenen Willen. Denn allgemach hatte sich vom grünen Tisch in Berlin her, von wo er die reichsländischen Angelegenheiten von 1870 bis Oktober 1879, also volle 9 Jahre, geleitet hatte, in ihm ein väterliches oder doch vormundschaftliches Gefühl der Verantwortung für Elsaß-Lothringen entwickelt. Herzog fühlte sich verwachsen mit dem Reichsland, und dies Empfinden war noch lebendiger in ihm geworden, seitdem er in unmittelbarer Wirksamkeit im Lande lebte.
»Es tut mir weh, dies Land so früh verlassen zu müssen« – »Es bleibt ein Stück von meiner Seele hier« ...
Aus solchen Worten sprachen Empfindungen, die vielleicht seine verschlossene, kühle Natur nie zum Ausdruck gebracht hätte (und wohl auch gegen andere nie zum Ausdruck gebracht hat), wenn die Stunde und die ganze Konstellation der augenblicklich gegebenen Bedingungen nicht mächtig in ihm gewirkt hätten. Es war eine jener seltenen Stunden, wo eine sonst stolz geschlossene Seele, unter dem elementaren Naturgebot des Sturms, der von außen und innen an ihr rüttelt, fast unbewußt ihre geheimen Tiefen öffnet ... Bei einem Mann wie Herzog wirkte das sehr ergreifend.
Ich habe für des ersten reichsländischen Staatssekretärs Charakter und Geistesart immer eine hohe Schätzung gehabt und dem feingebildeten, klugen Mann auch Sympathien geschenkt, – aber der Feldmarschall Manteuffel war mir allezeit in seiner vielseitigen Geistigkeit und seinem reicheren und feinen Gefühlsleben eine ungleich anziehendere Natur, mit der ich mich auch in einigen Zügen wahlverwandt fühlte, und deren komplizierte, interessante Eigenart mich mächtig fesselte.
Am Nachmittag des 10. Juli habe ich, wie nie vorher und nachher, die tiefe Gegensätzlichkeit jener beiden Naturen empfunden, – und wenn auch die Unterredung mit Herzog mir den kühl gemessenen Mann in wärmerem Licht erscheinen ließ: die Ansicht ist doch nicht in mir gewandelt worden, daß Herzog wie eine Abstraktion wirkte gegenüber der starken Lebendigkeit des alten Feldherrn, dem frische Tatkraft, gleichsam wie eine unsterbliche Jugend, Körper und Geist belebte ... Schon das äußere Bild, wie er in den Saal trat, sich gewandt verneigte, die Hand küßte und angeregt plauderte, war nicht das eines Mannes von 70 Jahren, in dessen Vergangenheit so viele Taten im Felde, wie mit der Feder, – so viele Kämpfe wie Siege lagen, dessen Geist und Körper sich also in rastloser Übung der Kräfte geregt hatten! Keine Müdigkeit, keine Erschlaffung war sichtbar in seinem Wesen; straff gespannt waren alle Sehnen des Leibes, alle Fäden des Geistes. In ihm war alles Wille und Schwung, Tatkraft und Gedankenleben, und an jenem Tag besonders! Es war ja auch ein Kampf, wenn auch ein still geführter, zu seinem Ende gekommen, und – er war Sieger ...
Dennoch hatte ich vom ersten Augenblick seines Eintritts in den Salon an das unabweisliche Gefühl, als empfände Manteuffel jenen Sieg als keine reine Freude, und als suche er ihn vor sich und andern zu rechtfertigen, und das trat dann nach einem kurzen Hin und Her der Unterhaltung auch klar hervor. Es drängte alles wie ein Präludium auf ein Hauptthema hin. Manteuffel, der nichts von dem vorhergegangenen Besuch Herzogs wußte und wohl auch nicht ahnte, daß der verschlossene Mann so rückhaltlos und mit einer so leidenschaftlichen Bitterkeit von seinem stark verletzten Selbstgefühl gesprochen habe, begann nun seinerseits die Verabschiedung des Staatssekretärs zu besprechen. Das liegt jetzt lange, lange Jahre zurück, und das Leben hat an mir eine ganz seltene Fülle interessanter Ereignisse vorübergeführt, aber die Leuchtkraft der Erinnerung an den 10. Juli 1880 ist noch so stark, daß sich jene Stunden hell und wie gegenwärtig erhalten haben ...
Manteuffel kannte mein tiefes Interesse für alles, was Politik, Kunst, Wissenschaft und überhaupt geistiges Leben heißt, und er sprach zu mir so vertraulich, daß ich unwillkürlich ein Gefühl hohen Stolzes empfand. Denn um Manteuffels Gestalt lag es wie ein weltgeschichtlicher Hauch, und alles, was er redete und tat, war wie von historischem Geist getragen. Ich habe es später oft erfahren und erkannt, daß sogar seine Irrtümer nie aus kleinlichen Regungen hervorgingen, sondern daß sein geistiges Wesen immer große Züge behielt. Und der Feldmarschall hub nun an, von dem Unfehlbarkeitsdogma der Berliner Geheimräte zu sprechen, das viel starrer sei als das von Rom. Er faßte den Geheimrat als den Typus bureaukratisch begrenzter Engherzigkeit auf, und meinte, Herzog sei trotz seiner hohen Staatsstellung doch immer »Geheimrat« geblieben. Der Staatssekretär, führte Manteuffel aus, habe den Statthalter zu einer Art Repräsentationsfigur entwerten und die eigentliche politische Leitung der Geschäfte langsam und fest in seine Hände spielen wollen. »Das aber,« sagte der alte Feldherr mit einem eigentümlich stolzen und starken Ton, »weist meine ganze Natur ab, – und es widerspricht nicht nur meiner Vergangenheit und dem Geist, in dem ich jede mir gestellte Aufgabe zu lösen suchte, sondern auch dem innersten Wesen dieser Aufgabe selbst. Herzog wollte mich nach dem alten Satz behandeln, den Thiers gern und glänzend verfocht: » Le roi règne, mais ne gouverne pas.« Dieses rex regnat, sed non gubernat der Lateiner, das schon im siebzehnten Jahrhundert im polnischen Reichstag gesprochen wurde, ist ja die Basis konstitutioneller Monarchien, – aber hier, in diese ganz besonderen Verhältnisse und speziell für meine Sendung paßt es nicht. Ich mußte da schnell eine ganz klare Lage schaffen. Zwei Strömungen nebeneinander, die jede einen eigenen Gang mit besonderem Ziel gehen, das hätte eine unheilsame Zersplitterung der Kraft gegeben, eine Art Nebenregierung, die die eigentliche Regierung geschädigt hätte. Einheitlich muß hier das politische Wirken sein. Der Statthalter muß, meiner Auffassung nach, der führende Geist sein, dem seine Minister und Räte wohl Berater sind, die sich ihm aber in Fällen verschiedener Auffassung unterordnen müssen. Das konnte Herzog nicht. Da wurde eben das Zusammenwirken unmöglich – und – er mußte weichen.«
Das alles war wohl recht sicher und stolz gesagt, aber es klang dennoch ein Ton mit an, als ob Manteuffel sich gewissermaßen rechtfertigen oder doch die volle Zustimmung anderer haben wolle, die er für urteilsfähig und verständnisvoll in diesen Fragen achtete. Er hat später gerade den Satz: » Le roi règne, mais ne gouverne pas« in Verbindung mit dem Herzogschen Konflikt öfters auch andern gegenüber ausgesprochen, so zum Beispiel auch meinem Mann gegenüber, der zur Zeit von Herzogs Abschied zufällig abwesend von Straßburg war.
Als ich an jenem Sommernachmittag wieder allein war und im Geiste die Eindrücke der inhaltvollen Stunden rekapitulierte, trat mir eines als der unabweislich wahre Grund entgegen, der eine Einheitlichkeit und ein fruchtbares Zusammenwirken dieser beiden bedeutenden Naturen unmöglich machte: es war kein Vertrauen zwischen beiden. Sie beargwöhnten sich als gegeneinander agierende Kräfte. Mißtrauen und Zweifel waren latent in allen Gedanken und Handlungen, die ihr berufliches Verhältnis zueinander betrafen; und Mißtrauen ist wie ein Gift für jedes einheitliche Verhältnis, – sei es nun Ehe, eine staatliche, politische, amtliche oder wirtschaftliche Verbindung. Es nagt an den Wurzeln, so daß solches Verhältnis, solange das Gift wirkt, keine Frucht tragen kann. Diese alte Wahrheit war auch hier lebendig geworden, und das Gift konnte nicht anders unwirksam gemacht werden als durch – Scheidung. Am 11. August kam die Ernennung des neuen Staatssekretars. Es war der bisherige preußische Staatsminister für Handel und Gewerbe und Staatssekretär im Reichsamt des Innern, Exzellenz Hofmann. Er kam auf Bismarcks Vorschlag und Wunsch ins Reichsland.
Manteuffel hatte dieser Ernennung zwar zugestimmt, stand ihr aber im übrigen ganz fern, und er hat es selbst ausgesprochen, daß er Hofmann gar nicht kannte und nicht mehr von ihm wußte, als daß er eben Staatssekretär in Berlin gewesen war.
In Hofmann trat dem Statthalter eine vom ersten Staatssekretär absolut verschiedene Natur entgegen; wohl ein ebenso fleißiger, ernster und kenntnisreicher Beamter, – aber keine Persönlichkeit von der eigenwilligen Starrheit seines Vorgängers, sondern ein Mann von einer milden Schmiegsamkeit und einem willigen Anerkennen der Vorherrschaftsstellung des Statthalters. Ich habe einmal Manteuffels Politik (wie ich glaube, mit einigem Recht) die Politik der widerspruchsvollen Hände genannt. Das hat sich in seiner »Regierungszeit« als Statthalter heilvoll und – unheilvoll bewiesen. Die eine Hand wollte eine eiserne Faust sein, festhalten, aufgereckt zum Griff bleiben und streng das Eroberte hüten, und die andere wollte mild seine Wunden heilen, einladen, entgegenwirken, Freiheiten als Geschenke verteilen. Da machte denn oft die eine Hand das schlecht, was die andregut gemacht hatte –, und die eine vernichtete, was von der andern geschaffen war. Denn die weiche Hand fuhr mit impulsivem, heißem Drang manchmal mit vorzeitigen und halben Maßregeln in den stillen, festen Gang der Dinge und warf ihn zurück, statt ihn zu fördern. Manteuffel ist vielfach in seinen zweifellos idealen Bestrebungen mißverstanden und deshalb auch von Organen der altdeutschen Presse und von einer theoretisierenden Partei in Berlin heftig angegriffen worden, – unter anderm auch von einem scharf entbrannten Pressekampfe im Herbst 1880. Aber es lag ein großer Irrtum in all diesen Kritiken; man schloß von dem Konzilianten in der Form auf ein sachliches Nachgeben. Das war es aber nicht eigentlich oder wenigstens ganz selten. Manteuffel wollte vielmehr nur die Fülle seiner wohlwollenden, ja liebreichen Absichten und Gefühle für Elsaß-Lothringen in Einklang bringen mit den festen Normen, die ihm Staatsklugheit und geschichtliche Notwendigkeit für sein Handeln vorschrieben, und das mußte manchmal Dissonanzen, Verschiebungen, Halbheiten zeitigen. Dazu kam, daß Manteuffel, teils aus dem Empfinden heraus, zu göttlicher Sendung auserkoren zu sein, und teils aus dem Gefühl eines starken Selbstbewußtseins, fest an die Macht seiner Persönlichkeit glaubte, der er fast mystische Wirkungen zuschrieb.
Das, gerade das, hat man ihm als »Pose«, als »Schauspielerei« ausgelegt, aber es stieg aus viel besserem Boden: aus dem Glauben eines Gottesgnadentums für seine Person. Er hatte auch persönlich starke Wirkungen, zum Beispiel durch seine Reden, sei es nun im Kreise seines gastlichen Tisches (er sah jeden Tag elsässische und altdeutsche Gäste bei sich zur Mittagstafel) oder bei offiziellen Ansprachen, besonders auf seinen häufigen Reisen in das Land. Die starrsten Protestler und Chauvinisten konnten sich dem Reiz seiner hinreißenden Worte und der ehrlich-edlen Überzeugung, von der sie getragen waren, nicht entziehen. Er sprach da mit einem geschichtlichen Weitblick, einer Schonung weher Gefühle der Besiegten und einer sachlichen Überzeugungskraft, welche die Geister und Herzen tief trafen. Und wenn nun auch die Erkenntnis in die Seelen der Altelsässer trat von der gerechten und verständnisvollen Leitung des Landes durch den Statthalter, so war doch im geheimen zu viel Gegensätzliches in ihnen, das von Frankreich her geschürt und rege gehalten ward, als daß nicht fast andauernd Reibungen und Unzufriedenheiten entstanden. Mit einem fast jünglinghaften Schwung ging Manteuffel an die Bewältigung der ungeheuren Aufgabe, die ihm vom Kaiser gestellt ward, und die er selbst sich stellte. Wohl hatte er im allgemeinen Erfolge, die hauptsächlich in dem versöhnlichen Geist zu erkennen waren, der das Land mit der neuen Regierung zu verbinden begann, aber er hatte auch empfindliche, tatsächliche Mißerfolge; man braucht nur an die Erfahrungen mit dem Metzer Bischof Dupont des Loges zu erinnern, an dessen kühl ablehnende Stellung gegenüber dem fast leidenschaftlichen Liebeswerben Manteuffels, an die Ordenssache, wo der Bischof den ihm vom Kaiser verliehenen Kronenorden zweiter Klasse mit dem Stern, den ihm Manteuffel übermittelte, mit einem lettre de regret quittierte. (Nicht lettre de refus, wie die französischen Zeitungen meinten.) Bourbaki, Gambetta und verschiedene französische militärische und zivile Würdenträger fühlten sich veranlaßt, die leidenschaftlichsten Lobsprüche an Dupont des Loges zu senden für sein französisch-patriotisches Verhalten, Gambetta mit den Worten: » Merci au nom de la patrie française tout entière«. Diese peinliche Ordensangelegenheit mit ihren noch peinlicheren Konsequenzen hatte bedrückend auf des Feldmarschalls Schwungkraft gewirkt; dazu kam die Rede des Barons Bulach im Landesausschuß, welche eine geradezu vernichtende Kritik an Manteuffels Verwaltung übte; deren Bedeutung und Wirkung wurde freilich abgeschwächt durch die Erklärung des Präsidenten Mieg-Koechlin, der unter dem Beifall des Hauses erklärte: die Angriffe gegen den Statthalter seien nur als die persönliche Meinung des Herrn von Bulach anzusehen und nicht als die Ansicht des Landesausschusses. Das Land würde dem Statthalter dankbar sein, wenn er seine Politik der Milde fortführe ... Auch die ganz im protestlerischen Sinn ausgefallenen Wahlen, die starke Gegensätzlichkeit Kablés und Antoines in Metz (und verschiedene Vorgänge in der Beamtenwelt) wirkten lähmend auf Manteuffels Willens- und Geisteskraft. Die unterirdischen Zusammenhänge mit dem chauvinistischen und seit 1870 so ungeheuer rachsüchtig bewegten Frankreich wurden verhängnisvoll sichtbar bei jeder Offenbarung deutschfeindlichen Geistes im Lande. Eine Eroberung im Fluge, wie sie Manteuffels begeisterte, vorwärts drängende, und ich muß es so nennen: allzu siegessichere Art sich vorgestellt hatte, erwies sich jedenfalls als – Illusion. Es waren wohl bedächtige, vertrauenswerte, auch politisch hochbegabte Altelsässer da, auf die sich eine langsame, stetig und zielbewußt vorgehende Regierung stützen konnte, aber Manteuffel wollte zu schnell vorgehen. Manteuffel war wie jener ungeduldige Gärtner, der, um das Wachstum einer Pflanze zu prüfen und zu erkennen, sie oft mit ihren Wurzeln aus dem Erdreich hebt und dadurch das stille Wirken und Weben der Erdenkräfte und das feine und langsame Werden der Pflanzenkräfte stört.
Ich möchte hier noch einige der damals hervortretendsten, in der Öffentlichkeit des politischen und wirtschaftlichen Lebens wirkenden Altelsässer nennen und charakterisieren. Ich möchte sie bezeichnen als teils affirmative, teils negative Politiker. Es war eine versöhnliche Stimmung, ein gegenseitiges Entgegenkommen zwischen den Altelsässern mit der neuen Regierung und der neudeutschen Gesellschaft entschieden fühlbar. Das hatte schon unter Manteuffel begonnen und wuchs unter dem Fürsten Hohenlohe zu sichtlicher Höhe. Die Ehrlichkeit der Gesinnung beider Seiten und die geschichtlich gewordenen Verhältnisse wurden anerkannt. Das war schon eine bedeutende Stufe zur friedlichen Entwicklung ins große Deutsche Reich hinüber. Leider, leider sind später Gegensätzlichkeiten und Mißverständnisse, die dann Mißtrauen bewirkten, entwicklungshemmend geworden. Doch davon später ... Zu den affirmativen Politikern gehörten vor allem: Schlumberger (Jean), Klein, Schneegans, Koechlin, Mieg usw. Zu den negativen: Kablé, Antoine, teils Baron Bulach Vater (Hugo Bulach Sohn in der obligatorischen Sprachenfrage) und andere. Die meisten waren wohl laue Politiker, die schon nach uralter Bibelwahrheit die unzuverlässigsten sind, da sie unberechenbar zwischen warm und kalt schwankten. Julius Klein, dessen Bedeutung, wie eingangs gesagt, schon Bismarck erkannt und ihm Mitwirkung im Rat bei der Neuregelung der Verhältnisse im Elsaß 1879 gegönnt hatte, spielte im öffentlichen Leben in Straßburg und auch im gesellschaftlichen eine Rolle, die weit über die Sphäre hinausragte, in der seine bürgerliche Stellung lag. Klein war nämlich Apotheker; ein Beruf, auf dessen Vertretern, wie ein geistreicher, jovialer Elsässer einmal bemerkte, in Frankreich immer, seit Molières » Malade imaginaire«, ein leiser Hauch des Komischen lag. Und einer mußte in persönlicher Würdigkeit und geistigem Ernst schon recht Bedeutendes leisten, um diese Nuance vergessen zu machen. Und einen hohen Wert von Intelligenz und Bildung hatte Klein und dabei eine herzgewinnende Liebenswürdigkeit und eine fesselnde Erscheinung. Er war von seinen Mitbürgern und Landsleuten so geschätzt, daß die kleine Hinterstube in seiner Apotheke (er hat letztere noch bis Ende der achtziger Jahre tätig verwaltet) selten von solchen leer war, die Rat und Beistand in allen möglichen Staats-, Rechts- und Lebensfragen bei ihm suchten. Auch sehr hohe deutsche Beamte haben es nicht verschmäht, den hervorragenden Politiker um seine Meinung in Fragen von Bedeutung anzugehen. Er war übrigens meinem Mann und besonders mir in wahrer Freundschaft ergeben ... Klein hatte eine ungewöhnlich feinfühlige Seele; ein im besten Sinne des Wortes femininer Zug war ihm eigen. Ein weiches Gefühlsleben, viel Kunstsinn, besonders für Musik und Literatur, machten ihn auch im Verkehr mit klugen Frauen zu einem sympathischen Gesellschafter. Eine etwas elegische, schwärmerische Note klang in seiner lebhaften, geistreichen Art zu plaudern, immer mit an. Kleins Erscheinung, besonders sein Kopf, war so anziehend, daß er selbst in größeren Versammlungen einem Fremden immer hätte auffallen müssen. Die Stirn war breit und gedankenvoll. Die Augen hatten einen eigentümlich tiefsinnigen Blick. Zwischen den Brauen lag eine schwermütige Falte (ich nannte sie immer die »Laokoonfalte«, weil sie ihm einen so leidvollen Ausdruck gab), während ein feines Lächeln um seine Lippen stand ... Er ist nun lange tot, aber er gehört zu den Unvergeßlichen. Er wird auch in den Büchern der Geschichte des Landes unvergänglich stehen.
Auch Jean Schlumberger, der bedeutende Industrielle von Gebweiler, stand trotz seiner vorgerückten Jahre durchaus im Mittelpunkt des reichsländischen politischen Lebens und hat ihm viele Jahre lang einen versöhnlichen Charakter gegeben. Er stand auf dem Boden des Frankfurter Friedens, anerkannte die gegebenen geschichtlichen Tatsachen und setzte seine Kraft und seine gewichtige Bedeutung für das Wohl seines Vaterlandes, Elsaß, ein. Er war Manteuffel und den späteren Statthaltern (denn er starb erst unter Hohenlohe-Langeburg) ein ehrlicher Mitarbeiter und eine vertrauenswürdige Stütze. Als langjähriger Präsident der Landesvertretung, des Landesausschusses, hatte er natürlich eine fortdauernde lebendigste Wirkung auf dessen Mitglieder. Schlumberger war wie eine Verkörperung der Ehrenhaftigkeit, des Altruismus und der bürgerlichen Tugend in Staat und Familie. Er stellte sich fest und jugendlich tapfer in die Reihen derer, die ihre Kraft mit der neuen Regierung gemeinsam der Verwaltung ihres engeren Vaterlandes widmeten. Seine Großherzigkeit gegenüber den »Enterbten der Menschheit«, sein streng rechtlicher Sinn, seine arbeitsfreudige Rührigkeit und sein vermittelnd herzliches Wesen haben ihm Freundschaft und Vertrauen aller Kreise erobert.
Auch Manteuffel hatte ein tiefgründiges Vertrauen zu ihm und war ihm persönlich befreundet. Der alte Präsident Schlumberger (er hat später den erblichen Adel erhalten, wurde Ehrendoktor der Universität Straßburg und zum Wirklichen Geheimrat mit dem Titel »Exzellenz« ernannt) hat dem ersten Statthalter, auch über dessen Grab hinaus, innige Anhänglichkeit und Treue bewiesen.
Ein anderer bemerkenswerter, später ganz »affirmativer« elsässer Politiker war C. A. Schneegans, 1836 in Straßburg geboren.
Er war eine reich veranlagte Natur; geistreich, von gediegener humanistischer Bildung, ein klarer Dialektiker als Journalist und politischer Redner, mit großem Blick für die geistigen Strömungen in der Geschichte, dabei mit dichterischem Schwung und Talent Schneegans hat sich mit Grazie und Geist auf den Gebieten der Lyrik und Epik in französischer und mehr noch in deutscher Sprache hervorgetan. – und von sensitivem Gefühl. Eine Natur, in der alle Anregungen und Eindrücke des Lebens einen starken und dabei fein vibrierenden Widerhall fanden.
Nachdem er kurze Zeit in seinem ersten Beruf (Philologie) als Lehrer in Paris tätig gewesen war und auch dort schon einzelne Artikel für den »Temps« geschrieben hatte, wandte er sich bald ganz der Journalistik zu. Er trat 1861 in Straßburg als Redakteur in den »Courrier du Bas-Rhin« ein, blieb dabei Mitarbeiter des »Temps« und schrieb zugleich Korrespondenzen für deutsche Zeitungen. Während des Krieges Beigeordneter des Gemeinderats seiner Vaterstadt, ging er nach der Belagerung von Straßburg (Ende 1870) nach Bern, wo er die Zeitung »Helvétie« gründete. Er hatte damals die Absicht, Schweizer zu werden, – wohl um sich auf eine Insel zu retten, die unberührt von dem Sturm der politischen Dinge war, welche, das Schicksal seiner Heimat umwälzend, auch in seine eindrucksfähige Seele hocherregte Wogen warfen.
Im Winter 1871 wurde Schneegans zum Abgeordneten für den Niederrhein in die Nationalversammlung gewählt und nahm an den Verhandlungen in Bordeaux Über diese geschichtspsychologisch interessanten Vorgänge in Bordeaux und deren Wirkung auf Schneegans und seine elsässischen Freunde geben die in der »Deutschen Rundschau« teilweise veröffentlichten Memoiren von Schneegans bemerkenswerte Aufschlüsse. teil. Hier begann sich nun offenbar die seelische Wandlung in Schneegans vorzubereiten, die nach schweren inneren Kämpfen den Mann, der seinem Vaterland Frankreich treu und warm anhing, dahin drängte, sich von diesem loszusagen, um seiner engeren Heimat, dem Elsaß, all seine Kraft und Liebe zuzuwenden; denn in Bordeaux teilte sich ihm und fast allen elsässischen Abgeordneten das bittere Gefühl mit, daß Frankreich in jener ernsten Zeit nur von dem trägen Wunsch erfüllt war, Ruhe und Frieden wiederzuerlangen, – selbst um den Preis Elsaß-Lothringens, für dessen Geschick es keine innere Anteilnahme zeigte. Die Elsässer kehrten nach ihrer Protesterklärung am siebzehnten Februar 1871 tief erbittert und enttäuscht in ihre Heimat zurück. Schneegans nach Bern, wo er in seiner Zeitung »Helvétie« eine beredte Schilderung der Vorgänge von Bordeaux gab, die zuerst die Gemüter sehr erbitterte, später aber Männer wie Kablé doch nicht verhinderte, ihre Liebe für Frankreich und ihre Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit des Elsaß mit dem alten Vaterlande leidenschaftlich in Wort und Tat zu bekunden.
Doch zu Schneegans zurück. Er hatte zunächst für Frankreich optiert und ging im Mai 1871 nach Lyon, wo er die Leitung einer neugegründeten liberalen Zeitung, »Journal de Lyon«, übernahm. Doch die allzu klerikale Richtung im Verwaltungsrat und die Tatsache, daß Schneegans von seinen liberalen Freunden in Lyon nicht genügend unterstützt, ja sogar im Stich gelassen wurde, führten einen Konflikt herbei, der mit einer endgültigen Scheidung endete. Schneegans mochte wohl immer tiefer empfinden, daß Frankreich, welches er sich als innerlich tief trauernd über den Verlust des Elsaß vorgestellt hatte, in Wahrheit dessen Schicksal ziemlich kühl gegenüberstand. Da zog ihn denn seine heißeste Heimatliebe zurück nach dem Geburtsland. Er machte 1874 seine Option rückgängig und ging auf die Bitten seiner Freunde nach Straßburg, die, gleich ihm, den echtesten Patriotismus darin zu erkennen meinten: auch unter den neuen politischen Verhältnissen ihre Kraft einzusetzen für eine glückliche Entwicklung und Verwaltung des Landes. Des verehrten toten Freundes Küß' Worte in seinem letzten Brief mochten ihm wohl auch leitend wie ein Gebot und wie eine Verheißung vorgeschwebt haben: »Frankreich ist für uns verloren! Denken wir daran, uns das Elsaß zu retten!«
Für sein Ideal, die Autonomie, trat er von nun an in freiem Bekenntnis und mit der Tat ein. 1874 wurde Schneegans Mitredakteur des »Elsässischen Journals«, – und 1876 ward er in den Reichstag gewählt. So waren ihm zwei Gebiete offen, Journalistik und Parlament, auf denen er erfolgreich für seine Sache wirken konnte. Er hat dann im Reichstag, den Intentionen des Reichskanzlers entgegenkommend, den der Autonomistenpartei sympathischen Antrag auf Verlegung der Regierung nach Straßburg, Einsetzung der Statthalterschaft, gestellt, der nach starker Befürwortung durch eine längere Rede des Fürsten Bismarck vom Reichstag angenommen wurde. Nach der Einführung der Neuorganisation wurde Schneegans als Ministerialrat in die Abteilung des Innern berufen; – aber, sei es nun, daß er nicht seinen, mehr auf das allgemeinpolitische Gebiet weisenden besonderen Fähigkeiten entsprechend beschäftigt wurde, oder daß die Verhältnisse im Lande noch nicht reif dazu waren, ein ersprießliches gemeinsames Wirken von eingewanderten Beamten mit elsässischen Politikern in der Landesregierung möglich zu machen: kurz, Schneegans fühlte, daß die Stelle eines Ministerialrats in Straßburg nicht der fruchtbare Boden für sein Wirken sein würde und trat daher schon im Frühjahr 1880 in das Auswärtige Amt in Berlin, auf Bismarcks Veranlassung, der ihn besonders schätzte; er wurde dann im selben Jahr zum Konsul in Messina ernannt. 1888 ward er Generalkonsul in Genua und starb dort im März 1898.
Schneegans war ein bedeutender Sohn des Landes, auf den das Elsaß mit begründetem Stolz schauen kann. In dem für das Reichsland so bedeutsamen und bewegten ersten Jahrzehnt nach dem Kriege und speziell in der Entwicklungsgeschichte des Autonomismus, der für die Regierung die ansehnlichste Stütze aus einheimischen Kreisen war, hat Schneegans eine führende Rolle gespielt, – wie überhaupt das geistige Wesen dieses hervorragenden Elsässers mit tiefen Wurzeln aus dem Boden einer großen Zeit aufwuchs und deren Lebenselemente enthält.
Die Universität war in Manteuffels Salon (mehr als bei den späteren Statthaltern) mit sehr bedeutenden Erscheinungen vertreten. Die damals jüngste deutsche Hochschule fand ganz naturgemäß ein besonderes Interesse und eine gewisse mütterliche Zärtlichkeit beim Reich. Die hervorragendsten Kräfte wirkten in den verschiedenen Fakultäten. So z. B. in der juristischen (als Staatsrechtslehrer noch bis vor kurzem an der Straßburger Universität) Professor Dr. Laband, Sohm, Schulze, Merkel, Knapp, Geffcken Geffcken, der mit der Tochter des berühmten Dichters Immermann verheiratet war, einer geistig und äußerlich vornehmen Erscheinung, hat später viel von sich reden gemacht durch die Veröffentlichung der Tagebücher des Kronprinzen (nachmaligen Kaisers Friedrich). Geffcken war, ehe er nach Straßburg kam, in der hanseatischen Diplomatie tätig.. In der philosophischen: Nöldeke, Michaelis, Erich Schmidt, Baumgarten, neben anderen. In der medizinischen: Leyden, von Recklinghausen, Gusserow, Kußmaul, Laqueur, Hoppe-Seiler, Freund, Jolly, Waldeyer. Bei den Theologen: Holtzmann, Reuß (ein Altelsässer). Als Nationalökonom leuchtete Schmoller, und unter den Naturwissenschaftlern de Bary und Kundt. Der Tod hat aber in den letzten Jahren eine grimme Ernte unter ihnen gehalten, und nur wenige von den oben Genannten wirken und leben noch. Der 1918 verstorbene Laband war, von den Tagen der Universitätsgründung bis vor kurzer Zeit in Straßburg tätig, wohl allezeit die in der Gesellschaft bekannteste und durch mannigfache Beziehungen mit dem öffentlichen wie sozialen Leben am meisten mit Straßburg verbundene Persönlichkeit gewesen. Er war auch Mitglied des Staatsrats von Elsaß-Lothringen. Seine Bedeutung als Staatsrechtslehrer ist weltbekannt. Er gilt als ausschlaggebende Autorität in allen Fragen, die seine Wissenschaft berühren. Labands Unterhaltungsgabe hat trotz ihrer scharfpointierten Art, der Tiefe seiner Gründe, der überlegenen Sicherheit seines Wissens nie etwas Lehrhaftes oder gar aufdringlich Selbstbewußtes. Er verstand die große Kunst, liebenswürdig zuzuhören und die Personen, mit denen er sich unterhielt, durch seine Anregung zur vollen Betätigung ihrer geistigen Eigenschaften zu bringen. Der berühmte Professor hatte auch viel Verständnis für die Künste, insbesondere für Musik und Literatur, und mancher Künstler kennt ihn als – Mäcen. Er war eine von den vielseitigen Naturen, die auf allen Gebieten ihres Wirkens, den strengen wie den heiteren, ihres Erfolges sicher waren. Er wurde vor einigen Jahren zum Wirklichen Geheimrat mit dem Titel Exzellenz ernannt und lebte dann, von seiner wissenschaftlichen Wirksamkeit zurückgezogen, still in Straßburg bis zu seinem 1918 erfolgten Tod.
Den Universitätskreisen nahe, aber zuerst noch nicht in ihnen wirkend, stand der bedeutende Dr. Theobald Ziegler. Er war im Beginn seiner Laufbahn Gymnasiallehrer, dann am Protestantischen Gymnasium Konrektor und hatte später neben dem ausgezeichneten Philosophen Windelband den Lehrstuhl der Philosophie und Pädagogik inne.
Zieglers schriftstellerische Tätigkeit begann sehr früh. Mit 28 Jahren veröffentlichte er sein erstes, auf gründlichen Studien beruhendes Buch über das Straußsche Werk: »Der alte und der neue Glaube«. Daran schloß sich eine Reihe von bedeutenden Arbeiten, die sich teils mit ethischen, teils mit sozialen, am meisten aber mit literarischen Problemen beschäftigten. Seine Arbeiten: »Die geistigen und sozialen Strömungen im 19. Jahrhundert«, dann das geistvolle Buch über »Friedrich Nietzsche« und die bedeutsamen Abschnitte in Bielschowskis Albert Bielschowski ist vor der Vollendung seines Werkes »Goethe« gestorben. Einige bekannte Professoren und Gelehrte, wie Ziegler, Max Friedländer, Wershoven, Dr. Leppmann, haben in selbstloser Weise an der Vollendung des Werkes gearbeitet und sie herbeigeführt. Werk: »Goethe« haben in der gelehrten und gebildeten Welt große Anerkennung erfahren. Theobald Ziegler vollendete in Bielschowskis Buch das Faustkapitel, fügte den Schlußabschnitt hinzu, brachte in das 16. Kapitel eine Darstellung von Goethes Verhältnis zur Romantik und beleuchtete im 4. Kapitel Goethes Stellung zu Fichte, Schelling und von Hegel. – Des Professors Ziegler feiner, durchgeistigter Charakterkopf, wenn er auch erst später in der Gesellschaft auftauchte, darf hier nicht vergessen werden. Professor Theobald Ziegler wirkte später an der neuen Hochschule in Frankfurt a. M. und ist nun seit einigen Jahren tot.
Im Sommer des Jahres 1885 war der Generalfeldmarschall von seiner alljährlichen Erholungsfahrt nicht mehr zurückgekehrt; er starb in Karlsbad an einer Lungenentzündung. Man sagt, er hätte zu weite und über seine Kraft gehende Wanderungen auf die Höhen gemacht. Das könnte auch sinnbildlich für sein Leben gelten. Seine Leiche wurde mit königlichen Ehren geleitet und gefeiert. Durch Österreich nach Berlin – Potsdam. Auf dem Dotationsgute Topper ward Manteuffel dann prunklos und still, wie es sein letzter Wunsch gewesen, auf dem Dorfkirchhof begraben.
In Frankreich erschienen anläßlich seines Todes sympathische Beileidsartikel. Persönlich war Manteuffel von der Okkupationszeit in Nancy her, wo er mit äußerster Milde waltete, sehr beliebt und geschätzt. Seine Widersacher haben ihm freilich häßlichen Tadel daraus hergeleitet. Auch in elsässischen Kreisen ward der Marschall tief und ehrlich betrauert. Im Stadthaus von Straßburg war am Begräbnistag Manteuffels dessen lebensgroßes, von Schüler gemaltes Bild ausgestellt. Fünftausend Besucher, meist Landbewohner in den malerischen Elsässer Trachten, zogen da vorüber. Es war ein herzrührender, ungekünstelter Trauerzug für einen milden Herrn. Er war ja auch so versöhnlich im Reichsland gewesen, daß er eher die Gefühle der Altdeutschen als die der Elsaß-Lothringer und Franzosen verletzt hätte. Das war nicht Liebedienerei, nicht Popularitätssucht, wie man es oft genannt hat, – nicht Schwäche, – sondern der Marschall wollte die, die durch Schicksalsgewalt, durch historische Vorgänge, an denen sie keine Schuld hatten, schmerzlich getroffen waren, besonders rücksichtsvoll behandeln. Die Großmut eines edlen Siegers Besiegten gegenüber.
Dupont des Loges, der Bischof von Metz, schrieb am 21. Juni an seinen Freund, den Provinzial der Dominikaner, Souaillard: » Vous êtes, dans le vrai, mon bien cher Père, et vous comprenez mieux de loin, qu'on ne paraît la comprendre de près, l'étendue de la perte que nous venons de faire dans la personne du maréchal. Un attachement mutuel, j'ai presque dit une amitié sincère, nous unissait, et grâce à sa constante et loyale bienveillance, j'ai pu protéger les intérêts religieux de mon cher diocèse.«
In den Kreisen hoher deutscher Militärs ist das Urteil über Manteuffel, wie schon gesagt, ungemein scharf gewesen. Rein militärisch betrachtet mag die Gestalt Manteuffels ja wohl auch nicht ungerecht von diesen Herren beurteilt werden. Daß man aber aus der von Frédéric Loliée veröffentlichten (und von Fräulein Dosne, Thiers' Schwägerin, bereitwillig zur Verfügung gestellten) Korrespondenz des großen Historiker-Staatsmanns Thiers mit dem Grafen St. Valliers und mit dem Vicomte de Gontant-Biron schließen zu sollen glaubt, Manteuffel hätte sich allzu frankreichfreundlich während der Friedensverhandlungen und der Okkupationszeit verhalten und habe die deutschen Interessen gegenüber den französischen vernachlässigt, ist wohl irrig. Es findet sich keine einzige Stelle in den Publikationen, die mehr besagt, als daß man auf französischer Seite Manteuffels konziliante Art des Verkehrs in den schwierigsten Lagen anerkannte und ihm Dank dafür wußte.
Thiers hat dem Feldmarschall bei dessen Abzug aus Frankreich seine Geschichte des Konsulats und Kaiserreichs übersandt mit der Widmung:
» A son Excellence, le général de Manteuffel, en souvenir de son humaine et généreuse administration des provinces occupées françaises – son dévoué
A. Thiers«
Aus den Loliéeschen Veröffentlichungen seien als Beweise für meine Meinung die hauptsächlichsten, Manteuffel betreffenden Stellen zitiert, damit der Leser selbst urteilen kann. Sie stehen in zwei Briefen von Thiers an Graf St. Vallier und in einem von St. Vallier an Thiers. Der Passus im ersten Brief lautet: »Ich kenne die Leute und die Sachen, und ich habe, ohne daß ich dabei gewesen bin, alles das klar vor mir, was zwischen Herrn von Bismarck und Herrn von Manteuffel vorgegangen sein muß. Es sind das die menschlichen Armseligkeiten, von denen die Staatsmänner leben müssen, wie die Ärzte von den Krankheiten leben. Haben Sie die Güte, Herrn von Manteuffel zu sagen, daß ich aufs tiefste das ihm Widerfahrene bedaure, und wie leid es mir tut, ihn in Ungelegenheiten geraten zu sehen, wegen des uns bewiesenen Interesses, das doch ebensosehr Zeugnis für seine persönliche Hochherzigkeit wie für seine Einsicht in die wahren Interessen seines Landes ablegte. Übrigens hat er als Militär wie als Diplomat so gute Dienste geleistet, daß diese Wolke nicht von Dauer sein wird, und daß sein König, der rechtschaffen und dabei vernünftig ist, ihm jedenfalls Gerechtigkeit widerfahren lassen muß.«
Die Stelle im zweiten Brief von Thiers an St. Vallier spricht aus: »Ich bin immer noch äußerst gerührt über das von Herrn von Manteuffel mit Bezug auf uns beobachtete Verhalten, und ich werde als Mensch wie als Bürger ihm ewig Dank dafür wissen. Ich werde schließlich doch noch einmal meine Lebenserinnerungen niederschreiben, vorausgesetzt, daß ich nicht unter der Last erliegen werde, und die Wißbegierigen des künftigen Jahrhunderts werden dann erfahren, daß ein feindlicher General, der, ebensohoch wegen seines Herzens wie seines Geistes dastehend, Frankreich gegenüber der edelste der Gegner war ...«
Und der Passus in St. Valliers Brief an Thiers hat folgenden Wortlaut: »Der gute General von Manteuffel ist wieder nach Berlin zurückgekehrt, wo er bei seiner Ankunft den Feldmarschallstab vorgefunden hat; er ist derselbe geblieben bis zum Schluß: stets gerecht, versöhnlich und freundschaftlich. Auch er hat, obgleich Preuße, ein Blatt ernstlicher Dankbarkeit in unsern Annalen verdient.« –
Es sind scharfe Stimmen laut geworden über Manteuffel nach der Veröffentlichung dieser Korrespondenzen, – und harte Worte sind über den Marschall gefallen. Mir scheinen sie, als gewonnenes Ergebnis aus den Loliéeschen Publikationen, nicht verständlich. Denn wie kann das Lob eines Feindes als ein Tadel aufgefaßt werden, nur eben aus dem Grunde, daß es eines Feindes Mund entstammt? Das würde doch einem Mangel jeder objektiven Sachlichkeit und jeder Gerechtigkeit im Urteil gleichkommen.
Daß man einem Mann wie Manteuffel, dessen ganzes Leben ein Hoheslied der Vaterlandsliebe gewesen, einen Mangel an Patriotismus vorwerfen kann wegen seines gerechten, loyalen, aber freundlich anerkennenden Wesens und Verkehrs mit dem Feind erscheint unbegreiflich und widerspruchsvoll in sich.
Wie sich Manteuffels Gestalt aus jener Epoche des Übergangs darstellt, hat sie etwas Überragendes, Bedeutendes. In dem sinnenden, milden und doch feurig durchdringenden Blick seines Auges lag viel von jener stillen und geduldigen Weisheit des Lebens, die, weil sie alles erkennt und versteht, auch milde urteilt und verzeiht. Es ist dem ersten Statthalter vor allem der Vorwurf des Schwankenden, Schwachen, Unsicheren, eines gewissen experimentierenden Zickzackganges gemacht worden. Es ist auch unleugbar, daß seiner im Grunde genialen Verwaltung des Reichslandes etwas Sprunghaftes und Unsicheres anhaftete. Dies aber allein aus seinem Wesen herleiten zu wollen, würde wenig Blick für die Psychologie der Verhältnisse und Menschen verraten. Die Unsicherheit und das Schwankende ergeben sich vielmehr und vor allem aus dem Charakter jener Übergangszeit. Jede Übergangszeit trägt solche Signatur; besonders wenn sie sich im Leben der Staaten und Völker vollzieht. Eine neue Kultur mit neuen Bedingungen und Kräften soll ein altes Kulturfeld bebauen. Eine Saat ersprießlicher Keime muß gleichsam in einen vulkanischen Boden gelegt werden; seine Lebensmöglichkeiten sind dem neuen Bebauer noch nicht bekannt. Wenn Erfüllung und Reife der Einsaat geerntet werden sollen, müssen die Bebauer still wartend der Zeit überlassen, diese Wunder zu wirken. Warten! Die Zeit wirken lassen! Das ist die einzige Weisheit, die auf reale Erfolge zählen darf, natürlich nur auf der Grundlage verständnisvoller Pflege. Vielleicht hat Manteuffel gegen dieses einfache Naturgebot, im starken Selbstbewußtsein seiner aktiven Individualität, sich zu sehr aufgelehnt. Das war wohl der tragische Irrtum in seiner Politik, – ein Rechenfehler der Staatsweisheit!
In Manteuffels Natur war etwas Faustisch-Ringendes, Allwollendes und Allumfassendes. Trotz der geklärten Weisheit, zu der ihn Erfahrung und Nachdenken geführt hatten, blieb er in seinem Gefühl bis an das Ende seiner Tage ein Jüngling.
Der Feldmarschall hat das ersehnte Ziel seiner Seele nicht voll erreicht: Popularität zu erlangen! Vielleicht war seine Natur zu kompliziert für das Allgemeinverständnis. Jedenfalls ist er, trotz seiner reichen und großen vaterländischen Taten, trotz seines rastlosen, edlen Wirkens, das bis in seine Greisentage ging, nie ein volkstümlicher Held für die deutsche Nation geworden ...
Wie ich hier sitze und die Gedanken und Bilder aufzeichne, welche mir die äußerst rege Erinnerung an den Aufgang der elsaß-lothringischen deutschen Zeit und der Zeit für Deutschland überhaupt nach dem Kriege von 1870 bis 1871 eingibt, wird mir der ungeheure Umschwung lebendig zwischen damals und jetzt. So in der Weltlage, als in dem kulturellen, politischen, ethischen Stand der Völker. Und zwar der Völker an sich und in ihren Beziehungen zueinander. Das Zwischennationale steigt in seiner ganzen Lebendigkeit und fruchtbaren Kraft vor mir auf. Es war eine Zeit der Hochblüte deutschen Geistes und deutschen Könnens damals. Und wie es immer in starken Blütezeiten ist: Blüte zeitigt Duft und – Duft berauscht. Rauschstimmungen und Übermaß, Überfluß, Überschwang machten sich neben den stolzen Äußerungen ruhig in sich gefesteter Kraft geltend.
Eine gewisse Gehobenheit der deutschen Seele, die ja sehr gerechtfertigt war, ließ manchmal über die Linie des schönen Maßes hinausgehen. Aber es waren eben doch gute, stolze, hochgemute Geister, welche die Seelen schwellten.
Geschichtsphilosophisch ist es hochinteressant, zu erkennen, wie ein außerordentlich tüchtiges, hochintelligentes, fleißiges, rechtliches, gutherziges und gerechtes Volk dazu kommen konnte, bei all diesen ganz unoffensiven Eigenschaften den Haß einer ganzen, ganzen Welt auf sich zu laden.
Der Neid, eine der teuflischsten Eigenschaften des Urteufels, ist hier wohl zur bezwingenden Macht geworden ... Ich schreibe diese Zeilen hier im Spätherbst 1918. Kampf und Weltringen ist auf die Spitze getrieben. Ich glaube, ich habe recht, wenn ich den Weltkrieg von Anbeginn an den Krieg der Unberechenbarkeiten genannt habe. Die Tage sind so überladen mit überraschenden Wendungen, daß nicht nur die Logik der Ereignisse, die doch immer vorhanden ist, aus ihren natürlichen Linien gerückt ist, sondern auch die Zeit in ihrem Gang und Wesen. Denn die Tage sind jetzt des Geschehens so voll, daß sie wie Jahre dünken. Auch die Grenzen zwischen den Menschenaltern scheinen verschoben; denn junge Kraft wird früh reif im Riesenkampf, früh welk und früh tot – – und ältere Kraft wird jung an den kräftefordernden Aufgaben dieser Zeit.
Eine merkwürdige Zeit ist es, von Überspannung alles Vermögens ideeller und realer Art. In solcher Überspannung liegt soviel Fragliches: Werden die Kräfte in der äußersten Spannung heil bestehen? Wird diese Spannung Gesundes oder Ungesundes hervorbringen? Wird sie eine Spannung sein, die höchste Kräfte entbindet, oder wird sie eine verzweifelte Überspannung sein, welche Müdigkeit und Vernichtung im Gefolge hat? Das sind furchtbar dunkle Schicksalsfragen, deren Wesen Schatten ist und Schatten wirkt ... Die milde Gottheit Erinnerung heißt mich, dem Winke ihrer hellen Hand zu folgen und mich etwas abzuwenden von dem Tage von heute. Sie führt mir die Zeit nach dem Kriege 1870-1871 herauf in glänzenden und lebendigen Bildern. Man hat sie die Gründerzeit genannt und hat das, etwas einseitig, vorzüglich auf finanzielle Gründungen angewendet. Ich möchte den Begriff gern weiter und tiefer fassen. Es wurde wirklich gegründet, geschaffen auf allen Gebieten, und gerade auf den edelsten. Es war die Zeit, da Bismarck in seiner Höchstkraft stand und gründete – ein Reich! – da Wagner in der Hochblütekraft seines Genius war und den deutschen Sagenkreis in Musik übersetzte, das Festspielhaus Bayreuth gründete und dort den »Nibelungen« und später dem »Parsifal« feste Edelstätte gab. Es war auch die Zeit, da Nietzsche die neue Philosophie des Übermenschentums gründete, die weckend und beeinflussend auf die Philosophie anderer Länder wirkte.
In der Staatskunst, Musik und Philosophie waren also drei epochemachende Geister wirksam und gründend. Leider ist ja Nietzsches Philosophie, die völlig neu, großzügig, von edlen, aber manchmal wirren Linien ist, oft mißverstanden worden. Und was bei ihm für freie, große Geister gedacht, frei und ungefesselt vom Pharisäerhaften, Hergebrachten war, wurde von kleinen Naturen zum Ungebundenen, Unbändigen, oft Zügellosen verzerrt. »Jenseit von Gut und Böse« – der Gedanke der »Herrenmoral« und des »Übermenschen«, der andere Maße und Bedingungen von der Welt fordern und gewinnen durfte, – das alles konnte heillose Verwirrung in undisziplinierte Geister und unerfahrene Herzen tragen, – und – es geschah auch so ... Der Naturalismus mit seinen enthüllten und auch sogenannten Naturtrieben ist teils von der mißverstandenen neuen Moral Nietzsches beeinflußt, ja sogar hervorgerufen worden, obgleich dieser Naturalismus so durchaus anderen Geistes und von anderen Strebungen war als der Gedankeninhalt der Nietzscheschen Philosophie und Poesie.
In Nietzsches Geistesart ist es so überaus neu und mächtig anziehend, wie Kunst und Wissen, das heißt Poesie und Philosophie bei ihm eng verschwistert sind, und wie die wundervolle Lyrik seiner Empfindung und Sprache auch durch das exakte Denken seines Geistes mit starkem Blütenwerk rankt ...
Ja, es war wirklich eine Gründerzeit. Im banaleren Sinne machte sie sich auch in der Gesellschaft geltend. Der Luxus, des »Lebens Überfluß« der wohl mit dem größeren Reichtum und den regeren Weltverbindungen in die Erscheinung trat, ward nun nicht nur ein vorübergehender Gast, sondern Heimatberechtigter in der deutschen Gesellschaft. Oft mit wenig Geschick gehandhabt, das Übertreibungen und Auswüchse zeitigte, meist aber mit Anmut und mit junger Lust an dem Neuen, bisher wenig Gekannten geboten. Hoffnungsfreudigkeit, Unternehmungslust, ein fröhliches Einsetzen der Persönlichkeit, freundliches Gefallen an echtem Glanz (manchmal auch an unechtem), die Lust, den Tag, die Gegenwart auszuleben und dennoch für die Zukunft zu schaffen, das alles kennzeichnete den Geist der Gesellschaft im engeren und weiteren Sinne.
Im Deutschen Reich war eben eine neue Welt erschienen, und die wollte man auf allen Gebieten sich entwickeln sehen. Überall wurde Neues aufgebaut und gegründet, – auch in den Künsten. Rückkehr zur Natur, Naturalismus hieß die bewegende Kraft. Freier und weiter wurden auch die Lebensformen, die freilich nicht immer geschmackvoll gehandhabt wurden. Wo sie aber mit Anmut und Geschmack geboten wurden, zeigten sich auch Bilder von verfeinerter und höherer Kultur. So ist mir ein Abend besonders im Gedächtnis, den ich im Anfang der achtziger Jahre bei Paul Lindau erlebte.
Lindau stand damals wohl auf der Höhe seiner künstlerischen und gesellschaftlichen Bedeutung. Sein starker, vielgewandter und doch trotz seiner Sarkasmen und scharfgeschliffenen Witze liebenswürdiger Geist mußte die geistig bedeutsamen Persönlichkeiten von Berlin, das damals Weltstadt zu werden begann, mächtig anziehen. Er schuf auch gerade damals die liebenswürdigsten seiner Werke. Fein getönte Seelengemälde in Novellen, wie zum Beispiel »Herr und Frau Bewer« und daneben reichbewegte Romane. Da er auch finanziell bedeutende Einnahmen von seinem literarischen Wirken hatte, gefiel es ihm, in großer Weise Geselligkeit zu üben. Ihm zur Seite stand damals seine kluge, sehr hübsche und mit spezifischem Berliner Geist begabte Frau Anna, geborene Kalisch. Sie war schlagfertig, frohsinnig, leichtlebig, gewandt, mit viel Schick in Gewandung, Sitten, Bewegungen und Lebensgewohnheiten. Sie war immer umgeben von einem kleinen Hof von Verehrern und Bewunderern, in dem sie sich mit sprudelnder Lebenslust und harmloser Keckheit bewegte. Graf Wilhelm Bismarck, des Großen zweiter Sohn, gehörte zu diesem Kreise.
Es war ganz am Anfang der achtziger Jahre, als ich in Berlin, vom Elsaß aus, wieder ein wenig »norddeutsche Kulturluft« atmen wollte und dort für ein paar Wochen lebte. Ich hatte die Stadt seit 1870 nicht gesehen. Damals trug sie noch die Eierschalen eines etwas täppischen Weltkückens; nun waren die abgestreift, und ein herrlicher Paradiesvogel stand in all seiner goldenbunten Pracht vor mir. Was für eine Kraft, was für geheime Schönheit, für Streben und Können mußten in diesem Volk liegen, daß es in solcher Hochentwicklung aufblühen konnte! Arbeitsliebe und Lebensliebe blühten gleichermaßen an diesem köstlichen Stamm. Es war eine Verästelung über die Welt hin, und doch fest gegründet im eigensten, stolzen Heimatboden. Das aber haben sie uns später als Sünde, als Verbrechen angerechnet: daß der deutsche Stamm die ganze Welt überzweigte mit seinem kräftigen Wuchs und seinen Früchten und Blüten. Und aus der Erkenntnis dieser siegreichen Wahrheit ist dann der riesenhafte Neid und Haß geworden, der den stolzen Stamm mit einem Anprall von vernichtenden Waffen- und Menschenkräften bedroht und bezwungen hat.
Wenn ich heute an den großartigen Aufschwung und Aufgang von damals denke und nun den furchtbaren Zusammenbruch in diesem Weltkrieg 1914-1919 mit seinem Wirrwarr und Getöse erschaue und vernehme, dann gerät meine geschichtliche und philosophische Erkenntnis, mein Glaube an die Logik des Weltgeschehens in eine unheilvolle Erschütterung. Oder ich müßte zu dem uralten Glauben zurückkehren, den früheste Kulturvölker schon hatten, und der in allen Religionen wiederkehrt: ein gewisses Gleichgewicht zweier Mächte im All zu erkennen, – der guten und der bösen Macht. Immer im natürlichen Kampf, den ihre immanenten Elemente hervorrufen, gegeneinander stehend, fällt der Sieg bald auf die göttliche, gute, bald auf die teuflische, böse Seite. Man könnte wohl mit Fug sagen, daß die Gegenwart eine Herrschaft des Teufels gebracht habe. Der »Anteil des Teufels« ist in der furchtbar bewegten Zeit sehr merkbar zu spüren. Das im Volksmund öfters gehörte: » Der Mensch oder die Zeit ist ja von Gott verlassen« drückt einen ähnlichen Gedanken aus. Das göttliche, gute Prinzip mußte für eine Weile dem teuflischen weichen ... Auch Nietzsche würde eine Bestätigung seiner Theorien und Gedanken in solchem Weltgeschehen erschauen. Er proklamiert eine Herrenmoral als die einzig siegende für die Welt und erklärt das Christentum für eine Schwäche, fast für eine Feigheit, da für eine Religion der Liebe das Geschlecht der Menschen noch nicht reif sei. Das Christentum ist, seiner Auffassung nach, eine Sklavenmoral. Es strebt einen Seelenzustand der Ergebung, des Dienens, der Vergebung, der Duldung an. Ein Aufgeben des »Ich« in der Liebe zum Nächsten, eine schrankenlose Demut, die dem, der einem einen Backenstreich gab, noch die andere Wange darbieten soll. Seine philosophische Religion, wenn man dies Paradoxon gebrauchen kann, strebt eine Herrenmoral an für auserlesene, starke Geister. Aber der ersehnte »Übermensch« erwuchs nicht, sondern blieb im Traumreiche des phantastisch-dionysischen Dichters und seiner äußerst geistreichen, aber allzu verstiegenen Gedanken ... Doch, ich bin weit, weit abgekommen von meinem Ausgangspunkt, dem Abend bei Lindau.
Lindau war damals ein wenig Diktator in der Literatur, wenigstens in der von Berlin. Und doch war er nicht eigentlich ein Großer der modernen realistischen Schule, die mit völlig neuen Formen auftrat und alles Ältere, was mit idealerer Weltanschauung durchdrungen war, einfach verneinte. Die scharfe Waffe seines Urteils und seines Witzes war gefürchtet, bei vielen war er auch verhaßt ... Man ist in der Gesellschaft und dann auch in der Literaturgeschichte oft dem Urteil begegnet, als sei sein Denken, seine Lebensart und sein Schaffen frivol gewesen. Ich möchte dem entschieden entgegentreten; höchstens könnte jenes Wort nur eine teilweise Geltung haben, etwa für seine kritisch-künstlerischen Aufsätze. Er schwang aber die Geißel seines wirklich funkelnden, geistreichen Witzes meist über Erscheinungen, die solchen Strafgerichts wert waren; und er hat dadurch eine gewisse Zucht und Disziplin in die allzu mostschäumend sich gebärdenden Geister der damals »Jüngsten« gebracht. Man fühlte sich in der Gesellschaft, männliche wie weibliche Mitglieder, geehrt von Lindaus Freundschaft, Anerkennung, Verehrung. Das war fast wie ein geistiger Adelsbrief.
An jenem Abend war viel Hochkultur des Geistes, viel Schönheit und Anmut der Frauen, viel Vornehmheit der Namen (in sozialer und künstlerischer Beziehung) dort versammelt. Ich entsinne mich einer kleinen Szene, die recht charakteristisch für Lindaus Stellung in Berlin war. Er war damals ein Liebling der Gesellschaft und teilte seine Gefühlsgnaden aus wie – ein beliebter Herrscher.
Zum Abendessen an kleinen Tischen waren an meinem Tischchen drei Paare. Eine sehr hübsche und elegante Frau Pringsheim, eine schöne Polin, Frau Treitel, und – ich; dazu die Herren: Herzog von Ratibor, Graf Wilhelm Bismarck und Baron Korff. Der letztere, übrigens damals mein Kavalier, war eine höchst interessante Persönlichkeit. Er war ein Schwiegersohn Meyerbeers und berühmt durch seinen Geist, seine verfeinerten Lebensgewohnheiten, sein ritterliches Wesen, seine Verehrung von Frauenschönheit, sein Verständnis und seine Liebe für die Künste, insonderheit für die Musik.
Sein seelisches Wesen schien mir eine Mischung von Elementen aus verfeinerten Essenzen einer Don-Juan-, Don-Quichote- und einer Faust-Natur. Auch in seiner Erscheinung trat das hervor. Ritterlich, etwas phantastisch, etwas träumerisch, oft kühn in Besitzesfreudigkeit, dann wieder tiefnachdenklich, oft bis zum Sterben lebenssatt und doch leidenschaftlich lebensliebend, konnte er, je nachdem, hinreißend oder abstoßend wirken.
Beim Champagner trat Lindau an unsern Tisch, um mit den Damen anzustoßen. Ganz harmlos und als ob das natürlich und auch erwünscht wäre, küßte er die beiden Berliner Schönheiten auf die Wange beziehungsweise die Schulter. Das machte aber durchaus keinen frivolen Eindruck, sondern hatte etwas gesund Lebensfreudiges, das sich ganz maskenlos frei gab, und die Damen nahmen es auch lächelnd an. Als er mir dann nahte, die ich an diese kleine Münze der Sympathie nicht gewöhnt war, sah er mich lange und tief an und küßte mir dann mit richtigem Feingefühl die – Hand ...
Diese kleine Szene erscheint mir charakteristisch für den kecken, lebensfrohen und doch recht harmlosen Ton der Berliner Gesellschaft von damals ... Ich habe von Berlin in jener Zeit einen schönen, teils sehr bedeutenden Eindruck mit in meine neue Heimat, das Elsaß, genommen. Es war dort eine Hoch- und Freientwicklung aller »guten Geister« ... Auch im Reichsland strebte übrigens damals alles zu edlerer Höhe. Die deutsche Kultur begann siegreich zu wirken, und der Boden, den sie in den elsässischen Seelen fand, war nicht hart und spröde, sondern öffnete sich zusehends wärmer und freier dem Einwirken guter deutscher Einflüsse. Wir konnten ja auch auf dem festen Grunde einer alten deutschen Kultur aufbauen. Denn nur einhundertneunzig Jahre war das alte deutsche Land in französischem Besitz gewesen (1680-1870), und das, was ihm Frankreich an Kultur gebracht hatte, war viel mehr äußerliches Wesen betreffend gewesen. Gottfried von Straßburg mit seinem »Tristan«, Herrad von Landsperg mit ihrem »hortus deliciarum«, später Pfeffel mit seinen »Fabeln«, die Stöbers und anderen Dichter, deren Namen in die Weltliteratur übergingen, hatten dem elsässischen Schrifttum bedeutsame deutsche Elemente eingefügt.
Erwin von Steinbach hatte das weltberühmte Straßburger Münster geschaffen; – in der Malerei wirkten Baldung Grien, Schongauer und andere als einflußreiche deutsche Meister. Man kann wohl sagen, daß alle höhere Kultur von den Deutschen geschaffen ward.
Nur die äußere Kultur, welche mehr auf die gröberen Sinne wirkt: Kochkunst, Kleiderkunst, gesellschaftliche Gepflogenheiten und Sitten kamen dem Elsaß von Frankreich. Das aber schienen die Elsässer besonders zu schätzen, denn sie haben nachmals viel von dieser französischen Kultur geredet und haben sie zurückersehnt. Die im Kern Deutschen im Elsaß haben wohl auch immer die Güter der deutschen Kultur hochgehalten und gepflegt (besonders ist das in protestantischen Pfarrhäusern geschehen), und nur die oberflächlicheren Elemente haben den französischen Firnis, die glitzernde Schale mehr geschätzt als den nährenden Kern. Seit November 1918 sind nun die Franzosen in Elsaß-Lothringen eingezogen. Zuerst gemäß den Bedingungen des Waffenstillstandes als besetzende Truppen. Jedoch mit den immer grimmigeren Bedingungen, die sich mit den wachsenden inneren Gärungen und Zusammenstürzen in Deutschland (durch die Revolution) vollzogen, haben sie es zum festen Besitz usurpiert. Wie furchtbare Rätsel dräut es über Deutschland. Unser Heer ist zurückgekehrt, seit Monden; es ist nicht geschlagen, sondern es hat bis zuletzt auf Frankreichs Boden kriegsmäßig gestanden und hat seine ehernen Mauern nicht durchbrechen lassen. Es ist einfach der ungeheuren Übermacht gewichen, und es ist wohl relativ einer unserer größten Erfolge, daß unsere Feinde erst fünf Erdteile aufbieten mußten, um uns nur zum Rückzug zu bringen. Da stehen denn ungelöste Rätsel, welche der Gang der Geschichte erst langsam lösen wird; zur völligen Klarheit offenbaren wird er sie vielleicht nie.
Wer hat das frevelhafte Verschweigen geübt, das erst mit dem plötzlichen verzweifelten Bekenntnis gebrochen wurde: »Wir können nicht mehr! Wir müssen den Waffenstillstand und den schleunigen Frieden um jeden Preis haben!«
Wer hat den Zusammenbruch, der doch schon wochenlang, vielleicht monatelang heimlich gebröckelt haben muß, verschwiegen?
Und das andere Rätsel? Wie konnte ein Kampf mit so ungleichen Kräften als ehrlicher Kampf der Völker gelten? Wenn im gewöhnlichen Leben ein Mann, und sei er noch so stark, tapfer und wohlgerüstet, einer Gruppe von acht bis zehn Männern gegenübersteht, so wird kein rechtlicher Mensch dies für einen ehrlichen Kampf erklären. Im Weltkrieg jetzt war das aber so, besonders nachdem unsere Bundesgenossen uns treulos verlassen hatten. Deutschland gegen eine acht- bis zehnfache Überzahl! Das war kein ehrlicher Kampf mehr vom großen völkerrechtlichen Standpunkt.
Spätere Geschichtsschreiber werden das mit Befremden konstatieren. Und daß nach soviel Siegen und nicht geschlagen Deutschland in einen brutal ungerechten Waffenstillstand gezwungen ist und zu einem unerhört grausamen Frieden geknechtet werden soll ... Daß die sogenannten »Sieger«, die nur die Übermacht darstellten und durch sie uns zum Rückzug zwangen, nun als Diktatoren und Triumphatoren auftreten, das sind bisher unerhörte Vorgänge in der Geschichte. Und doch steht eine große Nation (die unsere) mit gebundenen Händen einer solchen Fürchterlichkeit gegenüber. Diese gräßliche Tragödie der Weltgeschichte hat entschieden teuflische Züge, die von unseren Feinden hineingetragen wurden.
Doch ich will wieder zu damals zurückkehren. Es war die Zeit der Gründungen, wie ich schon sagte. Nicht nur in der Politik, der Musik, der Philosophie, mit ihren genialen Geistern, Bismarck, Wagner, Nietzsche, sondern auch zum Beispiel in der Literatur. Hier wird, ganz im Gegensatz zur Musik, in der Wagner auf die Ritterromantik, die Sagen- und Legendensphäre, ja zum Mystizismus in seinen Stoffen und Melodien griff, ein Kultus der nackten gegenständlichen Wirklichkeit getrieben und gepredigt. Auch Nietzsche, der Neugründer in der Philosophie, drängte besonders in seiner übrigens herrlichen Lyrik und seinen Aphorismen durchaus in den übernatürlichen Lichtkreis des dionysischen Rausches, der flimmernde Linien über den Dingen sieht und schafft.
Die künstlerische Trunkenheit gewisser epochemachender Geister, wie Wagner und Nietzsche, steht in einem seltsamen sehr scharfen Gegensatz zu den Strebungen des Naturalismus. In der Literatur spielten die Brüder Hart eine bedeutende Rolle. Ende der siebziger Jahre waren sie aus ihrem westfälischen Münster nach Berlin gekommen. Sie hatten bald, anfeuernd durch ihr begeisterndes Wesen, eine Schar neuer junger Kräfte um sich, deren Führer sie wurden. Finanzielle Mißwende zwang sie aber, etwa 1879 Berlin zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren. Aber ihre Feuergeister, zu Leitern und Schöpfern vorbestimmt, konnten die heimatliche Enge und Stille nicht lange ertragen. Die Brüder kehrten bald, ich glaube, nach Jahresfrist, wieder in die Reichshauptstadt zurück, wo sie bald kritisch und dichterisch tätig, die gärenden Elemente zu einer kräftigen Strömung zusammenfaßten. Sie beschirmten besonders die jüngsten Schaffenden in der damaligen Dichtung und traten mit der kritischen Tat für sie ein.
Die beiden Harts waren in Sprache und Auffassung, sowohl im Lyrischen wie im Epischen, von idealer Schwungkraft und weltumfassendem Wesen.
Ich habe Heinrich Hart nur vorübergehend bei Besuchen in Berlin gesehen und gesprochen, aber mit ihm in fruchtbringender Korrespondenz gestanden. Seinen jüngeren Bruder Julius lernte ich erst vor zirka sechs Jahren in Berlin, wo ich zu längerem Besuch weilte, kennen und aufrichtig schätzen.
Die kritische Beanlagung der Brüder Hart (Heinrich ist ja leider schon 1906 schwerem Leiden erlegen) ist gewiß glänzend, aber mir scheint, daß der schöpferische Teil ihres Wesens ungleich viel größer ist und viel gebieterischer zum Ausdruck drängte. Es ist wohl nur aus materiellen Gründen zu erklären, daß der überlebende Julius Hart sein eigentliches Wirkungsgebiet in der künstlerischen Kritik, besonders in der des Theaters, gefunden hat. Die feste Anstellung bei der Zeitung (»Der Tag«) ist wohl hier Schicksal geworden.
Man begegnet nun oft in Literaturgeschichten und in Gesprächen mit hochgebildeten literarischen Persönlichkeiten dem Urteil, als seien die Brüder Hart für Berlin die Bahnbrecher des Naturalismus gewesen, wie es M. G. Conrad für München und Süddeutschland war. Das ist aber nur sehr modifiziert wahr. Die Harts hatten einen führenden Einfluß auf die jungen modernen Geister, und da unter ihnen viel Wirklichkeitsapostel waren, hat man kurzweg die Gebrüder Hart die Führer der norddeutschen naturalistischen Schule genannt. Sie waren aber nur die bedeutendsten Kämpfer für eine Neubildung in der Literatur.
Es wurde vor allem auf andere Stoffwahl, andere Technik und andern Stil hingestrebt, und die damaligen »Dichter«, etwa die um 1860 und da herum geborenen, betrachteten sich als die Bringer einer ganz neuen Kunst.
Mir ist immer die ganze naturalistische Richtung und Entwicklung mehr wie ein Experiment mit etwas absolut Neuem, von Frankreich Hineingetragenem als wie eine natürliche Entwicklung der Geister aus den Zeitströmungen erschienen. Ich glaube, man könnte diese ganze Richtung einen bewußt angestrebten Zolaismus nennen. Als solchen hat ihn der stärkste und leidenschaftlichste Verfechter des Naturalismus, der Münchener Conrad, auch gefeiert und auf seinen Schild gehoben.
Conrad war ein begeisterter Verehrer von Zola und hat ihm, seinen Studien über ihn und so weiter Jahre seines Lebens gewidmet.
Bei Conrads Schwärmerei für Wagner und Nietzsche, die bei seiner feurigen Natur sich sehr leidenschaftlich gab, ist eigentlich seine Propagandarolle für den Naturalismus und die »Moderne« nicht gleich begreiflich. Das kann nur sein Enthusiasmus für Zola bewirkt haben, der seinen Anfang nahm bei Conrads Aufenthalt in Paris. Er feiert ihn als Großmeister des Naturalismus. Etwa 1880-81 schrieb er ein Buch über ihn. In Frankreich begann ja gegen Ende der zwanziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts, etwa 1828, die Reaktion gegen die Romantiker. Honoré de Balzac mit seiner » Comédie humaine«, dann Flaubert mit »Madame Bovary« waren ihre Einleiter. Zola war ihr Vollender als Naturalist.
Conrad ging leider so weit, den ausgezeichneten, feinen Dichter Heyse literarisch zu befehden. Conrad, auch äußerlich eine sehr stattliche Persönlichkeit, hatte und hat in seiner lebhaften Geistigkeit, seinem tief und heiß erfassenden Wesen, in der fast jünglinghaften Begeisterungsfähigkeit und dem dabei männlich festen Charakter entschieden etwas, das junge Geister hinreißt, sie trunken macht und in seine Sphäre zwingt. Er hat diese Macht immer edel zu üben gewußt ... Für ihn und seines Wesens Gleiche gibt es wirklich kein Alter. Er zählt jetzt dreiundsiebzig Jahre, und ist jung, – jung dabei. In einem seiner letzten Briefe findet er die wundervollen Worte für die Jungen-Alten: »Wir Lebendigen, wir Lachenden, wir Verlangenden, wir – Ewigen!«
Die von Conrad gegründete »Gesellschaft«, eine literarische Zeitschrift in München, war nun aber durchaus nicht nur eine Sprechhalle für den Naturalismus, obgleich ihm freier, weiter Raum gegönnt war. Die »Gesellschaft« war mehr eine gastliche Halle für überhaupt starke Dichtertalente, unabhängig von den sie leitenden Strebungen. Detlev von Liliencron, der ein Wahrheits-, aber niemals ein Wirklichkeitsapostel war, trat auch bestimmend in der »Gesellschaft« auf. Ich selbst, Idealistin reinen Geblüts, fand auch liebreichste und förderndste Aufnahme bei Conrad. – Eine merkwürdige Erscheinung ist es, daß zwei bedeutende Naturalisten, Zola und Gerhart Hauptmann, der doch mindestens in seinen Dramen (mit wenig Ausnahmen) entschieden dem Naturalismus huldigt, ihre Erstlingswerke im Banne der Romantik schrieben. Zolas » Contes à Ninon« und Hauptmanns »Promethidenlos« sind Beweise dafür.
Vielleicht ist ihre spätere, naturalistische Tätigkeit mehr aus der verständigen Erkenntnis erwachsen, daß den Auswüchsen und Überschößlingen der Romantik gegenüber eine starke Gegenwirkung nötig sei, als aus drängender Intuition ihrer Phantasie und ihrer gesamten Geistigkeit.
Die beiden die Zeit sehr beherrschenden Geister in der Dichtung-Philosophie und in der Musik, Nietzsche und Wagner, hatten in ihren Seelen aus einem Überstrom von Romantik, Idealismus und Gefühlstrunkenheit, ja sogar Mystizismus geschöpft und eine solche Heerschar von Jüngern, Bekennern und Enthusiasten mit sich gezogen, daß man schon daraus erkennen kann, daß die eigentlichste und mächtigste Zeitströmung durchaus nicht in den Naturalismus mündete.
Eine vorwiegend kritische Natur, mit feinstem Erkennungsvermögen für die Dichtkunst, für die Schönheiten und Intimitäten der Sprache und des Stiles, war der leider zu früh verstorbene Leo Berg. Ich habe in interessantem Briefwechsel mit ihm gestanden und ihn auch in Berlin und noch 1902 hier in Baden-Baden bei mir gesehen. Er gehörte zu den geborenen Führernaturen auf geistigem Gebiet und ist lange Zeit schützend und richtunggebend im literarischen Berlin gewesen. Auch auf mich, die ich abseits im Schwarzwald lebe, hat er Einfluß geübt, freilich ich auch auf ihn ... Armer Quasimodo! Ich glaube, er litt unter seiner Mißgestalt. Er war etwas verwachsen, hatte einen zu großen Kopf und einen zu kurzen Fuß. Aber das alles vergaß man wirklich, wenn man unter dem Banne der Schönheit seiner Seele stand.
Ich biete meine Erinnerungen nicht immer in genau chronologischer Folge, sondern oft, wenn die Strömungen, die sozialen, künstlerischen oder politischen, in andere Zeiten hineingreifen, treten eben diese, besonders beleuchtet, in den Vordergrund. Das geistige Band ist mir im allgemeinen bestimmender und wertvoller als das zeitliche. Meine Gedanken erfassen wieder die Epoche, welche das Ende der Manteuffelschen Statthalterschaft in Elsaß-Lothringen und die Verwaltung des Reichslandes durch den Fürsten Hohenlohe-Schillingsfürst brachte.
Ich habe besonders lange bei der Zeit der ersten Statthalterschaft und bei Manteuffels Gestalt verweilt, weil sie außerordentlich bedeutsam für das Land waren. Sie haben im Gefolge eine Ära der Versöhnlichkeit gehabt, die unter der Verwaltung des Fürsten Hohenlohe-Schillingsfürst sich entwickelte. Sie ist aber wohl viel weniger seinem Walten zu verdanken als der Saat freundlichsten Verständnisses für das ideale und reale Bedürfen des Landes, welche meist von Manteuffels Hand gelegt war. Der Zeitabschnitt der Hohenloheschen Statthalterschaft stand unter sehr günstigem Zeichen. Nicht nur war, wie ich schon oben angedeutet, das Erbe von Manteuffels politischer Tätigkeit als Grundlage neuen Wirkens vorhanden, sondern im zweiten Jahre von Hohenlohes Verwaltung vollzog sich eine völlige Änderung in dem ihm beigegebenen Ministerium, die von bedeutsamen Folgen war. Die damals in Frankreich blühende Boulange mit ihrem wilden Revanchegeist (Boulanger war ja auch eng verbunden mit der Patriotenliga, die ihre Fühlfäden im Elsaß ausstreckte) hatte die Wahlen im Reichsland offenbar beeinflußt. Der Revanchegeist war also wie von draußen eingeführter Impfstoff, der Fieber erregt, nicht aber wie ein aus dem Körper sich entwickelnder Krankheitsstoff ... Diese Krisis führte sogar hart bis an die Möglichkeit, daß man Berlin wieder zum Ausgangspunkt der Verwaltung von Elsaß-Lothringen machen und eventuell die Statthalterschaft aufheben wollte. Fürst Hohenlohe fuhr selbst nach Berlin zur Klärung und Wendung der Dinge. Das Ergebnis war ein Ministersturz. Das Ministerium von Hofmann fiel als Opfer des Sturmes. Von da an hatte mein Mann, der zuerst Unterstaatssekretär (Justiz und Kultus) war, die politische Leitung, zuerst als stellvertretender Staatssekretär und dann vom Sommer 1888 an als ernannter Staatssekretär. Ein Jahr vorher, als er mit der Stellvertretung betraut war, wurde er schon zum Wirklichen Geheimrat mit dem Titel Exzellenz ernannt und ihm das schöne Palais des Staatssekretariats, im Volksmund »das Schlößchen« genannt, zur Wohnung überwiesen. Nach dem Sturm entwickelte sich nun fast eine »Meeresstille und glückliche Fahrt«, wenn man bei solchen geschichtlichen Übergangszeiten überhaupt davon reden kann.
In diese reich- und schönbewegte Zeit unter der zweiten Statthalterschaft brachte das Leben in Kunst und Gesellschaft manche wertvolle Annäherung der neu- und altelsässischen Kreise. Ich habe versucht, im Verein mit meinem Mann in dem kleinen »Schlößchen« am Kleberstaden in Straßburg einen Sammelpunkt der verschiedenen Gesellschaftskreise zu schaffen. Vom Salon aus konnte man in dieser Zeit und unter diesen politischen Konstellationen in der Tat eine kleine Kulturmission erfüllen. Da sind die interessantesten Typen an mir vorübergezogen, und mit den meisten habe ich in lebhaftem Kontakt gestanden. Vielleicht ist es mir gelungen, mit den Anregungen des eignen Wesens, das warm und eindringlich alle Erscheinungen des Lebens umfaßt, auch die mir begegnenden Geister zu höherer Regsamkeit zu entzünden. Jedenfalls weiß ich, daß Huttens Wort: »Die Geister sind wach! es ist eine Lust zu leben!« jener Epoche leuchtend zu Häupten stand. Schon unter Manteuffel war, wohl unter der doppelten Anziehung der neuen, mit hervorragenden Lehrkräften besetzten Universität und des interessanten »kleinen Hofes« (Statthalter mit seiner Familie und seiner höfischen Umwelt), Straßburg der Lieblingsaufenthalt junger deutscher Königs-, Fürsten- und Hochadelssöhne. Ich habe dort den späteren König von Sachsen, seine Brüder Max und Johann-Georg, den später regierenden, jetzt gestorbenen Herzog Friedrich von Anhalt, den Prinzen Aribert von Anhalt, den Fürsten von Hohenzollern (damals Erbprinz), den Prinzen von Meiningen, den Fürsten und Prinzen von Thurn und Taxis, den Prinzen Isenburg-Birstein (dessen Mutter eine Erzherzogin von Österreich war), einen besonders liebenswürdigen Kavalier, Fürsten Leyen, Castell und viele andere kennengelernt. Neben dem Studium, dem sie meist mit Ernst oblagen, kam es auch durch die sehr jungen, lebenslustigen, ritterlichen Herren wie ein Strom von Frohsinn, Leichtlebigkeit, heitrem Lebensgenießen in die Gesellschaft; sogar wie eine feine Welle einer Cour-d'amour-Stimmung. Wie im Federballspiel die Bälle lustig und kühn hin und wider geworfen werden, so flogen hier die leichten Spielbälle der Neigung und Jugendlust hin und her zwischen den jungen Herren und Damen. Und weil es so leicht und spielend geschah, war es auch so harmlos ...
Auch unter Hohenlohes Statthalterschaft waren noch fürstliche und reichsunmittelbare Herren zum »Studium« in Straßburg; aber das Feudale trat dann doch etwas zurück zugunsten des im besten Sinne »gemischten« politischen Salons. Welch bunte Fülle von Gestalten! Der Fürst selbst war eine Verkörperung feinhumanistischen Geistes. Seine schmiegsame kleine Gestalt, seine leuchtenden Augen, seine leise, fein gemessene Rede, die oft sehr warme Tone hatte, – das alles ist mir unvergessen – – – ...
Bei den riesenhaften Dimensionen, in denen er seine Gastlichkeit als Repräsentant des Kaisers üben mußte, trat sein zurückhaltendes, das passive Beobachten mehr der aktiven Unterhaltung vorziehendes Wesen weniger bedeutend in den Vordergrund als im kleinen Zirkel, wenn er zum Beispiel in meinem Salon war.
Der Salon beim Statthalter und auch beim Staatssekretär mußte notwendigerweise etwas gemischt sein, denn die politische Stellung dieser Herren erforderte eine Berührung mit allen Kreisen.
Der Fürstin war das mit ihrem sehr bestimmt ausgesprochenen feudalen Wesen nicht sehr bequem. Die geborene russische und verheiratete deutsche Fürstin war exklusive Hochadelkreise gewöhnt, und ihr historischer Sinn war wohl nicht rege genug, um die recht oft gewöhnlichen Namen und gutbürgerlichen Persönlichkeiten, die man aus politischen Rücksichten empfangen mußte, gern in ihren Kreis sich einfügen zu sehen. Sie hatte ja auch, als ihr Gemahl deutscher Botschafter in Paris war, die offizielle Welt der Republik weniger gesehen als die feudale des Faubourg St. Germain. Übrigens hatten sowohl die Königs- und die napoleonische Kaiserherrschaft als auch die Republik, welche Staatsformen in Frankreich (also auch im Elsaß) wechselten, Spuren in der Gesellschaft und den bürgerlichen Auffassungen gelassen; sie liefen ziemlich widerspruchsvoll nebeneinander her. Die napoleonische Zeit hatte, weil sie ihren kaiserlichen Glanz mit der Verleihung und Schaffung von Titeln, Ämtern und Orden erhöhen wollte, im Elsaß eine ungewöhnliche Achtung vor der Autorität solcher staatlichen Auszeichnungen zurückgelassen und – auch eine Titel- und Ordenssucht, die ein wenig lächerlich wirkte. Es ist zum Beispiel keine Fabel, daß viele Besitzer der légion d'honneur den kleinen roten Orden sogar stolz auf Morgenröcke und Arbeitsjacken hefteten (böse Zungen sprechen sogar von – Nachtkamisols). Ebenso entspricht es der Wahrheit, daß der Titel »Präsident« einen so stolzen Klang für den napoleonisch geschulten Elsässer hatte, daß er sich ihn, und wenn er auch nur zum Beispiel den Vorsitzenden eines Vereins bezeichnete, auf Besuchskarten drucken und sich so nennen ließ ... Neben diesen sklavischen Verneigungen vor Orden und Titeln und der Sucht, solche zu besitzen, gingen auch ausgesprochen demokratische Auffassungen, zum Beispiel, daß man Vornehmheit nicht im Namen oder ritterlichen Wesen fand, sondern vielmehr im Besitz von Geld. Ja, in den ersten Jahren nach dem Krieg wurde im Elsaß das Wort »vornehm« nur als gleichbedeutend mit » sehr reich« gebraucht ... Die elsässische Bevölkerung ist überhaupt eine, die sich den herrschenden Staats- und Lebensformen sehr leicht anschmiegt und angliedert. Wenn man daneben den Elsässern starke Eigenwilligkeit, ja Halsstarrigkeit nachsagt (in Frankreich hießen sie früher nur die têtes carrées), so müßte man jene Anschmiegsamkeit nur als eine rein äußerliche, den Verhältnissen klug nachgebende auffassen, und das würde auf eine geringe Zuverlässigkeit des Charakters schließen lassen. Nachschrift. Jetzt 1918/19 bewahrheitet sich diese Beobachtung in krasser Weise – diese utilitarische Charakterlosigkeit. Die Elsässer selbst lieben, sich in diesem Sinne zu ironisieren.
In allen, in den achtziger und neunziger Jahren besonders viel und mit großem Erfolg aufgeführten elsässischen Dialektdramen des begabten Maler-Dichters Stoskopf zum Beispiel erscheint immer wieder der Typus des zwiespältigen Elsässers, der sich äußerlich den Verhältnissen anschmiegt, ja selbst nach deutschen Titeln und Orden jagt, innerlich aber mit Frankreich paktiert. Und – dieser Typus wird bejubelt und belacht im »Elsässischen Theater«.
Das gibt zu denken.
Übrigens ist in diesem Theater, dessen Gründung und Aufblühen ich noch mit vielem Interesse gesehen und »beschützt« habe, ein altdeutscher junger Jurist, Staatsanwalt Greber, mit ernsten Problemen aufgetreten; seine Dramen sind im reinsten Landesdialekt geschrieben. Er hatte die gründlichste Kenntnis des elsässischen Volkscharakters, eine warme Liebe für das Land und ein großes dramatisches Talent; auch beherrschte er eben die Landesmundart vollkommen. Leider ist er in der Blüte seiner Kraft, – Geist und Herz erfüllt mit großen, künstlerischen Problemen, allzu früh, vor einigen Jahren gestorben. Er war ein sehr bedeutsames Bindeglied zwischen altelsässischem und neudeutschem Wesen, eine Mittlerpersönlichkeit von lautersten Zielen, ganz objektiven Anschauungen und starkem Können. Wenn meine Erinnerung die ganze Zeit, die ich im Elsaß lebte, umfaßt, so erscheinen mir die Jahre, etwa von 1888-1901 (bis dahin kann ich es nur eingehend beurteilen, weil ich es 1901 verließ), die beste Blüte darzustellen. So in künstlerischer, als kultureller, als politischer Beziehung. Hohenlohe-Schillingsfürst, der übrigens schon 1894 Straßburg verließ und nach Berlin als Reichskanzler kam, hat dieser gut fortschreitenden und auch versöhnlichen Entwicklung im Elsaß nur teilweis den geistigen Stempel aufgeprägt. Sein Wirken war mehr ein passives, wie es in seiner beobachtenden, zuwartenden Natur lag; es war mehr ein kluges Gewährenlassen der schön aufkeimenden Entwicklung als ein direkter lebendiger Einfluß ... Ich möchte einige bemerkenswerte Gestalten aus der damaligen Gesellschaft hier herausheben, auf daß sie ein lichtes Auferstehen in diesen Erinnerungsblättern haben.
Neben dem Fürsten Hohenlohe, dem körperlich Schmächtigen, taucht da sein Bruder auf, der Kardinal in Rom war. Er weilte öfter, doch immer nur vorübergehend, in Straßburg. Stattlicher und höher gewachsen als sein Bruder Chlodwig (Clovis nannte ihn die Fürstin, die fast immer Französisch sprach), war er ganz anders in der Erscheinung. Auch aus einer absolut andern Geisteswelt. Er betonte mehr seine Kirchenfürstenwürde als die des weltlichen Fürsten und ließ sich viel lieber »Eminenz« als »Durchlaucht« nennen. Ein kleines und doch scharfes Charakteristikum.
Von Generalen und höheren Offizieren mit besonders eindrucksvollem Wesen treten mir aus der Erinnerung entgegen: der martialische v. d. Burg, dessen Bild ich weiter oben bereits gezeichnet habe; dann General von Verdy du Vernois, nachmals Kriegsminister in Berlin, ein scharfer, beißender Geist; er war von großen, glänzenden Gedanken, doch auch von schneidend zugespitzten – sehr witzig, aber schonungslos in seinem Urteil. Daneben war er für leichtflüssige Poesie begabt, mehr für rasch und oberflächlich hinrauschende, und dann manchmal sentimental. Er war überraschend im Improvisieren von oft sehr reizenden Gelegenheitsgedichten. Verdy hat übrigens auch ein Drama geschrieben, das in Wiesbaden aufgeführt wurde. Er ist als kriegsgeschichtlicher Schriftsteller von Bedeutung gewesen. Seine Werke sind von lichtvoller Auffassung und markigem Stil.
In seinen Improvisationen war er manchmal nicht ganz glücklich in seinen Bildern und Wortspielen. So ließ er zum Beispiel einmal ein kleines Gedicht, welches uns (das Paar Puttkamer) feiern sollte, folgendermaßen enden:
»Sie ist der allerschönste Staat an diesem Sekretär«, übersah aber dabei, daß das, was eine Freundlichkeit, eine Schmeichelei für mich sein sollte, eine Unfreundlichkeit gegen meinen Mann war.
Daneben ersteht mir in der Erinnerung der ernste, strenge Graf Haeseler, der damals in Metz stand. Ein ganz ungewöhnlicher Offizier! Fast barbarisch hart in seinen Anforderungen an Mannschaften und Offiziere, war er beinah noch strenger gegen sich selbst. Er war negierend jedem weichen und reichen Lebensgenuß gegenüber: den Freuden heiterer Geselligkeit, der Liebe, der Tafel, ja sogar der Künste. Er trank zum Beispiel nie Wein, nicht einmal bei offiziellen Gastmählern oder Festlichkeiten; er nahm immer nur – Milch als Getränk. Er hatte das bartlose Gesicht einer ernsten Frau und die mächtigen, unproportionierten Glieder eines unausgewachsenen Riesen. Gewisse abstinente, grüblerische, weltfremde Züge seines Gesichts erinnerten an den großen Moltke.
Und dann will ich des Grafen York, des herrlichen, gedenken, der ein so unwürdiges Ende in China fand (er erstickte an den Gasen eines im Schlafzimmer befindlichen Kohlenbeckens). Und doch schien dieser Held an Geist und Körper vorbestimmt zu sein zu ruhmvollsten Werken und zu einem von Siegen verklärten Ende. Ich sehe ihn noch vor mir, den ungemein ausdrucksvollen Kopf bedeckt mit dichtem, sehr früh ganz weiß gewordenen Haar (er war damals erst Mitte Vierzig), die Stirn sehr hoch, die Augen blitzend von genialen Gedanken und Tatkraft, – ein starkes Lebensbild! Er hatte die Eigentümlichkeit, inmitten bewegtester Gesellschaft halbe Stunden und stundenlang zu schweigen, um dann, von irgend etwas stark angeregt, plötzlich die Schatzkammern seines tiefen Denkens und Wissens zu öffnen und in blinkender Rede Gold darzubieten. Selten ist wohl so, man könnte sagen, aktiv geschwiegen worden. Graf York war mit meinem Mann und mir befreundet und hat einigemal, wenn seine Frau in Rußland zu längerem Besuch weilte (sie war Polin-Russin), bei uns im Schlößchen gewohnt. Wenn wir dann abends zu Dreien zusammensaßen, flog die Unterhaltung wie ein köstliches Flammenspiel hin und her. Mein Mann hatte sehr viel Verständnis und Interesse für die Kriegskunst, wie ich an anderer Stelle schon bemerkte, und York wieder hatte für Staatskunst tiefes Verständnis. So begegneten sich diese beiden erlesenen Geister, und es war ein Genuß, sie zu hören ... Yorks Werke sind nach seinem tragischen Ende mit noch größerem Interesse gelesen worden als in der Zeit seines allzu kurzen Lebens. Sein Werk über Napoleon I., den York als Kriegshelden, Feldherrn, Staatsmann und administratives Genie sehr bewunderte, gilt als ganz besonders wertvoll für die Erkenntnis des genialen Cäsaren und soll, wie York mir erzählte, an der Militärschule von St. Cyr als Lehrmaterial benutzt werden. Auch Yorks »Weltgeschichte in Umrissen«, »Alexanders des Großen Feldzüge«, »Das Vordringen der russischen Macht in Asien« sind ernste, gedankenreiche Geschichtschreibung. Graf Max York war übrigens der Urenkel des großen York.
Seine Frau war eine reizende, sehr elegante und vornehme Weltdame; etwas leichtlebig, ein verwöhntes, launenhaftes Kind. Sie wurde von York schwärmerisch geliebt, hatte selbst aber kaum Verständnis für seine große Natur.
Viele bedeutende Lehrer der Hochschule sind mir beim Statthalter und in meinem Salon begegnet. Außer den schon Genannten, Laband, Geffcken, wären noch besonders zu nennen: Michaelis, Leyden, Kußmaul, Moritz Carriere, Th. Ziegler und andere. Ich erinnere mich eines interessanten Abends, wo ich zwischen den beiden Prinzen Max und Johann Georg von Sachsen, Brüdern des nachmaligen Königs, während des Mahles saß.
Prinz Max machte einen lebensfröhlichen Eindruck, als ob es ihm reizend und erwünscht sei, den prickelnden Schaum aus den Bechern des Daseins zu trinken, während sein Bruder Johann Georg, der äußerlich fast ein genaues Abbild seines Großvaters »Philaleths« war, auch geistig ihm verwandt zu sein schien. Ich beschäftigte mich damals sehr ernst mit der »Divina commedia« und hatte einige Gesänge in gereimte Terzinen, also völlig im Danteschen Versmaß übersetzt. Prinz Johann Georg, der übrigens intimste Kenntnis der Dante-Übertragung seines Großvaters zeigte und feines Verständnis für des großen Italieners Ewigkeitswerk, sprach auch mit ernstem Interesse von meinen Dante-Aspirationen.
Jener Abend mit dem ernsten und dem heitern Prinzen zu meinen Seiten hatte sich mir eingeprägt. Als ich kurze Zeit darauf von dem Schritt des einen vernahm: der katholischer Priester geworden war, tauchten mir unwillkürlich die strengen Züge des »Philaleths«-Ähnlichen auf.
Aber, sehr seltsam: grade der andere, der lebenslustige Prinz Max, hatte die ernste, den Weltfreuden abgewandte Bahn eingeschlagen.
Dies Rätsel hat mich lange beschäftigt ...
Und die herrliche Gestalt des Großherzogs Friedrich von Baden (des 1907 Verstorbenen), der jeden Herbst zu Truppenübungen nach dem Elsaß kam, geht auch durch jene Zeiten. Die Stunden, die ich mit dem milden Mann, dem geistig so regsamen, jeder Kulturentwicklung folgenden Fürsten zusammen war bei Hohenlohe und im eigenen Hause, sind mir fast wie hochgestimmte Feste erschienen. – Die historische Gestalt Friedrichs des Zweiten von Baden habe ich an anderer Stelle gewürdigt und gezeichnet.
Ich möchte hier noch einige intimere Offenbarungen seines Wesens festhalten, die, ganz individuell gegeben, von Mensch zu Mensch, ein eigenartig warmes Licht auf seine Züge werfen ... Er hatte das eine (das er übrigens mit vielen großen Naturen gemeinsam hatte), ich möchte es: die große Liebe nennen. Die wunderbare Bejahung alles Guten und Großen. Aus dieser schönen Güte ist seine heldenhafte und doch dabei so zarte und feine Natur zu verstehen. Die eigentümliche Mischung von Stolz und Bescheidenheit in ihm, das Natürlich-Heroische, das freundliche Eingehen auf jede rein menschliche Frage, das Ritterliche, das geistig Wachsame, das restlose Anerkennen der Größe anderer und die Dankbarkeit, wenn solche Größe sich ihm dienstbar machte: alles dies entstammte der großen Liebe.
Keinem Menschen gegenüber ist mir Nietzsches schönes Wort lebendiger erschienen: »Die großen Gedanken, die aus dem Herzen kommen, – und alle die kleinen, sie kommen aus dem Kopf« ... Übrigens auch ein Beweis, daß des Großherzogs Gedanken aus »dem Herzen kommen«, war ein Umstand, der vielleicht auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen könnte, aber doch vom Psychologen bald als sehr charakteristisch erkannt werden dürfte. Es ist die sehr häufige Anwendung des Eigenschaftswortes »wert«. Das beweist eben, daß er immer in ein Affektionsverhältnis zu Dingen und Menschen trat. Er beurteilte sie nicht nur mit dem Verstand, sondern er wertete sie mit dem Herzen. Ich kenne kaum eine Kundgebung des edlen Fürsten, in welcher jenes Wort nicht mindestens einmal erschiene.
In den Briefen, die ich von ihm besitze, erscheint das kleine bedeutungsvolle Wort immer; – auch habe ich mit Interesse verfolgt, daß kaum eine öffentliche Rede Friedrichs von Baden, wenigstens soviel ich deren kenne, ohne das Wörtchen: »wert« ist, das mir so rührend kennzeichnend für sein Wesen erscheint.
Einige Abende, im kleinen Kreis mit dem Großherzog verbracht, sind mir als besonders eindrucksvoll in der Erinnerung geblieben, weil ich das Gefühl inneren Nahegerücktseins zu dem herrlichen Fürsten nie so lebendig fühlte.
Der erste solcher Abende wird etwa im Herbst 1893 in Straßburg gewesen sein. Der Großherzog kam damals als Generalinspekteur der fünften Armeeinspektion jeden Herbst nach dem Reichsland, um den großen Feldübungen beizuwohnen.
Es war noch unter der zweiten Statthalterschaft (Hohenlohe-Schillingsfürst), und mein Mann war als Staatssekretär Leiter des reichsländischen Ministeriums. Es war im Statthalterpalast ein Herrengastmahl gewesen zu Ehren des Großherzogs. Nach dem Mahl hatte Fürst Hohenlohe noch einige Damen und Herren der Gesellschaft zum Tee gebeten. Es entspann sich nun im Laufe des Abends (Fürst Hohenlohe und mein Mann nahmen auch regen Teil daran) ein Gespräch über die heutige (also damalige) Jugend. Es ist mir unvergeßlich, mit welch edlem Feuer Friedrich von Baden eintrat dafür: den Geist der großen Zeit (Befreiung zur Einheit 1870-71) in der letzten Jugend regsam zu halten. Er fürchte, daß, wie es bei dem Nachgeschlecht eines Heldenzeitalters oftmals schon geschah, die Jugend die mit Blut und Kraft und Leben bezahlten Schätze einfach als bequemes Erbteil betrachte. Es könne der Jugend gar nicht genug gepredigt werden das Goethesche: »Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!« In einer plötzlich und unvergleichlich gewachsenen Größe bescheiden und strebsam zu neuen Zielen zu bleiben, sei eine Seltenheit für rasche und stolze Jugend. Ich erinnere mich, daß ich ihn damals zum erstenmal über einen Satz reden hörte, den er sehr liebte, und der auch gewiß von hohem Lebenswert ist: von der Bedeutung der Erfahrung!
Wir sind später öfters darauf zurückgekommen: Er wertete die Erfahrung als die Vorstufe zu Erkenntnis, Verständnis und zu weisem Handeln. Erfahrung als Summe des Erlebens ist naturgemäß eine Errungenschaft des Alters oder doch der höheren Lebensjahre, und der Großherzog meinte, sie müsse der immerwache Lehrmeister der Jugend bleiben.
Ich erinnere mich, meine Meinung dahin ausgesprochen zu haben, daß ich an die Tüchtigkeit der damaligen Jugend glaubte, was der Großherzog mit einem gütigen, aber doch ein wenig zweifelvollen Lächeln aufnahm.
Viel später, es war im Winter 1901-1902, sprachen wir wieder über das Thema. Mit Freuden konnte dabei bestätigt werden, daß der damals schon über dreißigjährige Friede kein fauler, sondern ein äußerst fleißiger gewesen sei, indem eine Hochblüte auf den Gebieten geistiger, technischer und manueller Arbeit erschienen sei: in der Kunst, in den Wissenschaften, in Kunsthandwerk, Industrie, Verkehrsleben und Handel. Wohl eine stillere Größe als die der heroischen Jahre, aber doch eine lebhafte Zeugin für die Tüchtigkeit des Nachgeschlechts ...
Ein anderer Abend, der mir besonders im Gedächtnis haftet, war auch in Straßburg, etwa im Jahre 1898. Der Großherzog hatte eine Einladung zum Gastmahl bei mir angenommen in den Räumen des sehr schönen Staatssekretärpalais. Der Großherzog führte mich zu Tisch. Ganz herzgewinnend war es, wenn er irgendeinen huldigenden, schmeichelhaften Satz ausgesprochen hatte und dann gleich, wie entschuldigend, hinzufügte: »Sie müssen das einem alten Herrn nicht übelnehmen, wenn er seine Meinung so frei sagt.« Damals war grade ein neues Dichtungsbuch von mir erschienen, daran knüpfte sich dann ein Gespräch über Literatur. Des Großherzogs Kunstempfinden und -geschmack wurzelten tief im Klassischen. Die neuere Kunst, insofern sie dem Kultus der nackten Wirklichkeit huldigt, der minutiösen Behandlung der Erscheinung, sei diese auch gemein, häßlich oder abstoßend, wertete er gering. »Was ich an Ihrer Dichtung besonders liebe, ist die klassische Linie«, sagte er mir öfters.
Des Großherzogs Interesse und Verständnis für Literatur ging übrigens viel mehr auf historische als auf schöngeistige Werke.
Der Großherzog, der eine besondere Schätzung für meinen Mann und dessen politisches Wirken an der Spitze des reichsländischen Ministeriums hatte, unterhielt sich oft mit diesem über elsaß-lothringische Angelegenheiten und zeigte ein ganz ungewöhnliches Verständnis dafür – selbst für kleinere und fernerliegende Verwaltungsfragen.
Damals war wieder einmal in den Zeitungen und überhaupt in der öffentlichen Meinung der oft beschworene und wieder gebannte Schatten aufgetaucht: von der Zuteilung des Elsaß an Baden.
Wer Friedrichs von Baden großzügige historische Auffassung der Mission und der Aufgaben der deutschen Fürsten im Verhältnis zur höheren Einheit im Reich kannte, der mußte ja gleich lächelnd erkennen, wie töricht es war, ihm solche Aspirationen anzusinnen. So klar hätte doch die Anschauung in jedes Beobachtenden Geist treten müssen: daß in dem Heroendrama von 1870 das Schicksal ihm eine Rolle aufbewahrt hatte, die er mit der schönen Unterordnung ausfüllte, welche den Geist der Sache über alles stellt und ihr einen Triumph gibt über jedes persönliche Moment. Friedrich von Baden hatte es einmal klar ausgesprochen: »Es gibt keine Freiheit ohne Unterordnung und Selbstlosigkeit« – ein ähnlicher Gedanke, wie ihn Euripides kundgab: »Gehorsam fühlt meine Seele sich am schönsten frei.«
An jenem Abend begann der Fürst jene wieder aufgetauchten Gerüchte zu berühren im Gespräch mit meinem Mann.
In dem sonst so sanften, wie gedämpft strahlenden Blick kam es da wie Funken, die allmählich aufloderten zu einer Flamme, wie von auferweckter Jugendlichkeit.
Mir war's, als ob ich einen späten Reflex des Feuers von 1870 in den Worten glühen sähe ...
Wie er damals dem Großherzog von Oldenburg gegenüber betont hatte, als von Gebietserweiterungen süddeutscher Staaten nach ihrer siegreichen Beteiligung am Deutsch-Französischen Krieg die Rede war, daß »Baden keine Belohnung für sein Verhalten wolle, denn dies sei einfach eine Pflichterfüllung gegen das deutsche Volk und gegen das Deutschtum an sich gewesen«, so, fester noch und klarer, führte er an jenem Abend jenen Gedanken aus. Es war ein edler Genuß, ihm zuzuhören, und die Stunde bewahre ich in meinem Gedächtnis auf als eine der seltenen, wo die Nähe einer bedeutenden Persönlichkeit uns wie mit dem Ahnen historischer Größe umweht.
Eine andere eindrucksvolle Erinnerung stellt ein Abend im großherzoglichen Schloß, hier in Baden, dar. Die Demission meines Mannes hatte uns von Straßburg nach Baden geführt. Es war im November 1904. Ein unvergeßlicher Abend!
Ein Gastmahl im Schloß hatte einen kleinen Kreis, vielleicht zwölf Personen, vereint. Roggenbach, der als Gast des Großherzogs im Schlosse wohnte, und der Admiral von Diederichs, der Führer der Chinaflotte, waren auch anwesend.
Rührend war es anzusehen, wie der achtundsiebzigjährige Großherzog dem neunundsiebzigjährigen Roggenbach Aufmerksamkeit erwies.
Freiherr von Roggenbach war bekanntlich von 1861 bis 1865 badischer Minister und dem großherzoglichen Paar auch später immer besonders nahestehend. Roggenbach, nur anderthalb Jahre älter als Friedrich von Baden, war aber an Erscheinung und Kraft (geistiger und körperlicher) mindestens ein Jahrzehnt älter. Er bot ein Bild greisenhafter Hinfälligkeit neben dem viel aufrechteren, hellblickenden Fürsten; dennoch folgte er der sehr lebensprühenden Unterhaltung, die sich dann entspann, fein aufmerkend, und brachte auch hin und wieder durch irgendeinen bedeutsamen Satz eine eigenartige Strömung in den Gedankenfluß ...
Ich hatte mich in dem Kreis so hervorragender Männer natürlich beiseitegestellt, – aber der Großherzog und Roggenbach zogen mich gleichwohl in die Unterhaltung, die sich dann plötzlich um mein Buch: »Die Ära Manteuffel« zusammenschloß ...
Nie ist mir ein Wort, auch nicht die bedeutendste schmeichelhafte Kritik aus der Feder berufener Kritiker, soviel wert gewesen und hat mich so stolz gemacht, als das des Großherzogs über mein Buch, das übrigens Roggenbach, etwas echohaft, in gleichem Sinn wiederholte.
Der Großherzog gab mir die Hand und sprach: »Ich danke Ihnen herzlich!« – und als ich frug, wofür, und sagte, daß ich das gar nicht verdiente, meinte er: »Für die Ära Manteuffel – ich habe viel daraus gelernt ...«
Und dann wurde über meine günstige Auffassung des alten Feldherrn gesprochen.
Der Großherzog hatte wenig Sympathie für Manteuffel ... das lag wohl in gegensätzlichen Anschauungen zu dessen militärischen und diplomatischen Auffassungen und Leistungen.
Ich verteidigte mich, indem ich betonte, daß ich den Feldmarschall erst in einer späteren, geklärteren Epoche seines Lebens kennen und werten lernte, – wo sein brennender Ehrgeiz Befriedigung und Kühlung gewonnen hatte, durch die Berufung zu einer Mission (Statthalter des Reichslandes), welche fast die eines Regenten war. Der Großherzog, dessen schönnatürliche Einfachheit im Gegensatz stand zu dem bewußten Pathos und den historischen Gesten Manteuffels (ich kann kein passenderes Wort dafür finden), lehnte vieles in dessen Wesen ab. Er fand es aber sehr beachtenswert und interessant, daß man des alten Feldherrn Natur, wie er sich gerade in der elsässischen Mission betätigte, höher auffassen konnte, – und er ging lebhaft darauf ein, – um so mehr, als auch mein Mann eine ähnliche Wertung für Manteuffel hatte wie ich. – Und meines Mannes Urteil hat der Großherzog allezeit sehr hochgehalten.
Wenn die Großherzogin Luise in das Gespräch eintrat, was an jenem Abend in besonders lebendiger Weise geschah, so machte es sich ganz natürlich, daß sie geistig führte und mit dem beweglichen Funkenspiel ihrer Gedanken und Anregungen auch die anderen Geister zu höherer Anregung leitete. Der Großherzog hatte dann eine so milde und doch männliche Art, sich ihren Urteilen anzulehnen.
Ein ganz schroffes oder scharf ablehnendes Wort ward wohl selten oder kaum aus seinem Munde gehört. Wenn er aus irgendeinem Grunde eine Sache oder eine Persönlichkeit mißbilligte oder im Gegensatz zu einer ausgesprochenen Meinung anderer geringer einschätzte, so schwieg er meist – mit einem feinen, überlegenen, doch nicht verletzenden Lächeln. Das habe ich einigemal zu beobachten geglaubt, als von Bismarck und auch von Manteuffel die Rede war, die er nicht bedingungslos schätzte. Den dritten Reichskanzler dagegen hat er bei dessen Lebzeiten sehr hochgehalten als einen milden, weisen Staatsmann.
Ein Brief aus dem Dezember 1904, den mir der Großherzog noch eigenhändig schrieb, gibt davon bestimmt Kunde. Die Stelle lautet: »Wertgeschätzte, gnädige Frau! Empfangen Sie meinen recht herzlichen Dank für Ihr sosehr gütiges Schreiben, womit Sie mir die hochinteressante Aufzeichnung über den vormaligen Statthalter Fürsten Hohenlohe-Schillingsfürst zu übersenden die Aufmerksamkeit erwiesen haben. Es war das ein Aufsatz, den die »Neue Freie Presse« im August 1904 veröffentlicht hatte. Ich habe diese Arbeit mit dankbarer Freude gelesen, da ich jeden Ausdruck der Anerkennung der Verdienste und hohen Eigenschaften dieses ausgezeichneten Staatsmannes freudig begrüße. Es ist sehr verdienstvoll, daß Sie es unternommen haben, aus Ihren Lebenserfahrungen ein so reiches Maß von gerechtem Lob und Verehrung ihm zu bekennen und damit den künftigen Generationen ein Vorbild von hoher Bedeutung und historischem Wert zu schaffen.« Damals sagte ich ungefähr folgendes von Hohenlohe: Neun Jahre ist es mir vergönnt gewesen, in des Fürsten Chlodwig Hohenlohe Nähe zu leben, als er von 1885-1894 die Statthalterschaft in Elsaß-Lothringen führte und das Erbe Manteuffels antrat. Selten sind wohl zur Waltung derselben Aufgabe zwei so absolut entgegengesetzte Naturen sich unmittelbar gefolgt. Der geniale Heißsporn Manteuffel, dessen starke Initiative, dessen unbezwingliche Lust zu Aktionen etwas Jugendbeflügeltes, nicht immer von edlem Maß Gezügeltes hatte – und – der wägende, fein beobachtende Hohenlohe, der sich den Extrakt aus den Verhältnissen und Menschen vorsichtig suchte und fand, ihn dann mit den Elementen seines Wesens durchsetzte und dann erst als reifes Ergebnis in Wort und Tat zur Erscheinung brachte. Hohenlohe hatte bei seinem Verwaltungsantritt zwar ausgesprochen: »Ich stehe nur auf dem Piedestal, das Manteuffel errichtet hat« – dies letztere ist aber nur richtig zu verstehen mit einer Einschränkung, die zwar wie eine bloße Formalität klingt, dennoch aber eine fundamentale Wesentlichkeit ist.
Hohenlohe hatte wohl im großen und ganzen Manteuffels Versöhnungspolitik adoptiert, aber er handhabte sie von Grund aus anders, – nämlich mit dem, was Bismarck so bezeichnend »ministerielle Bekleidungsstücke« nannte. Manteuffel machte seine eigene Überzeugung, sein subjektives Urteil souverän und unbedingt zum Agens bei den wichtigsten Entscheidungen. Hohenlohe dagegen ließ sein ruhig erwogenes Urteil immer beeinflußt und bedingt werden von dem Rat der ihm zur Seite stehenden Minister. Etwas Harrendes, Spähendes lag in dem Wesen dieses Staatsmannes, etwas, das seine beste Größe in passivem Wirken hatte. Er ließ die Dinge wachsen und werden, zwang sie nicht in seine Kreise, sondern neigte sich zu ihnen und erspähte ihre Entwicklungsmöglichkeiten ... Für eine politische Übergangszeit, wie sie bei der Einsetzung der Landesverwaltung von Elsaß-Lothringen 1879 bestand, wäre Hohenlohe geradezu die vorbestimmte Persönlichkeit gewesen. Es ist auch authentisch, aber dürfte nicht sehr bekannt sein, daß Fürst Bismarck unter den Kandidaten, die für den Statthalterposten (den ersten, 1879) in Erwägung kamen, in erster Linie an den Fürsten Chlodwig Hohenlohe dachte. »Er wäre ein vortrefflicher Mann für diese wichtige Stellung –, aber ich kann ihn jetzt in Paris nicht entbehren«, äußerte Bismarck.
Die Wahl Manteuffels, die von dem damaligen Reichskanzler nur mit Bedenken gutgeheißen wurde, ging aus der eigensten Initiative Kaiser Wilhelms I. hervor, der allezeit höchste Sympathie und Schätzung für den Feldherrn-Staatsmann bekundet hatte. Als Manteuffel 1885 starb, ward dann auch Hohenlohe sogleich auf den Statthalterposten in Straßburg berufen. Er kam von Paris, wo er unter schwierigen politischen Bedingungen lange Jahre durch sein Taktgefühl und die weise Milde seines Auftretens, sowohl in amtlichen, als in sozialen Kreisen, eine hochgeachtete und beeinflussende Stellung als deutscher Botschafter einnahm ... Fürst Hohenlohe machte beim ersten Schauen einen etwas matten, hinfälligen Eindruck. Seine ganze Erscheinung und Art schienen auf den ersten Blick nicht in die großen Linien zu passen, mit welchen sein Bild damals in die Geschichte gezeichnet war. Der Eindruck wurde aber gewandelt, wenn man in seine Augen sah, und wenn der etwas stockende Gang seiner Rede beflügelt wurde durch das ungemein Gedankenausdrucksvolle seines Blicks. Was in seinen Worten manchmal unzureichend war (denn er hatte nicht die Macht der Rede), ergänzten seine Blicke. In ihnen stand gleichsam die Beweiskraft dafür, daß der milde Mann auch sehr eindrucksvoll und kräftig handeln konnte. Wenn die Bedeutung dieser staatsmännischen Kraft nun auch hauptsächlich in passivem Wirken bestand, so soll damit nicht etwa ausgesprochen sein, daß es ihr versagt gewesen wäre, in große Aktionen zu treten und zur erforderlichen Zeit eine starke Initiative zu ergreifen. Das hat wohl vor allem sein energisches Handeln in den sechziger Jahren in Bayern bewiesen, wo er damals als Ministerpräsident wirkte. Sein kraftvolles Eintreten gegenüber ihm gegensätzlichen Parteien in Fragen der Zolleinigung der süddeutschen Staaten mit Preußen, die er durchsetzte, – sein unverrückbares Festhalten an dem von ihm als richtig erkannten Ziel: den Anschluß Bayerns an Preußen zu bewirken, vor allem aber die Zirkulardepesche, welche ein Vorgehen gegen die Jesuiten anregte und die katholischen Staaten zu gemeinsamer Abwehr gegen das von Rom her drohende Unfehlbarkeitsdogma anrief, sind lebensvolle Beweise dafür. Das sind weltbekannte Dinge, die ich hier nur skizziere zur Illustration seiner geistigen Persönlichkeit. Fürst Hohenlohe war ein Kenner der Weltliteratur. Es hatte sich, wohl durch seinen langen Aufenthalt in Paris und dadurch, daß in seinem Hause viel Französisch gesprochen wurde, bei ihm eine Vorliebe und intimere Kenntnis der französischen Literatur ausgebildet. Er war dementsprechend der modernen deutschen Literatur etwas fremder geworden und blieb den Dichtern seiner Jugend zugewendet.
Wenn wir auch in der Schätzung moderner deutscher Dichter öfters verschiedener Ansicht waren: in der Wertung von Platen zum Beispiel waren wir völlig eins. Der Fürst konnte ganz feurig und jugendbegeistert werden, wenn er jemand fand, der seinen geliebten Poeten verstand und liebte. In meinem literarischen Merkbüchlein stehen noch viele Strophen, die mir der Fürst in die Feder diktiert hat; meistens von Platen, aber auch von Th. Moore, Longfellow, Yonny und anderen.
Ich habe, außer meinem weiter unten charakterisierten Freund Cronau, noch nie einen Menschen kennengelernt, der so viele und so lange Poesien rezitieren konnte, aus freiem Gedächtnis, wie Hohenlohe.
Auf Nietzsche und seine eigenartigen, tiefen, doch oft etwas bizarren Schöpfungen habe ich den Fürsten aufmerksam gemacht. Er kannte den genialen Dichter-Philosophen kaum vom Hörensagen, und dennoch stand dieser auf der Höhe seiner Berühmtheit. Ein Beweis dafür, daß Hohenlohe dem damals aktuellen geistigen Leben in der deutschen Literatur doch etwas fremd geworden war.
Als er Nietzsche aber dann eingehend studierte, gewann er eine tiefe Schätzung für ihn und zitierte oft die eigentümlichen Kraftsätze des großen Einsamen, Selbstherrlichen.
Im November 1894 ging Hohenlohe von Straßburg fort, um seines Kaisers Ruf auf den diplomatischen Thronsessel in der Wilhelmstraße in Berlin zu folgen. Er hatte sich als Statthalter im Elsaß viel Schätzung und Sympathie gewonnen, und die Ehrungen, die ihm die Bevölkerung bei seinem Abschied bewies, waren bei der Besonderheit der politischen Bedingungen freudig überraschend; sie schienen als spontane Impulse von Bedeutung. Der Fürst verließ das Reichsland sehr ungern. Er war fünfundsiebzig Jahre alt, und dazu kam, daß seiner Wesensart überhaupt das Zuwartende, das leise Wirken eignete, und nicht die beflügelte Kraft, die frisch und kühn wagt und erobert, – die er an seinem großen Vorgänger Bismarck allezeit bewundert hatte, und die ihm eine Vorbedingung für die außerordentlichen Forderungen der höchsten Amtswaltung im Reiche erschienen. Es ist ihm aber in den sechs Jahren, die er Reichskanzler war, dennoch vergönnt gewesen, daß er auf der verhältnismäßig kurzen Wegstrecke bedeutende Marksteine von Erfolgen aufrichten konnte, so zum Beispiel die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Militärstrafprozeßordnung und so weiter.
Hohenlohes Bedeutung lag, wie ich schon oben andeutete, mehr in passiven Eigenschaften. Seine meisten Erfolge sind aus äußerst geschicktem und taktvollem Zusammenwirken solcher Kräfte hervorgegangen. Hohenlohe war ein Meister darin, die Begabungen der ihm zu- und untergeordneten Beamten zu erkennen und den von ihm als gut erkannten Ideen dienstbar zu machen. Er hatte also auf dem gewaltigen Kulturboden der Geschichte weniger die Berufung zum Schöpfer oder Säemann als zum klugen Gärtner und Bebauer. Wenn seiner Natur das Schöpferische versagt war, so waren ihr dafür die Eigenschaften des Erhaltenden und zu höheren Graden Entwickelnden gegeben. Als Geist mehr tief als hochfliegend, in seiner Seelen- und Charakterart mild abgeklärt wie edler Wein, der keine Gärung und keine unsauberen Elemente kennt, – mehr weise als genial, mehr sinnend und wägend, als kühn versuchend und wagend.
All sein Denken und Handeln war aus der Philosophie geboren, nicht aus der raschen Ursprünglichkeit der Inspiration. Eine von den ruhigen Größen der Geschichte, die nicht blenden durch überraschende Wirkungen, aber deren Licht in stiller Flamme wegedeutend wirken kann.
Durch die 1906 erschienenen und von Hohenlohes Sohn, dem Prinzen Alexander, im Verein mit dem Präsidenten Curtius herausgegebenen Memoiren des Reichskanzlers ist des Großherzogs Friedrich Urteil wie auch das aller ernsten Beurteiler und Verehrer des alten Fürsten ungünstig beeinflußt und gewandelt worden. Vieles, was als Größe oder weise Zurückhaltung erschien, stellt sich im Licht dieser Memoiren-Bekenntnisse als von kleinerem Geist beseelt dar. Eine gewisse, nicht immer taktvolle Geschwätzigkeit, wenn es sich um interessante Unterhaltungen mit bedeutenden Persönlichkeiten handelte, machte sich darin geltend. Und das Schweigen, das »aktive Zuhören«, wenn Menschen, denen Hohenlohe Bedeutung zumaß, redeten, war wohl weniger ein überlegenes Prüfen anderer geistiger Anschauungen als ein Sichten und Sammeln von Elementen, Anregungen, Auffassungen, die er mit dem eigenen Denken verquicken konnte, um sie sich fruchtbar zu machen.
Die Mißbilligung des Großherzogs Friedrich von Baden für diese Memoiren galt aber mehr denen, welche sie ohne weise Redaktion veröffentlicht hatten. Denn wirklich ward das schöne Licht, in welchem Hohenlohes staatsmännische Gestalt in der Geschichte stand, nachmals durch Wolken verdüstert, die manchen kleinen, fast entstellenden Zug in sein Bild zeichneten.
Des Großherzogs Tadel traf besonders den Sohn des Reichskanzlers, den Prinzen Alexander, von dem er ein verständnisvolleres Sichten des reichen Stoffes aus dem Lebenswirken seines Vaters erwartet hatte. Auch daß man mit der Publikation nur fünf Jahre nach dem Tode des alten Fürsten gezögert hatte und sie nicht, wie er es gewollt, zehn Jahre nach ihm veröffentlichte, fand der Großherzog ungehörig. Ich habe damals eine Ehrenrettung des Prinzen Alexander geschrieben und in der »Neuen Freien Presse« erscheinen lassen; aber es war schwer, ihn gegen den allgemeinen Sturm des Unwillens ein wenig nur zu decken.
Daß der dritte Reichskanzler absolut unfähig war, eine »Rede« zu halten, ist ja bekannt. Sogar bei Tischreden konnte er eine lähmende Befangenheit nicht meistern. Er hat es mir einmal ganz bestimmt versichert, daß dies nur begründet war in einer großen Schüchternheit. Und die befiel ihn, den Weltkundigen, Geselligkeit Gewöhnten, der mit allen Größen seiner Zeit verkehrt hatte, merkwürdigerweise sogar, wenn er in irgendeine größere Gesellschaft eintrat. Er hat mir das so bestimmt versichert, daß wohl kein Zweifel daran sein dürfte. Und wenn nun auch durch die Memoiren Schatten auf sein hellglänzendes Bild gesunken sind: Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst ist doch eine bedeutende Gestalt von weitreichendem und fruchtbarem Einfluß in der Geschichte seiner engeren Heimat Bayern und des großen Deutschen Reiches gewesen.
Einer Tatsache, die nicht uninteressant und dabei wenig bekannt sein dürfte, möchte ich Erwähnung tun; nämlich, daß es von bedeutender literarischer Stelle beabsichtigt war, mir die Bearbeitung der Hohenloheschen Memoiren zu übertragen. Und das verhielt sich so:
Meine »Ära Manteuffel« war zuerst in der »Deutschen Revue« (deren feingeistiger Herausgeber und Leiter Richard Fleischer ist) veröffentlicht worden, ehe sie als Buch erschien. Als man von der Existenz der Hohenloheschen Memoiren erfuhr, hatte sich in Fleischer der Wunsch geregt, daß ich diese Denkwürdigkeiten bearbeiten möge. Als er im Jahre 1904 einige Wochen in Baden-Baden weilte, nahm er eines Tages Gelegenheit, das meinem Manne mitzuteilen. Dieser erwiderte ihm, daß er, ebenso wie Fleischer, überzeugt sei, daß ich diese Arbeit sehr gut und auch gern vollziehen würde; aber er glaube, der Fürst hätte noch bei Lebzeiten über die Art der Veröffentlichung seiner Memoiren verfügt. Übrigens hätte sein Sohn Alexander, der ihm von seinen vier Kindern wohl geistig am nächsten stand, diese Denkwürdigkeiten gewissermaßen als Erbteil erhalten. Man müsse sich also an ihn wenden.
Fleischer sandte auch dann den Direktor Löwenstein von der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart nach Kolmar im Elsaß, wo Prinz Alexander Bezirkspräsident war. Löwenstein brachte die Botschaft, daß Prinz Alexander bereits gebunden sei durch den Willen seines Vaters, der noch bei Lebzeiten den Präsidenten Curtius in Straßburg als Herausgeber und Redigierenden, neben ihm, dem Prinzen, selbst bestimmt habe.
Ich möchte hier eine Charakteristik der engeren Familie des Fürsten (besonders des Prinzen Alexander) einfügen, die wohl von großem politischen und sozialen Interesse sein dürfte. Ebenso möchte ich die Gemahlin Hohenlohes besonders hervorheben.
Der Fürstin Gestalt war zu eigenartig, herb, stolz und doch natürlich warm, und in dieser Beziehung von Eigenschaften zu interessant, um sie nicht in hellere Betrachtung rücken zu sollen. Sie war eine prachtvolle Natur, ich möchte sagen: mit unbeugsamen Energien und ungebrochenen Kräften. Etwas despotisch wohl, aber sie übte die Despotie einer großen, sich mit starkem Willen markierenden Liebe. Sie konnte wohl einmal unbequem damit werden, aber man fühlte doch, was für eine Urkraft des Wohlwollens in ihr wirkte. Wahrheit und Gerechtigkeit übte sie bis zur Rauheit; – daneben lagen Züge reicher und weicher Barmherzigkeit mit aller Kreatur; vornehmlich Mitleid und Liebe zu Kranken und zu schutzlosen Tieren.
Die Fürstin liebte auch jeglichen Sport und übte ihn noch mit frischrüstigem Eifer, als sie die Sechzig überschritten hatte. Sie ritt, schwamm, schoß, machte die höchsten Bergaufstiege und jagte, – auf ihren russischen Besitzungen Elche und Bären und in den steirischen Bergen Gemsen.
Die Fürstin war also Russin, eine geborene Prinzessin Wittgenstein, die Schwester des teils berühmten, teils berüchtigten Prinzen Peter Wittgenstein. Ihre Bildung war ganz französisch, wie ja überhaupt die geistigen Bedürfnisse der russischen Aristokratie sich nur an den Quellen Frankreichs befriedigen. Sie hatte wenig oder kaum Verständnis für deutsches Geistesleben. Ich habe aber, wenn wir auch von durchaus verschieden geprägter Wesensart waren, immer viel Sympathie, Verstehen und Verehrung für ihre herbe und doch so gefühlvolle Eigenart gehabt.
Die Kinder des Fürsten, die doch natürlich in den neun Jahren ihres dortigen Aufenthalts den Gesellschaftskreisen nahegetreten waren und auch Einfluß auf sie gewonnen hatten, waren recht verschieden an Begabung und Erscheinung. Der älteste Sohn, der damalige Erbprinz, weilte nur immer vorübergehend in Straßburg. Er war eine stattlich-schöne Erscheinung, mit den leuchtenden Augen des Vaters, – und hatte eine ganz auffallende Ähnlichkeit mit dem Prinzen von Wales, nachmaligem »Einkreiser« Eduard VII.
Der Erbprinz Philipp Ernst hatte die behaglich liebenswürdige Natur eines Lebemannes im besseren Sinne. Seine geistige Physiognomie hatte keine markanten oder großen Züge. Dagegen war seine Frau, eine geborene griechische Prinzessin Ypsilanti, von feiner und eigenartiger Geistigkeit. Ihr Gesicht trug hochintelligente, – semitische Züge. Das war auch natürlich, da ihre Mutter eine Tochter des bekannten jüdischen Bankiers Baron Sina in Wien (ebenfalls griechischer Herkunft) war. Das erbprinzliche Paar war im Winter, wo es von seinem böhmischen Schloß Podiebrad kam und die Straßburger Gesellschaftszeit mitmachte, eine vornehme Zierde der Gesellschaft. Der damalige Erbprinz war nach seines Vaters 1901 erfolgtem Tod noch längere Jahre Fürst und starb an einem üblen, schweren Leiden, das ihn auch zuletzt seiner geistigen Fähigkeiten beraubte. Er war nach dem Tode seiner ausgezeichneten Gattin Chariclée zum zweiten Male, und zwar morganatisch, verheiratet, – mit einer Schauspielerin. Dieser Verbindung entstammt ein Sohn ...
Das älteste Kind des alten Fürsten Chlodwig, die unverheiratet gebliebene Prinzessin Elisabeth, war eine so köstliche Inkarnation der echten Herzensgüte, daß sie wohl zu den ganz, ganz wenigen gehört, die keinen Feind hatten und deren mildes, stilles und weiches Wesen überall in der Familie und in der Gesellschaft versöhnlich, vermittelnd, die guten Elemente zusammenschließend, wirkte. Auch sie ist tot. Von der engeren Familie des Fürsten Chlodwig, ihn und seine Gemahlin eingeschlossen, lebt nur noch das Zwillingspaar: Fürst Moritz und Prinz Alexander. Moritz, als der zuerst von dem Zwillingspaar auf der Welt Erschienene, erbte das Fürstentum, als sein Bruder Philipp Ernst starb.
Für Repräsentation, offizielles Hervortreten oder gar politische Tätigkeit ist er weniger geschaffen. Er liebt vielmehr ein gemütvolles häusliches Leben in vornehmer Einfachheit und Ruhe. Da er mindestens die Hälfte des Jahres auf seinem Besitztum in Steiermark, Alt-Aussee, lebt, hat sich seit langem bei ihm eine Vorliebe für steirisches volkstümliches Leben ausgebildet. Er trägt dort die Gebirgstracht und liebt wie die Steiermärker Zitherklang, Schnadahüpfl, Volkstänze und Gemsjagd.
Er stand lange Zeit beim dritten Garde-Ulanenregiment (bei dem jetzt sein Sohn steht), und ich kenne ihn, auch von Straßburg her, wo er Adjutant seines Vaters, des damaligen Statthalters, war, in der vornehm kleidsamen Uniform dieses Truppenteils. Das zarte Gelb, das die Uniform belebt, kleidete den hübschen, dunkeläugigen Prinzen sehr gut – – aber – sein eigentlichster, kleidsamster Rahmen war doch die Steirer Bergtracht.
Da sehe ich ihn noch vor mir, als ich damals (1892) bei den alten Hohenlohes in Aussee zum Gastbesuch war, wie er, äußerlich ein einfacher steirischer Bua, die Zither spielte. Das sehnsüchtig sentimentale »Verlassen bin i« von Koschat begleitete er, während ich, die berühmte Oktave hinaufsteigend, schwärmerisch sang ... Unstreitig das interessanteste und begabteste von des Fürsten Chlodwig Kindern ist der Prinz Alexander. Wie sich diese Zwillinge, Moritz und Alexander, äußerlich ganz ungemein unähnlich sind, so auch im Gemüt und in ihrer gesamten Geistigkeit. Prinz Moritz sah aus wie ein schmucker, im besten Sinne genußfroher Edelmann, der in Familie und Welt lieber die kleine leichte Münze gesellschaftlicher Freundlichkeit als die schwerere goldene tatkräftiger Freundschaft oder geistiger Betätigung ausgab. Flott, hübsch, leichtlebig, gutmütig und sehr verträglich war er. Sein Zwillingsbruder Alexander trug schon äußerlich die Marke seines ganz anders gearteten Wesens. Groß, schlank, mit ernsten, mehr interessanten als sympathischen Zügen, trug er sich in Haar- und Bartschnitt und in der Kleidung sehr »englisch«. Er sah auch aus wie ein hochmütiger, kühler Hochtory. –
Hochmütig!? er galt entschieden dafür, – aber ich glaube behaupten zu können, daß jeder, der nur ein wenig tiefere Einblicke in seinen Charakter, in seine ganze Wesensart tat, das verneinen mußte. Er war nur schwer zugänglich, weil er von einem die Seelenregungen und die Gedanken gern verschließenden Stolz war. Er war nicht nur von starken Gedanken, sondern auch von heißen Gefühlen beherrscht, was ja auch die Geschichte seiner Liebe und Ehe beweisen dürfte. Seinem Vater, den er übrigens schwärmerisch und bedingungslos verehrte, stand er geistig am nächsten; das habe ich oft aus des alten Hohenlohe-Schillingsfürst Munde gehört.
Prinz Alexander Hohenlohe, der nur das Referendarexamen gemacht hatte, übersprang in der staatlichen Stufenleiter ziemlich viele Stufen und ward vom Referendar aus gleich – Bezirkspräsident. Aber seine große Intelligenz und Anpassungsfähigkeit an die Landes- und Verwaltungsverhältnisse glichen den Mangel an den Übergangsstufen aus. Freilich war ihm in seinem Oberregierungsrat Sommer eine beratende und tatkräftige Stütze gegeben, kraft derer er sicherer, fest und mit größeren Schritten ausschreiten konnte. Sommer war einer von den nicht gerade zahlreichen jüngeren Beamten, die wahrhaft staatsmännisch begabt waren, sich allezeit einen großen, tiefen Blick für die politischen Verhältnisse wahrten und dabei eine gewandte, feste und doch milde Hand hatten.
Sommer, der in der Beamtenskala bis zur Stellung eines Ministerialrats aufgestiegen war, nahm ziemlich verstimmt von dem politischen Charakter der Köllerschen Ära, seinen Abschied aus dem Staatsdienst und trat in den privaten Dienst der fürstlich Solms-Braunsfelsischen Verwaltung. Für die Betätigung dieser hervorragend begabten, staatsmännisch veranlagten, feurig-energischen Persönlichkeit war es ein viel zu enger Entfaltungsraum.
Eine andere sehr hervorragende jüngere Kraft ist Heinrich Cronau, welcher bis jetzt, das heißt bis zur Ausweisung der deutschen höchsten Behörden durch die Franzosen, die einflußreiche und bedeutsame Stellung als Unterstaatssekretär des Innern innehatte. Seine gesamte Geistigkeit, sein Charakter, seine Intelligenz, seine bedeutende Urteilskraft, seine sehr eigenartige Lebensphilosophie machen ihn zu einer der interessantesten und liebenswürdigsten Erscheinungen, der man im Leben begegnen kann. In seinen Lebensformen ist er von einer gewissen behäbigen Gelassenheit, welche Elemente der Resignation zu enthalten scheint. Die ist nicht etwa ein Zeichen von Phlegma und Lässigkeit, sondern das Ergebnis tiefgründiger Philosophie, welche lange einsame Wege mit dem Frankfurter Philosophen Schopenhauer gemacht hat. Die Weisheit, die sich Cronau aus seiner Welterkenntnis extrahiert hat, ist ernst und resigniert, aber nicht von der Unerbittlichkeit und Bitterkeit Schopenhauers, sondern von der gelassenen Heiterkeit eines leichten Fatalismus gemildert. Eine seiner liebenswürdigsten Eigenschaften ist es, daß er nie einem Minderbegabten seine überlegenen Geisteskräfte fühlen läßt und – im antiken Sinne des Wortes – disputieren kann.
Bei den stärksten Meinungsunterschieden bleibt er immer sachlich in kristallklarer Objektivität, wie sie nur immer die griechischen Philosophen bei Disputationen haben konnten ... Eine seltene und bemerkenswerte Kraft stützt seinen bedeutenden Geist: das ist ein ganz außerordentliches Gedächtnis. Und Gedächtnis ist natürlich eine der förderndsten Grundlagen für jede Bildung und Kultur. Es hatte sich, weil solche Gedächtniskraft ganz selten vorkommt, ein Legendenkreis um Cronaus Leistungen auf diesem Gebiet gebildet. Aber vieles, was märchenhaft, fast unglaublich erschien, war dennoch Wahrheit. So zum Beispiel die Tatsache, daß Cronau das ganze Handelsgesetzbuch auswendig wisse. Ich habe den bedeutenden Mann, den ich meinen Freund nennen darf, erst kürzlich gesprochen und auf meine diesbezügliche Frage die Antwort erhalten, daß er tatsachlich das ganze Handelsgesetzbuch mit Ausnahme von zwei bis drei Paragraphen, die aber kaum je angewendet würden, auswendig gewußt habe und wahrscheinlich noch wisse. Eine Eigentümlichkeit dieses phänomenalen Gedächtnisses ist, daß es besonders allem Gedruckten und Geschriebenen gegenüber so überraschend wirksam ist. Lebensvorgänge, Menschen, deren Namen, Gesicht usw., prägen sich seinem Gedächtnis nicht so ein. In dieser Hinsicht ist zum Beispiel mein Gedächtnis viel unfehlbarer.
Ganze Akte von Dramen, die Cronau vielleicht Jahrzehnte nicht mehr gelesen hat, weiß er wörtlich zu zitieren. Und er hat niemals etwa mnemotechnische Übungen gemacht; es ist eben nur eine wertvolle Naturanlage. Dieser großbegabten und großzügig entwickelten Persönlichkeit müßte in dem durch die Nationalversammlung neu zu schaffenden deutschen Staatswesen eine hervorragende Stelle verliehen werden, denn es gibt wenig deutsche Männer, die seinesgleichen sind an reingeistigen und moralischen Werten.
Doch wieder zu Prinz Alexander zurück! Er ging 1894, als sein Vater das Elsaß und den Statthalterposten verließ und als Reichskanzler nach Berlin ging, auf dessen Wunsch mit ihm, als sein Adlatus. Das war eine Art Vorstudienzeit für die amtliche Selbständigkeit im Bezirkspräsidium Kolmar. Indessen hatte er seine Ehe mit der verwitweten Fürstin Solms, geborenen Prinzessin Tricase-Moliterno, geschlossen. Gegen den ausgesprochenen Willen seiner Familie, besonders seiner Mutter, die zu mir mit einer leidenschaftlichen Heftigkeit und mit einer Freimütigkeit darüber sprach, daß es mich peinlich befremdete und in schwere Verlegenheit setzte. Die Fürstin Solms war ein gut Teil älter als Prinz Alexander, ich glaube: neun Jahre. Jedoch die Leidenschaft des Prinzen und wohl auch die seiner heimlich Verlobten gingen mit so glühender Kraft gegen die hemmenden Schranken, daß sie bald hinfällig wurden. Die Ehe ward kein Glück, – und die Gatten leben seit langem getrennt voneinander. (Scheidung ist nicht möglich, da beide Katholiken sind.) Sie lebt in einer Villa in Beaulieu an der »Azurküste«, der Prinz lebt in Paris, seit Beginn des Krieges aber und wohl auch jetzt noch in Zürich. Er hat Deutschland verlassen, weil er sich angefeindet und mißverstanden fühlte. Seine spätere politisch-publizistische Tätigkeit in Schweizer Zeitungen, die sehr undeutsch, fast wie vaterlandslos wirkte, ist nicht mehr objektiv, sondern von subjektiven Erfahrungen beeinflußt. Die Erfahrungen, die vor allem seinen Geist verdüstert und seinen Charakter verhärtet und verschärft haben, sind wohl die, welche die Veröffentlichung der Memoiren seines Vaters ihm brachten. Schuld und Schuldlosigkeit, bewußte scharfe Absicht und eine gewisse ideale Gutgläubigkeit, Berechnung der Wirkung und eine fast naive Freude an allem, was sein Vater geschaffen, sogar wenn es recht fragwürdig war, die Freude auch, daß er nun rückhaltlos jede, jede Kundgebung, jede Intimität veröffentlichen konnte, – das alles wirkte zusammen, um die Tragödie zu vollenden, die sein Leben fortan darstellte. Denn von allen Seiten brachen Unheil und Anfeindungen über ihm zusammen.
Der alte Fürst-Reichskanzler hatte im Mai 1901, als er nach Ragaz fuhr (wo ihn bekanntlich der Tod ereilte), bei seinem Sohn Alexander, dem damaligen Bezirkspräsidenten in Kolmar, einige Tage gerastet. Er war auf einem Gastmahl bei seinem Sohn mit dem Präsidenten des Konsistoriums, Professor Curtius, zusammengetroffen. Der Fürst hatte die Gedenkblätter seines Lebens seinem Sohn Alexander letztwillig hinterlassen und ihm das schon bei Lebzeiten, mitgeteilt. Nun trat er an Curtius heran mit der gewichtigen Frage: »Wollen Sie mir helfen, meine Memoiren zu ordnen und herauszugeben?«
Curtius bejahte, – doch, noch ehe eine gemeinsame Sichtung, Auswahl und Anordnung des reichen Stoffes erfolgen konnte, starb Hohenlohe.
Jener Satz hätte nun ein Leitmotiv für die hochpolitische Aktion der Herausgabe jener Memoiren sein sollen. Es lag doch zweifellos in ihm der Gedanke, daß eine Sichtung und Auswahl notwendig sei, denn es waren viel intime und interne Fragen in den Blättern behandelt, deren Fassung und Wiedergabe ebenso ein feines politisches Taktgefühl, als eine weitschauende, tiefeindringende Erkenntnis forderten. Vieles hätte auch für immer in das Reich erlauchten Schweigens gewiesen werden müssen, denn Verschweigen ist oft viel königlicher als große Worte. Es sollte auch eine Bestimmung des alten Fürsten bestehen, daß, wenn der Tod ihn bald überrasche, die Memoiren erst zehn Jahre nach seinem Tode veröffentlicht werden sollten. Es geschah aber nicht also, sondern die »Erinnerungen« erschienen schon fünf Jahre nach Hohenlohes Tode, und sie gaben bedingungs- und rückhaltlos alle Erinnerungen, Urteile, Erfahrungen, Gespräche mit bedeutenden Menschen, das heißt also den ungekürzten Inhalt der »Denkwürdigkeiten«. Auch der Deutsche Kaiser war sehr ungehalten über einen großen Teil des Inhalts, vorzüglich, wo es sich um ganz vertrauliche Gespräche zwischen ihm und dem Reichskanzler handelte. Wilhelm II. war so erzürnt ob der Vollherausgabe der »Denkwürdigkeiten«, daß er den Familienältesten der Schillingsfürster Hohenlohes telegraphisch berief und ihm seinen starken kaiserlichen Unwillen aussprach. Aber an der Tatsache der Veröffentlichung war nichts mehr zu andern, und der Fürst Philipp Ernst konnte nun keinen Einfluß auf seinen Bruder Alexander mehr ausüben. Prinz Alexander reiste in der Folge (es war im Jahr 1906, fünf Jahre nach dem Tode seines Vaters) nach Berlin, um einen Versuch der Rechtfertigung beim Kaiser zu machen. Er hatte eine vertrauliche Besprechung mit dem Fürsten Bülow, der damals Reichskanzler war, um ihn zu ersuchen, ihm Audienz beim Kaiser zu erwirken. Jedoch der Fürst teilte dem Prinzen in liebenswürdigster Form mit, daß es geratener sei, er stände von seinem Vorhaben ab, denn des Kaisers Unwillen sei stark erregt gegen ihn, und er liefe Gefahr, entweder überhaupt die Audienz nicht bewilligt zu erhalten oder sehr harte Worte über sich ergehen zu lassen. Unter diesen, für Hohenlohe scharfen und tragischen Bedingungen zog er es vor, aktionslos zurückzufahren nach Kolmar; aber er sah sich moralisch gezwungen, den folgerichtigen Schritt zu tun: er bat um seine Entlassung. Sie wurde ihm klanglos gewährt. –
Mit dem hochherzigen, edlen alten Großherzog von Baden, Friedrich II., hatte ich öfters Gelegenheit, über die Hohenlohe-Memoiren zu sprechen. Das Urteil des sonst so milden, maßvollen Mannes war vernichtend für Alexander Hohenlohe.
Kurzum, der aufgewühlte wilde Strom der Meinungen trug den Prinzen nicht weich und angenehm auf seinen Wellen, sondern erschütterte ihn heftig. Dazu kamen dann noch politische Erfahrungen in seiner elsässischen Amtsstellung und – die Trennung von seiner Frau. – Man legte ihm sogar wegen der verfrühten Herausgabe der Memoiren üble, selbstsüchtige Motive unter, als habe er um der finanziell reicheren Ernte willen das Lebensbild seines Vaters noch einmal so früh veröffentlicht, als es vom Verfasser gewollt und gewünscht war ...
Die Seele des Prinzen Alexander war durch seine Erfahrungen so mit Bitternissen gefüllt, daß er menschenfeindlich, ja: vaterlandsfeindlich die Reihen seiner Genossen und Landsleute floh. Er ging nach Paris und die Übersetzung der »Denkwürdigkeiten« ins Französische begann. Das geistige Wesen des Prinzen und seine Lebensgepflogenheiten waren immer mehr kosmopolitische als national-deutsche gewesen; und als deutscher Edelmann neigte er mehr zu Deutsch-Österreich als zu Deutschland.
Als der Weltkrieg ausbrach, verließ der Prinz Paris und ging nach – Zürich. Von da an beginnt eine Epoche seines Wirkens, die mir völlig wesensfremd und auch unverständlich ist. Denn hier herrschen weder Gerechtigkeit noch Liebe, sondern die dämonischen und trügerischen Geister, die, weil sie nicht gradaus schauen, sondern schielen, alle Umrisse und Farben falsch sehen. Prinz Alexander hat in der »Neuen Zürcher Zeitung« öfters Aufsätze veröffentlicht, wie zum Beispiel: » Caveant consules!« »Der Selbstmord Europas« und andere, welche ganz undeutsch, fast vaterlandslos wirken und nicht ahnen lassen, daß der Verfasser einen der deutschesten Fürstennamen trägt und sein Vater als Reichskanzler die Geschicke des Deutschen Reiches und als Statthalter die des Reichslandes leitete ... Prinz Alexander verehrte seinen Vater als einen überzeugungstreuen, allezeit für Deutschlands Wohl und seinen Kaiser wirkenden Staatsmann; aber er scheint das in diesen Kundgebungen vergessen oder doch in den Hintergrund gerückt zu haben. Wenn der Geist des alten Fürsten seinen Liebling Alexander sähe in der fragwürdigen Umwelt dieses Schweizer Ortes Zürich, der nun ein Treffpunkt aller Unzufriedenen der Welt und besonders von deutschfeindlichen Elementen geworden ist, er würde wohl tief erschrecken. Mir persönlich, die ich sehr viel Sympathie und Schätzung für den Prinzen Alexander hatte und habe, tut es weh, ihn durch persönliche Erfahrungen in so subjektiven Anschauungen befangen zu sehen.
In der Zeit der Statthalterschaft von Hohenlohe-Schillingsfürst (1885-1894) liegt für mich auch reiches künstlerisches Erleben. Mein Haus war als sehr kunstliebend bekannt, und es gestaltete sich daher ganz natürlich, daß, wenn bedeutende Künstler nach Straßburg kamen, diese besonders Fühlung mit uns suchten. Auch die heimischen Künstler, besonders die sich kraftvoll und vielseitig entwickelnde Maler- und Bildnervereinigung, auch die elsässischen Dialektdichter standen mir nahe.
Eine der glänzendsten und berühmtesten Erscheinungen, der ich an anderer Stelle Worte innigster Bewunderung und wärmsten Gedenkens gewidmet habe, möchte ich hier ganz besonders würdigen. Es ist Franz Liszt, den ich 1885 (ein Jahr vor seinem Tode) eine Woche bei mir zu Gast hatte.
Wohl hatte ich in Wort und Schrift von schwärmerischen Anhängern und Freunden sowie von scharfen Kritikern eine Fülle von Urteilen über den Meister auf mich wirken lassen und mir aus dem teils ins Maßlose drängenden Überschwang der Linien, teils aus solchen von nüchterner Führung, die dem Hochgang seines Künstlertums nicht folgen konnte, mittlere, aber doch große Linien zu einem Bilde von ihm gefügt; die intimeren Züge trug ich mir selbst hinein aus den Offenbarungen, die mir seine Musik aus seinem Seelenleben vermittelte.
Ein Künstleraristokrat schien er mir, eine von den großen Renaissancenaturen, die alle reichen Reize und alle Mängel ihrer stark bewußten, nicht mit naiver Eingebung wirkenden Kunst zeigen; die in ihren subjektivistischen Neigungen sich neue Formen suchen und diese Formen, wie eine Renaissanceart, das Rokoko zeigt, in überfließender Ornamentik zur Erscheinung bringen.
Aber das Bild, das ich vom Meister hatte, blieb im Grunde doch ein Bild meiner eigenen Phantasie.
Denn die echte Erkenntnis erwächst doch erst aus persönlichen Berührungen, aus der Anregung und Anschauung von Individuum zu Individuum. Und wirklich! wie wuchs sein Bild ins Große, Warme, Leuchtende!
Wie habe ich in wenig Tagen persönlich-vertrauter Begegnung das ganze reiche, wechsel- und stürmevolle, in einem ewigen Vibrato von Erregungen und Anregungen hinströmende Leben dieses merkwürdigen Mannes verstanden! – Damals, es war ein milder, blütenöffnender Maitag, trat mir also Liszts eigenartige Gestalt wunderbar eindrucksvoll zum ersten- und letztenmal entgegen. Beim ersten Anblick und in der ersten Stunde schien er mir von einer müden Hinfälligkeit. Etwas Schleppendes, Gebrochenes lag in seinen Bewegungen, in seiner Sprache, ja sogar in dem, was er sprach, als wären Lenz- und Sommerorkane seines Lebens bis in die Krone und Wurzeln gefahren und hätten die Kernkraft seines Marks zerrissen. Aber ich erkannte sehr bald darauf, schon einige Stunden später, als wir beim Mahl in kleinem Kreise beisammensaßen, daß diese scheinbare Müdigkeit nur eine stolze Zurückhaltung war; ein sensitives Zurückweichen vor dem Mißverstandenwerden, das gerade seiner überschwenglichen Natur nur allzu leicht bei den »Vielzuvielen« geschehen konnte.
Als ich, neben ihm sitzend, zuerst nur zagende, gleichsam tastende Antworten erhalten hatte, fiel mir plötzlich ein, daß Liszt seine intimsten literarischen Kundgebungen, so: » Chopin De la fondation Goethe à Weimar« usw. in französischer Sprache verfaßt hatte. In einer glücklichen Eingebung fuhr ich in der Unterhaltung in dieser Sprache fort.
Da richtete sich seine zusammengesunkene Gestalt empor, – er warf die langen, schneeweißen Haare von der Schulter zurück (eine Bewegung, die er, wie ich beobachtete, nur machte, wenn ihn etwas stark anregte) und hob die Augen. Ein rascher Jugendstrahl kam in seinen Blick, und er begann lebhaft zu sprechen. Wie ein blinkendes Strömen war es in seiner Rede.
Liszt war, wie bekannt, ein geborener Ungar; die deutsche Sprache war ihm, wie freilich auch die französische, eine angelernte. Wohl mag die geschmeidige Grazie und der pikante Reiz des Französischen mehr seiner Seelenart entsprochen haben –, aber ich glaubte den Grund seiner Sympathie doch noch etwas tiefer gefunden zu haben: es war die Sprache seiner Liebe, seines Glückes und der feinsten Blüte seines Künstlertums gewesen! Die Jahre in Paris hatten ihm ein Bündnis verfeinertsten Genusses gegeben, in der Leidenschaft für die geistreiche, anmutige Gräfin d'Agoult, die übrigens selbst unter dem Namen Daniel Stern künstlerisch, und zwar in der Literatur, tätig war.
Da hatte er das Paradies, von Liebe und Kunst vereint, genossen, das Musset mit den Zeilen malt:
Du paradis j'ai fait le tour –
J'ai fait des vers, j'ai fait l'amour.
Manchmal hatte ich, während Liszt sprach, die Empfindung, als wäre ein Jüngling neben mir, solche Hingerissenheit des Gefühls, solche rasche Gluten der Diktion, soviel Kraft war in seinen Worten! ...
In Liszts Wesen lag etwas, im besten Sinne des Wortes: Aristokratisches, ja sogar etwas Beherrschendes, so daß man unwillkürlich an Schillers Wort gemahnt wurde, das er Karl VII. in der »Jungfrau von Orléans« reden läßt:
»Es soll der Sänger mit dem König gehen –
Sie beide wohnen auf der Menschheit Höhen« ...
Aus diesem mild beherrschenden Zug, der in ihm lag, glaube ich auch die eigentümliche Erscheinung erklären zu können, daß Liszt seine Laufbahn als konzertierender Pianist, obgleich sie ihm Triumphe ohne Beispiel brachte, so früh aufgab, – mit 37 Jahren. In dem Herumreisen von Land zu Land, von Hof zu Hof liegt, wenn es auch in dem denkbar vornehmsten Rahmen geschieht, doch immer ein Stück Vagantentum, und das widerstrebte offenbar seiner aristokratischen Natur! Als er 1848 sich dauernd in Weimar niederließ, schuf er dort für die Musik ein klassisches Zeitalter und war zugleich ein König in einem Kunstreich. Es erwuchs um ihn her eine Art von Hof mit allem regen Treiben, ehrgeizigen Drängen, Favoritstellungen und so weiter, wie es sonst nur monarchischen Höfen eignet.
Liszt kam 1885 zur Aufführung seiner »Heiligen Elisabeth« nach Straßburg, welches Oratorium, um ihn zu feiern, damals in imposanter Weise in einigen süddeutschen Städten aufgeführt wurde.
Wie immer auf all seinen Wegen war dem Meister ein kleines Heer von Anhängern und Bewunderern gefolgt, das ihn in überschwenglichen Worten wie ein Hymnenchorus umsummte. Es war interessant zu beobachten, mit welcher Liebenswürdigkeit er dennoch eine unnahbare Grenze zwischen sich und ihnen markierte. Zu mir hatte er vom ersten Abend an einen völlig anders gestimmten Ton, den Ton einer zarten Huldigung möchte ich's nennen, denn es war Ritterlichkeit und Wärme darin ...
Am Tage nach der Elisabeth-Aufführung sollte ein größerer Abendempfang bei mir sein. Es war nun natürlich in der Gesellschaft der begreifliche Wunsch rege, den Meister auch spielen zu hören. Aus Zartgefühl machte ich ihm aber nicht die mindeste Andeutung davon. Da berührte er selbst in ganz unerwarteter Weise am Morgen des Tages der Festlichkeit die Frage. In seiner leisen, einschmeichelnden Art nahm er meine Hand und sagte: »Ich habe soviel von Ihrem schönen Gesang gehört. Werden Sie uns nicht heut abend etwas singen? Vielleicht ›Mignon‹ von mir? Ich würde Sie begleiten.«
» Si vous chantez«, setzte er mit warmem Lächeln hinzu, » je vous jouerai quelque chose« ...
Ich war sehr entzückt von dieser seinen Liebenswürdigkeit; aber, offen gestanden, auch ein wenig erschreckt ... Liszt würde mich also zu einem seiner Lieder begleiten, und – ich hatte noch nie zu seiner Begleitung gesungen. Ich wußte also gar nicht, ob er etwas sehr willkürliche Künstlerrhythmen nehmen würde, oder ob er vielleicht gar die Gewohnheit hätte, freie Phantasien zwischen die gegebene Begleitung zu streuen. Ich sagte ihm dennoch freudig zu und sang abends: »Kennst du das Land?« Er aber spielte diskret und ohne jede Kaprice die Begleitung. Er lächelte mich während des Singens mit seltsam jugendlichem Aufleuchten des Auges an. Als der letzte Ton verhallt war, drückte er meine Hand und sagte: » Merci, Mignon«. Die zwei innigen Worte sind mir wie ein künstlerisches Erlebnis in der Seele geblieben!
Und dann spielte er.
Ich hatte ihn nie bis dahin gehört, denn als er seine Virtuosenlaufbahn schloß, war ich noch nicht geboren, und später ließ er sich nur hören in dem verhältnismäßig engen Kreis, in dem er wechselnd in Weimar, Rom, Budapest lebte, und mit dem ich keine Berührung hatte.
Er spielte! Und da erfuhr ich zum erstenmal, daß der wahre Genius in sich die Ewigkeit der Jugend, der Liebe, des Lenzes aller Kräfte birgt.
Die Psyche siegte so fraglos über die Physis, daß sogar das Gesetz der Natur, daß das Alter ein Verwelken des Organismus ist, aufgehoben schien. Dieses Genie, dieser Mann mit dem großzügigen Geist und Herzen, die er in seiner Kunst offenbarte, war ein geborener Herrscher über Seelen. Ein hinreißender Flug von Schwärmerei, der von der Entzückung sich zur Verzückung steigerte, trug ihn selbst und die unter seinem Zauber stehenden Hörer gleichsam über Räume und Zeit hinweg. Liszt zauberte aus dem an sich spröden Klang des Pianos, aus dem wenigstens mein Ohr immer das Holz und das harte Elfenbein anklingen hört, Geigenwirkungen hervor. Es rauschten unter seiner Hand ebenso machtvolle, fast orchestrale Töne auf, wie feine und zärtliche Stimmen zu werben schienen, etwa als ob in Lenzbüschen Amseln und Nachtigallen sangen.
Wohl war das Spiel jenes Abends unvergeßlich, aber es sollten mir noch viel intimere Kunstoffenbarungen werden; jedenfalls hatten sie einen ganz besonderen, in dieser Art von keinem andern erfahrenen Reiz, und waren nur für mich allein. Und das ist ein köstlicher Besitz in den Erinnerungen meines Lebens. Es kam so: damals war das erste Buch Dichtungen von mir erschienen. Liszt sah es in meiner Bibliothek; es schien ihn zu interessieren. Eines Morgens trat ich in seinen Salon, wo auch der Flügel stand. Ich störte ihn sonst nie in den Morgenstunden, die er mit geistlichen Übungen (er war ja damals Abbé in Rom), Erledigung seiner sehr regen Korrespondenzen, Gängen in den Münster, Empfang von Besuchen usw. ausgefüllt hatte.
An jenem Morgen aber öffnete ich leise die Tür, weil ich den Flügel anklingen hörte und mir einen verstohlenen Platz suchen wollte, um den Meister zu hören.
Er hatte mich erblickt und – bat mich, zu ihm zu kommen, denn er wolle mich spielen.
Mein Dichtungsbuch lag aufgeschlagen auf dem Piano und nun hub er an zu phantasieren über eine Strophe oder Dichtung, die ihn anzog.
Ich erinnere mich noch besonders der Töne, die er zu einem kleinen Gedicht: »Sehnsucht« fand, welches seine schwärmerische Seele, die neben grandiosen Zügen auch mimosenhaft-feminine hatte, sehr bewegte. Die Worte lauten:
Die Glocken rufen um Mitternacht –
Die Sehnsucht ist großäugig aufgewacht,
Und redet sacht –
Sie wandert in Nächten und ruht am Tag –
Ihr Herz hat einen fiebernden Schlag,
Daß ich tief erschrak –
Sie ist wie ein irregewandertes Kind,
Um die Stirn trägt sie ein Dornengewind,
Und schluchzt und sinnt ...
Nun ward so ruhelos mein Herd,
Da sie um Mitternacht eingekehrt
Und mich weinen gelehrt.
Sie löste vom Haupt sich ein Dornenreis,
Und drückt es auf mein Herze leis –
Das blutet nun heiß ...
War es nicht, als ob die Sehnsucht, dieser zarteste und beflügelte Drang der Seele, eine goldene Schmetterlingsgestalt nahm und in den offenen Himmel des Entzückens steuerte?
Wie er das in Tönen gab! Und wie am Ende die Akkorde verhallten, als ob leise und glühend die roten Lebenstropfen aus dornenwundem Herzen rieselten ... Das war auch eine Programmusik, die aber nur mir gehörte, die niemals aufgeschrieben ward (leider!), und die nur wie ein ganz zartes, aber unsterbliches Klingen über meinen eignen Strophen in meinem Erinnern tönt.
Liszt übte, wie es wohl begreiflich ist, einen bestrickenden Zauber auf die Frauen aus, – und sein ganzes Leben, bis in sein Greisenalter hinein, ist durchwebt von Leidenschaften und schönen Trunkenheiten des Gefühls: der Liebe – denn Liebe ist wie die Lebensluft des Genies.
Fast alle großen Künstler, besonders Dichter und Musiker, haben ein bewegtes Herzensleben gehabt. Man könnte sagen: sie lieben die Liebe. Nüchterne Geister haben oft schiefe, kleine oder scharfe Auffassungen darüber ausgesprochen; sogar der geistreiche, gewiß nicht kleinliche oder spießbürgerliche Nietzsche. Er prägte über Liszt das schneidende, verständnislose, aber witzige Wort: »Liszt ist die Schule der Geläufigkeit – nach Weibern.« Stachlichte, in sich zurückgezogene, einsame Naturen wie Nietzsche können eben das Reichausstrahlende und Glut- und Lichthinnehmende in Seelen wie die von Liszt nicht verstehen. Seine Herzens- und Geistesverbindung mit der Fürstin Wittgenstein, die ja auch in Weimar lange mit ihm gelebt hatte, führte nicht zur Ehe, trotzdem sie von beiden viele Jahre leidenschaftlich angestrebt worden war und nachdem endlich in Rom und durch Rom alle Hindernisse überwunden waren. Welche Gründe das bewirkten, liegt wohl ganz tief und nie ganz entschleiert im Seeleninnersten des Meisters. Aber einen reichen Wert hat für ihn die seelische Verbindung mit der Fürstin immer gehabt, – er schrieb ihr jeden, jeden Tag, – auch damals, von Straßburg aus, – und er war doch bereits ein müder Mann von – vierundsiebzig Jahren.
Eine hübsche Episode möchte ich noch aus den Tagen von Liszts Besuch erwähnen.
Eines Morgens, während der Abwesenheit des Meisters (er war täglich, er war ja seit 1865 Weltgeistlicher in Rom, zur Messe im Straßburger Münster), kam mein Mann, der sonst so Ernste, Gemessene, mit einem, fast möchte ich sagen: schelmischem Lächeln aus des Meisters Schlafzimmer. Er hielt sorglich ein geschlossenes Papier. Ich begegnete ihm in einem der Salons und frug, warum er so bedeutungsvoll lächle und was er denn in dem Papier trage. Da öffnete er das Geschlossene – und es war ganz voll langer weißer Haare. Die hatte er im Schlafzimmer noch vor dem Ordnen desselben zusammengesucht, um – sie an Damen der Gesellschaft, die ein Andenken von Liszt sehnlich wünschten, zu schenken. Und, – ich kann versichern: sie fanden reißenden Absatz ... den paar ausgefallenen Greisenhaaren wohnte also für viele Verehrerinnen immer noch eine mystische Anziehung inne. Ich gestehe, daß ich keinen solchen Fetisch begehrte. Liszt hatte mir bessere Andenken geschenkt: eine prachtvolle Bildnisphotographie mit einer reizenden Widmung und dann das große Medaillon seines Kopfes, von Rietschel modelliert, das jahrelang in seinem Weimarer Studio bei ihm gewesen war, ein mir besonders liebes und intimes Andenken. Liszt war ein ungewöhnlicher Schöpfer, und besonders in seinen sinfonischen Tonwerken von einem imponierenden Können. Und er war ein Anreger für eine ganze Künstlergeneration. Seine Kunst zu lehren hat eine Reihe sehr bedeutender Künstler geweiht. Zwei der hervorragendsten, Tausig und Franz Brendel, sind allzu früh gestorben. Der letztere stellte (wenigstens für mich) die zarteste und gewaltigste Offenbarung einer Künstlerseele dar; sein Spiel stand über jedem Vergleich, den Worte geben können. Liszt war auch selbstlos und bahnbrechend wirkend für andere tonschöpferische Genies, wie besonders für Wagner und Berlioz. Er war auch ein ungewöhnlich feiner Schriftsteller. Aber nicht allein in der reichen, schillernden Vielheit seines Künstlertums liegt der Zauber, den er auf seine Zeit und weit über sie hinaus übte, sondern in seiner eigentümlich hinreißenden dithyrambischen Geistesart. Es war eine jener starken dionysischen Naturen, von denen es wie Rausch und Entzücken ausgeht, – die sich an sich selbst und an der gesamten Erscheinungswelt berauschen, und deshalb auch den Rausch und die Entrückung ins Hohe in andern Geistern bewirken. Wie ein köstlicher Edelstein strahlte er Schönheit aus, denn des Edelsteins Wesen ist es: zu leuchten! Aber nur Auserlesenen war er zugänglich – denn es ist eine bekannte Wahrheit: »Der Rubin läßt sich nur vom Diamant ritzen« ...
Manche Begegnungen und Freundschaften mit Großen der Kunst und der Welt fallen in diese Zeit. Zwei von besonderem, lange nachwirkendem Wert sind meine Beziehungen zum Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern und zu seiner Schwägerin, der Infantin Eulalia von Spanien, die mit dem Herzog von Montpensier verheiratet war. Ich hatte der sehr reizvollen Infantin in dem Straßburger Staatssekretärpalais Gastfreundschaft erweisen können, und sie hatte gebeten, daß, wenn wir nach Paris kämen, wir doch ihrer Mutter, der Exkönigin Isabella II. von Spanien, Besuch machen möchten. Die Infantin Eulalia, die jetzt fünfundfünfzig Jahre zählt, ist von lebhaftester Jugendlichkeit; sie gehört für mich zu den – Zeitlosen, die man sich gar nicht alt vorstellen kann, weil die Elemente der Jugend, Frische, Grazie und Lebendigkeit das Zepter führen, welches sonst die Jahre in Besitz haben.
Es wird ungefähr 1893 gewesen sein, daß wir uns bei der Königin Isabella vorstellten. Die Infantin Eulalia war auch just dort zum Besuch, was unserer Begegnung mit der etwas pompösen, noch vom steifsten spanischen Zeremoniell umgebenen Königin gleich einen intimeren Charakter gab. Isabella von Spanien trat mit der ganzen prunkvollen Wucht einer geschichtlichen Persönlichkeit auf. Ihre Erscheinung war dazu etwas grotesk. Sie war ganz ungewöhnlich korpulent und dazu ziemlich groß. Ihre Züge zeigten wenig feine Linien, sondern mehr starke, grobsinnliche. Ob sie je schön gewesen war, konnte man aus den verschwommenen, fleischigen Zügen nicht erkennen. Auf dem immerhin sehr ausdrucksvollen Kopf trug sie, wie eine flammende Krone, eine hochrote Perücke. Dazu war sie in die kostbarsten weitbauschigen Gewänder gehüllt und mit einem schwirrenden Hofstaat von anmutigen Frauen und charaktervoll dreinschauenden Herren des ältesten spanischen Adels umgeben. Die Räume des »Palais de Castille« in der Avenue Kleber, das sie bewohnte, zeigte die vornehmsten Linien künstlerischen Ausschmucks und viel, viel wundervolle Blumen. Sie machte durchaus nicht den Eindruck im Rahmen dieser stolzen, kostbaren Umgebung, als sei sie eine » reine en exile«. Sie sprach das Französische mit dem Gutturalklang des Spanischen und mit einer etwas fetten Stimme. Sie gab die Gastfreundschaft, die wir ihrer Tochter in Straßburg erwiesen hatten, in liebenswürdigster Weise wieder. Ein größeres Gastmahl, das sie uns gab, war gedacht als eine Huldigung für unser Deutschtum. Es wurden hauptsächlich deutsche Edelweine vom Rhein und der Mosel gereicht. Die Herren vom Hof und die Diplomatie erschienen mit deutschen Orden, insoweit sie welche besaßen. Und die Königin dokumentierte ihre Liebe für deutsche Musik, indem sie mich bat, von ihrem Lieblingskomponisten Mendelssohn zu singen. Daß die Königin ein bewegtes Herzensleben gehabt hatte, das von großer Leidenschaftlichkeit und überströmender Sentimentalität getragen war, wußte ich aus der Geschichte ihrer Jugend und ihrer Regentschaft. Nun hatte das alles wohl durch die ernsten Erfahrungen ihres Lebens und auch durch das höhere Alter, das oft dämpfend wirkt, geschlummert. Ganz erstorben war es nicht, denn die Musik, besonders die gemütvolle Mendelssohnsche, gab ihm eine Auferstehung. Die kleinen, zwar gutmütigen, aber etwas herrisch blickenden Augen bekamen dann einen träumerischen Ausdruck. Sie drückte meine Hände und konnte mir gar nicht genug sagen: » Comme vous avez touché mon – cor –«, sie meinte natürlich coeur, sprach es aber spanisch aus. Dem, der die Geschichte ihres Lebens kannte, mußte diese Assonanz an das Körperliche wie ein unbeabsichtigtes Bekenntnis erscheinen.
Ich schalte in meinen Erinnerungen das Urteil über die geschichtliche Persönlichkeit der Königin Isabella aus. Nur schattenhaft zog die Gestalt Franz von Assisis, der im nahen Epinay sur Seine seit 1870 von ihr getrennt lebte, vorüber. Marforis dunkle, zärtliche, verhängnisvolle Silhouette zeichnete sich hinter der etwas massiven Gestalt Isabellas II. wie ein ferner, dunkler Traum in die Luft. Gleitend und geisterhaft flirrte es wie ein Wirbel- und Totentanz von Geschehnissen und historischen Persönlichkeiten auf! Mit was für strengen Mächten hatte die Geschichte diese Bourbonin gerichtet! Mit was für leidenschaftlichen Ausbrüchen in Liebe und Haß war sie von dem fieberpulsierenden Leben ihrer Zeit und ihres Landes auf und ab gehoben worden in der Widerstandslosigkeit ihrer sentimental rührsamen Natur.
Napoleon III., Prim, Serrano, Pius IX., Don Carlos, die teils mit rauhen, teils mit milden Händen in ihrem bunten, seltsamen Geschick webten, erschienen einen Augenblick vor mir, als ich im Empfangssaal der alten Königin mich tief vor ihr verneigte ... Aber Isabella stand ja längst jenseits der Geschichte, und so begrüßte ich in ihr auch nur die königliche Frau, die bourbonische Matrone, die sich, mehr indolent wohl als philosophisch, ihrem Geschick einordnete.
Öfters war ich noch zu intimen Tees bei der Königin und der Infantin Eulalia und sah in ungezwungenem Verkehr die Mitglieder ihrer bourbonischen Verwandtschaft. Es waren meist schöne, dunkle, etwas müde Gesichter mit den charakteristisch bourbonischen weichen Linien.
Die Königin schien mich sehr gern zu haben. An einem Nachmittag, sie hatte mich in ihrem Privatschreibzimmer empfangen und lange mit mir geplaudert, übergab sie mir eine große Photographie ihrer Person. Ich besitze sie noch; sie trägt in schweren Zügen die Unterschrift:
Comme souvenir à Madame Alberta de Puttkamer Isabella II d'Espagne.
Es ist ein Kuriosum, das aber genau der Wahrheit entspricht: an diesen zehn Worten hat sie gewiß drei bis vier Minuten ge–malt, – denn ihre Hand war so starkfleischig, daß die Finger die Feder nur mühsam umspannten und gleichsam jedes Wort wie eine Errungenschaft des Willens gegenüber der schweren Materie hinstellten.
Am lebhaftesten geht die lachende Gestalt der Infantin Eulalia durch jene Erinnerungstage. (Ich sah sie später übrigens noch in Nymphenburg bei München bei ihrem Schwager, dem Prinzen Ludwig Ferdinand, von dem ich später noch sprechen werde.)
Wenn ich ihrer gedenke, fällt mir immer des genialen Heine höchst lebensmalerische Strophe ein:
Sie lachte so glücklich und so toll
Und mit so weißen Zähnen –
Und wenn ich an das Lachen denk',
So weine ich plötzlich Tränen« ...
Nie habe ich ein so berückendes Lachen gehört und nie ein so verklärendes Lächeln gesehen.
Die Linien ihres Gesichts hatten in der Ruhe etwas seltsam Starres, fast unschön Hartes. Der etwas grausam feste Blick der blauen Augen, die energischen Mundlinien wandelten sich im Lächeln in geradezu reizende Schönheit. Man sagt, das Lächeln wirke auf die Züge des Gesichtes geheim beseelend, wie etwa der Sonnenstrahl auf ruhende Linien einer Landschaft, eines architektonischen Bildes, eines Marmors. Doch scheint mir dieses Bild nicht richtig; denn die Goldhelle der Sonne schärft eher die Linien und läßt sie schleierloser werden. Viel eher möchte ich das Lächeln mit dem kosenden weicheren Mondlicht vergleichen, das eine transparente Zartheit, ja sogar einen leisen Glorienschein über die Dinge breitet.
Wenn solcher Mondstrahl des Lächelns über der Prinzessin Eulalia Gesicht ging, dann war es wie durch Zauberwerk zu unaussprechlicher Anmut gewandelt. Und da sie oft, sehr oft lächelte und hell lachte, war sie eben reizend. Sie lebte und lebt meist in Paris und ist längst getrennt von ihrem schönen Gatten Antoine, duc de Montpensier, infant de grace. Das » infant de grace« bedeutet die verliehene Würde des spanischen Infanten; die angeborene Würde heißt: infant de droit ... Lachend erzählte mir einst die Infantin, daß ihr Gatte eine eigentümliche Manie habe; nämlich: die Kilometer der Eisenbahn- und Autofahrten, die er im Jahre mache, zu buchen. Er war dann ganz stolz, wenn die Zahl alljährlich höher wurde. Er reiste eben gar nicht der Eindrücke, der Ziele, der Schönheit der Landschaft wegen, sondern um der Kilometerzahl willen. Das ließ auf spärlichste Geistesbegabung und -tätigkeit schließen. Und Eulalia war ihm auch offenbar ganz bedeutend überlegen an Intelligenz. Sie war auch philosophisch beanlagt und hatte Kant, Hegel, Schopenhauer eifrig studiert. Das erscheint mir eine besondere Leistung für eine so bestimmt ausgeprägte romanische Geistesart, – gegenüber den so sehr ernst, tief und exakt denkenden deutschen Philosophen. Eulalia hat später ihre Memoiren herausgegeben, die ihr den Zorn ihres Neffen Alfons XII. zuzogen. Schon die Heirat von der Infantin Eulalia Sohn, Alfons von Bourbon, mit der anmutvollen Prinzessin Beatrice von Koburg hatte der König mit Unzufriedenheit gesehen. (Es sind dem Prinzen Alfons bekanntlich die Infantenwürde und verschiedene Orden und Auszeichnungen entzogen worden, weil er die protestantische Prinzessin, ohne seines Königs Willen zu befragen, heiratete.)
Die Infantin Eulalia hatte mir früher einmal bei einem ihrer Besuche in Straßburg gesagt: » Vous avez un grand admirateur a Munich; mon beau frère, le prince Ludwig Ferdinand. Il a le grand souhait, de faire votre connaissance.« Und so machte es sich denn natürlich, daß ich, von Aussee kommend, wo ich Hohenlohes besucht hatte, in München für einige Tage Halt machte und mich in Nymphenburg vorstellte, das heißt liebenswürdigerweise kam der Prinz mir zuvor und machte mir zuerst im Gasthof Besuch. Eine Einladung zum nächsten Abend, mit der Bitte, von einer vorherigen steifen Audienz abzustehen, brachte er mir. Prinz Ludwig Ferdinand ist eine ungemein lebhafte, kunstfreudige Natur, enthusiastisch auch für alle wissenschaftliche Betätigung eingenommen. Er ist Arzt und sehr eifrig und fleißig in seinem Beruf. Er faßt alle ihn interessierenden Fragen mit einer feurigen Hingabe an; vielleicht manchmal zu viele, was dann die warme Stetigkeit beeinträchtigt und seinem Wesen oft etwas Sprunghaftes gibt. Das Warmherzige, reizvoll Natürliche, das in all seinen Worten und Taten ist, macht ihm empfänglichere Seelen sehr geneigt. Musik und Dichtkunst liebt er besonders und versteht sie in ihren Tiefen. Er ist auch schöpferisch in der ersteren tätig und hat unter anderem aus meinem Dichtungsbuch »Jenseit des Lärms« die Liebessymphonie in Töne gesetzt. Er geht aber für meinen Geschmack etwas zu dezidiert in der Gefolgschaft von R. Strauß, Hugo Wolf und von den höchst impressionistischen Neuesten ... Unsere erste Begegnung war sehr sympathisch und seelenbindend. Der Rahmen war auch so anziehend und künstlerisch wie nur denkbar. Schloß Nymphenburg liegt in seinem breiten Bau fast wie ein beschauliches Landschloß mitten in einem edelschönen Park und buntlachenden Blumenbeeten. Es war Spätsommer damals, und aus dem Garten kamen Dunstwellen von Reseda und späten Rosen her. Etwas seltsam Verschollenes, Märchenträumerisches lag über der Gartenlandschaft. An jenem ersten Abend ward viel Musik gemacht. Der Prinz begleitete mich zum Gesang; er spielt verständnisvoll und anschmiegend. Er trug auch auf seiner Geige, deren Bogen er mit viel Talent und feinem Geschmack führt, gute und edle Musik vor. Es herrschte ein ganz ungebundener Ton, von dem das alte Hofzeremoniell, das eingehalten werden mußte, seltsam genug sich abhob. Als wir zum Beispiel zu Tisch gingen, führte mich der Prinz, – aber am Eingang zum Speisesaal mußte er meinen Arm lassen und – vorangehen mit den anderen königlichen Herrschaften. Dann schlössen wir – Nichtköniglichen uns erst an. Es ward viel gelacht und gescherzt darüber, – aber es mußte eben sein. Auch beim Herumreichen der Speisen und Weine wurden von den Lakaien zuerst die königlichen Herrschaften bedient und dann erst – wir anderen. Dem Prinzen war das peinlich und er glich es dadurch aus, daß er sich wohl zuerst vorlegte, aber mir dann das Ausgesuchte gab und sich danach erst selbst bediente.
Es war ein intimer Familienzirkel, und das sollte natürlich eine Ehrung für mich sein. Des Prinzen Ludwig Ferdinand Bruder, Prinz Alfons, mit Gemahlin und seinen Schwestern: der Herzogin von Genua, der Gräfin Elvira Wrbna (sprich: Wirm) mit ihrem schönen Gatten und der unverheirateten Prinzessin Clara. Der Kreis wurde erweitert durch die verschiedenen persönlichen Adjutanten und Hofdamen. Von den Offizieren sind mir besonders Graf Dürckheim und Baron Ow (sprich: Au) erinnerlich; zwei ritterliche, schöne deutsche Edeltypen. Baron Ow hatte mich von meinem Münchener Gasthof in einer königlichen Equipage abgeholt und nach Nymphenburg geleitet; ebenso geschah es auch abends wieder von Nymphenburg nach München.
Zwei Tage darauf war ich wieder zum Tee dort; wir fuhren danach durch den weiten herrlichen Park, in dem auch zahmes Edelwild gehalten wird. Es war 1892; das ist nun lange Jahre her, denn damals lief des Prinzen ältester Sohn Ferdinand, »Ferdl« genannt, ein jauchzendes, glückseliges Kind, unserem Wagen voran. Seit 1906, also jetzt auch schon seit dreizehn Jahren, ist er verheiratet mit seiner spanischen Verwandten, der Infantin Marie Therese, die ihm vier Kinder schenkte. Er ward durch diese Heirat Infant von Spanien, verzichtete für seine Person auf Stellung und Rechte eines Prinzen von Bayern, – behielt aber Titel, Rang und Wappen eines bayrischen Prinzen.
Die Prinzessin Maria de la Paz, der Infantin Eulalia Schwester und Gemahlin des Prinzen Ludwig Ferdinand, bietet in ihrem Wesen einen auffallenden Gegensatz zu den beiden. Während in jenen etwas Aufschäumendes, fast Überschäumendes liegt, ist in ihrem Wesen und Reden etwas gemäßigt Hinfließendes. Ruhig wie ihr Blick und ihre Bewegungen sind auch ihre Worte und die Diktion ihrer Rede. Sie erscheint mir als eine innige, tiefe Künstlernatur. Sie liebt und fördert die Dichtkunst und soll sehr schöne Übertragungen aus dem Spanischen ins Deutsche geschaffen haben, was sich leider bei meiner Unkenntnis jener Sprache meinem Urteil entzieht. Das Heim des Prinzenpaares hat den schönen Rhythmus und das warme Wesen einer reich bewegten Geistigkeit und anmutenden Innigkeit. Eine vornehme Natürlichkeit gibt ihr noch einen besonderen Zug.
Bei den Kölner Blumenspielen sah ich den Prinzen und seine Familie zuletzt; denn seit damals bindet mich ja leider ein schweres örtliches Leiden (Gelenkentzündungen) fast ganz an mein Heim. Und das Reisen und überhaupt die Fortbewegung von Ort zu Ort und die Bewegungsfähigkeit sind sehr beeinträchtigt. Ja, bei den Kölner Blumenspielen sahen wir uns zum letztenmal. Die Blumenspiele sind ganz eigenartig und sind in ihrem Wesen oft, oft mißverstanden worden; und da sie eine nicht zu unterschätzende Bedeutung im literarischen Leben haben, möchte ich einmal unparteiisch von ihnen berichten.
Fastenrath war ihre Seele, und was für eine feurige, kunstbegeisterte Seele! Diese Spiele waren ja eigentlich eine Verpflanzung einer sehr poesievollen literarischen Sitte und Feier aus Spanien und Südfrankreich nach Deutschland. Pflanzen von Duft und Kraft und Eigenart, die unter besonderen Himmelsstrichen und in besonderem Boden köstlich in Blüte kommen, verkümmern oft unter anderen Lebensbedingungen. Sie müssen sich aus dem Boden entwickeln, sonst machen sie allzuleicht den Eindruck des künstlich Getriebenen. Für die romanische Kultur, den nationalen Charakter, die reich spendende Landschaft mit ihren wundervollen Rosen, für das troubadourhaft Ritterliche, speziell von Spanien, sind die Blumenspiele gedacht. Es war kühn, sie auf das ernstere, kühlere Wesen deutscher Kunst, deutscher Gefilde zu übertragen. Dazu gehörte ein Feuergeist, eine Mittlernatur, ein Verstehender für beide Volkspsychen, die spanische und die deutsche. Und – es mußte auch das materielle Können vorhanden sein: reiche Mittel, um diese Spiele zu inszenieren und heimisch zu machen. Das alles besaß Fastenrath! Er liebte und verstand die spanische Kunst und Kultur und hatte von seinen Jugendtagen an viel im Ausland, besonders aber in Spanien, gelebt. Er war sehr früh ganz unabhängig geworden und in den Besitz eines ganz ungewöhnlich großen Vermögens gekommen. Ein hoher Idealismus und starker Optimismus und dazu ein großartiger Zug von Gastfreundschaft trugen ihn in seinem Wirken. Die Blumenspiele, die einst als » jeux floraux« in Südfrankreich entstanden (im vierzehnten Jahrhundert in Toulouse), haben ihre Hochblüte dann in Spanien gehabt, wo sie noch heute in Barcelona ein kunstfröhliches Dasein haben. Sie waren in ihrer ersten Bedeutung poetische Wettkämpfe, und der Sieger erhielt den Titel eines Doktors der fröhlichen Wissenschaft. Am 1. Mai 1324 wurden sie zuerst gefeiert, und eine goldene Rose, Nelke und ein goldenes Veilchen wurden den Siegern als Preis gereicht. Das war im Land der Troubadoure, im mittägigen Frankreich! Ende des vierzehnten Jahrhunderts wurden die » jeux floraux« nach Spanien verpflanzt.
Fastenrath mit seiner schwärmerischen, für Kunst glühenden Begeisterung sah die ritterlich-künstlerischen Spiele in Spanien, und seine junge Feuerseele (die er in regen Flammen bis zu seinem Tode behielt) griff den tiefpoetischen Gedanken in ihnen auf, und es ward nun sein Streben, die Spiele, die doch tiefer Ernst waren, in Deutschland einzuführen. Daß er Köln dazu wählte, war ein glücklicher Gedanke. Die sanges-, wein- und blumenfrohe Stadt, die etwas von romanischem, heiterleichtem Geist hat, wie auch ihr immer noch fröhlicher Karneval beweist, war wie vorbestimmt dazu. Fastenrath besaß ein eigenes, mit solidem Patrizierreichtum eingerichtetes Haus am Neumarkt, und das war allezeit ein Mittelpunkt für das gesellig-künstlerische Leben der so bedeutsamen rheinischen Großstadt. Fastenraths Feuerseele hatte etwas Flackerndes, Unruhiges, manchmal fast wildleidenschaftlich Erregtes. Da ward es denn für sein Haus und für all seine Bestrebungen von ausgezeichnetem Einfluß, daß er gerade diese Frau, diese milde, kluge, liebenswürdige, alles Maßlose in die rechten Linien rückende Frau hatte.
Frau Louise Fastenrath verdient wahrlich ein Denkmal in der Geschichte der Blumenspiele. Sie war Wienerin, leichtlebig im besten Sinne, mit einem Blick für alle Fragen der Kunst und des Lebens, der ebenso von einer hohen Intelligenz geschärft, als von einem gütigsten Herzen erwärmt und geklärt war. Es würde zu weit führen, wenn ich die ganze Einrichtung und Ausführung der Blumenspiele hier darlegen wollte. Es sei nur eines gesagt, daß alljährlich ein Wettbewerb von Dichtern und Schriftstellern in der Weise stattfand, daß eingesandte Originalbeiträge derselben von einem Ausschuß gesichtet und beurteilt wurden, der sehr ernste und bedeutende Richter enthielt. Ich nenne nur den als Rechtsprofessor und als Schriftsteller hochstehenden Geheimrat Dr. Zitelmann in Bonn; dann den langjährigen Feuilleton-Redakteur der »Kölnischen Zeitung«, Baron von Perfall, dann den Redakteur der »Kölnischen Volkszeitung« und so weiter.
Die Beiträge wurden anonym mit betreffenden Kennworten eingesandt, und es fand ein durchaus sachliches Sichten und Richten statt. Und da gewöhnlich zwischen fünf- und sechstausend Dichtungen für die Preise einliefen, so war es immerhin ein Sieg, als Preisgekrönter durch einen solchen Ausschuß gewählt zu werden. Die Kölner Blumenspiele sind mit großem Unrecht von vielen, die sie gar nicht in ihrer Bedeutung erfaßten, angegriffen worden.
Ich habe sie immer gewertet als das, was sie waren und sein sollten: ein schöner, ernster Wettbewerb in der Dichtkunst! Die Preise waren Gold- und Silbergefäße, Schmuckgegenstände, Edelzierate für das Haus, Bronzen, Statuetten, wertvolle Bücher. Am 1. Mai wurden sie in Köln mit einem Prunk und einer solchen Pracht in Blumen und Festlichkeiten gefeiert, deren Spender und Leiter eben – Fastenrath war ... Er ist nun schon lange tot, und seine kunstsinnige, liebenswürdige Frau, die zuerst nach seinem Tode die Blumenspiele und die große Fastenrathstiftung verwaltete, ist auch einige Jahre nachher gestorben. Diese Stiftung ist für solche, die in der Dichtkunst aufstreben, und auch für solche, die auf der Höhe stehen und ihr Talent bewiesen haben.
Mit dem Tode der beiden Fastenraths ist ein wärmender Flammenherd für die Kunst und auch für die höhere Geselligkeit erloschen. Ich hatte Fastenraths kennengelernt, als ich 1904 vom Kölner Literaturverein gebeten wurde, einen Vortrag aus meinen Dichtungen zu halten. Er fand im Gürzenichsaale statt und brachte einen glänzenden Erfolg, so daß ich dem alten, feurigen Herrn versprechen mußte, nunmehr auch zu den Blumenspielen (die mir bis dahin fremd waren) Dichtungen zu senden. Ich bin im allgemeinen gegen solche Wettbewerbe; in diesem besonderen Falle aber nicht, und ich muß sagen, daß die Kölner Tage mit ihrer höchst poesievollen Inszenierung und ihrem Rausch von Kunst und Lebensfreude mir reizvolle Anregung und warme Erinnerung wurden.
Noch einige Worte über Fastenrath! Er hatte sich so in die spanische Kultur und das spanische Geistesleben versenkt, daß ihm die Sprache fast wie seine Muttersprache vertraut war. Er schrieb für die besten Zeitungen und Zeitschriften Spaniens und hat ein umfangreiches, verdienstvolles Werk über deutsche Kultur, Wissenschaft und Kunst in spanischer Sprache geschrieben. Es heißt »Walhalla« und ist gedacht als eine Ruhmeshalle für deutsche Helden des Geistes und der Tat. Eine amüsante und für Fastenrath charakteristische Geschichte möchte ich hier einflechten. Eines Tages führte er mich in seine herrlichen Bibliotheksäle, die bis zur Decke mit Folianten, Schriften, Büchern gefüllt waren. Kunstvoll geschnitzte, bequeme Leitern ermöglichten den Verkehr bis in die »höchsten Kreise«. Da führte mich Fastenrath mit einem bedeutungsvollen, aber schmerzlichen Lächeln vor eines der langen, geschnitzten Fächer. Das eine Fach war ganz mit einem gleicheingebundenen Werk von zirka fünf- bis sechshundert Seiten gefüllt. Er deutete darauf und sprach in bitterem Tone davon, daß er in Deutschland nicht so gewertet werde, wie er es wohl verdiene, denn er habe seine »Walhalla« geschrieben, um deutsches Wissen, Können und Tun zu verherrlichen und die Kunde davon in weite Lande zu tragen. Das habe ihm auch in Spanien Ruhm und Ehren gebracht, – aber in Deutschland anerkenne man ihn nicht, ja, man mißverstände ihn meist sogar: »Sehen Sie einmal, teure Exzellenz, hier in Deutschland kennt man dieses mein Werk zu Deutschlands Ruhm fast gar nicht. Wer hat die ›Walhalla‹ gelesen?« Und er wies auf die sechs oder mehr großen Bände dieses Werkes. Ich antwortete ihm, daß ich es freilich auch nicht kenne und bis heute auch nichts davon gewußt habe.
Ich nahm einen Band aus dem Fach und schlug ihn auf: – er war in spanischer Sprache geschrieben!! In seiner Bibliothek war das Werk nicht auf deutsch; ich weiß auch nicht, ob es in dieser heimischen Fassung existiert. Ich sagte ihm lächelnd, daß wir Deutsche trotz unserer großen Sprachkenntnisse doch noch nicht so weit wären, das Spanische, das doch immerhin keine Weltsprache ist, zu beherrschen. Fastenrath war stark selbstbewußt, – ja sogar recht eitel, und beklagte sich fortwährend über seine Zurücksetzung im öffentlichen Leben Deutschlands. »Sehen Sie, ich habe keinen deutschen Orden, während ich in Spanien Auszeichnungen habe, die mir das Recht geben, mich dort Exzellenz zu nennen.«
Das trübte den Verkehr mit dem sonst so anregenden, feurigen, kunstbegeisterten Mann sehr. Er war neben diesem häßlichen Fehler aber von hohen geselligen und bürgerlichen Tugenden; zum Beispiel von wahrhaft königlicher Gastfreundschaft und – ein Mäcenas. Schmeicheleien war er außerordentlich zugänglich, – aber dazu konnte ich mich, obgleich ich ihn sehr schätzte, nicht herabwürdigen. Dennoch standen wir uns vortrefflich, und ich danke dem lieben, klugen, kunstfrohen Mann viele erlesene Stunden und Erinnerungen. Seit seinem und seiner Frau Tode bin ich den Kölner Blumenspielen ferngeblieben. Meine letzte Anwesenheit dort fiel mit der der Familie des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern und ihm zusammen. Seine junge Tochter Maria del Pilar (kurz in der Familie »Pilar« genannt) war zur Blumenkönigin erkoren. (Eine solche, auf einem Thron von kostbaren Blumen mit einem Baldachin von roten Rosen, verteilt die Preise an die gekrönten Dichter.) Sie, ihre Eltern und ich waren als Ehrengäste geladen, und es war uns Wohnung in einem der ersten Gasthöfe bereitet. Eine besondere Ehrung war uns noch zugedacht: Kompositionen des Prinzen zu Dichtungen von mir (Liebessymphonie) wurden von der ersten dramatischen Sängerin des Stadttheaters vorgetragen. Ich war in jenem Jahr dreimal preisgekrönt worden. Ein Vorgang, der zum erstenmal sich ereignete und deshalb gefeiert ward ...
Die Schilderung des Besuches in Nymphenburg und dann der Kölner Blumenspiele mit dem Reichtum der Persönlichkeiten und Eindrücke hat mich ein wenig seitab geführt von dem chronologischen Hergang meines Lebens und von meinem Aufenthalt im Elsaß. Ich möchte also zurückgreifend wieder an die Ära Hohenlohe-Schillingsfürst anknüpfen; denn damals habe ich so tief in die Geschichte des Landes gesehen und dadurch auch etwas Weltgeschichte miterlebt, so daß meine Erlebnisse und Schilderungen vielleicht von allgemeinerem Interesse sein können.
Fürst Hohenlohe wurde bekanntlich im Oktober 1894 vom Kaiser als Reichskanzler nach Berlin berufen. Er war damals 75 Jahre, – äußerlich wohl etwas hinfällig, aber doch noch recht frisch im Geist und an seelischer Kraft. Damals war das Bild, welches er der Zeit bot, noch ungetrübt von dem Eindruck seiner »Memoiren«. Die Schleier, in die er sein Wesen und seine Rede gern hüllte, erschienen uns allen noch als die vornehmen Hüllen eines tief verschlossenen Wissens und Könnens. Er konnte so verheißungsvoll, so deutungsreich schweigen und mit seinen schönen Augen schauen, als ob er aller Dinge Grund ermessen habe und das Beste davon in sich verschließe. Man glaubte bei ihm immer an einen Hort verborgener Geistesschätze, die er zu gewählter Zeit verschwenderisch spenden könne.
Daß es nicht so war, haben die Memoiren und manches andere später enthüllt ...
Als er 1894 von Straßburg fortging, war eine entschieden versöhnliche Stimmung im öffentlichen politischen und auch im sozialen und künstlerischen Leben des Elsaß fühlbar. Das rein äußerliche Moment: daß in seinem Hause meist Französisch gesprochen wurde (die Fürstin war Russin und beherrschte das Deutsche weniger als das Französische), tat den Elsässern wohl. Sie hatten eben immer noch durch die jahrelange französische Bildung und Kultur Vorliebe für alles Französische. Das Elsaß ist seit den Jahren seiner Vereinigung mit dem Deutschen Reich, insbesondere seit der Einsetzung der Statthalterschaft, durch verschiedene Entwicklungsphasen gegangen. Der Geist, der in diesen letzteren wirkte, ging nicht etwa direkt von dem jeweiligen obersten Walter, dem Statthalter, aus, sondern sehr merkbar vom leitenden Staatssekretär, der parlamentarischen Landesvertretung, der Presse und von den Geschehnissen in Frankreich, welches immer noch als ein mitbestimmender Faktor für die Gefühlsstimmung gewisser großer Kreise der Bevölkerung gelten konnte.
Die Ära der Versöhnlichkeit unter Hohenlohe ging in großzügiger Weise von der Trias aus: Leiter der Staatsgeschäfte (von Puttkamer), Leiter der Presse (Pascal David) und Leiter des elsässischen Parlaments (Dr. von Schlumberger). Die elsässische Bevölkerung, das heißt die Intellektuellen, sowie die einfache Landbevölkerung, die Industriellen, waren überzeugt von der Ehrlichkeit des Wollens, der Stärke des Könnens und der Klarsichtigkeit des Verstehens jener drei Faktoren.
Und wenn es wohl noch viele gab, die unzufrieden mit dem Gang der Geschichte waren und mit den Folgen des von Frankreich verlorenen Kampfes, und wenn auch die Gefühle vieler noch an dem früheren Vaterland hingen: der Einsicht verschloß sich doch der Abgeneigteste nicht, daß ein versöhnliches Entgegenkommen bei der deutschen Regierung war, und daß die Trias: Minister, Presse und Parlament von ehrlichem Verständigungsgeist beseelt war. Dadurch wurde das Schwankende, das in den neuen politischen Verhältnissen lag, bedeutend gefestigt. Bei Gelegenheit des siebzigsten Geburtstages von Puttkamer (28. Juni 1901) erschien ein Artikel von David, der den ernsten Staatsmann besonders in seinem Wert für Elsaß-Lothringen lebhaft würdigt. Er gipfelt in der Auffassung, daß Puttkamer, der mit so bedeutendem Erfolg dreißig Jahre seines Lebens der wichtigen politischen Aufgabe gewidmet habe, Elsaß-Lothringen mit dem Deutschen Reich zu verschmelzen, sich in den politisch schwierigen Verhältnissen Achtung und Sympathie nicht nur der Eingeborenen, sondern auch der Vorgesetzten und der Beamten erworben habe. Er sei wahrlich »der rechte Mann am rechten Platz«, und man könne es dem Lande nur wünschen, daß es noch lange Jahre des wohlwollenden und bedeutenden Mannes Mitwirkung in der Regierung genieße.
Auch Fürst Hohenlohe-Langenburg (der damalige Statthalter) sandte einen von den allerwärmsten und dankbarsten Gesinnungen erfüllten Brief, in dem er aussprach, daß es seine zuversichtliche Hoffnung sei, »noch lange mit dem hochverdienten Mann zum Segen des Landes wirken zu können«. Er sprach aber trotz der oftmals und besonders in diesem Geburtstagsbrief betonten »höchsten Schätzung« kein Wort beim Kaiser für seinen Staatssekretär, dessen Bedeutung und schwere Entbehrlichkeit für das Reichsland er kannte ... Kaum zweiundeinehalbe Woche nach jenem Geburtstagsbrief geschah nämlich das damals von allen (ja von allen) als unbegreiflich Angesehene: der Staatssekretär von Puttkamer nahm seinen Abschied, weil – es erwünscht war ...
Dichte Schleier ruhen über dieser Unbegreiflichkeit; sie werden wohl kaum je ganz gelüftet werden – – –
Die bedeutendsten Zeitungen, auch ganz verschiedener Parteirichtungen, wie »Kölnische Zeitung«, »Frankfurter Zeitung«, »Kreuzzeitung« und so weiter, brachten schmerzlich bedauernde Artikel über den allzu frühen und »nicht begreiflichen Rücktritt des ungewöhnlich verdienten Staatssekretärs«. Der ehrliche, edle Mann, der gradeaus handelte und dachte, und dem jede Intrigenwirtschaft wesensfremd war, schien durch ein sehr fein und sehr geheim gesponnenes Intrigennetz gefallen zu sein. Da nicht klare Beweise darüber existieren, möchte ich die »Schleier« ruhen lassen. Nachträgliche Enthüllungen wecken ja doch den Toten nicht auf ... Nur eines möchte ich hier sagen, daß Puttkamer, dieser zurückhaltende und bescheidene Mann, der ein sehr mildes Urteil hatte und ohne Bitterkeit war, zu mir mehrmals in seinen letzten Lebensjahren geäußert hat: »Ich bin das Opfer ehrgeiziger, rücksichtsloser Persönlichkeiten geworden, deren Unaufrichtigkeit ich zu spät erkannte. Sie haben den zweifelhaften Ruhm, mir meine letzten Jahre, in denen ich noch viel für mein Vaterland und für die neue Heimat hätte wirken können, vergiftet zu haben.«
Es war wahrhaft herzerschütternd, diesen milden Mann einmal bitter reden zu hören. Noch heute bebt mir das Herz, wenn ich an den stillduldenden Mann denke, dessen Seele so tödlich verwundet worden war.
Nur wenige Jahre, nicht ganz fünf, hat er in dem landschaftlich entzückenden, friedvollen Baden gelebt; dann endete eine schwere Lungenkrankheit Anfang März 1906 sein Leben. Da erklangen denn in allen Zeitungen Hymnen auf seine staatsmännische und menschliche Bedeutung ... Zu spät, zu spät! – – – Ich habe ihm ein Denkmal gesetzt in einem großen Aufsatz, der in der »Deutschen Revue« erschienen ist und zugleich in meinem Essaybuch: »Aus meiner Gedankenwelt«. Er trägt die Aufschrift: »Max von Puttkamer«. In diesem Aufsatz gebe ich die ganze Fülle der Erkenntnis dieses seltenen, mir so innig nahe gewesenen Mannes und der Hochverehrung seiner großen Seele. Ich möchte nun natürlich in meinen Lebenserinnerungen die Charakteristik meines Gemahls, der von so großem Einfluß auf mein Geistesleben war, nicht fehlen lassen. Ich zitiere deshalb aus jenem Gedenkblatt: »Max von Puttkamer« das Folgende: »Vor allem ist in seinem Wesen eine ganz seltene Eigenschaft zu verzeichnen, die sogar bei den Allergrößten verschwindend wenig zu finden ist; eine monumentale Eigenschaft, die den, der sie besitzt, geradezu prädestiniert zum leitenden Staatsmann und schaffenden Politiker. Das ist die scharfe Erkenntnis des Wesentlichen in den Geschehnissen und Menschen und die Betonung und Vorherrschaft des rein Sachlichen gegenüber dem Persönlichen. So hatten zum Beispiel Ehrgeiz, Ehr- und Titelsucht, Eitelkeit, Neid, Ruhmredigkeit bei den politischen Strebungen von Max von Puttkamer nicht die leiseste Stimme. Solches Zurücktreten der eigenen Persönlichkeit hinter die Bedeutung der Sache und ihre Förderung wurde bei ihm noch besonders akzentuiert und verstärkt durch eine ganz ungewöhnliche Bescheidenheit, und war also nicht nur geistig, sondern auch moralisch bedingt. Es war daher für ihn nur natürlich, daß, wenn er eine Sache mit allen Kräften gefördert und manchmal bis zum Höchstpunkt entwickelt hatte, er seine Aufgabe als erledigt ansah und nun mit seiner Person in die Schatten des Hintergrundes trat, so daß oft andere die Erfolge sich nutzbar machten und auf ihre Person buchten ... Für ihn lag der Erfolg und Lohn einzig in dem Bewußtsein eine Pflicht erfüllt und eine als wichtig erkannte Sache gefördert zu haben. Eine, wie man mir gern zugeben wird, und wie es alle Einsichtsvollen unter seinen Zeitgenossen mitbekunden, außergewöhnlich hohe und reine Auffassung. Wenn Max von Puttkamer trotz seiner großen persönlichen Bescheidenheit und trotz dieses geräuschlosen Zurücktretens in den Hintergrund des Sachlichen, dennoch in eine leitende Staatsstellung (als Staatssekretär in Elsaß-Lothringen) kam und sie vierzehn Jahre innehatte, so ist das wohl ein Beweis dafür, daß wirkliche Bedeutendheit sogar ohne die persönliche Tendenz des Sichdurchsetzenwollens zur Würdigung und zum Durchbruch kommt: einfach und naturgemäß nach den ihr innewohnenden Gesetzen der Schwere ihres Wertes.
Daß seine staatsmännische Bahn mitten in der Rüstigkeit seiner Kraft und in der Freudigkeit erfolgreichsten Wirkens abgebrochen ward, erklärt sich im letzten Grunde wohl auch aus jenem übermäßig bescheidenen Zurücktreten und dem Unterlassen der Betonung eigenen Verdienstes. Die Früchte seiner Sämann- und Anbaukunst hat er nicht ernten können. Das war der tragische Ausklang seines reichen Lebens ... Aber sogar in den Zeiten nach seiner Demission ist er nie bitter oder scharf im persönlichen Urteil über einige Widersacher und laue Freunde geworden, sondern hat sich wahrhaft groß, in fast erhaben wirkender Würde dem Schicksal gebeugt.
Max von Puttkamer hat seine Laufbahn, die im Anfang eine rein juristische war, über die Brücke des Parlamentarismus genommen. Sein starkes politisches Talent und das daraus folgende natürliche Interesse für geschichtliche Vorgänge hat sich schon früh und ernst dokumentiert.
Sein Vater, der als ganz junger Mann Gardehusarenoffizier gewesen war, dann seinen ausgedehnten Besitz in Pommern übernahm und später als Landrat fungierte, war lange Jahre Landtagsabgeordneter. Seine Mutter, eine geborene von Pape, Schwester des bekannten Generalobersten in den Marken, Kommandierenden des Gardekorps, von Pape, hatte Max von Puttkamer sehr früh verloren. Neben einem viel älteren, ihm innerlich antipodisch veranlagten Bruder und sechs älteren Schwestern, unter der Oberhoheit eines sehr ernsten, wärmerem Gefühlsleben geringen Raum schenkenden Vaters flossen seine ersten Kinderjahre hin.
Ein etwas nüchterner, spartanischer Geist scheint sein Vaterhaus und seine ganze Erziehung beeinflußt zu haben. Besonders war ein solcher rege in dem Pfarrhaus in Pommern, in dem der Knabe »Max« für die höhern Klassen des Gymnasiums in Stettin vorbereitet wurde. Strengste Pflege der Geistes- und Charakterbildung und Stärkung der physischen Kraft, doch ohne feinere Kultur des Gemütslebens, wurden hier geübt. Übrigens ist Max von Puttkamers Vetter und späterer Schwager Robert von Puttkamer, der nachmalige Vizepräsident des Staatsministeriums in Preußen, auch in dem Pfarrhaus von Barnimslow Zögling gewesen. Es ward dort auch eine heilsame Basis der Anspruchslosigkeit in die jungen Seelen gelegt, und gute Kämpfer wurden gegen den wuchtigen Ernst des Lebens geschult ... Als der junge Max seine Abiturientenprüfung mit siebzehn Jahren am Gymnasium zu Stettin bestanden hatte, schwankte er in der Wahl seines zukünftigen Berufes. Sein Vater hatte dem geistig und im Charakter durchaus Vollreifen unbeschränkte Entscheidung nach eigenen Neigungen gelassen. In der Geschichte hatten Max' regen Geist neben den »politischen Feldherren« die angezogen, die Schlachtenlenker und Schlachtendenker zugleich sind. Er hatte in Prima neben seinen Schulstudien schon eifrig Jomini studiert, den damals besonders modernen Strategen und Feldherrn, der neben seiner kriegswissenschaftlichen Bedeutung und praktischen Tüchtigkeit doch etwas vom abenteuerlichen Reiz des Landsknechts an sich hatte. Jominis Erfahrungen waren im Dienst der verschiedensten Heere, des helvetischen, französischen, russischen, erworben. Er konnte wohl geeignet erscheinen, mit besonderer Eindruckskraft auf jungempfängliche Geister zu wirken.
Max von Puttkamer stand jedenfalls eine Zeitlang stark unter seinem Reiz, und es erwuchs in ihm der Wunsch, sich auch der Kunst und Wissenschaft des Krieges zu widmen. Seine bestimmte Absicht scheiterte nur daran, daß er vom untersuchenden Arzt damals zu schwach für den Militärdienst befunden wurde. Und so begann er das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften. Aber er hat immer im Leben eine feurige Vorliebe für alles Kriegswesen behalten. Durchaus von den größten geschichtlichen Gesichtspunkten aus wie bis in die kleinsten technischen Fragen hinein kannte er die Geschichte der Schlachten der bedeutenden Feldherren aller Zeiten, und in seinem Geist waren ebenso die Schlachtaufstellungen und kriegerischen Maßnahmen Friedrichs des Großen gegenwärtig, wie die von Napoleon I. oder von antiken Feldherren. Ich erinnere mich noch genau, wie er in Zeiten, die jener Jugendleidenschaft für Kriegskunst längst entrückt waren (in Straßburg Anfang der neunziger Jahre), lebhaft und verständnisvoll mit bedeutenden Offizieren diskutierte. Besonders mit dem bekannten Obersten Grafen York von Wartenburg (der dann, beim Armeekommando in China stehend, dort an Kohlendünsten in seinem Schlafzimmer starb), über friderizianische und napoleonische Kriege. An einer anderen Stelle dieses Buches habe ich noch mehr von dem ausgezeichneten Manne gesagt. Die beiden Gebiete Staats- und Kriegskunst liegen sich ja so nahe und greifen eines in das andere über, daß, um den höchsten und auch natürlichen Anforderungen zu entsprechen, eigentlich jeder Staatsmann kriegswissenschaftliche und jeder Feldherr staatswissenschaftliche Studien gemacht haben sollte. Neben seiner Fachwissenschaft, der Jurisprudenz, zog die hohe Politik den Geist Max von Puttkamers mächtig an. Wie ich an anderer Stelle sage: Er hat seine Laufbahn über die Brücke des Parlamentarismus gemacht. Die parlamentarische Schulung hat er an englischen Vorbildern gesucht und erfahren. Er erkannte im englischen Staatsleben klassische Muster für politische und parlamentarische Tätigkeit, während es bei uns in deutschen Landen noch in seiner Kindheit stand. Damals, im Aufgang seiner Bahn, hat ihn der große Philosoph, Dichter und Historiker Thomas Babington Macaulay am intensivsten beeinflußt. Max von Puttkamer wies in seiner gesamten Geistesrichtung und -begabung übrigens so viele Ähnlichkeiten mit seinem großen Vorbild Macaulay auf, Macaulay interessierte sich auch sehr für Kriegswesen und war zwei Jahre englischer Kriegsminister. daß ich später, als mein Sinn für geschichtliche Betrachtung höher geweckt wurde durch meinen Mann, öfters vergleichende Studien zwischen beiden gemacht habe.
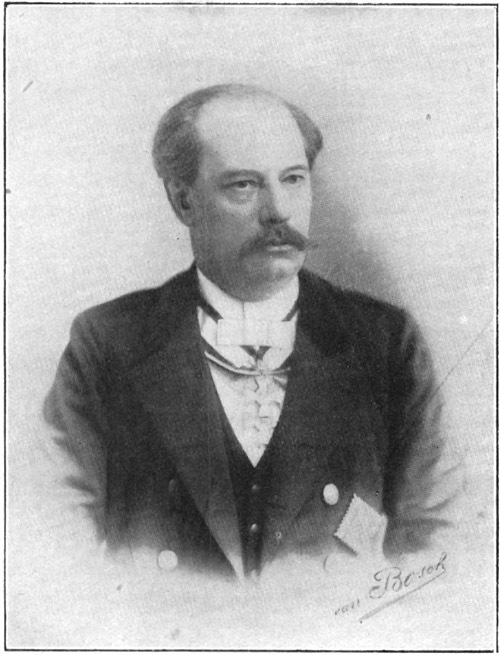
Max von Puttkamer Staatssekretär (1896-1901)
Max von Puttkamer war ein liberaler, königstreuer Aristokrat und darin auch dem großen Whigbaron ähnlich. In Deutschland sind ja die Begriffe liberal und konservativ nicht rein politische, sondern zugleich soziale. Die liberalen Parteien gelten als bürgerliche, – die konservativen als aristokratische, – während doch »liberal« mit aristokratisch, königstreu und monarchisch nicht im mindesten begrifflichen Gegensatz steht. Ich erinnere mich aus unserer ersten Ehezeit, daß der Engländer Macaulay eine große Rolle in unseren Gesprächen spielte. Die Lektüre seiner »Geschichte Englands« und der politisch-philosophischen »Essays« füllten die Abende in der weltabseits liegenden posenschen Kleinstadt Fraustadt, dem ersten Schauplatz unserer Ehe, oft und schön aus. Besonders der Maidenspeech, den Macaulay im englischen Unterhaus über die Juden hielt, wurde von uns eifrigst diskutiert. Sein feiner und glänzender Stil hat uns beide damals stark beeinflußt. Mich persönlich zog noch besonders an, daß Macaulay der Welt zuerst bekannt wurde durch seine poetischen Schöpfungen, von denen einige, wie »Pompeji« und »Evening« mit der Goldenen Medaille des Kanzlers der Universität Cambridge ausgezeichnet wurden. Die Vereinigung von Philosophie und Dichtung ist ja übrigens durchaus nicht selten und wo man ihr begegnet, von feinster Anziehungskraft.
In der Provinz Posen, wo die Gegensätze von Polen- und Deutschtum noch recht stark ausgeprägt waren (und ja auch neuerlich wieder sehr verschärft auftreten), ward 1867 mein Mann einem polnischen Edelmann gegenüber aufgestellt für die Wahlen zum Landtag. Er siegte über den Polen in scharfem Kampfe mit großer Majorität. Von da an lagen die Hauptakzente seiner Tätigkeit und seines Interesses auf parlamentarisch-politischem Gebiet.
Max von Puttkamer blieb vom Konstituierenden durch den Norddeutschen bis zum Deutschen Reichstag Mitglied dieser parlamentarischen Vereinigungen bis 1881, und immer im Wahlkreis Fraustadt. Er trat der nationalliberalen Partei bei, besonders der engeren Gruppe Bennigsen, Miquel, Völk, Marquardsen, Stauffenberg.
Die nationalliberale Partei, die vorzüglich in den Jahren 1870-74 große Bedeutung gewann und auch numerisch den breiten Boden, den sie im deutschen Volk hatte, markierte, erfuhr 1879 eine Spaltung und starke Minderung ihrer politischen Bedeutung. Eine Gruppe von zirka 18 Mitgliedern trat aus dem Verband; unter diesen befand sich auch Puttkamer-Fraustadt. Indessen war eine, wie es sich nachmals erwies, geradezu epochemachende Wendung in sein amtliches Leben getreten: er ward 1871 in das neugewonnene Elsaß versetzt, und zwar als Rat an das Oberste Gericht des Landes nach Kolmar. Hiermit begann seine immer enger werdende Verkettung mit dem Westen Deutschlands und mit der Entwicklung des Deutschtums in Elsaß-Lothringen. Allgemach wuchs aus seiner tätigen Teilnahme in Verbindung mit dem seiner durch scharfe Beobachtung gewonnenen Erkenntnis der Kräfte und Bedürfnisse des Landes auch sein Einfluß.
Fürst Bismarck war wohl zunächst durch Puttkamers parlamentarische Aktivität auf sein politisches Talent aufmerksam geworden. Gemäß seinem bescheidenen Naturell, das immer die Sache über jedes persönliche Hervortreten gestellt hatte, lag Puttkamers Betätigung im Parlament hauptsächlich in der Arbeit der Kommissionen, aber er war auch sehr geschickt und eindrucksvoll in Reden aufgetreten. Mehr in Debatten und Repliken aktueller politischer und Gesetzesfragen als in Programm- und Prinzipienreden. Er erkannte wie Bismarck den eigentlichen Lebensnerv der Politik mehr in praktischen Erfolgen als in der Entwicklung von Theorien ruhend. Puttkamer war auch eines der vom Reichstag erwählten Mitglieder der Reichsjustizkommission, welche die Gesetze betreffend Strafprozeß, Zivilprozeß, Gerichtsverfassung von 1870-76 beriet. Kraft seiner großen staatsmännischen Begabung und ihrer fortwährenden Übung im Parlamentarismus trat er ganz natürlich in das Sphärengebiet der höheren Politik. Das fachmännisch-juristische Wirken trat trotz seines lebendigen Interesses daran, weil es trockener und enger eingekreist ist, allmählich in die zweite Stelle.
Das Großzügige, ja oft Weltzügige der hohen Politik dagegen setzte seine gesamte Geistigkeit in belebteste Schwingungen. – Bismarck hatte Max von Puttkamer bald als einen der feinsten Kenner reichsländischer Verhältnisse erkannt. Das erstemal, daß der Fürst Veranlassung nahm, Puttkamers Ansicht über elsaß-lothringische Fragen zu hören, war gegen die Mitte der siebziger Jahre. Es liegen mir da einige Aufzeichnungen meines Mannes vor, welche die Lage ganz authentisch dartun. »Der Fürst ließ mich zu einer Besprechung in sein Zimmer im Reichstag einladen und sagte mir ungefähr: Es sei offensichtlich, daß die Verwaltungsorganisation im Reichsland sehr kompliziert sei, und er habe die Empfindung, daß dort die Bureaukratie sich mehr als nötig breitmache. Es könne in Frage kommen, ob es, um zu einer Vereinfachung zu gelangen, richtiger sein würde, die Bezirkspräsidenten aufzuheben oder das Oberpräsidium ..., welche Ansicht ich darüber habe. Ich erwiderte, daß die Beseitigung der Bezirkspräsidenten doch wohl die Aufhebung der Bezirke, die aber nicht bloß Verwaltungseinheiten, sondern auch kommunale Körper seien, nach sich ziehen müsse. Das führe sehr weit, da zwischen den Gemeinden und dem Land dann jedes Mittelglied fehlen würde. Die ganze Wegegesetzgebung zum Beispiel basiere auf den Bezirken. Dagegen hielte ich die Einrichtung des Oberpräsidiums für überflüssig und für verfehlt. Es sei gar kein Grund ersichtlich, weshalb nicht die Bezirkspräsidenten direkt unter dem Ministerium in Berlin stehen sollten, wie in Frankreich die Präfekten unter Paris. Die reichsländischen Bezirke seien nicht weiter von Berlin entfernt als manche Departements von Paris; und wenn die Eingeborenen in der Ministerialinstanz eine Besprechung haben oder ein Gesuch vertreten wollten, so sei es gar nicht unerwünscht, daß sie nach Berlin reisen müßten, wie früher nach Paris. Das Bedenklichste aber schiene mir das Auseinanderreißen der ministeriellen Gewalt. Ein großer und gerade der wichtigste Teil derselben ruhe bei dem Oberpräsidenten, der aber keine politische Verantwortlichkeit habe. Diese sei ausschließlich bei dem Reichskanzler. Ein solches Verhältnis sei auf die Dauer nicht haltbar, insbesondere dann nicht, wenn man im Reichstag anfangen würde, sich eingehender mit den Details der Verwaltung zu beschäftigen, wozu die Verabschiedung des Landeshaushaltsetats geradezu herausfordere. Meine Meinung sei, daß unter Aufhebung des Oberpräsidiums eine dem Reichskanzler subordinierte Behörde in Berlin eingerichtet werde, in der die gesamten ministeriellen Befugnisse konzentriert würden ... Fürst Bismarck äußerte keine Ansicht, doch schien er insbesondere meiner Auslassung über die Verantwortlichkeit beizustimmen. Seit dieser Zeit hat, während ich im Reichstag war, der Fürst mich sehr oft über Vorgänge und Persönlichkeiten in Elsaß-Lothringen befragt – ›zu seiner allseitigen Information‹, wie er äußerte, und um nicht mehr auf offizielle Berichte angewiesen zu sein.«
Die Jahre 1875-79 bringen dann fortwährend Besprechungen Bismarcks mit meinem Mann, und Erörterungen reichsländischer Fragen. Insbesondere trat der Gedanke einer Neuorganisation der Regierung in Elsaß-Lothringen, das bekanntlich vom Reichskanzleramt von Berlin aus regiert wurde, immer plastischer hervor. Schon 1876 wurden Verbindungen mit hervorragenden Elsässer Herren vom Fürsten gewünscht und durch Puttkamer eingeleitet und vermittelt. Es liegt noch ein Brief Bismarcks vor, der dies Thema bespricht; sonst wurden die Verhandlungen fast alle mündlich geführt während der Reichstagssession in Berlin. Bezügliche Stellen aus jenem Briefe lauten:
Berlin, 16. Januar 1876.
Behufs Besprechungen einiger für die Verwaltung des Reichslandes wichtigen Fragen wäre es mir sehr erwünscht, mit einigen hervorragenden und sachkundigen Personen der dortigen außeramtlichen Kreise Rücksprache nehmen zu können. Da meine Gesundheit mir einstweilen nicht gestattet, den Oberrhein zu besuchen, und ich für jetzt jeden amtlichen Charakter der Besprechungen vermeiden möchte, um denselben die volle Unbefangenheit zu bewahren, so nehme ich Ew. Hochwohlgeboren freundliche Vermittlung mit der Bitte in Anspruch, zu versuchen, ob Sie im Kreise Ihrer Bekanntschaft Herren der bezeichneten Stellung finden, welche geneigt sein werden, mich zu dem gedachten Zweck hier aufzusuchen. Ich denke dabei in erster Linie an die Herren Schlumberger und Koechlin, – und wenn Sie dieselben unter Benutzung dieses Schreibens zur Herreise im Laufe des Winters vermögen können, würde ich Ihnen sehr dankbar sein. Sollten die Herren eine direkte Einladung wünschen, so bitte ich Ew. Hochwohlgeboren, mich davon vertraulich zu benachrichtigen.
Koechlin, Schlumberger, der alte Baron Zorn von Bulach, Schneegans, der übrigens als Reichstagsabgeordneter auch direkte Fühlung mit Bismarck hatte, und Julius Klein traten näher in den Gesichtskreis des gewaltigen Kanzlers. In allen elsässischen Personalfragen sowie in Organisations- und Verwaltungsfragen des Reichslandes ward Max von Puttkamer damals vom Fürsten zur Beratung herangezogen und zeigte sich dabei als feinsinniger Kenner und Beurteiler. Daß Bismarck dies Urteil über Puttkamer sich bewahrte, geht unter anderem aus einem in den vielbesprochenen Memoiren des Fürsten Chlodwig Hohenlohe veröffentlichten Brief von Bismarck an den 1885 zum Statthalter ernannten Hohenlohe hervor. Bismarck schreibt da, als er Hohenlohe anrät, sich, ehe er sein Amt anträte, Informationen über reichsländische Verhältnisse in direkten Besprechungen in Straßburg zu holen: »Besonders empfehle ich zu diesem Behuf den Unterstaatssekretär von Puttkamer, der durch Klugheit und Kenntnis des Landes sich auszeichnet.«
Später glaubte Hohenlohe eine verminderte Wärme in Bismarcks Urteil über Max von Puttkamer konstatieren zu sollen. Er sagt in seinen »Denkwürdigkeiten« an der Stelle, wo nach dem elsässischen Ministersturz (1887) die Rede war, den Staatssekretärposten neu und eventuell mit Puttkamer zu besetzen, daß der Fürst Bismarck dazu bemerkt habe: »Puttkamer ist zu liberal und nicht energisch genug.« Doch dem widerspricht die Tatsache, daß mein Mann zum Staatssekretär an Hofmanns Stelle ernannt wurde, und zwar unter der Amtsführung des Fürsten Bismarck.
An der ganzen Neuorganisation (1879) hatte Puttkamer auch schon den tätigsten Anteil genommen und war damals von Bismarck selbst erwählt worden zum Unterstaatssekretär der Justiz und des Kultus. Von dieser Zeit an waltete er unablässig an den Geschicken des Landes als Staatssekretär vierzehn Jahre. Alles Starre, Doktrinäre, alles eigensinnige Bestehen auf Prinzipien zur höheren Ehre der Theorie war ihm fern. Er gehörte zu jenen praktischen Politikern aus der Schule Bismarcks, deren Strebungen mehr auf die heilsamen Errungenschaften gehen als auf den Triumph einer Idee. Politiker der Praxis, die auch im Notfall eine Provinz opfern, um ein Königreich zu gewinnen, oder in der gegenwärtigen Zeit etwas aufgeben, um es in der zukünftigen gemehrt und verstärkt wieder zu empfangen. Max von Puttkamers gewandte, liebenswürdige und geistreiche Art gab ihm eine wunderbare Anpassungsfähigkeit. Wie wäre es sonst möglich gewesen, daß er drei völlig verschieden gearteten Statthaltern mit politischem Rat und politischer Tat, und zwar zu deren hoher Anerkennung und Wertschätzung diente!? Dem kirchlich und politisch reaktionären Manteuffel, der außerdem eine so merkwürdig komplizierte Natur hatte und mit seinen starken Impulsen und sentimentalen Anwandlungen so leicht schwierig wurde; dem Fürsten Chlodwig, dessen ganze Art des Geistes und Charakters ungefähr die entgegengesetzte von Manteuffel war, und dem Fürsten Hohenlohe-Langenburg, der die sehr bestimmt geprägte Eigenart eines süddeutschen – »großen Herrn« darstellt ... Um die persönliche Stellung meines Mannes den Statthaltern gegenüber knapp und bezeichnend auszudrücken: die Fürsten Hohenlohe sahen in Puttkamer in erster Linie »ihren Staatssekretär«, während Manteuffel in ihm in erster Linie den vornehmen, politisch und humanistisch gebildeten Edelmann sah, dann erst den hohen Staatsbeamten. Die vielen Statthalterbriefe, die sich in den Papieren meines Mannes befinden, sind charakteristisch dafür. So sind zum Beispiel alle Manteuffel-Briefe, selbst die politisch wichtigsten, mit Bemerkungen und Hindeuten auf ein persönliches Nahestehen geschrieben. Die Unterschriften sind überaus warm: »In Herzlichkeit«, »In bekannten, freundschaftlichen Sentiments«, »Mit warmem Gutenachtgruß« und so weiter. Die Briefe sind voll zarter Rücksicht für die allerdings sich nie Rast gönnende Arbeitsbeweglichkeit meines Mannes (er nahm im ganzen Jahr nicht mehr als drei Wochen Urlaub), für sein Wohlbefinden, für intimere Vorgänge seines Lebens und insbesondere auch von einer rührenden Verehrung und Teilnahme für mich. Die Briefe des Fürsten Hohenlohe-Schillingsfürst sind ganz sachlich, sprechen viel von Entwürfen zu Reden, Gesetzen, Depeschen, Exposés, die er Puttkamer beauftragte zu machen, und haben nie eine wärmere persönliche Note. Sie geben das Bild eines Regenten, der sehr viel Einsicht, Übersicht, Sachkenntnis und Erfahrung hat, der aber das politische Talent seines Ministers viel weniger für eigenkräftige Wirksamkeit als im Dienste seines höheren Willens flüssig zu machen wünschte.
Da Fürst Chlodwig meinem Mann und mir im Leben viel freundschaftliches Interesse bekundete, ist es wohl denkbar, daß seine kühleren Briefe aus dem Prinzip hervorgingen: amtliche Kundgebungen nicht mit irgendwie persönlichen Fragen zu verquicken.
Max von Puttkamer hatte sich in den dreißig Jahren seiner Wirksamkeit in Elsaß-Lothringen so hinübergelebt mit allen Gedanken und Gefühlen in dies interessante und schöne Grenzland, das den gewaltigen Stempel zweier bedeutenden Kulturen trägt, daß er es im besten Sinne als seine Heimat empfand. Als er für seine Rüstigkeit und die Frische seines Könnens und Wollens allzufrüh schied aus einem Wirkungskreis, mit dem er fast organisch verwachsen war, ging ein Riß durch sein Leben. Die Wunde davon, die sein Stolz gern verheimlichte, schloß sich erst mit seinem Tode. Sie hat ihm rastloses Weh bereitet.
Das Bild von Max von Puttkamer, wie es sich in der öffentlichen Meinung, deren konzentrierter Ausdruck die Presse ist, darstellt, trägt große Züge, welche die Wahrheit nachzeichnen. Daß mein eigenes Urteil fast mit jenem zusammenfällt, darf mir wohl als ein Beweis für meine Unparteilichkeit zuerkannt werden. Gewisse intime Schattierungen, Lichtreflexe, Linienführungen, Feinheiten und Blicke in die Tiefe seines Wesens konnte ich natürlich besser geben bei »meiner Liebe zum Gegenstand« und vielleicht auch kraft einer besonderen divinatorischen Gabe der Seelenerkenntnis, die man mir zuspricht.
Alle die Hunderte von Artikeln, die anläßlich des siebzigsten Geburtstages (28. Juni 1901), des Abschieds (18. Juli 1901) und seines Todes (März 1906) erschienen sind, tönen in einem Unisono hoher Verehrung und Anerkennung aus, und vor allem in dem Satze, daß die dreißig Jahre seiner Wirksamkeit unvergessen in der Geschichte des Landes weiterleben, – ja, daß Puttkamer selbst ein Stück reichsländischer Geschichte verkörpere. Ich will hier nur einen Auszug aus dem »Hannoverschen Courier« bringen, der meine Darstellung des ausgezeichneten Mannes glücklich und harmonisch ergänzt.
(Morgenausgabe vom 28. Juni 1901.)
»Am 28. Juni feiert der Staatssekretär von Puttkamer seinen siebzigsten Geburtstag in ungeschwächter körperlicher Rüstigkeit und in vollster Frische des Geistes. Herr von Puttkamer ist bereits im Jahre 1871 aus dem preußischen Staatsdienst in das Reichsland gekommen und war an dem damaligen Appellhof in Kolmar zuerst als Rat und dann als Generaladvokat tätig, bis er 1879 als Unterstaatssekretär zur Leitung der Justizabteilung berufen wurde. Als dann 1887 Exzellenz von Hofmann zurücktrat, wurde Herr von Puttkamer mit der Führung der Geschäfte des Staatssekretärs betraut und bald darauf zum Staatssekretär ernannt. Somit steht Herr von Puttkamer nunmehr nahezu vierzehn Jahre in leitender Stellung an der Spitze des elsaß-lothringischen Ministeriums. Vieles und Großes ist während dieser Zeit auf dem Gebiete der inneren Verwaltung und der Gesetzgebung in Elsaß-Lothringen geschehen. Auf Einzelheiten einzugehen, würde an dieser Stelle zu weit fuhren. Aber wenn die Zustände sich heute unter dem politischen Gesichtspunkt als günstige und befriedigende darstellen, so gebührt das Verdienst hieran mit in erster Linie dem Staatssekretär von Puttkamer. Mit weitem politischem Blick behielt er immer das Große und Ganze im Auge und verlor sich niemals in Kleinigkeiten, um über einen Augenblickserfolg ein höheres und allgemeineres Ziel preiszugeben. In weiser Mäßigung wußte er vorhandene Gefühle zu schonen, ohne dem Staatsgedanken und der Autorität des Staates das geringste zu vergeben. Und so ist es seiner tiefen Kenntnis der Personen und Dinge im Reichsland gelungen, manche widersprechenden Elemente allmählich zu einer gerechten Würdigung und Anerkennung der neuen Verhältnisse hinüberzuleiten. Auch bei den Katholiken findet Herr von Puttkamer, obgleich Protestant, Achtung und Zutrauen. Denn wenn schon der Staatssekretär gelegentlich klerikalen Übergriffen auf das schärfste und energischste entgegentrat, so hat er sich doch stets von jeder engherzigen Kulturkämpferei ferngehalten und vielmehr für berechtigte katholische Interessen staatsmännische Unbefangenheit und Verständnis gezeigt. Aus seiner langjährigen parlamentarischen Wirksamkeit als Vertreter von Fraustadt (Posen), im preußischen Landtag und im Reichstag, hat sich Herr von Puttkamer eine außerordentliche parlamentarische Gewandtheit erworben und sich zu einem ausgezeichneten Redner und Debatter herangebildet. Dies kommt ihm im Verkehr mit dem Landesausschuß besonders zustatten, und daher hat der persönliche Einfluß und das Beliebtsein, dessen Herr von Puttkamer sich bei den elsaß-lothringischen Abgeordneten erfreut, nicht zum wenigsten Teil daran, daß die Beziehungen zwischen der Regierung und dem reichsländischen Parlament gute und das Wohl des Landes vorteilhaft fördernde sind. Gewiß hat Herr von Puttkamer auch Feinde und Widersacher, aber selbst die Gegner beugen sich vor dem überlegenen Wissen dieses ungewöhnlich klugen Mannes, vor der Lauterkeit seines Charakters, vor der Vornehmheit seiner Gesinnungen. Der weitschauende Staatsmann ist zugleich ein wohlwollender Vorgesetzter für seine Räte und Beamten. So werden ihm denn allgemein und von allen Seiten zu seinem siebzigsten Geburtstag warme und herzliche Glückwünsche dargebracht. Möge es dem Staatssekretär von Puttkamer vergönnt sein, noch viele Jahre in seiner hohen, aber schwierigen und verantwortungsreichen Stellung zu wirken, in der er zudem das volle Vertrauen des früheren Statthalters, des Altreichskanzlers, Fürsten zu Hohenlohe-Schillingsfürst genoß, wie auch des jetzigen Statthalters Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg im ganzen Umfange besitzt.«
Aus den »vielen Jahren« der Wirksamkeit, die man dem Staatssekretär wünschte, sind dann nur zweiundeinehalbe Woche geworden. Da nahm Max von Puttkamer seinen Abschied.
Eine große Erregung ging damals durch das Reichsland. Alle Zeitungen waren des innigen Bedauerns über sein Scheiden voll, aus allen Schichten der Bevölkerung liefen Trauerbriefe ein ...
Die Ereignisse gingen ruhigen, unabänderlichen Schrittes weiter – – – Max von Puttkamer hat noch fünf Jahre in der Muße gelebt, die seiner aktiven Natur so völlig ungewohnt war. In vielen Nekrologen bedeutender Zeitungen sind bei seinem Tode 1906 umfassende Würdigungen von Puttkamers politischer Persönlichkeit gegeben worden. Ich will hier nur einige Stellen aus dem Nachruf der »Kölnischen Zeitung«, als eines vornehmen Weltblattes, zitieren, die merkwürdig ähnliche Linien zeigen mit dem Bilde, das ich hier skizziert habe:
»Der Staatssekretär a. D. Max von Puttkamer ist gestern abend in Baden-Baden gestorben, wo er seit seinem 1901 erfolgten Rücktritt die letzten Jahre seines Lebens zubrachte. Der Wirkliche Geheime Rat Max von Puttkamer gehörte zweifellos zu den hervorragendsten staatsmännischen Gestalten, die nach 1870 mitgeholfen haben, die Geschicke der wieder deutsch gewordenen Reichslande zu bestimmen; trug er doch während dreißig Jahren eine Menge von Bausteinen zur Aufrichtung des deutschen Staatsgebäudes in Elsaß-Lothringen herbei und wirkte mit an der inneren Ausgestaltung und Wohnlichkeit des Gebäudes, in dem sich die einhundertneunzig Jahre (nicht zweihundert Jahre) von den Franzosen beherrschte Bevölkerung behaglich zu fühlen begonnen hat. Er gehörte zu den Männern, die in der Reife ihrer Anschauungen den Umbildungsprozeß der reichsländischen Verhältnisse ihren natürlichen Gang haben gehen lassen und dem auf manchmal sehr erregten Wogen treibenden Schiff mit starker Hand die Richtung gewiesen haben. Erst wenn die Jahre das Fundament geschaffen haben werden, von dem aus die Allgemeinheit die stille, stetige Arbeit Max von Puttkamers ohne Trübung durch die Färbung der Parteibrille betrachten kann, wird man zur rechten Würdigung des Staatsmannes gelangen, der in schwierigen Verhältnissen das Reichsland in die neue Zeit hinübergeführt hat. So leicht es ist, den Spuren der Männer nachzugehen, die dröhnenden Ganges durch die Welt schreiten, so schwer ist es, feingeistigen Männern zu folgen, die, Feinde lauten Hervortretens, nie ihre Person in den Vordergrund stellen, sondern stets bestrebt sind, ihre Persönlichkeit mit dem Schilde ihrer Arbeit zu decken. Ein solcher Mann war Max von Puttkamer.
Fürst Bismarck hat ihn stets durch volles Vertrauen ausgezeichnet, und nicht mindere Achtung genoß seine ruhige, stetige Art bei seinen unmittelbaren Vorgesetzten. Freiherr von Manteuffel hat ihm stets freie Hand innerhalb seines Ressorts gelassen. Von dem schönen Verhältnis, in dem Manteuffel und Puttkamer zueinander standen, und von dem tiefen Verständnis der beiden Männer für ihre Naturen zeugt die seine Würdigung der Persönlichkeit Manteuffels in dem Werke ›Die Ära Manteuffel‹ aus der Feder Alberta von Puttkamers, bei dessen Abfassung ihr Gemahl Wertvolles beigesteuert hat.
In verständnisvollem Zusammenwirken hat er dann fast ein Jahrzehnt dem zweiten Statthalter, Fürsten Chlodwig Hohenlohe, als kluger Berater zur Seite gestanden, und fast sieben Jahre noch war seine Mitarbeiterschaft dem dritten Statthalter, Fürsten Hohenlohe-Langenburg, erhalten. Nicht Stück für Stück in allen ihren Einzelheiten lassen sich seine Erfolge aufführen. Wenn aber die Verhältnisse in einem Lande, dessen Bevölkerung Frankreich, von dem sie das Jahr 1870 losriß, ohne Rücksicht auf die alte Vergangenheit als ihre Heimat ansah und liebte, im Laufe eines Menschenalters sich so entwickelt haben, daß ein deutscher Geschichtsschreiber einer späteren Zeit sich vom nationalen Standpunkt aus damit zufrieden erklären kann, so hat Max von Puttkamer den größten Anteil daran.«
Soweit die »Kölnische Zeitung«. Das war damals 1906, und das Urteil umfaßte die dreißigjährige Wirksamkeit Puttkamers und war in einer Zeit gegeben, die alle Zeichen, alle Elemente der Versöhnung und des freundlichen Anschlusses an das Deutsche Reich gebracht hatte. Es setzte bald nach 1901 eine Ära des Mißtrauens, dann des Mißverstehens ein, wie ich teils schon angedeutet habe, teils weiter unten schildere, und gipfelte endlich in der Abkehr vom Deutschtum und der Hinneigung zu Frankreich. Vom moralischen, philosophischen, vom volksgeschichtlichen Standpunkt aus ist die historische Erfahrung geradezu entsetzlich, daß eine Entwicklung, die wirklich in der Emporblüte war, so brutal zerstört werden konnte und sich so willig der Zerstörung hingab. Noch tragischer ist es vielleicht, daß so vieler edler und bedeutender deutscher Männer eifriges und energisches Wirken, ihre Lebensarbeit, nun einfach ins Leere gestoßen ist ... Entwurzelt und – im Leeren!
Und es ist nun, als ob das stolze, große Wirken nie gewesen sei, denn seine geistigen Spuren sind ja getilgt. Freilich, vieles in der Kultur des Landes, alle die Gaben der Technik, der Baukunst, der Kunst und Wissenschaft, die können nicht hinweggetilgt werden, ohne die jetzigen Herren von Elsaß-Lothringen in ihrem Besitz zu schädigen, denn mit den Kulturerrungenschaften würde man auch dem Lande einen hohen Wert nehmen. Brücken, Stauweiher, Kanäle, Wegebauten, Paläste, Universität, Häfen, Kanalisation, Schulen, Kirchen und so weiter. In solchen monumentalen Lettern schreiben die »Barbaren« eben ihre Kultur und Zivilisation in die Länder – – –
Also, die ernste politische Arbeit am Deutschtum im Elsaß ist verloren gewesen, – vergebens, vergebens, vergebens! ... Auch die meines edlen Mannes. Ja, er war ein ausgezeichneter Mann an Geist, Charakter und Gemüt, und ihm war vornehme und seine Schulung geworden: In der ernsten Kindheit nach fast spartanischen Gesetzen einer grundlegenden Erziehungsanstalt, in der Jünglingszeit in einer bewegten Schule der Erfahrung, die das hochgehende politische Leben des Jahres 1848 und der folgenden brachte (einer Zeit, deren Frühlingsstürme geradezu mächtig entwickelnd für die Keime staatsmännischer Talente werden mußten), und in der Manneszeit durch die großen und interessanten Aufgaben, vor die seine Kraft gestellt ward, in den Parlamenten und im neueroberten Reichsland. Er besaß eine ganz ungewöhnlich vielseitige, im eigensten Sinne humanistische Bildung, die er in geistsprühender Unterhaltung flüssig machte. Seine gediegene Bildung hatte er im Aufgang seines Lebens gern mit den besten Elementen englischen Geisteslebens durchdrungen. Wie er von deutschen Historikern Leopold von Ranke besonders liebte, so von englischen Macaulay und Carlyle. Und von Dichtern standen neben seinem vielgeliebten Goethe die Engländer Byron und Shakespeare.
Als er im Zenit seines Mannesalters nach Elsaß-Lothringen kam, in dessen Kulturboden noch tief und frisch die Saat französischen Geisteslebens eingestreut war und hoch aufsproßte, wuchsen in seine deutsche Grundbildung Blüten französischen Wesens hinüber. Ich möchte sagen, wie zuerst der Duft der Feinblüte englischer Kultur in seine Bildung trat, so später ein Duft der französischen. Das mischte in sein im Grunde schweres und tiefes Wesen sehr glücklich einige feinere und leichtere Elemente ...
Er hat noch in der Stille seiner Zurückgezogenheit der letzten Lebensjahre mit regsamem Geist die geschichtliche und kulturelle Entwicklung seiner großen Heimat, des Deutschen Reiches, und seiner engeren, Elsaß-Lothringens, verfolgt. Besonders bekundete er immer eine in seiner milden, maßvollen, staatsweisen Art ernste Abneigung den Auswüchsen und Übergriffen moderner Kampfnaturen und antistaatlicher Strömungen gegenüber. Und er klagte oft, daß die Deutschen dadurch, daß sie den Widerstreit der Parteigegensätze zu sehr in den Vordergrund der politischen Bühne trügen, das häßliche Schauspiel zersplitterter Kräfte böten und dabei leicht das richtige Gefühl verlören, sich dem Ausland gegenüber allezeit in Geschlossenheit und nationaler Einheit darzustellen. (Wie prophetisch! Dieses kampf- und streitsüchtige Parteiwesen war es just, das uns in dem fürchterlichen Weltkrieg der Gegenwart zum Verhängnis wurde!!)
Bei aller intellektuellen Bedeutung hatte Max von Puttkamer ein reiches, gutes, fast allzu weiches Herz und einen Charakter von einer Schmiegsamkeit, Anpassungsfähigkeit und dabei Stärke, wie er wohl äußerst selten sein dürfte. Er zeigte sich jeder Lage gewachsen. Er war im Glanze glänzend und würdig, und im Unglück still und ergeben. Er hat sich immer still und groß in den Rahmen gefügt, den das meisternde Schicksal um ihn schloß ...
Langsam hatte also dann 1901 eine Ära des Mißtrauens eingesetzt. Die erste Zeit der neuen Köllerschen Regierung war die Saat, vom Geist der Versöhnung unter Puttkamer ausgestreut, noch wirksam. Keime, die angesetzt hatten, Wurzeln, die in das wartende Erdreich griffen, entwickelten sich noch zu Früchten; und jener öfter zitierte Satz, den Bismarck einst an einer Forstschule als Inschrift fand, ward Wahrheit. In seinem ersten Teil konnte er für die Köllersche Verwaltung gelten, – im zweiten für die verflossene Puttkamersche. Der erste Teil (Köller) sagt: »Wir ernten, was wir nicht gesät haben«, und der zweite Teil (Puttkamer): »Wir säen, was wir nicht ernten werden.« –
Vor einigen Jahren ist ein Buch erschienen von einem Privatgelehrten und Politiker Martin Berger. Da in diesem Buch ein sehr positiver, klar erkennender Geist waltet und ein unparteiischer, hochintelligenter Beobachter sich ausspricht, möchte ich einige Urteile, besonders über Herrn von Köller, hier einflechten. Ich selbst möchte mich enthalten, ein eingehenderes Urteil über diesen Staatsmann und Parlamentarier niederzulegen. Da es nicht sehr günstig lautet, könnten Engherzige oder Fernerstehende glauben, es sei persönlich beeinflußt, weil unsere Naturen sich in Begabung und Richtung gegensätzlich gegenüberstanden, und weil er mehr gegen als für meinen Mann agiert hat. Es ist aber durchaus nicht der Fall, daß ich persönlich beeinflußt bin, sondern mein Urteil ist streng sachlich und anerkennt auch gern die guten und größeren Seiten des Herrn von Köller.
Köller war also der direkte Nachfolger meines Mannes im Straßburger Amte 1901. Er war schon früher, als Unterstaatssekretär des Inneren, jahrelang tätig in Elsaß-Lothringen unter dem Staatssekretariat meines Mannes gewesen und kam dann 1894 nach Berlin als Minister und später als Oberpräsident nach Schleswig. Er kannte natürlich Land und Verwaltung des Elsaß von seiner früheren Amtszeit her. Köller war damals weder im Lande noch im Parlament beliebt gewesen.
Als ostelbischer Junker und Hochkonservativer von spezifisch preußischem Gepräge hatte er öfters engherzige und scharf pointierte Gesichtspunkte. David hatte, bei Gelegenheit von dessen Ernennung zum Staatssekretär, eine sehr ernste und scharfe Kritik an Köller geübt, in Artikeln der »Straßburger Post«, unter gleichzeitiger außerordentlicher Anerkennung und Hochverehrung für den scheidenden Staatssekretär von Puttkamer.
David sagt hier auch, daß Köller die Früchte der Tätigkeit seines Vorgängers geerntet habe ...
Mit der ganzen Freimütigkeit eines Mannes, der innerlich und äußerlich völlig unabhängig war, nennt Pascal David die Dinge und Menschen so, wie er und der größte Teil der Elsaß-Lothringer sie erkannte. Es machte auch den Chefredakteur der »Straßburger Post« durchaus nicht irre in seinem politischen Vorgehen, daß sich nun eine Stimmung gegen ihn in den Kreisen der Verwaltung scharf betonte. Berger kennzeichnet dies so: »Wenn schon die Maiartikel über die Hohkönigsburg und die daran schließenden Artikel stark verstimmt hatten, so verschärfte sich diese Stimmung durch Davids Artikel bei Puttkamers Entlassung und Köllers Amtsantritt noch sehr, und es waren Machinationen im Gange, als deren Haupterreger man den in seiner Eitelkeit oft von Davids Beurteilung verletzten Unterstaatssekretär von Schraut bezeichnete; Machinationen, um David aus seiner Stellung als Chefredakteur zu drängen, doch blieben sie erfolglos.«
Ich möchte hier noch einige andere Stellen aus Bergers Buch zitieren, weil sie historische Wahrheiten aussprechen, die öffentlich noch kaum bisher so bestimmt gesagt wurden. Er spricht nämlich davon, daß David und wie David den bewährten Staatsmann Puttkamer seinerzeit gegen die Angriffe der Klerikalen in Schutz genommen habe, und konstatiert, »daß diese Hetzstimmung absolut nicht die wirkliche Stimmung des Landes repräsentiert habe«. Er führt auch folgende historisch bedeutsame Tatsache an: »Einen festen Halt hatte der Staatssekretär in dieser Zeit an dem Reichskanzler Fürsten Hohenlohe, der wohl einsah und seine Auffassung entsprechend vertrat, daß Puttkamers Politik für das Land sehr nützlich sei. An dieser Überzeugung hat Fürst Chlodwig auch nach dem Ausscheiden aus seinem Amte festgehalten, wenn er ihr auch in seinen Denkwürdigkeiten nicht in der Weise Ausdruck geliehen hat, wie es aus persönlichen und sachlichen Gründen am Platz gewesen wäre.« So weit Berger. Das ist übrigens in der ernsteren Presse fast überall (auch in Österreich) mißbilligend bemerkt worden und – es ist in der Tat schwer verständlich, daß die Worte und die Handlungen, mit denen Hohenlohe im Leben für Puttkamers staatsmännisches Talent und sein reiches Wissen allezeit eintrat, in den »Denkwürdigkeiten« so blassen Reflex finden. Er hielt zum Beispiel das politische und fachmännische Urteil Puttkamers so hoch, daß er, wie es aus Briefen ersichtlich ist, in schwierigen Fragen seines neuen, hochwichtigen Amtes seinen früheren Staatssekretär um die Darlegung seiner Meinung bat und sich auch gern von ihr beeinflussen ließ.
Im Jahre 1900, einundachtzig Jahre alt, trat Hohenlohe vom Reichskanzlerposten zurück. Im gleichen Jahre trat der später so viel besprochene Abbé Wetterle zum erstenmal in den Landesausschuß. Der streitbare Priester und damals schon heimlich Abtrünnige ward 1901, bei Köllers Amtsantritt, ein Freund des Staatssekretärs und verkehrte oft im Palais am Kleberstaden. Es ist wohl einer der radikalsten Irrtümer Köllers gewesen, daß er die persönlich freundlichen Beziehungen zu Wetterle als einen erhofften Anschluß und eine Gefügigkeit der klerikalen Partei an die Regierung auffaßte. Die Ära des Mißtrauens, die 1901 einsetzte und bis etwa 1908 andauerte, war wohl wesentlich aus der Verkennung jener Tatsache und auch aus der Unterschätzung der Bedeutung der sozialdemokratischen Partei im Reichslande hervorgegangen.
Wetterle war also der Freund des Herrn von Köller. Das war ein Augenblickserfolg, über dem kurzsichtig die Zukunftserfolge und -entwicklungen übersehen wurden. Der erhoffte Anschluß und die Gefügigkeit der klerikalen Partei traten nicht ein, sondern das genaue Gegenteil. Die Klerikalen fühlten sich erstarkt durch das Entgegenkommen der Regierung und nutzten die Macht, die sie gewannen, für ihre kirchlichen Sonderzwecke aus. Und die andere Partei, die Sozialdemokratie, erstarkte aus einem anderen Grunde: Aus Köllers Glauben an deren geringen Einfluß. Er ließ sie eben als, wie er meinte, völlig ungefährlich gewähren. Er hat es mehrfach und mit stolzer Bestimmtheit ausgesprochen, daß »die Sozialdemokraten keinen Boden im Lande hätten«. Die Illustration zu dieser Verkennung war die Wahl von einer sozialdemokratischen Mehrheit im Gemeinderat von Mülhausen und die Wahl mehrerer Sozialdemokraten in den Gemeinderat von Straßburg. Das Erbe, das Köller dem Lande hinterließ, als er 1908 aus seiner Stellung schied, war die Machtstellung und Stärke der beiden genannten Parteien.
Die Erscheinung und das Wesen des Herrn von Köller waren ausgesprochen junkerlich-preußisch. Er war von starker Intelligenz, aber nicht von umfassender humanistischer Bildung. Er hatte die Welt und all ihre Entwicklungen, besonders auch die kulturelle, künstlerische, literarische, von denen er nur eine Oberflächenkenntnis hatte, immer nur durch das Augenglas eines pommerschen Junkers geschaut. Seine selbstsichere, etwas knorrige Junkererscheinung paßte nicht in das westlichste Neu-Deutschland. Es ist auch niemals eine starke Wechselwirkung zwischen ihm und den Elsaß-Lothringern beobachtet worden. Er war damals ein Liebling des Kaisers.
Bei Köllers Demission 1908 trat an seine Stelle der bisherige Unterstaatssekretär für Landwirtschaft und öffentliche Arbeiten, Baron Zorn von Bulach. Die bereits hochgeschossene Saat seines Vorgängers fiel nun als verhängnisvolles Erbe in Bulachs Hand. Baron Hugo Zorn von Bulach begegnete in der neudeutschen wie in der elsässischen Gesellschaft keinem rückhaltslosen Vertrauen. In seine Erziehung hatten viele französisch-napoleonische Einflüsse hineingespielt. Sein Vater, überall im Elsaß nur Bulach père genannt, war Kammerherr Napoleons III., und seine Mutter, eine geborene Baronin Rheinach, war Ehrendame der Kaiserin Eugenie. So besaß Baron Hugo auf keiner der beiden Seiten ein tiefgehendes Vertrauen. Die Elsässer sahen in ihm, der nun der höchste deutsche Beamte im Reichsland war, einen Abtrünnigen oder doch nicht ganz Sicheren. Die Deutschen glaubten aus seiner Vergangenheit und seinem früheren Auftreten im Reichstag, als er dort einen altelsässischen Wahlkreis vertrat, Zweifel an seiner überzeugten Sympathie für das Deutsche und die deutsche Herrschaft entnehmen zu können. Hatte doch Baron Hugo Bulach (scherzhaft der »zornige Filz« von Zorn fils genannt) bei den Verhandlungen im Reichstag über die deutsche Sprache (als obligatorisch bei allen öffentlichen Verhandlungen) eine fulminante Rede dagegen gehalten. Das wurde bereits auch bei Besprechung der Manteuffelschen Zeit mitgeteilt, und er hatte daran eine vernichtende Kritik der Manteuffelschen Landesverwaltung geknüpft; – mit entschiedener Abneigung gegen die deutsche Regierung. Zwar war diese Rede, im Namen der Elsässer, von Mieg charakterisiert worden als nicht von den Elsässern inspiriert, sondern als persönliche Auffassung des Barons Hugo; aber wenn sie auch dadurch als elsässische Kundgebung abgedämpft war, so trat sie deshalb um so mehr persönlich feindselig gegen deutsches Wesen hervor. Man hatte es da mit einer Enthüllung seiner innersten Meinung zu tun, und wenn es als ein solches document humain, um mit Zola zu sprechen, betrachtet werden muß, so stellt das doch einen erheblichen Gegensatz dar zu der Stellung und Betätigung als oberster deutscher Beamter, Minister in Elsaß-Lothringen. Ich glaube, die Meinung vieler und bedeutsamer Persönlichkeiten ging nicht fehl, wenn sie besagte, daß Baron Hugo Bulach die Stellung als Staatssekretär in erster Linie angenommen habe, weil es ein großer Wunsch Kaiser Wilhelms war, den Bulach sehr verehrte und hochschätzte. Eine staatsmännische Begabung und Vorbildung, die wohl unerläßlich nötig ist für eine so besondere politische Mission wie die eines elsaß-lothringischen Staatssekretärs, hatte Zorn von Bulach nicht; wohl aber den reinsten Willen, edelmännischen Charakter und Erfahrung auf vielen Gebieten der Verwaltung seines Vaterlandes Elsaß. Seine Familie gehört zu den wenigen alteingesessenen Rittergeschlechtern.
Eine Persönlichkeit im Ministerium für Elsaß-Lothringen muß hier ein wenig näher betrachtet werden: Unterstaatssekretär von Schraut, weil dadurch auch Lichter auf ein im Trüben und Geheimen gefertigtes Netz fallen, dessen Fäden Unheil spannen; – und für einen spannen, der im Vertrauen auf seine gute Sache (das heißt seine hingebend treue Verwaltung des Reichslandes) gar nicht daran dachte, daß gegen ihn Intrigen gewebt wurden.
Und doch geschah es! und sehr geschickt geschah es, so daß man zuerst die Ereignisse für ein waltendes, unaufhaltsames Schicksal hielt; – aber es war zum großen Teil ein ehrgeiziges und utilitarisches Machwerk des Herrn von Schraut, der damit seinem Vorgesetzten, Exzellenz von Köller, dienlich zu sein glaubte. Schraut war ein wahrer Rattenkönig unter den Ratten, die das sinkende Schiff verließen.
Man hielt eine geschickte, verdeckte Aktion des Herrn von Köller, der es übrigens offen ausgesprochen hatte, daß er den Puttkamerschen Posten anstrebe, für die eigentliche Demissionsursache. Die eigentliche Aktion hatte Herr von Schraut übernommen. Ich möchte aber hiermit ausdrücklich betonen, daß ich kein eigenes Urteil in der Sache habe, sondern es ist mir, freilich von durchaus glaubwürdigen und in die Verhältnisse einsichtigen Persönlichkeiten ausgesprochen und versichert worden. Nach den Eindrücken, die ich aus früheren Epochen vom Wesen der Herren von Köller und von Schraut habe, kommen mir jene Urteile recht wahrscheinlich vor. Es ist mir nämlich von dem verstorbenen Pascal David, dem ausgezeichneten Hauptleiter der »Straßburger Post«, als ganz sicher mitgeteilt worden, daß Schraut, als er gewiß zu sein glaubte, daß Köller der »kommende Mann« sei und als direkter Vorgesetzter von großer Bedeutung für sein amtliches und privates Schicksal sein würde, keine andere Rücksicht, Vorsicht und Nachsicht mehr kannte, als dem neuen Herrn zu gefallen. Was da für Machinationen, Intrigen, Entstellungen, Übertreibungen und Erfindungen zusammengewirkt haben mögen, um zum Statthalter oder gar zur höchsten Stelle, dem Kaiser, zu dringen, weiß ich nicht. An zwei Schritten mit negativer Tendenz kann man aber ungefähr ermessen, was für ein Geist da wirksam war. Schraut hatte erweislich darauf hingewirkt, daß man dem scheidenden Staatssekretär keine Abschiedsfeier bereite. Und gerade von den Beamten, die unter Puttkamer wirkten und immer hochverehrend zu ihm gestanden hatten, war ein ganz, ganz anderer Abschied erwartet worden. Denn es war allezeit ein starkes Band zwischen dem Staatssekretär und seinen Beamten gewesen. Und nun?! Als Puttkamer von Straßburg abfuhr nach Baden, war nicht ein einziger der Herren am Bahnhof, während sie fünf Tage vorher, als ich abreiste, in Scharen da waren und das Abteil zu einem Blumengarten gestalteten. Es sollte also scharf unterschieden werden zwischen dem, was man der sozialen, und dem, was man der amtlichen Stellung schuldig zu sein glaubte. Die andere Negation von Schraut war noch häßlicher: es war in den Kreisen der Elsässer eine solche Sympathie für Puttkamer und man war so fest überzeugt, daß er ehrlich das Wohl des Landes wollte, daß man dringend wünschte, diese Gefühle auch dem Kaiser auszudrücken. Er sollte dadurch über die wahre Stimmung im Lande aufgeklärt werden. Zu diesem Zweck sollte eine Deputation von Elsaß-Lothringern nach Berlin zum Kaiser fahren. Diese Bewegung wurde von Schraut unterdrückt; wie man sagte, im Einverständnis mit dem Statthalter, dem Fürsten Hohenlohe-Langenburg!
Ein Dokument der wahren Gesinnungen der Landesvertretung (Landesausschuß) von Elsaß-Lothringen ist in meiner Hand. Es ist das Schreiben der drei Präsidenten des Landesausschusses, welches eine herrliche Erinnerungsgabe für den scheidenden Staatssekretär begleitete. Es waren ein in prachtvoll edlen Linien geschnitztes Büfett und ein Kredenztisch im gleichen Stil. Die beiden Prachtstücke sind Werke des berühmten elsässischen Intarsiakünstlers K. Spindler. Die farbig, wie Gemälde wirkenden Bilder, die an der Stirnseite angebracht sind, sind alle von naturfarbenem Holz, ohne einen Pinselstrich Farbe. Es wurden nur herrlich gemaserte und getönte Naturhölzer dazu verwendet. Die feinsten Linien der Gesichter, des Geästs des strömenden Wassers, alles Landschaftlichen, Architektonischen und überhaupt Bildhaften ist mit farbigen Naturhölzern eingelegt. Auf dem Schanktisch (Büfett) tritt im Hauptfeld der Mitte des Oberbaus Elsaß und Lothringen, verkörpert in zwei reizenden Frauengestalten im Volkskostüm, einem entgegen. Die beiden Möbel sind große Kunstwerke. Das begleitende Schreiben, das die wahre Gesinnung des politischen Elsaß bekundet, lautet so:
Straßburg, 8. April 1902.
Euerer Exzellenz haben wir das Vergnügen, mitteilen zu können, daß bei der ersten Gelegenheit, welche sich ihnen hierzu geboten hat, gleich in der Sitzung der abgelaufenen XXIX. Tagung, und ganz spontan, Mitglieder des Landesausschusses die Absicht kundgegeben haben, zur Erinnerung an die langjährigen guten Beziehungen, welche zwischen ihnen und Euerer Exzellenz bestanden haben, ein Ehrengeschenk zu stiften und Eurer Exzellenz anzubieten. In erfreulicher Weise ist es möglich geworden, wie wir Grund haben, annehmen zu dürfen, einem Wunsche Ew. Exzellenz entgegenzukommen und von der Hand eines elsässischen Künstlers zwei Gegenstände anfertigen zu lassen, welche in ihrer künstlerischen Ausstattung die Erinnerung an das während langer Jahre von Eurer Exzellenz verwaltete Land wachhalten sollen. Die Wahl ist auf ein in angedeuteter Weise ausgestattetes Büfett für das Speisezimmer und ein dazu gehöriges Dressoir gefallen, die anzufertigen der elsässische Künstler Spindler beauftragt worden ist. Derselbe wird diese Gegenstände Eurer Exzellenz direkt zugehen lassen, und bitten wir im Namen aller Gebenden, sie annehmen zu wollen. Wir verbinden damit den Wunsch, daß der Anblick dieser Gegenstände Ew. Exzellenz oft die liebe Erinnerung an die Tage zurückrufen möge, wo wir in gemeinsamer Arbeit das eine Ziel verfolgten, das Wohl unsres Landes zu fördern, um welches Eure Exzellenz sich so hohe Verdienste erworben haben.
Wir schließen mit den herzlichsten Wünschen für Eurer Exzellenz ferneres Wohlergehen, und verbleiben mit vorzüglichster Hochachtung
Ew. Exzellenz
ergebenste
im Namen aller Subskribenten aus den Bezirken
Ober-Elsaß: Dr. von Schlumberger.
Unter-Elsaß: Gunzert.
Lothringen: E. Jannez.
Was für eine Kluft, was für ein Abgrund klafft zwischen damals und jetzt! Und welche Mächte haben ihn aufgerissen!
Sechzehn Jahre haben dies schwer Begreifliche geschaffen. Es ist nicht nur von deutschen Staatsmännern, Politikern, Beamten, Offizieren und so weiter erkannt worden, wenn sie über die Entwicklung der elsaß-lothringischen Geschichte seit 1870 sprachen, und nicht nur von solchen, die durch berufliche Tätigkeit dort – Mitagierende in dem historischen Schauspiel waren, sondern auch von eingeborenen und den Deutschen etwas abholden Elsässern: daß noch kein Deutscher, besonders von den leitenden Staatsmännern, die elsässische Volksseele so verstanden habe, wie der Staatssekretär von Puttkamer.
Es war damals Ehrlichkeit des Verständigungswillens auf beiden Seiten wirksam; dazu ein Vertrauen auf diese Ehrlichkeit; und große Sachlichkeit in Prüfungen und Entscheidungen. Das ward allmählich nach Puttkamers Demission abgeschwächt; man fühlte sich durch den partikularistisch norddeutsch orientierten Herrn von Köller wenig verstanden. Eine gewisse Behaglichkeit und Bonhomie bei ihm täuschte über die scharfkantigen, junkerlichen Auffassungen und Gepflogenheiten.
Als Köller 1908 dem Baron Bulach Platz machte, war auf dem ehemals so reich tragenden, edlen Boden des Vertrauens und der Versöhnlichkeit schon heimlich das Unkraut Mißtrauen aufgeschossen. Und es ward unterirdisch, von den Wurzeln her, genährt durch das von Frankreich eingeführte Gift deutschhetzerischen Wesens und eines intransigenten Haß- und Rachefiebers. Der Segen des aufgehobenen Diktaturparagraphen!! O Hohn auf Freiheit, wenn sie Zügellosigkeit wird! – Doch noch einige Worte über Schraut. Er war inzwischen geadelt worden und – Exzellenz, aber diese Würden paßten zu seiner Erscheinung und zu seinem Wesen wie, ich will den Vergleich lieber nicht aussprechen.
Ich muß hier bevorworten, daß ich durchaus nicht zu denen gehöre, die vom Äußeren auf die Seele schließen, von einem schönen Gesicht und edlen Körperlinien etwa auf eine schöne Seele oder edle Geistigkeit, und von häßlichem Antlitz auf unschöne Seelenzüge. Hier aber, bei Schraut, war das Äußere so ganz bestimmt ausdrucksvoll, daß man unwillkürlich daraus auf die Gestaltung seines Inneren schloß. Und der Schluß war richtig ... Selten habe ich so brutal gewöhnliche Züge, so listigen, fast möchte ich sagen verschmitzten Ausdruck in häßlichen Augen gesehen. Gewiß, er war nicht verantwortlich dafür. – Die Natur hatte ihn so wenig anziehend gestaltet; aber er hätte das wohl erkennen und ein wenig wandeln können. Schraut war dabei sehr eitel, – nicht nur auf geistige Güter, sondern auf leibliche Eigenschaften, so daß er sich in Verkennung der Wirklichkeit, die ihn eher einem Faun ähnlich erscheinen ließ, sich für einen »Typus klassischer Linien« hielt. Weil dies der Wahrheit in so verblüffender Weise entgegengesetzt war, hielt ich seine Worte zuerst für Scherz – – – aber, sie waren wirklich ernst gemeint. Ich muß hier das häßliche und platte Wort »protzen« anwenden, weil es am besten das Wesen der Schrautschen sozialen Gepflogenheiten ausdrückt ...
Ja, er »protzte« mit seiner Bekanntschaft mit Bismarck zum Beispiel, und er tat dies mit Worten, die sein Verhältnis zum Kanzler in ein absolut falsches Licht rückten. Er tat, als sei er Bismarcks nächster Vertrauter, sein Mitarbeiter, sein besonderer Liebling gewesen, und hatte überhaupt die Gewohnheit, wie sie Emporkömmlinge öfters zeigen, sich darzustellen als den Gesuchten, Umschmeichelten, Geehrten von allen nur irgend hohen und interessanten Persönlichkeiten. Ich will aber auch, um der Gerechtigkeit willen, nachdem ich von Schrauts wenig angenehmen Eigenschaften wahrheitsgemäß berichtete, von einer schönen, anziehenden reden. Schraut war sehr musikalisch und ein begeisterter Freund und Schwärmer für edle Musik und schöne Literatur. Ich habe manch reizvolles Gespräch mit ihm über Kunst geführt, und da ist es wohl auch hie und da geschehen, daß ich vieles Unliebsame darüber, wenn auch nicht vergessen konnte, so doch in den Hintergrund gerückt empfand. Schraut war übrigens eine klare Intelligenz, fleißig und voller Kenntnisse in seinem Fachberuf, seiner Stellung durchaus gewachsen; aber ohne jenen großen, überschauenden Zug, der den eigentlichen Staatsmann kennzeichnet. Er war ein sehr guter, fleißiger Beamter, der wohl die Aspirationen zum großen Politiker hatte, auch die Eitelkeit, sich als einen solchen zu fühlen, aber es nicht in einem Bruchteil seiner Begabung wirklich war ...
Alles, was nun nach 1901, wo ich mit meinem Mann, der den Abschied nahm, vom Elsaß schied, an den höchsten Stellen der Reichslandverwaltung wirkte, kenne ich, wenn man so sagen kann, nur noch theoretisch, nicht mehr praktisch lebendig. Ich habe die Politik und überhaupt das ganze staatsmännische und soziale Wirken der Herren nicht mehr mit erlebt und aus eigenster Anschauung erkennen können, sondern aus den Betrachtungen und Urteilen anderer erfahren. Deutsche Statthalter waren seit 1908, wo der Abschied des Fürsten Hohenlohe-Langenburg erfolgte, der Graf, spätere Fürst Wedel (1908-1914), und zuletzt bis zum November 1918, wo die Franzosenwirtschaft hereinbrach, Herr von Dallwitz.
Wenn man die Regierung des Landes, das heißt den Geist der verschiedenen Statthalterzeiten charakterisieren wollte, so müßte man die Ära Manteuffel wohl eine Zeit des leidenschaftlichen Aufschwunges, des Willens zur Beglückung des Landes nach den verschiedensten politischen Rezepten nennen. Manteuffel bekundete sein geistiges Wesen als Feldherr und Diplomat, wie er das mit größerem oder minderem Erfolg bei den verschiedenen wichtigen hochpolitischen Missionen immer getan.
Die Ära Hohenlohe-Schillingsfürst war eine ruhigere, zuwartende, in der die Verhältnisse sich zu klareren und gefestigteren Gebilden konsolidierten. Fürst Chlodwig regierte als wägender Staatsmann und wurde von seinem Staatssekretär von Puttkamer erkenntnisvoll, energisch und dabei mild unterstützt.
Es war eine Ära der Einlenkung und der Versöhnlichkeit, wie ich das an anderer Stelle eingehender beschrieb.
Die Ära Hohenlohe-Langenburg (die ich noch sieben Jahre dort erlebt habe), charakterisierte sich als eine Zeit der – Kaiserrepräsentation. Hohenlohe-Langenburg war vor allem grand seigneur, und ein nicht eigentlich zielsicherer Staatsmann. Er überließ die politische Hauptleitung seinem Staatssekretär (bis 1901 von Puttkamer) und – tat wohl damit das Richtige. Dann arbeitete er noch mit Herrn von Köller zusammen. Diese letztere Ära kann man mit Fug eine Zeit des Mißtrauens im Lande nennen.
Eine wachsende Entfremdung zwischen der deutschen Verwaltung und der elsaß-lothringischen Bevölkerung trat ein. Die mindestens eigentümliche Freundschaft des Staatssekretärs mit dem streitbaren Abbé Wetterle wurde überall als mit großen Fragezeichen versehen aufgefaßt. Jedoch Köller sah die politische Entwicklung im Reichsland so optimistisch an, daß er die Aufhebung des Diktaturparagraphen (die Puttkamer und Hohenlohe noch für politisch unentbehrlich hielten) veranlaßte und die wachsenden Gefahren des heimlichen Liebäugelns mit Frankreich und so weiter übersah. Auf Hohenlohe-Langenburg folgte also dann der Graf, spätere Fürst Wedel, ein charaktervoller, liebenswürdiger General-Diplomat. Seine Gemahlin, eine der reichsten schwedischen Erbinnen, Gräfin Hamilton, übte mit dem Fürsten zusammen eine mustergültige Gastfreundschaft in dem vornehmen Palast in der Alten Brandgasse. Ein General-Diplomat sollte meiner bescheidenen Meinung nach die Verkörperung des Ausspruchs von jenem Jesuiten-General Aquaviva sein: Fortiter in re, suaviter in modo – und Wedel war es auch, soviel mir bekannt ist. Als Wedel 1914 in der Folge des Zaberner Falles seinen Abschied nahm, sandte man von Berlin einen Herrn, der bisher hohe und höchste Verwaltungsposten in Norddeutschland bekleidete, den Minister von Dallwitz. Ihm zur Seite waltete als Staatssekretär der Graf von Roedern. Er war ein ungemein fleißiger Staatssekretär, mit einer angeborenen Leidenschaft für Arbeit – und einem sehr regen Pflichtgefühl dafür. Er war äußerst streng in den Anforderungen an sein eigenes Können und Vollbringen, aber auch in denen an die ihm unterstellten Beamten. Er war deshalb mehr gefürchtet als beliebt.
Jener Anlaß zu Wedels Verabschiedung, der sogenannte »Zaberner Fall«, war nun ursprünglich eine unbesonnene Dummejungen-Geschichte, die Taktlosigkeit und Ungehörigkeit eines blutjungen Offiziers in einer militärischen Instruktionsstunde. Das zeigte recht eigentlich, wie gespannt und mit gefährlichen Elementen geladen die »politische« Luft im Elsaß war. Ein Funke, und der heimlich angesammelte Explosionsstoff loderte auf, und – zeigte seine Kraft! – Der Auftakt und der erste Akt dieses Dramas ist wie eine tolle Burleske, das Ende spielt entschieden ins Episch-Gewaltige und -Tragische. Wie die Franzosen und ebenso die französierenden Elsaß-Lothringer immer in der Politik etwas von dem Rhetorischen des Schauspielers und von dem spielerisch Unbesonnenen des Kindes hatten und haben, so waren auch seit Jahren die heimlichen Kundgebungen eines großen Teiles der Bevölkerung von jenem Geist erfüllt.
Jener damals übrigens blutjunge Leutnant Freiherr von Forstner hatte also in der Instruktionsstunde von den Pflichten des Soldaten gesprochen und gesagt, daß die Elsässer überhaupt nichts taugen als Soldaten – und sie seien, wie man es hier zu Lande nenne, alle Wackes. (Das heißt ungefähr so viel als »Gassenjunge, roher Straßenbummler«.) – Dann rief er einen Elsässer Soldaten auf und frug ihn: »Also was bist du?« Er mußte antworten: »Ein Wackes!« Die sämtlichen anderen elsässischen Soldaten mußten dem Beispiel folgen. Dann sagte Forstner noch: »Jedem, der einen Elsässer unschädlich macht, schenke ich zehn Mark«, – »und ich,« bemerkte höchst unbefugterweise ein Unteroffizier, »lege noch drei Mark dazu.«
Wenn das ein Scherz sein sollte, denn man kann doch unmöglich annehmen, daß ein vernünftiger Mensch, wenn auch in einer kleinen, so doch offiziellen Stellung, derlei ungehöriges, törichtes Zeug im Ernst gesprochen haben könnte, so war es ein plumper, höchst unpassender Scherz. Er erregte auch tatsächlich eine große Empörung in Elsässer Kreisen und rührte alle den in den letzten Jahren gesammelten Explosionsstoff gefährlich auf. Der Leutnant wurde nicht nur von der Bevölkerung verfolgt mit Hohn- und Schimpfworten, sondern es wurde ein politischer »Fall« aus diesem Streich gemacht, der in seinen Folgen und Weiterungen einen Konflikt zwischen Militär- und Zivilbehörde hervorrief. Es würde zu weit führen, alle Phasen dieses »Falles« zu erörtern. Es sei hier nur gesagt, daß die militärische Seite (Oberst Reuter war für den Offizier seines Regiments, Freiherrn von Forstner, eingetreten) recht bekam, und daß die inzwischen zu einer Ungeheuerlichkeit angewachsene Angelegenheit im Reichstag verhandelt wurde. Die Verhandlung ergab ein Mißtrauensvotum für den Reichskanzler, Herrn von Bethmann-Hollweg, und hätte beinahe zu seinem Abschied geführt. Er blieb aber, – und nur der Statthalter, Graf Wedel, zog die Konsequenzen der höchst unliebsamen Geschichte und schied aus seiner Stellung »mit völlig weißer Weste«, wie der Abgeordnete Lieber einst von der fleckenlosen Tätigkeit Wissmanns in Afrika gesagt hatte.
Der militärische Machtgedanke war also in nicht begreiflicher Weise gestärkt worden und – Elsaß-Lothringen empfand das und schrieb es in das vermeintliche Schuldbuch der Deutschen. Hier hatte wirklich eine ganz unbedeutende Ursache, die in ihren ersten Keimansätzen hätte vernichtet werden können (zum Beispiel durch die Versetzung des jedenfalls schuldigen Leutnants von Forstner), zu einer politischen, fast schon ins Großhistorische streifenden Wirkung geführt. Denn die rastlos und heimlich gesuchten Verbindungen mit Frankreich wurden nun noch leidenschaftlicher betrieben, weil eben der »Fall Zabern« wirklich ein übles Licht auf die deutsche Herrschaft im Reichsland geworfen hatte. Mit großem Geschick hatten besonders Dr. Bucher, Langel und andere versucht, durch französische Vorlesungen ( conférences), Konzerte, Theatervorstellungen die Kultur Frankreichs den Elsässern näherzurücken.
Mit Raffiniertheit und auch oft mit Geist und Geschmack hatten sie rein künstlerische Fragen durch gewisse Wendungen und Beleuchtungen zu politischen gemacht, und immer so, daß das hellere, günstigere Licht auf französische Art, Wesen und Kultur fiel und das Deutsche nur verkümmert und schattenhaft erschien. Jede festliche Gelegenheit, jeder Ausflug der Elsässer wurde zu einer französisch-patriotischen Kundgebung gewandelt. Man trug die französischen Farben in Kokarden und Bandschleifen, Fahnen und Fähnchen und so weiter –, und sang, wenn man sich unbeobachtet von Deutschen glaubte, französische Lieder, teils sehr feindseligen Inhalts. Kam man dann in die deutsche Hörweite, so wurden leise und in höhnendem Ton deutsch-vaterländische Weisen angestimmt. Das ging schon jahrelang so, – und wurde von der deutschen Verwaltung für harmloses Spiel angesehen. Seitdem der Diktaturparagraph gefallen, war die Auffassung im Lande nicht die würdige, als die sie von den deutschen Behörden gedacht war. Es war nämlich dadurch ein Zustand nicht von wahrer, edler Freiheit geschaffen, sondern der einer Zügellosigkeit für früher unterbrückte Wünsche, die nach Frankreich schielten. So war ungefähr der Boden und die ausgestreute Mißtrauens- und Mißverstehenssaat ein Jahr vor dem Ausbruch des Weltkrieges. Der Kultus der Rache und des Hasses in Frankreich ward wie eine politische Kunst, wie eine historische Wissenschaft gepflegt. Geschichte und Geographie wurden in den Schulen auf Kosten des Rechts und der Wahrheit gefälscht, und den Kindern ward im zarten Alter schon ein völlig verzeichnetes Weltbild gezeigt. Hier hat mir ein Buch als glaubwürdigster Beweis gedient, das 1918 erschien, aber die Erfahrungen eines Pädagogen gibt, die dieser (Professor Dr. Rühlmann) schon von 1910 an in Frankreich machte. Er wurde nämlich damals von der deutschen Regierung nach Frankreich abgeordnet, um die Schulverhältnisse zu studieren. Das war also vier Jahre vor Ausbruch des Weltkrieges ... Alle Lehrgegenstände, die es irgendwie zuließen, politisch, insbesondere chauvinistisch-patriotisch durchdrungen zu werden, wie zum Beispiel Geographie und Geschichte, waren es bis zu einem unangenehmen Übermaß. Dabei waren den Lesebüchern der unteren Klassen Bilder beigegeben, die geradezu den Abscheu vor Deutschland, Mißachtung, Haß- und Rachegefühle nährten. Rühlmann beweist in seinem Buch »Die französische Schule und der Weltkrieg«, daß der »Revanche«-Gedanke in der kindlichen Seele gepflegt und gehegt wird durch die ganze Schulzeit. Und wenn die Kinder aus der Schule ins Leben treten, sei er schon so festgewurzelt in Geist und Herz, daß nichts ihn mehr ausrotten könne. Die beiden hervortretenden Gedanken, die im Geschichtsunterricht dauernd behandelt werden, sind – die Rheingrenze und Elsaß-Lothringen.
»Der Rhein ist die historische Grenze Frankreichs«, ist ein Kardinalsatz der französischen Geschichtsauffassung. Camille Sullian, ein sehr gefeierter Historiker, schreibt in seiner Geschichte von Gallien: »Der Rhein ist der alte Grenzsaum, der natürliche Grenzsaum, die Scheidelinie der Zivilisation, gesichert durch unsere ligurischen, gallischen, römischen, fränkischen Vorfahren, wiederhergestellt durch Karl VII., nach dem Anspruch der modernen Nationen, – wiederhergestellt ohne Unterbrechung durch Könige Frankreichs, – verwirklicht zum erstenmal durch das französische Volk. Er wird wieder erobert werden ein zweites Mal um den Preis gigantischer Opfer durch das französische Volk. Er muß bleiben der ewige Grenzsaum zwischen Frankreich und Germanien.« Hierin ist wohl am konzentriertesten die gesamte Geschichtsauffassung der Franzosen in der Grenzfrage nach Osten niedergelegt.
Moderne französische Historiker wie Erneste Lavisse, Hanotaux, Clémenceau formulierten und predigten diese Fassung auch fortwährend und begründeten sie in vielleicht nicht unglücklicher Art mit der Behauptung, daß der Rhein als natürliche Grenze schon bei den klassischen Römern galt. Nach einer Angabe von Cäsar wird als feststehender Satz angenommen, daß der Rhein die Grenze der römischen Provinz Gallia war. Die Franzosen hielten und halten sich danach für Erben und Nachfolger altrömischer Kaisertradition. Im politischen Testament des Kardinals Richelieu fungiert auch der stolze Satz: »Ich war immer bestrebt, Frankreichs von der Natur bestimmte Grenzen, die Grenzen des alten Galliens, wiederherzustellen ...«
Furchtbar sind die Haßpredigten und die organisierten Aufrufe an die Jugend (Schule) zu Rache und Haß gegen alles Deutsche. Hierin ist Lavisse der empörendste Aufrührer der jugendlichen Nationalleidenschaft.
In der Frage Elsaß-Lothringen ist eine so verwirrende Fülle von Trugschlüssen, Anmaßungen, Lügen und Irrtümern zusammengeworfen, daß es über den Rahmen dieser Blätter weit hinausgreifen würde, sie zu schildern. Tatsächlich behandeln uns die Franzosen, und zwar unwidersprochen und ungestraft, wie unberechtigte Usurpatoren ihres Besitzes, und schreiben uns im eigenen Land ohne Recht und Sinn Gesetze und Lebensbedingungen vor wie blöden Sklaven. Gewiß schreit das zum Himmel, aber findet diese beispiellose Anmaßung denn irgendeinen Widerspruch bei der Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe bei der ganzen Welt unserer Feinde? Diese Worte schreibe ich Ende April 1919, volle fünf Monate nach dem Waffenstillstand, der aber eine neue, ungeheuerliche Form des Krieges ist und sicherlich nichts von Friedenselementen in sich hat, wie er sie doch wohl als Präludium zum Frieden haben sollte. Nur noch eines: Die Franzosen haben immer durch die Tatsache, daß der bekannte General von Bernhardi, ein hervorragender Militärschriftsteller, 1912 ein Werk herausgab: »Deutschland und der nächste Krieg«, gefolgert, daß der Krieg von langer Hand bei uns vorbereitet sei, während doch bei ihnen schon 1905, also neun Jahre vor Kriegsanfang, Delaisi ein Werk veröffentlichte: » La guerre qui vient«. Dies nur als Illustrationsbemerkung.
Es ist nicht etwa eine posthume geschichtliche Erkenntnis von mir, wenn ich ausspreche, daß etwa seit 1901, als die Ära der Versöhnlichkeit endete, der Gambettasche Satz immer drohender erschien: »Immer daran denken, nie davon sprechen!« Im geheimen ward die furchtbare Haß- und Rachepolitik gegenüber Deutschland fortgesetzt. In dem Stück Geschichte, das ich in Elsaß-Lothringen mit erlebt habe, von 1871 bis 1901, habe ich selbst in den deutsch-versöhnlichsten Zeiten immer jenen verhängnisvollen Satz transparent gesehen: »Immer daran denken, nie davon sprechen!« Das heißt: Das große Haßfeuer heimlich schüren, bis es zu einer furchtbaren Tat auflodert ... Ich habe in der langen Zeit, die ich im Elsaß lebte, zu tiefe Einsicht gehabt in die ungeheure Haßkraft und die wirklich wahnsinnige nationale Eitelkeit der Franzosen, um nicht überzeugt zu sein, daß sie unsere gefährlichsten Feinde waren, sind und sein werden!
Ja, jener Gambettasche Satz war wohl im geheimen lebendig, – dennoch aber war die Ära Hohenlohe-Schillingsfürst eine Zeit der Versöhnlichkeit, ja des gegenseitigen Entgegenkommens. Auch in der Kunst brachte die Annäherung der deutschen Elemente zu den altelsässischen manche wertvolle Entwicklung, die von den kunstliebenden Deutschen aufs innigste gepflegt wurde. Elsässische Maler-, Bildner-, dichterische und musikalische Talente wurden in jeder möglichen Art gehoben und gefördert. Es traten nun in Erscheinung künstlerische Vereinigungen, Ausstellungen, dramatische Vorstellungen, Zeitschriften, Illustrationswerke. Für die bildende Kunst ward die »Elsässische Rundschau«, die später ein mannigfach wechselndes Schicksal hatte, bedeutungsvoll. Sie wurde begründet von C. Spindler und Joseph Sattler. Der erstere ist ein Deutsch-Elsässer, – der andere ein schon ganz jung berühmt gewordener Bayer. Joseph Sattler hat seinen Ruf als Exlibris-Zeichner erworben. Er war durchaus, von Anbeginn seiner Laufbahn an, ganz eigenartig und eigentlich ganz außerhalb der zeitgenössischen Strömungen stehend. Dürersche und Holbeinsche Linienführung und vieles von der strengen Geistigkeit und der herben Charakteristik dieser Meister eignet ihm, als stände er in andern Jahrhunderten mit seinem Auffassen und Schaffen. Der erste Jahrgang der »Elsässischen Rundschau« ist im wesentlichen nur von Spindler und Sattler gezeichnet, bringt viele und höchst interessante Bilder und ganz wenig Text. Nur ab und zu eine elsässische Dialektdichtung von Stoskopf und so weiter; ganz von dem behäbigen, glücklich gesunden Humor des elsässischen Volkswesens durchdrungen.
Spindler, eine prächtige Inkarnation des Idealtypus eines elsässischen Künstlers, lebt in St. Leonhard, am Fuß des Odilienberges; der ist der wundervolle ernste und doch so holde Hintergrund. Von seiner schönsten Sage »Die heilige Odilia« hat Spindler ein herrliches Blatt in der »Elsässischen Rundschau« geschaffen. Das reiche Land, das in den warmen Jahreszeiten fast immer nach Weinblüte und reifendem Korn duftet, ruht wie ein Gottesfrieden im Arm der Berge, und ist doch der Erisapfel der Politik – fast der Weltpolitik; denn Frankreich hat ja eine ganze Welt aufgerufen, um uns das Vogesenland zu entreißen.
Spindler hatte sich damals eine ganz eigenartige Klause geschaffen. Mit einfachen Mitteln waren große Wirkungen im Dekorativen seiner Werkstatt erreicht. Der hohe Raum, in den man eintrat, und der ihm Wohn-, Arbeits- und Empfangsraum darstellte, war eine alte verlassene Kapelle mit Spitzbogenfenstern. Durch Vorhänge, Raffungen von schweren Stoffen und durch eigenartige Möbelstücke, die wohl aus uralten Bauernhäusern stammten, waren ganz verschiedene Räume innerhalb des hohen, weiten Kapellenraumes geschaffen. Spindler pflegt eine ganz seltene Kunst, die in dieser Art und Vollendung wohl noch nie da war. Ich habe sie weiter oben eingehender beschrieben. In bunter Pracht oder in vornehm-blasser Ruhe, in starren und dann wieder in weichen Linien wirken seine Intarsiabilder. Für die Weltausstellung in Paris und die spätere in St. Louis in Amerika hatte er von der deutschen Regierung den Auftrag, je ein Musikzimmer und ein Zimmer mit Szenen der Nibelungenlegende zu gestalten.
Welch hohen Kunstwert Spindlers Werke haben, ist wohl auch ersichtlich dadurch, daß die einzelnen Stücke aus den betreffenden Räumen an verschiedene große Museen zu sehr hohen Preisen verkauft wurden. So an das Kensington-Museum in London, an das Nationalmuseum in Berlin, an ein Museum in Paris! und so weiter.
Spindler und Sattler hatten schon sehr früh, als sie noch unbekannte Künstler waren, in Monsieur Laugel in St. Leonhard einen kunstsinnigen Beschützer und Mäcenas. In dankbarer Erinnerung hatten die beiden jungen Künstler die Wände der Eintrittshalle von Laugels reizender Villa mit Fresken geschmückt; die Geschichte des Königs Dagobert! Der Pinsel schuf hier in großen Zügen ergötzliche, lebensprühende Bilder. Wir waren damals bei Laugel in seiner Villa zum Tee, und ich hatte den Eindruck, als ob er die Kunst als über den Nationen und über jeder Politik stehend verehrte, liebte und förderte. Wie war es dennoch so anders! Er hatte ja schon jahrelang insgeheim Verrat geübt!
Indessen wuchs die Bedeutung der »Elsässischen Rundschau« zu einer Kunstzeitschrift, welche die gesamte elsässische Kunst widerspiegelte, und deren Mitarbeiterkreis sich immer mehr erweiterte. Der Text wurde umfangreicher gegenüber den bildlichen Darstellungen, und die »Rundschau« ward nun zweisprachig. Neben Artikeln, die von einem Deutschen in deutscher Sprache geschrieben waren, und welche die elsässisch-deutsche Entwicklung befürworteten, nahmen französische Abhandlungen einen zuerst bescheidenen, dann immer anspruchsvoller wachsenden Raum ein. Man flocht höchst geschickt Politisches in künstlerische Betrachtungen. Das war wie eine neue Epoche im elsässischen Kunstleben: eine immer deutlicher sich markierende Abkehr vom deutschen Wesen und eine stärkere Wendung zum französischen. Der nachmals als rege und leidenschaftlich für Frankreich wirkende Dr. Bucher (ein deutscher Name), der sich längst in Buchér französiert hatte, schrieb nun ohne die geringste Maskierung ganz für die französische Kunst begeisterte Artikel in der »Rundschau«, die, soviel ich weiß, nun einen französischen Namen führte. Für Frankreichs Interessen, das heißt für seine wilde Rachepolitik, hatte Dr. Bucher jahrelang insgeheim gewirkt. Es sind darüber authentische, nicht widersprochene Dokumente vorhanden: Briefe, Artikel und so weiter, welche in einer Broschüre über den – merkwürdigen elsässischen Herrn veröffentlicht sind. – – Der »Salon«, als Vereinigungspunkt der verschiedenen gesellschaftlichen und nationalen Strömungen des reichsländischen Kulturlebens hätte gerade unter diesen ganz eigenartigen Bedingungen eine große Bedeutung haben müssen. Es war nun neben den mehr offiziellen Empfangsorten (beim Statthalter und beim Staatssekretär) hin und wieder ein »Salon« von Bedeutung für das geistige Leben des Neulandes aufgelebt. In den ersten Jahren der Manteuffel-Zeit wäre wohl der Salon des Geheimen Rats Professor Geffcken zu nennen gewesen, dessen Gemahlin, eine geistig sehr feine und vornehme Frau, eine Tochter des hervorragenden Dichters Immermann war; doch war dieser Salon etwas zu akademisch orientiert und norddeutsch und hatte wenig Verbindung mit Elsässern.
Ich erinnere mich aber noch ganz besonders gern eines Salons in Straßburg, der mit Anmut, Geist, Taktgefühl und Liebenswürdigkeit geführt wurde. Es war der »Salon« von Frau Ida Bodenheimer. Ihr Mann, ein Schweizer gleich ihr, hatte die Schriftleitung des »Elsässer Journals«, das damals zweisprachig erschien und durchaus versöhnlichen und entgegenkommenden Wesens war. Ida Bodenheimer, eine Frau von hoher Begabung auf vielen geistigen Gebieten, wirkte weithin vermittelnd. Sie war die Tochter eines deutschschweizerischen Professors in Bern. Sie war (eine Seltenheit bei Frauen) von durchaus objektiver Auffassung für völkische Fragen, in der Politik und überhaupt in allen Lebens- und Geistesbetätigungen. Sie war der Idealtypus eines verfeinerten Semitentums, das durch die Weltbildung aller Kulturnationen geläutert war. Dazu war sie von warmer, warmer Herzensgüte, von bestem Taktgefühl, – und war eine sehr hübsche, gewandte und elegante Frau. Damals stand sie lachend auf den Höhen einer durch eigenes Verdienst gewonnenen Stellung. Sie hat dann im Jahre 1894, nach einer tragischen Verkettung ihrer Lebensverhältnisse, ein jähes Ende gefunden. Das heißt: sie hat dies Ende in Verzweiflung selbst hervorgerufen.
Ich habe sie sehr liebgehabt und sie nie vergessen können. Sie ist wohl das Opfer eines überfeinerten Ehrgefühls geworden – denn ihr ist das Leben aus Schmerz über eine Schuld ihres Mannes unerträglich demütigend erschienen. – – – Und sie war doch selbst so schuldlos und eine so vornehme Natur! Als sie noch lebte und lachte, war sie hinreißend und hat viel unsicher schwankende Geister auf ihr Gebiet politischer Klarheit und Gerechtigkeit geleitet. Sie war für jene Epoche (bis 1894) von sozialer und dadurch auch von politischer Bedeutung.
Salons, die vermittelnd zwischen Elsässern und Deutschen wirkten, wüßte ich, außer meinem eigenen, kaum einen bedeutenden zu nennen. Denn die Salons der Sengenwalds (Laure und Elisabeth) und der von Madame Weber-Schlumberger waren doch mehr leichter geselliger Natur. Es verdient erwähnt zu werden, daß damals Paderewski, der jetzige Diktator und Präsident von Polen, der mitberatend an dem Haß- und Rachetisch von Versailles sitzt, in Straßburg am Konservatorium als Pianist und Klavierlehrmeister angestellt war. Er bezeigte damals schon eine sehr elsässisch-französische Hinneigung und verkehrte demgemäß weniger in reindeutschen Salons. Er stellte ungefähr das Gegenteil des Begriffs »männlich« dar. Mit seiner rötlichen Haarmähne, seinen feinen weißen Händen und seinen Albinozügen machte er einen etwas verschwommen-schwärmerischen, hysterischen, nervösen, femininen Eindruck. Er huldigte übrigens auch dem Mesmerismus und Mystizismus. Sein Spiel war wunderbar, von vibrierender Erregung, nervös und geistreich. Und obgleich mein Haus doch sehr musikalisch war, bin ich nie in näheren Verkehr mit ihm gekommen; ich war ihm wohl zu ausgesprochen deutsch ... Ihn an der Spitze einer Nation mit heldenhafter Geste (sie gebärdet sich freilich mehr heldenhaft, als sie es ist) zu denken, entbehrt nicht einer komischen Note.
Straßburg war damals schon eine so große Stadt und die einzelnen Kreise (Professoren, Militär, Verwaltungs- und Justizbeamte, Kaufleute, Künstler) so groß, daß sie in sich verkehrten und sich wenig mit anderen Sphären mischten. Das akzentuierte sich später immer mehr: man lebte nebeneinander hin, aber nicht mehr miteinander. Die geheimen unterirdischen Verbindungen mit Frankreich wurden immer lebenspulsierender.
Hohenlohe-(Schillingsfürst) ging damals, im Herbst 1894, recht ungern von Straßburg fort. Eine gewisse Oberschicht von friedlicher Versöhnlichkeit, die ziemlich stark war, hielt die heimlich wühlenden Elemente gebändigt. Man anerkannte in Elsaß-Lothringen auch das ehrliche Entgegenkommen der deutschen Beamten und Offiziere. Es war also immer noch ein breiter, vornehmer Raum zur friedlichen Entfaltung. Was aber an der Pflanze deutsche Kultur oft recht erfreuliche Blüten trieb, ward gefährdet durch die in den Niederungen brauenden, giftigen Dünste.
Es fallen für mich übrigens in jene Zeit interessante Begegnungen und Begebenheiten. – Eine fruchtbare und sehr eigenartige Freundschaft mit Pascal David, dem Hauptleiter (Chefredakteur) der »Straßburger Post«, war eine Goldgrube für uns beide. Ich glaube, daß unser geistiges Wesen sich sehr glücklich ergänzte. Die »Straßburger Post« zeichnete sich damals durch klarste Sachlichkeit aus und stand hoch über Parteizwisten und persönlich gefärbten Tendenzen. David, aus einer alten katholischen Familie vom Rhein, war ein kosmopolitischer Kopf. Er kannte fast alle Weltteile, einige mit tiefer Erkenntnis und Schätzung, wie zum Beispiel Amerika, von dem er Großes für die Weltkultur erhoffte. (Die Gegenwart scheint ihm recht zu geben.) Er hatte lange in der Türkei, in Konstantinopel, gelebt, und seine erste literarische Betätigung entstammt den Anregungen der orientalischen Eindrücke. Er sandte seine Aufsätze an die »Kölnische Zeitung«, die durch die glänzend geschriebenen Schilderungen des dortigen Lebens auf ihn aufmerksam wurde und ihn später in die journalistische Laufbahn führte. Die Zeitung war ja die Mutterzeitung der »Straßburger Post«, zu deren Hauptleiter sie David machte. Der eigentliche Beruf desselben war das Postwesen, in welchem er auch in Konstantinopel beschäftigt war. Eine Griechin hatte er sich zur Frau gewählt, die er dann nach Deutschland mitbrachte; in seinem Hause wurde Neugriechisch gesprochen.
Er war nach der Seite des Gemüts hin ebenso hervorvorragend begabt als nach der rein geistigen, – dabei von harmonischer humanistischer Bildung. Und – er war fast unglaublich bescheiden und erinnerte darin an meinen Gatten. Er stellte wohl den reinsten Typus des Altruisten dar, der mir je im Leben nahegekommen ist. Das kleine, bücherüberladene Hinterzimmer in der Thomannsgasse, wo er seine ausgezeichneten Artikel schrieb, war zu gewissen Stunden täglich allen geöffnet, die in ihren lebenswichtigen Angelegenheiten Rat und erlösende Tat bei ihm suchten. Und er machte dann das Schicksal jedes einzelnen wie zu seinem eigenen und hat vielen, ich glaube außerordentlich vielen, geholfen und sie ins Klare gerettet. Wie oft bin ich, als ich noch im »Schlößchen« am Kleberstaden in Straßburg lebte, in der Dämmerung zu ihm gehuscht, die Begleitung lästiger Bedienten hinter mir lassend, – und – was für köstliche Stunden haben wir dann erlebt!
Keiner, außer der eigensten engsten Familie, hat zum Beispiel so tief wie er gelitten unter dem Abschied meines Mannes von dem Lande, dem dieser doch die Blüte seiner geistigen und überhaupt seelischen Kraft gegeben hatte!
David hat das laut und kräftig bekannt, in einer Zeit sogar, unter Köllers Regierung, als es ihm nur schaden konnte – und es sind ja auch gewaltige Hetzen auf ihn inszeniert worden (von Exzellenz von Schraut), die aber von der »Kölnischen Zeitung« erkannt und kräftig in ihre unlauteren Grenzen zurückgewiesen wurden.
Pascal David hat meinen Mann, der 1906 starb, um einige Jahre überlebt, – und mit ihm ist einer meiner selbstlosesten Freunde dahingesunken ...
Ich komme jetzt zu einem Kapitel, das von bedeutendem psychischen Wert ist, und viel von der Geschichte der Entwicklung meiner Individualität enthält. Ich würde es gern bis in alle Tiefen und Breiten behandeln, aber ich werde, nachdem ich es gründlich erwogen, doch im ganzen und großen davon abstehen. Es ist das Kapitel der Freundschaften mit den Unterkapiteln von lyrischen und Brieffreundschaften. Jene Freundschaften durchziehen wie ein feines goldenes Arabeskengewebe alle Zeit meines Lebens. Viel Schönheit, viel Erquickung, viel geistige Freuden, Erhebung und inneres Blühen ist mir dadurch geworden, – und viel – habe – ich auch geben können. Aber da dieses Buch für die Öffentlichkeit bestimmt ist, so erscheint es mir richtiger, nur Persönlichkeiten zu schildern, die auch von öffentlichem, allgemeinem Interesse sind. – – – Ich habe die bestimmte Erkenntnis aus dem Leben gewonnen, daß Männer ein größeres Talent zur Freundschaft haben als Frauen. Zur Freundschaft, wie ich sie auffasse, gehört eine gewisse Großzügigkeit, die zweifellos dem männlichen Geschlecht mehr eignet als dem weiblichen.
Die Freundschaft zwischen Mann und Weib, von der ich rede, ist meinem Empfinden nach besonders reizvoll, denn bei der Verschiedenheit, ja oft Gegensätzlichkeit der beiden Psychen ergeben sich ganz naturgemäß bei näheren seelischen Berührungen interessantere Anziehungen, stärkere Reize und feinere Anregungen. Es gibt Freundschaften zwischen Mann und Weib, welche die zartesten Elemente der Liebe in sich schließen, und die ich »lyrische Freundschaften« nennen möchte. Sie sind wohl ebenso lebensheiß wie die Liebe, und sie haben auch das große Moment der Sehnsucht in sich. Man könnte sagen, solche Freundschaft sei die heiligere Empfindung, im Vergleich mit der Liebe, welche »die begehrende Leidenschaft« schlechthin genannt werden kann. Eine solche »lyrische Freundschaft« verband mich mit dem bekannten Dichter Prinzen Emil Carolath. Ich habe das weiter oben, von Kolmar und meinem Aufenthalt dort redend, eingehend geschildert. Ich nenne also in diesen Blättern nur solche Freunde (und teilweise habe ich sie schon genannt), welche auch für die Allgemeinheit von Interesse sind. In meiner Seele aber sind alle Erinnerungen bewahrt, an alle, die je Sympathie für mich hatten, und denen ich Sympathie entgegenbrachte; – denn ich bin eindrucksfähig und sehr dankbar. Ich danke allen für die hellen und reichen Stunden, die sie mir bereiteten, und werde sie all meine Lebenstage nicht vergessen – – nie! – – Und wenn sie auch als namenlose Schatten durch diese Blätter wandeln, so haben sie doch geheimes Leben. Denn alles Reiche und Schöne, das uns gegeben wird, wirkt und webt an unserem geistigen Wesen, – und – was wir gegen das Ende unsres Lebens sind, entstammt tausend Anregungen und vielem Erkennen und Schürfen in goldnen Weisheitsschächten, ebenso wie liebreichen Begegnungen, Herzensanziehungen, Neigungen, Sehnsucht, Liebe, Heimweh nach Höchstem und kaum Erreichbarem – – Alles zusammen, das lebendige Leben, das modelt uns. Das wird unser edler Meister, wenn wir stark sind, – und unser Sklavenhalter mit der Peitsche der Reue, wenn wir schwach oder lässig sind ...
Das »Schlößchen« am Kleberstaden in Straßburg war immer wie von einem Kranz ritterlicher Freunde umgeben, – aus denen, wie verschieden sie auch von Geist und Erscheinung waren, ich nicht ein Zweiglein missen möchte, denn sie haben alle Reiz und Duft und Farbe in das Leben von damals gebracht. Diese Freunde waren meist hohe Intelligenzen, hatten feine Kultur des Geistes und Bildung des Herzens und waren auch anziehende Erscheinungen, die dekorativ und inhaltlich sehr freundlich wirkten.
Ein eigenartiges Element war der sporadisch auftauchende Österreicher Graf Sternberg. Er war der echte Typus eines Wiener Aristokraten. Leichtlebig und »ein rechter Vagant und Schuldenmacher«, wie er sich selbst nannte, war er wenig gebildet, eigentlich, in »den Anfangsgründen steckengeblieben«, aber von ragender Intelligenz und starkem Charakter. Er ist später in Österreich zu einer gewissen Berühmtheit gekommen durch sein eigenartiges Hervortreten im parlamentarischen Leben und sein etwas gewalttätiges, streitbares Wesen. Er war der Regierung, dem Hof und der höchsten Gesellschaft oft höchst unbequem durch seine brutalen Offenherzigkeiten, die er gern in parlamentarische Verhandlungen hinüberspielte. Der alte Kaiser Franz Joseph hat ihn am Ende bewogen, vom parlamentarischen Leben sich endgültig zurückzuziehen, und – zahlte ihm dafür seine Schulden.
Ich möchte auch hier noch des sehr interessanten Unterkapitels der »Brieffreundschaften« gedenken, die mir viel Lebenswerte zugeführt haben; trotzdem es bei den meisten gar nicht zu einer persönlichen Begegnung kam oder zu nur ganz wenigen. Doch diese paar Male entwickelten, eine so starke Leuchtkraft, daß sie dazwischenliegende Trennungszeiten köstlich durchschimmerten.
Freilich, es haftet diesen Gefühlen, und wenn sie auch auf tiefem Verstehen beruhen, immer etwas Abstraktes an. Sie haben nicht die einzig schöne Sonnenwärme des lebendig Persönlichen. Unter den mir so Befreundeten sind besonders zu nennen: Dr. Hans Müller, der Verfasser des berühmten Dramas »Könige«, eines der größten Dichtertalente Österreichs, dessen Prosa, mehr noch als seine Verse es sind, wundervoll glühend und tief ist. Ein Geistreicher und Herzensgewaltiger ist er, der die Seelen im Fluge nimmt. Dann Dr. Stefan Zweig, vielleicht noch feiner und tiefer als sein Freund Hans Müller, aber nicht so hinreißend wie er. Ich möchte sie so charakterisieren: Zweig ist der größere Künstler, Müller der größere Dichter. Dann Dr. Ernst Friedländer in Weimar, der Fortsetzer und Bearbeiter der Leixnerschen Literaturgeschichte, wohl eine der reinsten Idealgestalten, die ich in der Literatur fand. Er ist – blind, und sein ganzes Erkennen und großes Schauen ist nun der Welt des Geistes zugewandt, in der er ein Starker und Reicher ist. Wenn unsere Naturen sich begegnen, ist immer ein schönes Zusammenklingen darin. Michael Georg Conrad, der Münchener »starke Mann« der Literatur, ist für mich einer der Immernahen, auch ohne das Verbindende der Briefe oder der persönlichen Begegnung. Er ist der jünglinghaft Begeisterte, nie Alternde. Seine Jahre sind alt, aber er kann stark und froh von sich sagen: »Wir Jungen, wir Lachenden, wir Ewigen!«
Auch Ewald Silvester und Wilhelm Dreecken gehören zu jenen Freunden; Silvester ein junger Feuerkopf, ein Himmelsstürmer, Dreecken eine nach jeder Richtung hin vornehme Natur, von erlesenem Geschmack und hohen, schön disziplinierten Geistesgaben. Er steht in meiner Schätzung und Sympathie sehr hoch ...
Und toter »Brieffreunde« möchte ich auch gedenken, insoweit ich es nicht schon getan habe. An anderer Stelle habe ich Leo Berg, Liliencron, Lindau, Bodenstedt, Jensen betrachtende Gedanken gewidmet und mochte jetzt noch eines »Brieffreundes« gedenken, der durch sein tragisches Schicksal und seinen frühen Tod mir besonders vor den anderen emporgehoben erscheint. Es ist Wilhelm Holzamer, ein ebenso bedeutender Dichter wie Kritiker, der in weiteren Literaturkreisen noch immer nicht so hoch gewertet ist, als er es verdient. – Sein Leben stand unter der Herrschaft des Gegensatzes von Schicksal und Begabung. Und da es nicht ganz zum Sieg der einen oder der anderen Macht kam, – denn beide waren ehern stark, so war sein ganzes Leben ein tragisches Kämpfen. In viel höherem Grade, als es überhaupt das Menschenleben ist. Jene beiden standen sich eben zu scharf verschieden gegenüber.
In Wilhelm Holzamer, wie er als Mensch und Künstler sich bekundete, lag eine starke, ehrliche und lachende Lebensbejahung. Ein Ausdruck, der (charakteristisch genug) von einem Bergvolk stammt, und der es wert wäre, in die geläuterte Kunstsprache übernommen zu werden, ist wie für Holzamer gesprochen: »Lebfrisch!« Er war eine Höhen- und Überwindernatur. Mit seiner gesunden, aufrechten, »lebfrischen« Männlichkeit, mit diesem leuchtenden Blick, der für reine Freude geschaffen schien, konnte man sich ihn tatsächlich und sinnbildlich nur als Wanderer auf frischwindigen Höhen denken. Die Höhe mit all ihren Herbheiten und Schroffen, aber auch mit ihren klarweiten Ausblicken zu Himmel und Tal, mit ihrer Entrückung vom Herdentreiben, mit ihren in der Stille verfeinert empfundenen Klängen und Düften, für die war er geboren. Schwungkraft und Gesang waren in ihm, und die streben immer zu Gipfeln ... Aber das Schicksal griff ihn immer wieder mit argen Krallen und riß ihn in die Niederungen. So kamen Wehmut, Zweifel und Gedrücktheit in seinen Aufflug. Sein Lachen ward ein Lächeln, manchmal ein recht wehes, wohl auch bitteres, und in die frischen Gesten seiner Regsamkeit kam Gedämpftheit, gelassene Betrachtung und Resignation, die ihm oft nicht die Kraft zum Meistern der Verhältnisse ließen, vielmehr ward er manchmal von den Gewalten außer ihm gemeistert.
Wie er als Mensch in seinem wirklichen plastischen Lebensgefüge stand, davon weiß ich nur wenig, denn ich habe ihn nur losgelöst Von seiner Umwelt in meinem Heim gesehen. Sein Schicksal, das die grausame, tragische Maske trug, kenne ich in seinen tatsächlichen Umrissen, in seinem Werden und Wachsen aus Holzamers freiwilligen Bekenntnissen. Vor Jahren, als die »Gesellschaft« in München noch unter M. G. Conrads lebensstarker Führung ein Spielraum für jüngere, aufstrebende Talente war, erhielt ich von einem mir damals ganz unbekannten Schriftsteller W. Holzamer aus Heppenheim an der Bergstraße einen Brief. Es war eine Bitte: zu einer größeren Studie über mich ihm einiges Material zu senden und ihm eine persönliche Begegnung zu gestatten. Das erstere gewährte ich gern, – das zweite – nicht, denn ich hatte und habe den Stolz, solche kritischen Kundgebungen wenn irgend möglichst unbeeinflußt durch persönliche Eindrücke, ganz objektiv gegeben zu wünschen. Holzamer willfahrte mir. Er schrieb dann eine sehr schöne Studie, die meines innersten Wesens Kern aus den Dichtungen frei löste und erkannte. Holzamers ungewöhnlich divinatorische Gabe für psychologische Erkenntnis, die auch seinen dichterischen Schöpfungen so vornehme und zarte Noten gibt, feierte in seinem Essay einen Sieg ... Von jener Zeit an begann ein regsamer Austausch von Gedanken zwischen uns. Zum erstenmal begegnet bin ich ihm aber erst, als er mich im Sommer 1905 hier in Baden-Baden in meinem Heim aufsuchte. Durch den reichen Reiz des Persönlichen, der wohl bei beiden stark wirksam war, wurden die geistigen Beziehungen natürlich noch vertieft. Ich hatte damals nur außer kritischen und essayistischen Arbeiten wenig von Holzamer gelesen. Hier und da eine Dichtung, dann »Die Spiele«, »Der arme Lucas« und »Carnesie Colonna«. – »Peter Nockler« hatte ich zufällig noch nicht gelesen. Ein mir unvergeßliches Gespräch entspann sich darüber. Da es wohl von allgemeinem literarischen Interesse ist, geb' ich's in seinen Grundzügen wieder. Ich hatte einige Zeit vorher für den »Tag« eine größere Studie über Hermann Hesses »Peter Camenzind« geschrieben. Unser Gespräch entwickelte sich ungefähr so:
Holzamer: »Sie haben eine so ungewöhnlich feine und schöne Kritik über ›Peter Camenzind‹ geschrieben. Wer doch so glücklich wie Hesse wäre, einmal eine solche, von lichtem Verständnis glänzende Studie von Ihnen über ein Werk zu haben«, (und nach einer Pause): »Kennen Sie ›Peter Nockler‹?«
Ich: »Leider noch nicht. Ist Ihnen dies Werk besonders lieb?«
Holzamer: »Ich habe die vielleicht anmaßende Empfindung, als könne sich ›Peter Nockler‹ mit dem berühmten ›Camenzind‹ messen und ihn vielleicht gerade um die Augenhöhe überragen – – – um die Augenhöhe«, – sagte er damals etwas leiser – »sein Blick kommt wohl von etwas höher her«.
Ich: »So ist es wohl einer von den widrigen Zufällen, die fast wie tragisches Geschick wirken, daß ich Ihr Buch nicht kannte und deshalb die Größen nicht messen konnte?«
Holzamer: »Überhaupt, glauben Sie an Hesses schöpferische Kraft?«
Ich: »Ja!, nach solchen Beweisen. Seine früheren Bücher, besonders ›Eine Stunde hinter Mitternacht‹ und die ›Dichtungen‹ sind mehr Schöpfungen aus geistreichen Träumen. ›Camenzind‹ ist rinnendes Leben.«
Holzamer: »Weil es ein Ichroman ist. Hesse wird niemals anders können, als die Erfahrungen seines Lebens abschreiben, und da sich sein Leben in engen Grenzen abspielt und ihm der Ereignisse Strom wenig nahe kommt in seiner Bodensee-Einsamkeit, so werden seine späteren Bücher nur Varianten des ersten sein. Denken Sie an dies Urteil – später – ob es nicht recht behalten wird.« – – Und Holzamer hat recht behalten. Hesse hat kein so starkes Buch wieder geschrieben. Alles später Geschriebene wirkte wie – Schattierungen vom ersten. Nur wo er, zum Beispiel im »Knulp«, offenbar auf eigene Erlebnisse zurückgriff, steigt er wieder zur »Camenzind«-Höhe ...
Aber Holzamer hat auch recht behalten mit dem heimlich anklingenden Vorwurf für mich. Ich las dann »Peter Nockler« und erkannte es als ein wundervolles, echtes Lebensbuch, das einen Wert über die Mode hinaus, über die Gegenwart hinaus hat, und das sich immer siegender in der Literatur und im Publikum behaupten wird.
Man hat Holzamer vor allem einen lyrischen Künstler genannt. Ich würde der gegenteiligen Meinung sein und ihn mehr ein episch-dramatisches Talent nennen. Aber warum überhaupt ihn einreihen in Schulbegriffe? Ich meine, das ganze Schulwesen in der Literaturgeschichte, dies Rubrizieren in Klassiker, Romantiker, Naturalisten, Neuklassiker, Neuromantiker, Epigonen und so weiter hat wenig Sinn. Höchstens für die Mittelmäßigen, die Anlehner, die Abhängigen, die nicht Eigenständigen.
Jedes aufrechte, stamm- und wurzelstarke Talent, das auf Eigenboden steht, gibt zuviel Selbstgewachsenes, als daß es Raum für fremde Art hätte. Alle Geistigkeit und alles Talent ist in fortwährender Gegenseitigkeitsberührung und -wirkung mit anderen. Es ist nur natürlich, sich von anziehenden Geistern und Meistern beeinflussen zu lassen. Wilhelm Holzamer war ein starker, urwüchsiger Geist, der aber auch die zartesten Feinheiten aus der Seele der Dinge und Menschen hörte und erschaute.
Alles echte Künstlertum besteht ja zum guten Teil in solchem Erschauen der Linien über den Wirklichkeitslinien, – in einem Erhorchen von Tönen, die nicht in der allen bekannten hörbaren Tonskala liegen, – in einem mit beseelten Sinnen Erfassen alles Lebendigen. Schon die Sprache in Holzamers Prosa- und Poesiewerken bezeichnet ihn vielmehr als episch-dramatisches Talent.
Holzamers Sprache ist knapp, bewegt, in ganz kurzen Sätzen vorwärts dringend, keck, im Kern den Gedanken und das Geschehnis packend. Ich glaube, daß diese Art eine absichtliche Technik darstellt, denn (und das ist doch wohl scharf beweisend) in seinen Briefen hat er sie nicht. Ich möchte das mit ein paar Beispielen aus seinen Briefen beweisen:
»11.März 1905.
Ich habe die Kritik immer als ein rechtes Hindernis empfunden. Eine Stunde des Schaffens ist doch mehr als Jahre dieser verlorenen, fruchtlosen kritischen Arbeit, die man nur deshalb immer wieder tut, weil man doch an ihre Fruchtbarkeit im Momente glaubt, um dann immer wieder enttäuscht zu werden. Selten geschieht's aus Freude. Ich darf mich jetzt aber auf eine Freude richten, wenn Ihre Bücher ankommen. Ich muß und will Ihrem Genius so ganz und voll gerecht werden. Aber alles, was ein Kritiker auch sagen mag, es bleibt doch hinter dem zurück, was ein Dichter zu sagen hatte, und man fühlt dem Dichter gegenüber meist nur zu deutlich seine eigene Unzulänglichkeit.«
Oder in einem andern Brief:
»11. Juni 1906.
Soll ich's wiederholen, daß ich viel an die schonen, genußvollen Stunden gedacht habe und viel an Sie denke, – in ihrem gedanklichen Inhalt, in ihren auslösenden Gefühlen, in dem schönen Rahmen Ihres herrlichen Heimes und der Fülle der Junipracht, der Schönheit Badens, das sich wie ein kostbarer Garten dehnt? Sagen Sie, was Sie wollen (ich war damals sehr schmerzlich befangen in einer schweren Leidenszeit durch die Krankheit und den Tod meines Mannes), Sie sind zu beneiden. Das Leben hat Ihnen in all seinen Möglichkeiten soviel gegeben – – es mußte Ihnen auch einmal nehmen. Und wie Sie sind und wie es Sie fand, war dieses Nehmen nicht auch ein Geben? Es ist doch alles nur, daß wir das Leben überwinden und zu uns selbst kommen; zu unserem Wesentlichen, das wir in jedem Glück und Leid anders erkennen und neu entdecken, um es nur tiefer zu erfassen und zu erweitern und zur Ganzheit zu runden ...«
»Die Spiele«, die übrigens ja einem besonderen Zweck und einer besonderen Persönlichkeit (dem Großherzog von Hessen für die »Spiele« in Darmstadt 1901) gewidmet sind, fallen etwas aus der Eigenart unseres Dichters. Wenn man sie liest, ohne den Verfassernamen zu kennen, würde man sie Maeterlinck oder einem seiner Jünger zuschreiben. Sie stehen in unseres Dichters starkem, eigenartigem, lebensplastischem Schaffen wie eine mystische Künstlerlaune ... Die Lyrik Holzamers erscheint mir nicht von so hohem Wert wie seine erzählenden Werke. Die Form ist auch nicht immer ganz klar, sondern zeigt zackige, etwas verschwommene Linien. Stärke des Gedankens, köstliche Bildnerkraft, subtile Feinfühligkeit im Seelenerkennen und Innigkeit der Empfindung sind Holzamer eigen. Kraft dieser Gaben hat er auch so meisterlich in das Schaffen anderer sich hinüberleben und es beurteilen können. Die Monographien über Heine und C. F. Meyer sind solche Meisterstücke der seelischen künstlerischen Erkenntnis. Er trat gleichsam mit dem Willen zur Bejahung des Guten an die Beurteilung literarischer Werke und künstlerischer Erscheinungen und hatte eine edle Freude an anderer Können. Seine Kritik hatte, wenn ich so sagen darf, etwas Affirmatives-Konstruktives im Vergleich zu der meist scharfen Negation vieler anderen, die manchmal just darin ihre geistige Überlegenheit zeigen – möchten.
Mit »Ellida Solstratten«, die Holzamer besonders liebte, bin ich nicht in ein nahes Verhältnis gekommen; diese Schöpfung ist mir fern und fremd geblieben. Das war Holzamer sehr leid. Ich zitiere eine Briefstelle hierüber: »Sie sind mit der ›Ellida‹ nicht eins geworden. Vielleicht werden Sie es noch (ich ward es nie). Und werden Sie es nicht, so muß es wohl an mir liegen, – an dieser Flucht in die Abstraktion aus naher Wirklichkeit. Und doch kann ich kaum besser schreiben und stilistisch pflegen, als ich hier getan ... Mir stand dies Buch als Notwendigkeit am Wege ...«
Und von seinem schattenvollen Leben sagt er einmal in einem Brief: »Ich habe Schicksal und – Schuld, – Leid, Not, schwere Pflichten und keinen Stern. In Ihnen blüht es, und um Sie. Sie sind wahrlich zu beneiden. Über ich beneide Sie mit freudigem Gönnen um all das Gute, Schöne, Reiche, Blühende! ...«
So lange er lebte, haben ihn eigentlich wenige, sogar unter den »Intellektuellen«, gekannt und gelesen. Nur der literarische Ring, das heißt die engere Welt der Autoren, die wertete und erkannte ihn. Trotz seiner hervorragenden Bücher ist er dem großen Publikum ein fast Unbekannter geblieben.
Die alte Wahrheit von der immanenten Folgerichtigkeit her Dinge, die in seinem Leben nicht Offenbarung fand, wird in seinem Nachleben vielleicht Recht und Sieg gewinnen. Eine solche Höhen- und Lichtnatur muß auf Gipfel und zur Sonne, denn dort ist ihr Element.
Die Ewiges schaffen, müssen ja meist in der Gegenwärtigkeit ihres Lebens leiden und unerkannt bleiben, weil sie eben über den Tag hinaus wirken. Dafür gehört ihnen die Zukunft, die Unvergessenheit; während die anderen, welche starke Gegenwartserfolge haben, selten über diesen Zeitraum hinaus leben, – sondern mit dem Tageswert hinsterben und auslöschen für die Nachwelt. Holzamer wird ein Unvergeßlicher sein, und seherisch klingt es, wie er gesungen:
Daß die vielen alle,
Die im Tal verwehn,
Auch noch, wenn ich falle,
Müssen aufwärts sehn.
Ich habe Holzamer eingehender behandelt als manche andern Bedeutenden, weil ich meine: wir sind ihm alle über seinen Tod hinaus noch etwas schuldig. Was wir ihm nicht mehr lebendig-persönlich bieten konnten (denn ach, er starb so tragisch früh für das, was er noch hätte bieten können), das möchte man nun in Zartheit, Warme und Verehrung nach seinem Tod ihm geben.
Ich möchte auch hier noch eines lieben und verehrten Freundes gedenken, der aber noch in der Sonne der Gegenwart wandelt. Er nimmt durch seine nicht in solchem Maße erwartete Hochentwicklung ein besonderes Interesse in Anspruch. Es ist der Fürst Wilhelm von Hohenzollern-Sigmaringen. Ich lernte ihn in Straßburg, wo er studierte, kennen. Er war damals mit seinen einundzwanzig Jahren ein frohsinniger, leichtlebiger Kavalier, der wenig über seine Alters- und Standesgenossen hervorragte; wenigstens schien es so. Ein Reigen junger Lust schwang sich durch die Tage von damals. Die Luft war wie vom Duft der Rosen der Schönheit voll, und war wie ein Rausch von süßem Wein. Die silbernen Akkorde von Lachen durchtönten die Luft, und der Jubel der Jugend war darin. Da traten die ernsteren Elemente der Seele doch mehr in den Hintergrund. Das große, ernste Leben hat sie erst aufgerufen, – doch, als es rief, wurden unsere Seelen würdig befunden.
Der Fürst (damals Erbprinz) hat den Ibsenschen Sinnspruch wahrgemacht: »Werde, der du bist!«
Mit seinem Geist, und überhaupt mit seinem seelischen Wesen, ist eine Hochentwicklung geschehen, wie sie wohl nur bei erlesenen Naturen beobachtet werden kann. Das Charakteristische beim Fürsten ist das starke Streben, das Emporstreben. Was er als gut und schön erkennt, strebt er nach den Maßen seines Könnens an und erreicht es meist durch seinen stark geschulten Willen. Er ist ein echt deutscher, vornehmer Mann, aufrecht, stolz, dennoch bescheiden, – wahr, mit starkem Sinn für Wissenschaft, besonders für Geschichte, – und – für die Künste; – jedoch mehr für die bildenden als die redenden. Der Fürst ist Katholik; von einer tiefen, fast kindlichen Frömmigkeit und von regstem Bewußtsein für seine mannigfachen Pflichten. Er erscheint mir, wenn ich über das grimmige Deutschland-Schicksal nachdenke, als einer der wenigen Männer, die in der furchtbaren Not unsres Vaterlands ihm ein Führer sein könnten! Ein treuer Eckhardt – – – Aber die Deutschen sind zurzeit den Kleinen in dem Goetheschen Lied zu ähnlich, die sich ängstlich ducken, und nicht zu selbständigen Schritten finden. – – – Der Fürst und ich, wir stehen seit lange in regsamem Gedankenaustausch; und dieser Briefwechsel ist mir eine ehrliche Freude, denn in der Freundschaft mit dem Fürsten bin ich um einen edlen Menschen reicher geworden.
Als ich im Jahre 1901 aus der brandenden Strömung des Lebens in Straßburg in die Beschaulichkeit und blühende Stille von Baden kam, umfing mich die Einsamkeit einer herrlichen Natur wie eine uferlose Schönheit. – Jetzt erst, das fühlte ich siegend, tonnte ich mich ganz meiner Kunst widmen. Freilich, es traten noch dunkle, fürchterliche Schicksalsgestalten dazwischen: Schmerzen und Sorgen. Mein teurer und verehrter Gemahl war stark von dem Seelenschmerz ergriffen, den sein Abschied aus der geliebten Stellung, die seine ganze geistige Kraft in schöner Regsamkeit gehalten hatte, verursachte. Die tiefe Enttäuschung, die ihm vielgestaltig entgegengetreten war, machte ihn innerlich und dann auch körperlich wund und krank. Er war immer eine urgesunde, widerstandsfähige Natur gewesen; nun hatte ein Lebenssturm ihn so gepackt, daß er bis in die Tiefen erschüttert war und zusammenzubrechen drohte. Und – mein Gott –er brach ja auch bald zusammen.
Er hat sehr an meiner Kunst, an meinem Talent gehangen, und war viel stolzer darauf als ich. Ich weiß auch sicher, daß alles, was ich nun in Baden-Baden noch zu seinen Lebzeiten schrieb, ihm wie die letzten Blumen des Glücks auf seinem tiefumdüsterten Lebenswege erschien. Und ich war innerlich befreit und befriedigt, daß ich sie ihm pflücken und bieten konnte. Um ihn ein wenig in frühere Gedankenkreise zu heben, suchte ich ihn zur Mitarbeit an der »Ära Manteuffel«, die ich damals schrieb, zu veranlassen. Doch er war nicht dazu zu bewegen, auch nur eine Zeile daran zu schreiben; wohl aber half er mir, indem er mir Fragen, an deren Lösung er persönlich mitgewirkt hatte, klarlegte. Sonst war ich der Alleinverfasser dieses kleinen geschichtlichen Werkes, – aber mein Mann hat noch eine solche Freude darüber gehabt, als stände er wieder inmitten seines staatsmännischen Schaffens von ehedem. Im Frühjahr 1904 erschien das Buch, – Anfang März 1906 starb er. Auch mein Dichtungsbuch: »Jenseit des Lärms« erschien damals, und er lebte noch einmal in diesen Lebens- und Liebesblättern auf. Er hatte, und das ist gewiß eine Seltenheit bei einem Staatsmann, ein subtil seines Verständnis für die Dichtkunst, für alles wahrhaft Sprachkünstlerische, und den Heiligenschein des Lebens: die Schönheit. Der März 1906 hat mich sehr einsam gemacht, – denn, wenn ich auch aus dem überströmend reichen Born meiner Empfindung vielen gegeben, und oft gern und innig gegeben habe: das Tiefgründigste, das Quellennächste gehörte doch ihm. Das habe ich erst ganz tief und wie eine triumphierende Wahrheit empfunden, als er – tot war. Sein Heimgang hat mich sehr einsam gemacht.
Meine drei Kinder waren längst fern vom Hause und hatten sich jedes ein eigenes Heim gegründet. Zwei Söhne und eine Tochter, alle drei sind verheiratet. Ich möchte davon abstehen, eine eingehende Charakteristik von ihnen zu schreiben, weil mein Griffel doch wohl allzusehr von mächtiger Mutterliebe geführt werden würde, und weil meine Leser das mit Recht unzulässig subjektiv finden könnten. Das eine kann ich aber ganz objektiv sagen: sie sind alle drei hochbegabt mit Geist und Talenten. Der Älteste Jesco, eine ausgesprochene Künstlernatur, singt ganz ungewöhnlich schön.
Das weite Reich der Einsamkeit, in das ich trat nach meines Mannes Tod, war aber nicht leer, nicht unbeseelt; jedoch es herrschten zuerst tragische Gottheiten in ihm, und allgemach erst wichen sie denen mit helleren Zügen und sonnigem Lächeln. Wehmut und Sehnsucht umspannen mich wie mit starken Fäden, aus denen ich selbst mir ein Gewebe wirken mußte. Unpersönliche Mächte waren es, die mich wieder zur Lebensliebe führten; den persönlichen hatte ich mich zuerst verschlossen. Die Stimmen der Menschen sagten mir zuerst zu wenig: andere Töne und Klänge wurden mir bedeutsam: Stimmen aus der Tiefe der eigenen Seele und Stimmen der Landschaft, der Landschaft im höchsten Sinne. Also nicht nur der Natur, die ihr mehr die äußere Gestalt gibt, sondern das ganz bestimmte Wesen, die Seele der Landschaft. Nach meines Mannes Tode verließ ich die Wohnung im Tal und bezog ein Heim auf einer Anhöhe, nahe von rauschenden Wäldern, umgeben von Gärten und Auen. Der Villa gegenüber steigen das »alte Schloß«, die »Felsen«, der »Merkur« und das neue Schloß empor. Das ist ein Stück Seele aus der Geschichte des Landes. In der Stille vernimmt man die Stimmen, die sonst vom Taglärm, vom Alltag übertönt werden. Das sind die zartesten, tiefsten Daseinsakkorde – und ich erhorchte auch für meine Kunst gar Köstliches daraus. Mir ist, als sei ich wirklich auf eine Höhe gekommen und hätte für immer alle Niederungen tief unter meinem Fuß gelassen ... Jeder Baum, der aus dem Wald herübergrüßt, gehört zu dem Schönheitsbild, das meine Welt bedeutet. Ich fühle ein ins Unendliche quellendes Wünschen in mir: alles, was so allmächtig von Gedanken und Empfinden, von Vorstellungen und forderndem Schöpfungsdrang sich regt, hinausstellen zu können in die Kunst. Zu schaffen, zu dichten, zu schaffen! Ich gehe in den Abend meines Lebens, an seine irdischen Grenzen, und habe nur noch eine zugemessene Zahl von Tagen und Nächten, die ich mit eigenstem Seeleninhalt füllen kann. Aber mein Wünschen greift hinüber ins Unendliche, – denn im Endlichen ist mir die Zeit nicht mehr gegönnt. O, hatte ich noch ein Leben zu leben, auf daß ich alles geben könnte, was in mir zur Offenbarung drängt! Ich fühle mich so überquellend an Kraft, an Jugend (obgleich ich gar nicht jung bin), an über die Grenzen drängendem Willen zur Tat! Vielleicht hat St. Zweig etwas recht mit dem Wort, das er von mir gesagt hat: »die Beherrscherin der Jahre«. Aber es besteht ein tragischer Gegensatz zwischen dem Geistigen und Leiblichen bei mir; wenigstens in der Bewegungsfähigkeit beider Kräfte. Geistig fliege ich wie ein Aar und körperlich krieche ich wie eine arme Waldschnecke. Ich bin seit Jahren in der Bewegung meiner Glieder sehr, sehr gehemmt durch chronische Gelenkentzündungen. Durch die erzwungene Seßhaftigkeit bin ich wohl noch mehr mit der Landschaft verbunden, als ich es ohnehin, meiner Eigenart nach, sein würde.
Friedrich der Große hat einmal ausgesprochen: seine letzte Leidenschaft seien die Bücher; ich möchte den Satz für mich etwas erweitern: nicht nur die Bücher sind meine letzte Leidenschaft, sondern auch die schöne Landschaft. Ich habe einmal Baden das Paradies ohne Schlange genannt; und ich glaube, daß es ein gutes Wort ist. In dieser anmutvollen, zarten und doch so großartigen Landschaft ist keine, keine Häßlichkeit versteckt; das heißt in der Landschaft nicht; unter den Menschen dieser Landschaft ist manch ein Schlänglein und manche Schlange mit Giftzähnen. Unangetastet, fast heilig sind mir die Tage damals gewesen; ich gehörte nur ihnen und sie mir. Es war wie eine glückliche Ehe: so vertraut waren wir einander, die Zeit und ich, – und so tief hatten wir einander in den letzten Kelchgrund geschaut. Die menschliche Gesellschaft mit allen ihren Ich- und Alltagsnöten, das Getriebe der verflachenden Geselligkeit, all das Hin und Her in Worten und Taten, ich konnte es mir etwa ein Jahr nach dem Tode meines Mannes fernhalten auf meiner Höhe. Dann pochte das Leben und pochten die Menschen stärker an die verschlossenen Tore meines Hauses und meiner Seele. Und dann begannen sie auch mit lieblichen Worten und weichen Gebärden Einlaß zu erbitten. Nicht nur das Leben brachte mich wieder in Berührung mit den Menschen, sondern zuerst der Tod. Zwei meiner edelsten und mir geistig verwandtesten Freunde starben 1908. Pascal David, der Hauptschriftleiter der »Straßburger Post«, und Prinz Emil Carolath. Ich habe ihre Bedeutung für mich, und für Politik (David) und Kunst (Carolath) weiter oben behandelt. Ach, die Kränze des Lebens und freudiger Hinneigung, wie waren sie reich und alles Duftes und aller Wunder voll! Doch wie viel ihrer besten Zweiglein und Blumen haben Trennung und Tod wild herausgerissen, so daß das kostbare Gewinde an mancher Stelle zerrissen niederhängt! – – – Die sechs Jahre (1908 bis 1914), die nun bis zum Anfang des Weltkrieges folgten, waren friedvoll und nur dem Schönen und Geistighohen gewidmet. Sie erscheinen mir jetzt im Vergleich zu dem, was nach ihnen kam, wie ein wundervoller Ausschnitt aus einer hohen und glücklichen Kultur. Meine Lebensliebe ist auch wieder aufgewacht, und ich habe manch wertvollen Künstlerbesuch empfangen und manch eine Künstlerfahrt und manche Fahrt in die herrliche Landschaft gemacht. Denn ich war auch körperlich noch so bewegungsfreudig wie nur je ehemals ... Ich möchte hier ein paar Bilder von solchen Ausflügen ins Schöne geben. Sie werden erkennen lassen, wie hoch, wie lauter, wie bewegt die Zeit jener »hohen und glücklichen Kultur« war. Ich möchte zuerst ein Gemälde in aller Farbenkraft, deren mein Griffel fähig ist, geben, indem ich eine Fahrt in die Umgegend Badens schildere. Es soll zeigen, mit welcher königlich verschwenderischen Hand hier die Natur ihre Landschaftsreize gibt und wie eindrucksvolle Schlösser der Vergangenheit sie umhegt.
Ein seltsam flimmernder, trunkener Tag liegt über dem Oktoberland. In der Luft steht ein Duft wie aus tausend hochreifen Früchten. Am Wege schaukeln langsam die Wagen dahin, die Bütten mit überquellenden Trauben führen. Helle Ochsengespanne lenken sie. Wohlig träge geht der leuchtende Blick der herrlichen Rinder über die Wiesen, die von den Goldnetzen der Herbstgespinste verschleiert sind ... Alte Griechendichter haben einst den großen Blick einer schönen Göttin mit solchem Schauen verglichen.
Ein Lebensrausch, der alle Kräfte überschwenglich in eins gefaßt hat, kündet sich in der Natur ringsum. Ein Überströmen und Aufschäumen vor dem eisigen Sterben.
Am Waldrand hängen die reichen Korallenschnüre der Ebereschen und der Rosenfrüchte des Hages. Mein Weg geht unter den Breitzweigen der Nußbäume dahin; herbe Würzen atmet ihr Laub. Ein feines, wehes Lilalicht liegt schon auf den Matten; Herbstzeitlosen halten ihre duftlosen Kelche empor. Aber noch liegen auch lebensbuntere Kranze über dem Land, denn all die wilden Gelb- und Rot- und Blaublümelein des Sommers recken sich noch einmal blühend in diese berauschende Herbstsonne. Mir ist, ich fühlte all das Leben, das in den Dingen kocht und steigt und quillt, durch meine eignen Pulse brennen ...
Im Weiterwandern taucht aus dem blauen Rauch der Ferne ein scharfgezacktes Bild auf. Ein breiter, weiter Baumgang, von malachitgrünem Laub überragt, öffnet sich und rahmt einen Schloßbau ein. Der steht mit eigentümlich schwermütigen Linien in dem glitzernden Herbsttag. Eine schlafende Vergangenheit!
Das ist das Schloß Favorite, welches die Markgräfin Sibylle, des Türkenbezwingers Ludwig Wilhelm I. von Baden Witwe, sich um 1725 zum Sommersitz erbaute. Mehr denn einhundertfünfundneunzig Jahre steht es, schläft es. Nicht die Stürme der Lüfte und nicht die Stürme des Lebens scheinen diese Mauern mit rüttelnden Griffen angetastet zu haben. Jede kleine Muschel, jeder Kieselstein steht glatt eingefügt in den seltsamen Mörtelbewurf, der die Außenseite des Schlosses bildet. Die Mauerverkleidung erscheint nämlich höchst eigenartig; sie ist von erstarrtem Mörtel, in den unzählige Granitstückchen, Kiesel und Schneckengehäuse eingebacken sind. Das Ganze wirkt wie ein glitzerndes Muschelhaus und ist im Barockstil aufgeführt. Wetter der Zeit rühren doch an alle Dinge und bröckeln leis von ihrer Schönheit oder Eigenart Stück um Stück, also daß ihre Gestalt verwandelt erscheint – aber dies Schloß ist ganz unangetastet, als ob es ehegestern aus irgendeiner architektonischen Fürstenlaune emporgewachsen sei, etwa wie die von dem königlichen Ästheten von Bayern in den Alpen erbauten Schlösser ...
Wohl stehen als mächtige Hüter die riesenhaften Parkbäume um das Schloß und bilden eine verschwiegene und wehrhafte Wand gegen Welt und Wetter; aber sie haben doch nicht immer so starke Arme und trotzige Häupter gehabt, sondern sind in den einhundertfünfundneunzig Jahren langsam erst zu seiner Schutzherrschaft angewachsen. Damals, um 1725, hatten sie wohl schlanke, feine Ärmchen, die kein Wetter und keine Not abwehren konnten. Es ist also wirklich etwas Geheimnisvolles und Märchenhaftes um die Unberührtheit dieses Schlosses ...
Favorite hat etwas sinnig Persönliches. Ein starkes Eigenleben, das einst in ihm pulsierte, scheint die Räume noch zu beseelen. Eine feinfühlige künstlerische Hand hat hier gleichsam die hohe Summe eines reich erfüllten Lebens in köstlichen Werten zusammengefaßt ... In das Leben der Markgräfin Sibylle haben die verschiedensten Kulturen hineingereicht. Ihr Gatte, jene fürstliche Landsknechtnatur, so möchte ich ihn nennen, hatte durch seine Kriegszüge, die ihn fast in alle europäischen Lande führten, etwas für jene Zeiten ungemein Kosmopolitisches. Sein ganzer Lebensgang war ein rastloses Kämpfen und Siegen in Schlachten. Er war aus einer Zeit und in eine Zeit geboren, deren Atem leidenschaftlicher Krieg und wogende Wirrnis war. Die Zeit lag noch in den Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges. Um 1655 erblickte Ludwig Wilhelm das Licht. In Paris ...
Mit neunzehn Jahren (sein Vater war schon 1669 gestorben) ward er von seinem Großvater, dem Markgrafen Wilhelm I., in kaiserlichen Dienst geschickt. Unter Montecuccoli focht er im nahen Elsaß gegen Turenne. Nach dem Nymweger Frieden kehrte Ludwig Wilhelm nach Baden heim und übernahm, da sein Großvater 1677 gestorben war, die Regierung. Ein Jüngling von zweiundzwanzig Jahren, der aber schon durch die läuternden Feuer von Schlachten und Manneszucht gegangen war. Nach wenigen Jahren ruhevoller Regierung ist der Markgraf dann wieder in kaiserlichen Dienst getreten und hat, zum Feldmarschall ernannt, eine stolze, sieghafte Bahn in Bosnien, Ungarn, Böhmen gemacht. Darauf erhielt er den Oberbefehl an der Donau, und zwischen den Schlachten (gegen die Türken) bei Nissa 1689 und bei Salankemen 1691 fällt seine Heirat mit Auguste Sibylle von Lauenburg. In diese Ehe haben nicht die Fackeln des sanften Griechengottes Hymen, sondern lodernde Kriegsfackeln geleuchtet ... 1693 wurde dem Markgrafen der Oberbefehl über die Reichsarmee gegen die Franzosen erteilt. Nach der Einnahme von Heidelberg ging er nach England, um mit König Wilhelm III. Vereinbarungen über die Kriegspläne gegen Frankreich zu treffen. Dann befehligte er im Spanischen Erbfolgekrieg die Reichsarmee gegen Frankreich und Bayern, eroberte 1702 Landau und siegte 1704 mit Marlborough. Wahrlich, ein reiches Kampfleben. Aber er krankte an schweren Wunden, als er 1705 seinen festen, friedvollen Herrschersitz auf seinem Schloß Rastatt nahm. Dies Schloß, das gegenwärtig Offizierskasino ist, hat nun die Volksphantasie mit den seltsamsten Mären illustriert. Gänge, die von Festsälen zu inneren Gemächern führen, werden in der Fabulierkunst des Nachgeschlechts geheime Wege zu verschwiegenen Herzensfreuden, mit Favoritinnen, die sich Ludwig Wilhelm aus dem Harem des Sultans entführt haben sollte. Dem Volk von Baden, in seiner geruhigen, behäbigen Landmannsart, war ihres stolzen Markgrafen Wesen und Erleben, das mit fast allen Nationen Europas in Berührung gekommen war, so fremd und dabei so anziehend, daß es zu dem »Türkenlouis« mit einer scheuen und schaurigen Ehrfurcht aufblickte und ihn nur in einer Sphäre von seltsamlichen Mären und Aventiuren sah. Er schien dem Völkchen, dessen Grenzen des Erlebens und Schauens der liebliche, friedsame Schwarzwald war, nicht nur ein Völker-, sondern auch ein Herzenbezwinger.
Die Legendenbildung, die sich an die Siegerkränze des ritterkühnen Ludwig Wilhelm I. hängt, ist also wohl begreiflich, aber sie stützt sich, wie insbesondere die Geschichte von den verschleierten Bildern aus Türkenland, auf nicht eine Handbreit Tatsächliches ... Nur zwei Jahre Ruhe waren dem Markgrafen in Rastatt gegönnt, dann starb er (1707) an den Folgen seiner schweren Kriegswunden. Diese bewegte Vergangenheit ging mir in raschen Bildern durch den Sinn, indessen ich langsam durch die breitschattenden Baumgänge des Schloßparks schritt, die schon im metallenen Flimmern des Oktobers standen. Zur Seite, unter neigenden Blutbuchen, hebt sich ein finsterer Kapellenbau, der einzige schwarze Punkt in dieser hellgrüßenden Schönheit. Dort hat Sibylle gebetet, gebüßt, sich gegeißelt, als hätte die Schuld von vielen Magdalenen auf ihren schönen Schultern gelastet.
Weil sie nun eine so absonderlich herrliche Frau war und sehr jung in freie Witwenschaft kam, hat man ihr auch viele lohende Liebesleidenschaften angedichtet, die sie in späteren Matronenstunden dann innig bereut haben sollte ... Doch so redet nur die mit dem Urteil leichtfertige Sage; die ernster prüfende Geschichte weiß nichts von solcher bewegten geheimen Erotik ... Sie muß eine starke und dabei zarte Eigenart besessen haben, diese Witwe des Türkenbezwingers, denn im Innern des Schlosses Favorite, das ihre selbsteigenste Schöpfung ist, waltet edles Frauen- und Künstlertum. Favorite ist 1725 erbaut und 1733 verlassen oder doch nie mehr auf längere Frist bewohnt worden (1733 starb Sibylle); dennoch ist in allen Schloßräumen eine warmbelebte Wohnlichkeit. Mit einziger Ausnahme der Empfangshalle, die durch drei Stockwerke steigt und in ihrer kühlen Höhe und der Wandbekleidung aus Hunderten von Delfter Plättchen einen glattfrostigen Eindruck macht. Selbst die grünen Blätterringel der Parkbäume, durch die funkelnde Sonnenstäubchen lohen, die nur in hüpfendem Tanz über alle die kostbaren Weißblautäfelchen huschen, selbst deren reizend bewegte Zeichnung wirkt hier nicht warm, sondern wehmütig-schattenhaft.
Ich habe so viele alte, interessante Schlösser gesehen, in denen ehemals historische Persönlichkeiten wandelten, in denen auch Denkmale ihres Lebens und Trachtens in mehr oder minder schöner Erscheinung bewahrt werden, aber immer war es tote Vergangenheit, die mich aus großen verloderten Blicken anschaute. Etwas leer Hallendes, wie in Grüften, in denen nur modernde Leiber ruhen, denen die Seele nicht geblieben ist, war in ihnen – doch in diesem Schloß hier scheint die Vergangenheit nicht tot: sie schläft nur – sie atmet, als ob man sie wecken könnte und sie dem Tag von heut nicht fremd und fern wäre ...
Warm, behaglich und eigenpersönlich muten die Wohn- und Ziergemächer an. Die Tapeten sind in kunstreicher Arbeit von der Markgräfin und ihren Hoffräulein gestickt. Der Empfangssaal im östlichen Flügel zeigt eine Wandverkleidung, die durchwegs Stickereien in Wolle und Glasperlen auf einem höchst eigenartigen Grund von gelben Glasröhrchen weist. Dann das Schlafzimmer von Sibylles ältestem Sohn (später als Markgraf Ludwig Georg), in dem ganz wunderbare Gobelinarbeiten erhalten sind. Ebenso sind die Silber- und Goldstickereien des Himmelbettbehanges im Schlafzimmer der Markgräfin Sibylle von deren Hand gearbeitet. Dies Schlafzimmer, mit seinem Säulenwerk, mit dem kostbaren, wie zu seliger Hochzeit gerichteten Bett und dem schönen Fensterbänklein, das in den zauberstillen Schloßgarten sieht, es ruft unwillkürlich die Dekoration des Hochzeitgemaches aus »Lohengrin«, wie es in Bayreuth sich darstellt, wach. Es ist, als ob alle süßen Lohengrin-Melodien leise zu tönen beginnen müßten, wenn nur das schwirrende Wortgesumm der Besucher verhallt wäre ... Merkwürdig, diese gleiche Stimmung in beiden Gemächern! Und doch hat sicherlich in Bayreuth keinem das verschwiegene Gemach in Favorite vorgeschwebt – und noch viel weniger hat die Markgräfin Sibylle den »Lohengrin« vorahnen können ... Sehr wohnlich und belebt wirken auch im Familienzimmer die fünf Ölgemalde der markgräflichen Familie. Sibylle, ganz knospenjung, noch als lauenburgische Prinzessin, also fünfzehn bis sechzehn Jahre alt, der Markgraf Ludwig Wilhelm, auch als Jüngling, mit kühnen, offenen Zügen, dann beide als Gatten, und endlich der junge Sohn Georg August, mit sympathischen Zügen ... Das Schreibzimmer, das einen farbenschönen und köstlichen Anblick gewährt durch die breitstreifige, grün und rote Atlastapete mit reichem Gold, zeigt die besten, die lebensreifen und lebenstreuen Bilder des markgräflichen Paares. Ludwig Wilhelm ist da ganz der verwegene, sieggewohnte Condottiere, von dessen großem, über Fernen und Zeiten hinspähendem Blick man gerne glaubt, daß er Heere leiten und Tod und Wunden trotzen konnte. Der weltwandernde Fuß des »Türkenlouis« hat ja die reizende Verschollenheit dieses Schlosses nie betreten, er hätte wohl auch kaum lange hier gerastet; höchstens als todwunder Amfortas in den beiden letzten Lebensjahren – aber da stand ja Favorite noch nicht ... Das andere Gemälde stellt Sibylle als Witwe dar mit ihren jungen zweiunddreißig Jahren. Das Gesicht zeigt schöne, sehr regelmäßige, sehr stolze Züge; aber nichts von hingebender, weicher Weiblichkeit – nichts von innigen Zügen der Sehnsucht nach Anlehnung, sondern eine fast wehe Herbheit liegt um den Mund, als wolle ihr Leben nur steile Pflichtgebote kennen ... Die Geschichten, die das Volk erzählt von der Reue über Liebessünden, die Sibylle zu der finstern Kapelle und zu den Geißelungen geführt habe, werden vor dem, was diese Züge reden, zu Fabeln ... Oder sollte die seltsame Persönlichkeit des Mustapha, dieses klugen und treuen Dieners, den Ludwig Wilhelm aus dem Türkenlande heimgebracht, dennoch der Erwecker und der Träger einer berückenden Leidenschaft gewesen sein, der die stolze Fürstin über die Grenzen ihres Wollens in heimliche Schuld hingerissen, die sie dann mit harten Religionsübungen zu sühnen trachtete? Eine Rolle hat Mustapha jedenfalls im Leben der Markgräfin gespielt, denn sonst hätte sie ihm nicht in ihrer eigensten Schöpfung Favorite hart unter den Fenstern des Schlosses an einem erlesenen Platz unter kirchengewölbten Parkbäumen ein Denkbild errichten lassen. Auf der Säule eines Brunnens ragt der dunkel- und kühnblickende Kopf jenes Türken Mustapha – – doch zu den Schätzen des Schlosses zurück! Ganz merkwürdig und anziehend stellt sich das sogenannte Florentiner Zimmer dar. Perlmutter und Steinchen von mannigfacher Farbe und Art sind zusammengestellt zu kunstreichen Bildern, die meist Landschaften darstellen und in einiger Entfernung wie Freilichtgemälde erscheinen. Besonders ein Tisch und ein Kleinodienkasten sind von leuchtender Bildkraft und Schönheit. Die Wände sind außer von Mosaikdarstellungen noch von Glasgemälden gebildet, die, einhundertundfünfzig bis einhundertundachtzig an der Zahl, Bildnisse berühmter Gelehrter und Künstler der damaligen Zeit und Vorzeit zeigen. Dazwischen funkeln hier und in den andern Gemächern vornehme und eigentümliche Formen von Kronleuchtern, Vasen, Rahmen und Spiegeln in kostbarem böhmischem Glas, das von Schlackenwerth bei Karlsbad, der Besitzung der Markgräfin, stammt. Auch viele fremd anmutende Kostbarkeiten sieht man in den Gemächern, die Ludwig Wilhelm von seinen Kriegsfahrten, insonderheit aus Türkenland, heimbrachte. Der vornehme und sinnige Charakter dieses Schlosses, seine fürstlich behagliche Wohnlichkeit hat sich unwandelbar gewahrt bis in den gegenwärtigen Tag durch 180 Jahre der Leere und des Schweigens. Nur einmal hat in dieser Zeit einer, der uns Heutigen noch nicht ganz in die Vergangenheit ragt, dieses Schlößchen mehr als vorübergehend bewohnt. Kaiser Wilhelm I., als er noch Prinz Wilhelm war und im Jahre 1849 gegen die Freischaren kämpfte, hatte hier sein Quartier ... Die Kostbarkeiten von Favorite, die aus den Kulturen, Künsten und Kunsthandwerken so vieler naher und ferner Völker stammen und hier zu einem erlauchten und lauschigen Heim zusammengefügt sind, haben deshalb so sehr den Reiz des Individuellen, weil sie meist Träger persönlicher Erinnerungen sind. Es ist so viel Seele in diesen Dingen, darum leben sie auch warm durch die Jahrhunderte ... Der Park und das Schlößchen mit seinen reichen Ulmen und Eichen und Linden raunte wie mit zärtlichen Stimmen – con sordino einer träumerischen Herbstluft ... Ich schritt zurück ins offene Land. Hinter mir eine leise schlafende Vergangenheit – vor mir die lachende reife Erfüllung des Lebens. Ein strotzender Herbst in Früchten! Mit regem Sinnen und regen Sinnen fühl' ich mich der Vergangenheit und der Gegenwart verknüpft. Der Oktoberabend brennt noch in heißen Farben über den Feldern. Brächte ein Maler diese tollkühnen und doch so unsäglich fein gehauchten Farben, man würde ihn unnatürlich schelten. Hat man doch ehemals den köstlichen Makart, einen der farbengewaltigsten Meister der Zeiten, wenn er alle Strahlenkraft des Regenbogens flimmernd über seine Dinge und Menschen breitete, »farbenorgiastisch« genannt! »Man«, das heißt der Neid oder das Unverstehen ... Ein rascher, leiser Abendwind kam auf, also daß die Wolken droben wie goldene Siegerwagen durch die Himmel rollten. Das Bergland weit umher funkelte wie von königlich hingestreuten Juwelen ... Wie beim Abschied von einem geliebten Menschen sich vom alltäglich grau hinwebenden Leben noch einmal die ganze Leuchtkraft alles Besten in seinem Wesen hebt und zusammenfaßt und mit einem einzigen innigen Gefühl die Seele füllt, so war es auch, als ob in diesem späten Oktobertag sich des Jahres ganze Schönheit drängte mit der innigen Gewalt eines bezwingenden Eindrucks! ... Oktober! Wonnemond des Herbstes! Deine Sonnentage sind so trunkenschön, weil Dionys, der frohe Gott, über der Landschaft und über den Seelen sein starkes Zepter schwingt. Evoe! – – –
Und einige Künstlerfahrten liegen auch in dieser gnadenvollen Zeit des Friedens und der Erfüllung; Fahrten, die ich deshalb meinen Lebensblättern einfüge, weil sie nicht nur für meine Geistigkeit von Bedeutung sind, sondern wohl auch weite Kreise anziehen werden durch die Künstlernaturen, denen sie gelten. Die eine Fahrt galt Hubert Herkomer; eine andere dem Ästheten und geistreichen Schriftsteller Baron Gleichen-Rußwurm, dem Urenkel von Schiller. Ich folgte einer Einladung auf sein Schloß in Franken, das ein ganz, ganz eigenartiger Geist belebt. Gleichen besitzt in seiner Seele alle Essenzen moderner deutscher Kultur, und auch solche aus romantischen und klassischen Zeiten. Er ist eine ideale Sammler- und Anlehnungsnatur. Er kann viel weniger aus dem Freien schaffen, als er sich an gegebene Zeit-, Landes- oder Dichteranregungen anlehnen und sie ausgestalten kann. Er ist also weniger ein Gestalter, als ein Ausgestalter. Bei seiner ungewöhnlichen Belesenheit in den Literaturen aller Nationen, ist das Wissen und Erkennen, auf dem er aufbaut, ganz außergewöhnlich groß. Der betrachtende, philosophische, ästhetische (weniger der geschichtliche) Essay ist sein fruchtbarstes Feld. Viel Talent besitzt er auch für eine Eigenart der Literatur: »das Märchen«. Nicht etwa das Märchen, wie es naiv aus der Seele des Volkes sich entwickelt, sondern das, welches man am besten wohl das philosophische Märchen nennt. Es gibt in anmutender Form ein Rankenwerk um einen Weisheits- oder philosophischen Satz. Gleichen hat in mancher Beziehung Verwandtes mit Bodenstedt, – nur daß er viel feiner und auch tiefer ist als der persisch-deutsche Poet. Er hat sich mit viel Liebe in die geistige und körperliche Umwelt seines großen Urahnen versetzt, und Schloß Greifenstein umschließt auch ein höchst eindrucksvolles Schiller-Museum. Die Tage, die ich dort verlebte, erscheinen mir wie Festtage des Lebens und der Kunst.
Als ich sein Schloß zum erstenmal sah, es war Herbst und um den leuchtenden Mittag, lag eine große Stille rings. Eine Stille, die man zu hören glaubt, wie seltsam das auch klingt ... Nur ein Rinnen und Rauschen in der Luft, wie die Anfang- und endlose Schwingung der Zeit. Sonst kaum ein Laut. Das alte Schloß Greifenstein ragt dunkel in den metallischblinkenden Herbsttag. Es liegt in Unterfranken, in einem weltfernen Vorland der Rhön, wo alles noch so wundervoll »altfränkisch« ausschaut. Der etwas trotzig aufragende Bau mit seinem hallenden Burghof ist aus verschiedenen Jahrhunderten und Stilen heraus geworden und macht dennoch einen ungemein einheitlichen Eindruck. Sein Unterbau, sein Erbgeschoß sind rein romanisch und entstammen dem elften Jahrhundert. Der Oberbau und besonders der Turm mit seiner Rokokohaube entstammen dem sechzehnten und späteren Jahrhunderten. Der große Saal im Erdgeschoß stellt reinste Formen des romanischen Profanstils dar, wie er besonders im Burgbau auch in Franken zu hoher Blüte im elften und zwölften Jahrhundert kam. Mit der dumpfen Geschlossenheit seiner Rundbogenlinien und seiner reichen Pfeilergliederung wirkt der Saal, der auch mit erlesenem Geschmack in seiner Ausstattung mit Möbeln und Zierrat in solchem Stil gehalten ist, durchaus ruhig-kräftig und stolzgedrungen. Doch ist das untere Geschoß nur wie eine ernste Vorstufe zu dem wiedergeborenen, lebhaften Geist späterer Jahrhunderte, zu der Renaissance, welche alle andern Räume der Burg beseelt. Die große Profanbasilika im unteren Stockwerk wird auch nur zu größeren Gastereien benützt, die selten vorkommen. Sonst schläft der seltsame Saal, in dem es leicht-modrig duftet, ganz unberührt, als sei er das Grab von Jahrhunderten ... Nur wenn die Sonne durch die Fenster fällt, fahren tanzende Schatten über alles Gebälk und Gestühl: Ranken von Efeu und Wein sind am Gemäuer draußen hochgestiegen und durch die flirrt dann manchmal die Sonne mit Edelsteingefunkel. Dann rinnt heimliches Farbenleben bis in die starrsten und kältesten Formen und Ecken. In die eigentliche Welt dieses Schlosses, in die wundervoll festgehaltene Stimmung des Rokoko vom achtzehnten Jahrhundert, tritt man erst, wenn man die schön gewundene Steinwendeltreppe bis zum ersten Stock erklommen hat. Hier, in diesem Stockwerk, konzentriert sich das gesamte Leben des Schlosses. Mit einem köstlichen Sinn für geschichtliche und sittengeschichtliche Stimmung für das, was man den Geist der Zeit nennt, ist hier eine ganz einheitliche Wirkung geschaffen, oder besser gesagt: die Stimmung einer längst verklungenen Zeit ist glücklich in ihren Grundnoten festgehalten und schwingt in gleichtönigen Motiven fort.
In unserer Zeit, mit dem Fiebertempo ihrer wilden, unsteten Pulse, ist's fast ein Wunder, eine große Stimmung in der Kunst oder im Leben, unzerrissen oder auch nur unversehrt, festzuhalten. Er aber gab den Inhalt einer ganzen großen Zeit in allen ihren feinen Verästelungen und Wurzelfasern und mit dem Duft und Reiz ihrer intimsten Blüte. Und nicht nur frisch erhalten, sondern in ihrer Eigenart fortgebildet. Das ist hohe Künstlerschaft dessen, der es schuf. So wird die Kunst Leben und das Leben wird eine herrliche Kunst. Der hier solch ein Meister der Zeit wurde, daß er schöne Vergangenheiten nicht nur als Schatten und tote Seelen bewahrt, sondern sie auferstehen läßt, sie belebt und ihnen – Renaissance gibt, ist ein Ästhet und eine Künstlerseele von subtilstem Fühlen und großzügigem Denken: Baron Alexander von Gleichen-Rußwurm! Einem erlesenen literarischen Publikum ist er längst wohlbekannt durch seine bedeutsamen Aufsätze über Kunst, Philosophie und Leben, die auch gesammelt in stattlichen Bänden vorliegen. In weiteren Kreisen ward er bekannt durch seine Reden und Fahrten im Jahre 1905, als seines großen Urahnen Schiller hundertster Todestag in vielen Landen mit ernsten Huldigungen gefeiert wurde. Die Vorbedingungen für die künstlerische Ausgestaltung des alten Schlosses Greifenstein waren nun freilich in großartiger Weise gegeben. Die Burg liegt fern von aller Unstätheit, von allen Gebrochenheiten und Zerrissenheiten des tobenden Verkehrslebens. In einer Stille, in der die Seele des Menschen und die Seele der Zeit gleichsam tief ausatmen können. Ein reicher Fruchtgrund für ideale Höchstkulturen. Dazu ist der Rokokorahmen des alten Schlosses gegeben, der seinen Inhalt fast zu fordern scheint von einer Herren- und Künstlernatur. Auch kommt als dritte, sehr wesentliche Vorbedingung dazu, daß Baron Gleichen durch materiellen Besitz so glücklich ist, alle seine Kunstpläne und -gedanken in sichtbare Form übertragen zu können. Ich erinnere mich nicht, jemals ein Museum, ein Schloß, ein Haus und so weiter gesehen zu haben, das den kulturellen, überhaupt geistigen Inhalt einer Zeitepoche so harmonisch einheitlich festgehalten hätte.
Die Atmosphäre der Schiller-Goetheschen Zeit ist meisterlich gegeben. Alles, was auf die Freundschaft und geistige Gemeinschaft der beiden Gewaltigen Bezug hat, besonders die geiststrahlende Weimarer Zeit, ist liebevoll behandelt. Da sind in stillen Sälen, die mit Möbeln in edel einfachen und doch zierlich preziösen Formen ausgeziert sind, Herrlichkeiten der Erinnerung zu schauen, welche von intimsten geistigen Beziehungen künden. Ich kannte damals Weimar und sein Schiller- und Goethehaus nicht, aber, nach den Abbildungen und Schilderungen, die mir auch speziell vom Schillerhaus gemacht wurden, möchte ich glauben, daß Weimar mehr den Alltag von Schillers Leben, Greifenstein das Feierlichere, Kunstgeschmückte, gleichsam den Sonntag seines Dichterlebens zur Erscheinung bringt.
Die Möbel, der Zimmer- und Hausschmuck, die Bibliothek, die Kunstgegenstände, die in Greifenstein zu einem Schiller-Museum vereint sind, entstammen Schillers Häuslichkeit, und geben durchaus das Bild eines in erlesenem Geschmack und Kunstverständnis beschlossenen Künstlerlebens, während im Publikum der Irrtum verbreitet ist, als sei seine Häuslichkeit karg und ärmlich gewesen. Mit auserlesenem, ich möchte sagen, nachschillerischem Geist ist hier von Gleichen alles zu einem großen und wahren Bild zusammengefügt.
Etwas von dem feierlichen Ernst, dem Pathos und der schönschreitenden Würde von Schillers Genius liegt über dem Raum ...
Das Schiller-Museum ist ein unregelmäßiger Eckbau, durch dessen Fenster das vieltönige Grün aus den bewegten Zweigen uralter Bäume leuchtet.
Das gibt ihm, wenigstens zur frühherbstlichen Zeit, da ich es sah, eine aus Licht und Schatten mystisch verwobene Dämmerung. Und die gleitet deutend und sagend um die Dinge aus gestorbenen Zeiten ...
Gleich am Eingang steht des Dichters Schreibtisch aus der Weimarer letzten Zeit. Mit seinem hellpolierten Holz, seiner freundlichen, wohlgefälligen Form, mit seinem ganzen zierlichen und bequemen Äußeren sieht er wie eine Einladung zu sinniger Arbeit aus. Stühle mit feiner Intarsiaarbeit lehnen an den Winden. Aus der einen Ecke grüßt ein sehr hübscher Teetisch mit Samovar, der im täglichen Gebrauch Schillers und seiner Familie war. Es sind auch viele wertvolle Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde, Gipsabgüsse, feine Sevresporzellane und viel Zierschmuck und Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens da, die durchaus von höherem Kunstgeschmack jener Zeit geadelt sind. Es ersteht vor dem Geist ein Heim von individuellem Reiz, wohl etwas gespreizt, pretiös und für unsern Geschmack zu helltönig und übergangslos in den Farben, aber durchaus nicht von jener dürftigen Kargheit oder leeren Ärmlichkeit, wie das Schillersche Haus gemeinhin geschildert wird. Einige Zeichnungen und Gemälde sind besonders interessant, auch durch die Geber, die meist auch die Schöpfer waren. So zum Beispiel Gemälde von Dalberg, die übrigens Geschenke an Lotte sind. Ein Hymen, mehr in der Auffassung eines Amors, der sehr sentimental zwei lodernde Herzen in einen Baumstamm zeichnet; dann von demselben Künstler die »Sieben Todsünden«; gräßlich lebendige Fratzen, die wie Ausgeburten aus Danteschen Höllensphären wirken. Dann ein sein empfundenes, in grauser Nebelhaftigkeit wirkendes Aquarell »Erlkönig«, unbekannt von wem; Zeichnungen zum »Geisterseher« vom Erbprinzen von Schwarzburg-Rudolstadt; Silhouetten von Schiller als Karlsschüler; Handzeichnungen der Prinzessin Helene von Orleans, die sie in der Verbannung in Erfurt entwarf. Ein Schiller-Gemälde aus der Mannheimer Zeit, das in einer sehr charaktervollen, aber seltsam gedrungenen Zeichnungsart eine fremde Note in die Züge unseres Dichters bringt. Auch einige sehr talentvolle Zeichnungen und Ölgemälde von der Hand der Christophine Reinwald (Schillers Schwester) sind da; unter anderm: des Dichters Kinder. Dann Zeichnungen von Maria Paulowna, Gipsabgüsse von Humboldt; Büsten von Schiller und ein Bild von Lottes erster Liebe, dem Engländer Heron, das sie immer bis zu ihrem Tod im Zimmer hatte. Endlich ein merkwürdiges großes Wandgemälde, Clio darstellend. Es mutet sehr streng klassisch, etwas nüchtern und kalt an: auf ganz mattblauem, amarantfarbenem Hintergrunde eine sitzende Göttin – die Gestalt in ganz ungetöntem Weiß; wie eine große Wedgewood-Platte wirkt die Darstellung. Goethe hatte diese »Clio« für das Weimarer Schloß geplant. Das stieß aber auf Hindernisse, und so kam das Bild als Geschenk von Goethe in Schillers Hand.
Aus des Dichters Gebrauch sind viele Gegenstände aufbewahrt, die teils anziehend, teils eigentümlich sind. Da ist eine reizende Tabatière mit Lottes Miniaturbild, eine Tasse von Angelika Kaufmann gemalt. Eine Briefmappe von Schiller, ganz in dem gefühlvollen, ornamentalen, etwas weichlichen Geschmack der Rokokozeit. Auf weißem, durchlochtem Kartonpapier sind in gezirkelten Girlanden Rosen und Vergißmeinnicht, die bis zum Überdruß zitierten Sinnbilder von Liebe und Freundschaft gestickt. Das Ganze ist mit blauen Bündchen zusammengehalten. Das kommt einem recht tändelnd, spielselig vor für die Hand eines Dichters, der so gewaltige Lebensbilder schuf, so erschütternde dramatische Gestalten hinstellte, so ernst-pathetisch in Kunst und Leben waltete ... Weiter ist eine, Visitkarte von Schiller bewahrt; auf einfachem, grau und grobkörnigem Papier, in viel größerem Format als unsere Besuchskarten, stellt es sich dar mit dem einfachen Namen:
Friedrich Schiller,
aber in reizend wirkender Umrahmung von Kupferstichornamenten, im Geschmack des Rokoko. Viel anspruchsvoller ist die auch hier bewahrte Besuchskarte von Goethe; sie zeigt auf ebenso unschönem Druckpapier mit einer verschnörkelten Linienrahmung folgende Worte:
Großherzoglich Sachsen-Weimarischer
Wirklicher Geheimrath und Staatsminister
von Goethe.
Und dann liegt im Museum Schillers letzte Feder, mit der er schrieb! Ein einfacher Gänsekiel, noch mit den vollen Tintenspuren. Eigentlich eine gräßliche Ironie, daß solch ein kleiner, häßlicher Gänsekiel unvergänglicher ist als Menschenleben und Jahrhunderte.
Doch wenden wir uns zu Schillers Bibliothek; sie enthält hohe Werte an Büchern, die meist von berühmten Autoren an Schiller geschenkt wurden. So Goethes Werke, von ihm an Schiller gewidmet. Es ist die Göschensche Ausgabe von 1787, eine für die damalige Buchkunst herrliche Ausgabe. Eine Shakespeare-Übersetzung von Wieland (1763, Zürich, Orell). Dann die Memoiren des Duc de Villars, die Schiller teils für die »Jahrbücher« übersetzte, und eine sehr wertvolle Ausgabe von Molière (1735), mit so feinen und geistreichen Kupfern, als seien sie von Chodowieckis meisterstarker Hand. Und dann Herders »Vom Geist der hebräischen Poesie« mit Widmung, Werther-Briefe in verschiedenen Ausgaben, die Geschichte Schottlands (von Robertson), aus welcher der Dichter Studien zu »Maria Stuart« machte; Karten von Frankreich, die Schiller für die »Jungfrau von Orleans« benützte; Manuskripte aus dem »Wilhelm Tell« und so manches, das in die innersten Werkstätten seines Geistes führt.
Gerührt und erschüttert steht man an den heiligen Schwellen und schaut in die Leuchtpracht dieses einsamen, von allem zerstreuenden Welttreiben sich in einen eigenen Weltkreis konzentrierenden Geistes ... Wohl muten die Lebensformen und die Sphären seines Seins etwas pathetisch, altmodisch gefühlsselig, auch wohl ein wenig schwulstig und überschwenglich an, aber mit welcher Geschlossenheit der Empfindung, mit welcher Kraftsammlung des Geistes! Und wie zerflattert erscheinen einem dagegen all die kultivierten Stimmungen, Stimmungchen, Stilkuriosa, Launenschwelgereien und nervösen Zerfahrenheiten von vielen, ach »viel zu vielen« modernen Autoren!
Schillers Heim und Häuslichkeit, wie sie sich aus den Erinnerungsstücken des »Schiller-Museums« in Greifenstein darstellen, haben reizende und reiche Züge – Züge von anmutender Schönheit sowie von seiner Kunstliebe und von gemütvoller Trautheit. Sehr schön und mit besonders zarten Tönen fügen sich diesem blassen Bilderbuch der Vergangenheit auch die Erinnerungszeichen ein, die Lotte, als sie verwitwet war, von Freunden ihres ausgezeichneten Gemahls erhielt. Da ist zum Beispiel die erste Ausgabe der Farbenlehre (1810), von Goethe an Lotte geschenkt. Eine Sepiazeichnung von Hackert, »Kassandra« darstellend; ein Bild der Frau von Stein im Alter, das die etwas männlich herben, denkscharfen Züge in sympathisch milden Linien zeigt. Da sind auch Lottes Bildnis, von Charlotte von Stein gezeichnet, und andere Erinnerungen an Lotte Schiller, ebenso wie an die » chère mère«, jene Frau, die mit den vornehm herben Zügen ihres Äußeren und ihrer Seele so ganz charakteristisch im Hintergrunde von Schillers Ehe steht. Eine versunkene Zeit! Aber die Überleitung von ihrem intimsten Wesen, wie es sich hier kundgibt, zu dem künstlerischen Geschmack unserer Tage ist in Greifenstein mit so fein erkennendem Blick und so maßvoll und schön anordnender Hand gegeben, daß die übrigen Räume des Schlosses durchaus harmonisch mit dem herrlichen Schiller-Museum zusammen wirken. In den Sälen sind diskrete Farben; einige sind in reizvoll verblichenen Tönen gehalten, als seien sie mit überkommenen Hausrat aus vergangenen Jahrhunderten gefüllt, und sind doch von modernstem Kunstgeschmack geschaffen. Dann wieder tun sich Räume auf, ganz in den frohsinnig hellen Farben des Rokoko leuchtend, wie zum Beispiel das Speisezimmer, ein kleines Juwel erlesenen Geschmacks. Durchwegs ist in Greifenstein der Geist und Geschmack der Schillerschen Zeit festgehalten und sogar eigenartig verklärt von einem im besten Sinne modernen, aus dem alten neu gestaltenden Wesen. Es sind gleichsam die feineren Extrakte jenes ästhetischen Jahrhunderts hier vereint, und der Geist des Schloßherrn, des Baron Alexander von Gleichen, der die Renaissance jener Schillerzeit so fein wählerisch vollzog, offenbart sich hier zugleich als Meister und als Diener eines höheren Kunstverstehens ...
Im Jahr darauf machte ich, von Berlin kommend, Halt in Weimar. Ich wollte Schillers und Goethes Heim, die beide in ihrem künstlerischen Wesen verehrungsvoll und zartfühlend von den Nachfahren erhalten sind, in ihrem unangetasteten Stimmungswert auf mich wirken lassen. Der Gedanke, den ich schon weiter oben aussprach, wurde mir bestätigt: Schillers Heim an sich machte einen reicheren, behaglicheren Eindruck, als es gemeinhin geschildert wird; und machte weiter einen wärmeren und mehr beseelten als das von Goethe. Alle Schilderungen des Goethelebens geben, auch freundliche, reiche Bilder von der Wohn- und Wirkungsstätte des Meisters; die sie niederschrieben, ließen sich hinreißen: vom Reichtum des Inhalts jener Zeit auch die äußere Erscheinung der Dinge erstrahlen zu lassen. Das zeichnet Verklärungslinien, die die Wirklichkeit nicht hatte. So scharf hatte ich mir nun den Gegensatz von äußeren Lebensformen und Lebensinhalt doch nicht gedacht. Gewiß, diese lohende Flammenkraft des Geistigen suchte sich ihre schönen Formen in der Kunst. Aber ich meine immer, es müsse Goethes Schönheitssinn ein tiefes Bedürfen gewesen sein, die Kunst auch in seiner Häuslichkeit, an seiner Arbeitsstätte walten zu lassen. Man wende mir nicht ein, daß ja sein Haus mit herrlichen Erzeugnissen der Skulptur und Malerei geschmückt sei ... Die Kunstwerke sind in einer so gedrängten und gehäuften Mannhaftigkeit da, daß sie nicht wie der feine und erlesene Schmuck eines Hauses wirken, sondern wie ein Museum mit so und so viel Nummern. Es rieselt einem förmlich die Kälte des Marmors und der Gypse der allzuvielen Kunstgebilde bis in die Adern ... Sehr verschiedene Faktoren scheinen mir da zusammengewirkt zu haben, um die Erscheinung einer gewissen Kühle und Enge des Goetheschen Hauses hervorzubringen. So wie das Maßhalten neben dem überschwenglich quellenden Reichtum seiner Seele lag, und sich die mannigfachen Gestaltungen seiner Schöpferkraft wie von einem feingetönten Goldgrund des Maßvollen abhoben, so waltete auch Mäßigkeit (die sogar erkennbar ein Behagen fand in einer gewissen Beschränkung) im Rahmen seines äußeren Lebens ...
Diese Gedanken waren wach in mir, als ich die erste Nacht in dem altertümlichen Gasthaus (es ist fast dreihundert Jahre alt) in Weimar zubrachte. Ein Sturm war mitternachts emporgesprungen wie ein wütender Riese, der zwischen Sternen und Wolken spielt. Solch ein Sturm, kalt und donnernd, wie ihn dieser seltsame Frühling 1910 manchmal brachte, über dem der Halleysche Komet stand. Gegen Morgen schwieg das Ächzen in den Lüften und in den alten Balken des Hauses. Der tolle Wind hatte einen merkwürdig todfahlen Morgen herangeweht. Die Gassen und Häuser lagen rein und still da, nur auf dem Marktplatz, vor den Fenstern des uralten Gasthofs, in dem ich wohnte (Goethe war dort vor 130 Jahren abgestiegen), entfaltete sich ein maßvoll bewegtes Treiben. Alles Marktschreierische, Grelle schien hier gedämpft ins Gemäßigte, Ruhiggesittete. Fast geräuschlos in gefällig anmutender Form spielte sich ein reges Markttreiben ab. Wirklich, es war als ob der genius loci hier Ordnung machte und eine gewisse Schönheit der Bewegung waltete. Es war keine Täuschung, keine subjektive Annahme: ich spürte dieses Ortsgeistes Wehen auch anderswo in Weimar oft und stark. Es ist, als ob jeder einzelne Bürger stolz sei, in der Goethestadt zu leben, und als ob jeder glaubte, der klassischen Stätte eine gewisse Würde in seinem äußeren und inneren Gehaben schuldig zu sein. Ein edler Zoll, den der Nachgeborene an diesem Ort, fast unbewußt, wie an einem Altar entrichtet. Ich habe solche starkwirkende Kraft des genius loci nur in Weimar und in Oberammergau, viel weniger zum Beispiel in Bayreuth, gespürt. Das ist wie die versöhnende, immanente Folgerichtigkeit der Dinge: die Kraft großer Lebensinhalte und menschheitbewegender Gedanken wirkt immer Siege, wenn auch oft späte. Das tritt auch lebhaft dadurch in die Erscheinung, daß das kleine Weimar eine Stätte großer Anziehung für Künstler und feine Geister blieb. Damals zur Goethe-Schiller-Herder-Zeit war die kleine Residenz ein Musenhof geworden; nicht nur um der leitenden Dichtergeister willen, sondern auch aus Kraft und Willen seines Regenten, des hochsinnigen Karl August. Bewußt hat er die klassische Gestaltung des geistigen Lebens seiner Hauptstadt begünstigt und erhöht. Nun hat der Geist jener Zeit, der auch den Ort mit einem Heiligenschein des Geistigen bekrönt, seine Strahlenmacht über Jahrhunderte herrschend gemacht. Schon zwölf Jahre nach Goethes Tode kam der Gewaltige einer andern Kunst, Franz Liszt, nach Weimar und zog nach sich ein Heer (oft ein recht wildes Heer) von Schülern, Zauberlehrlingen, dithyrambisch Begeisterten. Da, wo einst das klassische Wort erklungen war, ertönte nun der romantische Akkord, der übte dann auch eine gewisse Weltherrschaft, wenn auch eine zeitlich viel beschränktere. Liszt ist übrigens Weimar, das einst die lyrische Bewegtheit einer seiner schönweltlichen Leidenschaften sah, immer anhänglich geblieben bis ans Ende, trotz seiner eigentümlich großen Abschweifung nach Rom und ins Römischkirchliche.
Auch Deutschlands bizarrster, geistreichster Philosoph des Umsturzes, Friedrich Nietzsche, hat Weimar als stillen Hort nach den Schiffbrüchen seines geistigen Kampflebens gesucht. Er hat von 1897 bis 1900 dort gelebt und ist in seiner Schwester Villa Silberblick gestorben. Das Haus hat Frau Elsbeth Förster-Nietzsche jetzt mit verständnisvoller Liebe für ihren Bruder und dessen gigantische Reformversuche auf geistigem, insonderheit philosophischem Gebiete zu einem Nietzsche-Archiv umgestaltet. Einhundertundvierzehn Jahre sind hingegangen seitdem Schiller in Weimar starb und siebenundachtzig Jahre seit Goethes Tod, aber die Leuchtkraft der Erinnerung an beide ist noch so stark, daß sie den etwas abseits gelegenen, äußerlich kleinbürgerlichen Ort zu einer wahren »Lichtstadt« hat werden lassen. Das moderne Weimar birgt eine recht stattliche Zahl feiner und großer Künstler. Der herrliche Wildenbruch, der in ebenso ehern-monumentalen Zügen in seiner Dramatik zeichnet, wie in psychologisch feinen und oft zartest gehauchten Linien in seinen epischen Kundgebungen (Roman und Novelle), verbrachte seine letzte Lebenszeit hier. Ernst Hardt, der kühn Gestaltende, oft Angefochtene, aber dennoch unumstößlich Bedeutende, hat seinen Wohnsitz in Weimar; ebenso die Dichter Johannes Schlaf und Paul Ernst, ferner Wilhelm Hegeler, der für seinen »Pastor Klinghammer« mit dem Bauernfeld-Preis Ausgezeichnete; Max Geißler, der das in seiner Art klassische Buch »Das Moordorf« geschaffen und sich schon durch diese einzige Tat zu einer weithin sichtbaren Höhe aufgeschwungen. Dann der höchst verdienstvolle Geheimrat Suphan, ehemals Direktor des Goethe-Schiller-Archivs, und sein Nachfolger Geheimrat v. Oettingen, ferner Peter Gast, der Herausgeber der gesammelten Briefe von Nietzsche; Dr. Friedländer, der feine, kluge, ausgezeichnete Bearbeiter der Leixnerschen Literaturgeschichte; L. von Hofmann, der eigenartige und stark gestaltende Maler, van der Velde und so weiter. Ich bin in Weimar mit der tiefen Liebe, die mir für Goethe eigen ist, und mit meiner leidenschaftlichen Anteilnahme und Bewunderung für Schiller, hauptsächlich auf den Spuren gewandelt, welche deren Leben und Wirken gelassen haben. Und es sind mir davon, wie ich schon oben andeutete, ganz andere Eindrücke geworden durch die eigene Anschauung als sie mir vorher durch Schilderung im geschriebenen und gesprochenen Wort geweckt wurden. Vor allem der Eindruck einer beklemmenden Enge und Kargheit der äußeren Lebensformen, der sich aus der größeren Bedürfnislosigkeit jenes Zeitalters nicht allein erklären läßt. Dies Goethe-Haus, dies Fürstengeschenk einer edelmäzenatischen Zeit, das den ersten Minister des kleinen Staates beherbergte, der dazu ein wohlhabender Mann war, wie unbehaglich, wie strenge mutet es an! Wenig bequemer Hausrat an Divanen und Ruhesesseln, keine Teppiche auf den rauhen Dielen, keine wärmenden Tür- und Fenstervorhänge!
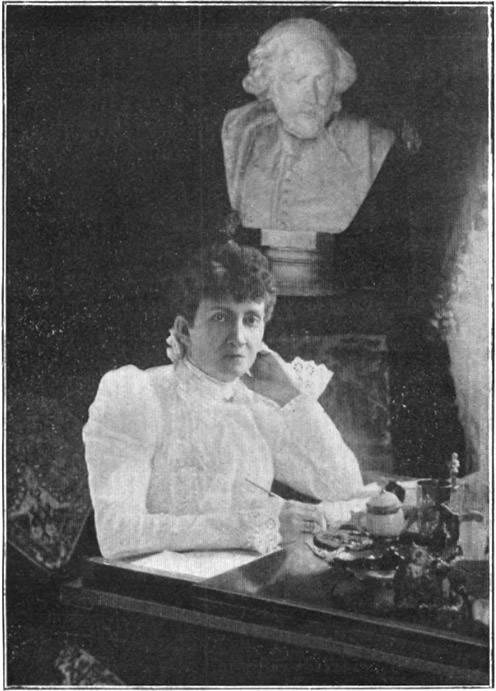
Alberta von Puttkamer
Aus den letzten Jahren
Die Kultur unserer Zeit weist ja freilich viel weichere, üppigere Züge auf, welche wohl die natürliche Folge sind von der Sehnsucht zum Ausrasten nach der nervösfiebrigen Hast, die in alle Arbeit gekommen ist. Die menschlichen Kräfte sind im größeren Wettbewerb einander näher; sie reiben und stoßen sich einander müde. Das Bedürfnis weichen Ausruhens nach nervenzehrender Hast ist eine Zeitforderung. Frühere Jahrhunderte brauchten einfach die weichen Stützen und Ruhepolster für ihre Kraft nicht, das heißt die größere Behaglichkeit und Bequemlichkeit in den äußeren Lebensformen. Dazu kommt wohl auch, daß die Verbreitung der Industrie ein viel bedeutenderes Angebot von Hilfsmitteln zur Verschönerung und Behaglichkeit des Lebens bringt. Dinge, die einem jetzt auf allen Gassen geboten werden, mußte man damals mühevoll suchen. Aber im Goethe-Haus lebt noch etwas besonders Strenges, wie eine absichtliche Abwendung von behaglicher Häuslichkeit. Neben Zügen von pompöser Repräsentation (die museumartigen Empfangsräume) erscheint überall das strenge Antlitz der Arbeit, die sich jede sinnenschmeichelnde und sinnenreizende Anmut der Umgebung fernhielt. Nur sich geistig sammeln, sich nicht zerstreuen, das predigen diese ernsten Räume ... Vielleicht auch fand der weltschweifende Geist Goethes mehr in der Allnatur und in den grenzenlosen Gefilden der Kunst seine beste Heimat und das Haus war ihm nur die eng umgrenzte Stätte für Arbeit und die körperlichen Forderungen des Lebens: Schlaf, Nahrung und so weiter. Dabei mutet es wie ein seltsamer Widerspruch an, daß Goethe gern in diesem etwas ungastlich dreinschauenden Heim Gastlichkeit übte. Etwas aber, das sich weder aus der damaligen Kultur noch aus Goethes geistigem Wesen erklären läßt, ist die lässige Verschanzung gegen die Unwirtlichkeit vom Wetter. Goethe war, wie bekannt, sehr empfindlich gegen Kälte und Zugwind, dennoch hat das für jene Zeit prächtige Haus kein einziges Doppelfenster und sein Schlafzimmer hatte keine Heizungsmöglichkeit. Daß das Studierzimmer und die Bibliothek des Geistesgewaltigen die strengen Züge der Arbeit trugen, ist tief überzeugend. Ehrfurcht vor dem ehernen Willen zur geistigen Tat läßt den späten Beschauer sein Haupt neigen vor solcher Größe. Aber über der Schwelle, wo Goethes Schlafgemach beginnt, da sollten andere Geister geherrscht haben ... Hier ruhte und hier starb der Herrliche. Warum ließ man ihn und warum blieb er in diesem gruftähnlichen, niedrigen Gemach, dessen einziges Fenster verschattet war von hohen Gartenbäumen? Ein Bett, in dem diese mächtigen Glieder doch kaum gestreckt ruhen konnten, davor ein elendes Stückchen Teppich. Kein Ofen, um eine gastliche Flamme in ihm zu nähren – und wenn der Wind durch den Garten und die alten Gassen fuhr, dann bot ihm das leichte Fensterlein keinen Schutzwall, sondern der schaurige Sturmhauch flog bis an die Stirne des Herrlichen, der gewiß von den Nächten weiche, warme Ruhe nach werkvollen Tagen fordern konnte. Nie mehr kann ich den würgenden Eindruck aus mir lösen, den ich in Goethes Sterbezimmer hatte ... Wie hat man ihn in diesem »Mauerloch« krank sein und sterben lassen! In den sonnenvollsten, schönsten Raum des Hauses hätte man ihn betten müssen, in weiche Decken und schwellende Pfühle, und ihm seine liebsten Bilder hineintragen, damit seine scheidenden Blicke auf der besten Liebe seines Lebens, der Kunst, geruht hätten, und nicht auf der elend getünchten Wand eines ungeschmückten Raumes! ... Daß Goethe sieben Jahre lang im sogenannten Gartenhaus glücklich lebte und dichtete, ist vielleicht der redendste Beweis dafür, daß er sein Heim nicht im Haus, sondern im Zauber vielgestaltiger Natur suchte und fand. Das Gartenhaus ist enge, arm an Raum und Licht. Die schlecht bewahrten Fenster hat Frau von Stein mit ganz einfachen, dünnen Gardinchen eigener Arbeit geschmückt. Es ist unwirtlich und kahl im Innern, aber es hat die farbenreichste Dekoration von Bäumen, zartfiedrigen Büschen und Blumen. Der große Park schaut tief ins Haus, und in den drei schönen Jahreszeiten: Lenz, Sommer, Herbst, können die smaragdenen Baumschatten als Tapeten, die vielblumigen Gartengründe als Teppiche und die Bänke und die Tische im Garten als bequemer Hausrat gelten. Die Natur ist ihm eben dann sein Haus geworden ...
Sinnend schritt ich zum Schiller-Haus. Der Jenaer Professor mit knappen Einnahmen, der vom hochsinnigen Karl August einen Jahresgehalt von tausend Talern bezog, hat wohl einfach, aber entschieden behaglicher gewohnt in seinem Stockwerk als die Minister-Exzellenz in ihrem geräumigen Hause. Wärmere, anmutendere Lebensformen scheinen ihn umgeben zu haben. Wohl möglich erscheint meine Annahme, daß die leitenden Frauenhände den Charakter der beiden Häuslichkeiten beeinflußten, und daß die sinnige, feine Charlotte von Lengefeld mit mehr Reiz und Behaglichkeit im Hause waltete als die rasche, gröber geartete Christiane Vulpius und die etwas kühle Sophie Pogwisch ... Eine wehmütige Weihe liegt auf Schillers Wohnräumen, vorzüglich auf seinem Schlaf- und Sterbezimmer ... Hier fand dies strömend reiche Leben seine frühe Grenze ... Ein Gedanke trat mir scharf in die Erscheinung, der eigentlich so natürlich sich ergibt, dem ich aber noch kaum begegnet bin, wenn im geschriebenen oder gesprochenen Wort die Größe der beiden Herrlichen verglichen und gemessen wird ... Wozu überhaupt Helden nach Maßen messen und wägen? Jeder ist ein unmeßbarer Wert – aber, wenn man sie denn schon einmal messen will, dann soll man's mit dem Stab der Gerechtigkeit ... dann heißt es, das Schillersche Lebenswerk mit dem Goetheschen vergleichen im Raum der gleichen Jahre. Schiller starb mit sechsundvierzig Jahren. Er hatte bis zu diesem eben reifen Mannesalter Gipfel erreicht von gigantischen Linien. Meisterschöpfungen: Wallenstein, Carlos, überhaupt alles, was er geschaffen, liegt innerhalb dieser Grenze. Dem darf man daher nur die Goetheschen Schöpfungen auch bis zu seinem sechsundvierzigsten Jahre entgegenstellen, also bis 1795! Bis dahin aber waren erst die Fragmente zum ersten Teil des »Faust« erschienen (der erste Teil vollendet erschien bekanntlich erst 1808), »Götz«, »Werther«, »Egmont«, »Tasso«, »Reinicke Fuchs«. Nach 1795, also nach Goethes sechsundvierzigsten Jahre, erschienen erst »Wilhelm Meisters Lehrjahre«, »Hermann und Dorothea«, »Faust«, erster Teil, »Wahlverwandtschaften«, »Wahrheit und Dichtung«, »Wilhelm Meisters Wanderjahre«, »Faust«, zweiter Teil, – also sein bestes Lebenswerk. Nahezu die doppelte Zahl von Schillers Lebensjahren war Goethe gegönnt. Goethes dichterisches Schaffen bis zum sechsundvierzigsten Jahre bringt noch nicht so gewaltige Höhen wie das Schillers, der schon mit vierzig Jahren der Welt die kostbare Trilogie des »Wallenstein« schenkte. – Schiller ist nie in die geruhigen Täler der friedvollen Beschaulichkeit gekommen; er war noch im Ansturm zu den Gipfeln, im ersten Ausrasten nach erstiegenen Höhen. Sechsundvierzig Jahre nur! Die eben reife Manneskraft ... Was hätte dieser Herrliche noch geschaffen! Unwillkürlich nahm der Gedanke Besitz von mir. Es ist nicht etwa müßig, ihm nachzugehen, denn man kommt auf sehr tiefsinnige Wege der Erkundung von dem Mysterium des schaffenden Menschengeistes ... In Weimar wird eine Karte verkauft: der alternde Goethe, noch jung in dem herrlich beseelten Ausdruck seiner Züge, steht sinnend da, einen Totenkopf in der Hand. Es ist Schillers Schädel, darunter die Worte: »Geheim Gefäß, Orakelsprüche spendend – Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten!« In diesem Bilde scheint mir die ganze großartige und rührende Schätzung des Überlebenden für den früh Abberufenen zu liegen ... Diese Freundschaft, die so tief versteht und anerkennt, diese Freundschaft zwischen Goethe und Schiller ist wohl das schönste Heldengedicht der Weltliteratur.
Ich ging den Parkhang »am Horn« hinab. Ganz feine Schleierlein in einem so lichten Grün, wie man es nur manchmal in Muschelopalen sieht, wehten erst an den Bäumen, und ein so herber Duft umflog mich, wie ihn die Sonne aus allerersten Knospen lockt ... Tauben flatterten von den alten Stadttürmen her, es war so still, daß man ihren Flügelschwung wie einen feinen Taktschlag vernahm ... da ging ich zu meinem Wagen, der abseits hielt, und fuhr gen – Tiefurt. Weit geöffnet fühlt' ich alle Tore zu meiner Seele. Sinne und Gedanken strebten allen Eindrücken entgegen ... Es ist seltsam: in der freien Natur, im Garten am »Gartenhause«, in der lieblichen Landschaft, welche die Tiefurter Allee nach beiden Seiten säumt, im Tiefurter Park, an den Ufern der Ilm fühlte ich Goethe viel näher als in seinem etwas dumpf beschränkten Hause. Und gar im Tiefurter Schlößchen, da kam mir die ganze eigenartige Zeit von damals in reizvollen Gestalten entgegen – er, stolz und froh und geistesblitzend unter ihnen ... Diese Zeit, die so anspruchslos in allem war, was zu den äußeren Lebensformen gehört, und so hochgespannt und anspruchsvoll gegenüber den seelischen Werten ... den Menschen Goethe, diesen lachenden und doch ernsten Lebenskünstler, nie habe ich ihn tiefer verstanden und in seiner heiteren Allnatur begriffen, als in dieser linden, ich möchte sagen, maßvoll lieblichen Landschaft, die so gar nichts Überschwengliches in Linien und Farben hat ... Leise raunten die Wellen der Ilm an den Ufern, die einst die frohen und sinnigen Spiele der »Fischerin« gesehen hatten ... Ein beweglicher Abendwind kam über Land und es klang wie ein ganz fernes, fernes Lachen darin ... Mein Wagen glitt langsam zwischen den alten, maiknospenden Bäumen des Weges dahin. Die Türme und Dächer Weimars stiegen in silbernen Linien auf. Der junge Mond flimmerte über ihnen ...
Diese kleinbürgerliche und doch so weltbürgerliche Stadt, in wie gewaltigem Bann sie die Nachlebenden hält! Dies Wandeln auf den Spuren der geliebten Meister ist fast wie eine Taufe mit dem heiligen Geist jener Zeit.
Aus Traum und Erinnern trat ich in die zerrende Hast der Gegenwärtigkeit zurück, aber der Heiligenschein jener stolzen Vergangenheit breitet sich wie ein unverlöschliches, zartes Lebensglühen über der grausam harten Unrast des »Heut« und beglänzt die sich überstürzenden Bilder wechselnder Eindrücke mit einem sinnigen Leuchten. –
Und heut, heut ist der allen Deutschen geheiligte Ort der Sammelpunkt für die Volksauserwählten geworden. Diese geklärte Stille, in der noch die größten deutschen Geister wie lebendige Erinnerungen schweben, dies Weimar soll der edle Hintergrund sein für die Nationalversammlung.
Nie haben wir der Zusammenfassung unsres besten Seins und Wesens so bedurft, als jetzt in der recht- und zügellosen Zeit, in der man mehr die Spuren teuflischen Waltens merkt, als das Walten eines guten Gottes. Es geht durch die Religionen und Philosophien aller Völker: Heiden, Christen, Juden, Mohammedaner, Buddhisten eine gegensätzliche Dualität zweier Mächte, der schaffenden, pflegenden, schützenden, das heißt Gott, und der zerstörenden, vernichtenden, bösen ... Das Wesen der beiden ist durch alle Zeiten und Kulturen fest bestimmt; ob sie Jehovah und Belzebub, Ormuzd und Ahriman, Odin und Loge, Zeus und Pluto, Gott und Teufel heißen, sie sind die scharfen Gegensätzlichkeiten, die endlich und unendlich im Kampf miteinander sind. Die Menschheitsgeschichte beweist wohl, daß alle Mächte, die der Gottheit dienen oder Teile ihres Wesens darstellen, an sich sieghafter und mehr bestimmt sind zur wahren und letzten Herrschaft. So die Gerechtigkeit, die Güte, die Barmherzigkeit, die Wahrheit, die Liebe und andere, während die böse Macht, nennen wir sie den Teufel, wohl vorübergehende Siege und Übergewicht erringen, aber nie völlig und endgültig triumphieren kann. Dies Schauspiel vollzieht sich nun, und noch dazu besonders eindrucksvoll in der Geschichte der Gegenwart. Der Volksmund nennt es in seinem naiven Instinkt für das Richtige: »Gott hat uns verlassen.« Aber nein! Nicht die göttliche Macht hat uns verlassen, sondern sie ist nur von der Übermacht des Bösen in den Hintergrund gedrängt und zeitweise niedergezwungen worden. Die böse Macht, das Teuflische, ist in allen gräßlichen Zügen bei unsern Feinden zu schauen, zu spüren und schneidend zu empfinden. Absolut teuflische Kräfte herrschen dort: Ungerechtigkeit, schamlose Lüge, Rache, Heuchelei, Haß, Vernichtungswillen und Zerstörungs lust; denn wie ist die Schändung unsrer Denkmäler anders zu erklären? Wir können aus diesem Vernichtungssturm, der uns niedergeworfen hat, nur siegend hervorgehen, wenn wir zwei Kräfte dem teuflischen Geist entgegensetzen: eine passive und eine aktive. Die passive müßte sein: Geduld, die uns zu ertragen lehrt, wo wir und weil wir mit unserm eingeengten materiellen Können die Dinge nicht mehr zu meistern fähig sind. Und die aktive wäre: das Zusammenfassen und in eins drängen alles dessen, was gut, gerecht, wahr, stark, Gott ähnlich in uns ist. Diese deutsche Kraft, die jeder von uns zum höchsten Zusammenschluß bringen soll, muß unser Sieg über die böse Macht werden, die jetzt ein Reich von tausend Teufeln unsern ehemals so stolzen, kräftigen Nacken beugt. – Das sind Gedanken von der Nacht- und Höllenseite des Lebens, wie sie uns freilich die Gegenwart auf jedem Schrittbreit Weges entgegendrängt. So gilt es, sich abzuwenden und den Weg zu helleren Eindrücken zu suchen. Träumend und noch wie geschlagen von der häßlichen und grimmigen Erkenntnis des gegenwärtigen Geschehens, fühle ich mich, da steigen mir schon aus Vergangenheiten lebensvolle Bilder auf; sie führen mich in eine lachende Ebene von Bayern. Hochsommer ist's und die Luft zittert und singt wie mit feinstem Anklingen von Glas. Es sind die kleinsten Insekten, die zartestgeflügelten, die solch eine holde Melodie in der Luft spielen ...
Ich bin auf der Fahrt zu Hubert Herkomer. Es war ein wundervoller Augusttag, einer der seltenen Tage, die unter dem Zauber von Blumen und Frucht stehen; noch volles sommerliches Blühen und schon herbstliches Reifen. Die Zeit der reichsten Formen und Farben in der Natur. Landsberg heißt das kleine, ziemlich weltabseits gelegene oberbayerische Städtchen, in dem Herkomer meist seine Sommerstille sucht. Ein Ort, den seine kindliche Liebe und Dankbarkeit ihn immer wieder finden läßt. Seine unsäglich geliebte Mutter starb hier, und das Dorf Waal, in dem er geboren ist und aus dem die Familie Herkomer, ein Schlag starker, talentvoller Handwerker stammt, ist ganz nahe. Die Landschaft zeigt klare, ruhige Linien. Eine weite Sicht ins Land, ohne starke Höhen. Etwas Sinniges, milde Träumerisches liegt auf dem Städtchen, dem Reste von düsteren Festungswällen, enge Gassen mit altgiebeligen Häusern und viele dunkelernste Kirchen einen mittelalterlichen Zug aufprägen ...
Etwas abseits vom Städtchen, hart an den reichumbuschten Ufern des Lech, der hier fast stürmisch lebhaft strömt, ragt ein eigenartiges Bauwerk. Es ist der berühmte »Mutterturm«, den Herkomer zum Andenken an seine heißgeliebte Mutter hier erbaute. Er steigt in kräftig wirkendem Tuffstein, die leicht wellige Ebene beherrschend, empor und leuchtet mit seinen vergoldeten Dächern stolz und ganz eigenartig ins Weite. Neben dem Turm mit seinen edel imponierenden Linien, steht einige Schritte entfernt ein ganz schlichtes, einstöckiges Landbauernhaus; es enthält einige sehr primitive Wohnräume ohne jeden künstlerischen Schmuck. Hier wohnte in ihren letzten Lebensjahren und starb des Künstlers Mutter. Die Absicht tritt sichtlich hervor, die ganz einfachen Formen und Linien der Umwelt jener einfachen Frau zu wahren. Eine schlicht bürgerliche, bäuerliche Sphäre ...
Hier wohnt auch Herkomer, wenn er Sommers Muße sucht von seinem großartig werkreichen Winterleben in England; richtiger gesagt: hier in dem kleinen Häuschen vollzieht sich sein leibliches Sein, hier schläft er, nimmt seine Mahlzeiten und so weiter, während er in dem Turme seinem geistigen Leben Nahrung und Bewegung zuführt: hier studiert und arbeitet er. Der »Mutterturm« ist eben für ihn eine geweihte Stätte, eine Sphäre der Feierlichkeit, in der nur für die erlauchteren Lebensbetätigungen Raum ist. Hier empfängt auch Herkomer seine Besuche. Der allererste Blick auf ihn brachte mir eigentlich eine Enttäuschung.
Die Erscheinung wirkt wie die eines englischen Reverend. Der sehr mächtige Blick, der faszinierend ist, könnte auch von Glaubensgewalt so leuchten. Ich trug Herkomers frühere Bildnisse scharf in meinem Geist geprägt. Diesen schwärmerischen Künstlerkopf mit den großen, stolzen Linien (ich hatte immer nur Brustbilder von ihm gesehen) dachte ich mir auf einer hohen, schlanken Gestalt. Die Erscheinung, die mir entgegentrat, war kaum mittelgroß. Auf den Bildern, die ich kannte, deckt ein weicher, gekräuselter Vollbart die untere Gesichtshälfte, während das dunkele Haar (jetzt ist's ergraut), das in der Mitte gescheitelt bauscht, mit dem Bart zusammen einen reichen, charakteristischen Rahmen um die bedeutenden Züge schloß. Der Kopf gemahnte damals an gewisse Darstellungen des Apostels Johannes auf älteren Gemälden, wie man sich ihn etwa, visionär entrückt, die »Offenbarung empfangend« vorstellen mag ... Dieser sehr dekorative Bart war nun völlig verschwunden. Dadurch treten alle Linien um den Mund schattenlos hervor. Die Lippen sind weich, fast mit zärtlichen Linien gezeichnet, aber es umgibt sie ein scharf energischer Zug; zwei Gegensätze, die ja auch in seinem Wesen liegen, die aber nun, sich merkwürdig widersprechend, dicht nebeneinander gerückt sind. Den Bart hat Herkomer übrigens fallen lassen als Opfer der Bühnenerscheinung. Das ist wohl kaum bekannt und erscheint mir als ein recht interessantes Faktum. Im Jahr 1888 hatte Herkomer schon angefangen, neben den Kundgebungen seines Genies als Maler, Zeichner, Radierer und so weiter auch die musikalisch-dramatische Kunst zu pflegen. Die Oper » The Sorceress« war seine erste Tat auf diesem Gebiet. 1889 schuf er dann » An Idyl« und bald darauf (nach Coppécs » Luthier de Cremone« den » Filippo«. 1890 bis 1891 spielte er auf seinem eigenen auf seinem Landsitz Bushey erbauten Theater selbst die Titelrolle. Hierzu fiel sein Bart. Der Künstler hatte übrigens auch (er ist ein mächtiger Organisator, worauf ich nachher zurückkommen werde) die Dekorationen selbst gemalt und die Kostüme gezeichnet und fertigen lassen, so daß Theater und Aufführung allereigenste Schöpfung von ihm waren.
Durch das Fehlen des Bartes wird nun ein völlig anderes Gesamtbild des interessanten Kopfes gegeben. Ich sprach das auch dem Künstler gegenüber aus; er findet aber, es kämen durch den Bart Schatten in sein Gesicht, die falsche Linien zeichneten. Ich meine, es ist ein Opfer der Schönheit zugunsten des geistig schärfer Markierten.
Der erste Blick brachte also eine Enttäuschung, aber auch nur der erste. Auge und Stirn gewinnen offenbar noch an Bedeutung dadurch, daß sie nun diese ganz unverhüllten Züge beherrschen. Die Augen tragen seine ganze Geschichte in sich; sie haben etwas Dramatisches, ich kann es nicht besser bezeichnen. In ihnen liegt Schöpferkraft, Schöpferlust, Zärtlichkeit, Selbstbewußtsein einer Herrschernatur, Träumerei, Denkschärfe, alles, was überhaupt in seiner merkwürdigen Natur liegt. Eine gewaltige und – weiche Seele ...
Als ich an jenem Augusttage in das gotische Rundzimmer im ersten Stock des »Mutterturms« eintrat, legte Herkomer ein Buch aus der Hand. Es war ein Band Shakespeare. Dieser herrliche Mittler verband gleich unsere Geister. Herkomer hat größte Hinneigung zur Philosophie; er meinte, er habe dies Gebiet durchaus durchforscht, aber von Plato bis zu den modernsten Individualitäts-Philosophen keinen gefunden, der so alle Weltweisheit, alle Lebenserkenntnis erschöpft habe wie Shakespeare. Hierbei möchte ich eine Bemerkung machen, die ich als Ergebnis ernster Beobachtung gewonnen habe und die vielleicht eine gefundene Wahrheit ist: der große Künstler überhaupt ist viel mehr befähigt, höchste Philosophie zu geben als der Gelehrte, weil die Erkenntnis des letzteren durch den Verstand einseitiger sein muß als die Erkenntnis des Künstlers, dessen Geist noch beflügelt wird durch die Vorstellungskraft (Phantasie im höheren Sinne), welche mit ihrem Schwung die kühnsten und höchsten Gedanken findet und verbindet.
Wirklich erscheinen ja auch große Künstler, wie zum Beispiel Goethe, Shakespeare, Cervantes, Dante, Wagner, um nur einige zu nennen, Finder tieferer Lebensweisheit und -wahrheit, als sogenannte Fachphilosophen; denn diese wirken theoretischer, abstrakter und lehren eben nicht angewandte Weisheit und erprobte Wahrheit, sondern aus logischen Gründen konstruierte. Doch dies nur als Abschweifung ...
In dem Rundzimmer des Turmes fällt über dem in schönen markigen Linien ausgeführten Kamin das Bildnis einer Frau auf. Des Künstlers Mutter, von ihm gemalt! Ganz ungewöhnlich herbe Linien zeigt das Antlitz, als ob sie der Lebensschmerz gemeißelt hätte. In der Jugend- und Reifezeit dieser Frau waren ja auch Not und Kampf die strengen Meister. Der große, starke Blick der Augen, die von Tat- und Leidens- und Liebeskraft sprechen, bringt erst eine schöne Wärme in dies ernste Antlitz. Sie ist dem Sohn ganz besonders viel gewesen. Ihr Vater war in dem kleinen Dorf Waal der Schullehrer. Als solcher (das ist ja sonst traditionell in diesen stillen, weltfernen deutschen Stätten) pflegte er die Musik. Seiner Tochter Begabung dafür hatte er liebevoll ausgebildet. Väterlicherseits stammt Hubert Herkomer von einer besonders tüchtigen Handwerkerfamilie. Maurer, Schnitzer, Schreiner, die in die einfache Ausübung ihres Gewerbes aber schon bestimmt individuelle, zur Kunst strebende Züge getragen haben. Herkomers Vater und seines Vaters Brüder haben ja auch an dem nach allen Richtungen hin künstlerischen Bau und Ausschmuck seines herrlichen englischen Besitzes Lululand in Bushey regen, tätigen Anteil genommen. Als der kleine Hubert zwei Jahre zählte, wanderten seine Eltern mit ihm nach Amerika aus. In die Kampf- und Leidensjahre dort, 1851 bis 1857, und dann in die erste englische Zeit, als die Herkomers nach Southampton übersiedelten, brachte die Mutter mit ihrer Musik heitere Schönheitsakzente. Sie trug auch durch Erteilen von Musikstunden zum Unterhalt der kleinen Familie bei.
Übrigens müssen die Herkomers schon in Waal den Ruf von eigenartigen Menschen gehabt haben, da man von der Familie das Wort sagte: »Diese Herkomers tun nie etwas so wie andere Leute«. Hubert war das einzige Kind des Holzschnitzers. Es wird erzählt, daß sein Vater schon bald nach seiner Geburt den Ausspruch tat: »Dieser Junge soll mein bester Freund und ein Maler werden!« Jedenfalls eine merkwürdig zur Wahrheit gewordene Vorhersagung. Das Streben nach der Höhe der Kunst hin lag entschieden schon in der eigenartigen Betätigung Lorenz Herkomers, in seinem Handwerk, aber dann auch immer bestimmter betont in der Art der Erziehung seines einzigen Kindes. Sehr originell war des Vaters Art, den Knaben zur Landschaft- und Naturbetrachtung zu schulen. Täglicher Schulbesuch war für den in seiner Kindheit sehr schwächlichen Knaben nicht möglich. So erfand der Vater eine seltsame Lern- und Beobachtungsmethode, die zugleich dem Körper Kräftigung bot.
Er schickte den Knaben täglich ins freie Land hinaus, in Wald, Wiese und Heide mit der Weisung: » Sit and dream!« Abends wurde dann das Ergebnis des einsamen Denkens und Beobachtens mit den Eltern besprochen, und Lehren und Erläuterungen wurden von ihnen daran geknüpft.
Was dem Knaben an solchen stillen Sonnentagen der Geist der Landschaft offenbarte, was er mit seinen fein beobachtenden Sinnen, mit seinem klaren Erkennen und aus der Fülle seines Empfindens aus den Schatzkammern der Natur gefunden und aufgehoben, das hat er viel später, nachdem es seelisch voll ausgereift war, in Kunstgebilden der Welt geschenkt ...
Übrigens nicht nur durch die Wahlverwandtschaft unserer Naturen, sondern auch wohl durch die Tatsache, daß wir durch seine erste Ehe etwas verwandt sind, traten wir uns gleich bei dieser ersten Begegnung, die einen Sonnentag währte, viel näher als dies sonst wohl möglich gewesen wäre. Freilich ward mir die Erkenntnis seines innersten Wesens wohl auch durch eine gewisse hellseherische Gabe für Seelenforschung und durch meine begeisterte Hinneigung zu aller Größe und Schönheit erleichtert. Herkomer schien das auch instinktiv zu erkennen, denn als ich ihm von meiner Absicht sprach, meine Eindrücke in einer Studie niederzulegen, sagte er: » I am sure you will find the psychological side of all you saw and heard, and thereby lift your article in the rank of literature«. Hätte ich auch Lululand in Bushey geschaut, diese Schöpfung eigensten Künstlertums, so würden noch feiner ergänzende Linien in mein Bild kommen. Indessen, die großen, bestimmenden Lebenszüge habe ich tief erkannt – vielleicht auch viel zarte und feine Linien. Was vor allem imponierend hervortritt in Herkomers Genius ist die – Schöpferlust. Die natürliche Bewegung seines geistigen Wesens ist: schaffen. Seine gesammelte Kraft konzentriert sich immer zur Kunsttat. All seine Gaben prädestinieren ihn zum Schöpfer. Sein reiches, großes Herz umfaßt alle Erscheinungsformen der Welt und bringt sie sich geistig nahe, daß er sich mit ihnen durchdringt. Dann hält seine Willenskraft sie fest und gestaltet sie durch ernste Arbeit zu Kunst und – sein scharfer Geist übt das unerbittliche Zensorenamt an dem, was er geschaffen.
Es ist eine solche Disziplin in der Beherrschung der Form, in der Korrektheit im eigentlich Technischen, daß man all seinen Werken neben dem Triumph der Idee, die männlich ernste Arbeit ansieht. Es ist die Überwindung und Beherrschung des Technischen zu endgültiger Meisterschaft.
Man hat darin seine Schulung durch das Handwerk erkennen und in der scharfen Berücksichtigung und Ausbildung des Mechanischen in der Kunst, seine Abstammung von Meisterhandwerkern erschauen wollen. Ich würde meine Deutung für richtiger halten: er setzt die Strenge seines Verstandes fortdauernd zum obersten Richter über sein Können.
Schelling sagt ein gutes Wort, das mir Herkomer gegenüber in den Sinn kam: »In demselben Augenblicke zugleich nüchtern und trunken sein, das ist das Geheimnis wahrer Poesie ...« Überhaupt wahrer Kunst meine ich.
Der Flug der Phantasie verhindert den scharfen Wirklichkeitssinn, der jede Erscheinungsform beobachtet und wertet (bei Herkomer noch durch die Schulung des » sit and dream« besonders ausgebildet) davor, materialistisch zu wirken – und der scharfe Verstand und Wirklichkeitssinn wiederum legen der Phantasie, dem Hang zum Träumen, starke Zügel an. So wird das edel Maßvolle ausgelöst ... Diese Strenge gegen sich selbst, die ihm nur erlaubt, Vollendetes, Meisterliches zu geben, entstammt auch noch einem andern Grund: einer moralischen Eigenschaft; das ist der treibende, feurige Ehrgeiz, der ihn rastlos von Stufe zu Stufe emporführte, aus Lebensniederungen auf weithin beherrschende Höhen. Man hat diesen Ehrgeiz oft völlig verkannt, indem man die banalen Züge der Eitelkeit in ihm sah. Wohl ist das starke Bewußtsein seines eminenten Könnens in Herkomer, aber es kann gar nicht scharf genug betont werden, daß es nicht Überhebung, selbstgenügsames Ausruhen auf Lorbeeren oder eine zu starke Wertschätzung äußerer Ehren bei ihm bewirkt, sondern daß es die ernste Pflicht wachhält, nun auch höchste Anforderungen an eigene Leistungen zu stellen. Das » noblesse oblige« in edler Form ... Herkomer denkt so hoch von der Kunst und von der Berufung des Künstlers, daß er ein Königreich über allen Königreichen für sie bereit denkt.
Wir sprachen über Mäcenatentum und welche Pflichten die Herrscher über Gold und Staaten der Kunst gegenüber haben. Da warf er seinen Kopf zurück, und sein Blick wurde wie von einem Leuchten mächtig, als er mit starkem Ton sagte: » Das sind nicht die Könige –, wir sind die Könige«. – Er sieht die Kunst in ganz reinen und großen Linien und geriet zum Beispiel in einen heißen Zorn, als wir von der »Sezession« sprachen. Sie bedünkt ihn eine unfreie, schnöde Wirklichkeitsschilderung. Allzu großer Wirklichkeitskultus, das heißt wenn er die Linien der Gemeinheit und Häßlichkeit geflissentlich betont, ist ihm ebenso zuwider wie der geistreichelnde, verschwommene Symbolismus, der zum Verständnis erst ein beigegebenes Programm nötig hat. Und er hat recht. Der künstlerische Gedanke muß im Kunstwerk selbst Tat werden; – er muß so reich und restlos Erscheinung werden, daß für keine Erklärung Raum bleibt.
Herkomer ist ein durchaus unabhängiger, eigenartiger Genius, der sich mit der Vielkraft seines Wesens in allen Formen seiner Kunst offenbart.
Er hat sich, wie alle lebensvolleren Künstlernaturen, wohl von andern Meistern beeinflussen lassen, hat Verwandtes aus ihnen in sich hinüber gelebt und subjektiv verklärt (Walker hat ihn zum Beispiel in früher Jugend beeinflußt), aber er hat sich von keinem andern Genius führen lassen. Führerschaft und Herrschaft sind viel zu stark in ihm immanent. Er ist eben Herkomer und nur aus sich selbst zu erklären und zu verstehen. Werdegang und Schöpferkraft sind in ihm so wach, daß er immer neue Ausdrucksformen in seiner Kunst suchte und – fand. Herkomers Vielseitigkeit ist fast beispiellos in den Techniken und in den Problemen und Vorwürfen. Er schuf Ölgemälde, Aquarelle, Radierungen, Mezzotintostiche, Emailarbeiten, wie zum Beispiel den berühmten Silberschild mit Emaileinsätzen: » the triumph of the hour«. Und diese verschiedenen, mit Meisterschaft geführten Techniken übt er in den verschiedensten Charakteristiken der Kunst. Er ist gleich hervorragend als Bildnismaler (als solcher hat er vielleicht sogar am meisten Weltruhm), als Landschafter, als Maler dramatischer, lyrisch-idyllischer, tragischer Vorgänge und Lebensausschnitte (vulgo Genremaler). Ganz hervorragend an dramatischer Gestaltungskraft sind zum Beispiel » On strike«, das ich persönlich viel bedeutender finde als das hochberühmte » The last muster« die Invaliden von Chelsea, dann » Pressing to the west«, »Des Wilderers Verhaftung« und so weiter.
Herkomers ungemein reine Auffassung der Frauenschönheit ließ ihn neben den herrlichen Frauenbildnissen (ich nenne nur besonders Catherine Grant, dann die Dame in Schwarz und Lady Eden) auch Idealkörper schaffen, die als Inkarnationen des Schönheitszaubers gelten können. » All beutiful in naked purity« und » Beauty's altar« sind hier in erster Betonung zu nennen. – Sein Lebenswerk ist ein ungewöhnlich vielgestaltiges, denn außer in der reichen Galerie seiner Kunstwerke entfaltet sich sein geistiges Leben noch bedeutend nach anderen Richtungen. Er war in Oxford John Ruskins Nachfolger als Professor der Kunstgeschichte, er hat in Bushey eine Kunstschule geschaffen, wo er vorbildlich in Werken und Worten lehrt. Er hat Kunsthandwerkerstätten dort erstehen lassen, wo er wirkt und die er leitet, und alles aus eigenstem Geist und Können. Das Haus in Bushey ist allein eine Kunsttat,, die ein Menschenleben hatte füllen können. Alles, jedes Schnitzwerk, jede getriebene Eisentür, jeder gemalte Fries, jedes Gerat, jedes Möbel ist von Herkomer erdacht, von seiner Kunst geadelt und in den von ihm geschaffenen Werkstätten gemacht. Man kann wohl sagen: sein Heim trägt den Ritteradel seines Genius.
Herkomers Künstlerleben bedeutet eine merkwürdig reiche Ich-Entfaltung und ein Wort Herders über Goethe fiel mir ein, als ich ihn sah: »Ich höre nur manchmal von ihm ein Wort, und wie das auch falle, ist's ein Kerl von Geist und Leben!« – Wir sprachen bei Herkomer unter anderem von seinem wundervollen Bildnis Wagners in Aquatinta, und wie tief er alle Denker- und Dichterzüge aus dem unsympathischen Kopf herausgearbeitet habe. Auch wurde die kurze Geschichte seiner enthusiastischen Hinneigung zu dem Bayreuther Herrscher, der eine völlige Abneigung folgte, berührt. »Der Verkehr mit Wagner war eine Unmöglichkeit,« rief da Herkomer mit einem starken, überzeugten Ton, »er war der eitelste und selbstsüchtigste Mensch, der mir je begegnet ist.«
Er sprach sich dann noch sehr scharf über gewisse, in Äußerlichkeiten des Anzugs und so weiter bekundeten Kleinlichkeiten und Lächerlichkeiten der Eitelkeit aus, und meinte, daß der Gegensatz von grandiosem Künstlertum und wenig anziehendem, eitlem Menschentum zu frappierend häßlich gewesen sei bei Wagner. Merkwürdig; der Fall Nietzsche-Wagner hat da ein Seitenstück im Fall Herkomer-Wagner. Derselbe Vorgang enthusiastischer, eruptiver Entzückung und Bewunderung, und dann das jähe Sichabwenden! Übrigens ist es ja vielleicht an sich schon natürlich, daß starke Herrschernaturen von eigenartigster Gestaltung sich beim Begegnen leichter stoßen und abstoßen, als anschmiegend aneinanderfügen. – Wir traten aus dem »Mutterturm«, um in dem kleinen Bauernlandhaus, das etwa dreißig Schritt entfernt liegt, eine Mahlzeit zu nehmen, in die dazwischen sich breitenden, parkähnlichen Gartenanlagen. Sie schmiegen sich sehr malerisch an die Ufer des Lech, der silbertönig und silberfarben dahinwogt, – und sie sind alle von Herkomer gepflanzt und erdacht. Schaffen, schaffen, nur immer aus dem Nichts Gestaltungen in die Welt hinausstellen, sich das Leben zur Kunst und die Kunst zum Leben umwandeln, das ist das eigenste Element dieser Kraft- und Schönheitsnatur. – Herkomer ist durchaus Engländer von Erziehung und Geistesprägung, jedoch sind die Urstoffe von Begabung und Triebkräften ganz deutsch.
Als seines Geistes, seiner Bildung, seines Lebens Heimat empfindet er England, doch ist ihm die kleine, traute Ecke des Deutschen Reiches: Ober-Bayern, ein gut Stück Herzensheimat geblieben.
Seine Bilder mit bayrischen Motiven, wie: »Bittgang«, »Forellenfluß«, »An der Quelle«, »Der Holzknecht«, »Das erwachende Gewissen«, »Holzfäller«, »Des Wilddiebs Ende«, »Licht, Leben und Melodie« und so weiter, zeigen eine tiefbeseelte und herzenswarme Auffassung des oberbayrischen Volkswesens. Herkomer, der wenig deutsch redet, spricht aber den bayrischen Dialekt vollendet. Landsberg ist sehr stolz auf seinen weltberühmten Mitbürger. (Der Künstler ist seit 1888 deutscher Bürger, und hat seine Frau Maggy Griffith in Landsberg geheiratet.)
Ein Ewigkeitsandenken seiner Kunst hat er dem Rathaus in Landsberg gestiftet: die beiden Wandgemälde im Sitzungssaal.
Die Sonne lag noch mit rotgüldenen Lichtern über dem stillen, grünen Land, – und in den bleichen, metallenen Wellen des Lech kam ein Sprühen wie von zarten Rubinlichtern auf ... Der Abend – ich mußte heimwärts gegen München ... Ein ungewöhnlich reicher Tag ging zu Ende ... Der Wagen, der uns zur Station brachte, sollte uns noch vorher durch das Städtchen und zum Rathaus führen. Die Gassen des Städtchens, und insbesondere das Rathaus, machen einen völlig mittelalterlichen Eindruck.
So weitab in Zeit und Raum scheint das Jahrhundert der Hast zu sein, dessen Pulse ein unaufhörliches tempo di febbre haben ...
Feierlich still lag das sehr schöne gotische Treppenhaus. Unsere Schritte und unsere Worte hallten mit wunderlichen Nachtönen ...
Der Saal im ersten Stock enthält die beiden Herkomerschen weltberühmten Wandbilder, Magistratssitzungen darstellend. Am meisten fällt an den Bildern die ganz herrliche Plastik der Linien und die Perspektive auf. Auf den Gemälden öffnen sich die Fenster auf die Stadtgassen. Die Giebel draußen, das Gassenleben, die Luft sind von einer geradezu sinnetäuschenden Lebenswahrheit. Die Bänke mit dem Schnitzwerk springen vor, als ständen sie frei da, – die Köpfe der Bürger heben sich wie in bewegter Plastik heraus. Wahrlich, die Gemälde sind wie Lebensausschnitte. – – –
Herkomer ist eine der seltenen Erscheinungen, die ich Sonnennaturen nennen möchte, – die immer strahlen, immer geben, immer Leben zeugen müssen, weil sie eben die Urkraft der Gestaltung in sich haben, welche ist: die große, schaffende Wärme und das siegende Licht! – Aber auch er, der Sonnige, ist nun in die Schatten gegangen: vor einigen Jahren starb er in England. Ich denke seiner als eines Großen ...
Ich habe später noch manch eine Fahrt ins »alte, romantische Land« und überhaupt in alle namenlosen Lande der Schönheit gemacht, bis – die grausame Grenze durch mein körperliches Leiden kam. Ich ward sehr, sehr gehemmt in meiner Bewegungsfähigkeit und meine Hausschwelle wurde die unliebsame Grenze meiner Wünsche. Aber ich gestaltete mir nun mein Heim um so intimer und reizvoller, weil es meine eigentliche Welt wurde ...

Villa Johannisberg
Wohnung der Dichterin in Baden-baden
Man hat oft scherzhaft gesagt, die Villa Johannisberg auf der Höhe, wo ich wohne, sei nun ein Wallfahrtsort geworden, an dem ein stetiges Zu- und Abströmen von Menschen sich vollziehe. In diesem Scherz sind aber wohl einige goldene Körner Ernst. Als ehemals in Straßburg mein Haus so gesucht und ein solcher Sammelpunkt interessanter und im doppelten Sinne vornehmer Gesellschaft war, habe ich das viel mehr der hohen, sozialen Stellung zugeschrieben, als einer persönlichen Anziehung; jetzt aber, seit jenem Tod vor dreizehn Jahren, seitdem ich Witwe bin, keine offizielle Stellung mehr habe und etwas abseits in meiner Schwarzwaldeinsamkeit meinen Strebungen lebe, darf ich die Tatsache, daß mein Haus sehr gesucht ist, wohl freudig, doch bescheiden, als einen persönlichen Erfolg in mein Lebensbuch schreiben. Die dreizehn Jahre meiner Einsamkeit sind kostbaren Erlebens voll, aber mehr inneren als äußeren Erlebens. Man kann es wohl so in einen markanten und wahren Satz fassen: früher gestaltete ich aus dem äußeren Erlebnis das innere, – und jetzt gestalte ich aus dem inneren das äußerlich in die Erscheinung tretende. – Leonardo da Vinci sagt mit einem ernst erkennenden Wort: »Künstler, deine Kraft liegt in der Einsamkeit!« Die stillen Stunden, die leer von Weltlärm und Menschenreden bleiben, sind dann gewissermaßen die leeren Hüllen, die Inhalt fordern. Und der Begnadete, der aus sich heraus gestalten kann, der Künstler wird in der Stille der Einsamkeit nicht nur die reichsten Quellen seiner Seele rauschen hören, sondern er kann und wird seine Kraft sammeln und in eine starke Einheit fassen ...
Dies Leonardosche Wort fühlte auch ich an mir wahr werden.
Denn, wenn ich auch viel besucht und viel gesucht werde: der Grundton meines Lebens ist – Einsamkeit. Und auch ich habe in ihr meine volle Kraft gefunden! – Ich habe in den letzten Jahren vieles geschaffen, was wohl zu dem Reichsten gehört, das ich überhaupt zu bieten vermag.
Das Drama »Merlin« (es hat seine Uraufführung am 11. September 1919 hier an der ausgezeichneten »Neuen Kurhausbühne« erlebt) ist eine sehr ernste Dichtung, – durchweg in gereimten Jamben geschrieben, und behandelt ein altes Menschheitsproblem. Das Drama stellt das Ergebnis tiefer Quellenstudien englischer und altfranzösischer Legenden- und Historienstoffe und der eigengestaltenden Dichterkraft dar. Es ist ein Lebenswerk im besonderen Sinne.
Außer dem »Merlin« ist in den letzten Jahren von mir geschrieben worden: das Dichtungsbuch »Mit vollem Saitenspiel«, das Essaybuch »Aus meiner Gedankenwelt« und vor allem meine Lebensblätter. Dies Buch hier, an dem ich nun die letzten Seiten schreibe, gibt die Geschichte meines Lebens in Skizzen, von den grundlegenden Tagen meiner Kindheit an ...
Ich möchte noch einer stolzen und ergreifenden Freude gedenken, die mir zum 5. Mai, meinem Geburtstag, geworden ist. Da ward ich zur Ehrenbürgerin in meiner Vaterstadt Glogau einstimmig von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung ernannt.
Einige Zeitungen haben es ausgesprochen, daß ich die erste deutsche Frau sei, der diese seltene und hohe Auszeichnung des Ehrenbürgertums geworden ist. Der sehr schön ausgestattete Ehrenbürgerbrief begründet die Ernennung so:
»Wir ernennen Ew. Exzellenz zur Ehrenbürgerin um der hohen Verdienste willen, die Sie sich um deutsches Dichten und Denken erworben haben.«
Deutsch, ja deutsch bin ich bis zum Kerngrund meines Lebens. Und in diesem stolzen Bekenntnis mochte ich meine Lebenserinnerungen ausklingen lassen; es soll wie ein stolzer Orgelklang in einem hohen Dome wirken ... Grade weil wir in Niederungen, die uns völlig wesensfremd sind, gezwängt wurden von unsern Feinden, – grade weil dieser (zeitliche) Niederdruck unter die Höhe unserer eigenen Kultur, die dennoch unzerstört da ist, falsche Bilder von der Wahrheit der Dinge zeichnet, darum müssen wir alle, alle Kraft zusammenschließen in geeinter Sammlung, um das wieder nach außen darzustellen, was tiefinnerlich noch ist.
Teuflische Taten und Worte unserer Feinde einerseits, und sinnlose Torheit, Vermessenheit und Verkennung der Werte von weiten Schichten des eigenen Volkes andererseits, haben gebröckelt und gezerrt an dem hohen Edelbau des Deutschen Reiches; doch ohne ihn zu zerstören; wie geschäftige Schwarzseher intra und extra muros es meist künden. Aber es bedarf, um das Vernichtete aufzubauen, der stark bewegten Kraft, – der Arbeit!
Die Kraft, die uns Deutschen in so hohem Maße eignet und das Talent zur Arbeit, diese beiden, die Welten fast aus dem Nichts schaffen können, sie müssen aufgerufen werden zu höchster Entfaltung! Die Kraft muß wieder Macht werden! ... Eine gewisse Verzagtheit betont sich seit der Revolution im inneren Staatsleben. Und doch haben wir Mut, Glauben an unsre Kraft und vor allem die Liebe zum Vaterland so dringend not.
Ein erschreckender Satz erklang zuerst leis und wie tastend bei den Daheimgebliebenen, welche das ganze entsetzliche Grauen des Umsturzes mitgemacht haben; das Wort vom – Auswandern, weil es in Deutschland nun allzu schwer zu leben sei ... Und mittönend wurde der häßliche Satz laut: daß man sich schämen müsse, ein Deutscher zu sein, weil man – ehrlos geworden sei durch den Friedensvertrag. Ich möchte mit feurigen Zungen reden können, – ich möchte in meinen Worten die Kraft der Evangelisten haben, auf daß ich jene feigen Sätze mit Brandmarken zeichnen könnte, wie sie es verdienen. Ehrlos! ehrlos? Kann es ehrlos genannt werden, wenn einer unter den wühlenden Schmerzen einer Folterqual ein »Ja« hervorstößt auf irgendeine gräßliche Schuldfrage? Unter dem Zwange der Folter Ausgesagtes kann doch nie ein Schuldbekenntnis sein und kann auch niemals die Ehre antasten. Wer das behauptet ober glaubt, steht in großen Lügen oder in großem Irren. Wer tief anschaut, wer groß erkennt, weiß es, wie es um die deutsche Kraft bestellt ist. Das Schreien und Schimpfen der Kleinen wird nie die Erkenntnis der Großen antasten ...
Vor mehreren Jahrhunderten, noch zur Zeit der nicht geeinten Kraft Deutschlands, hat Giordano Bruno, der gelehrte geistreiche italienische Philosoph, der zuerst Mönch gewesen, ein starkes begeistertes Wort von den Deutschen gesagt. Er lebte ja auf seinen unsteten europäischen Fahrten auch lange in Deutschland und hat deutsches Volkswesen, auch grade in kleineren Städten, wie Marburg, Wittenberg und so weiter studiert. Er sagt: »Gib, o Jupiter, den Deutschen, daß sie ihrer Kraft sich noch mehr bewußt werden und sich höhere Ziele stecken, und sie werden nicht Menschen, sondern Götter sein!«
In der starken deutschen Volksseele soll und darf kein Raum sein für das Zurückweichen, für feiges Ausweichen vor Gefahren. Es ist deshalb ein Unding, wenn Deutsche es aussprechen, daß sie auswandern, ihr Vaterland verlassen wollen, und alles Herrliche, das dieses Vaterland geleistet hat und leisten kann; ein Unding auch war's, wenn sie hinuntersteigen wollten von den Höhen der erreichten Kultur und der höheren geistigen und sittlichen Werte, um in bequemeren Niederungen zu leben.
Voranleuchten sollte jener Brunosche Satz allen Kleingläubigen; allen, die sich unter ihre eigene Bedeutung herab ducken und bücken. Aufrecken sollen sie sich! glauben sollen sie an ihr Können und ihren ideellen Besitz, den sie wahren müssen gegen einen fast wahnsinnigen Willen der Gewaltherrschaft! – Ich bin stolz auf mein Deutschtum. Ich lasse mir meinen Glauben an die Sendung Deutschlands für die Welt- und Menschheitsgeschichte nicht herabdämmen durch die widrigen Schicksale der Gegenwart, – obgleich ich von ihrer ganzen Fürchterlichkeit erschüttert bin. –
Ich schulde gern und mit Begeisterung alles, was nur stark und gut und liebreich in mir ist, meinem heilig geliebten Vaterland ...
Und wenn ich nur ein Stück echtdeutschen Wesens darstellen konnte in dem, was ich dichte und denke, was ich spreche und handle und wirke und will, dann habe ich mein Leben erfüllt, denn ich habe nach meinen Kräften Zeugnis abgelegt für das Heiligste: für die Größe meines Vaterlandes.