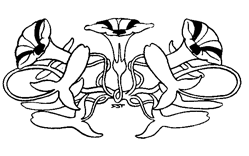|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

 Im Jahre 1721 erschienen ohne Namen und unter Angabe eines falschen Druckortes die »Persischen Briefe«, als deren Verfasser sich später Montesquieu bekannte. Doch war es von Anfang an ein öffentliches Geheimnis, daß sie aus der Feder dieses einer vornehmen Familie angehörigen und ein hohes Staatsamt bekleidenden, zweiunddreißigjährigen Mannes geflossen seien. Sie erregten ein ungeheures Aufsehen und hatten einen ungewöhnlichen buchhändlerischen Erfolg. Und das ist begreiflich. Denn sie brachten die Gedanken, die jene Zeit bewegten, zu scharfem Ausdruck und kamen durch ihre eigenartige, gefällige und reizvolle Form dem Geschmack der Leser, wie er damals war, entgegen. Was aber die Gemüter in jenen Jahren erfüllte, läßt sich am kürzesten bezeichnen als eine allseitige abfällige Kritik dessen, was der große »König-Sonne«, Ludwig XIV., getan und geschaffen hatte. Wohl niemals sonst in der Weltgeschichte ist über das Lebenswerk eines zu seinen Lebzeiten vom ganzen Erdkreis als groß bewunderten Herrschers unmittelbar nach seinem Tode ein so scharf abweisendes Urteil von seinem eigenen Volke gefällt worden, wie über Ludwig XIV. von den Franzosen. Als er am 1. September 1715 starb, ging ein Jubel der Erleichterung durch alle Herzen. Seinen Sarg, den nur wenige Höflinge zu
geleiten wagten, verfolgte das Volk von Paris mit Schmähreden und Steinwürfen. Sein Testament kassierte das bislang so sklavisch gehorsame Parlament. Als Regent für seinen unmündigen Urenkel, Ludwig XV., setzte es den Herzog Philipp von Orleans ein, von dem jeder wußte, daß Ludwig XIV. ihn niemals mit dieser Würde betraut hätte. Als der freimütige Massillon in der Sainte-Chapelle dem König die Leichenrede hielt, der sich von seinen Zeitgenossen der Große hatte nennen lassen, fuhren die ersten Worte des Kanzelredners wie ein Blitzstrahl hernieder: »Gott allein ist groß, meine Brüder,« und wie dumpfer Donner grollte es nach: »und groß besonders in diesen letzten Augenblicken, wo er den Tod verhängt über die Könige der Erde.«
Im Jahre 1721 erschienen ohne Namen und unter Angabe eines falschen Druckortes die »Persischen Briefe«, als deren Verfasser sich später Montesquieu bekannte. Doch war es von Anfang an ein öffentliches Geheimnis, daß sie aus der Feder dieses einer vornehmen Familie angehörigen und ein hohes Staatsamt bekleidenden, zweiunddreißigjährigen Mannes geflossen seien. Sie erregten ein ungeheures Aufsehen und hatten einen ungewöhnlichen buchhändlerischen Erfolg. Und das ist begreiflich. Denn sie brachten die Gedanken, die jene Zeit bewegten, zu scharfem Ausdruck und kamen durch ihre eigenartige, gefällige und reizvolle Form dem Geschmack der Leser, wie er damals war, entgegen. Was aber die Gemüter in jenen Jahren erfüllte, läßt sich am kürzesten bezeichnen als eine allseitige abfällige Kritik dessen, was der große »König-Sonne«, Ludwig XIV., getan und geschaffen hatte. Wohl niemals sonst in der Weltgeschichte ist über das Lebenswerk eines zu seinen Lebzeiten vom ganzen Erdkreis als groß bewunderten Herrschers unmittelbar nach seinem Tode ein so scharf abweisendes Urteil von seinem eigenen Volke gefällt worden, wie über Ludwig XIV. von den Franzosen. Als er am 1. September 1715 starb, ging ein Jubel der Erleichterung durch alle Herzen. Seinen Sarg, den nur wenige Höflinge zu
geleiten wagten, verfolgte das Volk von Paris mit Schmähreden und Steinwürfen. Sein Testament kassierte das bislang so sklavisch gehorsame Parlament. Als Regent für seinen unmündigen Urenkel, Ludwig XV., setzte es den Herzog Philipp von Orleans ein, von dem jeder wußte, daß Ludwig XIV. ihn niemals mit dieser Würde betraut hätte. Als der freimütige Massillon in der Sainte-Chapelle dem König die Leichenrede hielt, der sich von seinen Zeitgenossen der Große hatte nennen lassen, fuhren die ersten Worte des Kanzelredners wie ein Blitzstrahl hernieder: »Gott allein ist groß, meine Brüder,« und wie dumpfer Donner grollte es nach: »und groß besonders in diesen letzten Augenblicken, wo er den Tod verhängt über die Könige der Erde.«
So kündigte sich die Zersetzung der alten Ordnung an, die am Ende des Jahrhunderts zur Revolution führen sollte. Diese Zersetzung nun fand in den »Persischen Briefen« ihren Ausdruck. Zwei Perser, so ist die Annahme, Usbek und Rica, reisen 1711 nach Paris und beobachten die Verhältnisse während eines zehnjährigen Aufenthaltes, in dessen Mitte der Tod Ludwigs XIV. fällt, mit einem Blick, der um so schärfer und eindringender ist, als sie Ausländer, Mohammedaner, sind, die alle dem Europäer und Christen selbstverständlichen Dinge um Grund und Berechtigung ihres Daseins befragen. Wird auch den politischen Zuständen die weitgehendste Beachtung geschenkt, so ziehen doch auch alle anderen sozialen Verhältnisse in wechselnden Bildern vor dem Auge des Lesers vorüber und in einer so eigenartigen Beleuchtung, daß sie noch heute nach fast zwei Jahrhunderten zum fruchtbaren Nachdenken anregen, mag man ihre Auffassung annehmen oder verwerfen. Griff man nun damals in allen Kreisen, vorab an dem sich mit der vorangegangenen Zeit in starkem Gegensatz fühlenden Hofe, gern nach einem Buche, das diesen Gegensatz zum Ausdruck brachte, so tat die Form desselben auch das ihrige, ihm Leser zu gewinnen. Die Briefform ist die ungezwungenste, sie teilt den Stoff in kleine, leicht zu bewältigende Abschnitte, sie ist von jeder abhandlungsmäßigen Pedanterie fern und kann durch beliebigen Wechsel und Wiederaufnahme vor jeder Ermüdung bewahren. Außerdem war in die Briefe ein Roman hineingeflochten, in dem der damaligen Vorliebe für den Orient und für etwas stark gewürzte Erotik Rechnung getragen wurde, und wenn eben eine philosophische Erörterung über die höchsten Dinge angespannte Aufmerksamkeit verlangt hatte, ruhte man behaglich bei den Briefen der Eunuchen und der Haremsweiber aus, in denen diese von den mehr oder weniger pikanten Vorgängen im Serail berichteten.
In unseren Auszügen ist dies »indifferente Vehikel für die eigentliche Nahrung«, wie man es genannt hat, ausgeschieden. Nicht aus Prüderie, sondern weil es seinen Wert gänzlich verloren hat und den heutigen Leser langweilen muß. Es sind ferner die Gleichartiges behandelnden Briefe zusammengerückt, wohl auch unter einer Überschrift vereinigt. So verliert das Werk allerdings seinen rein literarischen Duft, aber ohne inneren Schaden zu nehmen, da er uns heute höchst fade vorkommen muß. Gewonnen wird damit eine größere Leichtigkeit, sich mit dem bleibenden und eigentlich wertvollen Gedankengehalt der Persischen Briefe auseinanderzusetzen.
Montesquieu war, als er die »Persischen Briefe« herausgab, bereits ein Mann von bedeutenden Kenntnissen und erprobter Erfahrung. Er stammte aus einer adligen Familie, Secondat, nannte sich aber nach ihrem Stammsitz, der nahe bei Bordeaux gelegen war, und nach einer später geerbten Baronie Charles Secondat de Montesquieu, Seigneur de la Brède. An Ereignissen, die, als sein erstes Werk erklärend, Erwähnung finden müßten, war sein Leben arm. Sein Vater wies ihn früh auf juristische Studien hin, die er mit großem Eifer und hervorragend philosophischem und historischem Sinne betrieb und die ihn bald zu eingehenden Studien der antiken Verfassungen hinleiteten. Daneben lockten und fesselten ihn aber auch naturwissenschaftliche Studien, bei denen er freilich über die vom heutigen Standpunkt aus beschränkt erscheinenden Kenntnisse seiner Zeit nicht hinausdrang, die aber immerhin seine Beobachtungsgabe schärften und ihn mit der wertvollen Überzeugung erfüllten, daß in allem menschlichen Geschehen ebenso ewige und ausnahmslose Gesetze herrschen wie in den kosmischen Vorgängen. In jungen Jahren fand er Aufnahme in die Akademie von Bordeaux und nahm zugleich als Präsident des dortigen Gerichtshofes eine hervorragende Stellung ein. Früh kam er auch nach Paris und lernte das dortige Leben kennen, zugleich aber auch seine Eigenart und seine Denkfreiheit behaupten. Es ist bezeichnend für ihn, der sich in den glänzenden Salons gern und sicher bewegte, daß er sein altehrwürdiges Stammschloß La Brède immer wieder aufsuchte, um in seiner Abgeschiedenheit und Ruhe die im geräuschvollen Leben gesammelten Eindrücke zu verarbeiten, an der Weisheit vergangener Jahrhunderte zu klären und zu Büchern zu gestalten, die ihn den ersten Geistern seiner Zeit einreihten.
1728 fand er Aufnahme unter die vierzig »Unsterblichen« der Akademie, einer der vielen Franzosen, die über die Akademie gespottet und ihr dann doch nicht ungern angehört haben. Man erzählt allerhand sonderbare, der inneren Wahrscheinlichkeit entbehrende Geschichten über das Verfahren, das er eingeschlagen habe, um die sich seiner Aufnahme in die Akademie entgegenstellenden Schwierigkeiten aus dem Wege zu schaffen. Richtig ist, daß sie vorhanden waren und daß sie überwunden wurden. Sie beruhten auf seiner allgemein bekannten, wenn auch öffentlich nicht eingestandenen Autorschaft der »Persischen Briefe«. Überwunden wurden sie unschwer in einer Zeit, der nichts heilig war, und die eine hämische Freude darob empfinden mußte, den bitteren Verspötter alles Bestehenden in jener Körperschaft zu sehen, die sich als Hüterin der nationalen Geistesgüter ausgab.
Montesquieu aber ward seiner neuen Würde nicht recht froh. In den Augen der Welt hatte sie ihm den höchsten Ruhmesglanz verliehen, den Frankreich vergeben konnte, in seinen eigenen Augen bedurfte es eines noch höheren und gediegeneren. Erfüllt von großen, aber noch unbestimmten literarischen Plänen, ging er auf Reisen, und dies in einer Zeit, wo Franzosen noch nicht zu reisen pflegten, weil ja kein Land der Welt nach ihrer Meinung sich mit ihrem Vaterlande vergleichen konnte. Montesquieu durchwanderte Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien, die Schweiz und Holland und ging, dem ihm befreundeten Lord Chesterfield folgend, im Oktober 1729 nach England, wo er bis zum August 1731 verblieb. Hatte er überall mit offenen Augen um sich geschaut und den politischen und sozialen Verhältnissen seine Aufmerksamkeit gewidmet, so machte die englische Verfassung einen besonders tiefen Eindruck auf ihn. Er ist der erste aus der Reihe bedeutender französischer Geister des 18. Jahrhunderts, die Frankreich dem englischen Einflusse öffneten, der bedeutend genug, besonders auf politischem Gebiete, gewesen ist, wenn auch die wesentliche Verschiedenheit der germanischen und der romanischen Rasse ihre hemmende Wirkung auf einem Gebiete mehr, auf dem anderen weniger äußern mußte.
Als er wieder auf seinem Stammschlosse angelangt war, verwandelte er seinen Park in einen englischen Garten, und mit dem Blick auf diese Erinnerung an das Land der großartigen politischen Freiheiten schrieb er in zweijähriger Arbeit seine »Betrachtungen über die Ursachen der Größe der Römer und ihres Verfalles«, die 1734 erschienen.
Während er in der Einsamkeit seines Schlosses arbeitete, lagen nicht nur die Quellenschriftsteller der römischen Geschichte auf seinem Tisch. Die Gedanken eines großen Italieners und zweier Franzosen gaben ihm Anregung. Jener war Macchiavel mit seinem Buch über die erste Dekade des Livius, diese Saint-Evremond mit seinen »Betrachtungen über den verschiedenen Geist des römischen Volkes zu den verschiedenen Zeiten der Republik« und seinen »Bemerkungen zu Sallust und Tacitus«, sowie endlich Bossuet mit seiner »Abhandlung über die Weltgeschichte«. Montesquieus Buch ist für den Kenner ein Zwiegespräch mit jenen, eine Auseinandersetzung mit seinen Vorgängern, die im einzelnen diese Meinungen bald verwirft, bald annimmt, im Grundgedanken aber eigenartig und bedeutend ist. Aber während die Kenntnis dieser Vorgänger für den Genuß und das Verständnis der »Betrachtungen« erläßlich ist, kann eine Kenntnis der römischen Geschichte nicht entbehrt werden. Montesquieu begleitet mit seinen »Betrachtungen« die ganze Entwicklung Roms, ohne die Tatsachen mehr als anzudeuten. Seite auf Seite dieser großen Geschichte blättert er um und schreibt nieder, was sie ihn lehrt. So bekommen die »Betrachtungen« auch oft etwas Aphoristisches, und so müssen sie auch gelesen werden. Sie verlangen ein langsames und nachdenkendes Lesen, das ihren Inhalt ausschöpft. Schätzte doch Montesquieu eingestandenermaßen die Schriftsteller gering, die alles auszusprechen für nötig halten. So gelesen gewähren die »Betrachtungen« einen hohen Genuß. Grade dadurch, daß der Leser stets etwas aus der eigenen Kenntnis und aus dem eigenen Nachdenken hinzutun muß, gewinnt er vieles, und nicht das Unbedeutsamste darunter ist das Gefühl, mit einem tiefen und eigenartigen Geiste gleichsam in persönlichen Verkehr zu treten. Was die »Betrachtungen« wertvoll macht, ist jene oben gekennzeichnete wissenschaftliche Überzeugung, von der sie getragen werden, daß allem geschichtlichen Geschehen Gesetze zugrunde liegen, die ebenso ewig und unveränderlich sind wie die der physikalischen Welt. Diese Auffassung bewahrt ihnen für alle Zeiten ihren Wert, mag auch die Forschung über Einzelheiten andere Anschauungen erarbeitet haben.
Unsere Übertragung hat wenig gekürzt und nur wenig kürzen können. Was fehlen durfte, sind einige Seitenblicke auf zeitgenössische Verhältnisse sowie einige Stellen, an denen sozusagen die künstlerische Freude am Gestalten Montesquieu ausführlicher werden ließ, als der Gegenstand unbedingt erforderte. Es liegt in der Natur der Sache, daß diese Kürzungen gegen Anfang und Schluß ausgedehnter sind. Erst mit dem 6. Kapitel entfaltet seine Darstellung sich zu ihrer vollen Eigenart und beginnt die klare Herausarbeitung der »Ursachen der Größe der Römer«. Und ebenso erlahmt sie gegen Schluß wieder, einesteils, weil, wie man deutlich durchfühlt, Montesquieu an dem langen Todeskampfe des byzantinischen Reiches nicht den gleichen inneren Anteil nimmt, wie an dem Wachsen und Verfallen Westroms, andrerseits weil für eine die wesentlichen Züge und tiefliegenden Gründe der eigenartigen Entwicklung Ostroms heraushebende Darstellung damals noch nicht die notwendigen Vorarbeiten vorhanden waren.
Schon in England hatte Montesquieu sich mit dem dritten und letzten seiner großen Werke beschäftigt, das dann 1748 erschien, mit dem Buche »Von dem Geist der Gesetze«. Es ist einerseits als eine Fortsetzung und Erweiterung der »Betrachtungen« anzusehen, andererseits aber überhaupt als das Werk, in dem er die gesamten abgeklärten Urteile über die Kulturwelt niederlegte, wie sie ihm in unermüdlicher und wiederholter Durchdenkung alles ihm aus eigener und fremder Beobachtung zur Verfügung stehenden Materials erwachsen waren. »Ich kann sagen,« schreibt er, »daß ich mein ganzes Leben lang daran gearbeitet habe. Als ich von der Schule kam, gab man mir Bücher über das Recht in die Hände: ich suchte dessen Geist.« Man erinnere sich, ehe man den »Geist der Gesetze« liest, was er im 18. Kapitel der »Betrachtungen« über die allgemeinen Ursachen sagt, die das menschliche Geschehen beherrschen, und nehme die Stelle aus dem ersten Buch des »Geistes der Gesetze« hinzu, mit denen unsere Auszüge beginnen. Von diesem Punkte aus wird man den Sinn des Titels leicht verstehen. Die »Einführung«, die er selbst seinem Buche vorausschickt, wird dann über die von ihm verfolgten Ziele aufklären. Wenn er an dieser Stelle davon spricht, daß er einen lehrhaften Zweck im Auge gehabt hat, so ist dieser in vollem Maße erreicht worden. Hat man den Verfasser der »Betrachtungen« als den Vater der modernen pragmatischen Geschichtsschreibung bezeichnet, so ist er in Rücksicht auf den »Geist der Gesetze« der erste zu nennen, der die konstitutionelle Monarchie als beste Form der Staatsregierung zu erweisen gesucht hat. In diesen beiden Leistungen liegt sein Weltruhm und die Unvergänglichkeit seines Werkes.
Außerdem aber ist hervorzuheben, daß Montesquieu sein Lebenswerk mit diesem Buche insofern abrundete, als er dem kritisch zerstörenden, mit dem er begann, ein kritisch aufbauendes an die Seite stellte und so die Beanlagung seines Geistes in diesen beiden Richtungen bekundete. Gehört er durch das erste unter jene Männer, die das ancien régime untergruben und zum Fall brachten, so gebührt ihm durch das letztere der höhere Ruhm, über die Anarchie der Revolution hinweg bereits auf die Staatsgrundsätze hingewiesen zu haben, zu denen das 19. Jahrhundert sich bekennen sollte.
Schon aus Rücksicht auf den Raum konnte aus dem sehr umfangreichen Werke nur ein kleiner Ausschnitt gegeben werden. Maßgebend war dabei der Grundsatz, aus der gewaltigen Masse, die selbst dem Verfasser stellenweise über den Kopf gewachsen ist, den seine Anschauungen enthaltenden Kern herauszuschälen.
In einem Anhange sind einige Seiten aus seinem »Verschiedene Gedanken« hinzugefügt, in denen sich manches Goldkorn findet, das der unermüdliche Denker, Leser und Beobachter auf seiner Lebensreise gesammelt hat.
Nach dem »Geist der Gesetze« hat er, wenn man von der kurzen »Verteidigung des Geistes der Gesetze« absieht, nichts weiter geschrieben. Er lebte still zurückgezogen und sah die Wirkung seiner Gedankenarbeit von Jahr zu Jahr wachsen. Er hatte das richtige Gefühl, daß er seine Arbeit getan habe. Mit erhabenem Gleichmut ertrug er den Verlust seines Augenlichtes, der ihm schon lange gedroht hatte. »Es scheint mir,« sagte er, »daß die Spur von Licht, die mir noch bleibt, nur das Morgenrot des Tages ist, an dem sich meine Augen für immer schließen werden.«
Er starb am 10. Februar 1755, sechsundsechzig Jahre alt, in Paris.