
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
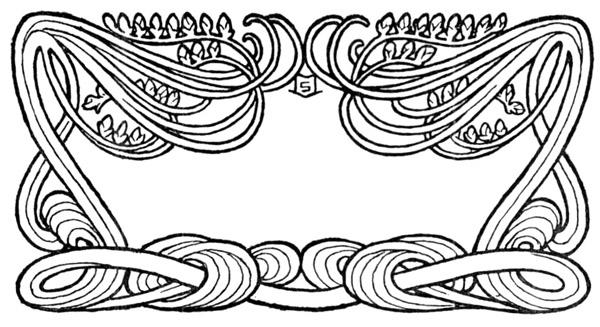
 Es empfiehlt sich sehr zu glauben, und viele Geister, welche der Ungewissheiten müde sind, in denen die Wissenschaften sie notwendigerweise belassen müssen, nehmen mit dem Glauben fürlieb, dass alles, was an unserm Erdenlose wirklich erhaben und bedeutend ist, fast ausschliesslich in dem uns umgebenden Mysterium liegt, namentlich in den beiden düstersten und furchtbarsten Mysterien, die es giebt: Tod und Verhängnis. Auch ich glaube, freilich auf meine besondere Weise, dass die Erforschung des Mysteriums in allen seinen Erscheinungsformen die edelste Aufgabe ist, der unser Geist sich widmen kann, und sie bildet auch thatsächlich das Hauptbestreben aller Derer, die in Kunst und Wissenschaft, Philosophie und Litteratur, über die blosse Beobachtung und Wiedergabe der Einzelthatsachen, der kleinen Wahrheiten und Realitäten der Erfahrungswissenschaften hinausgehen.
Sie leisten darin mehr oder weniger, sie gehen in dem, was sie wissen, mehr oder weniger weit und hoch, je nach dem Grade ihrer Ehrfurcht vor dem, was sie nicht wissen, je nach dem Umfange, den ihr Verstand oder ihre Einbildungskraft der Gesamtheit der Kräfte zuschreibt, die man nicht kennen kann. Das Bewusstsein des Unbewussten, in dem wir leben, verleiht unserm Leben eine Grösse und Bedeutung, die es nie hätte, wenn wir in dem uns bekannten aufgingen, oder wenn wir unbesehen glaubten, dass das, was wir wissen, um vieles wichtiger ist, als das, was wir nicht wissen.
Es empfiehlt sich sehr zu glauben, und viele Geister, welche der Ungewissheiten müde sind, in denen die Wissenschaften sie notwendigerweise belassen müssen, nehmen mit dem Glauben fürlieb, dass alles, was an unserm Erdenlose wirklich erhaben und bedeutend ist, fast ausschliesslich in dem uns umgebenden Mysterium liegt, namentlich in den beiden düstersten und furchtbarsten Mysterien, die es giebt: Tod und Verhängnis. Auch ich glaube, freilich auf meine besondere Weise, dass die Erforschung des Mysteriums in allen seinen Erscheinungsformen die edelste Aufgabe ist, der unser Geist sich widmen kann, und sie bildet auch thatsächlich das Hauptbestreben aller Derer, die in Kunst und Wissenschaft, Philosophie und Litteratur, über die blosse Beobachtung und Wiedergabe der Einzelthatsachen, der kleinen Wahrheiten und Realitäten der Erfahrungswissenschaften hinausgehen.
Sie leisten darin mehr oder weniger, sie gehen in dem, was sie wissen, mehr oder weniger weit und hoch, je nach dem Grade ihrer Ehrfurcht vor dem, was sie nicht wissen, je nach dem Umfange, den ihr Verstand oder ihre Einbildungskraft der Gesamtheit der Kräfte zuschreibt, die man nicht kennen kann. Das Bewusstsein des Unbewussten, in dem wir leben, verleiht unserm Leben eine Grösse und Bedeutung, die es nie hätte, wenn wir in dem uns bekannten aufgingen, oder wenn wir unbesehen glaubten, dass das, was wir wissen, um vieles wichtiger ist, als das, was wir nicht wissen.
 Man muss sich ein allgemeines Bild von dieser Welt machen. Unser ganzes moralisches und menschliches Leben beruht auf unserer Weltauffassung. Aber was ist für die Mehrzahl der Menschen, wenn man es recht besieht, eine allgemeine Weltauffassung, wenn nicht eine allgemeine Vorstellung des Unbekannten? Bei einer so wichtigen Frage mit so ernsten Folgen ist es nicht erlaubt, sich auszusuchen, was einem am besten gefällt und am meisten imponiert. Wir haben die Pflicht, das zu wählen, was uns am wahrsten oder vielmehr als das einzig wahre erscheint, denn ich glaube nicht, dass der Mensch zwischen einer scheinbaren und einer wirklichen Wahrheit ernstlich wählen kann. Eine von beiden wird ihm in gewissen Augenblicken allemal wahrer erscheinen, als die andere. Und in allem, was er thut, sagt und denkt, in Kunst und Wissenschaft, im Geistes- und Gefühlsleben, soll er sich an diese
halten. Vielleicht wird es ihm unmöglich sein, sie näher zu bestimmen, vielleicht bringt sie ihm keine befriedigende Gewissheit. Vielleicht ist sie nur ein tieferer und aufrichtigerer Eindruck als andere. Das thut nichts. Eine Wahrheit braucht, damit wir sie lieben, nicht immer unanfechtbar und endgiltig zu sein. Es ist schon viel, wenn sie uns erkennen lässt, dass die Ideen, die wir vor ihr liebten, mit der Wirklichkeit und der ehrlichen Erfahrung nicht übereinstimmten. Das reicht hin, um sie unserer ganzen Dankbarkeit würdig zu machen, bis sie schliesslich das Schicksal ihrer Vorgängerinnen teilt. Das grosse Übel, das unser moralisches Leben vernichtet und die Reinheit unseres Geistes und Charakters bedroht, ist nicht, dass man sich täuscht oder eine unsichere Wahrheit liebt, sondern, dass man einer Idee treu bleibt, die man nicht mehr ganz teilt.
Man muss sich ein allgemeines Bild von dieser Welt machen. Unser ganzes moralisches und menschliches Leben beruht auf unserer Weltauffassung. Aber was ist für die Mehrzahl der Menschen, wenn man es recht besieht, eine allgemeine Weltauffassung, wenn nicht eine allgemeine Vorstellung des Unbekannten? Bei einer so wichtigen Frage mit so ernsten Folgen ist es nicht erlaubt, sich auszusuchen, was einem am besten gefällt und am meisten imponiert. Wir haben die Pflicht, das zu wählen, was uns am wahrsten oder vielmehr als das einzig wahre erscheint, denn ich glaube nicht, dass der Mensch zwischen einer scheinbaren und einer wirklichen Wahrheit ernstlich wählen kann. Eine von beiden wird ihm in gewissen Augenblicken allemal wahrer erscheinen, als die andere. Und in allem, was er thut, sagt und denkt, in Kunst und Wissenschaft, im Geistes- und Gefühlsleben, soll er sich an diese
halten. Vielleicht wird es ihm unmöglich sein, sie näher zu bestimmen, vielleicht bringt sie ihm keine befriedigende Gewissheit. Vielleicht ist sie nur ein tieferer und aufrichtigerer Eindruck als andere. Das thut nichts. Eine Wahrheit braucht, damit wir sie lieben, nicht immer unanfechtbar und endgiltig zu sein. Es ist schon viel, wenn sie uns erkennen lässt, dass die Ideen, die wir vor ihr liebten, mit der Wirklichkeit und der ehrlichen Erfahrung nicht übereinstimmten. Das reicht hin, um sie unserer ganzen Dankbarkeit würdig zu machen, bis sie schliesslich das Schicksal ihrer Vorgängerinnen teilt. Das grosse Übel, das unser moralisches Leben vernichtet und die Reinheit unseres Geistes und Charakters bedroht, ist nicht, dass man sich täuscht oder eine unsichere Wahrheit liebt, sondern, dass man einer Idee treu bleibt, die man nicht mehr ganz teilt.
 Wenn es nur darauf ankäme, sich vom Unbekannten ein möglichst grossartiges, ergreifendes, imposantes und niederschmetterndes Bild zu machen, so thäten wir unrecht, uns eine Beschränkung aufzuerlegen. Es steht in mehr als einer Hinsicht fest, dass die schönste, rührendste und frömmste Gebärde angesichts des Mysteriums das Schweigen oder Gebet, die Furcht und Unterwerfung ist. Auf den ersten Blick scheint die völlige Hingabe und das tiefe, kaum verhaltene Grauen vor einer ungeheuren, unerforschlichen, unerkennbaren, aber wachsamen, menschlich übermenschlichen Kraft von überlegener
Weisheit und vielleicht väterlicher Gesinnung würdiger und heiliger, als eine geduldige, peinliche und schweigende Erforschung. Aber sind wir noch imstande, haben wir noch das Recht, zu wählen? Es kommt nicht mehr auf Grösse oder Schönheit der Gebärde an. Angesichts des Mysteriums wie aller anderen Dinge, und mehr noch, als bei allen anderen Dingen, geziemt sich nicht Schönheit oder Grösse, sondern Wahrheit und Aufrichtigkeit. Die Schönheit, die im Niederknieen oder im Fussfall liegt, ist durch die Vergangenheit hineingelegt worden, oder vielmehr durch etwas, das damals eine Wahrheit war. Heute ist die Gewissheit, die wir haben, vielleicht nicht grösser, aber es ist nicht mehr dieselbe Wahrheit, von der wir durchdrungen sind. Wenn wir das Unbekannte nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was es ist, so wissen wir doch wenigstens zum Teil, was es nicht ist, und wenn wir die Gebärden unserer Väter wieder annähmen, so würden wir sie auch vor dem annehmen, von dem wir wissen, was es nicht ist. Denn wenn es auch nicht unbedingt feststeht, dass das Unbekannte weder wachsam, noch persönlich, weder von überlegener Weisheit noch Gerechtigkeit ist, wenn es auch nicht unbestreitbar ist, dass es weder menschliche Gestalt, noch Pläne, weder Lüste und Laster, noch Tugenden des Menschen hat, so ist es doch ungleich wahrscheinlicher, dass es von allem, was uns als das Wesentlichste am Leben erscheint, keine Ahnung hat. Vielleicht ist in seinem ungeheuren und ewigen Weltplane der Gattung ein kleiner, vergänglicher Platz angewiesen, aber das Thun und
Lassen des gewaltigsten, des besten oder schlimmsten Einzelwesens nimmt keinen höheren Rang darin ein, als die kaum wahrnehmbaren Bewegungen der dunklen geologischen Zelle in der Geschichte der Länder und Ozeane. Wenn es auch nicht völlig ausgeschlossen ist, dass das Unsichtbare und das Unendliche über uns wachen und uns je nach unseren guten oder bösen Absichten Glück oder Leid zuwägen, unser Geschick bei jedem Schritte lenken und mit Hilfe unzähliger Kräfte und nach unerforschlichen, aber unläugbaren Gesetzen über unsere Geburt und unseren Tod, über unsere Zukunft, und über unser Leben nach dem Tode walten, so ist es doch ungleich wahrscheinlicher, dass sie alle Augenblicke in unser Leben eingreifen, aber mit gleichgiltigen, ungeheuren, blinden Kräften, die uns durchdringen und umbilden, die auf und in uns übergehen und uns beleben, ohne von unserm Dasein zu wissen, gleich wie Wasser, Licht und Luft. Aber beruht nicht unser ganzes bewusstes Leben, das unsere einzige Gewissheit bildet und den einzigen festen Punkt in Raum und Zeit – auf eben solchen ungleich grösseren Wahrscheinlichkeiten, und ist es nicht sehr selten, dass die »Ungleichheit« so gross ist, wie hier?
Wenn es nur darauf ankäme, sich vom Unbekannten ein möglichst grossartiges, ergreifendes, imposantes und niederschmetterndes Bild zu machen, so thäten wir unrecht, uns eine Beschränkung aufzuerlegen. Es steht in mehr als einer Hinsicht fest, dass die schönste, rührendste und frömmste Gebärde angesichts des Mysteriums das Schweigen oder Gebet, die Furcht und Unterwerfung ist. Auf den ersten Blick scheint die völlige Hingabe und das tiefe, kaum verhaltene Grauen vor einer ungeheuren, unerforschlichen, unerkennbaren, aber wachsamen, menschlich übermenschlichen Kraft von überlegener
Weisheit und vielleicht väterlicher Gesinnung würdiger und heiliger, als eine geduldige, peinliche und schweigende Erforschung. Aber sind wir noch imstande, haben wir noch das Recht, zu wählen? Es kommt nicht mehr auf Grösse oder Schönheit der Gebärde an. Angesichts des Mysteriums wie aller anderen Dinge, und mehr noch, als bei allen anderen Dingen, geziemt sich nicht Schönheit oder Grösse, sondern Wahrheit und Aufrichtigkeit. Die Schönheit, die im Niederknieen oder im Fussfall liegt, ist durch die Vergangenheit hineingelegt worden, oder vielmehr durch etwas, das damals eine Wahrheit war. Heute ist die Gewissheit, die wir haben, vielleicht nicht grösser, aber es ist nicht mehr dieselbe Wahrheit, von der wir durchdrungen sind. Wenn wir das Unbekannte nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was es ist, so wissen wir doch wenigstens zum Teil, was es nicht ist, und wenn wir die Gebärden unserer Väter wieder annähmen, so würden wir sie auch vor dem annehmen, von dem wir wissen, was es nicht ist. Denn wenn es auch nicht unbedingt feststeht, dass das Unbekannte weder wachsam, noch persönlich, weder von überlegener Weisheit noch Gerechtigkeit ist, wenn es auch nicht unbestreitbar ist, dass es weder menschliche Gestalt, noch Pläne, weder Lüste und Laster, noch Tugenden des Menschen hat, so ist es doch ungleich wahrscheinlicher, dass es von allem, was uns als das Wesentlichste am Leben erscheint, keine Ahnung hat. Vielleicht ist in seinem ungeheuren und ewigen Weltplane der Gattung ein kleiner, vergänglicher Platz angewiesen, aber das Thun und
Lassen des gewaltigsten, des besten oder schlimmsten Einzelwesens nimmt keinen höheren Rang darin ein, als die kaum wahrnehmbaren Bewegungen der dunklen geologischen Zelle in der Geschichte der Länder und Ozeane. Wenn es auch nicht völlig ausgeschlossen ist, dass das Unsichtbare und das Unendliche über uns wachen und uns je nach unseren guten oder bösen Absichten Glück oder Leid zuwägen, unser Geschick bei jedem Schritte lenken und mit Hilfe unzähliger Kräfte und nach unerforschlichen, aber unläugbaren Gesetzen über unsere Geburt und unseren Tod, über unsere Zukunft, und über unser Leben nach dem Tode walten, so ist es doch ungleich wahrscheinlicher, dass sie alle Augenblicke in unser Leben eingreifen, aber mit gleichgiltigen, ungeheuren, blinden Kräften, die uns durchdringen und umbilden, die auf und in uns übergehen und uns beleben, ohne von unserm Dasein zu wissen, gleich wie Wasser, Licht und Luft. Aber beruht nicht unser ganzes bewusstes Leben, das unsere einzige Gewissheit bildet und den einzigen festen Punkt in Raum und Zeit – auf eben solchen ungleich grösseren Wahrscheinlichkeiten, und ist es nicht sehr selten, dass die »Ungleichheit« so gross ist, wie hier?
 Man sollte nie über die Stunden trauern, wo ein grossartiger Glaube uns verlässt. Das Erlöschen eines Glaubens, das Springen einer Feder, das Ende der Herrschaft eines Gedankens, der uns nicht mehr beherrscht, weil wir ihn fortan zu beherrschen glauben, ist allemal
ein Zeichen, dass wir leben, dass wir weiter kommen; denn wir brauchen viele Dinge, wenn wir nicht stehen bleiben. Nichts sollte uns lieber sein, als wenn ein Gedanke, der lange unser Halt war, sich selbst nicht mehr halten kann. Und wenn wir auch nichts an die Stelle der gesprungenen Feder zu setzen haben, grämen wir uns darüber nicht! Es ist immer noch besser, es bleibt eine Lücke, als eine verrostete Feder, oder eine Wahrheit, der wir nur halb trauen. Zudem ist die Stelle auch uns scheinbar leer, denn im Grunde tritt an die Stelle einer bestimmten Wahrheit stets eine namenlose Wahrheit, die ihre Zeit erharrt und ruft. Und wenn diese Wahrheit auch scheinbar zu lange im Leeren harrt und ruft, wenn sich kein neues Gebilde gestalten will, das die alte Feder ersetzen könnte, so schafft das Bedürfnis doch schliesslich – im moralischen wie im physischen Leben – das erforderliche Organ, und die negative Wahrheit wird über kurz oder lang die Kraft in sich finden, das stillstehende Uhrwerk wieder in Gang zu setzen. Und man kann oft wahrnehmen, dass ein Leben, das nur eine derartige Triebkraft hat, oft am meisten Stärke, Begeisterung und Fruchtbarkeit besitzt.
Man sollte nie über die Stunden trauern, wo ein grossartiger Glaube uns verlässt. Das Erlöschen eines Glaubens, das Springen einer Feder, das Ende der Herrschaft eines Gedankens, der uns nicht mehr beherrscht, weil wir ihn fortan zu beherrschen glauben, ist allemal
ein Zeichen, dass wir leben, dass wir weiter kommen; denn wir brauchen viele Dinge, wenn wir nicht stehen bleiben. Nichts sollte uns lieber sein, als wenn ein Gedanke, der lange unser Halt war, sich selbst nicht mehr halten kann. Und wenn wir auch nichts an die Stelle der gesprungenen Feder zu setzen haben, grämen wir uns darüber nicht! Es ist immer noch besser, es bleibt eine Lücke, als eine verrostete Feder, oder eine Wahrheit, der wir nur halb trauen. Zudem ist die Stelle auch uns scheinbar leer, denn im Grunde tritt an die Stelle einer bestimmten Wahrheit stets eine namenlose Wahrheit, die ihre Zeit erharrt und ruft. Und wenn diese Wahrheit auch scheinbar zu lange im Leeren harrt und ruft, wenn sich kein neues Gebilde gestalten will, das die alte Feder ersetzen könnte, so schafft das Bedürfnis doch schliesslich – im moralischen wie im physischen Leben – das erforderliche Organ, und die negative Wahrheit wird über kurz oder lang die Kraft in sich finden, das stillstehende Uhrwerk wieder in Gang zu setzen. Und man kann oft wahrnehmen, dass ein Leben, das nur eine derartige Triebkraft hat, oft am meisten Stärke, Begeisterung und Fruchtbarkeit besitzt.
Schliesslich könnte der Glaube auch ganz und gar vergehen, ohne uns etwas von dem zu nehmen, was wir ihm gegeben haben; und unser aufrichtiges, frommes und selbstloses Trachten, ihn zu veredeln, zu erweitern und zu verschönern, ist nicht umsonst gewesen. Jeder Gedanke, um den wir ihn bereichert, jedes gute Opfer, das wir seinetwegen gebracht haben, hinterlässt seinen Eindruck in unserem moralischen Wesen. Der Leib vergeht, aber der Tempel, den er gebaut hat, bleibt stehen, und der Raum, den er erobert hat, schrumpft nicht zusammen. Und darum ist es keine vergebliche Arbeit, sondern ein Werk, auf das man nie verzichten soll, den kommenden Wahrheiten Häuser zu bauen, die Kräfte, die ihnen dienen werden, in gutem Stand zu halten, und Raum in sich zu schaffen.
 Ich kam auf diese Dinge, als ich kürzlich einen Blick auf verschiedene kleine Dramen zu werfen hatte, die ich geschrieben habe. Sie zeugen von den Schmerzen eines Geistes, der zu tief ins Mysterium hineingeraten war, Schmerzen, die, wenn auch verzeihlich, so doch nicht mehr unvermeidlich genug sind, dass man das Recht hätte, stolz darauf zu sein. Die Triebfeder dieser kleinen Dramen war die Angst vor dem Unbekannten, das uns umgiebt. Der Dichter glaubte – oder vielmehr war es ein dunkles dichterisches Gefühl, denn auch bei den ehrlichsten Dichtern muss man oft das instinktive Gefühl von ihrer Kunst und den Gedanken ihres wirklichen Lebens trennen – der Dichter glaubte darin an ungeheuere, unsichtbare Schicksalsmächte, deren Absichten völlig unbekannt sind, die aber im Sinne des Dramas mit bösem Willen über unser Thun und Lassen wachten und dem Leben, dem Lächeln, dem Frieden und der Liebe feind waren. Vielleicht waren sie im Grunde genommen gerecht, aber nur, wenn sie zürnten, und sie übten die Gerechtigkeit auf eine so unterirdische und gewundene Weise,
so fern und langsam, dass ihre Züchtigungen – denn sie belohnten nie – sich wie willkürliche und unerklärliche Akte des Geschickes ausnahmen. Mit einem Wort, es war so etwas wie die christliche Gottesidee in Verbindung mit dem antiken Schicksalsgedanken, und in die undurchdringliche Nacht der Natur verstossen; von hier aus suchten sie Gedanken, Pläne, Gefühle und Glück der Menschen zu belauern, zu verwirren und zu verdüstern, und hatten ihre Freude daran.
Ich kam auf diese Dinge, als ich kürzlich einen Blick auf verschiedene kleine Dramen zu werfen hatte, die ich geschrieben habe. Sie zeugen von den Schmerzen eines Geistes, der zu tief ins Mysterium hineingeraten war, Schmerzen, die, wenn auch verzeihlich, so doch nicht mehr unvermeidlich genug sind, dass man das Recht hätte, stolz darauf zu sein. Die Triebfeder dieser kleinen Dramen war die Angst vor dem Unbekannten, das uns umgiebt. Der Dichter glaubte – oder vielmehr war es ein dunkles dichterisches Gefühl, denn auch bei den ehrlichsten Dichtern muss man oft das instinktive Gefühl von ihrer Kunst und den Gedanken ihres wirklichen Lebens trennen – der Dichter glaubte darin an ungeheuere, unsichtbare Schicksalsmächte, deren Absichten völlig unbekannt sind, die aber im Sinne des Dramas mit bösem Willen über unser Thun und Lassen wachten und dem Leben, dem Lächeln, dem Frieden und der Liebe feind waren. Vielleicht waren sie im Grunde genommen gerecht, aber nur, wenn sie zürnten, und sie übten die Gerechtigkeit auf eine so unterirdische und gewundene Weise,
so fern und langsam, dass ihre Züchtigungen – denn sie belohnten nie – sich wie willkürliche und unerklärliche Akte des Geschickes ausnahmen. Mit einem Wort, es war so etwas wie die christliche Gottesidee in Verbindung mit dem antiken Schicksalsgedanken, und in die undurchdringliche Nacht der Natur verstossen; von hier aus suchten sie Gedanken, Pläne, Gefühle und Glück der Menschen zu belauern, zu verwirren und zu verdüstern, und hatten ihre Freude daran.
 Dieses Unbekannte nahm zumeist die Gestalt des Todes an. Die unendliche, düstere, heimtückisch-geschäftige Gegenwart des Todes erfüllte diese ganzen Stücke. Das Rätsel des Daseins wurde nur durch das Rätsel seiner Vernichtung beantwortet. Und obendrein war dieser Tod eine gleichgiltige und unerbittliche, blindlings drauflostappende Macht, die mit Vorliebe die Jüngsten und am wenigsten Unglücklichen dahinraffte, nur weil sie etwas weniger thatlos waren, als die Übrigen, und jede zu lebhafte Bewegung in der Nacht seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Es waren auch nur kleine, zarte, zitternde und thatlos grübelnde Geschöpfe, die einen Augenblick am Abgrund taumelten und schluchzten, und ihre Worte und Thränen erhielten nur dadurch ihre Bedeutung, dass sie mitsamt in den Abgrund stürzten und dass dieser Sturz bisweilen einen Widerhall weckte, der die Annahme zuliess, der Abgrund sei bodenlos, weil der Schall, der daraus hervordrang, dumpf und verworren war.
Dieses Unbekannte nahm zumeist die Gestalt des Todes an. Die unendliche, düstere, heimtückisch-geschäftige Gegenwart des Todes erfüllte diese ganzen Stücke. Das Rätsel des Daseins wurde nur durch das Rätsel seiner Vernichtung beantwortet. Und obendrein war dieser Tod eine gleichgiltige und unerbittliche, blindlings drauflostappende Macht, die mit Vorliebe die Jüngsten und am wenigsten Unglücklichen dahinraffte, nur weil sie etwas weniger thatlos waren, als die Übrigen, und jede zu lebhafte Bewegung in der Nacht seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Es waren auch nur kleine, zarte, zitternde und thatlos grübelnde Geschöpfe, die einen Augenblick am Abgrund taumelten und schluchzten, und ihre Worte und Thränen erhielten nur dadurch ihre Bedeutung, dass sie mitsamt in den Abgrund stürzten und dass dieser Sturz bisweilen einen Widerhall weckte, der die Annahme zuliess, der Abgrund sei bodenlos, weil der Schall, der daraus hervordrang, dumpf und verworren war.
 Es ist nicht unvernünftig, aber auch nicht erspriesslich, das Leben derart anzuschauen, und ich hätte erst garnicht davon angefangen, wenn daraus nicht hervorginge, dass diese Anschauung oder eine Anschauung ähnlicher Art, sobald das geringste Unglück geschieht, im Grunde von den meisten Menschen geteilt wird, selbst von den lebensvollsten, den besonnensten und ruhigsten. Und in der That werden wir im gewissen Sinne ja auch stets – trotz allem, was wir lernen, trotz allen Eroberungen, die wir machen, trotz allen Gewissheiten, die wir vielleicht erlangen werden – kleine, schwache und unnütze Wesen bleiben, die dem Tode geweiht und den Launen der achtlosen und masslosen Mächte ausgesetzt sind, die uns umgeben. Wir erscheinen einen Augenblick im unermesslichen Raume und haben keine andre ersichtliche Aufgabe, als die Fortpflanzung einer Art, die selbst wieder keine ersichtliche Aufgabe hat im Getriebe eines Weltalls, dessen räumliche und zeitliche Ausdehnung der kühnsten und gewaltigsten Phantasie Hohn spricht. Das ist eine der tiefen, aber negativen Wahrheiten, die der Dichter wohl einmal berühren kann, bei der sich aber der tausendfältig gebundene Mensch, der im Dichter lebt, nicht allzulange aufhalten sollte. Es giebt eine Fülle von grossen und verehrungswürdigen Wahrheiten, in deren Bannkreis einzuschlafen nicht gut ist. Wir sind von so vielen Wahrheiten umgeben, dass es nur sehr wenige Menschen giebt, und selbst die schlechtesten bilden
davon keine Ausnahme, die nicht eine grosse und verehrungswürdige Wahrheit als Beraterin und Führerin haben.
Es ist nicht unvernünftig, aber auch nicht erspriesslich, das Leben derart anzuschauen, und ich hätte erst garnicht davon angefangen, wenn daraus nicht hervorginge, dass diese Anschauung oder eine Anschauung ähnlicher Art, sobald das geringste Unglück geschieht, im Grunde von den meisten Menschen geteilt wird, selbst von den lebensvollsten, den besonnensten und ruhigsten. Und in der That werden wir im gewissen Sinne ja auch stets – trotz allem, was wir lernen, trotz allen Eroberungen, die wir machen, trotz allen Gewissheiten, die wir vielleicht erlangen werden – kleine, schwache und unnütze Wesen bleiben, die dem Tode geweiht und den Launen der achtlosen und masslosen Mächte ausgesetzt sind, die uns umgeben. Wir erscheinen einen Augenblick im unermesslichen Raume und haben keine andre ersichtliche Aufgabe, als die Fortpflanzung einer Art, die selbst wieder keine ersichtliche Aufgabe hat im Getriebe eines Weltalls, dessen räumliche und zeitliche Ausdehnung der kühnsten und gewaltigsten Phantasie Hohn spricht. Das ist eine der tiefen, aber negativen Wahrheiten, die der Dichter wohl einmal berühren kann, bei der sich aber der tausendfältig gebundene Mensch, der im Dichter lebt, nicht allzulange aufhalten sollte. Es giebt eine Fülle von grossen und verehrungswürdigen Wahrheiten, in deren Bannkreis einzuschlafen nicht gut ist. Wir sind von so vielen Wahrheiten umgeben, dass es nur sehr wenige Menschen giebt, und selbst die schlechtesten bilden
davon keine Ausnahme, die nicht eine grosse und verehrungswürdige Wahrheit als Beraterin und Führerin haben.
Gewiss, es ist eine Wahrheit, und wenn man will, sogar die gewaltigste und gewisseste aller Wahrheiten, dass unser Leben nichtig ist, dass all unser Dichten und Trachten zum Lachen ist, dass unser und unseres Planeten Dasein in der Geschichte des Weltganzen nur ein elender Zufall ist, und doch ist auch dies eine Wahrheit, dass unser Leben und unser Planet für uns die bedeutendste und selbst die einzig bedeutende Erscheinung in der Geschichte des Weltganzen ist. Welche von beiden ist da die wahrere? Und hebt die eine notwendigerweise die andre auf, oder hätten wir ohne die letztere wohl die Kraft, die erstere auszusprechen? Die eine wendet sich an unsere Einbildungskraft und kann uns in deren Bereiche nützlich sein, aber die andere geht unser leibhaftiges Leben unmittelbar an. Es ist klar, dass jede ihre Berechtigung hat. Nicht darauf kommt es an, sich an die vom Standpunkt des Weltalls wahrste Wahrheit anzuklammern, sondern an die im Sinne des Menschen wichtigste. Wir wissen nicht, ob das Weltall Zweck und Ziel hat, ob ihm am Schicksal unserer Art liegt oder nicht, und darum ist die wahrscheinliche Vergeblichkeit unseres Daseins oder unserer Art eine Wahrheit, die uns nur mittelbar angeht und für uns unentschieden bleibt. Dagegen ist die andre Wahrheit, die uns einen Begriff von der Bedeutung unseres Lebens giebt, eine Wahrheit, die zwar enger ist, uns aber augenblicklich, unmittelbar und unabweislich angeht. Es wäre verkehrt, sie einer fremden Wahrheit unterzuordnen oder zu opfern. Es ist uns gewiss erlaubt, die erste nicht aus den Augen zu verlieren, sie ist der zweiten Halt und Leuchte, sie lässt uns nicht zu ihrem eitlen und beschränkten Sklaven werden, vielmehr aus allem Vorteil ziehen, was diese nicht umschliesst. Aber wenn sie uns entmutigt und lähmt, so liegt das daran, dass wir uns nicht deutlich genug bewusst sind, welche zwar hervorragende, aber bedenkliche Stellung sie unter den wichtigsten Wahrheiten einnimmt, denn sie hängt von einer Anzahl von Fragen ab, die noch nicht gelöst sind, während die Probleme der andern in jedem Augenblick vom Leben selbst gelöst werden. Zudem ist sie noch in dem fiebernden und gefährlichen Stadium, das alle in unseren Verstand eindringenden Wahrheiten durchlaufen müssen. Ich meine die Zeit der Eifersucht und Ausschliesslichkeit, in der sie keine anderen Wahrheiten neben sich dulden. Man muss warten, bis das Fieber sich gelegt hat und die Wohnung, die wir in unserm Geiste bereitet haben, wahrhaft gross und gesund ist. Dann ist der Augenblick gekommen, wo die sich widersprechenden Wahrheiten nichts andres mehr sehen werden, als was sie eint: das Band des Mysteriums; wo sie sich stillschweigend einigen, die unter ihnen auf den Thron zu heben, zu fördern, und zu stützen, die ihre Arbeit ruhig weiter gethan hat, während die anderen aus dem Gleichgewicht kamen, die, welche am meisten Gutes stiften kann und am meisten Hoffnung bringt.
 Gegenwärtig ist nicht sonderbarer, als die Verwirrung, die in unsern Instinkten und Gefühlen, und mit Ausnahme der ruhigsten, hellsten und besonnensten Augenblicke, auch in unsern Ideen über das Eingreifen des Unbekannten oder des Mysteriums in die wirklich ernsten Ereignisse unseres Lebens herrscht. Man findet infolge dieser Verwirrung Gefühle, die keiner lebendigen, bestimmten und annehmbaren Idee mehr entsprechen, z. B. solche, die vom Dasein eines bestimmten, mehr oder minder anthropomorphen, wachsamen, persönlichen und vorsorglichen Gottes ausgehen. Man findet Gefühle, die zur Hälfte noch Ideen sind, z. B. solche, die sich auf Geschick, Verhängnis und immanente Gerechtigkeit der Dinge beziehen. Endlich findet man Ideen, die auf dem Wege sind, zu Gefühlen zu werden, z. B. die, welche den Genius der Art, die Gesetze der Entwickelung und Auslese, den Willen der Rasse u. s. w. zum Gegenstand haben. Zuletzt giebt es Ideen, die noch reine Ideen sind, und zu ungewiss, zu zerstreut, als dass man schon sagen könnte, wann sie sich in Gefühle umsetzen und somit einen ernstlichen Einfluss auf unser Handeln, unsere Stellung zum Leben, unser Glück und Unglück haben werden.
Gegenwärtig ist nicht sonderbarer, als die Verwirrung, die in unsern Instinkten und Gefühlen, und mit Ausnahme der ruhigsten, hellsten und besonnensten Augenblicke, auch in unsern Ideen über das Eingreifen des Unbekannten oder des Mysteriums in die wirklich ernsten Ereignisse unseres Lebens herrscht. Man findet infolge dieser Verwirrung Gefühle, die keiner lebendigen, bestimmten und annehmbaren Idee mehr entsprechen, z. B. solche, die vom Dasein eines bestimmten, mehr oder minder anthropomorphen, wachsamen, persönlichen und vorsorglichen Gottes ausgehen. Man findet Gefühle, die zur Hälfte noch Ideen sind, z. B. solche, die sich auf Geschick, Verhängnis und immanente Gerechtigkeit der Dinge beziehen. Endlich findet man Ideen, die auf dem Wege sind, zu Gefühlen zu werden, z. B. die, welche den Genius der Art, die Gesetze der Entwickelung und Auslese, den Willen der Rasse u. s. w. zum Gegenstand haben. Zuletzt giebt es Ideen, die noch reine Ideen sind, und zu ungewiss, zu zerstreut, als dass man schon sagen könnte, wann sie sich in Gefühle umsetzen und somit einen ernstlichen Einfluss auf unser Handeln, unsere Stellung zum Leben, unser Glück und Unglück haben werden.

 Im täglichen Leben wird man sich dieser Verwirrung nicht bewusst. Sie pflegt sich hier nicht auszudrücken, denn das tägliche Leben giebt sich nicht die Mühe, seinen Empfindungsinhalt in eine Formel zu zwingen oder durch ein Bild zu veranschaulichen. Aber sie wird sehr sichtbar bei allen, die den Beruf in sich fühlen, das wirkliche Leben wiederzugeben, zu erklären, zu deuten und die geheimen Gründe der guten und schlimmsten Geschicke aufzudecken, vornehmlich also bei den Dichtern, und unter ihnen wieder bei denen, die am unmittelbarsten mit dem äusseren Leben der That zu thun haben: den Dramatikern, wobei es übrigens wenig ausmacht, ob es sich um Romane, Tragödien, eigentliche Dramen oder historische Stücke handelt, denn ich nehme die Worte Dichter und Dramatiker im weitesten Sinne.
Im täglichen Leben wird man sich dieser Verwirrung nicht bewusst. Sie pflegt sich hier nicht auszudrücken, denn das tägliche Leben giebt sich nicht die Mühe, seinen Empfindungsinhalt in eine Formel zu zwingen oder durch ein Bild zu veranschaulichen. Aber sie wird sehr sichtbar bei allen, die den Beruf in sich fühlen, das wirkliche Leben wiederzugeben, zu erklären, zu deuten und die geheimen Gründe der guten und schlimmsten Geschicke aufzudecken, vornehmlich also bei den Dichtern, und unter ihnen wieder bei denen, die am unmittelbarsten mit dem äusseren Leben der That zu thun haben: den Dramatikern, wobei es übrigens wenig ausmacht, ob es sich um Romane, Tragödien, eigentliche Dramen oder historische Stücke handelt, denn ich nehme die Worte Dichter und Dramatiker im weitesten Sinne.
Es ist nicht zu leugnen: eine herrschende und sozusagen ausschliessliche Idee ist eine grosse Kraft für den Dichter und Deuter des Lebens, und diese Kraft ist um so unerschöpflicher und spielt in der Dichtung eine um so bedeutendere Rolle, je geheimnisvoller diese Idee ist, je schwerer sie zu prüfen oder zu bestimmen ist. Dies ist übrigens auch ganz in der Ordnung, so lange der Dichter nicht den leisesten Zweifel am Werte seines herrschenden Gedankens hegt; – und es giebt sehr gute Dichter, die sich hierüber nie Fragen vorgelegt, nie gezweifelt, nie gezaudert haben. Man denke z. B. daran, welche bedeutsame Rolle die Idee der heroischen Pflicht bei Corneille spielt, der christliche Glaube bei Calderon, die Tyrannei des Schicksals bei Sophokles.
 Die Idee der heroischen Pflicht ist menschlicher und minder geheimnisvoll als die beiden andern, und obwohl sie heute weit weniger fruchtbar ist, als zu den Tagen Corneilles – denn es giebt heute sehr wenige heroische Pflichten, die in Frage zu stellen nicht vernünftig und selbst heroisch wäre, und es wird immer schwerer, eine zu finden, die wirklich gebieterisch ist –, so kann man doch unter gewissen, wohl vorstellbaren Verhältnissen auf sie zurückkommen.
Die Idee der heroischen Pflicht ist menschlicher und minder geheimnisvoll als die beiden andern, und obwohl sie heute weit weniger fruchtbar ist, als zu den Tagen Corneilles – denn es giebt heute sehr wenige heroische Pflichten, die in Frage zu stellen nicht vernünftig und selbst heroisch wäre, und es wird immer schwerer, eine zu finden, die wirklich gebieterisch ist –, so kann man doch unter gewissen, wohl vorstellbaren Verhältnissen auf sie zurückkommen.
Aber welcher Dichter schöpfte wohl aus einem Glauben, der selbst bei den Gläubigsten nur mehr nachzitternde Erinnerung ist, noch die Kraft und Eingebung, die Calderon darin fand, als er den Christengott zur erhabenen und unsichtbaren, aber doch allgegenwärtigen, allmächtigen und allthätigen Hauptperson seiner Dramen machte? Und wer von uns kann heute noch die Tyrannei des Schicksals, jener unbeugsamen, vorherbestimmten, unentrinnbaren Macht, die den und den Menschen, das und das Geschlecht auf dem und dem Wege in das und das Unglück oder in den Tod treibt – wer von uns kann sie heute noch vernünftiger Weise glauben, heute, wo wir sehen, dass unser Leben vielen Gewalten unterworfen ist, die freilich unbekannt sind, deren tückischsten Schlägen aber die Weisesten auszuweichen lernen, und die jedenfalls blind, gleichgiltig und unbewusst scheinen? Dürfen wir heute noch annehmen, dass es eine Macht auf Erden giebt, die niederträchtig genug ist und Zeit dazu hat, nichts andres zu thun, als den Menschen zu plagen, seine Pläne zu verwirren und seine Unternehmungen zu kreuzen?
Man hat sich noch einer dritten geheimnisvollen und allgewaltigen Macht bedient: der immanenten Gerechtigkeit. Aber man darf nicht vergessen, dass das Postulat der immanenten Gerechtigkeit eigentlich niemals aufgestellt worden ist, ausser in ganz schlechten Werken, denen jede Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit abgeht. Die Behauptung, dass sich das Böse in diesem Leben mit Notwendigkeit und ersichtlich bestraft, das Gute mit Notwendigkeit und ersichtlich belohnt, wird durch die bescheidenste Lebenserfahrung zu offenkundig widerlegt, als dass ein wirklicher Dichter diesen willkürlichen und unhaltbaren Traum seinem Werke zu Grunde legen würde. Wenn man andererseits die Sorge für Lohn und Strafe dem Jenseits zuschiebt, so kehrt man auf einem Umwege in das Land der göttlichen Gerechtigkeit zurück. Wenn aber die immanente Gerechtigkeit nicht auch permanent, unveränderlich, unentrinnbar und unfehlbar ist, so ist sie nur noch eine wohlmeinende und ungewöhnliche Laune des Schicksals, und man kann dann von Schicksal, geschweige denn von Gerechtigkeit, kaum mehr reden; sie ist eben nur ein Zufall, d. h. fast nichts.
Es giebt freilich eine sehr wirkliche immanente Gerechtigkeit, kraft deren lasterhafte, grausame, niederträchtige, ungerechte und unehrliche Menschen nicht so moralisch glücklich sind, wie die guten und gerechten, die treuen, liebevollen, wohlmeinenden, unschuldigen und friedlichen Menschen. Sie lässt, wie man gesagt hat, das Böse mit derselben Unfehlbarkeit nach dem Schmerze gravitieren, wie die Erde nach der Sonne gravitiert. Aber dann handelt es sich nur um eine innere, sehr menschliche, sehr natürliche und erklärliche Gerechtigkeit, und wenn wir ihren Ursachen und Wirkungen nachgehen, so kommen wir notwendigerweise zum psychologischen Drama, und dieses Drama spielt auf einer Bühne ohne den tiefen, vom Mysterium bewachten Hintergrund, der die Ereignisse des Dramas oder der Geschichte in eine grossartige, geheiligte und bedrohliche Perspektive rückt. Aber hätte man das Recht, diesen Hintergrund dadurch wieder herzustellen, dass man auf eine Anschauung vom Unbekannten zurückgreift, die von der unser Leben beherrschenden himmelweit verschieden ist?
 Da wir einmal von herrschenden Gedanken und Mysterien sprechen, verlohnt es sich vielleicht, die verschiedenen Gestalten zu verfolgen, welche der Schicksalsgedanke bisher angenommen hat und noch täglich annimmt, denn auch heute ist das Verhängnis die letzte Instanz zur Erklärung des Unerklärlichen, und die Deuter des Lebens haben es immer noch im Sinne.
Da wir einmal von herrschenden Gedanken und Mysterien sprechen, verlohnt es sich vielleicht, die verschiedenen Gestalten zu verfolgen, welche der Schicksalsgedanke bisher angenommen hat und noch täglich annimmt, denn auch heute ist das Verhängnis die letzte Instanz zur Erklärung des Unerklärlichen, und die Deuter des Lebens haben es immer noch im Sinne.
Sie haben sich bemüht, es zu erklären, zu verjüngen und annehmbar zu machen. Sie haben die eisigen Fluten des grossen trostlosen Stromes, von dessen Ufern sich die Wohnungen der Menschen allmählich zurückgezogen haben, durch hundert neue und gewundene Kanäle in ihre Werke zu leiten versucht. Die meisten unter denen, welchen es gelungen ist, uns glauben zu machen, dass sie dem Leben einen tiefen und endgiltigen Sinn gaben, haben instinktiv erkannt, welche übermächtige Bedeutung die allzeit unverantwortliche, allzeit erhabene und entschuldbare Macht des Schicksals den menschlichen Handlungen verleiht. Das Verhängnis scheint tragisch wie keine andre Macht, und sobald es in ein Werk hineinkommt, thut es darin dreiviertel aller Arbeit. Man kann wohl sagen, dass der Dichter, der heute in den materiellen Wissenschaften, in dem Unbekannten, das uns umgiebt, oder in unserer eignen Brust ein Äquivalent für das antike Schicksal fände, d. h. eine gleich unbezwingliche, gleich allgemein anerkannte Prädestinationsidee, ganz gewiss ein Meisterwerk schaffen würde. Freilich würde er dann auch das grosse Rätselwort gefunden haben, das wir alle suchen, und unsere Annahme würde sich folglich nicht so schnell verwirklichen.
 Hier also fliesst die läuternde Quelle, deren Wasser die Poeten schöpfen kommen, um die grausamsten Tragödien reinzuwaschen. Im Menschen lebt ein Instinkt, der das Verhängnis anbetet, und alles Verhängnisvolle scheint ihm feierlich, schön und garnicht in Abrede zu stellen. Er möchte frei sein, aber es ist beruhigender, sich sagen zu können, dass man es unter gewissen Umständen nicht ist.
Eine feindselige und unerschütterliche Gottheit ist bisweilen annehmbarer, als eine Gottheit, die einen Entschluss fordert, um ein Unglück abzuwenden. Man liebt im Grunde doch die Abhängigkeit von einer Macht, die höher ist, als alle Vernunft, und was unser Geist dabei an Selbstgefühl verliert, das kommt einer Art Gefühlseitelkeit zu gute: man fühlt sich geschmeichelt, dass eine so ungeheure Macht auf alle unsre Pläne acht giebt und unseren einfachsten Handlungen eine so geheimnisvolle und ewige Bedeutung verleiht. Endlich erklärt und entschuldigt das Schicksal alles, indem es alles schwer Erklärliche und noch schwerer Entschuldbare auf gebührende Entfernung ins Unsichtbare oder Unbegreifliche versetzt.
Hier also fliesst die läuternde Quelle, deren Wasser die Poeten schöpfen kommen, um die grausamsten Tragödien reinzuwaschen. Im Menschen lebt ein Instinkt, der das Verhängnis anbetet, und alles Verhängnisvolle scheint ihm feierlich, schön und garnicht in Abrede zu stellen. Er möchte frei sein, aber es ist beruhigender, sich sagen zu können, dass man es unter gewissen Umständen nicht ist.
Eine feindselige und unerschütterliche Gottheit ist bisweilen annehmbarer, als eine Gottheit, die einen Entschluss fordert, um ein Unglück abzuwenden. Man liebt im Grunde doch die Abhängigkeit von einer Macht, die höher ist, als alle Vernunft, und was unser Geist dabei an Selbstgefühl verliert, das kommt einer Art Gefühlseitelkeit zu gute: man fühlt sich geschmeichelt, dass eine so ungeheure Macht auf alle unsre Pläne acht giebt und unseren einfachsten Handlungen eine so geheimnisvolle und ewige Bedeutung verleiht. Endlich erklärt und entschuldigt das Schicksal alles, indem es alles schwer Erklärliche und noch schwerer Entschuldbare auf gebührende Entfernung ins Unsichtbare oder Unbegreifliche versetzt.
 Man hat darum versucht, die Statue jener furchtbaren Göttin, welche die Tragödien des Sophokles und Euripides beherrscht, noch in ihren Trümmern zu benutzen, und mehr als ein Dichter hat von ihren verstreuten Gliedmassen den Marmor genommen, aus dem er eine neue, menschlichere, weniger unbedingte und unbegreifliche Göttin gebildet hat. Man hat z. B. das Schicksal der Leidenschaften dargestellt. Aber wenn eine Leidenschaft in einer bewussten Seele wirklich verhängnisvoll werden soll, wenn das Mysterium wieder in Kraft treten soll, welches das Grausige erklärt, indem es dasselbe über das Mass des Menschlichen und den menschlichen Willen hinaushebt, so bedarf es des Eingreifens eines Gottes oder einer andern unendlichen und unbezwinglichen
Macht. So hat Wagner im »Tristan« seine Zuflucht zu einem Liebestrank genommen, Shakespeare im »Macbeth« zu den Hexen, Racine in der »Iphigenie« zum Orakel des Kalchas und in der »Phädra« zum Hasse der Venus.
Man hat darum versucht, die Statue jener furchtbaren Göttin, welche die Tragödien des Sophokles und Euripides beherrscht, noch in ihren Trümmern zu benutzen, und mehr als ein Dichter hat von ihren verstreuten Gliedmassen den Marmor genommen, aus dem er eine neue, menschlichere, weniger unbedingte und unbegreifliche Göttin gebildet hat. Man hat z. B. das Schicksal der Leidenschaften dargestellt. Aber wenn eine Leidenschaft in einer bewussten Seele wirklich verhängnisvoll werden soll, wenn das Mysterium wieder in Kraft treten soll, welches das Grausige erklärt, indem es dasselbe über das Mass des Menschlichen und den menschlichen Willen hinaushebt, so bedarf es des Eingreifens eines Gottes oder einer andern unendlichen und unbezwinglichen
Macht. So hat Wagner im »Tristan« seine Zuflucht zu einem Liebestrank genommen, Shakespeare im »Macbeth« zu den Hexen, Racine in der »Iphigenie« zum Orakel des Kalchas und in der »Phädra« zum Hasse der Venus.
Wir kommen hier auf einem Umwege wieder in das Land des Verhängnisses zurück, und dieser Umweg ist bei archaistischen oder sagenhaften Stoffen, wo jede poetische Freiheit erlaubt ist, auch mehr oder weniger zulässig. Bei einem Drama jedoch, das die heutige Wirklichkeit zum Gegenstande hat, müsste man eine andere Macht erfinden, die uns wirklich unwiderstehlich erschiene und die die Verbrechen eines Macbeth, das Grausige, in das Agamemnon willigt, und vielleicht auch die Liebe der Phädra geheimnisvoll rechtfertigte und ihnen die düstere Grösse und den schrecklichen Adel verliehe, die sie von sich aus nicht haben. Man streiche aus dem »Macbeth« die teuflische Vorsehung, das Eingreifen der Hölle und den Heldenkampf gegen eine verborgene Gerechtigkeit, die jeden Augenblick durch die tausend Spalten der empörten Natur hindurchbricht: und die Hauptfigur ist nur mehr ein wahnwitziger und verächtlicher Mörder. Man streiche das Orakel des Kalchas aus der »Iphigenie«, und Agamemnon ist ein Scheusal. Man streiche den Hass der Venus, und Phädra ist eine kranke Seele, deren moralische Zurechnungsfähigkeit und Widerstandskraft gegen das Böse zu gering ist, als dass wir an ihrem Unglück wirklich teilnehmen könnten.
![]()
 Offen gesagt kann der heutige Leser und Zuschauer sich mit keinem dieser übernatürlichen Eingriffe mehr zufrieden geben. Im Grunde seines Bewusstseins ist es ihm nicht mehr möglich, sie ernst zu nehmen, gleichgiltig, ob er es will oder nicht, ob er es weiss oder nicht. Er hat eine andere Weltanschauung. Er sieht keinen ausgesprochenen, beharrlichen, wohlbegrenzten und planvollen bösen Willen mehr in der Menge der Kräfte, die in ihm und um ihn wirken. Wenn er im Leben einem Verbrecher begegnet, so erfährt er, dass dieser Mensch durch Unglück zum Verbrechen kam, durch seine Erziehung oder erbliche Belastung, durch Leidenschaften, die er selbst empfunden und bei sich niedergekämpft hat, obwohl er vollständig einsieht, dass es Fälle giebt, wo es ihm sehr schwer geworden wäre, sie zu unterdrücken. Er wird – vielleicht umsonst – nach einem Grunde für die Ungerechtigkeiten der Erziehung oder Erblichkeit suchen, aber niemals wird es ihm einfallen, die Hölle, den Zorn eines Gottes oder einer Reihe unabänderlicher Schicksalsschlüsse für dieses Verbrechen verantwortlich zu machen. Wie, und in einer Dichtung sollte er derartige Erklärungen billigen, die er im Leben niemals zugeben wird? Im Gegenteil wäre es die Pflicht des Dichters, ihm eine höhere, klarere, in weiterem und tieferem Sinne menschliche Erklärung zu geben, als er selber finden kann. Sonst wird er in der Hölle, im Zorn eines Gottes oder in den ehernen Schicksalsschlüssen
nur eine Reihe von Symbolen sehen, die ihn nicht mehr befriedigen. Es ist an der Zeit, dass die Dichter das einsehen. Das Symbol genügt, um eine allgemein anerkannte Wahrheit oder eine solche, der man noch nicht ins Auge schauen will oder kann, einstweilen zu versinnbildlichen, aber wenn der Augenblick gekommen ist, wo man die Wahrheit selbst sehen will, ist es besser, das Symbol verschwindet. Zudem muss ein Symbol, dass einer wirklich lebensvollen Poesie würdig sein soll, mindestens ebenso gross und schön sein, wie die von ihm vertretene Wahrheit, auch muss es der Wahrheit vorausgehen, und ihr nicht nachhinken.
Offen gesagt kann der heutige Leser und Zuschauer sich mit keinem dieser übernatürlichen Eingriffe mehr zufrieden geben. Im Grunde seines Bewusstseins ist es ihm nicht mehr möglich, sie ernst zu nehmen, gleichgiltig, ob er es will oder nicht, ob er es weiss oder nicht. Er hat eine andere Weltanschauung. Er sieht keinen ausgesprochenen, beharrlichen, wohlbegrenzten und planvollen bösen Willen mehr in der Menge der Kräfte, die in ihm und um ihn wirken. Wenn er im Leben einem Verbrecher begegnet, so erfährt er, dass dieser Mensch durch Unglück zum Verbrechen kam, durch seine Erziehung oder erbliche Belastung, durch Leidenschaften, die er selbst empfunden und bei sich niedergekämpft hat, obwohl er vollständig einsieht, dass es Fälle giebt, wo es ihm sehr schwer geworden wäre, sie zu unterdrücken. Er wird – vielleicht umsonst – nach einem Grunde für die Ungerechtigkeiten der Erziehung oder Erblichkeit suchen, aber niemals wird es ihm einfallen, die Hölle, den Zorn eines Gottes oder einer Reihe unabänderlicher Schicksalsschlüsse für dieses Verbrechen verantwortlich zu machen. Wie, und in einer Dichtung sollte er derartige Erklärungen billigen, die er im Leben niemals zugeben wird? Im Gegenteil wäre es die Pflicht des Dichters, ihm eine höhere, klarere, in weiterem und tieferem Sinne menschliche Erklärung zu geben, als er selber finden kann. Sonst wird er in der Hölle, im Zorn eines Gottes oder in den ehernen Schicksalsschlüssen
nur eine Reihe von Symbolen sehen, die ihn nicht mehr befriedigen. Es ist an der Zeit, dass die Dichter das einsehen. Das Symbol genügt, um eine allgemein anerkannte Wahrheit oder eine solche, der man noch nicht ins Auge schauen will oder kann, einstweilen zu versinnbildlichen, aber wenn der Augenblick gekommen ist, wo man die Wahrheit selbst sehen will, ist es besser, das Symbol verschwindet. Zudem muss ein Symbol, dass einer wirklich lebensvollen Poesie würdig sein soll, mindestens ebenso gross und schön sein, wie die von ihm vertretene Wahrheit, auch muss es der Wahrheit vorausgehen, und ihr nicht nachhinken.
 Aus diesem Grunde ist es heute auch viel schwerer, grosse Verbrechen und wirklich erschütternde, entfesselte und grausame Leidenschaften in ein Werk einzuführen oder gar auf die Bühne zu bringen, denn man weiss nicht mehr, wo man die geheimnisvolle Entschuldigung, deren sie bedürfen, für sie finden soll. Und doch sind wir noch alle bereit, wenn es sich um Verbrechen oder Leidenschaften dieser Art handelt, jeden Eingriff des Geschicks zuzulassen, ausser wenn die Unmöglichkeit auf der Hand liegt: so liegt uns die mystische Rechtfertigung im Blute, und so überzeugt sind wir, dass der Mensch im Grunde genommen nie so schuldig ist, wie er es scheint.
Aus diesem Grunde ist es heute auch viel schwerer, grosse Verbrechen und wirklich erschütternde, entfesselte und grausame Leidenschaften in ein Werk einzuführen oder gar auf die Bühne zu bringen, denn man weiss nicht mehr, wo man die geheimnisvolle Entschuldigung, deren sie bedürfen, für sie finden soll. Und doch sind wir noch alle bereit, wenn es sich um Verbrechen oder Leidenschaften dieser Art handelt, jeden Eingriff des Geschicks zuzulassen, ausser wenn die Unmöglichkeit auf der Hand liegt: so liegt uns die mystische Rechtfertigung im Blute, und so überzeugt sind wir, dass der Mensch im Grunde genommen nie so schuldig ist, wie er es scheint.
Doch bestehen wir auf dieser Rechtfertigung nur, wenn es sich um ganz naturwidrige Verbrechen oder Unglücksfälle handelt, die wirklich abnorm, unvermutet, unverdient und unerklärlich sind, Verbrechen oder Unglücksfälle, deren Thäter oder Opfer mehr oder weniger hochstehende Menschen und Herren ihres Bewusstseins sind. Es widerstrebt uns zu glauben, dass ein ausserordentliches Verbrechen oder Unglück nur rein menschliche Ursachen haben soll, und wir können ihm absolut kein Interesse abgewinnen, wenn es so ist. Wir wollen immer noch eine Erklärung für das Unerklärliche, und wir wären durchaus nicht zufrieden, wenn der Dichter uns sagte: »Diese Unthat hat dieser starke, kluge, selbstbewusste Mensch gethan. Das ist das Verbrechen eines Helden, das Leiden und der Untergang eines Gerechten, die tragische und unabänderliche Ungerechtigkeit, der dieser Weise zum Opfer fiel. Sie erkennen selbst, welche menschlichen Gründe diese Ereignisse haben. Ich habe Ihnen keine anderen zu offenbaren, wenn nicht vielleicht die Gleichgiltigkeit des Weltalls gegen das Thun der Menschen.« Ebenso unzufrieden würden wir sein, wenn es ihm gelänge, uns diese Gleichgiltigkeit zu veranschaulichen und sie uns gewissermassen »am Werke« zu zeigen. Aber da es im Wesen der Gleichgiltigkeit liegt, nicht zu wirken und nicht einzugreifen, so ist dies nahezu unmöglich.
 Wenn es sich indes um Othellos keineswegs unvermeidliche Eifersucht oder Romeos und Julias durchaus nicht vorherbestimmtes Unglück handelt, so entbehren wir den läuternden Einfluss des Verhängnisses oder irgend einer anderen Macht nicht. In einem
anderen Drama, dem Meisterwerke John Ford's, »'t is pity, sh's a whore«, das auf der blutschänderischen Liebe Giovannis zu seiner Schwester Annabella beruht, werden wir bis an den Rand des Abgrundes geführt, wo wir gewöhnlich die mystische Rechtfertigung verlangen, wenn anders wir nicht das Haupt abwenden sollen. Trotzdem verzichten wir nach einem Momente des schmerzhaften Schwindels auch hier darauf. Denn die Liebe von Bruder und Schwester ist, aus grösserer Höhe gesehen, ein Verbrechen gegen unsere Moral, nicht aber gegen die menschliche Natur, und jedenfalls hier verzeihlich durch die Jugend und leidenschaftliche Blindheit der Schuldigen. Ebenso findet Othellos Blutthat seine Erklärung in seiner Bethörtheit, in die Jagos Ränke diesen leichtgläubigen und unschuldigen Halbbarbaren versetzt haben, und Jago selbst findet eine Art von Rechtfertigung in seinem zwar ungerechten, aber doch nicht gegenstandslosen Hasse. Das Unglück des Veroneser Liebespaares endlich erklärt sich durch die Unerfahrenheit der Opfer und das allzugrosse Missverhältnis zwischen ihren Kräften und den Widerständen, die sie zu überwinden haben. Denn man kann bemerken, dass wir mit einem Menschen, der gegen überlegene Gegner anringt, Mitleid haben, aber wenn er unterliegt, so sind wir keineswegs überrascht. Es fällt uns gar nicht ein, die Dinge anders anzusehen und das Geschick verantwortlich zu machen, und wenn er einer übermenschlichen Macht zum Opfer fällt, so sagen wir uns einfach: »Das musste so kommen.«
Wenn es sich indes um Othellos keineswegs unvermeidliche Eifersucht oder Romeos und Julias durchaus nicht vorherbestimmtes Unglück handelt, so entbehren wir den läuternden Einfluss des Verhängnisses oder irgend einer anderen Macht nicht. In einem
anderen Drama, dem Meisterwerke John Ford's, »'t is pity, sh's a whore«, das auf der blutschänderischen Liebe Giovannis zu seiner Schwester Annabella beruht, werden wir bis an den Rand des Abgrundes geführt, wo wir gewöhnlich die mystische Rechtfertigung verlangen, wenn anders wir nicht das Haupt abwenden sollen. Trotzdem verzichten wir nach einem Momente des schmerzhaften Schwindels auch hier darauf. Denn die Liebe von Bruder und Schwester ist, aus grösserer Höhe gesehen, ein Verbrechen gegen unsere Moral, nicht aber gegen die menschliche Natur, und jedenfalls hier verzeihlich durch die Jugend und leidenschaftliche Blindheit der Schuldigen. Ebenso findet Othellos Blutthat seine Erklärung in seiner Bethörtheit, in die Jagos Ränke diesen leichtgläubigen und unschuldigen Halbbarbaren versetzt haben, und Jago selbst findet eine Art von Rechtfertigung in seinem zwar ungerechten, aber doch nicht gegenstandslosen Hasse. Das Unglück des Veroneser Liebespaares endlich erklärt sich durch die Unerfahrenheit der Opfer und das allzugrosse Missverhältnis zwischen ihren Kräften und den Widerständen, die sie zu überwinden haben. Denn man kann bemerken, dass wir mit einem Menschen, der gegen überlegene Gegner anringt, Mitleid haben, aber wenn er unterliegt, so sind wir keineswegs überrascht. Es fällt uns gar nicht ein, die Dinge anders anzusehen und das Geschick verantwortlich zu machen, und wenn er einer übermenschlichen Macht zum Opfer fällt, so sagen wir uns einfach: »Das musste so kommen.«
![]()
 Es wird uns also nur dann schwer, an die Möglichkeit eines Verbrechens auf natürlichem und menschlichem Wege zu glauben, wenn es von einem nach allem Anschein klugen und selbstbewussten Wesen begangen wird, ebenso wie es uns schwer wird, ein auf natürlichem Wege unerklärliches, unverhofftes und unverdientes Unglück ohne weiteres gutzuheissen. Woraus sich ergiebt, dass man nur solche Ungerechtigkeiten auf die Bühne bringen dürfte – und wenn ich sage: auf die Bühne bringen, so ist das wohlverstanden eine Abkürzung und ich müsste vielmehr sagen: uns auf irgend eine Weise zu Zuschauern eines Ereignisses machen, dessen Umstände und handelnde Personen wir nicht ausnahmslos persönlich kennen – woraus sich ergiebt, sage ich, dass man nur solche Ungerechtigkeiten, Sünden und Verbrechen auf die Bühne bringen sollte, deren Thäter kein ausreichendes Bewusstsein haben, und nur solches Unglück, das schwachen Seelen zustösst, die in aller Unschuld ihren Begierden zum Opfer fallen, weil sie unvorsichtig, blind und unbesonnen sind. Um diesen Preis könnten wir auf das Eingreifen einer Macht, die über der Sphäre der dem Menschen geläufigen Psychologie liegt, getrost verzichten, wenn eine derartige Auffassung von der Bühne nicht der Realität des Lebens ins Gesicht schlagen würde. Denn wir sehen im Gegenteil sehr selbstbewusste Naturen täglich Verbrechen begehen und sehr gute, vorsichtige, tugendhafte, gerechte und verständige Menschen einem Heer von unerklärlichen,
unverhofften und fast immer unverdienten Leiden und unglücklichen Zufällen zum Opfer fallen. Die obengenannten Dramen, die Dramen der Unbewussten, Schwachen, Bedrückten, der Opfer ihrer eigenen Wünsche und Begierden, fesseln uns gewiss und erregen unser Mitleid, aber das eigentliche Drama, das den Dingen auf den Grund geht und sich ernstlich mit allgemein wichtigen Wahrheiten befasst, das Drama, das uns alle angeht und unser ganzes Leben umspannt, ist das Drama der Starken, Bewussten und Klugen, die fast unvermeidlich in Sünde, Verirrung und Verbrechen fallen, ist das Drama des Gerechten und Weisen, der gegen ein allmächtiges Unglück anringt, und gegen Mächte, welche die Weisheit und Gerechtigkeit entwaffnen; – denn der Zuschauer, mag er im wirklichen Leben noch so schwach und so wenig ehrenhaft sein, rechnet sich als solcher immer zu den Gerechten und Starken, und wenn er das Unglück der Schwäche mit ansieht, wenn er selbst daran teilnimmt, so stellt er sich doch nie ganz auf Seite Derer, die ohne jeden Widerstand unterliegen.
Es wird uns also nur dann schwer, an die Möglichkeit eines Verbrechens auf natürlichem und menschlichem Wege zu glauben, wenn es von einem nach allem Anschein klugen und selbstbewussten Wesen begangen wird, ebenso wie es uns schwer wird, ein auf natürlichem Wege unerklärliches, unverhofftes und unverdientes Unglück ohne weiteres gutzuheissen. Woraus sich ergiebt, dass man nur solche Ungerechtigkeiten auf die Bühne bringen dürfte – und wenn ich sage: auf die Bühne bringen, so ist das wohlverstanden eine Abkürzung und ich müsste vielmehr sagen: uns auf irgend eine Weise zu Zuschauern eines Ereignisses machen, dessen Umstände und handelnde Personen wir nicht ausnahmslos persönlich kennen – woraus sich ergiebt, sage ich, dass man nur solche Ungerechtigkeiten, Sünden und Verbrechen auf die Bühne bringen sollte, deren Thäter kein ausreichendes Bewusstsein haben, und nur solches Unglück, das schwachen Seelen zustösst, die in aller Unschuld ihren Begierden zum Opfer fallen, weil sie unvorsichtig, blind und unbesonnen sind. Um diesen Preis könnten wir auf das Eingreifen einer Macht, die über der Sphäre der dem Menschen geläufigen Psychologie liegt, getrost verzichten, wenn eine derartige Auffassung von der Bühne nicht der Realität des Lebens ins Gesicht schlagen würde. Denn wir sehen im Gegenteil sehr selbstbewusste Naturen täglich Verbrechen begehen und sehr gute, vorsichtige, tugendhafte, gerechte und verständige Menschen einem Heer von unerklärlichen,
unverhofften und fast immer unverdienten Leiden und unglücklichen Zufällen zum Opfer fallen. Die obengenannten Dramen, die Dramen der Unbewussten, Schwachen, Bedrückten, der Opfer ihrer eigenen Wünsche und Begierden, fesseln uns gewiss und erregen unser Mitleid, aber das eigentliche Drama, das den Dingen auf den Grund geht und sich ernstlich mit allgemein wichtigen Wahrheiten befasst, das Drama, das uns alle angeht und unser ganzes Leben umspannt, ist das Drama der Starken, Bewussten und Klugen, die fast unvermeidlich in Sünde, Verirrung und Verbrechen fallen, ist das Drama des Gerechten und Weisen, der gegen ein allmächtiges Unglück anringt, und gegen Mächte, welche die Weisheit und Gerechtigkeit entwaffnen; – denn der Zuschauer, mag er im wirklichen Leben noch so schwach und so wenig ehrenhaft sein, rechnet sich als solcher immer zu den Gerechten und Starken, und wenn er das Unglück der Schwäche mit ansieht, wenn er selbst daran teilnimmt, so stellt er sich doch nie ganz auf Seite Derer, die ohne jeden Widerstand unterliegen.
 Wir gelangen hier an den düsteren Punkt, wo die Macht des Menschen ein Ende hat und der gerechteste, besonnenste und geklärteste Wille auf die Geschehnisse, von denen unser gutes oder schlimmes Schicksal abhängt, keinen Einfluss mehr hat. Es giebt kein Drama höherer Art, es giebt keine grosse Dichtung, wo der eine oder andere Held nicht an diesen Scheideweg kommt, an dem sein Schicksal
sich entscheidet. Warum begeht dieser gute und weise Mensch dieses Unrecht oder dieses Verbrechen? Warum macht dieses Weib, das doch weiss, was es thut, diese Bewegung, durch die es auf ewig sein Glück verscherzt? Wer hat die Kette des Verhängnisses, die diese unschuldige Familie umschlingt, Glied für Glied geschmiedet? Warum missrät alles um diesen Menschen und um jenen kommt alles wieder ins Gleichgewicht, obwohl er nicht so stark, verständig, thatkräftig und geschickt ist? Warum begegnet diesem nur Liebe, Güte und Schönheit, und warum trifft jener auf seiner Strasse nur Hass, Verrat und Bosheit? Warum bei gleichem Verdienst hier das beharrliche Glück und dort das unermüdliche Unglück? Warum tobt ewiger Sturm um dieses Haus und ewiger Sternenhimmel spannt sich über dem andern? Warum hier Geist, Gesundheit, Reichtum, und dort Blödigkeit, Krankheit und Armut? Woher kommt diese Leidenschaft, die so viel Übel nach sich zieht, und jene, die so viel Gutes bringt? Warum schreitet der Jüngling, dem ich gestern begegnete, langsam aber sicher einem tiefen Glück entgegen, und sein Freund geht mit demselben gemessenen Schritte nichtsahnend und ruhig in den Tod?
Wir gelangen hier an den düsteren Punkt, wo die Macht des Menschen ein Ende hat und der gerechteste, besonnenste und geklärteste Wille auf die Geschehnisse, von denen unser gutes oder schlimmes Schicksal abhängt, keinen Einfluss mehr hat. Es giebt kein Drama höherer Art, es giebt keine grosse Dichtung, wo der eine oder andere Held nicht an diesen Scheideweg kommt, an dem sein Schicksal
sich entscheidet. Warum begeht dieser gute und weise Mensch dieses Unrecht oder dieses Verbrechen? Warum macht dieses Weib, das doch weiss, was es thut, diese Bewegung, durch die es auf ewig sein Glück verscherzt? Wer hat die Kette des Verhängnisses, die diese unschuldige Familie umschlingt, Glied für Glied geschmiedet? Warum missrät alles um diesen Menschen und um jenen kommt alles wieder ins Gleichgewicht, obwohl er nicht so stark, verständig, thatkräftig und geschickt ist? Warum begegnet diesem nur Liebe, Güte und Schönheit, und warum trifft jener auf seiner Strasse nur Hass, Verrat und Bosheit? Warum bei gleichem Verdienst hier das beharrliche Glück und dort das unermüdliche Unglück? Warum tobt ewiger Sturm um dieses Haus und ewiger Sternenhimmel spannt sich über dem andern? Warum hier Geist, Gesundheit, Reichtum, und dort Blödigkeit, Krankheit und Armut? Woher kommt diese Leidenschaft, die so viel Übel nach sich zieht, und jene, die so viel Gutes bringt? Warum schreitet der Jüngling, dem ich gestern begegnete, langsam aber sicher einem tiefen Glück entgegen, und sein Freund geht mit demselben gemessenen Schritte nichtsahnend und ruhig in den Tod?
 Das Leben stellt uns oft vor Fragen dieser Art, und viele pflegen eine hinreichende Antwort im Übernatürlichen zu suchen, im Vorherbestimmten, im Übermenschlichen, im Mysterium … Fromme Seelen werden in dem und dem Ereignis stets einen Fingerzeig
Gottes sehen. Aber wir, die wir gewohnheitsmässig in das Haus des Sturmes und in das des Friedens gehen, wir kommen selten wieder heraus, ohne den sehr menschlichen Grund des Sturmes oder Friedens erkannt zu haben. Wenn wir den guten und weisen Menschen, der dies Unrecht oder jenes Verbrechen begangen hat, kennen gelernt haben, so haben wir damit auch alle bedingenden Umstände kennen gelernt und erfahren, dass diese Umstände keineswegs übernatürlich waren. Wenn wir dem Weibe näher getreten sind, das durch eine Gebärde sein Glück auf ewig verscherzt hat, so wissen wir ganz genau, dass diese Gebärde ihm nicht verhängt war und dass wir sie an seiner Stelle nicht gemacht hätten. Wie wir in vertrauter Freundschaft mit dem gelebt haben, um den alles missrät, und mit dem, um den alles wieder ins Gleichgewicht kommt, so haben wir auch die Eichel auf den Fels oder auf fruchtbaren Boden fallen sehen, ohne an feindselige Mächte voll dunkler Absichten zu denken. Und wenn Armut, Krankheit und Tod auch die drei bösen Göttinnen des Menschenlebens bleiben, so flössen sie uns doch nicht mehr die abergläubische Furcht von ehedem ein. Uns will vor allem scheinen, dass sie unbewusst, gleichgiltig und blind sind, dass sie um keines der Geistesgesetze wissen, die sie nach unserem Dafürhalten heiligen, und wir haben nur allzu oft gesehen, dass sie, die wir Prüfung, Lohn, Strafe, Läuterung nannten, diese hohen sittlichen Namen, mit denen wir sie beschenkten, durch ihre Launen ohne Wahl selbst widerlegten.
Das Leben stellt uns oft vor Fragen dieser Art, und viele pflegen eine hinreichende Antwort im Übernatürlichen zu suchen, im Vorherbestimmten, im Übermenschlichen, im Mysterium … Fromme Seelen werden in dem und dem Ereignis stets einen Fingerzeig
Gottes sehen. Aber wir, die wir gewohnheitsmässig in das Haus des Sturmes und in das des Friedens gehen, wir kommen selten wieder heraus, ohne den sehr menschlichen Grund des Sturmes oder Friedens erkannt zu haben. Wenn wir den guten und weisen Menschen, der dies Unrecht oder jenes Verbrechen begangen hat, kennen gelernt haben, so haben wir damit auch alle bedingenden Umstände kennen gelernt und erfahren, dass diese Umstände keineswegs übernatürlich waren. Wenn wir dem Weibe näher getreten sind, das durch eine Gebärde sein Glück auf ewig verscherzt hat, so wissen wir ganz genau, dass diese Gebärde ihm nicht verhängt war und dass wir sie an seiner Stelle nicht gemacht hätten. Wie wir in vertrauter Freundschaft mit dem gelebt haben, um den alles missrät, und mit dem, um den alles wieder ins Gleichgewicht kommt, so haben wir auch die Eichel auf den Fels oder auf fruchtbaren Boden fallen sehen, ohne an feindselige Mächte voll dunkler Absichten zu denken. Und wenn Armut, Krankheit und Tod auch die drei bösen Göttinnen des Menschenlebens bleiben, so flössen sie uns doch nicht mehr die abergläubische Furcht von ehedem ein. Uns will vor allem scheinen, dass sie unbewusst, gleichgiltig und blind sind, dass sie um keines der Geistesgesetze wissen, die sie nach unserem Dafürhalten heiligen, und wir haben nur allzu oft gesehen, dass sie, die wir Prüfung, Lohn, Strafe, Läuterung nannten, diese hohen sittlichen Namen, mit denen wir sie beschenkten, durch ihre Launen ohne Wahl selbst widerlegten.
![]()
 Unsere Einbildungskraft mag noch so geneigt sein, das Eingreifen übermenschlicher Kräfte zu wünschen und zu billigen, im praktischen Leben giebt es doch wenige unter uns, selbst unter den mystisch Veranlagten, die nicht überzeugt sind, dass unser moralisches Unglück im Grunde genommen von unserem Geist und Charakter abhängt, und unser physisches Unglück vom Spiele gewisser, zum Teil unbekannter Kräfte und Kausalzusammenhänge, die oft wenig aufgeklärt sind, aber doch nicht völlig anders als das, was wir eines Tages in der Natur zu entdecken hoffen. Und im ganzen genommen leben wir alle in dieser Gewissheit, die nur dann wahrhaft erschüttert wird, wenn es sich um unser eigenes Missgeschick handelt, denn dann fällt es uns schwer, die gemachten Fehler zu erkennen oder uns einzugestehen, und es berührt unsern menschlichen Stolz recht peinlich, dass unser Unglück keine tieferen Gründe hat, als der Fall der Eichel auf den Fels, das Zerschellen der Woge an den Klippen oder ihr Verrinnen im Sande, und das Schicksal des Falters, dem ein wärmender Sonnenstrahl die zarten Flügel entfaltet oder ein vorbeifliegender Vogel das Leben raubt.
Unsere Einbildungskraft mag noch so geneigt sein, das Eingreifen übermenschlicher Kräfte zu wünschen und zu billigen, im praktischen Leben giebt es doch wenige unter uns, selbst unter den mystisch Veranlagten, die nicht überzeugt sind, dass unser moralisches Unglück im Grunde genommen von unserem Geist und Charakter abhängt, und unser physisches Unglück vom Spiele gewisser, zum Teil unbekannter Kräfte und Kausalzusammenhänge, die oft wenig aufgeklärt sind, aber doch nicht völlig anders als das, was wir eines Tages in der Natur zu entdecken hoffen. Und im ganzen genommen leben wir alle in dieser Gewissheit, die nur dann wahrhaft erschüttert wird, wenn es sich um unser eigenes Missgeschick handelt, denn dann fällt es uns schwer, die gemachten Fehler zu erkennen oder uns einzugestehen, und es berührt unsern menschlichen Stolz recht peinlich, dass unser Unglück keine tieferen Gründe hat, als der Fall der Eichel auf den Fels, das Zerschellen der Woge an den Klippen oder ihr Verrinnen im Sande, und das Schicksal des Falters, dem ein wärmender Sonnenstrahl die zarten Flügel entfaltet oder ein vorbeifliegender Vogel das Leben raubt.
 Mein Nachbar, den ich gut kenne, den ich alle Tage sehe, der regelmässige Gewohnheiten hat und friedlich gesonnen ist, verliert, will ich annehmen, Schlag auf Schlag seine Frau bei einem Eisenbahnunglück, einen seiner Söhne bei einem Schiffbruch,
einen anderen bei einer Feuersbrunst, und der letzte möge an einer Krankheit sterben. Ich wäre schmerzlich verwundert, aber ich würde es mir nicht einfallen lassen, diese Kette von Unglücksfällen auf ein göttliches Strafgericht, eine immanente Gerechtigkeit, eine eigentliche böse Vorsehung, ein unentrinnbares, ergrimmtes und bewusst handelndes Verhängnis zurückzuführen. Ich würde an das Leben denken, an seine tausend unglücklichen Zufälle, ich würde ein entsetzliches Zusammentreffen darin erblicken, aber es wird mir nie einfallen, dass ein übermenschlicher Wille diesen Zug in den Abgrund gestürzt, dieses Schiff auf eine Klippe geworfen, diese Feuersbrunst verursacht und all diese Furchtbarkeiten begangen haben soll, nur um einen Nichtswürdigen zu strafen oder einen Ruchlosen zu züchtigen, der vielleicht eine grosse Schuld auf sich geladen hat, eines jener Vergehen, die in den Augen der Menschen so gross und in denen des Weltalls so klein sind, eine That, die vielleicht nicht einmal aus seinem Herzen oder Geiste herausgekommen ist und jedenfalls keinen Grashalm auf Erden geknickt hat.
Mein Nachbar, den ich gut kenne, den ich alle Tage sehe, der regelmässige Gewohnheiten hat und friedlich gesonnen ist, verliert, will ich annehmen, Schlag auf Schlag seine Frau bei einem Eisenbahnunglück, einen seiner Söhne bei einem Schiffbruch,
einen anderen bei einer Feuersbrunst, und der letzte möge an einer Krankheit sterben. Ich wäre schmerzlich verwundert, aber ich würde es mir nicht einfallen lassen, diese Kette von Unglücksfällen auf ein göttliches Strafgericht, eine immanente Gerechtigkeit, eine eigentliche böse Vorsehung, ein unentrinnbares, ergrimmtes und bewusst handelndes Verhängnis zurückzuführen. Ich würde an das Leben denken, an seine tausend unglücklichen Zufälle, ich würde ein entsetzliches Zusammentreffen darin erblicken, aber es wird mir nie einfallen, dass ein übermenschlicher Wille diesen Zug in den Abgrund gestürzt, dieses Schiff auf eine Klippe geworfen, diese Feuersbrunst verursacht und all diese Furchtbarkeiten begangen haben soll, nur um einen Nichtswürdigen zu strafen oder einen Ruchlosen zu züchtigen, der vielleicht eine grosse Schuld auf sich geladen hat, eines jener Vergehen, die in den Augen der Menschen so gross und in denen des Weltalls so klein sind, eine That, die vielleicht nicht einmal aus seinem Herzen oder Geiste herausgekommen ist und jedenfalls keinen Grashalm auf Erden geknickt hat.
 Aber er, der von diesen grossen Schicksalsschlägen betroffen ist, die in ihrer Furchtbarkeit wie jähe Blitze in einer Gewitternacht sind: wird er wohl ebenso denken, wird er sie für ebenso natürlich, selbstredend und erklärlich halten? Wird das Wort Geschick, Unglück, Zufall, Missgeschick, Verhängnis, Stern, und vielleicht auch das Wort Vorsehung,
für ihn nicht eine Bedeutung erlangen, die es vorher nicht hatte? Wird er sein Gewissen nicht in anderer Weise befragen, als sonst, wird er sein Leben nicht geheimen Einflüssen und Mächten unterworfen wähnen, einer Art von Schicksalstücke vielleicht, die ich nicht darin finden kann? Wer hat nun recht? Wer von uns beiden sieht weiter und klarer, er oder ich? Erschaut man in trüben Stunden Wahrheiten, die man in friedlicheren Tagen nicht sieht, und welchen Moment soll man wählen, um dem Leben einen Sinn zu geben?
Aber er, der von diesen grossen Schicksalsschlägen betroffen ist, die in ihrer Furchtbarkeit wie jähe Blitze in einer Gewitternacht sind: wird er wohl ebenso denken, wird er sie für ebenso natürlich, selbstredend und erklärlich halten? Wird das Wort Geschick, Unglück, Zufall, Missgeschick, Verhängnis, Stern, und vielleicht auch das Wort Vorsehung,
für ihn nicht eine Bedeutung erlangen, die es vorher nicht hatte? Wird er sein Gewissen nicht in anderer Weise befragen, als sonst, wird er sein Leben nicht geheimen Einflüssen und Mächten unterworfen wähnen, einer Art von Schicksalstücke vielleicht, die ich nicht darin finden kann? Wer hat nun recht? Wer von uns beiden sieht weiter und klarer, er oder ich? Erschaut man in trüben Stunden Wahrheiten, die man in friedlicheren Tagen nicht sieht, und welchen Moment soll man wählen, um dem Leben einen Sinn zu geben?
Im allgemeinen wählen die Deuter des Lebens aller Art die trüben Stunden. Sie versetzen sich und uns in den Seelenzustand des Opfers, sie stellen uns das Unglück unseres Nächsten so gedrängt, so unvermittelt, so massig vor Augen, dass wir einen Augenblick wähnen, selbst das Opfer zu sein. Freilich ist es ihnen fast unmöglich, uns das Ereignis so vorzuführen, wie wir es im gewöhnlichen Leben sehen. Wenn wir mit der Hauptperson des uns überwältigenden Dramas Jahre lang gelebt hätten, wenn diese Person unser Freund, Bruder oder Vater gewesen wäre, so hätten wir im Verlaufe des Stückes wahrscheinlich alle Gründe seines Unglückes entdeckt, entziffert und erkannt, und es würde uns nun weit weniger Wunder nehmen, oft sogar würde es uns sehr natürlich und nach menschlichem Ermessen fast unausbleiblich erscheinen. Aber der Deuter des Lebens hat weder die Zeit noch das Vermögen, uns all die wirklichen Gründe zu erzählen. Sie sind gewöhnlich unscheinbar, winzig, unzählig und von äusserst langsamer Wirkung. Er ist also geneigt, die menschlichen und wirklichen Gründe, die er uns nicht zeigen kann, die aufzuspüren und aufzuzählen ihm nicht möglich ist, durch einen allgemeinen Grund zu ersetzen, der gross genug ist, um das ganze Drama zu umfassen. Und wo wird er diesen allgemeinen und hinreichend grossen Grund finden, wenn nicht in den zwei oder drei Worten, die wir zu stammeln pflegen, wenn wir uns nicht stillschweigend fügen wollen: göttliche Vorsehung, Verhängnis, dunkle und namenlose Gerechtigkeit?
 Man kann sich fragen, bis zu welchem Grade das berechtigt und heilsam ist, und ob es Sache des Dichters ist, die Unruhe und Verwirrung der vielleicht am wenigsten lichten Minuten wiederzugeben und festzubannen, oder die Hellsichtigkeit der Augenblicke zu erhöhen, wo der Mensch sich im Vollbesitz seiner Kraft und Vernunft glaubt. Einen Vorteil haben alle unsere Missgeschicke, und folglich auch die Einbildung eines persönlichen Unglücks: sie lassen uns in uns gehen. Sie zeigen uns unsere Schwächen, unsere Irrtümer und Fehler. Sie erleuchten unser Bewusstsein mit einem tausendmal schonungsloseren und wirksameren Lichte, als es jahrelanges Forschen und Nachdenken thun würde. Sie lassen uns auch wieder aus uns herauskommen, lehren uns, um uns blicken, und geben uns mehr Verständnis für die Leiden unserer Brüder. Sie thun noch mehr, sagt man. Sie zwingen uns die Augen zu erheben, eine höhere Macht anzuerkennen,
uns einer unsichtbaren Gerechtigkeit zu beugen und einem unerforschlichen und unendlichen Mysterium zu huldigen. Ist das wirklich das Beste an ihrem Wirken? Ja, vom Standpunkte der religiösen Moral ist es heilsam gewesen, dass sie uns zwangen, die Augen zu erheben, solange unsere Augen auf einen Gott fielen, der uns die höchste Schönheit, die höchste Güte und Gerechtigkeit verkörperte, der gewiss und ohne Wanken war. Es ist heilsam gewesen, dass der Dichter, welcher in seinem Gotte ein unumstössliches Ideal sah, uns den Blick so oft wie möglich zu diesem alleinigen und letzten Ideal erheben liess. Was aber haben wir heute diesen bewegten Blicken zu bieten, wenn wir sie von den Wahrheiten und alltäglichen Erfahrungen des Lebens aufblicken lassen? Was sollen wir angesichts des triumphierenden Unrechts, des ungerochenen und erfolgreichen Verbrechens sagen, wenn wir den Menschen über die alles mehr oder weniger wieder ausgleichenden Gesetze des Gewissens und des inneren Glückes hinausschauen lassen? … Welche Erklärung sollen wir am Sterbebette des Kindes geben, beim Untergang des Unschuldigen, bei den Tücken des Zufalls gegen den Unglücklichen, wenn wir eine höhere, kürzere, treffendere, endgiltigere Erklärung geben wollen, als die, mit denen wir uns im alltäglichen Leben wohl oder übel begnügen müssen, weil es die einzigen sind, die auf eine gewisse Anzahl von Thatsachen passen? Haben wir, um unser Wirken in einen feierlicheren Dunstkreis zu hüllen, das Recht, Befürchtungen, Irrtümer, Gefühle und Vorurteile
zu verbreiten, die wir missbilligen und bekämpfen würden, wenn wir sie noch im Herzen unserer Freunde oder unserer Kinder anträfen? Haben wir das Recht, einen bangen Augenblick zu benutzen, um die kleinen, aber achtbaren Gewissheiten, die der Mensch durch Beobachtung der menschlichen Herzens- und Geistesgewohnheiten, der Daseinsgesetze, der Launen des Zufalls und der mütterlichen Gleichgiltigkeit der Natur mühsam gewonnen hat, – um diese Gewissheiten durch ein Verhängnis zu ersetzen, das von allen unseren Handlungen widerlegt wird, durch Mächte, vor denen wir nie das Knie beugen würden, wenn das Unglück, das unseren Helden trifft, uns selbst treffen würde, durch eine mystische Gerechtigkeit, die uns mehr als eine schwierige Erklärung erspart, aber der wirksameren und positiveren Gerechtigkeit, mit der wir in unseren persönlichen Leben rechnen, in keiner Weise gleicht?
Man kann sich fragen, bis zu welchem Grade das berechtigt und heilsam ist, und ob es Sache des Dichters ist, die Unruhe und Verwirrung der vielleicht am wenigsten lichten Minuten wiederzugeben und festzubannen, oder die Hellsichtigkeit der Augenblicke zu erhöhen, wo der Mensch sich im Vollbesitz seiner Kraft und Vernunft glaubt. Einen Vorteil haben alle unsere Missgeschicke, und folglich auch die Einbildung eines persönlichen Unglücks: sie lassen uns in uns gehen. Sie zeigen uns unsere Schwächen, unsere Irrtümer und Fehler. Sie erleuchten unser Bewusstsein mit einem tausendmal schonungsloseren und wirksameren Lichte, als es jahrelanges Forschen und Nachdenken thun würde. Sie lassen uns auch wieder aus uns herauskommen, lehren uns, um uns blicken, und geben uns mehr Verständnis für die Leiden unserer Brüder. Sie thun noch mehr, sagt man. Sie zwingen uns die Augen zu erheben, eine höhere Macht anzuerkennen,
uns einer unsichtbaren Gerechtigkeit zu beugen und einem unerforschlichen und unendlichen Mysterium zu huldigen. Ist das wirklich das Beste an ihrem Wirken? Ja, vom Standpunkte der religiösen Moral ist es heilsam gewesen, dass sie uns zwangen, die Augen zu erheben, solange unsere Augen auf einen Gott fielen, der uns die höchste Schönheit, die höchste Güte und Gerechtigkeit verkörperte, der gewiss und ohne Wanken war. Es ist heilsam gewesen, dass der Dichter, welcher in seinem Gotte ein unumstössliches Ideal sah, uns den Blick so oft wie möglich zu diesem alleinigen und letzten Ideal erheben liess. Was aber haben wir heute diesen bewegten Blicken zu bieten, wenn wir sie von den Wahrheiten und alltäglichen Erfahrungen des Lebens aufblicken lassen? Was sollen wir angesichts des triumphierenden Unrechts, des ungerochenen und erfolgreichen Verbrechens sagen, wenn wir den Menschen über die alles mehr oder weniger wieder ausgleichenden Gesetze des Gewissens und des inneren Glückes hinausschauen lassen? … Welche Erklärung sollen wir am Sterbebette des Kindes geben, beim Untergang des Unschuldigen, bei den Tücken des Zufalls gegen den Unglücklichen, wenn wir eine höhere, kürzere, treffendere, endgiltigere Erklärung geben wollen, als die, mit denen wir uns im alltäglichen Leben wohl oder übel begnügen müssen, weil es die einzigen sind, die auf eine gewisse Anzahl von Thatsachen passen? Haben wir, um unser Wirken in einen feierlicheren Dunstkreis zu hüllen, das Recht, Befürchtungen, Irrtümer, Gefühle und Vorurteile
zu verbreiten, die wir missbilligen und bekämpfen würden, wenn wir sie noch im Herzen unserer Freunde oder unserer Kinder anträfen? Haben wir das Recht, einen bangen Augenblick zu benutzen, um die kleinen, aber achtbaren Gewissheiten, die der Mensch durch Beobachtung der menschlichen Herzens- und Geistesgewohnheiten, der Daseinsgesetze, der Launen des Zufalls und der mütterlichen Gleichgiltigkeit der Natur mühsam gewonnen hat, – um diese Gewissheiten durch ein Verhängnis zu ersetzen, das von allen unseren Handlungen widerlegt wird, durch Mächte, vor denen wir nie das Knie beugen würden, wenn das Unglück, das unseren Helden trifft, uns selbst treffen würde, durch eine mystische Gerechtigkeit, die uns mehr als eine schwierige Erklärung erspart, aber der wirksameren und positiveren Gerechtigkeit, mit der wir in unseren persönlichen Leben rechnen, in keiner Weise gleicht?
 Und doch thut dies der Deuter des Lebens, sobald er sein Werk in eine höhere Sphäre erheben und ihm eine tiefe, religiöse Schönheit verleihen will, mehr oder weniger absichtlich. Und selbst wenn dies Werk so ehrlich wie möglich und seiner innersten Wahrheit so getreu wie möglich ist, so glaubt er doch, dieser Wahrheit mehr Halt und Grösse zu verleihen, wenn er sie mit einer Schar von Schemen der Vergangenheit umgiebt. Ich weiss, er braucht Bilder, Voraussetzungen, Symbole, kurz, alles, was die Vorstufen des Unerklärlichen bildet, aber warum sie so oft dem nicht mehr Wahren entnehmen, und
so selten dem, was vielleicht einst Wahrheit sein wird? Wird der Tod erhabener, wenn man ihn mit überwundenen Schreckbildern umgiebt und ihn in einem Lichte leuchten lässt, das aus einer nicht mehr vorhandenen Hölle kommt? Wird unser Geschick geadelt, wenn man es von einem höheren, aber imaginären Willen abhängen lässt? Wird die Gerechtigkeit, dieses Riesennetz, das die menschlichen Handlungen und Gegenhandlungen über die unwandelbare Weisheit der physischen und moralischen Naturkräfte ziehen, wird diese Gerechtigkeit dadurch erhöht, dass man sie in die Hände eines einzigen Richters legt, den der Geist unseres Werkes doch gerade entthront oder vernichtet?
Und doch thut dies der Deuter des Lebens, sobald er sein Werk in eine höhere Sphäre erheben und ihm eine tiefe, religiöse Schönheit verleihen will, mehr oder weniger absichtlich. Und selbst wenn dies Werk so ehrlich wie möglich und seiner innersten Wahrheit so getreu wie möglich ist, so glaubt er doch, dieser Wahrheit mehr Halt und Grösse zu verleihen, wenn er sie mit einer Schar von Schemen der Vergangenheit umgiebt. Ich weiss, er braucht Bilder, Voraussetzungen, Symbole, kurz, alles, was die Vorstufen des Unerklärlichen bildet, aber warum sie so oft dem nicht mehr Wahren entnehmen, und
so selten dem, was vielleicht einst Wahrheit sein wird? Wird der Tod erhabener, wenn man ihn mit überwundenen Schreckbildern umgiebt und ihn in einem Lichte leuchten lässt, das aus einer nicht mehr vorhandenen Hölle kommt? Wird unser Geschick geadelt, wenn man es von einem höheren, aber imaginären Willen abhängen lässt? Wird die Gerechtigkeit, dieses Riesennetz, das die menschlichen Handlungen und Gegenhandlungen über die unwandelbare Weisheit der physischen und moralischen Naturkräfte ziehen, wird diese Gerechtigkeit dadurch erhöht, dass man sie in die Hände eines einzigen Richters legt, den der Geist unseres Werkes doch gerade entthront oder vernichtet?
 Fragen wir uns nur, ob es nicht an der Zeit ist, die Schönheiten, Bilder, Symbole und Gefühle, die wir immer noch benutzen um das Weltbild in uns zu erweitern, einer ernstlichen Nachprüfung zu unterziehen.
Fragen wir uns nur, ob es nicht an der Zeit ist, die Schönheiten, Bilder, Symbole und Gefühle, die wir immer noch benutzen um das Weltbild in uns zu erweitern, einer ernstlichen Nachprüfung zu unterziehen.
Sicherlich stehen viele dieser Schönheiten, Symbole und Gefühle nur mehr in ganz loser Beziehung zu den Erscheinungen und Gedanken und selbst den Träumen unseres wirklichen Daseins, und wenn sie uns noch fesseln, so ist dies viel mehr die Folge von unschuldigen und harmonischen Erinnerungen an eine gläubigere und der Kindheit des Menschen nähere Vergangenheit. Wäre es nicht wünschenswert, wenn die, deren Beruf es ist, uns für die Schönheiten und Harmonien der Welt, in der wir leben, empfänglich zu machen, der thatsächlichen Wahrheit dieser Welt um einen Schritt näher kämen? Wäre es nicht zu wünschen, dass sie, ohne darum ihre Weltauffassung um einen einzigen Zierrat ärmer zu machen, diesen Zierrat weniger oft unter lieblichen oder schrecklichen Erinnerungen suchten, und häufiger in der Fundgrube der Gedanken, auf denen sie ihr Geistes- und Gefühlsleben thatsächlich aufbauen?
Es ist nicht einerlei, ob man von falschen Bildern umgeben lebt oder nicht, selbst dann nicht, wenn wir wissen, dass sie falsch sind. Die trügerischen Bilder treten doch schliesslich an Stelle der richtigen Gedanken, die sie darstellen. Und andere Bilder gebrauchen, seine Zuflucht zu wahreren Begriffen nehmen, heisst das Feld des Unendlichen und des Mysteriums nicht einschränken. Wollte man es auch, es wäre kaum möglich, dieses Feld ernstlich einzuschränken. Man wird es auf dem Grunde der Moralprobleme, auf dem Grunde des Menschenherzens und im ganzen Weltall doch wiederfinden. Es spricht nicht mit, dass die Mysterien nach Lage und Wesenheit nicht mehr die alten sind; ihre Macht und ihr Wirkungsbereich bleiben doch fast die gleichen. Um nur eines dieser Mysterien zu nehmen: die Thatsache jener höchsten und rein geistigen Gerechtigkeit unter den Menschen, die, obwohl ohne Werkzeuge, Waffen und Organe, und oft sehr langsam in ihrer Wirkung, doch fast immer gewiss ist und sich in einer Welt, in der alles die Ungerechtigkeit zu begünstigen scheint, schier unwandelbar erhält. Hat diese Thatsache nicht ebenso tiefe, ebenso unerschöpfliche Ursachen und Wirkungen, und ist sie nicht ebenso erstaunlich und bewundernswert, wie das Dasein und die Weisheit eines allmächtigen, ewigen Richters? Oder besticht uns dieser mehr, weil er unerforschlicher ist? Liegen mehr Quellen der Schönheit und für den Genius mehr Anlässe, seine Macht und seinen Scharfsinn zu üben, in dem, was a priori unerklärlich ist, als in dem, was sich erklären lässt? Ist in einem glücklichen, aber ungerechten Kriege – ich nenne nur die Kriege der Römer, die Eroberungen der Spanier in Amerika, Napoleon, das heutige England u.v.a. – ist in einem glücklichen, aber ungerechten Kriege, der stets mit Entsittlichung des Siegers endigt und ihn in Angewohnheiten, Selbsttäuschungen und Sünden fallen lässt, durch die ihm sein Triumph teuer zu stehen kommt, – das geheime und unerbittliche Wirken der psychologischen Gerechtigkeit etwa weniger erhebend und grossartig, als das Eingreifen einer übernatürlichen Gerechtigkeit? Und kann man dasselbe nicht auch von der, einem jeden von uns innewohnenden Gerechtigkeit sagen, die, je nachdem wir nach Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit trachten, den Raum des Friedens, der Liebe und des inneren Glückes in unserem Geist und Herzen erweitert oder verengt?
»Ich bitte Sie«, schreibt Thomas Huxley in einem herrlichen Briefe an einen Freund, der ihn mit Hilfe von veralteten Bildern über den Tod eines angebeteten Sohnes zu trösten suchte, »ich bitte Sie wohl zu verstehen, dass ich gegen alles dies a priori nichts einzuwenden habe. Wenn man in täglicher Berührung mit der Natur lebt, können einen aprioristische Schwierigkeiten nicht beunruhigen. Geben Sie mir einen Beweis, der Ihr Wunderbares rechtfertigt, und ich werde daran glauben. Warum auch nicht? Es wäre dies fast ebenso wunderbar, wie die Erhaltung der Kraft oder die Unzerstörbarkeit des Stoffes. Wer sich deutlich klarmacht, was alles zum Falle eines Steines gehört, kann keine Lehre verwerfen, nur aus dem Grunde, weil sie wunderbar ist.
»Aber je länger ich lebe, desto klarer wird es mir, dass das Heiligste im Menschenleben der Moment ist, wo man sagt und fühlt: »Ich glaube, dass dies oder das wahr ist!« Alle grossen Belohnungen und schweren Strafen unseres Daseins knüpfen sich an diesen Akt.
»Die Welt ist in allen Stücken ein und dieselbe, und wie es mir nicht gelingt, meine kleinen anatomischen und physiologischen Schwierigkeiten zu lösen, wenn ich meinen Glauben nicht allem verweigere, was nicht auf genügender Evidenz beruht, so kann ich auch nicht glauben, dass das grosse Mysterium des Daseins sich unter anderen Bedingungen entschleiert.«
 Und um auf dieses Mysterium zurückzukommen, an das uns Huxleys Brief erinnert, auf das schrecklichste von allen, das Mysterium des Todes: wäre es wohl leicht nachzuweisen, dass der Sinn für Gerechtigkeit, Schönheit und Güte, dass die Geistes- und Gefühlskräfte, die Wissbegier für alles, was mit dem Unendlichen, Allmächtigen, Ewigen zusammenhängt, nachgelassen hätten, seit der Tod für uns nicht mehr die ungeheure
und fast ausschliessliche Furcht des Lebens ist? Es ist nicht zu leugnen, dass die Last des Todes mit jeder Generation abnimmt, in dem Maasse, wie seine gewaltsamen Formen und die Furcht vor etwas nach dem Tode abnehmen. Wir denken nicht mehr so oft an ihn und fürchten ihn weit weniger als ehedem. Im Grunde fürchten wir weniger ihn, als den Schmerz, der ihn begleitet, und die Krankheit, die ihm vorausgeht. Aber er ist nicht mehr die Stunde des zornigen und unerforschlichen Richters, nicht mehr das einzige, furchtbare Ziel, nicht mehr der Abgrund der ewigen Mysterien und Strafen. Er wird nach und nach – und er ist es schon oft – die ersehnte Ruhe nach beschlossenem Dasein. Er lastet nicht mehr auf unsren Handlungen, und vor allem greift er – was der Hauptpunkt ist, an dem sich der grosse Wandel offenbart – nicht mehr in unsre Moral ein. Ist unsere Moral aber weniger hoch, rein und tief, seit sie selbstloser geworden ist? Und hat die Menschheit ein unerlässliches, kostbares Gefühl verloren, seit sie ein Grauen verlor? Wem kommt wohl die dem Tode genommene Bedeutung zu gute? Jedenfalls dem Leben. Wir besitzen einen Vorrat an neuen und allzeit verfügbaren Kräften, und wenn man uns einen Schrecken, eine Trübsal, eine Entmutigung nimmt, so tritt an deren Stelle eine Bewunderung, eine Zuversicht und eine Hoffnung.
Und um auf dieses Mysterium zurückzukommen, an das uns Huxleys Brief erinnert, auf das schrecklichste von allen, das Mysterium des Todes: wäre es wohl leicht nachzuweisen, dass der Sinn für Gerechtigkeit, Schönheit und Güte, dass die Geistes- und Gefühlskräfte, die Wissbegier für alles, was mit dem Unendlichen, Allmächtigen, Ewigen zusammenhängt, nachgelassen hätten, seit der Tod für uns nicht mehr die ungeheure
und fast ausschliessliche Furcht des Lebens ist? Es ist nicht zu leugnen, dass die Last des Todes mit jeder Generation abnimmt, in dem Maasse, wie seine gewaltsamen Formen und die Furcht vor etwas nach dem Tode abnehmen. Wir denken nicht mehr so oft an ihn und fürchten ihn weit weniger als ehedem. Im Grunde fürchten wir weniger ihn, als den Schmerz, der ihn begleitet, und die Krankheit, die ihm vorausgeht. Aber er ist nicht mehr die Stunde des zornigen und unerforschlichen Richters, nicht mehr das einzige, furchtbare Ziel, nicht mehr der Abgrund der ewigen Mysterien und Strafen. Er wird nach und nach – und er ist es schon oft – die ersehnte Ruhe nach beschlossenem Dasein. Er lastet nicht mehr auf unsren Handlungen, und vor allem greift er – was der Hauptpunkt ist, an dem sich der grosse Wandel offenbart – nicht mehr in unsre Moral ein. Ist unsere Moral aber weniger hoch, rein und tief, seit sie selbstloser geworden ist? Und hat die Menschheit ein unerlässliches, kostbares Gefühl verloren, seit sie ein Grauen verlor? Wem kommt wohl die dem Tode genommene Bedeutung zu gute? Jedenfalls dem Leben. Wir besitzen einen Vorrat an neuen und allzeit verfügbaren Kräften, und wenn man uns einen Schrecken, eine Trübsal, eine Entmutigung nimmt, so tritt an deren Stelle eine Bewunderung, eine Zuversicht und eine Hoffnung.

 Man wird vielleicht sagen, namentlich was Gerechtigkeit und Verhängnis betrifft, dass man diese beiden Kräfte, die in uns sind, nach aussen projiziert und personifiziert, erstens, weil es viel schwerer ist, sie in uns nachzuweisen, und zweitens, weil es so gut wie sicher ist, dass das Unbekannte und Unendliche als solche, d. h. als Dinge ohne Vernunft, Moralität und Persönlichkeit, uns nicht zu begeistern vermögen. In der That ist zu bemerken, dass das materielle Mysterium, so dunkel und gefährlich es auch sein mag, die psychologische Gerechtigkeit, so verwickelt ihre Ergebnisse sein mögen, uns nicht im geringsten beunruhigt. Das Begeisternde und Niederschmetternde liegt nicht darin, dass wir etwas in der natürlichen Weltordnung nicht verstehen, sondern in der Vorstellung, dass ein höherer bewusster, vernunftbegabter, übermenschlicher und doch vielleicht menschenähnlicher Wille über der Natur schwebt, mit einem Worte, dass es einen Gott giebt; und welchen Namen wir ihm auch geben mögen, sei es Gerechtigkeit, Vorsehung, Mysterium, es ist doch immer der Gott, den wir fürchten, d. i. ein Wesen, das uns gleich ist, und dabei doch ewig, unendlich, unsichtbar und allmächtig; denn ich weiss nicht, ob wir vor einer moralischen Gewalt, die nicht nach unserm Bilde geschaffen ist, überhaupt Furcht hätten. Es ist nicht das Unbekannte in der Natur, was uns schreckt, nicht das Mysterium unserer Welt. Es ist das Mysterium einer anderen Welt. Es ist nicht das materielle, sondern das
moralische Rätsel. Z.B. ist nichts weniger bekannt, als der Ursachenzusammenhang eines Erdbebens, und es giebt nichts Schrecklicheres. Trotzdem versetzt das Erdbeben, das unserm Körper Grauen einflösst, unsern Geist nur dann in Entsetzen, wenn er es als einen Akt der Gerechtigkeit, eine geheimnisvolle Rache, eine übernatürliche Strafe ansieht. Ein gleiches gilt von Sturm, Krankheit, Tod, von tausend Erscheinungen und Katastrophen im menschlichen Dasein. Anscheinend hängt das wahre Grausen, d. i. das seelische, und die grosse Erregung, die mehr in uns aufrührt, als der physische Selbsterhaltungstrieb, mit der Vorstellung eines mehr oder weniger bestimmten Gottes, eines geheimnisvollen Wissens, einer unsichtbaren permanenten Gerechtigkeit, einer unerforschlichen, wachsamen Vorsehung eng zusammen. Aber es handelt sich darum, was der Wahrheit am nächsten kommt, und ob der Deuter des Lebens die Aufgabe hat, zu beängstigen, zu betrüben und von Grund aus aufzuregen, oder zu beruhigen, sicher zu machen und aufzuklären.
Man wird vielleicht sagen, namentlich was Gerechtigkeit und Verhängnis betrifft, dass man diese beiden Kräfte, die in uns sind, nach aussen projiziert und personifiziert, erstens, weil es viel schwerer ist, sie in uns nachzuweisen, und zweitens, weil es so gut wie sicher ist, dass das Unbekannte und Unendliche als solche, d. h. als Dinge ohne Vernunft, Moralität und Persönlichkeit, uns nicht zu begeistern vermögen. In der That ist zu bemerken, dass das materielle Mysterium, so dunkel und gefährlich es auch sein mag, die psychologische Gerechtigkeit, so verwickelt ihre Ergebnisse sein mögen, uns nicht im geringsten beunruhigt. Das Begeisternde und Niederschmetternde liegt nicht darin, dass wir etwas in der natürlichen Weltordnung nicht verstehen, sondern in der Vorstellung, dass ein höherer bewusster, vernunftbegabter, übermenschlicher und doch vielleicht menschenähnlicher Wille über der Natur schwebt, mit einem Worte, dass es einen Gott giebt; und welchen Namen wir ihm auch geben mögen, sei es Gerechtigkeit, Vorsehung, Mysterium, es ist doch immer der Gott, den wir fürchten, d. i. ein Wesen, das uns gleich ist, und dabei doch ewig, unendlich, unsichtbar und allmächtig; denn ich weiss nicht, ob wir vor einer moralischen Gewalt, die nicht nach unserm Bilde geschaffen ist, überhaupt Furcht hätten. Es ist nicht das Unbekannte in der Natur, was uns schreckt, nicht das Mysterium unserer Welt. Es ist das Mysterium einer anderen Welt. Es ist nicht das materielle, sondern das
moralische Rätsel. Z.B. ist nichts weniger bekannt, als der Ursachenzusammenhang eines Erdbebens, und es giebt nichts Schrecklicheres. Trotzdem versetzt das Erdbeben, das unserm Körper Grauen einflösst, unsern Geist nur dann in Entsetzen, wenn er es als einen Akt der Gerechtigkeit, eine geheimnisvolle Rache, eine übernatürliche Strafe ansieht. Ein gleiches gilt von Sturm, Krankheit, Tod, von tausend Erscheinungen und Katastrophen im menschlichen Dasein. Anscheinend hängt das wahre Grausen, d. i. das seelische, und die grosse Erregung, die mehr in uns aufrührt, als der physische Selbsterhaltungstrieb, mit der Vorstellung eines mehr oder weniger bestimmten Gottes, eines geheimnisvollen Wissens, einer unsichtbaren permanenten Gerechtigkeit, einer unerforschlichen, wachsamen Vorsehung eng zusammen. Aber es handelt sich darum, was der Wahrheit am nächsten kommt, und ob der Deuter des Lebens die Aufgabe hat, zu beängstigen, zu betrüben und von Grund aus aufzuregen, oder zu beruhigen, sicher zu machen und aufzuklären.
 Ich gebe zu, dass es sehr schwer ist, sich von der herkömmlichen Weltauffassung loszumachen, und oft fällt man gerade dann in sie zurück, wenn man sich von ihr zu befreien meint. So hat Ibsen, der das Verhängnis auf eine neue und gewissermassen wissenschaftliche Art und Weise untersucht hat, die verhüllte, grossartige und tyrannische Gestalt der Erblichkeit zur Hauptfigur seines besten Dramas gemacht.
Aber im Grunde genommen ist es in diesem Stücke nicht das wissenschaftliche Mysterium der Erblichkeit, das in uns gewisse menschliche Ängste aufrührt, die tiefer sind, als unsere leiblichen Ängste. Wenn nichts weiter darin läge, würde es uns nicht mehr aufregen, als das wissenschaftliche Mysterium dieser oder jener furchtbaren Krankheit, dieser oder jener atmosphärischen oder maritimen Erscheinung. Nein, wodurch eine andre Furcht in uns wachgerufen wird, als die einer drohenden, aber natürlichen Gefahr, das ist der dunkle Gerechtigkeitsbegriff, der der Erblichkeit innewohnt, das ist die verwegene Behauptung, dass die Sünden der Väter fast immer an den Kindern heimgesucht werden, das ist die Unterstellung, dass ein allmächtiger Richter, eine Art von Rassengottheit, über unsere Handlungen wacht, sie auf eherne Tafeln schreibt und in ewigen Händen Belohnungen wägt, die erst spät zu Tage treten, und Strafen, die ewig sind. Mit einem Worte erscheint das Antlitz eines Gottes in dem Augenblicke wieder, wo man ihn verleugnet, und eine uralte Höllenflamme lodert noch unter dem Steine hervor, den man schon versiegelt hatte.
Ich gebe zu, dass es sehr schwer ist, sich von der herkömmlichen Weltauffassung loszumachen, und oft fällt man gerade dann in sie zurück, wenn man sich von ihr zu befreien meint. So hat Ibsen, der das Verhängnis auf eine neue und gewissermassen wissenschaftliche Art und Weise untersucht hat, die verhüllte, grossartige und tyrannische Gestalt der Erblichkeit zur Hauptfigur seines besten Dramas gemacht.
Aber im Grunde genommen ist es in diesem Stücke nicht das wissenschaftliche Mysterium der Erblichkeit, das in uns gewisse menschliche Ängste aufrührt, die tiefer sind, als unsere leiblichen Ängste. Wenn nichts weiter darin läge, würde es uns nicht mehr aufregen, als das wissenschaftliche Mysterium dieser oder jener furchtbaren Krankheit, dieser oder jener atmosphärischen oder maritimen Erscheinung. Nein, wodurch eine andre Furcht in uns wachgerufen wird, als die einer drohenden, aber natürlichen Gefahr, das ist der dunkle Gerechtigkeitsbegriff, der der Erblichkeit innewohnt, das ist die verwegene Behauptung, dass die Sünden der Väter fast immer an den Kindern heimgesucht werden, das ist die Unterstellung, dass ein allmächtiger Richter, eine Art von Rassengottheit, über unsere Handlungen wacht, sie auf eherne Tafeln schreibt und in ewigen Händen Belohnungen wägt, die erst spät zu Tage treten, und Strafen, die ewig sind. Mit einem Worte erscheint das Antlitz eines Gottes in dem Augenblicke wieder, wo man ihn verleugnet, und eine uralte Höllenflamme lodert noch unter dem Steine hervor, den man schon versiegelt hatte.
 Aber diese neue Form der Gerechtigkeit des Schicksals oder Verhängnisses ist noch anfechtbarer und unannehmbarer, als das einfache antike Schicksal, das allgemein und unendlich blieb, nichts allzugenau erklären wollte und darum auf eine grössere Zahl von Fällen passte. Es ist denkbar, dass es sich in dem Ibsenschen Spezialfalle um eine sozusagen zufällige
Gerechtigkeit handelt, wie es denkbar ist, dass ein Blinder einen Pfeil in eine Menschenmenge schiesst und dass dieser Pfeil zufällig einen Vatermörder trifft. Aber aus diesem Ausnahmefall ein Gesetz machen, hiesse mit dem Mysterium von neuem Missbrauch treiben, d. h. Elemente in die menschliche Moral einführen, die nicht hineingehören. Vielleicht wären sie wünschenswert und erspriesslich, wenn sie gewissen Wahrheiten entsprächen, aber weil sie dies nicht thun und unserm wirklichen Leben somit fremd sind, so gehören sie eben nicht in unsere Moral. Ich werde in einem andern Kapitel noch zu zeigen haben, dass es bei dem heutigen Stande unserer Erfahrung unmöglich ist, in den Erscheinungen der Erblichkeit die kleinste Spur von Gerechtigkeit zu entdecken d. h. das geringste moralische Band zwischen der Ursache – der That des Vaters – und der Wirkung – dem Lohn oder der Strafe des Kindes.
Aber diese neue Form der Gerechtigkeit des Schicksals oder Verhängnisses ist noch anfechtbarer und unannehmbarer, als das einfache antike Schicksal, das allgemein und unendlich blieb, nichts allzugenau erklären wollte und darum auf eine grössere Zahl von Fällen passte. Es ist denkbar, dass es sich in dem Ibsenschen Spezialfalle um eine sozusagen zufällige
Gerechtigkeit handelt, wie es denkbar ist, dass ein Blinder einen Pfeil in eine Menschenmenge schiesst und dass dieser Pfeil zufällig einen Vatermörder trifft. Aber aus diesem Ausnahmefall ein Gesetz machen, hiesse mit dem Mysterium von neuem Missbrauch treiben, d. h. Elemente in die menschliche Moral einführen, die nicht hineingehören. Vielleicht wären sie wünschenswert und erspriesslich, wenn sie gewissen Wahrheiten entsprächen, aber weil sie dies nicht thun und unserm wirklichen Leben somit fremd sind, so gehören sie eben nicht in unsere Moral. Ich werde in einem andern Kapitel noch zu zeigen haben, dass es bei dem heutigen Stande unserer Erfahrung unmöglich ist, in den Erscheinungen der Erblichkeit die kleinste Spur von Gerechtigkeit zu entdecken d. h. das geringste moralische Band zwischen der Ursache – der That des Vaters – und der Wirkung – dem Lohn oder der Strafe des Kindes.
Es ist den Poeten erlaubt, Hypothesen zu machen und der Wirklichkeit gleichsam vorzugreifen. Aber oft geschieht es, dass sie im Glauben, ihr vorzugreifen, sie nur auf den Kopf stellen, und dass sie in der Meinung, eine neue Wahrheit vorwegzunehmen, nur die Fährte einer alten Illusion wiederfinden. Hier müsste man, wollte man der Wirklichkeit vorgreifen, in der Verneinung der Gerechtigkeit vielleicht noch weiter gehen. Aber wie wir auch über diesen Punkt denken mögen, wenn eine poetische Hypothese ehrlich und gültig bleiben soll, so gehört es sich, dass sie durch die tägliche Erfahrung nicht widerlegt wird, sonst ist sie höchst unnütz und gefährlich, und wofern der Irrtum nicht ganz unfreiwillig ist, nicht einmal redlich.
 Was ergiebt sich aus alledem? Sehr vieles, wenn man will, aber vornehmlich dies eine: dass der Deuter des Lebens genau so wie Die, welche es leben, in der Handhabung oder Zulassung des Mysteriums äusserst vorsichtig sein muss und sich durchaus nicht einbilden darf, dass der dem Unerklärlichen eingeräumte Anteil in einem Werke oder Dasein notwendigerweise das Beste oder Grösste sein muss. Es giebt sehr schöne, wahre und menschliche Werke, wo die »Schauer des Weltmysteriums« fast ganz fehlen. Man ist noch nicht gross, tief oder erhaben, weil man ununterbrochen an das Unerkennbare und Unendliche denkt. Der Gedanke daran wird nur dann wahrhaft erspriesslich, wenn er der unverhoffte Lohn eines Geistes ist, der sich der Erforschung des Erkennbaren und Endlichen bedingungslos und rechtschaffen gewidmet hat, und man wird bald inne, dass der Unterschied zwischen dem Mysterium
vor unserer Kenntnis, und dem Mysterium
nach unserer Ungewissheit recht bemerklich ist. In dem ersten scheint viel Trübsal zu liegen, denn in ihm herrscht die Enge, und alle Schwermut lagert sich auf zwei oder drei zu nahe liegenden Höhen. In dem andern scheint viel weniger Trübsal zu sein, denn seine Raumfläche ist weit, und an den fernen Horizonten nehmen selbst die grössten Trübsale die Gestalt von Hoffnungen an.
Was ergiebt sich aus alledem? Sehr vieles, wenn man will, aber vornehmlich dies eine: dass der Deuter des Lebens genau so wie Die, welche es leben, in der Handhabung oder Zulassung des Mysteriums äusserst vorsichtig sein muss und sich durchaus nicht einbilden darf, dass der dem Unerklärlichen eingeräumte Anteil in einem Werke oder Dasein notwendigerweise das Beste oder Grösste sein muss. Es giebt sehr schöne, wahre und menschliche Werke, wo die »Schauer des Weltmysteriums« fast ganz fehlen. Man ist noch nicht gross, tief oder erhaben, weil man ununterbrochen an das Unerkennbare und Unendliche denkt. Der Gedanke daran wird nur dann wahrhaft erspriesslich, wenn er der unverhoffte Lohn eines Geistes ist, der sich der Erforschung des Erkennbaren und Endlichen bedingungslos und rechtschaffen gewidmet hat, und man wird bald inne, dass der Unterschied zwischen dem Mysterium
vor unserer Kenntnis, und dem Mysterium
nach unserer Ungewissheit recht bemerklich ist. In dem ersten scheint viel Trübsal zu liegen, denn in ihm herrscht die Enge, und alle Schwermut lagert sich auf zwei oder drei zu nahe liegenden Höhen. In dem andern scheint viel weniger Trübsal zu sein, denn seine Raumfläche ist weit, und an den fernen Horizonten nehmen selbst die grössten Trübsale die Gestalt von Hoffnungen an.
![]()
 Das menschliche Leben als Ganzes ist etwas recht Trauriges, und es ist leichter, ich möchte fast sagen, angenehmer, von seinen Trübsalen zu sprechen und sie hervorzukehren, als seine Tröstungen zu suchen und sie zur Geltung zu bringen. Die Trübsale sind zahlreich, augenscheinlich und untrüglich, aber die Tröstungen, oder vielmehr die Gründe, aus denen wir die Pflicht zu leben mit gewisser Heiterkeit annehmen, scheinen selten, wenig sichtbar und zweifelhaft. Die Trübsale scheinen gross und edel und eines unabweislichen, gleichsam persönlichen und fühlbaren Mysteriums voll, die Tröstungen dagegen gewöhnlich, selbstsüchtig, ja, fast niedrig. Und doch, wenn man näher zusieht und sich durch den vergänglichen Schein nicht täuschen lässt, so rühren sie auch an ein Mysterium, das nur darum weniger sichtbar und handgreiflich ist, weil es tiefer und geheimnisvoller ist. Der Lebenswille oder die Bejahung des Lebens, so wie es ist, bekunden sich freilich auch in niedrigeren Daseinsformen, aber sie gehorchen im ganzen genommen ohne oder gar wider ihr Wissen tieferen Gesetzen, die dem Weltgeist näher stehen und folglich auch verehrungswürdiger sind, als das Bestreben, die Welt und ihre Trübsale zu fliehen, oder die edle, resignierte Weisheit, die sich damit begnügt, dieselben festzustellen.
Das menschliche Leben als Ganzes ist etwas recht Trauriges, und es ist leichter, ich möchte fast sagen, angenehmer, von seinen Trübsalen zu sprechen und sie hervorzukehren, als seine Tröstungen zu suchen und sie zur Geltung zu bringen. Die Trübsale sind zahlreich, augenscheinlich und untrüglich, aber die Tröstungen, oder vielmehr die Gründe, aus denen wir die Pflicht zu leben mit gewisser Heiterkeit annehmen, scheinen selten, wenig sichtbar und zweifelhaft. Die Trübsale scheinen gross und edel und eines unabweislichen, gleichsam persönlichen und fühlbaren Mysteriums voll, die Tröstungen dagegen gewöhnlich, selbstsüchtig, ja, fast niedrig. Und doch, wenn man näher zusieht und sich durch den vergänglichen Schein nicht täuschen lässt, so rühren sie auch an ein Mysterium, das nur darum weniger sichtbar und handgreiflich ist, weil es tiefer und geheimnisvoller ist. Der Lebenswille oder die Bejahung des Lebens, so wie es ist, bekunden sich freilich auch in niedrigeren Daseinsformen, aber sie gehorchen im ganzen genommen ohne oder gar wider ihr Wissen tieferen Gesetzen, die dem Weltgeist näher stehen und folglich auch verehrungswürdiger sind, als das Bestreben, die Welt und ihre Trübsale zu fliehen, oder die edle, resignierte Weisheit, die sich damit begnügt, dieselben festzustellen.

 Wir sind stets geneigt, das Leben düsterer zu malen, als es ist, und das ist eine grosse Sünde, die in der gegenwärtigen Ungewissheit freilich entschuldbar ist. Es giebt in der That noch keine annehmbare Erklärung. Das Menschenschicksal ist nach wie vor unbekannten Kräften unterworfen, von denen einige vielleicht verschwunden sind, aber nur, um anderen Platz zu machen. Auf alle Fälle ist die Zahl der wirklich ins Gewicht fallenden nicht verringert. Man hat das Wirken und Eingreifen dieser Mächte auf verschiedene Weise zu erklären versucht, und man könnte sagen, dass wir seit der Erkenntnis von der Hinfälligkeit der meisten dieser Kräfte vor der Wirklichkeit, die sich trotz allem nach und nach enthüllt, auf das Verhängnis zurückgekommen sind, um das Unerklärliche, oder doch wenigstens die Trübsale des Unerklärlichen, auf irgend eine Weise zu verallgemeinern. Im Grunde bedeuten Ibsen, der russische Roman, die bessere Geschichtsforschung der Gegenwart, Flaubert u. s. w. nichts Anderes. (Siehe unter anderem »Krieg und Friede«, »Die Gefühlserziehung« und das Übrige.)
Wir sind stets geneigt, das Leben düsterer zu malen, als es ist, und das ist eine grosse Sünde, die in der gegenwärtigen Ungewissheit freilich entschuldbar ist. Es giebt in der That noch keine annehmbare Erklärung. Das Menschenschicksal ist nach wie vor unbekannten Kräften unterworfen, von denen einige vielleicht verschwunden sind, aber nur, um anderen Platz zu machen. Auf alle Fälle ist die Zahl der wirklich ins Gewicht fallenden nicht verringert. Man hat das Wirken und Eingreifen dieser Mächte auf verschiedene Weise zu erklären versucht, und man könnte sagen, dass wir seit der Erkenntnis von der Hinfälligkeit der meisten dieser Kräfte vor der Wirklichkeit, die sich trotz allem nach und nach enthüllt, auf das Verhängnis zurückgekommen sind, um das Unerklärliche, oder doch wenigstens die Trübsale des Unerklärlichen, auf irgend eine Weise zu verallgemeinern. Im Grunde bedeuten Ibsen, der russische Roman, die bessere Geschichtsforschung der Gegenwart, Flaubert u. s. w. nichts Anderes. (Siehe unter anderem »Krieg und Friede«, »Die Gefühlserziehung« und das Übrige.)
Es ist dies freilich nicht mehr das Schicksal im antiken Sinne, die – wenigstens im Sinne des Volkes – wohlbegrenzte, willkürliche, unbeugsame, unversöhnliche und bei aller Blindheit doch wachsame Gottheit, es ist ein unbestimmteres, gestaltloseres, weiteres, zerstreutes, gleichgiltiges, unpersönliches, unmenschliches, allgemeines Verhängnis, kurzum, nichts als ein dem allgemeinen und unerklärlichen Menschenelend in Erwartung eines Besseren vorläufig gegebener Name. Man kann es in diesem Sinne annehmen, obwohl es nichts erklärt und nur eine neue Bezeichnung für das unveränderte Rätsel ist. Man muss sich nur hüten, ihm einen übertriebenen Wert und Rang zu geben, und sich nicht einbilden, dass man die Menschen und Ereignisse aus sehr grosser Höhe und in endgiltiger Beleuchtung sieht, und dass es darüber hinaus nichts mehr zu suchen giebt, weil man in einem gegebenen Augenblick die unbezwingliche und dunkle Gewalt des Schicksals hinter jedem Dasein stehen sieht. Es ist klar, dass die Menschen in gewisser Hinsicht immer unglücklich erscheinen werden, dass sie immer nach einem verhängnisvollen Abgrund gezogen zu werden scheinen, denn sie werden ewig der Krankheit, der Unbeständigkeit der Materie, dem Tod und Alter ausgesetzt bleiben. Wenn man nur das Ende aller Existenzen ansieht, so hat selbst das glücklichste und siegreichste Leben notwendigerweise etwas Verhängnisvolles und Elendes. Aber treiben wir mit diesen Worten keinen Missbrauch, und gebrauchen wir sie vor allem nicht aus Leichtfertigkeit oder aus Liebe zur mystischen Schwermut, um den Anteil dessen zu verringern, was sich anders erklären lässt, wenn man sich der Erforschung der Leidenschaften, Gedanken und Gefühle des Menschenlebens und der Natur der Dinge befleissigt. Vergessen wir nie, dass wir vom Unbekannten rings umgeben sind. Dieser Gedanke ist der heilsamste, der sich denken lässt, der kraftvollste und fruchtbarste, aber benutzen wir die Unpersönlichkeit des Unbekannten nicht, um ihm eine Gestalt und feindselige Absichten unterzuschieben, die es allem Anschein nach nicht haben kann. Napoleon, sagt man, hat in Erfurt bei seinem berühmten Zwiegespräch mit Goethe missbilligend von den Stücken gesprochen, in denen das Schicksal eine grosse Rolle spielt, und dass wir in unserer »Leidenschaft für das Unglück« gerade diese gewöhnlich am schönsten fänden. »Sie gehören«, sagte er, »einer Zeit an, der das Licht unserer Tage fehlte. Was heisst heute Schicksal? Die Politik ist das Schicksal!« Dies Wort Napoleons ist eng, die Politik ist nur ein winziger Bruchteil des Schicksals, und sein eigenes Geschick sollte ihm bald genug zeigen, dass er in seiner Verallgemeinerung der Politik zum Schicksal vergebens versucht hatte, den mächtigsten Geistesstrom, der auf unserm Erdballe fliesst, in ein tönendes Wort einzuzwängen. Aber so unvollständig Napoleons Wort auch ist, so wirft es doch wenigstens auf eine der Strömungen dieses grossen Stromes ein Licht. Das ist wenig, wenn man will, aber immerhin noch mehr, als das blasse Nichts ungewisser Träume, und hinreichend, die Thatkraft zu erwecken und das Schicksal eines Menschen zu entscheiden. Und ihm hat dieser Lichtstrahl lange Zeit genügt, um das Unbekannte, das er nicht Schicksal nannte, zu überschauen. Ich weiss, dieser Teil des Unbekannten, den er so überschaute, war, – wenn auch vielleicht der ungeheuerste, den ein menschliches Auge je überblickt hat, – aus grösserer Höhe oder nach ihm gesehen, doch unzureichend. Nichtsdestoweniger war er es, der ihn befähigte, das Gute und Böse zu thun, das er gethan hat. Wir haben hier nicht über ihn zu Gericht zu sitzen, noch uns zu fragen, ob es für das Glück eines Jahrhunderts besser gewesen wäre, wenn er sich von den Ereignissen hätte leiten lassen. Was wir in diesem Augenblick im Auge haben, das ist die Gefügigkeit des Unbekannten. Für uns, deren Geschicke sich viel bescheidener ausnehmen, bleibt das Problem das gleiche, und auch das Prinzip, welches das Prinzip Goethes war: sich auf der äussersten Grenze dessen zu halten, was zu begreifen ist, aber diese Grenze nie zu überschreiten, denn unmittelbar dahinter beginnt das Fabelland mit seinen für den Geist bedrohlichen Nebeln und Phantomen. Man sollte dem Mysterium, dem Unwiderstehlichen und Unsichtbaren nur dann weichen und nur dann die Waffen strecken, Verzicht leisten und sich in müssiges Schweigen hüllen, wenn sein Eingreifen wirklich fühlbar, auffällig, persönlich, vernunftbegabt, moralisch und zweifellos ist, und dieses so bedingte Eingreifen ist seltener, als man denkt. So lange das Mysterium sich derart noch nicht offenbart, ist freilich noch kein Anlass, es darum zu verneinen, aber ebensowenig ist es angebracht, stehen zu bleiben, auf die Anstrengung zu verzichten, die Augen zu senken und sich stillschweigend zu unterwerfen.
