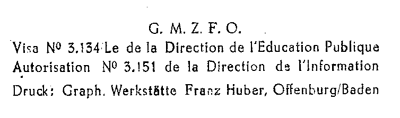|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Das Erdenreich des Pfarrers
In jedem Kirchsprengel ist ein Mann, der keine Familie hat, aber zu jeder Familie gehört; den man als Zeugen, Rat oder Teilnehmer zu allen feierlichsten Verhandlungen des bürgerlichen Lebens zieht; ohne den man weder geboren werden, noch sterben kann, der den Menschen bei der Geburt empfängt und erst am Grabe verläßt, der die Wiege, das Ehe- und Sterbebett und den Sarg segnet und einweiht; ein Mann, den die kleinen Kinder zu lieben, zu verehren und zu fürchten gewohnt sind; den selbst Unbekannte ihren Vater nennen; dem die Christen ihre innersten Geständnisse, ihre geheimsten Tränen zu Füßen legen; ein Mann, welcher der berufene Tröster in allem Elend der Seele und des Leibes, der verpflichtete Vermittler des Reichtums und der Bedürftigkeit ist, welcher den Armen und den Reichen abwechslungsweise an seine Türe klopfen sieht: den Reichen, um sein geheimes Almosen darzubringen, den Armen, um es ohne Erröten zu empfangen; welcher, ohne einen bestimmten Rang in der Gesellschaft einzunehmen, allen auf gleiche Weise angehört: den untern Klassen durch seine einfache Lebensweise und nicht selten durch die Niedrigkeit seiner Herkunft; den höheren Klassen durch seine Erziehung, Wissenschaft und den Adel der Gefühle, die eine menschenfreundliche Religion einflößt und verlangt; mit einem Worte, ein Mann, der Alles weiß, der Alles sagen darf, und dessen Wort mit dem Gewicht einer göttlichen Sendung und der Gewalt eines fertigen, vollendeten Glaubens zu dem Verstande und Herzen der Menschen spricht. – Dieser Mann ist der Pfarrer; Keiner kann den Menschen mehr Gutes oder mehr Böses tun, als er, je nachdem er seine hohe gesellschaftliche Sendung erfüllt oder mißkennt.
Was ist ein Pfarrer? Ein Pfarrer ist der Diener der Religion Christi, seine Glaubenslehren zu wahren, seine Sittenlehre zu verbreiten, und dem Teile der Herde, der ihm anvertraut ist, seine Wohltaten zu spenden beauftragt. Aus diesen drei Aufträgen des Priestertums entspringen die drei Eigenschaften, wonach wir den Pfarrer betrachten wollen, nämlich als Priester, als Sittenlehrer und als geistlichen Spender des Christentums in der Gemeinde. Von da fließen auch die dreierlei Pflichten her, die er zu erfüllen hat, um der Erhabenheit seiner Auftrage auf Erden, u. der Achtung oder Verehrung der Menschen würdig zu sein.
Als Priester oder Wahrer der christlichen Glaubenslehre, sind die Pflichten des Pfarrers unserer Prüfung nicht zugänglich; die Glaubenslehre, ihrer Natur nach geheimnisvoll und göttlich, durch die Offenbarung aufgedrungen, durch den Glauben, diese Tugend menschlicher Unwissenheit, angenommen, entzieht sich jeder Kritik; der Priester ist, wie der Gläubige, nur seinem Gewissen und seiner Kirche, der einzigen Autorität, die er über sich hat, Rechenschaft schuldig. Indessen kann auch hier der erleuchtete Verstand des Priesters, in seiner Tätigkeit als Lehrer des Volkes, auf dessen Religion einen nützlichen Einfluß ausüben. Manches unwürdige Märchen, mancher geläufige Aberglauben hat sich in den Zeiten der Finsternis und Unwissenheit mit dem erhabenen Glauben des reinen christlichen Dogma vermengt; der Aberglauben aber ist der Mißbrauch des Glaubens, und dem aufgeklärten Diener einer Religion, die das Licht erträgt, weil alles Licht von ihr gekommen ist, liegt ob, die Schatten zu entfernen, die das Heilige verdunkeln und welche gegen das Christentum, diese praktische Civilisation, diese höchste Vernunft, bei Manchen das Vorurteil erwecken könnten, als mache es in frommer Industrie oder rohem Aberglauben mit falschen oder trügerischen Culten gemeinsame Sache. Es ist die Pflicht des Pfarrers, diese Glaubensmißbräuche zu heben und den allzu bereitwilligen Glauben seines Volkes auf die würdige und geheimnisvolle Einfachheit des christlichen Dogma, auf die Betrachtung sein« Sittenlehre, auf die fortschreitende Entwicklung seiner Vervollkommnungswerke zurückzuführen. Die Wahrheit bedarf niemals des Irrtums, und der Schatten trägt nichts zum Lichte bei.
Noch schöner ist die Wirksamkeit des Pfarrers als Sittenlehrer. Das Christentum ist eine aus zwei Arten geschriebene göttliche Philosophie: als Geschichte im Leben und Sterben Christi; als Lehre in den erhabenen Unterweisungen, die es der Welt gebracht hat. Lehre und Beispiel, diese beiden Worte des Christentums, sind im Neuen Testament oder Evangelium vereinigt. Der Pfarrer soll es immer in Händen, immer vor Augen, immer im Herzen haben. Ein guter Priester ist die lebendige Auslegung dieses göttlichen Buches. Jedes der geheimnisvollen Worte dieses Buches gibt dem Gedanken, der es befragt, eine entsprechende Antwort, und schließt einen praktisch-sozialen Sinn in sich, der die Handlungsweise des Menschen erleuchtet und lebendig macht. Es gibt, leine moralische oder politische Wahrheit, die sich nicht als Keim in einem Verse des Evangeliums fände; alle neuen Philosophien haben einen derselben ausgelegt und wieder vergessen; die Philanthropie ist aus seiner ersten und einzigen Lehre, der Liebe, entsprungen. Im Gefolge des Evangeliums ist die Freiheit durch die Welt gezogen und keine entwürdigende Sklaverei hat vor seinem Lichte bestehen können; die politische Gleichheit ist aus der Anerkennung unserer Gleichheit und Brüderschaft vor Gott, die es uns abgenötigt, entsprungen; die Gesetzen sind gemildert, die unmenschlichen Gebräuche abgeschafft worden, die Ketten sind gefallen; das Weib hat die gebührende Achtung im Herzen des Mannes wiedererobert. In dem Maße wie sein Wort durch die Jahrhunderte erschollen ist, hat es einen Irrtum oder eine Tyrannei gestürzt, und man kann sagen, daß die ganze Gegenwart mit ihren Gesetzen, Sitten, Einrichtungen und Hoffnungen nichts Anderes ist, als das in die neuere Gesittung mehr oder weniger eingefleischte evangelische Wort! Aber sein Werk ist noch lange nicht vollbracht; das Gesetz des Fortschritts oder der Vervollkommnung, diese tätige und mächtige Idee der menschlichen Vernunft, ist auch das Gesetz des Evangeliums; es verbietet uns, im Guten inne zu halten, es treibt uns zu immer Besserem an, es untersagt uns, an der Menschheit zu verzweifeln, deren Gesichtskreis es stets weiter ausdehnt und erhellt; und je mehr sich unsere Augen dem Lichte öffnen, desto mehr Verheißungen lesen wir in seinen Mysterien, desto mehr Wahrheiten in seinen Lehren, desto mehr Zukunft in unserer Bestimmung.
Der Pfarrer hat also mit diesem Buche alle Moral, alle Vernunft, alle Gesittung, alle Politik in seiner Hand. Er hat es nur zu öffnen, zu lesen, und den Schatz des Lichtes und der Vollkommenheit, wozu die Vorsehung ihm den Schlüssel anvertraut hat, rings um sich her zu verbreiten. Aber gleichwie das Lehramt Christi, soll auch das seinige ein doppeltes sein: durch sein Leben und durch sein Wort; sein Leben soll, soweit es die menschliche Schwäche erlaubt, die sichtbare Auslegung seiner Lehre, ein lebendiges Wort sein! Die Kirche hat ihn vielmehr als Vorbild denn als Orakel hieher gestellt; im Worte kann er fehlen, wenn ihm die Natur die Gabe desselben versagt hat; das Wort aber, das Allen verständlich ist, ist das Leben: keine menschliche Zunge ist so beredt und so überzeugend, wie die Tugend.
Der Pfarrer ist ferner geistlicher Spender und Verwalter der Sakramente seiner Kirche und der Liebeswerke. Seine Pflichten in dieser Eigenschaft nähern sich denjenigen, welche jede Verwaltung auferlegt. Er hat mit den Menschen zu tun, er muß sie also kennen; er kommt in Berührung mit den menschlichen Leidenschaften, seine Hand muß daher zart und sanft, voll Klugheit und Mäßigung sein. Sein Amt umfaßt der Menschen Fehler, Reue, Elend, Drangsale und Notdurft; er braucht deshalb ein Herz, das von Duldung, Erbarmung, Sanftmut, Mitgefühl, Liebe und Verzeihung überströmt! Seine Türe muß zu jeder Stunde dem, der ihn weckt, offen, seine Lampe immer brennend, sein Stock immer zur Hand sein; er darf weder Jahreszeiten, noch Entfernungen, noch Ansteckung, weder Sonnenhitze, noch Schnee kennen, wenn es sich darum handelt, dem Verwundeten das Oel, dem Sünder die Vergebung, dem Sterbenden seinen Gott zu bringen. Vor ihm, wie vor Gott, darf es weder Reiche noch Arme, weder Große noch Kleine geben, sondern allein Menschen, das heißt, Brüder in Elend und in Hoffnung. Sowie er aber seinen Dienst Niemanden verweigern darf, so darf er ihn auch ohne Behutsamkeit denjenigen nicht anbieten, die ihn verachten oder verkennen. Aufdringliche Liebe erbittert und stößt zurück, mehr als sie anzieht; er muß in vielen Fällen warten, bis man zu ihm kommt oder ihn ruft; er darf nicht vergessen, daß er bei der unumschränkten Freiheit, welche, dem Gesetze unseres gesellschaftlichen Zustandes gemäß, jeder Kultus genießt, der Mensch nur Gott und seinem Gewissen von seiner Religion Rechenschaft zu geben hat. Die bürgerlichen Rechte und Pflichten des Pfarrers fangen erst da an, wo man ihm sagt: Ich bin ein Christ.
Der Pfarrer steht in verschiedenartigen administrativen Verhältnissen zu der Regierung, zu der Gemeindebehörde und zu der Kirchenpflege.
Sein Verhältnis zu der Regierung ist einfach; er ist ihr schuldig, was jeder Bürger ihr schuldig ist, weder mehr noch weniger: Gehorsam in dem, was recht ist. Er soll weder für noch gegen die Formen oder Häupter der Regierungen dieser Erde Partei nehmen; die Formen ändern sich, die Gewalten tauschen Namen und Besitzer, Einer stürzt immer den Andern vom Thron. Das sind menschliche, vorübergehende, flüchtige, und ihrer Natur nach unbeständige Dinge; die Religion, die ewige Regierung Gottes über das Gewissen, ist über diesen Kreis politischen Wechsels und Wandels erhaben; ihr Diener soll sie ferne davon halten. Der Pfarrer ist der einzige Bürger, der das Recht und die Pflicht hat, bei allem Getriebe, Haß und Kampf der die Meinungen und Menschen trennenden Parteien neutral zu bleiben; denn er ist vor allen Dingen Bürger des ewigen Königreichs, gemeinschaftlicher Vater der Sieger und der Besiegten, Mann der Liebe und des Friedens, der nur Frieden und Liebe predigen kann; Schüler desjenigen, der für seine Verteidigung nicht einen Tropfen Blutes vergießen lassen wollte und zu Petrus sagte: Stecke dein Schwert in die Scheide!
Seinem Bürgermeister gegenüber soll der Pfarrer in dem, was die Religion betrifft, eine edle Unabhängigkeit behaupten, in allem Uebrigen friedfertig und verträglich sein: er soll weder nach Einfluß in der Gemeinde geizen, noch sich um Vorrechte streiten; er darf nie vergessen, daß seine Autorität auf der Schwelle seiner Kirche, am Fuße seines Altars, auf der Kanzel der Wahrheit, vor der Türe des Bedürftigen und Kranken, am Bette des Sterbenden anfängt und endigt: überall sonst sei er der Niedrigste, der Unscheinbarste der Menschen.
Hinsichtlich der Kirchenpflege beschränken sich seine Pflichten auf diejenige Anordnung und Oekonomie, welche die Armut der meisten Kirchensprengel mit sich bringt. Je weiter wir in der Gesittung und im Verständnis einer rein geistigen Religion voranschreiten, desto unnötiger wird die äußere Pracht in unsern Tempeln. Einfachheit, Sauberkeit, Anständigkeit in den zum Gottesdienst dienenden Gegenständen ist Alles, was der Pfarrer von seiner Kirchenpflege verlangen kann. Oft sogar hat die Armut des Altars etwas Ehrwürdiges, Rührendes und Poetisches, was durch den Kontrast mehr Eindruck und Rührung hervorbringt, als seidene Zierraten und goldene Leuchter. Was sind all unsere Vergoldungen und unsere funkelnden Sandkörner vor dem, der den Himmel ausgespannt und die Sterne gesäet hat? Vor dem zinnernen Kelch beugen sich eben so viele Stirnen, wie vor silbernen oder goldenen Gefäßen. Der Glanz des Christentums liegt in seinen Werken, und der wahrhafte Schmuck des Altars sind die in Gebet und Tugend ergrauten Haare des Priesters nebst dem Glauben und der Andacht der vor dem Gott ihrer Väter knieenden Christen.
Zu seiner Nahrung und Kleidung, zu Bezahlung und Ernährung der Weibsperson, die ihn bedient, zur Unterstützung aller Notdürftigen, die an seine Türe klopfen, bezieht der Pfarrer einen zweifachen Gehalt: den einen mit 750 Franken, vom Staat: den andern durch das Herkommen bestimmten, das Casual genannt. Dieses Casual oder der Nebenverdienst, das in manchen Städten, wo es zur Bezahlung der Pfarrgehilfen dient, ziemlich viel beträgt, bringt in den meisten Dörfern dem Pfarrer wenig oder nichts ein. Er hat also kaum das Allernotwendigste, die res angusta domi, dennoch möchten wir ihm, im Interesse der Religion wie in dem seiner Achtung an Ort und Stelle, zurufen: »Sehet nicht auf den Nebenverdienst; nehmet ihn vom Reichen an, der ihn euch aufdringt; schlaget ihn aber dem Armen aus, der sich entweder schämt, euch nichts anzubieten, oder bei dem sich zur Hochzeitfreude, zum Vaterglück oder zur Leichentrauer, der störende Gedanken gesellt, einige seltene Geldstücke im Grunde seines Beutels suchen zu müssen, um eure Segnungen, eure Tränen oder Gebete damit zu bezahlen; erinnert euch, daß wir, wenn wir uns gegenseitig das Brot des materiellen Lebens unentgeltlich schuldig sind, uns das himmlische Brot noch viel mehr schuldig sind; und weiset den Vorwurf von euch, als ob ihr den Kindern für die unschätzbare Gnade des gemeinschaftlichen Vaters Bezahlung abnähmet, und eine Taxe auf euer Gebet legtet.« Wir möchten ferner den Gläubigen zurufen: »Die Segnungen des Altars sind nicht mit Geld zu bezahlen.«
Als Mensch hat der Pfarrer noch einige ganz allgemeine Pflichten, die aus der Sorge für seinen guten Ruf, diese Blüte des bürgerlichen und häuslichen Lebens, diesen guten Geruch der Tugend, entspringen. In stiller Zurückgezogenheit in seinem bescheidenen Pfarrhause, im Schatten seiner Kirche wohnend, soll er nur selten ausgehen. Es ist ihm erlaubt, einen Weinberg, einen Garten, einen Baumacker, manchmal auch ein kleines Feld zu besitzen und mit eigenen Händen zu bebauen; einige Haustiere zum Vergnügen oder Nutzen darauf zu halten, z. B. eine Kuh, eine Ziege, Schafe, Tauben, Singvögel, besonders einen Hund, dieses lebendige Hausgeräte, diesen Freund derer, die von der Welt vergessen sind und doch das Bedürfnis fühlen, von Jemand geliebt zu werden. Aus diesem Asyl der Arbeit, der Stille und des Friedens soll der Pfarrer sich selten entfernen, um sich in die lärmenden Gesellschaften der Nachbarschaft zu mischen; er darf nur bei einigen feierlichen Gelegenheiten mit den Glücklichen der Welt aus dem Becher der Gastfreundschaft schlürfen; der Arme ist reizbar und eifersüchtig, und geneigt, den Mann, welchen er oft an der Türe des Reichen in der Stunde sieht, wo der Rauch von seinem Dache aufsteigt und einen reicher besetzten Tisch, als der seinige ist, ankündigt, der Schmarotzerei oder Sinnlichkeit zu beschuldigen. Öefters, wenn er von seinen frommen Ausflügen zurückkommt, oder wenn eine Hochzeit oder Taufe die Freunde des Armen versammelt hat, kann der Pfarrer sich einen Augenblick an den Tisch des Arbeiters setzen und sein schwarzes Brot mit ihm teilen; sein übriges Leben soll er am Altar oder in der Mitte der Kinder zubringen, die er den Katechismus, dieses gemeine Gesetzbuch der erhabensten Philosophie, dieses Alphabet göttlicher Weisheit, stammeln lehrt. Mitten unter den ernsten Studien, wozu ihm in seiner Einsamkeit seine Bibliothek den Stoff liefert, kann man den Pfarrer des abends, wenn der Küster die Kirchenschlüssel geholt, wenn die Betglocke vom Turme geläutet hat, mit seinem Brevier in der Hand, unter den Apfelbäumen seines Obstgartens, oder auf den erhabenen Fußpfaden des Gebirges die liebliche, wohltuende Luft der Fluren und die dem Tage abverdiente Ruhe genießen sehen, wie er bald stille steht, um einen Vers der heiligen Gesänge zu lesen, bald nach dem Himmel oder dem Horizont seines Tales aufblickt, und langsamen Schrittes in heiliger, köstlicher Betrachtung der Natur und ihres Urhebers wieder herabsteigt.
Dies ist die Lebensweise, dieses sind die Genüsse des Pfarrers. Seine Haare grauen, seine Hände zittern, wenn er den Kelch hält, seine gebrochene Stimme erfüllt nicht mehr das Heiligtum, klingt aber noch im Herzen seiner Herde nach; er stirbt, ein Stein ohne Namen bezeichnet seinen Platz auf dem Gottesacker, neben der Türe seiner Kirche. Sein Leben ist dahin! er ist auf immer vergessen. Aber er hat in der Ewigkeit Ruhe gefunden, wo seine Seele zum voraus lebte, und er hat hienieden das Beste getan, was man hier tun kann: er hat nämlich ein unsterbliches Dogma fortgesetzt; er hat einer unermeßlichen Glaubens- und Tugendkette einen Ring angefügt und den kommenden Generationen einen Glauben, ein Gesetz, einen Gott hinterlassen.
Was den Mann ausmacht
Was wäre der für ein Mann, der am Schlusse seines Lebens nichts aufzuweisen hätte, als seine in Verse gebrachten poetischen Träume, während seine Zeitgenossen mit allen Waffen den großen Kampf für Vaterland und Gesittung kämpften? während die ganze sittliche Welt um die Wiedergeburt der Ideen und der Verhältnisse in entsetzlichen Wehen lag? Mit allem Rechte würden verständige Leute über einen solchen Wechselbalg sich lustig machen, und er hätte wohl verdient, zum Heerestroß gestoßen oder zum unnützen Gepäck geworfen zu werden; es liegt in dieser beschaulichen Vereinzelung, die man Männern des Gedankens in Zeiten der Arbeit oder des Kampfes anrät, was man auch davon sagen möge, eine große Unmacht oder ein großer Egoismus. Der Gedanke und die Tat müssen sich notwendig gegenseitig ergänzen. Beides zusammen macht erst den Mann.
Religiöse Überzeugung
Wenn es irgend etwas Unabhängiges und Unverletzliches in der Welt gibt, so ist es der Gedanke und die Ueberzeugung. Der Verfasser hat hier kein Glaubensbekenntnis abzulegen, aber er bekennt seine Verehrung, Dankbarkeit und Liebe für eine Religion, welche die Menschheit in ihrer tiefsten Innerlichkeit berührt und durchdrungen, die göttliche Vernunft in die menschliche Vernunft eingezeugt, die Sittlichkeit zum Dogma und die Tugend zum Gesetze erhoben, endlich während zweimal tausend Jahren dem religiösen Instinkte so vieler Milliarden menschlicher Wesen eine Seele, einen Körper, eine Stimme, ein Gesetz, – so vielen Gebeten eine Zunge so vielen Aufopferungen eine Triebfeder, so vielen Schmerzen eine Hoffnung gegeben hat. Wenn er auch über die mehr oder weniger symbolische Bedeutung dieses oder jenes Dogma dieser großen Gemeinschaft der Geister eine verschiedene Ansicht hätte, könnte er jemals ohne Undank und ohne Verbrechen, feindselig gegen eine Religion sein, die er mit der Milch seiner Mutter eingesogen hat, und der er alle eigene Kenntnis höherer Dinge verdankt? Könnte er dieses Brot des Lebens, das so viele Millionen Seelen und Geister nährt und stärkt, durch den Kot ziehen? Ein solcher Gedanke wird ihm nie kommen, einen solchen hatte er nicht, indem er dies Buch schrieb. Er hatte nur einen: Verehrung gegen Gott, Liebe zu den Menschen und Freude am Guten und Schönen in allen denjenigen zu wecken, die jene edeln und göttlichen Triebe in sich fühlen. Die Kontroversen erzeugen nicht selten Streit; man soll aber auch in Sachen des Denkens Liebe und Nachsicht üben.
Man hat mich auch des Pantheismus angeklagt, oder dafür gelobt. Eben so gerne würde ich mich des Atheismus bezichtigt sehen, dieser großen moralischen Verblindung mancher Menschen, denen, ich weiß nicht durch welche Strafe der Vorsehung, der erste Sinn der Menschheit, der Sinn, der Gott sieht, abgeht. Weil der Dichter Gott überall sieht, hat man geglaubt, er sehe ihn in Allem. Man hat das Wort des heiligen Paulus, dieses ersten Commentators des Christentums: In illo vivimus, movemur et sumus, für Pantheismus genommen: in diesem Sinne bin ich Pantheist. Aber die höchste Individualität, Selbstbewußtsein und Selbstbeherrschung demjenigen bestreiten, der uns die Individualität, das Selbstbewußtsein und die Freiheit gegeben hat, dies hieße, der Sonne das Licht, dem Ocean den Wassertropfen bestreiten. Nein: mein Gott ist der Gott des Evangeliums, der Vater, der im Himmel, das heißt, der überall ist.
Hugo Felicité Robert de Lamenais
In seinem ebenso geistvollen wie dokumentarischen Buch »Die politischen und sozialen Ideen des französischen Katholizismus«, das mit kirchlicher Druckerlaubnis vom 20. September 1928 im Volksvereinsverlag in München-Gladbach erschienen ist, schließt Dr. Waldemar Gurian das 7. Kapitel mit dem Satz: »Der Mann, der am 27. Febr. 1854 mit der Kirche unversöhnt starb und in einem Massengrabe beigesetzt wurde, so daß man die Stätte nicht mehr kennt, an der sein Leib ruht, steht, wie Msgr. Baudrillart, der gegenwärtige Rektor des Instituts catholique bemerkt hat, am Anfang der intellektuellen Bewegung im französischen Klerus und an der Quelle aller großen Bewegungen der letzten Jahre des 19. Jahrhunderts«.
Dieser Mann ist Hugo Felicité Robert de Lamenais. Es ist hier nicht der Platz, Lamenais einen neuen literarischen Denkstein zu setzen. Aber die 26. Betrachtung, die Lamartine unter der Überschrift »Gott« Lamenais gewidmet hat, gibt doch Veranlassung, an dieser Stelle einiges Wenige über diese grandiose Persönlichkeit zu sagen, deren sprachgewaltiges, seine Zeit in helle Aufregung versetzendes Büchlein »Worte eines Gläubigen« die deutschen Dichter Ludwig Börne und Ehrenfried Stöber uns in unsere deutsche Sprache übertragen haben.
H. F. R. de Lamenais ist am 19. Juli 1782 in St. Malo in der Bretagne geboren und wurde nach gründlichsten Studien 1816 in Rennes zum katholischen Priester geweiht. Das hoffnungsreich begonnene Gelehrten- und Priesterleben endete in unsagbarer Tragik. Lamenais war Gegner des königlichen französischen Katholizismus, weil die Verbindung des Katholizismus mit dem Restaurationsstaat ihm für das katholische Leben keine Aussichten zur wirklichen Religiösität bot. Er zielte darum darauf hin, die kath. Kirche von dem politischen System seiner Zeit unabhängig zu machen und schuf ein eigenes gesellschaftliches Programm für die Erneuerung des französischen Katholizismus, Und wie er überhaupt Gegner der gallikanischen Ideen gewesen ist, die darauf abgestellt waren, daß die katholische Kirche in Frankreich als Staatskirche sich besonderer Freiheiten gegenüber Rom erfreute, wollte er auch nicht, daß die französischen Katholiken gebunden seien an die königlich-französische Regierung der Restauration. Der Papst war für ihn das alleinige Oberhaupt der katholischen Kirche auch in Frankreich. Leo XII. ehrte diesen Willen und bot seinem Vertreter den Kardinalshut an, den aber Lamenais zu Gunsten seines späteren Gegners Lambruchini ablehnte.
Streitbare Gegner hatte der kühne Kämpfer. Ihre Zahl wuchs und auch ihre Kraft ganz besonders, als Lamenais mit seinen jungen Genossen Montalembert und Lacordaire – sie waren 27 und 20 Jahre alt – die Zeitschrift »L'Avenir« (Die Zukunft) herausgab, und in dieser Volkssouveränität, Glaubens-, Vereinigungs- und Pressefreiheit forderte. Nur etwas über ein Jahr – vom 16. Oktober 1830 bis 15. November 1831 – ist diese Zeitung erschienen, und sie hat es nie auf mehr als 3000 Abonnenten gebracht. Aber unter ihrem Motto: »Gott und die Freiheit« war sie ein einzigartiges, sozialrevolutionäres, publizistisches Organ, dessen geistige Quelle, Glaube und Gewissen der Menschheit und Gerechtigkeit gewesen sind. Die Menschheit ist, so sagte Lamenais, nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen, und als »reinster Ausdruck der durch die Uroffenbarung gegebenen Prinzipien des mit der Religion unlöslich verbundenen Lebens« hat das Christentum die Aufgabe, die natürliche und unverlierbare Freiheit in der Welt und in der Geschichte zu verwirklichen.
Am 15. August 1832 hatten Lamenais' Feinde eine erste Verurteilung seiner Ideen in Rom erwirkt. Sie erfolgte in der Enzyklika »Mirari vos«, ohne daß der Name Lamenais genannt wurde. Als Lamenais aufrief, das Evangelium zu erfüllen, das Reich der Lüge zu zerstören und auf den Trümmern ein Reich der christlichen Eintracht und Brüderschaft aller Menschen zu errichten, wurde der Bruch des Abbé Lamenais mit der katholischen Kirche Tatsache. Es schieden sich durch die Enzyklika »Singulari vos« (25. Juni 1834) Menschen und Wege. Die soziale und religiöse Bewegung ging auch ohne Lamenais im französischen Katholizismus weiter, allerdings nicht mehr getragen von diesem stürmischen Feuerkopf. Die demokratischen und sozialen Ideen von Lamenais, für ihn begründet durch seinen religiösen Glauben, von anderen an ihm oder nur für sich vielfach um ihres sozialrevolutionären Inhalts willen geschätzt, schufen sich auch ohne den Zusammenhang mit der Kirche und in der Kirche ihre Kreise begeisterter Freunde. In der katholischen Kirche Frankreichs waren durch Antoine Frederic Ozanam im Sinne des Stifters des Ordens der Vinzentinerinnen, Vinzenz von Paul 1833 die Vinzenz-Vereine entstanden, die das Werk der sozialen Reform durch ausgedehnteste Caritas in Angriff nahmen und an vielem die Hebel ansetzten, was Lamenais als soziale Rückständigkeit erkannt und bezeichnet hatte. Wenn es in den Jahrzehnten um die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts in Frankreich eine junge kath. Bewegung, den »Sillon« (die Furche) von Mac Sagnier gegeben hat, und wenn heute wieder die soziale und die demokratische Frage im Zentrum des Lebens der Katholiken und überhaupt der Christen steht, so wirft man mehr als einen Blick auf Lamenais, der seiner Zeit eben um ein Jahrhundert vorausgewesen ist und wie so mancher andere das Los des unbequemen Neuerers tragen mußte, da er machtvolle Gegner hatte und gerade in dem Kreise verlästert und unmöglich gemacht wurde, in dem er sein erstes und größtes Wirkungsfeld suchte. Die politische Reaktion Metternichs hat das verhindert und Lamenais' Trennung von der katholischen Kirche bewirkt.
Die ersten poetischen Betrachtungen Lamartines sind 1820 erschienen, also in einer Zeit, in der Lamenais noch nicht seine großen sozialen und politischen Kämpfe führte, aber in der er immerhin mit seinen weit hinausgreifenden religiösen Gedanken an die Öffentlichkeit trat. Wir verspüren den Eindruck, den Lamenais auf Lamartine gemacht hat, wenn wir in der 26. Betrachtung die Verse lesen:
»Weck' auf uns, großer Gott! Sprich! Aendere die Welt,
und Dein befruchtend Wort vom Nichts vernommen werde!
Nun ist es Zeit! Auf! Auf! Aus Deiner langen Ruh,
schaff eine neue Welt aus diesem Chaos Du!«
Dieses Gedicht ist auch in den späteren Ausgaben der »poetischen Betrachtungen« stehen geblieben. Die Verurteilung und die Verfehmung des religiös-politischen Kämpfers hat Lamartine nicht gehindert, seine Sympathie für Lamenais zu bekunden.
Die vier Verse, die wir eben zitierten, sind eine Mahnung gewesen nicht nur für die Zeit vor 125 Jahren, die Mahnung gilt auch unserer Gegenwart, und wenn schon von einer Erneuerung der Welt im Geiste des Christentum gesprochen wird, wenn die sozial belebte kraftvolle Demokratie von den Christen als eine ethische und kulturelle Daseinsaufgabe gesehen werden soll, dann muß auch an den Mann erinnert werden, der als erster in Europa machtvoll den Ruf erhoben hat, Lamenais. Die meisten unserer deutschen Zeitgenossen kennen noch weniger seinen Namen als ihn seine Landsleute, die Franzosen, noch vor einigen Jahren gekannt haben. Inzwischen sind aber alte Bücher in Frankreich neugelesen worden und sind neue dazu gekommen. Die sozialen Lehren des Abbé Lamenais wurden eifrig studiert und auch Paul Boncourt befindet sich unter denen, die ihm eine eigene Schrift gewidmet haben. Lamenais ist kein Sozialist, aber er ist ein Sozialreformer von Format und in Deutschland haben einst Joseph Görres und sein Kreis von ihm Anregung erhalten, wie eine neue Arbeit von Liselotte Ahrens uns ihn näher brachte. Vielleicht ist es auch nicht ausgeschlossen, daß jene erste deutsche sozialpolitische Rede in einem deutschen Parlament, die der Badener Franz Josef Buß am 25. April 1837 im Bad. Landtag gehalten hat, und die einzig in ihrer Zeit dasteht, wie das August Bebel bekannte, beeinflußt war von den sozialen Ideen des Abbé Lamenais. Sie waren beide ja Zeitgenossen, beide Katholiken und beide Feuerköpfe von Format. Die soziale Betätigung von Buß in den späteren Jahren, der immer mehr erhobene Weckruf an die katholische Kirche, sich der sozialen Not anzunehmen, den wir bis zum Jahre 1846 hören, von welchem Datum ab Buß von anderen Gedanken mehr in Anspruch genommen war, standen aber sichtlich unter dem Einfluß von Lamenais, Und das, obwohl Lamenais Revolutionär, Buß Konservatiker war, obwohl Lamenais außerhalb der Kirche, Buß mitten in ihr stand.
Dieses kleine Wort zum besseren Verständnis, warum wir aus Lamartines Werken dieses Gedicht an Lamenais in der Übersetzung von Georg Herwegh hier ebenfalls abdrucken.
Soviel an dieser Stelle. In dem Wohl bald in unserem Verlag erscheinenden Neudruck der »Worte eines Gläubigen« ist von der Stellung Lamenais' in seiner Zeit und in der unserigen mehr gesagt.
Gott
An den Abbé de Lamenais
Es mag der Geist so gern an seinen Fesseln rütteln
Und ab die schwere Last des Menschenelends schütteln:
Indessen ruht mein Sinn auf dieser Körperwelt,
Steig' ich zur Geisterwelt empor, wenn mir's gefällt.
Ich lass' dies ganze All zu meinen Füßen schweben,
Um frei in dem Gebiet des Möglichen zu leben.
Der Seele ist zu eng der Kerker, drin sie wohnt,
Und eine Glätte sucht sie
ohne Horizont.
Gleich einem Tropfen, den wir in den Ozean gießen,
Will im Unendlichen mein Denken all' zerfließen;
Da herrscht's als Königin des Raums, der Ewigkeit,
Und mißt gar kühn die Zeit und die Unendlichkeit.
Durchläuft das Sein und wagt es, durch das Nichts zu schweifen,
Die Unbegreiflichkeit des Schöpfers zu begreifen.
Wie aber mein Gefühl zu schildern auch ich such',
Stirbt jedes Wort hin in ohnmächtigem Versuch.
Die Seele wollte oft schon sprechen, doch es hatten
Die Lippen Töne nur, meiner Gedanken Schatten.
Zwei Sprachen für den Geist geschaffen hat der Herr:
Man spricht die eine aus und hört sie gleich nicht mehr;
Es kann von Menschen hier die Sprach' erlernet werden,
Sie reicht gerade aus für das Exil auf Erden
Und folgt dem wandelbaren Geschicke der Menschheit,
Verschieden nach dem Land, vergeht sie mit der Zeit.
Die andre, ewig, allumfassend, auserlesen,
Ist angeboren schon jedwedem denkenden Wesen:
Sie ist kein toter Schall, der in der Luft verhallt,
Nein, ein lebendig Wort, das aus dem Herzen schallt;
Man höret, man begreift, man spricht sie mit der Seele.
Sie leuchtet und schlägt ein, trifft stets die rechte Stelle:
Des Himmels Sprache ist's, gesprochen vom Gebet,
Die zarte Liebe nur aus Erden hier versteht;
Des Herzens glühende Gefühle auszudrücken
Weiß sie in Seufzern nur und in entzückten Blicken.
Wenn himmelan sich hebt die Seel' in kühnem Schwung,
Wird sie mir offenbar durch die Begeisterung;
Und diese kann allein Licht in der Nacht gewähren
Und besser als Vernunft mir diese Welt erklären.
O komm' und lasse auch auf ihren Flügeln dich
Zum Himmel tragen, wie getragen werden ich.
Schon sehen wir die Welt weit unter uns da liegen,
Der Zeit entfliehen wir, den Raum wir überfliegen,
Und in der ewigen Ordnung der Wirklichkeit
Sehn wir von Antlitz nun zu Antlitz die Wahrheit.
Die Sonne, die Aufgang und Untergang nicht kennet.
Ist
Gott, das All, das vor sich selbst in Andacht brennet!
Er ist allein! und Zeit und Unermeßlichkeit
Sind Elemente nur seiner Unendlichkeit.
Das Licht, das ist sein Blick, der Raum sein Aufenthalt, er
Gibt in der Welt sein Bild, in der Ewigkeit sein Alter;
Im Schatten seiner Hand besteht die Schöpfung blos,
In ew'gen Fluten quillt das Sein aus seinem Schoß,
Aus dieser ew'gen Quell' ein ew'ger Strom es rinnet
Und kehrt in ihn zurück, in dem das All beginnet.
Maßlos wie Er erschallt der Werke Dankesruf
Im Werden schon zu ihm, daß Allmacht sie erschuf!
Mit jedem Atemzug kann Welten er erschaffen,
Aus sich nimmt Alles er, bezieht auf sich es stets,
Sein höchster Wille ist ihm oberstes Gesetz!
Doch dieser Wille, den ein Schatten decket nimmer,
Ist Macht, Gerechtigkeit, Ordnung und Weisheit immer.
Und alles lenket er mit ihm in seinem Lauf,
Und stufenweise steigt das Nichts zu ihm hinauf.
Und Jugend, Liebe, Kraft, Verstand, Schönheit und Leben
Kann ohne Maß und Ziel aus seiner Füll' er geben;
Das Nichts wird Herrlichkeit auf Gottes Machtgebot,
Aus einem Stäubchen kann er schaffen einen Gott!
Und dieser Gott, der ward von ihm hervorgerufen,
Er zählet immerdar des tiefen Abstands Stufen,
Und strebt zum Schöpfer stets empor in kühnem Flug,
Der aller Dinge Ziel und sich allein genug.
Das ist, das ist der Gott, den jeder Geist verehret,
Den Abraham geglaubt, Pythagoras gelehret,
Der Sokrates erschien, geahnt von Plato ward;
Der Gott, den der Vernunft das Weltall offenbart,
Der für das Recht und für das Unglück mußte kommen,
Den
ganz zu eigen uns,
Christus herabgekommen!
Das ist nicht mehr der Gott, gemacht von Menschenhand,
Der Gott nicht, den Betrug für Toren einst erfand,
Der Gott ist's nicht, entstellt, von falscher Priester Händen,
Zu dem Leichtgläubige voll Angst und Furcht sich wenden,
Er ist's allein, ist eins, gerecht und gut sein Sinn,
Die Erde sieht sein Werk, der Himmel kennet ihn.
O glücklich, wer ihn kennt! Noch mehr, wer ihn bekennet!
Wer, während ihn die Welt beschimpft oder nicht kennet,
Beim Lampenschein sich allein in stiller Nacht
Ins Heiligthum begibt vom Glauben überwacht,
Von heißer Liebe sich zu ihm hinauf laßt ziehen,
Läßt seine Seele gleich dem Weihrauch dort verglühen!
Doch zu erheben sich zu ihm braucht unser Geist,
Gedrücket und gebeugt, des Himmels Kraft zumeist.
Wir müssen uns hinauf auf Flammenflügeln schwingen,
Sehnsucht und Liebe kann allein hinauf uns bringen.
Ach – daß ich Spätling nicht zu jener Zeit entstand,
Da noch die Menschen, jung, entschlüpft kaum seiner Hand,
Gott nahe durch die Zeit, näher durch Unschuld stehend,
Verkehrten mit ihm, vor seinem Antlitz gehend!
Was sah ich nicht die Welt, nachdem sie kaum gemacht?
Und hört den Menschen nicht, da er zuerst erwacht?
Alles sprach ihm von dir, du hast zu ihm gesprochen;
In tausend Strahlen hat dein Schimmer sich gebrochen;
Sogleich, als die Natur aus deinen Händen sprang,
Des Schöpfers Namen auch allüberall erklang:
Der Name, der jetzt durch der Zeiten Rost verborgen
Ist, glänzte strahlendhell am jungen Schöpfungsmorgen;
Es durfte vormals nur der Mensch dir nahen sich,
An seinen Vater flehn, da riefst du:
der bin ich.
Gleich einem Kind hat lang ihn deine Stimm' regieret,
Du hast ihn lange Zeit au deiner Hand geführet;
Wie oftmals ward er dich in deinem Glanz gewahr,
Bei Mamre's Eichen, in dem Tale von Sennar,
In Hored's Flammenbusch und auf dem heil'gen Berge,
Von welchem Moses stieg mit dem Gesetzeswerke!
Die Kinder Jakobs, aus Aegypten fortgereist,
Hast vierzig Jahre lang mit Manna du gespeist.
Durch Donnerorakel hast du ihren Geist erschrecket
Und ihrem Blicke dich durch Wunder oft entdecket,
Vergaßen sie sich je, so fandest Engel du,
Die riefen ihnen laut des Herren Namen zu.
Doch gleich dem Flusse, fern dem Quell, der ihn geboren,
Hat die Erinnerung an dich sich auch verloren,
Es hat den alten Stern der Zeiten düstre Nacht,
Um seinen hehren Glanz und Herrlichkeit gebracht.
Du sprachst nicht mehr: und es fing die Hand der Zeiten
An, nun Vergessenheit aus über dich zu breiten!
Der Glaube minderte im Lauf der Jahre sich;
Den Zweifel stellt der Mensch zwischen die Welt und dich.
Für deinen Ruhm zu alt ist diese Welt geworden,
Dein Namen, deine Spur vergessen aller Orten,
Zu finden wieder sie, muß man in seinem Lauf
Der Tage langen Strom gehn Well' um Well' hinauf,
Natur und Firmament! zeigt euch umsonst den Sinnen!!
Den Tempel sieht der Mensch, doch nicht den Gott, der drinnen.
Vergebens spüret er im blauen Lustgefild
Dem Lauf der Sterne nach, mit denen es erfüllt;
Er kennet, die sie lenkt, die Hand nicht mehr jetzunder,
Ein ewig Wunder hört leicht auf, zu sein ein Wunder,
Sie glänzen morgen, wie wir heut' sie glänzen sah'n!
Wer kann uns sagen, wo ihr Strahlenlauf begann?
Ob, das befruchtet und erwärmt, das Licht dort, oben
Sich auch ein erstes Mal über die Welt erhoben?
Niemand hat leuchten es zum ersten Male gesehn,
Für ew'ge Tage kann kein erster Tag bestehn.
Die sittliche Welt wird umsonst dein Dasein nennen,
Im Wechsel lassen dich vergebens auch erkennen;
Vergebens spielst du mit dem allergrößten Land
Und gibst's von Herrn zu Herrn und gibst's von Hand zu Hand,
All' dieser Wechsel nimmt die Augen nimmer Wunder,
Und zur Gewöhnlichkeit sank nun der Ruhm herunter;
Der größte Schicksalsschlag wird uns nichts Neues sein,
Das Stück ist längst verbraucht, gelangweilt schläft man ein.
Weck' auf uns, großer Gott! sprich, ändre Welt und Erde,
Und dein befruchtend Wort vom Nichts vernommen werde:
Nun ist es Zeit! Auf! Auf! aus deiner langen Ruh:
Schaff' eine neue Welt aus diesem Chaos du!
Ein andres Schauspiel laß die müden Augen sehen!
Vor unserm Zweifelssinn laß neue Wunder stehen!
Die Himmel, die zu uns nicht sprechen mehr, schaff' um,
Und eine neue Sonn' kreis' über uns herum;
Zerstör' die Welt, sie möcht' sonst deinen Ruhm dir rauben;
Komm', komm', und zeig' dich selbst und zwinge uns, zu glauben!!
Doch ehe noch vielleicht herein die Stunde bricht,
Da diesem Weltall wird entziehn die Sonn' ihr Licht,
Wird jene andre Sonn', die sittliche, aufhören,
Dem menschlichen Verstand Erleuchtung zu gewähren,
Und an dem Tage, da erlischt ihr heller Schein,
Das ganze Weltall stürzt in ew'ge Nacht hinein,
Und alsdann wirst du wohl dein unnütz Werk zerschlagen.
In alle Zeiten wird der Trümmerhaufe sagen:
Es kann nichts außer mir bestehn! Ich bin allein!
Ihr habt nicht mehr geglaubt und höret auf zu sein!
Die religiöse Welle
Ein religiöser Zug geht durch alles menschliche Denken; aber die lautere Religion des Herzens hat nur im Glauben und Bewußtsein ihren Halt. Sie verlangt von der öffentlichen Gewalt keine innigere Teilnahme, die sie nur irre führen, keine Gunstbezeugungen, die ihr nur schaden könnten; sie verlangt nur, was sie selbst zugesteht, was ihr eigenstes Wesen und ihren Ruhm ausmacht, Unabhängigkeit und freie Ueberzeugung. Die Politik ist nicht mehr jene schmähliche Kunst, die Menschen zu verderben und zu täuschen, um sie zu knechten. Das Christentum hatte auch in sie einen göttlichen Keim von Sittlichkeit, Gleichheit und Tugend gelegt, der freilich Jahrhunderte bedurfte, um sich zu entwickeln. Man sieht seine allmählige Entwicklung von Jahrhundert zu Jahrhundert, in den Seufzern der Völker, in den Wünschen guter Könige; er ist ein lebensvoller Gedanke des menschlichen Geschlechts, immer angegriffen, nie unterdrückt. Schon Fenelon's frommer Geist enthüllt ihn der Gewalt, als das heilige Gesetz politisch christlicher Liebe, als das Evangelium der Herrscher, Er ging unversehrt aus den Fesseln des Despotismus, wie aus den Saturnalien der Anarchie hervor; er triumphiert über die Schwachen, die ihn leugnen, über den Wahnwitz, der ihn entweiht, Vernunft, Freiheit, Sittlichkeit verlassen endlich das unbestimmte theoretische Feld, suchen Form und Gestalt anzunehmen und gewinnen Leben und Dasein in Institutionen, wo Ordnung und Freiheit sich gegenseitig Garantie leisten. Das sind die Zeichen des neuen Jahrhunderts! Wenn es nicht die blutigen Lehren der Vergangenheit vergißt, wenn es sich erinnert an die Anarchie und Sklaverei, die zwei Rachegeißeln, welche die Verbrechen der Könige, wie die Ausschweifungen der Völker strafen; wenn es von den menschlichen Einrichtungen nicht mehr fordert, als mit unserer unvollkommenen Natur verträglich ist, so wird es seine glorreiche Bestimmung erfüllen; es wird den frohen Empfindungen entsprechen, mit der es heute die Menschen voll Hoffnung begrüßen.
Die Ideen der Revolution
Es ist nun bald ein halbes Jahrhundert, daß diese Revolution, nachdem sie in den Ideen bereits gereift war, auch in der Wirklichkeit ausgebrochen ist. Sie war anfangs nichts als ein Kampf, hernach ein Einsturz, dessen Staub lange Zeit Alles verdunkelte; man wußte weder warum, noch aus welchem Boden, noch unter welchen Fahnen man stritt. Man feuerte, wie in nächtlichem Kampfgewühl, auf Freunde und Brüder; den Schlägen folgten Gegenschläge; empörende Auftritte befleckten alle Farben; mit Abscheu zog man sich von einer Sache zurück, auf deren Seite das Verbrechen trat, und die es verdarb, wie es jede Sache verdirbt; man ging von einem Extrem zum andern über; man erkannte Nichts mehren den stürmischen Bewegungen, in dem Wechsel des Schlachtenglücks; es war eine Schlacht, das heißt Verwirrung und Unordnung, Sieg und Niederlage, Enthusiasmus und Entmutigung.
Die menschliche» Ideen haben für Europa eine jener großen organischen Krisen herbeigeführt, wovon die Geschichte nur einen oder zwei Daten überliefert hat; Epochen, wo eine abgenutzte Zivilisation einer andern weicht, wo die Vergangenheit keinen Halt mehr hat, wo den Massen sich die Zukunft zeigt, mit aller Ungewißheit und Dunkelheit, die das Unbekannte immer hat; schreckliche Epochen, wenn sie nicht fruchtbar sind; Krankheiten in den Entwicklungsstufen des menschlichen Geistes, die ihn für Jahrhunderte lang töten, oder für ein neues und langes Dasein beleben. Die französische Revolution war die Sturmglocke der Welt. Mehrere ihrer Phasen sind vollendet, sie selbst ist noch nicht geschlossen; nichts hat ein Ende in diesen langsamen, innerlichen, ewigen Bewegungen des Menschenlebens: es gibt Zeiten des Stillstands; aber in eben diesen Zeiten reisen die Gedanken, sammeln sich die Kräfte und rüsten sich zu neuer Tätigkeit.
Im Entwicklungsgang der Staaten und Ideen ist der Zweck immer nur ein neuer Ausgangspunkt. Die französische Revolution, die man später die europäische nennen wird, – denn die Ideen verurteilen sich, wie das Wasser in ebener Fläche, – die französische Revolution, sage ich, ist nicht bloß eine politische Revolution, eine Umänderung der Staatsgewalt, ein Dynastiewechsel, eine Republik statt einer Monarchie; alles dieses ist nur zufällig, nur äußerliche Erscheinung, nur Werkzeug, nur Mittel, Ihr Werk ist um so wichtiger und höher, weil sie unter allen Regierungsformen in Erfüllung gehen könnte, und weil man Monarchist oder Republikaner, ein Anhänger der einen oder der andern Dynastie, dieser oder jener konstitutionellen Einrichtung sein könnte, ohne deswegen mit weniger Aufrichtigkeit und geringerer Tiefe der Revolution zugetan zu sein. Man kann ein Instrument dem andern vorziehen, um die Welt zu bewegen und ihre Stellung zu verändern; das ist Alles, Aber die Idee der Revolution, d, h, der Umänderung und Verbesserung, erleuchtet nichts desto weniger den Geist, und erwärmt nichts desto weniger das Herz, Wo ist unter uns der Mann, der denkt, ein Mann von Herz und Vernunft, ein Mann von Religion und Hoffnung, der, wenn er die Hand auf die Brust legt und sich im Angesicht einer in Gesetzlosigkeit und Altersschwäche dahin siechenden Staatsgesellschaft vor Gott fragt, nicht antwortete: »Ich bin revolutionär«? Die Zeit reißt Alle mit sich fort, sowohl den, der ihr widersteht, als den, der mit seinen Wünschen ihr voraus oder zu Hilfe eilt, Ihr Strom ist so reißend und unüberwindlich, daß diejenigen, welche am kräftigsten rudern, und den Drang der Wogen zu besiegen oder zu lähmen glauben, unmerklich sich weit von dem Gesichtspunkt, an dem sie mit Herz und Blick hingen, hinweggerissen sehen, und dann ganz erstaunt sind, wenn sie einst den Weg messen, den sie gegen ihren Willen gemacht haben.
Die Presse
Heute fängt man an, den Plan der Vorsehung in jenem großen Kampf zwischen den Menschen und Ideen zu erkennen. Der Staub hat sich gelegt, der Horizont wird heller. Man sieht die gewonnenen und verlorenen Stellungen, die auf dem Schlachtfeld gebliebenen, die zu Tod getroffenen, die noch lebenden, die jetzt oder später siegreichen Ideen: man begreift die Vergangenheit; man begreift das Jahrhundert; man erkennt einen Streif von der Zukunft. Es ist ein schönes und seltenes Denkmal für den Menschengeist. Er hat das Bewußtsein von sich selbst und von dem Werke, das er vollendet; es wird fast Tag am Horizont seiner Zukunft. Ist eine Revolution einmal begriffen, so ist sie auch vollendet: der Erfolg kann spät eintreffen, ist aber nicht mehr zweifelhaft. Die neue Idee hat, wenn auch noch nicht ihr Gebiet, doch ihre unfehlbare Waffe erobert. Diese Waffe ist die Presse: die Presse, diese tägliche und allgemeine Offenbarung Aller durch Alle, ist dem Geist der Neuerung und Verbesserung dasselbe, was das Schießpulver Jenen war, die sich seiner zuerst bedienten: nämlich ein in mächtiger Ueberlegenheit gesicherter Sieg, Für die politischen Philosophen handelt es sich also nicht mehr darum, zu kämpfen, sondern die unüberwindliche Waffe der neueren Zivilisation zu mäßigen und zu leiten. Die Vergangenheit ist zertrümmert, der Boden frei, der Raum leer, die Rechtsgleichheit als Grundsatz aufgestellt, die Redefreiheit in den Regierungsformen anerkannt, die Gewalt ist zu ihrer Quelle zurückgegangen; das allgemeine Interesse und die allgemeine Vernunft sprechen sich in Institutionen aus, welche mehr die Schwäche als die Tyrannei zu fürchten haben; das gesprochene und geschriebene Wort hat das Recht, sich überall und immer an die Einsicht Aller zu wenden; dieses große Tribunal der Vernunft beherrscht alle andern aus ihm entsprungenen Gewalten und wird sie mehr und mehr beherrschen; jetzt und künftighin regt sie alle sozialen, religiösen, politischen, nationalen Fragen an, mit jener Kraft, welche die öffentliche Meinung ihr leihen wird je nach dem Maße ihrer Ueberzeugung, bis daß die menschliche Vernunft, erleuchtet von dem Strahl, den Gott ihr leihen wird, in den Besitz der ganzen sozialen Welt getreten ist, und, zufrieden mit ihrem logischen Werk, wie der Schöpfer spricht: »Was ich getan habe, ist wohl getan«, und einige Tage ausruht, wenn es anders im Himmel und auf der Erde Ruhe gibt.
*
Der Strom hat seinen wilden Sturz hinter sich, die Fluten werden ruhiger, der Lärm vertost, der menschliche Geist fließt in einem breiteren Bett, er rauscht frei und kräftig dahin; er hat nur sein eigenes Ungestüm, seine eigene Aufwallung zu fürchten, er kann sich nur mit seinem eigenen Kote besudeln. In gerader Richtung strömt er dem unbekannten Ziele zu; ein unendlicher Durst nach Vervollkommnung, nach Wahrheit und Sittlichkeit verzehrt ihn; ein neuer Sinn, ein heilbringender oder verderblicher Sinn, ward ihm gegeben, diesen Durst zu stillen. Dieser Sinn, welcher der Menschheit erst in ihrem Alter enthüllt wurde, gleichsam um sie zu trösten und zu verjüngen, dieser Sinn ist die Presse; eine neue Macht, die sich noch nicht kennt und noch vor sich selbst erschrickt. Sie richtet in einer schon fertigen Zivilisation dieselbe Verwirrung an, die ein sechster Sinn in der menschlichen Organisation verursachen würde. Aber die Zeit, ihr eigenes Uebermaß, der einzige unfehlbare Prüfstein der Gesetzgebungen, werden ihren Gebrauch regeln, ohne ihrer Früchte uns zu berauben, und wie erschreckend auch die schwankende Stellung ist, in die sie die charakterfestesten Geister versetzt, ich kann nicht glauben, daß wir einer Macht weiterhin fluchen dürfen, die eine Vorsehung, weiser und großmütiger als wir, dem menschlichen Gedanken zugestanden hat, und eine ihrer köstlichsten Gaben verschmähen und ihre Wohltat verwerfen.
Durch Liebe zum Sozialismus
Die industrielle Bewegung; – sie entreißt die Bevölkerung den häuslichen Sitten und Gewohnheiten, den friedlichen und ehrlichen Beschäftigungen mit dem Landbau; sie übertreibt die Arbeit durch den Gewinn, den sie plötzlich in die Höhe treibt und ruckweise wieder fallen läßt; an den Luxus und an die Laster der Städte gewöhnt sie Menschen, die sich nicht mehr in die Einfachheit und Mäßigkeit des Landlebens fügen können; daher heute ein Mangel, morgen ein Ueberfluß an Arbeitern, die dann aus Hunger und Not dem Aufruhr und der Verwirrung zur Beute werden.
Die Proletarier; – eine zahlreiche Klasse, unbemerkt unter einer theokratischen, despotischen und aristokratischen Regierungsform, wo sie unter dem Schutz einer der Mächte lebt, die den Boden besitzen, und wenigstens in ihrer Schutzherrschaft eine Garantie für ihr Dasein hat; die aber heutzutage, wo sie durch die Unterdrückung ihrer Schutzherrn und durch den Individualismus sich selbst überlassen ist, in einer schlimmeren Jage als je, sich befindet, unfruchtbare Rechte erobert hat, ohne das Nötige zu besitzen, und die Gesellschaft so lange ausregen wird, bis der verhaßte Individualismus dem Sozialismus weicht.
Aus der Lage der Proletarier ist die Frage des Eigentums entstanden, die heutzutage überall abgehandelt wird; eine Frage, die sich durch den Kampf lösen würde, wenn sie nicht bald durch die Vernunft, durch die Politik und die soziale Liebe gelöst wäre. Die Liebe ist so viel wie Sozialismus; – die Selbstsucht so viel wie Individualismus, Die Liebe, wie die Politik, befiehlt dem Menschen, seinen Nächsten nicht sich selbst zu überlassen, sondern ihm zu Hilfe zu kommen, eine Art gegenseitiger Versicherung unter billigen Bedingungen zwischen der besitzenden und nicht besitzenden Klasse zu bilden; sie sagt dem Eigentümer: du wirst dein Eigentum behalten; denn trotz dem schönen Traum der Gütergemeinschaft, der vom Christentum und den Philanthropen vergebens versucht wurde, scheint bis auf diesen Tag das Eigentum, die notwendige Bedingung jedes Staatsgebäudes zu sein; ohne dasselbe ist weder Familie, noch Arbeit, noch Zivilisation denkbar. Aber sie sagt ihm auch: du wirst nicht vergessen, daß dein Eigentum nicht bloß für dich, sondern für die ganze Menschheit da ist; du besitzest es nur unter gewissen Bedingungen der Gerechtigkeit, Nützlichkeit, Verteilung und des Genusses für Alle; aus deinem Ueberfluß wirst du also deinen Brüdern die Mittel zur Arbeit verschaffen, die ihnen nötig sind, damit auch sie ihren Teil bekommen. Ueber dem Recht des Eigentums wirst du ein anderes Recht anerkennen, das Recht der Menschlichkeit! Darin besteht die Gerechtigkeit und Politik; beide sind Eins.
Tag des Gerichts
Wir, die wir jetzt andere richten, bald wird man uns selbst richten; bald wird eine unparteiische Zukunft nach unsern Ansprüchen auf den Ruhm des Jahrhunderts, die wir so unendlich groß glauben und die sie allein kennt, fragen; bald wird sie das schreckliche Verzeichnis unserer Meinungen aufsetzen, die wir Grundsätze nennen, unserer Vorurteile, die wir Gerechtigkeit heißen, unseres Lärmens, den wir für Ruhm halten. Und bereits richten wir uns selbst; bereits, indem wir unsere Vorurteile als Zeugen, unsere Parteilichkeit als Richter anrufen, vergöttern oder verdammen wir, je nachdem die Leidenschaft in uns spricht, ein Jahrhundert, von dem wir erst die blutige Morgenröte gesehen haben; ein Jahrhundert der Finsternis für die Einen, ein Jahrhundert des Lichts für die Andern, ein Jahrhundert des Kampfes für Alle!
Wir wollen weder diese Verachtung, noch diesen Stolz teilen! wir wollen nicht glauben, daß jene Wahrheit, die allen Zeiten, allen Menschen angehört, nur auf unser Dasein gewartet habe, um wolkenlos über unsrer Wiege sich zu erheben. Wir wollen nicht vergessen, daß jede Wahrheit ein Kind der andern, ein Kind der Zeit ist, wie die Weisen sagen, daß die ganze Zivilisation an jener goldenen Kette hängt, die die Welt trug und nur ein glänzender Schein war. Doch wir wollen uns auch nicht selbst verleumden; der Tag des Gerichts erscheint nur zu bald! zu bald schon wird die Nachwelt uns auf die Wage legen und sagen: sie waren (was wir auch in der Tat sind) die Menschen einer doppelten Epoche in einem Jahrhundert des Uebergangs!