
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn wir im Geiste mit atemloser Spannung kühne Forschungsreisende auf ihren Entdeckungsfahrten in fremde Länder begleiten und uns die sie bedrohenden Gefahren so recht zu vergegenwärtigen suchen, so denken wir dabei wohl in erster Linie an bewaffnete Zusammenstöße mit wilden Eingeborenen, an lebensgefährliche Jagden auf Löwen und Tiger, Elefanten und Nilpferde, Büffel und Nashörner. Und doch nehmen alle solche Zusammentreffen mit den großen Tieren der Wildnis nur wenige nervenspannende Stunden in Anspruch, doch treten sie in Wahrheit vollkommen zurück hinter den kleinen Freuden und Leiden des aufreibenden Alltags, hinter dem unablässigen Kampf, den der Reisende zu führen hat gegen Millionen vielgestaltiger kleiner Plagegeister aus dem unerschöpflichen Heere der Insektenwelt. Diese winzigen Plagegeister erschweren in viel höherem Maße, als die Raubtiere und Dickhäuter, das Reisen in solchen Gegenden und machen es zur Qual und manchmal zur Unmöglichkeit. Der Kampf gegen sie ist ungleich aufreibender, hartnäckiger und aussichtsloser. Sie bezwingen den Menschen oft genug durch ihre Menge, durch ihre Unermüdlichkeit und durch ihre Allgegenwart. Nirgends vermögen wir diesen kleinen Quälgeistern zu entrinnen, die unter Umständen das Leben zur Hölle machen. Jeder, der in heißen Ländern gereist ist, weiß ein Liedchen davon zu singen, und auch in meiner Erinnerung taucht, während ich diese Zeilen niederschreibe, so manches unliebsame Erlebnis wieder auf.
Unermeßlich schöne Wochen voll erhebender Jäger- und Forscherfreuden hatte ich in den prachtvollen Urwaldungen und in den schroffen Felsenwirrnissen des bulgarischen Hochbalkans verlebt, aber wir atmeten damals doch auf, als nach langem, anstrengendem Marsche durch die heiße bulgarische Ebene dann endlich die Hügelstadt Philippopel vor unserem Auge aufstieg. Hier wollten wir uns einige Tage Ruhe gönnen, hier die langentbehrten Genüsse der Zivilisation wieder einmal recht gründlich auskosten. Das erste Gasthaus der malerischen Stadt nahm uns freundlich auf, obwohl wir in unseren abgerissenen Jagdkleidern nicht gerade besonders vertrauenswürdig aussahen. Es gab ein nach unseren damaligen Begriffen köstliches Abendessen am gedeckten Tisch mit richtigen Porzellantellern, und ein tüchtiger Trunk deutschen Bieres beschloß den festlichen Tag. Dann aber harrten unser, die wir wochenlang auf harter Erde im Schlafsack oder unter dem Zelte genächtigt hatten, endlich wieder einmal richtige Betten, und wie freuten wir uns auf dieses mollige Lager! Während unsere Leute in einfacheren Räumen untergebracht waren, bezogen Freund R. und ich das beste Zimmer des Hauses, und wir hatten unsere Freude an den schönen Stickereien und Teppichen, mit denen die sonst kahlen Wände bekleidet waren und die dem Raum ein so wohnliches und heimeliges Ansehen verliehen. Wir ahnten ja nicht, welche Qualen unser unter diesen Teppichen harrten! Mit wohligem Behagen streckten wir schließlich die müden Glieder in den schönen Betten und überließen uns dem Schlummer. Aber nicht lange. Ich machte auf; am ganzen Körper empfand ich ein gräßlich brennendes Gefühl, begann mich unwillkürlich zu kratzen, und als ich dann ein Insekt mit den Fingern erwischte und gleich darauf einen abscheulichen Geruch wahrnahm, da stieg's mit schauervoller Gewißheit in mir empor: Wanzen! Dem Reisegefährten ging es nicht anders. Auch er saß schimpfend aufrecht in seinem schönen Lager, das er mit soviel Wohlbehagen aufgesucht hatte. Was soll ich diese wenig angenehme Erinnerung weiter ausmalen? Das Ende war, daß wir arg zerstochen das schöne Gastzimmer verließen, auf das flache Dach des Hauses stiegen und uns hier wieder in unsere treuen, vorher schnöde verachteten Schlafsäcke einhüllten, gewiß, in diesem schlafen zu können, ohne von greulichen Wanzen und anderem Ungeziefer gräßlich geplagt zu werden.
Möglich, daß die Bettwanze ( Cimex lectularius, Abb. 1) von jeher im nahen Orient heimisch war, wo sie heute ja nach besonders verbreitet ist, wahrscheinlicher, daß sie ursprünglich aus Ostindien stammt und von dort erst nach Europa verschleppt wurde. Sicheres über die Herkunft des Tieres wissen wir nicht, nur daß wir zweifellos den Wunsch haben, es möchte da geblieben sein, wo der Pfeffer wächst. Schon die Griechen und Römer kannten die Bettwanze. In Straßburg soll sie zuerst im 11. Jahrhundert aufgetreten sein, und aus London wird sie gar erst in der Hälfte des 17. Jahrhunderts erwähnt, indem sie nach der einen Überlieferung mit nordamerikanischem Bauholz, nach der andern mit den Bettstellen geflüchteter Hugenotten eingeschleppt worden sein soll. Manche Naturforscher sind auch der Ansicht, daß die Bettwanze ursprünglich die Behausungen der Schwalben, Tauben und Fledermäuse bewohnte und sich dann erst allmählich an das Zusammenleben mit den Menschen angepaßt hat. Auch heute finden wir noch an den genannten Örtlichkeiten oft genug Wanzen. Aber es handelt sich dabei gewöhnlich um andere, den betreffenden Tieren angepaßte Arten, die allerdings, wenn sie auf den Menschen kommen, auch an diesem Blut zu saugen versuchen. Die Sache ist aber nicht so gefährlich, daß man etwa die Schwalbennester an den Häusern zerstören müßte, wie es in manchen Gegenden leider geschieht. Gerade bei den Schwalben verwechselt der Laie die in ihren Nestern und Federn schmarotzenden Lausfliegen gewöhnlich mit Wanzen.
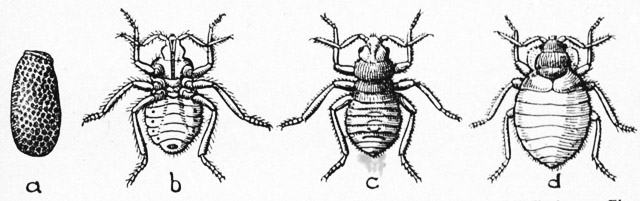
Abb. 1. Bettwanze. a Ei, b Larve von der Bauchseite, c von der Rückenseite, d Vollgesogenes Tier.
Jedenfalls ist das greuliche Insekt heute Weltbürger und findet sich überall da, wo Menschen wohnen. Bei nomadisierenden Völkerschaften fehlt die Bettwanze; sie wird zum unerwünschten Hausgenossen der Menschen erst von dem Tage an, wo sie seßhaft werden. Je unsauberer diese sich halten, je mehr sie in den Häusern zusammengedrängt sind, um so wohler fühlt sich die Wanze, und deshalb sind vernachlässigte Großstadtwohnungen ihr Dorado. Tagsüber sitzt sie hier verborgen hinter lockeren Tapeten, in feinen Rissen und Spalten des Mauerwerks oder der hölzernen Bettstelle und kommt erst mit Einbruch der Dunkelheit hervor, um den ahnungslosen Schläfer zu überfallen und gierig sein Blut zu saugen. Eiserne Bettstellen schützen ja bis zu einem gewissen Grade, und auch an solche aus Erlenholz soll die Wanze nicht gern gehen, auch solche Zimmer meiden, in denen viel geraucht wird. Leider muß man aber im allgemeinen doch sagen, daß einmal eingenistete Wanzen sehr schwer wieder zu vertreiben sind, denn sie sind äußerst widerstandsfähig, und es bedarf schon sehr starker Mittel, um ihnen den Aufenthalt zu verleiden. Man braucht ja nicht so weit zu gehen, wie ein Schriftsteller des Mittelalters, der den drastischen Rat gibt, verwanzte Häuser einfach abzubrennen, aber man tut doch gut, nicht lange herumzudoktern, sondern gleich einen tüchtigen und erfahrenen Kammerjäger mit der Ausrottung der stinkenden Plagegeister zu betrauen. In der Wärme fühlt sich die Wanze besonders wohl, wird deshalb im Sommer oder im geheizten Zimmer besonders lästig und ist nirgends so häufig, wie in warmen Ländern. Im nahen Orient zum Beispiel ist die sonst so schöne und malerische altbulgarische Krönungsstadt Tirnowo als Wanzennest weit und breit verrufen. Überdies verträgt die Wanze auch sehr gut Kälte und kann erstaunlich lange hungern. Verschiedene Versuche haben gezeigt, daß sie viele Monate lang ohne Nahrung auskam, wenn sie auch dabei ganz durchsichtig und so flach wie ein Kartenblatt wurde. Wehe aber dem Sterblichen, auf den solche ausgehungerte Wanzen dann durch eine tückische Fügung des Schicksals losgelassen werden! Glücklicherweise sind die Wanzen ja ausgesprochene Nachttiere und überaus lichtscheu. Tritt man in einen verwanzten Gasthof, so kann man die Plage dadurch mildern, daß man die ganze Nacht über das Licht brennen läßt. Erfahrene Orientreisende hüllen sich dann schlafend in durchschwitzte Pferdedecken, deren Geruch den Wanzen offenbar zuwider ist, denn es ist erwiesene Tatsache, daß auch in Kasernen die Kavalleristen viel weniger unter der Wanzenplage zu leiden haben, als die Vertreter der anderen Waffengattungen. Eine gewisse Vorsicht den Wanzen gegenüber ist nicht nur deshalb am Platze, weil ihr Stich recht schmerzhaft ist, ein brennendes Jucken verursacht, ja in manchen Fällen zur Bildung bösartiger Ekzeme führt, während andere Menschen, namentlich die Zigeuner, sich auffallend wenig empfindlich gegen Wanzenstiche zeigen, sondern auch deshalb, weil die Wanzen gelegentlich schmerzhafte und langwierige Hautkrankheiten übertragen können, was in den Tropen besonders gefährlich ist. So überträgt die unserer Bettwanze nahe verwandte indische Art Cimex rotundus eine furchtbare, Kalaazar genannte Krankheit, die mit einer ungeheuren Vergrößerung der Milz verbunden ist, und in Brasilien gibt es eine große, schwarze, rotgefleckte Art, die ebenfalls als Vermittlerin einer gefährlichen Trypanosomenseuche gilt.
Keineswegs sind alle Wanzen so unappetitliche Tiere wie unsere Bettwanzen. Dieses wenig liebliche Mädchen aus der Fremde hat in seiner Verwandtschaft auch recht farbenschöne Arten, die auf Blüten leben und sich manierlich auf das Saugen von Pflanzensäften beschränken. Nur eins ist allen gemeinsam: der abscheuliche Geruch, den auch unsere Zunge in unliebsamer Weise zu spüren bekommt, wenn wir etwa eine Himbeere zum Munde führen, die eine Wanze sich als Ruheplätzchen auserkoren hatte. Verursacht wird der kennzeichnende Wanzengeruch durch ein an der Luft leicht verdünstendes Öl, das in zwei Drüsen erzeugt wird, die an der Brust des Tieres liegen, ihre Ausführungsgänge aber an der Bauchseite beim letzten Beinpaar haben. Dies gilt wenigstens vom erwachsenen Tier, denn bei den Larven münden die gleichen Drüsen merkwürdigerweise auf der Rückenseite. Es darf wohl als sicher angenommen werden, daß das Aussondern der stinkenden Öltropfen dem Willen des Tieres anheimgestellt ist, daß wir es also hier mit einer Verteidigungswaffe zu tun haben, ähnlich wie sie unter den höheren Tieren das übelberüchtigte Stinktier besitzt. Dem Öl wohnen sogar entschieden giftige Eigenschaften inne, denn ein russischer Zoologe hat festgestellt, daß kleine Insekten bei Berührung mit dem Öl sofort absterben, und er konnte deshalb in Ermangelung anderer Gifte solches Wanzenöl als Abtötungsmittel in seinen Insektengläsern benützen.
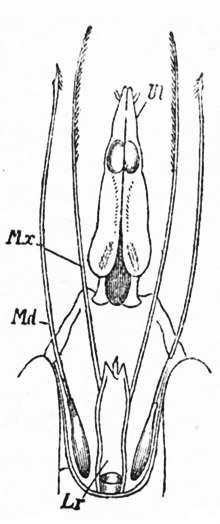
Abb. 2. Mundteile (Schnabel) des Wasserskorpions. Lr Oberlippe, Ul Unterlippe, Md Oberkiefer, Mx Unterkiefer.
Während aber alle anderen Wanzen geflügelt sind und als Kennzeichen dieser Gruppe gerade der Umstand gelten darf, daß die Vorderflügel in ihrer Wurzelhälfte von lederartiger Beschaffenheit sind, ist unsere Bettwanze dadurch ausgezeichnet, daß bei ihr die Flügel völlig verkümmerten, da sie sie ja als Parasit nicht nötig hat, so daß also diese Erscheinung als Anpassung an ihre schmarotzende Lebensweise aufzufassen ist. Auffallend an der Bettwanze ist weiter die sehr flache, plattgedrückte Gestalt ihres breiten Körpers (sie heißt deshalb in Holland Platje = Plättchen), ferner die braunrote Färbung, die zahlreichen rötlichgelben Härchen, die an dem Wurzelende verdickten, ziemlich langen Fühler, die stark vorquellenden Augen und die langen Beine, deren Klauen der Haftläppchen entbehren. Ein Geschlechtsunterschied ist nur insofern vorhanden, als der Hinterleib beim Weibchen breiter und abgerundeter, beim Männchen schmaler und zugespitzter ist. Die Körperlänge der erwachsenen Bettwanze beträgt etwa 6 mm. Haben sich die Tiere vollgesogen, so erscheinen sie bedeutend größer und stattlicher. Die kleinen Wanzen, die man trifft, sind sog. Larven. Für seine blutsaugerische Tätigkeit ist das abscheuliche Geschöpf von der gütigen Natur vortrefflich ausgerüstet, gehört es doch zu den Schnabelkerfen, deren Mundorgane zu stechenden und saugenden Werkzeugen umgebildet sind (Abb. 2). Wir nennen den ganzen Apparat einen Schnabel und sprechen deshalb von Schnabelkerfen. Bei der Bettwanze ist er im Ruhezustand in einer besonderen Kehlfurche nach der Bauchseite zu eingeschlagen (Abb. 3). Die sogenannte Unterlippe bildet eine Rinne, deren Ränder nach oben zusammengebogen und bis auf einen schmalen Spalt einander genähert sind. Zum Verschluß dieses Spaltes dient ein bei allen Insekten vorhandener, vor dem Vorderkiefer gelegener und nicht als Glied angelegter Hautfortsatz, die sog. Oberlippe. Oberlippe und Unterlippe bilden also bei den Wanzen zusammen ein geschlossenes Rohr. Im Innern dieses Rohres eingeschlossen sind nun vier an ihrer Spitze gezähnte oder mit Widerhaken versehene stilettartige Bildungen, die morphologisch dem paarigen Ober- und Unterkiefer entsprechen, und zwar bilden die beiden Unterkieferhälften zusammen wiederum ein engeres Rohr, das eigentliche Saugrohr, während die beiden Oberkieferhälften zum Einstechen durch die Haut dienen und das Außenrohr als ein Futteral für das ganze niederträchtige Werkzeug anzusehen ist. Beim Stechen entfließen den Speicheldrüsen der Wanze kleine Gifttröpfchen, die die Veranlassung zu dem brennenden Juckreiz und in schlimmen Fällen zur Bildung von Geschwüren sind. Auch der Geruch des Tieres scheint gut entwickelt zu sein, denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird es aus ziemlicher Entfernung durch die Ausdünstungen des schlafenden Menschen angelockt, wie z. B. schon öfters beobachtet wurde, daß Wanzen sich von der Decke des Zimmers unmittelbar auf den schlafenden Menschen herabfallen lassen.
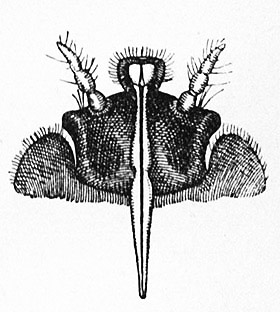
Abb. 3. Kopf und Rüssel der Bettwanze, von unten gesehen.
Leider ist die Vermehrung des garstigen Quälgeistes groß, denn im März, Mai, Juli und September legt jedes Wanzenweibchen etwa je 50 weißliche, perlfarbige, walzenförmige Eierchen in die feinsten Spalten ihres Schlupfwinkels. Schon nach drei Wochen schlüpfen die jungen Wanzen als Larven aus, sind aber in diesem Zustande viel kälteempfindlicher als die alten Wanzen, weshalb die Septemberbrut in der Regel zugrunde geht, falls nicht das betreffende Zimmer geheizt wird. Bis zur Geschlechtsreife bedürfen die Tierchen immerhin eines Zeitraumes von etwa elf Monaten, doch kann von einer eigentlichen Verwandlung kaum die Rede sein, da das Puppenstadium völlig fehlt und die Larven bis auf die geringere Größe und die lichtere Färbung den Alten schon fast völlig gleichen. Sie müssen eine Anzahl Häutungen durchmachen, und bei aufmerksamem Nachsehen findet man die abgestreiften Bälge in ihrem Schlupfwinkel. Ihr Stech- und Saugapparat ist noch schwach entwickelt, weshalb sie sich nur an solchen Stellen betätigen können, wo die Haut dünn ist, und lieber an Kinder und junge Frauen als an erwachsene Männer gehen.
So unangenehm das Geschlecht der Hauswanzen dem gewöhnlichen Sterblichen auch erscheinen mag, so ist es doch in mehr als einer Beziehung von hohem Interesse für den Naturforscher. Zunächst schon deshalb, weil die verhältnismäßig kleine (bis 1913 waren erst 19 Arten bekannt) Familie der Cimicidae eine überaus große und weit zerstreute Verbreitung hat, woraus man entweder auf ein sehr hohes oder auf ein sehr junges geologisches Alter schließen könnte. Sodann, weil sich die allmähliche Entstehung ihrer parasitischen Lebensweise gut verfolgen und auf die Gruppe der nahe verwandten, nicht blutsaugenden, sondern von Pflanzensäften lebenden Anthocoridae zurückführen läßt. So lebt Lycotocoris campestris auf offenem Felde, wird dann mit dem Stroh in die Viehställe verschleppt, gibt hier die vegetabilische Ernährungsweise auf und wird zum Blutsauger, der sowohl Pferde wie Kühe befällt. Eine weitere Verschleppung vom Viehstall ins Schlafzimmer ist sehr wohl denkbar, und die vielen Erzählungen von geflügelten Wanzen dürften demnach auf diese Art zurückzuführen sein. Ebenso paßt Oeciacus hirundinis, die gewöhnlich in den Nestern von Mehl- und Rauchschwalben schmarotzt, sich leicht veränderten Verhältnissen an, denn sie findet sich auch in den Nestern der Sperlinge, Steinkäuze und Mauersegler, ja selbst in denen der Uferschwalben, obschon diese doch weitab von den menschlichen Wohnungen eine völlig andere Lebensweise führen. Nach Reiber sind die Niststätten der Turmschwalben oft förmlich mit Wanzen tapeziert, aber trotzdem sollen die Wand an Wand mit den Vögeln hausenden Turmwächter nie von dem Ungeziefer belästigt werden. Interessant ist, daß die große Mehrzahl der Wanzen, wenn die Schwalben im Herbst gen Süden ziehen, in den Nestern zurückbleibt und hier monatelang der Winterkälte und dem Hunger widersteht, wobei die Tiere allerdings stark abmagern.
Dunkelmännern und blutgierigen Tyrannen pflegen aus dem eigenen Geschlecht die grimmigsten Feinde zu erwachsen. Nicht anders ist es den Wanzen ergangen, denn der unerbittlichste Gegner unserer Bettwanze ist die erheblich größere und kräftigere, schwarzbraune Schreitwanze, ausgezeichnet durch lange Beine, jedoch auf kurzen Füßen, und durch den frei vortretenden, länglichen, hinten abgeschnürten Kopf. Im Gegensatz zur Bettwanze kann sie nicht nur fliegen, sondern sogar zirpen, ist überhaupt viel behender und vermag ihre Beute, zu der in erster Linie die Bettwanze zählt, allenthalben aufzusuchen, indem sie sie springend überfällt und ihr den spitzen Schnabel in den Leib bohrt, wobei offenbar eine giftige Flüssigkeit austritt, da die Opfer sofort sterben. Die gewöhnliche Gangart der Schreitwanzen ist aber trotz der langen Beine langsam und gemessen, gewissermaßen ruck- und stoßweise. Wahrscheinlich ist die Schreitwanze weniger auf den hageren Leib der Bettwanze lüstern, als auf das in den vollgesogenen Tieren aufgespeicherte Blut, denn auch sie selbst ist Blutsauger und sticht bei Gelegenheit gern auch den Herrn der Schöpfung an. Ein ganz uneigennütziger Bundesgenosse im Kampf gegen das Ungeziefer ist sie also nicht, obwohl sie auch hinter den Flöhen sehr her sein soll. Die verbreitetste Art ist bei uns Reduvius personatus, die das Volk als Kotwanze zu bezeichnen pflegt, und zwar deshalb, weil ihre Larven sich mit Vorliebe in den düstersten und staubigsten Schmutzwinkeln aufhalten, hier auf ihrer klebrigen Oberfläche sich ganz in Staub hüllen und dann einem wandernden Staubflöckchen vollkommen gleichen. Manche Naturforscher behaupten sogar, daß sich die Tiere dieser schützenden Maskierung bewußt seien, und ein französischer Gelehrter will beobachtet haben, daß Kotwanzenlarven, wenn sie bei der Häutung mit dem alten Balg auch die schützende Maske abstreifen, diese sich sofort wieder anziehen, falls sich nicht gleich Gelegenheit zum Aufnehmen neuen Schutzmaterials bietet. Allerdings hat der französische Forscher vergessen, uns zu sagen, wie die Larven das wohl anstellen mögen. In unseren Gärten kommen auch sehr hübsch gefärbte Schreitwanzen vor, so z. B. eine schöne blutrote Art, die man häufig in den Blumenbeeten findet.

Abb. 4. Rückenschwimmer.
Andere Vertreter des Wanzengeschlechtes haben sich vollkommen dem Wasserleben angepaßt, denn die munteren, spinnenartigen Tierchen, die wir auf allen Tümpeln auf langgespreizten, beängstigend dünnen Beinen wie Schlittschuhläufer an der Wasseroberfläche hingleiten sehen, sind nichts anderes als solche Wasserwanzen. Man könnte sie in der Tat für Wasserspinnen halten, wenn sie nicht sofort durch die geringe Beinzahl und durch das Vorhandensein des langen Stechrüssels kenntlich wären. Ihre Eierchen legen sie reihenweise an den Wasserpflanzen ab, und aus ihnen schlüpfen unansehnliche blaßgelbe Larven. Alle Wasserwanzen sind außerordentlich ungestüme, heftige und sehr räuberische Geschöpfe, die im Kampf ums Dasein ihren Mann zu stellen wissen. Die bekannteste Art ist der Rückenschwimmer ( Notonecta glauca, Abb. 4), der auch den Namen Wasserbiene führt, weil er recht empfindlich zu stechen vermag. Seinem Namen entsprechend, schwimmt er auf dem Rücken, hat also den Bauch nach oben gerichtet und berührt mit der Hinterleibspitze, an der sich die Atemlöcher befinden, beständig die Wasseroberfläche. Die ausgespreizten Hinterbeine sind zu großen Ruderstangen umgewandelt, die schnappmesserförmigen, innen mit Dornen versehenen Vorderbeine dagegen zu grimmigen Greiforganen, mit denen die unglückliche Fliege, die ein Zufall ins Wasser wehte, ergriffen und in die Tiefe geschleppt wird, wo die Wanze ihr den todbringenden Stich versetzt und sie dann im Herumschwimmen allmählich aussaugt. Da der Rückenschwimmer auch vor Angriffen auf größere Geschöpfe nicht zurückscheut, gilt er mit Recht als ein nicht zu unterschätzender Schädling der Fischbrut. Noch empfindlicher als er sticht der zur gleichen Sippe gehörige Wasserskorpion ( Nepa cinerea), ein unheimlicher Geselle von länglichem Körperbau, der in eine schützende Schlammfarbe gehüllt ist und sich gewöhnlich an einen Stein drückt, so daß die unliebsame Bekanntschaft mit ihm in der Regel in sehr unvermuteter Weise gemacht wird. Im allgemeinen wird freilich nur der Aquarienfreund, der die Tümpel nach Beute absucht, mit diesen Wasserwanzen zusammengeraten und ihnen die schmerzhaften Stiche schon deshalb verzeihen, weil die Tierchen selbst außerordentlich interessante Bewohner des Aquariums sind und viel Stoff zu anregenden Beobachtungen bieten.
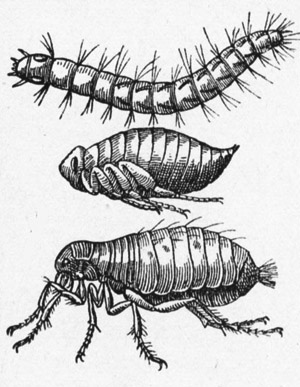
Abb. 5. Menschenfloh. Oben Larve, in der Mitte Puppe, unten erwachsenes Tier.
Ein Gutes haben die Wanzen aber doch: sie peinigen uns wenigstens nur bei Nacht und lassen uns während des Tages in Ruhe. So anständig ist der Floh ( Pulex irritans, Abb. 5) nicht, denn er macht weder in den Tages- noch in den Jahreszeiten einen Unterschied, sondern ist jederzeit mit gleichem Eifer darauf erpicht, süßes Menschenblut zu saugen. Trotzdem erscheint er uns nicht so widerwärtig wie die Wanze. Schon deshalb nicht, weil ihm deren abscheulicher Geruch fehlt und weil sein munteres Wesen, sein großartiges Sprungvermögen uns wider Willen zum Lachen reizt. Der Volkshumor hat gerade diesen Piraten zur Zielscheibe seines Witzes genommen, zumal der Floh als vollendeter Demokrat zwischen Mensch und Mensch keinen Unterschied macht. Er findet sich bei hoch und niedrig, bei reich und arm, im Ballsaal wie in der niedrigsten Hütte, beim Fürsten wie beim Pferdeknecht, und schon Goethe wußte, daß es einen König gab, »der hatt' einen großen Floh«. Natürlich sticht der boshafte kleine Kerl immer dann, wenn man sich's nicht merken lassen darf, von wegen der »Genierlichkeit«, um mit Onkel Bräsig zu reden. Der muntere Turner im braunen Trikot, wie man ihn wohl auch genannt hat, bekundet sogar eine gewisse Ritterlichkeit, denn es ist unleugbar, daß er für das schönere Geschlecht eine ausgesprochene Vorliebe besitzt. Es gibt aber auch Menschen, die von Flöhen fast gar nicht gestochen werden, während sich andere ihrer kaum erwehren können; man spricht da von mehr oder minder »süßem Blut«, aber der Floh macht ja nicht einmal zwischen »blauem« und rotem Blut einen Unterschied, und es ist mir deshalb wahrscheinlicher, daß die größere oder geringere Dicke der Haut und namentlich individuelle Hautausdünstungen anziehend oder abschreckend auf den Floh einwirken. Der stechende Springer ist auch naturwissenschaftlich sehr interessant, denn er stellt einen ganz besonderen Typ im großen Reiche der Insekten dar und ist seiner Abstammung nach von uraltem Adel.
Dies beweist ein von dem 1912 verstorbenen Königsberger Professor Klebs bei Polangen an der deutsch-russischen Grenze gefundenes Stück Bernstein, in dem ein Floh eingeschlossen war. Gewiß ist es ein seltener Zufall, daß ein auf das Leben im Pelze seines Wirtes angewiesener Schmarotzer wie der Floh sich in das noch flüssige Harz vorweltlicher Nadelbäume verirren und guterhalten nach vielen Jahrtausenden uns zugänglich gemacht werden konnte. Dieser uralte Floh zeigt nahe Verwandtschaft mit einer noch heute in Mitteleuropa und besonders in Ostpreußen vorkommenden Flohgattung ( Palaeopsylla), und zu ihrer Verwunderung konnten die Fachgelehrten feststellen, daß ein und derselbe Floh von der Oligozänperiode sich bis heute, also durch mehrere hunderttausend Jahre hindurch, ohne wesentliche Veränderungen zu erhalten vermochte. Ungelöst bleibt freilich die Frage, auf welchem Tier dieser Urfloh gelebt haben mag. Von den Säugetieren der Bernsteinzeit wissen wir ungemein wenig, denn Knochen kommen in den Ablagerungen dieser Periode nicht vor. Daß es aber Säugetiere gab, geht aus dem Vorhandensein von Viehbremsen und Stechfliegen im Bernstein hervor, und noch bestimmtere Beweise liefert das Vorkommen von Säugetierhaaren in den Bernsteineinschlüssen. Nach Eckstein sind diese Haare auf Tiere aus den Gruppen der Schlafmäuse (Bilche) und Eichhörnchen zurückzuführen. Die heute noch in Ostpreußen lebenden Verwandten des Urflohes schmarotzen auf dem Maulwurf und auf der Spitzmaus, also auf Insektenfressern, und es ist demnach nicht unwahrscheinlich, daß auch der Bernsteinfloh ein Insektenfresserparasit war. Professor Dampf vermutet außerdem, daß sein Wirtstier ein Höhlenbewohner gewesen ist, weil er völlig augenlos ist. Ich möchte eher auf ein maulwurfartig lebendes Tier schließen, da ja auch bei unserem heutigen, auffallend großen Maulwurfsfloh die Augen stark verkümmert sind.
Gegenwärtig ist das Flohgeschlecht zu großer Blüte gediehen, denn viele Säugetier- und Vogelarten beherbergen ihre eigene Art von Flöhen. Altbekannt ist der auf vernachlässigten Hunden massenhaft zu findende Hundefloh, der ebenso wie der Katzenfloh gelegentlich auch an den Menschen geht. Sir Walter Rothschild in Tring hat sich das Studium der Floharten zur Aufgabe gemacht und ihrer über 2000 feststellen können. Das erforderte allerdings nicht nur viel Mühe, sondern auch recht erhebliche Kosten, denn die Flöhe seltener Tierarten sind entsprechend schwierig zu erlangen, und es ist bekannt, daß der reiche Sammler z. B. den Floh eines Polarfuchses mit baren 3000 Franken bezahlte, schade, daß man nicht auch für den gewöhnlichen Menschenfloh ähnliche Preise bekommt! Morphologisch kennzeichnet sich der rot- oder pechbraune Menschenfloh durch seinen seitlich stark zusammengedrückten Körperbau, einfache Augen, hinter diesen eingelenkte Fühler, durch das völlige Fehlen der Flügel sowie namentlich dadurch, daß die drei Brustringe beweglich aneinandergefügt, also nicht fest verwachsen sind und je ein paar Luftlöcher aufzuweisen haben. Besonders auffallend an dem Tiere sind die kräftigen, bestachelten Beine mit der stark entwickelten Hüftpartie, die dem Floh seine Sprungkünste ermöglichen, von verwandten Arten unterscheidet sich der Menschenfloh namentlich dadurch, daß er nicht wie diese am Halsring einen starken Kamm mit verbreiterten Borsten trägt, seine Mundteile sind ebenfalls zum Stechen und Saugen eingerichtet, weichen aber in den Einzelheiten doch sehr von denen der Wanzen ab. Das Saugrohr wird gebildet von den gezahnte Leisten darstellenden Oberkiefern im Verein mit der Oberlippe, die an der Unterseite rinnenförmig ausgehöhlt ist und die Ausmündungsöffnungen der Speicheldrüsen enthält; deren Sekret birgt wohl auch einen Giftstoff, und dadurch kommt das lästige Jucken, die Hautrötung und Pustelbildung bei den Flohstichen zustande. Die Unterkiefer sind weite, schützende Platten und bilden zusammen mit der Unterlippe eine Art Scheide um die eigentliche Saugröhre.
Nach erfolgter Paarung legt das Flohweibchen zwölf verhältnismäßig große, dickovale, perlgraue Eierchen in die Ritzen und Spalten des Zimmerbodens oder der Wand, und aus ihnen schlüpfen schon nach sechs Tagen die Flohlarven hervor. Jedes Weibchen setzt nach und nach etwa 800 Eier ab, und es läßt sich leicht ausmalen, wie da die Flöhe über Hand nehmen können, wenn in einem Hause die Reinlichkeit zu wünschen übrig läßt. Die Flohlarve ist ein 3½ mm langes, weißliches Tierchen mit schlankem, borstigem Leibe, der aus 14 Ringen zusammengesetzt ist, weicher Haut, kräftigen Freßzangen, kurzen Fühlern, aber ohne Beine und ohne Augen. Es bewegt sich unter schlangenartigen Windungen im Staube fort und ernährt sich hier von allerlei verwesenden Bestandteilen. Schon nach elf Tagen verwandelt sich die Larve in eine sehr bewegliche, anfangs weiße, später dunkler werdende Puppe, die schon deutlich die Umrisse des künftigen Flohes erkennen läßt. Auch das Puppenstadium dauert nur elf Tage, die ganze Verwandlung daher im Sommer nur vier, im Winter etwa sechs Wochen. Bei den erwachsenen Tieren sind die Männchen nur halb so groß als die eine Länge von 4 mm erreichenden Weibchen, sobald ein Mensch in die Nähe des frisch ausgeschlüpften Flohes kommt, springt dieser ihm an die Waden und ist nun Zeit seines Lebens versorgt, falls ihm nicht ein glücklicher Druck mit dem Fingernagel ein vorzeitiges Ende bereitet. Die Springfähigkeit des Tierchens ist erstaunlich groß, findet ihresgleichen in der Insektenwelt überhaupt nicht und ersetzt ihm vollständig die fehlenden Flügel. Der Floh muß eine ungeheure Muskelkraft besitzen, denn bei abgerichteten Flöhen hat es sich gezeigt, daß sie das 70fache ihres eigenen Gewichtes fortzubewegen vermögen. Solche »Flohzirkusse« (Abb. 6) waren in meiner Jugend auf jedem Jahrmarkt zu sehen, während sie neuerdings mehr und mehr verschwinden. Die Ablichtung der Tierchen erfolgte dadurch, daß man sie längere Zeit zwischen flachen Uhrglasschalen hielt, wo sie sich das springen abgewöhnten, und sie dann mit seinen Drähtchen an die fortzubewegenden Gegenstände spannte.
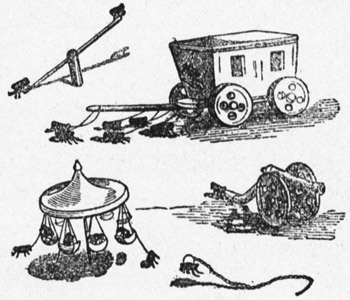
Abb. 6. Bilder aus dem Flohzirkus.
Versiegen dem Floh seine Nahrungsquellen, stirbt etwa der ihn beherbergende Mensch oder wird das betreffende Haus verlassen, so begibt sich das Tier meist in massenhafter Gesellschaft von seinesgleichen auf die Wanderschaft. Er kann übrigens gleich der Wanze lange hungern, sticht aber dann um so empfindlicher, wenn er wieder ein Menschenkind findet. Göldi hat großartige Flohwanderungen aus verlassenen Häusern Brasiliens beobachtet, die in Gestalt einer kleinen, dichten Wolke oder eines Knäuels von hüpfenden schwarzen Punkten durch Gärten und freie Plätze zogen. Eine Begegnung mit einem solchen ausgehungerten Flohheer mag ja naturgeschichtlich recht interessant sein, ist aber in jeder anderen Beziehung gewiß ein höchst unliebsames Erlebnis. Im Sommer 1910 nahm die Flohplage in Paris einen befremdend großen Umfang an, so daß sie förmlich zu einer öffentlichen Kalamität wurde. Es wurde dies wohl mit Recht darauf zurückgeführt, daß die Ratten infolge der vorhergehenden großen Seine-Überschwemmung ihre Wohnplätze wechselten, indem sie aus ihren unterirdischen Schlupfwinkeln vertrieben und zu einer mehr oberflächlichen Ansiedlung veranlaßt wurden. Man kennt ja das Kloakennetz der Großstädte als beliebten Aufenthaltsort der Ratten, und namentlich das von Paris ist als solches während der Belagerung von 1870/71 weltberühmt geworden. Diese Rattenflöhe, die durch ihre Kleinheit auffallen, können aber geradezu gefährlich werden, weil sie die Pest von den Ratten auf die Menschen zu übertragen vermögen, indem sie bei ihren Stichen die bei den Ratten aufgenommenen Pestbazillen in das menschliche Blut verpflanzen. Die Wissenschaft ist sich ja heute darüber einig, daß die Pestansteckung nicht unmittelbar von den Ratten ausgeht, sondern noch eines Zwischenträgers bedarf. Auch der auf dem Bobak, einem murmeltierartigen Geschöpf Sibiriens, schmarotzende Floh steht in dem schlimmen Verdacht, die Pest weiter zu verbreiten. In den Mittelmeerländern wird der dortige Hundefloh wegen seiner Vermittlung einer tödlichen Milzkrankheit gefürchtet. Swellengrebel fand verschiedene Arten der hygienisch so gefährlichen Rattenflöhe in den Docks von Amsterdam, einmal 105 Stück auf einer einzigen Ratte. Die Durchschnittszahl ergab aber selbst im Hochsommer nur drei Flöhe auf jeder Ratte. Fütterungsversuche zeigten, daß die Flöhe sehr gern auch Menschenblut annahmen und dabei trefflich gediehen. Von 49 dieser Flöhe, die auf die menschliche Haut gesetzt wurden, stachen 43 sofort, ohne daß sie etwa ausgehungert waren. Ihre Lebensdauer betrug bis zu 41 Tagen, und sie vermochten bei Zimmertemperatur sechs Tage ohne Schaden zu hungern, in feuchter Luft bedeutend länger (bis 21 Tage), bei Trockenheit und Hitze dagegen nur zwei Tage. Durch Schwefeln sowie durch Verwendung dampfförmiger Formaldehyds konnten die Flöhe leicht getötet werden, ebenso durch reichliche Benetzung des Zimmerstaubs mit Seifenwasser. Vorbeugungsmittel, wie Essigsäure, Jodoformpulver u. dgl. schützten die menschliche Haut nur sehr kurze Zeit; am wirksamsten war noch Nelkenöl.
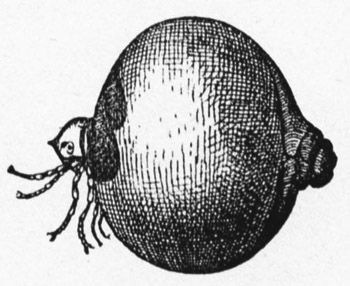
Abb. 7. Vollgesogenes reifes Weibchen des Sandflohs.
Viel unangenehmer als unser im großen und ganzen ziemlich harmloser Menschenfloh ist der berüchtigte Sandfloh ( Sarcopsylla penetrans) der Tropenländer. Ursprünglich war er in Südamerika heimisch, ist aber von da 1873 nach Westafrika Doch erwähnt schon der Basler Wundarzt Samuel Braun in seinen »Schiffahrten« 1624 gefährliche »Würmlein« aus Westafrika, die von manchen als die Larven des Landflohs gedeutet werden. Henning nimmt deshalb an, daß die Sandflohplage schon Ende des 16. Jahrhunderts in Afrika auftrat, aber auf das Kongogebiet beschränkt blieb und nach etwa 80 Jahren wieder erlosch. verschleppt worden, neuerdings auch nach China, und vereinzelt ist er auch schon in Indien und Persien aufgetaucht. Er ist um die Hälfte kleiner als unser Floh, von gelblicher Körperfarbe und durch den auffallend eckigen Kopf ausgezeichnet. Die Männchen leben auch nicht anders als unsere Flöhe, aber die befruchteten Weibchen setzen ihre Eier nicht im Freien ab, sondern graben sich zu diesem Zwecke in die Haut des Menschen ein, und zwar mit besonderer Vorliebe in die der Zehen. Hier bohren sie sich soweit ein, daß nur die Spitze des Hinterleibes hervorragt, aus der nach und nach die Eier heraustreten und zu Boden fallen. Das Weibchen selbst schwillt während dieser Zeit zur Größe einer kleinen Erbse an (Abb. 7) und verursacht einen starken Juckreiz, der sich durch Kratzen noch verschlimmert, dann Entzündungen und Eiterungen hervorruft, nicht selten sogar den Brand, der dann zur Amputation der befallenen Zehe oder gar des ganzen Fußes nötigt. Selbst Todesfälle durch Sandflöhe sind festgestellt worden. Das einzige Gegenmittel besteht in dem Herausheben des vollgesogenen Weibchens, das aber äußerst vorsichtig geschehen muß, denn wenn das Tier zerreißt, wird der Zustand der Wunde nur verschlimmert. Besonders unangenehm ist, daß da, wo sich einmal ein Sandflohweibchen eingenistet hat, bald auch andere sich einstellen, so daß vernachlässigte Füße, wie unsere Abbildungen 8 10 zeigen, von einer Anzahl der gefährlichen Schmarotzer bewohnt werden können. Die sorgfältige tägliche Säuberung der Füße gehört deshalb in den Tropenländern zu den unerläßlichsten hygienischen Maßregeln.
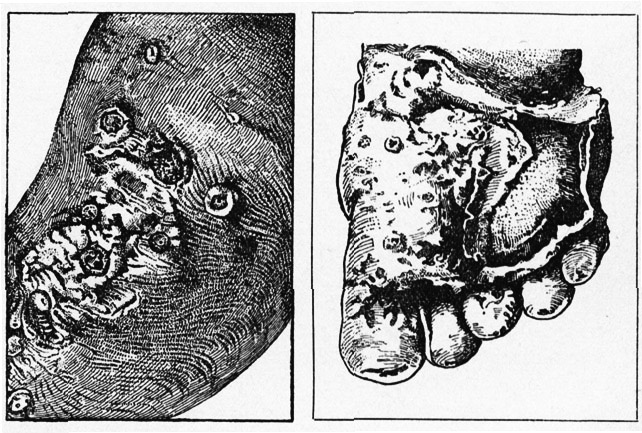
|
|
|
Abb. 8. Fußsohle mit etwa einem Dutzend eingenisteter Sandflöhe. |
Abb. 9. Fußsohle eines Negers, die durch Sandflöhe zerstört ist. |
Vor den erstaunten Augen eines deutschen Reisenden aus bester Familie tun sich zum erstenmal all die bunten Wunder des Orients in ihrer schier verwirrenden Fülle auf; er kann sich gar nicht satt sehen. Aber er ist ein selbständiger Mensch, der sich nicht von Fremdenführern zu den sogenannten Sehenswürdigkeiten schleppen läßt, sondern der tiefer hinabsteigen möchte in diese fremde Märchenwelt, der nähere Einblicke tun möchte auch in das Wesen des Volkes. Er sucht deshalb in einem verschwiegenen Winkel der Eingeborenenstadt ein arabisches Kaffeehaus auf und kommt sich sehr stolz und mutig vor, wenn er hier als einziger Europäer zwischen beturbanten Türken und zähnefletschenden Arabern Platz nimmt.
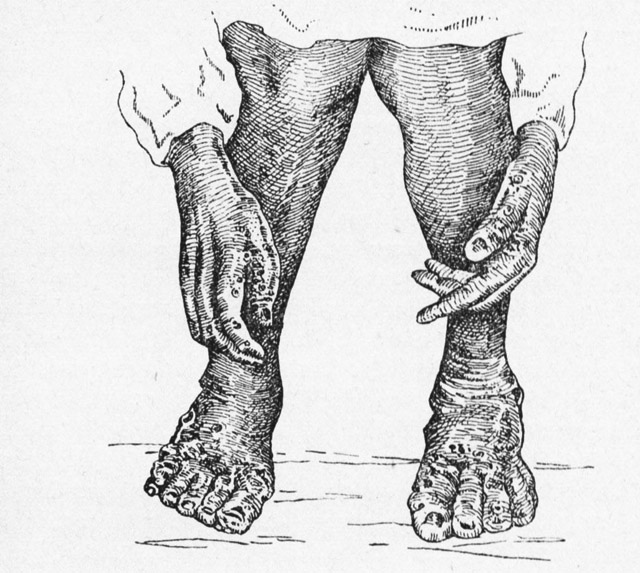
Abb. 10. Hände und Füße eines von Sandflöhen stark heimgesuchten Negers.
Der Mokka, den ihm der Kaffeedschi in der üblichen Weise über dem Kohlenbecken bereitet, ist köstlich, und selbst die ungewohnte Wasserpfeife schmeckt gar nicht übel, wenn auch alle Versuche zur Anknüpfung eines Gespräches von den schweigsamen Orientalen nur mit höflichem Lächeln beantwortet werden. Deshalb nur halb befriedigt, verläßt schließlich der Fremdling die gastliche Stätte und geht neuen Abenteuern nach. Nach einigen Tagen aber verspürt er am Körper ein eigentümliches, nie gekanntes, brennendes Jucken, das wie ein nagendes Fressen an der eigenen Haut anmutet und zu fortwährendem Kratzen reizt. Angenehm ist das nicht, zumal wenn man sich gerade in guter Gesellschaft befindet. Der Reisende denkt an einen Hautausschlag, wie sie ja in warmen Ländern so häufig sind, aber er wird bald eines Besseren oder vielmehr Schlechteren belehrt. Wie er einmal auf dem flachen Dach seines Gasthofes sitzt und die Abendkühle genießt und träumerisch zu den scharfen Umrissen der Palmenwedel hinüberblickt, fällt sein Auge zufällig auch auf die eigene Gewandung, und da sieht er zu seinem Entsetzen ein munteres Läuslein aus seiner Weste herausspazieren, das wohl gleichfalls die Abendkühle genießen will. Der einen folgen noch mehrere. Tief beschämt stürzt unser bedauernswerter Freund in sein Zimmer, entkleidet sich, betrachtet seine Wäsche von innen und findet hier ein reges Tierleben. Kein Zweifel mehr, er ist verlaust und schämt sich darob nicht wenig. Da bleibt nichts übrig, als schleunigst ein heißes Bad zu nehmen, den Körper mit grauer Salbe einzureiben, Kleider und Wäsche aber zu verbrennen. Immer hilft's auch nicht, aber doch in den meisten Fällen. Allzusehr zu schämen brauchte sich der verlauste Fremdling übrigens nicht, denn auch dem saubersten und reinlichsten Menschen kann es im Orient zustoßen, daß sich auf seinem Körper eine muntere Läusekolonie entwickelt. Die Übertragungsgefahr ist eben zu groß, und gerade in dem echt orientalischen Kaffeehaus hat der Fremdling die Stammutter seiner Läusekolonie aufgelesen. Jetzt erinnert er sich auch, daß einmal einer der Araber etwas an seinem schneeweißen Burnus behutsam mit den Fingern ergriff und fein säuberlich zur Erde setzte. Das war gewiß eine Laus, denn strenggläubige Mohammedaner töten ja ein solches Tier nicht, sondern nehmen es nur von sich weg. Die Übertragungsgefahr ist in solchen Fällen um so größer, als gerade die Kleiderlaus durchaus nicht das träge, schwerbewegliche Geschöpf ist, für das man sie früher allgemein hielt. Sie begibt sich z. B. ganz gerne auf die Wanderschaft, und neuere Beobachtungen haben gezeigt, daß sie bei günstiger Temperatur 10 mm in der Minute zurücklegen kann, also 6 m in der Stunde und somit täglich 24 m, wenn sie nur vier Stunden lang marschiert. Da aber eine abgesetzte Laus ohne Schaden drei Tage zu hungern vermag, so kann sie in diesem Zeitraum 72 m durchmessen, also in einem viel größeren Raum sich ausbreiten, als es der beschränkte eines orientalischen Kaffeehauses zu sein pflegt. Selbst durch Sand- oder Erdschichten von 30 mm Höhe vermag sie sich mit Leichtigkeit hindurchzuarbeiten.
Während man den Floh mit einem gewissen Humor hinnimmt, spricht man nicht gerne von der Laus, und es galt in unserem sauberen Deutschland bisher gewissermaßen als Schande, am Körper Läuse zu beherbergen, was auch gar nicht mehr häufig vorkam. Der Krieg machte die Laus gewissermaßen salonfähig, denn sie hat im Schützengraben auch die höchsten Offiziere nicht verschont, vielmehr hat der langwierige Schützengrabenkampf ein höchst unerwünschtes, aber allgemeines und notwendiges Interesse für die Lausefamilie hervorgerufen. Schon 1870/71 haben unsere tapferen Krieger in Frankreich unsäglich unter der Läuseplage gelitten, und ich habe manchen Offizier gesprochen, der diese als das Schrecklichste aus dem ganzen Feldzuge bezeichnete. Unendlich viel schlimmer war es jedoch, als jetzt unsere siegreichen Heere in Rußland einrückten und nun die Läuseplage im größten Umfang kennenlernten. Der derbe Soldatenhumor hat sich ja auch mit dieser echt russischen Erscheinung abzufinden versucht, wie die vielen Inschriften in den Unterständen und so mancher humoristische Vers beweist.
Doch hat die Sache auch eine sehr ernste Seite. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der durch den Läusestich hervorgerufene, höchst lästige Juckreiz die Nachtruhe des Soldaten stark beeinträchtigt, und wenn das so Wochen und Monate lang fortgeht, so muß entschieden auch die Leistungsfähigkeit der Truppen darunter leiden. Noch schlimmer aber ist es, daß es heutzutage keinem Zweifel mehr unterliegen kann, daß der schreckliche Flecktyphus, der in dem letzten Balkankriege so verheerend aufgetreten ist und auch im Weltkriege, namentlich in Serbien, wieder zahlreiche Opfer unter den Truppen gefordert hat, durch den Stich der Kleiderlaus übertragen und weiterverbreitet wird. Die deutsche Heeresleitung ist deshalb mit den schärfsten Maßregeln gegen die gefährliche Läuseplage vorgegangen und hat sich's viele Millionen kosten lassen, des ekelhaften Ungeziefers Herr zu werden. Überall wurden hinter der Front großartige Entlausungsanstalten errichtet, die sogen. Lausoleums, und niemand darf ohne Entlausungsschein ins saubere Vaterland zurückkehren. Als dieser planmäßige und großzügige Kampf gegen die Lausegesellschaft aufgenommen wurde, war man sich natürlich bewußt, daß er nur auf der Grundlage einer genauen Kenntnis der Biologie der Laus erfolgreich geführt werden könne. Aber als sich nun die Militärbehörden an die Fachgelehrten wandten, stellte es sich zur allgemeinen Überraschung heraus, daß wir von der Naturgeschichte der Laus eigentlich herzlich wenig wußten, und ehe neue Kenntnisse gewonnen wurden, ist leider mancher braune Lappen unnütz für zwecklose Maßregeln verschleudert worden. Unsere Naturforscher haben eben von jeher mit der dem Deutschen eigenen Vorliebe für alles Fremde viel mehr die Tierwelt der Tropen oder der Polarländer erforscht, gelehrte Bücher über das Nervensystem irgendeines ausländischen Wurmes geschrieben oder harmlose Tierchen aus den größten Tiefen des Weltmeeres heraufgeholt, als sich um die einheimische Fauna gekümmert. In den älteren Lehrbüchern findet man über die Biologie der Läuse eigentlich immer nur dieselben, wenig besagenden Sätze, die ein Verfasser dem andern nachgeschrieben hat, und, wie selbst Escherich zugibt, war ein Weltkrieg notwendig, um die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Zoologie auf ein so lohnendes und praktisch wertvolles Thema zu lenken; überhaupt ist eine der ersten Kulturforderungen, die Erfüllung heischt, ein großzügiges, mit allen Hilfsmitteln der Neuzeit ausgestattetes Institut für angewandte Entomologie. Nun freilich, wo Not an Mann war, stürzten sich alle Zoologen und Laboratorien mit wahrhaft begeistertem Eifer auf die Erforschung der Läusegesellschaft, und an Material dazu fehlte es ja wirklich nicht. Bis September 1915 waren bereits nicht weniger als 200 mehr oder minder wertvolle Arbeiten über die Läuse erschienen, die biologisch viel neues brachten und manche verborgenen Gewohnheiten der bisher von der Wissenschaft so arg vernachlässigten Tierchen schonungslos ans Tageslicht zerrten. Sowohl im stillen Institut als auch draußen in der lärmenden Zone des Krieges arbeiteten Zoologen, Hygieniker und Mediziner mit nie gesehenem Eifer daran, den Schleier, von dem bisher das Leben der Läuse umhüllt war, zu lüften. Hätte man vor dem Kriege das gewußt, was man heute über die Läuse weiß, es wären viel Geld, manche Unannehmlichkeiten und unseren braven Feldgrauen endlose Qualen erspart worden. Besonders erfolgreich waren die Untersuchungen des Jenenser Professors Haase, der im russischen Gefangenenlager Hammerstein überreiche Gelegenheit fand, die Laus nach allen Richtungen hin zu studieren; er saß ja sozusagen mitten unter den Läusen und hatte Tausende und aber Tausende der niedlichen Tierchen zu seiner Verfügung.

Abb. 11. Filzlaus. (Weibchen rechts, Männchen links.)
Wie bei den Flöhen, gibt es auch bei den Läusen eine ganze Reihe verschiedener Arten, die ihren jeweiligen Wirtstieren angepaßt sind, ja die Aufteilung in verschiedene Formen geht bei der Laus sogar noch weiter, indem auch die verschiedenen Menschenrassen wieder von ganz verschiedenen Läuseformen heimgesucht werden, die sich im Bau der Gliedmaßen und der Mundwerkzeuge sowie in der Färbung voneinander nicht unwesentlich entscheiden. Kein Geringerer als Darwin hat hieran die Vermutung geknüpft, daß man aus dem Vorhandensein und aus der Art solcher Außenparasiten Schlüsse ziehen könne auf die mehr oder minder engen verwandtschaftlichen Beziehungen ihrer Träger. Die Läuse könnten uns danach also Aufschluß erteilen über den verwandtschaftlichen Grad von Affen, Menschenaffen und den verschiedenen Menschenrassen. In der Tat beherbergen weder die Halbaffen noch die niedrig stehenden neuweltlichen Affen echte blutsaugende Läuse, sondern solche finden sich mit der Gattung Pedicenus erst bei den höherstehenden Affen der alten Welt, obwohl deren Wohnplätze räumlich oft sehr isoliert und weit voneinander getrennt sind. Die Menschenaffen dagegen beherbergen nicht die Gattung Pedicenus, sondern die Gattung Pediculus, also dieselbe, die auch uns Menschenkinder so quält. Kopf- und Kleiderläuse des Menschen, die hier in Betracht kommen, sind nun aber je nach der Menschenrasse weiteren Abänderungen unterworfen, die zu untersuchen eine sehr lohnende und wissenschaftlich wertvolle Aufgabe wäre. So ist z. B. die Kopflaus des Europäers schmutziggrau, die des Japaners gelb und die des Negers fast schwarz. Man könnte also dieses saugende Ungeziefer fast für den Gradmesser der Blutsverwandtschaft ansehen.

Abb. 12. Kopflaus. (Links Haar mit Eiern.)
Es kommt auch vor, daß ein und dieselbe Tierform mehrere Läusearten beherbergt, und leider macht der Mensch auch in dieser Beziehung keine Ausnahme, da er sogar drei Läusearten Unterkunft und Nahrung gewähren muß, von denen eine, und zwar gerade die ekelhafteste, die Filzlaus, merkwürdigerweise nur bei der kaukasischen Rasse vorkommt, also, zu unserer Schande sei es gesagt, bei dem am höchsten entwickelten Zweige des Menschengeschlechtes. Diese Filzlaus ( Phthirius pubis, Abb. 11) ist von den beiden anderen Formen auf den ersten Blick durch ihre Gestalt zu unterscheiden, denn sie ist fast ebenso breit wie lang, überhaupt sehr plump gebaut, aber mit mächtig entwickelten Hakenfüßen ausgerüstet. Mit ausgespreizten Beinen liegt sie dem Menschenkörper platt auf und gräbt sich oft ziemlich tief in die Haut ein, so daß sie nicht ohne weiteres sofort zu entfernen ist, während man andere Läuse bequem mit den Fingern abheben kann. Ihr Körper ist farblos, so daß das dunkle Eingeweide durchschimmert. Der ausschließliche Aufenthalt der Filzlaus sind die behaarten Teile der Schamgegend, manchmal auch die Haare in den Achselhöhlen, selten wandert sie auch zu den Haaren im Bart oder den Augenbrauen aus und hinterläßt dann auf der Haut eigentümliche Flecke, die von dem Franzosen tachesbleues genannt und wahrscheinlich durch die Entleerung der Speicheldrüse des Tieres auf die menschliche Haut hervorgerufen werden. Einreiben der betreffenden Körperteile mit Petroleum oder Terpentinöl gilt als ein gutes Gegenmittel gegen diese unappetitlichen Läuse. Ausschließlich im Kopfhaar, namentlich vernachlässigter Kinder, schmarotzt die Kopflaus ( Pediculus capitis, Abb. 12), verhältnismäßig die harmloseste der drei Formen. Sie ist von graugelber Farbe und plumpem Körperbau. Ihr Kopf hat keine halsartige Verengung aufzuweisen, die Fühler sind kurz und dick, der Mittelleib hat einen fast viereckigen Umriß. Namentlich in südlichen Ländern ist diese Laus außerordentlich verbreitet, und in den italienischen Städten sieht man überall auf offener Straße Frauen und Mädchen sitzen, die sich gegenseitig die Läuse aus ihrem pechschwarzen Haar heraussuchen. Nur bei starker Vernachlässigung kann es zur Bildung von Grind und Geschwüren kommen. Reinlichkeit, Kurzschneiden des Kopfhaares, fleißige Handhabung von Kamm und Bürste, Waschen mit Salz- und Seifenwasser sind gute Vorbeugungsmittel. Die gefährlichste Lauseart ist die Kleiderlaus ( Pediculus vestimenti, Abb. 13), die von brauner Farbe, schlanker, länger, feingegliederter und behender ist wie die Kopflaus. Der Kopf ist mit einer halsartigen Verengung versehen, die Fühler schlank. Die Kleiderlaus lebt an den feinen Körperhaaren des menschlichen Leibes und tritt namentlich dann auf, wenn aus irgendwelchen Gründen die Wäsche längere Zeit nicht gewechselt werden konnte. Es gibt übrigens Naturforscher, die Kopf- und Kleiderlaus nur als Abarten oder Unterformen ein und derselben Spezies gelten lassen wollen.
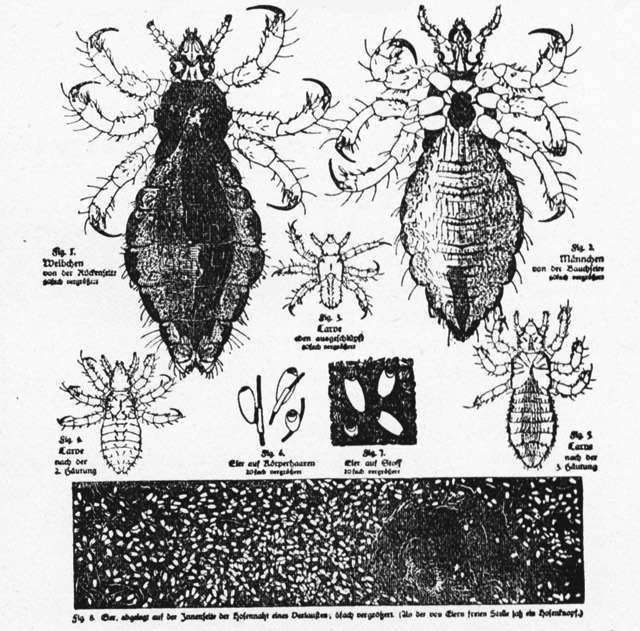
Abb. 13. Kleiderlaustafel der »Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie«.
Die Filzlaus wird 1¾, die Kopflaus 2, die Kleiderlaus 3 mm lang, und bei allen sind die Weibchen wesentlich größer als die Männchen. Aus alten Zeiten wird vielerlei Fabelhaftes über die sogenannte Läusesucht ( Phthiriasis) berichtet, der unter anderem Sulla und noch König Philipp II. zum Opfer gefallen sein sollen. Man hat den Erreger dieser Krankheit in einer besonderen, heute ausgestorbenen Läuseart gesucht, trifft aber wohl das Richtigere, wenn man sie einfach für eine Hautkrankheit erklärt, in deren Geschwüren sich Fliegenmaden oder anderes Ungeziefer eingenistet hatten, die man in naiver Unkenntnis für Läuse hielt. Alle Menschenläuse entbehren der Flügel, halten sich zeitlebens auf ihrem Wirt auf, sind also stationäre Parasiten und saugen lediglich den warmen Lebenssaft ihres unfreiwilligen Gastgebers. Die Füße sind zu Klammerorganen ausgestaltet, mit deren Hilfe sich die Läuse sehr fest halten und die gewagtesten Kletterpartien unternehmen können.
»Du hast ganz recht, wir halten aus,«
So sprach zum Floh die kleine Laus,
Mit zugekniffnem Auge.
»Ich sauge!
Ich sauge mir ein Bäuchlein an,
Daß ich mich kaum bewegen kann;
Na, warte, Dicker, warte,
Dir wird noch dünn die Schwarte.«
Die Mundteile sind zum Saugen eingerichtet, werden nur beim Gebrauch sichtbar und bestehen aus einer kurzen, röhrenförmigen Scheide, mit einem Kranz hakenförmiger Borsten an der Mündung, die sich ins Fleisch einbohren und so den brennenden Juckreiz erzeugen; dann aus zwei in dieser Scheide verborgenen Halbröhren und vier weit vorstreckbaren Stechborsten. Durch diese saugenden Mundwerkzeuge stehen diese Läuse in scharfem Gegensatz zu den nahe verwandten haar- oder federfressenden Mallophagen, die beißende Mundteile besitzen. So unangenehm der Stech- und Saugakt der Läuse für den Betroffenen auch sein mag, so anziehend und interessant ist er doch für den beobachtenden Naturforscher. Oft dauert das Saugen stundenlang, und der blutdürstige Schmarotzer scheint dabei förmlich in eine Art Rausch zu verfallen, was ihn unempfindlich gegen äußere Einflüsse macht. Man kann saugenden Läusen z. B. Beine oder Fühler abschneiden, ohne daß sie sich viel darum kümmern.
Die Beziehungen zwischen Mensch und Laus sind uralt. Gehören Läuse doch schon zu den Landplagen, die der Herr über Ägypten verhängte. »Aaron schlug mit seinem Stab in den Staub, und es wurden aus diesem Läuse an den Menschen und dem Vieh. Aller Staub des Landes wandelte sich in sie.« Nun, die geringste der ägyptischen Plagen ist das sicherlich nicht gewesen. Daß man in Ägypten im 2. vorchristlichen Jahrtausend sich schon einsalbte und andere Mittel gebrauchte, um sich und sein Heim vor dem Läuseungeziefer zu schützen, das bezeugen auch Papyrus-Handschriften, die aus jener Zeit auf uns gekommen sind. Auch Herodot erwähnt die Läuseplage öfter und erzählt, wie sich die Libyer dagegen zu schützen suchten. Aus Demosthenes geht hervor, daß sogar die berühmte Aspasia, die Geliebte des genialen Perikles, weidlich von Läusen geplagt wurde, und daß sie deshalb den Beinamen Phtheiropyle, das ist »Lauserin«, erhielt. Möglicherweise ist dieser Beinamen der Aspasia auch nur von boshaften attischen Possenschreibern angeheftet worden, ohne daß ihm eine bestimmte Tatsache zugrunde lag, die nach allem, was wir sonst von dieser geistvollen Frau wissen, doch schwer glaublich erscheint. Plato kannte die Läuse gut und vergleicht einmal die Kunst des Läusefangens mit der Kunst der Strategie. Selbst der alte Homer wird schon mit den Läusen in Verbindung gebracht, denn die Sage erzählt, daß, als der Dichter der Iliade bei seiner Durchquerung Griechenlands Fischersleute antraf, die ohne Beute landeten, sie ihm das Rätsel aufgaben: was wir nicht fingen, ist bei uns; nicht bei uns ist, was wir fingen. Selbst ein Geist wie Homer löste dieses Rätsel nicht, denn er war zu erhaben für derlei prosaische Dinge. Auch am Hofe des Sonnenkönigs, Ludwigs XIV., wo man sich übermäßig schminkte und puderte, aber selten wusch und noch seltener badete, spielten die Läuse eine große Rolle, und man suchte ihnen durch starke Wohlgerüche den Aufenthalt auf dem menschlichen Körper zu verleiden. Merkwürdigerweise werden Naturvölker, wie manche Negerstämme, fast gar nicht von diesem Ungeziefer geplagt, wie es überhaupt grundfalsch wäre, wenn man solche wilden Völker etwa für besonders unreinlich halten wollte. In dieser Beziehung laufen ihnen jedenfalls die unteren Klassen des russischen Volkes den Rang ab, und so kann es uns nicht wundernehmen, wenn sich die Laus förmlich zum slawischen Nationaltier entwickelt hat. Vielleicht trägt auch der Umstand dazu bei, daß man in dem rauhen russischen Klima so lange Pelze tragen muß. Die Russen bringen es übrigens fertig, ihrer Bevölkerung mit Läusen noch eine humoristische Seite abzugewinnen. Sie erfanden das Läusespiel. Es besteht darin, daß zwei oder mehrere Spieler sich zusammen an einen Tisch setzen und auf diesem einen Kreis zeichnen; jeder von ihnen setzt in den Mittelpunkt dieses Kreises eine Laus, die er vom eigenen Körper genommen hat, und wessen Tier nun zuerst den Rand des Kreises erreicht, der hat gewonnen. Überhaupt scheint, wie Dr. Ernst Schultze unlängst mitteilte, der Russe der unteren Kreise sich mit seinen Läusen ganz wohl zu fühlen, denn seine Sprache besitzt für diese Schmarotzer mindestens ebensoviele Ausdrücke, wie die arabische für das Pferd. Der Erwachsene bezeichnet die Laus mit Vorliebe als »ägyptisches Hammelchen«, der Schuljunge nennt sie »Kühe«, die Kalmücken gehen mit dem Ungeziefer äußerst zart um und töten es niemals. Hierbei spielen wohl auch religiöse Anschauungen eine Rolle, ähnlich wie wir es oben im arabischen Kaffeehaus sahen und wie es auch beim Buddhismus der Fall ist, denn weil Buddha keinem lebenden Geschöpfe ein Leid antun mochte, hat man seine Lehren nach dieser Richtung hin teilweise arg übertrieben, und es wird dadurch z. B. in Indien die Bekämpfung der Pest sehr erschwert. Besonders arg liegen die Verhältnisse in manchen russischen Klöstern. Als sich der Theologe Palmer beim Besuch der Mönche des heiligen Sergius über das Vorhandensein von Ungeziefer in den Zellen beklagte, wurde ihm die Antwort erteilt, diese Geschöpfe seien in einem Kloster sehr nützlich, weil sie Werkzeuge der Vorsehung zur Geduldsübung und zur Ertötung des Fleisches bildeten. Die häufige Berührung mit dem verlausten russischen Militär hat nun auch unsere Feldgrauen mit der Läuseplage bekannt gemacht, aber es ist ihr sofort mit deutscher Gründlichkeit zu Leibe gegangen worden. Es würde zu weit führen, eine Entlausungsstation in allen ihren Einzelheiten zu beschreiben, aber sie wirkt fast wie die bekannten Jungbrunnen: auf der einen Seite tritt der Mensch verlaust und mißmutig hinein, zur rückwärtigen Tür verläßt er sie fröhlich und ungezieferfrei, und auch all sein Hab und Gut ist gründlich desinfiziert. Mit Recht konnten deshalb unsere Krieger die Eingangspforte des »Lausoleums« mit der Inschrift schmücken:
»Tritt ein, Soldat, in dieses Haus!
Auflebt der Mensch, abstirbt die Laus!«
Neuerdings werden auch die Pferde, namentlich die erbeuteten Kosakenpferde, die stets ganze Scharen von Läusen beherbergen, systematisch entlaust und lassen sich das mit ersichtlichem Wohlbehagen gern gefallen.
Die Sitte des Rasierens verdanken mir wahrscheinlich auch der Läuseplage. Man wollte die Haare, an denen die Läuse ihre Eier absetzen, nach Möglichkeit vermindern. Der Volksmund behauptet, daß eine Laus innerhalb 24 Stunden Großmutter wird. Nun, ganz so schlimm ist es nicht, denn sie gebraucht immerhin 6 7 Wochen, um Großmutterfreuden zu erleben; aber unheimlich genug bleibt ihre Vermehrungsfähigkeit doch, namentlich, wenn sie durch günstige Temperaturverhältnisse noch vergrößert und beschleunigt wird. Eine Metamorphose machen die Läuse nicht durch, denn die ausschlüpfenden Jungläuse gleichen bereits fast ganz ihren Erzeugern und haben nur einige Häutungen durchzumachen, um selbst geschlechtsreif zu werden. Die Fortpflanzung geschieht durch millimetergroße Eierchen (Abb. 14), die sogenannten Nisse, die an den Körperhaaren des Menschen angeklebt werden und sich durch ihre birnen- oder tautropfenartige Gestalt auszeichnen; oben sind sie mit einem zierlichen Deckelchen versehen, und wenn das Ei nach 5 8 Tagen reif geworden ist, springt dieses Deckelchen auf, und das junge Läuslein spaziert vergnüglich in die Welt hinaus, um alsbald mit dem lohnenden Geschäft des Blutsaugens zu beginnen. Die weibliche Kopflaus legt etwa 50 Eier, die Kleiderlaus gegen 80, die Filzlaus glücklicherweise nur etwa ein Dutzend. Die Kleiderlaus setzt ihre Brut mit Vorliebe auch in den Falten der Wäsche und verschmutzter Kleidungsstücke ab. Seidene Unterwäsche gewährt einen gewissen Schutz, aber durchaus keinen unbedingten, denn wenn sie nichts anderes findet, begnügt sich die Laus schließlich auch mit Seidenwäsche. Welch greulichen Umfang die Läusebevölkerung des menschlichen Körpers schließlich annehmen kann, geht daraus hervor, daß man bei der Reinigung eines einzigen gefangenen Russen nicht weniger als 3800 Läuse ablesen konnte.
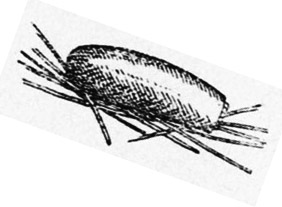
Abb. 14. Ei der Kleiderlaus an Fasern der Wäsche befestigt.
Leider sind die Läuse ein überaus zähes Ungeziefer und entwickeln eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegen Unbilden mannigfacher Art. Ihr Hautpanzer ist so fest, daß sie den Druck zwischen zwei Glasplatten von weit mehr als 1000 Gramm Gewicht noch gut vertragen, falls sie nicht gerade vollgesogen sind. Auch gegen die Einwirkungen von Nässe und Kälte sind sie wenig empfindlich und sterben selbst bei einer Temperatur von -12 Grad noch nicht ab. Viel schlechter wird trockene Hitze von ihnen ausgehalten, denn eine Temperatur von 50 Grad tötet die Tiere nach ¾ Stunden, noch höhere Hitzegrade auch die Nisse. Auf diesem Umstand beruht ja auch die Mehrzahl der heutigen Entlausungsverfahren, indem trockene Luftströme von etwa 100 Grad zur Anwendung kommen. Dagegen tötet Formal selbst nach 24 Stunden die Nisse noch nicht ab, und heiße Formalindämpfe sowie 3 5prozentige Kresolseifenlösung müssen wenigstens eine Stunde einwirken, um ein Ergebnis zu erzielen. Unter einer Sand- oder Erdschicht von 30 cm vermögen sich die Tiere vier Tage lang lebend zu erhalten. Aus alledem erhellt zur Genüge, daß recht gründlich vorgegangen werden muß, wenn man die Läuse wirklich los werden will. Ferner wissen wir heute, daß die Wohnorte der Kleiderlaus durchaus nicht so beschränkt sind, wie man früher wohl allgemein annahm, denn sie findet sich nicht nur in der Wäsche und in sonstigen Bekleidungsstücken, sondern auch im Riemenzeug der Soldaten, im Lagerstroh, selbst in den Brustbeuteln, am Papiergeld und an auf dem Körper getragenen Amuletten, kurz überall, wo sie sich mit ihren hakigen Beinen noch festzuklammern vermögen. Ebenso sind oft alte Möbel, Ritzen in verschalten Wänden oder der Erdboden da, wo Verlauste gelagert haben, mit dem Ungeziefer angefüllt. Zu ihrer Ernährung bedarf die Laus unbedingt warmes, strömendes Blut. Die auf dem Menschen schmarotzenden Läuse nehmen auch nur mit sichtlichem Widerstreben das Blut anderer Tiere, etwa das von Meerschweinchen oder Kaninchen, an. Die Verdauungstätigkeit ist erstaunlich rasch, denn schon nach zwei Minuten tritt das eingesogene Blut wieder als Kot am After aus. Hungrige Läuse suchen das Licht auf, gesättigte meiden es. Hase neigt der Anschauung zu, daß das Geruchsvermögen der Läuse äußerst gering sei und daß sie den Menschen höchstens auf eine Entfernung von 10 15 cm zu wittern vermögen. Wäre das richtig, dann wären alle die vielen starkriechenden Abschreckungsmittel, die man vorbeugend gegen das Ungeziefer verwendet, höchst überflüssig und das Geld für sie zum Fenster hinausgeworfen. Ich kann mich aber in Übereinstimmung mit Escherich in dieser Beziehung Hase nicht anschließen, denn es steht fest, daß Abwehrmittel dieser Art mindestens eine erhebliche Linderung und dem gequälten Menschen für einige Stunden erquickenden Schlaf verschaffen. Weiter hat, wie schon erwähnt, die Erfahrung gelehrt, daß Leute, die viel mit Pferden umgehen, auch weniger unter der Läuseplage zu leiden haben, und daß man vor dem Ungeziefer ziemlich sicher ist, wenn man sich beim Schlafengehen in eine durchschwitzte Pferdedecke wickelt; offenbar wirkt auch der Geruch des Pferdeschweißes auf das Ungeziefer abschreckend ein. Auch unsere Feldgrauen wissen das, denn sie legen, wenn sich Gelegenheit dazu bietet, ihre Kleider gerne während der Nacht auf die schlafenden Pferde, in der Überzeugung, daß sie sie dann am nächsten Morgen ziemlich läusefrei finden. Die Begattung der Läuse ist sehr innig und langdauernd. Einige Beobachter haben Läusepärchen 5/4 Stunden lang in Kopula gesehen, ohne dem Anfang des Aktes beigewohnt zu haben. Das Männchen kriecht dabei unter das Weibchen, und beide Tiere richten dann den Hinterleib steif schräg nach oben.
|
Abb. 15. Krätzmilbe. |
||
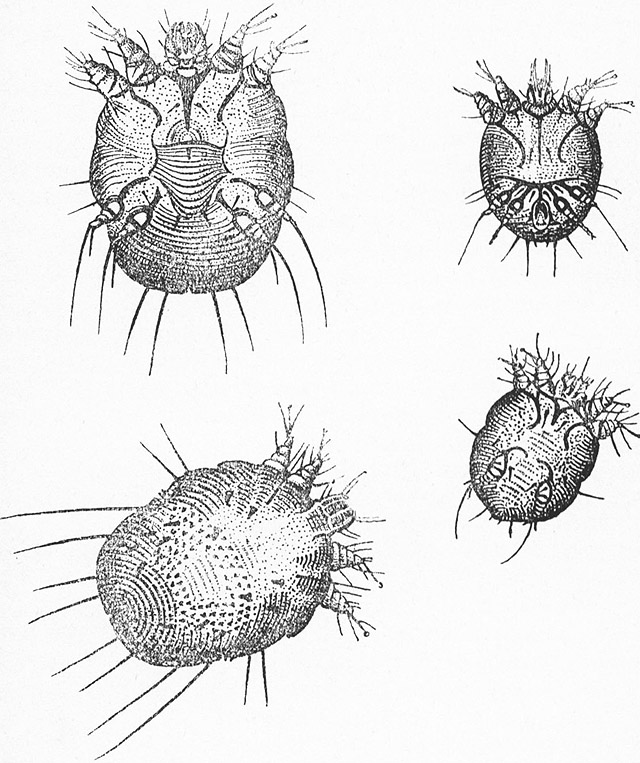
|
||
|
Weibchen von unten
|
Männchen von unten
|
|
Neuerdings ist auch die Stubenfliege, der man ohnedies Übles genug nachsagt, als Läuseträgerin bekannt geworden. Die Insassen eines Lazarettschiffes wurden zeitweise sehr stark von Fliegen heimgesucht, die aus einer in der Nähe befindlichen Müllgrube zu kommen schienen. Oberstabsarzt von Verth konnte nun wiederholt beobachten, wie Läuse die getöteten Fliegen verließen, sobald man diese erschlagen hatte. Die Wichtigkeit dieser Beobachtung in hygienischer Beziehung liegt auf der Hand. Wissen wir doch heute mit Sicherheit, daß die Läuse den gefürchteten Flecktyphus übertragen. Mit der Untersuchung dieser Angelegenheit waren vom Kriegsministerium die bekannten Protozoenforscher Professor von Prowazek und Dr. da Rocha-Lima betraut worden. Während jener bald ein Opfer der Wissenschaft wurde, konnte dieser zum ersten Male experimentell die Übertragung des Flecktyphus durch Läuse auf Meerschweinchen nachweisen. Er untersuchte auch Läuse, die sicherlich den Flecktyphuskeim beherbergen mußten, mikroskopisch und fand in ihren Verdauungswegen winzige bazillenähnliche Körperchen, die sich stark vermehrten. Auf Querschnitten solcher Läuse zeigte sich, daß jene Körperchen sich in ungeheurer Menge in den Magenzellen und Speicheldrüsen angesiedelt und hier gewisse Veränderungen hervorgerufen hatten.
Aber nicht nur von den Läusen werden die Soldaten im Schützengraben geplagt, sondern sie haben zu Kriegszeiten auch unter allerlei anderem Ungeziefer mehr zu leiden als unter geregelten Verhältnissen. So ist vielfach die ekelhafte Krätzmilbe ( Sarcoptes scabiei, Abb. 15) ungewöhnlich häufig bei den Truppen aufgetreten, ein winziges Spinnentier von ⅓ ½ mm Länge, gelblichweißer Farbe, gedrungenem, schildkrötenartigem Körperbau, ohne Augen und ohne besondere Atmungsorgane. Kennzeichnend für diesen Schmarotzer sind weiter die vielen feinen Querfurchen auf dem Körper, die Dornen und Stacheln auf dem Rücken und einzelne Haare am Körper. Beim Weibchen tragen die beiden Hinterbeinpaare je eine lange, den Körper weit überragende Borste, die das Männchen nur am vierten Beinpaar besitzt, während das dritte dafür mit geteilten Haftscheiden ausgestattet ist. Die vier Beinpaare der Tiere haben gar nichts Spinnenähnliches, sind vielmehr kurz und gedrungen, fünfgliedrig, am Grunde mit Chitinleisten und am Ende mit Saugnäpfen versehen. Der Mund ist kegelförmig. Die Befruchtung des Weibchens erfolgt durch den After; aber zur Ablage der reifen Eier bildet sich dann eine besondere Öffnung mitten auf der Bauchseite. Die 25 30 ovalen Eierchen sind 0,15 mm lang und mit Klebstoff versehen, so daß sie überall leicht haften bleiben, und liefern nach 4 8 Tagen sechsbeinige Larven, die mehrere Häutungen durchmachen, um sich nach 14 Tagen in achtbeinige Nymphen zu verwandeln. Diese Nymphen ähneln schon sehr den erwachsenen Tieren, besitzen aber noch keine Geschlechtsorgane, die sie erst nach weiteren 14 Tagen erhalten. Wo die Krätzmilben nicht durch entsprechende Gegenmittel vertilgt werden, ist ihre Vermehrung durch rasche und unausgesetzt aufeinanderfolgende Bruten ungeheuer, und ein einziges Weibchen soll nach 90 Tagen 1½ Millionen Nachkommen haben, eine Rechnung, die freilich nur auf dem Papier steht. Die Männchen sterben alsbald nach der Begattung, die Weibchen nach der Eiablage.
Schon Aristoteles kannte diese unheimliche Milbe und wußte auch recht gut, daß sie die als Krätze bezeichnete Hautkrankheit hervorruft. Im Mittelalter aber ging diese naturwissenschaftliche Kenntnis wie so viele andere verloren, und wenn man Milben bei den an Krätze Erkrankten fand, erklärte man es in naiver Weise damit, daß nicht die Krankheit durch sie hervorgerufen worden sei, sondern daß vielmehr sich die Milben infolge der Krankheit durch Urzeugung gebildet hätten. Die Araber waren klüger, denn der Arzt Avenzoar, der im 12. Jahrhundert lebte, war über die Ursache der Krätzkrankheit ganz genau unterrichtet. Der italienische Forscher Bonomo beschrieb zwar 1687 die Krätzmilbe recht kenntlich, ahnte aber nicht, daß sie den Krätzausschlag verursachte. Diese Erkenntnis wurde erst 1834 durch Benucci neu gewonnen. Heute wissen wir, daß die Krätzmilbe nicht nur auf Menschen, sondern auch auf zahlreichen Haustieren schmarotzt, so z. B. auf Hunden und Katzen, wo sie die als Räude bezeichnete Krankheit hervorruft. Die Erkrankungen der oft genug daran zugrunde gehenden Haustiere sind also wesentlich schwerer als die des Menschen, und man glaubte deshalb, daß die betreffenden Milbenarten nicht mit der des Menschen identisch seien. Indessen steht jetzt fest, daß es sich höchstens um Unterarten einer und derselben Grundform handelt, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß räudige Tiere auch den Menschen anzustecken vermögen. Auf dem menschlichen Körper bewohnt die Krätzmilbe niemals den Kopf, das Gesicht oder den Rücken, bevorzugt solche Stellen, wo die Haut weich und dünn ist (Abb. 16) und tritt meist zuerst auf den Spannhäuten zwischen den Fingern und Zehen auf, dann auch an den Beugestellen der Gliedmaßen, in den Achselhöhlen usw. Nur bei grober Vernachlässigung und infolgedessen eingetretener Übervölkerung wandern die Krätzmilben auch nach anderen Körperstellen aus.
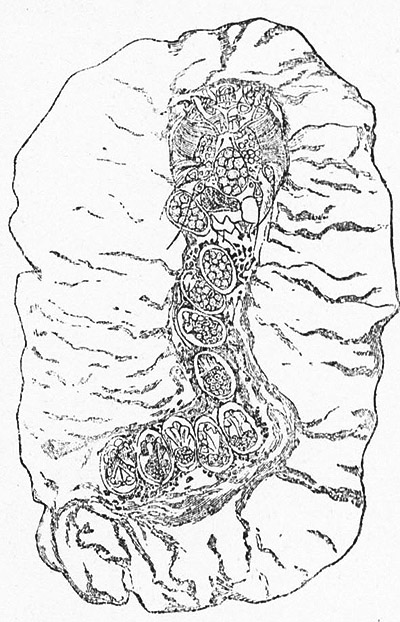
Abb. 16. Ein von einem Krätzmilben-Weibchen in der menschlichen Haut hergestellter Gang. Oben das Weibchen, dahinter Eier in verschiedenen Stadien der Entwicklung. Nach Guiart.
Sie sind übrigens gar nicht so ungeschickte Läufer und vermögen trotz ihrer kurzen Stummelbeine in einer Minute etwa 3 bis 4 cm zu durchmessen, ja die bewegungslustigen Larven sind sogar noch flinker. Beim Gehen bewegen sie die Vorderfüße in der Ordnung, daß immer der äußere Fuß der einen Seite mit dem inneren Fuß der anderen Seite gleichzeitig vorwärtsschreitet, daß also ein ungleichnamiges Paar der Vorderfüße beständig abwechselt. Die Hinterfüße werden sehr oft nur nachgeschleppt, und wo sie wirklich gebraucht werden, handelt es sich fast ausschließlich um das mit Haftscheiben versehene Paar. Beim Laufen auf rauhen Körpern stehen die Milben auf dem letzten Gliede des Fußes und halten sich mit den Krallen fest; auf glatten Flächen dagegen treten sie hauptsächlich auf die Haftscheibe, deren Stiel sie beliebig steif machen und in verschiedenen Richtungen krümmen und biegen können. Die Anwesenheit der Milben gibt sich alsbald durch ein lästiges Jucken kund, da sich die Tiere in die Oberhaut eingraben. Die Männchen gehen dabei nie so tief wie die Weibchen, wechseln auch fortwährend ihren Aufenthalt; die befruchteten Weibchen dagegen graben sich in schräger Richtung eine haarähnliche, tiefe, gewinkelte Röhre von ½ 2 cm Länge, die in einer kesselartigen Erweiterung endigt; hier ruht dann das Tier, so daß man es oft durch die Haut hindurchschimmern sieht. In dieser Röhre werden die Eier abgelegt. Auch die Krätzmilbe sondert aus ihren am Kopf gelegenen Speicheldrüsen wahrscheinlich einen Giftstoff aus, der sehr zur Erhöhung des immer unerträglicher werdenden Juckreizes beiträgt und zur Bildung von kleinen Pusteln führt. Tagsüber verhalten sich die Milben ziemlich ruhig, aber nachts und bei Bettwärme sind sie in voller Tätigkeit und quälen ihren Wirt dann fürchterlich. Erworben wird die Krätze durch Ansteckung, wenn man einen krätzekranken Menschen berührt oder sich in ein von einem solchen benütztes Bett legt oder auf ähnliche Weise. Oft soll schon das Anfassen der vom Krätzekranken berührten Gegenstände genügen, um den Parasiten zu übertragen. Glücklicherweise besitzen wir im Perubalsam und neuerdings im Ristin ein rasch und fast unfehlbar wirkendes Mittel gegen die Krätzmilbe. Nur bei arger Vernachlässigung kann sie deshalb größere Verbreitung auf dem Körper gewinnen und häßliche Schorfbildungen hervorrufen, wie man sie namentlich bei der Fischerbevölkerung Norwegens und Islands gefunden und als Schorfräude bezeichnet hat. Es gibt übrigens auch freilebende Milben, die sich in die menschlichen Wohnungen verschleppen lassen und dann gleichfalls zu Schmarotzern werden, so z. B. Pediculoides ventrosus, die für gewöhnlich in Getreidehalmen lebt, aber bei der Ernte mit in die Scheunen kommt und dann gelegentlich die ländlichen Arbeiter befällt. In Japan kommt eine Laufmilbe vor, deren Stich schwere Erkrankung mit Fieber- und Lymphdrüsenschwellung hervorruft und nicht selten zum Tode führt.
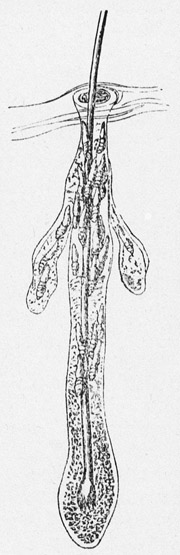
Abb. 17. Haarbalgmilben in einem Haarbalg. Nach Guiart.
Wesentlich harmloser ist die erst 1842 entdeckte Haarbalgmilbe ( Demodex folliculorum, Abb. 18), die namentlich an den Bälgen der im Gesicht befindlichen Haare schmarotzt, auch an den Augenlidern. Ihr Körper ist länglich, und sie besitzt vier Paar Stummelbeine, die Larven nur drei Paar, während der Hinterleib ohne Gliedmaßen ist. Sie ist viel kleiner als die Krätzmilbe, denn erst bei 600facher Vergrößerung wird sie sichtbar. Durch Verstopfung der Drüsenausfuhrgänge verursacht sie die sogen. Mitesser oder Finnen (Abb. 17). Manche Forscher haben sie übrigens im Verdacht, daß sie bei der Übertragung von Krebskrankheiten und Aussatz eine Rolle spielt. Sehr bösartig ist jedenfalls die Haarbalgmilbe des Hundes, denn sie ist der Erreger der in den meisten Fällen unheilbaren Acarusräude.

Abb. 18. Haarbalgmilbe.
Niemand wandelt ungestraft unter Palmen, bisweilen wandelt man aber auch nicht ungestraft in unserem schönen deutschen Wald. Auch hier lauert allerlei blutgieriges Ungeziefer kampflüstern auf den Herrn der Schöpfung. Da sitzen an den Grashalmen oder im Gebüsch winzige Zecken, Holzböcke, wie sie der Volksmund nennt, oft Dutzende oder Hunderte an einem Halm, und spreizen gierig die Vorderbeine aus, um auf den anstreifenden Menschen herüberzusteigen, sich an seinem Körper eine Stelle mit weicher Haut auszusuchen und hier dann an sorgfältig ausgewähltem Plätzchen Blut abzuzapfen, und zwar so nachdrücklich, daß sie selbst auf das Vielfache ihres ursprünglichen Umfanges nach und nach anschwellen, bis sie eine perlgrau schimmernde Kugel von Erbsengröße darstellen. So behutsam gehen diese Blutsauger beim Anstechen zu Werke, daß man ihre Anwesenheit in der Regel erst dann gewahr wird, wenn sie schon längere Zeit gesogen und einen ins Auge fallenden Umfang erreicht haben. Man muß sich hüten, sie etwa herausreißen zu wollen, denn ihr mit Widerhaken fest an der Stichwunde verankerter Rüssel würde dann losreißen und eiternde Geschwürbildungen verursachen. Besser ist es, die Zecke durch wiederholtes Betupfen mit Benzin, Fett oder Petroleum zum freiwilligen Abfallen zu bringen. Das im gewöhnlichen Zustand 1½ 4 mm lange braunrote Tierchen gehört gleich der Krätzmilbe zur Klasse der Spinnentiere, so wenig es auch äußerlich mit einem Karkar gemein hat, denn seine Beinchen sind kurz, der Körper dagegen erscheint gedrungen, wie aus einem Guß, eiförmig abgeplattet und erinnert in der Gestalt an ein Rizinussamenkorn, weshalb auch der Holzbock den wissenschaftlichen Namen Ixodes ricinus führt. Bei uns ist er in manchen Gegenden so häufig, daß Menschen, sowie Hunde oder Katzen fast von jedem Waldgang ein Exemplar mit nach Hause bringen, namentlich die Heidelbeeren suchenden Kinder und Jäger. In anderen Gegenden ist er wieder so selten, daß man ihn kaum dem Namen nach kennt. Ungeheuer häufig dagegen sind die Zecken in den Tropen, wo sie bisweilen in großen Scharen gleichzeitig den Menschen befallen, und in Südamerika hat man jeden Abend eine Stunde zu tun, um die am Körper sitzenden, dort Carpatos genannten Tiere zu beseitigen. Im allgemeinen befallen sie aber auch in den Tropen den Menschen seltener als das Wild und das Vieh, da die Schmarotzer unter diesem ja Auswahl genug haben und der Mensch sich im Urwald in der Regel an die wenigen gebahnten Pfade hält. Schon in Südeuropa gibt es strichweise so viele Zecken, daß sie zu einer förmlichen Landplage werden, denn wenn auch der Stich an sich harmlos ist, so kann er doch bei massenhaftem Auftreten des Tieres recht unangenehm wirken. Zoologisch ist die Zecke ein außerordentlich interessantes Geschöpf. Man denke sich nur ein Tier, das keine Augen besitzt, Nase und Ohren an den Vorderbeinen hat, seine Eier auf dem Kopfe herumträgt und sich bei reichlicher Nahrung bis zum Dreißigfachen des ursprünglichen Umfanges vergrößern kann! Die Zecken schlüpfen als sechsbeinige Larven ohne Atmungs- und Geschlechtsorgane aus den Eiern. Die Larven verwandeln sich dann später in achtbeinige Nymphen, die zwar Atmungs-, aber noch keine Geschlechtsorgane besitzen. Aus den Nymphen gehen dann die geschlechtsreifen, gleichfalls achtbeinigen Tiere hervor. Außer den Häutungen von der Larve zur Nymphe und von der Nymphe zum Geschlechtstier gibt es keine weiteren.
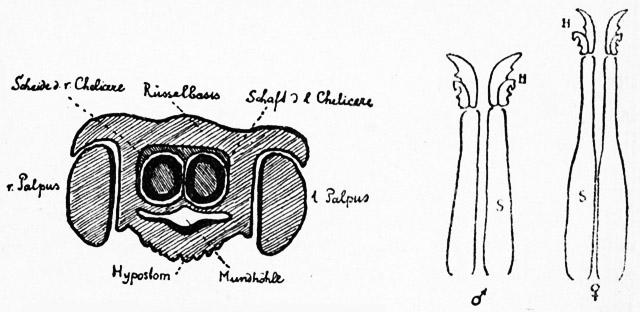
|
|
|
Abb. 19. Querschnitt durch den Rüssel einer Zecke. (Halbschematisch nach Eysell.) |
Abb. 20. Chelikeren vom Männchen ♂ und Weibchen ♀ der Zecke (30mal vergrößert). Nach Eysell. S Schaft, H Haken. |
Um die schmarotzende Lebensweise des Tieres zu verstehen, müssen wir uns zunächst einmal seinen Stechrüssel ansehen, der verhältnismäßig einfach gebaut und äußerlich im ganzen von keulenförmiger Gestalt ist; während der viel verwickelter gebaute Stechmückenrüssel sich aus 7 Teilen zusammensetzt, beschränkt sich der Zeckenrüssel auf drei. Einer davon ist das unpaare, durch Verwachsung der Maxillen entstandene Hypostom (Abb. 19), das auf seiner Unterfläche symmetrisch angeordnete Reihen rückwärts gerichteter Zähnchen trägt, ähnlich wie die Radula der Schnecken, die sogen. Schneckenzunge, während es oberseits eine tiefe Rille aufweist, die zusammen mit dem unteren Hohlraum der beiden Chelikeren das Saugrohr bildet. Die den Mandibeln (Oberkiefern) entsprechenden Chelikeren (Abb. 20) bestehen aus einem langen Schaft und kräftigen, scharfen Klammerhaken an seinem Ende. Besondere Muskeln dienen dazu, die Chelikeren vorzustoßen oder zurückzuziehen, und zwar entweder gleichzeitig oder jede für sich allein, ja selbst rotierende Bewegungen können ausgeführt werden. Gestützt werden Hypostom und Chelikeren durch die Rüsselbasis, einen Chitinrahmen, der einem quergestellten, aufgerichteten Ringe ähnelt. Der Stechakt geht nach den genauen Beobachtungen Eysells in folgender Weise vor sich. Das Tier ritzt zunächst mit dem lanzettförmigen, feinschneidigen Hypostom die Oberhaut seines Opfers. In die so entstandene Wundrinne dringen nun die Enden der Chelikeren ein, indem sie sowohl nach vorwärts wie rotierend bewegt werden und sich durch Spreizen ihrer Haken jeweils fest verankern. Ist das mit der einen Chelikere gelungen, so kommt die andere an die Reihe, dann stößt wieder die erste ein Stück vor, und so geht es weiter, bis der Rüssel auf eine Blutader gestoßen und genügend tief zum Saugen eingedrungen ist. Das Hypostom wird während des Vordringens der Chelikeren nachgezogen und unterstützt die Befestigung des Rüssels dadurch, daß es seine rückwärts gerichteten Zähne in das Unterhautgewebe einschlägt.
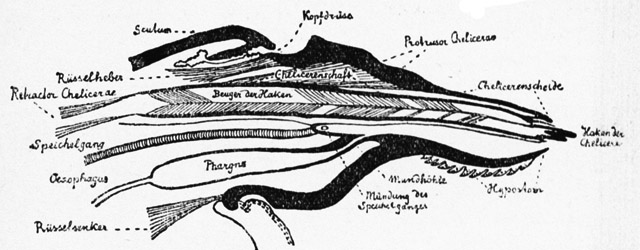
Abb. 21. Längsschnitt durch den Rüssel einer Zecke. (Halbschematisch nach Nuttal, Cooper und Robinson.)
Wenn man diese Beschreibung liest, fühlt man es ordentlich am ganzen Körper kratzen und jucken, aber in Wirklichkeit geschieht das Einstechen der Zecke (Abb. 21 u. 22), wie schon erwähnt, so behutsam und vorsichtig, daß man in der Regel gar nichts davon merkt. Schon die Einbohrstelle wird von dem Tier mit einer gewissen Umsicht ausgesucht, worüber oft längere Zeit vergeht. Es ist klar, daß der mit den Widerhaken und Haifischzähnen festverankerte Rüssel nicht ohne weiteres herausgezogen werden kann und daß deshalb bei gewaltsamer Entfernung des Tieres sein Saugorgan abbrechen muß. Will die Zecke aber selbst loslassen, so schlägt sie die Widerhaken der Chelikeren zurück und dreht das Hypostom um, so daß die hindernden Widerstände für das Herausziehen wegfallen. Die einmal eingebohrte Zecke läßt freilich so leicht nicht wieder freiwillig los und saugt nicht nur stunden-, sondern tagelang an ihrem Opfer, solange sie überhaupt fähig ist, Blut aufzunehmen. So zäh die lederartige Haut der Zecke auch ist, so ist sie doch außerordentlich dehnbar, und eben dieser Umstand ermöglicht die gewaltige Anschwellung ihres Körpers, der dann so elastisch wird, daß er, zu Boden geworfen, wie ein perlgrauer Gummiball auf- und abspringt. Eine nicht unbedeutende Rolle beim Saugen der Zecke spielen die paarig an ihrem Vorderkörper gelegenen Speicheldrüsen. Das von ihnen ausfließende Sekret verhindert nämlich das Gerinnen des Blutes, verstärkt zugleich die Blutung und wirkt endlich auch noch schmerzstillend, damit das Opfer möglichst wenig von der Anwesenheit des Blutsaugers bemerken soll.
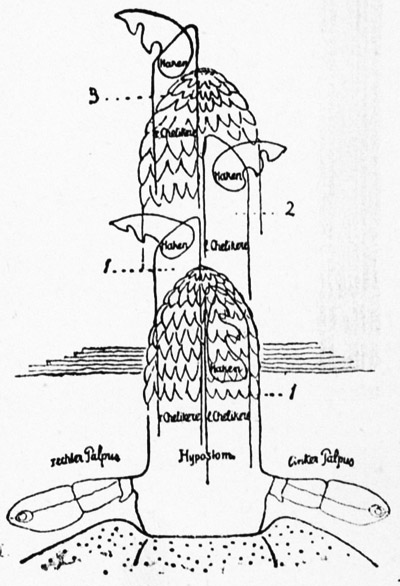
Abb. 22. Schema eines in die Haut eindringenden Zeckenrüssels (nach Eysell). Die Zahlen bezeichnen, wie sich die Chelikeren beim Einstechen nacheinander einstellen.
Die sonderbare Art der Eiablage, wobei die Eier mit Hilfe einer chitinösen, birnenförmigen und mit zwei fingerförmigen Fortsätzen versehenen Blase (genisches Organ) in Klumpen von 200 300 am oberen Schildrande festgeklebt werden, gab früher zu der Fabel Veranlassung, daß die Holzböcke ihre Eier durch den Mund ausstoßen. Das vollgesogene Weibchen verläßt sein Wirtstier und beginnt etwa vierzehn Tage später in irgendeinem stillen Winkel auf dem Erdboden mit der Eiablage. Die kugeligen Eier ruhen etwa vier Wochen in dem Schlupfwinkel, in den sie abgesetzt wurden, bis die Larven ausschlüpfen, während das nach der Eiablage zu einem schlaffen Sack zusammengeschrumpfte Weibchen in kurzer Zeit stirbt. Die kleinen Larven steigen an Grashalmen und im Gebüsch empor, halten sich hier mit einem Beinpaar fest und strecken die Vorderbeine sehnsüchtig nach einem vorüberstreifenden Opfer aus. Bleibt ein solches aus, so können sie zwar zunächst sehr lange hungern, müssen aber schließlich doch an Erschöpfung zugrunde gehen. Die ganze weitere Entwicklung des Tieres ist also von dem Zufall abhängig, ob ein geeignetes Wirtstier vorüberkommt oder nicht, und es ist klar, daß viele Zecken absterben, ehe sie ihre weitere Daseinsentwicklung durchmachen können. Dieser Nachteil wird freilich durch ihre große Vermehrungsfähigkeit reichlich wieder ausgeglichen. Die Larven sind übrigens träge Geschöpfe und in dem Aussuchen ihrer Nahrung recht wählerisch. Im Notfall gehen sie allerdings auch an kaltes Blut, und man findet namentlich Eidechsen am Hals und auf der Innenseite der Schenkel öfters dicht mit Zeckenlarven besetzt, die ausnahmsweise statt des Blutes auch mit Lymphe vorliebnehmen sollen. Manche Larven steigen auch höher im Gebüsch empor und lassen sich dann von da bei geeigneter Gelegenheit herabfallen, weshalb man öfter Zecken gerade unter dem Rockkragen mit nach Hause bringt.
Die Atmung dieser Larven geschieht durch die ganze Haut, während die Nymphen und die erwachsenen Tiere ein richtiges Luftröhrensystem mit zwei seitlichen Atemlöchern besitzen. Von den sonstigen Sinnesorganen der Zecken verdienen namentlich die Hallerschen Bläschen Erwähnung, die am vordersten Beinpaar sitzen und zwei bläschenförmige, aber nicht allseitig geschlossene Vertiefungen vorstellen. Früher hielt man sie allgemein für den Sitz des Gehörorgans, das aber für die schmarotzenden Zecken wenig Wert hätte, während man jetzt der Meinung zuneigt, es hier mit einem Geruchsorgan zu tun zu haben.
Während der Stich unseres Holzbockes nicht sonderlich schlimm ist, gibt es tropische Arten, deren Stiche beängstigende Herzbeklemmungen und starke Schwellungen, ja sogar ein Zuschwellen der Augenlider verursachen können. Gefährlicher als durch ihren Stich werden die Zecken dadurch, daß sie gleich anderen Blutsaugern allerlei Krankheiten, insbesondere gefährliche Blutparasiten, übertragen können; dies um so mehr, als festgestellt wurde, daß sogar noch die Nachkommenschaft verseuchter Zecken diese üble Eigenschaft behält. Im allgemeinen haben freilich mehr die Haustiere als der Mensch darunter zu leiden. So wird durch unser Ixodes ricinus die Hämoglobinurie der Rinder übertragen, und von Boophilus annulatus weiß man seit 1893, daß er mittelbar das berüchtigte Texasfieber der nordamerikanischen Rinder verursacht, dessen Einschleppung in Deutschland nur mit Mühe verhütet werden konnte. Den Menschen gefährlich wird namentlich Ornithodarus moubata, das in Afrika das gefährliche Rückfallfieber verschleppt, und Argas persicus, die berüchtigte Giftwanze von Miana, deren Rücken eine Unzahl weißer Grübchen aufweist und die in ihrer persischen Heimat den Menschen schon wiederholt zur Räumung seiner Ortschaften zwang, da nach ihrem Stich häufig eine Zersetzung des Blutes eintritt. Diese Art gehört schon zu der etwas abweichenden Gruppe der Zungenzecken, die bei uns durch die Tropenzecke ( Argas reflexus) vertreten ist, ein in den Tropen schlimm hausendes, von da aus aber auch auf Geflügel und selbst auf den Menschen übergehendes, sehr widerstandsfähiges und schwer auszurottendes Ungeziefer. Ungleich häufiger als bei uns ist die Tropenzecke in Frankreich. Im Gegensatz zum Holzbock ist sie sehr lichtscheu und stellt sich tot, sobald sie sich bedroht glaubt.
Es ist an einem der wenigen warmen Sonntage dieses verregneten Sommers, und ich sitze bei meinem Manuskript, aber die rechte Andacht zum Schreiben will nicht aufkommen, denn die Wärme des Sonnenscheins hat nicht nur die Menschenherzen mit neuer Lebenslust erfüllt, sondern auch das zudringliche Heer der Fliegen (Abb. 23) aus seinen Schlupfwinkeln hervorgelockt. Mit unheimlicher Zudringlichkeit belästigen diese treuesten, aber höchst unwillkommenen Begleiter des Menschen den vielgeplagten Herrn der Schöpfung. Fällt ihm ein schöner Gedanke ein, so krabbelt auch schon eine Fliege auf der Denkerstirn, und wenn man sie mit einer unmutigen Handbewegung verscheucht hat, ist auch der schöne Gedanke mit ihr verflogen. Eine andere hat sich mit boshafter Beharrlichkeit meine Nasenspitze als Ruheplatz auserkoren, um hier ihre Beine zu putzen, und mit einer Hartnäckigkeit, die einer besseren Sache würdig ist, kehrt sie verscheucht immer wieder zurück. Ein liebesseliges Fliegenpärchen feiert gar Hochzeit auf meinem Manuskript, und ein Fliegenjunggeselle bemüht sich redlich, auf dem Papier einen fehlenden i-Punkt in wenig appetitlicher Weise zu ersetzen. Es wird nichts mit der Arbeit heute, die Fliegen sind daran schuld, diese unverschämtesten, zudringlichsten und beharrlichsten aller Geschöpfe. Wahrlich, man könnte einen türkischen Pascha oder einen indischen Nabob beneiden, hinter denen beständig der bekannte riesenhafte Neger steht, um mit einem Fächer aus Straußenfedern die Fliegen zu verscheuchen. Oder man kann den schwäbischen Landpastor begreifen, von dem Weber in seinem lachenden Demokrit erzählt, daß er, bevor er sich an Speise und Trank labte, erst von dem Hauptgericht hier ein Kleckschen hinlegte, dort ein anderes, bis sich ihre Gnaden die Fliegen darauf versammelt hatten. Dann erst deckte er seine Schüsseln auf und langte in Ruhe für sich selbst zu. Er zahlte also gewissermaßen eine Abfindungssumme oder ein Schutzgeld, wie ehemals die kleineren Reichsstädte den benachbarten Raubrittern. Kann bei uns die Fliegenplage namentlich auf dem Lande in der Nähe der Viehställe und Dunghaufen schon recht unangenehm werden, so ist das doch nur ein Kinderspiel gegenüber dem Umfang, den sie in südlicheren Ländern annimmt. Der Aufenthalt im sonnigen Italien oder im bunten Orient kann einem empfindlichen Menschen durch die Myriaden von Fliegen tatsächlich vollkommen verleidet werden. Auch im Felde haben während der Kriegssommer Soldaten wie Zugtiere unendlich durch die massenhaft vorhandenen Fliegen ausstehen müssen. Bei den ohnehin so vielgeplagten Pferden setzte sich das Geschmeiß in Augen und Ohren fest, weshalb von zuständiger Stelle an die Tierschutzvereine die Bitte um Lieferung von Ohrenschützern für die Pferde erging. Solche Vorkommnisse zeigen uns aber auch zugleich, wie grausam es ist, den Pferden den Schwanz kurz zu stutzen, denn an ihrem langen Schweifwedel besitzen sie immerhin einen guten, natürlichen Fliegenwedel. Besonders furchtbar soll die Fliegenplage auf Gallipoli gewesen sein, dessen blutgetränkte Gefilde nicht zuletzt dadurch zu einer wahren Hölle für die Soldaten wurden. Die Folge der dort herrschenden Gluthitze und Regenlosigkeit war eine geradezu ungeheuerliche Menge von Fliegen, die das Dasein förmlich verpesteten. Infolge der Hitze schnitten viele Soldaten ihre Hosen derart ab, daß die Knie freiblieben, aber dann sammelten sich auch dort sofort, wie überhaupt auf jedem nackten Körperteil, unzählige zudringliche Fliegen. Das vorgesetzte Essen war in wenigen Sekunden schwarz von Fliegen, und man konnte keinen Bissen zum Munde führen, ohne einige der aufdringlichen Plagegeister mit zu verzehren. Die entsetzliche Unzahl dieser Tiere erfüllte die Zelte und Unterstände mit einem blödsinnigen Gesumme und machte die Leute, die im Schatten zu schlafen versuchten, geradezu wahnsinnig. Überall saßen die Fliegen in schwarzen Massen, ekelhafterweise auch mit besonderer Vorliebe auf den Leichen der Gefallenen. Jede Bewegung wurde vom Aufsummen eines Fliegenschwarms begleitet, die Mahlzeiten durch sie zum Teil ungenießbar gemacht. Die Fliegen vervielfachten die Leiden der Verwundeten und verdarben die Laune der Gesunden. Der Gott Gallipolis war nicht Mars, der Schlachtenlenker, sondern Beelzebub, der Fliegengott.
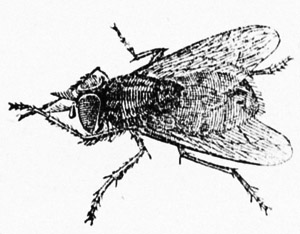
Abb. 23. Stubenfliege.
(Vergrößert. Nach einer Originalzeichnung für den Kosmos von Dr. H. Grünberg, Berlin.)
Schon in unseren kultivierten Behausungen können die Fliegen den zur Verzweiflung bringen, der behaglich seine Zeitung lesen oder ein erquickendes Nickerchen abhalten möchte. Scheffel singt:
»Just zur Stunde süßen Mittagsschlummers
Heben sie das teuflischste Gesumme an
Und tournieren wie die Sarazenen
Wider mich, den harnischlosen Mann.
Hüpfen auf den Mund, als ström' er Honig,
Tanzen auf des Auges Lid und sumsen
Höhnend an die Ohren ihr ›wach auf‹ mir.«
Ja, ja, »erquickend ist die Mittagsruh, nur kommt man oftmals nicht dazu«. Noch bezeichnender als Scheffel schildert unser unübertrefflicher Wilhelm Busch in dieser Beziehung die Fliege.
»Dem Herrn Inspektor tut's so gut,
Wenn er nach Tisch ein wenig ruht,
Da kommt die Fliege mit Gebrumm
Und surrt ihm vor dem Ohr herum.
Und aufgeschreckt aus halbem Schlummer
Schaut er verdrießlich auf den Brummer.«
Auch Schopenhauer war nicht gut auf die Fliegen zu sprechen, die ihn manchesmal in seinen tiefsinnigen Betrachtungen gestört haben mochten. Er schreibt: »Zum Symbol der Unverschämtheit und Dummdreistigkeit sollte man die Fliegen nehmen, denn wenn alle Tiere den Menschen über alles scheuen und schon von ferne vor ihm fliehen, setzen sie sich ihm gerade auf die Nase. Auch Homer führt uns die Fliege als Sinnbild der Unverschämtheit und Schamlosigkeit vor. »Schamlose Fliege«, das ist das beliebteste Schimpfwort, mit dem sich die hehren Göttinnen im hohen Olymp gegenseitig titulieren. Nur der menschliche Olympier Goethe weiß in seiner ruhigen und vorurteilslosen Art auch der Fliege nach eine gute Seite abzugewinnen. Es heißt bei ihm: »Jeder, der in sich fühlt, daß er etwas Gutes wirken kann, muß ein Plagegeist sein, er muß nicht warten, bis man ihn ruft, er muß nicht rasten, wenn man ihn fortschickt, er muß sein, was Homer an seinen Helden preist, er muß sein wie eine Fliege, die, verscheucht, den Menschen immer wieder von einer anderen Seite anfällt.« Es ist schwer, in dieser Beziehung mit unserem größten Dichter übereinzustimmen, denn auf den gewöhnlichen Menschen wirkt doch das Zudringliche, das Unsaubere und das Zuchtlose des Fliegenwesens allzu abstoßend. Ihren Kot setzen sie in Form der bekannten schwarzen Pünktchen mit Vorliebe auf den dazu ungeeignetsten Stellen ab, wie etwa auf einem neuen goldenen Bilderrahmen oder einem schönen Kronleuchter; sie lieben es offenbar, das Strahlende zu schwärzen. Demokrit-Weber wirft ihnen sogar vor, sie hätten auf diese Weise schon wertvolle hebräische Handschriften gefälscht.

Abb. 24. Durch die Stubenfliege drohende Gefahren. (Aus einem amerikanischen Flugblatt entnommen, das die Gefahren drastisch darstellt, um zur rücksichtslosen Bekämpfung aufzufordern.)
Die Fliegen sind aber nicht nur äußerst lästig, sondern sie sind auch in hygienischer Beziehung geradezu gefährlich, ein Umstand, den man bisher viel zu wenig gewürdigt und seiner wahren Bedeutung nach eingeschätzt hat. Heute kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß gerade durch die überall den Menschen umschwirrenden Fliegen gefährliche und ansteckende Krankheiten übertragen werden (Abb. 24). Freilich hat es auch nicht an Stimmen gefehlt, die die Fliegen für überwiegend nützlich erklärten, und ältere Naturforscher haben behauptet, daß diese Insekten zur Reinigung der Luft beitrügen, weil sie diese von Pilzen säuberten; leider ist aber gerade das Gegenteil richtig. Schon im Mittelalter brachten einsichtsvolle Ärzte, wie z. B. Mutall i. J. 1498, das Auftreten der Pest mit den Fliegenschwärmen in Verbindung, und auch die Chinesen, bei denen bekanntlich die Schmutzerei groß ist und die demzufolge entsetzlich unter der Fliegenplage zu leiden haben, erkannten schon seit Jahrhunderten einen gewissen Zusammenhang zwischen Seuchen und Fliegen. Aber diese Stimmen sind ungehört verhallt, und erst in neuerer Zeit ist bei uns die richtige Einsicht zum Durchbruch gekommen. 1869 hat Rainbert die Übertragung des Milzbrandes durch Stubenfliegen nachgewiesen, 1880 erkannte Laveran sie als Träger der die eitrige Entzündung von Wunden verursachenden Bazillen, und 1898 wurde im Spanisch-Amerikanischen Kriege die Fliege als Übermittlerin von Typhusepidemien festgestellt, eine Erfahrung, die sich auch im Burenkriege wieder bestätigte und die man durch reichliche Verwendung von Moskitonetzen zu bekämpfen suchte. Namentlich hat der amerikanische Entomologe Howards in Wort und Schrift aufs nachdrücklichste auf die hygienische Gemeingefährlichkeit der Stubenfliege hingewiesen und zu einem allgemeinen Vernichtungskriege gegen sie aufgefordert. Heute wissen wir, daß die Fliegen außer den schon genannten Krankheiten auch noch Durchfall, Cholera, Tuberkulose, Pocken, Scharlach, Diphtherie, Rückfallfieber, Dysenterie, Augen- und Milzkrankheiten sowie Wurmkrankheiten zu verschleppen vermögen, selbst den entsetzlichen Aussatz, für den man früher mit Unrecht die Moskitos verdächtigt hatte. Das ist in der Tat eine scheußliche Musterkarte der verheerendsten Krankheiten und fordert wohl zu weitgehender Vorsicht auf. Um so gefährlicher wird das Insekt in dieser Beziehung, als es über die ganze Erde verbreitet ist, denn es fühlt sich in den Hütten der Eskimos in Grönland wie im tropischen Afrika daheim und ist eigentlich überall zu finden, wo es Menschen gibt, die Vieh halten, namentlich Pferde und Rinder, deren Dungstätten die bevorzugten Plätze zur Eiablage der Fliege bilden. Das Flugvermögen der Tiere erleichtert ihnen einen raschen Ortswechsel und trägt weiter zur Verbreitung der mitgeschleppten Krankheitskeime bei. Man muß die Fliegen nur beobachten, wie sie hin- und herfliegen; vom Spucknapf zu der für den Säugling bestimmten Milch, vom Kehrichteimer zur Küche und dem dort wartenden Mittagessen, vom Pferdestall zu der als Nachtisch bestimmten Torte, von einem Aas zu einem Menschen, der sich irgendwelche Verletzungen zugezogen hat, und man wird begreifen, daß sich so kaum auszudenkende Möglichkeiten zur Verschleppung von Krankheitskeimen bieten. In den zahlreichen Haaren, mit denen der Fliegenkörper bedeckt ist, haften Schmutzteilchen aller Art nur zu leicht und werden dann wieder abgestreift, wenn sich die Tiere nach ihrer Art fleißig mit den Beinen putzen. Äußerlich und innerlich sind sie mit Krankheitskeimen förmlich vollgepfropft, da sie ja an den schmutzigsten Orten sich aufhalten und in dem Aussuchen ihrer Nahrung ganz und gar nicht wählerisch sind, vom Auswurf eines Lungenkranken sättigen sie sich ebenso gern, wie von einer Zuckerlösung. Ein einziger der winzigen Punkte, die den Fliegenkot darstellen und überall innerhalb der menschlichen Behausungen abgesetzt werden, enthält oft hunderte der schädlichsten Bazillen. Genaue Untersuchungen haben festgestellt, daß infizierte Fliegen noch nach drei Tagen lebende Tuberkel- und Dysenteriebazillen beherbergten, nach vier Tagen nach Choleravibrionen, während Typhusbakterien sogar noch nach 23 Tagen sich als lebensfähig erwiesen.
Aus dem Gesagten dürfte zur Genüge hervorgehen, wie ungeheuer wichtig eine planmäßige Bekämpfung der Fliegenplage vom hygienischen Standpunkt aus ist. Es hat deshalb auch vor einigen Jahren in London eine besondere »Ausstellung gegen die Fliegen« stattgefunden, um weitere Bevölkerungskreise über die von der Stubenfliege ausgehenden Gefahren aufzuklären. Besonders wurde empfohlen, auf den Misthaufen trockenes Stroh auszubreiten, in das die Fliegenlarven hineinkriechen, um sich zu verpuppen, worauf sie dann mitsamt dem Stroh verbrannt werden können, weiter wurde als besonders zweckmäßig eine Mischung von Rohpetroleum, grüner Seife und Wasser angepriesen, mit der man sich die Haut einreiben und die Kleider tränken sollte. Es ist ja möglich, daß dadurch die Fliegen abgehalten werden, aber leider gab die Ausstellung keine Auskunft darüber, wie es der Mensch selber bei einem solchen Petroleumgeruch aushalten soll. Im allgemeinen hat man sich bei uns bisher damit begnügt, die einzelnen Fliegen in den Zimmern totzuschlagen oder wegzufangen, und die Fliegenklappe, in deren Handhabung manche Leute es zu einer wahrhaft bewundernswerten Geschicklichkeit brachten, gehörte ja zur unentbehrlichen Ausrüstung unserer Großväter. Mit Fliegenpapier, Fliegenleim und Fliegenfallen einfachster und verwickeltster Art suchen wir selbst den Fliegen zu Leibe zu gehen, aber eigentlich stellt alles das gegenüber dem in immer erneuten Massen ansummenden Ungeziefer nur eine aussichtslose Sisyphusarbeit dar. Am besten wirken solche Vorrichtungen noch, wenn man sie im zeitigen Frühjahr anwendet, also nicht erst im Hochsommer, wo die Fliegenplage ihren Höhepunkt erreicht. Die im Frühjahr erscheinenden Fliegen sind nämlich die überwinterten Mutterfliegen, die den ganzen Leib voll Eier haben, so daß man mit ihnen eine ganze Generation von Fliegen tötet und dadurch in der Tat die Zahl dieser Plagegeister wesentlich zu verringern imstande ist. Auch sind die Fliegen sehr empfindlich gegen Zug und flüchten deshalb aus den Wohnungen und Ställen, wenn man durch Öffnen sämtlicher Türen und Fenster Zugluft herstellt. Vor allem aber müßten die zur Eiablage für die Fliegen geeigneten Brutstätten verschwinden oder doch möglichst eingeschränkt werden. In Nordamerika hat man sich in dieser Beziehung sogar schon zu gesetzlichen Vorschriften aufgeschwungen, für deren strenge Einhaltung die Behörden wenigstens in den größeren Städten sorgen. Dünger und Küchenabfälle müssen in festen, gut verschließbaren Behältern gesammelt werben, Senkgruben und Dunghaufen sind beständig mit Chlorkalk zu bespritzen. Unter dem anfeuernden Einfluß Howards' ist die Fliegenbekämpfung in Nordamerika geradezu volkstümlich geworden und zeitigt auch manche echt amerikanische Auswüchse. So bot z. B. das große Nashorn des zoologischen Gartens in Neuyork einen höchst ungewöhnlichen Anblick, indem es ganz und gar in Fliegenpapier eingehüllt war. Eine besonders bei den Farmern verbreitete Zeitung aus dem Dollarlande erschien eines schönen Tages statt auf gewöhnlichem Papier auf Fliegenpapier gedruckt, mit der Behauptung, daß die Farmer während der Ernte doch keine Zeit hätten, die Zeitung zu lesen, und daß sie ihnen auf diese Weise noch nützlich werden könnte. Der allgemeine Eifer für den Vernichtungskampf gegen die Fliegen wurde auch noch durch Geldpreise angespornt für die, die eine bestimmte Zahl von Fliegenleichen abliefern würden. Den Vogel schoß ein zwölfjähriger Knabe ab, der für 119 000 tote Fliegen 400 Mark in die Tasche stecken durfte. Die gesamte Beute füllte 10 große Fässer, die im Universitätsgebäude von Clarc ausgestellt wurden.
Ganz eigenartig sollen beim Fliegenfangen die Frauen der Sahara verfahren; sie benutzen nämlich die eigene Nase als Fliegenfalle, indem sie sie mit einem Klebemittel bestreichen. Wirkungsvoll dürfte es sein, die natürlichen Feinde der Fliegen zu schonen und zu hegen, also in erster Reihe unsere lieblichen Singvogelarten, wie z. B. Schwalben, Fliegenschnäpper, Rotkehlchen u. a. Ein im Zimmer freifliegendes Rotkehlchen z. B. räumt gehörig mit den Fliegen auf, und besondere Schmutzerei durch den Vogel ist auch nicht zu befürchten, weil man ihn leicht dazu gewöhnen kann, immer auf einen bestimmten Platz zum Ausruhen zurückzukommen; zu Cholerazeiten dürfte das ein ganz gutes Vorbeugungsmittel sein: Auch in der Pflanzenwelt besitzen die Fliegen manche Feinde, wie z. B. die im Süden der Vereinigten Staaten wachsende Venusfliegenfalle. Wenn im Herbst die Fliegen an den Fensterscheiben der bekannten Pilzinfektion unterliegen, so sollte man sie ruhig einige Tage hängen lassen, denn sie stecken dann noch viele ihrer Gefährten an. schlafende Rinder sollte man im Sommer stets durch Moskitonetze vor den Fliegen schützen und ebenso alle Nahrungsmittel in der Küche, Speisekammer, in den Kaufmannsläden und Bäckereien unter fliegensicherem Verschluß halten. Gemüse, Früchte, Fleisch u. dgl. sind vor dem Genuß oder vor der Zubereitung gründlich zu waschen, Ställe möglichst ausgiebig und oft zu lüften und an den Wänden mit Chlorkalk zu bestreichen, wird der Fußboden reinlich gehalten, so trägt dies auch ersichtlich zur Verminderung der Fliegenplage bei, ebenso ein Anstrich der Fensterrahmen mit Lavendelöl und das öftere Abbrennen von Räucherkerzen in den Zimmern, wieviel aber noch in dieser Beziehung zu tun übrig bleibt, das ist mir namentlich bei meinen Orientreisen aufgefallen, herrscht z. B. in der Türkei die Cholera, so hat man zwar an der bulgarischen Grenze eine langweilige Quarantäne durchzumachen, aber niemand achtet darauf, daß es in der Küche des Speisewagens des Schnellzuges von aus Konstantinopel mitgeschleppten Fliegen nur so wimmelt, die dann die Reise bis Budapest oder Wien mitmachen, wodurch sich die bei solchen Gelegenheiten immer wieder beobachteten vereinzelten Cholerafälle in der ungarischen Hauptstadt ohne weiteres erklären.
So unsauber die Fliege nun aber in der Wahl ihres Aufenthaltsortes und ihrer Ernährungsweise auch ist, so sehr hält sie doch am eigenen Leibe auf Reinlichkeit, und fortwährend hat sie an ihrem borstigen Körper zu putzen und zu striegeln. Ist sie nicht gerade mit Fressen oder Lieben beschäftigt, so putzt sie sich, und sie erinnert dabei ein wenig an die Katzen, indem sie gleichfalls das Reinigungsgeschäft (Abb. 25) mit den Füßen besorgt und sich gewissermaßen auf trockenem Wege wäscht. Zuerst kommen Gesicht und Nacken daran, die sie mit dem vordersten Beinpaar so tatkräftig und unter so gewagten Halsverrenkungen bearbeitet, daß man meinen sollte, sie müßte die scheußlichsten Kopfschmerzen davon bekommen. So gründlich gehen sie dabei zu Werke, daß ganze Staubflöckchen von ihnen herabfallen. Namentlich der tiefe Einschnitt zwischen Kopf und Rumpf wird tüchtig hergenommen und dann reiben sie sich mit dem Anschein hoher Befriedigung die Vorderfüßchen, gerade wie ein alter Schacherer, der ein recht gutes Geschäft gemacht und einen ahnungslosen Käufer tüchtig hineingelegt hat. Ist das kleine, dicke Köpfchen gereinigt, so kommt der Mittelkörper daran, besonders die Flügel, wozu auch das zweite und dritte Beinpaar in Tätigkeit gesetzt werden. Mit dem Hinterleib, den das letzte Beinpaar allein bearbeitet, wird die Fliege am schnellsten fertig und strahlt nun in neuer Sauberkeit, freilich nicht für lange. So genäschig die Fliegen auch sind, vermögen sie doch auch bei knappen Zeiten, ohne Schaden zu nehmen, sogar vier Tage ganz ohne Nahrung auszukommen. Ihr Wohlbefinden ist sehr von der Witterung und namentlich von der Temperatur abhängig. Bei warmem Sonnenschein sind sie so recht in ihrem Element und schwirren fröhlich hin und her. Niemals werden sie zudringlicher und unverschämter als bei drückender, schwüler Witterung, dagegen sitzen sie träge und gleichgültig herum, wenn anhaltend kühles Regenwetter herrscht. In den menschlichen Behausungen brauchen sie übrigens kaum jemals zu hungern, irgend etwas für sie findet sich da immer.

Abb. 25. Putzstellungen der Stubenfliege.
Wie mag es aber wohl eine Fliege anstellen, um sich z. B. ein Bröckchen Zucker einzuverleiben, wo sie doch weder Zähne, noch einen Schnabel, noch überhaupt verhärtete Mundteile besitzt, sondern lediglich einen weichen Saugrüssel? Nun, sie findet da einen ganz einfachen Ausweg, um zu der ersehnten Süßigkeit zu gelangen. Sie befeuchtet nämlich den Rüssel mit einem Tröpfchen Speichel und saugt den entstandenen Zuckerbrei auf. Nicht selten sieht man Fliegen, denen vorne an der Rüsselscheide ein Tröpfchen weißer Flüssigkeit anhängt; das ist eben der erwähnte Speichel. Möglicherweise haben die Tiere gerade besonders Appetit und das Wasser läuft ihnen gewissermaßen im Munde zusammen, auch noch auf andere Weise wissen sich die Fliegen besondere Leckerbissen und süße Stoffe zugänglich zu machen, auf die sie sehr erpicht sind. So haben sie es sogar wie die Ameisen bis zum Melken der Blattläuse gebracht. Bekanntlich stapeln die Pflanzenläuse in ihrem Hinterleib eine klebrige, zuckerhaltige Flüssigkeit auf, die sie dann in Form kleiner Tröpfchen von sich spritzen oder auf die Blattunterlage fallen lassen. Durch einen glücklichen Zufall konnte nun kürzlich eine Fliege ( Fannia mannatica) beobachtet werden, die auf einem Holunderbaum saß und hier bei den Blattläusen die Saftentstehung künstlich herbeiführte, also gewisser, maßen einen Melkakt vornahm. Die Fliege bearbeitete zu diesem Zweck mit heftigen Bewegungen ihrer Vorderbeine so lange streichend den Hinterleib der Blattlaus, bis ein Tropfen der zuckerreichen Flüssigkeit hervortrat, der nun von dem gierig vorgestreckten Rüssel der Fliege eingesogen wurde.
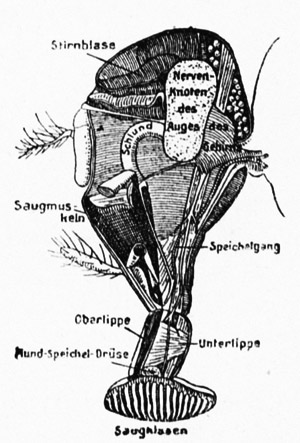
Abb. 26. Querschnitt durch den Kopf einer Fliege (Schematisch nach L. O. Howard.)
Der für die Fliege so kennzeichnende Rüssel ist ein abwärts gerichteter Schöpfrüssel, der nur zum Saugen eingerichtet ist, niemals aber zum Stechen dienen kann. Er nimmt die ganze Unterkopfhälfte (Abb. 26) ein und setzt sich aus nur zwei Teilen zusammen, nämlich aus der langen, gestreckten, schmalen Oberlippe, die in den Spalt der dicken, fleischigen Unterlippe paßt und ihn verschließt, und aus der Unterlippe, die in einem breiten, reichlich mit Geschmacks- und Tastnerven ausgestatteten Saugkissen endigt, in das der Speichelgang einmündet, während die Speicheldrüsen selbst im Hinterleibe liegen, allerdings befindet sich im Saugkissen selbst nach eine besondere Speicheldrüse, deren Sekret aber lediglich zur Feuchthaltung des Kissens dient. Ein muskulöser Saugapparat befördert dann die aufgenommene Nahrungsflüssigkeit in den Schlund und von da weiter in den Magen. Neben dem Rüssel fallen an dem dicken Fliegenkopf hauptsächlich noch die breite Denkerstirn und die stark hervorquellenden großen Fazettenaugen auf. Die Fliege gehört zu den Zweiflüglern, und daraus erklärt sich schon, daß von den beiden Flügelpaaren nur das vordere zu glashellen, stark mit kräftigen Adern durchzogenen Flügeln entwickelt ist, während das hintere Flügelpaar zu eigenartigen Gebilden verkümmert ist, die die Gestalt von Trommelschlegeln haben, von einem Schüppchen überdeckt sind und als Schwingkölbchen bezeichnet werden. Über die physische Bedeutung dieser Schwingkölbchen ist man sich noch immer nicht recht klar; manche Forscher wollen in ihnen den Sitz von Sinnesorganen sehen, namentlich den des Gehörs, während andere der Meinung sind, daß sie zur Bewegung der Brummringe im Stimmapparat beitragen und auch auf die Atmung und Flugfähigkeit fördernd einwirken. Keinesfalls wird aber das für die Fliegen so kennzeichnende summende Geräusch durch die Schwingkölbchen allein verursacht, denn außer ihnen wirken noch zu seiner Entstehung krampfhafte Reibungen der Hinterleibsringe, sowie die zu Stimmorganen umgewandelten Luftlöcher des Brutkastens mit. Die Fühler der Fliegen sind im Gegensatz zu den langen, feinen und vielgliedrigen Fühlern der Mücken kurz, derb und nur dreigliedrig. Für unsere Stubenfliege selbst gelten als beste Artkennzeichen gegenüber ihren zahlreichen und vom Laien nicht leicht zu unterscheidenden Verwandten die gelbe Färbung des Hinterleibs sowie die scharfe Knickung der Hauptader im Flügel.
Im Herbst sieht man zahlreiche Fliegen tot an den Wänden oder Fensterscheiben sitzen mit stark aufgetriebenem Hinterleib, auf dem deutlich Schimmelpilze zu erkennen sind, während unter der toten Fliege ein grauweißes Staubhäufchen die Sporen dieser Pilze darstellt: Schon Goethe ist diese Erscheinung aufgefallen, und er hat mancherlei sinnreiche Betrachtungen darüber angestellt, wenn er auch, da man damals noch nichts von den pathogenen Bakterien wußte, natürlich das Rätsel nicht ergründen, sondern nur von einer »zerstörenden Zerstäubung der Fliegen« sprechen konnte, seitdem haben sich zahllose Forscher mit dieser Angelegenheit eingehend befaßt, und heute wissen wir, daß es ein besonderer Pilz ( Empusa muscae) ist, der dieses Massensterben der Fliegen verursacht und somit mittelbar zu einem Wohltäter der vielgeplagten Menschheit wird. Der Pilz höhlt die Fliegen innerlich förmlich aus, denn wenn wir einer solchen Fliege den Leib aufschneiden, finden wir ihn ganz leer, nur sind alle Wandungen mit dem verheerenden Schimmelpilze bekleidet.
Leider ist die Vermehrungsfähigkeit der Fliegen ganz ungeheuer. Wilhelm von Gleichen, der die erste ausführliche Monographie der Stubenfliege geschrieben hat, berechnet die mögliche Gesamtzahl der Nachkommenschaft eines einzigen Weibchens in einem Sommer auf 2 216 420 Stück, und Ledermüller, der eine größere Eianzahl und eine öftere Eiablage annimmt, kommt gar auf die schwindelerregende Zahl von jährlich 2 553 945 525 Abkömmlingen. Selbst Howards bedient sich bei seinen Berechnungen der Millionenziffern und knüpft daran noch allerlei andere Betrachtungen; so hat er auch ausgeklügelt, daß 500 Millionen Fliegen, von denen durchschnittlich 50 auf ein Gramm gehen, ebensoviel wiegen würden, wie ein ausgewachsener Elefant, der auf etwa 10 000 kg zu schätzen ist. Aus der Nachkommenschaft einer Fliegenmutter würde man aber fast 9 Millionen Elefanten zusammensetzen können. Ein solcher Dickhäuter benötigt einen Standraum von ungefähr 15 Quadratfuß, und auf einer englischen Quadratmeile hätten demnach 122 200 Elefanten Platz; die 9 Millionen Fliegenelefanten würden demnach einen Standraum von annähernd 10 Millionen englischer Quadratmeilen beanspruchen, das ist jedoch ungefähr doppelt so viel, wie die gesamte Erdoberfläche ausmacht. Mit anderen Worten, mit der Sommernachkommenschaft einer einzigen Fliegenmutter ließe sich unsere ganze Erde mit einer doppelten Schicht von Fliegen bedecken. Das sind natürlich Zahlenreihen, die in Wirklichkeit niemals auch nur annähernd stimmen können. Dafür sorgt, abgesehen von dem Mangel an genügenden Nährstoffen, schon das große Heer der Fliegenfeinde, also vor allem die Singvögel, Raubinsekten verschiedenster Art usw., und außerdem ist nicht zu vergessen, daß unzählige Maden und Puppen infolge ungünstiger Einflüsse überhaupt nicht zur Entwicklung, kommen, denn sonst hätten die Fliegen ja längst die Herrschaft auf dem Erdball errungen und das Menschengeschlecht verdrängt. Merken wir uns deshalb bei der Fortpflanzung der Fliege nur folgendes: Nur einmal genießt das Weibchen flüchtige Hochzeitsfreuden, aber schon drei Tage später zeitigt sie 70 90 millimetergroße, gestreckt kegelförmige, perlmutterweiße Eierchen, die häufchenweise in irgendeinem Schmutzwinkel, am liebsten auf Dung, abgesetzt werden. Da der Hinterleib der Mutterfliege ziemlich schmal zugespitzt ist, vermag sie die Eier ziemlich tief in Spalten zu versenken, wo sie gegen Austrocknung und gegen die schädlichen Einflüsse des Lichtes besser geschützt sind. Dieser Vorgang wiederholt sich 4 6mal, worauf die alte Mutterfliege den Weg alles Fleisches geht. Bei manchen Fliegenarten vollführen die Männchen nach Mückenart einen besonderen Hochzeitsreigen, so Hamalomya manicata, die etwas kleiner als die Stubenfliege ist, aber gleichfalls in Häusern und Gärten lebt. In großer Gesellschaft werden hier die seltsamen Tänze unter der Stubendecke oder auch unter Baumgruppen im Wald aufgeführt. Schon nach 6 24 Stunden, je nach den Wärmeverhältnissen, entschlüpfen den Fliegeneiern die gewöhnlich Maden benannten Larven (Abb. 27), gelblichweiße, schwerfällige Geschöpfe, die zwar keine Augen haben, aber trotzdem sehr lichtscheu sind, weil offenbar ihre ganze Hautoberfläche lichtempfindlich ist. Sie besitzen ein besonderes Nervensystem und Atmungsorgane, aber keine deutlich abgesonderten Köpfe.
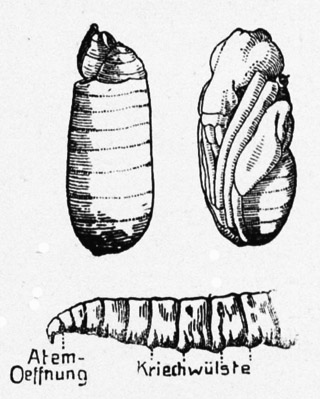
Abb 27. Larve der Stubenfliege. (Natürliche Größe 9 mm.) Oben Puppe der Stubenfliege. (Puppengehäuse und Tonne ohne Hülle.)
An dem etwa 9 mm lang werdenden Tierchen entspricht nicht etwa das dicke Körperende dem Kopfe, wie man zunächst meinen möchte, sondern im Gegenteil das spitzige; bei genauer Betrachtung mit der Lupe können wir an diesem spitzen Ende schwarze, Nagehaken, die zur Aufnahme der Nahrung dienen, erkennen und außerdem zwei schwärzliche Punkte, die aber nicht etwa die Augen darstellen, sondern die Atemlöcher. Die Fliegenmaden haben keine Beine, sondern nur auf der Unterseite Kriechwülste, mit denen sie sich schwerfällig fortbewegen. Trotz ihrer primitiven Organisation sind sie äußerst zähe und widerstandsfähige Geschöpfe und besitzen eine geradezu unverwüstliche Lebenskraft. Man kann sie 7 8 Stunden lang in Öl oder Alkohol halten; herausgenommen kriechen sie munter wieder fort. Man kann ihnen die Luftlöcher verkleben, sie machen sich nichts daraus. Nach 10 14 Tagen verwandeln sich die Maden in längliche, eirunde, dunkelrotbraune Tännchenpuppen, die schon nach 3 4 Tagen die fertige Fliege liefern können.
Zunächst ist an der Puppe (Abb. 27) irgendwelche Gliederung überhaupt nicht zu erkennen, und ihr ganzes Inneres besteht aus einer Masse, die wie geronnene dicke Milch aussieht. Es hat also eine Auflösung der Organe stattgefunden wie im Vogelei, eine Histiolyse, wie die Wissenschaft sagt, aber bald macht sich die neue Gliederung des Tieres geltend, und kurz vor dem Ausschlüpfen sind alle Körperteile der Fliege schon deutlich zu erkennen.
So eklig ein Gewimmel von Fliegenmaden in faulendem oder stinkendem Fleisch unserem Gefühl nach sich ausnimmt, so muß der Naturforscher bei näherer Betrachtung sich doch sagen, daß diese Maden im Gegensatz zu den erwachsenen Fliegen recht nützliche Geschöpfe sind, denn sie vertilgen viel faulende Stoffe, spielen also in der Natur die Rolle der Sanitätspolizei, gegen deren Vorschriften sich dann die erwachsenen Fliegen so arg versündigen. Diese sind bereits l4 Tage nach dem verlassen der Puppenhüllen wieder fortpflanzungsfähig und mögen ein Durchschnittsalter von 8 10 Wochen erreichen, hauptsächlich fällt die Fortpflanzung in die Monate Mai bis Oktober. Der alte Linné hatte gar nicht so unrecht, wenn er meinte, daß die Nachkommenschaft von drei Fliegen während ihrer Madenzeit ebenso rasch mit einem Pferdekadaver fertig werde, wie ein Löwe. Die im Herbst zuletzt befruchteten Weibchen lagern ihre Eier nicht gleich ab, sondern der männliche Zeugungsstoff behält in ihrem Körper seine befruchtende Kraft den Winter über und bringt die Eier erst dann zur Entwicklung, wenn die Frühjahrssonne wieder scheint: ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig gerade das wegfangen solcher Winterfliegen ist, die man törichterweise im Zimmer oft schont, weil sie uns gewissermaßen wie ein freundlicher Gruß der geschiedenen schönen Jahreszeit erscheinen wollen. Auch durch Wanderung und Verschleppung vermögen die Fliegen ihre Verbreitung noch ständig weiter auszudehnen. So hat der Naturforscher Perier festgestellt, daß während des gegenwärtigen Weltkriegs Paris um eine neue Fliegenart bereichert wurde, die weit dicker als die gewöhnliche Stubenfliege, aber doch kleiner als die blaue Schmeißfliege ist. Der Fremdling ist schon zahlreich aufgetreten und scheint sogar die Stubenfliegen zu verdrängen. Genaue Untersuchungen ergaben, daß es sich um eine im äußersten Norden Amerikas heimische Calliphoraart handelt, die wahrscheinlich dadurch nach Paris verschleppt wurde, daß man in Kanada für Kriegszwecke zahlreiche Pferde aufgekauft und nach Paris befördert hatte, wo sie lange auf den dortigen Bahnhöfen untergebracht waren, ehe sie an die einzelnen Truppenkörper verteilt wurden.
Musca domestica ist keineswegs die einzige Art aus der formenreichen Fliegenfamilie, die unsere Häuslichkeit als mehr oder minder unerwünschte Mitbewohner beherbergt, wenn sie auch den weitaus größten Prozentsatz darstellt. Hier sei nur noch kurz die durch ihre weiche Körperbeschaffenheit ausgezeichnete kleine Essigfliege erwähnt, die wissenschaftlich den poetischen Namen Drosophila = Taufreundin führt, ihn aber recht wenig verdient, da sie sich um Tau durchaus nicht kümmert, um so mehr aber eine ausgesprochene Neigung für faulende Pflaumen u. dgl. bekundet. Ihre Maden leben denn auch in solchen Früchten und mit besonderer Vorliebe im Essig. Bekannter ist die Käsefliege ( Piophila caesi). Ihre Larven wissen als muntere Käsemädchen alten Käse in wimmelnde Bewegung zu versetzen. In des Lebens Mai stellen diese Maden sich in eigenartiger Weise auf den Kopf, krümmen den Körper zu einem Kreis zusammen und können sich nun erstaunlich weit fortschnellen. Sie sind übrigens nicht auf Käse beschränkt, sondern finden sich auch im Schinken, ja gelegentlich selbst im Kochsalz und im Menschenkot. Die Fliege ist glänzend schwarz und hat gelbrote Beine.
Die großen, dicken Fliegen mit dem stahlblau schimmernden Hinterleib, die so gewaltig zu brummen verstehen und mit erstaunlicher Hartnäckigkeit immer wieder und wieder gegen die Fensterscheiben anprallen, sind Schmeißfliegen ( Calliphora vomitoria), vom Volk gewöhnlich Brummer genannt. Sie kommen nur dann in die menschlichen Behausungen, wenn sie ihre Eier ablegen wollen, und treiben sich sonst lieber draußen im Garten herum, wo sie auf den Blumenbeeten Hochzeit feiern und von den zuckersüßen Blütenausschwitzungen nippen. Um den Menschen selbst kümmern sie sich unter gewöhnlichen Umständen wenig, wohl aber sind sie in hohem Grade erpicht auf seine Fleischvorräte, deren Vorhandensein ihnen ihr scharfes Geruchsvermögen schon aus erstaunlich großer Entfernung verrät. Sie suchen Fleisch, um an ihm ihre Eier abzulegen, damit dann die Larven von dem faulenden Fleisch sich nähren können. Bei Kadavern aller Art sind sie in der Regel die ersten Lebewesen, die erscheinen, und sie spielen als Sanitätspolizei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Fleischsorte selbst ist ihnen ganz gleichgültig; sie gehen ebenso gern an einen toten Singvogel, wie an ein Kamel, an einen Ochsen, wie an einen Weißfisch. Das Weibchen sucht sich zur Eiablage immer die weichste und geschützteste Stelle des Kadavers aus und bevorzugt besonders die Umgebung der Augen und des Maules oder Schnabels oder etwa vorhandene Schußwunden, während Stellen, wo die Haut dick ist, verschmäht werden. Nach Fabres versuchen lassen sich Fleischvorräte durch Papierumhüllung sehr gut gegen die gierigen Fliegen schützen. Mit ihren langen Legeröhren, die sie wie ein Fernrohr auseinanderschieben, vermögen sie in den feinsten Spalt einzudringen und setzen hier ihre 300 Eier ab, die etwas gekrümmt sind, wie Gurken. Die schon nach wenigen Stunden ausschlüpfenden Maden sind nackt, weiß, kegelförmig, haben lederartige Haut und Luftlochträger mit je drei Löchern, die wie blaßgelbe Wärzchen aussehen. Der ausstülpbare After ist mit zwei Fleischfortsätzen versehen. Auch diese Maden besitzen schon den scharfen Geruchssinn ihrer Mutter, denn wenn sie nicht unmittelbar am was abgesetzt wurden, sondern nur in dessen Umgebung, so wissen sie doch ihre Nährquelle alsbald zu finden und scheuen auch nicht davor zurück, sich dabei aus ziemlicher Höhe herabfallen zu lassen, was ihnen bei ihrer elastischen Leibesbeschaffenheit nicht im geringsten schadet. Einen so ekelhaften Anblick ein von Fliegenmaden wimmelnder Kadaver auch bietet, so vollzieht sich hier doch ein natürlicher Auflösungsvorgang, der nur im Interesse der lebenden Geschöpfe gelegen ist. Schon im Altertum erkannte der Mensch die Bedeutung dieser merkwürdigen Tiere, aber das naturgeschichtlich so schlecht unterrichtete Mittelalter bezeichnete sie als »Leichenwürmer« und nahm an, daß sie ganz von selbst entstünden. So gierig fressen diese kleinen Larven, daß sie schon am zweiten Tage die doppelte Körpergröße erreichen und innerhalb 24 Stunden um das 200-fache an Gewicht zunehmen. Auch findet im Larvenstadium eine weitere Entwicklung der Mundteile und der Atmungsorgane statt. Besonders Kennzeichnend für diese Maden ist es, daß sie mit Speicheldrüsen versehen sind, deren Sekret offenbar und wohl mit Nachhilfe der Fäulnisbakterien die Zerfetzung des Fleisches beschleunigt. Das ist auch notwendig, denn die aus zwei gekrümmten Stäbchen mit hakenförmigen Enden bestehenden Mundteile wären gar nicht zur Aufnahme fester Nahrungsstoffe geeignet, sondern das Fleisch muß erst verflüssigt und in einen breiartigen Zustand versetzt werden. Es findet also gewissermaßen eine Art Vorverdauung der Nährstoffe schon außerhalb des Tierkörpers statt. Die Made spuckt auf ihre Nahrung, wie Fabre sich drastisch ausdrückt, und verwandelt das Fleisch in eine Art Kraftbrühe oder Liebigs Fleischextrakt, um es so bequem zu sich nehmen zu können. Genaue Untersuchungen haben gezeigt, daß das Speichelsekret mit dem Pepsin verwandt ist, aber noch stärker wirkt. Ist die Made ausgewachsen, so bohrt sie sich durch die Haut des Kadavers, der von anderen Aasfressern dann vollends vertilgt wird, nach außen, läßt sich herabfallen und gräbt sich bis zu 5 cm Tiefe in die Erde ein, wo die Verpuppung und Überwinterung erfolgt. Die fetten Maden bilden übrigens ein ausgezeichnetes Vogel- und Hühnerfutter, und ich kann deshalb zu ihrer leicht zu bewerkstelligenden Zucht nur raten, zumal diese bei geeigneten Vorkehrungen im Freien keineswegs so unappetitlich ist, wie man vielleicht meinen könnte. Die Schmeißfliege wäre also an und für sich dem Menschen eher nützlich als schädlich, zumal man ja seine Fleischvorräte leicht vor ihr schützen kann, wenn sie nicht noch die ekelhafte Gewohnheit hätte, bisweilen auch lebende Geschöpfe anzugehen, die sich infolge Erschöpfung nicht gegen sie wehren können. So schildert Brehm einen entsetzlichen Fall, wo ein armer Teufel erbetteltes Fleisch unter seinem Hemd geborgen hatte, dann in Ohnmacht gefallen war, während die Schmeißfliegen das Fleisch mit ihren Eiern bedacht hatten, worauf die auskriechenden Maden von dem toten Fleisch auf das lebende übersiedelten und dem Unglücklichen die ganze Brust zerfraßen, so daß er eines qualvollen Todes sterben mußte. Weiter sind Fälle bekannt geworden, wo Schmeißfliegen ihre Eier an Ohr- oder Nasengeschwüre ablegten und die Larven dann zum Hirn emporstiegen, oder wo sie in den Augenwinkeln lebten und dann Erblindung herbeiführten. Wenn es sich dabei auch immer nur um seltene Ausnahmefälle handelt, so scheint nach dem Gesagten doch auch der Schmeißfliege gegenüber eine gewisse Vorsicht geboten, und namentlich schlafende Kinder sollte man sorgsam vor ihr hüten.
Eine ähnliche Lebensweise führt die Fleischfliege ( Sarcophaga carnaria), obgleich sie trotz ihres Namens weniger auf Fleisch angewiesen ist, sondern sich gern mit verwesenden tierischen und pflanzlichen Stoffen aller Art begnügt. Sie ist etwas größer als die Stubenfliege und kenntlich an der schwarzgelben Würfelzeichnung auf dem Hinterleib. Ihre Fortpflanzung ist insofern interessant, als sie keine Eier legt, sondern lebende Maden gebärt, deren jedes Weibchen an 20 000 in seinem Leibe birgt, aber wohl etwa nur 8 000 wirklich absetzt. Während unsere Fleischfliegenart ziemlich harmloser Natur ist, lebt in Rußland eine größere Form, die Sarcophaga magnifica, die ihre Maden an geschwürigen Stellen bei dem Weidevieh und nicht selten auch beim Menschen absetzt. Namentlich in Südrußland gehen viele Pferde durch diese Fliege zugrunde, vor deren Einschleppung wir uns hüten müssen. Die Larven zerstören in dem eiternden Gewebe die Weichteile bis auf die Knochen und verursachen dadurch unerträgliche Schmerzen. Es steht fest, daß bei Rindern Todesfälle infolge dieser Fliegen eingetreten sind. Als noch gefährlicher gilt die amerikanische Lucili macellaria, die mit Vorliebe solche Personen befällt, die mit einem eitrigen Nasenkatarrh behaftet sind.

Abb. 28 Schlammfliege
Ganz harmlos, aber dafür zoologisch interessant, ist die Schlammfliege ( Eristalis tenax; Abb. 28), denn ihre walzenförmigen, milchweißen Larven leben in Jauche und zeichnen sich durch den Besitz eines langen Schwanzes aus, weshalb sie vom Volk auch »Rattenschwänze« genannt werden. Die Eier werden von den Fliegen in Häufchen von 30 50 am Rand der Jauchegruben abgelegt und entlassen schon nach wenigen Stunden die Larven, die sich durch gleichmäßiges vorwärtsschieben der beborsteten Beinpaare bedächtig in das übelduftende, aber nährkräftige Bad begeben. Durch ihr Wühlen und Fressen tragen sie zur Auflösung der festen Teile und zur weiteren Verflüssigung der Jauche bei. Ihr Kopf erinnert an die Sturmhaube eines Ritters, die Haut ist von pergamentartiger Beschaffenheit und der Schwanz in Wirklichkeit eine doppelte Atemröhre, allerdings kann er auch als Greif- oder Wickelschwanz benutzt werden und ist außerdem der Sitz eines recht empfindlichen Gefühlsorgans, also ein überaus vielseitiges und für das Tier sehr wichtiges Instrument. Wollen sich die Rattenschwänze verpuppen, so verlassen sie das flüssige Element und nehmen ein Luftbad, indem sie gegen den Wind zu laufen, da sie offenbar erst trocken hinter den Ohren werden wollen, ehe sie die Würde einer Puppe erreichen. Während dieser Landwanderung treten an ihrem Körper allmählich schon die Veränderungen ein, die das Puppenstadium darstellen. Die Körperhülle wird zäh und pappeartig, und nur der Schwanz bleibt feucht und weich. Oft werden solche wandernde Rattenschwänze von Ameisen überfallen, die sehr hinter diesen fetten Bissen her sind und sich in der weichen Nackenhaut der Larven einbeißen, nachdem sie sie durch Zusammenkneifen des Schwanzes gezwungen haben, sich auszurecken. Unzählige Larven fallen so ihren Peinigern zum Opfer, und nur wenige können sich durch die Flucht in die Jauchegrube oder durch Wälzen von ihren Quälgeistern befreien; sonst müßte es bei der starken Vermehrungsfähigkeit dieser Tiere auch ungleich mehr Schlammfliegen geben. Die frische, aus der Puppe geschlüpfte Fliege erinnert in ihrer Gestalt und Färbung an eine Drohne und hat zunächst sehr schwache Beinchen und gebrauchsunfähige Flügel, so daß sie erst ein paar Stunden ausruhen und sich kräftigen muß, bis sie den ersten Flug in die weite Welt wagen kann. Dieser Flug ist stoßweise und gewöhnlich schräg nach aufwärts gerichtet. Das Insekt summt und surrt fröhlich im Sonnenschein hin und her, besucht Blüten, saugt Honig und steigt dann beim Hochzeitsflug hoch in die Lüfte empor, um schließlich nach genossenen Liebesfreuden matt und müde wieder zur Erde herabzutaumeln. Viele werden dabei von den Vögeln weggeschnappt, während die Kreuzspinnen merkwürdigerweise die Schlammfliegen verschmähen und sogar angewidert ihr Netz verlassen sollen, wenn sich eine solche Fliege darin gefangen hat. Es ist ein eigentümliches Gefühl, wenn man sieht, wie diese feingegliederten Tierchen mit dem farbenschimmernden Körper und den glasigen Flügeln, die aussehen, als wären sie in Samt und Seide gekleidet, ihre anmutigen, schwebenden Tänze im Sonnenschein über duftenden Blumen vollführen, und sich dann anderseits vergegenwärtigt, daß sie aus der stinkenden Jauchegrube entstammen, wo ihre häßlichen Larven als zur Individualität erhobenen Eingeweidesäcke gelebt und trotz aller Possierlichkeit doch eigentlich nur einen Freßzellenkomplex dargestellt hatten. So wunderbar arbeitet die Natur: aus dem Ekelhaftesten und Häßlichsten versteht sie das Poetischste und Schönste hervorzuzaubern.
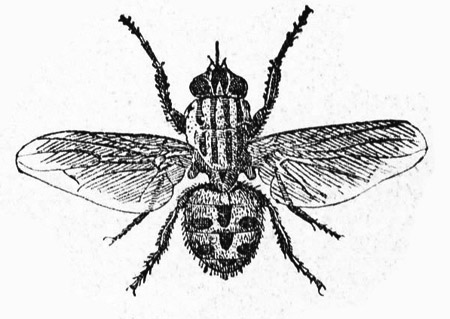
Abb. 29. Wadenstecher (nach L. O. Howard)
Wir haben oben gesehen, daß die Stubenfliegen nicht zu stechen vermögen, weil ihr Rüssel lediglich zum Lecken und Saugen eingerichtet ist. Ja, wird da mancher Leser einwenden, ich weiß aber doch ganz genau, daß ich schon oft von Fliegen gestochen worden bin, noch dazu recht empfindlich. Ganz richtig, aber dann handelt es sich eben nicht um die Stubenfliege, sondern um eine gleichfalls in der menschlichen Häuslichkeit wohnende, glücklicherweise seltener auftretende Art von grauer Färbung mit geflecktem Hinterleib, die den bezeichnenden Namen Wadenstecher ( Stomoxys calcitrans, Abb. 29) führt. Sie ist auf den ersten Blick zu erkennen, da der Rüssel nicht senkrecht nach unten geschlagen, sondern wagrecht aus dem Kopfe hervorgestreckt wird und spitz zuläuft. Dieser Rüssel ist nicht zum Saugen, sondern zum Stechen eingerichtet, und namentlich bei schwülem Wetter sind diese Stiche ziemlich schmerzhaft. Die kegelförmigen, milchweißen Larven dieser Fliegen leben im Pferdemist und sind gestreckter, nicht so eckig und uneben, wie die der Stubenfliege, ihr Umriß mehr geradlinig. Namentlich frisch abgesetzter Pferdedung lockt mit seinem verführerischen Geruch diese Fliege unwiderstehlich zur Eiablage an, woraus zu folgern ist, daß man den frischen Pferdedung für sie unzugänglich machen sollte, um sich vor dieser Stechfliege zu schützen. In 25 Gramm Dung fand Howards 160 Larven und 146 Puppen, was also einer Menge von 2400 Fliegen auf das Kilo Dung entspricht. Kuhdung liebt die Stechfliege viel weniger, aber im Notfall begnügt sie sich damit; da, wo wenig Vieh gehalten wird, auch mit gärenden vegetabilischen Abfällen, weshalb sie sich namentlich in der Nähe von Brauereien und Brennereien finden läßt, schließlich auch mit dem verfaulenden Haufen ausgejäteten Unkrauts im Garten. Glücklicherweise ist die Vermehrungsfähigkeit dieser Fliege beschränkter und ihre Entwicklung langsamer als bei der Stubenfliege, allein die Puppenruhe dauert 4 6 Wochen. Wie man nach den gemachten Angaben leicht verstehen wird, hat die Stechfliege eine besondere Vorliebe für die Droschkenhalteplätze. Wenn sie im Zimmer an den Wänden sitzt, ist sie auch ohne nähere Betrachtung leicht von der Stubenfliege zu unterscheiden, denn während diese gewöhnlich den Kopf nach unten gerichtet hat, hält ihn der Wadenstecher nach aufwärts. Die südrussischen Bauern schlagen deshalb, ehe sie sich zu Bette begeben, alle mit aufwärts gerichtetem Kopf an den Wänden sitzenden Fliegen tot, während sie sich um die übrigen nicht kümmern. Die nah verwandte Hornfliege ( Haematobia serrata, Abb. 30) aus Nordamerika pflegt in dicken, schwarzen Massen zu Tausenden an den unteren Teilen des Horns der Rinder zu sitzen, weil sie dort das gequälte Tier nicht wegscheuchen kann, und sie von hier aus ihre blutsaugerischen Ausflüge nach den mit weicher Haut versehenen Körperteilen ungestört unternehmen können. Diese boshaften Fliegen zapfen dem geplagten Vieh so viel Blut ab, daß der Milchertrag auf mehr als die Hälfte heruntergeht und auch der Fleischansatz stark geschädigt wird. Angeblich soll das Tier aus den Mittelmeerländern stammen und erst als ein Danaergeschenk Europas nach Nordamerika verschleppt worden sein, wo es sich infolge besonders günstiger Daseinsbedingungen ins Unendliche vermehrt hat.

Abb. 30. Kuhhorn mit zahlreichen Hornfliegen.
Eine noch gefährlichere Fliege aus der Gruppe der Stechfliegen ist die afrikanische Tse-Tse-Fliege, von der wir bis jetzt acht Arten kennen. Ihre Verbreitung erstreckt sich von Südafrika bis zum Kongobecken, Marusee, Tanganjika und Sumaliland; im größten Teil des Sudans ist die Fliege für gewöhnlich nicht vorhanden, aber zur Zeit des englischen Sudanzuges hat sie doch unter den Pferden und Rindern große Verheerungen angerichtet. Eine Art tritt sogar im Nilbecken auf, wo die Schlafkrankheit in manchen Gegenden schon reißende Fortschritte gemacht hat. In Togo ist die Fliege selten und kommt nur im Hinterland während der Regenzeit vor. Die höheren Regionen des Kamerungebiets sind von ihr frei, nicht aber die Küstengebiete. Südlich vom Kilimandscharo gibt es keine Tse-Tse-Fliegen. Sehr stark herrscht dagegen die Schlafkrankheit im Kongogebiet, und am Viktoriasee, wohin die Fliege wahrscheinlich vom Kongo eingeschleppt worden war, wurde der erste Fall im April 1901 festgestellt. Merkwürdig ist überhaupt die scharfe Abgrenzung der Wohngebiete, die man deshalb als Fliegengürtel bezeichnet. Schattige Ebenen, Waldland und Buschlandschaften scheinen die Fliegen besonders aufzusuchen, während sie hohe Gebirge und die unmittelbare Nachbarschaft des Meeres meiden.
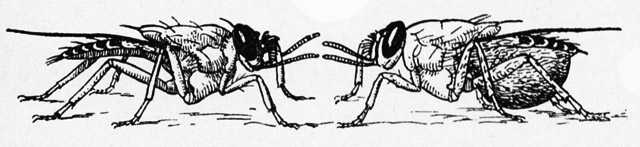
Abb. 31. Tse-Tse-Fliege in hungrigem und vollgesogenem Zustande.
Der Stich von Glossina morsitans (Abb. 31) schadet Menschen, dem Wild, Ziegen, Eseln, säugenden Kälbern und Schweinen weniger, ist dagegen für alle anderen Haustiere verhängnisvoll und bedeutet in der Regenzeit meist den sicheren Tod, da alle Tse-Tse-Fliegen Trypanosomen übertragen. Eigentlich ist die Tse-Tse-Fliege, die nicht größer ist als eine Stubenfliege, mit ihrem schlanken Bau, ihrer anmutigen Zeichnung und den gelblichweißen Beinen ein recht hübsches Insekt, aber zugleich eines der unheimlichsten und gefährlichsten, das den Erdteil bewohnt. Dies gilt namentlich von Glossina palpalis, die die Schlafkrankheit, diese furchtbare Geißel Afrikas, überträgt und dadurch schon ganze Gegenden entvölkert hat. In ihrer Fortpflanzung weicht die Tse-Tse-Fliege sehr von anderen Fliegen ab, denn sie legt weder Eier, noch gebiert sie zahlreiche kleine Larven, sondern bringt nur eine einzige, schon sehr weit entwickelte Larve zur Welt, die fast ebenso groß ist, wie das Muttertier und keine Nahrung mehr zu sich nimmt, sondern alsbald in die Erde sich verkriecht und sich hier schon nach 1½ Stunden in eine Puppe verwandelt, die 1 2 Monate zum Ausschlüpfen benötigt. Mit Vorliebe werden die Larven an den Wurzelstrünken der Bananen abgesetzt, und alle 10 22 Tage wiederholt sich dieser Vorgang. Besondere Milchdrüsen im Körper des Muttertieres sorgen für die Ernährung der heranwachsenden Larve. In der Regel fällt die hauptsächlichste Fortpflanzungszeit mit der Regenperiode des betreffenden Landstriches zusammen. Die Tse-Tse-Fliegen verfolgen ihre Opfer mit hartnäckiger Ausdauer oft weite Strecken, bis sie endlich Gelegenheit zum Stechen finden, und zwar tun dies nicht nur die Weibchen, sondern auch die Männchen. Erleichtert wird ihnen ihr Handwerk durch ihren lautlosen, nicht summenden Flug, so daß man die Gegenwart der Fliege in der Regel erst gewahr wird, wenn sie schon ihren Stechrüssel durch die Haut einsenkt. Die nächste Folge des Stiches ist eine stark juckende Pustel. Die Fliege saugt derartig kräftig, daß sie in 2 3 Minuten das Doppelte ihres Eigengewichts an Blut zu sich nehmen kann (Abb. 31), und alle 4 5 Tage bedarf sie neuer Nahrungsaufnahme. In Beziehung auf ihre Opfer ist sie nicht sehr wählerisch, saugt sogar an Fischen und Krokodilen, und gerade von diesen aus soll sie besonders gefährliche Krankheitskeime übertragen. Das blutzersetzende Kleinlebewesen, das durch die Stiche der Tse-Tse-Fliege übertragen wird und die Schlafkrankheit erzeugt, heißt Trypanosoma gambiense, gehört zur Familie der Geißeltierchen und wurde 1902 durch Dutton entdeckt. Die Krankheit selbst, die schon ganze Ortschaften und Landstriche entvölkert hat, ist zwar bereits seit 1800 bekannt, aber man tappte bis in die neueste Zeit über ihre Entwicklung vollständig im Dunkeln, und erst die bahnbrechenden Forschungen Kochs haben vollständige Aufklärung geschaffen, während die Naturgeschichte der Tse-Tse-Fliege selbst namentlich durch Stuhlmann eingehend erforscht wurde. Die Krankheit nimmt in der Regel einen chronischen Verlauf, und es lassen sich dabei ziemlich scharf drei Stadien unterscheiden. Zunächst einmal ein Fieberstadium, darauf das Stadium der Nervenstörungen mit Zuckungen und Lähmungserscheinungen und endlich das Endstadium mit unüberwindlicher Schlafsucht (Abb. 32), rasch fortschreitendem Kräfteverfall und schließlicher Verblödung, bis der Tod den Kranken von seinem traurigen Schicksal erlöst. Von Europäern sind namentlich die Frauen gefährdet, da deren Beine nicht genügend gegen die Stiche der Fliegen geschützt sind, während die Männer ja gewöhnlich in den Tropen Ledergamaschen tragen. Die Fliege bevorzugt zum Stechen dunkle Hautstellen, und man behauptet deshalb, daß helle Kleidung einen gewissen Schutz gegen sie gewährt. Fast nie wird man in offenen Steppen und ebensowenig im geschlossenen lichten Urwald gestochen, desto größer aber ist die Gefahr im Buschlande, in Sumpfgegenden und an den Waldrändern. Glücklicherweise bedarf die Larvenentwicklung des furchtbaren Insekts ganz bestimmter Wärme- und Feuchtigkeitsverhältnisse, und daher kommt es, daß die Fliegengürtel oft nur wenige hundert Meter breit sind, die Gefahr also rasch überwunden werden kann, wenn man sie eben überhaupt kennt. Die mit der Larve beschwerten Weibchen sind viel weniger beweglich als die Männchen und anscheinend auch bedeutend vorsichtiger. So kam es, daß Stuhlmann unter 1 200 eingefangenen Tse-Tse-Fliegen nur 90 Weibchen fand, die er weiter züchtete und dabei noch manche interessante Beobachtungen machen konnte. So dauerte der Geburtsakt über eine Viertelstunde, wobei die Tiere mit den Hinterbeinen sich selbst Geburtshelferdienste leisteten. Das wiederholt sich fast das ganze Jahr hindurch alle 10 22 Tage. Ausnahmsweise konnte Stuhlmann feststellen, daß auch solche Weibchen, die nie mit Männchen in Berührung gekommen waren, Larven erzeugten, daß also hier ein Fall von Parthenogenesis (Jungfernzeugung) vorlag, wie er bei so hochentwickelten Insekten immerhin selten ist. Während der Mittagsstunden sind die Tse-Tse-Fliegen faul und träge und wenig zum Stechen aufgelegt. Der Stich schmerzt etwa wie der einer feinen Nadel, und es bleibt dann ein winziges rotes Pünktchen zurück, das in den nächstfolgenden Tagen etwas juckt und anschwillt. Während des Kriegsjahres 1915 waren im Pariser Insekten-Salon auch lebende Tse-Tse-Fliegen ausgestellt, und hierdurch fanden weitere Kreise Gelegenheit, diesen unheimlichen Zweiflügler lebend vor sich zu sehen.

Abb. 32. Schlafkranker Knabe, zwei Tage vor dem Tode. Nach Bruce.
Ein schöner lauer Sommerabend. Wir stehen am Waldrande und warten auf den austretenden roten Rehbock. Gespannt blickt unser Auge nach dem dunklen Waldessaum, aus dem der sehnlichst erhoffte Kapitale heraustreten muß. Da heißt es hübsch still sein, um den scheuen Bock nicht vorzeitig zu vergrämen. Aber es wird uns schwer gemacht, denn von allen Seiten summt's um uns herum. Mit unheilverkündendem feinem Gesang stürzen blutgierige Mücken auf uns los. Die Zigarre, die sie wenigstens bis zu einem gewissen Grade abhalten würde, dürfen wir nicht anzünden, denn der Wind steht schlecht. Endlich zeigt sich drüben, zwischen den dunklen Tannen der Schonung, etwas Rotes, und schon heben wir die Flinte, als einer der Blutsauger gerade unserer Hand einen empfindlich schmerzenden Stich versetzt. Wir können uns nicht länger bezwingen, schlagen nach dem Quälgeist, aber in diesem Augenblick dröhnt's schon: »Bö, Bö, Bö,« denn der im Austreten begriffene Bock hat unsere unvorsichtige Handbewegung gesehen, und für diesesmal ist es mit dem Anstand nichts. Mißgestimmt wenden wir uns zum Heimgehen. Es ist doch wirklich zu ärgerlich, wie ein solch winziges Insekt uns die schönsten Pläne verderben kann, aber unser Ärger schwindet, wenn wir daran denken, wieviel mehr in anderen Gegenden die Menschen durch die Stechmücken leiden müssen, wo ihnen nicht bloß ein Jagdvergnügen durch sie gestört, sondern oft das ganze Dasein durch sie verbittert wird. Schon in manchen Teilen unseres Vaterlandes können wir die Erfahrung machen, daß es für den Menschen kaum möglich ist, seiner Beschäftigung nachzugehen, wenn die Stechmücken überhand genommen haben. So sind gewisse Rheininseln der Stechmücken wegen fast unbewohnbar, und auch die schönen Donauauen bei Wien liegen im Sommer verödet da, weil die Schnaken jeden Spaziergänger in die Flucht schlagen. Selbst Malariafälle häufen sich dort in erschreckendem Maße, denn die Stechmücken können ja durch ihren Stich diese Krankheit übertragen. Viel schlimmer aber ist die Mückenplage in heißen Ländern, und die Moskitos spielen dort eine höchst bedeutsame Rolle im Leben und Haushalt des Menschen. Unter Moskitos (das Wort ist portugiesischen Ursprungs und bedeutet soviel wie »kleine Fliege«) ist nicht etwa eine besondere Stechmückenart zu verstehen, sondern es ist nur ein Sammelbegriff für die hierher gehörigen Tierchen überhaupt, also vor allem für die Angehörigen der Gattungen Culex und Anopheles, sowie für die oft noch unheimlicheren Kriebelmücken. Ebenso wird aber auch die Stechmücke in kalten Ländern zur Plage. Die sumpfige Tundra des Nordens erzeugt sie in Milliarden und aber Milliarden, und diese zwingen den Lappen mit seinen Renntierherden zur Flucht und machen jedes Reisen in diesen Gegenden während der Mückenzeit zur Unmöglichkeit.
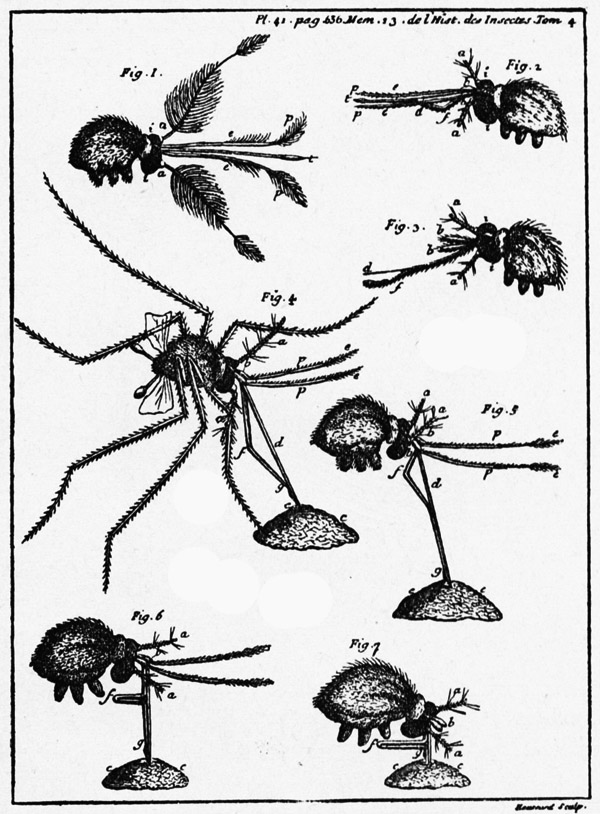
Abb. 33. Moskito-Tafel aus Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. 4. Band. Paris, 1788.
Seit der alte Réaumur seine vortrefflichen und größtenteils heute noch gültigen Beobachtungen über die Stechmücken veröffentlicht hat (Abb. 33), haben wir bis vor einem Vierteljahrhundert eigentlich wenig Neues mehr über diese winzigen und nationalökonomisch doch so hochwichtigen Tierchen erfahren. Das hat sich seit einigen Jahrzehnten nun freilich vollkommen geändert, als einerseits das Interesse für Kolonialbesitzungen allgemein wurde, anderseits die Erkenntnis sich Bahn brach, daß viele der gefährlichsten Tropenkrankheiten durch die Stiche der Mücken übertragen werden, und daß infolgedessen ihre hygienische Bedeutung ganz gewaltig ist. Seitdem ist der Strom der Spezialliteratur über Stechmücken unheimlich angeschwollen, Ströme von Tinte wurden ihretwegen vergossen, und nicht wenige dieser Arbeiten sind auch geradezu mit dem Blute der Forscher selbst geschrieben. Zunächst wurde eine Fülle weiterer Formen aufgefunden. 1905 zählte man bereits 650, und seitdem ist die Zahl nach ganz bedeutend gestiegen.

Abb. 34. Fühler einer deutschen Mückenart ( Culex nemerosus), links Männchen, rechts Weibchen.
Die meisten entstammen den feuchtheißen Niederungen der Tropen, da sie ja zu ihrer Entwicklung Wasser nötig haben, und wenn man früher immer vom Pesthauch der Sümpfe sprach, so handelte es sich dabei in Wirklichkeit um ihren Mückenreichtum. Tatsächlich sind die Moskitos zum Fluch vieler Länder geworden, und man braucht nur den Namen Cayenne auszusprechen, um an eine Hölle auf Erden zu denken. Selbst die olympische Ruhe unseres Goethe ist durch diese Plagegeister erschüttert worden, denn er schimpft nicht wenig über die Schnakenplage an der sonst so lieblichen Saale.
Für unsere Zwecke genügt es, wenn wir als typische Vertreterin der Familie der Stechmücken, die nicht mit den nichtstechenden Bachmücken ( Tipula) verwechselt werden dürfen, unsere gemeine Stechmücke ( Culex pipiens), vom Volk gewöhnlich Schnake oder Gelse genannt, etwas näher betrachten. Es ist ein schlank und zierlich gebautes Tierlein von 6½ mm Körperlänge, langen, leicht ausfallenden Spinnenbeinen und zierlichen, vielgliedrigen Fühlern. Bei näherer Betrachtung mit der Lupe sehen wir, daß Körper und Flügel stellenweise mit feinen Schuppen bekleidet sind, ähnlich wie bei den Köcherfliegen und Schmetterlingen. Die Gestalt dieser Schuppen ist sehr verschiedenartig und sie sind deshalb für die systematische Einteilung und Bestimmung der zahlreichen Stechmückenarten von hohem Wert. Manche Formen lassen sich freilich auch schon mit dem bloßen Auge auf den ersten Blick erkennen, wie z. B. die geringelte Stechmücke ( Culex annulatus), die gleichfalls zu den bei uns häufigsten Arten gehört, an den weißen Ringen auf ihrem Hinterleib. Die Fühler (Abb. 34) sind beim Männchen wirtelförmig mit langen Haaren versehen, und auch die Taster tragen einen mächtigen Haarbusch, was dem Tierchen ein ganz eigenartiges Aussehen gibt, und beide Geschlechter sofort mit Sicherheit erkennen läßt; auch endigt der Hinterleib beim Weibchen viel spitzer, während der mehr zylindrisch gebaute des Männchens in eine Haftzange ausläuft. Das morphologisch interessanteste Gebilde der Stechmücke (Abb. 35) ist wohl der Rüssel, bei dem alle Mundorgane gewaltig in die Länge gezogen sind, so daß er dem Schnabel der Rhynchoten ähnlich wird, und der in seiner Art ein geradezu vollkommenes Sauginstrument darstellt. Der eigentliche Rüssel bildet nur die Hüllscheide für die Stechborsten und besteht aus der rinnenförmig zusammengebogenen Unterlippe, deren oben noch verbleibender Spalt durch die hier eingesetzte Oberlippe vollständig ausgefüllt wird. In dieser Scheide befinden sich fünf stilettartige, an der Spitze auch mit Widerhaken versehene Borsten; vier davon entsprechen den beiden Ober- und Unterkiefern und dienen zum Stechen, während der fünfte ein der Unterlippe ansitzendes Sondergebilde (Hypopharynx) darstellt. Beim Männchen ist der Stechapparat ungleich schwächer entwickelt und kann die menschliche Haut nicht durchbohren. Alle wirklich stechenden Mücken sind also ausnahmslos Weibchen.
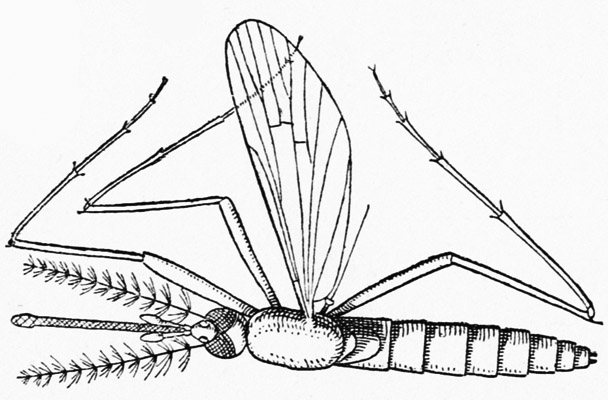
Abb. 35. Schema einer Mücke.
Den Stechakt selbst hat Eysell eingehend beobachtet. Die blutgierige Mücke kommt singend angeflogen und läßt sich an einer entblößten Hautstelle so geschickt nieder, daß kaum ein Gefühlseindruck entsteht und man den Stich nachts meist überhaupt nicht gewahr wird. Leise tastet nun die Mücke mit den Labellen des etwas abwärts gerichteten Rüssels die Haut ab und setzt jene und das zwischen ihnen befindliche Zünglein fest auf die als tauglich befundene Stelle. Jetzt hebt das Tier die Taster und führt mit ihnen zitternde Bewegungen aus. Dann tritt die Oberlippe zwischen den Labellen hervor und drückt sich in die Haut ein (Abb. 36), schnell folgen der Hypopharynx und die vier Stechborsten, die durch sägende Bewegungen die Wunde erweitern, während gleichzeitig ein Zurückweichen des Stechbündels durch die Verankerung der Widerhaken verhindert wird. Die Unterlippe folgt diesen Bewegungen im allgemeinen nicht, sondern entfernt sich bogenförmig und knickt schließlich spitzwinklig ein.

Abb. 36. Längsschnitt durch eine saugende Mücke. (Nach Schaudinn.)
Sind die Borsten genügend tief eingedrungen und auf eine Blutader gestoßen, so preßt die Mücke den Inhalt ihrer Speicheldrüse und ihres Vormagens in die Wunde, um durch die Reizung des Gewebes, die dann den Juckreiz und eine kleine Entzündung erzeugt, ein lebhafteres Zuströmen des Blutes zu bewirken und seine Gerinnung zu verhindern, denn geronnenes Blut würde ja die feinen Saugröhrchen der Mücke rasch verstopfen. Nun beginnt das eigentliche Saugen, das wegen der kräftig entwickelten Muskulatur des Saugapparats sehr rasch und gründlich vor sich geht. Neuere Forscher, wie z. B. Schaudinn, schreiben allerdings die Giftwirkung des Mückenstiches nicht dem Sekret der Speicheldrüse zu, sondern der Kohlensäure aus dem Oesophagus der Mücke, deren Ergießung mit einer Infektion von Hefepilzen aus dem Saugmagen Hand in Hand geht. Praktisch sind diese gelehrten Ausführungen freilich ein schlechter Trost, denn für den armen Gestochenen ist das gehüpft wie gesprungen. Das ausgesogene Blut wird im Oesophagus und im Vorratsmagen flüssig zurückbehalten und erst bei fortschreitender Verdauung nach und nach in den Mitteldarm gepreßt. Im ganzen beansprucht die Verdauung etwa zwei Tage, und hierauf ist die Mücke von neuem wieder stechlustig. Wenn man eine saugende Mücke näher beobachtet, kann man deutlich sehen, wie ihr Leib mächtig anschwillt und sich von dem aufgesogenen Blut rot färbt. Man muß sich aber hüten, sie in diesem Augenblick zu töten, weil dann die Stechborsten abbrechen, in der Wunde zurückbleiben und hier erst recht eine Entzündung verursachen würden. So gierig ist die Mücke im Augenblick des Blutsaugens, daß sie währenddem die ganze Außenwelt zu vergessen scheint, und wenn sie ihren Zweck erreicht hat, taumelt sie in einem förmlichen Blutrausch einher, ähnlich wie wir ihn von den marderartigen Raubtieren kennen. Bisweilen wird ihr diese unersättliche Gier rasch zum Verhängnis. So sah ich einmal, wie eine Mücke sich auf meiner Hand derartig vollsog, daß ihre zarten Magenwände dem Druck nicht standhielten und sie plötzlich zerplatzte, wobei meine ganze Hand mit Blutströpfchen bespritzt wurde. Alle saugen sich so voll, daß sie kaum noch zu fliegen vermögen, sondern das nächstbeste geschützte Plätzchen aufsuchen müssen, um hier das Eintreten der Verdauung abzuwarten. Starkes Rauchen, Nelkenöl und Salmiakgeist sind kleine Mittelchen, die den Spaziergänger oder beim Sitzen im Garten einigermaßen schützen, aber sie versagen schon in wirklich mückenreichen Gegenden unseres Vaterlandes und vollends in außerdeutschen Ländern. Ein alkoholischer Extrakt des bekannten Zacherlins wirkt schon etwas kräftiger, und außerdem vermag auch die Hautausdünstung mancher Menschen die Mücken abzuschrecken. Es gibt tatsächlich Leute, die fast nie gestochen werden. Ich selbst werde von Mücken eigentlich nur gestochen, wenn ich allein bin, und auch dann wenig. Befinde ich mich aber in Gesellschaft anderer, so erhalte ich keinen einzigen Stich, wenn auch meine Gefährten noch so sehr gestochen werden. In Transkaspien, wo man die Verbreitung der Malaria durch die Mücken fürchtet, fand ich bei den Kosakenposten überall hohe Holztürme aufgebaut, die oben eine flache Plattform haben, auf der die Kosaken schlafen, weil, wie man behauptet, die Mücken nicht so hoch fliegen und man deshalb in einer gewissen Höhe vor ihren Stichen sicher sei. Das mag im allgemeinen seine Richtigkeit haben, aber immer stimmt die Sache nicht; so weiß ich, daß Ballonfahrer über den Bodensee in mehr als 1200 m Meereshöhe tüchtig von den Schnaken gepeinigt wurden.
Da die Männchen der Stechmücken nicht Blut saugen, sondern sich mit vegetabilischer Kost begnügen, so gelangte man zu der Auffassung, daß die Weibchen Blut nötig haben, um ihre Eier richtig entwickeln und ablegen zu können. Es ist aber neuerdings im Gegensatz zu dieser Auffassung durch Böhmelt und Neumann festgestellt worden, daß die Stechmücken auch ohne vorheriges Blutmahl befruchtete Eier ablegen können. Neumann konnte monatelang sich Stechmücken halten und Nachzucht von ihnen erzielen, obwohl die Tiere niemals Blut bekamen und lediglich mit einer gekochten Zuckerlösung gefüttert wurden. Immerhin scheint das nur ein Notbehelf und die Blutnahrung der Weibchen das Naturgemäße zu sein. Freilich gibt es auch mückenreiche Gegenden, in denen Warmblütler fast vollständig fehlen, so daß die Mücken hier gar keine Gelegenheit finden, Blut aufzunehmen. Immerhin steht fest, daß bei Mangel von Blutnahrung die Eiablage sich verlangsamt, während bei reichlicher Blutaufnahme viel mehr und rascher entwicklungsfähige Eier abgesetzt werden. Sogar unbefruchtete Weibchen legen taube Eier, wenn man ihnen Gelegenheit zum Blutrausch bot. Schon nach einmaligem Blutsaugen erfolgt mit Sicherheit eine Eiablage, die sich nach 2 3maligem Saugen noch gewaltig steigert. Wenn aber auch der Rüssel der Männchen zum Stechen zu schwach ist, so fallen sie doch dadurch lästig, daß sie sich auf der Haut niederlassen und Schweißtröpfchen aufsaugen. Wahrscheinlich haben die Weibchen ursprünglich auch nichts anderes getan, sind aber dann durch ihre stärkeren Stechwerkzeuge zum Blutsaugen verleitet worden und auf diese Weise nach und nach zu dem Zustand des Halbparasitismus gelangt, in dem sie sich jetzt befinden.
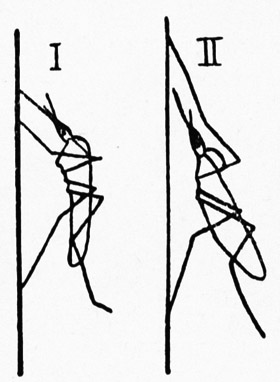
Abb. 37. I. Culex sitzend, II. Anopheles sitzend. Nach Waterhouse.
Die Stechmücken sind, wie gesagt, weit verbreitet und finden sich überall, wo stehende Gewässer, seien es auch solche kleinster Art, ihnen Gelegenheit zum Absetzen ihrer Brut geben; doch meiden sie die Wüsten und vegetationslosen windigen Berge. Ihre Flugkraft ist gering und trägt sie, wie eine Beobachtung in Indien ergeben hat, nicht über 800 m hinaus, so daß die oft zu bemerkende Ausdehnung ihrer Verbreitungsbezirke wohl mehr auf Verschleppung durch Bahnen, Schiffe, Wagen u. dgl. zurückzuführen ist oder darauf, daß ihre leichten Körper durch Luftströmungen wider ihren Willen in entferntere Gegenden entführt wurden. Sie sind Dämmerungstiere, daher lichtscheu und fliehen den Sonnenschein, obschon sie die Wärme sehr lieben. Ihr Gehör ist scharf, der Geruch, der seinen Sitz in den Fühlern hat, sogar vorzüglich, denn sie wittern ihre Opfertiere schon aus ziemlicher Entfernung. Auch der Gefühlssinn in den Tastern ist gut entwickelt, dagegen ist das Gesicht trotz der großen Fazettenaugen herzlich schlecht. Die Mücken können wahrscheinlich nicht weiter als 70 mm sehen und auf diese Entfernung überhaupt nur hell und dunkel, sowie verschwommene Umrisse der Gegenstände unterscheiden. Die zarten langen Beine dienen mehr zum Sitzen als zum Gehen. Wenn Culex ausruhend an einer Wand sitzt, so legt sie den Leib an diese an, während die Anopheles-Arten ihn von der Unterlage ab und schräg in die Höhe heben, wodurch beide Formen auf den ersten Blick leicht zu unterscheiden sind (Abb. 37). Wenn sich stechlustige Mücken uns nähern, so machen sie uns gewöhnlich durch einen singenden Ton auf ihre unwillkommene Erscheinung aufmerksam. Die tieferen Töne dieses einförmigen Mückenliedes werden durch Flügelbewegungen hervorgerufen, die höheren dagegen durch die Luftlöcher im Mittelleib, deren künstlicher Bau verschiedene Tonabstufungen zuläßt, wenn Luft aus der Luftröhre in sie gepreßt wird und die Verschlußmembranen der Atemlöcher dabei als Stimmbänder wirken. Wo Mücken häufig sind, vollführen sie namentlich in feuchten Jahren oft umfangreiche Lufttänze; das sind Hochzeitsreigen. Man kann solche tanzenden Mückenschwärme durch geschickte Nachahmung des weiblichen Singsangs geradezu anlocken, und sie folgen ohnedies gern dem Kopf des Wanderers, wie überhaupt erhöhten Gegenständen. Bisweilen schwellen sie zu Milliarden von Individuen an und bilden dann wandernde Säulen, die lebhaft an Rauchwolken erinnern und schon zu manchem Aberglauben Veranlassung gegeben haben.
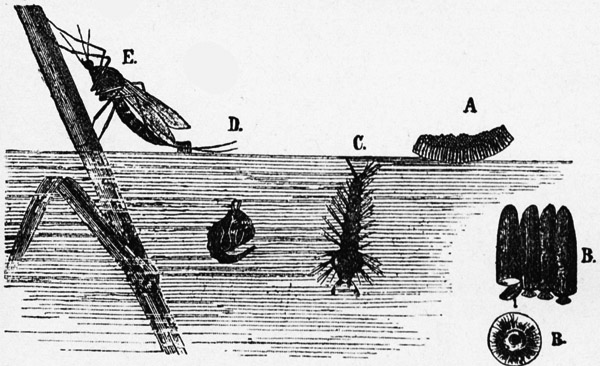
Abb. 38. Entwicklung der Mücke. A Eierpaket. B Einzelne Eier. C Larve. D Puppe. E Mückenweibchen, Eier legend.
In ihrer Fortpflanzung ist die Stechmücke, wie bemerkt, ganz vom Vorhandensein stehenden oder sehr langsam fließenden Wassers abhängig, begnügt sich aber mit den geringfügigsten Ansammlungen, wenn sie auch im allgemeinen Tümpel bevorzugt, deren Boden mit altem Laub bedeckt ist. Im Notfall dienen ihr aber auch Regentonnen, Dachrinnen, leere Konservenbüchsen, in den Tropen die Blattachseln großblättriger Pflanzen, kurz und gut jede Gelegenheit, die imstande ist, Regen- oder Überschwemmungswasser zurückzuhalten. Trocknet das Wasser aus, so setzt die Mücke ihre Eier schließlich auch in den feuchten vertorften Blättern ab, die auf dem Grunde der ausgetrockneten Tümpel liegen. Das alte Mückenweibchen, das in einem Keller oder in einer ähnlichen Örtlichkeit überwintert hatte, fliegt im Frühjahr einer solchen Brutstelle zu und setzt sich so auf ein schwimmendes Blatt, daß es mit der Spitze des Hinterleibs das Wasser zu erreichen vermag, wobei die Hinterbeine X-förmig gekreuzt werden, während sie nach vollendetem Geschäft ausruhend nach aufwärts gestreckt werden. Das Tier legt innerhalb weniger Minuten 200 300 flaschen- oder spindelförmige Eier (Abb. 38), die beim gewöhnlichen Verlauf der Dinge je nach den Temperaturverhältnissen in 2 5 Tagen zum Ausschlüpfen kommen, aber auch zu überwintern imstande sind. Die ganze Entwicklung der Stechmücke nimmt etwa 15 17 Tage in Anspruch, und ebensolange dauert es, bis die ausgeschlüpfte Mücke fortpflanzungsfähig ist, so daß also vom Ei bis zu dem geschlechtsreifen Tierchen etwa 4 5 Wochen vergehen. Die Eierchen bilden zusammen eine schwimmende Schüssel, die je nach der betreffenden Art durch verschiedene Vorrichtungen am Untersinken verhindert wird, wie z. B. durch einen Ölüberzug, durch Luftpolster oder Schwimmglocken u. dgl. Im ganzen entspricht die Form dieses Eierfloßes dem Fragment einer Hohlkugel. Sinken die Eier von Culex pipiens durch einen unglücklichen Zufall doch zu Boden, so kommen sie nicht zur Entwicklung, sondern gehen zugrunde.
Die ausschlüpfenden grauen, zarthäutigen, etwa 7 mm lang werdenden Larven sind vorn am breitesten, haben scharf gesonderte Leibesringe, auf den Körperseiten kleine Borstenbüschel, einen rundlichen Kopf mit zwei Augen und kräftigen, zangenförmigen Kinnbacken, sowie lange mit einer Borstenquaste gekrönte Fühler. Ihr dicker Körper und der breite Brustring verleihen ihnen ein etwas bedrohliches Aussehen, aber in Wirklichkeit sind es ganz harmlose Tiere, die sich nur von verwesenden pflanzlichen Stoffen nähren und diese Nahrung sich herbeistrudeln, wenn sie in der ihnen eigentümlichen Weise senkrecht an der Wasseroberfläche aufgehängt sind. Ihr letzter Körperring trägt nämlich eine borstenbekränzte Atemröhre, die die Tierchen zur Luftaufnahme an die Oberfläche des Wassers emporstrecken, während sie sonst sich lang herabhängen lassen. Oft verweilen sie in dieser Stellung längere Zeit regungslos, ab und zu packen sie sich aber gegenseitig neckisch an den Köpfen oder steigen in Schlangenwindungen zum Boden herab, um sich hier zu entleeren, wobei sie sich auf den Rücken legen, oder um sich bei einer durch die Erschütterung des Wassers angezeigten Gefahr im Schlamm zu verkriechen. Besonders munter zeigen sich die Larven, die übrigens ein ausgezeichnetes Fischfutter vorstellen, bei Sonnenschein und spielen dann oft sehr ergötzlich miteinander. Stehen sie ruhig im Wasser, so mutet ihr durch Klappen verschließbares Atemrohr an wie ein kleiner, zur Wasseroberfläche herausgestreckter Schornstein; tauchen sie dagegen, so wirken die Borstenbüschel auf der Unterseite des Hinterleibes wie die Schrauben eines Dampfers. Trotz ihres zarten Aussehens sind die Larven ziemlich lebenszäh, vermögen sich sogar im Brackwasser durchs Leben zu schlagen, während reines Seewasser sie allerdings tötet. Sie vertragen selbst empfindliche Kälte, nicht aber eine Hitze über 45 Grad. Jede Larve, die das Ei auf der dem Wasser zugekehrten Seite verlassen hatte, hat 3 4 Häutungen durchzumachen und ist in ihrem Wachstum sehr von der Temperatur und von den Ernährungsverhältnissen abhängig. Die knopfig und bucklig geformte, vorn verdickte und auf dem Rücken gleichfalls mit Borstenbüscheln geschmückte Puppe ist auch verhältnismäßig recht beweglich und klappt beim Heruntersinken zum Boden den achtgliedrigen, mit Schwimmplatten versehenen Hinterleib wie einen Krebsschwanz hin und her. Eine Luftblase im Innern der Hülle erleichtert in erwünschter Weise das spezifische Gewicht und befähigt sie, sich gleichfalls mit der Atemröhre an der Oberfläche des Wassers zu halten. Doch ist die Atemröhre bei ihr nicht von der Gestalt eines kleinen Schornsteins, sondern doppelt und mehr keulen- oder trompetenartig geformt. Nach zehn Tagen erhebt sich die Puppe in fragezeichenförmiger Krümmung etwas über die Wasseroberfläche, es sondert sich in ihren Beinlöchern Luft ab, die sich unter der Hülle ansammelt, ihr ein silberglänzendes Aussehen verleiht und sie schließlich durch bei zunehmenden Druck zwischen den Atemröhren zum Aufspringen bringt. Es gewährt einen höchst eigentümlichen Anblick, wenn nun das fertige junge, noch bleiche Insekt scheinbar ohne jede Triebkraft der Puppenhülle entsteigt und die zarten Beinchen eines nach dem andern behutsam aus ihren Futteralen herauszieht. Für viele junge Mücken ist ihre erste Lebensstunde zugleich die letzte, da ein Windstoß genügt, um sie ins Wasser zu werfen, wo sie elend ertrinken müssen. Geht aber alles gut, so braucht das Tier doch erst noch einige Zeit, um gründlich abzutrocknen und die Flügel für den ersten Ausflug in die große Welt zu härten. Wenn auch viele der Tiere zugrunde gehen, so steigen doch noch alljährlich Millionen und aber Millionen junger Schnaken aus unseren Waldtümpeln zum Lichte empor.
Wenn man bedenkt, daß die Lebensdauer der Stechmücken verhältnismäßig lang ist, da sie sich über mehrere Monate erstreckt, daß ein einzelnes Mückenweibchen wenigstens nach theoretischer Berechnung innerhalb eines Jahres 7½ Millionen Nachkommen zu erzeugen vermag, daß durch den Mückenstich leicht Keime gefährlicher Krankheiten übertragen werden können, so erscheint eine planmäßige und unausgesetzte Bekämpfung dieser Plagegeister als eine wirtschaftlich und hygienisch durchaus nicht unwichtige Maßregel. Mit Abwehrmaßregeln des einzelnen ist es aber nicht getan, sondern wenn man nachhaltige Erfolge erzielen will, muß durch Stadt und Gemeinde mit behördlichen Vorschriften und in zweckmäßiger Weise vorgegangen werden. In schnakenreichen Gegenden muß jedermann zum Mückenkrieg aufgeboten werden, und alle sind verpflichtet, ins Feld zu ziehen, mit Scheuerlappen, Besen, Lötlampen, Räucherpulvern u. a. geeigneten Waffen und Werkzeugen. Die Stellungen der kleinen blutgierigen Feinde müssen genommen werden in Kellern, Stallungen u. a. Schlupfwinkeln, und wo man ihnen gar nicht anders beikommen kann, da geht man zum Gasangriff über, der sehr wirksam ist, wenn er manchmal auch den Angreifer beißende Tränen kostet.
In einem solchen Kriege ist die Hilfe tüchtiger Bundesgenossen nicht zu unterschätzen, und an solchen fehlt es glücklicherweise nicht, denn die Zahl der Mückenfeinde ist Legion. Schon die Mückenlarven im Wasser werden eifrig verfolgt von Schwimmkäfern, Libellenlarven, Wasserläufern, Wasserskorpionen, Rückenschwimmern, Schwimmwanzen, Molchen und den verschiedensten Fischen, unter denen sich Elritze und namentlich Stichling hervortun. Die Schonung und Hege, ja gegebenenfalls auch das Aussetzen und die künstliche Verbreitung solcher natürlichen Mückenfeinde ist deshalb die erste Pflicht im Schnakenkrieg. Auch in den Tropen ist an ihnen kein Mangel; so ist die Insel Barbados die einzige malariafreie Insel der kleinen Antillen, und wenn auch Hoddons behauptet, daß dies daran liege, daß auf Barbadas die passenden Bruttümpel zu hoch über dem Meere sich befänden, so hat doch Gibbons nachgewiesen, daß der wirkliche Grund des Fehlens der Malaria auf ein kleines Fischchen ( Girardinus poeciloides) zurückzuführen ist, von dem alle Tümpel der Insel wimmeln, und das wegen seines massenhaften Vorkommens von den Eingeborenen »Millions« genannt wird. Man hat dieses mückenvertilgende Fischchen auch auf Jamaika ausgesetzt und auch dort schon gute Erfolge wahrgenommen. Für unsere Gegenden empfiehlt sich namentlich die Verbreitung des interessanten und farbenschönen Stichlings, der ja leider in Süddeutschland vielfach fehlt. Allerdings wollen die Fischzüchter wenig von ihm wissen, weil er die Nutzfische beeinträchtigen soll, aber es gibt Tümpel und kleine Teiche genug, die für die Fischzucht nicht in Betracht kommen, wo also Stichlinge ohne jeden Nachteil angesiedelt werden könnten. Außer wasserbewohnenden Tieren kommen für die Vertilgung der Mückenlarven aber auch noch fleischfressende Pflanzen in Betracht, wie Wasserschlauch und Sonnentau, und auf ihre Vermehrung wäre gleichfalls Bedacht zu nehmen. Wenn von mancher Seite empfohlen wurde, Wasserlinsen, die, nebenbei gesagt, auch ein vorzügliches Geflügelfutter und namentlich Entenfutter abgeben, derart zu vermehren, daß sie an der Wasseroberfläche eine dicke Decke bilden, so daß die Mückenlarven davon abgeschlossen würden, so vermag ich nicht recht an die Wirksamkeit dieser Maßregel zu glauben, denn es wird zwischen den einzelnen Wasserlinsen doch immer noch genug Raum bleiben, wo die Larven oder Puppen ihre winzige Atemröhre herausstrecken können. Den erwachsenen Mücken stellen namentlich Spinnen, Libellen, Raubinsekten aller Art, Kröten, und zwar besonders die Feuerkröte, Laubfrosche, Eidechsen, Fledermäuse und das ganze Heer der insektenfressenden Singvögel nach, unter denen besonders die Schwalben einschließlich des Mauerseglers hervorzuheben sind. So ist mir ein Fall bekannt, wo in einem Vogesenstädtchen des mittleren Elsaß zahlreiche Gerbereien Luft und Wasser in den tieferen Stadtteilen verpesteten und dadurch einen Mückenherd und eine Malariaplage schufen; der obere Stadtteil dagegen blieb gänzlich frei von der Plage. An den wenigen Hektometern Weges und den wenigen Dekametern Höhenunterschiedes konnte das nicht liegen, und auch der Bergwind genügte nicht, denn er kam erst nach Sonnenuntergang und wich bereits vor Sonnenaufgang. Die Erklärung jenes örtlichen Vorzugs lieferten vielmehr hunderte von Schwalben, die ihren gewöhnlichen Sitz auf Leitungsdrähten hatten, die über den tiefer gelegenen Straßenzug ausgespannt waren. Zeitweise schwirrten sämtliche Schwalben unter lautem Gezwitscher auf und unternahmen einen Bogenflug nach dem von Mückenschwärmen wimmelnden Tal zu. Die lebendige Mauer, die tatsächlich keine Mücken heraufgelangen ließ, waren also die Schwalben. Für schnakenreiche Gegenden wäre demnach die Ansiedlung und Vermehrung der Schwalben von großer Wichtigkeit, und man könnte für sie Leitungsdrähte ausspannen, durch die die Mückenherde von den menschlichen Behausungen abgeschnitten würden. Auch die Fledermäuse, die wohl infolge ihres eigenartigen Haarkleides gegen Mückenstiche immun und die überdies schon als Vertilger schädlicher Nachtschmetterlinge hochnützlich sind, hat man schon mit sichtlichem Erfolg zur Mückenbekämpfung herangezogen, indem man ihnen in malariaverseuchten Gegenden besondere Türme als Wohnstätten errichtete und dabei als Nebenprodukt auch noch den für die Gärtnerei so wertvollen Fledermausguano gewann. Sehr gern kommen die stechlustigen Mücken bekanntlich in die Schlafzimmer, und es empfiehlt sich daher, in diesen bis zum Schlafengehen einen starken Luftzug herzustellen und, wenn man bei offenem Fenster schlafen möchte, feine Drahtgazenetze statt der Glasscheiben zu verwenden. In den Tropen gehören ja die Moskitonetze zum unentbehrlichen Hausgerät, da man es ohne sie überhaupt nicht aushalten würde. Auch im jetzigen Kriege haben sich dünne Schutzschleier aus feldgrauem Tüll als eine große Wohltat für unsere Soldaten erwiesen. Starke Gerüche schützen auch bis zu einem gewissen Grade; so bleiben starke Knoblauchesser von den Mücken meist verschont, und die Arbeiter aus den sizilianischen Schwefelgruben gelten als vollständig mückenfest. Ähnlich wirkt das bei manchen wilden Völkern übliche Bemalen des Körpers mit Ockerfarbe u. dgl., und vielleicht ist diese Sitte ursprünglich mehr auf hygienische als auf kosmetische Gründe zurückzuführen.
Der planmäßige allgemeine Kampf gegen die Mücken hat sich einerseits gegen die überwinternden Weibchen, anderseits gegen die sich entwickelnde Brut zu richten. Jenen geht man dadurch zu Leibe, daß man sie in ihren Schlupfwinkeln in den Kellern und Ställen aufsucht und hier durch Ausschwefeln oder durch Spiritusfackeln tötet. Der Feuergefährlichkeit wegen sind diese Maßregeln freilich immer nur mit einer gewissen Einschränkung zu empfehlen, denn in Baden z. B. wurde 1909/10 durch ungeschicktes Abflammen von Kellerwänden ein Feuerschaden von mehr als 40 000 Mark verursacht. In solchen Fällen ist deshalb das Abspritzen der Wände mit Insektizid, wovon 3 Liter auf 100 Liter Wasser kommen, vorzuziehen, zumal diese Methode auch wesentlich billiger ist. Ein noch ungelöstes Problem ist freilich die Vernichtung der im Freien überwinternden Mücken, denen gegenüber aber der Zaunkönig, die Meisen- und Goldhähnchenarten u. a. Vögel eine erwünschte Tätigkeit entfalten. Besser als den erwachsenen Mücken ist ihrer Brut beizukommen. Wo Bruttümpel vorhanden sind, die weder für die Schönheit der Landschaft, noch sonstwie von Wert sind, da schüttet man sie einfach zu. Sehr gut bewährt hat es sich auch, wenn man im Spätherbst die schwarzen vertorften Blätter, die im Grunde ausgetrockneter Tümpel liegen, ausgräbt und verbrennt, denn damit werden viele Mückeneier vernichtet. Zu weit gehen darf man in allen solchen Maßregeln aber auch nicht. In Honolulu z. B., wo seit dem Ausbruch des gelben Fiebers von den Behörden ein sehr energischer Mückenkrieg in Gang gesetzt wurde, beklagt sich die Bevölkerung bitter, daß die getroffenen Maßregeln über das Ziel hinausschießen und daß namentlich die Bananen in den Gärten rücksichtslos ausgerottet werden, weil die Wasseransammlungen in ihren Blattwinkeln auch als Mückenbrutstätten gelten.
Ein weiterer Weg zur Vernichtung der Mückenbrut besteht darin, daß man die Wasseroberfläche durch Aufgießen von Petroleum, das sich in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht ausbreitet, von der Luft abschließt, so daß die Larven und Puppen elend ersticken müssen. Dieser Weg hat nur das Bedenkliche, daß mit der Mückenbrut auch alle andern interessanten tierischen Bewohner kleiner Teiche vernichtet werden, daß das Wasser nicht mehr als Viehtränke benutzt werden kann, und daß auch Wild und Vögel, die an solchen Stellen zur Tränke kommen, dadurch schwer geschädigt werden. Das Aufgießen von Petroleum ist deshalb immer nur bei kleineren Tümpeln, die für Zwecke der Fischzucht und für den Naturschutz nicht in Betracht kommen, zu empfehlen und im allgemeinen mit weiser Zurückhaltung anzuwenden. Der echte Naturfreund wird sich mit solchen, alles Getier vernichtenden und bedrohenden radikalen Maßregeln nicht recht befreunden können. Dasselbe gilt für die Vergiftung der Tümpel mit Anilinfarbe oder mit Soprol, denn auch dieses tötet zwar sehr rasch die Mückenlarven, jedoch zugleich auch die andern Wassertiere. Milder wirkt da ein aus Gallol bestehendes und mit Wasser zu Brei anzurührendes Pulver, das als Larvizid in den Handel kommt und wovon man etwa 3 Gramm auf den Quadratmeter Wasseroberfläche zu rechnen hat. Es bringt die Mückenlarven schon innerhalb einer halben Stunde zum Absterben, ohne den Fischen und Fröschen zu schaden; allerdings erweist es sich auch den Mückenpuppen gegenüber als ziemlich wirkungslos. Wo viel Wildenten vorhanden sind, wird man trotz sumpfiger Beschaffenheit der Gegend wenig unter den Mücken zu leiden haben, denn jene unersättlichen Fresser räumen gewaltig unter der Mückenbrut auf. Auf den Dorftümpeln und städtischen Teichen ist deshalb das Halten zahlreicher Enten auch aus diesem Grunde zu empfehlen. Die Mückenbrut braucht zu ihrer Entwicklung eine ruhige, unbewegte Wasserfläche und stirbt ab, wenn diese Voraussetzung durchbrochen wird. In Mexiko hat man daher mit großem Erfolg zur Mückenbekämpfung eine künstliche, öfters wiederholte Bewegung der Wasseroberfläche mit Hilfe von Turbinen oder eines Windmühlenmechanismus angewandt. Am Po und in anderen Gegenden hat sich das sogenannte Poljensystem gut bewährt. Es besteht darin, daß die Bruttümpel durch ein künstlich angelegtes System kleiner Gräben mit einem tiefer gelegenen Zentralbecken verbunden werden, das möglichst zahlreiche Mückenfeinde enthält, die dann bei Hochwasser auch in die Bruttümpel hinaufsteigen und dort das Mückengeschmeiß vernichten.
Die bekannte Sonnenblume wirkt auch sehr mückenfeindlich; an der unteren Seite ihrer Stengelblätter sondert sich nämlich ein klebriger Saft ab, durch den viele dort ein Ruheplätzchen suchende Mücken festgeleimt werden. Der Anbau von Sonnenblumen empfiehlt sich deshalb sehr für malariaverseuchte Gegenden, zumal ja die Kerne der Pflanzen für die Ölgewinnung in Betracht kommen und auch ein vorzügliches Hühnerfutter abgeben, ebenso das Mark und die grünen Blätter ein erstklassiges Pferdefutter. Starkriechende Pflanzen, wie Knoblauch, Eukalyptus, Zitronellagras u. a., sollen gleichfalls die Moskitos abhalten. Beim Eukalyptus kommt aber wohl mehr in Betracht, daß er infolge seines raschen Wachstums der ganzen Umgebung die Bodenfeuchtigkeit entzieht und deshalb keine Wasseransammlungen duldet, die für die Entwicklung der Mückenbrut dienlich sein könnten. Eine zu den Lippenblütlern gehörende Pflanze, Ocynum viride, wird geradezu Moskitopflanze genannt und soll nach den Erfahrungen von Lorymore tatsächlich die Moskitos fernhalten. Chemische Untersuchungen der Pflanze ergaben, daß sie ein starkes aromatisches Öl enthält, worauf wohl ihre mückenverscheuchende Wirkung zurückzuführen ist.
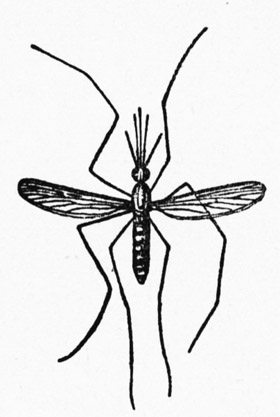
Abb. 39. Anopheles claviger. Nach Grassic.
Wie weit man es mit rücksichtsloser, planmäßiger, durch die Behörden organisierter Mückenbekämpfung bringen kann, das hat sich z. B. in Kuba und Rio de Janeiro gezeigt, Gegenden, die früher wegen des gelben Fiebers einen sehr üblen Ruf hatten. Heute ist die Seuche, die sich übrigens erst zwölf Tage nach der Infizierung durch den Mückenstich geltend macht, dort fast völlig verschwunden, was für Kuba namentlich auf die unermüdliche Tätigkeit des Naturforschers Finley zurückzuführen ist. Wer da weiß, eine wie gewaltige seelische Depression in Tropengegenden für den Europäer der fortwährende aussichtslose Kampf gegen die Stechmücken bedeutet, der wird solche Erfolge erst recht zu würdigen wissen. Ganz ausrotten werden wir trotz aller Maßregeln die Stechmücken ja nie, wohl aber ist durch richtiges Vorgehen eine sehr merkliche Einschränkung dieser Plagegeister und Hand in Hand damit ein Rückgang gewisser Krankheiten (übertragen doch manche Mückenarten sogar einen gefährlichen Rundwurm, eine Filariaart, die die scheußliche Filariose verursacht) zu erzielen.
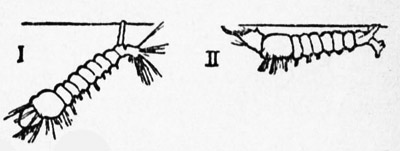
Abb. 40. I. Culex-Larve, II. Anopheles-Larve im Wasser. Nach Sambon.
Während die Übertragung des gelben Fiebers durch Stegomyia fasciata erfolgt, kommen für die Verbreitung der Malaria hauptsächlich Angehörige der besonders in den Tropen stark verbreiteten Gattung Anopheles (Abb. 39) in Betracht, und zwar ist der Krankheitserreger ein Protozoon, das den wissenschaftlichen Namen Plasmodium malariae führt. Die Anophelesarten sind sofort daran zu erkennen, daß die feinen Schuppen besonders an den Flügel-Vorderrändern zu dunkeln, schachbrettartigen Flecken angehäuft sind. Die Weibchen sind durch ihre langen Taster ausgezeichnet, die den Rüssel oft noch überragen, während sie bei Culex kurz und stummelförmig sind. Auch in biologischer Beziehung sind tiefgreifende Unterschiede zwischen beiden Gattungen vorhanden. Wir haben bereits gesehen, daß sich die erwachsenen Tiere schon durch ihre Art des Sitzens an senkrechten Wänden leicht unterscheiden lassen, und ähnliches gilt auch von den Larven, denn die der Anopheles besitzen keine besonderen Atemröhren, sondern atmen durch die ganze Hautoberfläche und hängen sich deshalb nicht senkrecht im Wasser auf, sondern legen sich ihrer ganzen Körperlänge nach an dessen Oberfläche an (Abb. 40). Sie leben vorwiegend in klaren, algenreichen, sonnenbeschienenen Gewässern, wo sie hauptsächlich grüne Algen verzehren, nebenbei aber auch mancherlei animalische Kost zu sich nehmen. Die Eier werden einzeln oder in kleinen Gruppen in Sternchenform abgelegt und durch seitliche Luftsäcke am Untersinken verhindert. Die ganze Entwicklungsdauer nimmt nur 20 26 Tage in Anspruch. Die Moskitos halten sich teils bei den menschlichen Behausungen, teils in den Urwäldern auf, und man unterscheidet darnach geradezu »zahme« und »wilde« Moskitos. Sie sind sehr lichtscheu, verkriechen sich tagsüber und schwärmen erst mit Einbruch der Dämmerung blutdürstig aus. Die Weibchen wollen täglich saugen und können überhaupt nur zwei Tage ohne Nahrung bleiben. Beim Stechen und Saugen stellen sie sich fast auf den Kopf und strecken die Hinterbeine hoch empor. Interessant ist, daß eine auf Batavia lebende Moskitoart eine Symbiose mit den dortigen kleinen Baumameisen eingeht. Diese halten sich nämlich als Milchkühe Schildläuse, um sich an deren süßen Ausschwitzungen zu laben. Wenn nun die mit dem süßen Futtersaft gefüllten Ameisen ihre Straße ziehen, stellen sich ihnen die Moskitos entgegen, halten sie auf und beklopfen ihnen in schnellem Tempo mit den Vorderbeinen Kopf und Stirne. Infolge dieses Reizes erbricht die Ameise einen Teil des aufgenommenen Futtersaftes, den der Moskito hastig aufsaugt, um bald darauf dasselbe Spiel von neuem zu beginnen und eine andere Ameise auszuplündern. Sucht diese sich den selbstsüchtigen Liebkosungen durch die Flucht zu entziehen, so folgt ihr der Moskito fliegend nach, bis er seinen Zweck erreicht hat. Es wurde niemals beobachtet, daß diese Moskitoart anderweitige Nahrung zu sich nahm, auch Wasser saugend wurde sie nie angetroffen; sie scheint also in ihrer Nahrung ganz von den Ameisen abhängig zu sein.
Als europäische Vertreterin der nur 3 4 mm großen, durch kurze Beine, Rüssel und Fühler, sowie durch breite Flügel ausgezeichneten und deshalb mehr an den Fliegentyp erinnernden Kriebelmücken oder Gnitzen sei hier noch kurz die gefährliche Kolumbadscher-Mücke ( Simulia columbaczensies) erwähnt, die in ihrer merkwürdigen Naturgeschichte durch den ungarischen Forscher Tömösvary erforscht ist und ihren Namen nach einem alten Serbenschlosse führt, das inmitten ihres glücklicherweise ziemlich beschränkten Verbreitungsgebietes gelegen ist. Unsere Feldgrauen auf der Balkanhalbinsel werden wohl schon zu ihrem Leidwesen mit diesem unheimlichen Plagegeist Bekanntschaft gemacht haben, der in wolkenähnlichen Scharen Mensch und Weidevieh überfällt, und ihr Stich brennt heftig und verursacht harte, schmerzhafte Knötchenbildung, so daß das winzige Insekt zu einer wahren Landplage geworden ist. Sein Vorderrücken schimmert schieferblau, der Hinterleib ist weißlich gefärbt, die Fühler gelb, die Flügel sind glashell und wenig geädert. In ihrer Entwicklungsgeschichte weicht diese Mücke erheblich von den früher geschilderten Arten ab; sie legt nämlich nicht weniger als 5000 10 000 Eier, wobei das Weibchen auf einem im Wasser liegenden Stein in klaren, schnellfließenden Gebirgsbächen sitzt. Hier bilden die Eier dann einen zähen, gelblichweißen Gallertklumpen, dem nach 2 3 Wochen die Larven entschlüpfen. Diese setzen sich mit einem eigenartigen Haftorgan am Hinterleib fest, während das freie Vorderende nach Art und Weise der Blutegel im Wasser hin und her pendelt. Doch besitzt auch dieses Vorderende Haftorgane, wodurch dem Tier eine spannerartig kriechende Fortbewegung ermöglicht ist. Außerdem ist es am Munde mit ruderartigen Borstenbüscheln ausgestattet, die die Nahrung herbeistrudeln, und der Körper mit Spinndrüsen, die die Anfertigung eines feinen Gespinstes erlauben. Im Spätsommer oder Frühherbst schreiten die Larven zur Verpuppung und spinnen sich dazu ein reiskorngroßes, trichterförmiges, oben offenes Gehäuse, worin die Puppe überwintert (Abb. 41 42), die also erst im nächsten Frühjahr zur Mücke wird. Ihr Aussehen ist insofern merkwürdig und auffallend, als sie am Vorderrande acht lange Atemfäden besitzt. Die im Frühjahr ausgeschlüpften Mücken schlagen sich zu großen Scharen zusammen, wandern die Bäche entlang zur Donau herab und bilden hier wolkenartige Scharen, die der Wind bald nach Südungarn, bald ins Innere Serbiens entführt. Diese dicken Mückenmassen überfallen blutgierig das Weidevieh, kriechen ihm in Nase, Ohren und Maul, martern es durch ihre schmerzhaften Stiche bis zum Tollwerden, verursachen dadurch schnell erhärtende Geschwülste und sind imstande, auch den kräftigsten Büffel innerhalb sechs Stunden zu töten. In Serbien ist der durch diese Mücken unter dem Weidevieh angerichtete Schaden auf jährlich etwa 2 Millionen Kronen zu beziffern. Wie sie unter dem Vieh zu hausen vermögen, möge das Beispiel von Temes Kubin beweisen, wo 1880 innerhalb vier Stunden 80 Pferde, 40 Rinder und 400 Schweine zu Tode gepeinigt wurden. Auch sind gut beglaubigte Fälle bekannt, wo Kinder oder kurzröckig gekleidete Frauen durch diese unheimlichen Mücken das gleiche traurige Schicksal erlitten. Gelegentlich werden die Kriebelmücken durch Luftströmungen sogar bis nach Deutschland getragen, wo ihnen 1902 in der Gegend von Lüneburg 6 Kühe und 1 Stier zum Opfer fielen.

|
|
|
Abb. 41. Puppen der Kolumbadscher Stechmücke, an Wasserpflanzen angeheftet, um durch die Strömung nicht fortgerissen zu werden. (Nach Horwarth.) |
Abb. 42. Eine einzelne Puppe einer verwandten Art, die sich ebenfalls im fließenden Wasser verankert. |
Auch 1915 wurden bei Landsberg a. W. mehrere Rinder wahrscheinlich durch diese Mückenart umgebracht. Auch in der Lüneburger Heide ist die Kriebelmücke ganz neuerdings wieder aufgetreten und es wurden in einer ganzen Reihe von Gemeinden Viehverluste festgestellt, namentlich bei Rindern, die frisch auf die Weide getrieben waren und nach dem langen Stallaufenthalt besonders empfindlich gegen die Stiche zu sein scheinen. Von den erkrankten Tieren sind etwa zwei Drittel verendet. Der Krankheitsverlauf ist ziemlich verschieden, bekundet sich aber namentlich durch Herzschwäche und Blutleere des Gehirnes. Am meisten stechen die Mücken an warmen und schwülen Tagen, während an kühlen und regnerischen das Vieh verschont bleibt. Das Einreiben der Weidetiere mit scharf riechenden öligen Flüssigkeiten hat sich als Vorbeugungsmittel nicht bewährt, ist bei größeren Beständen auch schwer durchführbar. Von besonderer Wirkung waren Polizeiverordnungen, die in den gefährdeten Bezirken den Weidegang der Rinder nur nachts gestatteten und eine Entschädigung für am Tage geweidetes und dabei gestochenes Vieh ablehnten. Der Aberglaube der serbischen Bevölkerung läßt die Kolumbadschermücke in der Felsenhöhle entstehen, in der St. Georg den Lindwurm erlegte, und diese Sage hat insofern eine gewisse Berechtigung, als die Mücken bei Unwetter in Felsenhöhlen flüchten, und dann, wenn die Witterung wieder besser geworden ist, plötzlich aus diesen zum Vorschein kommen.
Beim Pilzsammeln werden wir häufig die unangenehme Erfahrung machen, daß die scheinbar schönsten Pilze im Innern ganz von häßlichen Maden zerfressen und deshalb für die Küche unbrauchbar sind. Diese Tierchen sind in vielen Fällen die Larven von Pilzmücken. Und eine hierher gehörige Art, die wegen ihrer dunkeln Flügel als Trauermücke ( Sciaria militaris) bezeichnet wird, verdient insofern unser besonderes Interesse, als sie Veranlassung zur Entstehung des sagenhaften Heerwurms gibt. Das Leben dieser Mücke spielt sich nämlich hauptsächlich im Larvenstadium ab, das 8 bis 12 Wochen währt, während das Puppendasein nur ebensoviele Tage dauert und der ausgebildeten Mücke nicht mehr als drei Tage vergönnt sind, sich am Lichte zu freuen.
Sie legen ihre mohnkorngroßen Eierchen in faules Laub, und diesem entschlüpfen weißliche Larven mit schwarzem, kornigem Kopf und verwandeln sich später in bucklige Mumienpuppen, die gern in den Laufstraßen der Mäuse liegen. Die Larven leben besonders in geschlossenen Buchenwäldern, wo sie die faulenden Blätter skelettieren und ihr Kot in Form schnupftabakartiger Krümel dem kluge des aufmerksamen Beobachters nicht entgeht. Der Laie merkt aber von ihrem Dasein überhaupt nichts, denn es spielt sich für gewöhnlich ganz unter der alten Blätterschicht ab, und nur selten wird dies anders, wenn nämlich Übervölkerung und Nahrungsmangel eintritt oder die Feuchtigkeitsverhältnisse, gegen die diese Tiere sehr empfindlich sind, ihnen nicht mehr zusagen. Dann entschließen sie sich in großen Massen zur Auswanderung, und eben dadurch kommt der berüchtigte Heerwurm (Abbildung siehe Schlußleiste) zustande. Er stellt sich dar als eine weißgraue Schlange von Handbreite, Daumendicke und drei bis vier Meter Länge und besteht aus unzähligen bleichen, dunkelköpfigen Maden, die durch einen klebrigen Schleim zusammengehalten werden. Schlangenartig kriecht diese Masse einher, sich langsam vorwärts schiebend, geringe Hindernisse überschreitend, größere aber umgehend, bis sie wieder geeignete Weideplätze und zusagende Feuchtigkeitsverhältnisse aufgefunden hat. Der Schleim ist so zäh, daß sich das Ende dieser Trugschlange in die Höhe heben läßt, ohne daß der Zusammenhang zerreißt, wobei eine klebrige Flüssigkeit an den Händen haften bleibt. Wahrscheinlich stellt dieser zähe Schleim eine Schutzvorrichtung der sonst ganz wehrlosen Tierchen dar und erfüllt als solche auch vollkommen ihren Zweck, denn die sonst so sehr auf Mücken erpichten Vögel lassen den Heerwurm völlig unbehelligt. So schleicht er unheimlich im Waldesdunkel einher, windet sich langsam in schwankend lautloser Fortbewegung über abgefallene Fichtennadeln und über die Moosdecke, glasig schillernd im Sonnenschein, eine dunkle Spur von Unrat hinter seinem schleppenden Ende zurücklassend. Natürlich haben sich Aberglaube und Volkssage in hohem Maße dieser merkwürdigen Naturerscheinung bemächtigt, die zwar schon seit 1503 bekannt ist, aber erst 1868 durch Forstmeister Beling in ihrem wahren Wesen erkannt wurde. Je nach der Richtung, die der Heerwurm einschlägt, soll er Krieg oder Frieden, gute Ernte oder Mißwachs, Tod oder Genesung bedeuten. Für uns aber bedeutet er nur einen neuen großartigen Beweis für die geheimnisvolle Gestaltungskraft der Natur.
