
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
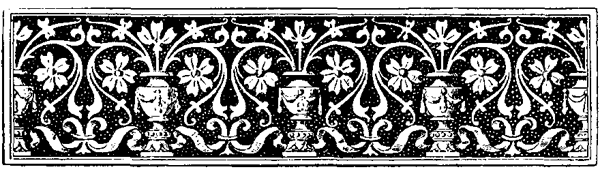
 Der düstere Morgen eines Octobertages breitete sein nebliges Licht über die Dauphiné, als ich, von der Landstraße abbiegend, zur Ortschaft Vaureb gelangte. Da miethete ich mir einen Führer und ein Maulthier und setzte meinen Weg fort nach der Grande Chartreuse.
Der düstere Morgen eines Octobertages breitete sein nebliges Licht über die Dauphiné, als ich, von der Landstraße abbiegend, zur Ortschaft Vaureb gelangte. Da miethete ich mir einen Führer und ein Maulthier und setzte meinen Weg fort nach der Grande Chartreuse.
Der Herbst hatte die Bäume schon größtentheils ihres Laubes beraubt, und gleichsam ihrer Befreiung gewärtig, hingen, gelb und roth und mit schweren Tropfen beladen die noch übrigen Blätter an den dürren Zweigen; das Gras, zwischen welchem sich mein Pfad dahinschlängelte, war schneeweiß vom Reif, und von den Bergen wehte ein eiskalter Wind über die Gegend, die Bewohner des Dorfes an den nahenden Winter gemahnend. Alles rings um mich war traurig, herbstlich düster und öde. – In meinen Mantel gehüllt, kam ich vorwärts, bald auf meinem Maulthiere, bald zu Fuß, und so gelangte ich zu dem Thore der sogenannten großen Wüste.
Jetzt steht hinter der Mauer, welche die düstere Gegend von der übrigen Welt absondert, eine Mühle, neben derselben ein kleines Bauernhaus und die einfache Kapelle, in welcher der als Schaffner des Klosters hier wirkende Karthäuser seine Messe liest; übrigens ist Alles verlassen. Brausend stürzt über die schmale Bergkluft der Bergbach herunter; so weit das Auge blickt, bedeckt ein Fichtenwald die Berge mit seinem dunklen Grün, und sobald man durch das Thor geschritten ist, würde man sich in eine Wildniß versetzt fühlen, wenn nicht das Glockengeläute der Kapelle den Führer zum Gebet und den Wanderer daran mahnte, daß er den Kreis erreicht habe, in welchem so viele Leidende, die mitten in unserer Civilisation nur Wunden davontragen, eine Zuflucht suchten.
Der Name des Ortes ist gut gewählt worden, es ist wirklich eine Wüste. In diesen finsteren Fichtenwäldern, welche in ununterbrochener Reihe über den Bergen dunkeln, und in diesen Felsen, welche sich bald in größeren Massen an der Bergwand hindehnen, bald zerstreut, wie der letzte Orkan sie liegen gelassen, auf der Straße blinken, erhebt sich ein Bild unendlicher Verlassenheit vor den Augen des Wanderers; und wie viel hat Der wohl leiden oder hoffen müssen, der zuerst sich eine düstere Zufluchtsstätte gesucht hat, um da von seinen Schmerzen auszuruhen, oder sich mit Selbstquälerei den Himmel zu verdienen; und wie viel mußten Diejenigen leiden, die nach ihm diese Schwelle überschritten haben, und zwar unter der Bedingung, daß sie niemals in die Welt zurückkehren werden, niemals dahin, wo sie alle Blüthen, eine nach der andern, abfallen gesehen, wo alles Hoffnungsgrün vor ihren Augen dahingeschwunden bis der ganze Umkreis in winterlicher Kahlheit vor ihnen stand und sie nur eine Hoffnung hatten, düster und ernst, wie das Grün dieser Tannen, welches der Wechsel der Jahreszeiten nicht verändert, aber auch dauernd wie dieses, nämlich den Glauben. – Hier an dem unermüdlich herabstürzenden Bache suchten sie vielleicht Ruhe, vielleicht nur einen Ort, an welchem das Tosen der Fluth die verzweiflungsvolle Klage übertönt und die ächzenden Zweige sie das Hohngelächter, mit welchem die grausame Welt einst ihre Klagen aufnahm, vergessen machen. – Und fanden sie wohl diesen Grabesfrieden, diese Ruhe, für welche sie Alles dahingaben, selbst die Trümmer ihres Lebens, um die sie in ihrer Einsamkeit Jahre lang seufzten, weinten, beteten? – Wer weiß dies! Ist es doch nicht einmal gewiß, daß Derjenige Ruhe haben werde, der sich vor jedem Eindruck geflüchtet; – das Herz ist ein Meer, und wenn der Sturm vorüber ist, der seine Wogen aufgepeitscht, schwillt es durch die Fluth.
Von solchen Gedanken erfüllt, gelangte ich zum Kloster, das sich in seiner regellosen Großartigkeit vor mir erhob, halb in den mystischen Schleier des Nebels gehüllt. Ich klopfte an. Das Thor öffnete sich, und nach kurzer Zeit ging ich in dem großen Burgunder Gastsaal auf und ab, wohin der heilige Pater nach einigem Zögern mich geführt hatte, der ich als Ungar weder Franzose noch Italiener war und ein Deutscher nicht sein wollte. Nach einiger Zeit kam einer der Mönche zu mir, ein Mann mit sanftem und blassem Gesichte, der sich anbot, mir das Kloster zu zeigen; und es wurde dunkel, bevor wir durch so viele Gänge und Säle kamen und ich mir alle die Pracht besehen konnte, mit welcher Eitelkeit dieses große Menschengrab geschmückt hat. – Der Karthäuser ging, nachdem er mich zurückgeführt hatte, fort; ich war wieder allein. Einen Theil des Saales erfüllte das Dunkel des Abends, den andern Theil beleuchtete das Feuer des Kamins, sein Licht bald auf größere, bald auf kleinere Kreise ausdehnend, je nachdem die Flamme emporloderte oder zurücksank; ich saß in der Nähe des Feuers und überließ mich meinen Gedanken. – Ich wurde aus meinen Träumereien durch einen Diener geweckt, der Kerzen brachte und zwei Fremde in den gemeinschaftlichen Saal führte. – Sie waren vor mir in's Kloster gekommen, und gerade jetzt von der Einsiedelei des heiligen Bruno zurückgekehrt, setzten sie sich, ermüdet vom Gehen, zu mir an den Kamin. – Einer von ihnen mochte ungefähr fünfzig Jahre alt sein, Falten durchfurchten seine Stirn und sein Haar begann schon zu ergrauen; allein in seinen Zügen zeigten sich männliche Kraft und Gesundheit, und sein muskulöser Körperbau widersprach seinen grauen Haaren. Der Andere stand noch im Frühling seines Lebens, doch in seinem regelmäßigen blassen Gesichte zeigten sich mehr Spuren bitterer Erfahrung, als in den ruhigen Zügen seines ergrauten Gefährten, und wer diese beiden Männer neben einander betrachtete, konnte leicht sehen, daß hier nicht Derjenige alt sei, dessen Haar zu ergrauen begann. Ungefähr wie eine Blume und eine Eiche, so standen sie neben einander; jene hat erst einige Tage gelebt und beginnt schon zu welken, diese hat Jahrhunderte gesehen, jedoch ohne daß ihre Kraft abgenommen hätte und ihre grünen Zweige ausgetrocknet wären. Der Jüngling saß mit ernstem Gleichmuthe vor dem Kamine, vertieft in das Anschauen der Flamme, während der Aeltere von Zeit zu Zeit einen besorgten Blick auf seinen Gefährten warf, als ob er in den Bewegungen seines blassen Gesichtes nach den Gedanken spähte, die durch seine Seele zogen. – Endlich sagte der junge Mann, gleichsam seine Träumereien unterdrückend: »Ich fühle mich hier wohl, mein Freund.«
»Morgen können wir hier bleiben,« antwortete der Andere, »und wenn auch Niemand ohne Erlaubniß länger als vierundzwanzig Stunden hier verweilen darf, so können wir dieselbe doch leicht erhalten.«
»Morgen, und übermorgen, und immer!« entgegnete der junge Mann traurig, indem er sich nach dem Fenster hinwandte, als er dem Blick seines Freundes ausweichen wollte, und dieser sprach:
»Für immer! – Das ist ein schweres, bitteres Wort, besonders in deinem Alter, wo es noch ein ganzes Leben bedeutet.«
»Wenn eines Menschen Glück verloren gegangen ist, wenn er endlich selbst die Hoffnung auf Trost verloren hat, so bedarf er nur der Ruhe und jener Apathie, welche seine Gefühle ertödtet, aber mit seinen Gefühlen auch seinen Kummer; in solchem Zustande seufzt das Herz nur nach Vernichtung, und diese ist es, die ich hier zu finden hoffe.«
Der Jüngling stand auf, sah, auf das Fenster gestützt, in das nebelhafte Dunkel hinaus, während sein Gefährte schweigend einen kummervollen Blick auf ihn warf. Endlich stand auch er auf, näherte sich dem Jüngling und redete ihn an. Dieser antwortete leidenschaftlich, und es entstand ein langes Gespräch zwischen ihnen, wovon ich wegen der Entfernung nichts verstand, aber dessen traurigen Sinn der Ausdruck der Sprechenden vermuthen ließ. – So vergingen beinahe zwei Stunden, während welcher ich Briefe schrieb, ohne daß ich jedoch im Stande gewesen wäre, meine Aufmerksamkeit den auf- und abgehenden Sprechenden zu entziehen, besonders als ich einzelne Bruchstücke des Gespräches vernahm. Endlich blieb der Jüngling stehen und sprach, wie vom Schmerz hingerissen: »Ich glaube, daß es Menschen gibt, die mit ihrem Schicksale zufrieden sind, wenn ich auch noch wenige solche gefunden habe; der Knabe, welcher stundenlang Kieselsteinchen gesammelt hat, zählt, wenn seine Mütze voll ist und er sich ermüdet hinsetzt, mit Befriedigung seine Schätze; und warum sollte nicht auch ein Mann zufrieden sein, der sein Leben lang geackert, oder gerechnet, oder Stiefel geflickt, oder Bücher geschrieben hat, wenn er im Alter ausruhend auf seine Vergangenheit zurückblickt und glaubt, daß er, weil er gearbeitet und sich abgemüht hat, auch etwas gethan habe. Das Leben eines großen Theiles der Menschen vergeht in Broderwerb; der Magen ist ein Danaidenfaß, das anzufüllen fortwährend Beschäftigung gibt, und wer damit zufrieden ist, dem gebe der Himmel Appetit, er wird mit seinem Brod oder mit seinen auserlesenen Speisen zufrieden sein und vielleicht glauben, sein Leben sei kein verfehltes gewesen, weil er seine Bemühungen bezahlt bekommen hat, und er habe den Gesetzen des unaufhörlichen Fortschrittes Genüge geleistet, weil er sich von jährlichen fünfhundert zu einem Einkommen von eben so viel tausend Francs emporgeschwungen hat. Wessen Seele nie durch die große Frage in ihrer Ruhe gestört wurde: »»Wozu er gelebt habe?«« der kann vielleicht zufrieden sein und ich kann ihn um sein Schicksal beneiden, aber ich kann ihm nicht folgen, eben so wenig, wie ich den Fleiß der Biene oder den Winterschlaf des Bären nachahmen kann – unsere Natur ist verschieden. – Mir ist nur das Eine klar, daß es außer diesem kein anderes Glück auf Erden gibt und daß ich es nicht erreichen werde. – Es gibt keinerlei Umstände, unter welchen man nicht glücklich sein könnte, aber es gibt Menschen, für welche gar kein Glück möglich ist, und diesen bleibt nur eine Pflicht zu erfüllen übrig: sich wegen des Unerreichbaren nicht abzumühen, das heißt aus der Welt zu treten und ihren Schmerz allein zu tragen. Wer im Kreise der Menschen keine Befriedigung mehr findet, der macht Jedermann unglücklich, in dessen Gesellschaft er tritt; die Frau, die sich liebend an sein Herz schmiegt, der Freund, dessen Rechte er drückt, Alle sind die Opfer seiner Laune. Wir sind Denen, die liebend an uns hängen, schuldig, befriedigt zu sein, und wer keine Befriedigung findet, der ziehe sich in die Einsamkeit zurück und befreie seine Seele wenigstens von dem Vorwurfe, Andere unglücklich gemacht zu haben. – Nicht der Frühling, nicht die warmen Strahlen der Sonne, nicht der laue Sommerregen bedecken den Baum mit Laub, in seinem Innern ruht die Kraft, die ihn ergrünen macht, und ohne sie würde der Strahl der Sonne seine Aeste verdorren machen, der Regen ihm Fäulniß bringen.«
Der Jüngling stand auf und ging mit glühenden Wangen zum Fenster. Man läutete eben zur Hora. – »Hörst Du diese Töne?« sprach er, zu seinem Gefährten gewendet. – »Der Sturm ist vorüber, die Fichten stehen unbeweglich und die Thäler erfüllt das frühere Schweigen, nur diese heiligen Töne durchziehen die Gegend, als ob sie über die schlummernde Natur Segen sprächen; – der Karthäuser erwacht aus seinen finsteren, unruhigen Träumen, er schaut durch's Fenster, und den gestirnten Himmel erblickend, spricht er ein eifriges, heilsames Gebet, und ist glücklich, weil er betet. Eine lange kummervolle Nacht war auch mein Leben, und auch ich hatte ungeheuerliche Träume; jetzt ist der Ruf an mich ergangen, der mich zum Gebete auffordert, ich muß beten. – Vor dem Kreuze des Erlösers hingesunken, werde ich um einen Trost beten, ich werde fasten und meinen Leib kasteien, und leiden, wie noch kein Mensch gelitten hat, und wenn endlich ein Hoffnungsstrahl mein finsteres Gemüth erleuchtet, wenn in diesen ausgetrockneten Augen sich wieder eine Thräne zeigen wird, wenn meine Lippen sich zum ersten Gebet öffnen werden: dann werde ich glücklich sein, wie Ihr in Eurer Welt es nicht sein könnt.«
*
Ich kann es nicht beschreiben, wie tief dieses ganze Gespräch auf mich wirkte, dessen zufälliger Zeuge ich war. Ich durchreiste ganz Frankreich und konnte den blassen Jüngling und seine traurigen Worte nicht vergessen. Als ich in Paris unvermuthet seinem Gefährten begegnete, erkundigte ich mich, nachdem ich mit ihm bekannt geworden war, oft nach dem Befinden des Jünglings, jedoch mit geringem Erfolg. – Die Sache interessirte mich so sehr, daß ich später, nachdem ich Frankreich verlassen hatte, mit meinem Bekannten, der seither beinahe mein Freund geworden, in Briefwechsel trat, und so gelangte ich zu den Schriften, die ich jetzt dem Publicum vorlege. Es ist das Tagebuch und zum Theil das Gedenkbuch des Jünglings, welches er im Kloster schrieb und bei seinem Tode seinem Freunde hinterließ. Wer nur Unterhaltung sucht, der lege diese Blätter fort, deren Ordnungslosigkeit künstlerischen Anforderungen nicht entspricht, deren eintöniger Gram nur Langeweile verursacht. – Aber, wen die Schmerzen einer guten und zum Edlen geschaffenen Seele nicht kalt lassen, wen die geheime Geschichte eines Herzens mehr interessirt, als die künstlich verwickelten Fabeln der Romane, der lese diese Blätter zu Ende, und vielleicht gibt es auch in seinem eigenen Leben eine Periode, bei deren Andenken es ihm einfällt, daß der Kummer, von welchem hier die Rede ist, nicht allein das Werk dichterischer Einbildungskraft war.
Heute verließ mich mein Vater. – Nachdem er aus meinem Briefe meinen Entschluß erfahren hatte, kam er sogleich. Zwei Tage brachte er hier im Kloster zu und bat mich fortwährend, mit ihm zu gehen. Endlich verließ er mich. – Sein Fortgehen wirkte tief auf mich. – Nicht als ob ich ihn liebte! Es gibt Zeiten, wo sich so viele fremde Dinge zwischen Vater und Sohn drängen, daß sie anfangs einander fern stehen, dann sich einander entfremden – es gibt Zeiten, wo jeder eine andere, von dem Andern nicht verstandene Sprache spricht, sich vom Andern verabscheuter Hoffnungen freut, wo jeder mit starkem Glauben sich an seine besondere Ueberzeugung klammert, die dem Einen beinahe zur Religion geworden, während der Andere darin nur Vorurtheile erblickt. – Eine solche Zeit ist auch die unsere; Vergangenheit und Zukunft, das sind die beiden Religionen, mit welchen zwei Generationen einander gegenüberstehen, und ist es zu verwundern, wenn im heutigen Frankreich Vater und Sohn sich in so wenig Punkten begegnen? Wogt doch schon lange das rothe Meer der Revolution zwischen uns, und wie sollten wir, die wir uns kühn auf den Weg gemacht und auf dem schwierigen Pfade rüstig vorwärts dringen, dessen Anfang eine Wüste war, an dessen Ende uns aber ein schönes, glorreiches Vaterland versprochen wurde – wie sollten wir nicht von Jenen fern sein, die bei den Fleischtöpfen Egyptens zurückgeblieben sind. – Dennoch machte der Augenblick der Trennung einen tiefen Eindruck auf mich, dennoch wurde mein Herz beklommen als ich seinen zitternden Händedruck fühlte und die Thräne sah, die über seine bleichen Wangen floß. O, weil ich fühlte, daß ich in diesem Augenblick von einer Welt Abschied nehme, und daß dieser zärtliche Händedruck und diese Thräne die einzigen Ueberreste von so vieler Liebe sind, die mich einst umfangen hielt. – Auch dieser Augenblick ging vorüber; von nun an stehe ich allein in der Welt.
Mein Vater geht, wie er sagte, nicht nach Paris, sondern nach der Provence; morgen wird er dort sein, wo ich geboren wurde und das Grab meiner Mutter steht. – O, wie anders wäre Alles, wenn meine Mutter noch lebte! – wenn mitten unter so vielen traurigen Erfahrungen der eine beglückende Gedanke mir zur Seite stünde, daß wir dennoch eine Liebe auf Erden besitzen, die mit der Zeit nicht schwindet; wenn ich ihr hätte meine Leiden gestehen können, wenn sie mir gesagt hätte, wie sie gelitten hat und wie sehr sie meiner bedarf – so wäre es mit mir nie so weit gekommen. – Die Liebe gleicht den heiligen Sprüchen des Koran: grabe ihre Worte in Stein oder schreibe sie auf ein Stück Papier, sie wird Dir stets ein Talisman sein und Dir Segen bringen; wer liebt, kann nicht unglücklich sein, kann keine unedlen Gefühle hegen – und ich bin nicht zum Schlechten geboren. – Aber sie ist gestorben und Alles ist aus.
Als man sie in's Grab gelegt hatte, stand ich lange auf dem stummen Rasen desselben; in meinen dumpfen, sprachlosen Schmerz versunken, stand ich dort, bis mein Erzieher mich nach Hause rief. »Die Sonne ist untergegangen, es wird bald Nacht sein!« so sprach er zu mir, und wenn ich auch ein Kind war, so verstand ich dennoch den traurigen Sinn seiner Worte, die mein Herz wie eine dunkle Prophezeiung erfüllten. – O, zu früh ist es über mir Nacht geworden!
Nacht ist es auch jetzt – nur zuweilen bricht das Mondlicht durch den düstern Schleier, mit welchem der Himmel bedeckt ist, während von dem glänzenden Heer der Sterne nur hie und da ein Lichtpunkt durch das große Nebelmeer dringt. – Die Nacht ist finster wie meine Seele. Aber wenige Stunden und das Licht wird zurückkommen; hinter allen diesen Schleiern erhebt sich bald die Sonne, und alle diese Wolken, die vom Osten her sich finster aufthürmen, werden im Purpur der erwachenden Sonne strahlen; es wird licht sein am Himmel und auf Erden. Und du, meine gramvolle Seele, sollte dir kein neuer Tag mehr aufdämmern? Ist das glorreiche Licht, das dich einst mit seinem Glanze erfüllte, schon für ewig verschwunden? Oder währst du nicht ewig, wie die Natur? O, wenn du das bist, wenn die sehnsuchtsvolle Ahnung, die dich einst erfüllte, kein bloßer Traum war, wenn der Nebelschleier deinen Glanz nur verhüllte und nicht vernichtete – o, dann erwache, meine Sonne, durchleuchte die Finsterniß der Seele, zerreiße den Schleier, du Ewiges in mir, und dringe vorwärts auf der Bahn, welche der Schöpfer dir vorgezeichnet hat. – Aber bist du auch ewig? O! wer auf diese Frage antworten könnte!
Man läutet zur Hora. – Ich gehe beten.
Der Nachmittags-Gottesdienst ist vorüber. – Es war Abend und in dem langen gothischen Gang, auf welchen die Thür meines Zimmers geht, herrschte schon Zwielicht. Die Schritte der einzeln in ihre Zellen zurückkehrenden Väter verhallten immer mehr, in meinem Umkreis wurde es immer stiller, endlich war ich allein. – Verzweiflung erfüllte mein Herz. – Ich kann nicht beten! Ich war in der Kirche, kniend erhob ich meine Augen zum Altar; ich bedeckte die Steine mit glühenden Küssen, wie wahnsinnig zerschlug ich meine Brust – vergebens, ich kann nicht beten. – Und dennoch ist es ein Glück, beten zu können – in meiner Lage das einzige Glück, weil es ein Trost ist. Die rings um mich knieten, beteten Alle; in jedem Gesicht zeigte sich die Begeisterung der Andacht, jedes Auge war mit hoffnungsvollem Blick zum Himmel gerichtet, nur ich blieb trostlos. Und dennoch gibt es vielleicht unter ihnen auch Leute, die so viel gelitten haben, wie ich; es mag Leute geben, deren Herz von schwereren Anklagen belastet ist als das meine, und warum ist nur mir allein kein Trost geworden? – Was habe ich gethan, daß Du mich so sehr verlassen hast, mein Gott? – Weil ich gezweifelt habe? Aber habe ich denn den Zweifel gesucht? Hatte ich als ein Kind nicht mit gefalteten Händen zu Dir gebetet, wie andere Kinder? Erfüllte sich die Seele des Jünglings beim Gedanken an Dich nicht mit flammender Sehnsucht? Warum hast Du nur mir die Gnade des Glaubens versagt? – Du hast jedem Menschen seine Schmerzen gegeben, vom Kinde angefangen bis zum Greise, vom Bettler bis zum König hinauf; es gibt kein Auge, das noch nicht Thränen vergossen hätte; aber Du hast ihnen auch einen Trost verliehen: das Kreuz, das auf ihrem Grabe steht und das für alle Schmerzen ihres Lebens hinreicht. – Aber was soll ich thun, der ich meinen Glauben verloren habe, der ich mein Vertrauen auf nichts setzen kann, weder auf Dich noch auf die Menschen; der ich mein Leben hingeben möchte für eine Ueberzeugung, und unter den sogenannten Wirklichkeiten keine einzige finde, an der ich noch nicht gezweifelt hätte. Was soll ich thun?
» Memento mori!« so erscholl plötzlich neben mir eine Stimme aus der Finsterniß, und als ich mich erschrocken hinwandte, ging einer der Väter mit ruhigen Schritten nach seiner Zelle. – – Memento mori – – – oft habe ich darüber nachgedacht, warum die Karthäuser diesen Spruch zu ihrem Gruß erwählt haben mögen. Jetzt erst begreife ich den Sinn dieses dunklen Spruches. – Die Väter sagen dies nicht zu einander, um ihre Seele von der Sünde zurückzuhalten – nicht um einander an die Schrecken des Gerichtes zu erinnern; dieses Wort ist ein Trost, nichts Anderes. – O, warum sprechen nicht die Menschen in der Welt einander so an, wo sie dieses Trostes so sehr bedürfen! Wenn deine Hoffnungen dich getäuscht haben, wenn von den Freuden deiner Jugend dir nichts geblieben ist, als Gräber und traurige Erfahrungen; wenn du in deinem Wissensdurste, in den Abgrund der Wissenschaften vertieft, deine Forschungen schließlich mit einer großen Frage beendigt hast; wenn – wenn du gelebt hast – denn wer könnte die Bitternisse des Menschendaseins alle aufzählen – dann vergiß nicht, o Herz, daß du sterblich bist, und sei ruhig. – Betrachte den Wanderer: wie müde er auch sei, wie sehr auch Steine und Dornen seine Füße verwundet haben mögen, sobald das Dach des Gasthauses ihm im Abendstrahle winkt, beklagt er sich nicht mehr, eilt er mit neuen Kräften hin, und sein Herz schwillt vor Freude, sobald er den Ort seiner Ruhe von Weitem erblickt; er hat nicht unter diesem Obdach seine ersten Träume erlebt, das ist nicht das Ziel, um dessentwillen er sich so viel bemüht hat, und er weiß wohl, daß ihn an der Schwelle dieses Hauses nicht seine Lieben empfangen werden, wie er einst hoffte, wenn er an die Rückkehr dachte; aber der Wanderer freut sich dennoch, ist es doch ein Ruheplatz, und der Wanderer wünscht nur auszuruhen. – Auch du hast einst von einer andern Zukunft geträumt, armes Herz; jetzt ist deinem Leben nur mehr ein Ziel übrig geblieben: das Ende; es wird dir Ruhe werden, und was willst du mehr? O, laß' mich sterben, mein Gott! sieh', wenn der Baum ausgetrocknet ist, so knickt ihn der erste Sturm, und die Wolke verschwindet, sobald ihr letzter Tropfen zur Erde gefallen ist, und die Flamme erlischt, sobald sie nichts mehr zu verzehren hat; auch meine Kraft ist verdorrt, meine Thränen sind geflossen und nichts ist mir geblieben, worüber dieses Herz noch erglühen könnte. Was soll ich noch auf dieser Erde thun? Wozu soll ich, ein nutzloses Trümmerwerk, auf dem großen Meere des Daseins noch herumtreiben? Meinethalben wird sich doch Niemand vor meinen Gefahren hüten; Niemand weiß, an welchen Felsen ich gescheitert bin. O laß' mich sterben, mein Gott!
Auch als Kind und Knabe seufzte ich zuweilen nach dem Tode, es war dies eine schöne, glückliche Zeit! Hoffnungsvoll, wie ich damals war, von Jedermann geliebt, voll Liebe für Alles, das Leben für einen glücklichen Traum haltend, dessen Sinn ich in einer andern Welt durchschauen werde – wie hätte ich damals nicht an ein Himmelreich geglaubt, da ich noch fähig war, grenzenlose Seligkeit zu fühlen! – Der Jüngling fürchtet nicht den Tod; sowie der Reiche seine Schätze verschwendet, weil er sich gar nicht denken kann, daß er arm werden könne, während der Bettler mit seinen Hellern sparsam umgeht: so wirft der Jüngling sein reiches, freudenvolles Dasein hin, für jede Hoffnung sein Leben aufopfernd; denn wie sollte er nicht an eine Ewigkeit glauben, der bisher nur die Entwicklung seiner Eigenschaften fühlte? Aber sobald der Mensch seine Kräfte ermatten und endlich dahinschwinden fühlt; wenn seine beseligende Liebe unter Schmerzen erstorben; wenn der Haß, der ihn einst zu Thaten spornte, abgekühlt ist und mit seinen Befürchtungen auch seine Hoffnungen dahingeschwunden sind; wenn in der Brust, in welcher einst so viele Stimmen tosten, endlich Alles still geworden; wenn anstatt der Stürme, welche das Herz einst erfüllten, nur mehr die Klage eines tief verletzten Gefühls sich vernehmen läßt: dann glaubt er es, daß er sterben könne. – Glücklich, wer in solcher Zeit noch zu genießen vermag; wer, seiner schönsten Hoffnungen beraubt, das Leben zufrieden hinnimmt und nachdem er aufgehört hat, nach einem Ziele zu streben, auf diesem großen Lehmklumpen noch Raum für seine Wünsche findet. – Möge er gleich der Ameise die Erde aufwühlen und nach einem Stück Brod ringen; möge er sich unter der Erde seine Schachte bauen, um ein Stückchen glänzendes Erz heraufzuholen; oder möge er von Meer zu Meer schiffen, um ein Stückchen Boden zu finden, wo er das Schauspiel der menschlichen Qualen und Sünden auf's Neue beginnen könne: – gleichviel, Jedermann ist glücklich, der ein Ziel hat, und Kraft, es zu erreichen, und die Ueberzeugung, etwas Großes oder Nützliches geleistet zu haben, wenn er es erreicht hat; der Knabe kann stolz sein auf sein Kartenhaus und kann, wenn er davor steht, sich so groß fühlen wie Bramante vor der Peterskirche. – Aber ich kann nach so göttlichen Hoffnungen nicht gleich einem Thiere genießen; ich will und kann nicht theilnehmen an dem ermüdenden Spiel, das die Menschen Leben nennen, an dem Spiel, bei welchem so Viele ringen, so viele weinen, so Wenige genießen, und bei welchem schließlich Niemand etwas Anderes findet als Zeitvertreib; ich will nicht mächtig sein, da ich meine Nichtigkeit fühle, kein Sclave, da ich von den Schwächen meiner Tyrannen überzeugt bin; ich habe mich genug mit diesen Larven abgegeben, und jetzt, nachdem ich ihre Falschheit erkannt habe, sehnt sich mein Herz nach Ruhe. – O erhöre mich, Allmächtiger, und schicke mir den Tod! – Nicht um himmlische Seligkeit, wie einst, nur um Vernichtung bitte ich Dich! o erhöre mich! Gib den Elementen, aus welchen ich bestehe, ihre Freiheit wieder; dieser Körper soll Staub werden, was er einst gewesen; schaffe aus ihm Raupen, Blumen, Steine, was Du willst, nur keinen Menschen mehr, und ich bin zufrieden.
Aber gedulde dich, mein Herz, denke, daß du sterblich bist; und ist dies nicht Trost genug?
Heute war ich beim Ordensgeneral; nach dem Morgen-Gottesdienst ließ er mich zu sich rufen. Ein ernster, strenger Mann, der seiner Tugend wegen sowohl unter den Mönchen, als in der ganzen Gegend in hoher Achtung steht. Wie man sich erzählte, beging er in seiner Jugend, von Leidenschaft hingerissen, während der großen Revolution große Grausamkeiten, und als dann Napoleon Kaiser wurde, ging er, seine Thaten tief bereuend, in's Kloster. – Jetzt ist er ein Greis, aber einer von jenen, welche die Zeit zu beugen, jedoch nicht zu brechen vermochte; noch glänzen seine Augen unter der mit tiefen Falten durchfurchten Stirn, das bleiche Greisenantlitz verlor nicht seinen männlichen Ernst, und seine hohe Gestalt, obwohl zur Erde geneigt, behielt jene Würde, welche ihr schon früher eigen war. Er ist eine Ruine, aber gleichsam die Ruine eines Triumphbogens, dem jedes Jahr stückweise den Schmuck nimmt, der aber seine Form nicht verliert und dem man es bis zum letzten Tage ansieht, daß er dem Ruhme errichtet wurde.
»Du hast Briefe erhalten, mein Bruder!« sprach der Greis und gab mir zwei Briefe in die Hand, den einen von meinem Vater, den andern von meinem Freunde. »Ich habe auch ein Schreiben erhalten von Deinem Vater,« fuhr er fort; »Dein Vater läßt Dich bitten, daß Du nach Hause kehrest. Geh'!«
Verwundert schaute ich ihn an. »Also willst Du mich vertreiben?« sagte ich endlich, »ich habe diese Mauern als Ruhestätte ausgesucht, und warum schickst auch Du mich von hier fort?«
»Dich vertreiben? Nein,« sprach er ruhig, »das werde ich nicht. Das Haus des Herrn steht Jedem offen, und es steht mir, seinem Knechte, nicht zu, den Unglücklichen von dessen Schwelle zu vertreiben, wo derselbe eine Ruhestätte sucht, wie einstens ich; – ich will Dich nur ermahnen: – bedenke, daß dem Menschen jeden Augenblick die Freiheit dazu nöthig ist, um glücklich zu sein, und daß Du noch zu jung bist, um ihr entsagen zu können; bedenke, daß diesem Augenblick, in welchem Du, Dich und Deine ganze Zukunft einem Vorsatz unterwerfend, die höchsten Wonnen Deines freien Willens genießest, die Jahre langer Knechtschaft folgen werden, in welcher es Dir untersagt ist, einen Willen zu haben. – Bedenke, daß Zeiten kommen können, in denen Du gealtert, die Schmerzen Deiner Jugend nicht verstehen und Deinen Vorsatz vielleicht verfluchen wirst, der Dich so vieler kleiner Freuden beraubte.«
»Ich habe Alles dies bedacht.«
»Du sprichst ein stolzes Wort,« sagte der Greis ruhig, »und nur in Deinem Alter spricht man es so entschieden aus. Du kannst im voraus bedenken, wie Du Dein Feld bestellen und was Du nach Deiner Saat ernten wirst; Du kannst bedenken, wie Du Dein Haus bauest, damit es dauerhaft sei und Dir ein sicheres Asyl für Deine alten Tage biete; – aber Deine Zukunft kannst Du Dir nicht vorstellen. – Ein Gedanke, unverhofft auf Deine Seele fallend, dem Samen gleich, den der Herbstwind auf die Erde streut – davon hängt Deine Zukunft ab, und wehe Dir, wenn dieser Gedanke, der in Deiner Seele großgewachsen ist, der seine Zweige über Dein ganzes Dasein hinbreitet und gleichsam mit Deinem Leben verwuchs, mit Deinen Verhältnissen im Widerspruche steht und Du dieselben nicht zu ändern vermagst.« »Nun, dann segne mein Geschick,« sprach ich, tief ergriffen von seinen Worten, »daß ich eine Welt verlassen, die mit dem Grundgedanken meiner Seele im Widerspruch stand, daß ich mich vor einer Welt retten konnte, welche die heiligsten Gefühle meines Herzens mit Spott besudelte, bis endlich mich selbst vor meinen Götzen Ekel erfaßte.«
»Und glaubst Du, daß der Mensch im Kloster besser, glücklicher werde?« sprach der Greis, einen bekümmerten Blick auf mich werfend. »O glaube das nicht; viel Trübsal wohnt in diesen Mauern, das Ihr in der Außenwelt nicht ahnet, und von so vielen leidenden Herzen heilten vielleicht außer jenen, die draußen im Kirchhofe ruhen, kaum einem die Wunden zu. Nur der Glückliche kann der Welt entsagen; nur Derjenige, dessen Seele ein starker Glaube und ein großes Hoffen erfüllt, kann sich im Kloster glücklich fühlen. Wie die Sonne, Alles mit ihrem Lichte erfüllend, Alles mit ihren warmen Strahlen durchdringend, so ist der große Gottesgedanke; wer ihn in der Schöpfung sucht, wird ihn überall finden, aber wehe Dem, der seinen Blick direct nach ihm richtet; mit erblindeten Augen steht er im Finstern. Und ist nicht dieser große Gedanke die ganze Habe des Mönches? Und wenn er auch diese verliert, wenn ein Zweifel – – Was ist ein Zweifel Dem, der in der Welt lebt? Sein ist der Frühling und die blühende Natur und hundert Freuden und hundert Schmerzen; der Karthäuser besitzt nur seinen Zweifel, dieser ist seine Welt, in der er lebt, für die er leidet, die, in der fürchterlichen Erscheinung der Wirklichkeit vor ihn tretend, seine schwache Seele darniederdrückt. Sehr wohl ahnte dies der heilige Bruno, der Stifter des Ordens, indem er, von den Qualen des Gottesleugners sprechend, diesen in seiner Hölle also reden läßt: »»O gebt noch neue Qualen zu denen, die ich schon leide; laßt mich durch alle Ewigkeit durch Millionen neuer Henker zergliedern, nur beraubt mich nicht ganz meines Gottes, die verzehrenden Flammen werden mir Rosen, die Wuth der Teufel sanfte Umarmungen, das Wehegeschrei dieser Kerker reizende Musik, diese fürchterliche Behausung ein herrlicher Palast dünken; nur von der furchtbaren Qual sei ich befreit, welche ich jetzt, erleide nur meinen Gott möge ich wieder ausfinden.«« O glaube mir, es wohnen Menschen in diesen Mauern, die diese Qualen erlitten, und es gibt keine andern in dieser Welt, welchen Du diesen vergleichen könntest! Denn glaube mir, man kann Trost auf der Erde finden, man kann ihn finden auch nach den größten und schwersten Bitternissen. Betrachte nur diesen Berg; einst war er, wie es scheint, ein Kegel, jetzt fehlt ein Stück zu seiner Vollkommenheit, und unten im Thale erhebt sich ein Hügel, kaum durch etwas Anderes auffallend, als durch die großen Felsstücke, die zerstreut auf ihm liegen. Auf dem Berggipfel stehen jetzt hohe Tannen und auf dem Hügel im Thale ist Alles mit Grün und Blumen bedeckt. Wer würde glauben, daß er die Trümmer einer Erdumwälzung sieht? Wer würde glauben, daß hier, wo jetzt Alles grünt, einst auf dem Gipfel eine große Erdwunde klaffte, unten im Thale sich Verwüstung ausbreitete? Und sieh', so wie dies, steht Alles in der Welt, was Du schön nennst – Alles nur auf Schauplätzen der Verwüstung, die durch die Zeit verschönert wurden; die ganze Welt ist eine große, prächtige Ruine, welche die Zeit mit ihrem Schleier verhüllte – und so ist auch unser menschliches Leben, dessen Freuden nichts Anderes sind als Blumenhüllen mit denen die Zeit die einst blutenden Wunden unseres Herzens bedeckte.«
»Und glaubst Du nicht,« fragte ich den Greis, »auch an einen unheilbaren Kummer?«
»Ich glaube nicht daran,« versetzte ruhig der Greis, »jeder Schmerz ist sterblich, und wenn es welche gibt, die lange währen, so ist dies nur deshalb, weil wir sie selbst genährt haben, und selbst dann erhalten sich zumeist nur die Worte unseres Grames und nicht unsere peinlichen Gefühle, gleichwie auf Grabsteinen, lange nachdem die letzte Thräne vertrocknet ist, noch dieselben Worte zu lesen sind, obgleich die Zeit längst deren Sinn zur Lüge umgewandelt.«
»Du magst Recht haben,« sagte ich zum Greise, »und Du hast Recht bezüglich der Mehrzahl der Menschen; aber es gibt Menschen, die Gott zu ihrem eigenen Unglück aus anderem Stoff geschaffen.«
»Und Du bist einer von diesen, nicht wahr?« sagte traurig lächelnd der Greis; »wer hätte dies nicht einmal in seinem Leben gedacht, wer hätte nicht unersetzliche Verluste und eine ewige Liebe? – Aber werde so alt wie ich, und sage dann, was von alledem bleibt. – Eine traurige Erinnerung, welche unverhofft in Deiner Seele auftaucht und Deine Lippen zu einem bittern Lächeln verzieht; vielleicht nicht einmal das. Wie der Spieler, der die Nacht beim grünen Tische des Lebens; glücklich warst Du und unglücklich, oft hast Du gewonnen und oft verloren; aber wie oft und auf welche Karten, wer weiß das? Genug – Du hast gespielt und gehst jetzt wahrscheinlich in Dein Bett zur Ruhe. Glaube mir, es gibt keine Erinnerung auf Erden, von welcher Du nicht gerade den bittersten Theil mit der Zeit verlierst.«
»Wenn dem so ist,« sprach ich wieder, »warum sollte ich nicht im Kloster bleiben, damit ich, das Vergangene vergessend, mein Herz wenigstens vor neuen Schmerzen bewahre?«
»Weil wir im Kloster nicht so leicht vergessen!« sprach der Greis seufzend. »Und jetzt gehe in Dein Zimmer, mein Bruder, lies Deine Briefe und bedenke wohl Dein Vorhaben. Du verbringst ein Probejahr in diesen Mauern, und wenn dieses verflossen ist, werde ich Dich wieder fragen, und wenn sich Dein Wille nicht geändert, so sollst Du willkommen sein in unserem Kreise.«
Also hast Du mich noch nicht vergessen, mein guter Wilhelm, und sandtest mir Deine lieben Zeilen nach in die Einsamkeit, damit sie mich trösten! Nimm meinen Dank für Deine Treue, aber glaube nicht, daß Du mich jetzt noch heilen könnest.
Als ich vor fünf Jahren um diese Zeit krank darniederlag und Du mich zurückrissest von der Schwelle des Todes, da war ich geistig und körperlich noch ein Jüngling. Jetzt ist meine Seele gealtert. Während Du mit stillem Fleiße bei Deinen Kranken thätig warst, lebte ich in Paris; und es ist dies eine wunderliche Stadt, in welcher das Volk binnen fünfzig Jahren ein Jahrtausend durchlebt und in welcher der Jüngling in Tagen sich die Erfahrungen von Jahren erwirbt. Ich bin ein Greis, und nicht einmal die allmächtige Liebe kann meine Krankheit mehr heilen.
Du wünschest die Geschichte meines Lebens zu kennen? Ich will sie für Dich niederschreiben: nicht als ob ich, wie Du meinst, hoffte, daß sich mein Schmerz lindern werde, wenn ich ihm männlich entgegentrete: nicht als ob ich glaubte, daß mir meine Lage weniger hoffnungslos erscheinen werde, wenn ich die Verhältnisse derselben überdenke; nicht deshalb: ich will Dir nur beweisen, daß ich Dich liebe, weiter nichts. Nachdem in unserer Zeit so viele für hervorragend gehaltene Persönlichkeiten ihre kleinsten Erinnerungen aufzeichneten, mag es interessant sein, wenigstens Dir, die Memoiren eines jener Unzähligen zu lesen, die an diesen großen Umwälzungen nur passiv theilnahmen und auf welche dieses Jahrhundert wie auf einen Stoff wirkte. In diesen Blättern liesest Du die Geschichte Hunderter von Jünglingen, die traurigste Geschichte, weil Alles, was Du in diesen Blättern lesen wirst, wahr ist, und weil Du Dir zu Deinem Tröste immer sagen kannst, daß Dein Freund um nichts unglückseliger war als Tausende, die mit ihm zugleich lebten.
Ich sehe Dich lächeln, wie immer, so oft ich von dem exceptionellen Zustand unseres Zeitalters sprach, und Du erzähltest, wie auch ihr unglücklich wäret, und vor Euch Eure Väter, und vor ihnen Andere, seit Anbeginn der Welt. »Glaube mir,« so sprachst Du oftmals, »der Mensch rang stets nach Glück; er fand viel Gutes und Nützliches in diesem Kampfe, aber gleich dem Alchymisten niemals Das, was er gesucht. Allen Jenen, die gelebt, war das Glück immer nur eine Hoffnung oder eine Erinnerung, und jede Nation besitzt ein Paradies oder ein Hesperien in ihrer Vergangenheit und ein Himmelreich oder ein Elysium in ihrer Zukunft, aber keine einzige erreichte es!« und Du magst Recht haben. Schon als Kind, als mir meine Amme noch von Riesen oder Zwergen erzählte, oder von der großen Magnetinsel, wußte ich immer, daß sie mir nur ein Märchen erzählt habe, sobald sie mit den Worten schloß: und dann wurden sie glücklich. Aber unser Zeitalter hat einen Schmerz, den frühere Jahrhunderte, wenigstens in solchem Maße, nicht gekannt haben, und dies ist jene Zweifelsucht, welche sich jetzt über alle Lagen unseres Lebens verbreitet, Alles erniedrigend, was uns erhoben, verleugnend, was uns beseligt, und Das raubend, ohne was wir nicht leben können. Einem Tantalus gleich steht das Menschengeschlecht zwischen der Vergangenheit, welche, wie das Labung versprechende Wasser dahinließt, so oft man sich darnach bückt und schöpfen will, und zwischen der Zukunft, welche uns ihre fruchtreichen Zweige entzieht, so oft wir darnach die Hand ausstrecken; es ist das Los der Menschheit, überall Linderung zu sehen, und zu fühlen, daß sie verflucht sei, weil ihre Wünsche unerreichbar sind. Stehen wir vielleicht schon auf den Trümmern einer zusammengestürzten Welt, zwischen deren zerfallenen Bauwerken unserem Geschlechts nichts Anderes übrig blieb, als Verzweiflung oder Tod? Oder in einem Chaos, welches gleich jenem, aus dem Gott unsere Erde gestaltete, die Keime eines neuen Paradieses in sich trägt? Ist es schon Nacht um uns her geworden, oder ist es der erste Strahl einer neuen Sonne, die uns so blendet? Wer weiß es? Wir sind unglückselig – und nicht immer liegt die Schuld an uns.
O, nicht ich, nicht ich trage Schuld au meinem Gram. Du, der Du mich kennst, weil Du mich geliebt, sage selbst, war ich nicht einst von Hoffnungen erfüllt, erglühte dieses Herz nicht für Alles, was es für edel hielt, entflammte sich meine Phantasie nicht bei jedem erhabenen Gedanken? Und wenn ich jetzt entsagend dastehe, und vereinsamt, und verzweifelt, bin ich etwa schuld daran? – ich, der ich auf meinem Lebenspfade überall entschlossen hintrat und mir einen Kreis verlangte und ihn nicht fand, – dessen Brust, nachdem sie ihre ersten Triebe zerstört sah, so reich an neuen Hoffnungen war, und beraubt auf's Neue grünte, bis sie endlich verödete wie die Wiese, deren fruchtbaren Boden der von Sommergewittern angeschwollene Bergbach mit seinen Felsen bedeckte! – O, ich habe nach Glück gerungen, verzweifelt kämpfte ich mit meinem Geschicke; wie der leidenschaftliche Spieler, der früher sein ganzes Vermögen verloren und bettelnd herumgeht, und wenn er einen Heller bekommen, wieder dorthin geht, wo er sein Alles verloren, und wieder seine Habe hinwirft, so kämpfte ich mit verzweifelter Standhaftigkeit mit meinem Geschicke, und wenn ich zuletzt Alles verloren habe, zuerst die reichen Hoffnungsschätze der jungen Brust, dann auch die kleinen Lebensfreuden, bei denen ich Trost gesucht, bin ich schuld daran, oder nicht vielmehr das Spiel selber, in welchem wir nicht gewinnen können?
Aber lassen wir das; wenn Du einst meine Geschichte kennen wirst, wirst Du selbst sehen, daß dort, wohin Du mich zurückrufest, für mich kein Platz ist. Dieses Herz hat genug Schiffbruch erlitten, und wenn es zerstört sich ein Friedensufer suchte, so that es dies, glaube mir, nur deshalb, weil es nicht mehr im Stande ist, den Stürmen des großen Meeres zu widerstehen. Ich war müde und kam in den Schatten dieser Mauern, um auszuruhen, wie der Arbeiter, den die Hitze des Mittags ermattete, unter dem Baume ausruht, bis der Schlaf seine Augen schließt. Laßt mich ruhen.
Ungefähr eine halbe Stunde westlich von Avignon steht ein Haus; wenn Du von Nimes kommst und auf den Garda-Hügeln hinabsiehst gegen den Rhone, blinkt es Dir weiß entgegen jenseits des Flusses, und wenn Du den großen Raum übersiehst, zu welchem sich die diesseits des Flusses hügelige Gegend verflacht, so ist es unmöglich, daß es Dir nicht in die Augen falle, so weiß ließ es dessen jetziger Besitzer malen, so sehr sind dessen Mauern in absonderlicher Form gebaut. Wenn man dem Gebäude näher kommt, erscheint sein Aeußeres noch sonderbarer, und wie gelehrt Du auch seist, Du wirst sein Alter nicht bestimmen können. In seinen Mauern findest Du hie und da auf einem Steine eine römische Inschrift, welchen einer der Besitzer, als er Steine brauchte, aus dem Gardaer Aquäduct oder aus den Nimser Ruinen holte; hie und da stößest Du auf eine maurische Arabeske, die vielleicht in Arls angefertigt wurde, während eine mächtige viereckige Tafel über dem gothischen Thore an das Zeitalter Richelieu's erinnert. Die Fenster sind zum Theile gothisch, zum Theile viereckig, ohne Ordnung in die Mauer geschnitten, wie eben der eine oder der andere Besitzer des Hauses Licht benöthigte. Jahrhunderte bauten an diesem Hause, und an seinem Gesteine sieht man die zerstörende Wirkung von Jahrhunderten; an der Außenwand den Riß, welchen die Männer der Ligue mit ihren Kugeln hervorbrachten, innen im Hofe die zerbrochenen Schilde, an denen während der 89er Revolution der Bauer seine Rache ausübte, während der saubere Anstrich und die reichen Oelbaumpflanzungen ringsherum die Ordnungsliebe und Wohlhabenheit des jetzigen Besitzers verkünden. Aber wie sonderbar auch dieses Haus scheine, es gleicht seinem Besitzer. In einem der bewegtesten Zeitalter des Menschengeschlechtes lebend, trägt auch er die Spuren aller jener Veränderungen an sich, die er durchgemacht: – aus den Erinnerungen seiner ersten Jugend den Familienstolz, in dem er erzogen wurde, und welcher, wie der gothische Zierrath unter dem Mörtel des Hauses, in seinem Betragen, trotz seiner Grundsätze und der Anstrengung, ihn zurückzuhalten, hie und da durchblickt; aus der Revolution die feste Thatkraft und die Irreligiosität, die Ruhmsucht des Kaiserreiches und die Kleinlichkeit der Restauration; auch er ist das Werk eines langen Zeitalters, auch er ist längst nicht mehr Das, was er war, sondern wozu ihn die wechselnde Nothwendigkeit gestaltete.
Dies ist das Haus, worin ich geboren wurde, dieser Mann ist mein Vater. Jetzt ist der Anblick dieses Hauses traurig; obwohl es noch rein und wohnlich zu sein scheint, zeigt dennoch das auf den Gartenwegen hie und da aufgeschossene Gras oder ein Stückchen herabgefallenen Mörtels deutlich, daß dessen schönere Tage vorüber sind, und wenn Du den Hausherrn siehst, wie er allabendlich allein die hochgewachsene Allee entlang geht, die er einstens selber gepflanzt, und er, während der leichte Abendwind in seinen weißen Locken spielt, so ernst vor sich hinstarrt, als fühlte er nicht die warme sommerliche Berührung; oder wenn er im großen gothischen Saale an seinem Tische sitzt, hundert geöffnete und zur Hälfte ausgeschnittene Bücher und Zeitungen vor sich, welche er nach einander nimmt und liest und beiseite wirft, so wirst Du einsehen, daß auch die schöneren Tage des Hausherrn längst vorüber sind, und daß er und seine Behausung zerfallen werden. Denn die einst der Genius dieses Hauses und der Engel des Mannes war, sie ist geschieden, und seither ist Niemand da, der die kleinen Risse der Mauern ausbessern läßt, und der die Falten des Mannes glättet, wenn ihm Sorgen die Stirn furchen; was Wunder, wenn der Riß sich erweitert und die Furche sich tiefer einprägt!
Geh' an das Ufer des Rhone, und wenn Du vier Bäume siehst und darunter einen weißen Stein, so bleibe stehen und wisse, daß Du am Grabsteine eines Familienglückes stehst, denn unter demselben ruht meine Mutter.
Es gibt Frauen, bei deren Anblick sich das Herz unwillkürlich öffnet, in deren Kreis Du Dich glücklich und besser und edler fühlst; Frauen, die Gott gleichsam zum Troste in den Leiden des Lebens geschaffen, die als Segen gesendet sind, damit sie Glück verbreiten. O, es gibt solche Frauen; wenn Du in das Haus trittst und Dir überall Freude und Zufriedenheit entgegenlächelt, und Alles gedeiht und blüht, so ist sie die Seele, die Alles durchdringt und Allem Leben gibt. Die schwierigsten Verhältnisse des Lebens zugleich mit ihrem Gatten ertragend, achtet sie nichts für zu gering, auch nicht die kleinste häusliche Sorge; nichts ist so groß, daß sie davor zurückschrecke, nichts so gering, daß es sie verdröße, denn der große Zweck alles dessen ist – die Liebe; als hätte der Schöpfer sie dem ernsten Manne als Mond beigesellt, damit sie, seiner Anziehung folgend, nur um ihn sich bewege, und wenn auch verborgen, so lange an seinem Himmel die Sonne glänzt, auftauche, sobald es Nacht geworden über ihm und er ihrer Leuchte bedarf. Eine solche Frau war meine Mutter.
Was soll ich erzählen von den Jahren, welche ich im Kreise dieses Engels zugebracht, wie sie mir das blonde Haar glättete, wie sie mir allabendlich lange schöne Geschichten erzählte, wie sie mir die Thränen mit ihrer weichen Hand trocknete, wenn ich weinte? Und wie soll ich alle jene Kundgebungen der Sorgfalt aufzählen, mit denen sie mich so sehr beglückte, und alle jene große Aufopferung, mit der sie mich vor den kleinsten Uebeln bewahrte? Wenn Du eine solche Mutter hattest, so weißt Du dies Alles gut; hattest Du sie nicht, so kannst Du meine Glückseligkeit nicht verstehen.
So wurde ich acht Jahre alt, da starb meine Mutter. – Noch am letzten Abend rief sie mich zu sich und sah mich lange an; endlich begann sie zu weinen, mit Mühe erhob sie sich von ihrem Lager, drückte mich an ihre Brust und sagte, indem sie mich segnete, ich möge weggehen; eben läutete man in der Dorfkirche die kleine Glocke, und als ich auf den Hausflur trat, kam mir der Geistliche entgegen, aber ich legte mich ruhig nieder und schlief ein, nicht wissend, was dies Alles bedeute. – Am andern Tage ging ich des Morgens in ihr Zimmer und fand sie aufgebahrt. – Man sagte mir, daß sie gestorben sei und daß ich beten solle; aber ich glaubte es nicht, sondern ging zu ihrem Lager und redete sie an – sie antwortete nicht. – Ihr Antlitz war sanft wie immer, nur blässer; aber die geschlossenen Augen öffneten sich nicht wie sonst, wenn ich an ihr Bett trat. – Ich küßte ihre Hände und sie waren kalt wie das Kreuz, welches sie hielten; ich sank an ihr Herz, aber es schlug nicht. – »Was bedeutet das?« frug ich mich selbst. Und verwundert stand ich da, während die Dienstboten um mich her laut schluchzten. – »Gehen Sie weg,« sagte endlich ein greiser Diener zu mir, der meine Mutter noch als Kind gekannt, »gehen Sie weg, sie ist todt.« – »Glauben Sie das nicht, Johann,« sagte ich mit gepreßtem Herzen, »sie schläft nur, sie wird gleich erwachen, sobald sie weiß, daß ich da bin.« Und ich redete sie auf's Neue an, und auf's Neue sank ich an ihre Brust und küßte ihre kalte Hand – und wieder – und nochmals – aber vergebens. Ich war außer mir, meine Thränen flossen stromweise. – »Was bedeutet das?« schrie ich verzweifelt. – »Sie ist gestorben, lieber junger Herr,« sagte der alte Diener, »Sie sehen, sie ist schon ganz kalt und ihr Herz schlägt nicht.« – »O, sie ist todt,« erwiderte ich mit brechendem Herzen, »sie kennt mich nicht mehr, sie liebt mich nicht mehr.« Gleich einem Schleier breitete sich der Schmerz über meine Sinne und bewußtlos fiel ich dem Greise in die Arme.
Als man sie am dritten Tage bestattete und ich sie nach langen Bitten noch einmal im Sarge ansehen durfte, war ich ruhiger. Alle sagten, daß sie im Himmel sei, und ich war überzeugt, daß auch ich sterben würde. Aber als man den Sarg zunagelte, aus unserem Hause trug und mit langsamen Schritten immer weiter und weiter bis an's Ufer des Rhone kam, als man ihn in's Grab hinabließ und so viel kalte, schwere Erde darauf warf – da brach mein Schmerz auf's Neue hervor, und beinahe als Feinde erschienen mir alle die Leute, die mich meiner Mutter beraubten und sie begruben. Als ich nach Hause kam, kniete ich verzweifelt vor dem Kreuz im Zimmer meiner Mutter nieder, wo sie mich beten gelehrt, und flehte zu Gott, daß er mich auch sterben lasse.
Tage und Wochen und Monate vergingen, und ich war untröstlich; Alles, was ich sah, wovon ich sprach, erinnerte mich an meine Mutter; das Haus, in dem Alles leer erschien seit ihrem Tode, der Hügel am Ufer des Rhone, und die Stille, wenn ich Abends nach Hause kam und Niemand da war, der mir Geschichten erzählte, – die Glocke, wenn sie ertönte, Alles erinnerte mich an sie. Ich hielt mich für den unglücklichsten Menschen der Welt.
Ein sonderbarer Zufall gab meinen Gedanken eine andere Richtung und mir dadurch Trost. – Eines Abends, ich kehrte eben vom Grabe meiner Mutter zurück, bemerkte ich nahe an unserem Thor einen kleinen Bettelknaben. Er sprach mich an, und da ich nichts hatte und mein Erzieher ein Geizhals war, so gingen wir weiter; der Knabe folgte uns bittend, flehte und jammerte so sehr, daß ich zuletzt, meine Schüchternheit überwindend, ihn ansprach und meinen Erzieher beinahe zwang, daß er ihm Almosen gebe. – Er beachtete meine Bitte kaum und ging weiter. »Mutter, Mutter!« schluchzte der Knabe. Meine Augen schwammen in Thränen, als ich ihn fragte, ob seine Mutter auch gestorben sei. »O nein,« antwortete der Knabe, »sie hungert schon den dritten Tag.« – Ich schauderte, und als ich, von meinem zankenden Hofmeister mich trennend, die bleiche Frau sah, und als ich sie in unser Haus rief und das arme verkümmerte Weib kaum folgen konnte: da fühlte mein Herz zum ersten Male, daß es größere Leiden auf der Welt gibt, als den Tod, und daß es wohl ein Schmerz ist, um dahingeschiedene Lieben zu weinen, daß aber Derjenige noch glücklich ist, der wenn er an seine Lieben denkt, keinen andern Grund zum Weinen hat.
Wehe Dem, der sich darauf verläßt, daß man ihn nicht vergessen wird! Wenn er sein Vertrauen auf eine Nation gesetzt, der er sein Leben geopfert, oder auf ein Individuum, das er geliebt, einerlei, er wird sich täuschen; kurz ist das Gedächtniß des Menschen. Möge man seinen Namen auf Marmor schreiben, oder Blumen zum Andenken auf sein Grab pflanzen, Jahre verwischen auch dort seinen Namen, und im nächsten Frühling bleibt vielleicht keine einzige der ungepflegten Blumen auf seinem Grabe. Mit der Zeit senkt sich der Grabhügel, das Grabgewölbe füllt sich aus, um nach längerer oder kürzerer Zeit vergessen zu werden, das ist unser Aller Loos. Wenn die Sonne hinter die Berge hinabtaucht und eine Fluth von Strahlen sich über die ganze Gegend ergießt, so daß Deine Augen den Glanz kaum ertragen können, wer würde da glauben, daß in einer Stunde auch nicht die geringste Spur der untergegangenen Sonne am Himmel bleibt, der so sehr mit ihren Strahlen erfüllt war, als sie schied; und wer würde glauben, daß das Meer, wenn es brausend wogt unter den Schlägen des Sturmwindes, daß es trotz des Sturm endlich doch ruhiger wird, und daß von diesen hohen Wogen zuletzt nichts weiter bleibt als hie und da eine kleine Welle, welche von Zeit zu Zeit sich an's Ufer schmiegend bricht; und wer würde es glauben, daß von jenem Manne, an dessen frischem Grabe Nationen weinten, nichts als ein leerer Name übrig sein wird, mit dessen Kenntniß der Gelehrte prahlt, und daß das Weib oder Kind, welches wir an einem Grabe im Schmerz erstickt sahen, nach Jahren, wenn ein Stück schwarzen Lappens ihnen in die Hände geräth, nicht gleich wissen werden, zu wessen Trauer sie es getragen. – Fürchterlich, aber wahr. – Wir werden zu Nichts, selbst in den Herzen unserer Lieben, und diesseits wie jenseits des Grabes sind unsere Hoffnungen nur Täuschungen. – Und dennoch, wie schön ist die Hoffnung, wie beseligend der Gedanke, daß, wenn wir nicht mehr sein werden, etwas von uns erhalten bleibt: eine That, bei deren Erwähnung das kommende Geschlecht sich begeistert, ein Lied, in welchem, wenn es von Mund zu Mund geht, eine unserer glücklichen Stunden nach Jahrhunderten aufersteht, oder wenigstens irgend ein Familien-Angedenken aus unserem häuslichen Leben, bei dessen Erwähnung die Augen in Thränen überfließen und von Lippen uns Segen nachtönt. Nutzlose Schwärmerei! – Jüngling, der Du von ewigem Ruhme geträumt, und Du, Greis, der Du, so lange Deine Kinder leben, in ihrem Andenken fortzuleben hofftest, Ihr habt Euch getäuscht, wie Alle, die auf die Nachwelt vertraut; wenn nicht etwas Anderes, so werden neue Todte Euch verdrängen, und wie groß auch der Schatten war, den ihr warft, als Eure Sonne zu sinken begann, glaubt mir, er verschwand, als sie untergegangen war; es war eben nur ein Schatten gewesen. – Was kann auf dieser Erde von Dauer sein, wenn selbst ich meine Mutter vergessen konnte – – sie, die bisher mein Alles gewesen, die nur für mich gelebt, deren jedes Wort, jeder Gedanke meinem Leben ein Segen war, und ich den nach ihrem Tode Niemand mehr so geliebt, wie sie, und der ich dies fühlte – sie dennoch vergaß!
So lange ich in unserem Hause war, wo mich Alles an sie erinnerte, und ich in unseren alten Dienstboten eben so viele Verbündete meines Grames sah, konnte natürlich mein Schmerz nicht aufhören, wenngleich Zeit und Gewohnheit ihn milderten und ihn beinahe zu einem beglückenden Gefühle umwandelten. Doch mein Vater, der zwar nicht gefühllos war, aber nur für die praktische Seite des Lebens Sinn hatte, fürchtete – vielleicht weil er im Forschen nach der höheren Bedeutung des Lebens nur Zweifel gefunden, oder weil er in einem Zeitalter geboren ward, das nach so viel Täuschungen zuletzt mit verzweifelter Resignation gleich dem zu Grunde gerichteten Spieler nur um Dinge von conventionellem Werthe spielte – nichts so sehr, als daß meine Sentimentalität, durch diesen stets genährten und gepflegten Schmerz gesteigert, mich zuletzt lehren werde, mit poetischer Verachtung Das gering zu schätzen, was er jetzt allein verehrte. Er schickte mich in das Freiburger Collegium, welches eben damals den Jesuiten übergeben worden war, in der Hoffnung, daß ich nicht allein meinen Schmerz vergessen, sondern auch als Zögling des unter der Restauration so sehr beliebten Ordens in der Welt Carrière machen werde.
Wie schmerzlich mir der Abschied fiel, wie viel Thränen ich am Grabe meiner Mutter und in den Armen unseres greisen Kammerdieners weinte, kannst Du Dir denken; ich wußte, daß ich mich auf Jahre entferne, daß ich unter fremde Menschen kommen werde, die mich nicht lieben, und während ich mit gepreßtem Herzen auf allen meinen alten Spielplätzen und unter so vielen kindlichen Erinnerungen umherging, fiel es mir ein, daß ich gehen müsse, und eine traurige Ahnung beschlich mein Herz.
So verließ ich das Haus, wo selbst der große Hofhund, der unserem fortrollenden Wagen bellend folgte, meiner Seele ein theures Wesen war, von dem es mir schwer fiel, zu scheiden, und so gelangte ich nach Freiburg, wo zwischen den Mauern des großen, ernsten Collegium-Gebäudes meine Schmerzen, die ich im Wechsel der Gegenden bereits zu vergessen begonnen, auf's Neue erwachten. – Denke Dich in meine Lage. – Ich, der glückliche Knabe, vor dem Garten und Wiese stets freigestanden, der ich dieß meine kleine Welt in ungezügelter Freude durchtummelnd, frei war, der, wenn er in seinen Spielen ermüdet war, stets Jemanden hatte, der ihn auf die Knie nahm und streichelte, ich fand mich jetzt plötzlich zwischen Kerkermauern unter so vielen ernsten Gesichtern, unter so vielen kalten Aufsehern. – Auch wenn wir selbst nicht glücklicher waren, ahnen wir Männer unter unseren vielen Leiden selten, wie groß oft schon die Schmerzen des Kindes sind. Seinem häuslichen Kreise, wo er glücklich war, entrissen und in die lieblose Ordnungsmäßigkeit eines Erziehungs-Institutes gedrängt, beweint auch der Knabe eine ganze verlorne Glückseligkeit, fühlt auch er, wenn sein tyrannischer Erzieher über ihn mit der unbeschränkten Macht des Stärkeren herrscht, alle Leiden der Knechtschaft und Unterdrückung, die Verlassenheit, in der ihn seine Eltern ließen, und Alles, was Männer fühlen und was dem Samen gleich in seinem Herzen lange verborgen keimt und wächst, bis es zuletzt aufsproßt und Früchte trägt. – Und wenn Du manchmal Männer siehst, und Du kannst in heutiger Zeit viele finden, die von Freuden umgeben, weil sie Das beinahe erfüllt sehen, was sie in glücklicheren Zeiten nur gehofft, sich dennoch nicht freuen können, so sei gewiß, daß der Gram, der ihre Seele wie mit einem Schleier überzieht, sich seit den Tagen ihrer Kindheit fortspann, und wenngleich die Ursache längst aufgehört hat, oder jetzt als Kinderei erschiene, so sehr gewachsen ist, daß alle Freuden des Lebens ihn nicht zu zerstreuen im Stande sind.
Das eben ist die traurige Seite unseres Geschickes, daß wir in jenem Abschnitte unseres Lebens, welcher auf unsere ganze Zukunft Einfluß hat, gewöhnlich dem Zufall oder, was noch ärger ist, sinnlosen Einwirkungen überlassen sind, und daß, bevor wir uns noch zu etwas bestimmten, unsere ganze Zukunft bereits durch unsere Erziehung entschieden wurde. – Deshalb vertraue Niemand auf den leichten Sinn des Kindes oder darauf, daß, weil es vergessen kann, Schmerzen und Freuden spurlos an seiner Seele vorübergehen. Wenngleich Lethe den Mann von seinem ersten Lebensalter trennt, und wenn auch einzelne Erinnerungen mit der Zeit verschwinden und einzelne Gefühle ihre Süßigkeit oder Bitterkeit verlieren; er selbst hat sich nicht geändert, und am jenseitigen Ufer steigt nur Der aus, welcher am diesseitigen eingestiegen, und ist Gold, wenn ihm die Erziehung die Schlacke, oder Schlacke, wenn ihm die Erziehung das Gold genommen. – Nicht nur der herabgesunkene Apfel Newton's ist es, der große Folgen auf dieser Erde erzielte; es können kleinere Ursachen die Quellen eben so großer Wirkungen sein, und es gibt Menschen, welche ein Wort, mit dem ihre Eltern oder ihre Erzieher sie einst beleidigt, zu Menschenfeinden machte. – Und dennoch, welchen Leichtsinn sehen wir bei der Erziehung, besonders wenn das Kind zu seinem Unglück eines jener beneideten ist, die eine sogenannte schöne Zukunft erwartet. – Das schönste Verhältniß dieses Lebens, jenes, welches zwischen Mutter und Kind besteht, ist ihm unbekannt. An der Brust einer fremden Amme aufgesäugt, von fremden Lippen seine ersten Worte ablauschend, von fremden Händen geführt, bis es zu gehen anfängt, fühlt das Kind in einer Gesindestube seine ersten Gefühle sich entwickeln. Und wenn es größer wird, sein Stammeln sich zum Sprechen entwickelt und das Herz, seinen Beruf fühlend, lieben will und zu lieben beginnt: ist das Wesen, an welches es sich in seiner ersten Leidenschaft klammert, nicht seine Mutter; sie ist fern, sie tanzt und wird bewundert; – das arme Kind sucht sich in dem Kreise des Gesindes ein Wesen aus, von dem es sich am meisten geliebt glaubt, und klammert sich an dieses. – O sieh' nur, wie es den Gegenstand seiner kindlichen Neigung mit seinen kleinen Aermchen umfaßt, wie es lächelt, wenn das geliebte Wesen ihm naht, wie es sich freut, wenn es nur dessen Schritte hört; das arme Kind weiß noch nicht, daß seine Eltern die geliebte Person nur auf Monate gedungen haben, damit sie ihr Kind liebe. – Manchmal führt man es in glänzende Säle, die Gesellschaft ist zahlreich, der Nachmittag lang, und man braucht Unterhaltung. Das Zimmer ist voll von Fremden und auf dem Sopha sitzt eine schöne Frau, die manchmal des Tages zu ihm kommt und von der man ihm so viel und so oftmal gesagt, daß es seine Mutter sei, bis es zuletzt mit schwerer Mühe es wissen lernte, daß sie es sei und daß es sie nicht anrühren dürfe; denn als das Kind sie jüngst in der Freude des Herzens umarmen wollte, stieß sie es zurück, damit es nicht ihre schön gekräuselten Locken derangire. Und als es eintrat, fragte einer aus der Gesellschaft: »Wo ist Deine Mutter?« Und das Kind zeigt auf die schöne Frau, und vor den Leuten, die ihm noch fremder sind, sich fürchtend, oder weil es Zuckerwerk sieht, welches von ferne winkt, läuft es dahin und bleibt dort, während die ganze Gesellschaft die Mutterliebe rühmt, bis endlich der edle Hausherr, mächtig gähnend, das Kind mit Einwilligung der Frau, die seiner lärmenden Fragen auch schon überdrüssig ist, in sein Zimmer zurückschickt, wo es wieder das Gesehene vergessend, spielen kann. – Wenn es nur unglücklicherweise nicht irgendwie verrathen hat, daß es seine Wärterin mehr liebt als seine Mutter! Die große Dame, die von der Liebe nichts hat als die Eifersucht, könnte ja leicht die einzige Freundin des Kindes – denn diese untergeordnete Person verwöhnt ja das Kind an sich – schmählich wegjagen und dem unerfahrenen Herzen zum ersten Male jenen Schmerz bereiten, welchen eine solche Trennung verursacht.
Und dies ist in den ersten Lebensjahren des Kindes jenes aus Kurzweil und Tanzstunden zusammengesetzte Dasein, aus welchem heraustretend es vielleicht drei Sprachen verstehen wird, nur die Sprache des Herzens nicht, und meisterhaft sich verneigen und tanzen können wird, nicht aber mit treuer Anhänglichkeit Jemanden umarmen; denn die erste Erziehung hat Alles an ihm entwickelt, nur das Herz ist öde geblieben. – Und so wird es in seinem siebenten oder achten Jahre seinem Erzieher übergeben, oder einem jener Institute, in welchen die gleichmäßige Erziehung meistens gleichmäßige Ungezogenheit entwickelt, und neben einzelnen wohl ausgebildeten Individualitäten – für welche das angewandte System gerade passend war – unzählige Individuen erzieht, die zu Dem, wozu sie erzogen wurden, keinen Beruf fühlen, für ihren wirklichen Beruf aber keine Erziehung erhalten – und deshalb, noch ehe sie in's Leben getreten sind, schon ihre Carrière verfehlt haben.
Und woraus besteht am Ende diese Erziehung? Natürlicherweise verstehe ich darunter nur die gute; jene unzähligen Fälle nicht zu erwähnen, wo dieselbe nichts Anderes ist, als – von der Eitelkeit bis zu den größten Lastern – eine Entwicklung alles Schlechten, was nur in unserer Natur geschlummert – was ist sie anders, als ein mühsames Erlernen Dessen, was wir später größtenteils vergessen, oder was wenigstens nicht beglückt! Meister folgt auf Meister, Wissenschaft auf Wissenschaft, ohne Rast immer weiter, das ist das System; nach der Rhetorik Poesie, nach der Poesie Philosophie, dann wieder der große Kreis der Natur, und hierauf Alles, was die Menschen gethan, die der alten und der neueren Zeit; darnach das große Naturrecht und dann gegensätzlich das unseres Vaterlandes, und weiß Gott was noch; unermüdlich hetzt uns die Schaar der Lehrer, gleich Windhunden uns fortwährend verfolgend, uns keinen Ruhepunkt gestattend, bis die Zeit verstrichen, die Jagd zu Ende ist und der Gehetzte ausrastet; jetzt kümmert er sich um die Wissenschaft nicht mehr, welche man ihm früh genug ekel gemacht hat, und zuweilen sich umwendend, blickt er mit Bedauern auf die Blüthen, welche er noch frisch gefunden hätte, die aber seine Treiber schon niedergetreten haben.
Und so tritt der Jüngling aus der Erziehung, voll von Kenntnissen, aber traurig, vielleicht den Tag noch genau wissend, an dem Brutus sein Vaterland befreite und Leonidas bei den Thermopylen für Hellas sein Blut vergoß, aber nicht ahnend, daß es auch einen Platz auf dieser Welt gäbe, für den er dasselbe thun könnte; ein gebildeter Jüngling, aber mit gealterten Gefühlen. – Seine Erziehung ist vollendet, er ist zwanzig Jahre alt und hat kein Herz. – Wie könnte es auch anders sein? Weggeschickt vom väterlichen Hause, oder in irgend ein entfernteres Zimmer mit seinem fremden Erzieher eingeschlossen, der ihn mit seinen Büchern gegen jede Lebensfreude verschanzte, wie sollte das Herz erwachen, da nur der Geist gebildet und alles Andere, selbst die Unterhaltung mit den Eltern, als Zerstreuung nur selten gestattet wird? Es ist noch gut, wenn die Seele – in welcher, damit dies den Jüngling zum Lernen ansporne, der Ehrgeiz früh erweckt wurde, ohne daß man bedacht hätte, wie verwandt derselbe dem Neide ist – unter dem Einfluß dieser unedlen Leidenschaft nicht gemein wird. Und alles dieses, damit wir zu jenem Wissen gelangen, dem wir später so oft fluchen und dessentwegen wir, wie unsere Vorahnen wegen des Baumes der Erkenntniß aus dem Paradiese, aus dem Eden der Kindheit vertrieben, Das verlieren, wodurch wir hätten glücklich werden können: das Gefühl.
Und was in den oberen Schichten der Gesellschaft die Sorglosigkeit thut, dasselbe bewirkt, wenn auch in geringerem Maße, bei andern die Nothwendigkeit und die von Tag zu Tag tiefer dringende Kälte und Empfindungslosigkeit, welche, bereits alle Classen des menschlichen Geschlechtes durchdringend, einem großen Fluche gleich sich über unsere Civilisation verbreitet, tausendmal größer als der Segen derselben. – Das mächtige Element der Liebe ist aus unserer Erziehung geschwunden und mit ihr die Glückseligkeit des Kindes, mit den kindlichen Freuden jener heitere Optimismus, zu dem wir erzogen werden sollen und ohne welchen das Leben nur Leiden bietet.
Aber wenn jemals ein Kind sich verlassen fühlte und unglücklich war in seiner Verlassenheit, so war ich es. Ernsteren Sinnes schon von Natur und menschenscheu, weil ich einsam erzogen wurde, stand ich auch vereinzelt unter meinen Kameraden und mischte mich selten in ihre Spiele, niemals in ihre Freuden; anfangs, weil der Schmerz, der seit dem Tode meiner Mutter in meinem Herzen lebte, noch nicht verstummen konnte, späterhin, weil ich, an Träumereien gewöhnt, mich in der Welt meiner Einbildung glücklicher fühlte, als in dem lärmenden Kreise, wo meine sonderliche Art und Weise mich zum Zielpunkt des Hohnes der ganzen Menge machte.
O! und es gab doch glückliche Momente auch in diesen Tagen. Wenn die Schule zu Ende war und ich, während meine Collegen in den Garten gingen, allein in meinem Zimmer bleiben und, auf's Fenster gestützt, in's Thal hinabsehen konnte und auf den Fluß, der sich dort hinschlängelt, und auf die braunen Häuser der Stadt, welche an der Seite des Berges sich treppenförmig erheben – welche reizende Träume durchzogen meine Seele, wie zufrieden fühlte ich mich in diesen Momenten, bis zuletzt der Glanz der Abenddämmerung auf den Bergen erblaßte und von der St. Nikolauskirche die Abendglocke zum Gebete rief. Dann kniete ich nieder an meinem offenen Fenster, vor dem gestirnten Himmel, und wenn meine Augen sich manchmal mit Thränen füllten, so war es nicht Schmerz, der mir sie erpreßte; – damals stand ja noch nicht die Erfahrung höhnend unter meinen Träumereien, und kämpften nicht Zweifel mit meinen Hoffnungen, wie jetzt; damals vermochte die Seele noch zu glauben, und wer sollte nicht glücklich sein, wenn er aufblickend das Himmelreich sieht?
Eine Haupteigenschaft meines Charakters ist die Religiosität; von den ersten Jahren meiner Kindheit an, da ich noch in den Armen meiner Mutter das erste Vaterunser stammelte, bis jetzt, wo ich verzweifelt vor dem Crucifix knie, war Glauben stets ein Hauptbedürfniß meiner Seele, welches, wenn unbefriedigt, mir peinlich wurde, aber niemals aufhören konnte und nicht gestattete, die Schmerzen des Zweifels durch Indifferenz zu lindern; und Du kannst Dir denken, wie sehr meine Lage auf die Entwicklung dieser natürlichen Neigung wirkte. – Die klösterliche Stille, das regelmäßige Gebet, die heiligen Bilder in den Gängen und der Gesang, welcher von der Kirche bis in mein Zimmer hinaufftönte, zogen gleichsam einen Zauberkreis um mich, in dem meine Einbildung sich immer mehr heimisch fühlte, mein Herz immer mehr Befriedigung fand und sich glücklich fühlte, in dem ich ein neues Leben lebte voll früher nie geahnter Sehnsucht und Wonne. – Es ist etwas Großartiges in den Gebräuchen der Kirche, das zum Herzen spricht, und vielleicht eben deshalb beglückend ist, weil es unserem Glauben lieber Bilder als Aufklärungen gibt.
Wer erinnert sich nicht an seine Kindheit, oder an einzelne Augenblicke seines Lebens, wo große Freude oder Schmerz seine Seele kalter Gleichgiltigkeit entriß, an jene Wirkung, welche der Gottesdienst auf seine Seele machte? Wessen Herz überkam nicht zuweilen Andacht, wenn er in das dunkle Gotteshaus trat? In wessen Seele entstand nicht eine geheime Sehnsucht, und wenn er, vor dem Altar auf die Knie sinkend, mit gepreßtem Herzen wieder die Gebete der Kindheit sprach, und wenn der heilige Gesang wie ein großer Segen vom hohen Gewölbe widerhallte, wer fühlte sich da nicht getröstet, sogar glücklich?
Dies waren meine Freuden, in denen ich nach meinem verlorenen Glücke Trost und zuweilen Glück fand, und obgleich eben diese ideale Religiosität eine Hauptursache meiner jetzigen Leiden ist, erfüllt dennoch ihre Erinnerung noch jetzt meine Seele mit Wonne.
Aber auch das Herz hat seine Rechte, und wer einmal so wie ich geliebt wurde, ist der Liebe bedürftig! Denn wie der Baum, wenn Du ihn aus seinem Boden nimmst, in einem andern auch nur dieselben Blüthen und Früchte trägt: so ändert sich das Herz, wie oft es auch sein Besitzthum verliert, nicht durch sein Leiden. – So klammerte ich mich mit der ganzen Gluth meines Gefühles an einen Jüngling, den ich im Collegium fand, und an welchen – da auch er aus Avignon war – schon meine kindlichen Erinnerungen, vor Allem aber jene ernste Seite unserer Natur mich fesselte, durch welche wir Beide uns von unseren Kameraden unterschieden. – Wir waren Beide ernst und fühlten uns Beide unglücklich; das war die einzige Verwandtschaft unserer Seelen, aber sie reichte hin, zwischen uns eines jener leidenschaftlichen Freundschaftsverhältnisse zu knüpfen, welches nur unter unerfahrenen Kindern möglich ist. Armand, dies ist der Name des Jünglings, war kein Träumer, wie ich, ihn betrübte nicht das Andenken einer schöneren Vergangenheit, wie mich; wahrhafte Schmerzen wühlten in seiner jungen Seele, und bittere Erfahrungen waren es, die den Baum seines Lebens an der Wurzel benagten. – Der Sohn eines der reichsten Banquiers in der Stadt, in allen Bequemlichkeiten des Lebens erzogen, war er zwölf Jahre alt, als sein Vater plötzlich fallirte. – Die Bequemlichkeiten des Lebens verschwanden, die kleine Wohnung, wohin sie aus ihrem schönen Hause gezogen, blieb leer vom Morgen bis zum Abend, die Freunde wurden fremd, die unglückliche Familie verlassen. – Und er sah dies Alles und fühlte und vernahm von den Lippen seines Vaters die verzweifelnde Lehre, die wir Menschenkenntniß nennen, und er hörte den Fluch, den der unglückliche Mann als einzigen Trost mit sich brachte, wenn er nach Besuchen, die er seinen einstigen Freunden gemacht, des Abends nach Hause kehrte und müde vom Betteln und mit gebrochenem Herzen sich auf sein Bett warf, bis in einer Nacht die Hausleute durch einen starken Knall geweckt wurden und den Unglücklichen am Schreibtische in seinem Blute fanden. Armand stand als verlassene Waise in der Welt, bis die Regierung, der sein Vater in glücklicheren Tagen durch eine Anleihe einen großen Dienst erwiesen hatte, ihn nach vielem Flehen in dieses Kloster zur Erziehung gab. – Er fühlte sich unglücklich, und nicht ohne Grund, denn wenn Täuschungen auch dem Manne bitter sind, und wenn es peinlich ist, zurückblickend eine Einöde hinter sich zu sehen, um wie viel bitterer ist dies dem Kinde, welches, in das Leben eintretend, nur Zweifel mitbringt, anstatt der Hoffnungen, und den schöneren Freuden des Daseins entsagt, noch bevor es gekämpft. – Aber eben dieses Unglück, diese Verlassenheit war es, was ihn meinem Herzen noch theurer machte. – Konnte ich ihn nicht glücklich machen, konnte ich nicht sein Alles sein, der ich mich selbst für ihn geopfert hätte? Mein junges Herz war so stolz in seiner Liebe. Und was galt uns die Welt, was die Menschen, die ich zu verachten begann; das Herz fühlt sich allmächtig, wenn es liebt, und ich liebte ihn; – nicht mit jenem kalten, bedachten Gefühl, welches wir später Freundschaft nennen und welches oft nur Gewohnheit oder in schwierigen Momenten Ehrgefühl aufrecht erhält, welches verwandte Gefühle und Prüfungen und Zwecke erheischt; ich liebte ihn ohne Grund, aber glühend, mit der ganzen Jugendkraft meines Herzens, wie man nur im Kindesalter zu lieben vermag, wo das ganze Gefühl, mit dem der Mann einst das Vaterland, die Welt und seine Geliebte umfaßt, sich in einem Wesen concentrirt und sich befriedigt fühlt.
Auch dies war ein Traum, aus dem mich endlich traurige Erfahrungen weckten, aber welcher auch jetzt noch durch den dunklen Schleier meines Lebens schimmert.
Doch Armand verdrängte in meinem Herzen das Andenken meiner Mutter. Vielleicht war er mir zur Strafe gegeben, damit ich durch ihn leide.
Hier brachte ich ungefähr sechs Jahre zu; während dieser Zeit besuchte mich mein Vater zwei-, dreimal; so oft ich ihm schrieb, was regelmäßig am Namens-, Geburts- und Neujahrstage geschah, antwortete er mir in einigen Zeilen und ermahnte mich zu neuem Fleiß; übrigens war ich verlassen. Eines Abends – ich ging eben mit Armand im Garten spazieren und wir sprachen, weil er nach ein paar Tagen fort mußte, mit Schmerz von unserer Trennung – trat plötzlich der alte Johann vor mich hin, und bevor ich ihn noch recht erkannt hatte, drückte er mich mit thränennassen Augen an sein Herz und theilte mir mit, daß er gekommen sei, um mich abzuholen. Ich blieb noch zwei Tage, um mit Armand zugleich fortgehen zu können, und dann verließ ich das Collegium.
Ich weiß nicht, welch' ein seltsames Gefühl das Herz erfüllt, wenn man Abschied nehmen muß! Wenn auch der Ort, von welchem wir scheiden, in uns keine glücklichen Erinnerungen weckt, ja selbst wenn wir darin nichts als Schmerz gefunden, so fühlen wir uns dennoch beklommen, und es wird uns beinahe so schwer, uns von Gräbern, wie von unserem Leben zu trennen; thörichtes Herz das immerfort anhänglich ist, nur um desto tiefer verwundet zu sein, wenn es endlich scheiden muß. Aber wenn mir die Trennung auch schwer wurde und meine Augen, als der greise Prior mir seinen letzten Segen gab und meine Kameraden uns ihren letzten Gruß nachriefen, sich mit Thränen füllten: kaum waren wir von der Stadt so weit entfernt, daß wir unseren eben verlassenen Wohnort nicht mehr sehen konnten, so fühlte ich mich schon glücklich. Und wie denn nicht? Welchen Schmerz würde Derjenige nicht vergessen, der sich frei fühlt, und ich hielt mich frei. Rings um mich die offene Gegend mit ihren wogenden Saaten, vor mir die weithin sich dehnende Straße, wo bald ein Wanderer, bald ein vorüberfahrender Wagen meine Aufmerksamkeit auf sich zog, hie und da ein finsterer Wald, in der Ferne die Gebirgskette, die meinen Horizont begrenzte; vor mir eine neue Welt, eine reizende blühende Welt, in welcher von den großen Bergen bis zur geringsten Pflanze, Alles, was ich sah, mein Herz mit Wonne erfüllte; in welcher das fernher schallende Glockengeläute, der Gesang der sich hoch erhebenden Lerche meinem Herzen als heitere Grüße erschienen. Und bei so viel Freuden Niemand, der mich mahnte, rascher oder langsamer, rechts oder links zu gehen; Niemand, der auf die Ausschweifungen meiner Seele lauerte, sie aufzeichnete und mir die Laune mit seinen Mahnungen verdarb; frei, wie nur ein Knabe sich fühlen kann, der von seinem strengen Erzieher befreit, heiter aus seinem ersten Kerker geht, noch nicht ahnend, daß das Leben, in welches er tritt, nur ein anderes größeres Gefängniß ist, dessen System Absonderung und Arbeit, wie in denjenigen, welche man in Amerika baut. O reizende Täuschung, mit der wir in's Leben treten! Wie prachtvoll glüht die Erde in den ersten Strahlen unserer Sonne, wie leicht zerstreuen sich die Nebel, die sich hie und da gelagert haben, und wie leicht ist der Weg, der sich vor uns ausdehnt und den zurücklegen noch so viel Kraft, so viel Lust in uns braust. Und daß dies Alles so schnell vorübergehen muß! O, wenn der Knabe ahnte, was seiner wartet, wenn er wüßte, wie viel man in diesem kurzen Leben leiden kann, wie einsam man unter so vielen Menschen stehen kann, wie hoffnungslos in dieser schönen Welt! – wenn er alle die Leiden auch nur ahnte, denen er nicht entgehen kann, die großen Uebel, welche die Seele niederschmettern, und die kleinen, gegen welche das Geschick uns nicht einmal den Trost der Thränen gewährte; wenn er ahnte, daß die Freunde, welche er für treu hielt, ihn verlassen werden, und daß er mit seiner glühenden Liebe nichts als eine Erfahrung, und mit seinen Verdiensten nur Feinde gewinnen wird, bis endlich seine glänzenden, weltumfassenden Hoffnungen in einer kleinen Grube Platz finden, selbst um die Hoffnung späteren Andenkens betrogen! O Dank Dir, mein Gott, daß Du uns die Zukunft verhülltest.
Mit der Erlaubniß meines Vaters reisten wir nicht direct zu ihm, sondern in kleinen Tagmärschen nach Bern, von da bis in's prächtige Oberland, nach Lausanne, über den Leman nach Genf und Chamouny. Wie glücklich ich da war, kannst Du, der Du diese Gegenden kennst, Dir vorstellen: schön ist die Erde Dem, der nur die schöne Oberfläche derselben sieht, und nicht jene kleinen Wesen, die darauf kämpfen, einander hassen, leiden, und vor welchen wir bei näherer Betrachtung Ekel empfinden wie vor dem für rein gehaltenen Wassertropfen, wenn man durch das Mikroskop die Infusorien darin sieht. Mein alter Johann, der in der Freude seines Herzens die Mühen der Fußwanderung kaum fühlte und auf der ganzen Reise nichts sah, als mich, und daß ich meiner Mutter gleichsehe, freute sich mit mir; nur Armand veränderte sich nicht, er war traurig wie immer, ja, je mehr wir uns unserem Hause näherten, desto ernster. Möglich, daß die französische Grenze die traurigen Erinnerungen seiner Kindheit in seinem Herzen wachrief, oder daß er vielleicht fühlte, wie fremd Einem die Heimat werden könne, wenn man dort von Niemandem erwartet wird. So kamen wir nach Chamouny.
In der Gebirgskette des Montblanc gibt es eine Stelle, welche man den Garten nennt; – es ist dies ein kleines, grünes Feld, von Gletschern umgeben, welches viele Reisende besuchen, wenn auch der Weg dahin mühsam und der Schauplatz eher seltsam, als schön ist. Auch wir gingen hierher, da meine jugendliche Phantasie nichts so sehr ansprach, wie diese kleine grüne Oase mitten in der großen Eiswüste. Nachdem wir auf einem Felsstück ausgeruht und dort unsere Namen eingegraben hatten, näherten wir uns auf dem Rückwege abermals dem Eismeer, als über den Gipfel des Montblanc ein anfangs einer kleinen Rauchsäule gleichendes Wölkchen hinzog, das gewitterdrohend immer dunkler, immer größer wurde, und bevor wir zur Mitte des Gletschers gelangt waren, sich mit aller Kraft entlud. Es war ein prächtiges, aber schreckliches Schauspiel. Rings um uns die große Wolkenfluth, hie und da von einzelnen Blitzen durchzuckt, von den Streichen des großen Sturmwindes bald zerrissen, bald in einen Knäuel geballt, unter uns der dunkelblaue Gletscher, dessen wogendes Eis der Platzregen brausend wegschwemmte, der Sturmwind, der das Thal durchheulte, und der Donner, an hundert Bergen und Felsen widerhallend und mächtig erdröhnend! – Mein Herz beengte sich, und dennoch war ich in gehobener Stimmung und Grauen erfüllte mich; so eilten wir weiter, unserem Führer nach, bald über lange Eisfelder, bald über große Klüfte, von einer Eisscholle auf die andere springend, bis plötzlich, als ich über eine breitere Kluft sprang, mein Fuß ausglitt; ich schwankte, finster gähnte unter mir die Kluft, mein Stock brach entzwei, und – – Armand ergriff mich mit der Kraft der Verzweiflung, riß mich an sich und hielt mich in seinen Armen fest. – Ich war gerettet. – Unser Führer stand bleich neben uns, mein alter Johann sank auf die Knie und betete. – Ich stand schweigend zwischen ihnen; ich war außer mir; wie aus einem Traum erwachend, schaute ich in den tiefen Spalt hinab, der vor mir gähnte, und mein Herz erbebte vor dem finsteren Gedanken des Todes. – Doch als ich umherblickend meinen Freund neben mir, in seinem glühenden Gesicht den ersten Freudenstrahl, in seinem Auge die ungewohnte Thräne sah, und als ich seine Hand fühlte, die jetzt zitternd in der meinen ruhte: da erfüllte mich Seligkeit, da fühlte ich, daß ich lebe, durch ihn lebe, den ich auf dieser Welt über Alles liebte, und in seine Arme sinkend, vergoß ich Thränen in Strömen. – »Das werde ich Dir nie vergessen!« schluchzte ich, und ich fühlte, daß dieses Wort ein Schwur sei. – Das Gewitter verzog sich indeß, strahlend erhellte die Sonne die Gegend, und der weiße Montblanc trat aus dem Gewölke, als ob er mit seinem greisen Haupt unseren jungen Bund segnete. O, das war ein schöner Moment!
Ein Augenblick, und darnach dieses lange, schmerzvolle Leben, so viel Leiden, so unendliche Qual, – ein Senfkorn Freude, und darnach diese schreckliche Pflanze. Verfluchter Moment, dem eine so lange Strafe folgte! – Und warum freute ich mich dann? – Weil ich gerettet war! Gerettet zum Leben! Liegt nicht bitterer Hohn in diesen Worten? – Gerettet, um anstatt eines einen Augenblick währenden Leidens Jahre lang zu dulden, um anstatt eines Todes tausend zu erleiden, – erhalten wie ein Thier, welchem ein Gelehrter die Brust aufschnitt und dem er dann grausam das Leben erhielt, damit er, den tödtlichen Stich vermeidend, das zitternde Herz weiter schlagen sehe, damit er zu seiner grausamen Freude den letzten Augenblick weiter verschiebe, in welchem die Leiden seines Opfers aufhören; und dafür dankte ich! – O, ich könnte lachen, ich könnte mitten unter diesen schrecklichen Leiden lachen, wenn ich zurückdenke, wie ich mich vor dem Tode fürchtete. Und was ist der Tod? Das Kind, welches träumte, daß es von einer Höhe hinabstürzt, hat seine Qualen bereits gefühlt; der müde Arbeiter, der Mittags unter einem Baume eingeschlafen ist, kennt bereits die Vernichtung, – und wir zittern und dulden fortwährend. – O Feigheit!
Nach einigen Tagen war ich bei meinem Vater. – Er empfing mich herzlich, obwohl die düstere Regelmäßigkeit, aus welcher er nie heraustrat, mir, der ich nur Leidenschaft kannte, frostig erschien. Doch, nachdem er nach einigen Tagen, aus Avignon zurückkehrend, mir zu wissen machte, daß Armand bei uns bleiben und mit mir auf die Universität nach Toulouse gehen werde, und nachdem Johann mir zugeflüstert hatte, daß mein Vater aus Dankbarkeit sich von der Präfectur zum Vormund meines Freundes habe ernennen lassen und für dessen ganze Erziehung und Zukunft sorgen werde: da war Alles vergessen und nur Freude und leidenschaftlicher Dank gegen meinen Vater erfüllte mein Herz.
Nur Eines war, was diesen reinen Himmel verdüsterte und meine Seele zuweilen mit tiefen Sorgen erfüllte, es war dies jene Irreligiosität, die leider in ganz Frankreich allgemein geworden war, die ich aber in meines Vaters Hause zum ersten Male kennen lernte. – Von Jesuiten erzogen, ergriff mein junges Herz mit seiner ganzen Gluth jenen Glauben, in welchem ich Jahre hindurch mein Glück gefunden hatte, und es war unmöglich, daß ich mich nicht über jenen kalten Indifferentismus wunderte, welchen ich jetzt rings um mich gewahrte. – Der Sonntag kam und Niemand ging in die Kirche; das Volk ging in einer Procession vorüber, wir sahen ruhig zum Fenster hinaus; die Kirche ordnete Fasten an und wir aßen Fleisch; ich wollte keines essen und erinnerte meinen Vater an die Fasten, er lächelte. »Was bedeutet dies?« dachte ich mir, »mein Vater lächelt!« Und es entstand in meiner Seele der erste Zweifel, der gegen meinen stärkeren Glauben zwar noch schwach ankämpfte, jedoch fortwährend wiederkehrte, und stets mit neuer Kraft. »Ist das Fasten vielleicht keine Hauptsache?« – so fragte ich mich mit quälendem Zweifel; »was wäre aber das, wenn wir ein Gebot der Kirche übertreten dürfen?« und ich dachte über die Sache immer mehr und tiefer nach, jedoch ohne für meine Seele Ruhe zu finden oder jene Wonne zurückzaubern zu können, welche ich einst in meinem Glauben gefunden hatte; und wenn ich in der Kirche war, oder in meinem Zimmer vor dem Marienbilde kniete, tauchte in meiner Seele immer auf's Neue die Frage auf: warum denn mein Vater gelächelt habe? Oder wäre das Alles, was ich thue, wirklich lächerlich? Ich erschrak über meine sündhaften Gedanken und sagte meine Gebete auf's Neue her; doch vergebens, sie hatten ihre Zauberkraft verloren.
Ich fing an, mich unglücklich zu fühlen; mein Herz trug die Last eines neuen, früher nie gekannten Schmerzes, und dies war um so empfindlicher, weil ich gerade die Quelle des Trostes verloren hatte; doch ich schwieg, indem ich es nicht wagte, irgend Jemandem meine Qual mitzutheilen, die ich für so sündhaft hielt, und die, wenn sie mich auch quälte, doch nicht ganz ohne Genuß war, wie überhaupt keine Prüfung, wo der Mensch sein Glück zerstört und in den ersten Momenten seine Kraft fühlt, ohne Wonne ist.
Noch bevor ich das Haus meines Vaters verließ, war ich ein Zweifler.
Und ist es nicht schrecklich zu denken, wie viele Menschen auf ähnliche Weise Zweifler werden, wie ich? Zweifler, das heißt Unglückliche, weil sie mit ihrem glühenden Glauben, in der Welt nur kaltem, verächtlichen Lächeln begegneten! Ist dies nicht schrecklich, besonders wenn man umherblickend sieht, daß es nicht das Loos einzelner unglücklicher Ausnahmen, sondern das allgemeine Uebel unseres Jahrhunderts ist, welchem nur wenige glücklichere oder stärkere Seelen entgehen können. Man läßt uns aus Gewohnheit taufen, wir werden als Christen erzogen, weil das angenommene System es mit sich bringt, und nachdem wir einige Jahre geglaubt und uns im Glauben glücklich gefühlt haben, treten wir in's Leben ein und finden rings um uns nur Irreligiosität; wir sprechen vom Glauben – und Jedermann zuckt die Achsel, von den Geboten der Kirche, und Jedermann bedauert unsere Schwäche, denn praktisch ist das Jahrhundert, in welchem wir leben, dessen Losungswort: rechne und arbeite; die Religion des Zeitalters ist der Nutzen, und wenn unser Jahrhundert Märtyrer hat, so ist es nur der Geldgeiz, der sie leiden und entsagen lehrt. – Und kann unter solchen Umständen der Einzelne seinen Glauben bewahren? Stelle ihn allein mit seinem Glauben mitten unter tausend Verfolger, und er wird kämpfen und sterben für seine Ueberzeugung; aber wenn Niemand da ist, der ihm widerspricht, wenn ihm von allen Seiten nur Bedauern und Verachtung entgegentritt, wenn Jedermann den Schwärmer duldet, ihn aber wie einen unschädlichen Wahnsinnigen keiner Antwort würdigt: wird er auch dann glauben? Der Einzelne vielleicht, die Mehrzahl gewiß nicht; denn so, wie im Leben Jedermann nur die coursirenden Geldsorten sammelt, so sammelt man auch in der Welt der Gedanken nur Begriffe von allgemeinen Werth, und Wenige gibt es, die widerstehen, wenn sie auch für ihren Widerstand nicht verfolgt werden.
Zu meinem Unglück war ich keiner von diesen, und nachdem ich meine Universitätsjahre zurückgelegt, nachdem ich gelesen und gelernt und, an meinem Glauben festhaltend, beinahe verzweifelnd gegen meine inneren zunehmenden Zweifel angekämpft hatte, wurde der Zweifler ein Leugner, der einst glückliche Knabe ein freudenloser Jüngling, und so kam ich zurück in das Haus meines Vaters.
Ich war neunzehn Jahre alt, als ich die Universität verließ und in das väterliche Haus zurückkehrte, nicht so glücklich, als ich in den Sälen desselben mit meinen Kinderspielen herumlief. Denn meine innere Welt, die meine Seele sich einst aus Liebe und Glauben gebildet hatte, war verschwunden; doch andererseits war ich wieder glücklich, wie jeder Jüngling, der, am Beginne seiner Laufbahn stehend, unüberwindliche Kraft in sich fühlt und den Preis, welchen er erringen will, für größer hält als denjenigen, welchen das Leben zu bieten vermag. Wer hat sich in dieser Zeit nicht eine glorreiche Zukunft vorgestellt? Wer fühlte nicht in sich einen Cäsar oder einen Mirabeau in jenen Tagen, in welchen wir aus großartigem Egoismus vergessen, daß außer uns auch noch Andere auf der Welt sind, die der Menschheit ihr Leben zu opfern im Stande sind, und in welchen uns noch nichts unmöglich erscheint, ausgenommen, was das wahrscheinlichste ist, daß wir gewöhnliche Menschen sein werden! O wie traurig ist es, wenn wir später zurückblicken; nicht weil jedes Jahr seine traurigen Erfahrungen gebracht hat, sondern auf uns selbst zurückzublicken und zu sehen, wie wenig von dem Jüngling in dem Manne zurückgeblieben ist, zu sehen, wie viel Hoffnungen, wie viel erhabene Gefühle im Herzen begraben liegen! Wer könnte dies im Alter von vierundzwanzig Jahren thun, ohne zu seufzen und sich als Bettler zu fühlen?
Ich war reich, einer der ersten unter meinen Studiengenossen, durch meinen Vater so zu sagen assecurirt, daß meine Verdienste nicht im Dunkel bleiben werden. Die Jugend ist ein großer Dichter und sie braucht beinahe nichts, um sich in ihrer Einbildungskraft eine schöne Zukunft vorzustellen; und ich bedurfte nicht erst der Aufmunterung meines Vaters, der – zu jenem Lebensalter gelangt, in welchem Jedermann in den wenigen Tagen, die er noch zu leben hat, für den Egoismus nicht mehr Raum genug findet und deshalb gern seine Hoffnungen auf seine Kinder setzt – nicht müde ward, glänzende Pläne zu bauen und meine Eitelkeit aufzustacheln. » Du wirst ein großer Herr werden,« sprach er zu mir, wenn wir zuweilen allein waren; »das Haus Bourbon kann meine Verdienste nicht vergessen und wird sie in Dir belohnen.« »Ich werde ein großer Mann werden!« so träumte ich, der ich meine Zukunft nur mir selbst verdanken wollte, und wir waren Beide zufrieden; er, weil er, mein Gesicht erglüht sehend, sich vorstellte, mein Herz schlage für das Ludwigs-Kreuz, ich, weil ich in seinen schmeichelhaften Worten die Anerkennung meiner Verdienste und so zu sagen die Garantie meiner Hoffnungen sah.
Armand, gegen welchen meine Gefühle sich nicht geändert hatten und der sich mir mit so treuer Anhänglichkeit anzuschließen schien, daß unsere Freundschaft unter unseren Kameraden fast zum Sprichwort wurde, war auch jetzt stets mit mir, und mein einziger Schmerz war vielleicht nur der, daß er meine Freuden nicht theilte. Er war noch trauriger als früher; je mehr ich von meinen Hoffnungen sprach, in desto düsterere Falten zog er seine Stirn, und ich, der ich in meinem großen Edelmuth nicht begreifen konnte, wie man sich über die Freuden eines Freundes nicht noch mehr freuen könne, als wie wenn man sie selbst besäße, – denn ich war nicht in dieser Lage, und der Glückliche weiß nicht, daß man neidisch sein könne, wenn man keine Hoffnungen hat, – ich staunte über seine Gemüthsstimmung, und so weit es möglich war, trachtete ich seinen Kummer durch Unterhaltungen zu zerstreuen. Wir gingen auf die Jagd, unternahmen Spaziergänge, gingen täglich nach Avignon, zuweilen auch weiter, und so verging ein Monat. In Avignon wohnte eine Tante von mir, sie war reich, wie mein Vater sagte, und deshalb sollte ich sie ehren; ich besuchte sie beinahe jeden Tag; Armand pflegte nicht mit mir hinzugehen, und wenn ich mich endlich von den zahlreichen Fragen und Ermahnungen der Alten freimachen konnte, war unser Zusammenkunftsort gewöhnlich in der großen Kirche. Einmal war meine Tante nicht zu Hause, und als ich vor der Zeit in die Kirche kam, ging ich in dem großen gothischen Gebäude lange auf und ab, bald die Inschriften der Grabsteine lesend, bald die heiligen Bilder betrachtend. Der Abend brach heran, im östlichen Theile der Kirche fing es an dunkel zu werden, während die westlichen Fenster in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne glühten. Tiefe Stille herrschte rings um mich, und meine Seele versank in Träumereien. Ich kannte die Kirche, oft hatte meine Mutter mich dahin gebracht, und ich kannte den Ort noch gut, wo ich damals zu knien und zu beten pflegte; was empfand ich Alles damals zwischen diesen Mauern, wie viel Sinn lebte in diesen steinernen Statuen und jetzt! Ich wurde aus meinen Träumen durch leichte Schritte erweckt, und mich umwendend, erblickte ich eine Dame, die in einer Seitenkapelle der Kirche verschwand. Was mag diese hier wollen, dachte ich mir, in solcher Zeit und so einsam, und meine Neugierde entbrannte; schon wollte ich ihr folgen, als durch die andere Thür der Kirche ein hochgewachsener junger Mann eintrat, der erst in der Kirche umherging und zuletzt in derselben Kapelle verschwand. Es sind Verliebte, dachte ich mir, was geht das mich an, und schon wollte ich gehen; allein ich weiß nicht, welche geheime Sehnsucht mich zurückhielt, so daß ich mich nicht entfernen konnte. Endlich ging ich von Säule zu Säule, als ob ich die Kirche betrachtete, und kam schließlich an eine Stelle, von wo ich in die Kapelle blicken konnte. Sie standen neben einander, die Dame hatte den Kopf geneigt, der Mann schien leidenschaftlich zu sprechen, zuweilen hielt er inne, gleichsam eine Antwort erwartend, denn die Dame schüttelte dann zweimal den Kopf, worauf er mit immer größerer Leidenschaft weiter sprach; endlich ging der Mann fort; die Dame folgte ihm einige Schritte, dann kniete sie, ihr Gesicht mit den Händen bedeckend, vor dem Altar nieder und weinte. In dem ganzen Vorgang war etwas Romantisches, das mein ganzes Herz gefangen nahm und ich stand, meinen Blick auf die Kapelle geheftet, noch unbeweglich neben meiner Säule, als Armand in die Kirche trat. Auf dem Wege erzählte ich ihm, was ich soeben gesehen, als wir, vor dem Posthause vorübergehend, einen jungen Mann in dasselbe eintreten sahen. »Ich möchte wetten, daß er es ist!« sagte ich zu meinem Freunde, und einige Minuten später rasselte die Pariser Malle-Post durch die Straßen. »Ich möchte die Geschichte doch genau kennen!« sprach ich wieder.
»Laß' das,« antwortete Armand übellaunig; »das Ganze ist gewiß nicht so interessant, wie Du Dir es vorstellst; ein Mann, der eine Frau betrügt, es ist eine gewöhnliche Geschichte; oder vielleicht eine Frau, die einen Mann betrügt, das ist eine noch gewöhnlichere Geschichte, eines jener Leiden, die wir Alle durchmachen müssen, wie unsere Kinderkrankheiten; sie sind jedoch nicht gefährlich und verursachen uns nur einmal Schmerzen. Habe keine Furcht, die Reihe wird auch an dich kommen, und dann wirst Du auch das Geheimniß dieses Liebespaares kennen lernen; flüsternd wirst Du Deiner Geliebten sagen, was dieser Herr der Schönen in der Kirche gesagt hat; Du wirst von ihr hören, was er gehört hat, Du wirst glücklich sein, und unglücklich wie er; wiederholen doch seit Jahrtausenden Millionen Lippen dieselben Wünsche, und Millionen Herzen leiden dieselben Qualen und sind in denselben Freuden selig; seit die Welt steht, hat das Menschengeschlecht noch keine vernünftige Stunde gehabt.«
Aber während er mit der gewohnten Bitterkeit sprach, die Menschen verspottend, erfand ich in meiner Phantasie neue und immer neue Geschichten, und ich hatte keine Ruhe, bis daß ich am andern Tage früh wieder nach Avignon gehen konnte, wo ich dem Ganzen auf die Spur zu kommen hoffte.
Als ich den andern Tag zu meiner Tante kam, fand ich das ganze Haus verändert; in dem mit Gras bewachsenen Hofe stand eine Reisekutsche, die erste vielleicht, seitdem die Dame des Hauses im Jahre 1800 von der Emigration zurückgekehrt war; der Flur war voll mit Gepäck und Koffern; im Vorzimmer sah ich fremde Diener, kurz, Alles deutete auf einen Gast. – Und Du kannst Dir meine Ueberraschung nicht vorstellen, mit welcher ich, in den Salon meiner Tante tretend, anstatt der greisen Freundin, wie ich mir den Gast vorstellte, dem Blick einer schlanken jungen Dame begegnete und, meine Tante, mich freundlich an der Hand fassend, mich der schönen Dame als Verwandten vorstellte.
Ich verschone Dich mit der Beschreibung derselben, denn ich weiß, daß nur Gott mit Worten schaffen kann, und ich will nicht nach Art der Poeten Rosen, Himmel, Nacht und andere derartige Schönheiten zusammenmengen, was von dem beschriebenen Gegenstand höchstens einen derartigen Begriff geben könnte, wie die Palette des Malers von dem rühmlichen Werke, welches aus den dort angehäuften Farben entstanden ist. Sie war schön, wie ich keine Frau vorher gesehen hatte, und wenn ich bei ihrem ersten Anblick überrascht wurde, weil ich in ihr einige Aehnlichkeit mit jener Dame fand, die ich in der Kirche gesehen hatte: so entstand, als ich ihr als einer Verwandten die Hand reichte und die ihrige zu meinen Lippen führte, in meinem Herzen ein Gefühl, welches ich bis dahin nicht gekannt hatte und das die romantische Begegnung in der Kirche bald vergessen machte. Meine Tante ward nicht müde, sich nach ihrem Manne zu erkundigen, der erst vor einem Monat gestorben war, und wie sie angekommen sei, und wie lange sie bleiben wolle, wie die Damen ihres Alters in Paris sich jetzt kleiden, wie der König aussehe und der Himmel weiß, was sie nicht noch Alles fragte, während meine arme Verwandte nicht müde ward, zu antworten, und ich ihr zuzuhören. Endlich ließ die Alte uns allein. – Wie viel hatte ich nicht früher mit Julien sprechen wollen, welche schöne Phrasen hatte ich mir im Geiste zusammengestellt, ungeduldig den Augenblick erwartend, in welchem ich mit ihr allein sein und Gelegenheit haben werde, ihr alle meine Vorzüge zu zeigen – und jetzt war die Tante fortgegangen und ich konnte nur schweigen. Das Blut drängte sich mir zum Herzen, meine Wangen glühten, ich betete um einen Gedanken und es fiel mir nichts ein. – Wer hat sich nicht in der Jugend jemals in solcher Lage befunden, wo wir noch kein Gespräch führen können, weil wir immer etwas sagen wollen! Die Augenblicke, welche ich derart schweigend zubrachte, schienen mir Jahre zu sein, doch Julie erbarmte sich endlich meiner und sprach mich an, und Alles war wieder in Ordnung. Der Stein, welchen Jemand auf dem Gipfel eines Berges in Bewegung setzt, kann nicht schneller hinabeilen, als ich mit meinem Gespräch über die Gegenstände. Julie hörte mir so aufmerksam zu, antwortete mir so fragend und lächelte so anmuthvoll, daß sie mich bald vergessen machte, wie kurze Zeit ich sie erst kenne, und in meiner Freude plauderte ich Alles aus, was je meine Seele erfüllt hatte, Vergangenheit und Zukunft, Hoffnung und Kummer. Wenn man neunzehn Jahre alt ist, so hat man Geheimnisse ohnehin nur dazu, daß man sie je mehr Leuten anvertrauen könne, und als meine Tante zurückkehrte, waren Diejenigen, welche sie verlassen hatte, beinahe Freunde geworden, ja ich war bereits verliebt.
Ich weiß nicht, ob Du jemals verliebt gewesen bist, denn es gibt Viele, welche dieses Gefühl niemals kannten, gleichwie viele Bäume keine Blüthen treiben und viele Menschen die Schönheit der Dichtung nicht empfinden. Warst Du aber je verliebt, so erinnere Dich zurück an jene Zeit, wo Dein ernstes Antlitz noch in den Gluthen Deiner Gefühle aufflammte, wo Dir ein Blick mehr galt als die ganze Welt, ein Händedruck mehr als der Ruhm des ganzen Menschengeschlechtes, wo jedes Wort eine Welt von Freuden in Dir erzeugte, und Du, gleichsam todt für die Erde, ein Himmelreich in Deiner Liebe durchlebte; und wenn die Erinnerung daran eine Thräne in Dein Auge lockt und gleichsam Heimweh nach jenen glücklichen Zeiten Dein Herz erfüllt, dann hast Du mich verstanden. Ich liebte sie glühend, unendlich, vom ersten Augenblicke an, denn nur so kann man lieben. Wer Tage, Wochen und Jahre dazu braucht, bis er eine Vollkommenheit nach der andern erkannt, und wer das Ganze berechnet und endlich erwägend es ausspricht, daß er liebe, der kann wohl ein glücklicher Gatte werden, aber er hat niemals geliebt. Nur Der, dessen Seele gleichsam Wahnsinn ergriff, der sich auf einmal glücklich oder verflucht fühlte, als ob Fluch oder Segen ihn plötzlich durchdrungen hätte, der keine Vollkommenheit sucht, keine Fehler kennt, nichts weiß, nichts will, sondern nur empfindet und sein ganzes Wesen plötzlich dem einen Gefühle hingibt, und nichts hofft und nichts fürchtet, der liebt so, wie ich geliebt, der kann meine Handlungsweise beurtheilen.
Armand war kälteren Gemüthes, und als ich, nach Avignon zurückgekehrt, mein Herz vor ihm ausschüttete und ihm mit der Redseligkeit des zum ersten Male Liebenden mein ganzes Glück erzählte und daß Julie mein Alles sei, daß ich ohne sie nicht leben könne, kurz Alles, was ein Verliebter bei solcher Gelegenheit, besonders wenn sich über ihm ein heiterer Himmel wölbt, sagen kann, hörte er meine Herzensergießungen lächelnd an. – »Nicht wahr, ich habe es gesagt,« sprach er lachend, »daß auch an Dich die Reihe kommen wird? Und wie bald ist es in Erfüllung gegangen! Jedem Menschen hat das Geschick sein Theil beschicken; ich fürchte nur, daß Du nicht genug bekommen hast, um damit lange auszureichen, und es gibt nichts Schmerzlicheres auf der Welt als nüchtern werden. – Jetzt hältst Du Deine Liebe für ewig, aber glaube mir, Träume dauern nicht lange, und besonders der nicht, zu dessen Verscheuchung keine stärkere Berührung nöthig ist als ein Kuß. Arme Verliebte! Der Mechaniker, der sich für den Erfinder eines Perpetuum mobile hält, ist nicht stolzer als sie, wenn sie von ihrer ewigen Liebe sprechen; aber noch ist der Künstler mit der Erklärung nicht zu Ende, und schon ist das Kunstwerk still gestanden, und schon packen die guten Leute beschämt ihre Siebensachen ein, glücklich, wenn sie auf ihre Erfindung kein Privilegium begehrt, das heißt, wenn sie nicht geheiratet und sich nicht zu ewiger Verstellung gezwungen haben.«
Es thut nichts so weh, wie zu hören, was wir später selbst erfahren, und ich bat Armand, mit seinem Spott aufzuhören. »Du hast nie geliebt,« sprach ich seufzend. – »Du täuschest Dich,« antwortete er, »ich habe geliebt, wenn ich auch nicht davon gesprochen habe, denn meine Seele kramt ihre Schätze nicht gern aus; ich habe glühend geliebt, wahrhaft wie Du, und ich habe aufgehört zu lieben, wie Du es wirst. Ich habe einmal in meinem Leben geliebt, und Du, dessen Natur feuriger ist, wirst wahrscheinlich öfter lieben; aber deshalb war meine Liebe dennoch nur ein Moment, wie die Deinige es sein wird, denn die Aloe, die in einem Jahrhundert nur einmal blüht, und die Rose, die jeden Monat nur Knospen treibt, behalten beide ihre Blüthen nur einige Tage.«
»Und wenn Du geliebt hast,« sprach ich, »warum hast Du es Deinem Freunde verheimlicht?«
»Weil ich die Menschen kenne,« antwortete er bitter, »und weil ich im Voraus ahnte, was jetzt geschehen ist, und weil ich stolz bin und nicht gern bedauert sein möchte, selbst von Dir nicht.« Er schwieg.
»Und warum wurdest Du verlassen?« fragte ich ihn beinahe erschrocken.
»Wahrscheinlich, weil ein Anderer, Würdigerer, dessen Name von besserem Klange, oder reicher ist, meine Stelle eingenommen hat; die Liebe ist ja blind, und so ist es nicht zu verwundern, wenn sie beim Hören eines schöneren Namens oder bei dem Klange des Goldes gerührt wird. Gute Nacht; träume von Deiner Geliebten, und wenn vielleicht auch sie von den schönen Pferden träumt, mit welchen Du sie in Paris spazieren fahren wirst, und von Deinen Bedienten und Deinem Hause, so wird sie morgen Deine Liebe erwidern.«
Ich kann es nicht beschreiben, welch' eine unangenehme Wirkung diese Worte auf mich machten; doch als ich wieder allein war und auf den bestirnten Himmel blickte, der sich dunkelblau über mir wölbte, tauchte Juliens Bild in meiner Seele auf, und es schwiegen alle Erinnerungen, die nicht von ihr sprachen.
Ich will Dich nicht langweilen mit der Beschreibung meines Glückes. Wie im Sommer der helle Himmel, an dessen blauer Wölbung Du nichts Auffallendes findest, weil die Sonnenstrahlen Alles mit gleichem Licht erhellen, – wie die Ebene, an deren Einförmigkeit Dein Blick ermüdet, weil jeder Fußbreit Boden Blumen und Grünes trägt, so war mein Leben in den ersten Tagen meiner Liebe – eine unendliche Seligkeit.
Und wie konnte es auch anders sein. Wenn es eine Seligkeit auf der Welt gibt, wenn es etwas gibt, wofür zu leben es der Mühe werth ist, so ist dies gewiß unsere erste Liebe; diese Phantasie bietet mehr Wonne als alles wirkliche Glück des Lebens. Und wie hätte ich nicht glücklich sein sollen, dem all' diese Freude sich so plötzlich, so unerwartet erschloß? – Nie hat ein Mensch mehr Glück genossen, als ich in jenen Tagen.
Mit Armand kam ich jetzt seltener zusammen, und obwohl ich mir es selbst leugnete, so fühlte ich doch, daß ich mich von ihm entfernte. Es können im Herzen mehrere Gefühle mit einander bestehen, aber nur eine Leidenschaft hat darin Raum, und bei mir war damals auch die Freundschaft eine Leidenschaft. Jetzt lebte in meiner Seele nur ein Gedanke, flammte in meinem Herzen nur ein Gefühl: es war Julie, die mein ganzes Wesen erfüllte. – Und was brauchte ich sonst? Worin das Herz ganz lebt, das wird unsere Welt, und es kann, sei es das Vaterland oder ein Weib, uns ganz beglücken, sobald wir es genug lieben, um dafür auf uns selbst zu vergessen.
Meine Tante unterstützte, wie Du denken kannst, meine Leidenschaft; sie war gut und freundlich von Natur, und in dem Alter, in welchem sie damals war, blickt jede Frau wohlwollend auf jenes Gefühl, durch welches sie einst glücklich gewesen, und gern hört sie in den Geheimnissen der Liebenden die Geschichte ihrer eigenen Vergangenheit. Arme gute Frau! wie oft suchte sie eine Arbeit, um uns allein zu lassen, wie freute sie sich, wenn sie leise eintrat und wir ihr Kommen nicht bemerkten, wie viele Hoffnungen erweckte sie in meinem Herzen durch ihre aufmunternden Worte, so oft sie von Julien sprach, indem sie bald mir mittheilte, was Julie gesagt, bald mir erzählte, sie sei erröthet, als von mir die Rede war, und tausend andere Kleinigkeiten, in welchen mein Herz damals ein Himmelreich fand. Auch sie war durch meine Liebe so zu sagen gehoben, ihr Leben hatte wieder einen Zweck, und fast verjüngte sie sich.
Einer unserer Lieblings-Spazierplätze war Vaucluse; die liebliche Gegend, in welcher der rieselnde Bach und jedes Baumblatt, das der Wind in Bewegung setzte, an die Liebe und die Lieder des großen Dichters erinnert, paßte gerade zu meiner Lage. Hier, wo ich neben Julien Alles fühlte, wovon der große Dichter gesungen, wo, ich dessen unsterbliche Lieder meiner Geliebten vorlesend, das Geständniß meiner eigenen Liebe ablegte, fühlte ich mich unendlich wohl und glücklich. – Klar und ruhig wie vor Jahrhunderten steht das Bassin zwischen seinen hohen Steinmauern, welche sich rings um dasselbe steil erheben, wie um den Ort zu schützen, wo einst ein Dichter träumte. Auf allen Seiten erblickt das Auge nur Felsen, rückwärts zu einer halbrunden Wand vereint und an zwei Seiten des Bassins steile Hügel bildend; nur über dem Wasserspiegel grünt ein Feigenbaum, gleichsam das Bild jener einen Hoffnung, die in Petrarca's Seele lebte und keine Früchte trug, wie dieser Baum an seinem schattigen Standorte, und dennoch schön war wie diese grünen Zweige mitten in der Steinwüste. Vorn braust der Bach im Wasserfall herab, und oben auf dem Berge steht die Burg Laura's. Und hier saß der Sänger am Bassin, vielleicht auf demselben Steine, wo wir saßen, und schaute hinab auf die Wellen, in welchen sich der Himmel abspiegelt, und hörte das Brausen des Baches; doch in seiner Seele lebte nur ein Gedanke – Laura. Jetzt schweigt er, das Herz ist vermodert und mit ihm der schmerzerrungene Lorbeer; Laura's Burg steht in Trümmern, und Alles, was der Dichter gelitten, ist ein altes Märchen geworden: doch der Gedanke lebt, er lebt in dieser Landschaft, die er in seinen Bildern benützte, er lebt in jedem Baum, in jedem Stein.
Das Los des Dichters ist doch seltsam; er kann seinen Schmerz kommenden Jahrhunderten hinterlassen, und wenn selbst sein Denkstein schon zu Staub geworden ist, kann er den Augen Tausender Thränen erpressen, und sich selbst vermag er keinen einzigen glücklichen Augenblick zu schaffen. Oder war dieser glücklich, der diese Stellen einst mit seinen Seufzern erfüllte? – er, in dessen Seele eine zweifache Liebe flammte und dessen Geschick es war, in beiden nur Qualen zu finden, indem er sein Vaterland verwüstet und sich von Laura für ewig getrennt sah! Oder warst du glücklich, glühender Tasso, warst du selbst nur in deiner letzten Stunde glücklich, als du nach so viel Leiden endlich im Kloster Onufrio ausruhend, gleich dem sterbenden Gladiator in deinen letzten Augenblicken den lärmenden Applaus deiner Verfolger rings um dich hörtest? Man erzählt, du habest gelächelt und in deinem begeisterten Antlitz habe der erste Freudenstrahl geleuchtet; aber lächeltest du nicht aus Erbitterung? Und erfüllte diese Freude dein Herz nicht vielmehr deshalb, weil du von den Menschen die letzte Gabe empfingst, als weil du gerade einen Lorbeer hattest? Und warst du glücklich, Rousseau, Du, Byron, oder ihr Hunderte unter tausend Millionen, seit die Welt steht, die ihr die Schmerzen eurer Zeitalter im Herzen truget und vielleicht nicht eine einzige Freude zum Trost hattet – ihr Diamanten zwischen Kohle, die der Himmel vielleicht nur deshalb geschaffen hat, damit ihr in kaltem Glanz leuchtet, während eure glücklicheren Genossen in erwärmenden Flammen verglühten! – Das Volk bewundert euch und beneidet euer Geschick, weil eure Seele reicher ist und eure hohe Stirn Lorbeer umflicht; ach, aber Niemand bedenkt, daß das Feld, auf welchem ihr für Andere so viel erntetet, für euch allein unfruchtbar, und der grüne Lorbeerzweig, den ihr auf der Stirn traget, nur der letzte Trieb des Lebensbaumes war.
Unter Anderem waren wir auch an einem schönen Juli-Abend in Vaucluse; die Sonne war längst untergegangen, als wir an's Nachhausegehen dachten und unseren Weg nach dem Gasthof »Petrarca und Laura« nahmen, wo unser Wagen stand. Hier überraschte mich eine seltsame Erscheinung. – Das gewöhnlich so ruhige Haus war jetzt gefüllt mit Gästen, auf dem Herd in der Küche saß ein dicker Bauer zwischen zwei Kerzen, wie als ein Wunder ausgestellt, während hinter ihm von einem Holzbrand die erlöschende Flamme zuweilen emporschlug und der besseren Beleuchtung wegen vorn eine rothbackige Magd ihre rauchende Lampe hinhielt. Die so ringsum beleuchtete Hauptperson las mit einiger Schwierigkeit, jedoch vernehmlich etwas vor, das ich nach Form und Inhalt bald als den »Moniteur« erkannte; während die rings um den Vorleser stehende und sich drängende Menge seine Worte bald mit aufmerksamen Schweigen, bald mit lautem Applaus und Vivat-Rufen begleitete. – Der Wirth und dessen Weib brachten nach einander die vollen Weinflaschen, und draußen vor der Thür bot ein kleiner Savoyarde mit kreischender Stimme dreifarbige Cocarden feil. Die Nachricht von der Juli-Revolution war eben auch hierher gelangt, und was wir sahen, war die liliputanische Nachäffung des großen Pariser Ereignisses, die an jenem Tage vielleicht in ganz Frankreich vor sich ging. Julie erschrak, und so schnell als möglich fuhren wir von der patriotischen Gesellschaft weg, von der unserer Kutsche und unseren Livré-Bedienten noch ein lautes: »Nieder mit der Aristokratie!« nachgerufen wurde.
Wer seine Geliebte nie in Angst gesehen hat, der weiß nicht, was Glückseligkeit ist, der kann sich darüber wundern, daß ich in dem Augenblicke, wo mein Vaterland in Aufruhr war, nichts Anderes fühlen konnte als Liebe. Und dennoch war es so; an unserem Wagen vorüber ging das Volk in größeren und kleineren Gruppen nach Avignon, und es rief bald: »Es lebe der König!« bald: »Es lebe die Freiheit!« Doch ich beachtete diese Leute kaum, bei deren Anhören mir vor wenig Monaten das Herz vor Freude gepocht hätte; ich fühlte nur den Druck der zitternden Hand, hörte nur den erstickten Laut, mit welchem Julie sich an mich schmiegend meinen Namen aussprach. – Der Liebende lebt in seiner eigenen Welt und kann, isolirt von allem Anderen, durch einen Händedruck selig sein, während sein Vaterland zu Grunde geht, – und durch einen niederschmetternden Blick kann er in dem großen Moment unglücklich sein, wo seine Nation einen Sieg errungen hat.
Bevor wir nach Avignon kamen, stiegen wir aus, um durch unser aristokratisches Erscheinen nicht in Unannehmlichkeiten zu gerathen, und gingen Arm in Arm zu Fuß in die Stadt. So gelangten wir, ohne beleidigt worden zu sein, wenn auch von Juliens Seite nicht ohne Angst, zu dem Hause meiner Tante, wo uns schon ein alter Diener erwartete, der während wir zu meiner armen Tante eilten, das Thor bedächtig schloß.
Wer die Scene nicht selbst gesehen, deren Zeuge ich jetzt wurde, kann sich dieselbe kaum vorstellen. – Das ganze Gesinde war in dem Speisesaale versammelt, meine Tante in Reisekleidern an einem Pfeiler des alterthümlichen Kamins gestützt, an ihrer Seite ihr ergrauter Beichtvater, auf dessen bleichem Antlitze heute alles Andere eher, nur kein Trost zu lesen war; um diese beiden Hauptpersonen standen einige alte Hausfreunde, welche die Furcht veranlaßt hatte, Gesellschaft aufzusuchen, oder die ihre Person und die Kostbarkeiten, die sie mit sich brachten, bei dieser allgemein geachteten Frau mehr in Sicherheit glaubten, die im Zimmer ab- und zugehenden und flüsternden Diener, halbgepackte Koffer, und über Alles dies das Licht von Kerzen, die man zu putzen vergessen, Alles das bildete ein überraschendes Ganzes, welches ich nicht zu beschreiben vermag. – Als wir eintraten, lief die gute alte Frau mit einem Ausruf der Freude Julien entgegen und preßte sie weinend an die Brust, vielleicht selbst nicht wissend, ob ihr diese Thränen die Freude entlocke, daß sie die verloren geglaubte Theure wiedersah, oder der Schmerz, daß sie dieselbe in einem solchen Augenblicke sehen mußte. – Die ganze Gesellschaft bestürmte mich mit Fragen, und nachdem ich Alles erzählt hatte, erzählte mir wieder ein Jeder so fürchterliche Geschichten, solche entsetzliche Abenteuer, deren Zeuge er gewesen, daß ich fast schauderte.
Von der Straße ertönte Musik, und eine Weile war Alles ruhig; Jedermann horchte mit aller Aufmerksamkeit auf die nur in einzelnen abgerissenen Tönen sich nähernde Musik. – »O mein Gott!« wehklagte endlich der Abbé in Verzweiflung seine Hände faltend, »draußen singt man die Marseillaise, wir sind verloren; die verfluchten Republikaner nahen heran, sie werden sich für den Tod Brune's an unserem armen Orden rächen, und was können wir dafür? 1815 war das Volk so fromm, wer hätte es in seinem heiligen Zorn zurückhalten können?« Die Musik näherte sich, todtenstill ward es in unserem Saale, nur zuweilen hörte man ein Stück eines Gebetes von den Lippen des Abbé, während von der Straße das stolze 89er Lied zu uns emportönte; der Musikchor und die rohe, aber mächtige Stimme des Volkes vereinten sich zu brausendem Donner. Meine Tante betete, Julie stand bleich, einer Bildsäule gleich, neben mir und schwieg, während' das furchtbare Lied, sturmgleich an unserem Hause vorbeiziehend, in einer Seitengasse verklang. – »Vergib uns unsere Sünden,« seufzte der silberhaarige Kammerdiener; »es war gerade so wie 1792, als der selige Marquis – –« – »Höre auf!« unterbrach ihn meine Tante, kaum im Stande, ihre Aufregung zu verbergen; »er starb für seinen König und für die gute Sache; wer weiß, welches Los uns erwartet!« – Juliens Augen schweiften an den Wänden des Zimmers umher, wo unsere Familienbilder hingen; ich trat zu ihr, um sie zu ermuthigen, aber sie schrie, einen wilden Blick auf mich werfend, indem sie auf die Bilder zeigte: »Hier hängen die Bildnisse dreier Männer, die auf dem Blutgerüste starben!« Und meine Hand krampfhaft drückend, sank sie nieder. Wir trugen sie auf ihr Zimmer und hatten sie daselbst kaum mit ihrer Kammerfrau zurückgelassen, als ein neuer Lärm auf dem Platze entstand: »Es lebe der König! Nieder mit den Republikanern!« erscholl es von allen Seiten, und unser Abbé und die ganze Gesellschaft sprang plötzlich wie der zur Schlange gewordene Stab Mosis empor, und Alle sprangen, sich umarmend und klatschend, im Saale umher. – Jetzt war Jeder ein Held, Jedermann verachtete den feigen Pöbel, Jeder war bereit, für seinen König zu sterben, die Hausfrau selbst schwang triumphirend einen Sonnenschirm, den sie eben in den Koffer hätte packen sollen, und schwur, daß man alle die Aufrührer aufhängen müsse, – bis ein neues conträres Geschrei der ganzen Freude und dem Muth ein Ende machte. – Jetzt, da Julie und meine Tante, die ich verehrte, das Zimmer verlassen hatten und ich das Ganze mit kalten, prüfenden Augen überblicken konnte, konnte ich mich des Lachens kaum enthalten, so sehr hatte die Furcht die ganze Gesellschaft entstellt, und ich überdachte eben, wie lächerlich das Leben des Menschen in den größten Momenten desselben sein kann, als ein neuer, die früheren überbietender Lärm meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog; jetzt hörte man zugleich einen zweifachen Ruf; einerseits erscholl es: »Es lebe der König!« – während von der andern Seite die Marseillaise und: »Es leben die Pariser!« erdröhnte; und die Rufe verschmolzen in immer wüthenderer Wiederholung zu einem furchtbaren Lärm, in dem man nichts verstehen konnte. – »Hier gibt es eine Schlacht!« sagte der Abbé. – »Wenn sie nur nicht schießen!« seufzte ein magerer Baron, in welchem wieder die Furcht vor der Emigration erwachte und der sich vielleicht wieder in sein Schnupftabaksgewölbe zurücksehnte, in welchem er im Auslande seinen Erwerb gesucht hatte. – Ich, in dem auf den Lärm die ganze Neugierde der Jugend erwachte, nahm meinen Hut und ging hinaus, und hatte nicht geringe Mühe, den einen der Diener dazu bewegen, daß er das Thor öffne.
Die Straße war gedrängt voll; der Stadtpöbel und das aus den nahen Dörfern hereingekommene Volk, hie und da ein Bürger in anständiger Tracht oder einige Soldaten in wilder Unordnung, drängten sich von allen Seiten, bald unter Flüchen auf einander losgehend, bald schaarten sie sich um einen Geistlichen oder um einen kaiserlichen Veteran, der seine zerlumpte Uniform auf's Neue angezogen hatte und unversehens zum Anführer geworden war. Ueberall wilde Unordnung und Drohungen, und erhobene Stöcke, Weiße und tricolore Cocarden und Fahnen, und über Alles dies das schwankende Licht von Pechfackeln und der finstere Himmel, der wie eine düstere Weissagung über dem Ganzen hing. – Das Ganze war etwas Außerordentliches, das meine ganze Phantasie hinriß, indem sie mir Das verwirklicht zeigte, wovon ich als junger Franzose so viel in meinem Leben geträumt – eine Revolution.
Wie es schien, war die Royalistenpartei hier die stärkere. Avignon ist seiner Natur nach eine katholische und monarchische Stadt, das Volk vergißt nie auf die Zeit seiner Blüthe, und wenn es auch Knechtschaft war, wodurch es groß ward, so wünscht es den Tyrannen doch zurück, dem es die Verherrlichung seines Namens verdankt; denn unter allen Arten des Egoismus ist die Eitelkeit denn doch die stärkste, und Nationalruhm ist etwas, was selbst der Eitelkeit der Allerletzten wenigstens einigermaßen Nahrung bietet; und so erinnert sich der Avignoner an seinen Papst, dessen Palast noch heute eine Hauptzierde der Stadt, wo die Mauern desselben, wie sehr sie auch in neuerer Zeit innen verfallen, noch hoch über die übrigen Häuser emporragen, in den Bewohnern derselben große Erinnerungen erweckend. – Deshalb haßt der Avignoner die Revolution und Alles, was ihr folgte und wodurch er immer mehr jenen Glanz schwinden sah, den einst wenigstens dessen Denkmale seiner Stadt verliehen. – Von Minute zu Minute wuchsen die Haufen mit weißer Cocarde, immer lauter und bedrohlicher erscholl das: »Es lebe der König!« in der ganzen Stadt, während aus den Reihen der Gegenpartei jene gutmüthigen Bürgergesichter verschwanden, welche vor einer Stunde, da noch Alles sicher erschien, mit stolzer Ruhe durch die Straßen gingen und jetzt wahrscheinlich in ihrem Zimmer, auf Alles vorbereitet, sich eine große weiße Cocarde anhefteten. Es ist eine eigene Gattung Menschen, aus denen die Mehrzahl der Franzosen besteht, und durch welche eben deshalb die größten Dinge ausgeführt wurden, weil sie jedem Regime ohne Widerspruch gehorchen – Menschen, wegen welchen deshalb so viele Revolutionen stattfanden, weil ihre Furcht vor Revolution Alles acceptirte, was die eben siegende Partei beschloß!
Nach alledem zu schließen, kam der Augenblick des Zusammenstoßes immer näher, und ich konnte mir denselben, ob ich nun die wüthenden Pöbelgestalten betrachtete, die um ihre weißen Banner geschaart, ihre Knittel erhoben, oder ob ich den kleinen tapferen Haufen gegenüber ansah, der mit so großer Begeisterung das Schlachtlied seiner Väter sang, nur blutig denken, als auf der andern Seite der Stadt plötzlich ein neuer Lärm entstand und, geführt und gefolgt von einem lärmenden Volkshaufen, ein Trupp Marseiller auf den Platz kam, welche von der dortigen Municipalität abgeschickt, eben in unsere Stadt kamen, um jede royalistische Reaction zu verhindern. – Die royalistische Menge zertheilte sich murrend vor ihren bewaffneten Feinden, und diese ließen unter fröhlichen Umarmungen und Händedrücken ihre geträumte Republik hoch leben.
Ich stand dort als ruhiger Zuschauer, meine Verhältnisse und besonders meine Liebe ließen mich nicht thatsächlich theilnehmen, und dennoch kann ich nicht ausdrücken, wie sehr diese ganze Scene auf mich wirkte. Aus meinen Gedanken, welche, ich gestehe es, nicht Frankreichs jetzigen Zustand mir vorzauberten, erweckte mich mein Name, und wie ich mich umkehre, ist es Armand, der mich leidenschaftlich an seine Brust drückt. – Ich erkannte ihn kaum, die Flinte in seiner Hand, auf seinem Antlitz die ungewohnte Freude, welche dasselbe fast veränderte, machten ihn fast zu einem neuen Menschen.
»Das bin ich,« sprach er begeistert, als ich diese meine Bemerkung ihm wohlgelaunt mittheilte; »ein neuer Mensch oder vielmehr im Ganzen ein Mensch, frei und glücklich wie Du. – Jetzt ist nichts mehr zwischen uns, was uns trennen könnte, seit heute Nacht bin ich Dir gleich und erst jetzt wahrhaft Dein Freund.«
»Und wärest Du das früher nicht gewesen?«
»O, glaube mir, ich liebte Dich,« sagte er bewegt, »mehr, als ich je einen Menschen geliebt, wie sehr ein Bettler einen Reichen, das Bauernkind den Grafen nur lieben kann; aber mußte ich mich nicht durch Deine Freundschaft geehrt fühlen, Deine Gefühle für Herablassung betrachten, mußte ich nicht fürchten, daß nach den Jahren der begeisterten Jugend aus dem Freunde ein Wohlthäter wird, aus meinem Schulcollegen ein großer Herr, der den armen Schreiber im finsteren Bureau gnädig protegiren oder vergessen wird? – Denn wenn auch Derjenige, der höher steht, seine Stellung auf Augenblicke vergessen kann, der, den das Schicksal niedriger gestellt, wird nicht darauf vergessen; er kann den Höheren anbeten, fürchten oder hassen. – Liebe kann nur zwischen Gleichgestellten bestehen, dort, wo wir jede Gabe annehmen können, ohne daß unsere Gefühle der Gedanke beleidigte, daß wir die Gaben nicht würden erwidern können.«
Es ist nichts auf der Welt, wessen ich so sicher gewesen wäre, als der Freundschaft Armand's, und Du kannst Dir denken, wie traurig überrascht ich mich fühlte, als nach so viel romantischen Träumen die Wirklichkeit so kalt vor mir stand. Ein großer Schmerz erfüllte meine Seele, denn ich fühlte, daß eine der schönsten Täuschungen meines Lebens verschwunden war, und ich ahnte, daß sie nicht mehr wiederkehren würde. Armand errieth meine traurigen Gedanken nicht, er war in diesem Augenblicke glücklich und konnte nicht begreifen, wie ein Anderer an diesem großen Tage es nicht auch sein könne. »Komm' mit mir,« sagte er, mich bei der Hand fassend, nachdem wir eine Zeit lang unter der bunten Menge umhergegangen waren; »gehen wir hinaus auf's Feld und betrachten wir die aufgehende Sonne, und hören wir diesen Freudenlärm von fern, wo die schrillen Töne zu einem großen Volkshymnus verschmelzen und diese lächerlichen Carricaturen, zu einem großen Ganzen vereint, zum Volke werden; nur von fern ist der Mensch groß, nur wenn seine Individualität in der Menge verschwindet.«
Wir gingen hinaus; der Himmel war rein, an seinem dunkelblauen Gewölbe begannen einzelweise die Sterne zu schwinden, während die Dämmerung, als ob sie allen schwindenden Glanz der Sterne in sich vereinigte, in immer schöneren, in immer glänzenderen Strahlen auftauchte; im Osten begann bereits der Horizont sich schwach zu röthen und ein kühles Lüftchen durchwehte den Raum. Eine Zeit lang stand die Gegend in Halbdunkel gehüllt, in ihren bekannten Formen mehr geahnt, als gesehen vor uns, während die nahende Sonne das Dunkel stufenweise zertheilte; und nachdem die Gegend mit ihren Oelbäumen und ihren netten Häusern sich langsam aus dem Nebel entwickelt hatte, fielen die ersten Strahlen auf die Stadtmauer und die blühende Gegend.
Schweigend standen wir neben einander, das langsam sich entwickelnde Bild der Gegend betrachtend, welches das Licht gleichsam auf's Neue vor uns schuf, und wir waren wie in den herrlichen Anblick versunken.
»Wie schön ist diese Morgendämmerung!« sprach ich, endlich bewegt, wie immer, so oft ich die stillen Wunder der Natur sehe.
»Schön, wahrhaftig schön«, sagte Armand begeistert, »das Morgenroth einer Nation ist aufgegangen über uns; und hörst Du den Lärm, welcher von der Stadt her dumpf zu uns dringt? Das ist die Memnonssäule, welche erklingend die ersten Strahlen begrüßt. Der Himmel segne Dich, mein Freund, ich gehe nach Paris, wo ein neues Leben beginnt, und fernerhin kann nur Der nicht fortkommen, der schwach oder muthlos ist. Du siehst mich ruhmvoll oder niemals wieder!« Und meine Hand drückend, ging er weg. Lange blickte ich ihm nach, bis seine Gestalt zwischen den Bäumen verschwand, und seufzend kehrte ich nach Avignon zurück.
O! und dieser Morgen war schön, herrlich wie jener, der jetzt seine ersten Strahlen über die kahlen Berge durch das kleine Fenster meiner Zelle ergießt, wenn er auch nicht das Frühroth einer Nation war, wie mein armer Freund geträumt. Der Mensch hat keine Morgendämmerung hernieden; wenn er manchmal aus seinen schweren Träumen aufwacht, bereitet sich eine finstere, endlose Nacht um ihn her, und wenn er wieder zur Ruhe geht, träumt er neue Träume, aber deshalb keine schöneren. Auf dieser Erde ist unser Los: hoffen, getäuscht werden und leiden; das ist das Schicksal eines Jeden, der auf dieser Erde lebt, sowohl Einzelner, als ganzer Nationen, ein schöner Traum, und die Erfahrung, daß der Traum nichts bedeutete. Das Individuum kann seine Zukunft in der Weltgeschichte lesen, daß es nämlich nichts von Dem erreichen werde, wonach es gerungen; wer für seine Nation eine schönere Zukunft hofft, erinnere sich an die Hoffnungen seiner Jugend und lerne entsagen. Nur die Schönheit der Natur ist unveränderlich; nur die Erde bedeckt ihre Gräber jährlich mit neuem Grün; nur die Sonne verliert nicht ihren Glanz über so viele Leiden; mit großartiger Ruhe schreitet sie ihre endlose Bahn, während das winzige Menschengeschlecht ringt, haßt, zu Grabe geht, damit es die Erde, worauf es zu genießen nicht verstanden, mit seinem Körper fruchtbar mache. Und wir ringen, und wir träumen von Unsterblichkeit auf dieser Grabeswelt, deren Staub einst gelebt und gedacht wie wir, wo jeder Ort vielleicht Zeuge großer Thaten war, und jeder uns an Vernichtung erinnert. O vanitas vanitatum!
Aber dieser Boden, welcher unter unseren Füßen immerfort blüht, und dieser Himmel, dessen Sonne endlos über unseren Wegen strahlt, wurden sie nicht vielleicht dem armen Erdensohne zum Tröste gegeben? jener, damit er in ihm ruhe, diese, damit sie einen Hoffnungsstrahl über sein Leben ergieße? Und dieses Sehnen, welches unsere Seele über die Erde erhebt und unsere Fesseln so schmerzlich fühlen läßt, sollte es nicht ein Zeichen sein, daß unser Beruf ein höherer ist? Auch der Vogel flattert unruhig in seinem Käfig, auch er ächzt in seiner Qual, wenn die starken Gitterstäbe seinen ringenden Körper blutig verwunden; aber wenn sich zuletzt seine Thür öffnet, wie erhebt er sich dann gen Himmel, wie singt er sein schönstes Lied dann in den ersten Momenten seiner Freiheit. – Auch in diesem Herzen ist etwas, was sich erheben könnte. Es gibt Momente, wo ich wieder hoffe. Hier zwischen den großartigen Bergen, wohin der traurige Lärm der Welt nicht dringt, wo kein neuer Gram mein Herz treffen kann und Liebe und Haß mit meinen Hoffnungen schwanden, fand auch meine Seele langsam ihre Ruhe wieder. Und könnte das Bild des Himmels, der sich einst darin gespiegelt, sich nicht wieder auf's Neue erfüllen? Glänzen doch auch im Spiegel des großen Meeres, wenn dessen Wogen sich geglättet, die Sterne auf's Neue.
Nach wenigen Tagen war der Friede hergestellt; meine Tante packte ihre Möbel aus, das Haus stand in seiner alten Ordnung wie ehedem, und in der Stadt kehrte Jedermann zu seiner früheren Beschäftigung zurück; nach einem Monate war von dieser großen Revolution kaum mehr übrig als ein neuer König und der Gegenstand eines schon langweilig gewordenen Gespräches. Es fehlte natürlich unter unseren Hausfreunden nicht an solchen, die täglich von einer neuen Vendèe perorirten, und da sie, wie jede besiegte Partei über die Vergangenheit nichts zu reden hatten, trösteten sie sich mit Prophezeiungen; übrigens lebte Jedermann in der größten Ruhe wie ehedem, und ich war glücklich, wie Einer, dessen Liebe von Tag zu Tag wuchs, und der beinahe sein Ganzes Leben in der Nähe seiner Geliebten zubringen konnte.
Am Abend eines schönen August-Tages sah ich sie zum letzten Male in Avignon; als wäre es gestern gewesen, so deutlich erinnere ich mich an den Tag. Die Gesellschaft hatte sich zeitlich zerstreut und wir waren allein. Das seelenvolle Gesicht auf die Hand gestützt, saß Julie am Fenster und ich neben ihr, in ihren Anblick versunken. Die Sonne war untergegangen, über den Dächern der gegenüberliegenden Häuser glühte der Purpur der Abenddämmerung und auf der Gasse wehte ein lindes Abendlüftchen, kaum stark genug, um die Locken meiner Julie in Bewegung zu setzen, und dennoch mildernd kühl nach dem heißen Tage, als ob die Nacht der ermüdeten Erde ein tröstendes Wort zuflüsterte. Es war Sonnabend und die Bewohner der Stadt ergingen sich zum großen Theile außerhalb der Mauern derselben, während in den feierlich stillen Gassen nur zuweilen die Schritte einzelner Arbeiter dies Schweigen unterbrachen, die sich in ihren Werkstätten verspätet hatten und jetzt ihren Gefährten nacheilten; vom Thurm ertönte das Abendgeläute, das über die Stadt und die Gegend gleich einem Segen dahinschwebte. Es war eine jener Stunden, in welchen die schweigende Natur vor uns tritt und das Herz, deren großartiges Schweigen für eine Frage nehmend, zu sprechen beginnt und sagt, was es gelitten, gehofft und verloren; Stunden, in welchen sich alle Gefühle schließlich in einer Thräne vereinigen, von der wir kaum zu sagen vermöchten, ob eine freudige oder qualvolle Empfindung sie uns erpreßt habe.
Ich liebte Julie längst; ich liebte sie, wie man nur dann lieben kann, wenn das Herz seine glücklichen Träume noch für eine Prophezeiung ansieht und Anderen vertraut, weil es sich selbst nicht kennt und deshalb nicht weiß, wie feige die Natur des Menschen ist. – Morgen sollte sie nach Paris reisen und wir waren allein. – Du kannst Dir meinen Zustand denken. – Wir sprachen, aber frage nicht wovon; wer so fühlt, wie ich damals fühlte, spricht höchstens, um nicht zu schweigen, aber von Liebe gewiß nicht, denn er fühlt, daß die Natur, als sie den erhabensten Gefühlen die Worte versagte, denselben zum Ersatz dafür gewährte, daß sie sich in jedem Worte, in wie conventionellem Sinne immer Andere es auch gebrauchen mögen, ausdrücken und von gleichgestimmten Seelen verstanden werden können. – Sprich mit Deiner Geliebten, wenn Du liebst, vom Wetter, vom Tag oder von was immer, es ist alles eins; die Sprache gleicht dem Glockengeläute, in welchem Jedermann das hört, was eben seine Seele erfüllt, und wobei der Eine vor tiefem Schmerz weint, weil seine Geliebte unter solchen Klängen zu Grabe getragen wurde, während der Andere, weil er weiß, daß zu Mittag geläutet wird, dabei ruhig seine Uhr aufzieht. Zwischen Liebenden gibt es kein gleichgiltiges Wort, und es konnte zwischen mir und Julien kein Wort fallen, das nicht mein Herz im innersten erschüttert, nicht neue Leidenschaft in mir erweckt hätte. Ob sie mich liebe, das wußte ich nicht; es gab Stunden, wo ich es fest glaubte, Tage, wo ich daran zweifelte; aber es war kein Augenblick, wo ich nicht fest daran glaubte, daß ich nur in ihr und durch sie leben könne, und daß die Ungewißheit qualvoller sei, als der Tod. – Ich muß es wissen, dachte ich mir, und sollte meine Frage auch meinen Tod zur Folge haben, ich frage sie. – Und ich fragte sie, sie aber antwortete nicht, sie heftete nur ihre dunklen Augen auf mich, und ich glaubte, sie brauche nach einem solchen Blick nicht zu antworten. Ich war so jung, so unerfahren, und Juliens dunkles Auge hing mit solcher Theilnahme an mir, daß ich keinen Augenblick an meinem Glücke zweifelte.
Wie der Blinde, dem der Arzt den Staar eben jetzt erst gestochen hat, und der, den ersten Strahl erblickend, die Macht des Lichtes auf einmal fühlt und vor Freude aufjauchzt, so war ich vom Gefühl meines Glückes übermannt. – Mein Herz pochte in raschen Schlägen, als ob es seine ganze Bahn in diesem einen seligen Augenblick zurücklegen möchte, meine Brust war beklommen, meine Lippen zitterten, halb zum Reden erschlossen, ich war außer mir; es war ein Chaos aller Arten von Glück, die ein Mensch je gefühlt hat. – Lächelnd sah das schöne Weib mich an, als ob sie sich über mein Glück freute, und mich beim Namen rufend, reichte sie mir die Rechte dar. Ich drückte die zitternde Hand an meine Lippen und bedeckte sie mit Küssen. Es war der glücklichste Augenblick meines Lebens.
Ich bedurfte der Einsamkeit und ging fort. Durch die schweigenden Gassen forteilend, ging ich vor das Thor, mein wogendes Herz sehnte sich in's Freie, es bedurfte der blühenden Auen, der Sterne, der grenzenlosen Nacht, einer ganzen Welt, um in seiner Freude Platz zu finden – Und ich eilte ziellos immer weiter, wie Einer, den seine Gedanken nicht ruhen lassen, bis endlich eine von der Ferne herüberklingende Serenade mich aus meinen Träumen erweckte. Unwillkürlich hatte ich beinahe die ganze Stadt umkreist und stand vor der Villa eines reichen Kaufmanns. Nur im oberen Stockwerk war noch ein Fenster erleuchtet, alles Uebrige stand dunkel zwischen den laubreichen Bäumen, zwischen welchen verborgen der Chor ertönte, während rückwärts die Stadtmauer wie ein dunkles Band erschien und weiter die päpstliche Burg mit ihrem hohen Dach an dem bestirnten Himmel dunkelte. Hast Du schon einen hellen bestirnten Himmel in einem Augenblick gesehen, wo Du Dich glücklich fühltest? Wenn Du diesen Anblick nie gehabt hast, so weißt Du nicht, wie schön diese Erde ist und wie glücklich wir uns auf ihr fühlen können. Wenn Dich nicht auf gemähten Wiesen der Duft von tausend verwelkten Blumen umwehte; wenn Du nicht von fern her das leise Murmeln des Flusses und über Dir zwischen den Zweigen die Vögel gehört hast, wenn sie erwachend auffliegen und auf neuen Zweigen erst leise zwitschern, als ob sie ihr Morgenlied anstimmten, und dann wieder schweigen, und wenn Du nicht die zitternden Sterne über Dir gesehen hast und die weiße Milchstraße, die sich, obwohl sie aus Millionen Sonnen besteht, am Himmel wie eine leichte Wolke hinzieht, und wenn Du, als Du Alles dies sahst, hörtest, fühltest, nicht glücklich warst durch Deine Liebe: so verstehst Du mich nicht; nur der Glückliche vermag die ganze Schönheit der Natur zu empfinden. Und wenn in solchen Augenblicken aus der Dunkelheit der Nacht noch süße Klänge Dein Ohr beführen, wenn der Gesang gleichsam als ein unsichtbarer Fluß durch Deine Seele gleitet und Deine Gefühle mit seiner Fluth hinreißt; wenn der Gesang mit seinen bekannten Klängen zugleich Deine vergangenen Freuden hervorzaubert und in Deiner Brust Alles, was die Erinnerung Beglückendes und die Empfindung Süßes zu bieten vermag, sich in einem Seufzer vermengt – denke Dir dieses Alles vereinigt und stelle Dir vor, wie glücklich ich war.
Die Musik war schon längst verklungen, die Musiker hatten sich zerstreut und auch von dem einen Fenster war das Licht verschwunden, als ich mich auf den Heimweg machte. Es begann schon zu grauen und von der großen Kirche her wimmerte das Seelenglöcklein. Wer hätte damals gedacht, daß Derjenige der Glückliche sei, für den man läutete, und nicht ich!!
Ich mußte nach Paris reisen. – Mein Wagen stand gepackt unter dem Thor, als ich von Avignon zurückkehrend, wo ich Abschiedsbesuche gemacht hatte, in das Zimmer meines Vaters trat. Es war bereits Abend, nur das Feuer des Kamins beleuchtete das Zimmer mit seinem flackernden Licht. Mein Vater saß, in den Anblick der Flamme versunken, in seinem Fauteuil. – Ich setzte mich zu ihm, er reichte mir die Hand und wir schwiegen wieder. Endlich aus seinen Gedanken erwachend, sprach er so zu mir:
»Morgen gehst Du nach Paris, mein Sohn; Freuden werden Dich verlockend umgeben, Frauen, Spiel, tausend und aber tausend Gefahren, wie man sagt, aber ich fürchte von all' dem für Dich nichts; ich kenne Deine Natur und den Geist des Jahrhunderts, der ernster geworden; Du wirst durch Freuden nicht fallen oder gar zu Grunde gehen. Ich habe nur einen Rath für Dich: glaube Niemandem, denn das Jahrhundert, in welchem Du lebst, ist egoistisch, und Paris übertrifft noch sein Jahrhundert. – Es werden Menschen zu Dir kommen und unter der Maske der Freundschaft Deine Hilfe suchen, Du wirst ganze Gesellschaften finden, die sich als Werkzeug zu Deinen Planen anbieten, sich um Dein Vertrauen bemühen werden; glaube Niemandem, mein Sohn; es wird Dich Jedermann nur als Werkzeug, nicht als Ziel aufsuchen, wie groß auch Deine Verdienste wären. – Hauptsächlich mißtraue jener geheuchelten Begeisterung, mit welcher gewisse politische Principien den Jüngling verführen; denn bei jeder Volksbewegung hat Jedermann seinen besonderen Egoismus; was als Zweck des Ganzen verkündet wird, ist nur Vorwand, und wehe Demjenigen, der sich hierdurch täuschen läßt.«
»Hüte Dich vor jeder politischen Begeisterung; es gibt keine Verfassung, die nicht auf niedrigen Fundamenten beruht und die Deine leidenschaftliche Anhänglichkeit verdient. In jeder Regierungsform findet die Tugend ihre Stelle, in jede kann sich Schurkerei einnisten, denn hier wie in allen unseren Institutionen bildet unsere Natur die Grenze, die weder im Guten noch im Bösen Vollkommenheit zuläßt. – Es gibt kein politisches System, das dem menschlichen Geschlecht so sehr nothwendig ist, daß es der Mühe werth wäre, dafür sein Blut zu vergießen, sowie es auch kaum ein Regierungssystem gibt, das immer ungeeignet wäre; Alles hängt vom Augenblicke ab, und wenn auch der Mann die Handlungen seiner ersten Jugend und die Nation kaum Das verstehen kann, was ihre Vorfahren gethan haben: jede Zeit bringt das Geeignetste mit sich, und nur wer seine Zeit versteht, ist mächtig. – Denn denke nicht in Deiner Eitelkeit, daß Du den Menschen eine Richtung geben könntest; Deine Gedanken sind entweder selbst Ereignisse des Zeitgeistes, oder sie sind es nicht, und dann wirst Du für einen Narren gehalten werden, wenn Du sie aussprichst; aber glaube auch nicht, daß Du sie nicht leiten könntest, denn wie unwiderstehlich auch die einmal in Bewegung gerathene Masse ist, wenn Du Dich geradezu ihr entgegenwirfst, so ist sie doch schwach und nachgiebig, wenn Du sie von ihrer Bahn ablenkst und ihrem Lauf einen übrigens freien Weg gewährst.«
»Wehe Dem, der mit Don Quixote'scher Tapferkeit der ewig sich drehenden Volkswindmühle Widerstand leistet, aber wehe auch Dem, der, sich an sie anklammernd, jeder ihrer Bewegungen folgen will; Beide werden zertrümmert; die Vernünftige benützt die Kraft, welche durch diese Bewegungen sich entwickelt, und mahlt für sich selber.«
»Es gibt Menschen, die immer nur von der Vergangenheit träumen, und andere, die nur in der Zukunft leben; folge nicht ihrem Beispiele und besonders halte Dich in Deinem Thun nicht an starre Logik; denn der Augenblick ist immer eine Mischung der Vergangenheit und Zukunft, und seitdem die Welt steht, wird sie mit Inkonsequenzen regiert; ja gerade durch Inconsequenzen bestehen unsere Verfassungen, die Monarchie durch Elemente der Freiheit, die Freiheit, weil man in ihrem Namen streng regiert.«
»Bewundere nichts; kein Baum ist so hoch, der nicht einst ein Samenkorn gewesen, und nicht vielmehr dem Boden, in welchen er zufällig gefallen, als sich selbst seine Größe verdankt; verachte Niemanden, denn die Muschel, die auf dem Boden des Meeres festsitzt, kann der Grundstein eines Welttheiles werden, und Du kannst nicht im Voraus wissen, wie groß Das wird, was im Anfang so gering erschien. – Ein vernünftiger Mensch nimmt nie in den ersten drei Tagen eine Revolution an; nach den ersten drei Monaten wiedersteht er ihr nicht; kurz, sei ruhig, umsichtig und egoistisch, sobald von mehr als höchstens drei Menschen die Rede ist; Volksmassen sind nicht dankbar.«
»Mein Rath mag traurig scheinen, namentlich dem Jüngling, welchem in der Regel nichts gefällt, was nicht unmöglich ist; aber sobald Du ein paar Jahre hinter Dir hast, wirst Du einsehen, daß mein Rath wahr ist. – Ich war jung wie Du, und noch feuriger, denn unser Jahrhundert war reich an Hoffnungen, und die Geschichte der letzten vierzig Jahre hätte Jedermann für unmöglich gehalten, unmöglich wegen ihrer Erhabenheit und Niederträchtigkeit, wegen ihrer wechselvollen Verschiedenheit und ihres unabänderlichen Elends. Als Desmoulins auf den Tisch stieg und das grüne Blatt auf seinen Hut steckte, trug auch ich in diesem Blatt eine Welt voll Hoffnungen auf meinem Hut, auch ich träumte von einer schöneren Zukunft, von Freiheit und Menschenliebe, bis der Terrorismus mich zur Flucht nöthigte. – Und als die ohne irgend einen Grund Verfolgten unter dem Directorat zurückkehrten, kam auch ich mit ihnen, und sah Bonaparte den Consul und nach ihm die Bourbons, und dann wieder ihn, der als letzter Blitz eines dahingezogenen Gewitters noch einmal über den Horizont zuckte, dann wieder die Bourbons, und jetzt unsere Juli-Tage und Louis Philipp; Alles das war und Alles das ist vergangen, und was ist geblieben? Die Erinnerung daran und vielleicht hie und da etwas Gutes, da jede Revolution wie die Nilüberschwemmung ihren Schlamm zurückläßt; aber wer hätte sich in diesen vierzig Jahren nicht getäuscht? Und wer wird sich nicht in den nächsten vierzig Jahren täuschen, oder nach diesen, oder überhaupt so lange Menschen leben? Ich sage es Dir noch einmal, glaube Niemandem und wisse, je mehr Du von den prächtigen Nullen hinter Dir aufstellst, welche die Welt bewundert, wie: Vaterland, Humanität, Liebe, desto mehr bist Du werth; wenn Du aber Dich hinter sie stellest, so wirst Du in aller Ewigkeit wenig gelten.«
Mitternacht war vorüber, als ich Avignon verließ. Der Himmel war halb bewölkt, nur zuweilen trat der abnehmende Mond hinter den Wolken hervor, und hie und da blickten einzelne Sterne durch den grauen Schleier, die Landschaft momentan beleuchtend. Die Stadt war stille. – Rings um die Mauern brannten noch hie und da die Lampen, ein flackerndes Licht auf die alterthümlichen Mauern und die hohen Bäume werfend, welche sie umgeben; während alles Andere, wohin ihr Licht nicht drang, vom grauen Himmel sich nur wie eine dunkle Linie abhob. – Die ganze Gegend stand im Zwielicht, als ob von den Landschaften, in welchen ich einen Theil meines Lebens hingebracht, in meiner Seele nur mehr eine dämmernde Erinnerung auftauchte. – Was das Kind angestaunt, wohin der Knabe sich zurückgesehnt, wo der Jüngling seine schönsten Tage verlebt hatte, das Alles befand sich im Umkreise dieser Stadt; und als ich, an der Ringmauer schnell vorüberfahrend, endlich deren letzte Ecke verschwinden sah und wie zufällig der Gedanke in mir auftauchte, daß nun vielleicht Alles verschwunden sei, was mich jemals im Leben beglückte, – begann ich zu weinen.
»Es gibt keine Gespenster,« sagt der Machiavell dieses Jahrhunderts. O, leider gibt es Gespenster! In der Tiefe unseres Herzens liegen viele Erinnerungen vergraben, und wenn wir allein sind und rings um uns Alles stille ist und in der Brust finstere Nacht herrscht, dann verlassen sie ihr finsteres Grab und erzählen ein trauriges Märchen von vergangenen Zeiten, und das Herz schaudert in seiner Verlassenheit. O, es gibt Gespenster! Und wer ist so glücklich oder so unglücklich, daß sie nicht zuweilen vor ihm auftauchen? Wer hat nicht in seinen Träumen den Ort gesehen, wo er einst gut oder glücklich gewesen, und der jetzt, wo jede Erinnerung zur Beschuldigung geworden, wie ein großer Vorwurf vor ihm auftaucht? Vor wem taucht nicht das Gesicht auf, das einst Glück in sein Leben gelächelt hat, wer fühlt nicht den längst niedergekämpften Schmerz, wenn dieser wie ein sterbender Löwe seinen Gegner noch einmal packt, damit er mit ihm zugleich sterbe? O, ich fühlte diese Qualen; wie viele Stürme auch mein Herz durchtobt, wie viele Schmerzen auch meine Seele durchwühlt haben; keine meiner Erinnerungen ist verloren gegangen, es gibt keine, die nicht auf der schwer errungenen Ruhe meines Herzens gleich den Trümmern eines Schiffes umhertreiben, welche jede Fluth an's Ufer bringt.
Wie der Eigenthümer zwischen den Trümmern seines zerstörten Hauses, so wandelt meine Einbildungskraft in der Vergangenheit umher. Hier ist an der halb eingestürzten Wand noch ein Nagel zurückgeblieben, an welchem einst das Bild seiner Geliebten hing; dort in der Ecke stehen noch Reste des Kamins, an welchem er so viele glückliche Abende zugebracht; auf dem Boden begegnen seine Blicke den Trümmern einzelner Einrichtungsstücke, welche einst der Stolz der Hausfrau waren und jetzt im Hofe zerstört umherliegen, als ob sie ihn an sein zu Grunde gegangenes Glück erinnern wollten; die Aeste der geliebten Linde ragen verkohlt durch das offene Fenster; dürr, seitdem die Flammen seinen belebenden Saft verzehrt, aber dennoch treu steht der Baum neben der Mauer an derselben Stelle, wo der Ahn ihn einst gepflanzt hat. Wie viele Ruinen! Und wenn ich auf mein vergangenes Leben zurückblicke, wie viel Liebe, Glaube, Freundschaft und Hoffnungen erfüllten es einst – und jetzt, wie viel Ruinen! O, wenn Jemand dem Eigenthümer gesagt hätte, daß er das Haus, in welchem er so viele Freuden verlebt, so viel gehofft, in diesem Zustande sehen werde! Und wenn man mir gesagt hätte, daß auch nur Tage kommen können, so leer, wie die inhaltslosen Jahre waren, die ich verlebt habe!
Als ich am Morgen des dritten Tages in meinem Wagen erwachte, tauchte Paris vor meinen Blicken auf. Erwarte nicht, daß ich Dir die Gefühle beschreibe, welche damals meine Seele erfüllten. Es gibt im Leben Augenblicke, von welchen nur eine Erinnerung zurückbleibt, nämlich die, daß wir glücklich waren, und dies war einer jener Augenblicke. Ich war noch fern; eine große Nebelwolke, die auf dem herbstlich geschmückten Plan lag, und darüber Thürme und Kuppeln in den ersten Strahlen der Sonne, das war Alles, was ich in diesem Augenblicke sah, aber meine Einbildungskraft ergänzte das Bild. Schon standen die alte Notredame-Kirche, das Phanteon, das Invalidenhaus vor mir, und während mein Wagen sich in schneller Fahrt der Stadt näherte und die einzelnen Formen der ungeheuren Masse sich immer mehr entwickelten, schweifte meine Seele in der Erinnerung von tausenderlei Träumen umher. Denn wer hat in seiner Kindheit nicht von Paris geträumt! Vor wem tauchte nicht diese Stadt, wie eine Hoffnung auf, die, gleichsam ein Herz, das ganze Leben ihres Volkes in sich schließt, zu welchem sich jeder Tropfen Blut mit aller Macht drängt; wessen Seele erfüllte nicht Sehnsucht, wenn er von den Wundern dieser Stadt, von ihren großen Thaten oder ihrer reizenden Verderbtheit hörte? Paris ist nicht allein die Hauptstadt, Paris ist Frankreich, und die Sehnsucht, welche die Bürger dieses Landes dahin drängt, ist heftig wie das Heimweh.
Was könnte auch die Einbildungskraft des Jünglings im Provinzleben Wünschenswerthes finden? Häusliches Glück aber, das bietet seiner in's Grenzenlose strebenden Seele keinen Reiz; der Jüngling vermag nicht einzusehen, daß wir auf dieser Erde nur Wenigen leben, uns nur mit Wenigem freuen, nur mit Maß ohne Ueberdruß leben können. Nach vielen Mühen ein mittelmäßiges Vermögen erwerben, das einer Familie mäßigen Comfort bietet; mit greisem Haupte zum Maire einer kleinen Stadt gewählt werden, sich der Achtung von ein paar tausend Menschen erfreuen, das ist kein Ziel, welches man sich im zwanzigsten Lebensjahre steckt. Der Jüngling braucht mehr: anstatt des häuslichen Kreises eine Nation, anstatt der Achtung einer Stadt Ruhm, großes Vermögen, das seinen grenzenlosen Wünschen genüge, und große Freuden, mit einem Wort Paris, denn nur hier kann er das Alles hoffen. Gleich einem großen Goldschacht steht diese Stadt vor seiner Einbildungskraft, kühn vertieft er sich in ihr Gewirre, und wenn er sich Jahre lang von Gasse zu Gasse durchgearbeitet hat, wird er endlich, wie er sich vorstellt, mit schwerer Beute herauskommen und zu genießen anfangen. Oder wenn seine Seele von großartigeren Wünschen erglüht, so steht dort das hohe Pantheon, die Triumphpforten und die Denksäulen, und sein Herz fühlt sich hingerissen, daß es Menschen gegeben, die man rühmt, und daß seine Brust dasselbe beseelt, was sie groß gemacht hat. Oder wenn seine Sinne nach Freuden dürsten, so findet er in Paris, wornach er sich gesehnt, was seine Einbildungskraft glühend geahnt hat. Paris ist eine Welt voll Ruhm, Schätzen und Freuden; ein Kaleidoskop, das bei jeder Wendung des Tages in neuen Schönheiten strahlt, und wer würde sich nicht darnach sehnen? Wer ahnt es, daß er sich in diesem Goldschacht nach jedem Quentchen Gold wird bücken müssen, ehe er es sammt der Schlacke zu Tage fördert, daß er sich bis zur Erschöpfung wird abmühen müssen, ehe er zu diesen hohen Gebäuden gelangt, daß es für die Sünde kein Eden auf dieser Welt gibt, und daß er schließlich vielleicht einer Derjenigen ist, die zwischen diesen Mauern nicht einmal ein Afterglück fanden? Paris ist eine große Hoffnung, für Jedermann, wenn er die Straßen dieser Stadt betritt, später aber eine große Täuschung, welche, wenn sie verschwunden, das Leben öde zurückläßt, gerade weil es zu viel versprochen hat. In den Hoffnungen gibt es keinen Rücktritt; sobald vor Deiner Seele ein großes Ziel aufgetaucht ist, sobald Deine Hoffnungen sich über den beschränkten Kreis der Alltäglichkeit erhoben haben, ist Dein Schicksal entschieden: Du mußt Dein hohes Ziel erreichen oder elend zu Grunde gehen. Ach, und wie Viele sind zwischen diesen Mauern zu Grunde gegangen, wie viele Hoffnungsbarken, welche dieser Ort mit unwiderstehlicher Macht angezogen hat, sind an diesen gemauerten Felsen gescheitert, wie viele junge hoffnungsvolle Wesen sind in diesem tosenden Menschengewühl zu Grunde gegangen! Wer in das Innere der Herzen schauen könnte, würde schaudern über die Menschenruinen, welche hinter dem zierlichen Aeußern dieser Stadt verborgen sind.
Betrachten wir den Jüngling, wenn er zum ersten Male in ihren Kreis eintritt; sein Herz ist voll Liebe, seine Seele vom starken Glauben gehoben, sein Kopf voll glänzender Träume; er steht vor Dir wie ein Spiegel, von dessen Fläche nur das glänzende Licht der Sonne zurückstrahlt wie die Welle, deren Klarheit noch von keinem Sturm getrübt ist, wie die Blume, die ihren Kelch eben erst erschlossen und noch von ihrer Pracht kein einziges Blatt verloren hat; betrachten wir ihn später, im Spiegel seiner Seele mengen sich hundert wilde Bilder wirr durcheinander, die reine Welle hat der große Fluß in sich aufgenommen und mit seinem Schaum getrübt, die Blüthe ist in der Gluth eines einzigen Tages verblüht, und die Frucht, die aus ihr geworden, wird noch unreif schon vom Wurme der Verderbniß und der Mißvergnügtheit zernagt. Ein einziges Jahr hat er in dieser Stadt zugebracht und schon ist er alt geworden, so viele Erfahrungen hat er da gemacht. – Und was soll er jetzt thun? Soll er in das Haus seiner Väter zurückkehren, um, sobald er dessen Schwelle überschritten, zu fühlen, wie viel er verloren, seit er fern war? Um seinen greisen Vater um dessen Illusionen zu beneiden, und im Kreise seiner Verwandten umherblickend, die ihn vielleicht noch lieben, zu fühlen, daß er nicht mehr lieben kann? Er ist fremd geworden im eigenen Hause, was soll er da mehr suchen? – Und was soll er in Paris suchen? Der Traum ist geschwunden; der diesen Ort einst angenehm gemacht, der Reiz ist zerflossen und vor ihm steht die nackte Wirklichkeit, die ihn anekelt. »Genieße!« so ruft die Welt; aber die Lippen des Freudenmädchens lächeln ihm vergebens, er ahnt das traurige Geheimniß, welches er im Fieber der Sinnengluth einst vergessen hatte; er sieht das Elend, welches die prächtigen Kleider verhüllen; er weiß, wie oft diese Augen Thränen vergossen, die jetzt vor falscher Freude strahlen, wie bleich dieses Gesicht war, bis endlich der Hunger es lächeln lehrte, und das Herz schaudert, daß es einst an so viel Bitterniß Freude finden konnte, daß es nicht zurückbebte vor dem Freudenbecher, in welchen das Schicksal so viel Thränen gepreßt hat. Vielleicht hat er einst von Freiheit geträumt, aber er war hier, wo so Viele zum Opfer geworden sind, und sah den zerlumpten Chiffonnier in den glänzenden Straßen umhergehen; er sah den Hunger vor reichen Kaufläden, und das Volk verachtet von Denjenigen, die es erhoben hat, anstatt der Herrschaft des Rechtes die grausame Macht des Goldes, kurz die große Täuschung, welche einem Volke, wie auch ihm, die Hoffnung raubte und an deren Stelle nichts zurückließ, als Wünsche und die Erinnerung vergeblicher Opfer. Das Herz entsagte seinem schönsten Traume. – Vielleicht hat er einst nach Ruhm gestrebt, vielleicht erglühte seine Einbildungskraft von der Vorstellung, er werde einer Derjenigen sein, die mit der Nation zugleich ihre Macht über die ganze Welt ausdehnen, oder die im Reiche des Gedankens Jahrhunderten eine neue Richtung, den leidenden Zeitgenossen neuen Trost verschaffen; auch das war eine schreckliche Täuschung. Er war hier und sah die Mächtigen des Landes, und kennt den Sänger, bei dessen Namen einst sein Herz laut pochte; er sprach mit den Weisen, die er einst bewundert, und er ward traurig über ihre Kleinheit.
Gehe nach dem Friedhof des Père Lachaise; gehe zwischen den Grabsteinen umher, wo Foy und Molière ruhen, wo mehr edle Herzen vermodern als im Pantheon; und wenn Du auf den Hügel gelangt bist, schaue über die grünen Cypressen auf die Stadt, wo Du nichts grünen siehst; schaue von diesem Ort der Verwesung auf Paris, und wenn Du die weithin sich erstreckende Häuserwüste siehst und darüber die hohen Thürme, welche Jahrhunderte alte Erinnerungen an der Stirn tragen, und in der Ferne die Säule des großen Kaisers, und das Pantheon, und die Triumphbogen, und wenn Dein patriotisches Herz sich durch so viel Ruhm erhoben fühlt: dann erinnere Dich, daß auch dies ein Ort der Verwesung ist, [und daß unter diesem glorreichen Steinhaufen eine Nation vermodert, eine Nation, deren Hoffnungen Eitelkeit zerstört hat; und wenn und Deine Augen sich mit Thränen füllen, so gehe zum Grabe einer geliebten Person und freue Dich, daß sie gestorben ist und nicht sieht.] O, wer damals, als ich diese Stadt mit hochklopfendem Herzen zum ersten Male erblickte, mir gesagt hätte, daß ich sie einst in solcher Gestalt vor mir sehen werde!
So ist das Leben! Wie verschieden ist es von Dem, was wir in unserer Jugend davon träumen! Wie viele Wolken, die unseren Morgen in rosigem Glanze umschatten, sind spurlos verflossen, wie viele strahlten im ersten Glanz der Sonne so schön, daß unser Auge denselben kaum zu ertragen vermochte, und jetzt brachten sie Gewitter über uns und zerschlugen die dem Keimen nahe Saat unseres Lebens.
Du feierst heute Deinen Geburtstag. Während ich in meiner Einsamkeit diese Zeilen schreibe, ist Dein Empfangssaal von Deinen Freunden erfüllt, nimm daher auch von mir diesen bescheidenen Glückwunsch; und wenn Du an Deinem Kamin einen Platz siehst, welcher leer steht, – doch, wer weiß, ob ihn nicht schon Jemand eingenommen hat, so gedenke Dessen, der fern von Dir, aber nicht minder aufrichtig Dir Segen wünscht.
Es ist eine schöne Sitte der Menschen, daß sie bei verschiedenen Gelegenheiten wenigstens mit Worten einander Glück wünschen. So wie im Mittelalter die Kirche gewisse Tage festhielt, an welchen Gottesfriede herrschen sollte: so bestimmten unsere Väter auch für das Herz gewisse Tage, an welchen es, von langem Haß ermüdet, sich wenigstens freundlicher Reden erfreuen könne, und wenn es schon keine Liebe gefunden hat, sich wenigstens einer reizenden Täuschung hingebe. Viele nennen diese Sitte Thorheit; aber wenn sich zwei Bergleute begegnen, wünschen sie nicht einander Glück, und rufen nicht die Schiffe, wenn sie sich auf dem weiten Meere begegnen, einander einen Gruß zu? Und warum sollten wir das nicht auch thun? Sind wir nicht auch Bergleute, die in den finsteren Schachten des Lebens Gold suchen? Sind wir nicht Schiffer, die, auf den Wogen des Lebens umhergeworfen, nach hundertfachen Gefahren endlich doch nur ein einziges Glück finden können – Ruhe im großen Hafen! Gesegnet sei, der die Menschen diese Sitte gelehrt hat.
Aber glaube deshalb nicht, daß ich noch zurückkehre zu ihnen; seitdem ich von ihnen geschieden bin, steht das Leben klarer vor mir und ich sehe, wodurch ich im Kreise des Lebens hätte glücklich werden können; allein das Herz hat seine Kraft verloren, und ich fühle, daß man eher eine Welt aus ihren Trümmern erbauen kann, als den Glauben, wenn das Herz ihn einmal verloren hat. Ich bin ruhiger – glücklich werde ich nicht mehr sein. – Das Schiff, welches der Sturm auf eine Klippe geschleudert hat, kann auf dem ruhig gewordenen Meere noch eine Weile umherschwimmen, aber glaube deshalb nicht, daß es seinen Weg fortsetzen könne; sein Mast ist gebrochen, seine Segel zerrissen, und nur so lange ringsherum der Wasserspiegel glatt und ruhig ist, wird es sich mit seiner unheilbaren Wunde vielleicht auf der Oberfläche halten können; wenn auch grüne Lorbeeren den ausgetrockneten Baum umranken, auf die dürren Zweige Blüthe heuchelnd, so ist seine Lebenskraft doch dahin und er wird nicht mehr blühen; das herabgefallene Irrlicht kann auch noch auf der Erde fortbrennen, aber es erhellt sich nicht mehr; und so ist das Herz. Ich habe zu viel verloren, um an eine Rückerlangung alles dessen auch nur denken und somit darnach streben zu können.
Niemand ist ungeduldiger als ein Glücklicher, den eine große Freude erwartet. Sobald seine Hoffnungen zur Gewißheit geworden sind, sobald zwischen ihm und der Freude nur mehr die Zeit liegt, gleich einem Zwischenraum, der den Wanderer von seinem Ziele fern hält, es aber ohne Hindernisse sehen läßt – treten an die Stelle der Freude, welche sonst die Hoffnung bietet, die Qualen der Ungeduld. – Es ist eine traurige Ironie unseres Geschickes, daß wir uns gerade gegen die Länge jener wenigen Stunden beklagen, in welchen wir glücklich sein könnten, daß wir uns sehnen, gerade jene Jahre schnell verflogen zu sehen, in welchen das junge Herz noch fähig ist, Freuden zu genießen! – Später verliert der Mensch mit seinen Hoffnungen auch die Unruhe, die rings um ihn aufgethürmten Hindernisse gestatten seinem Blicke nicht, in die Ferne zu schweifen, seine hochfliegenden Wünsche haben aufgehört, die Ruhe seines Herzens zu stören. Er weiß wohl, daß er nicht mehr glücklich sein kann, und fängt an sich zu freuen, sich zu freuen über jedes Hinderniß, das er besiegt hat, über jede einzelne Blüthe, die er auf seinem Wege fand, über jeden Ruhepunkt, auf welchem er ausrasten konnte. Du kennst die Sage von den sibyllinischen Büchern; als die Wahrsagerin dem Könige neun Bücher anbot, war ihm der Preis zu hoch und er kaufte sie nicht, und nachdem die Sibylle drei verbrannt hatte, kehrte sie wieder zurück und verlangte denselben Preis; der König begann zu schwanken, doch als endlich die Sibylle für die drei letzten noch einmal den ganzen Preis begehrte, da kaufte der König die Bücher und bestellte besondere Priester zu deren Bewachung. So ist das Leben; was ganz werthlos erschien, dafür möchten wir später, wenn noch ein Theil übrig geblieben, jeden Preis geben.
Doch lassen wir das und kehren wir zu mir zurück, der ich ein deutliches Beispiel dieser Reflexion war. Niemand war glücklicher in Paris denn ich zur Zeit, als ich dahin kam und dort die Geliebte erwartete; und dennoch gab es vielleicht keinen Unzufriedeneren, ja Unglücklicheren, als ich zu jener Zeit war. – Während mein Wagen durch die langen Gassen fuhr, während mir im Gasthof ein Zimmer geöffnet wurde, bis meine Koffer ausgepackt waren und ich dazu kam, Toilette zu machen, erlitt ich die Qualen einer Ewigkeit. Und welche Hindernisse während des Umkleidens, denn mein Diener konnte die Kleidungsstücke im Koffer schwer finden, und wie lange mußte ich warten, bis endlich ein Cabriolet herbeigeholt wurde. In der Zeit, wo das Herz sich noch freuen kann, müssen wir jede Freude mit Tantalusqualen bezahlen, und solche erlitt ich. – Endlich saß ich im Cabriolet; mein Kutscher, welchem ich erröthend die Wohnung meiner Julie bezeichnete, fuhr, als ob er mein Vorhaben errathen hätte, schnell nach dem bezeichneten Faubourg, und ich konnte mich ungestört meinen rosigen Träumen hingeben. O, könnte ich nur noch einmal so angenehm träumen, könnte, wenn auch nur ein einziges Mal, in meiner Seele die beglückende Täuschung erwachen, mit welcher ich damals durch die Straßen von Paris eilte, die Täuschung, es warte meiner ein Herz, das rascher schlägt, wenn ich eintrete, Lippen, die mit einem Freudenruf meinen Namen aussprechen, Arme, die sich mir liebevoll entgegenbreiten werden. O, könnte ich nur noch einmal meinem Glück vertrauen, könnte ich noch einmal zu jenen schönen Tagen zurückkehren, wo das Herz in seiner Liebe den außer diesem Staubklumpen befindlichen archimedischen Punkt gefunden – wie glücklich wäre ich! Vergebens! Die laublosen Bäume werden beim wiederkehrenden Frühling sich auf's Neue in Grün kleiden, die untergegangene Sonne wird morgen neue Strahlen ergießen, das Stück Erde, welches die Stürme des Meeres von der Küste losgerissen, taucht an der andern wieder auf: – nur das Herz verliert seine Schätze auf ewig. Wie Du auch immer weinen mögest, wie viel Du auch betest, der Strom der Zeit wirft Deine Lieben, die er einst verschlungen, nur als Leichen wieder aus. Lerne vergessen oder entsagen und dulden; sobald Du diese Welt erkannt hast, ist es aus mit der Hoffnung.
Vergebung, mein Freund, daß ich anstatt interessanter Geschichten, welche Du in meiner Biographie vielleicht erwartest, Dich mit solchen Kleinigkeiten langweile. Die größten Augenblicke hängen nicht von der äußeren Welt ab, diese Welt ist nur die Palette unseres Daseins, wo die Seele die Farben findet, doch nur um sich selbst ein Bild zu schaffen; das Herz hat seine besondere Geschichte, und ein trauriger Gedanke, ein freundlicher Traum kann für unser ganzes Leben mehr bedeuten als die Weltgeschichte. Und so ist mir dieser Moment interessant. Das Herz braucht Festtage, wo es die ganze Pracht seiner Empfindungen entfalten könne. Sei es ein Widersacher oder Furcht oder Freude nach überstandener Gefahr, gleichviel, das Herz muß beben, pochen, um zu leben; Ruhe ist Tod. – Wer erinnert sich nicht an die ersten Tage seiner Liebe, wo dieses einförmige Leben so ereignißvoll schien, wo die Liebe wie ein Freudenstrahl das Leben durchdrang, und wo früher Alles leer erschien, auf einmal Millionen Glückseligkeits-Atome sich vor seiner Seele bewegten.
Ich wollte meine Julie überraschen, und den Wagen ein Haus früher verlassend, befahl ich dem Kutscher, nach einigen Stunden wieder dort zu sein; dann ging ich zu Fuß zu dem Thor ihres Hauses. Mit zitterndem Herzen fragte ich den Portier nach ihrer Wohnung. – Sie war nicht zu Hause. – Du kannst Dir vorstellen, wie traurig überrascht ich war, besonders wenn Du bedenkst, daß ich in jenem Lebensalter war, in welchem man Alles leichter verliert als die Gelegenheit einer romantischen Scene. So ist das Leben; wen das Schicksal mit großen Streichen verschont, den kann es mit kleinen Hebeln quälen, welche sein Herz – wenn auch nur auf kurze Zeit – mit eben so viel Bitterniß erfüllen, wie jene! Und wenn wir die Lebensgeschichte der glücklichsten Menschen kennten, so würden wir gewöhnlich nichts als ein Mosaik finden, dessen glattes Bild aus einzelnen eckigen Glasstückchen besteht, von welchen jedes einzelne verwundend oder mindestens werthlos ist.
Da ich meinen Wagen nicht an der vorigen Stelle fand, ging ich traurig weiter, ziellos im Straßenlabyrinth umherirrend, wo ich, seit ich meine Julie nicht gefunden, nicht wußte, was ich suchen sollte. Meine Seele war traurig. – Seitdem ich liebte, fühlte mein Herz sich jetzt zum ersten Male in seinen Hoffnungen getäuscht, und wie eine düstere Ahnung erfüllte es mich, daß dies nicht die letzte Täuschung sein werde. – »Du bist kindisch,« sprach ich zu mir, »wußte denn Deine Julie, daß Du kommst? Kann sie nicht in die Kirche oder zu einer Freundin gegangen sein? Und was schadet es schließlich, wenn ich sie ein paar Stunden später sehe? Aber sie hat mein Kommen nicht geahnt,« dachte ich weiter, »das Geschick will nicht, daß ich glücklich sei.« Das Herz ist voll von Vorurtheilen, wenn es liebt, und fühlt Schmerz, wenn es selbst nur in seinen Träumen getäuscht wurde. Und wer weiß nicht, wie peinlich jede erste Täuschung ist. Der Mensch ist ein Spieler, den sein trügerisches Geschick zuerst gewinnen läßt, und wenn endlich sein Glück sich wendet und seine Würfel gegen ihn fallen, wenn er zum ersten Male ahnt, daß man auch verlieren kann, dann sieht er zuweilen seine ganze Zukunft auf einmal vor sich und schaudert.
In meine Gedanken versunken, ging ich weiter; ich verließ das Faubourg, ging durch das sogenannte Quartier Latin und kam, durch immer schmalere Straßen fortschreitend, endlich in jenen Theil der Stadt, wo der ärmste Theil der Bevölkerung wohnt und der Beobachter unter Schmutz und Koth vergißt, daß er sich in der modernsten, freudenvollsten Stadt der Welt befindet. – Paris gleicht nicht anderen Städten. Als ob mehrere von einander entfernte kleinere Städte sich wunderbar vereinigt hätten, jedoch noch nicht mit einander verschmolzen wären, so stehen einzelne Theile neben einander, ewig fremd, und jede mit ihren eigenen Sitten und Anschauungen; ein Häuserchaos, wenn man es von der Höhe im Ganzen betrachtet; Bruchstücke einer Welt, wenn man die verschiedenen Elemente der Bevölkerung in Augenschein nimmt. Gehe von den schweigenden Palästen des Faubourg, wo die großen Wappen Dich erinnern, daß die schönen Tage des alten Adels dahin sind, in die lärmenden Gassen der Chaussee d'Antin, wo glänzende Kaufläden, moderne Kutschen, die elegant gekleidete Menge, die rings um Dich wogt, Dich lärmend erinnert, daß Du Dich unter den Mächtigen dieses Jahrhunderts befindest, die kein anderes Wappen haben als dasjenige, welches auf 100.000 Louisd'or gedruckt ist, deren Namen Du nur im großen Buch der Börse findest, deren Geschichte nur in Ziffern geschrieben ist, die aber, wenn sie auch keinen Schatz von Erinnerungen besitzen, wie Diejenigen am jenseitigen Ufer, anstatt einer schönen Vergangenheit die ganze Gegenwart ihr eigen nennen; und von da gehe in die Straße St. Denis, in's Faubourg Saint-Antoine oder in den Stadttheil des Pantheon, betrachte die dunklen Häuser, wo die Spuren der Mode verschwunden sind, höre den Arbeitslärm rings um Dich, schaue die zerlumpten Bettler an, die Schaar kräftiger Arbeiter, die sich im bunten Gemenge rings um Dich drängt und der Du vorher den verächtlichen Ausdruck des stolzen Marquis oder seiner noch stolzeren Bedienten, später das befriedigte Lächeln der Freudenjäger, das seelenlose Gesicht des Banquiers, und jetzt in Elend und Jahrhunderte altem Haß vom Vater auf das Kind übergegangene verwilderte Züge vor Dir sahst: sage, ob Du Dir vorstellen kannst, Du seiest in derselben Stadt. – Paris ist eine Welt, in welcher vom Bettler bis zum Millionär Jedermann seine eigenen Hoffnungen und Täuschungen findet, in der sich vor Jedem ein anderer Gesichtskreis erschließt, je nachdem er auf einer tieferen oder höheren Stufe des gesellschaftlichen Lebens steht; eine Welt, in der man die Bestätigung und Widerlegung eines jeden Gedankens findet, als ob das Schicksal alle Nunancirungen des menschlichen Daseins deshalb auf einem Fleck vereinigt hätte, damit wir auf einmal sehen können, wie doch Alle in gleichem Maße elend sind.
Endlich kam ich in eine schmale Gasse, und zwischen hohen gebräunten Häusern und schmucklosen Kaufläden fortschreitend, sah ich in der Gasse nur einige Fußgänger und vor mir an einem Hause einen einzelnen Fiaker. Ich war müde, und da ich nicht wußte, welchen Weg ich einzuschlagen hätte, rief ich den Kutscher an: allein er war schon gedungen, und bereits wollte ich nach seiner Anweisung meinen Weg fortsetzen, als ein Herr und eine Dame Arm in Arm aus dem Hausthor kamen. – Es war meine Julie, und der Mann derselbe, den ich vor einigen Monaten in der großen Kirche zu Avignon gesehen hatte. – Ich staunte. – Sie stiegen schnell in den Wagen und dieser fuhr fort. Es war meine Julie! Aber hier, in einer Miethkutsche und mit einem fremden Manne! Hatte ich sie nicht bereits in der großen Kirche zu Avignon gesehen? Und erkannte ich nicht meine Julie! wenn auch unter dem Schleier? Aber Julie –! Ich war vernichtet. »Ich muß hier klar sehen!« überlegte ich, und stürzte in das Haus. – Ich fragte die Hausmeisterin; aber die arme Frau konnte mir nur sagen, daß ein Herr dieses Zimmer gemiethet habe, sie wisse jedoch nicht, wie er heißt. – »Ich muß es wissen!« wiederholte ich und rannte, wie ein Wahnsinniger von Gasse zu Gasse, mich immer mehr verirrend, immer mehr verzweifelnd, bis ich endlich Miethkutschen fand. Ich fuhr zu dem Hause meiner Julie, nicht wissend, was ich wollte, aber mit unwiderstehlicher Macht hingezogen.
»Wo ist die Gräfin?« fragte ich heftig den Portier, der mit aller Kälte, mit welcher sich ein solcher Mensch einem Fremden gegenüber benimmt, den er aus einer alten Miethkutsche mir schmutzigen Stiefeln steigen sieht, mir antwortete, sie sei noch nicht nach Hause gekommen. In diesem Augenblicke rollte eine elegante Kutsche in's Thor und meine Julie stieg aus in einer anderen Toilette, als in welcher ich sie vorher gesehen hatte. Verblüfft stand ich da. – Sie bemerkte meine Anwesenheit nicht und eilte die Treppe hinauf. Ich war außer mir, ich hätte weinen mögen vor Freude, das Herz zersprang mit fast vor Wonne. Wie eine Welle, die sich trübe erhebt und dann in glänzende Tropfen zerstiebt, so wechselte in meinem sturmdurchtobten Herzen die Stimmung. Ich wollte ihr zu Füßen fallen und sie um Verzeihung bitten für meine profanen Gedanken, Aus meinen Träumen erweckte mich der Portier, der mir in rauhem Tone sagte: »Die Gräfin empfängt heute Niemanden, kommen Sie morgen.« – »Ich werde hinaufgehen!« sagte ich zornig. Der Portier sah mich verächtlich an. Ich hätte mein Leben darum gegeben, wenn ich sie in diesem Augenblicke hätte sehen können; aber meine Kleider waren beschmutzt, und nachdem ich meine Karte übergeben, auf welche ich meine Adresse geschrieben hatte, ging ich traurig fort. Glückliches Alter, wo das Herz sich noch für schuldig hält, wenn es Das, was es später erlebt, nur zu denken wagte – wo die Dame seiner Liebe noch strahlend vor seiner Einbildungskraft schwebt – wo es nicht weiß, daß Frauen freundlich lächeln, mit warmen Worten sprechen und Einem zitternd die Hand drücken können und bei alldem dennoch täuschen. – Nach dem indischen Mythus schwebt vor den Augen eines jeden Sterblichen die Wolke Maja's, der Schleier der Täuschung, welcher die Dinge nicht in ihren wahren Farben sehen läßt. Wehe Dem, vor dessen Augen die Wolke zerfloß, vor ihm liegt Alles offen, er sieht die Gegenwart und die Zukunft; und ach, die Welt ist ein trauriger Anblick.
Kaum war ich in meiner Wohnung, als ich von Julien ein Billet erhielt; sie machte mir freundliche Vorwürfe, daß ich wie ein Fremder meine Karte übergab, und bat mich sowohl in ihrem, als auch ihres Vaters Namen, zum Diner zu kommen. Es waren die ersten Zeilen, die ich von Julien erhalten. Es gibt gewisse Schriftzeichen, so dachten die Menschen, als sie noch am Aberglauben hingen, deren Zaubermacht Wunder wirkt – durch welche, wenn wir sie erblicken, die Erde erbebt, der Himmel sich verfinstert und die Menschen zum Gebete niedersinken; und ich fühlte diese Zaubermacht – unter meinen Füßen erbebt die Erde, Nebel umschleierte meine Augen und ich fühlte mich hingerissen. Denn sie liebt mich, dachte ich mir, sie weiß, daß ich hier bin, und ihr Herz sehnt sich nach dir; sie liebt mich! Hat es mir nicht ihr flammender Blick gesagt, und der zitternde Händedruck, und die heimliche Thräne, als wir schieden, und jetzt diese Zeilen? Ich war unendlich glücklich. So wenig gehört zu unserem Glück, wenn wir noch glauben; das Herz findet da noch in Allem die Bestätigung seiner Hoffnungen. Punkt Fünf war ich im Hôtel. Im Salon war noch Niemand anwesend. Eben erst aus der Provinz gekommen, wußte ich noch nicht, daß in der großen Welt selbst die Einladungsstunde nicht wahr ist, und das Erste, was ich, in dieses Haus tretend, fühlte, war jene Beschämung, welche Derjenige, welcher die Gesetze der Mode übertritt, noch mehr fühlt, als wenn er sich gegen die Gebote Gottes und der Natur vergangen hätte. – In der großen Welt gleichen die Menschen den Uhren, deren jede zu schnell oder zu langsam geht, während nur diejenige richtig geht, die den Anforderungen des Augenblickes gerecht wird. Wehe Dem, der sich nach der gewöhnlichen Uhr richtend, zuerst in irgend einen Saal tritt; der wohlerzogene Mensch weiß, daß in einer Gesellschaft, wo Niemand arbeitet, Jedermann die Pflicht hat, wenigstens so zu thun, als ob er keine Zeit hätte; er weiß, daß man in einem Kreise, der sich nicht um das Jahrhundert kümmert, auch die Stunde vergessen muß. Doppelt wehe Demjenigen, der, wenn er nicht einer der Auserwählten ist, die edle Gesellschaft warten ließ; er sollte wissen, daß die sogenannte große Welt gleich unserer gewöhnlichen, von Gott geschaffenen Welt nur zur Freude Weniger geschaffen ist, und daß der gewöhnliche Mensch nicht auffallen darf; er mag sich glücklich schätzen, wenn er geduldet wird und weitervegetiren darf. Hat er sich lächerlich gemacht, so ist er verurtheilt. Du staunst! Du hast nicht in diesen Kreisen gelebt und weißt nicht, wie leicht es ist, darin lächerlich zu werden; eine schöne Handlung, in deren Ausübung Du gestrauchelt bist, ein Wort, in edler Aufregung, jedoch fehlerhaft gesprochen, selbst Dein bescheidenes Schweigen kann Dich auf ewig zum Gegenstände des Gespöttes machen. Hundert und aber hundert Menschen umgeben Dich, die nichts Anderes zu thun haben, als aus Spottsucht Deine Fehler oder aus Egoismus Deine Schwächen zu belauschen. Die Gesellschaft ist eine große Comödie, die Schauspieler führen ein eigenes Leben und spotten und verlachen auf ihrer Bühne Denjenigen, der unter ihnen vielleicht die beste Rolle spielt; Ihr sitzt auf der Galerie und lächelt über das Ganze.
Der Salon, in welchem ich, auf den Hausherrn wartend, auf- und abging, war einer der wenigen, die in Paris ihre vor der Revolution modern gewesene Form beibehielten. Das Rococo, welches die neue französische Aristokratie liebt, um in ihren Wohnungen wie in Allem ihre Vorgänger nachzuahmen, war hier mit dem Hause zugleich entstanden. Die dunkelrothen Vorhänge, die weißen vergoldeten Holzschnitte an den Wänden, die pausbäckigen Engel am Kamin, die gemalte Allegorie am Plafond, kurz, Alles stand so, wie es vor drei Generationen aufgestellt wurde; aus unserem Zeitalter hatte nur das Porträt Carl's X. unter dieser Pracht des vorigen Jahrhunderts Platz gefunden; auch das ist ein Trauerandenken, ein Todter unter den Todten. – In diesem Salon hatte die Zeit nichts geändert, nur daß sie Alles glanzloser, dunkler gemacht hatte. Es war dies ein Blatt aus dem Buche der Geschichte, welches der Leser nicht umwenden wollte, das aber zuletzt ganz abgegriffen wurde; es war eine der Stellen, wo der Geist des vorigen Jahrhunderts uns nur entgegentrat, um uns an seinen Tod zu erinnern. Und dennoch! wie viele Täuschungen hatte der Bewohner dieses Salons zwischen seinen altväterischen Möbeln gefunden! Hatte er in dem Armsessel seiner Ahnen, umgeben von gleichgesinnten Freunden, nicht gedacht, daß Alles noch wiederkehren könne, und daß er, die Gesellschaft überblickend, Alles so finden werde, wie er es in seiner Kindheit gewohnt war? – Jeder Mensch beurtheilt die Welt nach seiner eigenen Umgebung, und weil er darin nur Gleichgesinnte duldet, sieht er sie gewöhnlich so, wie er sie wünscht; und wenn Du selbst die Uebertriebendsten fragst, so wirst Du Wenige finden, die nicht von einer Majorität träumen, besonders wenn ihre Erinnerungen für sie sprechen. Darum klammert sich jede besiegte Partei so sehr selbst an ihre geringsten Erinnerungen, darum will sie wenigstens die Form erhalten, nachdem das Wesen derselben verloren gegangen, wie die alten Egypter, welche die Leichen ihrer Verstorbenen einbalsamirt aufbewahrten, weil sie glaubten, daß einst die Seele wiederkehren und ihre alte Wohnung aufsuchen werde. Vergebliche Täuschung! Der gefällte Baum treibt keine Reiser mehr, doch der Same, der einmal in die Erde gelegt wurde, geht einst auf und trägt die gleichen Früchte. Dies mag der Trost einer jeden besiegten Partei sein; das Geschick des Menschengeschlechtes wird durch ihren Untergang nicht unglücklicher sein, und die künftige Generation wird dasselbe erdulden, wogegen die Ahnen ankämpften, bis sie endlich sich wieder zum Kampfe erhebt und wieder siegt, um wieder zu leiden; das ist unser Geschick. – Schließlich behält Jeder die Hoffnung, und obwohl das menschliche Geschlecht größtentheils nur aus Solchen besteht, die vorwärts oder rückwärts gehen möchten, und obwohl jede Idee ihre Propheten hat, die sie vorausgesehen haben, und ihre Don Quixote's, die für sie kämpfen, wenn sie längst veraltet ist: so besteht die Welt dennoch, und politische Begriffe haben zuletzt doch nur Diejenigen unglücklich gemacht, die ohnedies nicht glücklich sein konnten. – Mit solchen Gedanken beschäftigt, ging ich auf und ab.
Endlich öffnete sich die Thür und meine Julie und ihr Vater traten in den Salon. Der Alte empfing mich freundlich, Julie befangen, aber, wie es schien, mit Freuden. Der Marquis war ganz so, wie ich mir ihn nach der Schilderung meines Vaters vorgestellt hatte, und auch ohne diese konnte ich mir bei meinem ersten Eintritt in das Haus, nach einem einzigen Umblick in demselben denken: das ist ein französischer großer Herr aus dem vorigen Jahrhundert. Wer kennt diesen Typus nicht? Diese Leute kamen theils mit der alten Kleidung, alle aber mit den alten Vorurtheilen nach Frankreich zurück und erinnerten sich an Alles, nur nicht an Das, was sie mit eigenen Augen gesehen hatten; und so standen sie, durch ein glorreiches Vierteljahrhundert von ihrer Nation getrennt, fremd im Heimatlande. Frankreich hatte sich verändert. Die adeligen Burgen standen in Ruinen, die Nation hatte neue Namen verehren gelernt, und die aufwachsende Generation wußte, daß die Gloire sie ihrer Väter beraubt hatte. Die Emigration sah nur die Berge und Flüsse, die an ihren alten Stellen geblieben waren, und kaum fühlte sie sich wieder heimisch, so begann sie ihr früheres Leben wieder. Freundlich und mit derart feinen Manieren, daß ihre Herzlichkeit keine Freundlichkeit erwecken konnte, so herablassend, daß Niemand sich ihnen nähern konnte, ohne sich verletzt zu fühlen: so traten diese Herren in ihren goldgestickten Röcken da auf, wo das Volk gewohnt war, Lorbeern zu sehen, ihre Namen stolz aussprechend, wo die Großen die Namen der seit einiger Zeit gewonnenen Schlachten führten, und so gingen sie noch einmal zu Grunde, jedoch ohne sich zu ändern.
Beim Diner waren Gäste zugegen, nach dem Diner kamen Besuche, und so konnte ich mit Julien kaum sprechen. In der Gesellschaft hat nur Derjenige Verstand, der nichts denkt und spricht, bevor er weiß, was; und da ich daran noch nicht gewohnt war, und in dieser Kunst, bei welcher man, wie beim Goldwäschen sich im Sand und Wasser abmüht, bis man endlich unter vielen unnützen Dingen ein Stückchen Gold findet, es zu keiner großen Meisterschaft gebracht hatte, so zog ich es vor, zu schweigen. Ein Umstand fiel mir auf. Während die Gesellschaft im Salon sich über politische Gegenstände unterhielt, brachte der Kammerdiener Julien einen Brief. Ich nahm an der Conversation nicht Theil und verfolgte Julie mit meinen Blicken, die an einem Nebentisch den Brief erbrach. Sie erblaßte, ihre Hand zitterte; endlich ermannte sie sich, zerknitterte das Papier und warf es in den Kamin; außer mir bemerkte dies Alles Niemand von der Gesellschaft; wenn jedoch Jemand auf mich geachtet hätte, so würde ihm meine Aufregung unmöglich entgangen sein. Endlich entfernten sich die Besuche, der Marquis ging zu einem seiner Freunde, wo er zu spielen pflegte, und wir waren allein.
Julie saß am Kamin und schaute, in Gedanken vertieft, in die Flammen, welche ihr Gesicht in Glanz hüllten, als ob sie deren Aufregung durch ihr flackerndes Licht verhüllen wollten. Ich saß, in ihren Anblick versunken, in den angebeteten Zügen nach ihren Gefühlen spähend, glücklich wie ein Kind, das, in den hellen Fluß schauend, möge es am Grunde desselben was immer gesehen haben, sich freut, daß es so tief hinabschauen konnte. Endlich redete ich sie an: »Julie, Sie sind traurig.«
Sie sah mich an und zwang ihre Lippen, zu lächeln. »Wer hat Ihnen das gesagt?« sprach sie; »ich bin nicht traurig; sahen Sie nicht, wie heiter ich war während des Diners, wie viel ich scherzte und lachte, und warum sollte ich denn auch traurig sein?«
»Während des Diners möglich,« antwortete ich »aber seitdem Sie das Briefchen erhalten haben –«
Sie erröthete.
»Meine theure Julie,« fuhr ich beklommenen Herzens fort, »theilen Sie mir Ihren Kummer mit.«
»Meinen Kummer? Es ist eine Kinderei, eine weibliche Laune,« sprach sie mit erzwungenen Gleichmuth, »nichts weiter. Glauben Sie nicht, nach dem Gesicht einer Dame den Zustand ihres Herzens beurtheilen zu können; auf dem Meere kann Jedermann den tobenden Sturm, auf dem Gesichte des Mannes dessen große Leidenschaften sehen; doch der Spiegel eines kleinen Bassins wird durch ein Kieselsteinchen, das hineinfiel, eben so in Bewegung gebracht, wie durch einen Sturm, und so kann nach unserem Gesicht Niemand beurtheilen, ob es das Gepräge eines großen oder kleinen Kummers trage. Uns hat die Natur einen kleinen Kreis zugemessen.«
»O Julie, verheimlichen Sie es mir nicht,« sprach ich ergriffen, »Ihr Herz belastet ein schwerer Kummer.«
»Sei dem so,« sprach sie mit bebender Stimme; »wenn dieses Herz ein großes Unglück betroffen hätte, ein solches, das man nie vergißt, welches als bitterer Tropfen in den Kelch des Lebens fällt und das ganze Leben verbittert: könnte ich es nicht mit eigener Kraft ertragen? – Ihr Männer seid die Herren der Schöpfung, Euer ist die Welt sammt Allem, was darauf lebt und vegetirt; Ihr könnt bewundert oder egoistisch sein, Ihr könnt für eine Nation oder Euch selbst leben, je nachdem Euer Herz es wünscht; Euer ist die Freude, die Macht und der Ruhm; das Weib hat nur einen Besitz, den Schmerz, aber der gehört ihr und sie theilt ihn mit Niemanden.«
»Und hätte der Freund kein Recht auf Vertrauen?« sprach ich betrübt. »Soll er nicht sagen können: Gib mir einen Theil von dem Schmerz, welcher Dein schwaches Herz erdrückt; laß' einen Theil Deiner Wolken meinen Himmel verfinstern, damit es über Dir heiterer werde; überlasse mir die Hälfte Deiner Last, denn ich liebe Dich, und die Last, welche wir von den Schultern der Geliebten auf unsere eigene laden, wird zum Schutz und ich habe mich um diesen Schatz verdient gemacht, denn ich liebe Dich. Dürfte das nicht Der sagen, der sein ganzes Leben einer Dame geweiht hat? Und könnte die Dame in ihrem Stolz ihm diese Bitte verweigern, wenn sie weiß, daß aller Jammer dieser Erde eine von geliebten Augen geweinte Thräne nicht aufwiegt, deren Grund wir nicht kennen?«
Tief ergriffen schaute sie mich an. »Sie sind ein guter Mensch,« sagte sie endlich; »gebe der Himmel, daß Ihr Herz sich niemals ändere und daß es eines der wenigen sei, die wie die Rosen, wenn auch von der Zeit stark entblättert, auch noch in ihrem letzten Blatte ihre Farbe und ihren Duft behalten; aber glauben Sie nicht, daß Ihr Trost meinen Kummer lindere. Die Leiden der Frauen sind derart, daß Trost nicht helfen kann; das weibliche Herz ist zu weich, als daß Vernunftgründe darin Widerhall finden könnten; und wenn sich am Himmel einer Frau auch Millionen Sterne zeigen, sie weiß doch, daß ihre Sonne untergegangen, und bei den Glanzpunkten erinnert sie sich nur an die Nacht, die rings um sie dunkelt.«
»O Julie!« rief ich, von meinen Gefühlen hingerissen, »Sie leiden!«
»Ich!« sagte sie, wie aus ihren Träumen erwachend und das Gesagte bereuend; »wer spricht denn von mir und woher vermuthen Sie, daß ich leide?«
»Und der Brief?« sprach ich und zitterte, denn ich war mir meiner Indiscretion bewußt.
Julie erblaßte. »Ja, der Brief,« sprach sie mit erstickter Stimme, verzweiflungsvoll zum Himmel aufblickend, »der unglückliche Brief! – Sie erinnern mich an meine Pflicht; diese Zeilen,« fuhr sie mit zitternder Stimme fort, »betreffen eine Person, die meinem Herzen theurer ist, als ich selbst, und für deren Sicherheit ich sorgen muß. Erlauben Sie, daß ich ein paar Zeilen schreibe, ich werde sogleich wieder hier sein.«
Sie ging hinaus und ich blieb allein im Salon zurück. Alles war still, nur das Knistern der Flamme und zuweilen das von der Gasse heraufdringende Rollen eines vorüberfahrenden Wagens unterbrach die Stille; den Kopf auf die Hand gestützt, saß ich da und schaute auf den großen Aschenhaufen, über welchen nur noch ein Stück Holz von Zeit zu Zeit aufflackerte. – »Julie ist unglücklich, – unglücklich wegen eines Andern, den sie mehr liebt, als sich selbst, vielleicht als die ganze Welt, und den ich nicht kenne,« dachte ich mir; »sie liebt, und nicht mich.« Die Qualen der Eifersucht erfüllten mein Herz. – Da trat Julie ein. Sie stellte sich neben mich zum Kamin; ich schaute sie an, ihre Wangen waren blaß, ihre Hand, in der sie einen Brief hielt, zitterte. »Julie,« sprach ich, schaudernd über den Ausdruck ruhiger Verzweiflung, mit welchem sie vor mir stand, »was ist geschehen?«
»Es ist Alles aus,« sprach sie mit schmerzerstickter Stimme; »ich habe den Brief geschrieben, ich wollte ihn fortschicken, allein ich sah, daß mein Plan Thorheit ist; bevor ich dieses Geheimniß einer dieser Sclavenseelen anvertraue, bevor ich selbst den Verräthern eine Waffe in die Hand gebe, möge geschehen, was das Schicksal mir beschieden hat, ich bin auf alles gefaßt.«
»Und von diesem Brief hängt Ihr Schicksal ab?« sprach ich zitternd.
»Nicht das meine,« antwortete Julie ruhig, »aber das einer Person, die meinem Herzen theurer ist als ich selbst; wenn diese Zeilen noch heute in die Hände meiner Freundin gelangen, so kann vielleicht noch Alles gut werden.«
»In die Hände Ihrer Freundin?« sprach ich, vor Freude hingerissen.
»In die Hände meiner Freundin, der Marquise Valmont.«
»In die Hände Ihrer Freundin, die Sie mehr lieben als sich selbst? sprach ich außer mir vor Freude; »edle Seele, die so lieben kann. Und ich bin hier und sie verzweifeln, oder sollte ich Ihr Vertrauen nicht verdienen?«
»Sie?« stammelte Julie, und ihre Wangen erblaßten noch mehr. »Sie? Niemals!«
»Warum nicht ich?« sprach ich endlich; »bin ich so niedrig, so verachtungswürdig, daß Sie mir nicht einmal diese Zeilen anvertrauen wollten?«
»Niemals,« sprach Julie leise, »nur Ihnen nicht.«
»Julie!« rief ich verzweiflungsvoll, »ich liebe Dich unaussprechlich, wie das Herz nur einmal lieben kann. Dein Dasein erfüllt meine Seele mit unendlicher Seligkeit, und wenn Du auch immer schwiegst und meine Leidenschaft vielleicht nicht erwidertest, so war ich doch glücklich, denn ich sah Dich, denn ich hörte Deine Stimme, denn ich fühlte Deine Nähe, denn Du warst –«
Sie schaute mich ergriffen an, zitternd reichte sie mir die Hand und sprach: »Und wissen Sie, was lieben heißt? Allem entsagen, woran Sie einst hingen, Alles aus Ihrem Herzen reißen, wovon es einst erfüllt war, selbst Ihre Erinnerungen; Abschied nehmen von den Freuden des Lebens, die Laufbahn verlassen, auf welcher Sie einem glorreichen Ziel entgegengehen können, Namen, Herz, Ruhm, die ganze Welt für ein Weib hinwerfen; und nachdem Sie endlich Ihre Zukunft für einen Augenblick, die Welt für ein Herz, alle Heiligthümer Ihres Glaubens für ein leises Ja hingegeben, sehen, daß Sie getäuscht sind: – das ist die Liebe. O, lieben Sie mich nicht, ich verdiene es nicht.«
»Und weißt Du, was lieben ist?« sprach ich hingerissen. »Allem entsagen, alle Erinnerungen aus dem Herzen reißen, Herz, Ruhm und die ganze Welt für ein Weib hinwerfen; für ein Weib alle Hoffnungen aufgeben, und fühlen, daß das Weib echt und treu ist; mitten in der Welt, wo Alles leidet, fühlen, daß Du glücklich bist; mitten unter den falschen Menschen ein Herz kennen, das treu bleiben wird, einen Ruhepunkt kennen, wo Du ausruhen kannst, Lippen, die für Dich beten, Augen, die sich nur für Dich erschließen, ein Wesen, dessen Gott Du bist, weil Du es beglückt hast, eine Welt, verschieden von derjenigen, in welcher die Uebrigen leben, eine Welt, in welcher Du ein anderes Leben lebst, andere Freuden genießest, in anderen Hoffnungen schwelgst, und welche Du mit Deinen Armen umfassen kannst, denn sie steht in der geliebten Person vor Dir; das ist lieben! Das ist es, was ich durch Dich fühle, was mir der Himmel mit all' seiner Macht nicht rauben kann. Und jetzt weißt Du, wie Du mich beglückt hast; gib mir den Brief.«
»Und wissen Sie, was Sie verlangen?« sprach Julie leise. »Dieser Brief kann ein unübersteigliches Hinderniß sein zwischen mir und Ihnen.«
Ich erschrak. Sie schwieg eine Weile, dann fuhr sie erröthend und leise fort: »Wenn mein Vater je erführe, daß Sie diese Zeilen meiner Freundin überbracht haben, die er haßt!«
»Ihr Vater?« sagte ich entzückt, »glauben Sie, daß ich an mich denke? Lieben Sie mich und ich bin glücklich.«
»Gustav!« sprach sie ergriffen und ich hielt sie in meinen Armen und fühlte ihre Thränen, die mein Gesicht benetzten, ich fühlte ihr Herz an meinem schlagen und weinte in qualvoller Wonne. Als wir uns trennten, strahlte Freude in Juliens Gesicht und ich stürzte wonneberauscht zur Marquise.
Mitternacht war längst vorüber, als ich von der Marquise, in der ich eine schöne und geistreiche Dame fand, in meine Wohnung zurückkehrte; es dämmerte, als ich in Schlaf versank, und Mittag war es, als ich aus meinen unruhigen Träumen erwachte. – Ich ging in die Tuilerien. – Zu jener Zeit, von welcher ich spreche, stand das Andenken der Juli-Revolution noch lebhaft vor den Augen der Wenigen, die später den Nutzen derselben genossen, ihre Geschichte aber vergaßen: und das Volk konnte, wie es unter seinen früheren Königen gewohnt war, in dem königlichen Garten frei umherwandeln, wo jetzt – 1836 – nur der anständig Gekleidete Einlaß findet, damit der arme Landmann, der in seiner Blouse kommt, den eleganten Spaziergängern nicht zum Aergerniß diene, oder das elende Bettlerkind, das vielleicht im Schatten der Bäume spielen möchte, den Kindern der Vornehmen nicht die Unterhaltung verderbe. – Alle die großartigen Fortschritte, durch welche die Juli-Dynastie die legitime Familie vergessen machen möchte und gegen die man nichts einzuwenden hätte, wenn nicht einige tausend Franzosen dafür ihr Leben verloren hätten und nicht ein großer König in der Verbannung gestorben wäre, existirten damals noch nicht. Und als ich in den Garten trat, strömte die Menge in gemischten Gruppen vor mir vorüber, ein großer Strom, in welchem die glänzenden und dunklen Wellen vermengt sind. – Auf mich hat dieser Garten stets einen besonderen Eindruck gemacht; er liegt zwischen dem Palais und dem Revolutionsplatz, zwischen den Schauplätzen des größten menschlichen Glanzes und des schrecklichsten Elendes, wie geschaffen dazu, daß die in diesen Alleen Lustwandelnden die Entfernung messen lernen, welche ihr Glück von ihrem Untergang trennt, und sehen, wie gering jene ist. Wer kann durch diese Räume gehen, ohne daß es ihm einfällt, über wie viele dahingeschwundene Hoffnungen diese Bäume ihre Schatten warfen; wer kann hier umherblicken, ohne zu seufzen, wenn er sich neben den wohlerhaltenen Mauern dieses Palais an die Ruinen erinnert, in welchen seit einem halben Jahrhundert so viel glänzendes Glück dahinschwand? Alles hat sich verändert, nur diese Bäume sind seitdem gewachsen – als ob die Natur mit jedem neuen Frühling ihr Siegesbanner flattern ließe und die Menschen ermahnte, daß sie unter so vielen Täuschungen sich nur auf sie verlassen können, daß nur sie immer und Jedermann Schatten gibt.
Eine halbe Stunde ging ich hier umher, als plötzlich Armand vor mir stand. Entzückt schloß ich ihn in meine Arme. – In solchen Augenblicken gibt es nichts Unangenehmeres, als die Menge; sie schreitet gleichgiltig vorüber und das Herz fühlt sich in ihrer Gegenwart doch befangen. – Wir gingen aus dem Garten nach den Champs-Elysées, schweigend, wie wir es stets nach großer Freude gewohnt waren; Menschen sind wie das Echo, ohnehin um so schweigsamer, je näher sie einander stehen. Armand war traurig; als er mich erblickte, flog ein Freudenstrahl über sein Gesicht, jedoch nur, damit sein Schmerz nach kurzer Freude um so lebhafter hervortrete. »Was macht Dich traurig, mein Freund?« fragte ich ihn endlich; »ich finde Dich niedergeschlagener, als bei unserer Trennung.«
Er drückte mir die Hand. »Als wir von einander schieden,« sprach er seufzend, »war ich noch glücklich. Damals hoffte ich, jetzt sehe ich klar. Ich hoffte eine Welt, in welcher ich keines andern Adelsbriefes bedarf, als desjenigen, welchen Gott mir in die Seele geschrieben, eine Welt, in welcher ich, der Bettler, edel fühlen, in der ich mich aufopfern kann, und kein spöttisches Lächeln mich empfängt, wenn ich vor meine Nation hintrete und begeistert spreche: Ich werde für dich leben, mein Vaterland! Ich hoffte für die Menschen eine Welt voll Tugend und freudiger Zufriedenheit – für mich eine Welt voll Thaten und Ruhm; – die Alten bekränzten das Opferthier, bevor es hingeschlachtet wurde, und warum hätte ich keinen Kranz erwarten sollen, da ich mich zu opfern bereit war? Und ich sah dieses große Schauspielhaus, in welchem das Trauerspiel nach einer prächtigen Scene fortgespielt wird, – in welchem die neuen Schauspieler nicht mehr fühlen, als die früheren, und in ihrem Bestreben nach Applaus und Lohn ihre Kunst, die Täuschung, mit ihren alten Vortheilen forttreiben – wo ein Theil der Zuschauer gähnt, ein anderer unempfindlich ist oder sich in den Logen mit andern Dingen unterhält, und die Wenigen, die das Stück verstehen, weinen. Ich habe Paris gesehen, den Ort, der in seinem Glanz so strahlend erschien, als ob er von einer eigenen Sonne beleuchtet würde, der aber, als ich in seine Nähe kam, als Sumpf vor mir stand. Ich habe die Menschen gesehen, diese bedrängte Menge, in der Niemand stehen kann, ohne seinen Nächsten zu drücken. Ich hoffte eine glorreiche Zukunft und sah die Vergangenheit, die nicht vergehen will, dieses hundertjährige Schandmal, welches die Geschichte uns aufgedrückt hat und welches Millionen Thränen und das Blut so vieler Nationen uns nicht abwischen können; ich träumte als Ebenbild Gottes und erwachte als Proletarier.«
Armand's Worte machten auf mich einen tiefen Eindruck. Ich liebte ihn, und in seinem Gesichte war ein bitterer Schmerz ausgeprägt, den ich nicht durch Trost zu lindern hoffen konnte, denn er war bereits zum Haß gediehen. »Freund,« sprach ich endlich, »wie anders hoffte ich Dich zu sehen. Als Du mir vor den Mauern Avignons zum letzten Male die Hand drücktest und ich Deine Hoffnungen vernahm, hielt ich Dich für glücklich. Wie wenn ein Schiff mit ausgespannten Segeln den Hafen verläßt, um eine weite Fahrt anzutreten, und Derjenige, dessen Freund sich darauf entfernt, sein Herz sich beengen fühlt, indem er den letzten Gruß vernimmt und sich dennoch freut, daß den geliebten Reisenden ein günstiger Wind begleitet: so schaute ich Dir nach, als Du Dich von mir entferntest, und jetzt sehe ich Dich wieder, gebrochen und hoffnungslos! Seitdem sind erst einige Monate vergangen und schon bist Du ohne Hoffnung! O glaube nicht, daß darum Alles verloren sei. – Es mag wohl peinlich sein, sich in den Menschen getäuscht zu haben und nach jahrelanger Hoffnung endlich darauf zu resigniren, was man als nothwendig betrachtet und darum für sicher gehalten hat; aber auch die Wunde verharscht endlich und läßt nur eine jener Narben zurück, welche Jedermann der zur Menschenkenntniß gelangt ist, an seinem Herzen trägt; nur wenn wir uns in unseren Lieben getäuscht haben, können wir uns mit Recht beklagen; nur sie treffen uns stets mit vergifteten Pfeilen, und davor hat doch der Himmel Dein Herz bewahrt.«
»Und weißt Du, was es heißt, eine Idee verloren zu haben?« sprach Armand traurig; »einen Gedanken, in dessen Strahlen das Herz groß geworden, der unserem Dasein Licht gegeben, der unser Leben erfüllt hat, und der, nachdem wir um seine Verwirklichung gekämpft, nachdem wir ihn schon nahe geglaubt, plötzlich verschwindet, wie eine Wolke über dem Meere, die der Schiffer für ein Ufer gehalten hat, während er an den aus ihr hervorschießenden Blitzen merkt, daß ihre finstere Masse sich nur zu seinem Verderben am Horizont gesammelt hat! O, Du weißt dies nicht, Du bist ein Graf, Du bist reich! Was ist Dir eine Idee? Wem das Leben so viel gegeben, der bedarf keiner Träume, und wenn er ihrer auch bedarf, so kann er auf weichen Kissen des Glückes von seinen Freuden träumen, er kann unter Vergnügungen vergessen was Andere leiden; oder er kann, mit seinem Geschick zufrieden, die Schmerzen als nothwendig erachten, die nicht ihn quälen. Doch ich bin ein Sohn des Volkes, ich besitze nichts; ich bin keiner jener Glücklichen, die egoistisch sein können, weil ihr Geschick von dem des übrigen Volkes verschieden ist. Ich bin ein Blatt vom großen Baume des Menschengeschlechtes, ein Tropfen des unendlichen Meeres, ein Staubkorn in der großen Wüste, und wenn ich den Baum gestürzt, die Wogen geglättet, die Staubwolke zur Erde gesunken sehe, soll ich da nicht klagen?«
»Und wärest Du wirklich unglücklich genug, zu glauben, daß Dein Glück von der Verwirklichung gewisser politischer Träume abhänge? Freund! gib Deine Träumereien auf; wenn sie auch in Erfüllung gingen, so würden sie ihre Schönheit verlieren; anstatt des reizenden Ganzen, das Du in Deiner Phantasie gesehen, wird die Wirklichkeit Dir nur elende Details bieten, die im schönsten Zeitalter, wie auch in der schönsten Gegend stets gefunden werden; und dann wird Dich das eine peinliche Gefühl erfüllen, wie sehr wir auf dieser Erde auch dann getäuscht sein können, wenn unsere Hoffnungen in Erfüllung gehen. Knüpfe Dein junges Dasein nicht an das Geschick der Menschheit, das, so wie es bisher traurig gewesen, auch wenigstens in unserem Zeitalter traurig bleiben wird. Mache es wie ich, wähle Dir ein Wesen aus und umfasse es mit Deiner ganzen Liebe, umspinne es mit Deinen Hoffnungen, erwähle es als Deinen Leitstern auf der schwierigen Reise, betrachte es als die Welt, in welcher Du leben mußt, und Du wirst glücklich sein, wie ich. So lange Du nicht die Liebe kennst, so lange Dein Herz nicht von einem Bilde dermaßen erfüllt ist, daß darin kein anderes mehr Platz findet, so lange nicht ein liebes Angesicht Dich die ganze Welt, ein Lächeln Deine Schmerzen und eine Thräne Dich vergessen macht, daß Du ein anderes Glück finden könntest, so lange verfluche nicht Dein Menschendasein, denn Du weißt nicht, wie viel Glück Du darin finden kannst.«
»Du bist zufrieden,« sprach Armand bitter, »Du thust wohl daran; was kümmerst Du Dich mitten in Deinen Glücksschlössern, wenn rings um dieselben sich die Wüste ausdehnt; was geht Dich der Sturm an, der draußen wüthet und tausend Fahrzeuge zertrümmert, so lange Dein Schiff im Hafen von sanften Wellen geschaukelt wird? Du bist glücklich und kannst lieben. Aber weißt Du denn, was die Liebe uns ist, denen das Glück stiefmütterlich zugemessen ist? – Kannst Du die Schmerzen ermessen, die Du fühlst, wenn Du nach langem Kampfe ermüdet, mit niedergeschlagenen Hoffnungen und blutendem Herzen einem Wesen begegnest, von dem Du Dich verstanden fühlst; wenn Du durch sie getröstet und glücklich bist, weil Du siehst, daß Du noch beglücken kannst; wenn Du einen Augenblick an ihrem Herzen ausruhend, wieder von Freuden zu träumen beginnst, wie der Kranke, nachdem er einige Minuten geschlummert hat, und wenn Dir plötzlich die Noth entgegentritt und Dir in's Ohr schreit: Wovon werdet Ihr leben? Du hoffst vielleicht noch; seit: dem Du liebst, fühlst Du neue Kraft in Dir; und steht es doch geschrieben: Der Herr nährt die Vögel des Waldes und kleidet die Lilien des Feldes, warum solltest Du verzweifeln? Aber wenn Du endlich die Stadt durchwandert und Abends nichts nach Hause gebracht hast; wenn Du von Haus zu Haus um Arbeit gebettelt hast und Niemand Deine Arbeit annimmt; wenn Du bereit wärest, aus Deinem Herzblut Geld zu schlagen; wenn Du ein Jahr aus Deinem Leben für ein Stück Brot hingeben möchtest, und Du nichts besitzest, was Du Deiner Geliebten geben könntest, was thust Du dann? Sie beklagt sich nicht, sie macht Dir keine Vorwürfe; aber betrachte ihre blassen Wangen, sieh' den Ausdruck des Schmerzes auf ihren angebeteten Zügen und verfluche Dein Leben nicht! Hadere nicht wider Dein Schicksal, wenn – nachdem sie Dir endlich ein Kind zur Welt gebracht und der Säugling Dir seine Händchen entgegenstreckt und Dein Herz vor Freude pocht – es Dir plötzlich einfällt, daß Du nichts besitzest, um das Kind zu erhalten! – Dem Besitzlosen bringt die Liebe nur Pein; wie jenem Reisenden, der in der Wüste verirrt, sich vor Durst kaum aufrecht erhalten konnte und plötzlich anstatt einer Wasserquelle einen Sack voll Goldstücke fand, so ergeht es dem Armen, der Liebe findet; diese ist in jeder andern Lage der größte Schatz der Welt, aber dem Wanderer in der Wüste ist sie nur eine schwere Last mehr, ein bitterer Hohn seines Geschickes, das ihm Schätze gab, während es sein Verderben beschloß. Es geht ihm im Gefühle seines Glückes, wie dem Blinden, welchem der Arzt soeben den Staar gestochen; schmerzhaft empfindet er einen Augenblick den Glanz, jedoch nur, um wieder zu erblinden; der Strahl, der für die Sehenden heiteres Licht über die Gegend ergießt, war für ihn ein Blitz, der seine letzten Hoffnungen niederschmetterte. Auch an die Freude muß das Herz sich gewöhnen, und wer kein Glück kennt, dem verleihe der Himmel keine Seligkeit, dem gebe er keine Liebe, sein Herz erträgt sie nicht. O, Ihr Reichen! denn glücklich mag ich Euch nicht nennen, weil Euer Geschick Euch anstatt Dessen, was Euch beglücken würde, nur Das gegeben, um was Andere Euch beneiden – Ihr ahnt nicht, wie viel man auf dieser Welt leiden kann. Wenn Ihr, Euch auf Eure bequemen Divans hinstreckend, den Arbeiter beneidet, der ermüdet unter einem Baume schläft, von keinen unruhigen Träumen gestört, als ob Gott ihn zum Trost täglich an seinen Tod gemahnte, wenn Ihr bei Euren Gastmahlen nach Appetit seufzt, nach Freude mitten unter Euren festlichen Belustigungen, und Ihr, Euer Marmorhallen überdrüssig, von einem Strohdach, der Schmeicheleien satt, von einem Herzen träumt, das für Euch schlüge: so ahnt Ihr nicht, welche Qual man auch in den beschränktesten Lebenskreisen fühlen kann. Um wie viel peinlicher ist das Schicksal Desjenigen, der seine Wünsche nicht, wie Ihr, auf dieser Erde unerreichbar, sondern von Tausenden genossen und verachtet sieht, während ihm nur das Verlangen und die Gewißheit beschieden wurde, daß er seine Wünsche nicht erreichen wird. – Und wie erst, wenn seine Seele vom großen Fluch des Ehrgeizes ergriffen wurde, wenn er unter diesen Triumphbogen, wo so viele Proletariernamen stehen, in dieser Stadt, wo jeder Pflasterstein das Denkmal einer glorreichen That, nicht einsehen könnte und wollte, daß das Volk, welches gesiegt hat, gleich dem siegreichen Gladiator wieder in sein Gefängniß gesperrt wird – daß auf dem Triumphbogen kein Platz für neue Namen ist, und unser Zeitalter, welches dem größten Jahrhundert folgte, nur gekommen ist, um von den großen Denkmälern die Schrift wegzuwischen, nicht, um neue darauf zu schreiben. Wenn der Arme dies Alles nicht einsehen wollte, wenn er handeln wollte, wie seine Ahnen gehandelt haben, wenn er für seine Nation leben möchte wie sie, und auf dieser Erde, wo er nicht glücklich sein kann, wenigstens ein großes Grab hinterlassen möchte, und er endlich einsehen muß, daß er, der um Einlaß bettelnd an den Thoren der Welt steht, für dieselbe nichts thun kann, daß es sein Schicksal ist, auf der Erde zu kriechen und getreten zu werden, und wenn er sich endlich als Schlingpflanze an einem stärkeren Stamm hinaufwinden kann, zwischen den Zweigen desselben trotz seiner eigenen Bedeutung unerkannt zu verschwinden; er die Erde mit seinem Blut netzen möchte, nur um eine Spur zu hinterlassen, und er sieht, daß er sich vergebens bemüht hat, weil das Menschengeschlecht nicht gern neue Namen lernt, und nur Den, der auf einer höheren Stufe der Gesellschaft steht, mit Beifall überhäuft, während es die tausend Aufstrebenden nicht beachtet; wenn er einsieht, daß es zum Ruhme nothwendig ist, in einem guten, goldbordirten Kleide für's Vaterland zu sterben, wenn man nicht in Lumpen begraben sein will! – wenn es ihm von allen Seiten entgegenschallt: Wehe Dir, Armer, dieser Erde, die Dir kein Brot gegeben, wird Dir auch keinen Ruhm geben: hat dann der Unglückliche noch Hoffnung auf der Welt?«
Ich war zu glücklich, um den Ehrgeiz zu begreifen; ich liebte nur Wenige und verlangte nichts als Gegenliebe: wie die Rose, die, wenn sie ihre Blüthen entfaltet, in ihrer niedrigen Stellung mehr vor einer kalten Berührung als vor den Blitzen des Himmels zurückbebt, so ließen die großen Bewegungen der Welt auch mich gleichgiltig, und obwohl ich Diejenigen bewunderte, die ihr Glück dem Wohl ihrer Nation aufopferten, und obschon ich in meiner Kindheit zuweilen auch von den Gracchen geträumt hatte, wog mir jetzt, nachdem ich Julien kennen gelernt, die Glorie der ganzen Welt nicht einen Blick meiner Geliebten auf. Und ich kann es nicht aussprechen, wie schmerzhaft Armand's Worte auf mich wirkten, durch welche ich zuerst sein ganzes Unglück erkannte; denn ich sah, wie viel Selbstsucht in seiner Begeisterung war, und ich wußte wohl, daß, während Derjenige, der nur in Ideen lebt, niemals ganz unglücklich sein kann, weil er noch über das Grab hinaus Hoffnungen hat, der Selbstsüchtige immer und ganz unglücklich wird, sobald er seine persönlichen Hoffnungen schwinden sieht. »Armer Freund,« sprach ich endlich, »wie bedauere ich Dich.«
»O bedauere mich,« sprach Armand aufgeregt; »wie verschieden auch die Existenzen sind, die das Geschick einem jeden Wesen beschieden hat, so ist doch jede zu ertragen; der Maulwurf in dem Grabe, das er sich selbst gegraben, und der Adler in seiner hehren Einsamkeit, sie können beide in gleichem Maße glücklich sein; jener hat das Tageslicht nie gesehen, dieser sehnt sich nicht nach Ruhe; verflucht ist nur Derjenige, dem sein Geschick Wünsche in die Seele gelegt und die Macht versagt hat, sie zu erreichen – das ist mein Schicksal. Beklage mich, aber tröste mich nicht; es gibt Schmerzen, die man durch Trost nicht mildern kann, und ich trage einen solchen Schmerz in mir.«
Ich fühlte die Wahrheit seiner Worte und belästigte ihn nicht mit Trost. Lange gingen wir schweigend neben einander, endlich fingen wir wieder an zu sprechen, er von seinen traurigen Erfahrungen, die er in Paris gemacht, ich von meiner Liebe, und so kamen wir wieder in den Garten der Tuilerien zurück.
Es mag ungefähr zwei Uhr gewesen sein und die ganze elegante Welt von Paris ging in bunter Menge in den langen Alleen spazieren; einige Mal gingen wir auf und ab, plötzlich standen Julie und Frau von Valmont vor mir. Armand wollte sich losmachen, aber wir waren so nahe und ich stellte ihn so rasch der Marquise vor, daß er sich nicht mehr entfernen konnte und gezwungen war, mit den Damen und mir spazieren zu gehen. Als wir uns trennten, lud die Marquise uns Beide auf den Abend ein, und Armand war, wie es schien, heiterer. – Die Marquise war schön, und es gibt nichts Tröstenderes als weibliche Freundlichkeit, welche, so lange wir sie für echt halten, dem Herzen, und sobald wir sie als Coquetterie erkannt, der Eitelkeit schmeichelt und in jedem jungen Herzen Hoffnungen erweckt. Als wir nach Hause kamen, wurde Armand zwar wieder traurig, ja er sagte sogar, er werde nicht zu der Marquise gehen, von welcher ihn Armuth und Ungewohntheit fern halten; doch nachdem ich ihn gebeten und ihn darauf aufmerksam gemacht, daß er gerade in diesem Salon mit den Hauptleitern der Bewegung bekannt werden und zu seinem Ziel gelangen könne, entschloß er sich, und nicht ohne Hoffnungen. – O arme Menschen, die Ihr, während das Herz Euch vor Angst pocht, nicht aufhört zu hoffen; wie dem Wanderer, dessen nächtlichen Weg ein Irrlicht erhellt, wie dem Dürstenden, dessen brennende Lippen ein paar Regentropfen kühlen, so werden Euch Eure Hoffnungen gegeben; der Wanderer möchte ausrasten, der Dürstende möchte sich den Dolch in's Herz stoßen, wie Ihr unter Eueren Schmerzen, aber Ihr müßt Euere Qualen bis zu Ende tragen. Arme Menschen, die Ihr im Labyrinth des Lebens Euerem Ende unter grünenden Zweigen entgegengeht, – die Ihr, in Euerem Herzen bereits die schwere Wunde tragend, wie der vom Pfeil getroffene Vogel, noch rings um Euch blühende Auen seht und nicht ahnt, daß unter ihren Blüthen Euch der Tod erwartet. Wozu so viele Täuschungen, wozu so schöne Träume vor so schrecklichem Erwachen? Wozu dieses erstarrte Herz, das im Bewußtsein, wie schnell es seinen ganzen Besitz verlieren könne, noch weiter hofft? Dem Dulder auf der Folterbank reicht sein Henker einen lindernden Trank, damit er nicht seine Empfindlichkeit verliere, dem Menschen gibt das Schicksal Hoffnungen, damit er dulden lerne. Auf dieser Welt, deren Wirklichkeit Pein ist, müssen wenigstens die Träume schön sein, – wer möchte sonst leben wollen!
Der Salon der Marquise von Valmont war einer derjenigen, wo die beiden großen Pariser Gesellschaften einander begegnen. Durch Geburt mit den vornehmsten Personen des Faubourg verwandt, und durch ihren Mann, der wie Viele seinen Titel in der großen Revolution erhalten, in die Gesellschaft des neuen Adels gezogen – stand sie zwischen den beiden Classen, wie ein Grenzpunkt, wo sie zuweilen einander berühren, nur um sich mit um so größerem Haß wieder abzustoßen. Wer niemals in der großen Welt gelebt und an den sogenannten Vergnügungen dieser Gesellschaft nie theilgenommen hat, und in einen Salon tretend, die strahlenden Kerzen sieht, und darunter die lächelnden Damen und die mit wichtigen Gesichtern plaudernden Männer, und die freundliche Hausfrau neben ihrem dampfenden Theekessel: der ahnt nicht, wie viel Haß, wie viel Neid und oft wie viel Schmerzen sich unter dieser heiteren Oberfläche verbergen. Im Salon, wie in der Welt, ist das erste Gefühl, mit welchem wir auftreten, ein freudiges, und oft dauert es lange, bis die reizende Täuschung verschwindet und man einsieht, daß auch diese Gesellschaft, wie jede andere, aus Egoisten besteht, welche Eitelkeit oder Nothwendigkeit zusammenhält, jedoch ohne sie wahrhaft mit einander zu verbinden – bis man einsieht, daß alle diese Wesen, die einander so nahe stehen, den Gestirnen des Himmels gleichen, die scheinbar neben einander glänzen, jedoch Millionen Meilen von einander entfernt sind – bis der Eingetretene endlich einsieht, daß die ganze Gesellschaft, die sich ihm so freundschaftlich anschmiegt, im Unglück sich gegen ihn wenden wird, gleich dem Meere, welches das Schiff erst mit seinen Wellen wiegte, und sobald es auf eine Sandbank gerathen, mit denselben Wellen zerstört. Ich war jung und zum ersten Male in Paris, und wer besitzt nicht so viel Eitelkeit, sich wohl zu fühlen in einer Gesellschaft, in der er gut aufgenommen wird? Es gibt keinen sichereren Weg zum Optimismus, als wenn man sich geehrt sieht; Jedermann hält die Welt für um so vollkommener, für je vollkommener er durch sie gehalten wird.
Ich sprach eben mit der Marquise, als die Thür sich öffnete und ein Mann eintrat, bei dessen Anblick alle meine gute Laune verschwand. Es schien mir, als sei es derselbe, den ich in der Kirche zu Avignon und einige Tage zuvor mit Julien Arm in Arm gesehen. Ich fragte so gleichgiltig als möglich, wer es sei, fühlte aber, daß meine Stimme zittere.
»Und Sie kennen ihn noch nicht,« sprach sie lächelnd, »Herrn Dufey, den Helden des Tages, der in den Julitagen das Kreuz der Ehrenlegion errungen, Bücher geschrieben hat und Gott weiß, was für Eigenschaften noch besitzt? So ist der Ruhm!« fuhr sie mit scherzhaftem Pathos fort; »wir Pariser proclamiren Jemanden als Engel oder Teufel, und die gute Provinz kennt nicht einmal seinen Namen.«
»Ich gestehe,« sprach ich, durch das Lob verdrießlich gemacht, »ich kenne seinen Ruhm nicht, und sehe auch jetzt den Grund desselben nicht ein, wenn er nicht mehr gethan, als Sie sagen.«
»Sehen Sie,« antwortete die Marquise gut gelaunt, »wir Pariser führen ein besonderes Leben. Unsere Gesellschaft gleicht dem Bienenkorb; wir leben von den Blüthen der Welt, aber unsere Wohnstätte ist ein abgesondertes Ganzes mitten auf Erden – was außerhalb derselben geschieht, interessirt uns in unserem abgeschlossenen Kreise nur oberflächlich; wer im Ganzen groß ist, für den ist in unseren Salons kein Raum; wir haben eine besondere Königin, und Dufey wird von uns eben so angebetet. Die Welt kennt in ihm nur den Maître des requêtes, und höchstens Den, der durch seinen Vater in der politischen Welt noch weitere Carrière machen kann; bei uns ist sein Glück fertig, und es wird wenige Männer in diesem Salon geben, die ihn nicht um sein Geschick beneiden, und wenige Damen, die sich durch seine Huldigungen nicht geschmeichelt fühlen. – Doch ich will ihm Ihren Freund vorstellen! Es gibt in Paris keine nützlichere Bekanntschaft, als die seinige, und ich stehe Ihnen gut dafür, daß für das Vorwärtskommen Ihres Freundes Niemand besser sorgen wird, als Dufey.«
Sobald ich von der Marquise allein gelassen war, wandte ich alle meine Aufmerksamkeit Dufey zu. Er war schön, schön im Sinne unseres Jahrhunderts, das wie jedes sich sein besonderes Ideal gebildet hat. Die griechische heitere Regelmäßigkeit, der feste Wille und die Kraft des Römers passen zu diesem Jahrhundert nicht mehr. Unser Zeitalter sucht auf den Gesichtern das Gepräge der Leidenschaft – Schönheit, jedoch zerstört durch Kummer – Kraft, jedoch gebrochen durch die schweren Schläge des Schicksals – Ruhe, doch die der Nacht, voll Finsterniß, kurz, weil für jedes Zeitalter nur Das schön ist, was dessen Gedanken ausdrückt – den Schmerz. Ein Gesicht, welches etwas Anderes anzeigt, kann dem Jahrhundert nicht gefallen, das nur den Schmerz versteht. Wer Dufey erblickte, fühlte sich unwillkürlich zu ihm hingezogen, und obschon Eifersucht und glühender Haß mein Herz erfüllten, so konnte ich doch auf diesen Jüngling nicht sehen, ohne mir einzugestehen, daß er mir überlegen sei. Es gibt Gesichter, auf welchen das Leben seine Geschichte in verständlichen Zügen aufgezeichnet hat. Ein solches Gesicht war das seinige; wer die ernste Ruhe desselben sah und dazwischen hie und da das kalte Lächeln, das wie die kleine Welle auf dem Meer als Bruchstück eines großen Sturmes um seine Lippen spielte, dessen Herz fühlte sich im Innersten zu ihm hingezogen. Lange behielt ich seine Bewegungen im Auge; doch bei all' meiner Aufmerksamkeit konnte ich aus nichts sein Verhältniß zu Julien wahrnehmen, und wenn ich zuweilen auf meine Julie schaute und sie zwei Schritte von Dufey so lächeln sah, wenn ich mit ihr sprach und sie ihren Geist sprühen ließ: so konnte ich nicht glauben, jenen Mann und jene Dame zu sehen, die ich in der Kirche zu Avignon und in einer verlassenen Gasse Arm in Arm gesehen. Ein junger Mann von zweiundzwanzig Jahren kann das weibliche Herz noch nicht ausstudirt haben, und trotz des bekannten Pessimismus der Jugend gibt es doch Niemanden, der die zahllosen Finten der Comödie des Lebens schon gekannt hätte, ehe er selbst auf der Bühne war und mitspielte.
Juliens Vater sprach in einer Ecke des Saales verdrießlich mit einigen alten Herren, und wer seine erzwungene Haltung sah und den verächtlichen, zuweilen bedauernden Blick, mit welchem er den einzelnen Eintretenden folgte, der konnte den Grandseigneur erkennen, der sich außerhalb seines Elementes fühlte. Es gibt in Frankreich Leute, denen keine größere Beleidigung zukommen kann, als wenn sie in einem Salon mit anderen Leuten zusammentreffen, und wie auf Gottes großer Welt unter der strahlenden Sonne, auch beim Kerzenschein Wesen neben sich sehen, die sie als Ihresgleichen nicht anerkennen wollen und für ihnen untergeordnet nicht halten dürfen. Je freier unsere politischen Institutionen sind, je mehr unsere Gesetze von der Gleichheit fabeln, um so weiter ist die Kluft, um so isolirter vom Volk steht jene Gesellschaft, welche es ein halbes Jahrhundert als seinen Feind bezeichnet hat. Generationen haben gegen sie gekämpft und gesiegt, die Welt hat sich verändert, und die französische Aristokratie, die keinen Widerstand leistete, die verarmte, auf's Blutgerüst geschleppt wurde, im Exil geboren wurde – besteht noch. Eine wunderbare Erscheinung, wenn wir nicht wüßten, daß in der Geschichte der Menschheit Vieles, was die Zeit zum Tode verurtheilt hat, durch den Haß aufrecht erhalten wurde, und daß, was der Stolz des Volkes niederschlug, durch die Eitelkeit Einzelner wieder aufgerichtet wird.
Der Alte erwiderte Dufey's Gruß mit auffallender Kälte und entfernte sich bald darauf mit seiner Tochter, die mir in der Eile noch zuflüsterte, ich möge ihnen nachkommen.
Eine halbe Stunde später waren wir in Juliens Salon; der Alte ging eine Weile verdrießlich auf und ab. »Haben Sie je eine solche Gesellschaft gesehen?« sprach er, sich endlich in einen Fauteuil werfend; »Alles, was Paris an geadeltem Pöbel besitzt, war beisammen; wenn die Hausfrau nicht zu meiner Familie gehörte, so könnten wir weidlich darüber lachen, aber so – Julie, Du gehst nicht mehr zur Valmont, verstehst Du? Blut ist Blut, und Du kannst sie bei Dir empfangen – obwohl man auch darüber zu reden haben wird – aber zu ihr wirst Du nicht gehen.«
»Wie mein Vater befiehlt,« sprach Julie sanft, »aber –«
»Aber, aber,« unterbrach sie der Alte heftig, »sprich nur kühn aus, was Du zu sagen hast; der Cousin wird ohnedies früher oder später Deine Gesinnung erfahren, die mehr zur Revolution, als zu Deinem Namen paßt.«
»Ich meine nur,« sprach Julie, die Augen niederschlagend, »die Welt werde noch mehr über uns reden, wenn wir nicht zur Cousine gehen.«
»Die Welt!« sprach der Vater mit bitterem Lachen, »und welche Welt? Vielleicht einige hungrige Journalisten oder geizige Banquiers? Wenn dies Deine Welt ist, so strebe nach ihrem Ruhm, nimm einen reichen Judenjungen zum Mann, oder einen jener neugebackenen Marquis, die Du für Comödianten, welche eine edle Rolle geben, halten würdest, wenn Du nicht in jeder ihrer Bewegungen den Bauer wahrnähmest; mich kümmert's nicht. Meine Welt besteht nur aus dem Kreise von Meinesgleichen, und diese sind meiner Meinung.«
»Wie mein Vater denkt,« sprach Julie sanft; »Sie wissen, daß ich in solchen Dingen keinen Willen habe.«
»Schande genug, daß Du ihn nicht hast,« fiel der Alte mit Zorn ein, »daß Du, die Du aus dem reinsten Blut dieses Landes entsprangst, wenn von der Ehre Deiner Familie die Rede ist, nichts wissen willst; Du wirst es aber vielleicht noch bereuen und Dich von einer Gesellschaft lossagen, die mit jeder Annäherung uns beschmutzt.«
»Beschmutzt!« sprach Julie aufgeregt und Röthe überflog ihr Angesicht; »das verdient meine Freundin nicht,« fuhr sie ruhiger fort, »durch die Valmont ist kein Fleck auf unseren Namen gekommen.«
»Das glaubst Du,« sprach der Alte bitter, »und weißt Du nicht, daß Valmont, der edle, der hochgeborne Marquis Valmont, ein Krämer war, oder ein Bedienter oder der Himmel weiß was für eine Art von Pöbel, und daß Du oder Deine Kinder, daß Ihr die Kinder dieses Krämers Euere Verwandten nennen werdet, daß Du sie in Deinem Hause sehen wirst, daß sie auf Eure Hochzeiten werden geladen werden, daß sie, wenn ich sterbe, stolz drei Monate länger Trauer um mich tragen werden, blos damit die Stadt erfahre, ich sei ihr Verwandter; und weißt Du, daß der Name, welchen Du trägst und der durch die Valmont mit dem Pöbel verwandt wurde, einst rein war – daß das Blut, welches in deinen Adern kreist, zwar auf dem Blutgerüst, aber bisher nie in den Adern gemeiner Leute geflossen ist! Und Du wagst es, zu behaupten, daß durch die Valmont kein Schimpf über uns gekommen sei? – Wahrhaftig, ich bedauere Dich.«
»Valmont war ein rechtschaffener Mann!« sprach Julie sichtlich erregt, »und – –«
»Valmont war ein rechtschaffener Mann!« unterbrach sie spottend der Alte. »Schade, daß Niemand Dich hört, der Bürgerkönig würde Dich für diese edlen Gesinnungen gewiß belohnen, und wer weiß, ob er Dir nicht auch einen Kramladen schenken würde, wo Du mit dem Julikreuz geschmückt, Deine Waaren verkaufen könntest – wie er schon Zwei belohnt hat, welche durch ein wenig Branntwein und fünf Francs in diesen glorreichen Tagen zu Helden wurden. Aber wenn Valmont ein rechtschaffener Mann war, so vergiß nicht, daß Deine Verwandtschaft mit ihm Dir die Verwandtschaft noch mehrerer rechtschaffener Personen eingetragen hat, daß Du nun gewiß Verwandte hast die Dir das Haar kräuseln, Kleider nähen, oder wenn Du irgendwo hinfährst, Dich als Omnibuskutscher protegiren können; und freue Dich, wenn Du kannst, besuche diese ehrlichen Leute, gehe mit ihnen spazieren, nenne sie Cousin – sind es doch auch rechtschaffene Leute und haben sich vielleicht eben so viele Verdienste erworben, wie Valmont selbst, nur daß sie ehrenwerther sind, weil sie nicht belohnt wurden. Nicht wahr, schon der Gedanke macht Dich erröthen, und wenn ich der Valmont meinen Rath ertheile, so fühlt sie sich verletzt, und warum? – Leben wir denn nicht im Jahrhundert der Freiheit, ist nicht die Gleichheit der Menschen proclamirt, der Adel nicht als eine Thorheit erklärt, die zu dem Zeitalter nicht mehr paßt? Oder geht die Logik nur so weit, als es das Interesse gewisser Herren erfordert, und halten sich Diejenigen, welche Niemanden über sich dulden wollen, für berechtigt, Alles, was unter ihnen steht, Pöbel zu nennen, als ob zwischen dem Erhabensten und Niedrigsten ihre winzige Person eine genügende Entfernung bildete? Lächerlich! Was dieses Land Erhabenes besaß, wurde niedergetreten; die Tempel des Herrn wurden durch Blut entweiht, der Thron ward zum Blutgerüst, die Abkömmlinge der Helden wurden durch Henkershand hingerichtet, und weshalb? Damit ein paar Banquiers in den Adelstand erhoben und an der Stelle des makellosen Banners aus den Fetzen der Legitimität, aus den Blutflecken des Terrorismus und aus dem Blau Euerer geträumten Himmel eine Tricolore zusammengeflickt werde; und ich soll sie nicht verachten, soll nicht stolz auf meine Ahnen blicken, welche das Volk vielleicht unterdrückt, aber niemals betrogen haben, die vielleicht für schlechte Principien kämpften, aber niemals aus Eigennutz schöne Principien heuchelten; die mit Verachtung auf ihre Unterthanen blickten, aber mit Verehrung auf ihren König; die nur in den finsteren Jahrhunderten dieses Landes strahlten, aber ihren Glanz niemals erborgten, wie die Sterne dieser Zeit, die aufgingen, sobald ihre Sonne, das Volk, untertauchte, und gern vergessen möchten, daß sie nur diesem ihr Licht zu verdanken haben! Zeige mir einen Ort in Frankreich, wo der Traum der Gleichheit zur Wirklichkeit geworden – zeige mir einen Reichen, der nicht stolz auf den Armen niederblickt und der mit seinem Nächsten Arm in Arm durch die Gassen gehen möchte, wenn dessen Rock zerfetzt ist; zeige mir nur an einem einzigen Ort die Praxis Deiner erhabenen Theorie, und das Zeitalter bewundernd, werde ich vielleicht auf meine Titel resigniren. So lange aber diese Leute auf ihr Geld pochen, wird mir es die Welt verzeihen, wenn ich mich meines Adels erinnere, wenn ich mich für höher halte, als Diejenigen, die von niederer Geburt sind und dem Gleichheitsprincip selbst widersprechen – und wenn ich nicht in Gesellschaften gehe, wo der Enkel meines Kammerdieners die Hauptrolle spielt.«
»Der Enkel Ihres Kammerdieners? fragte ich erstaunt.
»Der Enkel des Kammerdieners meines Vaters,« antwortete der Alte trocken; »vielleicht haben Sie einen hochgewachsenen jungen Mann mit schwarzem Bart und Haupthaar bemerkt; die Weiber halten ihn für einen Adonis, die Männer für ein Genie, denn sein Gesicht ist von ausschweifendem Leben bleich, und bevor die Julitage die Adelstitel verschwinden machten, rief der die Thür öffnende Kammerdiener ein lautes: »»Graf Dufey!«« wenn dieser eintrat. Dieser Graf ist der Enkel meines Kammerdieners.«
»Und wie ist das gekommen?« fragte ich weiter mit immer steigendem Interesse.
»Wie Alles in Frankreich, durch die Revolution!« sprach der Alte verdrießlich. »Wer in diesem Lande in der halbhundertjährigen Geschichte der Nation und Einzelner Wahrscheinlichkeit sucht, der wird die Wirklichkeit für Lüge halten. Wenn die Natur im Innersten erschüttert wird, wenn Berge einstürzen und an deren Stelle neue entstehen, was Wunder, wenn ein in der Tiefe gelegenes Felsstück zum Gipfel erhoben wird, und ein vom Sturm fortgerissenes Samenkorn, das im Thale gereift ist, auf dem Gipfel Wurzel schlägt; so geschah es mit Vielen in Frankreich. Als die Revolution ausbrach, war Dufey's Großvater in unserem Hause Kammerdiener, doch wegen seiner revolutionären Gesinnungen wurde er gleich nach der Erstürmung der Bastille verabschiedet. – Zur Zeit des Terrorismus wurde mein Vater und ich proscribirt, und nachdem wir uns eine Zeit lang unter hundert Gefahren verborgen gehalten, hatten wir kaum mehr eine Hoffnung zu entkommen, als eines Tages Duffey, der sich unterdeß mit den Blutmenschen befreundet hatte, zu uns kam und uns zur Flucht Pässe und jede nöthige Hilfe versprach. Mein Vater nahm, da wir keine andere Hoffnung hatten und unsere Wohnung ihm ohnedies bekannt war, seinen Antrag, wenn auch mit Mißtrauen, an, und übergab, theils um von einem solchen Menschen keinen unentgeltlichen Dienst anzunehmen, theils weil wir unser Geld nicht mit uns nehmen konnten, ohne uns verdächtig zu machen, Dufey hunderttausend Francs mit der Bedingung, daß er dieses Geld, wenn wir einst zurückkehren, uns wieder einhändige, und es bis dahin zu seinem eigenen Nutzen verwende. Wir reisten ab und hörten Jahre lang nichts von Dufey, ausgenommen einmal, daß er ein höheres Amt angetreten und unsere Güter um einen lächerlich wohlfeilen Preis an sich gekauft habe. – Als Napoleon Kaiser und Frankreich von seiner inneren Entzündung durch Blutverlust geheilt wurde, machte uns der alte Dufey zu wissen, daß unsere Namen von der Proscriptionsliste gestrichen worden seien und daß wir zurückkehren durften. Damals war keine Hoffnung zum Triumph der guten Sache, und wir reisten nach Paris. Der alte Dufey, der sich unterdessen mit Hilfe unseres Geldes bereichert hatte, empfing meinen Vater mit Freudenthränen; er machte ihm zu wissen, daß er das ihm anvertraute Geld zum Ankauf unserer Güter verwendet habe und gab uns dieselben zurück. Der alte Dufey war ein treuer Mensch, und obwohl er für seine Treue mit dem großen Gewinn, welchen er durch die Verwaltung unseres Geldes erzielt hatte, reichlich belohnt war, so kann doch Niemand sagen, daß wir seine Verdienste nicht anerkannt hätten. Mein Vater starb unterdessen und einige Monate später auch Dufey; doch zwischen Cäsar's Vater und mir schwand die Freundschaft nicht, mit welcher wir ihn und seinen Vater in unserem Hause, wo Letzterer ein gemeiner Diener gewesen, stets aufgenommen hatten. Endlich stürzte der mächtige Kaiser und mit ihm seine meteorgleich aufgetauchten Mächtigen, und der in den Grafenstand erhobene Dufey stand ohne Freund und Einfluß auf der Welt, ein reich gewordener gemeiner Mensch, nichts weiter. Aber mit der Legitimität trat auch ich in meine natürliche Stellung zurück, und wenn ich je seinem Vater Dank schuldig war, so mag er es selbst sagen, ob ich meine Schuld nicht treulich abgezahlt habe. An seinem Namen hingen Blutflecken, er selbst war einer Derjenigen, die dem legitimen König den hartnäckigsten Widerstand geleistet hatten – einer Derjenigen, die als das Banner der Revolution durch den großen Feldherrn noch einmal geschwungen wurde, der verlorenen Sache sich zuerst anschlossen. Doch als der Friede wieder eintrat, bemühte ich mich so sehr, benützte ich meinen Einfluß so entschieden, daß Dufey in sein früheres Amt wieder eingesetzt wurde, und weil er sich durch Geschicklichkeit auszeichnete, von Stufe zu Stufe emporstieg. Und was sagen Sie dazu, daß Derjenige, der mir und der Regierung so viel zu verdanken hatte, nach einigen Jahren sich der Opposition anschloß, und endlich, während sein Sohn in den Julitagen gegen seine Wohlthäter kämpfte, die Entsetzung seines Königs unterschrieb! Was sagen Sie dazu, daß er einer der ersten Diener dieser usurpatorischen Gewalt war, und auch jetzt einer Derjenigen ist, die jedes Recht auf's Frechste mit Füßen treten!«
Julie schaute, in Gedanken vertieft, in die erloschenen Flammen des Kamins; ich schwieg, theils weil ich in der Handlungsweise der Dufey's gerade keine so große Undankbarkeit sah, theils und vielleicht noch mehr deshalb, weil ich meine Eifersucht nicht unterdrücken konnte und Den, welchen ich zu hassen vielleicht Ursache hatte, nicht vertheidigen wollte. Es ist eines der Charakterzeichen unseres Jahrhunderts, daß, wenn es Leute gibt, die nicht lügen, in der sogenannten gebildeten Welt vielleicht kein Einziger existirt, der gegen seine Vorurtheile oder den Geist seiner Umgebung die Wahrheit aussprechen möchte, wenn nicht Interesse oder seine Eitelkeit ihn dazu aneifert; zu Lüge und Heuchelei erzogen, bringen wir unsere Tage in feiger Verstellung hin, bis wir endlich fühlen, daß wir von Denjenigen, gegen welche wir niemals wahr gewesen, keine Wahrheit verdienen; der Betrüger fängt an zu zweifeln, und gerade weil er sich Niemanden entfremden will, steht er verlassen da. Möge sich Niemand darüber wundern, daß in diesem Jahrhundert, wo der materielle Comfort so sehr zugenommen hat, dennoch so wenig zufriedene Menschen anzutreffen sind: der Glaube ist dahingeschwunden, und ohne Glauben kein Leben. »Traue den Menschen nicht!« sprach mein Vater, als ich ihn verließ. Mein junges Herz sträubte sich damals noch gegen diese traurige Lehre; aber ich blickte in mein eigenes Herz und fand, daß er die Wahrheit gesprochen habe, denn war ich nicht selbst ein Lügner, hatte ich nicht Hunderte, für die mein Herz nichts fühlte, Freund genannt? Hatte ich nicht auch gelernt, mich vor Denjenigen zu verbeugen, die ich verachtete, Denjenigen die Hand zu drücken, die ich nicht liebte? Und was konnte ich von einer Gesellschaft erwarten, deren gewöhnliche Reden Lügen sind? Die Bildung hat sich die Worte und Zeichen des Gefühles so sehr zu eigen gemacht, daß dem wahren Gefühl nichts übrig bleibt, als zu schweigen; und wer sollte nicht zuletzt auch an dem echten Golde zweifeln, wenn so viele falsche Münzen circuliren? Und wer möchte sich nicht lieber von einer Gesellschaft zurückziehen, in der sein Herz keine Nahrung findet? Aber man kann nicht allein stehen auf dieser Erde; so wie die größten Wonnen des Menschen gerade aus seinen Bedürfnissen entspringen, die ihn lehren, sich um die Liebe seiner Mitmenschen zu bewerben und die Segnungen des Mitgefühles zu genießen, so wird bei dem Einsamen selbst die Wonne zur Qual, denn sie läßt ihn seine Verlassenheit nur noch mehr fühlen. Gleich den Rittern der Vorzeit kann sich der Mensch mit Panzer und Schild gegen die Streiche seiner Feinde wappnen, aber die schwere Last seiner Sicherheit kann er nicht lange ertragen; und wenn er sein Ich gleich einer Festung mit starren Mauern umgeben hat, so fühlt er sich nur zu bald als Gefangener, wenn er sieht, daß die Mauer, die ihn vor seinen Feinden schützt, ihn zugleich von der ganzen Welt abschließt.
Der alte Graf, dem unser langes Schweigen sichtlich unangenehm war, sprach endlich zu mir gewendet: »Sie schweigen? Billigen Sie vielleicht Dufey's Handlungsweise? Natürlich, gegen uns ist die Welt strenge, unsere Fehler werden bemerkt, der Pöbel kann thun, was er will.«
»Weil nur wir beneidet werden können,« antwortete ich, endlich zum Sprechen gezwungen; »gegen die Armen ist die Welt in ihren Gaben ungerecht, gegen uns in ihrem Urtheil, und ich glaube, es ist nicht an uns, uns zu beklagen.«
»Ich will mit Ihnen nicht streiten,« sagte der Alte übler Laune; »jedes Zeitalter hat seine Vorurtheile, welche es für unwiderlegliche Wahrheiten hält und ausgibt, und wer in unserem Jahrhundert den Unterschied der Geburt vertheidigt, wird, für einen Verbrecher gegen das Naturrecht gehalten, sowie einst Diejenigen, denen es etwa einfiel, von Gleichheit zu träumen. Aber hüten Sie sich vor dem Pöbel, und wenn Sie für denselben etwas thun, so seien Sie im Voraus überzeugt, daß Sie keinen Dank ernten werden, und nach hundert Verlusten und Leiden sich nicht einmal damit trösten können, Jemandem genützt zu haben. Diese Welt wird Niemand ändern, und wenn auch hundert und tausend neue Principien und Systeme auftauchen, so wird doch das menschliche Herz, wie der Baum unter den Strahlen von hundert Frühlingen, immer nur dieselben Früchte tragen.«
Mitternacht war vorüber, und da ich die üble Laune des alten Herrn sah, ging ich fort. Meine Seele war voll Ungewißheit; was ich von Dufey's einstigen Verhältnissen vernommen hatte, vermehrte meine Besorgnisse, und als hingegen Juliens offenes Gesicht vor meiner Phantasie auftauchte und ich es für unmöglich hielt, daß ihr freundlicher Blick und ihre warmen Händedrücke Heuchelei sein können, da erschien mir jeder Zweifel als ein Verbrechen, durch welches ich mich der Liebe Juliens unwürdig machte. Jetzt, nachdem ich so viele Erfahrungen gemacht, nachdem ich, auf den Grund des Lebensstromes blickend, unter dessen schillernder Oberfläche nur Schlamm gefunden habe, könnte ich über meine Ungewißheit beinahe lachen. Doch der Jüngling rechnet anders; es gibt Dinge, die er für unmöglich hält, und wie starke Beweise sich ihm auch darbieten er verschließt sein Auge und glaubt, weil er glauben will und muß. So wie man die Menschen auf schlimme Nachrichten allmälig vorbereitet, damit die Seele unter ihrer schweren Last nicht zusammenbreche, so verfährt mit uns das Geschick; es bringt uns die Menschenkenntniß langsam bei, damit wir die schreckliche Wissenschaft ertragen lernen. Zuerst betrügt Dich ein Mensch, und wie schwer auch die Wunde sei, sie heilt zu und verhärtet Dir das Herz mit einer Narbe; später lernst Du an Mehreren zweifeln. Deine Lieblingsideen verschwinden nach einander, und Du erträgst es, weil Du schon weniger Vertrauen hattest; noch später verlassen Dich Deine Freunde und zuletzt erst siehst Du ein, daß auch Deine Geliebte falsch war, und Du vermagst Niemanden mehr auf der Welt zu trauen. Schreckliche Erfahrung! Doch die Zeit, welche Dir so viele Schätze geraubt, hat Dich gelehrt, Dich in Dich selbst zurückzuziehen, und wenn Du endlich verlassen dastehst, so erträgst Du's, denn Du bist bereits ein Egoist geworden. Ich hatte noch eine lange Schule durchzumachen, bevor ich soweit gelangte.
Nach Hause gekommen, fand ich Armand in meinem Zimmer; in seinem ganzen Wesen gab sich die größte Veränderung kund. Er kam mir mit glühenden Wangen entgegen und schüttelte mir mit ungewöhnlicher Wärme die Hand. Ich war es so wenig gewohnt, ihn so heiter zu sehen, daß ich nicht umhin konnte, ihm darüber meine Verwunderung auszudrücken. »Nicht wahr,« sagte er lächelnd, »ich habe mich sehr verändert, seit wir uns nicht gesehen? Sieh', wie viel ein wenig Hoffnung vermag. Du hieltest mich schon meiner Natur zufolge für unglücklich, und oft sagtest Du, Du könntest Dir gar keine Umstände vorstellen, in welchen ich zufrieden wäre; nun hat ein Hoffnungsstrahl meine Zukunft erhellt und ich fühle mich glücklich. O glaube mir, die Freude findet in jedem Herzen Platz, und wenn Du so vielen Menschen begegnest, bei welchen dieses Gefühl so selten oder nie sich kundgibt, so sei überzeugt, daß dieser Memnonssäule nur der belebende Strahl fehlt.«
»Aber was hat Dich so glücklich gemacht?« fragte ich erstaunt.
»Was mich so glücklich gemacht hat? Frage den Glücklichen, worüber er sich freut; laß' Dir seine Wonne schildern, und wenn er zufällig nicht Deinen eigenen Wünschen begegnet, so wirst Du lächeln. Ein Stück trockenes Brot, welches die Bettlerin mit ihrem Kinde theilt, kann ein ganzes Himmelreich in sich schließen; das Interesse jeder Sache hängt nur von unserer Lage ab, die unsere Einbildungskraft bestimmt, und das Glück ist schließlich nichts Anderes als Dasjenige, was wir dafür halten. Willst Du die Freude eines Menschen begreifen, so sieh' niemals auf die Gegenwart; betrachte die Vergangenheit des Glücklichen und Du wirst finden, daß Alles nur vom Unterschied zwischen der Vergangenheit und Gegenwart abhängt, und selbst die Thräne, welche dem schmerzbeklommenen Herzen Linderung verschafft, kann ein größerer Schatz sein als alle Perlen Indiens.«
»Du liebst also,« sprach ich, überzeugt, daß nur die Liebe solche Freude bieten könne.
»Ich?« erwiderte Armand mit bitterem Lächeln, das die Heiterkeit seines Gesichtes wieder verscheuchte. »Die Liebe ist ein Himmelreich, aus welchem man nur einmal stürzen kann, und über welches der Gefallene, wie Lucifer über das Himmelreich, in seinen Qualen einen schrecklichen Fluch spricht. Ueberdies,« fuhr er mit spottendem Tone fort, »ist die Liebe ein Genuß, zu dessen Erwerbung heutzutage mehr Vermögen gehört, als ich besitze, und welchen ein so armer Proletarier schon deshalb zurückweisen muß, weil es Wahnsinn ist, wenn ein Mensch, der vom Schicksal Schläge zu erwarten hat, sich zwei Rücken, und ein Unglücklicher, den Hunger erwartet, zwei Magen verschaffen will. Mein Glück ist, wie das armer Leute, nichts Anderes, als ein wenig Hoffnung, wahrscheinlich eine trügerische, wie unsere Hoffnungen schon zu sein pflegen, aber dennoch beglückend, weil sie die einzige, und weil ich fühle, daß es die letzte ist.«
»Und welche andere Hoffnung kann uns beglücken, als die, daß wir geliebt werden?« sprach ich seufzend, denn Juliens Bild stand vor mir.
»Daß wir Liebe verdient haben,« sprach Armand begeistert, »nicht von einem Weibe, dessen Liebe unseren Sinnen Genuß und unserer Seele Freude verspricht – nicht von einer Familie, die uns für unsere Bemühungen mit freundlicher Aufnahme in ihrem Kreise dankt – sondern daß wir die Liebe Desjenigen verdient haben, dessen Gegenliebe wir nicht erwarten können, dessen Umarmungen tödtlicher sind als seine Schläge, daß wir die Liebe des Volkes verdient haben, das ist schöner, als die sanften Freuden der Liebe.«
»Dem Himmel sei Dank, daß ich Dich so begeistert sehe,« sprach ich; »es ist eine Art von Glück, zum Leben Vertrauen zu haben, das, wie der Kaufmann seine Waaren, unsere Opfer auf Credit gibt und nimmt, und von welchem wir in anderer Weise nichts erwarten können.«
»Lache mich nicht aus, mein Freund!« sprach Armand; »sowohl diese Hoffnung, als auch diese Pläne wurden in mir durch ein Versprechen erweckt. Nicht wahr, es ist zu verwundern, daß ich, der so oft Getäuschte, wieder dem Versprechen eines Menschen glaube; aber wer kann dafür? Das Herz bedarf wenigstens der Hoffnung; das Volk hat mich in meinen Erwartungen getäuscht, und das sinkende Herz klammert sich an einen Strohhalm, um nicht unterliebte, zugehen. Vielleicht täuscht auch Dufey, wie so viele Andere, meine Erwartungen; doch schließlich habe ich wenigstens einige Tage gehofft, und diese Erde ist so arm an Freuden, daß es eine Thorheit wäre, die schönen Träume zu verscheuchen, selbst wenn wir im Voraus wissen, daß sie nicht in Erfüllung gehen werden.«
»Von Dufey erwartest Du Dein Glück?« fragte ich, erschreckt von dem Gedanken, daß er, der mir vielleicht die Geliebte raubte, jetzt mit mir das Herz meines Freundes theilen werde. Und als Armand weitläufig von Dufey's Macht und von dessen Versprechungen erzählte, als er dessen Eigenschaften nach einander zu preisen anfing, als er sagte, daß er von ihm, dem Manne des Volkes, mit größere Zuversicht Treue hoffen könne als von Andern, da erfüllte mich ein seltsames Gefühl von Schmerz und Haß, das ich nicht überwinden konnte. »Traue Dufey nicht,« sprach ich endlich, »er wird Dich hintergehen.«
»Und warum sollte ich ihm nicht trauen?« fragte Armand, »ihm, der den Fremden, den Armen so freundschaftlich aufnahm, der von mir nichts erwarten kann und bei seinem Versprechen an keinen Nebenzweck denken konnte; ich muß gestehen, ich sehe nicht ein, weshalb Du mir so räthst.«
Ich theilte ihm meine Verdachtsgründe, meine Begegnung in der Avignoner Kirche und hier in Paris mit; ich sagte ihm, wie glücklich ich wäre durch Juliens Liebe, wenn nicht Dufey's Bild zwischen uns stände, und daß ich ihn hasse, und daß ich überzeugt sei, das Schicksal habe ihn mir zum Fluch geschaffen – er werde mich auch meines Freundes berauben, so wie er mich bereits der Geliebten beraubt, und Beide, mein Freund und meine Geliebte, werden durch ihn unglücklich werden. Armand schwieg; er stand, die Hände gefaltet, vor mir, und in seinem Gesichte zeigte sich ein unbeschreiblicher Schmerz.
»Woran denkst Du?« sprach ich endlich, tief gerührt durch seinen Anblick und meine unvorsichtigen Worte bereuend, mit welchen ich vielleicht seine letzte Hoffnung zerstörte.
»Ich denke daran,« sprach er ernst, »daß wir uns von einander trennen müssen.«
»Trennen!« rief ich erschrocken, »wie kannst Du das sagen? Und hast Du die Vergangenheit vergessen, hast Du vergessen, daß ich Dir mein Leben verdanke und daß ich nirgends ausruhen könnte, außer an Deinem Busen? O, Dein Herz hat dieses Wort nicht gehört, das nur Deine Lippen ausgesprochen haben; wir können nicht von einander scheiden.«
»Es muß sein,« sprach Armand ernst, »unsere Interessen sind verschieden, und die die Zukunft auseinander führt, die kann die Vergangenheit, und sei sie auch noch so schön gewesen, nicht beisammen halten. Als wir noch Kinder waren, ahnte ich oft, daß diese Freundschaft sich lösen werde, und sieh', ich hatte Recht. Du, den das Geschick zum Genuß geschaffen hat, und ich, dessen Zukunft so ernst ist, wie könnten wir beisammen bleiben! Und wenn unsere Jugend auch den Unterschied zwischen uns ausglich, und Du, der junge Adler, und ich, das Gewürm der Erde, in unserer zarten Jugend mitsammen wandeln konnten, so fühlte ich doch, daß einst Deine Schwingen wachsen werden und daß ich Dir in Deinem Fluge nicht werde folgen können. – Damals glaubtest Du meinen Prophezeiungen nicht, der junge Graf konnte nicht ahnen, was das Leben den armen Jüngling schon längst gelehrt hatte; aber die Prophezeiung war richtig und sie wird in Erfüllung gehen.«
»Ich verstehe Dich nicht.«
»Freue Dich, daß Du mich nicht verstehst,« sprach Armand traurig; »freue Dich, daß das Geschick Dich seine starke Hand noch so wenig hat fühlen lassen, daß Du seine Mahnungen nicht zu bemerken vermagst. Aber ich bin der Schüler trauriger Erfahrungen, und als solcher an die Dunkelheit gewöhnt, sehe ich weiter in die Zukunft und kann im Voraus die Hindernisse angeben, an welchen unsere Freundschaft scheitern wird. Blicke in Dein Herz mein Freund, der Schmerz, welchen Du fühlst, hat meine Freude erzeugt; schon jetzt, da wir doch erst an der Schwelle des Lebens stehen, ist Derjenige, von dem ich mein Glück erwarte, Dein Gegner; Alles, was er zum Wohl Deines Freundes thun wird, ist Deiner Seele eine Pein; die traurigste Täuschung, welche Deinen Freund seiner letzten Hoffnungen berauben würde, würde Dir, wie sehr Du auch gegen Deine Gefühle kämpftest, eine geheime Befriedigung verursachen; und siehe, dieser Augenblick ist ein Bild unserer ganzen Zukunft. Wie stark auch das Herz sei, der Macht der Umstände kann es nicht widerstehen, und Menschen, die nicht eine gemeinschaftliche Hoffnung haben, in der sie sich begegnen, hängen vergebens an einander. Was nützt es, daß unsere Herzen sich einst so nahe standen; was nützt es, daß wir uns in unseren kindischen Träumen ewige Treue schwuren: uns hat das Geschick verschiedene Wege vorgeschrieben, und wir müssen uns trennen wie die Flüsse, deren Quellen zwar neben einander rieseln, die aber, je weiter sie fließen, desto mehr sich von einander entfernen.«
»O, mein Freund!« rief ich von Schmerz hingerissen, »wie kannst Du so sprechen –, wie kannst Du unsere Herzen mit dem kalten, schwankenden Flusse vergleichen, dessen erste Wellen ein Felsstück von ihrer Bahn abwenden kann, dessen Grund fühlloser Stein, dessen Oberfläche ein Spiegel ist, der hundert Bilder ohne alle Wahl abspiegelt; sind wir nicht freie Menschen, hat uns nicht der Himmel einander zur Stütze und Freude geschaffen? Und die Umstände haben keine Macht über unsere Freundschaft, wenn unsere Herzen einander nahe sind!«
»Glaube mir, mein Freund,« sprach Armand lächelnd, »der Himmel kümmert sich nicht viel um unsere menschlichen Angelegenheiten, und wer sich einen Freund wünscht, wird, wenn er ihn nicht gerade aufsucht, gewiß auf keinen solchen stoßen, den der Himmel direct für ihn geschaffen hat. Denke nur zurück an unsere Vergangenheit und sprich es aus, wie Deine schönsten Gefühle entstanden sind. War nicht ein Zufall oder zuweilen die Langweile die Quelle Deiner beglückendsten Verhältnisse? Und wenn Du Dich einmal bei Tisch auf einen andern Platz gesetzt, oder mit Deinem Dir vom Himmel erkorenen Freunde gerade von einem andern Gegenstande gesprochen hättest, wäret Ihr Euch vielleicht nicht ewig einander fremd geblieben? Eure Herzen harmoniren, aber wie viele Herzen schlagen in Harmonie? Und was nützt es, wenn das Herz nicht zu Deinem Accorde paßt? Was nützt es, wenn der Sohn gemeiner Leute zwar mit Dir gleiche Gesinnungen hegt, sein Rock aber zerlumpt ist? Was nützt es, wenn das bürgerliche Mädchen Dein Herz zwar besser versteht, aber nicht vom Tanzmeister gelernt hat, Dir in vornehmer Manier ihre Freundlichkeit zu bezeigen? Ihr werdet einander ewig fern stehen, wie gleichartig ihr auch von der Natur geschaffen seid. – Fern, das heißt fremd, denn das Herz umrankt, wie die Schlingpflanze, das Zunächststehende, und wenn es sich in seiner Lage glücklich fühlt, so thut es dies nicht, weil es ein gewisses, für es selbst geschaffenes Wesen, sondern weil es überhaupt etwas umfassen und so seiner Natur entsprechen konnte. Doch was die Lage und die Umstände zusammenknüpften, das können sie auch voneinander reißen; wie am Gletscher von Jahr zu Jahr neue Risse entstehen, und die Felsstücke, welche einst nebeneinander lagen, nach Jahren von einander gerückt sind, so entstehen auch in den Verhältnissen der Menschen Risse. Die Erde ist nicht erschüttert worden und im Leben ist nichts vorgegangen, was sich dem Gedächtnisse eingeprägt hätte, zwischen heute und gestern war kein Unterschied bemerkbar, und dennoch haben sich Felsen und Menschen allmälig von einander getrennt; denn wie mächtig auch unsere Eitelkeit sich dagegen sträube, wir sind nicht frei, selbst nicht in unseren Gefühlen, und obwohl uns das Geschick wie Wahnsinnigen anstatt Ketten, die Bande der Gewohnheit und der gesellschaftlichen Erfordernisse anlegt, damit nicht das Rasseln unsere Wuth erwecke, so sind wir doch auch so gefesselt, und vergebens sträuben wir uns dagegen. – Deine treue Anhänglichkeit, mein Freund, der heilige Wille, mit welchem Du mir Deine Freundschaft zugeschworen, ist vergeblich; das Leben wird auch Dich aus Deinen jugendlichen Träumen aufrütteln, und wie sehr Du es auch leugnen möchtest, Du wirst dennoch eben so gut ein Egoist werden, wie Andere.«
Nie hatte mich ein Wort schmerzlicher berührt als diese Prophezeiung Armand's; nicht weil ich mich verletzt fühlte, sondern weil eine innere Stimme mir sagte, daß er Recht habe. Ich schwieg, meine Augen füllten sich mit Thränen. Armand blickte traurig auf mich, auch er war gerührt, und seine Stimme zitterte, als er, mir die Hand drückend, sagte:
»Grolle mir nicht, mein Freund, und wenn es Dir auch weh thut, was ich in meiner Offenherzigkeit sprach, so bedenke, daß dies eine jener Erfahrungen ist, die wir durchmachen müssen. Wie Einer, den der helle Sonnenschein aus dem Schlafe erweckt, die Augen bei der ungewohnten Helle thränend öffnet, so gelangen auch die Menschen weinend zur Menschenkenntniß; aber einmal muß man dazu kommen, und es ist besser, wenn man zu der Zeit aufwacht, wo die Erde noch im Dämmerschein des Morgens, anstatt der Träume Genüsse darbietet, als in der schwülen Mittagshitze, wo Einem nichts übrig bleibt, als den Schatten aufzusuchen. Täuschungen können nicht ewig währen, und wenn auch diejenige, der wir uns beinahe Alle in der Jugend hingeben, nämlich, daß wir Andere mehr lieben als uns selbst, die schönste ist, so muß doch auch diese einmal schwinden. Der Mensch ist egoistisch von Natur, es ist das seine angeborne Eigenschaft, deren er sich nicht entkleiden kann und aus welcher sich seine Fehler, wie seine Tugenden entwickeln. In der Jugend, wo wir uns noch zu erhaben dünken, um unser ganzes Wesen einem so geringfügigen Gegenstande, wie das eigene Ich, zu widmen, leben wir dem Vaterlande, der Kunst, oder der Geliebten. Suchen wir aber nicht auch in diesen Dingen nur unsere eigene Befriedigung? Und wenn wir später das Ziel unserer Bestrebungen ändern, haben sich dann nicht vielmehr die Gegenstände unserer Freuden geändert, als jener angeborne Trieb, der uns anspornte, die Freude aufzusuchen? Und der Mann, der unglücklich genug ist, daß der Ehrgeiz sein Herz nicht mehr höher schlagen macht, der nach tausend Erfahrungen endlich einsieht, daß er seine Mitmenschen nicht beglücken kann, der schließlich, nachdem er im Sturm alle seine Schätze über Bord geworfen, nur um sein eigenes Leben zu retten, mit den Wellen ringt, worin unterscheidet er sich von dem Jüngling? Sie streben Beide nach einem Hafen, nur daß der Eine unglücklicher ist und unser Mitleid in größerem Maße verdient!«
»Und kann ich nicht auch in Deinem Glück die Befriedigung meines Egoismus suchen?« fiel ich ein; »und nachdem in meiner Jugend meine Erziehung den Ehrgeiz in mir ertödtet hat, nachdem ich mir kein großes Ziel vorgesteckt habe, in dessen Erreichung ich glücklich sein könnte, nachdem kein Familienglück mich erwartet, könntest Du nicht meine Welt, meine Familie, mein Alles sein? Du, der einzige Schatz, welchen ich den Stürmen des Lebens nicht über Bord werfe, den ich mit mir trage bis zu meinem Hafen.«
»O, warum mußte ich so viele bittere Erfahrungen machen!« sprach Armand traurig; warum sind wir nicht wieder Kinder, damit ich, mich Dir in die Arme werfend, die Freude ausweinen könnte, welche Deine zärtlichen Worte in mir erweckten! Doch die Zeit der Gleichheit ist vorüber; Du bist ein Graf, ich bin ein Bettler geworden, und wir müssen scheiden, wenn auch unsere Herzen vor Kummer brechen. Dich erwarten Freuden, mich vielleicht neue Täuschungen; wie fern wir auch einander stehen, ein Umstand kann unsere Herzen doch in Verbindung halten – der, daß Keiner von uns an seine glücklichsten Tage denken kann, ohne sich dabei seines Freundes zu erinnern; in unseren Erinnerungen bleiben wir ewig Freunde.«
»In unseren Erinnerungen und im Leben!« rief ich, hingerissen von meinen Empfindungen. »O, warum leugnest Du es, wozu kämpfst Du gegen Deine Gefühle? Diese Thräne, die in Deinem Auge glänzt, sagt mehr als Deine Klügeleien; blicke hinauf zu den Sternen, ihr Glanz wechselt! die Blumen verwelken und tragen neue Sprossen; das Meer ebbt und fluthet und sucht sich neue Grenzen; wohin Du immer schaust, Alles ist Veränderungen unterworfen, und vergebens suchst Du auf dieser Erde das Bild der Beständigkeit; doch sinke an meine Brust, und im Schlage meines Herzens wirst Du es finden. Möge was immer geschehen, möge die Welt sich wie immer verändern wir bleiben ewig Freunde!«
»Ewig,« wiederholte Armand, und über sein Gesicht flog ein schmerzliches Lächeln, als ich ihn leidenschaftlich an mein Herz drückte.
Draußen tobt ein Sturm, der Schnee schlägt knisternd an mein Fenster, und auf dem Friedhof erheben sich vor meinen Blicken die Schneewehen wie weiße Gespenster; weit und breit ist Alles düster und verlassen, als ob die Natur ächzend mit dem Tode ränge. Wie anders ist es, wenn der Sturm über grünende Frühlingsfelder dahintobt; da fällt ein Blüthenregen von den Bäumen und Düfte strömen über den Plan, während die Eichen ächzen und knarren, als ob sie die empörten Elemente zum Kampfe herausforderten. O, was sind Deine Stürme, o Jüngling, der Du noch eine große blühende Welt vor Dir hast, und den, wenn Deine Leiden vorüber sind, höchstens eine Thräne an die Schmerzen der Vergangenheit erinnert – was sind sie im Vergleich mit den Leiden des Mannes, der durch die Stürme keine Blüthen verlieren kann und nach ihnen doch nur eine kalte, freudenlose Ruhe findet?
Du hast mich gebeten, Dir mein ganzes Leben zu beschreiben, denn Du hofftest, daß mein Schmerz sich lindern werde, wenn ich der Ursachen derselben gedenke. Du täuschtest Dich. Ich kann Deinen Rath nicht mehr befolgen. Genug an dem, daß das Herz in seinen Qualen verblutete; wozu soll ich die Wunde desselben berühren, wozu es aus seiner Unempfindlichkeit erwecken, es wird ohnehin nicht mehr genesen. Wem der Schmerz von außen her verursacht wurde, den tröstet die Zeit; je weiter er seine Leiden hinter sich hat, desto geringer erscheinen sie ihm, bis sie endlich seinen Blicken ganz und gar entschwinden; und wenn es dann nicht einfällt, daß seine Leiden, so wie er sie bereits hinter sich hat, eben so gut vielleicht vor ihm stehen, der kann sich beruhigen, ja er kann sich seiner Erinnerungen vielleicht freuen, denn er glaubt, daß er das ihm beschiedene Maß von Leiden schon getragen habe.
Der Mensch ist wie ein Kind, das, wenn man ihm sein Spielzeug weggenommen, nach kurzem Weinen ein anderes ergreift, und endlich, wenn man ihm Alles genommen, im Staub der Erde sein Spielzeug findet. So lange das Herz den Keim der Freude in sich trägt, so lange empfindet es die Wucht des Schicksals nicht und es wird überall Freuden finden; doch wer den Quell seiner Leiden in sich selbst trägt, dem schwinden die Jahre vergebens dahin, den tröstest Du vergebens mit neuen Geschenken. Was nützt es dem Blinden, wenn Du ihm neue Bilder vor die Augen stellst, was dem Herzkranken, wenn Du ihm neue Genüsse bietest? Das Uebel liegt in ihnen selber und Du kannst es nicht heilen. Glaube nicht, die heilende Kraft der Zeit sei unwiderstehlich; nur vergangene Schmerzen kann sie Dich vergessen machen, aber sie vermag nicht, Dich an diejenigen zu gewöhnen, welche Dein Herz noch erfüllen. Der am Meere stehende Fels wird von den brandenden Wogen unterwaschen und endlich gestürzt, während der unter dem Meere ruhende Fels endlich zur Insel anwächst; – eben so macht es die Zeit mit unseren Schmerzen – die äußerlichen macht sie verschwinden, während diejenigen, die wir im Herzen tragen, immer größer werden.
Die Zukunft des Menschen liegt ganz in der Vergangenheit, und wie, wenn rauhes Wetter die Keime der Saat zerstört, die Sonne vergebens ihre warmen Strahlen darüber ausgießt, so können die lichten Tage des Mannesalters das Reis nicht mehr zur Blüthe bringen, welches im Keime verdorben ist. O, noch kannst Du mich nicht vergessen lehren, und vergebens sprichst Du von neuen Hoffnungen.
Täuschung! sprichst Du, Täuschung aller Täuschungen; das menschliche Herz ist so schwach, daß es nicht einmal seine Schmerzen zu behalten weiß. Frage die Erfahrung, und hast Du je einen Menschen gesehen, der sich nicht endlich getröstet hätte? Eine Nation, die ihren Todten nicht Grabmonumente errichtete, gleichsam das Geständniß ablegend, daß man den Dank und die Klage dem Stein überlassen müsse, weil Alles, was dem Menschen am Herzen liegt, dahinschwindet? Der Wahn, wir seien ewig unglücklich, ist eine Krankheit, nichts weiter – vielleicht eine Krankheit der Leber oder der Milz, und bist Du davon genesen, so steht die Erde, die Dir so düster erschienen, wieder in Rosenfarben vor Dir. – Aber soll mich dieser Gedanke trösten? Was habe ich davon, wenn Du mir den Grund meiner Leiden mit Deiner Pathologie erklärt hast und ich endlich einsehe, daß mein Körper die Leiden meiner Seele verursacht hat – daß nur eine Erkühlung der Grund, weshalb mir diese Erde so freudenlos erscheint – daß ein Loth Gehirn mehr oder weniger, ein Druck, welchen meine Amme unversehens meinem Kopf gegeben, ein Fall, der in meiner Kindheit mein Gehirn erschütterte, veranlaßt, daß mir die Welt in andern Farben erscheint? Das Leben ist für mich doch nur Das, als was es mir erscheint! Und es verursacht mir um so mehr Kummer, wenn ich einsehe, wie wenig dazu gehörte, mein Glück zu zerstören. Was liegt auch dem kleinen Wurm daran, daß der Gegenstand, der ihn in Schatten hüllt und ihn von den warmen Strahlen der Sonne abschließt, nur ein Grashalm ist? Was liegt der Motte daran, wenn sie in der Flamme einer kleinen Kerze zu Grunde geht? Der Grashalm, die Kerzenflamme sind für diese kleinen Opfer so viel, wie für uns ein Fels oder der Blitz, und es ist ein schlechter Trost, wenn Du den Eigenthümer, dessen Haus die Flammen zerstörten, daran erinnerst, welch' ein kleiner Funke genügte, um seine ganze Habe zu vernichten, oder wie er dem Verderben hätte entgehen können; er ist ein Bettler, gleichviel, wie er es geworden. Sein Trost besteht im Vergessen und Verachten der Freuden, deren sein Geschick ihn beraubte – in der Verachtung dieser Welt, wo der geringste Windhauch genügte, um seine Spuren zu verwehen, wo der Schatten um so größer wird, je länger die Sonne scheint – in der Verachtung dieses Lebens, wo für seine Tugenden die Welt, für seine Fehler sein Gewissen ihn strafte – wo sein Herz mehr als tantalische Qualen erlitt, weil die Fluth nicht sich ihm entzog, sondern seinen Durst nicht löschte, und weil die Früchte nicht vor ihm verschwanden, sondern bitter waren – in der Verachtung des Lebens, das ihn endlich einsehen lehrte, daß er nicht hoffen darf, ohne später dafür zu büßen; – sein Trost ist, die Menschen zu verachten, dieses unglückliche, verfluchte Geschlecht, das, zum Dulden zu schwach, zu feige, um zu widerstehen, nur seine Unterdrücker hassen und ihr Beispiel nachahmen kann; – sein Trost ist, Alles zu verachten, wie ich, und, in die Einsamkeit zurückgezogen, gleich dem sterbenden Römer sein Gesicht in den Mantel zu hüllen, damit die Welt seinen Schmerz nicht sehe und der Anblick so vieler Niederträchtigkeit die letzten Empfindungen seines sterbenden Herzens nicht verbittere – sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, und als Endresultat der Lebenserfahrung zerrissenen Herzens mit der heiligen Schrift auszurufen: » Verflucht, wer sich auf die Menschen verläßt!«
Wenn Dein Herz der Hoffnungen bedarf, so suche Dir eine Blume, umgrabe den Boden, in welchem sie wurzelt, pflege, begieße und bewahre sie vor dem Sturm, und die Blume wird dankbar sein; an ihren Zweigen werden sich Knospen entwickeln, und wenn Du in denselben Deine Hoffnungen sahest, so wirst Du nicht getäuscht sein, jede Knospe wird sich endlich erschließen und aus jedem Kelch wird Dir Dank entgegenduften. Wenn Du Theilnahme suchst und Dein Herz sich zuweilen nach einem freundlichen Blick, nach einem Herzen sehnt, das nur für Dich schlägt, so halte Dir einen Hund, der Hund wird Dir treu sein; wenn Du ihm zuweilen einen Bissen von Deinem Tisch hinwirfst, seinen Kopf auf Deinem Knie ruhen lässest und ihn streichelst, so vergißt der Hund, wie oft Du ihn hast hungern lassen, wie oft Du ihn auch grausam von Dir jagtest, wenn er sich Dir freundlich näherte, wie oft Du ihn aus deinem Zimmer triebst, er erinnert sich nur Deiner geringen Wohlthaten; und wenn Du Dich von Jedermann verlassen sehen wirst und Dein Herz in schweren Leiden auf der Welt schon keinen Trost mehr sucht, wird Dein treuer Begleiter sich an Dich schmiegen, so lange um Dich herumgehen und mit seinem Kopf Deine Hand stoßen, bis Du ihn endlich eines Blickes würdigst; und wenn Du an dem traurigen Blick seines Auges siehst, daß er Deinen Kummer verstanden hat, so wird vielleicht eine unerwartete Thräne Dein Auge erfüllen, indem es Dir einfällt: Gott habe den Hund vielleicht dazu geschaffen, daß der Mensch im Unglück nicht ganz verlassen dastehe, und auch am Grabe Desjenigen, der keine Erbschaft hinterläßt, ein Wesen um ihn trauere.
Wenn Du nicht ohne Spur verschwinden willst und es Deiner Seele wohl thut, eine Erinnerung zurückzulassen, so schneide Deinen Namen in die Rinde eines Baumes, und die Buchstaben werden an Deinem Baume von Jahr zu Jahr wachsen, bis sie endlich, wenn Du nicht mehr bist und unter den Menschen Niemand mehr sich Deiner erinnern wird, ihre Form verloren haben und als unauslöschliche Wunde so lange fortdauern werden, als der Baum steht. Nur von den Menschen hoffe nichts, nur auf sie verlasse Dich nicht, nur von ihnen erwarte keine Erinnerung; auch der Beste unter ihnen gleicht Dir, und Du bist ein Egoist.
Es gibt Wahrheiten, gegen welche das Herz sich sträubt, und eine solche ist die Selbstkenntniß. So wie die Bewohner dieser Erde Jahrtausende hindurch glaubten, ihre Kugel stehe fest, und die durch die Umdrehung derselben verursachten Erscheinungen der Sonne zuschrieben, so hält der Mensch sein Herz für beständig, und wenn er daran Aenderungen bemerkt, so schreibt er dieselben Allem, nur nicht sich selbst zu. Doch wenn auch spät, endlich kommt der Galiläi seines Herzens und sagt ihm ruhig die traurige Wahrheit, und spricht so: »Wenn Deine glänzenden Tage mit Nacht abwechseln und in Deiner Brust so viel Finsterniß ist wie Licht, so schreibe dies nur Dem zu, daß Dein Herz sich fortwährend um sich selbst dreht; Mensch, Du bist ein Egoist. »Fort von mir, Verleumder!« ruft unser Herz. »Hielt ich diese Brust nicht für standhaft, seit ich lebe; zeigte sich dieses Herz nicht edel, seitdem es zu schlagen anfing, und so viele Opfer, und Alles was ich für meine Lieben fühle, wäre Egoismus?« Vergebliches Sträuben! Wir können die Wahrheit verleugnen, aber nicht besiegen; und wie Galiläi in seinem Kerker, so spricht auch in unserer Seele stets eine Stimme für die Wahrheit. – Du, der Du an den Geboten der Tugend so standhaft festhältst, der Du die Bahn des Guten wandeltest, nur Deinem Vaterlande und Deinen Mitmenschen lebtest, warst Du schon unglücklich? Hungertest Du, als Du dem Bettler ein Stück Brot gabst? Wußtest Du, als Du Dich für Dein Vaterland aufopfertest, vorher, daß die Nachwelt Dich für Deine That nicht preisen werde? Daß das, was Du für Andere thatest, Dir zum Schaden gereichte? Wenn Du es nicht wußtest, so danke dem Schicksal für Deine Tugend und verachte Niemanden, der unglücklicher ist als Du, aber nicht schlechter, in Deiner Lage gleich Dir die Bahn der Tugend wandeln, gleich Dir lieben und opfern würde, weil sein Egoismus bewundert werden wollte, gleich dem Deinigen, und weil das Herz nach der Befriedigung materieller Wünsche höherer Genüsse bedarf. Es ist traurig, aber wahr: die Tugend ist oft nichts als ein glücklicher Zufall.
»Kenne Dich selbst!« so sprach ein Weiser. Wehe Dem, der diesen Rath befolgt; die Menschenkenntniß ist eine qualvolle Wissenschaft; aber wenn wir darin auch noch so große Fortschritte gemacht haben, daß wir das Ganze zu verachten beginnen, so bleibt uns doch ein Trost, nämlich, daß wir selbst besser sind. Man kann die Niederträchtigkeit sehen, mit welcher die Menge gegen jeden neu auftauchenden Ankömmling den Stein aufhebt, und wenn sie sieht, daß er stärker ist, ihr Niederbücken für eine Bezeigung der Achtung ausgibt; man kann die Tugend gehaßt, ja verachtet, unter den schweren Streichen des Schicksals niedergeschlagen und wie eine Eiche vom Blitz gefällt sehen, während das niedrige Gras, das sich rings um sie beugt, im warmen Sommerregen grünt und gedeiht; nach langen Erfahrungen kann man sich überzeugen, daß – so wie alle Menschenclassen einander dieselben Vorwürfe machen, und wie der Bürgerliche den Adeligen, der auf ihn herabsieht, des Hochmuthes beschuldigt, und Letzterer wieder dem Nichtadeligen, der mit seinem Stande nicht zufrieden ist, Eigendünkel vorwirft – wie der Arme den Reichen herzlos nennt, der im Genuß vergißt, wie Viele leiden, und der Reiche wieder dem Armen, der für seine Wohlthaten nicht dankbar ist, Herzlosigkeit vorwirft – eben so auch ihre Fehler gleich sind. Und es ist auch zwischen den Menschen im Ganzen genommen kein anderer Unterschied, als daß der eine mehr Entschuldigungsgründe hat, als der andere. Der Mensch kann dies Alles sehen und erfahren, und so lange er sich für besser hält als die Menge, kann er glücklich sein. Er fühlt wie Einer, der auf einem hohen Berge steht; was er rings um sich sieht, die menschlichen Wohnungen und die Felder, Alles erscheint ihm klein und niedrig; aber er steht höher, und wie vieler schönen Täuschungen ihn auch sein weiterer Gesichtskreis beraubt, das Gefühl seiner Erhabenheit ist ihm ein genügender Trost für Alles. Wenn wir aber einmal von unserer eingebildeten erhabenen Stellung herabsteigen, wenn unsere Tugend mit unserem Egoismus einmal in Conflict geräth; wenn wir, in unser Inneres blickend, sehen, daß es nur der Siegel Dessen ist, was wir an Andern verachteten; wenn wir bemerken, daß das Herz, welches sich einst so laut zu jedem Opfer anbot, gleich dem Echo um so schweigsamer wird, je näher das Opfer heranrückte: wenn wir uns selbst kennen, dann ist unser Schmerz unheilbar; – wenn wir endlich einsehen, wie wenig wir uns selbst vertrauen können, dann rufen wir mit verbittertem Herzen aus: »Wehe Dem, der sich auf Menschen verläßt!«
Alle Menschen sind in gleichem Maße egoistisch, und wäre der Glaube nicht, welcher Demjenigen, der den irdischen Gütern entsagt, höhere Güter verspricht, und wäre unsere Eitelkeit nicht, dieser Wahnsinn, welchen das Geschick den Menschen zum Controlor ihrer Klugheit gegeben, so hätte die Gesellschaft sich vielleicht schon längst aufgelöst. – Aber wer keinen Glauben besitzt, wer unter Leiden die Gabe, zu hoffen, verloren hat und im endlosen Himmel nichts findet als eine ungeheuere Wüste mit Sternen und Wolken, aber ohne Widerhall für das Gebet der Menschen; wer die Menschen zu gut kennt, um ihre Ehre, ihr Lob für ein Glück zu halten; wessen Einbildungskraft nicht erglüht, wenn er daran denkt, daß er nach Jahrhunderten oder nach Jahrtausenden von Kindern bewundert, von eitlen Schriftstellern gepriesen und von Parteien als Muster aufgestellt werden wird, nicht wegen Dessen was er gethan hat, sondern wegen Dessen, was das kommende Zeitalter von ihm hält, auf welches die Gegenwart jedes Verdienst, das sie nicht belohnen will, verweist, das kommende Zeitalter, welches die Gracchen, die für das Volk verbluteten, vergißt, und nur von Brutus, dem Repräsentanten des römischen Patriciats, spricht – das nur deshalb schöner ist als die Gegenwart, weil wir die Niedrigkeiten desselben nicht kennen, und dessen Geschlechter, wie wir auf die alte Zeit, vielleicht staunend auf uns zurückblicken werden, auf diese Heroen, die ich verachte! – wen nicht der Glaube zu guten Handlungen veranlaßt, wen nicht Ehrgeiz zu Opfern begeistert, Eitelkeit nicht zum Guten verleitet, und wer im Genuß so sehr ermüdete, daß er zuletzt selbst für seinen Egoismus keinen Gegenstand mehr findet: was bleibt einem Solchen auf der Welt noch übrig? – Das Grab, diese finstere Wiege unseres Glückes, wo das Herz ausruht nach der mühevollen Reise, wo keine Hoffnung unsere Ruhe stört, keine Erinnerung unsere Träume verbittert – das Grab! – Und wenn Dir nichts sonst auf der Welt geblieben ist, wenn Du umherschauend keine andere Hoffnung mehr hast, als daß Deine Leiden einmal aufhören werden, warum zauderst Du?
Ich schaue ringsumher. Am Himmel fliegen zerrissene Wolken in wildem Durcheinander, der Wintersturm wüthet im Schnee der Gebirge, als ob er die Grabesdecke von der Erde reißen wollte, damit wir an ihrem nackten Leibe schaudernd die Fäulniß sehen sollen und die hohen Fichten ächzen unter seinen Streichen. In meinem Zimmer ist Alles stumm, die Flammen des Kamins sind erloschen, und nur hie und da zuckt ein Funken durch den Aschenhaufen, der keine Wärme mehr verbreitet. Und draußen hinter diesen Bergen und Wäldern steht die Welt, winterlich schweigsam und frosterstarrt, eine Welt, unter deren schimmernder Oberfläche der Moder von tausend Frühlingen liegt, wie hier, und deren einziger Ton das Wehgeschrei der sturmerschütterten Massen ist; und drinnen vor dem Kamin sitzt ein Mensch, der längst die Flammen in seiner Brust erloschen gefühlt, auf dessen zu Asche gewordenen Gefühlen sich vielleicht nur deshalb hie und da ein Funken zeigt, damit er ihn an die Verwüstung gemahne, nicht damit er neue Wärme verbreite; – und wenn dieser Mensch vor dem Kamin sitzt, seine Qualen nicht mehr ertragen kann, wenn er, auf die Außenwelt und in seine Brust blickend, fühlt, daß hier wie dort seiner nur Leiden warten, daß er nirgends einen Ruheort finden kann, in der Welt nicht, weil die Menschen, in der Einsamkeit nicht, weil seine Gefühle ihn nicht ruhen lassen: sündigt er, wenn er sich aus seinem Kreise fortwünscht, wenn er, sein Fenster öffnend und einen Friedhof vor sich sehend, wie ich, und fühlend, daß Diejenigen, die hier liegen, süß ruhen, endlich einen großen, unwiderstehlichen Wunsch in seinem Herzen fühlt, und spricht: Große unergründliche Macht, die du mich ohne mein Verschulden auf diese Erde gesetzt, mein Herz mit Gram und Bitterniß erfüllt, mir allen Trost geraubt und mich im Schlamm der Welt hast versinken lassen, bis ich endlich sündigen und mich selbst verachten lernte – ich, dein Sclave, zerbreche meine Fesseln. Thürme deine Wolkenfesten an deinem Himmel übereinander, erfülle Diejenigen mit Entsetzen, die sich vor deinem Donner fürchten, überschwemme diese Erde mit deinen Plagen, damit die Verwüstung weit und breit Zeugniß gebe von deiner Macht; oder blicke segnend herab auf unsere arme Erde, schütte verschwenderisch deinen Segen aus über die Menschen, laß' an jedem Zweige Blüthen prangen, laß' deine Sonne in wärmeren Strahlen erglänzen, deine Sterne seien strahlender, dein Himmel blauer, bis endlich die Schaar der Vögel in der verjüngten Welt ein neues, schöneres Lied anstimmt – was kümmert es mich? Dieses Herz hat zu viel verloren, um von deinen Verheißungen noch etwas hoffen zu können. Ich bin frei.
Warum, o Herz, bist du bei diesen Gedanken so beklommen? Warum zitterst du, meine Hand, als ich nach dem Dolche griff? Haben so viele Leiden mich noch nicht die Ammenmärchen vergessen gemacht? Scheint mir die Welt noch so hell, daß ich das Grab fürchte? War dieses Wachsein so beglückend, daß ich selbst den Schlaf von mir fern zu halten wünsche? Thorheit! Und warum dieses Zaudern, warum halte ich zweifelnd meinen Dolch in der Hand, diesen sicheren Schlüssel, der, wenn er mir auch nicht die Thore eines neuen besseren Daseins erschließt, wenigstens für ewig mir den Ort versperrt, wo ich so viel gelitten habe? Oder fürchte ich mich vor dem momentanen Schmerz, der meine zerrissenen Sehnen noch einmal durchdringen wird, wenn dieses Eisen meine Brust durchschneidet? Fürchtet sich der Galeerensclave vor den Hammerschlägen, mit welchen ihm die Fesseln von den Füßen geschlagen werden? Und ist das ein Leiden, von dem wir wissen, daß wir dadurch frei werden?
Und dennoch ist in dieser Brust etwas, das nicht sterben will, eine geheime Kraft oder Schwäche, die sich an das Leben klammert, und, nachdem die süßen Bande des Herzens gerissen sind, als schwere Fessel zurückblieb.
Wenn ein Vater in den Armen einer treu geglaubten Gattin, von Kindern umringt, für welche zu leben Wonne und Pflicht ist, sich von der Welt schwer trennt; wenn er, die lächelnden Lippen seines Jüngstgeborenen sehend, einen Augenblick vergißt, wie freudenlos, bei den Schmerzen seiner Gattin, wie unempfindlich die Welt ist, so mag das hingehen; wenn Derjenige, dem ein Freund geblieben ist, welcher nach schweren Jahren noch immer mit gleicher Treue an ihm hängt, beim letzten Händedruck nur Schmerz fühlt, nur daran denkt, daß der Tod ihn eines treuen Freundes beraubt, und nicht, von wie viel drückenden Sorgen er dadurch befreit wird, so verwundere ich mich nicht; wenn Jemand große Pläne gefaßt hat und für sein Leben besorgt ist, welches er seinem Vaterlande den Wissenschaften oder der Ausführung eines Kunstwerkes widmete, das er seit seiner Kindheit in der Seele getragen, so begreife ich auch das; wer einen Hund hat, der sich nach ihm sehnen wird; wem nur eine Blume geblieben ist, die er gern erschlossen sehen möchte, der möge sich an's Leben klammern, dafür zittern und beten, er thut wohl daran. Aber ich? Was besitze ich auf der Welt? Einen Vater, der aufgehört hat, mich zu lieben, seitdem er von mir nichts mehr hofft; eine Gesellschaft, an die mich peinliche Erinnerungen knüpfen; sogenannte Freunde, welche dieses Herz niemals gekannt haben; ein Vaterland, das ich nicht lieben kann, und wohin ich mich auch wenden möge, keine Idee, kein Wesen, wofür meine Seele noch erglühen möchte. Sobald nur vierzehn Tage über meinen Tod hingegangen sind, wird mein Vater wieder ruhig in seiner Bibliothek auf- und abgehen, der Gespräche, die man vielleicht über meinen Selbstmord führen wird, wird man satt sein, und Du wirst in Deinem ärztlichen Album seufzend unter Deinen Erfahrungen verzeichnet haben, daß es auch Seelenkrankheiten gibt, die der Mensch nicht ertragen kann; vierzehn Tage, und Alles ist vorüber, und meine Ruhe wird Niemandem mehr weh thun, keine Thräne mehr erpressen, – und warum dulde ich also noch?
Wehe dem Selbstmörder! so spricht die Welt; sein Andenken ist verflucht unter den Menschen, an seinem Grabe weint Niemand, und die Mutter spricht seinen Namen mit einem frommen Seufzer aus, damit ihre Söhne nicht seien wie er. Und warum so viel Schauder vor dieser That, warum dieses allgemeine Verdammungs-Urtheil über den Unglücklichen, der sich Ruhe verschaffte, ohne die Rechte auch nur eines einzigen Menschen zu verletzen?! Wer nimmt es dem Thiere übel, wenn es, unter seiner Last zusammensinkend, die ihm aufgebürdeten Geräthe nicht bis dahin trug, wohin sein hartherziger Herr es wollte? Wer verdammt den Bettler, daß er Hungers starb? Wer den unter dem Messer des Chirurgen blutenden Kranken, daß er seinen Schmerz nicht ertragen konnte? Auch das Herz hat eine Waage, und wenn ihm Schmerzen von größerem Gewicht auferlegt wurden, ist es nicht natürlich, daß es, das Gleichgewicht verlierend, von der Erde emporschnellt? Auch das Herz hungert, und sollte es nicht durch Hunger zu Grunde gehen können? Auch die Seele hat ihre Schmerzen, und diese sollen nie gemildert werden können? Und warum nicht? Weil mir ein Vorurtheil im Wege ist? Die Menschen geben die Anforderungen ihrer Feigheit für Gebote Gottes aus und drohen dem Selbstmord mit der Hölle – und ich soll darauf hören? Ich soll ihren Reden glauben, wenn sie von Dir, Allmächtiger, der Du mich auf diese Erde setztest, sagen, zu sagen sich unterfangen, daß Du Dich an meinen Qualen ergötzest und mich ewig bestrafen werdest, weil ich meine Schmerzen nicht länger ertragen konnte!? O, diese Gottlosen! Wenn Du Deine Welt nicht zur Freude geschaffen hast, hättest Du sie mit bitterer Ironie so schön gestaltet, hättest Du Deine Morgenröthe mit so reizenden Wundern umgeben, wenn Du wolltest, daß sie Deine Creaturen nur zu Qualen erwecke? O nein! Die Schmerzen, welche wir leiden, liegen in uns selbst, in Denjenigen, die jetzt als Deine falschen Propheten vor mich hintreten; Jahrtausende hat dieses Geschlecht gearbeitet, um seine Gesellschaft aufzubauen und sich Folterwerkzeuge zu schaffen; Jahrtausende hindurch haben sich Millionen Geister bemüht, für diese schöne Welt eine traurige Erklärung zu finden, die Liebe qualvoll zu machen, die Du zu unserer Glückseligkeit geschaffen hast, unsere Freundschaft in Trug zu verwandeln, unser Herz mit Haß zu erfüllen; Jahrtausende bemühte sich die Menschheit in ihrem Stolz, mitten in dieser reizenden Natur, in welcher Alles zum Glauben zwingt, Zweifel zu verbreiten: und jetzt, da sie über Deine schöne Welt so viele Schmerzen gebracht hat, daß dieses Herz sie nicht mehr ertragen kann; jetzt, da meine Seele den Staub abschüttelnd, sich zu Dir erhebt, hält sie mir Schreckbilder vor, auf daß ich meine Fesseln ferner trage. O, ich beklage mich nicht gegen Dich, dieser Kreis, aus welchem ich mich fortsehne, ist nicht Deine Welt; Jene haben ihn geschaffen, die Deine Gebote stets verachteten, Deine Menschen quälen, Deine Blumenfluren zu Schlachtfeldern umwandeln! Und Du solltest Deinem Diener fluchen, weil er unter den Niedrigen nicht länger wandeln wollte, und mit schmerzbeladenem Herzen zu Dir zurückkehrte, von dem allein er Linderung erwartete? Wenn Du mich schon zum Leiden geschaffen hast, sieh' meine Last, mit der ich vor Dich hintrete, und sage, ob ich von meiner kurzen Reise nicht genug bringe.
Aber wenn Du auf Deinen Gott vertraust, spricht die Welt, warum wartest Du nicht, bis er Dich zu sich ruft? Wie wagst Du es auszurasten, bevor Deine Sonne untergegangen ist und Du Dein Tagwerk vollbracht hast? Siehe, Gott hat selbst von seinem Sohne den bitteren Kelch nicht weggenommen, und Du wagst es, ihn von Dir zu stoßen! – Aber was haben denn Diejenigen gethan, welche die Nachwelt bewundert und die Ihr Menschen den Kindern als Vorbilder aufstellt? – Regulus, der sterben ging, um sein Wort nicht zu brechen; Sokrates, der lieber den Giftbecher austrank, als daß er die Wahrheit verleugnete; so Viele, die für die Einbildung, für Vorurtheil starben; Eure Helden und Märtyrer: haben sie wohl gewartet, bis es Gott gefiel, sie abzurufen, oder sind sie Sünder, weil sie, ihrer inneren Stimme folgend, die Fesseln des Leibes vor der Zeit von sich warfen? Und ich sollte fehlen, weil ich dieser inneren Stimme gehorche, dem Mahnruf meines Herzens folge, weil ich thue, was ich thun muß, da Du doch meiner Seele diesen Gedanken eingegeben hast?! O nein, Du bist gut und gnädig, und als Du dieses Herz schufst und ihm so viele Leiden aufbürdest, wußtest Du gut, daß ich es nicht länger werde ertragen können. – Ich war entschlossen.
Plötzlich drang Gesang durch die Thür in meine Stube. Die Mönche hatten sich zu ihrer nächtlichen Andacht versammelt und die ruhigen schmerzvollen Töne des De profundis erfüllten das schweigsame Kloster. Nie hatte dieser Gesang so sehr auf mein Herz gewirkt; ich hielt den Dolch in der Hand, ich richtete ihn nach meinem Herzen, aber mein Entschluß begann zu schwanken, daß Bild meiner Mutter stieg in meiner Seele empor; sie war es, an deren Grab ich diese Töne zum ersten Male gehört; es fiel mir ihre Liebe ein, die heilige Geduld, mit welcher sie so viele Leiden ertrug; es fiel mir das Gebet ein, welches sie mich gelehrt hatte, und der Segen, welchen ihre sterbenden Lippen über mich aussprachen, über mich, den Selbstmörder: – und mein Herz begann zu schaudern vor seinem eigenen Wunsch.
»Aus der Tiefe schreie ich zu Dir, o Herr!« so lautete das Lied, »Herr, erhöre meine Stimme!«
Erhöre, mein Gott, die qualvollen Seufzer dieses leidenden Herzens; sieh' gnädig auf Deinen Diener herab, der seine Hände zu Dir erhebt, Dir weinend seine Fesseln zeigt und seufzt: Herr, nimm sie von mir, ich ertrage sie nicht mehr.
»Wenn Du nur meine Sünden siehst,« erscholl es weiter, »Herr, Herr, wer besteht vor Dir? Doch bei Dir ist Gnade.«
O sei auch mir gnädig, mein Gott! Betrachte nur meine Leiden und sei barmherzig gegen mich; denn bei Dir ist Gnade, und als Du dieses Herz schwach schufest, wolltest Du nicht, daß es so viel leide. Die ich einst liebte, sie hat dieses Herz glühend hassen gelernt; der mein Freund war, er schlug mir, ach! die tödtliche Wunde – war dies nicht genug? Und selbst dieses Herz, das Herz, welches einst in so reinen Flammen strahlte, in welchem Deine heiligen Gebote erklangen, dieses Herz hat sein Versprechen selbst nicht gehalten; was verlangst Du noch von mir, mein Gott?
»Meine Seele hofft auf den Herrn,« erscholl der Gesang: »von Morgen bis zum Abend hofft Israel auf den Herrn.«
O, ich habe gehofft; von der Morgendämmerung bis zum Abend meines Lebens habe ich auf Dich gehofft, aber meine Kraft hat mich verlassen. O, sei barmherzig gegen mich! Sieh', als Loth's Weib zurückschaute und die brennenden Städte erblickte, da verwandeltest Du sie in eine Säule, denn Du bist gnädig, o Herr, und wolltest nicht daß, wer solche Greuel gesehen, noch weiter lebe; und sieh' ich schaue zurück und hinter mir breitet sich Verwüstung aus, und Alles, was mein war, sehe ich zerstört. O, mein Gott, mein Gott, wie soll ich meinen Weg fortsetzen?
Ich sank zur Erde in meinem Schmerz und flehte um den Tod, wie nie ein Mensch um sein Leben gefleht hat; mein Herz schwoll vor Sehnsucht nach dem Tode, als wollte es zerspringen.
»Er selbst wird Israel erretten!« erklangen die Schlußworte des Liedes, und das Bild meiner Mutter erhob sich segnend vor meiner Seele.
»Du selbst wirst dieses Herz von seinem Weh erretten,« stammelte ich mit letzter Kraft; »o mein Gott, nimm den bitteren Kelch von mir.«
Am andern Tage fand man mich bewußtlos in meinem Zimmer.
Zwei Wochen sind es, daß ich dieses Tagebuch wegen meiner Krankheit nicht fortsetzen konnte; niemals war ich dem Selbstmord so nahe, als indem ich die letzten Blätter schrieb. Hingerissen vom Wirbel meiner Gedanken, Gegenwart und Zukunft vergessend, stand ich schwindelnd und schaudernd, wie ein Unglücklicher, der vor dem zu seinen Füßen klaffenden Abgrund zurückbebt, aber dennoch mit unwiderstehlicher Gewalt hinabgezogen, seinen Untergang fühlt, und trotzdem nicht vermag, seine Augen von dem schauderhaften Anblick zum Himmel zu erheben, an dessen reinem Blau sein armer Kopf die Ruhe zurückgewinnen könnte, und der verloren ist, wenn nicht eine treue Hand den schon Versinkenden zurückhält. O, es gibt Schutzengel; meine Mutter sprach oft von ihnen, und ich glaube jetzt auf's Neue, daß ihr gesegnetes Andenken mich vor Verzweiflung behütete. Das eben ist die schönste Eigenschaft der Liebe, daß ihre beglückende Kraft über das Grab hinaus wirkt; und so wie an der Stelle des Baumes, der einst grünte und blühte, auch nachdem er gefällt ist, der Keim eines neuen Reises zurückblieb, so bleibt auch in dem Herzen, welches einst Liebe beschattete, nach dem Hingang dieser Liebe immer etwas, was neue Blüthen treibt und es nicht veröden läßt. Alles auf der Welt verschwindet; die Woge, welche den armen Schiffer zu verschlingen droht, und der sanfte Windhauch, welcher den Kahn an's Ufer treibt, sie schwinden beide vergessen dahin – nur die Liebe geht nicht spurlos verloren; und wie die Erde nicht ganz in Dunkel gehüllt wird, so lange die untergegangene Sonne den Himmel mit Purpur bedeckt, so versinkt unser Dasein nicht völlig in Finsterniß, so lange das Andenken eines geliebten Wesens unseren Horizont erhellt; und wenn wir auch nicht wissen, wohin der Weg führt, den wir wandeln, so erinnert es uns doch daran, von wo wir ausgegangen sind, und läßt uns nicht ganz irre gehen.
Jetzt steht die Sonne strahlend über unseren Bergen, das Brausen der Fichten hat mit dem Sturme aufgehört und die Landschaft dehnt sich vor meinem Fenster in der kalten Pracht eines Wintertages aus. So ruht mein Herz nach schweren Stürmen, kalt und mit frosterstarrten Blüthen, und dennoch süß. Sei auch dafür gesegnet, mein Schicksal; und Du, heiliger Geist meiner Mutter, der Du Deinem Kinde in dessen schwersten Momenten als Schutzgeist nahtest, umschwebe mich stets mit Deinen heiligen Erinnerungen, damit dieses Herz, das aufgehört hat zu hoffen, seinen Trost in der Vergangenheit finde. Und so wie Du einst in glücklicheren Tagen Dein Kind in Schlaf wiegtest, so stehe Dein Bild vor mir, wenn ich meine Augen zum langen letzten Schlafe schließe. Denn wenn es nach dem Leben einen Schlaf gibt, so wird er schön sein, wenn Du der letzte Gedanke des Entschlummernden warst.
Ich bin nicht zum Geschichtschreiber geboren, wenigstens nicht zur Beschreibung meines eigenen Lebens. Sei es, daß meine Erinnerungen zu neu sind, als daß ich über dieselben unparteiisch schreiben könnte, sei es, daß, weil der Mensch gleich einem Spiegel nur dann rein reflectiren kann, wenn kein Strahl mehr durchdringt, dieses Herz noch zu jung ist, um klar zu reflectiren; genug an dem, ich fühle, ich weiß es, daß ich meine Biographie nicht schreiben kann, und nur weil Du es wünschtest und ich mir es vorgenommen habe, fahre ich in meiner Erzählung fort, wie schwer es mir auch fällt. Das menschliche Leben ist ein Meer, auf welchem Derjenige, der die Fahrt fortsetzt, vielleicht endlich zu einem Ufer gelangt; aber wer die Richtung ändert, der verirrt sich stets auf der endlosen Fläche; von nun an will ich standhaft sein und meine Erzählung so viel als möglich nicht wieder unterbrechen. Wenn der Erzähler zuweilen seufzend stehen bleibt, wenn manchmal Thränen seine Erzählung unterbrechen, so bedenke, daß auch der Wanderer seine Müdigkeit dann am meisten fühlt, wenn er sich niedergesetzt hat, um auszuruhen, und daß man in das Herz, wie in die Erde nicht tiefer dringen kann, ohne auf eine Quelle zu stoßen – und bemitleide Deinen Freund.
Es gibt Leute, welche glauben, daß es keine größere Wonne gibt, als die Aussöhnung der Liebenden oder Freunde nach kurzem Streit. Sie täuschen sich. Nach Sommerstürmen, wie kurz jene auch sein mögen, und wie hell die Sonne strahlt, nachdem jene sich gelegt, kühlt die Luft immer aus; eben so bleibt nach Zerwürfnissen immer eine Kälte zurück, und wenn auch nicht beide Theile, so pflegt doch Derjenige, der sich einer Schuld bewußt ist, die Bitterkeit des Augenblickes nicht zu vergessen. Vergebens leugnet das Herz das bittere Gefühl, vergebens klammert sich die Seele mit aller Kraft wieder an den Freund – wir streben mehr, zu vergessen, als das wir wirklich vergessen können; und die Freundschaft, einmal in ihrem gleichmäßigen Lauf unterbrochen, ist wie ein Bach, der, nachdem er in einen Wasserfall übergegangen, wohl wieder spiegelglatt wird, aber den Schlamm nicht mehr ausscheiden kann, den er in seinem Fall aufgewühlt und in sich ausgenommen hat.
So war es zwischen Armand und mir; wir drückten einander die Hände, wir freuten uns, wenn wir uns begegneten, kurz, wir waren scheinbar noch innigere Freunde als vorher, denn Jeder von uns fühlte, daß er dem Andern Genugthuung schuldig sei; aber was nützte das? Die frühere Eintracht war dennoch unterbrochen, und unser Verhältniß war nur ein neuer Beweis, daß man aus Güte vielleicht eben so oft lügt und sich verstellt, wie aus böser Absicht. Ueberdies hatte sich Armand's Charakter so verändert, er unterschied sich so sehr von Demjenigen, den ich einst zu meinem Freunde erwählt hatte, daß unser Verhältniß auf keinen Fall von Dauer sein konnte.
Als ich eine Wohnung aufnahm, vermochte ich ihn nach vielem Bitten, ein Zimmer anzunehmen, und so hatte ich Gelegenheit, täglich die Aenderungen zu bemerken, durch welche diese einst so reine Seele immer tiefer und tiefer sank. O Armand, ist das jener Armand, den ich einst so geliebt, dessen Seele egoistischen Genüssen entsagend, für die Menschheit glühte – der wie ein vom Blitz getroffener Baum, welcher seine Zweige mit Flammen statt mit Blüthen bedeckt, traurig, aber strahlend sich vor meiner Einbildungskraft erhob – der zu stolz war, um eitel sein zu können – auf den ich vertraute, wie auf einen Fels, welcher eine um so stärkere Stütze bietet, je härter er scheint; wie anders stand er jetzt vor mir! Die junge Kraft gebrochen, der heilige Zorn zum Neid, das hohe Streben Zum niedrigen Eigennutz herabgesunken! – Und Alles das binnen wenigen Monaten, Alles das in Folge der traurigen Erfahrung, daß das Volk nicht so ist, wie er sich es vorgestellt hatte! O, es glaubt Niemand, wie tief wir sinken können, wenn unsere einzige Hoffnung uns getäuscht hat!
Durch die Marquise und Dufey in die damals glänzende hohe Gesellschaft eingeführt, verlebte Armand seine Tage in unaufhörlichen Zerstreuungen. »Ich muß bekannt werden,« sprach er oft zu mir, wenn er aus einem oder dem andern Salon ermüdet heimkehrte; »wie unangenehm auch diese Lebensweise ist, ich kann doch nur durch sie Einfluß zu erlangen hoffen; durch das Volk kann ich mich nicht aus dem Staube erheben, ich muß daher Protection suchen, und wenn es durch Verdienste nicht möglich ist, so muß ich Fehler heucheln, um einen Wirkungskreis zu erlangen; aber einen Wirkungskreis muß ich gewinnen, sonst kann ich nicht leben.« – Und Tag um Tag verging, und Woche um Woche, und sein Leben wurde immer zerstreuter, sein Herz immer trauriger.
Es gab Augenblicke, wo in seinem ganzen Wesen ein unbeschreiblicher Kummer ausgedrückt war; dann saß er schweigend neben mir und starrte in Gedanken vertieft durch's Fenster, und wenn ich ihn ansprach und er mich anblickte, sah ich zuweilen einen schweren Tropfen in seinem dunklen Auge zittern. Wie sehr er auch seine Empfindungen verbarg, und, aus seinen Träumereien erweckt, von seinen gestrigen Unterhaltungen zu sprechen anfing, so konnten seine heiteren Worte doch nicht die tiefe Bewegung verbergen, welche seine Stimme vibriren machte; und wenn er zuweilen lächelnd von den Lächerlichkeiten seines Gesellschaftskreises sprach, so strafte dieses Lächeln selbst die Heiterkeit Lügen, die er heuchelte.
»Du bist nicht zufrieden!« sprach ich einmal, indem ich seine stumme Traurigkeit nicht mehr sehen, dieses standhafte Schweigen nicht mehr ertragen konnte, mit welchem er vor mir, seinem treuesten Freunde, seine Empfindungen zu verbergen strebte.
»Zufrieden!« sprach er, einen traurigen Blick auf mich werfend; »und wer ist denn mit seinem Schicksal zufrieden? Die Zufriedenheit ist eines der Wörter, welche für Kinder und Alberne im Wörterbuch stehen, und unanwendbar werden, sobald wir uns im Leben ein wenig umgesehen haben. Das Glück ist ein Kindertraum, und wenn dieser einmal geschwunden ist, so gibt es im Leben nichts, was ihn uns vergessen macht, oder dem Leben so viel Genuß bietet, daß wir auf unsere Hoffnungen zurückblickend, zufrieden sein könnten; glücklich ist Derjenige, dem die Natur eine stärkere Brust zum Ertragen der Leiden gegeben, und ich gehöre zu diesen.«
»Das ist eine traurige Ansicht,« erwiderte ich, gerührt von seinen Worten; »die Wege des Lebens sind ohnedies schwierig genug, wie wirst Du fortkommen können, wenn Du auch noch die schwere Last dieser Ueberzeugung auf dem Herzen trägst?«
»Wie ich fortkommen werde?« unterbrach er mich mit traurigem Lächeln; »wie Du, mein Freund, wie Hunderte, wie Tausende, wie alle Diejenigen, deren Herz für andere Freuden schlug als diejenigen, welche auf dieser Erde gesunden werden. Aber bist Du denn glücklich? Du, der Du Dein ganzes Glück auf ein einziges Wesen setzest, zu dessen Zufriedenheit nichts weiter nothwendig ist, als daß ein einziges Herz wahr sei, siehst Du Dich, oder glaubst Du Dich nicht auch darin betrogen? Und haben sich nicht auch die Uebrigen getäuscht, die höhere Ziele anstrebten, und steht nicht am Ende eines jeden Lebens, am Grabe, die Ueberzeugung, daß wir nicht glücklich waren? – Endlich bleibt dem Unglücklichen immer ein Trost: die Ueberzeugung, daß er das Schicksal seines Geschlechtes trägt.«
»Und drückt nichts anderes Dein Herz?« sprach ich. »O leugne es nicht, ich kenne Dich seit Deiner Kindheit, und ich habe Dich stets mehr betrübt, als heiter gefunden; doch Dein jetziger Kummer ist nicht derselbe, welcher damals Deine Seele drückte und den Du auch jetzt vor mir heucheln möchtest. Dich drückt die Last einer großen, neuen Sorge, und warum verhehlst Du mir es? Stehen unsere Herzen einander schon so fern, daß wir unsere Gefühle nicht mehr theilen könnten?«
Er blickte mich gerührt an, und mir die Hand drückend, schwieg er eine Weile. »Lassen wir das, mein Freund,« sprach er endlich, »ich kenne Dein Herz, ich liebe Dich wie immer; aber es gibt Schmerzen und Sorgen, die man eben von dem Freunde nicht aufdecken darf; laß' mich schweigen.«
Was ich früher nur geahnt hatte, wurde mir jetzt durch seine Worte klar, und Du kannst Dir vorstellen, wie ich ihn bat, er möge mir seinen Kummer mittheilen. Ich war in dem Alter, wo man noch nichts sehnlicher wünscht, als die Gelegenheit, sich aufzuopfern, und wo man, fühlend, daß man zu Allem bereit sei, sich auch zu Allem für fähig hält. Armand schien gerührt, aber er schwieg. »Es ist vergebens, mein Freund,« sagte er endlich mit zitternder Stimme, »Deine Liebe kann meinen Augen Freudenthränen erpressen, doch den Kummer, welcher dieses Herz erfüllt, vermag sie nicht zu heilen. Nicht die großen Leiden des Lebens, nicht die Dolchstiche, durch welche das Herz in einer Stunde verblutet, drücken die Seele am schwersten; nicht das schmerzt am meisten, daß unser Erdenwallen über so viele Gräber führt, daß wir kaum fortkommen. Den großen Schmerzen hat das Geschick Thränen gegeben und Kraft zum Widerstande, oder Schwäche, damit das Herz breche, wenn die Leiden zu groß werden. Aber den kleinen Leiden, jenen zahllosen Nadelstichen, mit welchen die Gesellschaft uns verfolgt, jenen kleinen Verlusten, von welchen uns nicht einmal die Erinnerung bleibt, und durch welche wir die Freuden des Lebens pfennigweise verlieren, ohne durch Jemand bedauert zu werden, diesen vermag Niemand zu widerstehen; und eine wie starke Seele uns auch Gott verliehen, wie sehr auch das Schicksal unser Herz gestählt habe, die unaufhörlich fallenden Tropfen höhlen zuletzt doch den Stein aus, von welchem eine Gewehrkugel abprallen würde.«
»Und gedenkst Du nicht mehr unserer Kindheit, wo es keine noch so kleine Sorge gab, die wir einander nicht mitgetheilt, für die wir in unserer Freundschaft nicht Trost gefunden hätten – wo unser Leben der gemeinschaftliche Besitz unserer Herzen war, deren Leiden wir mitsammen trugen, wo selbst unsere Beschwerden eine süße Erinnerung zurückließen, weil sie uns an den Freund gemahnten, in dem wir Trost gefunden?«
»O, warum erinnerst Du mich daran?« sprach Armand schmerzvoll; »bringe Alles vor, was dieses Herz mit Bitterkeit erfüllen kann, überhäufe mich mit Vorwürfen, nur diese eine Erinnerung rufe in meiner Seele nicht wach, ich ertrage ihre Schönheit nicht. O glückliche Zeit, wo wir noch einen Freund finden, weil wir selbst noch Freunde sein können – wo das Herz, noch auf dem Meere des Lebens schwimmend, sich an Alles klammert, um einen Halt zu finden – wo unser ganzes Wesen noch aus Thränen besteht, und dennoch, wie Morgengewölke, von Sonnenstrahlen erfüllt ist – wo das Herz noch gesund ist, wie Gott es geschaffen hat, und wo, wie bei der aus den Händen des Künstlers gekommenen Uhr in den ersten Tagen kein Aufziehen und keine Verbesserung nöthig ist, damit sie richtig gehe. O reizendes Alter! Wer kann von deinen glücklichen Jahren auch nur einen Tag zurückbringen? Mit der Zeit verwirklichen sich vielleicht die stolzesten Träume des Herzens; nur daß wir einst so reizend träumen konnten, nur daß das Herz, welches leer steht, nachdem wir damit so viele Gegenstände erfaßt, einst mit so wenig glücklich sein konnte, nur das scheint ein Traum, ein wunderbarer, unglaublicher Traum. O sprich nicht von unseren damaligen Leiden! Was sind die Leiden eines Knaben? Seine Thränen perlen, wie der Thau an unverschlossenen Knospen an seinem Herzen herab, und wenn wir es gebeugt sehen, so hat seine Fülle, nicht sein Leiden es niedergedrückt. Was waren meine Leiden, als ich meinen Schmerz noch mit Dir theilen konnte, und, von Dir verstanden, an Deiner treuen Brust mich ausweinen konnte und Trost fand!«
»Und warum solltest Du Deinen Schmerz nicht jetzt mit mir theilen können?« fragte ich traurig.
»Jetzt,« sprach er bitter lächelnd, »haben die Zeiten sich geändert; damals waren wir Kinder und standen Beide allein; unter der strengen Disciplin eines und desselben Erziehungs-Institutes trugen wir in gleichem Maße dieselben Fesseln; unter gleichem Druck leidend, von gleichem Haß erfüllt, waren wir innerhalb der Grenzen unseres kleinen Kreises gleich. Wenn in unserem Garten eine Blume sich erschloß und Du mich riefst, um mir sie zu zeigen, so konnte ich mich mit Dir freuen; die Blume gehörte eben so wenig Dir, wie mir. Wenn die unverdienten Beleidigungen unserer Erzieher mein Herz mit Bitterkeit erfüllten, so konnte ich Dir es sagen, denn auch Dich hatte schon ein solcher Kummer betroffen, und ich wußte wohl, daß ich nach einigen Tagen, vielleicht nach einigen Stunden in einem gleichen Falle Dein Tröster sein könne. Aber jetzt, mein Freund, sind die Kinder erwachsen und der Traum der Gleichheit ist verschwunden, und wenn ich auch mein Herz vor Dir ausschüttete, so würdest Du mich dennoch nicht mehr verstehen. Oder was würdest Du sagen, wenn ich Dir antwortete, es thue meinem Herzen weh, daß ich arm bin, daß mein Rock abgetragen ist, daß ich genöthigt bin, zu Fuß zu gehen, und bei jedem Schritt fürchten muß, es werde mich ein Wagen mit Koth bespritzen; es thue mir weh, daß mein Name unbekannt ist, während der Eurige mit stolzen Titeln prangt; daß ich unter Euch der Letzte sei, und daß ich lügen und heucheln muß, denn wenn Jemand meine Umstände ahnte, so wäre in diesen glänzenden Salons kein Einziger, der mich nicht verachten würde! Was würdest Du sagen, wenn ich Dir antwortete, daß mein Herz die Qualen des Neides erduldet? Du würdest mich verachten und höchstens sagen, daß Reichthum nicht glücklich macht. Ich glaube es, auf dieser Erde kann man keine Glückseligkeit finden. Das Glück ist eine Sonne, die in ewiger Ferne über uns strahlt und was diese Erde mit Licht erfüllt und mit seiner Wärme, die wenigen Blüthen sprossen macht, ist nur die Hoffnung, der segensreiche Strahl des fernen Glanzes. Aber wenn sich auch der Adler nicht zur Sonne erheben kann, ist es zu verwundern, daß der Wurm, der im Staube kriecht, auf den Vogel des Himmels mit Neid blickt und wäre es auch nur deshalb, weil jener die Erde unter sich sehen kann und nicht fürchten muß, mit Füßen getreten zu werden? Und ist es zu verwundern, wenn der Arme mit Neid auf Euch blickt, die Ihr zwar nicht glücklich seid, aber um so viel höher steht als er? Doch die Welt ist schön und das Leben bietet auch zuweilen dem Armen Genuß, so sprecht Ihr, wenn Ihr Euch nach Euren sardanapalischen Festen zuweilen der Natur, wie einer neuen Unterhaltung zuwendet und, Eure Blicke an den grünen Saaten werdend, vergeht, unter wie viel Thränen und Schweiß diese Aehren aufwuchsen. Die Raupe gibt Antwort auf Euer kaltes Raisonnement; wenn die Fluren rings um sie am süßesten duften und die Erde am reizendsten ist, spinnt sie sich ein und webt fleißig selbst ihr Grab; sie will einst als Schmetterling auferstehen, unbekümmert um die Reize dieser Erde, auf welchen sie nur kriechen kann. Und wenn ich nicht dulden will, wogegen sich selbst die Raupe sträubt; wenn ich wie die Lazzaroni's an der Sonne keine Freude finden kann, die mit ihren glänzenden Strahlen nur mein Elend in ein helles Licht setzt; wenn der Mond, der wie ein großer Thaler am Himmel strahlt, als ob der liebe Gott damit den Armen den schwer erworbenen Taglohn auszahlen wollte, diese Seele nicht in Ruhe lullt; wenn auch ich leben will, wenn meine Sinne Genuß wollen, meine Kraft Macht verlangt: wirst Du, der Reiche, der Du diese Qualen nicht fühlst, nicht fühlen kannst, Mitgefühl haben, oder wenn dem auch so wäre, kann ich glauben, daß Du mich trösten wirst?«
»O, glaube es nicht, der Arme hat keinen Trost auf dieser Erde, seine Leiden sind nicht so poetisch, daß wohlerzogene Menschen sich lange damit beschäftigen könnten; die übelriechenden, schmutzigen Lumpen erregen in Euch Ekel, und abgewendet werft Ihr Euer Almosen hin, damit die bleichen Gesichter nicht wie ein Vorwurf zwischen Euch und der Freude stehen. Aber die Armuth hat auch solche Schmerzen, welche Euer Geld nicht zu heilen vermag, es gibt zwischen Euch und den Hungers Sterbenden Stufen, auf welchen zu stehen vielleicht eben so peinlich ist, wie zu hungern, Wunden, die vielleicht noch mehr schmerzen, weil der Leidende, indem er die blutende Stelle verhüllen will, schweigen muß.«
»Dem Himmel sei Dank!« fiel ich ein, »wenn nichts Anderes Dich drückt; dem Allen können wir leicht abhelfen. Du kennst ja meine Umstände.«
»Und ich kann betteln,« unterbrach mich Armand bitter, »nicht wahr? Du hältst mir Deine Börse offen und ich nehme daraus, was ich brauche, und Alles ist gut. Glaubst Du also, daß ich dies thun werde? Denkst Du, wenn ich das thäte, und Du, was ich gern glaube, Deine Wohlthaten auch edelmüthig vergäßest, es würde mich nicht unaufhörlich das erniedrigende Bewußtsein schmerzen, daß ich ein Bettler bin, ein niedriger Sclave, der von seiner Schmach lebt und der keine andere Tugend mehr haben kann, als seine Treue, mit welcher der Hund an seinem Wohlthäter hängt? Nein,« sprach er nach kurzem Schweigen, »denke nicht so von mir; Deine Freundschaft ist mir zu theuer, als daß ich mein Recht aus Dein Herz für Gold verkaufen möchte; und wenn vielleicht bessere Tage kommen werden und ich das Ziel, nach welchem ich ringe, erreiche, so wird es meine größte Wonne sein, daß ich Alles mir selbst verdanke.« – Er stand auf, drückte mir die Hand und ging fort.
Ich habe das ganze Gespräch niedergeschrieben, damit Du den Charakter Armand's und die Gründe von Allem, was später geschah, leichter begreifest. Es ist das ein trauriges Bild aus den alltäglichen Geschichten unseres Jahrhunderts; aber etwas je Gewöhnlicheres es ist, desto nothwendiger ist es, daß es ganz gekannt werde, damit Du sehest, wie rein die Quelle ist, aus welcher der Strom entsprang, wie er sinken mußte, um fortkommen zu können, und seine spätere Trübung nicht ganz ihm selbst, sondern seiner unglücklichen Lage zuschreibest.
Das Unglück der Menschen liegt nicht so sehr in der Welt und ihren Umständen, wie in dem natürlichen Triebe, welchem zufolge Jeder, seinen Kreis verachtend und darüber hinausstrebend, so zu sagen sich selbst zu tantalischen Qualen verurtheilt. Es gibt keinen Kreis, in welchem nicht die schönsten Eigenschaften der Seele Beschäftigung fänden; die höchsten Tugenden, welche die Geschichte preist, können zur Beglückung eines häuslichen Kreises verwendet werden, und wer dies klar einsieht und darnach handelt, der kann glücklich sein. Das Unglück ist nichts als der Unterschied, welcher zwischen unseren Wünschen und der Wirklichkeit besteht, und wenn es in unserer Zeit mehr Unglückliche gibt als je, seitdem die Welt steht, so liegt der Grund hiervon gewiß zumeist darin, daß dieser Unterschied niemals größer war, als gerade heutzutage. Das Mittelalter mit seinen strengen ständischen Unterschieden schrieb den Hoffnungen der Einzelnen einen engen Kreis vor: der Unterthan wußte, daß er seinem Herrn mit seiner Person verpflichtet sei, daß sein Leben im Gesichtskreis des Dorfkirchthurms dahinfließen werde; der Bürger konnte über einen gewissen Grad des Wohlstandes oder über eine ständische Würde vernünftigerweise nicht hinausstreben; und wenn es Leute gab, welche hochfliegendes Streben nicht ruhen ließ, so traf diese unglückliche Unzufriedenheit höchstens die Adeligen, jene kleine Volksclasse, die, über Allen stehend, in ihrer unbeschränkten Freiheit Alles hoffen konnte und dem Mittelalter gewissermaßen als Ferment diente. Doch wie anders stehen die Dinge jetzt, besonders hier in Frankreich. Jeder Franzose ist frei und gleich, so spricht dieses Gesetz; und wer, vorzüglich wer noch jung ist, möchte glauben, daß dieses Gesetz, um dessen Durchführung die Nation ein halbes Jahrhundert blutete, nichts weiter, als ein leeres Wort sei? Wer möchte seine Wünsche und Hoffnungen beschränken, welchen das Gesetz keine Schranken setzt? Der junge Franzose tritt voll hoher Wünsche in das Leben und träumt – so wie unter Napoleon der gemeine Soldat den Marschallstab im Tornister trug – schon bei seinen Schulbüchern von einem Minister-Portefeuille. – Aber was ist die Folge hiervon? Sobald er in's Leben eintritt, tritt ihm die Wirklichkeit kalt entgegen und er kann keinen Schritt vorwärts thun, ohne seine Hoffnungen allmälig zusammenschrumpfen zu sehen, bis sie endlich wie die Berge vor den Blicken des sich entfernenden Wanderers verschwinden und das Leben sich zu einer endlosen Ebene verflacht. Der Mensch kann nicht, wie Gott aus Nichts etwas schaffen; wenn er auch das schöpferische Wort ausgesprochen hat, so entsteht seine Welt doch nur langsam, und die wir schon vor einem halben Jahrhundert das Licht triumphirend verkündigten, wir wandeln heute noch im Halbdunkel; und wenn auch das mittelalterliche Chaos sich aufzulösen beginnt, so sind wir doch noch weit von jener neuen Ordnung entfernt, die neuen Blüthen Bestand geben könnte. Was Wunder also, wenn unsere Jünglinge nicht zufrieden sind, wenn sie, in glänzenden Träumen erzogen, die Wirklichkeit nicht zu ertragen vermögen, und im Kampfe mit ihrem Schicksal auf Abwege gerathend, endlich in ihrer Erbitterung allem Guten und Edlen entsagen, weil sie das Eine, was sie für das Beste und Edelste hielten, nicht erreichen konnten; was Wunder, wenn Diejenigen, die von Kindheit auf von Freiheit träumten und ihre Seele mit den Erinnerungen der großen Revolution nährten, von der Menschheit getäuscht, endlich von ihrer eigenen Erhebung zu träumen anfangen? Die Ideen der Freiheit und Herrschaft liegen nahe neben einander, und wenn wir auf den Trümmern fast aller Revolutionen Tyrannen sich erheben sehen, so ist das der Grund hiervon, dass, nachdem das Volk in seinen Aufregungen ermüdete, Einzelne immer standhaft blieben und ihre Wünsche beibehielten; die Herrschaft ist nichts Anderes, als jener höchste Grad von Freiheit, in welchem wir nicht allein über unsere eigene Kraft, sondern auch über die Kräfte Anderer verfügen können, und dem Cäsar steht Niemand näher als Brutus, der ihn ermordete.
Aber wenn unser Zeitalter dadurch, daß es Wünsche erweckt, die es nicht befriedigen kann, zahllose Menschen unglücklich macht – und wenn es dadurch, daß es den Kreis der Möglichkeiten im Bereich der Hoffnungen so sehr ausdehnt, große Schmerzen verursacht! so wirkt der Umstand noch gemeinschädlicher, daß es, die Religion aufgebend, die Reihe der Möglichkeiten in der moralischen Welt eben so sehr ausdehnt, und die Menschen, in welchen es große Wünsche erweckte, zugleich von allem Zwang befreite, welchen Sittlichkeit und edlere Grundsätze ihnen auferlegen könnten. Der Werthmesser jeder Handlung ist der Erfolg: unser Zeitalter bewundert Alles, was großartig ist; es verbeugt sich vor dem Fürsten, der zehnmal den Eid gebrochen, es preist die Blutmenschen, erhebt den großen Imperator in den Himmel, als ob der Umstand, daß Jemand ein großes Andenken zurückließ, nicht eben so gut eine Schmach, wie ein Ruhm sein könnte, wie denn bei manchen asiatischen Völkern jeder Vorübergehende auf das Grab des Meineidigen einen Stein wirft, damit die Schandsäule von Jahr zu Jahr größer werde. In einer Zeit, wo man Alles hoffen und zur Erreichung der Hoffnungen Alles thun darf, bedarf es großer Tugenden, wenn leidenschaftliche Menschen nicht verdorben werden sollen. Und wenn ich Armand's Handlungen mit der Geschichte seines Vorlebens vergleiche, so gibt es Niemanden, dem ich mehr zu verzeihen geneigt bin, obwohl Niemand grausamer, als er, mein Herz verletzt hat.
O Erinnerungen meiner ersten Liebe, wohin seid ihr geschwunden? Wie ein Mensch, der, nach langen Träumen erwachend, fühlt, daß sein Herz vor Freude gepocht habe und auf seinem Kissen die Spur seiner feuchten Thränen sieht, aber sich die einzelnen Bilder nicht zurückrufen kann, die in ihm freudige oder schmerzliche Empfindungen erweckten: so fühle auch ich, daß ich glücklich und unglücklich war; aber wie und wodurch, wer könnte das klar wiedergeben? Wenn die Sonne am Himmel steht, unsern Horizont Licht erfüllt, die blumendurchwirkte Ebene in glänzenden Farben sich vor uns ausdehnt und so weit das Auge sieht, ringsherum nichts als Blüthe zu finden ist; oder wenn den Wanderer sein Weg auch manchmal durch einen dunklen Wald führt und er sieht, daß in dieser strahlend erscheinenden Welt dennoch jeder Baum, ja jede duftende Blume ihren Schatten hat – wenn er sieht, daß die geringste Wolke, die über seinen Himmel zieht, auf seinen Feldern eine dunkle Spur zurückläßt: so hebt selbst dieses Dunkel die Schönheit des Ganzen nur um so mehr hervor und scheint gewissermaßen nur dazu geschaffen, daß das Auge vom Glanz, der Kopf von den glühend herabsengenden Strahlen ausruhen könne. Und so ist das Leben des Jünglings, schön und beglückend, wo die Liebe als Sonne seinen Gesichtskreis durchdringt, und wieder schön und beglückend, wo sie dunkle Schatten auf seine Wege streut; aber wer könnte ihre einzelnen Schönheiten beschreiben? Sie strahlte und ist verschwunden; und wenn später an unserem dunklen Himmel jene Gegend, in welcher sie unterging, heller erscheint, und wir rings um uns Thau erblicken, so fühlen wir, daß wir nicht durchaus nur geträumt haben, und daß, was unsere Seele einst als ein großer Segen erfüllte, doch nicht ganz unter dem zerstörenden Einfluß der Zeit verschwinden konnte, gleichwie in der Kirche auch noch nach dem Gottesdienst die Weihrauchwolken, wie ein Segen unter dem Gewölbe schweben.
Ich werde Dich nicht mit der Schilderung einzelner Vorgänge meiner Liebesgeschichte behelligen; wie schön auch die Rose sei, so kann doch Niemand aus ihren zerpflückten Blättern ihre Schönheit entnehmen, und wenn das einzelne Blatt auch nicht ganz seinen Duft verloren hat, so vermag sich doch nur Der desselben zu erfreuen, der die Blume gekannt hat und durch den Rest von Duft an schönere Tage erinnert wird. Es genüge, wenn ich Dir sage, daß ich Julie von Tag zu Tag inniger liebte. Seitdem wir nicht mehr in die Abendgesellschaften der Marquise kamen und ich Dufey nur selten, mit Julien aber nie sah, verschwanden meine Zweifel immer mehr. Ich liebte zu leidenschaftlich, um glauben zu können, daß man im Stande sei, das Gefühl so geschickt zu verbergen; und als ich mehrmals das Gespräch auf Dufey lenkte, sah ich Julie ihren ruhigen Gleichmuth bewahren, und weder Lob, noch die Herabsetzung, mit welcher ihr Vater zuweilen von ihm sprach, machte sie erröthen; ich war überzeugt, daß ich mich getäuscht habe, und gab mich immer reizenderen Hoffnungen hin.
Im Faubourg hatten nach der Juli-Revolution alle geselligen Freuden aufgehört, und die Familien beschränkten sich, als ob sie ihre Schuldigkeit gegen ihren König, dessen Sturz sie größtentheils selbst verursacht, wenigstens trauernd abtragen wollten, ausschließlich auf ihre häuslichen Kreise. So konnte auch ich die Illusionen meiner Liebe in glücklicher Ruhe genießen, und ich war um so glücklicher, da mein Kreis Alles umfaßte, was ich liebte. Seit einiger Zeit gehörte nämlich auch Armand zu diesem Kreise. Da Juliens Vater seine Memoiren schrieb und zu dieser Arbeit einen Gehilfen suchte, so nahm er Armand auf meine Empfehlung als Secretär auf, und so konnte ich meinen Freund, wenn auch nicht in einer glänzenden, doch in einer solchen Lage sehen, in welcher er frei von Geldnoth und, einige Stunden täglich ausgenommen, unabhängig und ruhig die Erfüllung der glänzenden Versprechungen abwarten konnte, welche Dufey ihm gemacht hatte. – Du kannst Dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war.
Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die Freuden des ruhigen Familienlebens besser zu genießen fähig wäre, als ich; vielleicht weil der freundliche Einfluß meiner Mutter in meiner Kindheit mein Herz zeitlich für diesen Genuß vorbereitet hat – vielleicht auch, weil ich von meinem achten Jahre angefangen, fern vom väterlichen Hause, diese Freuden kaum aber höchstens auf Augenblicke hatte genießen lernen; genug an dem, daß es stets mein heißester Wunsch gewesen, in einem ruhigen, häuslichen Kreise zu leben, und daß ich, auf meine Vergangenheit zurückblickend, keine schönere Erinnerung finde, als jene Tage, die ich mitten in dem geräuschvollen Paris in dem stillen Kreise Juliens und ihres Vaters verlebte.
Den Morgen brachte ich gewöhnlich bei meinen Büchern oder in der Galerie des Louvre zu; der Greis arbeitete mit Armand, Julie war bei der Valmont oder bei einer andern Freundin, wohin ich ihr nur selten folgen durfte. Aber sobald es Abend ward und die ersten Lampen angezündet wurden, eilte ich in die alterthümlichen Salons, und kein Kind kann sich am Weihnachtsabend mehr über die Kerzen freuen, welche seine Geschenke beleuchten, als ich mich freute, wenn ich vorfahrend, die Fenster erleuchtet sah. Da saßen wir in glücklicher Ruhe vor dem großen Kamin, und während draußen das große Paris tobte, und die Menge, sich um Freuden oder Brot abmühend, rang, während von fernher schallende Trommelklänge zuweilen mit einer neuen Revolution zu drohen schienen: ruhte hier eine glückliche Familie am häuslichen Herd. Und so wie im Winter der warme Kamin desto angenehmer ist, je wildere Stürme die Fenster erklirren machen; wie mitten in der Wüste die Oase nach den ungeheueren Sandstrecken um so grüner erscheint: so schien dieser Kreis mitten in der lärmenden Stadt auch uns wärmer und reizender. Zuweilen, wenn ein oder der andere Bekannte den greisen Herrn des Hauses besuchte und sie mit einander von vergangenen besseren Zeiten sprachen, von der Undankbarkeit des Volkes, und wie Tag um Tag dahinschwindet, ohne daß das weiße Banner von den Thürmen der Notredame-Kirche weht, zog sich seine Stirn in Falten, und auch Armand, der des langen Hoffens müde zu werden begann, brach manchmal in bittere Klagen aus; aber die Einwirkungen des häuslichen Kreises sind stärker, als die der Welt, und wer in seinem Hause glücklich ist, den können politische Sorgen auf die Dauer nicht unglücklich machen. Und so wurde auch unser guter Alter, und selbst Armand, bald wieder heiter; es kostete meiner Julie nur ein Wort, und neue Hoffnung erfüllte jede Brust. »Du bist glücklich,« sprach Armand in solchen Momenten zu mir; »wen kein Ehrgeiz aus dem Glück seines kleinen Kreises reißt, wer unter den Menschen nur als Mensch leben will und frei sein kann, weil er nicht gebieten will: der ist schon an und für sich glücklich, wenn er auch nicht, wie Du, einen Engel besäße, der diese Erde durch seine Gegenwart in ein Paradies umwandelt; aber endlich werde auch ich glücklich sein, wenn auch nicht in dem Maße wie Du, so doch wenigstens in meiner Weise; der Bogen muß sich krümmen, um Kraft zu gewinnen, und so muß auch ich mich krümmen; doch je schwerer er sich krümmt, mit desto größerer Gewalt schnellt er die Pfeile ab, und diese Hoffnung hält meine Seele aufrecht. Mein Leben meinem Vaterlande, der Menschheit zu opfern, das war die schönste Hoffnung meiner Kindheit, und das ist auch jetzt meine einzige Hoffnung, nachdem die übrigen alle dahingeschwunden sind. Meine Geburt hat mir diese Hoffnung versagt, das Zeitalter, in welchem ich lebe, die Verderbtheit meiner Nation, meine Armuth, kurz, Alles ist meinen Wünschen hinderlich; ich muß daher mit meinem Schicksal kämpfen, gleich einer Schlingpflanze am Boden kriechen, bis ich auch an einem höheren Stamm hinaufranken kann; doch einmal gelange ich hinauf, und habe keine Furcht – wenn Du mich auf dem Gipfel siehst, so werde ich gleich dem Wanderer, der im Erklettern eines hohen Berges seine Kleider beschmutzte, mich oben reinigen.«
So verging der Winter.
Ich kenne keinen traurigeren Anblick, als eine Stadt im Frühling. Wenn die ersten warmen Tage das Feld draußen in Grün gekleidet haben und aus jedem Strauch dem Wanderer freudiger Vogelfang entgegenschallt, so erinnert den Bewohner der Stadt nur der die Straßen erfüllende Koth, daß der Frost aufgethaut ist. Der Freudenlärm, welcher die Wintertage erheiterte, verhallt immer mehr, und während die Natur ihr Festgewand anlegt, fühlen sich die Menschen zwischen Häuserreihen, wie in einem Gefängniß und gehen trauriger herum. – Und wer fühlt sich nicht so? Der reine Himmel, der über den Dächern gesehen wird, hie und da ein einsamer Baum oder ein kleiner Garten, der zwischen Steinhaufen grünt, selbst das Gras, welches an minder betretenen Stellen zwischen den Pflastersteinen emporsprießt, als ob die Natur auf's Neue mit den Menschen kämpfen wollte und das ihr geraubte Eigenthum zurückverlangte – erfüllen das Herz mit Sehnsucht; und wie Epheu, der sich am Gitter eines Gefängnisses emporrankt, erwecken alle diese Naturschönheiten nur eine um so größere Sehnsucht. – Wohin? Hinaus in's Freie, wo Alles grünt, und die Bäume schöner blühen, und das Herz sich freier erhebt. Glücklich, wer – wenn ihm dieser Wunsch in Erfüllung geht – die gehoffte Freude noch finden kann.
Juliens Vater hatte nicht weit von Paris an dem Ufer der Seine ein Gut; obwohl es unter seinen Besitzungen eine der kleinsten war, so machten es doch die nahe Lage, noch mehr vielleicht einige Familien-Erinnerungen und hauptsächlich der Umstand, daß er hier seine Jugend verlebt hatte, dem Alten so lieb, daß er jeden Sonntag hier zubrachte. Hierher gingen wir auch jetzt, sobald die ersten angenehmeren Frühlingstage angebrochen waren. Und in der That, wer nur einmal dort gewesen und diese anmuthige Gegend in ihrem Frühlingsgewand gesehen hat, der wird die Vorliebe des alten Grafen begreifen, wenn er auch nicht weiß, daß im dortigen Walde Heinrich IV. einen Hirsch schoß, daß Ludwig XIV. zweimal im großen Saal des Schlosses dinirte, über welche Merkwürdigkeiten der Hausherr ihn ohnehin nicht lange in Unwissenheit lassen wird, wie überhaupt über nichts, was zu seinen Familien-Erinnerungen gehört und das Alter und den einstigen Glanz seines Namens beweist. In unserem Jahrhundert ist es lächerlich, ja kaum begreiflich, wie es Menschen geben kann, die, nachdem sie so viel Großes sich ereignen gesehen, noch Zeit finden, diese mittelalterlichen Kleinigkeiten aufzusuchen und mit Lust von den Heldenthaten ihrer Ahnen zu sprechen, während sie doch kaum einen Menschen finden, dessen Verwandte nicht bei Austerlitz, bei Jena oder in sonst einer blutigen Schlacht mitgefochten haben. Aber wer kann dafür, es ist viel leichter, ganze Menschenrassen als Vorurtheile zu vernichten; und diesem Umstand kann höchstens Das zur Entschuldigung dienen, daß er auch Tugenden weckte, und unserem Zeitalter, wenn auch nichts Anderes, wenigstens die Namen der edelsten Gefühle – wenn auch keine lebenden Beispiele, doch die Tradition der Tugenden zur Nachahmung verschaffte. Der alte Graf war die wahrhafte Personification seines Standes; er war stolz, jedoch wohlwollend, hochmüthig gegen Alle, die sich für Seinesgleichen hielten, und herablassend und freundlich, wo sein höherer Rang nicht in Zweifel kommen konnte; nachgiebig, ja schwankend in Allem, was von seiner Willkür abhing; unerschütterlich in den Vorurtheilen seines Standes, die er einmal als seine Religion angenommen hatte; kurz, ein Mensch, der bereit war, sein Vermögen zum Besten Anderer aufzuopfern, doch Niemandem verpflichtet sein mochte; der mit seinem Gärtner Stunden lang scherzte und sich mit dem letzten Bettler in ein Gespräch einließ, doch mit einem Reichen von neuem Adel nicht zusammenkommen wollte. Ein Mensch, der sein Vorhaben hundertmal im Tag zu ändern im Stande ist, nur um irgend Jemandem eine Freude zu bereiten, doch lieber sein Kind, seinen Freund, ja sich selbst aufopfert, ehe er etwas thut, wodurch auf sein Wappen ein Schimpf kommen könnte. Der Graf war einer der letzten Ueberreste jenes französischen Adels, welcher, wenn er seinen Untergang durch seine Verderbtheit verdiente, denselben gewiß am meisten durch seine guten Eigenschaften beschleunigte, und als er sich zum Volk herabließ, als er selbst die edelsten Grundsätze verkündigte, jene große Katastrophe herbeiführte, in welcher er zu Grunde gehen mußte.
Niemand bedarf mehr der Consequenz, als wer tyrannische Gewalt ausübt; sobald er einmal vergißt, daß, wer herrscht, nicht genießen kann – sobald er einmal der Stimme seines Herzens gehorcht und seine Macht nur zum Wohle Anderer benutzen will – sobald er einmal unter die Bande, durch welche er das Volk gefesselt hielt, auch die Dankbarkeit aufnahm: schwindet seine Stärke, die Kette wird sicher beim letzten Ringe reißen und er verliert seine Macht gerade in dem Augenblick, wo er vielleicht zum ersten Male verdiente, sie auszuüben. Daß der französische Adel durch seine lange Verbannung nichts gelernt und nichts vergessen hat, und in sein Vaterland zurückgekehrt, auf diesem schwankenden Boden sich neue Schlösser bauen zu können einbildete; daß er noch nicht einsah, in Gefahren bestehe die einzige Stärke des Schwachen in der Nachgiebigkeit, sowie Hartnäckigkeit die Hauptschwäche des Starken ist – das ist gewiß schmerzlich, aber nicht staunenswerth. Die Geschichte mag zu Allem gut sein, aber gewiß nicht dazu, um als Beispiel zu dienen; Niemand befolgt ihren Rath. Wenn der Sieger nach schweren Schlachten, von seinen Hoffnungen umschanzt, ohne Furcht ausruht; wenn der Edelmann, in sein Ahnenschloß zurückkehrend, wie Juliens Vater, vergißt, daß die Wände nur ausgebessert wurden und unter dem neuen Anstrich die Spuren ihres alten Verfalles an sich tragen; wenn er vergißt, daß sein Livréebedienter ein Mitglied des Volkes ist, welches ihn aus seinem Besitz verjagte, und daß mit der Kirchenglocke, die ihn jetzt zur Messe ruft, einst wieder Sturm geläutet werden wird, wer könnte es ihm übelnehmen? Die Täuschung ist zu schön, als daß er ihr widerstehen könnte, und wenn über seinem Haupte das Damoklesschwert schwebt, so ist es vielleicht besser, wenn er bei seinem Gastmahle berauscht sitzt – wenigstens ahnt er seine Gefahr nicht; es ist vielleicht besser, wenn er, die Spuren jeder unangenehmen Erinnerung sorgfältig verwischend und seine Erfahrungen vergessend, seine Träume, wenn auch auf noch so kurze Zeit, zu verwirklichen strebt. Dies that Juliens Vater auf seiner Besitzung.
Unter der Revolution hatte auch dieses Schloß gelitten, wie damals Alles, was an den verhaßten Feudalismus erinnerte, und besonders, was nahe bei Paris war; zum Glück hatte später die Municipalität darin ihren Sitz aufgeschlagen und einen Theil des Schlosses, sowie den Glockenthurm beinahe vollständig erhalten. Sobald der Graf aus dem Exil zurückkehrte, war die vollständige Wiederherstellung seines Wohnhauses eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, und nachdem er sich zwanzig Jahre geplagt und, keine Kosten scheuend, zuweilen wegen eines Steines oder Möbels, das zu seinem Hause paßte, weite Reisen gemacht hatte – stand das Haus wieder als ein Ganzes an seiner alten Stelle, und dem alterthümlichen Ansehen desselben hätte Niemand angemerkt, daß es je der Ausbesserung bedurft habe. Und wie das Aeußere, so war auch das Innere; die hohen dunklen Zimmer, der große Saal mit dem ungeheuren Kamin und dem Eichengetäfel, die Hirschgeweihe rings an den Wänden, und in der Mitte über dem Bildniß Heinrich's IV. das Geweihe des vom König selbst geschossenen Vierundzwanzigenders, welches der Vater des Grafen selbst vergraben hatte, damit es nicht in profane Hände gerathe, kurz, Alles besaß ein mittelalterliches Aussehen. An den Wänden der Zimmer des Grafen hingen in langen Reihen Familienbilder, gepanzerte Ritter, worunter einer mit dem Stabe des Connetable, dann Richter und Kanzler in schwarzen Kleidern mit goldenen Ketten, hie und da ein Würdenträger der Kirche, und zwischen ihnen die Ahnmütter der Familie mit verblaßten Gesichtern, bald farblose Blumen in den Händen haltend, bald als Hirtinnen gekleidet, mit erstorbenem Lächeln ein Lämmchen streichelnd, und alle so alt, daß selbst die Leinwand unter der Farbe zu zerfallen begann. Wer hätte es dem Grafen übelnehmen können, wenn er hier ein Aristokrat blieb – wenn er, auf den Jahrhunderte alten Erker hinausschauend – der Graf hatte den alten Theil des Hauses zu seiner Wohnung gewählt – und den grünen Rasen vor dem Hause sehend, nicht weit davon den hellen Spiegel der Seine, auf welcher seine Ahnen einst den Zoll erhoben, und jenseits des Flusses zwischen Wiesen und Feldern das Dorf mit der durch seine Ahnen erbauten Kirche, neben seinem Hause die Eiche, welche der Sage nach zum Andenken der Geburt eines seiner Ahnherrn vor einem halben Jahrtausend gepflanzt wurde und jetzt ihre Zweige schon bis zum Erker erstreckte – kurz, wenn er, immer und überall seine Ahnen vor sich sehend, zuweilen vergaß, daß ihre Zeit vorüber, und er sich wieder für einen eben so mächtigen Baron hielt, wie sie einst gewesen.
Julie und ich brachten die Zeit größtentheils im Freien zu. Der Frühling hatte eben seine schönste Entwicklung erreicht, die Wiesen standen im bunten Farbenschmuck der Blumen, die Obstbäume waren mit Blüthen, wie mit Schnee bedeckt, selbst die Eichen fingen endlich an, zu grünen. Auf allen Seiten Blumen, überall Freudenlärm vom Summen der Käfer und Bienen bis zum entzückenden Gesang der Lerchen, überall eine Fluth von Düften, ein heiterer Himmel und im Sonnenschein glänzende Wellen. O, auch diese Erde ist schön in den ersten Tagen ihres Erwachens, wenn sie wie das Kind in den ersten Stadien seiner Kraft noch keine Vergangenheit kennt und unter so vielen Blüthen noch keine einzige verwelkte aufzuweisen hat. Und wie glücklich war ich in jenen Tagen! Meine Zweifel waren verschwunden, Dufey sah ich Wochen lang nicht, und hier war nur dann von ihm die Rede, wenn Frau von Valmont auf Besuch kam. Julie war so freundlich gegen mich, so hold verwirrt, so oft ich von meiner Liebe sprach – warum sollte ich mich nicht geliebt glauben? Das Herz braucht nicht einmal so viel Wahrscheinlichkeit, um hoffen zu können, was es zu seinem Glück für nothwendig erachtet; das Herz glaubt an Wunder, wenn die Erfüllung seiner Wünsche anders nicht möglich scheint.
Es gab eine Stelle am Seine-Ufer, welche Julie besonders liebte. Es war ein Felsstück, bei Gott weiß welcher Erdumwälzung hierher geschleudert, vor welchem die Jäger ihr zu Liebe einen Moossitz bereitet hatten. Der Fluß, der hier viel schmaler ist, als bei Paris und seinen Weg zwischen Hügeln in allerlei Krümmungen fortsetzt, erscheint dem Auge von allen Seiten eingeschlossen, so daß man, von der hier fast unmerklichen Bewegung des Wassers getäuscht, einen See zu sehen glaubt, dessen Spiegel von dichten Waldungen bekränzt und von herabhängenden Zweigen dicht berührt ist, so daß dieselben bei jedem Windhauch auf der ruhigen Wasserfläche Wellenbewegungen hervorbringen. Eine besondere Stille herrscht in dieser Gegend, und obwohl ich viele Gegenden kenne, die mehr Schönheiten aufweisen, so habe ich doch nie eine solche gesehen, in der man süßer träumen könnte. Hier verbrachte ich mit meiner Julie ganze Stunden. Glaube nicht, daß wir von Liebe sprechen; wozu auch? Stand ja hier das Bild einer großen, unendlichen Liebe vor uns, der Fluß, in seinen stillen Busen das Bild des Himmels voll aufnehmend, und hell und glänzend blau, wenn über ihm ein heiterer Himmel lachte, trübe, wenn über ihn Wolken hinzogen, in zitterndem Glanze jeden Stern doppelt abspiegelnd; man hätte ihn für ein Stück Himmel halten mögen, so wenig zeigte er seine eigene Farbe, so schnell glättete er seine Wellen, die vielleicht ein hineingeworfener Stein oder ein Windhauch erregt hatte; als ob er nur dazu geschaffen wäre, um seinen Himmel wiederzuspiegeln und in keiner eigenen Bewegung zu erzittern. Und blüht nicht eine reizende Lehre der Liebe auf jedem Zweige? Eine Lehre von jener Liebe, welche diese Welt mit ihren warmen Strahlen durchdringt, und so wie die Sonne dem Baume Laub, dem Herzen Hoffnungen gibt, damit Diejenigen, die einst getrennt waren, im Glück einander berühren, wie die Zweige, wenn sie vom Laub bedeckt sind; und sang nicht jeder Vogel im Dickicht von Liebe, und pochte nicht mein Herz von Liebe? Wenn wir zuweilen dort saßen und der Abendwind weiße Blüthen auf den Fluß streute, so wußte ich, daß in unserer Nähe ein blühender Baum stand, und wenn ich Julie lächelnd und erröthen, von den Schönheiten der Natur gerührt, oder von einem geheimen Gefühle bewegt sah und den zarten Druck ihrer Hand fühlte, hätte ich nicht glauben sollen, daß mein Glück nahe sei?
Abends, wenn die letzten Strahlen der Sonne zwischen dem Laube zitterten und wir nach Hause gingen, führte unser Weg über einen Hügel, der, die ganze Gegend beherrschend, die reizendste Aussicht darbot; hier blieben wir stehen. Die untergehende Sonne hüllte die Landschaft in Purpur und blickte sanft zurück, wie eine Mutter, die, von ihren Kindern Abschied nehmend, zurückschaut und sich nicht trennen kann, und wenn sie endlich scheidet, ihren Segen zurückläßt. Und jetzt ging sie unter, während im Westen der Abendstern erglühte; und von dem Glanzpunkt, dessen Strahlen man kaum zu ertragen vermochte, verblieb die ganze Farbenpracht zurück, schwächer und sanfter, aber den Horizont in einem immer weiteren Umkreise in Glanz hüllend. O, wer könnte dies beschreiben! Ringsherum die erlöschenden Strahlen, die den Himmel erfüllen, und, gleichsam ein Echo des Lichtes, von jeder Wolke zurückgeworfen, endlich im fernen Aether erlöschen; die Lichtströme, welche das Abendroth durchdringen, dieses allmälige Erbleichen und Erlöschen, dieses allmälige Hinschwinden des Lichtes, dieses Leben im Ersterben, diese Veränderung in unbeweglicher Ruhe, dieses langsame Ebben der Farbenfluth. O, wer dies beschreiben könnte, oder wer, wie damals ich, die Abspiegelung dieses erhabenen Momentes im bewegten Gesichte seiner Geliebten sehen und ihr zu Füßen sinken könnte, wie ich, als ich vom Gefühl hingerissen, einmal sprach: »O, warum kann ich jetzt nicht sterben, das ganze Licht meiner Seele über Dich ausströmend; warum kann ich mich nicht in Deinem Busen begraben, wie diese Sonne, die hinter die Berge sinkt, so daß von mir nichts Anderes zurückbliebe, als ein helles Andenken, das am klaren Himmel Deiner Seele hinzieht, eine Thräne in Deinem Auge, wie der Thau nach dem Untergange der Sonne!« Ich fühlte das Zittern ihrer Hand, und als ich aufblickte, glänzte eine Thräne in ihrem Auge. O, wer hätte damals gedacht, daß dies keine Freudenthräne, sondern eine Thräne des Mitleids war?
So verging beinahe ein Monat in seliger Ruhe. Außer der Frau von Valmont kam kein Fremder in unser Haus, und auch sie selten und nur auf wenige Stunden. So waren wir denn nur durch Armand und Julie, welche einigemal in der Woche zum Besuch ihrer Freundinnen nach Paris ging, mit der Welt in Verbindung. Ich selbst blieb gewöhnlich zu Hause. Niemand kann an einem Ort so sehr hängen, wie ich; dieses dunkle Zimmer mit seinen kahlen Wänden, in welchem ich mich jetzt seit ein paar Monaten aufhalte, ist meinem ganzen Wesen schon so sehr zum Bedürfniß geworden, daß ich mich nicht mehr ohne Schmerz davon trennen könnte, und so war es immer. Mich hat die Natur für enge Kreise geschaffen, und so wie in meinem Herzen immer nur ein Gefühl Platz hatte, und ich, von einem Gegenstände erfüllt, nicht begreifen konnte, wie man außer diesem noch etwas lieben könne – so waren auch meine Gedanken von einem engen Kreise umschlossen, und wenn ich, an einzelne Gegenstände gewöhnt, meine Gedanken mit ihnen verflochten hatte, so wirkte jede Aenderung störend auf mein Gemüth. Wenn ich in einer Hirtenhütte geboren worden wäre, von der Welt nichts Anderes, als mein schmales Thal sähe, kein anderes Maß der Zeit kennte, als den Schatten eines Baumes, in meinem Leben kein anderes Ereigniß erfahren würde, als das Erscheinen des ersten Veilchens oder des ersten Schnees, so wäre ich glücklich; mir genügte eine einzige Aussicht für mein ganzes Leben. Ich hätte auch zwischen den Wänden einer Fabrik glücklich sein können, mich der Geschicklichkeit erfreuend, mit der ich meine Arbeit verrichten würde, der Abendglocke, die zur Ruhe mahnt, oder des kleinen Vermögens, das ich groschenweise zusammengelegt hätte; höchstens würde ich noch eines Nelkenstockes bedurft haben, um an dem Wachsen und Welken seiner Blumen ein Bild des menschlichen Lebens zu sehen. Ich hätte in der einen Blume die ganze Natur bewundert. Kein Kreis auf der Welt ist so beschränkt, so bescheiden, in welchem ich nicht glücklich sein könnte; ich brauchte nur enge Grenzen, damit meine Seele sie ganz erfüllen und auf ihrer Bahn nicht hin- und herirren könne. Wenn ich auf mein vergangenes Leben zurückblicke und sehe, wie sehr mein Herz jede Empfindung festhielt, wenn ich bedenke, wie viel es bedurfte, bis mein Glaube zum Wanken gebracht wurde, und wie vielen Erfahrungen zum Trotz ich mein kindliches Vertrauen bewahrte; wenn ich in mein Herz blicke und die Veränderung sehe, welche mein Klosterleben darin schon hervorgebracht hat; wenn ich die Ruhe empfinde, die mein Inneres so wunderbar erfüllt, und die herbeizuführen nur einige Monate nöthig waren: so überzeuge ich mich von Tag zu Tag mehr, daß ich, zum Glück geschaffen, nur deshalb nicht glücklich geworden bin, weil mein Geschick mich in einen zu großen Kreis gestellt hat. Es gibt schwache Naturen, die wie Leute mit einem gebrochenen Bein eines Verbandes bedürfen, um aufrecht stehen zu können, und ich gehöre zu diesen.
Ich war in meiner ländlichen Zurückgezogenheit zu glücklich, um Zerstreuungen zu suchen. Ein unglückliches Ereigniß jagte uns aus unserer Ruhe auf. Wir kamen eben von unserem Lieblingsplatz zurück; Armand war damals mit uns und schien so niedergeschlagen, daß wir in unserem Streben, ihn zu trösten, die Stunde versäumten, in welcher wir gewöhnlich heimzukehren pflegten. Es war beinahe ein halbes Jahr, seit er mit Dufey bekannt war und von ihm mit Versprechungen hingehalten wurde. Wir ermahnten ihn zur Geduld, aber er war ohnehin geduldig. Woche auf Woche, Monat auf Monat verfloß und er sagte nichts; aber jetzt hatte er sein Vertrauen und mit diesem die letzte Hoffnung verloren, die ihn an's Leben kettete. Oder sollte er sein ganzes Leben hindurch der Secretär eines großen Herrn bleiben, von jeder schlechten Laune abhängig, welche das Gemüth seines Herrn trübt? Oder soll er ein Diener sein, nachdem er von Freiheit geträumt hat, und nur leben, um, was er als Jüngling verachtet, als Mann zu erfahren? Lieber tausendmal sterben, als so fortleben, sagte er mehrmals, und kaum waren wir im Stande, ihn zu trösten. Julie sagte übrigens so viel von den Versprechungen der Frau von Valmont, und ich, der ich inzwischen mit Dufey bekannt geworden war und von ihm sein Ehrenwort erhalten hatte, daß er für Armand's Zukunft sorgen wolle, sprach so energisch meine Ueberzeugung aus, daß er endlich ruhig wurde und mit uns nach Hause ging, um wider seine Gewohnheit die Nacht auf dem Lande zuzubringen.
Der Tag war außerordentlich heiß; der Himmel überzog sich immer mehr mit Wolken, und als wir auf den Hügel gelangten, von wo das Haus zuerst sichtbar wurde, verkündeten schon ferner Donner und einzelne Regentropfen das nahende Gewitter. Im Hause schien eine ungewöhnliche Bewegung zu herrschen, die Lichter, die bald durch das eine, bald durch das andere Zimmer leuchteten und wieder verschwanden, im Hofe mehrere Lampen in wilder Unordnung hin- und herirrend, zeigten an, daß etwas Außerordentliches geschehen sein müsse. »Hier ist etwas vorgegangen!« sprach Julie mit zitternder Stimme und mir Alle, die wir durch die großartige, düstere Naturerscheinung auf traurigere Gedanken vorbereitet waren, verdoppelten schweigend unsere Schritte. In den großartigen Wundern der Natur ist etwas, was auf das menschliche Herz einen größeren Einfluß ausübt, als unsere stolze Philosophie eingestehen möchte, und es gibt keinen Menschen auf der Welt, dessen Brust, wie kühn und ungläubig er auch sei, nicht bewegt wird, wenn am Himmel die Stimme des Donners erdröhnt und die Erde vom Aechzen der sturmgeschüttelten Wälder erfüllt ist; sei es, daß er in diesen Tönen die Stimme eines höheren Wesens vernimmt und, das Gefühl seiner eigenen Winzigkeit nicht ertragen könnend, glaubt, die Natur habe den Himmel in Wolken gehüllt, weil er, der winzige Mensch, litt oder von Gefahren bedroht ist – oder sei es, daß er in der großartigen Erscheinung nur das Walten des blinden Zufalls sieht – es ist gleichviel: das Herz kann in solchen Augenblicken niemals ruhig bleiben.
Das Gewitter brach indessen aus, Blitze zuckten nieder, Donner auf Donner folgte, der Platzregen strömte brausend nieder. Als wir zur Pariser Straße gelangten, über welche wir unseren Weg nehmen mußten, jagte eine Kutsche an uns vorüber. »Das war unser Wagen,« rief Julie, »mein Gott, was ist vorgefallen?« Und wir gingen wieder weiter, oder liefen vielmehr auf unserem zu einem Bach gewordenen Wege, und gelangten so zum Hause.
Im Hofe kam uns der alte Gärtner entgegen, ein greiser Diener, der bereits vor der Revolution seinen Dienst hier angetreten hatte. »Was ist vorgefallen?« rief Julie, bleich vor Angst. – »Der Graf ist krank,« antwortete der Alte mit erstickter Stimme; »doch,« fügte er hinzu, als er Juliens Aufregung sah, »es wird nicht von Bedeutung sein; o, liebe Gräfin, erschrecken Sie nicht, es ist nur eine kleine Alteration, es ist nicht von Bedeutung.« Und dem guten Alten rann eine Thräne über die Wange. Julie flog zu ihrem Vater: das Zimmer war dunkel, nur eine Lampe stand auf dem Tisch, und auch diese war von Lichtschirmen umstellt. Der Graf lag auf seinem Bette, todtenblaß, mit geschlossenen Augen und kaum merklich athmend. Neben dem Bette betete der Pfarrer des Dorfes, zu Häupten des Kranken stand dessen Kammerdiener, der seinem Herrn den Schweiß von der Stirn wischte. Als wir eintraten, ging der Pfarrer Julien entgegen und sagte ihr leise: »Er lebt noch! Gott ist gut,« fuhr er ruhig fort, »vielleicht erhält er ihn am Leben; beten wir für ihn.« Und der greise Mann kniete neben Julien nieder, und wieder herrschte Stille im Zimmer, nur zuweilen durch das Murmeln des Betenden oder vom fernen Donner des sich verziehenden Gewitters unterbrochen.
Ich kann es nicht beschreiben, wie sehr die ganze Scene auf mich wirkte. Als ich das Haus vor einigen Stunden verließ, war der Alte noch gesund und heiter, wie er es hier auf dem Lande gewöhnlich zu sein pflegte; er ging mit uns in dem Garten herum und zeigte uns die Veränderungen, die er bereits vorgenommen hatte oder noch vorzunehmen im Begriffe war, und sprach so sicher von der Zukunft, als ob er noch auf ein halbes Jahrhundert zu rechnen hätte, und jetzt! – An seinem Fenster stand ein Rosenstock, welchen er gerade dieser Tage aus Paris bekommen hatte, eine ganz neue, erst vor Kurzem aus England eingeführte Art. Die Zweige waren voll Knospen und eine derselben hatte gerade diesen Morgen sich zu erschließen begonnen. Der Graf hatte sich schon auf den Abend gefreut, wo er die aufgegangene Knospe in ihrer Pracht zu sehen hoffte, und sieh', selbst diese kleine Hoffnung sollte ihm nicht in Erfüllung gehen. Jetzt stand die Blume mit vollem Kelch am Fenster, aber er konnte sie nicht mehr sehen. Und so ist das Leben des Menschen. Die Sonne, die sich am Horizont erhebt, wird vielleicht nicht ihre Bahn zurückgelegt haben, der Thau auf den Feldern vielleicht noch nicht vertrocknet sein – und er wird nicht mehr sein. Und wir setzen unsere Hoffnungen dennoch in die Ferne, und dennoch suchen wir für dieses winzige Leben einen ungeheuren Spielraum, und nicht wissend, ob uns auch nur ein einziger Tag zum Genießen bleibt, opfern wir den Hoffnungen einer ungewissen Zukunft täglich unsere gegenwärtigen Freuden. O Thorheit! Und wenn diese Zukunft herankommen wird, wenn die längst erwarteten Tage, welchen wir so viel geopfert haben, endlich da sein werden, werden wir dann besser genießen können als jetzt? Wird das Herz, dessen Liebe wir unterdrückten, wärmer fühlen, sobald wir ihm die Freiheit lassen? Wird unser arbeitsmüder Leib lebhaftere Sinne, unsere Seele höhere Gedanken haben, als jetzt, wo wir, ihren Schwung zurückhaltend, alle Kraft nur dazu verwendeten, um uns später Unabhängigkeit zu verschaffen? Und wird diese kurze Unabhängigkeit allein die langen Jahre ersetzen können, während welcher wir um sie gedient haben? O Thorheit! wie viele Spieler gewinnen auch nur ihren Einsatz zurück? Und wäre es für sie nicht besser gewesen, vom Spiel fern zu bleiben und zu genießen, was sie besaßen, als nach langer Mühe sich nur darüber zu freuen, daß sie nichts mehr als ihre Zeit verloren haben? – In solche Gedanken vertieft, stand ich am Fenster, bald auf den Himmel hinaussehend, wo die Wolken sich zu zerstreuen begannen, und während am Horizont noch Blitze die sich auflösenden Wolkenmassen durchzuckten, schon einzelne Sterne erschienen, bald auf das Bett des Kranken, wo Julie stand, in der ganzen Schönheit ihres Schmerzes, gleich einem Engel die letzten Augenblicke des Sterbenden bewachend. Und ist sie nicht ein Engel, dachte ich in mir, ein Engel, welchem der Himmel die Seligkeit genommen und dafür Thränen gegeben hat, damit er, unter den Menschen wandelnd, sich ihnen verwandt fühlen und sie in ihrer Liebe besser trösten könne?
Mitternacht war vorüber, als der Arzt aus Paris ankam. Er fand den Kranken besser, jedoch noch in der größten Gefahr; der Schlaganfall war, wie es schien, nicht tödtlich, jedoch mußte man einen neuen Anfall befürchten. Der Arzt ging zu Bette, den Kammerdiener und den Pfarrer schickte Julie selber fort, und wir blieben allein im Zimmer. Schweigend saßen wir am Bette einander gegenüber, und nur das Picken der Uhr unterbrach die Stille.
Endlich öffnete der Kranke die Augen, staunend blickte er um sich, als ob er aus einem schweren Traume erwachte und sich nicht zurechtfinden könnte. Julie neigte sich zu ihm und fragte ihn, was er befehle. »Nichts, liebe Tochter,« erwiderte der Alte mit schwacher Stimme, »aber es ist schön von Dir, daß Du bei mir geblieben bist, denn das thut mir wohl.« Und ein schwaches Lächeln flog über das Gesicht des Alten, als er seine Tochter erblickte und den warmen Kuß fühlte, welcher seine Hand erwärmte. – »Wie fühlen Sie sich, theurer Vater?« fragte ihn Julie wieder. – »Richtig, als ich Dich sah, vergaß ich beinahe, daß ich krank bin,« erwiderte der Alte unruhig; »aber wer weiß, ob ich nicht vielleicht nur noch wenige Augenblicke zu leben habe, und wir haben mit einander noch viel zu reden.« Julie wollte Worte des Trostes stammeln und fing anstatt dessen zu schluchzen an. »Weine nicht, meine Tochter,« sprach der Alte wieder; »wenn ich auch bewußtlos schien, so hörte ich doch Alles, was der Arzt sprach, und erschrak nicht; ich fürchte den Tod nicht – wenn Du nur glücklich bist, so bin ich zufrieden.« Er fragte nach mir. »Gut, daß Du hier bist,« sagte er, als er mich bemerkte; »ich wollte Dich eben rufen lassen, ich habe auch an Dich eine Bitte, die Du mir nicht abschlagen wirst.« Da ihm das Reden schwer fiel, so baten wir ihn, bis morgen nicht zu sprechen, und wir versprachen ihm im Voraus, jeden seiner Wünsche zu erfüllen.
»Morgen!« sprach der Alte traurig lächelnd, »und wer kann mir sagen, daß ich morgen noch lebe, ob ich diese Augen, wenn ich sie einmal zum Schlafe schließe, noch einmal werde öffnen können? Nein, meine Lieben, gleich muß ich sprechen, und wenn Ihr mir die Erfüllung meiner Bitte versprecht, so werde ich ruhiger sein.« – Er schwieg einen Augenblick; wir knieten an seinem Bette nieder, um seine immer schwächer werdende Stimme besser zu hören, und endlich sprach er: »Ich bin der letzte Sprößling meiner Familie, mein Wappen geht mit mir zu Grabe; mein Name, der ein Jahrtausend geglänzt hat, wird verklingen; nun, so sei es. Jahrelang betete ich zu Gott, er möge mir einen Sohn schenken; er erhörte nicht mein Flehen, und ich klage nicht. Aber daß er mir Dich geschenkt hat, meine geliebte Julie, daß er Dich an mein Sterbebett stellte, damit Deine liebe Hand, auf meinem schweren Kopf ruhend, mir noch auf Erden himmlische Ruhe verschaffe, dafür segne ich seine weise Fügung, durch welche er sich mir so gnädig erwies. Ich war und bin stolz auf Dich, mein Kind, wenn Du auch nicht meinen Namen führen kannst. Nur Eines that mir oft weh; daß ich Dich auf der Welt einsam zurücklassen werde; von Euch hängt es ab, meine Seele von diesem letzten Kummer zu befreien.«
Julie erblaßte und zitterte an allen Gliedern; mein Herz pochte gewaltig, als wollte es meine Brust zersprengen.
»Du liebst Julie,« sagte er zu mir gewendet, »obwohl Du es niemals sagtest; ich habe es längst und vielleicht früher geahnt, als Du selbst. Willst Du meine Tochter zum Weibe nehmen?«
Ich war außer mir vor Wonne; ich preßte seine Hand mit leidenschaftlichem Druck an meine Lippen und Thränen stürzten mir aus den Augen.
»Ich verstehe Dich,« fuhr der Alte fort; »jetzt werde ich ruhig sterben, denn Julie hat mir selber gesagt, daß sie Dich liebt. O, sprich es hier noch einmal aus, vor Deinem sterbenden Vater, sage Gustav, daß Du ihn liebst und die Seine wirst.« – Julie schwieg. – »O, warum wolltest Du das nicht offen aussprechen, warum aus falscher Bescheidenheit verschweigen, was Deinen Vater in seinen letzten Augenblicken glücklich macht? Es gab eine Zeit, wo dieses Wort mir gesagt wurde und ich dadurch unendlich glücklich war; und wenn ich es nun von Deinen Lippen hören werde, so wird Dein erröthendes Gesicht mir das Bild Deiner Mutter vorzaubern, und wenn ich mich in der letzten Stunde meines Lebens an den schönsten Augenblick desselben erinnere, so werde ich sicherer sein, daß ich die Beglückerin meiner Jugend wiedersehen werde.«
»O, mein Vater!« stammelte Julie und Thränen erstickten ihre Stimme.
»Weine nicht, meine Tochter,« sprach der Alte gerührt; »Du bist stets mein liebes, gutes Kind gewesen, und Dein ganzes Leben lang wird Dich der Gedanke beglücken, daß Du die letzten Augenblicke Deines Vaters versüßtest und seinem sterbenden Herzen gabst, was das Nöthigste ist, wenn wir von dieser Erde Abschied nehmen – Ruhe. Möge mein Segen Dich stets umschweben,« sprach er mit schwächer werdender Stimme, während er mit seinen zitternden Händen die Wangen seiner Tochter streichelte – »wirst Du Gustav's Gattin werden?«
»Ich werde es!« antwortete Julie leise.
»Gebt Euch die Hände,« sagte er, sich mit letzter Kraft im Bette aufrichtend; »so, meine Lieben, und jetzt schwöret hier am Bette eines Sterbenden einander ewige Treue.«
»Wir schwören,« sagten wir Beide, und der Alte sprach, seine Augen gegen Himmel erhebend: »Seid gesegnet auf dieser Welt!« und dann sank er bleich auf seine Kissen zurück.
Er hielt noch unsere Hände zwischen seinen kalten Fingern, als der Arzt wieder ins Zimmer trat.
Drei schwere Tage brachten wir am Bette des Kranken zu; die außerordentliche Aufregung, mit welcher er gesprochen, hatte die Kraft seiner Seele aufgezehrt; und wie das erlöschende Feuer, das angefacht noch einmal aufflammt, jedoch nur um so schneller zu erlöschen, so nahm vom Augenblick jener Aufregung seine Kraft ab. Der Arzt gab die Hoffnung auf, die Dienstleute gingen weinend und müßig herum, bald untereinander vom Zustande ihres Herrn sprechend, bald den Kammerdiener oder einen Andern, der aus dem Zimmer des Kranken kam, mit Fragen bestürmend; Alles sah traurig aus, das ganze Haus erfüllte nur ein Gedanke: der Tod.
Nur Einer war glücklich im Hause: ich. Das Glück hängt nicht von unseren Freuden ab, ja zuweilen steht es dem Schmerz näher. Sowie die Erde nie mehr Blumen trägt, als nachdem sie im Winterschlaf lange kahl gestanden, so wie der schönste Augenblick des Tages gerade der ist, welcher auf die Nacht folgt, so ist das Herz gerade dann voll der schönsten Empfindungen, strahlt es dann im hellsten Glanze, wenn es lange öde und finster gewesen. Es ist, als ob auch die Freude der Thränen bedürfte, wie die Sonne des Regens, um mit ihren Strahlen den Regenbogen aufbauen zu können. Wenn ich mein ganzes Leben überdenke, so erinnere ich mich an keine Tage, in welchen ich so glücklich gewesen wäre, wie in jenen, die ich am Krankenbette von Juliens Vater zubrachte. Glaube deshalb nicht, daß seine Leiden mein Herz unempfindlich gelassen haben; ich war zu jung, um über mein eigenes Glück fremde Leiden vergessen zu können, und ich hing, da ich fast meine ganze Zeit in seinem Hause zugebracht, an dem Alten mit aufrichtiger Neigung. Er besaß eben so gut die Fehler, wie die guten Eigenschaften seiner Zeit, und es mag Niemanden gegeben haben, der in politischen Dingen unmenschlichere Grundsätze gehabt hätte, als er; aber im häuslichen Kreise konnte Niemand freundlicher sein, als er, und selbst Armand konnte bei all' seiner principiellen Opposition diesen guten Eigenschaften nicht widerstehen, und oft gestand er, daß er zu ihm, den er hassen sollte, vielmehr Neigung fühle. Aber bei mir bedurfte es nicht erst dieser guten Eigenschaften; ich sah in dem Grafen meinen größten Wohlthäter und beklagte sein Leiden von ganzem Herzen. Und dennoch fühlte ich mich an seinem Bette glücklich, nicht allein, weil ich ihn pflegen konnte, sondern auch glücklich durch meine Liebe, glücklich durch die Nähe Juliens, deren Besitz auch die Leiden einer ganzen Welt hätte vergessen machen können. War ich nicht mit meiner Julie beisammen? Konnte ich mit ihr nicht ihre schweren Sorgen theilen? Fühlte ich nicht, weinte ich nicht, wie sie? Und wenn Du sie gesehen hättest, wie sie da saß mit thränenerfüllten Augen, im blassen Gesicht ihres Vaters dessen Empfindungen erspähend, jeden Wunsch des Schweigenden ahnend; wenn Du sie gesehen hättest, wenn sie dem Kranken Wasser oder Medicin reichte, oder wenn sie ihm die Kissen zurechtlegte, wenn Du gehört hättest, wie sie ihren kranken Vater tröstete, und sich selbst, wenn der Alte eingeschlummert war: wenn Du sie gehört hättest, wenn sie mit mir zum Fenster ging und von ihrem Vater sprach, und von den glücklichen Tagen, in welchen er noch gesund war, und wenn Du gesehen hättest, wie sie dann stundenlang jeden Athemzug des Kranken belauschte: Du würdest sie angebetet haben. Und wenn es endlich Nacht wurde und der Schlaf auch sie übermannte; wenn ihre müden Augen sich nach langem Kampf schlossen und, das schöne Haupt auf die Kissen des Kranken gestützt, dieser Engel vor mir ruhte, rings um mich das Dunkel des Zimmers und die unendliche Stille der Nacht, und alles Leben und alles Leiden, vom großen Schlaf, wie von einem Schleier verhüllt – war ich allein nur wach, fühlte ich allein mein Glück, konnte ich allein, auf meine Geliebte schauend; fühlen, daß es eine Wirklichkeit auf Erden gibt, die schöner ist, als unsere reizendsten Träume!
Wer eine Frau nicht im Innern ihres Hauses gesehen hat, der kennt nicht ihre Reize. Das ist der Kreis, welchen die Frau sich schafft, welchen sie mit ihren zarten Berührungen belebt und in welchem sie immer edler wird. Wie tief auch das Weib gesunken sei, gib ihm einen häuslichen Kreis, und Du wirst staunen, was aus ihm geworden. Der Wurm, der früher von dem Vorübergehenden mit Füßen getreten wurde, hat sich in die Fäden seiner Gefühle eingesponnen, und wenn Du ihn jetzt siehst, so flattert er als farbenprächtiger Schmetterling vor Dir. Unter schönen Absichten und vom Egoismus dictirten Thaten fließt das Leben des Mannes dahin, während das bescheidene Weib den häuslichen Herd zum Altar macht, den sie täglich mit ihrer Selbstaufopferung heiligt. Wer Selbstverleugnung sucht, der schaue in ein Frauenherz, und er wird mehr finden, als bei den Heroen Roms und Griechenlands. – Wenn ich so ganze Nächte, vor ihr sitzend, meine Blicke in schweigender Glückseligkeit an ihrem Bilde weiden konnte; wenn ich sie zuweilen in ihren Träumen erröthen sah, oder ein schwaches Lächeln um ihre Lippen spielte und ich mir denken konnte, sie träume von mir; wenn es mir, indem ich so viel Schönheit sah, so vieler Vollkommenheit gedachte, einfiel, daß dieses Alles mein sein wird, daß ich dieses Alles besitzen, beglücken werde; und wenn endlich die Nacht verging und der Himmel heller durch unser Fenster blaute, das Laub der Eiche, wie von dem frischen Morgenwind geweckt, draußen zu säuseln begann, wenn die ersten Sonnenstrahlen, in's Zimmer fallend, Juliens Gesicht mit dem Purpur des Morgens übergossen, und meine Geliebte, vom Schlaf erwachend, zuerst nach ihrem Vater sah, und nachdem sie sich überzeuget, daß er noch am Leben, mir leise guten Morgen wünschte: welche unendliche Seligkeit erfüllte dann mein Herz! Niemand glaubt es, wie viel Freude Einen auch nur von einem einzigen Gesicht anlächelt, wenn man sich geliebt glaubt.
Aber was nützt es, mir diese seligen Augenblicke in's Gedächtniß zurückzurufen? Was nützt es, das Gespenst dieser schönen Stunden aus der Tiefe meiner Seele heraufzubeschwören? War es nicht genug, daß ich einmal soviel Glück verlor, und soll ich meine Seele auf's Neue in reizende Träume lullen, um ihnen wieder nachweinen zu müssen? Was nützt es dem Wanderer der Wüste, wenn er, seine müden Glieder ausrastend, von lachenden Fluren, von reichen Gastmählern und der Umarmung seiner Geliebten träumt? Endlich muß er doch erwachen und die Wüste rings um sich sehen, seinen Durst und seine Verlassenheit fühlen, und wieder weinen, wie als die grünen Fluren seiner Heimat zum ersten Male seinen Blicken entschwanden. – Und mir sind die grünen Fluren meines Lebens für ewig verschwunden, rings um mich dehnt sich eine unendliche Wüste aus. Reizende Träume! was neckt ihr meine Seele? Ist die Frucht nicht bitter genug, an der ich nagen muß? Warum soll ich mich auch noch erinnern, wie schön die Blüthe war, aus der sie sich entwickelt hat? O, gib mir Ruhe, mein Gott, Ruhe diesem Herzen, das sich in seinem Leiden zu Dir gewendet hat. Gibt es doch auf der ganzen Welt keinen Platz, wo ich ausruhen könnte, als Deinen Altar; wolle nicht, daß die Welt Deinen Diener wieder fortreiße. Eine Welle bin ich, die der Sturm ergriffen hat; o stille, mein Gott, die Stürme der Qual, die mein Inneres zerwühlten, auf daß in meiner Seele Dein Himmel sich wieder spiegle, damit ich glänzend dastehe in Deinen erhabenen Strahlen und lobpreisend zu Dir hinaufschaue.
Du bist doch gnädig und blickst barmherzig hernieder auf unsere menschlichen Schwächen. Als Du in Deiner Majestät über dem Meere schwebtest, und Dein Getreuer, der so muthig die Wellen betrat, zu zweifeln anfing und untersank, da sprachst Du sanften Tones: »Kleinmüthiger Mensch, warum zweifelst Du?« Aber nach diesem kurzen Vorwurf strecktest Du Deine Hand aus und führtest Deinen schwachen Apostel sicher an's Ufer. Und siehe, auch ich habe gezweifelt und bin versunken unter den Wellen, wo keine Rettung mehr ist; und mich solltest Du nicht zu Dir erheben? »O, kleinmüthiger Mensch, warum zweifelst Du?« so schallt eine Stimme in meinem Herzen, und ich fühle, daß es Deine Stimme ist. Erst müssen die Sterne verschwinden, die in unserer Nacht glänzten, ehe die Morgendämmerung kommen kann; es müssen die Glanzpunkte verschwinden, welche die Nacht des Lebens erheitern, bevor das strahlende Licht des Glaubens sich erheben kann – aber einmal kommt es! Ist das Herz einmal seiner kleinen Habseligkeiten beraubt, so erfüllt es sich mit dieser einen großen Glückseligkeit, und schon fühle ich diesen Augenblick herannahen. Der Haß ist verschwunden, mit den reinen Erinnerungen meiner Kindheit sind auch meine Thränen zurückgekommen, und das Herz schlägt von Tag zu Tag ruhiger. Das inbrünstige Gebet meiner Genossen und der heilige Gesang in unserer Kirche erfüllt meine Seele noch nicht mit Freude, wie Diejenigen, welche echter Glauben beseelt; doch in meinem Herzen erwacht die selige Ahnung, daß einst auch ich in dem großen Chore mitsingen werde, der zum Lobe des Schöpfers erschallt; und wenn meine glühende Glaubenssehnsucht auch noch nicht in Erfüllung gegangen ist, so ist sie doch wenigstens nicht mehr peinlich, ja zuweilen wird sie sogar zu süßer Hoffnung. Sei ruhig, meine Seele, bald vielleicht wirst du deinen bittern Kelch bis zur Neige geleert haben; schien er doch golden, als du ihn zu deinen Lippen erhobst, vielleicht schimmert auf seinem Grunde wieder Glanz für dich.
Nach drei Tagen endlich erklärte der Arzt, daß Juliens Vater außer aller Gefahr sei; Du kannst Dir vorstellen, wie glücklich wir waren. Julie war außer sich vor Freude, und ich hatte längst aufgehört, anders zu fühlen als sie. Doch diese reine Freude dauerte nur kurze Zeit. Julie schien von Tag zu Tag trauriger, und wenn ich an ihren Augen zuweilen die Spur von Thränen sah und auf meine Frage nach dem Grund ihres Kummers immer nur die Antwort erhielt, sie habe nicht geweint, so ward mein Herz von schwerer Besorgniß erfüllt. Zwar erschwerte uns der Alte durch seine schlechte Laune oft unsere Pflicht, aber ich kannte Julie, und nachdem ich sie alle Launen ihres Vaters, als er noch gesund war, so geduldig ertragen gesehen hatte, konnte ich mir nicht denken, daß sie jetzt dem Reconvalescenten seine unbegründete Gereiztheit übelnehmen könnte. Und war überdies der Alte nicht oft freundlich? Sprach er nicht stundenlang von unserem künftigen Glücke, und daß durch unsere Verbindung alle seine Wünsche in Erfüllung gegangen seien? Vielleicht liebt sie mich nicht, dachte ich mir zuweilen, und folgt mir nur ihrem Vater zu Liebe zum Altar. – Aber glaubte ich mich denn nicht schon in Avignon geliebt, als ich ihren Vater noch nicht kannte? Und wenn sie ihn liebte – dachte ich weiter, und vor meiner Seele tauchte wieder Dufey's Bild auf – und wenn sie ihn liebte und ich betrogen wäre? Thorheit! Warum sollte sie mich täuschen? Welchen Grund könnte sie dazu haben? – Doch nein, tröstete ich mich wieder, es kann nicht sein, hat doch die Möglichkeit Grenzen, und der Himmel, welcher mein Herz so geschaffen, daß es ohne Julie nicht leben kann, kann nicht wollen, daß sie falsch sei. Und so grübelte ich von Tag zu Tag immer mehr, wie Einer, der, in schweren Träumen liegend, gegen die traurigen Bilder ankämpft, und obwohl er sich hundertmal damit tröstet, daß er nur träumt, sie dennoch nicht vertreiben kann: so rang ich mit diesem Gedanken, bis ich endlich selbst in Traurigkeit verfiel, und vielleicht noch mehr als Julie. Glücklich war unter uns nur der Alte. Nicht weil er sich über das Glück seiner Tochter freute, und da er meinen Charakter kannte, über die Zukunft Dessen, was ihm auf Erden am liebsten war, sich beruhigt fühlte, sondern es erfüllte hauptsächlich der Umstand sein Herz mit Freude, daß seine Tochter sich mit dem Erben eines großen, seiner würdigen Namens verband; alles Uebrige war Nebensache. »Wenn der legitime König einmal zurückkommt, und er muß zurückkommen,« sprach er oft, »so bitte ich ihn, daß er meine Titel und Wappen auf Dich übertrage, und dann wird mein Name fortleben, durch den Deinigen noch gehoben, mit welchem verbunden er gewissermaßen noch einmal so alt sein wird; der Adel Eurer Kinder wird den Glanz zweier Jahrtausende an sich tragen, er wird reich, geachtet und der erste in Frankreich sein. Und weißt Du, was es heißt, die erste Familie in Frankreich zu sein; dessen Adel älter ist, als der aller Länder Europa's? Und dieser Behauptung wird Niemand widersprechen; ich zähle einen Connetable unter meinen Ahnen, Du zwei, und wie viel Marschälle und andere Große sind aus unserem Geschlecht hervorgegangen! Die Geschichte unserer Familie ist die Chronik der Nation. Sieh', nicht daß ich zu Grabe gehe, auch nicht, daß ich mich von Euch trennen muß, sondern nur, daß ich als der Letzte meines Stammes aus der Welt gehe, und meine Tochter, nachdem unser Wappen verkehrt über unserer Gruft angebracht worden, ihre Hand vielleicht einem Bürgerlichen schenken und unseren Besitz mit einem nicht Ebenbürtigen theilen könnte: das würde mich auf meinem Sterbebette schmerzen. – Hätte ich einen Sohn, so würde ich noch heute ruhig sterben.«
Da ich keinen andern Grund fand, so schrieb ich Juliens Traurigkeit zuletzt diesen Ausbrüchen zu, denn ich fand es natürlich, daß sie das zartfühlende Mädchen schmerzen mußten. Während sie, am Bette ihres sterbenden Vaters stehend, ihr Leben hingegeben hätte, wenn sie ihm dafür in seiner letzten Stunde einen heiteren Augenblick hätte erkaufen können; während sie nichts sah, nichts hörte und nicht daran dachte, daß auch ihr das Recht verliehen wurde, an den Freuden der Welt theilzunehmen: lag ihr Vater rechnend in seinem Bette, dachte er nur an das Fortbestehen seines Namens, fühlte er keinen Schmerz darüber, daß er sich von einer solchen Tochter trennen müsse, und klagte sein Geschick an, daß es ihm keinen Sohn gegeben. Was ist ihm diese Tochter werth, was ihre treue Anhänglichkeit, was die Thränen ihrer Liebe, die seine Stirn benetzten? Sie ist ein Mädchen und kann seinen Namen nicht forterhalten; was kümmert es ihn, daß er von ihr beweint werden wird? Das schlechteste Kind von der Welt wäre ihm lieber als diese Tochter, wenn es nur ein Sohn wäre. Gewöhnliche Menschen lieben ihre Kinder um ihrer guten Eigenschaften willen; er steht zu hoch dazu, bei ihm ist der Fortbestand der Familie der Hauptzweck; was kümmert es ihn, wenn seine Kinder herzlos sind, wie er selbst, wenn nur der Name erhalten bleibt. Und wenn die Familie, noch ein Jahrhundert bestehend, gleich der Aloe auch nur eine einzige Blüthe treibt, so wird die Welt, welche die Rosen verachtet, in ihrem Erstaunen mehr Lärm schlagen, als über den Blüthenflor von hundert Frühlingen. Man wägt nicht, man zählt die Generationen, und wenn auch der letzte am Gipfel des Baumes stehende Trieb so schwach ist, daß er, wenn er auf der Erde stünde, von einem Kinde in den Staub getreten würde, wer wagt es, zu sagen, daß er nicht hoch steht?
Gewiß war diese Erfahrung Julien schmerzlich; ja ich selbst fühlte mich damals dem Manne entfremdet, der auf seinem Sterbelager so kalt rechnen und zur Erreichung seines Zweckes selbst im letzten Augenblick Gefühle heucheln konnte, die er gar nicht hegte. Doch wenn man es bedenkt, wer opfert seinen Vorurtheilen nicht die Wahrheit? Und wer würde es wagen, den Stein aufzuheben gegen den Grafen und zu behaupten, er habe keine Vorurtheile? – Wir begreifen fremde Vorurtheile nicht, wir verdammen oder verlachen sie, und dennoch sind die Argumente, mit welchen wir gegen sie auftreten, oft selbst nichts, als Vorurtheile. Es sollte Niemand stolz sein.
Frau von Valmont kam jetzt öfter in unser Haus. Ich fühlte mich nicht sehr zu ihr hingezogen und mied meistens ihre Gesellschaft; theils weil ich an der ganz in weltliche Freuden versunkenen Frau keinen Gefallen fand, theils, und vielleicht mehr noch, weil Julie mehrmals halb im Scherz, der alte Graf aber stets im Ernst behauptete, sie liebe mich und ich müsse auf meiner Hut sein, daß ihre schönen Augen mich nicht fesseln. Ich gestehe, daß der, wenn auch nur im Scherz ausgesprochene Gedanke, ich könnte eine Andere, als Julie lieben, meine Seele beleidigte.
Als ich einmal gerade aus dem Garten kam, eilte ich zu meiner Julie und ging zu ihr hinein, obwohl die Marquise dort war, da ich, ohne den Anstand zu verletzen, nicht mehr zurück konnte. Ich kam unerwartet, und die beiden Damen waren verlegen; Julie verbarg einen offenen Brief in ihrem Busen und über ihre Wangen rollten Thränen, die sie schnell abwischte. Die Marquise erwiderte meinen Gruß mit erzwungenem Lächeln, und nachdem das Gespräch noch eine Weile mit der größten Gezwungenheit fortgesetzt worden war, entfernte sich die Marquise.
Julie setzte sich schweigend an ihren Arbeitstisch und ich betrachtete die Blumen, die im Fenster standen; unbeschreiblich ist es, mit welchen schmerzlichen Gefühlen der scheinbar gleichgiltige Vorgang mein Herz erfüllte. Endlich konnte ich das Schweigen nicht mehr ertragen, ich näherte mich Julien, und nicht wissend, was ich sagen solle, sprach ich endlich nach langem Schwanken: »Julie, Sie verheimlichen mir etwas.«
Sie erröthete und arbeitete weiter.
»Habe ich kein Recht auf die Geheimnisse dieses Herzens?« fuhr ich zitternd fort.
Sie erhob ihr Haupt und ihre Wangen glühten, als sie, den Blick auf mich gerichtet, sagte: »Sie fangen früh an, von ihren Rechten zu sprechen.«
Es lag eine so kalte Verachtung in diesem Blick und so viel Bitterkeit in diesen Worten, daß ich mein ganzes Wesen erschüttert fühlte. Ich war vernichtet, außer mir ging ich im Zimmer auf und ab, und hundert Gedanken, hundert widersprechende Vorsätze kämpften in meiner Seele. Endlich entschloß ich mich, und wieder zu Julie tretend, sagte ich: »Julie, wenn Sie andere Rechte meinen, als welche die Liebe freiwillig gibt, so täuschen Sie sich; ich verlange von Ihrem Herzen Vertrauen, nicht weil Sie Ihr Leben an das meinige durch einen Schwur ketteten, sondern weil ich mich für geliebt hielt. Ich bitte Sie um Vergebung für diese Täuschung.«
Julie blickte mich erstaunt an; meine Augen füllten sich mit Thränen, als ich fortfuhr: »O Julie, vergeben Sie mir, daß ich es wagte, mich für geliebt zu halten; ich, der Unwürdige, welchem nichts dazu ein Recht geben konnte, als seine treue Anhänglichkeit und das Bewußtsein, daß er, wenn er auch wenig besitzt, doch nichts besitzt, was er nicht aufzuopfern bereit wäre – geliebt von Ihnen, dem schönsten, dem reizendsten Weibe der Erde; – aber wer kann dafür, die Täuschung war zu schön, als daß ich ihr hätte widerstehen können, und ich bin gestraft genug, daß ich diese schöne Illusion verlieren mußte.«
»Gustav,« sprach Julie, sichtlich gerührt durch meine Worte, »was drückt Ihr Herz?«
»Und das fragen Sie noch?« sagte ich, von meinem Schmerz hingerissen; »o fragen Sie die Erde, warum sie finster, wenn ihre Sonne untergegangen ist; fragen Sie das Kind, warum es weint, wenn seine Mutter im Grabe liegt; fragen Sie den Baum, warum er verwelkt, wenn man ihn von seiner Wurzel getrennt hat. Und was ist das im Vergleich zu meinem Leiden? Nur mein Verlust ist unersetzlich, nur mein Verlust war nicht vorherzusehen, nur mein Verlust ist ein langes unendliches Leiden. Und Sie fragen, weshalb ich klage? Wissen Sie denn nicht, was Liebe ist? Ihr Herz ist so rein, so engelhaft, fühlten Sie nie Ihr ganzes Wesen in ein anderes versunken, standen Sie nie abgesondert von der Welt, nichts sehend, nichts fühlend, nichts hörend, als den geliebten Gegenstand; glücklich, wenn Sie ihn lächeln, Höllenqualen erduldend, wenn Sie ihn leiden sahen; sich für einen Gott haltend, wenn bei Ihrem Nahen der Geliebte leicht erröthete; in diesem einen Gefühl mit aller Kraft wurzelnd, und dennoch so stark, so hoffnungsreich unter den Stürmen des Lebens wie ein Baum, den der Wind erschüttert, aber nicht entwurzelt? Sollten Sie dieses Gefühl nie gekannt haben?«
»Ich verstehe Sie nicht!« sagte Julie fast erschrocken auf mich blickend.
»Gut,« fuhr ich fort, »sehen Sie, so habe ich Sie geliebt; doch nein, nicht so! Worte können es nicht schildern, wie ich Sie geliebt habe, und wenn mein Blick es Ihnen nicht sagte, mein zitterndes Herz nicht in Ihrem Herzen die Ahnung davon erweckte, so werden Sie es nie begreifen. Und wissen Sie, was es heißt, das auf einmal verlieren, Alles auf einmal, eine ganze Welt von Freuden, eine Vergangenheit, von der wir Jahre lang geträumt haben und die uns jetzt als eine große Täuschung erscheint, eine Zukunft, in der wir ein Eden träumten und die sich plötzlich wie eine große Wüste vor uns ausdehnt?«
»Gustav, was fällt Ihnen ein?« sprach Julie mit zitternder Stimme.
»Nichts!« sagte ich erbittert, »nichts, es fiel mir nur ein, daß das Leben eine schöne Sache ist, und daß der Mensch wohl thut, wenn er daran hängt, aber nur so lange, als er etwas davon erwarten kann; denn wenn Das, was er für Gold hielt, in seinen Händen gelber Thon wird, so ist er ein Thor, wenn er die Last nicht abwirft und sich damit weiter bemüht. Es fiel mir ein, wie angenehm mir das Leben noch vor einigen Wochen, ja vor einigen Stunden war; daß ich mich erniedrigt hätte, nur um es weiter besitzen zu können; daß ich auf den Knien um einige Stunden gebettelt, die Hand des Tyrannen gesegnet hätte, der, mich in Fesseln schlagend, mich nur hätte athmen lassen, und daß es jetzt nichts so Unbedeutendes auf Erden gibt, wofür ich nicht mein Leben hinwerfen möchte!«
»Gustav, Sie sind heute schrecklich,« sagte Julie, blaß vor Aufregung; »aber ich begreife den Grund Ihrer Schmerzen nicht.«
»Gut,« entgegnete ich erbittert, »sprechen wir offen mit einander. Daß und wie ich Sie liebte, wissen Sie selbst, dieses Herz kann nicht lügen und nichts verheimlichen, und Sie haben an meinen Gefühlen gewiß nie gezweifelt; daß ich glücklich war, als Sie mir am Bette Ihres Vaters Treue schwuren; daß ich seitdem hundert Luftschlösser baute, in welchen meine Glückseligkeit wohnte, brauche ich Ihnen nicht zu sagen; daß Sie mich nicht lieben, das fühlt Ihr Herz, und nach alledem glaube ich, daß ich Ihnen meine Geschichte nicht weiter zu erzählen brauche.«
»Wer hat es Ihnen gesagt?« fragte Julie erröthend.
»Wer?« sprach ich mit schmerzerstickter Stimme, »o, das Herz braucht nicht viel, um sein Schicksal zu erkennen. Ich ging auf den blühenden Fluren umher, wo der Frühling tausend Veilchen schuf, und ich fragte jede Blume, und der ganze Blüthenflor sagte mir: »»Julie liebt Dich!«« ich blickte zu den Sternen empor und las in ihren Strahlen: »»Sie liebt Dich!«« und der Gesang der Nachtigallen, das Brausen des Windes und Tag und Nacht, die ganze Natur rief mir einstimmig zu: »»Sei glücklich, denn sie liebt Dich.«« – »»Ich liebe Dich!«« wiederholten auch Ihre Lippen mit zartem Tone, und mein Herz ertrug die Last seiner Wonne nicht. Aber die ganze Welt log und Ihr Schweigen enthüllte mir jetzt die Wahrheit.«
»Und weil ich einer kindischen Neugierde nicht entsprechen wollte,« erwiderte Julie ernst, »weil ich schwieg, wo meine Worte Ihnen nur weh thun, oder Sie von etwas in Kenntniß hätten setzen können, was Sie nichts angeht und Sie nicht ändern können, glauben Sie, daß ich meines Wortes vergesse und den vor meinem Vater geleisteten Eid breche? Sie kennen mich nicht.«
»Ihr Versprechen,« erwiderte ich traurig, »ein gegebenes Wort, Ihr Schwur? Und glauben Sie, daß ich zufrieden sein kann, wenn Sie dieses Versprechen erfüllen, Ihrem Schwur getreu bleiben? Wenn Sie zum Altar treten und Ja sagen, um Ihres Vaters willen vielleicht Ihre Thränen unterdrücken, sich aus kindlichem Pflichtgefühl oder vielleicht aus Mitleid aufopfern und meine Gattin werden, so glauben Sie, daß ich nichts weiter zu wünschen habe? Werde ich nicht vor der Welt an Ihrer Seite gehen, und wenn Jedermann Ihre Reize preisen wird, stolz sagen können, diese Frau, die Ihr bewundert, ist mein, denn Ihr sterbender Vater zwang sie zu einem Eide und ich nahm ihr Opfer an; sie gehört mir, wie die Sclavin dem asiatischen Tyrannen; es ist die Pflicht dieses Weibes, mich zu lieben, oder mir wenigstens Liebe zu heucheln, sie würde vor Gott und den Menschen sündigen, wenn sie dieses Gefühl nicht heuchelte? Werde ich Sie nicht umarmen, und wenn Ihr Herz unter meinen Umarmungen nicht rascher schlagen wird, selig sein können in dem Gedanken, daß dieses vom Himmel zum Glück geschaffene Herz nicht glücklich sein wird, weil es keinen Andern lieben wird? Und wenn ich meine Lippen an Ihre kalten Lippen pressen werde und mein glühender Kuß durch Ihren Kuß erwidert werden wird, werde ich dann nicht selig fühlen, wie treu meine Gattin ihre Pflichten erfüllt? Und wenn ich Ihre blassen Wangen und jeden Morgen darauf Thränenspuren sehen werde, wird mich dann nicht das Bewußtsein trösten, daß diese Wangen meinethalben bleich, diese Thränen durch mich erpreßt wurden? O, ich werde unendlich glücklich sein, nicht wahr, und was könnte ich noch mehr verlangen? O Julie! Liebe, Liebe verlangte dieses Herz! Seitdem ich Sie zum ersten Male sah, seitdem dieses Herz zum ersten Male von seiner Leidenschaft durchdrungen wurde, bat ich das Schicksal nur um Liebe; der Gedanke, daß ich Sie jemals werde mein nennen können, war zu schön, als daß ich es gewagt hätte, dies zu hoffen, und ich konnte auch ohne dies glücklich sein; was kümmerte mich alles Uebrige, wenn ich mich nur geliebt wußte! Wenn die Sonne von Wolken verhüllt wird, so bleibt es dennoch hell auf der Erde, so lange sie nur am Himmel steht, wenn wir sie auch nicht strahlen sehen; und ich hätte glücklich sein können fern von meiner Julie, wenn ich nur gewußt hätte, daß ihre Seele über mir strahlt und daß nur fremde Hindernisse sie von mir fern halten. Doch ich verlangte Liebe, glühende Liebe, unendlich und ewig, wie die, welche dieses Herz erfüllt. Ich gab meiner Liebe meine Seele hin und bat dafür wieder um eine Seele; was nützt mir der Körper? Ich wollte nicht genießen, ich wollte lieben. Was nützt mir Ihr Besitz? Sie könnten mir ihn ohne Zerstörung Ihres Glückes nicht gewähren, und so gewährt, genügt er mir nicht.«
Julie schwieg, doch blickte sie mich gerührt an und ihre Augen füllten sich mit Thränen.
»O Julie!« fuhr ich hingerissen fort, »warum hatten Sie kein Vertrauen zu mir, als Sie, von kindlicher Liebe getrieben, mir ewige Treue schwuren? Warum sagten Sie mir nicht, sobald wir allein waren, daß das Versprechen nur erzwungen war? Es hätte mich geschmerzt, aber ich hätte es ertragen, da mein Herz damals die Wonne noch nicht gewöhnt war. Ich war einen Augenblick der glücklichste Mensch der Welt, nachdem aber das vorbei war, hätte mich wenigstens das Bewußtsein getröstet, daß meine Julie mir vertraute und daß sie mir ihr Glück zu verdanken hat. Ich wäre zu Ihrem Vater gegangen und hätte ihm gesagt, daß ich Sie nicht liebe, oder daß ich, anderswo gefesselt, mein Versprechen nicht erfüllen könne; Ihr Vater hätte mich verachtet, die Welt mich vielleicht verleumdet, doch meine Julie hätte mich geachtet, und ich hätte zufrieden sein können. Doch jetzt, o daß ich jetzt das erleben mußte; daß Sie, nachdem ich das Glück bereits gewöhnt war, nachdem ich meine ganze Zukunft an diese Eine Hoffnung geknüpft, daß Sie jetzt, nachdem ich mich auf der höchsten Stufe der Glückseligkeit befand, plötzlich meinen Namen ausrufen, damit ich, wie ein Mondsüchtiger erwachend, von der Höhe herunterstürze und zu Grunde gehe; daß Sie jetzt, nachdem ich den süßen Trank bis zum letzten Tropfen geleert, sagen: es sei Gift und ich müsse zu Grunde gehen; das, Julie, ist grausam.«
»Gustav,« sprach Julie, immer mehr gerührt, »wie zwecklos quälen Sie sich.«
»Sprechen Sie nicht so zu mir,« entgegnete ich mit schmerzerstickter Stimme; »seien Sie nicht so freundlich gegen Denjenigen, dessen wahnsinnige Liebe Ihrem Herzen gewiß nur Schmerz verursacht hat; dieser sanfte Ton versetzt mein Herz wieder in Unruhe, und ich bedarf der Ruhe. – Was nützt mir das? Was nothwendig ist, das muß früher oder später ohnehin geschehen; wozu die neue Aufregung? Ich werde zu Ihrem Vater gehen und ihm sagen, daß ich mein Wort nicht halten kann; dann aber fürchten Sie nicht, daß meine Gegenwart Ihre Ruhe weiter stören werde. Der Graf wird mir vielleicht seine ganze Verachtung zuwenden, er wird mir vielleicht fluchen; aber Sie werden Ihrem Vater lieb bleiben, die ganze Welt wird Sie lieben, bewundern, wie bisher, und das ist mir genug.«
Ich brach in Thränen aus, Julie drückte mir die Hand. »Und Sie,« sprach sie mit weicher Stimme, »Sie, der Sie mich so lieben, der ohne mich nicht leben kann?«
»Ich?« sagte ich, »und wer spricht von mir? Was bin ich, daß mein Glück zu berücksichtigen wäre, wenn es sich um Juliens Ruhe handelt? Bin ich ein Gott, daß ich Opfer verlangen könnte, oder daß ich sie, wenn sie mir dargeboten werden, annehmen könnte, ohne mich verachten zu müssen? O Julie, seien Sie, wie und durch wen immer, glücklich und ich bin zufrieden. Ich werde mein Geschick preisen und glücklich sein, so oft ich in Ihrem Gesicht Freude werde strahlen sehen. Seien Sie nur glücklich, damit dieses Herz nie seine That bereue und zum Trost das Bewußtsein hege, daß es nicht umsonst verblutete.« Julie weinte. »Weinen Sie nicht, Engel, weinen Sie nicht meinethalben! Ich war ja doch einmal glücklich, wenn auch nur in der Einbildung, doch immerhin glücklich, wie es nie Jemand auf Erden gewesen, und die Erinnerung an diese Illusion wird süßer sein, als das ganze genußreiche Leben Anderer. Sie werden mich ja nicht ganz vergessen, nicht wahr?«
»Gustav,« sprach Julie mit zitternder Stimme, »ich liebe Dich.«
»Du liebst mich?« rief ich, beinahe erschrocken über das Uebermaß von Glück, das meine Brust erfüllte; »Julie, Du liebst mich? Um Gotteswillen, treibe keinen Scherz mit mir!
»Ich liebe Dich!« sprach sie ruhig. Ich war außer mir, ihre Hand zitterte zwischen meinen Fingern, die Thränen flossen stromweise über ihre glühenden Wangen. »Mein Gott,« rief ich, »gib mir das Herz eines Engels, damit ich so viel Glück ertragen könne.« Ich drückte sie in meine Arme. O, das Herz ist stärker, als man glaubt, da es, so viel Wonne fühlend, im Uebermaß des Glückes nicht bricht.
Später erzählte mir Julie, daß Frau von Valmont mich liebe, und daß dieses Geständniß, welches sie ihr heute Morgens gemacht und das ihrem Herzen so weh that, es sei, was sie mir verheimlichen wollte. Und ich glaubte es – was hätte ich meiner Julie nicht geglaubt. Noch an demselben Abend gab sie mir einen Brief, welchen ich der Frau von Valmont zu eigenen Händen übergeben mußte. Am nächsten Tage wurde bestimmt, daß unsere Hochzeit nach einem Monat stattfinden sollte.
Der Tag der Hochzeit nahte heran; Du kannst Dir vorstellen, wie glücklich ich war. Wie Einer, der zu einem Gipfel emporklimmt und den Augenblick des Genusses, welchen ihm die Aussicht oben bieten wird, kaum erwarten könnend, dennoch, wenn er umherblickt, so reizende Landschaften sieht, daß er den Weg kaum fortsetzen kann, so zufrieden ist er mit Dem, was er schon sieht; so war auch ich zufrieden, ja selig, und dennoch voll Hoffnungen. O, mein Freund! es gibt mitten in diesem finsteren Leben Stunden, in welchen wir einsehen, daß die Sage vom Paradiese auch auf dieser Erde sich verwirklichen könne.
Wir waren fast immer allein. Frau von Valmont kam, seit ich ihr Juliens Brief übergeben, nicht in unser Haus, und so verschwand auch das letzte unangenehme Gefühl, welches mir die Anwesenheit dieser Frau sonst verursachte, und ich konnte vollkommen glücklich sein. Für einen Mann oder wenigstens für Den, der durch Eitelkeit noch nicht ganz verdorben ist, kann nichts unangenehmer sein, als wenn er sich von einer Frau geliebt sieht, für die er ähnliche Gefühle nie gehegt hat oder nicht mehr hegt. In solchen Augenblicken schämen wir uns beinahe unserer Kälte.
Viel bedarf man um glücklich zu sein, denn das Herz genügt sich nie weniger, als während seiner Freuden. Wenn wir uns glücklich fühlen sollen, so ist es nöthig, daß Alles rings um uns in Einklang sei, daß uns niemals Schmerz entgegentrete, auch nicht einmal Unempfindlichkeit, denn das Herz gleicht der Rose, die, je mehr sie sich im Blühen entfaltet, desto leichter bei der geringsten Berührung ihre Blätter verliert. – In meinem Kreise ging alles nach Wunsch; wohin ich mich auch wandte, überall strahlte mir Freude entgegen. Der Greis, der bereits vollkommen hergestellt war, schenkte seiner Tochter bald einen alten Becher oder sonst eine Kostbarkeit, und indem er hierbei ein Ereigniß aus der Familiengeschichte erzählte, bemerkte er lächelnd, die Herren Banquiers könnten bei all' ihrem Reichthum ihren Töchtern nichts schenken, woran so viele Erinnerungen hängen; bald ging er mit mir im Garten auf und ab und sprach von unseren Vermögensverhältnissen, und wie reich wir durch diese Heirat sein würden, und er verjüngte sich vor Freude. Die Dienstleute gingen mit heiteren Gesichtern herum, denn sie liebten Julie; selbst die Natur schien sich zu erfreuen, indem sie des Sommers ganze Pracht entfaltete und der Himmel sich wolkenlos über uns wölbte. Diese Tage waren zu schön, als daß ich sie beschreiben könnte.
Armand sah ich selten. Der Graf setzte in diesen Tagen sein Werk nicht fort, und da er nicht selbst nach Paris gehen konnte, so übertrug er Armand alle zu unserer Hochzeit nöthigen Vorbereitungen. Als dieser zum letzten Male bei uns war, übergab ihm der Alte 20.000 Francs, um Perlen auszuzahlen, die für Julie bestimmt waren. Seitdem sahen wir ihn nicht wieder.
Es ereignete sich, daß ich bei meinem Advocaten noch Einiges zu besorgen hatte und nach Paris ging. Der Advocat war abwesend, Armand fand ich nicht zu Hause, und ich ging verstimmt in der Stadt herum, den Abend erwartend, weil der Advocat damals zurückkehren sollte und so gelangte ich in's Palais-Royal. – Ich habe diesen Ort nie geliebt; Du weißt, wie sehr ich die Politik hasse und wie wenig Interesse mir die kleinen Kämpfe und Siege derselben boten, in welchen nach so viel Mühen doch so wenig errungen wurde. Vielleicht sind die kalten Raisonnements meines Vaters daran schuld, vielleicht meine Natur, zufolge welcher ich bei Allem nur die poetische Seite suchte; aber so viel ist gewiß, daß, namentlich seit ich Julie liebte, Niemand der Politik gegenüber gleichgiltiger sein konnte, als ich, und dies ist vielleicht eine der Hauptursachen meines späteren Unglückes. – In diesem Leben, wo wir uns so oft täuschen, ist es nicht gut, unser Schiff einem einzigen Anker anzuvertrauen, unser ganzes Glück auf einen einzigen noch so erhabenen Gegenstand oder auf eine einzige Person zu setzen. – Man soll so handeln, wie der reiche Mann, der sein Geld nicht auf einen Platz anlegt, ja sogar einen Theil seines Vermögens zuweilen in fremde Länder schickt, damit ihm, wenn er an einem Ort verliert, am andern noch etwas bleibe, was ihm Zinsen trägt; auf je mehr Karten man den Schatz des Herzens setzt, desto sicherer ist man, daß man nicht Alles verlieren werde. Napoleon tröstete sich nach dem Verlust einer Welt mit dem Bilde seines Sohnes, und wie vielen Menschen bot wieder beim Verlust eines geliebten Wesens der Lärm der Welt Linderung. Ich gehörte leider nicht zu diesen, und nachdem ich den einen Gegenstand verloren hatte, durch welchen ich glücklich gewesen und für welchen ich mich bereitwillig aufgeopfert Hütte, wurde ich nothwendigerweise unglücklich, und was noch schlimmer ist, egoistisch. Doch lassen wir das. Die Politik war mir, wie gesagt, verhaßt, und dennoch konnte ich niemals unter die Säulen dieses ungeheuern Palastes treten, ohne daß ganze die Revolution und hundert andere Bilder mir vor Augen schwebten.
Wenn ich vor den steinernen Mauern dieses Hauses stehe, welche auf die größere Bewegung der Menschen so kalt, so unbeweglich herniederschauten: wenn ich auf den Pfaden wandle, auf welchen sich einst das verwilderte Volk tummelte, und die wieder kalt und zierlich dastehen, wie vor der Revolution, dann habe ich das Bild jener großen Zeit lebendig vor mir und ich werde traurig. – Nicht als ob ich bedauerte, was dadurch verloren gegangen und was meinem Herzen eben so uninteressant erscheint, wie der gegenwärtige Zustand, sondern weil es mir einfällt, wie schwach und niedrig wir selbst in den erhabendsten Momenten der Geschichte sind, und wie viel wir vergessen müssen, wie fern wir von den bewundertsten Zeitaltern, wie weit wir noch davon entfernt sind, uns – die Häßlichkeit der Einzelheiten vergessend – des großen Ganzen zu erfreuen. – Solche Gedanken erfüllten mich auch an diesem Tage, als ich im Palais-Royal auf- und abging. Die langen Säulenreihen standen in hellem Sonnenschein; vor hundert Gewölben war aller erdenkliche Luxus ausgebreitet und in den Alleen drängten sich Tausende in bunten Massen, freudenmüde, sorglos. So stand dieser Ort auch vor fünfzig Jahren; damals wie jetzt wogten die sich unterhaltenden Schaaren auf diesem hellen Platze, heiter und sorglos, während der arme Chiffonnier oder der zerlumpte Taglöhner, die Qualen des Elends im Herzen, in dieser bunten Menge herumging, und seinen Hunger mit Rachegedanken milderte. Drei Jahre waren vergangen, seit Camille Desmoulins unter der Linde seine Rede gehalten und das Volk den Baum seines Laubes beraubte, um sich Cocarden zu machen, und Alles war verändert. Der Taglöhner stand damals mit erhobenem Haupte vor dem Redner, der im Hof von der Bestürmung der Bastille sprach, und das Volk an seine Vergangenheit erinnernd, zu Thaten aneiferte. Drei Jahre, und eine neue Welt! Und was wird in jenen drei Jahren geschehen, die jetzt folgen? dachte ich bei mir und schauderte vor dem Gedanken. Die Revolution ist in Frankreich nicht beendet; man braucht in diesem Lande nur ein Jahr zuzubringen, um überzeugt zu sein, daß die Parteien nur aus Müdigkeit rasten und nicht erdrückt sind; und was wird die Zukunft bringen? Ein Volk, welches wie dieses sich so lange mit Politik beschäftigt hat, das jede Regierungsform erprobte und für jede sein Blut vergoß, wird bei einer Thatsache, wie die Juli-Revolution war, wahrscheinlich nicht stehen bleiben, wenn auch nicht schon der Bestand der Regierung täglich an die Revolution erinnerte. Und was wird geschehen, wenn dieses Volk noch einmal zu den Waffen greift?
Lange ging ich im Hof umher; endlich fing es an zu regnen, und ohne recht zu wissen, was ich that, ging ich in ein Spielhaus. – Unter allen Fehlern und menschlichen Irrthümern ist keiner, den ich so hasse, wie das Spiel; nicht wegen seinen schrecklichen Folgen – bringt es doch unser menschliches Geschick mit sich, das wir für jeden Genuß büßen müssen, und je mehr Genuß eine Leidenschaft bietet, mit desto mehr Gefahren droht sie – sondern weil das Spiel die Seele verdirbt und nichts unsere schlimmen Eigenschaften mehr entwickelt. – Denn was ist das Spiel? Es gibt Menschen, und in neuerer Zeit gab es große Schriftsteller, welche diesen Fehler mit dem schönen Kleide der Poesie verhüllten und ihn zu entschuldigen strebten. »Es ist schön, dem Schicksal entgegenzutreten,« sagen sie, »unsere ganze Zukunft von der Chance eines Augenblickes abhängig zu machen« – und wer weiß, was für prächtige Redensarten sie noch vorbringen, um ihre Behauptung zu unterstützen. Aber ist diese Leidenschaft, die für so poetisch ausgegeben wird, etwas Anderes als Geiz, als niedrige Habsucht, die sich von jener des alten Geizhalses nur darin unterscheidet, daß sie ihre Mittel unüberlegt wählt?« – »Aber der echte Spieler,« sagen sie, »spielt nicht um Geld, er bedarf nur der Aufregung, um seine abgestumpften Nerven wieder zu beleben.« Ist aber Derjenige, der keines Gefühls fähig ist, den die Schönheit dieser Welt nicht bewegt, dessen Brust die Liebe nicht erwärmt, den weder das Vaterland, noch der Glaube begeistert, und der vor einem Haufen Gold seine Sinne sich empören, seine Brust flammen, seinen Kopf schwindeln fühlt, nicht geizig? Wäre Derjenige, welchem ein paar Goldstücke lieber sind, als die ganze Welt, der seine Familie verläßt, seine Geliebte zurückweist, ja sogar den Freudenbecher mit Ekel von sich stößt, nur um, nachdem er sich eine ganze Nacht am grünen Tische abgemüht, mit vollen Taschen zurückzukehren und seinen Gewinn nicht zu genießen, sondern zu neuem Spiel fortzulegen, der an der Ebbe und Fluth seines Goldhaufens mit gierigen Blicken hängt und außer dem Spiel keine andere Freude kennt – wäre ein Solcher kein Geizhals?
Wenn man junge Männer vor dem Spiel warnt, so pflegt man gewöhnlich einen schlechten Weg einzuschlagen. Man spricht von den Folgen des Spieles, und um den Zögling abzuschrecken, stellt man ihm das Bild eines unglücklichen Spielers vor Augen; man zeigt ihm, wie der Spieler von Stufe zu Stufe weiterging, bis endlich Elend und das schauderhafte Verbrechen die Folge seines ersten Fehlers war. Diese Methode ist, wie fast unsere ganze Erziehungsmethode meines Erachtens fehlerhaft. Die Idee der Gefahren ist für junge Menschen mehr verlockend, als abschreckend, denn das Herz ist in der Jugend zu sehr an die Hoffnung gewöhnt, um von der Zukunft nicht immer die schönere Seite zu erwarten; und wenn dem Jüngling auch zuweilen einfällt, daß seine Hoffnungen ihn täuschen könnten, so hält er sich für zu stark, um vor dem Gedanken des Unglücks zurückzuschrecken. – Man müßte ihm, dem jungen Menschen, einen glücklichen Spieler schildern. Man müßte ihm den Elenden hinter seinem Goldhaufen zeigen; da sitzt er bleich und gewinnt nach so vielen schlaflosen Nächten, doch das Rad des Schicksals kann sich gegen ihn wenden, und in seinem Gesicht drückt sich Angst aus; Jahre lang zitterte er so, und er gewann immer und zitterte immer wie ein Verbrecher, von Augenblick zu Augenblick die aufgeschobene Strafe erwartend. Und jetzt wurde der Würfel wieder geworfen, sieh' nur, wie er lächelt; dieser Würfel hat das Glück einer Familie begraben! Vielleicht hängt ein Menschenleben an der glatten Oberfläche des Würfels und er lächelt doch; was geht das ihn an? Hat er doch gewonnen, hat sich doch sein Goldhaufen wieder vergrößert; wenn Tausende leiden, wenn an jedem Franc Blut hängt, so freut er sich dennoch; er hätte doch auch verlieren können, er hat nicht betrogen, und das ist für sein elendes Gewissen genug. – Wenn man jungen Leuten diesen zeigte, wenn man ihnen bewiese, wie selbstsüchtig selbst der Beste durch das Spiel wird, wie man endlich lernt, sich über das Unglück der Freunde zu freuen und wegen einiger Goldstücke Alles zu vergessen; sie würden sich vielleicht nie in ihrem Leben an einen Spieltisch setzen.
Das erste Zimmer, in welchem ich stand, war voll von Spielern, und nachdem ich eine Zeit lang die verzweifelnden oder von wilder Freude strahlenden Gesichter gesehen und die eintönigen Laute rouge et noir, pair impair satt hatte, ging ich in das zweite Zimmer. Hier saßen nur Wenige, und die Zuschauer schienen mit gespannter Aufmerksamkeit den Ausgang des Spieles abzuwarten. »Le jeu est fait!« sprach endlich der Croupier mit heiserer Stimme; das Rad rollte, Todtenstille herrschte im Zimmer, endlich blieb die Kugel stehen. »Rouge verliert!« klang es wieder, und ein blasser junger Mann stand vom Tische auf, und während er seinen Hut nahm und mit dem ruhigen Ausdruck der Verzweiflung zur Thür hinausging, rollte das Rad weiter. – Es war Armand. – »Armer Jüngling!« sagte ein ehrwürdig aussehender Greis, den wie mich wahrscheinlich nur der Zufall hergeführt hatte. »Hat er viel verloren?« fragte ich ihn zitternd. – »Wenigstens zehntausend Francs, seit ich hier bin, und wer weiß, ob nicht auch sein Leben.« – Ich schauderte und eilte Armand nach, jedoch vergebens; bis mir mein Hut zurückgestellt wurde, den ich nach Gewohnheit abgegeben hatte, und ich die Treppe hinabgelangt war, fand ich ihn nicht mehr im Garten. Ich ging nach seiner Wohnung, er war nicht dort; ich lief von einer Gasse in die andere, vergebens. – Endlich kehrte ich müde und durchnäßt in's Palais-Royal zurück und ging noch einmal in das Spielzimmer, in der Meinung, er sei zurückgekehrt; er war auch hier nicht.
Ich wollte sein Unglück in seiner ganzen Ausdehnung kennen und ging zu dem Juwelenhändler, bei welchem Juliens Perlen gekauft wurden. Der Preis dafür war noch nicht erlegt. Erst jetzt sah ich den Abgrund, in welchen mein Freund versunken war, in seiner ganzen Tiefe. Das ihm anvertraute Gold war verloren, und was hätte er noch thun können? Ich nahm mir vor, diese Schuld am andern Tage auszuzahlen, mit ihm zu sprechen, und wenn es sein müßte, zu seiner Rettung mein ganzes Vermögen zu opfern. Aber was kann nicht Alles bis morgen geschehen, was kann der Verzweifelte in der langen Nacht nicht Alles thun, und wo soll ich ihn finden? In solche Gedanken vertieft, ging ich in der Allee auf und ab; endlich nahm ich Platz an einem Tisch und ließ mir, um meinen Durst zu löschen, Eis geben; ich wollte die Nacht abwarten, um ihn noch einmal in seiner Wohnung aufzusuchen, denn ich war entschlossen, Paris nicht zu verlassen, als bis ich mit ihm gesprochen habe. – Es fing schon an dunkel zu werden; in den Gängen brannten die Gasflammen in langer Reihe, und der Garten, wo die Lampen erst jetzt angezündet wurden, erstreckte sich rings um mich in zweifelhaftem Lichte und schien um so dunkler, je größer der Glanz war, der mich rings umgab. Der Regen hatte aufgehört und an dem sich klärenden Himmel verbreiteten schon einzelne Sterne ihren Glanz. – Ich schaute zu ihrem reinen Glanze hinauf, und in meinem ruhiger pochenden Herzen tauchte Juliens Bild wieder auf. – Ein Gespräch weckte mich aus meinen Träumereien. Es war Armand's Stimme; er saß hinter mir an einem Tische, der Gegenstand aber, von welchem er mit seinem Gefährten sprach, war ein derartiger, daß ich im ersten Augenblicke aus Neugierde, später aus Schamgefühl mich zurückhielt und mich nicht umwandte, und so lauschte ich zum ersten Male in meinem Leben, wie peinlich es mir auch war und wie sehr ich mich auch dessen innerlich schämte.
»Ich habe heute wieder verloren, ich habe viel verloren!« sagte Armand.
»Ich bedauere, ich bedauere sehr,« antwortete der Andere; »doch das Rad des Glückes wird sich wieder wenden.«
»Wenn ich nur habe, womit ich es wieder in Bewegung setzen kann,« sagte Armand verdrießlich, »doch kurz, Herr Salomon, ich brauche wieder Geld.«
»Wer braucht hier in Paris nicht Geld?« antwortete der Andere gleichgiltig; »wenn in der Seine Thaler flössen anstatt Wasser, so würde an die armen Leute in Rouen davon kein Tropfen kommen.«
»Lassen wir den Scherz,« erwiderte Armand, sichtlich die Geduld verlierend, »ich brauche Geld, und von Ihnen, und sogleich.«
»Herr, sehr gern,« sprach der Andere mit all' der unangenehmen Freundlichkeit des Wucherers, »doch wer kann dafür, wenn ich kein Geld habe?«
»Sie haben kein Geld,« unterbrach ihn Armand, »und wer sonst hätte Geld, wenn nicht Sie, der Sie die ganze Jugend in Händen haben und heute oder morgen der Erbe aller Väter von Paris sein werden. Ich brauche nothwendig Geld, verlangen Sie hundert Percent auf einen Monat, wenn Sie wollen, nur verschaffen Sie mir das Geld noch heute.«
»Sie wissen ja,« erwiderte der Andere, »wie gern ich diene, besonders Ihnen, den ich so sehr schätze, aber –«
»Schon wieder ein Aber!« fiel Armand zornig ein.
»Also,« fuhr der Andere ruhig fort, »natürlich in einem Monat zu zahlen und hundert für hundert, und wie viel brauchen Sie?«
»Zehntausend Francs!« sprach Armand nach einigem Zaudern und leiser, als ob er sich selbst schämte, so viel zu begehren.
»Zehntausend Francs!« seufzte der Andere, »wissen Sie, wie viel das ist? Das ist in der Provinz eine große Erbschaft; wenn ich meiner Tochter so viel zur Mitgift gebe, so findet sie in einem Tage hundert Männer, und Sie sprechen diese Summe so leicht aus.«
»Ich brauche zehntausend Francs,« unterbrach ihn Armand, »und ich frage Sie, ob sie mir dieselben verschaffen wollen?«
»Es ist unmöglich, Herr, es ist durchaus unmöglich,« erwiderte der Andere; »was denken Sie, woher soll ich so viel Geld nehmen?«
»Aber Salomon, lieber Herr Salomon,« sprach Armand mit erstickter Stimme, »ich bedarf dieser Summe zur Rettung meiner Ehre; sehen Sie, ich spreche offen mit Ihnen, denn Sie waren immer freundlich gegen mich; verschaffen Sie mir dieses Geld und ich werde Ihnen Zeit meines Lebens dankbar sein.«
»Sehen Sie,« sprach der Andere, mit dem Kaffeelöffelchen an seine Tasse klopfend, »Menschen wie wir sollten nicht spielen; das gehört für große, reiche Herren, wir aber müssen uns das Geld erwerben.«
»Ihr Rath ist gut, sehr gut,« erwiderte Armand, und seine zitternde Stimme verrieth seine innere Aufregung, »doch jetzt kommt er zu spät; helfen Sie mir nur jetzt, und ich werde Ihnen folgen, glauben Sie mir, ich werde Ihnen sicher folgen.«
»Und wie wollen Sie mir zahlen?« fragte der Andere lauter; »denn zwanzigtausend Francs – so viel würde nämlich das Darlehen binnen einem Monat ausmachen – sind keine Summe, die man am Spieltisch so leicht gewinnen kann.«
»Sehen Sie, Salomon,« antwortete Armand, »Ihnen kann ich es sagen; dieser Tage werde ich Gesandtschafts-Secretär, meine Ernennung ist so viel als gewiß, sie ist, wie man mir sagt, bereits unterschrieben, und dann –«
»Werden wir Ihnen gratuliren,« fiel ihm der Andere in's Wort, »wir werden Ihnen vom Herzen gratuliren.«
»Aber lieber, guter Herr Salomon,« sprach Armand flehend, »scherzen Sie nicht, sondern helfen Sie mir. Wenn Sie ein Herz haben, wenn Sie das Leben eines Menschen nicht auf's Spiel setzen wollen, so verschaffen Sie mir das Geld, und ich werde Sie als meinen Wohlthäter, als meinen zweiten Vater ehren.«
»Das ist Alles schön und gut,« sagte der Andere, »und von Ihnen, der mich immer so verächtlich behandelte, doppelt erfreulich; doch so ein armer Mensch wie ich muß Sicherheit haben, und wenn Sie nicht einen Bürgen finden, so kann ich Ihnen nicht helfen. Haben Sie keine Freunde?«
»Freunde!« sprach Armand bitter, »o Du gute Seele, als ob wir Freunde hätten, wenn wir ihrer bedürfen.«
»Zum Beispiel der junge Graf,« fuhr der Andere fort, »mit dem Sie wohnen.«
»Der Graf!« sprach Armand kalt, »ich werde bei ihm nicht betteln.«
»Oder Dufey.«
»Dufey hat für mich bereits so viel gethan, daß es unbescheiden wäre, von ihm mehr zu verlangen,« erwiderte Armand, »außerdem ist die Summe so groß.«
»Gerade kommt er,« sprach der Andere, ohne Armand zuzuhören; er rief ihn und trug ihm die ganze Sache vor. Dufey überlegte einen Augenblick, endlich sagte er die Bürgschaft zu und schickte den Juden um das Geld fort, der noch einige Phrasen von Edelmuth murmelte und dann fortging.
»Auch ich habe eine Bitte an Dich!« sagte Dufey endlich mit leiserer Stimme.
»Verlange mein Leben!« stammelte Armand.
»Und versprichst Du mir's?«
»Ich schwöre es!« – Sie gingen fort. Ich fuhr aufgeregt und in Gedanken vertieft aus der Stadt hinaus.
Am andern Morgen fuhr ich zeitlich nach Paris, nahm bei meinem Banquier Geld und eilte zu dem Juwelenhändler, um ihn für Juliens Perlen zu befriedigen. »Die Rechnung ist schon gestern ausgeglichen worden,« erzählte mir der Kaufmann; »spät am Abend kam Armand und überbrachte das Geld.« – Ich überlegte, welche Opfer die Herbeischaffung einer solchen Summe meinem Freunde gekostet haben mag und wie wenig Vertrauen er zu mir hatte, und mißgestimmt, kehrte ich nach Hause zurück.
In unserem Vorsaal begegnete ich Armand; er empfing meinen Gruß kalt, ja mit sichtlicher Verlegenheit und eilte fort. Ich ging zu meiner Julie; sie fühlte sich unwohl. Am Morgen war sie noch wohl, ja sie hatte mit Armand, wie mir ihre Kammerfrau sagte, zweimal gesprochen, aber seitdem fühlte sie Kopfschmerz. Uebellaunig ging ich im Hause hin und her, bald mich nach dem Befinden meiner Julie erkundigend, bald mit ihrem Vater sprechend, bald wieder im Garten spazieren gehend. Ich hatte nirgends Ruhe. Julie war meinem Herzen so nothwendig, daß ich ohne sie keine Stunde leben konnte, und eine traurige Ahnung störte meine Seele in der ungewohnten Einsamkeit. Mittags kam sie nicht zu Tische. Endlich nach dem Diner ließ sie mich rufen.
Sie war blässer als gewöhnlich, sichtlich unruhig und aufgeregt, was ich nur ihrem Unwohlsein zuschrieb. Ich fragte sie nach ihrem Befinden und sie sagte mir, daß sie sich zwar besser, jedoch von der Migräne geschwächt fühle. Endlich gab sie mir einen Brief und bat mich, denselben der Frau von Valmont zu überbringen und selbst auf die Antwort zu warten. Ich küßte ihr die Hand, sie zitterte, und als ich sie wieder fragte, wie sie sich befinde, bat sie mich, ihr ihre Kammerfrau zu schicken, denn sie müsse sich niederlegen. Obwohl ich Julie öfter in solchem Zustande gesehen, so hatte ich sie doch nie so aufgeregt gefunden, und als ich voll Besorgniß nach Paris fuhr, nahm ich mir vor, ihren Arzt mitzubringen.
Bei der Marquise fand ich Dufey; er las ihr eben einen Brief vor, und als ich eintrat, übergab er ihn ihr, damit sie ihn selbst durchsehe. In seinem Gesichte strahlte Freude, und als auch ich meinen Brief übergab, ging Frau von Valmont in das Nebenzimmer, um, wie sie sagte, einige Anordnungen zu treffen, und ich blieb mit Dufey zurück; seine Heiterkeit überraschte mich. So hatte ich diesen Menschen nie gesehen, und obwohl meine Eifersucht seit einiger Zeit verschwunden war, so fühlte ich mich doch noch ruhiger, als ich die Gleichgiltigkeit sah, mit welcher er seine Scherze fortsetzte, als ich von Juliens Unwohlsein sprach; übrigens aber verursachte mir dieses Gespräch ein unbeschreiblich unangenehmes Gefühl. Sei es, daß der Mensch gleich den Thiereu die Anwesenheit eines Feindes instinctmäßig fühlt, sei es, daß man einen Menschen, den man einmal gehaßt hat, auch wenn man den Fehler später einsieht, doch nicht aufhört, zu hassen: genug an dem, Dufey's Gegenwart war mir unangenehm, und ich fühlte meine Brust fast erleichtert, als Frau von Valmont in den Saal zurückkehrte, und Dufey, nachdem sie ihm noch ein Wort zugeflüstert hatte, wegging.
Du weißt, in welchem Verhältniß ich zu Frau von Valmont stand, und wenn Du bedenkst, daß ich bei der Frau war, von welcher ich mich geliebt glaubte und der gegenüber ich mich eher fremd fühlte, da ich als Verlobter einer Andern dort war, so kannst Du Dir meine Lage vorstellen, in der ich eine Stunde nach der andern verrinnen sah.
Man zündete bereits Licht an, Frau von Valmont selbst war schon unruhig, der Kammerdiener war noch nicht mit dem Gewünschten zurückgekehrt, und Julie hatte gebeten, daß sie mich ohne dieses nicht nach Hause kehren lasse; so zurückgehalten, mußte ich noch bleiben, und daheim war Julie krank. – Noch nie hatte mir die Zeit so lang geschienen. Wir conversirten, und Frau von Valmont war eine gescheidte Frau, aber am Ende ging uns doch der Faden aus. Nur das Herz ist die unerschöpfliche Quelle, aus welcher das Gespräch ohne Langweile fließt; wenn das Herz schweigt, so reicht die ganze Welt nicht hin, um auch nur eine Stunde angenehm auszufüllen.
Es war schon neun Uhr vorüber, und da ich das Warten nicht länger ertragen konnte, so sagte ich: daß ich einen Arzt hinausbringen müsse, daß Julie jene Sache heute ohnedies nicht benöthigen könne, daß ich morgen frühzeitig kommen, Alles von den Dienstboten der Marquise übernehmen und es hinausbringen wolle, noch bevor meine Braut erwacht ist.
Frau von Valmont gerieth in sichtliche Verlegenheit, sie hielt mich zurück, aber vergebens; endlich ihre Augen auf mich richtend, fragte sie: »Ob ich Julie denn wirklich so sehr liebe?«
Es lag etwas Sonderbares in dieser Frage, und in meinen Umständen etwas, was mich in Verwirrung brachte. Ich hatte es so vielmal gehört, daß mich diese Frau liebe, daß ich es zuletzt selbst glaubte, und indem ich Worte suchte, welche ihre Gefühle weniger verletzen sollten, schwieg ich.
Sie wiederholte ihre Frage, und noch mehr überrascht, fragte ich sie endlich, wie sie zweifeln könnte.
»Wir täuschen uns in nichts so sehr, als in den Gefühlen,« sagte Frau von Valmont, »und Sie werden es für natürlich halten, daß Juliens treueste Freundin in diesem Augenblicke, wo deren ganze Zukunft auf dem Spiele steht, zu dieser Frage berechtigt ist.«
Befreit von meiner Besorgniß und mich meiner Einbildung fast schämend, welche mir die Frage der Frau von Valmont als aus einem andern Grunde entspringend erklärte, ließ ich meinem Herzen freien Lauf. Ich sagte ihr, wie sehr ich Julie liebe, daß die schönste Hoffnung meines Lebens in Erfüllung geht, da ich sie mein nennen dürfe; daß ich ohne sie nicht leben könne, und daß ich, meine Zukunft nur ihr weihend, sie beglücken werde; kurz ich sagte Alles, was nur Leidenschaft eingeben kann, und was man nur dann sagen kann, wenn die Liebe echt genug ist, um auch die Uebertreibungen wahrscheinlich zu machen.
Frau von Valmont schwieg, sie schlug die Augen nieder und es zeigte sich in ihrem ganzen Wesen so viel Befangenheit, eine solche unbeschreibliche Mischung von Reue und Verwirrung, daß ich unruhig wurde. Ich fragte um die Ursache, sie antwortete zuerst ausweichend. Endlich, als ich überzeugt war, daß sie etwas vor mir verheimliche, und ich sie bat, es mir zu sagen, und als ich sie auf ihre Ausflüchte mit immer größerer Unruhe bat, fragte sie auf's Neue: »Ob ich denn der Liebe Juliens sicher sei?«
Seitdem Julie es mir selbst gesagt hatte, war ich von meinem Glücke so überzeugt, daß ich nicht weiter zweifelte; aber diese Frage und der Brief Juliens, und Dufey, der eben zuvor erst das Zimmer verlassen hatte, riefen auf einmal meine ganze Eifersucht wach.
»Etwas ist geschehen,« dachte ich bei mir; Frau von Valmont mußte etwas wissen, und leidenschaftlich fragte ich sie wieder, doch sie schwieg abermals. Endlich durch meine Ungewißheit zur Verzweiflung gebracht, stürzte ich ihr zu Füßen und bat sie bei Allem, was ihr heilig und theuer auf Erden, daß sie vor mir nichts verheimlichen möge. Ich sagte ihr, wenn sie von Julien wüßte, daß sie mich nicht liebe, so solle sie mir es jetzt sagen, wo noch Zeit dazu ist: daß ich in meiner Brust Kraft genug fühle, zu entsagen, aber nicht, diesen Zweifel zu ertragen; ich sagte ihr, was ich von Dufey ahnte, und daß ich ihr ewig dankbar sein würde, wenn ich die Wahrheit, und sei diese noch so schrecklich, von ihr erfahre, und so Dem entgehe, was auf dieser Welt meinem Herzen am meisten weh thun würde: dem Gefühle, daß ich Julie unglücklich gemacht. Meine ganze Brust war so durchwühlt durch neue Zweifel, daß die fürchterlichste Wahrheit mir nach diesem Zustand, wie Seligkeit erschienen wäre.
Frau von Valmont blickte mich mit thränenerfüllten Augen an. »Sie lieben Julie mehr, als ich gedacht hatte,« sprach sie endlich; »ich bedauere Sie.«
»Um Gotteswillen!« rief ich außer mir, »seien Sie barmherzig, quälen Sie mich nicht ferner; sagen Sie mir, was Sie wissen, und wäre es selbst das, daß mich Julie nicht liebt; selbst wenn es das wäre, daß sie einen Andern liebt, so will ich Sie segnen für diese Nachricht, nur erretten Sie mich aus dieser Ungewißheit!«
»Und versprechen Sie, daß Sie nichts thun werden,« sprach die Marquise mit zitternder Stimme, »daß Sie, was Sie auch immer hören mögen, ruhig sein werden?«
»Ich verspreche es!« sagte ich mit gepreßtem Herzen.
»Auf Ehre?«
»Auf meine Ehre!«
Die Marquise ging in das Nebenzimmer. Ich zitterte am ganzen Körper, niemals hatte mein Herz in größerer Aufregung gepocht. Nach einigen Minuten kam sie wieder heraus. – »Was Sie vermutheten,« sprach sie stockend, »Sie sind ein Mann, und was Sie auf Ehre versprochen, werden Sie halten –«
»Was Sie vermutheten,« fuhr Frau von Valmont fort, »ist wahr – Julie liebt Dufey.«
Ich war vernichtet.
»Lesen Sie diese Zeilen,« sprach sie weiter, mir den Brief in die Hand gebend, welchen ich selbst gebracht »und überzeugen Sie sich von der Wahrheit meiner Worte.«
Der Brief lautete ungefähr so:
»Ich bin krank, so sehr ist mein Herz aufgeregt. Ich liebe Dufey. Du weißt, wie lange ich gegen dieses Gefühl kämpfte, aber vergebens. Das Herz überwand meinen Willen, und ich habe keine Kraft mehr, zu widerstehen. – Als ich neulich durch Dich auf seinen Brief antwortete und Du bei Deiner Freundschaft versprachst, keinen Brief mehr von ihm anzunehmen, da faßte ich meinen Entschluß. Gustav ist eine so edle Seele und liebt mich so sehr, daß ich überzeugt war, ich würde in seinen Armen, wenn auch nicht glücklich, doch wenigstens zufrieden sein können, daß in Erfüllung meiner Kindespflicht mein Herz seine alten Gefühle vergessen werde. Vergebens, der Brief, welchen mir Dufey heute durch Armand sandte, scheuchte mich auf aus meiner eingebildeten Ruhe, in meinem Herzen erhob sich die Liebe allgewaltig, ich habe keine Wahl mehr. Was ich in diesem Augenblicke leide, was ich noch ferner leiden werde, wenn ich, auf meine Vergangenheit zurückblickend, vielleicht den Fluch eines Vaters, das Unglück eines guten Menschen vor mir sehen werde – weiß der Himmel; ich weiß nur, daß ich nicht anders kann. Wenn ich sündige, so vergebe mir der Himmel; warum legte er solch' ein Gefühl in dieses Herz! Liebt er mich doch, wird er doch glücklich sein in meinen Armen! Was kümmert mich das Andere! O, meine Freundin! Möge ich verflucht sein auf ewig, möge ich meinen Vater, ja die ganze Welt unglücklich machen, nur er liebe mich, und Du sollst keine Klage von meinen Lippen hören. Ich kann nicht weiter schreiben, mein Kopf ist so verwirrt, daß ich kaum einen Gedanken festhalten kann, mein Herz bebt bei diesem Worte, und dennoch erfüllt mich eine unbeschreibliche Glückseligkeit, wenn ich daran denke, daß ich die Seine werde. Heute Abend, wenn es dunkel wird und mein Vater zur Ruhe gegangen ist, kommt er. Ich that es ihm durch Armand zu wissen, halte indeß Gustav bei Dir auf jede mögliche Art. Die Postpferde warten, und noch vor Mitternacht fahren wir fort. Dufey ist zu einer fernen Gesandtschaft geschickt worden und nimmt mich mit. Gott segne Dich für Deine Liebe. O, daß ich meinen kranken Vater so verlassen muß! Gott, mein Gott! Was wird aus mir werden?«
Was ich empfand, als ich diese unglückseligen Zeilen zu Ende las, kann ich nicht beschreiben; wenn Du in meine Brust sehen könntest und den Schmerz sehen würdest, welcher dasselbe noch in diesem Momente, wo zwischen mir und ihr so viele an Leiden reiche Jahre stehen, auch bei ihrer Erinnerung schon erfüllt, so würdest Du es ahnen. – Ich schwieg.
Frau von Valmont begann mich zu trösten; eine fürchterliche Ruhe, die der Verzweiflung, erfüllte meine Seele. – Vieles in dem Briefe war noch räthselhaft, Juliens früheres Verhältniß zu Dufey, und besonders Armand's Einfluß. Die Marquise, beinahe erfreut über meine scheinbare Ruhe, erzählte mir Alles.
Dufey liebte Julie schon längst, ihr Vater gab die Verbindung aus Adelsstolz nicht zu, und sie konnten einander nur heimlich sehen. Einmal wurde der Alte, ich weiß nicht durch wen, von ihrem Verhältniß in Kenntniß gesetzt; doch Julie, die von einem alten Hausfreund, welchem der Graf den Plan seiner Rache mitgetheilt, gewarnt wurde, schrieb an Frau von Valmont, und da diese Dufey zur Vorsicht ermahnte, so blieb die ganze Sache auch ferner geheim. Ich selbst überbrachte Frau von Valmont, den Brief, ich selbst war das Werkzeug des Betruges, dessen Opfer ich war. Als Julie sich später immer mehr von dem unerschütterlichen Willen ihres Vaters und von meiner Liebe überzeugte; als sie ferner die Furcht nicht überwinden und sich zu dem Geständniß nicht entschließen konnte, durch welches mein Glück zerstört worden wäre, nahm sie sich vor, sich von Dufey zu trennen. Und nachdem zwischen Dufey und ihr auch einige Zwistigkeiten vorgefallen waren, und hauptsächlich nachdem sie ihrem Vater geschworen hatte, die Meine zu werden, wurde ihr Vorsatz zum festen Entschluß. Dufey schrieb und bat öfter, jedoch vergebens. Julie verlangte ihre früheren Briefe zurück und beschwor Frau von Valmont, welche die Vermittlerin zwischen ihnen war, bei ihrer Freundschaft, von Dufey keinen Brief mehr anzunehmen. Er schickte ihr daher seine letzten Zeilen durch Armand. Armand's Schicksal hing von ihm ab; durch ihn wurde Jener von seinen Geldverlegenheiten befreit, er war sein Diener und vollführte seinen Willen. Welche Wirkung dieser Brief hatte, ersah ich aus Juliens Zeilen, es war kein Geheimniß vor mir. Ich staunte. Die Marquise zeigte mir eine Menge Briefe, welche sie von Dufey in Juliens Namen zurückverlangt hatte und die noch bei ihr waren sowie auch jener letzte, bei dessen Lesen ich sie durch mein Kommen unterbrochen hatte. Ich sah die Schrift an, das Datum der Briefe, Juliens Namen und die Adresse; ich las einzelne Zeilen und lachte in meiner Qual. Als ich mich am meisten geliebt glaubte, als ich mich am glücklichsten fühlte, schrieb sie einem Andern, lachte sie vielleicht meiner Gefühle, verhöhnte sie vielleicht meine leidenschaftliche Anhänglichkeit, und ich vertraute ihr! Und Armand! Er, den ich als Freund liebte, wie sonst Niemanden auf der Welt, für den ich mein Leben gegeben hätte, und der mich betrog, mich für eine kleine Anstellung, für ein paar tausend Francs verkaufte und jetzt vielleicht mit ihnen meine Leichtgläubigkeit verlachte. Ein unbekanntes Gefühl erfüllte meine Brust, ein Wunsch, den ich nie gefühlt hatte, aber von dem ich ahnte, daß es die Rache sei. – Ich nahm die Briefe und meinen Hut und wollte fortgehen. Frau von Valmont trat mir in den Weg. »Wohin gehen Sie?« fragte sie beunruhigt. – »Zu meiner Braut!« antwortete ich bitter.
»Um Gotteswillen, Gustav!« rief sie, mich an der Hand fassend, »bedenken Sie, was Sie thun; seien Sie ein Mann!«
»Ein Mann, nicht wahr, ein Mann?« sprach ich lachend, »ich war lange genug ein Kind; ich hatte lange genug Vertrauen, ich war leichtgläubig bis zur Lächerlichkeit; aber fürchten Sie nichts, jetzt werde ich ein Mann sein, und wenigstens werde ich mich nicht mehr auslachen lassen.«
»Gustav,« sprach Frau von Valmont, »erinnern Sie sich an Ihr Versprechen, an Ihr Ehrenwort, und lassen Sie mich nicht bereuen, daß ich Ihren Wunsch erfüllt habe.«
»O, fürchten Sie nichts,« entgegnete ich zitternd, »ich werde ruhig sein, ich werde sanft und artig sein, ich werde Niemanden beleidigen; nur will ich vor sie hintreten und sie fragen, warum sie mich betrogen, warum sie mein Leben zerstört, warum sie mir Treue geschworen habe, wenn sie einen Andern liebte; warum sie meine Gefühle in den Armen eines Andern verlacht habe. Ich will sie fragen – was weiß ich, doch sehen muß ich sie; ich muß meinen Fluch aussprechen, oder zu Grunde gehen unter der Last meiner Empfindungen. O, fürchten Sie nichts, Ihre Freundin ist sicher vor mir, möge sie leben und glücklich sein; was gehen mich Weiber an, ich brauche Blut! Aber Derjenige, für den sie mein Herz in den Staub getreten, für den sie meine Liebe verachtet, wird nicht leben; er wird nicht triumphiren über mich, er soll, nicht mit falschem Bedauern meinen Namen aussprechen und sagen können, es sei schade um mich, denn ich sei ein guter Mensch gewesen, und der Himmel weiß, was noch. Weder er, noch Armand soll über meine Verzweiflung lächeln; morgen, ich schwöre es, wird Einer von uns Dreien nicht mehr am Leben sein.«
»Sie sind schrecklich in Ihrem Zorn, aber ich glaube Ihren Worten,« sprach Frau von Valmont; »Sie sind ein Ehrenmann.«
»Ein Ehrenmann!« rief ich, hingerissen von meinem Schmerz, »Sie trauen meinen Worten? Wissen Sie denn, was ich fühle, daß Sie mich an Worte erinnern? Nehmen Sie einer Mutter ihr Kind und sagen Sie ihr, es schicke sich nicht, zu weinen; möge sie immerhin schwören, daß sie nicht weinen werde, glauben Sie, sie werde ihr Versprechen wirklich halten? Und die Mutter hat nicht mehr verloren als ich; sie bedarf der Thränen nicht mehr, als ich des Blutes. Sie erinnern mich an ein Versprechen, an einen Schwur! Hat nicht auch Julie mir versprochen, hat nicht auch sie mir Liebe geschworen? Und jetzt – sie hat ihre Liebe, mich der Haß hingerissen, und wer weiß, ob dieser nicht stärker ist.«
Frau von Valmont hielt mich noch immer zurück; ich strebte fortzukommen. Endlich stieß ich sie, mich vergessend, zur Seite und ging fort.
Als ich hinauskam, war ich ruhiger. Die stille Nacht, die Sterne beschwichtigten den Sturm meines Herzens ein wenig, und anstatt meiner Leidenschaft gewann immer mehr ein unbeschreiblicher Schmerz Macht über meine Seele. Ich ließ meinen Wagen am Gartenthor und ging zu Fuß nach dem Hause. Alles war still, nur Juliens Fenster war noch beleuchtet. Ich eilte die Treppe hinauf, meine Füße zitterten, ich konnte kaum über den Gang schreiten, über welchen ich so oft zu Julien gegangen war; diese Thür hatte sich, wie das Thor des Paradieses, sonst immer nur einem Glücklichen geöffnet, und jetzt! – – –
Ich lehnte mich an die Wand und schöpfte tief Athem, so beklommen war mein Herz. – Endlich ging ich hinein. Die Kammerfrau war eben mit dem Einpacken eines Koffers beschäftigt. Erschrocken stellte sie sich vor mich hin. »Die Gräfin schläft!« sprach sie mit zitternder Stimme. Ich stieß sie von mir und ging zu Julien hinein. Die Kammerfrau lief fort. Vor mir standen Julie und Dufey. Julie stand bleich, wie eine Bildsäule da, die Hand auf den Tisch gestützt, sie zitterte an allen Gliedern; Dufey war ruhig, in seinem Gesichte zeigte sich feste Entschlossenheit. Auch er war blaß, aber der flammende Blick, welchen er auf mich warf, zeigte, daß er es nicht aus Furcht war. – Wir schwiegen. – In meiner Seele kämpften Rache und Schmerz, und wenn ich einen Dolch in der Hand gehabt hätte, so weiß ich nicht, ob ich sie oder mich damit durchstochen hätte; da öffnete sich die Thür, und von der zitternden Kammerfrau gefolgt trat der alte Graf in seinem Schlafrock in's Zimmer. Die Dienerin, die Juliens Vater aus Furcht vor meiner Rache aufgeweckt hatte, ward fortgeschickt, und wir blieben allein.
Der Graf schwieg und blickte düster umher; nie war er mir so ehrwürdig erschienen, als unter der Wucht dieses stummen Schmerzes. Endlich sprach er, zu Dufey gewendet, würdevoll: »Daß ich Sie hier sehe und in dieser Stunde, das rechtfertigt die Verachtung, die ich stets gegen Sie hegte. Was Sie meiner beleidigten Ehre schuldig sind, das werden Sie, wenn auch gestern erst geadelt, vielleicht wissen; und wenn ich es auch in einer andern Lage für eine Schmach hielt, den Enkel meines Dieners herauszufordern, so können Sie doch gewiß sein, daß ich auch jetzt nicht darauf vergesse, daß ich einen Nichtswürdigen züchtige.«
Dufey's Wangen glühten, in seinem ganzen Wesen zeigte sich Wuth; doch sich mäßigend, antwortete er mit erstickter Stimme, der Graf werde ihn bereit finden.
Und nun wandte sich der Graf an seine Tochter. »Julie,« sprach er, und seine Stimme zitterte und der Ausdruck der Festigkeit in seinem Gesichte wich dem unendlichen Schmerze, »Du hast die schönste Hoffnung meines Lebens zerstört. Nach Dem, was geschehen, ist Gustav frei, und indem ich ihm sein Wort zurückgebe, beraube ich mich der letzten Freude meiner alten Tage; ich habe Dich geliebt, und Du erfüllst meine letzten Tage mit unendlichem Kummer; ich habe nur für Dich gelebt, und Du stößest mir einen Dolch in's Herz; Jahre lang hatte ich keinen andern Gedanken, als daß ich Dich glücklich sehen möchte, und Du bringst Schande über mein greises Haupt. Ich könnte Dich verfluchen,« sprach er mit zitternder Stimme und sein Auge glühte, »ich könnte Dich verfluchen, aber nein – entsage diesem Manne.«
Julie stand zitternd da und schlug die Augen nieder – sie schwieg.
»Als Du geboren wurdest,« fuhr der Alte weicher gestimmt fort, »da pries ich Gott; ich hob Dich gen Himmel empor und betete unter Freudenthränen: »»Erhalte sie, mein Gott!«« Der klare Blick Deines Auges, das Lächeln Deiner kindlichen Lippen erfüllten mich mit Freudenthränen, und obwohl verbannt und in der Fremde, obwohl arm und verlassen, vergaß ich in jenem Augenblick doch Alles, so glücklich fühlte ich mich durch Deinen Besitz. O, zwinge mich nicht, jenen Augenblick zu verfluchen – entsage diesem Manne.«
Julie schwieg.
»Denke an Deine Mutter,« sprach der Alte weiter, »doch Du kanntest sie ja nicht. Denke Dir also ein Wesen, das nur in Dir lebte, das bis zum letzten Hauche mit dem ganzen Herzen nur an Dir hing; denke Dir eine Frau, die Dich unter Schmerzen geboren, unter Thränen gepflegt und zitternd behütet hat. Als sie starb, segnete sie Dich und sprach, mich ansehend: »»Liebe Deine Julie, sie wird anstatt meiner Deine Liebe belohnen; nimm' keine zweite Frau, dieses Kind wird Dir mehr Freude bieten, mehr Dankbarkeit bezeigen, als Söhne es thun würden; liebe sie von ganzem Herzen.«« Und ich befolgte ihren letzten Wunsch, und jetzt, da ich alt geworden, da ich mich meinem Grabe nähere, soll ich allein auf der Welt stehen und Deine Mutter und ihren letzten Wunsch verfluchen?! Julie, überlege was Du thust – entsage diesem Manne.«
»Dufey hat meinen Schwur,« sprach Julie mit erstickter Stimme, »ich kann mein Wort nicht zurücknehmen.«
»Und hast Du mir nicht das Entgegengesetzte geschworen?« sprach der Alte aufgeregt; »oder bindet der Schwur, welchen Du Deinem Vater leistetest, Dein Gewissen nicht? Doch,« fuhr er ruhiger fort, »es ist gut; ich hätte nicht gedacht, daß ich in meinen alten Tagen so weit komme, diesen Menschen um etwas bitten zu müssen, aber es sei. Sie lieben meine Julie, mein Herr, nicht wahr, Sie lieben sie?« sprach er zu Dufey gewendet; »wenigstens sagten Sie es, gewiß haben Sie ihr geschworen, daß Sie sie lieben; beweisen Sie es und entsagen Sie ihr.« Dufey schwieg. Der Alte fuhr fort: »Sehen Sie sie an und sagen Sie, ob Sie noch glauben, sie glücklich zu machen. Von ihrem Vater verflucht, von ihren Bekannten, von der ganzen Welt verachtet, wirft sie sich Ihnen in die Arme, nicht weil sie Sie noch liebt, nicht weil sie Glück hofft, sondern weil ihr Eid sie bindet, weil sie sich aufopfert. Könnten Sie dieses Opfer annehmen?«
»Julie ist in dem Alter,« erwiderte Dufey ruhig, »wo sie über sich frei verfügen kann und wo die Gesetze dieses ihr Recht selbst gegen ihren Vater schützen; wenn sie sich für frei hält und mich nicht liebt, so trete ich zurück, sonst nicht.«
»Also gut,« sprach der Alte wieder, »jetzt kennst Du ihn, jetzt konntest Du seine ganze Niederträchtigkeit sehen; es ist ein Vater, den er beleidigt hat, und welcher der Wohlthäter seiner ganzen Familie ist – und er spricht kalt vom Gesetze, er sagt ruhig, das Kind dieses Vaters sei volljährig, und der Vater habe, weil er dem Grabe nahe ist, kein Recht auf sein Kind. Sage ihm also, daß Du ihn verachtest, daß Du ihm entsagst, daß ich noch eine Tochter habe, und daß Du dies bleiben willst.«
»Mein Vater!« sprach Julie, und in ihrer Stimme war etwas, was mein Herz im Innersten erschütterte, »wenn Sie wüßten, wenn Sie nur ahnten, welche Qualen Ihre Worte meinem Herzen verursachen, so würden Sie nicht so sprechen. Aber der Himmel weiß, daß ich Ihren Befehlen nicht gehorchen kann.«
»Nicht?« fiel der Alte ein, und seine Wangen glühten; »bedenke wohl, was Du thust; von diesem Augenblicke hängt Deine Zukunft ab, und vergiß nicht, wie viel Du Deinem Vater schuldig bist.«
»Und glaubst Du, daß ich dies vergessen könnte?« sprach Julie und ein bitteres Lächeln flog über ihr Gesicht; »wie könnte ich vergessen, daß ich Dir mein Leben verdanke, daß ich die Qualen, welche ich erdulde, die Unterdrückung, unter der ich leide, daß ich Alles Dir verdanke? In diesem Herzen ist kein Schmerz, aus meinen Augen fließt keine Thräne, die mich nicht an Dich erinnert.« – Julie sprach diese Worte, von Schmerz hingerissen; ihre Wangen glühten; der Alte schwieg. »Du sagst, Du habest, mich geliebt,« fuhr Julie erbittert fort; »o, wenn Du glaubst, daß, was Du gegen mich fühltest, Liebe war, so bedauere ich Dich, denn Du hast dieses Gefühl nie gekannt. – Als ich noch ein Kind war und meine wenigen glücklichen Jahre unter der Obhut meiner sanften Marie verlebte, kamst Du täglich, zuweilen einmal wöchentlich zu Deiner Tochter; so oft Du mich ansahst, war Dein Blick ernst und streng; anstatt sanfter Worte gabst Du mir Geschenke, und ich küßte Dir zitternd die Hand. Die Leute, die bei Dir waren, sprachen Alle mit so tiefer Ehrfurcht von Dir, daß ich Dich für ein höheres Wesen hielt, und wenn ich Marie immer weinen sah, so oft sie aus Deinem Zimmer kam, wenn ich sah, wie Deine Dienstleute sich fürchteten, sobald Du Dich nähertest: was Wunder, wenn auch ich in Deiner Gegenwart Furcht fühlte. Marie starb und Du schicktest mich in ein Kloster; Jahre lang sah ich Dich kaum einige Male, und auch dann nur auf Augenblicke, und als ich in meinem fünfzehnten Jahre in Dein Haus zurückkehrte und Dich wieder von Verehrern umgeben, wieder in Deiner Erhabenheit sah, war meine kindische Furcht größer als vordem. Du gabst mir Perlen, führtest mich in glänzende Salons, schlepptest mich von Unterhaltung zu Unterhaltung, kurz, ich genoß Alles, was sich Andere nur wünschten, in reichlichem Maße – doch Alles nur, weil Du es befahlst, Alles aus Gehorsam, weil Du von Deiner Tochter nichts als Gehorsam verlangtest, bis ich mich daran so sehr gewöhnte, daß ich fast vergaß, daß ich auch einen Willen habe.«
»Da kam mein erster Gemahl in unser Haus, er war mit Dir von beinahe gleichem Alter, ein eitler, niederträchtiger Mensch, den ich vom ersten Augenblick an haßte, aber er war reich und von großer Familie. Nach wenigen Wochen gabst Du mir zu wissen, daß er mein Gemahl sein werde. Ich kannte das Unglück, zu welchem Du mich verurtheiltest, noch nicht in seiner ganzen Größe, aber ich schauderte vor dem Gedanken, mein Leben mit diesem Menschen verbringen zu müssen. Ich schauderte, aber ich schwieg; Du fragtest mich ja nicht, ob ich ihn liebe, ob ich seine Gattin sein wolle. Er war reich und von großer Herkunft, und Dein strenger Blick sagte mir, daß all' mein Bitten vergebens wäre. Schweigend that ich Deinen Willen.«
»Wie viel ich in den Armen dieses Ungeheuers gelitten habe, weißt Du selbst; endlich war der Himmel gnädiger als Du und befreite mich. – Ich war zweiundzwanzig Jahre alt; was Frauen je gelitten, hatte ich bereits erduldet, und ich wußte nicht, was Freude sei. Da sah ich Cäsar; nie hatte sich vor ihm ein Mensch mir liebend genähert, stets hatte ich nur Deine ernsten Befehle und das leichtsinnige Geschwätz meiner sogenannten Freundinnen gehört; aber ich kannte noch nicht das Wort, das, aus der Tiefe des Herzens kommend, zum Herzen spricht. Von ihm hörte ich es zum ersten Male – ich liebte ihn. Wäre er wer immer gewesen, mein Herz fühlte sich in seiner Verlassenheit so unglücklich, ich sehnte mich so heiß nach Gefühlen, daß ich vielleicht auch einen Andern geliebt hätte. Ich war einen Augenblick glücklich. Aber Du bemerktest es, und Deine Tochter sollte nicht glücklich sein. »»Dufey's Großvater war unser Diener,«« sprachst Du kalt, »»und Du darfst ihn nicht lieben.«« Was kümmerten Dich die Thränen Deiner Tochter? Was kümmerte es Dich, daß Du ihrem Herzen die letzte Freude raubtest? Die eingebildete Erhabenheit Deines Namens wird aufrecht bleiben und Deine Ahnen werden Dir nicht vorwerfen können, daß Du Deine Tochter glücklich gemacht habest. Ich gehorchte abermals, denn ich kannte Deinen eisernen Willen, und ohne Widerspruch ging ich nach Avignon. Wenn Du ein Herz hast, so kannst Du Dir vorstellen, was ich gelitten habe; aber sage selbst: Hast Du je von mir einen Widerspruch, eine Klage vernommen? Cäsar kam mir nach, aber ich hörte ihn nicht an; indem ich meinem eigenen Entschluß zuschrieb, was ich auf Deinen Befehl that, entsagte ich auch Dem, was auf Erden meine einzige Hoffnung war, nämlich, daß er mich achten werde; er erinnerte mich an mein gegebenes Wort, an meinen Eid, und ich selbst nannte mich eidbrüchig. »»Er wird mich verachten,«« dachte ich mir, »»er wird auf Dich verzichten, Dein Bild aus seiner Erinnerung reißen, Du wirst unglücklich sein, aber Du wirst den Befehl Deines Vaters erfüllt haben.««
»Cäsar,« fuhr Julie nach einer kleinen Pause fort, »kannte dieses Herz zu gut, als daß er es selbst nach meinem eigenen Geständniß für treulos hätte halten können. Er kannte Deine Ansichten und die Macht, welche Du über mich ausübtest, und hörte nicht auf, mich in seinen Briefen an seine Liebe zu erinnern. Da brach die Juli-Revolution aus. Wenn ich früher zuweilen noch hoffen konnte, so hatte jetzt Alles ein Ende; ich kannte Deine Ansichten und wußte, daß ich nach Allem, was Cäsar in diesen Tagen gethan, niemals Deine Einwilligung erlangen könne, und daß mir nichts Anderes übrig bleibe, als zu entsagen.«
»Doch Cäsar's Briefe sprachen von seiner Leidenschaft, und Frau von Valmont machte mir zu wissen, daß er gleich nach der Revolution eine ihm angebotene Gesandtschaft nur deshalb nicht angenommen habe, weil er Paris, wo er mich sehen konnte, nicht verlassen wollte. Ich hatte längst aufgehört, mich auf mein Glück zu verlassen, alle meine Wünsche zielten nur auf das Glück meines Geliebten ab, und obwohl so viel Treue mich mit Freude erfüllte, so war mir doch der Gedanke unerträglich, daß Derjenige, welchen das Schicksal vielleicht zu einer großen Zukunft bestimmt hatte, seinen Beruf meinetwegen verfehlen sollte; ich mußte seine letzten Hoffnungen zerstören. Ich faßte einen Entschluß. Sie, Gustav, liebten mich, ich kannte Ihre edle Seele, und wenn auch nicht Liebe, so fühlte ich doch aufrichtige Freundschaft für Sie. Ich theilte der Valmont meine Absicht mit, und Sie hielten sich für geliebt.«
»Vergebung, mein Freund, für diese Täuschung, ich habe dafür genug gelitten. Aber was konnte ich thun? Ich sah Ihre treue Liebe, ich war überzeugt, daß ich Sie wenn auch durch geheuchelte Liebe, glücklich machen könne. Meine Tante, die ich so sehr liebe, sah durch unsere Verbindung den schönsten Wunsch ihres Lebens erfüllt; mein Vater wird sich freuen, und Dufey wird ungehindert auf seiner Laufbahn fortschreiten können – wie viel Glück hing von mir ab, und wie konnte ich widerstehen! Ihr Männer, die Ihr im Gefühle Eurer Freiheit nichts Höheres kennt als Euch selbst, und die Ihr eine Welt aufopfern würdet, nur um Euch nicht vor Euch selbst zu erniedrigen, Ihr wißt nicht, daß das Weib inniger liebt, als Ihr, und daß es Augenblicke gibt, in welchen es Alles aufopfern kann; es gibt Menschen, für welche es sich Jahre lang zu verstellen bereit ist; Ihr wißt nicht, was es heißt, vor einem Menschen zu zittern, und nicht wagen, die Wahrheit zu sprechen; Ihr habt nicht gelogen, weil Ihr niemals geliebt, Euch nie gefürchtet habt; unser Schicksal ist anderer Art.«
»Warum ich meinen Vorsätzen nicht treu geblieben bin, warum ich Cäsar's Briefe angenommen habe, nachdem ich mich entschlossen hatte, einem Andern anzugehören? Warum ich nicht widerstand, als ich, endlich nach Paris zurückkehrend, ihn treu fand und seiner Leidenschaft nichts Anderes entgegensetzen konnte, als meinen Entschluß, welchem mein Herz vom ersten Augenblicke an widersprach? – Was weiß ich! Wer in der Liebe nur seinem Verstande folgt, wer, bevor er die geliebte Person umarmt, noch rechnen kann, und in der Aufregung Vergangenheit und Zukunft nicht vergißt, der hat nie geliebt; und wenn ich nicht zu schwach wäre, zu widerstehen, so würde ich dem Befehle meines Vaters nicht gehorcht haben, und ich könnte glücklich sein.«
»Als Sie, Gustav, nach Paris kamen, war mein Entschluß geändert; ich sah Cäsar täglich, wir trafen in einem entfernten Stadttheil zusammen, und nur die Valmont, bei welcher ich meine Kutsche warten ließ, wußte um unser Geheimniß. Sie können sich die Gefühle vorstellen, mit welchen ich Sie erblickte, Sie können sich die Qual denken, mit welcher so viele Beweise Ihrer Liebe mein Herz erfüllten. Als Sie in Paris zum ersten Male in unser Haus kamen, machte mir ein guter Freund meines Vaters zu wissen, daß dieser unser Geheimniß kenne und den andern Tag Cäsar in unserem geheimen Zusammenkunftsort erwarten werde. Ich kannte meinen Vater und Cäsar, und zitterte vor den Folgen des Zusammentreffens; nachdem ich durch Sie von dieser Gefahr errettet wurde, war mein Herz dennoch nicht erleichtert, denn jetzt ahnte ich zum ersten Male die ganze Leidenschaftlichkeit Ihrer Liebe, und wenn ich mir auch früher vorgenommen hatte, mit Ihnen offen zu sprechen, so fehlte mir dann doch der Muth dazu. Ich lebte in unendlicher Unruhe. Von einer Seite Dufey, an welchen ich durch einen heiligen Eid gebunden war, von der andern Seite Sie, dessen Leidenschaft ich einst selbst angefacht hatte und den ich jetzt verlassen sollte; hier mein Geliebter, dort mein Vater, und was ich auch immer that, ich mußte in jedem Falle einen von Beiden beleidigen!«
»Oft faßte ich den Entschluß, Ihnen Alles zu entdecken; aber wenn Sie endlich kamen und ich Ihre Liebe sah und fühlte, wie viel Schmerz Ihnen mein Geständniß verursachen würde – schwieg ich wieder, und endlich überließ ich Alles dem Schicksal. Da ereignete sich das Unglück, daß mein Vater krank wurde. Ich nahm den Wunsch meines Vaters für den Fingerzeig des Schicksals und faßte den Vorsatz, den Eid, mit welchem ich Ihnen ewige Treue gelobte, nie zu brechen. Cäsar schrieb mir, ich schickte ihm seine Briefe zurück, und zuletzt bat ich die Valmont, ihn in meiner Gegenwart nicht einmal zu erwähnen; ich litt, aber mein fester Vorsatz verlieh meinem Herzen Ruhe und zuweilen eine Art von Befriedigung. Da kam Armand und brachte mir einen Brief von Cäsar. Ich wollte ihn nicht erbrechen. Allein Armand's Bitten, die bekannten Schriftzüge, die Ueberzeugung, daß ich die Abschiedsworte Cäsar's, der mir doch nichts zu Leide gethan, nicht zurückweisen dürfe, kurz, Alles widersprach meinem Vorsatz – und ich erbrach den Brief. Das Uebrige wissen Sie; ich liebe Cäsar, Sie werden meine Handlungsweise begreifen.«
Bewegt stammelte ich einige Worte; der alte Graf warf auf seine Tochter einen kalten Blick. »Ist es also Deine entschiedene Absicht, mein Haus zu verlassen?« sprach er endlich mit zitternder Stimme.
»O, mein Vater!« seufzte Julie, »könnten Sie Ihre Tochter von Ihrem Angesicht verbannen?«
»Für Dufey's Gattin ist in meinem Hause kein Platz,« erwiderte der Alte ernst, »Du mußt wählen.«
»Vater!« fiel ihm Julie in's Wort, »seien Sie nicht grausam gegen mich; jetzt kennen Sie ja meine Leiden, Sie wissen, wie viel ich gekämpft, wie lange ich auf die schönsten Hoffnungen meines Lebens verzichtet habe; o, verstoßen Sie mich nicht – Sie kennen Cäsar nicht, Sie wissen nicht, wie gut er ist und wie sehr er mich liebt; er wird auf seine politische Carrière resigniren, er wird Sie wie einen Vater lieben!«
»Wie einen Vater!« fiel ihr der Alte zornig in's Wort, »mich wie einen Vater, er, der Sohn eines Bedienten! Genug! Ich habe Dich gebeten und Du hast mir meine Bitte verweigert; Du selbst hast den Würfel geworfen, und wenn einst die Tage der Reue kommen, so kannst Du Dir selbst Vorwürfe machen.« – Hierauf ging der Alte zum Tisch und klingelte. »Ist der Notar noch hier, den ich aus der Stadt habe rufen lassen?« fragte er die eintretende Kammerzofe, und als diese bejahend antwortete, fuhr er fort: »Nach einer halben Stunde soll er in mein Zimmer kommen; auch der Pfarrer und der alte Louis sollen hinbestellt werden. – Sie,« sprach er, zu Dufey gewendet, »mit Julien, und Du mein lieber Gustav, bleibet hier, ich werde Euch rufen lassen.«
Der Alte ging hinaus, seine Tochter keines Blickes würdigend. Julie schluchzte, auf Dufey gestützt, ich ging zum Fenster, und indem ich in den stillen Garten hinausschaute, in welchem ich so viele glückliche Stunden zugebracht hatte, rang meine Seele mit einem unbeschreiblichen Schmerz. Endlich wurden wir zum alten Grafen gerufen. Das hohe alterthümliche Zimmer war von einigen Kerzen beleuchtet; am Tische, auf welchem ein Packet Schriften lag, saß der Graf, den Kopf auf die Hand gestützt; sein Gesicht war blaß, seine Hände zitterten; in einer dunkleren Ecke des Zimmers flüsterten der Pfarrer und der Notar miteinander.
Der alte Louis, der längst pensionirte Diener des Grafen, stand seinem Herrn gegenüber und folgte jeder Bewegung desselben mit gewohnter Aufmerksamkeit, wie wenn er dessen Befehle erwartete. Als wir eintraten, winkte uns der Graf, Platz zu nehmen. Es erfolgte wieder eine lange Pause, endlich faßte sich der Graf und sprach:
»Ich trage ein großes Geheimniß auf meinem Herzen. Ich hätte es mit in's Grab genommen, allein der Himmel wollte es nicht, daß ein Sprosse meiner Familie mit einer Lüge in's Grab steige, und die Zeit ist gekommen, in welcher ich es entdecken werde. Es ist bekannt, daß in den Tagen der Revolution mein Vater emigrirte; wir lebten in Deutschland, im Hause eines reichen Grafen, der einst in Frankreich gewesen war, der mit meinem Vater Freundschaft geschlossen hatte und sehr gastfreundlich war. Nach zwei Jahren wurde seine einzige Tochter meine Gattin. Sie war eine gute, aber kränkliche Frau, die ich nie geliebt und nur meinem Vater zuliebe geheiratet habe. Es that meinem Vater weh, daß wir wegen unserer Armuth nicht unserem Namen gemäß leben konnten, und ich heiratete das reiche Mädchen, fühlte aber mitten in den Genüssen des großen Lebens täglich mehr, daß ich ihr Glück geopfert habe. Mein Herz gehörte längst einer Andern. Ein armes Bürgermädchen, das ich zufällig kennen gelernt hatte, besaß meine Liebe, und obgleich meine Frau, so weit ihr kaltes Gemüth es erlaubte, mit Liebe an mir hing, so war die ältere Leidenschaft doch zu stark, als daß ich sie hätte überwältigen können. So verging Jahr auf Jahr, der alte Graf starb, meine Frau wurde immer kränklicher, und wenn auch unsere Tochter, die sie nach unserer fünfjährigen Ehe gebar, unser Verhältniß wieder zu einem innigeren gestaltete, so war doch das Kind andererseits so elend, und die kleine, fast einjährige Tochter meiner Marie so hübsch und anmuthig, daß auch in dieser Beziehung, als hätte das Schicksal es so gewollt, der Vater, wie der Gatte, sich nur außer dem Hause glücklich fühlte. Wir wurden nach Frankreich zurückberufen. Meine Frau blieb mit ihrem kranken Kinde in Deutschland. Als ich nach einer halbjährigen Abwesenheit zurückkehrte, fand ich meine Tochter im Grabe, meine Frau auf dem Todtenbette; ich blieb bei ihr, um sie in ihren letzten Tagen zu pflegen, ihr Ersatz zu geben für die Schmerzen, welche ich ihr durch meine Kälte verursacht, und um die Arme zu Grabe zu geleiten. Während dessen starb auch mein Vater, ich war frei, und Marie, die, solange er lebte, sich mit meiner Liebe begnügte, verlangte jetzt mehr. Sie verließ ohneweiters ihre Eltern, folgte mir bis hierher, ganz auf meine Liebe vertrauend, und glaubte sich jetzt berechtigt, meine Frau zu werden. Aber sie war ein Bürgermädchen und ich konnte ihren Bitten nur so weit nachgeben, daß ich den Tod meines legitimen Kindes verschwieg und an dessen Statt ihre Tochter, die ich unendlich liebte und die mit der Verstorbenen beinahe eines Alters war, als mein legitimes Kind adoptirte. Diese Tochter bist Du, Julie; Marie, die bis zu ihrem Tode Dich in meinem Hause auferzog, war Deine Mutter. Louis, der damals als Diener mit mir war, weiß alle Umstände, und diese Schriften werden darüber, wenn es eben nöthig ist, auch vor Gericht Zeugniß ablegen. Hier ist das Zeugniß vom Tode meiner legitimen Tochter,« sprach er zum Notar gewendet und ihm die Dokumente eines nach dem andern übergebend, »hier Juliens Taufschein, hier unzählige Briefe, in denen ihre Mutter von diesen Verhältnissen spricht, und wenn noch mehr nöthig ist, so werden in jener Stadt, wo ich als Emigrant gelebt, sich Leute genug finden, die über dieses Alles Zeugenschaft leisten können. Und jetzt,« sprach er zu Julien gewendet, »bist Du frei, der Name Deiner Mutter war Müller, und damit trittst Du aus meinem Hause. Ihnen,« fuhr er zu Dufey gewendet fort, »werden morgen fünfzigtausend Francs ausbezahlt werden, das einzige Vermögen meiner Tochter; der Notar ist hier, wir können sogleich den Heiratscontract aufsetzen.«
Der Graf schwieg, auf seinen glühenden Wangen kämpfte unendlicher Gram und Erbitterung, und als er die Documente, nachdem er sie noch einmal durchgelesen, zusammengebunden und dem Notar übergeben hatte, hob ein tiefer Seufzer seine Brust. Wir Uebrigen standen überrascht um ihn herum, und der alte Louis wischte sich mit seiner dürren Hand die Augen ab. Julie stand ruhig da, ihre Wangen waren bleicher als gewöhnlich, aber nichts verrieth eine Aufwallung oder Erregtheit, als sie sich zum Grafen wendete und mit fester Stimme zu ihm sprach: »Daß Sie« – sie stockte einen Augenblick, dann, indem sie sich gleichsam Gewalt anthat, fuhr sie fort – »daß der Herr Graf mir das Geheimniß meiner Geburt erst heute mittheilt, daß er mich als seine legitime Tochter mit einem hohen Namen und unter den Genüssen reichlicher Güter auferzogen und in meinem Herzen Hoffnungen geweckt hat, die sich einst nicht erfüllen sollten; daß er mich zum Gegenstände des Stadtgespräches gemacht; daß, während ich in einem bescheidenen bürgerlichen Kreise glücklich gewesen wäre, wenn ich meinem Schicksale hätte folgen können, die schönsten Gefühle meines Herzens einem Namen aufgeopfert wurden, der nicht der meinige war – alles dies berechtigte mich vielleicht, Klagen zu erheben; doch fürchten Sie nichts, Herr Graf, ich werde nicht klagen; ich kenne den Kreis, in welchem ich bis jetzt lebte, zu gut, ich verabscheue zu sehr dessen kaltblütige Niederträchtigkeit, als daß ich das Heraustreten aus demselben für ein Unglück halten sollte; oder könnte ich, da ich von Jenen scheide, unter denen ich während so vieler Jahre kein verwandtes Herz gefunden, etwas Anderes wünschen, als daß ich sie niemals kennen und mein Herz nicht an den Menschen zweifeln gelernt hätte? Daß Sie mir aber jetzt erst sagen, wer meine Mutter war; daß Sie, während ich in meinen ersten Kinderjahren mich liebend an meine Pflegerin schmiegte, mir niemals sagten, daß mein Herz an der Mutterbrust ruhte; daß Sie, nachdem sie mit gebrochenem Herzen gestorben war, mich nie zu ihrem Grabe geführt und zu mir gesagt haben: »»Hier ruht Deine Mutter, Deine Mutter, die Dich während jahrelanger Pflege auch nicht einmal ihr Kind nennen durfte, die Dich aufwachsen und lächeln sah, die die Umarmung Deiner kleinen Aermchen, die Zuneigung Deines Herzens fühlte, und auch nicht einmal das süße Wort Mutter von Deinen Lippen hören, nicht den wonnigen Stolz genießen durfte, mit welchem die Mutter auf ihr Kind zeigt, die nicht anders als mit Bangen in die Zukunft blicken konnte, welche sie ihres Kindes berauben und das Verhältniß auf ewig zerreißen wird, welches die Amme und Pflegerin einst an ihren Pflegling knüpfte;«« – daß ich nicht Blumen auf ihr Grab streuen und es mit Thränen benetzen konnte; – daß ich sie nicht in meinem Gebet nennen und in meinen Leiden nicht zu ihrem Andenken meine Zuflucht nehmen, mich nicht nach ihr sehnen konnte, wenn ich mich freute, damit ich mein Glück mit ihr theile: das verzeihe Ihnen der Himmel – ich kann nur weinen.«
Der Graf schien verlegen und stotterte ein paar Worte, daß er das Alles auf Bitten ihrer Mutter gethan habe, und um das Glück seiner Tochter zu bezwecken.
Auf Juliens Lippen schwebte ein bitteres Lächeln. »Mein Glück?« sprach sie mit schmerzerstickter Stimme, »mein Glück? Als ob von Glück die Rede sein könnte, wenn Du das Herz seiner Liebe beraubst; als ob es etwas auf dieser Erde gäbe, womit Du die Umarmungen einer Mutter ersetzen könntest! Glück? O, geh' in die Kreise, in welche Du mich zogst, als Du mich aus den Armen meiner Mutter rissest, und frage dort die Frauen, ob sie glücklich sind. Schaue sie an in ihren glänzenden Sälen im Wirbel steter Vergnügungen, und frage sie, ob sie, von Verehrern umgeben, zufrieden sind; ob sie nicht fühlen, daß das Frauenherz zu etwas Anderem geschaffen sei, als sich der Befriedigung der Eitelkeit zu freuen? Frage sie, ob sie sich niemals nach andern Freuden sehnten, als denjenigen, welche sie in ihrem Kreise fanden, und ob sie, nachdem diese Sehnsucht aufgehört, in ihren Herzen keine Leere spürten, ob sie nicht jenen Lebensüberdruß kennen, welcher das aus dem Sinnenrausch erwachende Herz erfüllt: – wenn sie endlich sahen, daß sie, nachdem sie stets nur nach Genuß gehascht, endlich die Fähigkeit zu genießen, verloren, und, nachdem sie stets Gefühle geheuchelt, keines Gefühles mehr fähig sind? Du aber wußtest es, und als meine Mutter, das Bürgermädchen, auf dieser Bühne, die sie nur aus der Ferne sah, eine glänzende, strahlende Welt erblickte, wußtest Du wohl, daß dieselbe nur aus Fetzen besteht, und daß die Farbe der Freude auf den Gesichtern der Schauspieler Schminke, unter welcher ihre Wangen nur um so fahler werden; und Du hättest dieser Bitte widerstanden, sowie Du den Thränen meiner armen Mutter widerstandest. Aber Du brauchtest ein Kind, welchem Du Deinen Namen und Dein Erbe überlassen, welches Du als Mittel zur Befriedigung Deines Stolzes benützen könnest – und Du nahmst mich, weil ich Dir eben am nächsten stand, ohne Liebe, wie jetzt, wo Du mich von Dir verjagst, weil ich aufgehört habe, Deinen Plänen zu dienen. Gut, daß Du diese Beweise aufbewahrt hast,« sprach sie, auf die Schrift deutend, »denn sonst könnte ich vielleicht zweifeln, daß Du mein Vater seist.«
Dufey, der während der ganzen Scene geschwiegen hatte und in sichtlicher Verlegenheit bald auf die Schriften, bald auf den Notar blickte, erklärte endlich mit unsicherer Stimme und vielen Worten, er habe nie ahnen können, daß er seine liebe Julie so unglücklich machen werde, und ehe er das Glück einer ganzen Familie zerstören sollte, sei er lieber bereit, zu entsagen.
»Entsagen?« schrie Julie erbleichend, »entsagen? O Mensch? Lehre mich nicht zuletzt auch noch an Dir zweifeln! Du willst mir entsagen? – Und bist Du denn nicht mein, sowie ich Dein bin? Hast Du mir nicht ewige Liebe geschworen, und daß Du ohne mich nicht leben kannst? Und weißt Du nicht, daß ich fühlte, was Du schwurst, und daß die Trennung von Dir mein Tod wäre?!«
Dufey schwieg und war, wenn möglich, in noch größerer Verlegenheit als vordem; fast hätte ich ihn bemitleidet, so unglücklich schien er in diesem Augenblick.
»Warum stehst Du so schweigend da?« sprach Julie zitternd und ihre dunklen Augen auf Dufey heftend; »hast Du nicht unzählige Male gesagt, daß Du Dich glücklich fühlen würdest, wenn ich arm, ohne Namen und Hoffnungen wäre, nichts besitzend als meine Liebe, damit ich mein Glück nur Dir allein verdanken könne? Nun ist Dein Wunsch in Erfüllung gegangen; als Bettlerin betrete in Dein Haus, ohne Vermögen, ohne Namen, ohne Freunde; ich besitze nichts als Deine Liebe, und nun kannst Du mich aus dem Staube zu Dir emporheben! Sage ihnen also, daß Du Dich freust, daß Du mich liebst und mich auch so lieben wirst!«
»Wie können Sie zweifeln?« stammelte Dufey.
»O, ich zweifle nicht,« fuhr Julie fort; »aber sie, die mich nicht lieben, die mich nie geliebt haben, sie glauben Dir nicht. Sieh', mit wie höhnischem Lächeln, mit welch' grausamen Mitleid sie mich anblicken – und zwar weil sie Dein Herz nicht kennen; sage ihnen nur ein einziges Mal, was Du mir hundertmal gesagt, und sie werden es Dir glauben: es war in Deinen Worten stets etwas so Ueberzeugendes, das unwiderstehlich wirkt.«
»Wozu soll ich vor Diesen wiederholen,« sprach Dufey gezwungen, »was ich so oft gesagt habe? Ich liebe Dich von Herzen, und obschon – –«
»Hatte ich nicht Recht?« sprach Julie zu ihrem Vater gewendet, »wenn ich sagte, daß er mich liebt? Sie glaubten, er hänge an mir wegen meines Besitzes oder meines Namens; – nun aber besitze ich nichts mehr auf der Welt und er liebt mich dennoch, und ich bin glücklicher, als ehe ich dieses Alles verloren hatte; wenigstens wird Niemand mehr sagen können, daß mein Cäsar mich nicht liebt.«
»Es wird vielleicht die Zeit kommen, wo Du Dich unglücklicher fühlen wirst!« erwiderte der Graf.
»Und Sie werden sich über mein Unglück freuen, nicht wahr?« entgegnete Julie bitter; »Sie werden Ihren gerechten Gott preisen, der das ungehorsame Kind bestrafte? O, ich kenne diese väterliche Gesinnung. Wenn das Kind, das, in die Welt hinausgestoßen ohne eigene Schuld, nur Qualen erduldete, dem nie Jemand in Liebe nahte, das seine Jahre unter Schmerz und Entsagung verbrachte, und alles das, weil es der Wunsch seines Unterdrückers war, der die Tyrannei unter dem heiligen Namen eines Vaters ausübt – wenn ein solches Kind endlich seine Fesseln zerbricht; wenn es – nachdem es mit der Furcht die einzige Empfindung aufgegeben, welche sein Herr in ihm zu erwecken trachtete – leben, und die Welt, die es selbst sich gestaltet, frei genießen will; wenn das unglückliche Geschöpf, dessen Herz zwar zitternd, wie die Magnetnadel, doch unaufhörlich ohne alles Widerstreben nach einem Punkte hin zeigt, nicht widerstehen konnte und endlich das thut, wozu die Natur es antrieb: so wird es verflucht, die Welt wendet sich schaudernd von dem Ungeheuer ab, selbst die Frommen vergessen, was es gelitten, und Jedermann beschwört die Strafe des Himmels herab auf das Haupt der Waise, damit diese ein abschreckendes Beispiel sei für Diejenigen, welche die Last der Ketten fühlend, diese vielleicht gleich ihr zerbrechen wollen. Aber es ist der Vater, und diesem ist Alles erlaubt; wenn er sein Kind anstatt Liebe nur seine Macht fühlen ließ; wenn er, nachdem er die Erziehung seines Kindes Andern anvertraut, es nach langer Entfernung endlich wieder in sein Haus nimmt, um es Jahre lang unter langsamen Qualen einem eitlen Plane aufzuopfern; wenn das Glück seiner Tochter in seinen kalten egoistischen Berechnungen eine werthlose Null war; wenn er endlich, weil seine Tochter ihm nicht mehr zum Werkzeuge dienen wollte, die unnütze Sclavin mit kaltem Gleichmuth aus seinem Hause jagt: so ist das Alles gut und in Ordnung. Die Welt ehrt das greise Haar, und der Himmel selbst schickt seine Blitze herab, um die heilige Macht desselben aufrecht zu erhalten. Nicht wahr, es ist so? Die Thränen, welche meine Mutter weinte, die lange Pein, welche ich erlitt, ist vergessen – nur Dein Zorn steigt zum Himmel empor, nur wenn es um Rache fleht, erhört Gott das Gebet. Aber mein Glaube ist ein anderer; Gott sieht mich, er weiß, wie viel ich gelitten habe, und er wird mich nicht vergessen.«
Der Graf schwieg; mit glühenden Wangen saß er da und warf einen ärgerlichen Blick auf seine Tochter, die, von ihrem Schmerz hingerissen, mit erhobenem Haupt vor ihm stand, als ob sie seine Rache herausforderte. Zitternd schwiegen Alle, und alle Herzen erwarteten beklommen den Ausbruch des Ungewitters, nur der Pfarrer trat unter den Aufgeregten versöhnend auf, indem er bald den Grafen zur Duldsamkeit, bald Julie zur Ruhe ermahnte; aber vergebens, denn es ist leichter, den Stürmen der Natur zu gebieten, als denjenigen, welche im Herzen toben.
»Was kann mich weiter kümmern,« sprach Julie, von ihrem Schmerz hingerissen; »möge was immer geschehen, ich kann nicht mehr unglücklicher werden – der Kelch ist voll bis zum Ueberfließen, und der Tropfen, der ihn überfließen macht, erleichtert nur seine Last. Weiß ich denn nicht, daß meine Mutter unglücklich war, daß mein Vater mich nicht liebt, mich nie geliebt hat? Bin ich nicht aus seinem Hause vertrieben? Und was kann dann noch geschehen? Das Opfer darf wenigstens nach dem tödtlichen Streich bluten, und ein Mensch sollte, wenn seinem Herzen eine schwere Wunde geschlagen wurde, nicht klagen dürfen, damit sein Peiniger sehe, was er verübt? O, laßt mich es ihm sagen, daß ich durch ihn unglücklich war von dem Augenblicke an, wo ich zu fühlen anfing, bis jetzt; unglücklich, wie meine arme Mutter, wie Diejenigen, die liebend an ihr hingen; laßt mich es aussprechen, daß ich, aus diesem Hause tretend, nichts mit mir nehme, als mein Bedauern, jemals seine Schwelle betreten zu haben; laßt mich ihm sagen, daß er mein Lebensglück zerstört hat, und daß selbst die Liebe meines Cäsar mich nicht vergessen machen wird, daß ein Vater sein Kind wie einen Bettler fortjagte und nicht eine einzige Thräne vergoß, als es auf ewig von ihm schied. O, diese Erinnerung ist Erbschaft genug, denn ich werde mich reich, edel, groß fühlen in meinem bürgerlichen Kreise, so oft es mir einfallen wird, daß ich aus dem Kreise Derjenigen ausgetreten bin, die ihren Adel durch solche Thaten aufrecht erhalten.«
»Nimm noch etwas mit als Erbschaft!« schrie der Alte, die zitternde Hand zum Himmel erhebend, »meinen Fluch!« und seine Wangen erbleichten, und besinnungslos stürzte er in die Arme des Pfarrers.
Julie erbleichte; ihre Augen starr auf ihren Vater geheftet, stand sie mit krampfhaft gefalteten Händen da. »Er hat mich verflucht!« sprach sie leise und kaum verständlich, wie wenn Einer seine Gedanken vor sich hin spricht. »Er hat mich verflucht!« wiederholte sie dann mit einem herzzerreißenden Schrei, ihrem Vater zu Füßen fallend, und preßte dessen Hand leidenschaftlich an ihre Lippen. Ihre Augen füllten sich mit Thränen; ich habe nichts Erschütternderes gesehen, als dieses Weib in seinem Schmerz. In ihrer Leidenschaft glich Julie dem Bergbach, der, aus seinen schmalen Ufern tretend, unwiderstehlich hinabstürzt, Alles zerstörend, was seinen Lauf hemmt, dann aber, wenn seine Fluthen gefallen, die einst blühenden Ufer verwüstet, das vordem glatte Bett voll von Felstrümmern zurückläßt. Der Sturm, der in ihrer Seele getobt hatte, legte sich, und dann sah sie nur ihres Vaters blasses Gesicht und hatte in ihrem Herzen nur das Gefühl der Schuld. »O, er hat mich verflucht,« schluchzte sie außer sich, »und kann sein Wort nicht mehr zurücknehmen; ich selbst habe meinen Vater getödtet!«
»Es soll Jemand nach Paris eilen, um den Arzt zu holen; hier ist rasche Hilfe nöthig!« sprach der Notar; und ich selbst, dem die peinliche Scene unerträglich geworden, verließ eilends das Zimmer. Nach wenigen Minuten war mein Pferd gesattelt und ich ritt im Galopp nach Paris. Die Nacht war still, die Landschaft war vom Duft frisch gemähten Heues erfüllt und oben am Himmel standen strahlend die Sterne. – Und mitten in diesen blühenden Räumen, unter diesem reinen Himmel, unter diesen Millionen Glanzpunkten, wie viel zertrümmerte Hoffnungen und blutende Herzen, die niemals von ihren Wunden genesen werden! – O, armer Mensch, der Du Dich im Glück so erhaben und auf Deinem bewimpelten Schiff den Herrn der Welt dünktest, weil der Wind zufällig nach Deinem Wunsch wehte und Dein Fahrzeug nach dem erwünschten Ufer trieb: warte den Sturm ab, und wenn Dein Fahrzeug zertrümmert umhergeschleudert wird und Du selbst, nackt, dem Elend ausgesetzt, nichts hoffen könnend, als den Tod, ein armer Schiffbrüchiger auf einem einsamen Felsen stehst – sieh', wie ruhig die Sonne sich über Deinem Elend erhebt, und lerne, wie gering Du bist auf der Welt; und wenn Du, kaum im Stande, die Last Deiner Leiden zu ertragen, die ganze Hoffnung Deines Lebens verloren hast, und im Leben umherblickend schon nichts weiter als Mitgefühl suchen kannst – so schaue dann die Menschen an, wie ruhig jeder seine Arbeit verrichtet, oder seine Freuden genießt, wie in der Gesellschaft gar nichts sich verändert hat, seitdem Du unglücklich wurdest – und lerne, wie gering Du unter den Menschen bist, ein Staubkörnchen, das in den Strahlen der Sonne emportauchte, und sobald die Finsterniß kommt, verschwindet. Und wozu dieses hohe Streben, das unsere Seele erfüllt? Wozu so viele Hoffnungen und eine Seele, die im falschen Gefühle ihrer Kraft es wagt, zu wollen? Wenn wir als Sclaven des blinden Zufalls geboren wurden, warum müssen wir so viel von Freiheit träumen? Der menschliche Jammer ist ein großes Geheimnis und nur wer jenseits dieses Lebens die Erklärung zu suchen wagt, nur der kann leben, ohne zu verzweifeln. Aber wer dies nicht vermag, der muß das Schicksal verfluchen, das ihn auf diese Welt rief, wo jede Blume auf dem Moderstaub tausend verwelkter Blumen, jede Hoffnung aus den Trümmern tausend verlorener Hoffnungen besteht, und wo wir nicht unter die Oberfläche der schönen Erde dringen, nicht an die Vergangenheit zurückdenken können, ohne hier, wie dort, finstere, kalte Verwesung zu finden.
Als ich mit dem Arzt zurückkam, wartete schon das ganze Haus mit peinlicher Gespanntheit auf uns. Der Graf kam kurz, nachdem ich fortgeritten war, zu sich und verjagte seine unglückliche Tochter mit neuen Flüchen; dann ließ er vom Notar sein Testament schreiben und verfiel, nachdem er es unterzeichnet hatte, in eine der Ohnmacht ähnliche Empfindungslosigkeit, aus welcher er nur zuweilen auf Augenblicke erwachte. Der Arzt sagte, nachdem er ihm den Puls gefühlt hatte, daß der Kranke nur noch wenige Minuten zu leben habe; Alles schwieg. Ich kann es nicht beschreiben, wie schmerzlich diese ganze Scene auf mich wirkte. Da lag er an der Schwelle seines Lebens, nach einem langen Leben zum letzten Male athmend auf Erden. Und nachdem er über sechzig Jahre gehofft, mit seinem Schicksal gekämpft, auf die Erfüllung seiner Wünsche Pläne gegründet, zu deren Erreichung Opfer gebracht hatte: was blieb dem Sterbenden in seinen letzten Augenblicken Anderes übrig, als das Gefühl, daß er sich vergebens bemüht habe, und wenn die Seele vielleicht noch wach war, und das Auge, das zuweilen matt umherblickte, noch sehen konnte – die traurige Erfahrung, daß an seinem Sterbebette kein Auge ist, das sein Hingang mit Thränen erfüllte, kein Herz, das durch die Trennung von ihm sich ärmer fühlen könnte! Und dennoch hatte nicht das Schicksal ihn zu dieser qualvollen Verlassenheit verdammt; wenige Schritte von ihm schluchzte seine Tochter, die ihr ganzes Leben hindurch treu an ihm hing, die er unglücklich gemacht, und die ihn dennoch liebte. Es hätte ihm nur ein Wort gekostet, und sein Kind wäre bei ihm gestanden, einen Segenspruch, und die Unglückliche hätte sich selig gefühlt – und er schwieg dennoch. Es ist traurig, den Menschen im Kampfe mit seinem Schicksal zu sehen; zu sehen, wie viel Kraft, wie viel edle Gefühle in dem langen Kampfe verloren gehen; es ist traurig, die Hoffnungen des Jünglings, den festen Willen des Mannes, die Geduld des Greises, alles das an der Stumpfheit der unempfindlichen Welt scheitern zu sehen. Dies Alles ist traurig. Doch zu sehen, wie der Mensch gegen sein eigenes Glück ankämpft; zu sehen, wie er mit eigenen Händen die Liebe zurückstößt, welche das Geschick ihm, wie jedem Menschen, wenigstens einmal im Leben dargeboten hat; zu sehen, wie er an Allem im Leben festhält, nur an Einem nicht, was ihn retten kann; zu sehen, wie er seinen höchsten Schatz von sich wirft, um wie ein von der Angst bethörter Unglücklicher gerade das Werthloseste aus den Flammen zu retten: das ist trauriger, tausendmal trauriger! Und sehen wir es nicht dennoch täglich? – Und wenn die Welt eine Hölle ist, sind wir nicht meistens selbst die uns quälenden Teufel?
Ich erkundigte mich nach Julien; sie war in ihrem Zimmer. Dufey war ebenfalls fortgeeilt, um einen Arzt aus der Stadt zu holen. Es gibt Augenblicke im menschlichen Leben, wo das Herz im Gefühl seines Unglücks sich nach Schmerzen sehnt. Sowie der Kranke in seinen Qualen sich beinahe über das Messer des Chirurgen freut, welcher, ihm das Geschwür durchschneidend, ihn bluten macht, so sucht der Mensch zuweilen selbst die Gelegenheit, die ihm seinen Kummer doppelt erschwert. Erbauen wir nicht Gräber? Halten wir nicht das Bild der verstorbenen Geliebten vor Augen? Klammern wir uns nicht an Alles, was in unserem Herzen eine peinliche Erinnerung erwecken kann? Und suchen wir nicht selbst Gelegenheit, uns jeden Abschied doppelt schmerzhaft zu machen? Wir drücken den Freund an's Herz, noch einmal wir seine Stimme hören, seine freundlichen Gesichtszüge sehen, und die Thränen, die er um uns weint; noch einmal wollen wir Alles sehen, was wir besessen haben und verlieren sollen, damit wir unseren Leidenskelch bis auf den letzten Tropfen leeren – vielleicht weil auf dieser Welt der Leiden auch das ein Trost ist, wenn wir sagen können, daß wir deren größte Qualen schon erlitten haben; vielleicht, weil es nach den Wonnen der Liebe keinen andern Genuß mehr gibt als den Gram der Liebe. – Ich ging zu Julien. Sie war allein. – In Gedanken vertieft, stand sie am Fenster und schaute hinaus in den stillen Garten, wo sich das erste Licht der Dämmerung verbreitete. Alles war stille. Die Kerzen waren fast ganz herabgebrannt und die Flammen derselben verbreiteten, vom Morgenwind hin- und herbewegt, im Zimmer ein ungewisses Licht. Mein Herz war von einem ungeheuern Schmerz erfüllt. Es fiel mir meine ganze Seligkeit ein, die ich besessen hatte, und wie ich Alles verloren habe, selbst das Gefühl meiner Beleidigung, das meiner Seele in den ersten traurigen Augenblicken Kraft verlieh. Ich weinte. – Julie wandte sich um. »Mein Vater ist gestorben,« sprach sie, ihre dunklen Augen ruhig auf mich heftend; »verhehlen Sie mir nichts, ich bin auf Alles gefaßt.«
Ich sagte ihr, daß er noch lebe.
»Doch sein Aufkommen ist nicht mehr zu hoffen, nicht wahr?« fuhr sie fort; »o Sie sind glücklich,« sprach sie mit einem schweren Seufzer, »Sie können um ihn weinen – ich habe keine Thränen.«
»Ich weine nicht deshalb,« sprach ich von meinen Empfindungen hingerissen; »die Zeit ist vorbei, wo das Bild des Todes mich mit Schmerz erfüllte. Ich habe gesehen, wie viel man auf dieser Welt binnen wenigen Stunden leiden kann, und ich bin nicht egoistisch genug, um meinen Freunden Jahre zu wünschen. Aber, daß ich so viel leiden, so viel verlieren mußte und Sie dennoch unglücklich sehen muß, daß ich auf meine schöneren Tage nicht zurückblicken kann, ohne mich zu erinnern, daß meine Liebe ihnen nur Qualen verursachte – das ist zu viel, als daß ich es ruhig ertragen könnte.«
Julie reichte mir gerührt ihre Hand. »Seien Sie nicht ungerecht gegen sich,« sprach sie mit weicher Stimme; »wenn es eine Erinnerung in meiner Vergangenheit gibt, die mich mit reiner Freude erfüllt, wenn es einen Trost gibt, der die Leiden dieser Stunde zu lindern vermag, so ist es Ihre Liebe, Ihre edle Freundschaft. – Aber es gibt Menschen, welche das Schicksal zum Leiden geschaffen hat. Sowie in gewissen Pflanzen der laue Sommerregen immer nur Bitterkeit zur Reife bringt, die von den ersten Tagen an in ihnen verborgen war: so gibt es Herzen, welchen sich Das, was Andere glücklich machen würde, nur nähert, um ihre Leiden zu vermehren. – So sei es denn; dieses Herz hat frühzeitig leiden gelernt, und wem das Schicksal die Kraft, zu widerstehen, verweigert hat, dem wird es vielleicht Kraft verleihen, seinen Kummer zu ertragen. Nur Eines erflehe ich vom Himmel: Ihre Vergebung.«
»O Julie!« sprach ich mit heftigem Herzpochen.
»O, verweigern Sie mir sie nicht,« erwiderte sie mit weicher Stimme; »ich bin ja unglücklich genug. Möge ich in dem traurigen Leben, an dessen Schwelle ich stehe, wenigstens den einen Trost haben, daß Derjenige, der unter allen Menschen sich gegen mich am edelsten benommen hat, meinem Andenken nicht fluchen wird.«
»Ihrem Andenken fluchen!« sprach ich, von Empfindung hingerissen. »Und was gibt es denn noch in meinem Leben, worauf ich in meinen öden Tagen zurückblicken könnte, als diese eine Erinnerung? Wer keine Freude hat, der braucht wenigstens etwas, das er beweinen könne; der Heimatlose Heimweh, der Greis die Erinnerungen seiner Kindheit, ich Dein Bild. Hundertmal leichter kann man den Glücklichen seiner Freuden berauben, als den Unglücklichen seines Kummers, der sein einziges Eigenthum ist, und an welchen er sich, wie der Schiffbrüchige an die Trümmer seines Schiffes mit verzweifelter Ausdauer festklammert; denn er fühlt, daß er sich durch nichts sonst aufrecht erhalten kann. O, aber Du, was kümmerst Du Dich um mein Andenken? Du wirst glücklich sein,« fuhr ich mit Bitterkeit fort, denn ich dachte eben an Dufey, »Du wirst in den Armen Deines Geliebten alles Glück genießen, mit welchem das Herz sich erfüllt, wenn es sich geliebt sieht und Liebe fühlt. Was werde ich Dir sein? Vielleicht eine flüchtige Wolke, die den Morgen Deines Lebens verdunkelte, die aber durch die stärkeren Strahlen Deiner Sonne zerstreut wird. Nun gut; es ist nothwendig zu Deinem Glück, daß Du mich vergessest, und ich will Dein Glück nicht zerstören.«
»Mein Glück!« erwiderte Julie seufzend, »als ob nach Dem, was vorgefallen ist, noch von Glück die Rede sein könnte! Lastet nicht der Fluch meines Vaters auf mir? Oder glauben Sie, daß man, was man von Leidenschaft hingerissen in einem Augenblick that, bei zurückgekehrter Ruhe vergessen könne? Ich täusche mich nicht so. Möge der Mensch es im Leben zu einer noch so großen Macht bringen, möge er seinen Weg noch so frei wählen können, Eines gibt es, was nicht in unserer Macht steht: die Vergangenheit; weder der Tyrann, der Nationen gebietet, noch der Private, der alle Hindernisse besiegt hat und sich schon am Ziele sieht, vermag ihre Stimme zum Schweigen zu bringen. Der Mensch kann eine Welt zu Stande bringen aber nicht das Gedächtniß aus seiner Seele verwischen und könnte ich nach solchen Erinnerungen glücklich sein? – Wenn ich auch in den Armen meines Cäsar mich glücklich fühlte, wenn ich in meinem Hause auch nichts als Ruhe und Zufriedenheit sähe, wenn ich auch von lauter Freude und Liebe umgeben wäre, könnte ich denn den Gedanken vermeiden, daß all' dieses Glück auf dem Grabe meines Vaters beruht, das ich ihm gegraben habe, und daß Ihr Glück, der ganze Schatz Ihres an mir hängenden Herzens, der Preis ist, um welchen ich diese Freuden erkaufte? Und wenn endlich eine jener schweren Stunden kommen wird, die zuweilen selbst im Leben des Glücklichsten eintreffen, und in welchen nur unser Selbstbewußtsein unseren Kummer mildert – wenn die Liebe meines Cäsar erkaltete, würde mir nicht der Fluch meines Vaters einfallen?! O, was sind alle Leiden, alle Qualen dieser Erde im Vergleich mit dem Gefühl, daß wir zur Strafe leiden!«
»Ich stammelte einige Trostesworte.
»O trösten Sie mich nicht,« fuhr sie fort, »ich kenne die ganze Schrecklichkeit meiner Zukunft; doch so lange mein Cäsar mich liebt, so lange dieses Herz sich in seinem Kummer zum Glück eines Wesens für nothwendig hält, so lange Jemand auf der Welt ist, für den ich leben und leiden darf, so lange fühle ich Kraft in mir, meine Schmerzen zu ertragen. Ich werde kämpfen mit meinem Kummer, damit er nicht die Freuden meines Geliebten verderbe; ich werde lächeln, wenn ich ihn heiter, vielleicht Freuden heucheln, wenn ich seine Stirn sich in düstere Falten zusammenziehen sehen werde. Aber nie werde ich mehr in diesem Leben glücklich sein. Wer das, um was er sein ganzes Leben hindurch gekämpft, erreicht hat, ist deshalb noch nicht glücklich, denn wer weiß, wie viel sich während des Kampfes geändert haben mag, und ob er nicht endlich nach langem Kampfe blos die Trümmer seiner Wünsche erreicht? Wer weiß, ob er nicht mit einem zu arg verwundeten Herzen zum Ziele gelangt, um an seinem Triumph noch Freude haben zu können? Wer bürgt dafür, daß man noch glücklich sein werde, wenn man Das endlich erreicht hat, ohne was man nicht glücklich sein zu können glaubte, und ob Derjenige, der sein Ziel erreicht hat, nicht dann gleich mir mit Sehnsucht auf die Tage zurückblicken werde, in welchen er wenigstens noch einen Wunsch hatte?«
Wir schwiegen. Im Garten wurde es immer heller; das Licht, das durch das Fenster des Grafen schien, erlosch allmälig. Juliens Locken bewegten sich im kühlen Morgenwinde hin und her. »Der Tag bricht an,« sprach Julie endlich, der letzte, welchen ich in diesem Hause zubringen soll. »Wir müssen Abschied nehmen. Cäsar wird binnen wenigen Minuten hier sein, und dann gehe ich fort. Vielleicht sehen wir uns zum letzten Mal.«
»Zum letzten Mal!« stammelte ich mit erstickter Stimme.
»Zum letzten Mal vielleicht in dieser Welt,« fuhr Julie mit erzwungener Ruhe fort; »reichen Sie mir Ihre rechte Hand und sagen Sie, daß Sie mir vergeben haben.«
Ich konnte nicht antworten; ich preßte ihre zitternde Hand an meine Lippen und meine Thränen flossen stromweise.
»O, weinen Sie, weinen Sie, mein unglücklicher Freund,« sprach Julie gerührt, »und mögen diese Thränen, welche ich Ihnen erpreßt habe, Ihrem Herzen so viel Linderung verschaffen, als sie meine Seele mit Kummer erfüllen. Wie glücklich hätten Sie sein können! Jung, mit Allem ausgestattet, was in diesem Leben wünschenswerth ist, voll Vertrauen zu den Menschen, mit der ganzen Kraft Ihrer Seele an Allem hängend, was es für Sie Schönes und Edles gab, hätten Sie der schönsten Zukunft entgegengehen können! Liebe, Ruhm, Freude, was die Einbildungskraft sich vorstellen, was man in diesem Leben erreichen kann, Alles hätte sich für Sie zu einer großen Hoffnung vereinigt; und jetzt! – – O, daß ich dies Alles zerstören mußte! Weinen Sie, weinen Sie, mein Freund, ich habe Sie Ihres ganzen Lebensglückes beraubt! Denn was ist das Leben ohne Liebe? Und Ihr Herz, das sich einmal getäuscht gesehen, wird nicht mehr lieben können. Die schwere Wunde, die Ihrem Herzen jetzt weh thut, wird heilen; es werden Zeiten kommen, wo dieser Schmerz abgestumpft, vielleicht nur mehr als dunkle Erinnerung vorhanden sein wird – doch, wenn Ihr Herz, in seiner Ruhe gestört, noch einmal wird fühlen wollen; wenn Sie ein Wesen sehen werden, durch dessen Anblick Ihr Herz gerührt sein wird; wenn Sie, dieses Gefühl wahrnehmend erröthen; wenn Sie, das Wort vernehmend, welches die Hoffnung der Liebe erregt, sich dem schönen Traum hinzugeben beginnen werden: dann wird mein Andenken in Ihrer Seele auftauchen und eine Stimme wird Ihnen zuflüstern; »»Julie hat Dich betrogen!«« Und unter der Wucht dieses Gedankens wird das erwachende Gefühl verschwinden und Ihr Herz seine traurige Sicherheit in der Einsamkeit suchen. O ich weiß gut, daß es so sein wird, und wenn Sie endlich einsehen werden, daß Ihre Zweifel ungerecht waren, und daß Diejenige, welche Sie ohne Ihre Erfahrungen geliebt haben würden, Ihre Liebe verdiente; wenn es Ihnen im Gefühl Ihrer Verlassenheit einfallen wird, daß an dem Allen ich schuld bin – werden Sie dann nicht die Unglückliche verfluchen, die Ihr ganzes Dasein vergiftet hat? O Gustav, thun Sie das nicht, ich kann ja nicht dafür!«
»Ich wollte Sie glücklich machen,« fügte sie nach einer kurzen Pause hinzu; »mein Fehler ist nur, daß ich schwach war. – Das Weib ist ein armseliges Geschöpf! Wie viel verlangt die Gesellschaft von ihm, und wie wenig Kraft hat die Natur seinem Herzen verliehen. Wie unendlich unglücklich ist es, wenn es ein einziges Mal vom rechten Wege abgewichen ist, und wie vielen Verlockungen ist es dennoch ausgesetzt, die es in's Verderben stürzen! Der Mensch ist frei, sagen unsere Philosophen; aber fragen Sie einen, der geliebt hat, und Sie werden ihn über diesen stolzen Ausspruch lächeln sehen. Wessen Herz in kalter Selbstsucht sich selbst genügt, wer seine Tage in thierischem Genuß oder mit unfruchtbaren gelehrten Studien hingebracht hat, der mag sich vielleicht frei dünken, aber nur so, wie der schlummernde Gefangene, der die hohen Mauern seines Kerkers nicht sieht und von Freiheit träumt. Doch wenn einmal in seinem Herzen die unwiderstehliche Macht der Liebe erwacht, dann fragen Sie ihn, ob er sich frei fühlt. Fragen Sie ihn, ob er der Welt zu gebieten vermag, daß sie ihr Alltagstreiben ändere und seine Gefühle nicht verletze; fragen Sie ihn, ob er seinem Herzen zu gebieten vermag, daß es den ungleichen Kampf aufgebe und seine Gefühle den Gesetzen dieser Welt unterwerfe. Unser Leben hat eine Scylla und eine Charybdis; es ist dies die Welt und unser Gefühl, und unsere ganze Freiheit besteht vielleicht darin, daß wir wählen können, an welchem dieser beiden Felsen wir Schiffbruch leiden wollen. Glücklich Derjenige, dem Gott zu dieser Wahl Kraft verliehen hat, daß er nur an einen dieser Felsen getrieben wird und mindestens die Hälfte seines Lebensglückes retten kann – ich schwebte zwischen beiden Felsen und verlor Alles.«
Julie schwieg; in ihrem ganzen Wesen war ruhige Resignation, tiefer, hoffnungsloser Schmerz ausgedrückt. Ich wollte sie trösten; ich sagte, die Zeit, welche unsere Freuden zerstört, nehme auch unsere Schmerzen mit. Ich sagte noch mehrere solche banale Phrasen, denn wer könnte über Leiden etwas Neues sagen, was in dieser leidensvollen Zeit nicht schon gesagt worden wäre? Doch Julie schüttelte traurig den Kopf. »Der Schmerz vermindert sich mit der Zeit,« sprach sie düster, »doch nicht das Schuldbewußtsein. Glücklich Derjenige, den das Schicksal in so einfache Situationen versetzte, daß er, wenn von ihm ein Opfer gefordert wird, sich selbst opfern kann. Doch es gibt schwierigere Umstände, in welchen man sein Opfer unter seinen Lieben wählen muß, wo man den Einen nicht beglücken kann, ohne einen Andern zu verletzen. Wen das Schicksal zu einer solchen Situation verurtheilt hat, dem bleibt nichts Anderes übrig, als zu bitten, daß der Betreffende ihm die unwillkürliche Verletzung vergebe.«
»O, wenn das Ihrem Herzen Ruhe verschafft,« sprach ich ergriffen, »so nehmen Sie meinen Schwur, daß ich Ihr Andenken ohne die geringste Bitterkeit bewahren werde. Wie viel ich auch bisher gelitten habe, welche Leiden immer mich in Zukunft erwarten mögen – ich werde vielleicht die Welt, vielleicht mich selbst verfluchen, doch nie Diejenige, welcher ich die schönsten Tage meines Lebens verdanke.«
Julie reichte mir gerührt die Hand, und als ich ihre zitternden Finger an meine Lippen preßte und dabei in ihr sanftes Antlitz und in ihren dunklen Augen Thränen zittern sah, und als ich fühlte, daß meine Worte das tiefe Leid ihres Herzens auf einen Moment linderten: da fühlte ich, daß auch der Schmerz seine Wonne habe.
Jetzt trat der Kammerdiener in's Zimmer und bat Julie und mich, hinüber zu kommen.
»Mein Vater läßt mich rufen?« schrie Julie, und ein Strahl der Freude flog über ihr Gesicht.
Der Kammerdiener schwieg.
»Er ist also gestorben,« sprach Julie bebend, »nicht wahr?«
»Er ist in den letzten Zügen!« entgegnete der Kammerdiener, und wir gingen eilends hinüber.
Der Tag war bereits angebrochen. Zwischen den Bäumen des Gartens flammte das Morgenroth und auf dem Tische brannten die Kerzen mit fahlem Licht. Alles war still im Zimmer. In der Mitte desselben saß der Graf, gegen das Fenster gewendet – wie er es in einem freieren Augenblick selbst gewünscht hatte. Sein Gesicht war bleich und ruhig, wie das eines Todten. Von der Leidenschaft, die sein Uebel verursacht hatte, war in seinen Zügen keine Spur mehr vorhanden; seine Schmerzen hatten in der Empfindungslosigkeit des Sterbenden aufgehört, und hätte man nicht seinen schwachen Athem vernommen, und hätte der Arzt nicht das leise Klopfen seines Pulses gefühlt, so würde Niemand geglaubt haben, daß er noch lebe. – Seine Augen waren, wie im Schlaf geschlossen. Welch' ein Anblick ist der eines Sterbenden! – Er lebt noch, sein Gesicht ist zwar blaß, doch dasselbe, welches wir stets gesehen und vielleicht geliebt haben; sein Herz schlägt noch, seine Brust athmet, sein Kopf hegt vielleicht noch Gedanken. Er läßt sein Testament schreiben, trifft Verfügungen, kurz, er ist einer unseres Kreises. Doch eine Stunde noch, und was ist er dann? Seine Verwandten theilen sein Vermögen unter sich, seine Diener schleppen seinen Leib achtungslos hin und her, und der Leichnam, von welchem sich Jedermann schaudernd abwendet, wird zu Grabe getragen, um vergessen zu werden und zu vermodern. Und das wäre das Ziel, um dessentwillen wir uns so viel abmühen? Nach so viel Leiden, nach so viel Opfern Vernichtung?! Dies wäre der einzige Preis, der uns am Ende unserer Laufbahn erwartet, daß der Herr uns, wie einem niedrigen Diener endlich die Fesseln löst und, uns aus seinem Hause jagend, sagt: »Du bist frei.«
O, wenn Du etwas Großes vollbracht hast, oder etwas Gutes, das nach Dir fortdauert; wenn Du in den letzten Augenblicken Deines Lebens wenigstens einen Freund an Deinem Bette siehst, der durch Dich glücklicher geworden; wenn Du ein Haus hinterlässest, welches Du gebaut hast; wenn nur ein einziger Baum, welchen Du selbst gepflanzt hast, und der als Denkmal Deines Wirkens auf Erden zurückbleibt, seine blühenden Zweige durch Dein Fenster streckt – aber zu sterben, ohne sich nützlich gemacht zu haben, ohne Spur aus dem Leben zu verschwinden, oder in Deinen letzten Augenblicken das Streben Deines ganzen Lebens vernichtet zu sehen, das ist über alle Beschreibung peinlich. – Mit solchen Gedanken beschäftigt, stand ich da, bald auf den Sterbenden, bald auf Julie blickend, und tief fühlte ich das Elend unseres ganzen Daseins, in welchem so Viele nur zwischen Leiden und Vernichtung wählen können. Endlich öffnete der Greis noch einmal die Augen. – Er blickte matt umher. »Oeffnet das Fenster!« sprach er mit schwacher Stimme. Wir thaten es. Julie warf auf ihren Vater einen Blick der Verzweiflung. »Segne mich!« stammelte sie mit erstickter Stimme. Der Greis blickte traurig umher, als ob er noch einmal die lange Reihe seiner Ahnen sehen möchte. Endlich ließ er seufzend den Kopf sinken und schwieg. »Nur ein Wort des Segens!« seufzte Julie; der Greis antwortete nicht, seine Hand fiel starr von der Lehne des Stuhles. Er war nicht mehr.
In das Zimmer drangen die ersten Strahlen der Sonne. Alles schwieg, nur in den Zweigen der großen Eiche säuselte der Morgenwind.
Tief ergriffen standen wir bei dem Todten; Julie betete. Da trat ein Diener in's Zimmer und übergab ihr einen Brief. Kaum hatte sie die Adresse gesehen, so erblaßte sie. Eilends erbrach sie das Siegel, und während sie die Zeilen durchflog, zitterte sie am ganzen Körper. »Um Gotteswillen,« sprach ich endlich, »was ist geschehen?« Sie antwortete nicht; die Augen auf's Papier geheftet, stand sie, wie außer sich, da. »Von wem ist der Brief?« fragte ich sie endlich; Julie sah mich an, und mir erstarrte das Herz unter der Einwirkung ihres verzweiflungsvollen Blickes. Schweigend reichte sie mir den Brief, und mit dem Schrei: »Ich bin verflucht!« sank sie in meine Arme.
Wir brachten sie in ihr Zimmer, und nachdem ich sie der Obhut ihrer Dienerin überlassen hatte, las ich den Brief. Er war von Dufey und lautete folgendermaßen:
»Meine liebe Julie! Wenn Sie mich je geliebt haben, woran ich nicht zweifeln darf, so stellen Sie sich den Schmerz vor, der in diesem Augenblick meine Seele erfüllt; und wenn es schon mein Fluch war, daß ich Ihnen durch meine Annäherung nur Leiden verursachen konnte, so seien Sie wenigstens überzeugt, daß ich mich bestraft fühle. Ich habe Ihre Ruhe zerstört, den häuslichen Kreis verwüstet, in welchem Ihre Tage so glücklich dahinfließen; ja, damit nichts übrig bleibe, dessen Raub Sie mir nicht vorzuwerfen hätten, beraubte ich Sie noch Ihres Namens und Ihrer glänzenden Stellung. Doch glauben Sie nicht, daß dieses Herz, welches Sie zu lieben wagte und im Bewußtsein Ihrer Gegenliebe so selig war, seine Pflicht ganz vergessen könnte. Glauben Sie nicht, daß der Mann, dem Sie so viel Vertrauen schenkten, dessen unwürdig war. Ich kenne meine Pflicht, und wie schwer sie auch sei, ich werde sie erfüllen; möge mein Herz ewig bluten, ich verzichte auf Ihre Liebe und auf den Eid, mit welchem Sie Ihr Herz an meines knüpften, und den ich niemals angenommen hätte, wenn ich mir hätte vorstellen können, daß er Ihnen so viel Schmerz verursachen werde. Es ist noch Zeit; gehen Sie zu Ihrem Vater, bitten Sie ihn um Vergebung, entsagen Sie mir und reichen Sie Ihre Hand einem Andern, Glücklicheren, und Alles wird wieder gut werden. Ihr Vater wird seinen Fluch zurücknehmen und das nur Wenigen bekannte Geheimniß wird ein Geheimniß bleiben, und Sie, meine Julie, werden glücklich sein. Glücklich? o nein! nicht so glücklich, wie ich es in schöneren Tagen gehofft habe, denn wer wird Sie so lieben, wie ich? Doch Sie werden wenigstens äußerlich glücklich, wenigstens beneidet sein, und das ist mehr, als ich Ihnen bieten kann. Nach Dem, was vorgefallen, ist Alles aus, und ich kenne meinen Vater zu gut, und fühle zu sehr, wie schrecklich der Fluch eines Vaters ist, als daß ich jetzt unser Glück zu hoffen wagte. So nehmen Sie denn mein Abschiedswort, welches ich mit zerrissenem Herzen spreche. In einer halben Stunde bin ich auf der Reise, und wenn ich unter den Lasten meines schweren Amtes zuweilen seufzen werde, so seien Sie überzeugt, daß dies dem Glück Derjenigen gelten wird, die ich auf dieser Welt am meisten, die ich einzig und allein liebte.
Cäsar.«
Ich staunte. Es gibt Dinge auf der Welt, welche man trotz aller Erfahrung so lange für unmöglich hält, bis man sie nicht erlebt, und so war das Benehmen Dufey's gegen Julie. Alles auf Erden hat seine Grenzen, nur nicht der Jammer und die Niederträchtigkeit der Menschen. So wie Derjenige, der Folterqualen erduldet, nicht sagen kann, daß er den Gipfelpunkt der Qual erreicht habe und daß seine Peiniger nichts mehr ersinnen werden, was seinen Schmerz zu vergrößern vermöchte: so kann der Schlechteste immer noch Jemanden finden, im Vergleich mit dem er sich für besser halten darf.
In diesem Augenblick trat Armand in's Zimmer, der von Paris kam, da er vernommen hatte, daß der Graf krank sei. Wenn Du je einen Freund hattest, wenn Du jemals mit aller Kraft Deines jungen Herzens an Jemandem hingst, den Du mehr liebtest als Dich selbst; wenn Du alle Gefühle Deines Herzens, Deine Freuden und Leiden nur mit ihm fühltest; wenn Du kein Geheimniß hattest, das Du ihm nicht anvertrautest, keinen Zweifel, auf den Du von ihm nicht Antwort erwartetest; kurz wenn Du in ihm die ergänzende Hälfte Deines Wesens, und Dich plötzlich von ihm betrogen, durch ihn Dich Deines ganzen Glückes beraubt siehst, oder wenn Du Dir die Möglichkeit dessen vorzustellen vermagst, so kannst Du Dir meinen Zustand denken. Tausend Flüche im Herzen, stand ich wortlos da; ich dürstete nach Rache, nach Blut, und zitterte am ganzen Körper. Er schien ruhig und reichte mir die Hand hin. Da brach mein ganzer Zorn aus, ich stieß seine Hand von mir. Ich sagte ihm Alles, was mir am Herzen lag; ich sprach von der Vergangenheit und Gegenwart und von seinem niederträchtigen Betrug. »Und jetzt fort aus diesem Hause!« schrie ich außer mir, »fort aus meinen Augen, Schurke!«
Armand blieb ruhig, nur das Zucken seiner Lippen und die leichte Röthe, die seine blassen Wangen einen Augenblick überflog, verriethen seine Aufregung. »Ich verstehe Dich,« sprach er endlich, einen verachtungsvollen Blick auf mich werfend; »morgen Früh um sechs Uhr werde ich Dir im Boulogner Wäldchen antworten.«
»Ich werde kommen!« sprach ich, fast erfreut von dieser Aufregung, »Du oder ich! Einer von uns Beiden muß fallen.«
»Du hast Recht,« sagte Armand ernst; »doch damit Du Dich nicht stolz überhebst, und unter dieser Maske eines Ehrenmannes nicht Deine Schande verbergest, wisse, daß Du erkannt bist. Ich wußte, daß Julie Dich nicht liebt, daß Du in Deinem kindischen Trotz Dich täuschen, Deinen Hoffnungen nicht freiwillig entsagen und Dich und Julie unglücklich machen werdest, und darum überbrachte ich Dufey's Brief, durch welchen ich wohl Deine Heirat verhinderte, aber nicht Dein Glück, das Du durch Juliens erzwungene Hand ohnehin nicht hättest finden können. Ich war überzeugt, daß, was ich thue, Dir, den das Schicksal durch Freuden verwöhnt hat, einen Augenblick wohl schmerzlich sein, Deine Zukunft aber vor einem großen Jammer bewahren werde; zugleich aber war ich überzeugt, daß ich, Dufey, dem ich mehr als mein Leben verdanke, glücklich mache. Und was thatest Du während dessen? Du warft in Paris, gingst von Haus zu Haus und erkundigtest Dich, wie ein feiger Spion, ob Dein Freund Dich nicht betrogen habe. Fragtest Du nicht beim Juwelenhändler, ob die Perlen Deiner Braut ausgezahlt seien? Leugne es, daß die große Gefahr Dich eine ganze Nacht nicht schlafen ließ und daß Du den andern Tag wieder kamst und wieder Erkundigungen einzogst. Du erröthest; nicht wahr, das ist ein Zeichen großer Freundschaft? O, Ihr Reichen, Ihr Erhabenen, die Ihr auf den höchsten Stufen des Lebens steht, Ihr hattet Verstand genug, nur diejenigen Fehler als ehrlos zu brandmarken, vor welchen Eure Lage Euch bewahrt. Treulosigkeit, Lüge, Tyrannei ist Euch erlaubt. Ein großer Betrüger, der Millionen verschwindelte, ist Euch ein Unglücklicher, der Arme, der hungernd sich ein Stück Brot nahm, wo er es eben fand, ein niederträchtiger Dieb. Aber vergesset nicht, daß unter Euch das Volk steht, daß es Eure Thaten kennt und mit einem andern Maße mißt, als Ihr; daß es weiß, was Ihr werth seid, die Ihr wagt, es mit Füßen zu treten, und daß es, wie tief es auch stehen möge, sich groß genug fühlt, um Euch zu verachten.«
Armand ging fort. Ich folgte ihm nach kurzer Zeit. Seine Worte erfüllten meine Seele mit tiefem Schmerz. Was ich aus Freundschaft gethan hatte, schrieb er den niedrigsten Absichten zu; ich verdiente seinen Dank, und er verachtete mich. So ist der Mensch; es gibt keine That, deren Folgen er berechnen könnte, selbst wenn er beglücken will; der größte Theil seiner Thaten hängt vom Zufall ab.
Abends, nachdem ich alle Anordnungen getroffen hatte, ging ich noch einmal hinaus auf das Gut des Grafen. Julie war nicht mehr dort. Wenige Stunden nach mir war auch sie fortgegangen, und Niemand wußte wohin. Von den früheren Bewohnern des Hauses fand ich nur noch den Grafen da. Ruhig lag er auf dem hohen Katafalk, und die rings um denselben stehenden Kerzen verbreiteten ein trauriges Licht auf die finsteren Ahnenbilder, die wie trauernd auf ihren letzten Sprößling herabblickten, und dieser, dessen Wappen umgekehrt war, harrte des Augenblickes, in welchem sein Sarg den letzten Platz des alten Grabgewölbes ausfüllen sollte. Ich war zum letzten Male in diesem Hause.
Was später geschah, weißt Du. Nachdem ich, von Armand's Kugel getroffen, niedergesunken war, nahmst Du mich in Deine Arme, und Du warst es, dessen freundliches Gesicht dem in's Leben Zurückkehrenden zuerst entgegenlächelte, und von diesem Augenblicke hast Du mich durch Deine Treue fast vergessen lassen, wie viel Böses Du mir thatest, indem Du mir das Leben rettetest.
Der Graf vermachte mir in seinem erneuerten Testament außer fünfzigtausend Francs in Baarem, seinen ganzen Besitz. Du weißt, wie viel ich mich bemüht habe, um Juliens Aufenthalt ausfindig zu machen um ihr diesen verfluchten Besitz zurückzugeben, und daß alle meine Bemühungen vergebens waren. Als es mir in meiner Krankheit am schlechtesten erging, wachte die Unglückliche drei Nächte hindurch an meinem Bette, dann verschwand sie, und Niemand konnte sagen, wohin.
Ich erholte mich endlich und kehrte zu meinem Vater zurück.