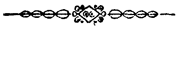|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Eine der wichtigsten war die Trennung aller Justizsachen von den öffentlichen und Polizeiangelegenheiten (durch Verordnung vom 10. Mai 1749). Es wurden nun drei höchste Landeskollegien eingesetzt. Das Directorium in publicis et cameralibus erhielt alle Kammer- und Polizeisachen, die oberste Justizstelle alle Justiz- und Criminalsachen, die Hof- und Staatskanzlei alle eigentlichen Staats- und auswärtigen Angelegenheiten. Außerdem wurden 1749 ein besonderes Commerciendirektorium und ein Direktionshofkollegium für das Berg- und Münzwesen errichtet.
war recht eigentlich Kaunitzens Werk (1752). Organisirt war sie durch die Stellen eines Haus-, Hof- und Staatskanzlers, eines Staatsvicekanzlers und fünf Hofräthen, welche unter denselben arbeiteten. Für Belgien und die Lombardei, über welche letztere 1753 der Erzherzog Peter Leopold (geboren 5. Mai 1747) zum Statthalter ernannt wurde, Vor der Hand, bis zu reiferem Alter des jungen Prinzen, war der Herzog Franz Maria von Modena dessen Stellvertreter. war die Staatskanzlei bis zum Jahr 1757 auch administrative Stelle, in Würdigung der mehr politischen als administrativen Rücksichten, welche, bei der Stellung jener beiden Länder zu den benachbarten Mächten, auf deren oberste Leitung genommen werden mußten.
Bei der Gründung der Staatskanzlei müssen zwei andere wichtige Schöpfungen Kaunitzens, welche sich auf dieselbe bezogen, erwähnt werden. Nämlich erstens die des geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchivs, zu welchem Ende Hofrath Rosenthal (1748-1752) alle Provinzstädte bereiste, um die wichtigsten Urkunden aus denselben nach Wien zu schaffen; es kam unter die Leitung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten. – Zweitens die Schöpfung der der Staatskanzlei untergeordneten Akademie der morgenländischen Sprachen (1752), um deren Organisation sich mit Kaunitz besonders dessen Freund Friedrich von Binder und im Detail der Jesuit Franz hochverdient machten, – eines Instituts, das hier nicht bloß wegen seiner Wichtigkeit für die Wissenschaften, sondern vielmehr wegen seiner staatlichen Nutzbarkeit (bei den politischen und Handelsverhältnissen Oesterreichs und der Türkei) angeführt wird.
Die Trennung der Verwaltung von der Justiz gab dieser letzteren endlich eine sichere Grundlage. Einen wirksamen Halt gegen die Uebergriffe der Feudalaristokratie schuf Maria Theresia durch die Organisation der Kreisämter (1748-1752); Zweck und nächste Folge derselben war die Emancipation des Landmanns vom Grundherrn, dessen naturgemäße Einreihung in den einheitlichen Staatsorganismus.
In weiterer Stufenfolge schlossen sich daran die Mittelbehörden der Hofstellen für Verwaltung, Finanzen und Justiz. Für die österreichischen Vorlande in Schwaben wurde 1752 eine von der Regierung zu Inspruck unabhängige Regierung zu Freiburg im Breisgau und zu Konstanz eine direkt unter dem Oberdirektorium in internis zu Wien stehende Repräsentation und Kammer errichtet Sie wurde 1760 nach Freiburg verlegt..
Späterhin erhielt der Neubau gleichmäßiger Verwaltung in der ganzen Monarchie seinen Schlußstein durch den
wozu Karls VI. »Finanzkonferenzrath« (in welchem der Kaiser präsidirte und 4 Geheime-Räthe mit Sitz und Stimme saßen) gewissermaßen als Vorläufer betrachtet werden konnte. Den »neuen aus Ministern und Hofräthen bestehenden inländischen« Staatsrath begründete Maria Theresia im Jahre 1760 (4. Dezbr.); sie erklärte dabei, daß sie demselben »alle an Sie gelangende inländische Geschäfte und Anliegenheiten in Dero teutschen Erblanden mittheilen werde, damit er sich eine vollkommene Kenntniß erwerbe, in dem Zusammenhange der Geschäfte verbleibe, das Ganze übersehe, solches mit seinen Theilen verbinden, alles reiflich erwegen, auf die ersprießlichsten Verbesserungen fürdenken, und bei allen Landesvorfallenheiten, wo Ihre K. K. A. M. etwas zu entschließen und zu verordnen haben, Allerhöchst Ihroselben mit seinem guten und freimüthigen Rath an Handen gehen könne, als worin seine einzige Beschäftigung zu bestehen hätte.« Als ein Mittel zur sicheren Erreichung dieses Zweckes wurde »als eine unabänderliche Grundregel festgesetzt, daß kein Mitglied des Staatsrathes, den Herrn Hof- und Staatskanzlern wegen der engen Verbindung seines Amtes mit den inländischen Geschäften einzig und allein ausgenommen, ein anderes Amt bekleiden solle, sondern solches bei dem Eintritte in den ernannten Rath abzulegen habe.« Die erste Zusammensetzung des Staatsraths (1761) war folgende; Staatsminister: Kaunitz, Ferdinand Graf von Haugwitz, Leopold Graf von Daun, Heinrich Graf von Blümegen; Staatsräthe: Egidius Freiherr von Borie, Anton Freiherr von Stupan. Mit Einsetzung des Staatsraths erlosch übrigens das » directorium in publicis et cameralibus« vom J. 1749.
Zwei Hauptaugenpunkte der Sorgfalt waren für Marien Theresien die Verbesserungen des Finanz- und des Kriegswesens.
Ungeachtet der Umsicht und rastlosen Thätigkeit, womit Marien Theresiens Gemahl das Ersparungssystem durchzuführen bemüht war, wobei ihm Jene freie Hand ließ, und obwohl es ihm in der That gelang, jährlich zwölf Millionen zu ersparen, so verschlang doch der Krieg ungeheure Summen und die Finanzverlegenheit erreichte eine solche Höhe, daß sich Maria Theresia im Jahre 1746 genöthigt sah, eine sehr harte Kopf- und Vermögenssteuer auszuschreiben, welche »Alle vom Minister bis zum Stallknecht, vom Erzbischof bis zum Klostergeistlichen herab« entrichten mußten, und wobei ein Fürst 600 Gulden, ein Bauer 48 Kreuzer, ein Taglöhner 12 Kreuzer zu bezahlen hatte; eine verletzende Ungleichheit! In Steyermark zeigte sich eine ebenso empfindliche Ungleichheit, sowohl was die Leistung dieses Herzogthums gegen die der übrigen Erblande, als was die der einzelnen Kreise Steyermarks gegeneinander betraf. Ein großes Verdienst um die Regelung und Verbesserung der Finanzen erwarb sich der Graf Friedrich Wilhelm von Haugwitz, welcher schon i. J. 1747 eine neue Kameraleinrichtung zu Stande brachte. Kaum war der österreichische Erbfolgekrieg beendigt, als Maria Theresia alles aufbot, um die öffentlichen Lasten auf alle Staatsangehörigen nach möglichst gleichen und verhältnißmäßig billigen Grundsätzen zu vertheilen (Rektifikation, begonnen 1748), sowie die reichlich vorhandenen Quellen des Nationalwohlstandes durch Hebung von Ackerbau und Industrie und Begünstigung des Handels bestmöglichst zu benützen. So ist schon das Jahr 1749 durch mehrere darauf abzielende Verordnungen bezeichnet. Zur Beförderung des inländischen Handels erhielten die Hauptmärkte zu Wien, Prag, Brünn, Troppau, Grätz und Linz eine neue Einrichtung, und wurden die inländischen Waaren von aller Transito-Mauth befreit; alle zur Erhebung der Mauth berechtigten Herrschaften in Unterösterreich durften von durchgehenden Waaren keine Mauth mehr einfordern lassen. Zur Hebung des inländischen Gewerbfleißes wurden Einfuhr und Gebrauch ausländischer Stoffe, goldener und silberner Borden, Spitzen und Stickereien verboten. Es folgten 1750 Verordnungen zur Verhütung der Schmuggelei, 1751 gegen den Wucher, gegen Ausfuhr kaiserlicher Münzen und Einschleppung geringhaltiger, Aufhebung aller Portofreiheit und zugleich Herabsetzung des Brief- und Paket-Portos, 1754 (unterm 12. Jan.) ein neues Münzedikt, 1755 eine Einrichtung zur Hebung des böhmischen Bergbaus (Graf Pachta wurde zum Oberberg- und Münzmeister in Böhmen ernannt). In den Niederlanden sorgte der neue Generalstatthalter Prinz Karl von Lothringen für die Verbesserung des Münzwesens (schon 1749), für Beförderung des Handels (1750 ließ er einen Kanal zwischen Brüssel und Löwen anlegen); und 1755 wurde für einige aus Holland, Deutschland und Lüttich in Belgien eingebrachte Waaren ein neuer Transitozoll eingeführt. In Steyermark wurde die Eisenindustrie begünstigt, indem die Arbeiter an den Werken bei der Soldatenstellung große Vorrechte erhielten. Mit solchen Einrichtungen wirkten dann allmälig auch andere förderlichst zum gemeinsamen Zwecke, so die Rectificirung der Grundabgaben, die Einführung der Urbarien und Grundbücher, die Aufhebung mehrerer Steuerfreiheiten, die Vereinfachung des Staatskassenwesens i. J. 1761, bis zu welchem Jahre sich sämmtliche Finanzen der deutschen und ungarischen Provinzen in den Händen mehrerer Minister befanden, von denen Jedem eine eigene Kasse zugetheilt war; nach der neuen Einrichtung von 1761 entstand eine Generalkassendirektion in Wien, welcher dann die sämmtlichen Kassen der Hauptfonds der österreichischen Finanzen untergeben wurden, und welche dafür zu sorgen hatten, daß alle reinen Staatseinkünfte, die bei den Aemtern, nach Abzug der zu Gefällen aufgelaufenen Unkosten, übrig blieben, erhoben und zur Bestreitung der Staatserfordernisse verwendet wurden. Die Geschäfte des »Direktionshofkollegiums für Berg- und Münzwesen« v. 1749 wurden 1757 dem Direktorium zugetheilt; später (1777) wurde für das Berg- und Münzwesen die Hofkammer errichtet. In demselben Jahre, in welchem das Directorium erlosch (1760), wurde im Interesse des Handels ein Kommerzienrath (er erlosch erst 1776) und wurde die Hofrechnungskammer, zu deren Verfassung Graf Ludwig von Zinzendorf den Grund gelegt, in's Leben gerufen, zu deren Ressort die Censur aller Staatsrechnungen, sodann die schleunige Anzeige jedes ihr im Finanzwesen, besonders bei Ausgaben vorkommenden Gebrechens und endlich die Aufstellung eines jährlichen Staatsetats mit Zuziehung der Finanzstellen gehörten. Im J. 1773 erhielt sie eine durchgreifende Reform (worüber später). Außerdem erhielt 1761 die Hofkammer die Leitung der Finanzen und eine »teutsch-erbländische Creditsdeputation« die Sorge für Aufrechthaltung des Staatskredits. Ueberblickt man diese Thätigkeit, so wird man die Angabe Nicolay's über den Stand der österreichischen Finanzen in den Jahren 1753 und 1757 begreiflich finden. Nach ihm betrugen die Staatsrevenüen im Jahre 1753 unter der Finanzverwaltung des Grafen Haugwitz 40,027,806 Gulden, während sich die Ausgaben bloß auf 22,100,000 fl. beliefen; im Jahre 1757 stiegen die ersteren (unter der Choteck'schen Verwaltung) auf 57 Millionen Gulden. So waren denn die Staatseinkünfte, ungeachtet der Kriege, um mehrere Millionen bedeutender, als zur Zeit Kaiser Karls VI., der noch dazu Neapel und Schlesien besessen hatte, dessen letzteren Ertrag allein man auf 6 Millionen Gulden angab!
Einen beträchtlichen Theil der durch die verbesserte Finanzverwaltung gesteigerten Einkünfte verwandte Maria Theresia auf das
Sie begriff die ganze Bedeutung von Prinz Eugen's inhaltschwerem Rath, die Nothwendigkeit: ein tüchtiges, waffengeübtes Heer zu besitzen, nicht etwa bloß als Mittel zur Erreichung jenes geheimen Lieblingswunsches, den sie nun einmal nicht aus der tiefsten Seele zu verbannen vermochte, der Wiedereroberung Schlesiens, sondern auch überhaupt zur Vertheidigung der Würde ihrer Monarchie, zur Behauptung der Stellung Oesterreichs in der Reihe der Großmächte Europa's, wie das seit langen Zeiten keiner ihrer Vorfahren mit solcher Energie unternommen hat als diese Frau. Sie hatte die Gebrechen des Heerwesens erkannt, zu deren Abstellung ihr treffliche Männer behülflich waren. Sie sah ein, daß nicht bloß in der Zahl der Soldaten die Stärke eines Heeres liege, sondern in der Bildung, im Geist, im Selbstgefühl der Krieger, daß das Heerwesen nichts Vereinzeltes, nichts durch bloße Willkür Erschaffenes, Störendes im ganzen Staatsorganismus sein dürfe, daß es vom Odem der Wissenschaft durchdrungen, vom Gefühl der Menschlichkeit gekräftigt sein müsse. Indem Maria Theresia alles dies im ganzen weiten Umfange berücksichtigte und keinen einzelnen Seitenzweig aus den Augen ließ, war die Heeresmutter (» mater castrorum«, so nannte sie die Inschrift einer Münze) auch wahrhaft Landesmutter. Auch im Kriegswesen, wie allüberall, handelte es sich um mehr als bloße Verbesserungen, handelte es sich um eine durchgreifende Neugestaltung, um etwas Schöpferisches.
Bevor wir nun die Thätigkeit auf diesem Gebiete näher betrachten, werfen wir einen Blick auf jenes vielbesprochene und verschiedenartig beurtheilte Institut, welches nicht selten die raschen Fortschritte der österreichischen Waffen aufhielt, auf den altherkömmlichen Hofkriegsrath, welcher, wenn er auch nicht immer seine allernächste Bestimmung erfüllte, doch dagegen der Lösung einer andern geschichtlichen Aufgabe vorarbeitete, der monarchischen Einigung zahlreicher Besonderheiten, nach Einer und derselben Norm, ganz abgesehen davon, ob diese zur Zeit immer zweckmäßig war. Der damalige Geschäftswirkungskreis des Hofkriegsraths
Vom Hofkriegsrath hingen ab: Das Generaldirektorium des Ingenieurkorps und Fortifikationswesens, (mit Mineurs und Sappeurkorps), das Feld- und Hausartilleriezeugamt (unter welchem alle Garnisons-Artillerie-Kommandanten in den Provinzen und alle bei Salpeter- und Pulverwesen Angestellten), – die Generalkommandanten in den Provinzen, – das Kriegskommissariat (für Rekrutirungssachen, Marschrouten, Kassenvisitationen, Montursachen u. s. w.), – die Verpflegsinspektion (für sämmtliche Militärmagazine im Krieg wie im Frieden); das Militärinvalidenamt, das oberste Schiffamt (für Schiff- und Brückenbau), die Monturökonomie-Hauptkommission, das Kriegszahlamt, die Garden, das Fuhrwesenkorps, die Kriegsakademie zu Wiener-Neustadt, die Ingenieurschule in Wien, das Konsistorium.
In Bezug auf die Militärgerichte war der Hofkriegsrath sowohl in Civilrechts- als in peinlichen Sachen das Revisorium und eignete für alle Klagen wegen versagten oder verzögerten Rechts, für alle Nullitätsklagen und alle Klagen des verdächtigen Richters. Für Civilstreitigkeiten und Geschäfte des adeligen Richteramts bestanden die
judicia delegata militaria mixta. Außerdem hatte jedes Regiment sein eigenes Gericht unter dem Präsidium des Obersten. (Vergl. de Luca I; der überhaupt bei diesen Abschnitten benützt worden.) theilte sich in Publica und in Judicialia, und die
Kommissariatsgeschäfte standen unter einem »General-Kriegskommissariatamt«, welches 1761 unter dem Präsidium des Grafen Johann Karl von Choteck stand, später aber dem Departement
in Publicis zugetheilt wurde. Beide Departements, das
in publicis, wie das
in judicialibus, standen (seit 1756) unter Einem Oberpräsidenten, dem Reichsgrafen Leopold Joseph Maria von Daun (geboren am 24. September 1705).
Dieser Mann war es, welcher das Werk fortführte, das der treffliche alte Khevenhüller begonnen hatte, welcher die Zeit des Friedens zur Reorganisation des österreichischen Heeres aufs Förderlichste benutzte. Daun machte rasch seine Carriere. Seine Sporen hatte er in Eugens letzten Feldzügen am Rhein und in dem unglücklichen Türkenkrieg Karls VI. verdient. Im ersten schlesischen Krieg hatte er nach der Schlacht bei Molwitz den Rest Schlesiens gedeckt, hatte er die Franzosen aus Böhmen vertreiben geholfen, und sich unter Khevenhüller bei dem Angriffskrieg gegen Bayern hervorgethan. Unter Khevenhüller's Nachfolger Traun befehligte er 1744 beim Rheinübergang die Avantgarde, und führte den Nachtrab, als das österreichische Heer durch Friedrichs Angriff auf Böhmen genöthigt war, sich schleunig aus dem Elsaß über den Rhein zurückzuziehen; bei Ludwigsburg schlug er einen Angriff der Franzosen zurück. Seine persönliche Tapferkeit in den Schlachten bei Hohenfriedberg und Sorr wurde durch die Ernennung zum Feldzeugmeister anerkannt, worauf er sich bei dem niederländischen Feldzug in den Schlachten bei Roucoux und besonders bei Laffeldt an der Spitze der Infanterie aufs Rühmlichste auszeichnete.
Nach dem Abschluß des Aachener Friedens war Daun als Hofkriegsrath und Präsident des judicii delegati militaris mixti unablässig mit der Verbesserung der Kriegsübungen beschäftigt. Unter seiner Aufsicht entwarfen die Generalmajors von Winkelmann und Graf Radicati 1749 ein neues Reglement, wobei Daun das preußische zum Muster genommen hatte; es wurde gedruckt und mit Kupfertafeln versehen ausgegeben. Zur praktischen Uebung wurden Offiziere aus allen Regimentern nach Wien beschieden und erhielten näheren Unterricht durch den General von Sincere und den Oberst von Angern. Und wie Daun die Infanterie, so erhob Fürst Wenzel Lichtenstein die Artillerie zu einer bis dahin unbekannten Stufe der Ausbildung. Die praktische Taktik im Großen wurde dabei nicht verabsäumt; sehr häufig wurden größere Truppenabtheilungen zusammengezogen und Maria Theresia besuchte dann die Lager, so im Juli und August 1750 die bei Pettau in Steyermark und bei Kollin; so musterte sie im folgenden Jahre die ungarischen Regimenter, welche bei Pesth zusammengezogen waren, so wohnte sie im August 1753 mit dem Kaiser den großen Artillerie-Manövern bei, welche Lichtenstein bei Moldau-Thein kommandirte.
Ein anderes Verdienst erwarb sich Daun dadurch, daß er Marien Theresien zur Errichtung von Bildungsanstalten für Offiziere, von Cadeten- und Ingenieurschulen veranlaßte.
Hiebei kam nun noch insbesondere das Verhältniß zum Adel in Betracht, der durch Erziehung auf Ritterakademien und dergl. in ein näheres, innigeres Verhältniß zur Dynastie sowohl als zum Staate gebracht werden sollte, um seine auf Geburt begründeten Ansprüche auf Bevorzugung, die man nicht leicht unbeachtet lassen konnte, doch wenigstens durch persönliche Tüchtigkeit zu rechtfertigen und somit dem Interesse des Staatsganzen zu dienen. So verwandelte Maria Theresia schon 1744 das bisherige Gymnasium zu Kremsmünster in eine adelige Akademie, und schenkte 1746 die Favorita auf der Wieden in Wien, wo ihr Vater Karl VI. gestorben, den Jesuiten zu einem Kollegium für die adelige Jugend, welches nunmehr ihren Namen erhielt; schon im folgenden Jahre wurde das Collegium Theresianum oder die Theresianische Ritterakademie eröffnet, 1748 mit der Garellischen Bibliothek (deren Vorsteher später – 1771 der wackere Michael Denis wurde), und 1750 mit ansehnlichen Summen zu immerwährender Erhaltung dotirt. 1747 gründete sie das adelige Convict zu Tyrnau; 1749 wurde die von der verwittweten Prinzessin Maria Theresia von Savoyen-Soissons gegründete savoyische Ritterakademie zu Wien, welcher die Kaiserin ihren besonderen Schutz zusagte, eröffnet.
Daun's Name aber muß insbesondere bei Errichtung der Ingenieurakademie zu Wien und der Kadettenschule zu Wienerisch-Neustadt (1752) mit Ehren gedacht werden; dreihundert Kadetten wurden in Letzterer, deren Oberdirektion Daun übertragen war, auf der Kaiserin Kosten im Lokale der landesfürstlichen Burg unentgeltlich erzogen. Maria Theresia erkannte Daun's Verdienste in diesem wichtigen Geschäftskreise, indem sie dessen Brustbild 1755 im Ingenieur-Saale der Akademie zu Neustadt aufstellen ließ. Ueberdieß erwies sie ihm während der Friedenszeit fast von Jahr zu Jahr höhere Ehren; 1751 ernannte sie ihn zum Kommandanten von Wien, 1753 zum Ritter des goldnen Vließes, 1754 zum Feldmarschall und 1756 endlich, in Voraussicht einer Zeit, da ihr seine bedächtige Umsicht von großem Werth sein würde, zum Präsidenten des Hofkriegsraths.
Aber auch in jeder andern Weise wurde für die geistige, moralische und materielle Grundlage des Kriegswesens gesorgt.
War gleich die Konskription für die sämmtlichen deutschen Erbstaaten damals noch nicht organisirt, so wurde dagegen (1733) in gesammten Erblanden eine Landmiliz von 24,000 M. errichtet; schon 1746 hatte der kaiserliche Generalfeldmarschall Prinz von Hildburghausen eine reguläre Kriegsverfassung in Kroatien, 1747 der General von Engelshofen eine gleiche in Slavonien zu Stande gebracht; 1750 wurden durch Bemühung des Generals Grafen von Maguire im Warasdiner Generalat zwei reguläre Regimenter auf deutschen Fuß gesetzt, in deutscher Sprache exercirt und kommandirt.
Für die Versorgung von Kriegern, die im Dienste für Dynastie und Vaterland Gesundheit oder Glieder eingebüßt, stiftete Maria Theresia Invalidenhäuser, 1750 das zu Wien (anfänglich in der Alsergasse, dann in das auf der Landstraße gelegene Gebäude der 1783 aufgelösten Kollonits'schen Stiftung, das sogenannte St. Johannes- oder Nepomuceni-Spital versetzt,) dann in den Niederlanden die zu Antwerpen und Mecheln. 1754 erhielten die Invaliden (14,000 Mann!) nach Maßgabe der Verordnung vom 28. März 1750 einen ordentlichen Gnadengehalt. Hierher gehört auch die Errichtung des Erziehungshauses für Offizierstöchter zu Ebersdorf in Oesterreich (1753).
Für gesunde Wohnung der aktiven Truppen wurde durch Erbauung geräumiger und allen Anforderungen entsprechender Kasernen gesorgt; so entstanden deren bloß in Wien allein von 1748 bis 1753 die am Salzgries, in der Leopoldstadt, in der Alsergasse und am Getreidemarkt.
Eine Menge weiser Verordnungen griffen wohlthätig in's innere Leben des ganzen Kriegerstandes ein. Man muß die achtungswerthen Bestrebungen Marien Theresiens anerkennen, den Wehrstand aus den Schranken einer Art von Pariakaste allmählig emporzuheben zum Bewußtsein ihrer angebornen Menschen- und ihrer erworbenen Bürgerrechte für die Soldaten, in ihrem Verhältniß zum Staat überhaupt und zu den übrigen Staatsangehörigen anderseits, beschränkend und schützend, einen Rechtszustand zu begründen, ohne daß ihr Stand dadurch zu einem bevorzugten Staat im Staate gemacht werden sollte. Was in dieser Hinsicht damals geschah, war immerhin ein Anfang des Fortschritts, mochte alles Errungene auch allerdings vom eigentlichen Ziele immerhin noch ziemlich weit ab liegen. Unter den Verordnungen, welche darauf hinwirkten, sind insbesondere hervorzuheben: das Reglement von 1749, betreffend die Montirung, Verpflegung, Einquartirung, Rekrutirung und Remontirung des Heeres, so wie das neue vom 1. Nov. 1757 für Montirung, Kasse und Gage, insbesondere die vom Jahre 1755 auch, derzufolge alle Regimenter gehalten wurden, bei den Vorschlägen zu erledigten Offiziersstellen auf verdiente Unteroffiziere und Gemeine mehr als bisher zu sehen. Unverkennbar ist auch bei dieser Maßregel, welche angeerbten Standesvorzug zu beschränken suchte, das streng monarchische Interesse im Hintergrunde; ebenso unverkennbar die Wichtigkeit ihrer Folgen in naher und ferner Zeit. In anderer Hinsicht, zur Weckung und Aufrechthaltung eines besseren Geistes in der Armee, zur Begründung eines Sinnes für ächt bürgerliche Solidität, war die Verordnung vom Jahre 1749 von Belang, welche zur Untersuchung und Tilgung des Schuldenwesens der Regimenter eine besondere Hofkommission, unter dem Feldmarschall Grafen Caspar Ferdinand von Cordua, (dem Vorgänger Daun's als Hofkriegsrathspräsidenten) einsetzte. Nicht minder folgenreich war die strenge, aber im Interesse des Staates wohlbegründete Verordnung vom Jahre 1752, nach welcher fremde Werber, wenn sie in Oesterreich betreten würden, mit dem Strange bestraft werden sollten. Das untrüglichste Mittel gegen das Verlocken der Unterthanen, der beste Schutz und Schild der Fürsten in den Zeiten der Noth, die Volksbewaffnung nach einem wahrhaft nationalen System, die allgemeine Waffenpflichtigkeit auf der Grundlage der Wehrberechtigung des Freien, kannte man damals, wo die Kriege der Fürsten nicht Sache des Volkes, wo der Begriff des Volkes bei diesem selbst wie bei den Fürsten fast erloschen war, in Oesterreich freilich noch ebenso wenig als in Preußen, wo der König wohl über den Verlust schöner Truppen tiefbekümmert sein, aber noch immer mit »Rackers« um sich werfen konnte, die »ewig leben wollten!« Wie ließe sich auch davon reden, wo die Staatsangehörigen größtenteils nicht Freie, sondern theils Unterthanen nicht bloß des Staatsoberhauptes, sondern auch unmittelbar Hörige des Grundeigenthümers waren, und alle ihre Kräfte und Fähigkeiten an der Scholle klebten, der sie zugeschrieben waren; während, anderseits auch die Bildung des Volkes, in Folge mehrhundertjähriger systematischer Verdummung und Unterdrückung, sich auf der tiefsten Stufe befand, wo es sein höchstes Recht nicht zu erkennen, geschweige zu erstreben vermochte! Wir werden in der Folge sehen, wie Maria Theresia auch auf diesem Felde unermüdlich zu wirken und die Fesseln allmählig zu lösen versuchte, welche wahrlich stets auch den Fürsten und dessen Dynastie hemmen, indem sie das Volk niederhalten.
Was die sonstige Ausbildung des österreichischen Kriegswesens betrifft, so verdienen folgende Maßregeln Beachtung und zeugen von dem herrschenden Geiste, welcher nach allen Seiten hin nicht bloß das Dringende augenblicklicher Nothwendigkeit begriff, sondern auch über den Augenblick hinaus rechnete. Berühmt war, und mit Recht, die österreichische Cavallerie, die schwere sowohl, als die flinken Husaren, bei denen Mann und Roß ein Leib. Mit gutem Fug bedachte man – für den Fall des Krieges – nicht bloß die Ergänzung der Menschen, sondern auch die Tüchtigkeit der Rosse; demgemäß wurden Gestüte angelegt, eine Maßregel, die auch abgesehen von dem nächsten militärischen Zweck, für die Folge auch dem Ackerbau zu Gute kommen mußte. Hieran knüpft sich gleich der Gedanke an eine spätere Maßregel (v. 1777), welche gleichfalls ursprünglich einem militärischen Zwecke, der Erleichterung der Truppenbewegungen, diente, aber nicht minder auf andere Bereiche des Staatslebens, auf Landwirthschaft, Handel und Verkehr einwirken mußte, nämlich die genaue Aufnehmung des Viehstandes. Von großer Wichtigkeit war ferner die neue Einrichtung der Militärgränze seit dem Jahre 1750. Auf die verbesserte Organisation der Tschaikisten und des Pontonnierskorps (für Oesterreich, als den natürlichen Wächter der Civilisation an Deutschlands Strom, der Donau, von unberechenbarer Wichtigkeit!) wurde große Sorgfalt verwendet, – Mineurs- und Sappeurskorps wurden errichtet. Auch die Obsorge für die Festungen wurde ebenmäßig beachtet. So wurde 1754 Olmütz besser befestiget, im darauffolgenden Jahre auch Luxemburg, und alle festen Plätze in den Herzogthümern Mailand und Mantua. In demselben Jahre (1755) entstanden drei Hauptmagazine, zur Verpflegung der Truppen in Kriegs- wie Friedenszeiten, in Oesterreich, Böhmen und Mähren, zunächst wohl allerdings in Voraussicht eines möglichen und geheim erwünschten Angriffskrieges gegen Preußen, zum Zwecke der Wiedereroberung Schlesiens.
Kürzere Zeit, als bei den Reformen Marien Theresiens im Kriegswesen, verweilen wir bei jenen, welche sie während des Zeitraumes von 1748 bis 1756 in der
einführte. Noch war damals jenes neue peinliche Gesetzbuch, die » constitutio criminalis Theresiana« weder erlassen, noch eingeführt, welches uns jetzt nur als Abdruck einer früheren Barbarei erscheinen kann, gründend auf dem unseligen Vorurtheil, daß jeder Angeklagte von vorneherein als Schuldiger anzunehmen, daß jedes Läugnen der zugemutheten Schuld bei demselben als böswilliger Trotz gegen die Richter anzunehmen sei, welchen, gleichwie ihnen die Vorannahme eines untrüglichen Besserwissens zu gute käme, so auch unbeschränkte Befugniß zustände, das Bekenntniß durch die Folter, die grausamste Strafe von vorneherein, zu erpressen, und auf dieses durch Strafqual erpreßte Geständniß hin auch noch die empörendsten Qualstrafen zu diktiren; – eine Verhöhnung alles göttlichen und menschlichen Rechts, wie sich kaum eine ärgere denken läßt, eine von den vielen fluchwürdigen Folgen jenes bei uns Deutschen insbesondere widernationalen geheimen und schriftlichen Inquisitionsprozesses! Wenn Maria Theresia bei ihrem gesunden Verstande und bei ihrem edlen Herzen den alten Schlendrian, der die furchtbarsten Folgen in Beziehung auf Entsittlichung haben, der zum Verzweifeln an der göttlichen Vorsehung und am Menschenwerth führen mußte, nicht mit einem Male abschaffte, so liegt der Grund wohl darin, daß sie über dieses Gebiet ihrer Herrscherpflichten zu wenig unterrichtet und demnach zu leicht geneigt war, bei dem Mangel an vorurtheilsfreien Rathgebern, welche sie auf himmelschreiende Ungerechtigkeiten aufmerksam machen konnten, Denjenigen ihr Ohr zu leihen, welche nun einmal in den Letzteren ihre Praxis durchgemacht hatten, in denselben ergraut und zu stumpf waren, die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Reform, die Forderungen der Humanität einzusehen, in welcher die höchste und ewige Gerechtigkeit enthalten ist. Daß Maria Theresia jedenfalls für das Bessere, für das rein-Menschliche und also für den ewigen Odem des Göttlichen empfänglich war, hat die Folgezeit hinreichend bewiesen, als sie, einmal aufmerksam gemacht und angeregt, durch keine Stimme zu Gunsten des alten Schlendrians bewogen werden konnte, demselben ihre Herrscherpflichten und das Wohl ihrer Völker zu opfern. Die neuen milderen Ansichten, welche sich zunächst in Bezug auf Hexenglauben und Hexenprozesse geltend machten, (man möchte sie den Morgentraum vor dem Erwachen nennen), sollen später, wiewohl noch in diesem Buche, betrachtet werden, bei Erwähnung der Anfänge religiös-kirchlicher Reformen.
Aus dem oben berührten geflissentlich weitergegriffenen Zeitraum können hier nur wenige ins Einzelne gehende Maßregeln angeführt werden. So das Verbot des Zweikampfs vom 12. Juni 1752. Es setzte nicht bloß die Todesstrafe darauf, sondern verschärfte sie auch noch dadurch, daß sowohl die Leiche des im Zweikampf Gefallenen, als die des hingerichteten Gegners nicht in geweihter Erde, sondern auf der Richtstätte begraben werden sollte. Eine barbarische Maßregel, um eine barbarische Art von Ehrenrettung abzuschaffen! Mag immerhin der Zweikampf tief in den Urerinnerungen aller Völker wurzeln, seine Hauptstärke hat der falsche Begriff von Ehrenrettung nur durch die Feudalaristokratie erhalten. Ihr allein verdanken wir ja sogar noch heute dessen Bestehen, sei es, daß der Bürgerliche keine andere Genugthuung von dem Adeligen erhalten zu können glaubt, wenn ihm nämlich der Letztere, als Beleidiger, die Ehre überhaupt anthut, ihn zu tödten oder sich von ihm tödten zu lassen, sei's, daß der Bürgerliche – schlimm genug! – nicht wahrhaft menschlich gebildet, nicht edelstolz genug ist, die Nachäfferei sogenannter nobler Passionen, in denen sich namentlich der deutsche Bürger leider seit geraumer Zeit so gefällt, zu verschmähen, sei's, daß beide noch nicht Achtung genug haben vor der höchsten Macht auf Erden, die auch kein Fürst ungestraft verletzen sollte, vor dem, was hienieden in der bürgerlichen Gesellschaft allein Gottes Heiligkeit vertritt, vor der Heiligkeit des Gesetzes!
Eine andere Verfügung Marien Theresiens (vom Jahre 1755) welche das Civilrecht betrifft, verdient gleichfalls Erwähnung. Alle von Personen unter 24 Jahren ohne Einwilligung der Eltern und Vormünder geschlossenen Eheverbindungen wurden für ungültig erklärt! Eine Verfügung, die nicht bloß aus den Konsequenzen des römischen Rechts, sondern auch aus der Konsequenz des Prinzips der Volksbevormundung entsprang.
Sehr wichtig und von den besten Folgen begleitet in Bezug auf Feststellung der Rechtszustände war die bereits angedeutete Einführung des neuen Urbarium's, welches bald nach dem Aachener Frieden entstand und als ein Schritt zu dem Ziele: Gleichheit der Rechte betrachtet werden muß.
Ein Aufstand, welchen das Landvolk im Warasdiner Generalat und in Kroatien 1755 erhob, darf hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden, weil Maria Theresia, nach Erstickung desselben durch bewaffnete Macht, auch die Ursachen des Uebels zu erforschen und abzustellen suchte. Und so bemühte sie sich denn auch wirklich, den schlimmen Zustand, welcher den Ausbruch der Verzweiflung hervorgerufen hatte, außer durch eine gerechtere Vertheilung der Contribution, auch durch Einführung eines geregelten feststehenden Urbariums zu verbessern, während sie anderseits Geist und Gemüth der armen Bevölkerung durch Gründung von Nationalschulen aus der furchtbaren Rohheit zu erheben und allmählig zu veredeln sich angelegen sein ließ.
In dem Verhältniß Marien Theresiens zu den Landständen (besonders zu den steyerischen) läßt sich unschwer der charakteristische Zug erkennen, wie das monarchische Princip sich über die längst beinahe ganz bedeutungslos gewordene Institution hinwegsetzte, wie aber Maria Theresia diesem Prinzip rein in wohlwollendsten Absichten für das Beste von Volk und Land folgte. Centralisiren und Ausgleichen; dies zeigt sich als Grundtypus. Die Dynastie wollte sich selbst, aber nicht minder auch die unteren Stände des Volkes von den Privilegien und Machtvollkommenheiten der oberen lösen; nur auf diesem Wege waren frische Triebe aus den Wurzeln, war eine neue durchgreifende Lebensthätigkeit und materieller Wohlstand zu hoffen, und ist einmal letzterer in einem tüchtigen Bürgerthum, ist in diesem ein Bewußtsein der Unabhängigkeit durch Besitz und Erwerb begründet, dann kann auch der geistige Fortschritt, das politische Bewußtsein nicht lange ausbleiben. Darum ist die Epoche der österreichischen Geschichte unter Marien Theresiens Regierung so interessant, weil sich hier zuerst die kleinen, fast unmerklichen Saatkörner, Triebe und Knospen aller folgenden Entwickelungen zeigen. Die Josephinische Zeit mit allen ihren raschen Blüten voll seltener Farbenpracht und oft betäubenden Duftes, – wer vermöchte sie vollkommen zu begreifen, ohne die Keime jener Theresianischen Epoche richtig gewürdiget zu haben? Hier ist noch das Tosen jener Stürme, die dem Frühling Bahn brechen, das geheimnißvolle Kreisen und Aufsteigen des Lebenssaftes in allen Adern des winterlich eingeengten und scheintodt daliegenden großen Organismus, der sich verjüngen will, das Ringen neuer Ideen und werdender Formen, wie die Ideen sich aus sich selber solche erschaffen, und der Widerstand der alten, abgestorbenen Formen, welche ihre Zeit hindurch ihre Anrechte auf Geltung behauptet haben. Und wie diese ganze Zeit, so – in Bezug auf dieselbe – auch wieder Maria Theresia selbst, theilweise noch gebunden und befangen von alten Formen, weil sie dieselben seit frühester Kindheit als etwas Wesentliches hochhalten und verehren gelernt, – und doch wieder tief in ihr das Ringen und Streben eines neuen Geistes, einer neuen Weltanschauung, an's Licht heraus, zur Anerkennung, zur Selbstgeltendmachung und Behauptung. Nenne man das nicht Gegensätzlichkeit, nicht Widerspruch! Messe man nicht den ganzen Charakter, der so genau der ganzen Zeit entspricht, bloß nach einzelnen Erscheinungen!
Was ich hier angedeutet, wird man klarer erkennen aus einem Blicke auf die
in den österreichischen Staaten in jener Epoche, welcher die Anfänge der folgenden Entwickelung angehören und nicht sowohl ergänzt als vielmehr beleuchtet werden durch die seit langer Zeit ersten Regungen geistigen Lebens in jenen Staaten.
Es kommt hiebei Mehrerlei zu beachten. Zuerst wieder das dem strengmonarchischen Prinzip entsprechende Streben nach einer allmäligen Emancipation der Dynastie, und also folgerichtig auch des Staates, von der Kirche. Die Monarchin entäußert sich gleichsam ihrer Persönlichkeit zu Gunsten der Monarchie, d. h. zunächst im Interesse der Dynastie. Dann aber ergibt sich sogleich, daß diese nicht ohne die Idee des Staates gedacht werden kann, worin am Ende auch der Begriff der Monarchie vollkommen aufgeht. Man erkennt, daß man nicht bloß alles für den Staat thun wollen dürfe, sondern daß man auch im Interesse der Monarchie nichts ohne den Staat thun kann. Nur eine weitere Schlußfolgerung steht noch aus, die vom Staat zu der Nation, oder hier im betreffenden Fall, zu den verschiedenen durch die Monarchie verbundenen Nationen. Denn immer ist's doch der Lebenssaft der Nation, aus dem der Baum des Staats seine Blätter, Zweige, Aeste, seine Blüten und Früchte erzeugt, und durch welchen die Monarchie eben zur lebendigen Krone desselben wird.
Nun aber möchte sich zum zweiten, als Gegensatz zu jenem monarchischen Streben nach Emancipation der Dynastie und des Staates von der Kirche, das historische Recht der Letzteren darstellen. Wenn nun hier von einem historischen Rechte die Rede sein soll, so kommt es vor allem auf die Feststellung des Zeitraums an, welchen man für Ersitzung annimmt, und man mißt hier nicht nach Jahren, sondern nach Jahrhunderten. Glaubt man also das historische Recht der Kirche, als eines allgemeinen unsichtbaren Staates, in dem jeder sichtbare besondere enthalten sei, behaupten zu können, und sprechen Jahrhunderte dafür, so erheben sich hinter diesen Jahrhunderten wieder andere, in welchen zwar nicht die allgemeine Kirche als solche im besonderen Staat enthalten war, weil man den Begriff derselben überhaupt noch nicht ausgebildet, verbreitet und Völkern wie Fürsten eingeprägt hatte, in welchen aber wohl der Staat als Staat unbedingt selbstständig und über jeden anderen Anspruch von Bevormundung erhaben war; ja, es ließ sich, um nur an das deutsche Reich zu erinnern, die Zeit anführen, als noch nicht das (vor Gregor VII. in seiner Wahleigenschaft gar nicht vorhandene) Kardinalskollegium, sondern die römisch-deutschen Kaiser die Papstwahlen, ohne Widerspruch der ganzen Christenheit, bestimmten. Diese Rückblicke würden indessen zu weit vom Ziele abführen; es genügt, daß, wenn von einem historischen Rechte überhaupt im vorliegenden Falle die Rede war, ein solches zu Gunsten der Monarchie sprechen mußte, ob man auch manche andere besondere historische Rechte zu Gunsten der Kirche im Allgemeinen und des Hochklerus in einem einzelnen Staate, in einer einzelnen Provinz insbesondere, fort und fort gelten lassen wollte.
Beide obige Anschauungspunkte zusammengefaßt, kommt nun noch die Persönlichkeit Marien Theresiens in Betracht. Sie war ehrlich fromm, sie war streng im römisch-katholischen Glauben erzogen, und – sie war Frau! Sie war fromm im schönsten, im edelsten Sinne des Wortes, denn sie war tugendhaft so völlig in jeder Beziehung, daß ihr selbst ihre Feinde dies nicht abstreiten konnten; aber sie sah auch in Folge ihrer Erziehung eine Menge altherkömmlicher Ansichten über Außerwesentliches, welche dem ursprünglichen Wesen des Katholicismus fremd sind, fast in der Höhe des Dogmas vor sich ragen, und sie hielt ihr Ohr einerseits Stimmen offen, welche jene unnatürliche Vermengung des Weltlichen und Geistlichen zur Untrüglichkeit des Glaubenssatzes, zur Gewissensangelegenheit machten, während sie anderseits so gesunde natürliche Anlagen und einen so eminenten Herrscherberuf hatte, daß sie auch solchen Stimmen ihr Ohr weder verschließen konnte noch verschließen wollte, welche sie auf die Gränzlinie der Unterscheidung zwischen Recht und Pflicht, zwischen Privatgewissen und Herrscherberuf unumwunden aufmerksam machten.
Daher nun anfänglich ein Schwanken, welches nicht ohne Irrthümer sein konnte; daher Irrthümer der Herrscherin, welche aus Skrupeln ihres Privatgewissens entstanden, und Ungerechtigkeiten, welche die Fürstin, die nichts mehr haßte als Ungerechtigkeit, in vermeintlicher Pflichterfüllung beging; doch wieder gleichzeitig auf der anderen Seite auf demselben Felde so viele Beweise eines richtigen Erkennens, einer großartigen Anschauung, eines rein menschlichen Gefühls und Bewußtseins; doch wieder so viele Siege des gesunden Menschenverstandes über Vorurtheile, welche sich den Nimbus so recht eigentlich bloß ersessen hatten. Wir finden eben, wie gesagt, in dieser Epoche bloß Anfänge; es war das Frühlingsäquinoktium in der Seele dieser Fürstin, mit allen seinen Stürmen, die Entwickelung mit allen Reaktionen der Ueberreste einer abgestorbenen Epoche, und wir dürfen uns durch dieselben in der Beurtheilung des Gesammtcharakters nicht irre machen lassen. Vorurteilsfrei wollen wir Gutes und Schlimmes nebeneinander betrachten, beides als naturgemäß, das Letztere als altes Laub, das Erstere als frische Keime.
Zunächst das Schlimme! Ich meine die Unduldsamkeit gegen solche Staatsangehörige, welche sich zu einer andern als zur römisch-katholischen Religion bekannten. Diese Unduldsamkeit war eine Erbschaft aus den Tagen Karls VI. und des ersten Wiener Erzbischofs, des Kardinals Kollonitsch. Wir erinnern uns des Benehmens gegen die Deputation der ungarischen Protestanten S. 134.; hinzuzufügen ist hier noch, daß der Zustand derselben ein sehr trostloser, daß die innere Verfassung der evangelischen Kirche in Ungarn durch Maßregeln der Gewalt in die äußerste Zerrüttung gekommen war. Ausschließung der Protestanten von den Aemtern, von den Magistraten, vom Bürgerrecht, Verbot der Reisen ins Ausland und des Besuchs auswärtiger Universitäten, Verbot des Drucks und der Einführung protestantischer Bücher in's Land überhaupt und in protestantischen Schulen insbesondere, ja selbst von Bekenntnißschriften wie der Heidelberger Katechismus, Verbrennen von Bibeln, Gebot: die katholischen Feiertage mitzufeiern, Auferlegung des den Glaubensansichten der Protestanten widersprechenden Eides bei der Mutter Gottes und allen Heiligen, Zwang, zu kranken Protestanten katholische Priester rufen zu lassen, Verweigerung der Erlaubniß zur Trauung zwischen Protestanten und Katholiken, harte Bestrafung des Rückfalls katholisch gewordener Protestanten zur evangelischen Lehre, dies sind einzelne Züge des unerfreulichen Bildes. Zur Proselytenmacherei im Großen, besonders solcher Protestanten, welche sich unter dem Schutze aufgeklärter Magnaten befanden, wurde der Plan einer neuen geistlichen Ritterschaft unter dem Patronat der Heiligen Joseph und Karl Borromäus entworfen. Mit größerer Schonung als die Evangelischen wurden die in Ungarn wohnenden griechischen Glaubensgenossen seit längerer Zeit bearbeitet, weil man von ihnen leichter eine Unterwerfung unter den römischen Stuhl, und eine Vereinbarung mit der römischen Kirche voraussetzen durfte; und wirklich kam eine solche zu Stande, als in demselben Jahre, in welchem der oben erwähnte Entwurf der neuen geistlichen Ritterschaft bekannt wurde, 1744, ein fremder Mönch (Kallugier, wahrscheinlich aus Rußland) inmitten der Griechen erschien und mit Feuereifer gegen die Verschmelzung mit der lateinischen Kirche wirkte. Der Kallugier erregte die größte Theilnahme und wurde fast wie ein Heiliger geehrt. Zwar mußte er bald dem Einschreiten der Macht weichen; er wurde gefangen genommen und später wahrscheinlich in aller Stille nach Rußland zurücktransportirt; aber der Impuls, den er den Griechen nun einmal gegeben, wirkte fort; vergeblich suchte der unirt-griechische Bischof von Munkatsch (1745) strenge Musterung zu halten, vergeblich drohte man den Standhaften mit dem Zorne der Königin. »Den Rock vom Leib,« erklärte kühn Einer aus ihrer Mitte im Namen Aller, »Hände und Füße, Leib und Leben wollen wir der Königin hingeben; aber wir haben nur eine Seele, und über die kann kein Mensch gebieten!« Viele entwichen über die Gränze, und die Aufregung dauerte, ungeachtet einer beschwichtigenden Verordnung Marien Theresiens vom Jahre 1746, fort, bis endlich später (1761) auch die nichtunirten griechischen Glaubensgenossen in Siebenbürgen ihren eigenen Bischof erhielten.
Die Lage der Evangelischen in Ungarn verschlimmerte sich nach dem Aachener Frieden immer mehr. Die Welt erfuhr den traurigen Zustand derselben schon 1747 durch eine Schrift Traurige Abbildung der protestantischen Gemeinden in Ungarn. (Brieg, 1747.) des Mathias Bahil, Predigers der böhmischen Gemeinde in der königlichen Freistadt Eperies, welcher einige Streitschriften gegen die römische Kirche aus dem Deutschen in's Böhmische übersetzt hatte, deßwegen als Aufwiegler und Meuterer betrachtet und eingekerkert wurde, aber glücklich aus seinem Gefängniß entronnen und nach Schlesien (Breslau) gekommen war, wo Friedrich II. das lange unausführbar geschienene Ideal vollkommener Glaubensfreiheit, wechselseitiger Achtung, wechselseitigen Friedens zwischen den Konfessionen verwirklicht, und eben so durch die That bewiesen hatte, daß der Friede zwischen Kirche und Staat nicht durch Opfer erkauft zu werden braucht, welche die Würde des Letztern beeinträchtigen. Man darf übrigens dabei nicht vergessen, daß Friedrich II. bei aller königlichen Weisheit, Milde und Gerechtigkeit, womit er verfuhr, durch das treffliche Benehmen der zwei würdigen Prälaten, des Grafen Philipp Ludwig von Sinzendorf, (1747) und des Fürsten Philipp Gotthard von Schaffgotsch, welche nacheinander dem Erzbisthum Breslau vorstanden, und welche er zu Generalvikarien für alle Angelegenheiten der Katholiken im ganzen Königreich ernannte, nicht wenig zu verdanken hatte. Uebrigens blickte Friedrich II. auch mit Theilnahme auf das Loos der armen Protestanten in Ungarn, und sah, wie diese vergeblich alles aufboten, um am Wiener Hofe Gerechtigkeit oder Linderung ihres Unglücks zu erlangen. Man hatte ihnen 1748 die Kirche zu Semering und noch 8 andre mit Gewalt genommen, ebenso 1749 die zu Raab. Am 20. May desselben Jahres berichteten sie, daß alle evangelischen Handwerker von der Kaiserin Königin sogenannte »Artikel-Briefe«, deren einer 300 Gulden kostete, lösen müßten, daß jede Zunft eine Prozessionsfahne für 400 Gulden anzuschaffen verbunden war, daß alle Meister und Gesellen den katholischen Prozessionen beizuwohnen und die wegbleibenden jedesmal einen Reichsthaler an die betreffenden katholischen Kirchen zu zahlen, daß sie jährlich viermal die Messe zu besuchen, und daß alle, welche dieß unterließen, jederzeit einen Gulden Strafgeld zu erlegen hatten; endlich wiesen sie in einem genauen Verzeichniß nach, daß man ihnen unter der Regierung Marien Theresiens bereits nicht weniger als 105 Kirchen genommen habe, ohne Angabe eines Grundes, ohne irgend ein Verschulden von Seite der Protestanten. Als sie im Juli 1749 eine Deputation nach Wien schickten, um bei der Kaiserin Vorstellungen zu machen und Abhülfe zu erbitten, erhielten die Deputirten nach langem Solicitiren zwar eine Audienz, aber keine öffentliche, und zürnend rief ihnen Maria Theresia zu: »Seyd ihr bei den fremden Abgesandten nicht gewesen, oder habt euren Rekurs nicht zu ihnen genommen? Es ist ja der Burmannia (der holländische Minister) bei mir gewesen; es hat sich wegen euch der hannöversche, ja auch sogar der preußische insinuirt.« Vergeblich betheuerten die Deputirten, daß sie weder die Gesandten, noch deren Monarchen um Fürsprache gebeten hätten; die vorgefaßte Meinung, daß der Marien Theresien so tief verhaßte König von Preußen heimlich die Hand im Spiele habe, eine Vermuthung, welche vielleicht durch die Feinde der ungarischen Protestanten in ihr geweckt oder bestärkt wurde, war hinreichend, um ihre Leidenschaftlichkeit so zu entflammen, daß sie ihre nichtkatholischen Unterthanen als ungehorsame, verrätherische, strafwürdige betrachtete. – Durch fanatischen Eifer in Verfolgung der Protestanten that sich insbesondere der Bischof von Vesprim, Martin Biro de Padan hervor, welcher nicht bloß in seinem Sprengel alles Mögliche dafür aufbot, sondern auch durch sein 1750 erschienenes » Enchiridion de fide haeresiarchis ac eorum asseclis in genere de apostatis etc.« förmlich zur Ausrottung der »Ketzer« aufforderte. Diese Schrift war so toll, daß man es von Seiten des Wiener Hofes für nöthig hielt, sie zu confisciren, weil man besorgte, daß sie eine förmliche Schilderhebung aus Nothwehr verursachen könnte. Friedrich II. hatte nämlich, nach verschiedenen Vorstellungen, die er durch seine Gesandten vergeblich zu Gunsten der ungarischen Protestanten beim Wiener Hof gemacht Er verfehlte auch nicht folgenden Punkt zu betonen: »Obgleich die in den Staaten des Königs eingeführte Toleranz die Römisch-Katholischen des Genusses der Freiheit und der ihnen bewilligten Privilegien versichere, so würden doch diese Arten der Vortheile mehr oder weniger Ausnahme leiden, nach dem Maße, als die Protestanten in Ungarn und Siebenbürgen in Ansehung ihrer Beschwerden erleichtert würden.«, am 16. Febr. 1751 den Fürst-Bischof zu Breslau ersucht, dieser möchte den römisch-katholischen Klerus in Ungarn, an welchem allein, und nicht an der Kaiserin Königin die Schuld liege, zu bedenken geben, welchen Unwillen jener Klerus durch Behauptung und Ausübung der Grundsätze des »Enchiridions« gegen ihre eigene Kirche bei der ganzen unparteiischen Welt erwecken und welcher Gefahr sich dieselbe aussetzen würde, »daferne etwa, bei Veränderung der in des Allerhöchsten Hand stehenden Zeitläuften, ein oder andere der Römischen Kirche zugethane Länder in Hände fremder Religionsverwandten, in deren Augen sothaner Kirche, nach der unstreitigen Reciprocität dieses Worts, für ketzerisch angesehen wird, gerathen, und diese sich beikommen lassen möchten, dieselben nach eben den Grundsätzen zu richten, welche man in Ungarn gegen die, so man Ketzer nennt, vor recht und billig ausgibt und behauptet.« Der Fürst-Bischof Schaffgotsch lehnte nun zwar dies Ansinnen des Königs ab, weil er mit gutem Fug besorgte, daß sein Schreiben an die katholische Geistlichkeit in Ungarn und den Bischof von Vesprim erfolglos bleiben würde, er ließ jedoch den Inhalt des königlichen Reskripts an den römischen Hof gelangen und fragte dort an, ob nicht der Papst den Bischöfen in Ungarn die Absicht des Königs zu erkennen geben und sie von allem gewaltsamen Verfahren gegen die Protestanten väterlich abmahnen wollte. Und wirklich interessirte sich der Papst für die fragliche Angelegenheit im Interesse der Katholischen in Preußen, weil er befürchtete, der König würde widrigenfalls denselben seinen bisherigen Schutz verringern oder ganz entziehen. So erhielt denn der päpstliche Nuntius in Wien Verhaltungsbefehle, um sich nach denselben mit den kaiserlich königlichen Ministern über die Art und Weise zu benehmen, wie die Gerechtsame, welche Katholiken und Protestanten in Bezug der freien Religionsübung genießen sollten, auf einen festen und beständigen Fuß gesetzt werden könnten. Und nun erfolgte die bereits erwähnte Konfiskation des ärgerlichen Enchiridions. Die Lage der ungarischen Protestanten blieb übrigens ziemlich unverändert. – Nicht viel besser erging es den Protestanten in Kärnthen, Steyermark und Oberösterreich. In Kärnthen verordnete ein Patent (dat. Klagenfurth, den 18. Oktober 1752, und von Felix Graf von Chotek unterzeichnet) geistliche Missionen »zu Ausrottung des Irrglaubens,« und nebenbei manche wahrhaft spanische Maßregeln, wie z. B. ledige Bursche, wenn sie sich über die Polizeistunde beim Tanze aufhielten, »unter die Soldaten gestoßen, oder, gleich denen leidigen Weibs-personen in das Zuchthaus gegeben,« beim Absterben eines Bauers der Wittwe (wenn sie nicht im besten Ruf der Rechtgläubigkeit stand) die unmündigen Kinder genommen und an unverdächtige Orte gebracht werden sollten u. dergl. Mittlerweile hatten sich im September 1752 die Protestanten in den drei genannten österreichischen Erblanden durch Deputirte aus ihrer Mitte mit den dringendsten Vorstellungen an den Reichstag in Regensburg gewandt und dem Corpus evangelicorum im Oktober ein Memorial übergeben, worin sie fußfälligst und mit Thränen baten: »Sich um der Liebe Jesu willen unser zu erbarmen und dahin gnädigst und hochgeneigt anzunehmen, daß mittelst nochmals erlassender vollgültiger Intercessionalien an Ihre Kayser-Königliche Maj. denen grausamen Bedruck- und Verfolgungen allergerechtester Einhalt geschehen, der evangelische Privatgottesdienst in obbesagten Landen erlaubt, oder, im Fall die allerhöchste Landeshuld uns nicht weiter bey solcher unserer Bekenntniß offen stünde, und das zwar flebile, jedoch um des Gewissens halber hierinnen tröstliche Beneficium emigrandi, cum consuetis conditionibus vergönnt werden möchte.« Hierauf erließen denn die evangelischen Reichsstände unterm 28. Februar ein Intercessionsschreiben, worin sie bewiesen, daß die Protestanten der Religion halber mit empfindlichstem Gefängniß, Leibesstrafe, Schlägen, Entsetzung von allen Gütern, Beraubung von Kindern und Gatten gequält würden, und daß dieses Verfahren wider die den im Reich anerkannten Konfessionen verstattete Toleranz, sowie gegen das Auswanderungsrecht verstoße, daß mithin den Protestanten entweder der Privatgottesdienst oder die Auswanderung erlaubt werden sollte. – Sie erlangten jedoch keines von beiden. Maria Theresia war in dieser ganzen Angelegenheit von vorneherein befangen und wurde ausschließlich von ebendenselben Männern berathen, welche die Haupttriebfedern der Protestantenverfolgung waren und in deren Interesse es daher lag, ihr die Unglücklichen als Böswillige darzustellen, sie zu überzeugen, daß deren Zustand keineswegs jammervoll bis zur Verzweiflung sei, und daß die Rückführung der Protestanten zur römisch-katholischen Kirche für die Fürstin nicht bloß Gewissenspflicht, sondern auch Sache der Politik sei, um alle Religionszwistigkeiten, durch Erstickung der verderblichen Quelle, für die Zukunft von vorneherein zu verhüten. Diese Ansichten ließen sich aufs Unzweideutigste in dem Reskript erkennen, welches Maria Theresia an den erzherzoglich österreichischen Direktorialgesandten in Regensburg, Freiherrn von Buchenberg, am 17. Septbr. 1753 erließ. Nochmals wandten sich die Protestanten unterm 19. Oktbr. 1754 mit einer ergreifenden Vorstellung an das Corpus evangelicorum, nochmals verwendete sich dieses für jene bei Marien Theresien und rechtfertigte sie gegen den Vorwurf des Frevels als Unterthanen. Der Erlaß Marien Theresiens an Buchenberg (v. 23. April 1755) zur Erklärung an das Corpus evangelicorum brach die ganze Sache in den ungnädigsten Ausdrücken ab. Sie erklärte: jeder habe es seinem Verbrechen zuzuschreiben, wenn er »patentmäßig« bestraft würde; sie wisse, was in ihrem Lande vorginge, und nähme alles auf sich; sie wollte rund heraus weder Freiheit der Religionsübung noch der Auswanderung gestatten, ja sie erklärte, daß sie auf die Vorstellung des Corpus evangelicorum gar keine Rücksicht nehmen wolle, sie bedrohte den Magistrat und jeden Einwohner von Regensburg mit scharfer Strafe, wenn diese entwichene österreichische Unterthanen aufnehmen würden; und als das Corpus evangelicorum dem Freiherrn von Buchenberg ein Promemoria übergeben und das bisherige Benehmen des Regensburger Magistrates reichsgesetzmäßig vertheidigen wollte, nahm Buchenberg dasselbe gar nicht an. So sehr konnte es dem unlauteren Fanatismus gelingen, den Geist einer vortrefflichen Frau zu verblenden und ihr wohlwollendes Gemüth zu beherrschen, – wenn gleich nicht für lange Zeit. Ich durfte diese Schattenseite in der Geschichte Marien Theresiens um so weniger verhüllen, als ich, in der Absicht, ein treues Bild ihres Charakters und der interessanten Entwickelung desselben zu geben, die Lichtseiten gezeigt habe und auch sogleich darauf hinweisen werde, wie sie selbst auch auf diesem Gebiete rasch zu hellerer Erkenntniß sich emporrang; daß sie (1755) vielen aus Frankreich nach Belgien geflüchteten Geistlichen, welche die Glaubensstreitigkeiten aus ersterem Lande vertrieben hatten, in Letzterem ein Asyl gönnte, unter der Bedingung: sich jeder Controverse über die Bulle »Unigenitus« zu enthalten, kommt wohl zunächst auf Rechnung ihrer Politik.
Uebrigens gab sich bereits inmitten des katholischen Klerus selbst die Erkenntniß der Nothwendigkeit von Reformen und von einer minder schroffen, minder feindseligen Stellung gegen die Protestanten kund. Höchst interessant ist in dieser Hinsicht der Hirtenbrief des neuen Erzbischofs von Wien, des Fürsten Johann Joseph von Trauthson an die Prediger seiner Diöcese (v. J. 1750); scharf waren darin die in der katholischen Kirche überhand genommenen Mißbräuche durchschaut und gerügt, welche von ungebildeten Priestern zum Nachtheil der Kirche selbst gepfleget wurden; mit ernstem Nachdrucke widersetzte sich der würdige Prälat der Profanirung der Kanzel durch jenen burlesken Ton, welchen weiland der witzige Abraham a Santa Clara angestimmt hatte, und ebenso gebot er, daß Niemand zum geistlichen Amte gelangen sollte, der die heilige Schrift nicht in der Ursprache verstünde. Alle aufrichtigen Freunde der katholischen Kirche mußten dem Streben Trauthson's nach höherer Bildung des Klerus ihren Beifall zollen; ebenso konnte es aber auch nicht ausbleiben, daß es auf Seite der Ermahnten und Zurechtgewiesenen einen erbitterten Widerstand fand. In Bezug auf das Verhältniß zu den Protestanten ehren Trauthson's Andenken folgende zwei Verordnungen. Die eine, daß die zum römischen Katholicismus übergegangenen Protestanten die Erlaubniß erhielten, die Bibel zu lesen, und die zweite, daß sie nicht gezwungen wurden, die Anrufung der Heiligen als Glaubenssatz anzunehmen und als solchen zu beschwören.
Eine ähnliche Kundgebung von vorhandener innerster Nothwendigkeit des Klarer- und Besserwerdens wie der Hirtenbrief Trauthson's war der des Bischofs von Gurk, des Grafen Joseph Maria von Thun; er theilte das Schicksal des Trauthson'schen. Das Volk selbst war, in der Mehrzahl, in Folge allzulanger Mißleitung und Angewöhnung, noch nicht fähig, in Sachen der Religion und des Kultus, Ursprüngliches und Wesentliches von Zugethanem, Unwesentlichem, Aechtes von Falschem zu sondern; jedes leise Antasten alter Bräuche und Ordnungen schien ihm Frevel, und leider wurde es in diesem unseligen Wahne durch diejenigen bestärkt, welche befürchteten, daß sie bei vernunftgemäßen und dem wahren Interesse der katholischen Kirche entsprechenden Reformen ihren Einfluß als Mittelmacht zwischen Familie, Staat und Kirche einbüßen möchten. Unter solchen Umständen war selbst eine Collision mit der Monarchin unvermeidlich, als diese, von der Nothwendigkeit: die Rechte der Krone von jenen der Kirche zu sondern, sich immermehr überzeugend, allmählig eine Richtung einschlug, in welcher sie, durch den scharfblickenden Kaunitz fort und fort gestützt, vorwärts schritt. Trauthson stand ihr hierbei thätig zur Seite, und wenn seine Reform-Bemühungen die Mißgunst der Jesuiten und des Volkes erregten, so hatte er dafür die Genugthuung, daß er auf die Verwendung seiner Monarchin (1756) die Kardinalswürde erhielt. Nicht minder thätig wirkte im Interesse des kaiserlichen Hofes beim römischen Stuhle der Bischof von Würzburg und Bamberg, Friedrich Karl von Schönborn.
So sehen wir denn – schon gleichzeitig mit jenen früher berührten beklagenswerthen Maßregeln gegen die Protestanten – eine Reihe von anderen im monarchischen Interesse, welche den Muth der streng katholischen Fürstin bekunden, die persönlich eine unverbrüchliche Devotion für die Geistlichkeit bewahrte und Kirchen, Klöster und Gnadenbilder reichlich beschenkte, aber dabei die Rechte der Krone dem römischen Stuhl gegenüber behauptete, und damit zugleich die Unabhängigkeit des Staates, die Freiheit der Justiz, die Sicherheit, die Bildung, die Thätigkeit der Staatsbürger, das Vermögen der Familien bewahrte.
Schon im Jahre 1746 erregte es nicht geringes Aufsehen, als sie am 11. Oktober dem Bischof von Olmütz, Ferdinand Julius Grafen von Troyer als Königin von Böhmen, kraft landesherrlichen Oberhoheitsrechts, in eigener Person die Lehen reichte; kein König von Böhmen und Markgraf von Mähren hatte dies vor ihr gethan! Als Königin von Ungarn erneuerte sie, mit Zustimmung des Papstes (1758), den alten Titel: apostolische Majestät, dessen Ursprung bis zu Stephan dem Heiligen hinaufreichte, und dessen Bedeutung sie geltend machte. Demgemäß behauptete sie die Rechte der heiligen Krone in Bezug auf Errichtung neuer und Vereinigung oder Aufhebung alter Bisthümer, die Patronatsrechte bei Vergebung der geistlichen Hochwürden. So errichtete sie die neuen Bisthümer Neusohl, Rosenau, Zips, Stein am Anger und Stuhlweissenburg. Kollar's treffliche Abhandlungen (von 1762 und 1764) über das Patronatsrecht und die gesetzgebende Gewalt der Könige von Ungarn entschieden vollends allen Zweifel.
Ein wichtiger Schritt für die öffentliche Sicherheit, für die Unabhängigkeit der Justiz, für die Feststellung des Grundsatzes, daß das Gesetz das Höchste und Heiligste im Staate, geschah durch die konsequente Befolgung der schon unter Leopold I. und Karl VI. eingeleiteten Maßregeln zur Beschränkung der kirchlichen Asylrechte, denen zufolge der Verbrecher unantastbar war, sowie er in den Bann einer Kirche oder eines Klosters eingetreten, – eine Einrichtung, welche ihrer Zeit der Bedeutung der Hierarchie als Schutzmacht gegen die weltliche bloße Gewalt entsprochen hatte, welche aber ihre Bedeutung verloren, als sie selbst die Offensive ergriffen hatte, als sie Parthei geworden war, – eine Einrichtung, welche dem Begriffe eines Rechtsstaates, sowie dieser sich als solcher feststellte, widersprechen, ihn beeinträchtigen, und daher durch ihn aufgehoben werden mußte. Völlig aufgehoben wurden die Asylrechte der Kirchen und Klöster in den österreichischen Staaten freilich erst später, (16. September 1775.)
Das Verhältniß der ausschließlichen Abhängigkeit der Klöster vom römischen Stuhle erlitt im Jahre 1747 den ersten Stoß; in diesem Jahre gab nämlich ein Vorfall im Jakoberkloster zu Wien die Veranlassung, daß Maria Theresia die bisher üblichen Visitationen der päpstlichen Nuntien verbot, welche nicht bloß sehr kostspielig waren, sondern auch die landesherrlichen Gerechtsame beschränkten.
Der nächste und wichtigste Schritt weiter zur Sicherstellung der Staatsunabhängigkeit von dem römischen Stuhle (zunächst freilich wieder zur Befestigung der unumschränkten monarchischen Machtvollkommenheit, aber in Folge derselben auch zu jener der Nationalunabhängigkeit) geschah 1749, in welchem Jahre Maria Theresia die Kundmachung päpstlicher Bullen ohne vorhergegangene landesherrliche Bewilligung ( placetum regium) verbot, – eine Grundlage, ohne welche kein gesicherter Rechtszustand zwischen Regierten und Regierenden denkbar ist, wie wir denn aus der Geschichte des Mittelalters leider zahlreiche Beweise für das Gegentheil haben, Lehren genug, welche mit allen ihren Konsequenzen für die Gegenwart nicht verloren sein sollten, wenn man nur nicht so leichtsinnig oder allzuselbstvertrauend wäre, sie für überflüssig zu halten.
Ein Schritt zu dem Ziele der Verschmelzung aller Sonderinteressen im Staate war die Aufhebung der Befreiung von der Theilnahme an den Staatslasten, welche die Geistlichkeit genoß; wohl hatte man auch bisher schon in außerordentlichen Fällen zu dem Mittel der Besteuerung der Geistlichkeit gegriffen, aber nie, ohne hiezu vorher die Erlaubniß des römischen Stuhles eingeholt zu haben. Im Jahre 1752 geschah dies zum letzten Male und fortan hörte man hiemit auf, in einer Angelegenheit, welche die Gesundheit des staatlichen Organismus betraf, eine außerhalb des Staates stehende Macht, deren Autorität eine rein geistige in Beziehung auf Personen sein sollte, als über dem Staate bestehend zu betrachten.
Eine andere folgenreiche Reform, welche Maria Theresia, im Interesse des Volkes, aber nicht ohne hartnäckigen Widerstand desselben, 1754 (21. Januar) begann und 1771 vollendete, war die Verminderung der zahlreichen Feiertage, durch deren Begehung Gewerbfleiß, Ackerbau und Handel, und demgemäß der Wohlstand der erwerbenden Klassen beeinträchtigt, Müssiggang, Trägheit und Schwelgerei dagegen so sehr gefördert worden waren. Mit Recht konnte Maria Theresia eine solche Begehung der Feiertage einen Mißbrauch nennen und in ihrer Verordnung darauf hinweisen, daß durch Verminderung derselben ächte Religiosität nur gefördert werden würde, zumal, da sie bei der Verwandlung der Müssiggangstage in Arbeitstage die Pflicht auferlegte, an den aufgehobenen Feiertagen die Messe zu hören, und mit Recht konnte sie ihre weise Verfügung als eine für das Volk wohlthätige bezeichnen; vermochte das Volk damals auch nicht den ganzen Umfang der daraus entspringenden Folgen abzusehen, so hätte es die schöne Absicht der Monarchin doch schon darin erkennen sollen, daß dieselbe alle auf die abgeschafften Feiertage fallenden Frohndienste aufhob. Dennoch murrte das Volk, und deutlich zeigte sich, daß sich hinter der Bigotterie eigentlich bloß krasse Genußsucht verbarg. Wäre es ein religiöses Vorurtheil gewesen, so hätte wohl zu dessen Zerstörung der Hinblick auf das Oberhaupt der katholischen Kirche, auf Papst Benedikt XIV. hingereicht, welcher die Verminderung der Feiertage nicht bloß in Marien Theresiens Erbstaaten, sondern auch in Spanien und Neapel, also in zwei gewiß strengkatholischen Reichen, gestattete.
Wir werden in der Folge sehen, wie sich aus diesen Anfängen von Reformen kirchlicher Zustände die tiefst eingreifenden Gestaltungen entwickelten, auf welchen Marien Theresiens edler Sohn Joseph rasch fortbauen zu müssen glaubte. Obwohl die Ausführung jener Reformen kirchlicher Zustände in eine Epoche fällt, welche erst im nächsten Buche geschildert werden soll, in die Zeit des siebenjährigen Krieges und in die unmittelbar nach demselben, so muß doch schon hier noch eine erwähnt werden, welche gleichsam eine Brücke bildet zu der unmittelbar folgenden Betrachtung von Marien Theresiens Obsorge für die Geistesmündigung ihrer Völker. Ich meine ihre Verordnung vom Jahr 1758 in Betreff des Mißbrauchs der Exorcismen, und die allmälige Abschaffung der Hexenprozesse, – dieser Geißel Deutschlands, dieses Hohns gegen den Christusglauben und den gesunden Menschenverstand, dieses unauslöschlichen Schandflecks in der Geschichte der deutschen Justiz.
Noch Marien Theresiens Oheim, Kaiser Joseph I., hatte in seiner (16. Juli 1707 publicirten) »neuen peinlichen Halsgerichtsordnung vor das Königreich Böheim, Marggrafthumb Mähren und Herzogthumb Schlesien« die Zauberei als eine »mit ausdrücklich oder heimlich bedungener Hülff des Teufels begangene Unthat« definirt und festgestellt: »Auf wahrhafte Zauberei, sie geschehe mit ausdrücklich- oder verstandener Verbündnus gegen den bösen Feind, dardurch denen Leuten, Viehe oder Früchten der Erde Schaden zugefüget wird, oder auf diejenige, welche neben Verläugnung des christlichen Glaubens sich dem bösen Feind ergeben, mit demselben umgangen, oder sich unzüchtig vermischet, wann sie auch sonsten durch Zauberei niemand Schaden zugefüget hätten, gehört die Straff des Feuers, obschon solche, aus erheblichen Ursachen, und wann Inquisitus oder Inquisita dazu gekommen, jung an Jahren, einfältig, in der Wahrheit bußfertig oder der Schaden nicht so groß, mit vorhergehender Enthauptung gelindert, und nur der Cörper verbrennet werden kann;« »Wahrsager, aberglaubische Seegen-Sprecher und Bockreiter, welche, ohne ausdrückliche Verbündnus mit dem bösen Feind dieses verüben, sollten zum Tod durchs Schwert verurtheilt, oder mit körperlicher Züchtigung, Landesverweisung, mehrjähriger öffentlicher Zwangsarbeit bestraft werden.« Eine Milderung war indessen schon bei jenem Josephinischen Gesetz darin zu erkennen, daß »auf die Aussagung der Complicum allein nicht alsogleich weder die Tortur vorzunehmen, weder zur Strafe zu schreiten« sei. Man erinnere sich, wie viele Schlachtopfer früherhin gerade dadurch zum Scheiterhaufen geliefert worden waren!
Maria Theresia hatte nun (wie sie selbst 1766 erklärte) gleich bei Anfang ihrer Regierung, auf die Bemerkung hin, »daß bei diesem sogenannten Zauber- und Hexenprozesse aus ungegründeten Vorurtheilen viel Unordentliches sich einmenge«, in den Erblanden allgemein verordnet, daß solche vorkommende Prozesse vor Kundmachung eines Urtheils zu ihrer Einsicht und Entschließung eingeschickt werden sollten; »welche Unsere höchste Verordnung« (so hieß es weiter in der Landesordnung über den Hexenprozeß von 1766) »die heilsame Wirkung hervorgebracht, daß derlei Inquisitionen mit sorgfältigster Behutsamkeit abgeführet und in Unserer Regierung bisher kein wahrer Zauberer, Hexenmeister oder Hexe entdecket worden, sondern derlei Prozesse allemal auf eine boshafte Betrügerei, oder eine Dummheit und Wahnwitzigkeit des Inquisiten oder auf ein anderes Laster hinausgeloffen seyen, und sich mit empfindlicher Bestrafung des Betrügers oder sonstigen Uebelthäters, oder mit Einsperrung des Wahnwitzigen geendet haben.«
Mittlerweile nahm auch die Presse neuerdings den hochwichtigen Gegenstand wieder auf; ein merkwürdiger Hexenprozeß in Würzburg vom Jahre 1749, in welchem die Nonne Maria Renata im Kloster Unterzell als Hexe verurtheilt und (am 21. Januar 1749) als solche hingerichtet wurde, gab die Veranlassung zu mehreren Streitschriften. Einen Auszug aus den Akten verfaßte und sandte der Abt Oswald Loschert an Maria Theresia, welche jedoch dadurch in ihrer helleren Weltanschauung nicht beirrt worden zu sein scheint. Die nächste bedeutende Schrift gegen Hexenglauben und Hexenprozesse, welche dadurch hervorgerufen wurde, gab der gelehrte, aber mit großer Vorsicht leise auftretende Hieronymus Tartarolli in Roveredo 1750 heraus. (» Del congresso notturno delle lammie libri trè.«) Er unterschied noch zwischen Hexerei und jener Zauberkunst, die sich auf wirklichen Teufelsbund gründe, und deren Vorhandensein abzuläugnen er sich wohl hütete. Scipio Maffei dagegen wies 1750 und 1754 nach, daß die eine so gut wie die andere »ein großes, weltbetrügendes Nichts« sei. (» Arte magica dileguata« und » arte magica annichilata.«) In demselben Jahre, in welchem das letztgenannte Buch erschien, wurde in Bayern ein Mädchen von 13 Jahren, 1756 eines von 14 Jahren als Hexe enthauptet! An der Spitze der Männer, welche in Oesterreich gegen das unselige Hexenwesen wirkten, stand Marien Theresiens Leibarzt, der große Gerhard van Swieten, welcher von dem Werke » de cultibus magicis« eine neue Auflage veranstalten ließ.
Die schon damals helleren Ansichten Marien Theresiens über den fraglichen Gegenstand ersieht man am besten aus der bereits angeführten »Landesordnung, wie es mit dem Hexenprozesse zu halten sei«, vom Jahre 1766. (Sie bildete den 58. Artikel der Constitutio criminalis Theresiana.) Da heißt es: wie sie unbeschadet ihres Eifers, die Ehre Gottes aufrecht zu erhalten, und alles, was zu deren Abbruch gereicht, auszurotten, doch keineswegs gestatten könne, »daß die Anschuldigung dieses Lasters (zauberischer Handlungen) aus eitlem alten Wahne, bloßer Besagung und leeren Argwöhnigkeiten wider Unsere Unterthanen was Peinliches vorgenommen werde; sondern Wir wollen, daß gegen Personen, die der Zauberei oder Hexerei verdächtig werden, allemal aus rechtserheblichen Inzichten und überhaupt mit Gründen und rechtlichem Beweise verfahren werden solle, und hierinfalls hauptsächlich auf folgenden Unterscheid das Augenmerk zu halten sey: ob die der bezichtigten Person zur Last gehenden den Anschein einer Zauberei oder Hexerei und dergleichen auf sich habenden Anmaßungen, Handlungen und Unternehmungen entweder 1) aus einer falschen Verstell- und Erdichtung und Betruge, oder 2) aus einer Melancholey, Verwirrung der Sinnen oder Wahnwitz, oder aus einer besonderen Krankheit herrühren, oder 3) ob eine Gottes und ihres Seelenheiles vergessene Person solcher Sachen, die auf eine Bündniß mit dem Teufel abzielen, sich zwar ihres Ortes ernsthaft, jedoch ohne Erfolg und Wirkung unterzogen habe, oder ob endlichen 4) untrügliche Kennzeichen eines wahren, zauberischen, von teuflischer Zuthuung herkommen sollenden Unwesens vorhanden zu seyn erachtet werden.« Worunter verstanden war, »daß eine erwiesene Unthat, welche nach dem Laufe der Natur von einem Menschen für sich selbst nicht hat bewerkstelligt werden können, mit bedungener Zuthuung und Beistand des Satans aus Verhängniß Gottes geschehen sei.« Man sieht: wie sehr auch Maria Theresia das Richtige ahnte, so haftete in ihr doch noch zu viel von den Eindrücken einer in Bezug auf religiöse Vorstellungen mangelhaften Erziehung, und glaubte sie nach der einen wie nach der anderen Seite hin mit nicht genug Vorsicht und Behutsamkeit beginnen zu dürfen. Mochte bei dem Hexenglauben auch Betrug, Hysterie, Geistesverwirrung mitunter Schuld tragen, die größte und furchtbarste Schuld trugen die Hexenrichter, und, wenn weder Tortur noch Furcht vor derselben mehr Geständnisse erzwingen konnte, welche der Richter den Inquisiten in den Mund legte, dann erst mußte der Hexenglauben aufhören.
Von diesem Gesichtspunkte aus ist es sehr beachtungswerth, daß Maria Theresia den Richtern die Aufsuchung des Hexenmals, die Anwendung aller Nadel-, Wasser- und anderen Hexenproben verboten, und auch die Vornahme der Tortur wenigstens an bestimmte Regeln band. Wie richtig ihr Takt war, das sogenannte Verbrechen der Hexerei dem Bereich richterlicher Willkür zu entziehen, ergibt sich auch aus der Unterscheidung der Strafbestimmungen, wobei sie streng auf Betrug mit oder ohne erschwerende Umstände, und andere bürgerliche Verbrechen, indem sie ferner auf Blasphemie die ganze Strenge des Gesetzes angewendet wissen wollte, – jedoch bei der sogenannten »wahren Zauberei«, als einem außerordentlichen Ereignisse, sich selbst die Strafart ausdrücklich vorbehielt, mit der Bestimmung, daß ihr der ganze Prozeß eingereicht werden sollte.
Im §. 16. verordnete sie: »daß, wenn sich irgendswo eine angebliche Besitzung vom Teufel, eine Gespensterey, Geisterey, und dergleichen hervorthun würde, solcher Vorfall ganz unverlängt bey Unseren Obergerichten angezeiget, von den Obergerichten aber gestalten Umständen nach entweder durch eigens abordnende Rathsglieder, oder auf ihre Verordnung durch die unterhabende Halsgerichten zuförderst auf die Verhältniß der Sach: ob, und was für ein Betrug darunter verborgen, und was eigentlich an der Sache seyn möge? sofort auch auf den Zustand der verdächtigen Person: ob solche nicht etwann mit einer Sinnveruckung behaftet seye? mit Beyziehung erfahrner Physicorum auf das genaueste nachgeforschet, und mittelst ordentlich verführender Inquisition alles gründlich untersuchet werden solle. Wo sodann, wenn der Betrug herauskommet, der Betrüger gestalten Sachen nach mit einer gemessenen Leibsstraffe zu belegen; falls aber das Vorgeben und Unternehmen aus phantastischer Einbildung, und Narrheit beschehen wäre, der Irrsinige in ein Narren- oder Krankenhaus zu überbringen; jenenfalls hingegen, wenn von den nachgesetzten Gerichten das Angeben eines vorhandenen Gespensts, eines umgehenden Geistes, oder einer Besessenheit vom Teufel für wahr, oder für zweifelhaft gehalten würde, nach der hieroben §. 7 und §. 12 vers. 4. gemachten Anordnung Uns solche Vorfallenheit allemal zu Unser-eigenen höchsten Schlußfassung einzuberichten seyn wird.«
Man sieht, das waren bereits mehr als bloße Anfänge; es waren schon energische Griffe mitten in die Sache, wobei sich die vollkommene Durchführung bis zum Ende als unausbleiblich im Hintergrunde zeigte.
Ich habe in diesem Abschnitte den Namen Gerhards van Swieten erwähnt, eines Mannes, welcher sich um die Förderung des geistigen Lebens in Oesterreich unsterbliche Verdienste erwarb, als diejenige Natur, welche vorerst die alten Schranken niederriß, welche den Boden urbar machte, der so lang brach gelegen. Daß Maria Theresia diesen Mann zu sich berief, daß sie ihm ihr volles Vertrauen schenkte, ist ein Beweis ihrer richtigen Einsicht und ihrer redlichen Absicht: für das wahre Beste ihrer Völker zu herrschen.
So möge denn ein kurzer Abriß von Gerhard van Swietens Leben und Wirksamkeit hier seine Stelle finden.
geboren zu Leyden am 7. Mai 1700, der Sohn Thomas van Swieten's und Elisabeth's de Loo, gehörte einer der ausgezeichnetsten Familien Hollands an, und zwar der katholischen Linie derselben. In einem Alter von 12 Jahren begann Gerhard van Swieten seine Studien auf der Universität Leyden, deren Stiftung (1575, 4. Januar) für ewige Zeiten das Andenken der glorreichen Vertheidigung Leydens gegen die spanischen Zwingherrn (vom 26. Mai bis zum 3. Oktober 1754) erhalten sollte. In den ersten Jahren seiner Studien zu Leyden verlor der junge van Swieten seine Aeltern, worauf ihn seine Vormünder nach Löwen sandten, wo er sich der Philosophie und späterhin den Rechtswissenschaften widmen sollte, gegen welche er jedoch eine so entschiedene Abneigung fühlte, daß er sich in einem Alter von 16 Jahren nach Leyden zurückbegab, um dort – gegen alle Vorstellungen seiner ganzen Familie – Medizin und Physik zu studiren. Ein großes Muster stand in Leyden vor den Augen des Jünglings, Boerhaave, Professor der Medizin, der Botanik und der Chemie, Verfasser der unsterblichen » institutiones medicae« und der » aphorismi de cognoscendis et curandis morbis.« Van Swieten fand in diesem ausgezeichneten Manne nicht bloß einen Lehrer, der ihn vor den zahlreichen übrigen Schülern auszeichnete, sondern auch seinen Lebensretter; denn als übermäßiger Fleiß, wobei er Essen, Trinken, Schlaf und jede Erholung hintansetzte, seinen Körper entkräftet hatte, als ihn eine tiefe Melancholie überfiel, zu welcher sich Schlaflosigkeit und Abmagerung gesellten, zog ihn Boerhaave mit liebevoller Sorgfalt vom Rande des Abgrundes zurück, untersagte ihm das Uebermaß des Arbeitens, verordnete ihm Fecht- und Musikübungen sowie erheiternde Lektüre vor dem Schlafengehen, und so gelang es ihm, in kurzer Zeit die Gesundheit des Jünglings vollkommen wieder herzustellen, der, selbst als er den Doktorgrad (1725) erlangt hatte, die Vorlesungen des großen Meisters zu besuchen nicht aufhörte, und ihm, wie ihn dieser seiner Freundschaft würdigte, die lebhafteste Dankbarkeit unauslöschlich bewahrte.
Van Swieten praktizirte eine Zeit lang in Leyden und eröffnete dann Vorlesungen über Medizin an der dortigen Universität mit dem glänzendsten Erfolge. Der Hörsaal vermochte kaum die Menge der Lernbegierigen zu fassen, welche aus dem Ausland, besonders aus England, herbeikamen, um Boerhaave's Schüler, Freund und geistes-ebenbürtigen Nachfolger zu hören. Dieser glänzende Erfolg aber, welchen van Swieten seiner gediegenen Gelehrsamkeit verdankte, ermangelte nicht, ihm auch Mißgunst zu erwerben, und van Swieten war nicht der Mann dazu, seine Gegner durch Nachgiebigkeit von seiner Seite milder zu stimmen. Der Umstand, daß er Katholik war, mußte zum Vorwande dienen, unter welchem man ihm die Fortsetzung seiner Vorlesungen untersagte. Die Universität empfand indeß bald, daß die Folgen dieser Maßregel für sie selbst unangenehmer waren, als für van Swieten, indem die zahlreichen Ausländer, welche van Swieten's Ruf nach Leyden gelockt hatte, nun nach seinem Abgange vom Lehrstuhle die Universität verließen. Van Swieten erhielt hierauf einen sehr ehrenvollen Ruf nach London, unter der Garantie einer jährlichen Einnahme von 1000 Pfund Sterling und mit der Versicherung, daß er dortselbst in Bezug auf seinen Glauben nicht die mindeste Anfechtung zu besorgen haben würde. Er schlug jedoch diesen Antrag aus und beschäftigte sich in der stillen Abgeschiedenheit seines Studirzimmers mit der Ausarbeitung seines klassischen Werkes, » commentarii in Boerhaavii aphorismos de cognoscendis et curandis morbis«, welches anfänglich lebhaften Widerspruch, selbst durch den berühmten Albrecht von Haller, einen von Boerhaave's ausgezeichnetesten Schülern, erweckte, aber auch den Ruf des Verfassers noch weiter ausbreitete und dauernd befestigte Die beiden ersten Bände erschienen 1747 und 1754..
Inzwischen war auch Maria Theresia auf den bedeutenden Mann aufmerksam geworden und wünschte ihn für ihre Staaten zu gewinnen; sie wußte wohl, daß sie einer energischen Geisteskraft und eines durchaus redlichen Charakters bedurfte, um dortselbst eine neue Organisation der Anstalten für Pflege von Wissenschaften und Künsten zu Stande zu bringen. Für diese Aufgabe nun war Gerhard van Swieten, mit seinem scharfen Geist und seinem gründlichen wissenschaftlichen Ernst, mit seinem unerschütterlichen Pflichtgefühl, mit seiner unermüdlichen Thätigkeit und mit seinen ausgebreiteten Verbindungen ganz der rechte Mann, und überdieß konnte ihm seine treue Anhänglichkeit an den Katholicismus, eine Anhänglichkeit, welcher er seine Professur zum Opfer gebracht hatte, bei Marien Theresien nur umsomehr zur Empfehlung dienen. Er scheute jedoch, an ein einfaches stilles Leben gewöhnt, das Geräusch des Hofes, und gab, auf die ersten Anträge, diese Scheu als Motiv seiner ablehnenden Antwort an. Maria Theresia wiederholte ihre Anträge und schrieb endlich persönlich an ihn, indem sie ihn über seine Furcht, daß die Stellung zum Hofe seine wissenschaftliche Thätigkeit, seine Selbstständigkeit beeinträchtigen könnte, vollkommen beruhigte. Zum Beweise ihres besonderen Vertrauens beauftragte sie ihn sodann, sich nach Brüssel zu begeben, um dort ihre Schwester, die Erzherzogin Maria Anna ärztlich zu behandeln. Van Swieten stellte die Gesundheit dieser Fürstin wieder her und entschloß sich nun, Marien Theresiens Anerbieten anzunehmen. Rasch ordnete er seine Angelegenheiten in Holland, und im Jahre 1745 reiste er nach Wien ab, wo er am 7. Juni mit seiner ganzen Familie ankam; (er hatte sich 1729 mit Maria Lambertina Theresia Ter Beek von Coesfeld vermählt und in glücklicher Ehe mit derselben zwei Söhne und zwei Töchter erlangt.)
Maria Theresia war in hohem Grade erfreut, van Swieten zu sehen und in ihren Diensten zu wissen; zu wiederholten Malen äußerte sie sich mündlich und schriftlich: »sie betrachte den Augenblick, in welchem sie ihn für sich und ihre Staaten gewonnen habe, als einen der glücklichsten und ehrenvollsten Abschnittspunkte ihrer Regierung.« Wie groß ihr Vertrauen auf ihn war, und was alles sie von ihm erwartete, bewies sie dadurch, daß sie ihn zu ihrem Leibarzt, zum Vorstand des Medicinal- und Studienwesens in ihren sämmtlichen Staaten und zu dem der kaiserlichen Bibliothek ernannte, endlich daß sie ihn durch ihren kaiserlichen Gemahl in den Reichsfreiherrnstand erheben ließ.
Van Swieten fand das Studien- und Medicinalwesen in Oesterreich in einem nichts weniger als erfreulichen Zustand und eröffnete seine Wirksamkeit dortselbst zunächst damit, daß er schon 1751 das ganze Studienwesen nach einem neuen, den Fortschritten der Wissenschaften angemessenen Plane zu reorganisiren begann, wobei als oberstes Prinzip Freiheit des Denkens und Lehrens aufgestellt wurde; allerdings nicht ohne heftigen Kampf, welchen veraltete Grundsätze und veraltete Lehrart entgegenstellten. Er selbst hielt bis zum Jahre 1753, als er taugliche Stellvertreter gewonnen hatte, öffentliche Vorlesungen über Medizin an der Wiener Universität, welche zahlreiche Hörer von nah und fern herbeilockten und den Ruf der Anstalt in kurzer Zeit bedeutend hoben und feststellten. Zu den wichtigsten Neuerungen, welche er in Bezug auf das Studium seiner nächsten Berufswissenschaft einführte, gehörten die Errichtung eines Lehrstuhls für Entbindungskunde, die Ernennung eines besonderen Professors, welcher die Studirenden der Arzneikunde täglich an Krankenbetten praktisch einübte, die besondere Sorgfalt für die bisher sogut wie ganz vernachlässigten Studien und Hülfsmittel der Anatomie, der Chemie und der Botanik; vor ihm bestand weder ein anatomisches Theater, noch ein öffentliches chemisches Laboratorium, noch ein botanischer Garten. Ihm verdankte das Medicinalwesen ferner die Anordnung einer unangesagten und strengen jährlichen Visitation der Apotheken, die Herabsetzung der ungebührlichen Kosten für Doktorpromotionen, worunter Talent und Verdienst bisher gelitten hatten (an der Universität Löwen wurden die allzuhohen Ausgaben bei jenem Anlaß 1755 beschränkt). Für die bürgerliche Existenz des Standes der Aerzte wurde durch Errichtung einer Medicinal-Wittwenkasse gesorgt, welche auf van Swietens Betrieb unter Marien Theresiens Auspicien zu Stande kam.
Nicht minder groß und dankenswerth waren van Swietens Verdienste um die kaiserliche Bibliothek. Er fand sie in einem traurigen Zustande, die köstlichsten Handschriften in Folge von Nachlässigkeit theils schon zerstört, theils dem Untergange nahe, die Kupferstichsammlung unvollständig, das ganze Institut in Bezug auf seine eigentliche Bedeutung ungenügend, da die Benützung bloß während des Sommers freistand, und selbst dann fand man daselbst weder Federn noch Tinte, um Auszüge machen zu können. Unter van Swieten wurde das Alles anders, nicht bloß wurde die Bibliothek nach einem verständigen Plane ergänzt, wurden ihre Schätze gegen alle Unbill gesichert; – sie stand dem Gelehrten nunmehr das ganze Jahr hindurch offen, und zwei mit allen Bequemlichkeiten wohlversehene Säle luden fortan zur Benützung derselben ein.
Bei aller vielverzweigten Thätigkeit für die Bibliothek, für das Studien- und Medicinalwesen fand van Swieten noch immer hinreichend Zeit für eine Thätigkeit, welche theils durch andere Seiten seines Berufes, theils durch ein ihm innewohnendes Bedürfniß bedingt wurde, so als Leibarzt des kaiserlichen Paares und der kaiserlichen Familie, so ferner als Arzt bei zahlreichen Consultationen, so als Präsident der Büchercensur, als Schriftsteller durch Fortsetzung seiner klassischen Commentarien zu Boerhaave's Aphorismen, durch wissenschaftliche Correspondenz. Mit welchem unermüdlichen Eifer er den Fortschritten der medizinischen und mathematischen Wissenschaften in allen ihm zugänglichen Sprachen folgte (er verstand Latein, Griechisch, Französisch, Deutsch, Italiänisch, Spanisch, Englisch und etwas Ungarisch) beweist wohl der Umstand hinlänglich, daß man nach seinem Tode dreißig Foliobände von Auszügen fand, die er bei seiner Lektüre gefertigt! Der Umfang einer solchen Thätigkeit ist nur begreiflich, wenn man seine weise Zeiteintheilung (das Geheimniß aller ächten Thätigkeit) in Anschlag bringt, wodurch es ihm möglich war, in der Regel mindestens zwölf Stunden täglich zu arbeiten, wenn man ermißt, daß seine Erholung nur im Nachdenken über die Gegenstände seiner Thätigkeit bestand, und wenn man sein bis in die letzten Lebensjahre ungeschwächtes vortreffliches Gedächtniß bedenkt.
Van Swietens Charakter war rein und untadelhaft. Was er that, geschah stets aus den lautersten Grundsätzen und Überzeugungen; und selbst wenn er als Censor die Werke der französischen Philosophen in Oesterreich verbot, war weder Bigotterie noch persönlicher Groll dabei im Spiele, obgleich seine Gewissenhaftigkeit ein reiches Maß von Spott durch jene Autoren über sich ergehen lassen mußte. Redlich suchte er den großen Einfluß, welchen er bei Marien Theresien besaß, zum Besten der Wissenschaften und der Aufklärung, sein Vermögen zum Besten der Armen zu verwenden; in 10 Jahren hatte er, wie man nach seinem Tode aus seinen Papieren ersah, über 30,000 Thaler an die General-Armenkasse gegeben; zahlreiche talentvolle aber arme Studirende der Medizin unterstützte er außerdem aus seinen Mitteln, Dürftigen, welche seinen ärztlichen Rath in Anspruch nahmen, gab er Geld für Arzenei und für Lebensbedürfnisse, Aerzten auf dem Lande oft 30, 50, bis 100 Ducaten zur Unterstützung von armen Kranken. Seinen Freunden ein treuer Freund, und allenthalben ein erprobter Menschenfreund, konnte er gleichwohl mancher falschen Beurtheilung nicht entgehen, weil er im Dienst unbeugsam streng war und mit einem Ernst, der bis zur rauhen Härte stieg, auf genaueste, haarscharfe Pflichterfüllung drang, wie er selbst ja gewohnt war, darin sein höchstes Ziel zu sehen. Kann man endlich seinen Charakter in einem Schlußstriche mit einem edleren Lobe bezeichnen, als daß er nichts mehr haßte und verabscheute als die Lüge? Wahrlich: ein solcher Mann war würdig, Marien Theresiens Vertrauen unumschränkt zu genießen, ein solcher Charakter rechtfertigte dasselbe unbedingt. Nach seinem Tode nahm seinen Platz in der Akademie zu Paris, deren Mitglied er war, kein Anderer ein, als der edle Franklin. Van Swieten starb am 18. Juni 1772, nachdem ihn einige Tage vorher noch die Kaiserin besucht hatte, 72 Jahre alt.
Nach der vorangegangenen Schilderung des Mannes, von welchem die erste Studienreform in Oesterreich ausgegangen und durchgeführt worden war (die zweite v. Jahr 1772 werden wir später betrachten), und bei einem Rückblick auf die bereits am geeigneten Orte erwähnten neuerrichteten Bildungsanstalten (wie die Ritterakademieen und Kadettenschulen, die orientalische Akademie u. s. w.) bleibt hier nur wenig nachzuholen, um das Bild der Thätigkeit in dem oben bezeichneten Wirkungskreise zu vervollständigen. Im Jahr 1751 wurde in Wien der Bau des prächtigen neuen Universitätshauses begonnen, am 5. April 1756 eingeweiht, ein wahrer Palast, mit ebenso großartigen als zweckmäßig eingetheilten Räumen. Im Jahre 1751 wurde auch der botanische Garten angelegt, welcher dann ähnlichen bei den Universitäten Mailand und Pavia zum Muster diente. Die erste Spur von einer Beachtung des Zusammenhanges zwischen Wissenschaft und Leben und der schönen Aufgabe für die Erstere, ohne Aufgebung ihres Selbstzweckes, das Letztere zu durchdringen, zeigte sich 1757, als an der Wiener Universität eine Sonntagsschule für Handwerker zum Unterricht in der populären Mechanik eröffnet wurde. Noch immer war aber alles, was für die Förderung geistigen Lebens in Oesterreich geschah, bloß Keim, noch mußten erst die Männer heranwachsen und reifen, welche das große Werk fortzuführen und die lange vernachlässigte, ja niedergehaltene Entwickelung von Völkern voll der reichsten Fähigkeiten über die hemmenden Schranken hinauszuleiten berufen waren. Noch wurden vorliebig die strengen Fachwissenschaften auf den Hochschulen gepflegt, noch richtete sich die Aufmerksamkeit weniger auf die selbstständige Ausbildung aller Seitenzweige, welche aus jenen sprossen und, in's Leben unmittelbar hineinragend, von der frischen Luft desselben bewegt, ihm auch Früchte zubringen sollen; noch war der Volksunterricht fast ganz unbeachtet; der Blick der Regierenden gewöhnte sich nur langsam, in die Niederungen der bürgerlichen Gesellschaft hinabzugleiten und dort die natürlichen Wurzeln zu entdecken, ohne deren geistig-moralische Erkräftigung keine Gesundheit des ganzen Baumes möglich ist; – die Gründung von Ritterakademieen war wahrlich nicht nothwendiger, als die von Dorf-, Normal- und Landwirthschaftsschulen und von Bildungsanstalten für Landschullehrer. Noch war endlich damals eine unglaubliche Masse von Reichthum als todtes Gut in Klöstern und Collegien aufgespeichert und verschlossen, welches späterhin zum Besten von Schulen flüssig werden sollte; noch konnte damals eine Reform des Studien- und Unterrichtswesens nicht durchgreifend, der Fortschritt des geistigen Lebens in Oesterreich mit den Ideen des Jahrhunderts nicht unaufhaltsam sein, so lange der Jesuitenorden nicht bloß den Kredit der höchsten Autorität als ausschließliche Vereinigung der besten Lehrer und der ausgezeichnetsten Gelehrten besaß, sondern auch Macht und Schutz genug, um denselben im Staats- und Familienleben geltend zu machen und einen Unterrichtsplan festzuhalten, welchen man deßhalb für den besten hielt, weil der Orden unläugbar eine lange Reihe von bedeutenden Talenten aufzuweisen hatte, welcher jedoch mit dem Prinzip des Ordens: blindem Gehorsam der Untergebenen gegen die Vorgesetzten, so durch und durch verwachsen war, daß produktive Ideen keine Möglichkeit fanden, wie sie aus der Freiheit des Geistes entströmen, Freiheit des Geistes in den Massen zu wecken, das Individuum durch Selbstthätigkeit von den Fesseln der Gattung zu entbinden, einen Wettgang der verschiedenartigsten Talente auf den verschiedensten Wegen zu einem und demselben Ziele anzuregen.
Diese hemmenden Ursachen betrachtet, darf man auch gegen jene Epoche des Beginnens und Säens nicht ungerecht sein, denn in Maria Theresia war wenigstens das Bewußtsein vorhanden, daß der Zustand ihrer Völker nichts weniger als ein vollkommener sei, und der redliche Wille, durch Heranziehung hervorragender Geister, mit Vertrauen auf sie und im Bunde mit denselben, einen besseren, ja den möglichst besten mit der Zeit herbeizuführen.
Einen Blick jetzt auf die