
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wenn der berühmte Zauberer Ajaxerle Eine burleske Figur in Raimunds dramatischem Märchen »Der Bauer als Millionär«. (ein Donaueschinger von Geburt und ein »Schneckenhändler« seines Handwerks) irgendeinen lustigen Wiener aus der Menge herausgriffe und ihn von den Ufern des »Schanzels« oder aus dem Gewimmel von Türken und Raizen, Müßiggängern und Geschäftseifrigen an der Ferdinandsbrücke plötzlich in das Dorf Pfohren Unfern Donaueschingens im Großherzogtum Baden. an das Ufer des Flusses stellte, welcher so still und bescheiden wie ein junger Landgeistlicher seines Weges dahinzieht – unser Landsmann aus der Kaiserstadt würde die friedlichen Wellen eher für Geschwisterkinder des wohlbekannten »Kanals« als für die Donau ansehen und, wenn sein magischer Kondukteur diesen Namen ausspräche, das Ganze für einen von jenen Schwabenstreichen halten, die mit dem Schwäbischen Herrgott beginnen und mit der Schwabenwanderung endigen; wie denn der Wiener gar zu gern alles, was aus »dem Reich« kommt, unter dem Generalbegriff Schwaben zusammenfaßt, nicht ahnend, daß jede Drôlerie, die er dem Schwaben aufbürdet, am Rhein ihm selbst auf Gegenrechnung gestellt wird.
Übrigens ist Pfohren, wohin der schwäbische Zauberer unseren Landsmann versetzte, wirklich der erste Ort, den die Donau, ihres Namens endlich versichert, berührt und den sie verläßt, ohne besorgt sein zu müssen, daß ihr derselbe wieder streitig gemacht werde. Pfohren ist nichts Geringeres als die Patin des Kindes, das die Kaiserstadt bereits als launenvolle große Dame besucht. Wir überlassen unseren Landsmann, der sich eher in dem fabelhaften Königreich des Geisterfürsten Longimanus als in dem stillen, tätig-behäbigen Schwaben zurechtfindet, für jetzt seiner Verwunderung, um die Donau auf ihrer Wanderung bis Ulm zu begleiten, wo wir eine Raststation zu halten gedenken.
Das Flüßchen führt uns zuerst nach dem Marktflecken Neudingen, der sich rühmt, daß er Karl den Dicken, früher weniger Mehrer des Reiches als seines Leibes, 888 in tiefster Armut sterben sah; im Erbbegräbnis des weiland Nonnenklosters ruhten die irdischen Reste der alten Grafen von Fürstenberg, deren Stammburg nicht fern ist. An Geisingen vorbei, durch heiteres Fruchtland, führt uns der freundliche Fluß nach Möhringen, wo das Schloß uns winkt, das der
edle Möhringer, aus dem fernen Sankt-Thomas-Land durch den Heiligen im Schlaf zurückgebracht, im Sonnenschein glänzen sah, indessen seine Hausfrau, »die schönste weit und breit im ganzen Donaugau«, und der junge Neufen Hochzeit hielten; wer kennt die lieblichen Romanzen nicht, die Gustav Schwab von der Reue der Frau und des Möhringers Milde und Treue sang?
»Der Möhringer«, schwäbische Sage in vier Romanzen. Siehe Gustav Schwabs »Gedichte«, 1829, 2. Band. Vgl. das alte Lied »Vom edlen Möhringer« (Bragur, 3. Bd., S. 402), das also beginnt:
Wollt jr herren fremde mer
Die vor zitten und ee geschah
Von dem edlen Möringer,
Wie er zu seiner Frawen sprach.
Usw.
Möhringen verlassend erreicht die Donau bald, das Eltaflüßchen aufnehmend, Tuttlingen, das gewerksame Städtchen im Baar, schon im 9. Jahrhundert genannt und im 14. von Eberhard dem Frommen, Graf zu Württemberg, erkauft, im Dreißigjährigen Krieg bald durch die Kaiserlichen, bald durch die Bayern erobert, Zeugin blutigen Unheils über das französisch-weimarische Heer, durch den tapferen Verteidiger Hohentwiels, Konrad Widerhold, seiner Palisaden und Mauern beraubt; Schloß Honberg ragt auf der Bergeshöhe wie ein alter Wächter über der freundlichen Stadt, und in kurzer Strecke schließt die anmutig gelegene alte Schmelze Ludwigstal sich an. An Nendingen, Mühlheim und Fridingen vorbeieilend, nähert sich die Donau dem malerisch gelegenen Schloß Wildenstein, das auf zwei schroff wie zwei ungeheure Kristalle aus Fluß und Ebene aufgeschossenen Felsen seine Mauern weist, und erreicht bald die Ruinen Falkensteins, bis sie, in einer Krümme ausweichend, Sigmaringen (Schloß und Stadt) berührt; das Residenzschloß des Fürsten, auf schroffen Felsen stattlich fußend, datiert seine Gründung vom 9. Jahrhundert, im 11. hielt es für Heinrich IV. wider den Gegenkönig Rudolf von Schwaben.
Eine Stunde unter Sigmaringen zieht der Fluß an Stadt und Schloß Scheer und weiter an mannigfachen Dörfern und Ortschaften vorbei, nimmt bei Riedlingen die Kanzach und die Biber auf und streift Zwiefaltendorf, eine Stunde von der alten Abtei, die, durch zwei Grafen von Achalm im elften Jahrhundert gestiftet, von der zwiefachen Ach den Namen empfing und nach ihrer Säkularisierung in ein Irrenhaus verwandelt worden ist; hier war's, wo einer der ersten Funken des Zwists entglomm, der später zwischen Welfen und Waiblingern in Deutschland und Welschland entbrannte, da Heinrich der Stolze, der Welfe, seinen Schwager Friedrich von Schwaben in die Abtei zu freundlicher Zwiesprache entbot und dessen Tod beschloß; aber Friedrich entrann noch zu rechter Zeit und verbarg sich im Turm; am anderen Morgen aber zog er, die gerechte Rache im Herzen tragend, von hinnen.
Rechtenstein und Reichenstein, zwei Burgruinen, schmücken die liebliche Landschaft, die sich nun auftut, und bald zeigt sich am rechten Ufer auf hohem Felsen das stattliche Gebäude der im achten Jahrhundert gestifteten weiland Reichsabtei Marchtal, in deren Kirche die Edlen von Stein seliger Urständ harren.
An Munderkingen (Wundrichingen) und Rottenacker vorbei, erreicht die Donau Ehingen, wo das steinerne Muttergottesbild in der alten Kirche den Frommen und die Reste der Römerstraße den Altertumsfreund anziehen; dann berührt sie Berg und Opfingen und windet sich unterhalb Gögglingen durch den Moor- und Heidegrund des sogenannten »Tauben Rieds« bis Ulm, wo das ehrwürdige Münster, unvollendet wie die meisten kirchlichen Wunderbauten des Mittelalters, ein gewaltiger Zeuge einstiger reichsstädtischer Bedeutsamkeit, deine Blicke fesselt.
Was war es einst, dieses Ulm, das sich römischen Ursprungs rühmt und stolz ist, nach seiner Verheerung durch Attila eine Stadt der fränkischen Könige geheißen zu haben! Wie übermütig trotzte es, mit den schwäbischen Städten im Bunde, dem Kaiser! Vor der Kirchenverbesserung, da noch das Sprüchlein galt: »Venediger Macht, Augsburger Pracht, Nürnberger Witz, Straßburger Geschütz und Ulmer Geld behält den Preis in der Welt« – als ein »fruchtbarer Acker der Mönche« prangend –, wie gewaltig widerstand es bald, ein gutes Bollwerk für die neue Lehre, der Zumutung des Kaisers, sich der alten Mutterkirche zu unterwerfen! Wie prunkte es so stolz mit den Namen der Söhne, die es geboren hat, der gelehrten Männer Agricola, Crusius, Diepold, Melander, Beham, Freinsheim, mit den Namen Thomas Abbts, dessen Gedächtnis das »Verdienst« erhält, Millers, der den »Siegwart« schrieb, Raffs, des alten Hans Nydhart, der den »Eunuchen« des Terenz übersetzte, des wackeren Meisters Syrlin, des Holzschneiders Schultes, der den »Theuerdank« schmückte! Der dreißigjährige Entmannungskrieg rüttelte zuerst – und mächtiger als die Pest – an den Grundfesten der reichsstädtischen Macht; der Sukzessionskrieg im Anfang, der Franzosenkrieg zu Ende des 18. Jahrhunderts vollendeten deren Auflösung, bis Mack 1805 die Schande seines Namens für ewige Zeiten an das Münster schrieb. Ulm, von dessen einstiger Volkszahl man sich einen Begriff machen kann, wenn man bedenkt, daß die Seuche im Jahre 1635 15 000 Leichen als Opfer empfing, zählt jetzt im ganzen ebenso viele Lebendige.
Von der alten Herrlichkeit blieb der Reichsstadt nichts als das Münster, das von 1377 bis 1488 erbaut wurde und bestimmt war, nicht bloß mit dem Kölner Dom und der Stephanskirche in Wien zu
wetteifern, sondern diese sogar zu überragen; aber schon griff der Geist der Reformation in das Werk und hinderte die Vollendung
Das Innere des Münsters mißt 416 Fuß in der Länge, 166 in der Breite, der Turm bis zur Spitze 337 Fuß; den Kostenaufwand schlägt die Überlieferung auf 900000 Fl. an. Sechs Pforten führen in die Kirche, unter deren Merkwürdigkeiten die Orgel gepriesen wird. Vor der Reformation hatte das Münster 51 Altäre; außerhalb der Kirche befand sich ein 1531 zerstörter »Ölberg«, ein Meisterwerk altdeutscher Kunst. Folgende Inschrift bewahrt das Gedächtnis an Kaiser Max I. Wagnis, der 1491 den Turm bestieg und, mit dem einen Fuß am Rande des Mauerwerks stehend, den anderen ins Freie hinausstreckte:
MAXIMILIANVS ROMANORVM PRIMVS AC HVNGARIAE REX, ARCHIDVX AVSTRIAE BVRGVNDIAE DVX HOC OPVS VSQVE AEDIFICATVM VISITAVIT ANNO CHRISTI MCCCCXCII. und das in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts erbaute Rathaus; aber statt der schwäbischen Deputierten siehst du jetzt ehrsame Gersten-, Samen- und Schneckenhändler und Pfeifenkopffabrikanten um dasselbe wandeln.
Die Dreifaltigkeitskirche, einst im Besitz der Predigermönche, ist ein neuer Bau aus der Epoche des Geschmackverderbnisses. Das deutsche Haus, das Friedrich und Hermann von Baden gestiftet haben, verlor seine Kirche 1818 wie die Michaelskirche, welche seit 1183 den Augustinern (ad insulas Wengenses) gehörte und nun den Katholiken eingeräumt ist, das dazugehörige Konventsgebäude, das jetzt als Kaserne benutzt wird; in dieser Kirche des früheren Klosters Wengen ruht jener schwärmerische fromme Diener der ewigen Weisheit, der Predigermönch Heinrich Suso, aus dessen Gemütstiefe die Wurzel der christlichen Mystik eine ihrer duftigsten Blüten emportrieb, einer jener begeisterten Kämpfer für die Vereinigung der Seele mit Gott, die mit den kräftigen, derben und gewandten Meistern der Dialektik, den Scholastikern auf Leben und Tod rangen; Surius hat in älterer Zeit Susos Leben und Schriften ebenso abgeschmackt, wie es Görres (in der Diepenbröckschen Ausgabe) liebevoll und (ganz neuerdings) A. Jahn geistreich aufgefaßt haben. Susos Leichnam requirierten 1688 der Bischof von Konstanz, später der Prälat von Wengen und der bayrische Intendant von Amman von dem protestantischen Rat Ulms, auf den Grund, daß ein Bayer in der Nähe des Grabes das Flehen des Seligen vernommen hatte: »Er wollte von der Gemeinschaft mit den Ketzern erlöst sein!« 1776 und 1802 wurden abermals Nachgrabungen veranstaltet.
Das alte Schwörhaus, das einst den reichhaltigen Bücherschatz der Stadt aufbewahrte, wurde 1786 ein Raub der Flammen; das Hospital, aus dem dreizehnten Jahrhundert stammend, und das Zeughaus, das jetzt in eine Kaserne umgewandelt worden ist, tragen noch das Gepräge des alten vaterländischen Baustils, wie die überhängenden Häuser in den engen, krummen Gassen noch heute die Schattenseiten des alten Städtewesens, die Behaglichkeit in der kleinen Welt, aus der das Individuum seine Fühlhörner in die große hinausstreckte, ebenso getreu repräsentieren als das Münster die Lichtseite, jene Auffassung des städtischen Gemeinwesens als einer einzigen großen Familie, auswärtiger Anmaßung gegenüber; jenen schönen Tatstolz des Patriziats, in welchem – trotz der heftigsten Reibungen – die Masse des Volkes befruchtend und nährend aufging, jene Pietät für das Übersinnliche, in welcher doch wieder der überschwellende Drang der ins Ungemessene und Abenteuerliche hineinstrebenden Sinnlichkeit zutage kam – kurz alle Widersprüche des Mittelalters, wie es im reichsstädtischen Wesen sich zusammendrängte, die ganze Verworrenheit seiner Zustände, die ganze Wechselwirkung von dunklem Trieb und allen Hemmnissen der Entwicklung, von erhabener Großartigkeit und spießbürgerlicher Absonderung – sie finden sich auf der architektonischen Physiognomie Ulms ziemlich vollständig erhalten, und selbst diese Kanäle und Flußarme, welche die Straßen so heimlich und verstohlen durchschleichen, erinnern an jene vergangenen Zeiten, da jedes Haus des Bürgers eine kleine Burg, der Wassergraben und die Brücke oder der Steg seine natürliche Verteidigung waren und jedes Pförtchen in einer langen grauen Wand ein Hinterhalt war, gerade groß genug, um zu heimlicher Lust oder Rache daraus hervorzuschlüpfen. Man kann nicht anders sagen, als daß, seit Ulm zuerst bayrisch und dann württembergisch geworden war, alles geschah, um die düstere, mittelalterliche Reliquie der lichten, freundlichen Neuzeit anzupassen; wenigstens hat es, soviel wir wissen, keine besonderen Stadtjuden mehr wie einst und besteuert die fremden Juden nicht mehr für jede Stunde, die sie in Ulm zubringen.

Ulm
Freilich: die Neuzeit! Rechnet man sie nicht von der Flucht Luthers nach der Wartburg an? Und doch zeigt man dort noch den Tintenklecks, den der alte deutsche Teufel des Volksbuches auf dem Gewissen hat. Solange Ulm sein Münster hat, wird es, da es keine so großartige Nivellierung des Volkscharakters erhoffen oder befürchten kann wie Wien oder Straßburg, immer das dunkle, in sich gedrückte Ulm des weiland Schwäbischen Bundes bleiben; und wir wollen nicht fürchten, daß das herrliche Münster, nachdem es viereinhalbhundert Jahre in Ehren gestanden und die Furcht des wohledlen Rats von 1494, daß es einstürzen möchte, zunichte gemacht hat, langsam zerbröckle; diese Denkmäler des Glaubens rüstiger Geschlechter, die deutschen Dome, die in den Stürmen der Reformation nicht wankten, werden noch kommende Geschlechter überragen, denen die Traditionen von einer Reformation selbst nur wie fast verschollene Märchen zu Ohren kommen und die stark genug sein werden, sich neue Tempel – ohne Steine und Kitt zu bauen.
Der Charakter der Landschaft, deren Krone Ulm ist, stimmt zu dem der Stadt, deren Münster, von was immer für einer Seite du ihr dich nähern magst, den Typus und Schlußstein des Ganzen bildet; überall ruht dein Auge mit Wohlbehagen auf Fülle und Segen – ob es nun die Höhen hinan sich wende, die hinter der Stadt aufsteigen, oder ob es, von diesen herab, die Fernsicht genieße, die sich auf das von der Donau, der Iller und der Blau durchschnittene unabsehbare Flachland darbietet, wo Türme und Dächer aus Fruchtfeldern emportauchen; das Auge des Geistes sieht auf den Heerstraßen die schwerbepackten Frachtwagen dahinziehen, die des alten Reichsstädter Linnenballen Ulm zählte als Reichsstadt über 200 Weber, deren Gewerk der Stadt jährlich an 60 000 Fl. brachte. im deutschen Reich verführen, und entdeckt das ehrenfeste Geleit daneben auf stämmigen Rossen mit wallenden Fähnlein. Oder du stehst am Ufer, wenn die »Ordinari«, von fröhlichen Gesellen bemannt, abstößt; aus wie verschiedenen Ländern sie kamen und sich zusammenfanden, die Ruder zu handhaben – du meinst gewiß, sie wären aus einer einzigen Familie; das macht die schwäbische Treuherzigkeit derer, die zurückbleiben, und es fällt dir dabei unwillkürlich das eine oder andere der Uhlandschen Wanderlieder ein, die nirgend anders als im idyllischen Schwaben gedichtet werden können; sollte das deutsche Reich heute wieder erstehen, wie es einst war – in Schwaben sind alle Elemente dazu noch als Reliquien vorhanden.
Der letzte Ort, der unsere Aufmerksamkeit fesselt, bevor wir von Neu-Ulm aus, das bereits auf bayrischem Gebiet liegt, der Donau folgen, ist Wiblingen, wo die Iller mündet; zwei fromme Grafen von Kirchberg stifteten dort 1099 ein Benediktinerkloster, dem im Bauernkrieg 1525 das Geläut zur Morgenandacht von St. Benedikts Fest unverhoffte Rettung von Sturm und Plünderung brachte. Schloß Böffingen und die beiden Thalfingen schwinden rasch an unseren Blicken vorbei, und nun zeigt sich Elchingen mit dem prachtvollen Gebäude des im zwölften Jahrhundert erbauten, mehrmals zerstörten und wiederhergestellten (säkularisierten) Klosters. Hier war's, wo Ney die Schlacht gewann, der er den Herzogstitel verdankte.
An Leibi und den beiden Fallheim, an Weißlingen und Langenau vorübersteuernd, gewahren wir jetzt auf sanfter Anhöhe das unansehnliche, aber eine reizende Aussicht bietende Städtchen Leipheim, wo 1525 die kriegerischen Bauern, nachdem sie langen Druck durch unmenschliche Ausschweifung wettgemacht hatten, im gräßlichen Gemetzel die süße Rache büßten; da war ihnen vor Rossen und Reitern kein Ausweg mehr, Wut faßte die Verzweiflung und rang sie nieder; wer von den Bauern dem Schwert entfloh, fand, dem Strom vertrauend, darin den Tod, und wer ihn den blutigen Wellen abgewann, rannte aufs neue blind in die mähende Sichel. Fort von dem Schauplatz, auf dem seither ein Fluch der Öde liegt; dort winkt schon auf sanfter Höhe das Schloß der Burgauer Markgrafen, Günzburg, dem Schiffer entgegen, das Karl, der Sohn Ferdinands von Tirol und der Philippine Welser, erbaute und später Kaiser Leopold I. dem Türkensieger Ludwig von Baden zum Geschenk gab. Imposant schauen die zwei alten Bergschlösser Reisensburg und Landstrost auf uns herab.
Doch wir schiffen weiter, an Offingen, Gundremmingen, den beiden Stotzingen, dem Predigerkloster Medlingen, Gundelfingen, Eichenbrunn und Feimingen vorbei, bis Lauingen, wo Römerstraße und Römersteine das Andenken der Weltherrscher, die einst hier weilten, bezeugen. Unter Arnulf heißt Lauingen Villa Logena. Kaiser Ludwig belagerte und eroberte, Ludwig im Bart, der Herzog zu Ingolstadt, erweiterte und umgab es mit stattlichen Mauern und Türmen. Später wurde Lauingen der Pfalz-Neuburger Eigen, deren Leichen in der Pfarrkirche ihre Ruhestätte fanden. Der hohe Turm, den ein Pfleger Lauingens, einer von Imhof, 1478 erbaute, bewahrt das Bildnis des durch sein geheimes Wissen berühmten und fast in den Ruf eines Magus gebrachten Albertus Magnus, Geboren zu Lauingen, Predigermönch, Meister zu Köln, Paris und Rom, Bischof zu Regensburg, gestorben zu Köln am 15. November 1280. Bischof von Regensburg, von dem die Sage, das Volkslied und der Meistersang uns so manch wundersame Mär berichten. Wer kennt die Mär von dem redenden Haupt nicht, das Albertus gefertigt und das sein Schüler, der heilige Thomas von Aquino, aus Glaubenseifer als Teufelswerk zerschlug, worauf Albertus ausrief: »O Freund, ein Werk von dreißig Jahren verdarbst du mir!« Oder jene anderen von dem wunderbaren Gastmahl, womit Albertus den Kaiser Wilhelm am Dreikönigstag 1248 in Köln bewirtet hat, mitten im Winter den ganzen beschneiten Klostergarten plötzlich mit Sonnenschein und tausend Frühlingsblüten belebend und schmückend?
Ein Meistersang in des »Marners güldnem Ton«, gedruckt zu Nürnberg durch Hans Güldenmundt, berichtet von dem Studenten,
... der hieß Albertus,
Und mit dem Zunamen Magnus
Von Laubingen er bürtig ist,
Das leyt dort an der Thone,
und wie er in Paris des Königs von Frankreich Tochter, die ihm Tag und Nacht im Herzen lag, zum Weibe haben will. Durch Schwarze Kunst macht er sich unsichtbar und bringt sie allnächtlich in sein Haus und zurück in ihres Vaters Schloß. Die Tochter aber klagt der Mutter ihr Leid, und der König beschließt, um den Verführer zu fangen, alle Häuser schneeweiß tünchen zu lassen, gibt der Tochter ein Gefäß mit roter Farbe und rät ihr, sie solle, wenn der unsichtbare Buhler wiederkomme, rasch ihre beiden Hände darein tauchen und dessen Haus damit berühren. Die Prinzessin befolgt diesen Rat, und am anderen Tag erkennt nun der König, durch alle Gassen reitend, das rechte Haus und gebietet, es zu umstellen. Albertus wird gefunden und entschuldigt sich naiv:
»Mein junger Müt hat es gethan,
Sonst wer' es nicht geschehen.«
Aber der zornige König will nichts von Gnade wissen und verurteilt den Studenten Albertus; der aber
... het ein Knewlein fadens fein
Das zoch er aus dem Büchsen sein
Er nam es in sein mundt so rot
Und für daheyn mit schallen.
Schnell und behend recht san der windt
Der König sprach: mein liebes Kindt
Ist keusch und frum, das sich ich wol
An diesen Wunderzeichen.
Albertus aber zieht nach Regensburg, verbrennt reumütig seine Zauberbücher und wird nun ein frommer Christ.
Sinniger ist die verwandte Sage von Albertus, die wir in »Des Knaben Wunderhorn« mitgeteilt finden, von der Königin, die neun Buhlen lockt und nach heimlich genossener Minnelust ermordet. Auch unserem Albertus droht dasselbe Los, aber er ist
... ein hochgelehrt Student
Ihr Komplexion er gar wohl kennt,
Er wusst gar wohl
Die konnt ihn nicht betrügen.
Er blickt sie an durch Kunstes Glas,
Er sah wie sie naturet was,
Er warb um sie,
Ihr List musst ihm erliegen.
»Neun Jünglinge«, sagt er zu ihr, »sah ich schweben dort,
... die warnen mich,
O Weib, das bringt mir bange,
...
Ein Wasser brauset unter mir,
Dein Bett ein böses Schifflein schier
Will schlagen um,
Will jenen mich gesellen.«
Erbost will ihn die Königin nun ertränken lassen, doch durch seine Kunst zerreißt er die Bande, die ihn fesseln, springt frisch und gesund in den See und schreitet stolz auf den Wassern dahin. Die Knechte zielen von allen Seiten auf ihn, aber ihre abgeschossenen Pfeile verwandeln sich in Vöglein, die ihn umschweben.
Die Königin rief da herab:
»O hätt' ich dich,
Ich wollt' dein Kunst zerstören.«
»Frau Königin«, er zu ihr sprach:
»Ich trage um neun Knaben Rach,
Neun Vögelein
Die Pfeil sich um mich schwingen.«
Nun fliegt Albertus zu aller Staunen in den Wald, die Königin wird bleich. Er schwingt sich in die Luft, die Vöglein folgen ihm, auf eines Turmes Zinne läßt er sich nieder und bindet allen Vöglein Brieflein an die Schnäbel, darin geschrieben steht:
»Neun mordete
Die Königin um Minne!«
Sie fliegen durch die Stadt, und die Schande wird offenbar, ein Vöglein aber flattert über der Königin hin und her und läßt ihr den Brief in den Busen fallen. Da entdeckt sich Albertus:
»Frau Königin,
Albertus ist mein Name.
Albertus Magnus heisse ich,
Sanktus nennt auch die Kirche mich,
Du hast um mich
Dein Bulerkunst verloren.«
Die Königin zerreißt verzweifelt und reuig ihr Gewand und »legt sich an wohl einen grauen Orden«. Albertus bekehrt sie vollends, und sie büßt achtzehn Jahre lang, während welcher Frist neun Vöglein vor ihrer Zelle singen, die sie atzt. Als aber die Frist verstrichen ist, führen die neun Vöglein sie als neun Engel ins Himmelreich.
Durch das ganze Mittelalter behaupteten Alberts Bücher von der Kräuter und Steine geheimen Kräften das größte Ansehen, er tritt gleichsam als Vorläufer Fausts auf, während die Kirche seinen Namen heiligspricht.
Zum zweiten bewahrt jener Imhofsche Turm noch das Wahrzeichen der »schönsten Jungfrau« (Geislin, Gräfin von Dillingen), »des größten Pferdes« und das Andenken jenes Sieges, den ein kleiner Schuster über einen riesigen Ungar davontrug, wovon der Ursprung des Stadtwappens – ein gekrönter Mohr mit goldener Kette – abgeleitet wird.
In Hormayrs »Historischem Taschenbuch für 1837« wird diese Sage nach älteren Angaben wie folgt erzählt: »Zur Zeit, als die Heiden oder Hunnen bis nach Schwaben vorgedrungen waren, rückte ihnen der Kaiser mit seinem Heer entgegen und lagerte sich unweit der Donau zwischen Lauingen und Faimingen. Nach mehreren vergeblichen Anfällen von beiden Seiten kamen endlich Christen und Heiden überein, den Streit durch einen Zweikampf entscheiden zu lassen. Der Kaiser wählte den Marschall von Calatin (Pappenheim) zu seinem Kämpfer, der den Auftrag freudig übernahm und nachsann, wie er den Sieg gewiß erringen möchte. Indem trat ein unbekannter Mann zu ihm und sprach: ›Was sinnst du? Ich sage dir, daß du nicht für den Kaiser fechten sollst, sondern ein Schuster aus Henfwil (später Lauingen) ist dazu ausersehen.‹ Der Calatin erwiderte: ›Wer bist du? Wie dürfte ich die Ehre eines Kampfes von mir ablehnen?‹ – ›Ich bin Georg, Christi Held‹, sprach der Unbekannte, ›und zum Wahrzeichen nimm meinen Däumling.‹ Mit diesen Worten zog er den Däumling von der Hand und gab ihn dem Marschall, welcher ungesäumt damit zum Kaiser ging und den ganzen Vorfall erzählte. Hierauf wurde nun beschlossen, daß der Schuster gegen den Heiden streiten sollte. Der Schuster übernahm es und besiegte glücklich den Feind. Da gab ihm der Kaiser die Wahl, von drei Gnaden sich auszubitten. Der Schuster bat erstens um eine Wiese in der Nähe von Lauingen, daß diese der Stadt als Gemeingut gegeben werde. Zweitens, daß die Stadt mit rotem Wachs siegeln dürfte (welches sonst keinem unmittelbaren Ort gestattet war). Drittens, daß die Herren von Calatin eine Mohrin als Helmkleinod führen dürften. Alles wurde ihm bewilligt und der Daumen St. Georgs sorgfältig von den Pappenheimern aufbewahrt, die eine Hälfte in Gold gefaßt zu Kaisheim, die andere zu Pappenheim.«
Das im antiken Stil erbaute Rathaus ist ein Werk Quaglios.
Der nächste größere Ort, den wir erblicken, nachdem wir auf nicht allzu kurzweiliger Fahrt mehrere unbedeutende übersahen, ist Dillingen. Habt ihr nie von der berühmten Universität Dillingens gehört? Von dieser geistlich-geistigen Pflanzschule, bei der zehn Gärtner auf ein Gewächs kamen? Und welche Gewächse! Bedauernswerte, die ihr von der Dillinger Hochschule nichts wißt! Oh, Dillingen ist eine Art von Pompeji, und es sollte uns wundern, wenn nicht von mancher deutschen Universität, welche dem Ideal einer alten Klosterschule mit glücklichem Erfolg nachstrebt (Namen tun hier nichts zur Sache), nächstens eine Kommission nach Dillingen gesendet würde, um den klassischen Boden auszubeuten und den ganzen Kordon von geistigen Quarantäneanstalten, der sich um die Dillinger Universität schlang, treu aufzunehmen; das ganze System von Kollegien, Konvikten, Seminarien und Konventen, woraus einst die gute Stadt Dillingen bestand; der Jesuitenpalast beherrscht sie noch heute, bedeutungsreich genug, wie ein Fürstenschloß. Hier ist nichts, was uns an das 19. Jahrhundert erinnern kann, als der Karolinenkanal, 6800 Fuß lang und 90 breit, zwischen Lauingen und Dillingen. durch den der alte Vater Max 1807 dem Strom trotzte, der ohne Scheu und Ehrfurcht vor der Weihe des Bodens schon mehr als einmal Lust bezeigte, die letzten Spuren der Universität Dillingen wegzuschlemmen.
Ganz andere Gedanken regt Höchstädt an; wohl eine Stätte des Hochgerichts, zu welchem ganze Völker geschleppt wurden – die einen als Schlachtopfer, die anderen als Henker, um dem Kitzel der Gewalthaber ein blutiges Schauspiel zu geben. Der Welfen und der Waiblinger Blut weihte die Felder Höchstädts für die Mordkämpfe in späteren Zeiten; am 12. August 1080 war's, daß Friedrich, der Hohenstaufe, dem Kaiser Heinrich IV. in aller Drangsal treu, durch Herzog Welf blutige Niederlage empfing; wieder ein zwölfter Tag im August (1634), daß die Kroaten in allen Gassen Höchstädts würgten. 1703 schlugen der Kurfürst Max Emanuel und Marschall Villars auf Höchstädts Feldern die Kaiserlichen, die unter Styrums Anführung aus ihrem Lager bei Haunsheim aufgebrochen waren und Donauwörth bedrohten, so gewaltig, daß sie Gepäck, Geschütz und Feldkasse im Stich ließen und flohen; 4000 Kaiserliche blieben auf der Walstatt.
Die Schlacht vom 13. August des nächsten Jahres, von den Briten nach dem auf einem Hügel unfern gelegenen Flecken die Schlacht bei Blindheim genannt, entschied desselben Maximilian Emanuels Geschick, dem Kaiser Leopold I. einst nach Wiens Entsatz den eigenen Degen zum Ehrengeschenk gegeben hatte und gegen den nun nicht bloß der Kaiser, sondern alle Mächte standen, die gegen Frankreich längst heimlichen Groll hegten, das sich mit dem Bayernfürsten verbündet hatte. Schon stürmte gegen diesen am Schellenberg bei Donauwörth das Unglück heran; bald flammten alle Dörfer, Flecken und Städte im ganzen Bayernland als Siegesfeuer des Kaisers empor; umsonst beschwor die Kurfürstin den Gatten, dem Bund mit Frankreich zu entsagen; Max Emanuel hörte nur den Rat und die Verheißungen Frankreichs. Der eitle Marschall Tallard brachte ihm frische Truppen, »die unüberwindlichsten Scharen des Erdballs«, wie er sie pries. Aber schon rückten die Vereinigten des Prinzen Eugen, des »edlen Ritters«, und Marlboroughs von Schwenningen gegen Höchstädt. Bayern und Franzosen bedeckten den ganzen Plan, die ersteren (im linken Flügel) bis an die Hügel bei Lutzingen hin, die zweiten (im rechten Flügel) bis Blindheim ausgebreitet. Am Morgen des 13. August dringen Eugen und Marlborough aus den Büschen hervor und drohen den Feinden plötzlich dicht vor der Stirn; bald stehen Schwenningen, Wolperstädt und mehrere andere Dörfer, Weiler und Mühlen in lichten Flammen. Die Schlacht bricht los wie der Tiger aus dem Käfig, der zum Mordsprung sich niederlegt. Prinz Eugen hat sein Augenmerk auf den Kurfürsten am linken Flügel, Marlborough auf Tallard, der sich in Blindheim hält; mit der ganzen Macht seiner Infanterie durchbricht Marlborough die Kavallerie Tallards, treibt sie von der Infanterie und den Dörfern und zerreißt die Schlachtordnung, daß sie sich zur Donau hinabkrümmt. Tallard, der inzwischen bei Lutzingen geweilt hat, sprengt zurück und gerät bei Blindheim mitten in Marlboroughs Scharen hinein, die den Gefangenen jauchzend umringen, während der Kurfürst dreimal den Angriff des Prinzen Eugen zurückwirft und zu spät mit Entsetzen die wilde Flucht der Franzosen gewahrt. Entmutigt läßt er zum Rückzug blasen, und langsam weicht er mit seinen noch verzweiflungsvoll kämpfenden Scharen bis hinter Lutzingen, wo das Gebüsch sich lichtet; bis dorthin verfolgt sie Eugen. Die sich in das feste Schloß von Höchstädt geflüchtet haben, das, auf einer sanften Höhe ragend, die Aussicht bis Lauingen und Donauwörth bietet, fechten bis tief in die Nacht wie Rasende fort.
20000 Tote oder Verwundete lagen auf dem blutigen Plan, mit 4000 Erschlagenen zahlten die Sieger den Preis der Schlacht; 25000 und das ganze Lager mit Proviant, Feldkasse und allen Geschützen fiel in ihre Gewalt. Der Kurfürst floh den Resten des französischen Heeres nach, da er sein Land verloren gab; in Waiblingen übertrug er die Regierung der unglücklichen Gattin.
Soviel Blut Unschuldiger mußte fließen, soviel Elend und so namenlose Grausamkeit mußten über das arme Land kommen, weil – zwei Fürsten um Spaniens Krone stritten, die schon vor dem Tod ihres letzten Besitzers, Karls II., durch den Schmutz der Parteien, die sie wie einen Fangball hin und wider schleuderten, genug besudelt war, als daß es noch des Blutes von Hunderttausenden bedurft hätte, um ihr den Fluch der Völker aufzuprägen. An solchen Epochen steht die Geschichte als Gottes Racheengel still, um die Rechte der Menschheit für spätere Zeiten aufzuzeichnen; sie zahlt ihr jeden Überschuß treulich heraus; ihre Münzstätte ist die Guillotine. Wie das Parlament Marlborough für den Sieg bei Blindheim ehrte, dessen Name eine bittere Ironie auf Tallards Kurzsichtigkeit ist, verewigt der Palast »Blenheim House«; wer aber kennt heute das Lied von Marlborough noch, das einst auf allen Gassen scholl:
Marlbrouk s'en va-t-en guerre,
Mirontonton, mirontontaine;
Marlbrouk s'en va-t-en guerre,
Ne sait quand reviendra.
Sechsundneunzig Jahre später (am 19. Juni 1800) standen vor demselben Höchstädt Kaiserliche und Franzosen sich abermals gegenüber, und die letzteren rächten die Schmach, die Tallards Unstern über die Nationalehre gebracht hatte.
An Blindheim, Gremheim, Schwenningen, Tapfheim, Münster, Erlingshofen und Auchsesheim vorüberfahrend, ermüdet uns der Strom durch die vielen Krümmungen, in denen er sich, an der Eintönigkeit und Reizlosigkeit der Gegend selber ermüdend, träge dahinwindet, bis er Donauwörth erreicht, wo er die Wörnitz, die Zusam und die Schmutter aufnimmt. Nur der Schellenberg, der die Lage der Stadt beherrscht (eine Quelle entspringt dem Berg, die alles, was man hineinwirft, versteinert), ragt aus der Öde wie ein Wartturm der Geschichte. Im Spanischen Sukzessionskrieg empfing der Kurfürst Max Emanuel hier die Vorahnung der Vernichtungsschlacht bei Höchstädt. Graf Arco hatte den Schellenberg mit Verschanzungen gedeckt, als am Abend des 2. Juli jenes Unglücksjahres 1704 Marlborough und Ludwig von Baden den Sturm befahlen. Nur wenige Stunden währte der entsetzliche Kampf, von dem der Sieger Ludwig von Baden selbst gestand: »So möchte ich schier lieber überwunden, denn Überwinder sein!« Siehe Zschokkes »Bayrische Geschichte«, Band 6.
Donauwörth, einst ein Eigentum der Grafen von Dillingen und Kyburg, erhielt durch Kaiser Heinrich IV. Türme und Mauern und kam durch Konrad IV. an Bayern. Kaiser Albrecht I. verleibte die Stadt dem deutschen Reich ein; Kaiser Ludwig der Bayer belagerte sie fruchtlos zwei Monate lang; Kaiser Karl IV. versetzte sie an Bayern; in den Zwisten der Fürsten errang sie ihre Freiheit, 1458 erlag sie aufs neue den Bayern, bis Kaiser Friedrich IV. sie wieder als Reichsstadt erklärte. Sie trat dem Schmalkaldischen Bund bei und erhielt, obwohl Karl V. sie erobert hatte, die Reichsfreiheit und die Freiheit, die evangelische Lehre zu bekennen. Im ersten Dezennium des siebzehnten Jahrhunderts veranlaßte eine Prozession, welche der Abt des Klosters »Zum Heiligen Kreuz« – dem Befehl des Rates zuwider – durch die Straßen führte, Unruhe im Volk, Auflauf und Gewalttätigkeit und in deren Folge Achtserklärung, die der glaubenseifrige Herzog Maximilian von Bayern vollzog; dem Versprechen, auf das hin die Stadt sich ergab zum Trotz, wurden die Bürger entwaffnet, die Pfarrkirche den Jesuiten eingeräumt, der katholische Glaube wiedereingesetzt, und die Stadt blieb bayrisch, bis Gustav Adolf sie 1632 eroberte und wieder als evangelische freie Reichsstadt erklärte. Zwei Jahre darauf fiel sie wieder in der Bayern Gewalt und Oberhoheit, bis ihr Kaiser Joseph I. 1705 nach der Schlacht am Schellenberg abermals die Reichsfreiheit gab. Seit 1782 verblieb sie Bayern für immer.
Das Kloster »Zum Heiligen Kreuz« stiftete Graf Mangold von Dillingen und Kyburg nach seiner Heimkunft von Konstantinopel, einem mitgebrachten Kreuzpartikel zu Ehren, 1029 für fromme Jungfrauen. Papst Paschalis II. gebot, daß statt der Nonnen, deren Zucht verfallen war, Benediktiner vom Schwarzwaldkloster St. Blasius einzögen. Als das alte Gebäude ein Raub der Flammen geworden war, stellte Kaiser Friedrich II. es wieder her.
In der alten Marienkapelle des Klosters fand Maria von Brabant, die ihr Gatte Ludwig der Strenge, Ottos des Erlauchten Sohn, grundloser Eifersucht geopfert hatte, ihr Grab. Dies ist die Geschichte ihres Todes: Kaum zwei Jahre war Maria von Brabant mit Ludwig dem Herzog in Bayern vermählt, als dieser an den Rhein reiste und seine Gattin mit seiner Schwester Elisabeth (der Mutter Konradius) im Schloß Mangoldstein zurückließ; Heinrich von Hirschau, an Abkunft wie an Sitten gleich edel, begleitete den Herzog, der ihn – wie die Herzogin nicht minder – stets wert hielt. Als nun die Zeit verging, sehnte sich die Herzogin nach dem Angesicht ihres Gatten und schrieb an ihn und schrieb an den Freund zugleich, den letzteren bittend, er möge den Herzog zur Heimkehr bewegen, dann wolle sie ihm gewähren, um was er sie einst gebeten hatte; es war aber einst beim Schach, daß er sie gebeten hatte, sie möchte ihn in Zucht und Sitte als ihren Ritter duzen. Der Brief an den Herzog war rot, der an Heinrich schwarz gesiegelt, der Bote aber verwechselte beide, und so empfing und erbrach der Herzog den für seinen Freund bestimmten, und alsbald erwachte in ihm wieder die Wut der Eifersucht, die sein falscher Marschall, der die tugendhafte Maria geliebt und von ihr verschmäht worden war, ihm schon früher ins Herz gesät hatte. Er erschlug den Boten und ritt zur Stelle heim. Im blinden Zorn mordete er im Schloß den Vogt und das Edelfräulein der Herzogin, vier Jungfrauen ließ er von den Zinnen stürzen, dann gebot er, die schuldlose Frau zu enthaupten. Erst als die blutige Tat geschehen war, erkannte er Marias Treue. Verzweiflung bleichte ihm über Nacht das Haar; nirgends Ruhe und Rast findend, stiftete er ein Kloster im Dorf Taal, das später nach Fürstenfeld versetzt wurde.
Meister Stolle singt von der edlen Fürstin:
O we hiute und immer me wafen si gescrit.
so we dem tage, so we der naht, so we der veigen zit.
so we dir gar verscamte vrucht.
uz Peyerlandt wie hastu dich geschendet.
an einer hoch gelobeten vrouwen die was wite irkant.
von Kuninges kunne was sie gebore unde heizen von Brabant.
ir wiplich ere ir wiplich zucht.
ir wiplich vröude die hastu irwendet.
sie ist an der merterern stat.
alsam diu gnote sante Katerine.
diu bot sich vlehten an ein rat.
durch den sunzen Got leit sie vil manige swere pine.
so ist der edelen herzoginnen sele vor gote irkorn.
wan sie gar ane schulde an rehtem morde hat ir lip verlorn.
Ich vernam bi allen minen tagen mort noch nie so groz.
so von der Peyer herren der hat sich gemachet bloz.
An tugende und an der werde sie.
Got schende die den rat im haben geraten.
der von Isols riet so horn ich jen unde der von Brockensberc.
die zwene haben geraten diu lesterlichen werc.
an der edelen herzogin.
man solte sie beide auf einer hürde braten.
nu muget ir horen jamer klagen.
sie bat ir herren kusses e ir ende.
sol ich nu sin von iu irslagen.
des muzent ir vil dicke winden sere iuwe hende.
ich laze ez an der megede sun daz ich unschuldich bin.
der tot den ich nu liden muoz der wirt noch iuwers heiles ungewin.
Das Volk hielt das Andenken der edlen Fürstin hoch wie das einer Heiligen und stahl noch im vorigen Jahrhundert gläubig den Mörtel von ihrem Grab als – Heilmittel.
Einen lebensfrischen Gegensatz zu diesen Todeserinnerungen bietet die Sitte der Schiffer Donauwörths, zuweilen ein fröhliches Schifferstechen zu veranstalten, auf der Donau ein selteneres Fest als am Rhein, obwohl auch die Ulmer Schiffer von alters her sich auf solche Kunst des Schiffturnierens etwas zugute tun. Seht, wie keck die halbnackten Gesellen auf der Spitze ihrer Nachen stehen, die weißblaue Lanze wiegend! Je zwei und zwei messen sich herausfordernd. Jetzt wird das Zeichen gegeben. Pfeilschnell schießen die Kähne, von emsigen Ruderern getrieben, wider einander, als solle der eine den anderen in den Grund bohren. Aber gewandt gleiten sie im Nu aneinander vorbei; die Wettkämpfer zielen genau; und schon fliegt der eine – oft fliegen beide – sich überschlagend in die Fluten hinab, und ein lautes Gelächter schlägt mit diesen zugleich über dem Besiegten zusammen, während der Sieger stolz die Lanze senkt und den Beifall der Umstehenden empfängt.
Wir verlassen Donauwörth, und bald entdecken wir aus der weiten, unfruchtbaren Fläche am rechten Ufer des Stroms den Turm des jenseits des Lechs gelegenen Dörfchens Rain, wo der dreiundsiebzigjährige Tilly die Schenkelwunde empfing, an der er zu Ingolstadt starb. Die Gegenden des linken Ufers mit ihren freundlichen Dörfern Zirgesheim, Nefsend, Altesheim, mit ihren anmutigen Hügeln und kleinen stillen Tälern, aus denen die Wasser so heimelig rinnen, entschädigen uns für die eintönige, trostlose Öde des Lechfelds, das sich auf der entgegengesetzten Seite auftut. In jenem Tal, dessen Pforten Leitheim und Lechsgemünd sind, liegen die Ruinen des Schlosses Graisbach, von dem sich Ludwig der Buckel, der unnatürliche Sohn Ludwigs im Bart, des Herzogs von Ingolstadt, Graf von Graisbach schrieb; unter Lechsgemünd strömt der Lech in die Donau, seine Ufer dünken uns hier so unscheinbar, daß wir es, statt hier stromaufwärts an ihm zu wandern, vorziehen werden, von Neuburg aus die Augsburger Straße einzuschlagen.
Unterhalb des Klosters Niederschönenfeld (das ein Kruzifix besaß, von dem das Volk glaubte, dem Bild des Heilands wachse der Bart, und das im Schwedenkrieg Blut geschwitzt haben soll) und Marxheims zersplittert sich der Strom in mehrere Arme, die kleine Inseln umspannen; wir erblicken, unsere Fahrt fortsetzend, auf mäßigen Höhen Staudheim, Burgheim und Straß und gegenüber die reizenden Dörfer Bertoldsheim und Stepperg.
Immer näher rücken die Bergeshänge an die Ufer heran, immer rascher treibt uns der Strom, ragende Felsstücke umbrausend, jetzt nach Neuburg. Wir landen am rechten Ufer unter den Inseln und wandern nach Oberhausen, um das Denkmal des ersten Grenadiers Frankreichs, Latour d'Auvergnes, zu besehen, der hier am 27. Juni 1800 fiel; dann ziehen wir die Rainer Straße an den Trümmern der zwei alten Römerburgen vorüber und nach der alten Stadt der Pfälzer Fürsten, die von ihrem Hügel so stattlich auf den Strom herabblickt und auf die gegenüberliegenden Höhen mit ihrem frischen, saftigen Waldesgrün, wie sie sich neugierigen Mädchen gleich hintereinander erheben, als wolle die hintere über die Schultern der vorderen sehen, mit ihren freundlichen Dörfern. Überall findet das Auge hier anmutige und effektvolle Kontraste von Werken der Menschenhand und der ewig jungen Natur; Kontraste, welche das Gemüt so gern versöhnt, weil ihm selbst in Versöhnung Beruhigung wird.
Eine herrliche Aussicht bietet sich vom Herzogsgarten aus; ein noch schönerer Überblick vom Schiff inmitten der Donau. Über der unteren Vorstadt, die sich in den Fluten spiegelt, tritt auf dem Berg der Schloßbau mit seinen stattlichen Giebeln hervor, die ehemalige Jesuitenkirche, das Jesuitencollegium mit seiner langen Fassade und das Rathaus stellen sich wie eine Fortsetzung des Schlosses dar und vereinigen sich mit demselben zu einer großartigen und doch an Nuancen reichen Masse; die Peterskirche schließt rechts die Höhe der Stadt ab, und darunter zeigt sich das Kruzifix auf dem Nachtberg, einem aus der Donau emporragenden Felsen.
Schon unter Karl dem Großen wird Neuburg erwähnt. Welser erzählt von einem Bischof Mannus, der damals in Neuburg gewaltet habe. Bevor die Stadt den Bayernfürsten zufiel, soll sie der Pappenheimer Eigen gewesen sein. Hier war's, wo Ludwig der Buckel seinen greisen Vater Ludwig im Bart belagerte und gefangennahm; nicht lange überlebte er die Untat. Kaiser Maximilian I. schuf, nachdem er 1505 Neuburg in Besitz genommen hatte, ein eigenes Fürstentum, dessen Lehen er den beiden Söhnen Ruprechts des Tugendhaften, Otto Heinrich und Philipp, übergab; 1742 erlosch die Neuburger Linie mit Karl Philipp, der die kurfürstliche Residenz von Heidelberg nach Mannheim versetzt hatte.; der erstere baute 1539 das alte Schloß und das Lustschloß Grünau, eine Stunde stromabwärts von der Stadt; Karl V. berannte und eroberte im Schmalkaldischen Krieg 1545 die Stadt, ließ sie aber nach dem Passauer Vertrag dem Pfalzgrafen Otto Heinrich wieder. – Im Dreißigjährigen Krieg fiel Neuburg in Gustav Adolfs, dann in der Kaiserlichen, dann in des Herzogs von Weimar und zuletzt in der Bayern Gewalt; im Spanischen Erbfolgekrieg verlor Max Emanuel sie nach der Schlacht bei Höchstädt an die Kaiserlichen.
Das alte Schloß bewahrt ein Andenken an Otto Heinrichs Fahrt ins Gelobte Land (von der heimgekehrt, er sich zu der Lehre Luthers bekannte) – kunstreich gewirkte Tapeten mit der Darstellung jener Fahrt, dann Fürstenbilder und Waffen. Wolfgang Wilhelm, der 1614 in den Schoß der Mutterkirche zurückkehrte, räumte das von Kaiser Heinrich dem Heiligen und Kundigunde 1007 gestiftete, von Otto Heinrich 1542 säkularisierte Nonnenkloster im Jahre 1618 den Jesuiten; Jacob Baldes Name lieh ihrem Kollegium Glanz; die Kirche durfte sich des Gnadenbildes »Maria von Foya« rühmen und bewahrte die irdischen Reste mehrerer Fürsten aus dem pfalzneuburgischen Hause. In der Pfarrkirche der oberen Stadt sah jener gottbegeisterte Prediger Marcus Avianus, der die Befreier Wiens auf dem Kahlenberg zur Schlacht des Entsatzes weihte, einst ein Muttergottesbild unbeachtet in einem Winkel, das ihn mit tränenfeuchten Augen flehend anblickte; als es mit Ehrfurcht hervorgeholt und nach damaliger Sitte mit prächtigen Kleidern angetan und auf den Altar erhoben worden war, wirkte es Wunder und hieß seitdem das »Gnadenauge«. Außer dem Jesuitenkollegium blühten in Neuburg die Klöster der Karmeliterinnen, der Ursulinerinnen, der Franziskaner, der Barmherzigen Brüder.
Wir verlassen jetzt Neuburg und unterbrechen die Donaufahrt, um das Flußgebiet des Lechs stromaufwärts zu verfolgen; Augsburg, Füssen und das herrliche Alpenschloß Hohenschwangau sind Rast und Ziel unseres Abstechers.
Diese unabsehbar vor euch hingebreitete Heide ist das Lechfeld; öd und unfruchtbar nennt ihr es, und doch trug es einst dem deutschen Volk so reiche Frucht der Ehren, als der Ungarn Blut wie ein sturmgepeitschter See an den Höhen brandete, die es im weiten Kreis umgeben. Ist die Erinnerung an unserer Väter Kraft und Begeisterung heute schon unnütz geworden, da wir bloß an das schönere Morgen denken, das wir nicht bloß durch Hoffen und Harren verdienen wollen, sondern auch durch Geisteskampf? So laßt die Geister derer mit uns fechten, die für die Freiheit des Vaterlands, für dessen Gesittung tapfer kämpfend fielen. Oh, noch bedürfen wir der Geschichte, von der die Feinde ihre Waffen zu erhalten vorgeben, die sie dem Fortschritt entgegenhalten wollen. Fassen wir nicht bloß ihren heiligen spiegelblanken Schild, daß die Feinde ihr Antlitz drin schauen und vor Scham sich verhüllend in die dunklen Verstecke zurückweichen; fassen wir auch ihre Angriffswaffen und rüsten wir das heranwachsende Geschlecht in der Wahrheit, daß es frühzeitig jede Täuschung, und komme sie in noch so ehrwürdigem Gewand, erkennen und niedertreten lerne. Die Summe unseres eigenen Tuns ist leider meist nur ein Widerstreben gegen Rückwälzung, gegen Anbetung der Mumien, die uns als ewige und heilige Notwendigkeit über die Häupter gesetzt werden soll. Vor dem Sturmesodem der Geschichte aber hält der Staub nicht zusammen; in allen Entwicklungen der Vergangenheit den Fortschritt der Menschheit erkennend, würden wir uns nicht selbst zu Toren bekennen, wenn wir, den Stillstand duldend, stillstehen wollten?
Lechfeld, Augsburg, Hohenschwangau! Welche Erinnerungen leuchten über diesen Stätten! – Über dem ersten die Idee des Volksfreiheitskampfes, über der zweiten der Geist des freien deutschen Bürgertums, über der dritten die Weihe unserer ganzen deutschen Geschichte!
Seht hin! Wimmelt das Lechfeld nicht abermals von den Schwärmen der Barbaren? Sie entwinden vorm Auge des Geistes sich der Dämmerung, aus den ungeheuren Gruben raffen sie sich empor. Von allen Seiten her flüchten Tausende von wehrlosen Christen vor ihnen nach Augsburg, wo der mutige Bischof Ulrich die Mauern durch Wälle begeisterter Männer verstärkt, die verzagenden Weiber tröstet, die Kinder in die Kirche trägt und vor dem Altar dem ewigen Schirmherrn, dem starken Gott Freiheit befiehlt; nicht lange zu beten hat er Zeit, die Schlacht ruft ihn hinaus, König Otto ist nah, näher sind die Heiden der alten Römerstadt, ihre windschnellen Rosse trinken zu beiden Ufern die Fluten des Lech und der Wertach; schon gleißen ihre Waffen im Sonnenschein dicht vor den Wällen, schon hören, die drauf zur Verteidigung stehen, wie die Bogen der Feinde beim Spannen dröhnen, wie diese hinaufschielen und -zielen. Hilfe in der Not. König Otto ist da mit den Deutschen.
Da weichen die Ungarn von den Toren und rücken am rechten Ufer des Lechs aufs unabsehbare Feld, sieggewohnt in Siegesahnung laut aufheulend, daß ihr Geschrei bis nach Augsburg hineinschallt. Gottergeben entrollen indessen die Deutschen die Schlachtordnung; Konrad von Franken zieht voran, dann folgt Eberhard von Ebersberg mit den Bayern, dann der König selbst, die heilige Lanze in der Faust, mit seinen gewaltigen Sachsen, dann Burckhard mit den Schwaben, hinter allen Boleslav mit den Böhmen; so wandelt die Heeresmacht todesmutig dahin, und alsbald begrüßt sie der Augsburger Scharen, die Bischof Ulrich und sein Bruder Theobald zum heiligen Kampf herausgeführt haben, nicht die Ritter allein, auch das Volk, das kräftig im Gefühl seiner jungen Selbständigkeit mit den alten Geschlechtern wetteifert, die Weber voran, die es gelüstet, ein blutiges Gewebe zu wirken, das große Leichenhemd der Tyrannei.
Nicht lange erträgt der Ungarn heißes Blut den Anblick der Deutschen, wie diese so stark und fest, als wären sie wie aus Eisen aneinandergewachsen, dastehen, den Angriff erwartend; den Barbaren gilt diese Ruhe für Feigheit oder Hohn, sie streifen von allen Seiten an die gewaltig geschlossene Masse, prallen an, weichen zurück, locken zum Einzelkampf. Jetzt stürzten sie ergrimmt plötzlich mit wildem Schlachtgeheul auf die Böhmen, brechen ein in die Reihen, wühlen würgend sich durch deren Lücken bis in die Schlachthaufen der Schwaben hinein. Der König gewahrt mit Sorge die Not im Rücken des Heeres, mit Freuden der Schwaben heldenhaften Widerstand. Zur Stelle sendet er Konrad von Franken zu ihrem Schutz und führt seine Sachsen gegen den Feind, wo dieser keinen Angriff erwartet; die Bayern hinterdrein.
Da zerreißen der Ungarn Geschwader, hier drängen sich die zerhackten Glieder ihrer Haufen zusammen, dort jagen andere zur Flucht. Der König rastet nicht und benützt das Glück. Immer enger drückt er sie in die eisernen Arme seiner Schlachtreihen; wie ein Rudel gehetzter Stiere treibt er sie jetzt zur Tränke in den Lech. Des Königs Vorbild begeistert die andern Heerführer; hier sind nicht Schwaben noch Bayern, nicht Sachsen noch Franken mehr – Deutsche sind endlich alle, rächen des Vaterlands Schmach, retten des Vaterlands Namen, des Vaterlands Existenz. Da schirmen die Bischöfe ihre Herden mit dem Schwert und bluten freudig für sie, Ulrich vor allen, und Michael von Regensburg und Starchant von Eichstätt. Wohl sinkt Ulrichs Bruder, und Konrad von Franken fällt. Die Völker aber entmutigt der Tod der Fürsten nicht; die Weber wirken fleißig am Leichentuch; schon werfen sie es übers weite Feld, mancher flüchtige Heide blickt auf, sieht's dicht überm Scheitel, da fällt es über ihn; und manchen erreicht es noch, der schon aufatmend, ihm entronnen zu sein, weitab vom Getümmel sein Roß verschnaufen läßt. Es ist vollbracht. Wen der Deutsche selbst nicht jagt, scheucht der Schrecken vor den Deutschen in die ferne Heimat zurück. –
Der Morgen graut; wir stehen vor Augsburg. Stattlich schimmern die Türme im Frührot, ein eigentümliches Gefühl von Wohlbehagen überkommt uns, da wir zum Tor hineinwandern und auf diesen starkgefügten Mauern, auf allen Gebäuden wie auf den Plätzen und in den Straßen das Gepräge der Tüchtigkeit, der Ordnung und Einigkeit, des Werkfleißes und des Handels, des edlen Bürgerstolzes erkennen. Und doch sind es nur die Reste der alten reichsstädtischen Pracht und Herrlichkeit, die einen so mächtigen Eindruck in uns hervorbringen. Noch immer ist es hier ein lebendiger Typus, der in vollen runden Formen aus dem Hintergrund verblichener Zustände hervortritt, und das Vergangene erscheint uns hier darum so frisch, als wäre es von heute, weil in Augsburg vor den meisten anderen freien Reichsstädten das deutsche Bürgertum nicht bloß sich am reichsten und am üppigsten nach allen Seiten hin entfaltete, sondern auch, auf der Höhe eines universellen Bewußtseins, im Mittelpunkt eines großartigen Weltverkehrs stehend, alle jene Keime des Philistertums ausschied, welche in anderen Gemeinwesen die historische Entwicklung der deutschen Nationalität und ihre Annäherung zur Humanität erstickten; der Fluch der Lächerlichkeit, dem die meisten reichsstädtischen Gemeinwesen mit Recht erlagen, hatte von jeher nirgendwo anders seine Wurzel als darin, daß der Staat sich nach dem Muster einer Familienwirtschaft gegen außen zu abschloß; die ursprüngliche Naivität eines solchen Verhältnisses mußte, auf Größere übergegangen, zur Pedanterie, zur Krähwinkelei werden und in der weiteren Folge selbst nach innen zu zerstörend wirken.
Augsburg wurde durch seine Lage und durch seinen Handel, welchen beiden es das Glück verdankte, daß die Wellenschläge der Geschichte es erreichten, ohne daß bis zur Reformation deren Strömung es fortriß, vor jenem Los bewahrt; der Reichtum der Geschlechter fand an dem Gewerbefleiß des Volkes ein heilsames Gegengewicht, der glänzende Hofhalt des Bischofs vermittelte trotz allen Reibungen zwischen beiden, und anderseits schützte das durch Geldmacht, persönliche Entschiedenheit und gelehrten Ruhm der ersten immer frisch erhaltene Ansehen des Gemeinwesens vor den Anmaßungen der Geistlichkeit; die Sinnlichkeit verwuchs wie zu Nürnberg in die Liebe zur Kunst, die sich wieder aus dem veredelten Gewerbefleiß entwickelt hatte und dessen Erzeugnisse veredelte. Und so begegnen wir hier überall einem erfreulichen Ineinandergreifen der verschiedenartigsten Elemente zum Gedeihen eines tüchtigen Ganzen, und wenn man Augsburg nicht ganz ohne Grund mit Venedig vergleichen wollte, so wird man wenigstens eingestehen müssen, daß das erstere auch nach Verlust seiner Selbständigkeit deshalb noch immer blüht, während Venedigs Blüte für immer gebrochen ist, weil das erstere – bei ähnlichen Gründen des Emporkommens – auf der sicheren Basis einer bürgerlichen Ordnung stand, während Venedig jahrhundertelang an Tyrannei verfaulte, wenn auch seine Flaggen noch auf allen Meeren wehten. Den Umschwung des Handels durch die neuentdeckten Wege empfand Augsburg mit und durch Venedig. Venedigs Geschichte, die unsere Nachbarn jenseits des Rheins so gern zu einem Melodrama machten, ist eine Macbethtragödie; das Unglück Venedigs kann mit allen Fluten des Meeresgottes die Flecken seiner Schuld nicht tilgen; Augsburgs Geschicke rollen in breiten Wellenmassen wie in einem Epos ab, in dessen Mitte der Pharus des freien deutschen Bürgertums ragt.
Als blühende Römerstadt Augusta Vindelicorum zeigt sich Augsburg zuerst. Schon im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt wurde die Lehre des Welterlösers eingepflanzt; die Sage spricht von einem britischen Fürsten Lucius, der jene in Rätien und Augusta Vindelicorum zuerst verkündigt habe; unter Chlorus besiegelte die schöne Afra, von Narzissus bekehrt, mit ihrer Mutter Hilaria den Glauben mit dem Martertod. Bald vermehrte sich die Zahl der Bekenner; bald hatte das Christentum die germanische Natur durchdrungen und sich mit ihr zu einem geschichtlichen Charakter innigst verbunden.
Die Sage läßt auch Attila vor Augsburg erscheinen. Bechstein erwähnt sie in folgender Kanzone seiner Verherrlichung Luthers:
Gen Augsburg zog einst, wie die Sage kündet,
Die Geißel Gottes mit des Heeres Wolke,
Die das Verderben brüderlich begleitet,
Ein fürchterliches Schrecknis allem Volke;
Da flammen Städt' und Dörfer, glutentzündet,
Und Angst und Todesnot sind rings verbreitet.
Der Hunnenkönig reitet
Dem Heer voran zum Lech, die Stadt zu stürmen,
Da sieht er rauschend aus den Tiefen steigen
Ein Riesenweib, das ruft: »Zurück! Nicht weiter!«
Drauf hoch und höher sich die Fluten türmen,
Und eilend lenkt sein Roß in tiefem Schweigen
Weit, weit von Augsburg weg der düstre Reiter.
Augsburg erscheint im Verfall der römischen Herrschaft zuerst als allemannische, dann nach Odoakers Sturz durch Theoderich als ostgotische Stadt. Im sechsten Jahrhundert ist sie bereits der Sitz eines Bischofs, dessen Sprengel über Rätien hinaus ins alte Norikum reicht. Im achten Jahrhundert steht Karls des Großen Heeresmacht wider Tassilo, den abtrünnigen Bayernherzog, vor Augsburg im Lechfeld. Im zehnten rauschen die Wogen der Ungarnschlacht über das Lechfeld hin; nach dem Sieg erbaute Ulrich die uralte, schon öfter zerstörte Kapelle der heiligen Afra aus dem Schutt, die Johanniskirche und ein Nonnenkloster bei der Stephanskirche. Die Pfalz auf dem Fronhof erhob sich im elften Jahrhundert; da wurde auch die Kirche der heiligen Afra hergestellt und erweitert, das Stift auf dem Perlach gegründet.
In den Zwisten zwischen Kaiser und Papst, da der erste die Alleinherrschaft herzustellen, des Reiches Fürstenschaft aber die oberste Gewalt mit ihm zu teilen trachtete, erstürmte Welf, der Bayernherzog, aus Haß gegen Heinrich IV. und den Bischof Siegfried, der dessen Partei hielt, Augsburg und führte den geistlichen Hirten in Ketten nach Ravensburg. Aber in den schweren Drängnissen entwickelte sich unbemerkt die Freiheit des Gemeinwesens; ein Band um das andere fiel, wodurch dies an das Ansehen und die Macht des Bischofs gehalten gewesen war, und die Geschlechter begannen sich zu fühlen und gegen Reichsvogt und Stadtvogt die Häupter zu heben. Langsam und sicher gestaltete sich das neue magistratische Wesen aus unscheinbaren Elementen; die Wichtigkeit des Amtes der Stadtpfleger machte sich geltend, dem Landvogt blieb kaum der Blutbann. Allmählich wuchs der Ratsmänner Zahl aufs Doppelte, und daß keinen die Gewohnheit zur Lust der Herrschaft verleite, wurde das jährliche Ausscheiden der Hälfte mit neuer Ersatzwahl verordnet.
1276 gab Rudolf von Habsburg der Stadt Augsburg das Stadtbuch und entband die Güter der Bürger und des Gemeinwesens von Vogtei und Bischofsdienst. Emsig wurde auf dieser guten Grundfeste fortgebaut, und zusehends mehrten sich unter dem Einfluß der Freiheit Handel, Gewerbe und Wohlstand; im Bewußtsein des Fleißes und der Kraft aber wuchs auch der Bürgerstolz den Geschlechtern gegenüber, bis jener endlich 1368 sich Anteil der Herrschaft und dadurch dem Gemeinwesen die Blüte der Freiheit errang, welche das Zunftwesen als schützende Stacheln umschanzte. Nach innen und außen wirkte der Segen der Freiheit; durch das ganze deutsche Reich bis Welschland und in die Niederlande galt der Augsburger Ansehen, nach allen Küsten wurde ihr Gut befrachtet, und die Geschlechter mochten es stolz mit den Fürsten aufnehmen. Kunst und Gelehrsamkeit standen in voller Pracht.
Um so eifersüchtiger wurde die teure Freiheit bewacht, und Ulrich Schwartz, der Bürgermeister, büßte (1478) am Galgen seine hochfahrenden Herrschaftsgedanken.
Die Schwartzin zu Irem herren sprach:
»Ir sollene Morgen daheim bleiben,
mir het getraumbt ein schwerer traumb,
man werd euch morgen fachen.«
»So schweig, so schweig, mein Fräuellein,
bist du Kaiserin, so will ich Kaiser sein,
sie dörffen mir nichts than
den Gewalt will ich Iber sie han.«
So läßt das Volkslied den Bürgermeister in Zwiesprache zu seiner Hausfrau reden. Der Bürger Reichtum entfaltete sich damals in solch stattlicher Pracht und Üppigkeit, daß der Rat in kluger Vorsicht, wie leicht der Sinn für Freiheit in Üppigkeit erschlaffe, strenge Gesetze gegen diese erlassen mußte; und ebenso streng handhabte er Gerechtigkeit gegen jedes Vergehen der Geistlichen, die Sittlichkeit aufrechtzuerhalten.
Es ist charakteristisch für jene Zeit, wie der Kaiser Maximilian bei seiner Anwesenheit zu Augsburg am St.-Johannis-Abend auf dem Fronhof ein Zimtfeuer machen ließ, »dabei war zechen Fuoder Thennenholz und waren die Scheitter fein in einander geflochten, dass es unten neun Klaffter weit wass, und an der Höhe 95 Zoll. Da liess Herzog Philipps laden alle burgerin und sonst auch schön Leut, da kamen zu luogen ob zechen tausent Menschen. Umb Ave Maria Zeit da nahm Herzog Philipp ein Jungkfrau an die Handt, die war von Ulm, hiess Ursula Neithartin, und andere Herren und Edelleut, nahm jeglicher ein Frauin oder Junckfrauin an die Handt und giengen zum Holtzhauffen, da gab Herzog Philipp seiner Junckfrauin ein brinnend windlicht in die Handt, die muoss dass Feuer anzündten, darnach danzten sie dreimall umb dass Feur herumb.« Bei einem anderen Tanz bat der Kaiser die Frauen Augsburgs, sie möchten »die [entstellenden] stirtz und hohen Schleyer, Ir. Maj. zu Ehren und Gefallen abthuen«.
Ein Gegenstück dazu ist das kostbare Feuer, das der Fugger Kaiser Karl V. anzündete.
Im Zwielicht war's, am Feuer saß
Der Kaiser, hub sein Venedigerglas
Voll Heiltranks an die Lippen;
Von Drangsal ist das Herz ihm schwer,
Das Fieber schüttelt ihn gar sehr;
Vergeußt den Trank beim Nippen.
Das Feu'r, kostbar, von Würz' und Zimt,
Ist ausgebrannt, die Kohl' verglimmt,
Der Kaiser vergaß zu schüren.
Vor ihm der Weber von Augsburg stand,
Den dauert's, als die Glut verbrannt,
Nun sollt' der Kaiser frieren!
Und aus dem Ärmel schlicht und schlecht
Viel Briefe zieht er, all gerecht,
Und legt sie auf die Kohlen,
Und bläst mit Macht, bis daß die Glut
Frisch knistert, wie voll Lebensmut,
Und lächelt dann verstohlen.
Die Briefe brennen lichterloh,
Der Fugger spricht so frei und froh
Als trüg' er des Kaisers Kronen:
»O kaiserliche Majestät,
Was meinst du, daß hier brennen tät?
Da brennen zwei Millionen.
Mit deiner Gunst verwand ich's mich;
Die Briefe dein, sie brannten dich,
Nun geben sie hellen Schimmer!«
Der Kaiser baß gewärmt, versetzt:
»Kein schöner Feu'r sah ich bis jetzt,
Mich dünkt: mich friert's gar nimmer!«
Das war die Zeit, da die Fuggerei, Ulrich Georg und Jakob Fugger erbauten 1520 in der Jakobsvorstadt 106 kleine Häuser, worin die Ärmeren für geringe Einlage Wohnungen angewiesen bekamen. eine Stadt in der Stadt, entstand und die Lustgärten der Fugger ein Weltwunder hießen, da die Welser eine Kriegsflotte nach Venezuela schicken mochten, das ihnen verpfändete Land zu erobern. Da wuchsen die mächtigen Bauten, Denkmäler des Reichtums, Bürgerstolzes und Geschmacks: der Luginsland, das neue Tanzhaus, die Ulrichskirche, das Gießhaus, das Zeughaus, das Kornhaus und viele andere. Jene beiden berühmten Geschlechter und die Peutinger, die Hainzel schirmten, den Medicäern nicht weichend, die Künste, ermunterten die Talente (die Fugger luden Tizian nach Augsburg und verehrten ihm für seine Kunst 3000 Kronen); und dieses Beispiel wirkte bis in die spätesten Zeiten, als Augsburgs Macht immer tiefer sank, noch mächtig nach. Die Bücherschätze des Domkapitels, der Kirche zu St. Ulrich und St. Afra, der Dominikaner, des gelehrten Konrad Peutinger, der Fugger waren so berühmt wie die Gemälde in der Amtsstube des Weberhauses und die Hans Holbeins des Älteren, Hans Burgmaiers, Christoph Ambergers.
Die Reformation entzündete in den Gemütern ein neues Streben; das derbe praktische Bürgertum strebte aus der Sicherheit des Besitzes heraus; die faktische Freiheit genügte nicht mehr, es drängte sich, von der Ahnung einer künftigen allgemeinen Weltbefreiung hingetrieben, nach der Feststellung der christlichen hin, und die bürgerliche Ordnung erweiterte sich zur moralischen. Luthers Kampf gegen Kardinal Thomas Vio gab den Impuls; die Herzen der Edelsten schlossen sich dem kühnen Glaubenshersteller auf. Der Langenmantel rettete Luther nach Hohenschwangau.
»Wer klopft so spät in stiller Nacht?«
Des Hauses Hüter sind aufgewacht,
Von Freiberg die beiden wackeren Degen,
Bekannt als gastlich allerwegen.
Sie treten rasch an des Schlößleins Tor:
»Sagt an, ihr draußen, wer steht davor?«
»Ein langer Mantel bringt eine Kapuz',
Bei guten Harnischen sucht sie Schutz.
Ihr zween Freiberger, wollt ihr sie leiden?
Etliche wollten die Kapuz' zerschneiden,
Etliche Motten, wären s' noch so klein,
Hätten sich gern genistet hinein.«
»Und ist's ein langer Mantel, den kennen wir gut.
Langmantel! komm in der Freiberger Hut.
Und steckt in der Kapuz' ein frommer Scheitel,
Wollen ihn schirmen; dies Wort ist nicht eitel;
Ob uns ein Glatzkopf auch sonst nicht behagt,
Kommt nur herein, nicht weiter befragt.«
»Ihr zween Freiberger, da sind wir beid',
Der Langmantel und das Ordenskleid.
Schaut: Ein Mönch kann ein Schwert auch führen,
Und geht doch heimlich anjetzt terminieren.
Sein Schwert ist die Wahrheit; drum mußt' er fort;
Er geht terminieren mit Gottes Wort!
Ihr zween Freiberger, das ist der Mann,
Der sagt: Gottes Wort, das lasset nur stahn.
Von Augsburg sind wir heimlich entritten,
Gott half ihm aus der Meuchler Mitten,
Die Kraft des Herrn ward ihm als Stab,
Und ein Engel wies ihm: Da hinab!
Nun werden sie ihn suchen gar bald,
Die Großen, die Kleinen und jung und alt,
Die Dicken, die Dünnen, die Schreier, die Heisern,
Mit Worten von Wachs und mit Werken gar eisern,
Und werden's aussprengen zu jedermanns Graus:
Da hinab half ihm der – Teufel hinaus.«
»Den Teufel«, spricht der Mönch, »fürcht' ich nit,
Von dem Wort Gottes lass' ich nit,
Ob sie schrauben, martern und plagen,
Bis ans End' werd' ich die Wahrheit sagen.
Helf Gott mir; ich kann nicht anders, Amen!
Martinus Luther heiß' ich mit Namen.«
Und als der Mann Gottes, unbefragt,
Zu den zween Freibergern dies Wort gesagt,
Da sind sie voll Freuden hochauf gesprungen
Und haben ihn als deutsche Männer umschlungen;
»Kehrt solch ein teurer Gast uns ein,
Soll ein deutsches Herz ein Lagerstell sein.«
Am 25. Juni 1530 wurde auf dem Reichstag das Glaubensbekenntnis, das Melanchthon verfaßt hatte, im Bischofshof übergeben. Mit unglaublicher Schnelligkeit verbreitete sich in Augsburg die Reformation; der Trotz gegen den Bischof, mit dem oft und lange Irrungen stattgefunden hatten, spornte den Eifer des Rates noch mehr, dessen meiste Mitglieder der neuen Lehre anhingen; die Brüder mehrerer geistlicher Orden wanderten aus, mehrere Kirchen wurden der Bilder beraubt und dem neuen Gottesdienst eingeräumt; und 1536 schloß Augsburg sich dem Schmalkaldischen Bund an.
Nach dem Unglück der protestantischen Fürsten bei Mühlberg (24. April 1547) drohte die Rache des siegreichen Kaisers, der für deutsche Freiheit kein Herz hatte, der preisgegebenen Stadt; die Fugger und die Peutinger baten zu Ulm um Gnade; um den Preis von 150000 Gulden, den Verlust von 12 Geschützen und gegen das Versprechen, jeder ferneren Verbindung abzusagen, wurde sie gewährt; und an der Spitze eines kaiserlichen Heeres und von den ausgewanderten Geistlichen gefolgt kehrte der Bischof wieder in die Stadt. Der Kaiser aber gab jenes in vielen Liedern verhöhnte Interim und stieß am 3. August 1548 die Verfassung um, durch die Augsburg bisher frei, groß und glücklich gewesen war, der Adel empfing statt des Volkes die Herrschaft, 31 aus den Geschlechtern, drei von der Gesellschaft und sieben aus der Gemeinde bildeten nun den Rat mit zwei Stadtpflegern und sechs Bürgermeistern (die ersten wie die letzteren aus den Geschlechtern), von denen jedesmal zwei drei Monate lang walten, das heißt mit Genehmigung der Stadtpfleger die Versammlung berufen durften. Zwar stellte Moritz von Sachsen, als er wider den Kaiser zog, am 6. April 1551 die alte Freiheit und den neuen Gottesdienst wieder her; aber die Freude darüber währte nur kurze Zeit. Am 25. August 1552 stand Karl V. in Augsburg und vernichtete das Werk des kühnen Moritz, der ihm den Passauer Vertrag abgenötigt hatte.
Das Unglück aber vermochte den Gemeinsinn nicht zu erschüttern, und wenn auch die einstige Blüte des Handels gebrochen war, so wandte sich dafür die Kraft des Gemeinwesens um so eifriger nach innen zu, die alte Würde aufrechtzuerhalten. Bis zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges entstanden jene massiven und imposanten Bauten, die uns noch heute Achtung vor dem Geist, der damals waltete, abgewinnen.
Elias Holl, ein Augsburger, in Venedig gebildet, schuf die meisten jener Bauten: das Zeughaus, das Siegelhaus und das vielbewunderte Rathaus. – »Er machte den Vorschlag«, berichtet Paul von Stetten d. J., »Kunst-, Gewerb- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg«, 1779. »das Rathaus, welches auf einer Seite baufällig war, abtragen und ein neues erbauen zu lassen. Mit verschiedenen Rissen und Modellen war er bald gefaßt, denn seine Ehrliebe trieb ihn ungemein zu diesem Werk. Es war auch bald einer ausgesucht, und er trieb unaufhörlich an der Vollziehung. Das Schlagwerk, welches auf dem Rathaus stand und welches man sonst nirgends unterzubringen wußte, war ein Anstand, den er heben mußte. Er besichtigte den Perlachturm und fand ihn geschickt dazu. Es hatte zwar nicht geringe Schwierigkeiten. Er mußte um 20 Schuh erhöht werden, und das Hinaufbringen schwerer Glocken hatte große Bedenklichkeiten. Holl aber wußte alle zu überwinden. Er erfand ein ungemein künstliches Gerüst, ohne daß ein Loch in die Mauer des Turms gebrochen werden durfte. Durch Hilfe der von ihm erfundenen Zugwerke brachte er die Glocken, den Knopf und das Bild der Cisa als einen Wetterhahn hinauf, und nachdem der Turm durch acht Maurer, die er allein zu diesem Bau gebrauchte, verworfen worden war, vollendete er dieses Werk mit allgemeinem Beifall. Dafür wurden ihm 300 Goldgulden verehrt. Während dieser Zeit wurden schon an dem alten Rathaus abgebrochen und zur Erbauung des neuen der Grund gelegt und gute Anstalt vorgekehrt. In 5 Jahren wurde er mit Haupt- und Nebengebäuden fertig und erhielt dafür vom Rat eine Verehrung von einem schönen vergoldeten Becher mit einem Deckel, darin der Stadt Wappen war, und 200 Goldgulden.«
Der Rat ließ, daß die innere Einrichtung des Gebäudes dem Eindruck von Pracht und Würde entspreche, den die Struktur anregt, alle Zimmer durch damals lebende Maler (Matthäus Kager, Joh. König, Matthäus Gundelach, Rottenhammer und Melchior Roos) mit historischen, biblischen und allegorischen Darstellungen kunstreich verzieren; am reichsten den sogenannten Goldenen Saal, der 110 Fuß in der Länge und 52 in der Höhe mißt und 52 Fenster hat; die Seitenwände mit Bildern von Kaisern, berühmten Frauen und Arabesken; die Decken mit allegorischen Darstellungen, sämtlich durch Matthäus Kager.
Aus jener Zeit stammen auch die öffentlichen Brunnen mit ihren Statuen; die Metallbilder des 1593/94 erbauten, 1672 und 1749 restaurierten Brunnens auf dem Perlachberg (Augustus usw.) sind ein Werk des Niederländers Hubert Gerhard, die Gruppe Merkurs und Kupidos, die Herkulesgruppe (nebst den Basreliefs am Herkulesbrunnen) schuf Adrian de Vries von Gravenhaag (1599 und 1602), die Statue auf dem Neptunbrunnen goß der Glockengießer Wolfgang Neidthardt. Um dieselbe Zeit ließ der Rat durch Joh. Reichel von Rain das Portal des Zeughauses mit der kolossalen Gruppe »Des Krieges Überwindung durch den Frieden« schmücken.
Das Unheil des Dreißigjährigen Krieges hatte Augsburg in vollem Maße zu empfinden. Gustav Adolf besetzte nach Tillys Tod (5. April 1632) die Stadt und zog als Sieger und Befreier der Protestanten ein, die Frauen trugen sein Bild in Gold als höchsten Schmuck. Zwei Jahre später, als die Schlacht bei Nördlingen geschlagen war, mußte Augsburg diesen Jubel furchtbar büßen. Der schwedische Kommandant Hans Georg aus dem Winkel verteidigte die Stadt gegen das Heer des Kurfürsten, das unter Oberst Wahl sie sieben Monate hindurch blockierte, bis die gräßlichste Hungersnot innerhalb der Mauern wütete. »Man schoß den Vogel aus der Luft, welcher zur Stadt flog. Bauern, welche heimlich Lebensmittel einbringen wollten, wurden an den nächsten Baum gehenkt; Kindern Nasen und Ohren abgeschnitten. Als drinnen alle gewöhnliche Nahrung verzehrt war, verkaufte man auf öffentlichen Fleischbänken Fleisch von Pferden, Hunden, Katzen. Den Armen wurde auch dies zu köstlich; sie kochten Leder, speisten Ratten und Mäuse. Der wütende Reiz des Hungers vertilgte zuletzt den Schauder vor faulendem Aas, und die Gier verschmähte das Fleisch menschlicher Leichname nicht. Es wandelten lebendige Gerippe in verblichener Menschengestalt auf den Gassen und priesen das Glück der Toten. Manchen Tag starben 100 und mehr jedes Alters. Die unbegrabenen Leichen in Häusern und Straßen verpesteten die Luft. Unbeklagt starb der Vater unter verschmachteten Kindern, und die Mutter legte ohne Träne den verhungerten Säugling von der Brust in die Erde.« Zschokke, »Bayrische Geschichte«, Bd. 6 Am 18. März 1635 endlich ergab sich die Stadt, und den Einzug der Sieger bezeichneten die Ausschweifungen des Fanatismus; das Gericht, das danach erging, verzehrte rasch wie eine Feuersbrunst die Reichtümer, erstickte den Handel und die Gewerbetätigkeit. 1646 bombardierte Wrangel Augsburg, das von Oberst Royer verteidigt wurde, 19 Tage lang ohne Erfolg.
Als nach dreißig Jahren des Mordes und der Verwüstung endlich Friede geschlossen wurde, hatte Augsburg, dessen Bevölkerung vor dem Beginn des Krieges sich auf 80000 Seelen belief, kaum noch 30000; zwar wurde die Ratswahl den Genossen des alten wie des neuen Glaubens zu gleichen Teilen zugestanden; aber die alte Eintracht, den alten Gemeinsinn, den alten Wohlstand vermochte diese Vergünstigung nicht wiederzubeleben.
Der Spanische Erbfolgekrieg gab zu den Greueln des Dreißigjährigen Krieges ein blutiges Nachspiel; Roheit und Entartung erstiegen den Gipfel, die Zeit der Ungarneinfälle schien wiedergekehrt; denn das Schlimmste war eingetroffen: die Deutschen kannten sich nicht mehr. Wie konnten da die Wunden vernarben, welche Augsburg im Schwedenkrieg empfangen hatte? Und dennoch – so mächtig wirkte der Gedanke an die einstige Größe, Bedeutung und Würde noch fort – erhob es sich langsam, aber sicher wieder und wandte die ganze Kraft auf den Gewerbefleiß, da der Welthandel ihm für immer verloren war; so viel deutscher Grundstoff lag noch unverwüstet in diesem Gemeinwesen, daß es mutig seine Geschichte gleichsam von vorne aufs neue zu beginnen hoffte und im rüstigen Streben nicht ermüdete. Infolge des Friedens zu Preßburg(26. Dezember 1805) erlosch Augsburgs Unabhängigkeit, und es erkannte Bayerns Oberhoheit an. Fort und fort strebte es seither in jenem Geist, seine Industrie blüht wieder, und ehrenwert wetteifert es mit den deutschen Städten gleichen Ranges.
Nun bleibt uns nur noch übrig, die Kirchen Ein gewissenhaftes Verzeichnis aller in Augsburgs Kirchen vorhanden gewesenen Kunstwerke findet sich in Paul von Stettens »Beschreibung der Reichsstadt Augsburg«. flüchtig zu Überblicken. Der katholische Dom interessiert den Altertumsfreund vornehmlich durch die uralten ehernen Flügeltüren. Die Kirche zu St. Ulrich und St. Afra bewahrt den Leichnam des heiligen Ulrich in einem von Placidus Verfielst gefertigten Sarg. Reich an schönen Grabmonumenten ist die (protestantische) Kirche zu St. Anna, ihr Schmuck der Guggersche und der österreichische Chor. An diese reihen sich die Kirche zum heiligen Kreuz, die Barfüßerkirche mit ihrer 1752. gebauten Orgel. Sämtliche Kirchen Augsburgs sind reich an Gemälden alter deutscher Meister.
Es lag nicht in unserer Aufgabe, hier eine umfassende Beschreibung Augsburgs zu liefern, wir wollten bloß ein Charakterbild der Stadt geben. Und so verlassen wir sie denn jetzt, um unseren Ausflug nach Hohenschwangau fortzusetzen.
Den Lech stromaufwärts verfolgend erreichen wir zuerst Landsberg, eine alte Stadt, wo schon Graf Theoderich von Wettin 1116 sich ein Schloß auf dem Berg gebaut haben soll – im Krieg Ludwigs des Bayern und Friedrichs des Schönen wie später im Schwedenkrieg fast in Schutt verwandelt –, dann Schongau, in dessen Nähe der Hohe Peißenberg sich erhebt. Am rechten Ufer des Lechs setzen wir, dem herrlichen Hochland immer näher kommend, unsere Wanderung bis zu dem Städtchen Füssen fort. Die Hauptstraße von Augsburg führt über Schwabmünchen, Buchloe, Kaufbeuren nach Füssen. Von dem Dorf Pfronten her, dem Fundort römischer Altertümer, mündet die Ulmer Heerstraße, die über Memmingen und Kempten kommt. Der Ausflug nach Hohenschwangau schließt sich für jene, welche auf die Donaureise von Neuburg bis Deggendorf verzichten, an die Wanderung über Innsbruck durch einen Teil des bayrischen Hochlands nach München an, von wo aus sich die Isarfahrt (mit der Rast in Landshut) darbietet.
Schon leuchten uns die Ferner Tirols entgegen, frische Alpenluft weht uns an, und wir fühlen uns stark und groß im ewigen Trotz der Menschenwürde gegen die tausendjährige Großartigkeit der Natur. Wie oft übermannt dich, wenn du ihr gegenüberstehst, wenn ihre starren Bergkolosse auf dich niederblicken, wenn ihre Ströme durch zerrissene Felsen schäumend an dir vorüberstürzen, wenn ihre Wälder auf jähen Abhängen sich über dir neigen, die Empfindung, als werde all dein Menschenstolz vor ihr zuschanden, und du fragst dich verzagend: Was bist du mehr als eine Eintagsfliege, die wird, zeugt und stirbt? Wer von der Natur nur anbetend niedersinkt, versteht sie nicht, dem ist sie tot. Über sie schwinge dich; du kannst's! Umschmiege sie nur wie Siegfried Brunhilde beherrschend, glühend vom Gedanken, daß du einzelner ewig bist im Geschlecht – und diese stolze, starre Königin erwärmt an deinem Herzen. Im Spiegel deines Auges beginnt sie sich zu regen, als wäre sie lange verzaubert gewesen. Erst erschrakst du vor einer Leiche, jetzt umschlingst du ein blühendes Weib, das die ganze Fülle seiner Reize, das tiefste Geheimnis seines Herzens in bräutlicher Hingebung jauchzend und weinend, zitternd vor Freude, Schamhaftigkeit und Wollust in dein Herz überströmt. Sklaven kann sie nicht lieben; nur dem öffnet sie den Schoß ihrer Anmut und Herrlichkeit, der in der Notwendigkeit die Freiheit erkennt, der ihr ebenbürtig ist an ewiger Jugend, der sich wie sie Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert, Stunde für Stunde aus sich selbst verjüngt.
Den Hut gelüftet! Den Alpenstock zur Hand! Willkommen Hochgebirge! Wie Scharen von uralten Sennern strecken die Alpen die weißen Häupter zum Himmel empor; ein Volk, das vor keinem Gewalthaber sich beugt und sich nur regt, wenn es sie zermalmen will. Da stehen sie und weiden die lustig springenden wilden Gießbäche, die wie weiße Ziegen dunkle Schluchten hinabstürzen. Aus dem Grund der Seen rauscht es herauf von den Geheimnissen der Nixen, die drunten den Reigen tanzen oder auf süße Lieder sinnen, die träumenden Hirten mit solchen vom Abhang hinabzulocken. Die dunklen Forste laden dich ein, die erste Tanne dort auf dem Felsen winkt dir stundenlang, bis ihr Duft wie alter Wein dir zu Kopfe steigt. Nimm dich vor den Zauberschwestern in acht. Ihrer Hunderttausende sind's; und siehst du der ersten stundenlang zu, wie sie den Wind mit ihrem langen verwirrten Haar ungestüm spielen läßt, und eilst du ihr zu, so lockt dich die zweite, die dritte; sie schlingen die Arme um dich, sie halten dich fest; sie gönnen dich der freundlichen Sonne nicht mehr, die sie hassen. O diese Liebe nennen wir Tod, und doch ist's nur Liebe, aber so urmächtige, wie wir Menschen sie nicht ertragen können – nur Liebe, die Liebe des Schöpfers selbst in hunderttausend Geschöpfen, die uns überwältigt.
Frisch auf und ans Ziel! Dein Aug' ist hell – Notwendigkeit der Liebe! Das ist die Erkenntnis der Freiheit. Und überall ihre Spur – der Kampf! Sieh den jugendlichen Ringer, den Lech, wie er durch Felsen sich Bahn bricht. Errötest du nicht? Fühlst du nicht, wie er dich beschämt? Entschuldige dich nicht mit den Menschen, den Sitten, den Vorurteilen. –
Hart an der Grenze zwischen Bayern und Tirol lehnt sich das Städtchen Füssen wie ein neugieriger Knabe mit dem Rücken an die Höhen, mit dem Gesicht über den Lech. Auf dem Felsen ragt das Schloß, das Bischof Friedrich von Augsburg 1322 erbaute. Bist du ein Freund der alten Zeit, so wandle mit uns hinan und besieh dir den Rittersaal; bist du ein Gourmand von Profession, so besuche die Küche; liebst du's, auf luftigen Höhen dich in Anschauung eines abgeschlossenen Ganzen ganz zu fühlen, so besteige mit uns den Treppenturm. In der Stadt erregen die Stiftskirche, ein Bau im Geschmack des vorigen Jahrhunderts, das Rathaus vom Jahre 1471 und die Abtei, deren Gründung die Überlieferung dem heiligen Magnus zuschreibt, deine Aufmerksamkeit.
In diesen romantischen Gründen begegnen uns Sagen, wohin wir uns immer wenden; aus jedem Wald, auf jedem Felsenhang tritt plötzlich eine vor uns, kühn und schön wie die Natur. Selbst die Legende trägt hier statt des härenen Gewandes ein stählernes, statt der Geißel der Büßerin ein ritterliches Schwert und einen Helm statt des Heiligenscheins. Jener Magnus, dessen Namen die Abtei in Füssen trägt und dessen Stab und Kelch in der Kapelle desselben bewahrt werden, zivilisierte diese paradiesische Wildnis nicht mit dem Brevier, sondern mit der Fackel und seinem guten irischen Schwert in der Hand. Bei Roßhaupten erschlug er den Drachen; noch weist uns das Mädchen, das uns führt, seiner Tritte Spur im Felsen, wo er den Lech übersprang Von Julius Cäsar berichtet die Sage gleiches; wie er hoch zu Roß von einem Felsblock zum anderen setzte, zwischen denen der Lech dahintost. Vgl. Hormayrs »Historisches Taschenbuch für 1836«, S. 192. und in die Räuberburg die Brandfackel warf.
Nur noch eine Stunde Wegs, und wir erreichen, Füssen im Westen hinter uns lassend, um den Pulerberg kommend, Hohenschwangau, die auf gewaltigen Marmorfelsen aus Waldesdunkel hochragende Burg. Sehen wir die stattlichen Zinnen, die Fähnlein auf den Türmen der Burg, des Springquells mächtigen Strahl, über dem dunklen Grün des Nadelgehölzes emporsteigend, die wohlgehaltenen Pfade, die zur Rast einladenden Bänke am Weg – so dünkt uns, das fröhliche freisame Rittertum lebe seit Jahrhunderten fort und fort in dieser reizenden Bergeinsamkeit und die Wogen der alles umwandelnden Zeit hätten sich an den Bollwerken der Alpen gebrochen; so kühn und trotzig wie ein treuer Hüter blickt der Älplispitz auf die ihm anvertraute Burg; und so friedlich ziehen dort auf dem See die Schwäne, als hätte sich eben der wunderbare Fremde zu ihnen gesellt, der des Ritters goldenen Nachen gezogen hat. Wir suchen ihn unter den Genossen heraus; vielleicht ist's jener, der dort so stolz den schneeweißen Hals über die andern erhebt und die starken Flügel wie vor Ungeduld nach der fernen Heimat schüttelt? »Die Sagen vom Schwanenritter leben auch hier im Munde des Volkes, wie der Schwan den schönen, schlummernden Jüngling zur Beschützung der Unschuld auf goldener Gondel aus unbekannten Ländern dahergezogen, wie der junge Held den Gottesgerichtskampf mit dem räuberischen Oheim gekämpft und ihn erschlagen, darauf die Prinzessin heimgeführt, aber von ihr erfleht hat, sie solle ihn ja nie befragen, wer er sei und woher er gekommen, sonst sei all ihr Glück dahin, und wie die Fürstin es doch nicht hat lassen können und darauf der Schwan sich sogleich wieder eingestellt und ihn abgeholt habe.« Hormayr, a.a.O., S. 234. Vgl. Wolfram von Eschenbachs »Titurel«, den »Jüngeren Titurel«, den »Lohengrin«, »Konrad von Würzburg«.
Unfern von dem Schwansee blicken wir in den dunklen Spiegel des Alpsees; im ganzen Bann dieses Feenschlosses überrascht uns See an See; wohin wir uns wenden, stürzen Gießbäche lustig brausend die Felsen hernieder. Mit Recht heißt eine nahe Höhe die Jugend; im Vollgenuß dieser ewigen Jugend der Natur vergißt man das hohläugige Faultier Alter, den Lastträger unserer gesellschaftlichen Sünden, den Reliquienesel, der um seiner Bürde willen selbst geehrt werden will und mit den schmutzigen Hufen nach jedem ausschlägt, der ihm zu nahe kommt.
Doch zurück zu der Burg! Treten wir durch das Tor, über dessen Einfahrtsbogen die Wappen Bayerns und die von zwei Rittern gehaltenen Hohenschwangaus uns begrüßen, in den Hof, wo die Fernsicht ins üppige Schwabenland sich beut, unter die süß duftenden Linden, an die drei Brunnen; horcht, was ihr geheimnisvolles Rauschen verkündet! Glaube, Vergangenheit, Gegenwart! Das Bild der jungfräulichen Mutter des Heilands (von Glinck) seht ihr an dem ersten Brunnen; o welch ein unversiegbarer Quell des Lebens entsprang jenem Gedanken der mütterlichen Jungfräulichkeit! In den innersten, geheimsten Felsadern deutschen Wesens rauscht er; und hätte es ihn auch nicht von der Kirche überkommen erhalten – wahrlich, es müßte ihn erdacht haben. Den zweiten Brunnen schmücken ein Schwan in Eisenguß, von Ludwig Schaller in München, der Burg Namen verdeutlichend, und ein Name, alle Erinnerungen ihrer Vergangenheit weckend; wie ein friedlicher Schwan bleibt sie ungestört in ihrer Waldeinsamkeit, und alle Wolken, durch deren Blitze die herrlichsten Zweige der deutschen Eiche sanken, sah sie nur im Spiegel der Alpenseen wie zauberisch verklärt. Den dritten Brunnen bildet ein kolossales Becken auf den Rücken von vier Löwen in Eisenguß, von Schwanthaler in München, aus dem jener mächtige Springquell, den wir schon früher gewahrten, in die Lüfte steigt – die beste Devise der Gegenwart, denn der Niederdruck erzeugt den Trieb nach aufwärts, und je stärker der Druck, je höher der Sprung; was liegt daran, ob wir zerstäubend wieder fallen? Strebten wir doch!
Hier aber, wo jeder Stein von der Vergangenheit redet, laßt uns dieser mit jener Liebe gedenken, die den Sohn an die Mutter bindet. Mit Recht durfte der verdiente, unermüdliche Forscher vaterländischer Geschichtsquellen, Freiherr von Hormayr, Hohenschwangau eine »süddeutsche Wartburg« nennen und von der Alpenfeste rühmen: »Marienburg steht ihr als altertümlicher Bau freilich ebenso voran, als ebendieses Marienburg hinsichtlich der Naturreize vor unserem Schwangau völlig verschwindet. Rheinsteins göttliches Stromtal findet ein starkes Gegengewicht in Schwangaus zauberischen Seen, Hochwald und Fernsicht. Aber trete auch immer in den Hallen Marienburgs, in den Hoch- und Heermeistern des deutschen Ritterordens, manches heroische Bild hervor – Rheinstein und Marienburg verschwinden abermals vor Hohenschwangaus überschwenglichen Reminiszenzen.«
Versuchen wir die Hauptzüge der Geschichte Hohenschwangaus zu markieren – eine Nachbildung der genauen und an Details reichen Schilderung Hormarys in verringerten Dimensionen.
Auf dem Marmorfelsen, der jetzt die Burg Hohenschwangau trägt, hatten schon die Römer eine Warte hingebaut. Als Besitz der Welfen, denen das Gelände zwischen Lech, Ammer und Loisach, zwischen Lech und Inn seit jener Zeit gehörte, da Heinrich, der Sohn Ethikos, von Kaiser Arnulf es durch List gewann, Arnulf bewilligte ihm soviel Land um sein altes Stammgut, als er von Morgen bis Mittag mit dem Pflug umziehen könne, zu Lehen; Heinrich setzte sich, einen kleinen Pflug in der Hand, zu Roß und umjagte, von Strecke zu Strecke frische Pferde besteigend, das Land vom Lech an den Plansee, an den Eibsee, den ganzen Ammergau, um den Scharnitzerwald gegen die Isar zu, bis ihm das letzte Pferd zusammenbrach. Sein Vater Ethiko entsagte aus Gram, daß die Welfen hinfort nicht mehr Freie, sondern Lehnsträger sein sollten, der Welt und lebte als Klausner. Das Bethaus in Ethikos Tal wurde später Ettal genannt. erscheint die Burg (Swangew, Swangowe) zuerst in der deutschen Geschichte; die Welfen übergaben sie frühzeitig pflichtigen Edlen, die den Schwan im Wappen führten; diese Burgmänner von Schwangau, dem Geschlecht der Montalbans verschwägert, treten urkundlich mit in den ersten Reihen der Edeln des Hochgebirges auf.
Hiltebold von Schwangau, Freund und wahrscheinlich Begleiter des alten Herzogs Welf auf dessen Kreuzzug und Rheinfahrt, war wie dieser Minnesänger; die »Manessische Sammlung« bewahrt seine Gesänge; an dem prächtigen Gelage, mit welchem Welf zu Gunzenlech das Pfingstfest feierte, gastete auch Hiltebold, und bei der Schenkung des elfischen Ammergaus an die Abtei Kempten war auch er Zeuge. Konrad von Schwangau war am 16. April 1263 Mitzeuge des Vermächtnisses, wodurch der letzte Staufe Konradin seine Oheime Ludwig und Heinrich von Bayern zu Erben seiner sämtlichen Lehensgüter und Allode einsetzte. Im August 1267 nahm der sechzehnjährige Konradin, bevor er, freudiger Hoffnungen voll, nach Italien dem Verrat und Mord entgegenzog, auf Hohenschwangau von seiner in zweiter Ehe mit dem Grafen Meinhard von Tirol vermählten Mutter Elisabeth, die ihn umsonst mit Bitten und Tränen beschwor, die deutsche Erde nicht zu verlassen, Abschied. Nach dem Fall der Hohenstaufen wurden die Schwangauer freie Ministerialen des Reiches, die Burg Reichslehen. Georg von Schwangau überfiel und plünderte 1280 Kloster Raitenbuch, mit dem er in schwerem Zwist lebte.
Ulrich von Schwangau zog dem Sohn Meinhards, Heinrich, zu Hilfe, dem es schwerfiel, die Krone Böhmens zu behaupten. Die Kinder dieses Ulrichs stritten mit ihren Oheimen Georg und Stephan und deren Söhnen lange um die Burg, bis der Zwist, durch den eine Zersplitterung der Herrschaft und des Burgfriedens mit den Schlössern Vorder- und Hinterschwangau, Schloß Frauenstein und dem Simpelturm am Halblech bis in acht Teile entstand, ausgeglichen wurde; Georg von Schwangau verkaufte seinen Anteil an Herzog Albrecht von München (den Gatten der schönen Bernauerin). Bayern übergab die Hut seines Anteils den Herren von Freiberg und Eisenberg, während die Schwangauer für ihren Teil fort und fort des Reiches Lehen trugen. Onuphrius von Freiberg war's, der 1518 Luther, welchen Langemantel ihm von Augsburg zugeführt hatte, in Hohenschwangau aufnahm, von da nach Hohenaschau und von dort nach Nürnberg flüchtete; die Söhne dieses Freibergs – Christoph Georg, Wilhelm, Pankraz – hatten den Geist des Vaters geerbt und hielten standhaft am gereinigten Glauben. Nach dem Tod Heinrichs von Schwangau (1544) kauften Hans und David von Baumgarten die Burg, und letzterer verpfändete sie an den Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg, der 1657 sein Pfandrecht für 170 000 Gulden an Bayern übertrug. Während des Heerzuges des tapferen Moritz von Sachsen gegen Karl V. waren Füssen und Hohenschwangau, wo Karls Großvater, der ritterliche Max so gern des edlen Weidwerks gepflogen hatte, das Hauptquartier Moritz' und Sebastian Schärtlins.
Die Burg, welche fort und fort in Bayerns Besitz blieb, hielt sich im Dreißigjährigen Krieg wacker gegen französische und schwedische Truppen; im österreichischen Sukzessionskrieg 1742 wurde sie von den Tirolern und von Trencks Panduren hart geschädigt. 1800 erlitten die Österreicher durch die Franzosen zwischen Füssen und Hohenschwangau eine schlimme Niederlage.
In neuerer Zeit sollte die Burg auf Abbruch verkauft werden, weil die Kosten der Erhaltung zu groß schienen. Fürst Wallerstein aber tat die ersten Schritte für die Rettung derselben, und 1832 erwarb sie der Kronprinz von Bayern und beschloß, sie aufs glänzendste im Charakter der alten Zeit herzustellen. Dominik Quaglio, der Kunst zu früh durch den Tod entrissen, wurde mit der Ausführung des großartigen Plans betraut. Wo die Marken Bayerns, Schwabens und Tirols zusammentreffen, sollte die Burg in neuem Schmuck prangen, die dem Wanderer der schönste Mittelpunkt ist, von dem er ausgeht, die Reize der Alpenwelt zu beschauen: Beginnend von Altschwangau, von da zur wilden Schlucht, wo die Böllat donnernd über die mit dem Wartturm gekrönten Felsen niederstürzt, von da zu den beiden Ruinen der Burghöhe; vom Schwanstein aus zum Mühlstadel, zum Tegelberg hinan, wo die Grüble-Grotte sich wölbt, zum Grat, wo die Silberspiegel von zwanzig Seen zu uns heraufleuchten. Oder vom Alpsee nach Pinswang, wo die Gipfel des Säulings am prachtvollsten sich zeigen. Oder den Kniepaß hinan, die Felsenufer des Lechs entlang, nach Reutte in Tirol, das der Tauern, der Zwieselberg und der Thaneller umspannen, nach Breitenwang, wo Kaiser Lothar, von der Romfahrt heimkehrend, sterbend Heinrich dem Stolzen (dem Welfen) die Krone gab, zu dem Kaiserbrunnen am Plansee – Ludwigs des Bayern Lieblingsaufenthalt –, zu den Wasserfällen bei Lermoos; oder zur Ehrenberger Klause, wo noch eine Inschrift das Andenken des kaiserlichen Gemsenjägers Max I. verkündigt; nach der im Bauernkrieg hart mitgenommenen Abtei Steingaden bis zum Staffelsee; an der Ammer nach Ettal, nach Partenkirchen, wo Friedrich der Rotbart vor Heinrich dem Löwen auf den Knien lag.
In gleicher Weise sollte – nach dem Willen des Kronprinzen – die bildende Kunst auf Hohenschwangau die bedeutsamsten geschichtlichen Erinnerungen dreier deutscher Heldengeschlechter – der Welfen, Staufen und Scheyern – gleichsam im Brennpunkt zusammenfassen; aus dem Hintergrund der Lokal- und der deutschen Helden- und Stammsagen sollte das Bild der deutschen Geschichte im vollen Glanz ihrer Majestät hervortreten, häusliches Leben und Sitte des Mittelalters als Rahmen um dasselbe sich schließen; Erinnerungen an die Reise des Kronprinzen im Orient, Darstellungen nach Episoden aus Tassos befreitem Jerusalem sollten zwei besondere Räume schmücken, innere Einrichtung und Hausrat aber dem Stil des Gebäudes und dem der Kunstwerke durchaus entsprechen. Die Ausführung sämtlicher Malereien wurde unter Dominik Quaglios oberster Leitung Münchner Künstlern übertragen, dem genialen Moritz von Schwind (einem geborenen Wiener), dem tüchtigen Lindenschmitt aus Mainz, der das Bild an der Sendlinger Kirche gemalt hat, dem braven Techniker Glinck, dem Bruder Dominik Quaglios, Lorenz Quaglio, dem trefflichen Ruben, der (mit Schraudolph) die Kompositionen zu den Glasmalereien der neuen Pfarrkirche in der Au lieferte, dem wackeren Pferdemaler A. Adam, dem bekannten Schlachtenmaler D. Monten, den Landschaftern Scheuchzer, M. Neher, Schimon, Nielson und mehreren anderen. Die Glasmalereien auf Hohenschwangau sind meist aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die schönste darunter das Bild Oxenstiernas vom Jahre 1586. Die Möbel wurden von Steibel, T.M. Glinck, Fortner, Sauter gefertigt. Unter den Ziergeräten zeichnen ein von Fr. Campe in Nürnberg hierher geschenkter großer Humpen, eine kunstreich gearbeitete Uhr (vom Jahre 1587), eine für Herzog Wilhelm V. von Bayern 1591 verfertigte Tischplatte mit dem bayrischen Wappen u.a. sich aus; das die Darstellungen aus des Kronprinzen Reise nach Griechenland und Konstantinopel enthaltende Zimmer ist mit Geschenken des Sultans Mahmud ausgestattet.
Durchwandeln wir nun die Räume des Schlosses, in denen die Kunst der alten Geschichten und Sagen ernsten Sinn in heiterer Schöne verklärt und allenthalben Sprüche und Reime zu Scherz und Ernst und Wappen von historischer Bedeutsamkeit die Lücken und Ecken füllen. Die von Säulen getragene Vorhalle, deren Fenster von Glasmalereien prangen, enthält alte Kriegs- und Jagdwaffen und Rüstzeug aller Art.
Der erste Saal, den wir betreten, ist der Sage vom Schwanenritter geweiht; zugrunde gelegt wurde jene Auffassung, derzufolge die fälschlich angeklagte Herzogin von Bouillon am Kaiserhof plötzlich den Schwanenritter als Kämpfer für ihre Unschuld gewinnt und ihm, nachdem er diese durch seinen Sieg über den Ankläger bewiesen hat, die Hand ihrer Tochter gibt. Man vergleiche die in Hormayrs »Taschenbuch für 1837« wiederabgedruckte Sage von der Tochter des Herzogs von Brabant. Vier Kompositionen (nach Rubens' Entwürfen von L. Quaglio und M. Neher gemalt) schmücken diesen Saal. Auf der ersten sehen wir den Schwanenritter vom Königshaus scheiden; auf der zweiten den Kaiser, wie er das Zeichen von der Ankunft des Schwanenritters vernimmt; auf der dritten dessen Kampf; auf der vierten seine Hochzeit mit der Tochter der Herzogin.
Aus diesem Saal wenden wir uns in das erste Zimmer links, worin Lindenschmitt die Verherrlichung der Schyren in acht Bildern unternahm. Das erste zeigt Herzog Luitpold, den Ahnherrn des Königshauses, wie er der Normannen Ring an der Dyle erstürmt (891). Ihm gilt folgender Sang:
O Vaterland, heiliges Vaterland!
Drei böse Gesellen strecken
Nach dir die plumpen Fäuste aus,
Sie fangen dich mit Schrecken,
Sie hätscheln dich mit Graus.
O möge Gott dich decken
Mit seiner starken Hand!
O Vaterland, heiliges Vaterland!
Schau, wie sie sich wechselseits locken!
Auf windschnellen Rossen reiten sie gut,
Die Pfeile fliegen wie Flocken,
Der Ungar lehrt den Mord seine Brut,
Wie flattern des Mähren Locken!
Der Normann schürzt sein Gewand.
O Vaterland, heiliges Vaterland!
Es würfeln die drei Gesellen,
Wer dich zu eigen haben sollt.
Sieh, wie auf den Bärenfellen
Der eiserne Würfel rollt!
Sie wollen dir Netze stellen,
Sie schmieden und hämmern dein Band.
O Vaterland, heiliges Vaterland!
Hast zwar zu Herrn oft Schwache,
Doch Männer soviel, wie Ähren das Feld.
Lag lang die Ehre in Brache,
Wird Weib und Kind ein Held.
Auf, deutsches Volk, erwache,
Und halte den Spielern stand!
O Vaterland, heiliges Vaterland!
Schau auf, wie dort an der Dyle
Ein Mann den Normannen sich mengt
Und mitten im lustigen Spiele
Der Spieler Ring zersprengt,
Und manchem drückt' er 'ne Schwiele,
Zugreifend mit deutscher Hand!
O Vaterland, heiliges Vaterland!
Schau auf: das sind die Normannen;
Wie jagt der Jäger den stürzenden Trieb!
Er hatte den Teufel zu bannen,
Er tat's mit Schwerteshieb.
Schau auf: da fliehn die Normannen,
Kein einziger hält ihm stand.
O Vaterland, heiliges Vaterland!
Sie möchten, du solltest dich drehen
Nach fremder Rosse buschigem Schwanz,
Doch solln sie dich lassen stehen
Für ewige Zeiten ganz;
Du fühlst in Todeswehen
Erst recht der Unsterblichkeit Pfand.
O Vaterland, heiliges Vaterland!
Willst du den Sieger kennen,
Der deiner Freiheit männlich pflag?
Viel Namen sind's, die ihn nennen
Bis auf den heutigen Tag:
Luitpold, der Ahn der Schyren,
Dein Hort, o Vaterland!
Das zweite Bild im Schyrensaal zeigt den gewaltigen Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, wie er mit Heinrich dem Löwen zu Rom 1155 Friedrich den Rotbart im Aufruhr des Volkes rettet. Das war die Stunde, wo
Der Rotbart hie und dorten,
Stets mitten in der Schlacht.
Das ist ein fleißig Morden,
Handwerk der Mitternacht!
Und die Römer riefen:
»... Wie sich's auf Römernacken ruht?
Der Römerdolch trifft stets noch gut
Durch all die Kaiserpracht!
Wo habt ihr eure Panzer,
Deutsche? Schlaft ihr nicht drein?
Bist, Kaiser, noch ein Ganzer?
Wirst bald ganz Leiche sein.«
Hoch zu Roß focht der Kaiser, und »müßt' er den Rotbart tränken bis die Lippen im heißen Bach«; aber das Getümmel riß ihn fort, das Roß stürzte, schon dünkte er sich verloren.
»Hätt' ich 'nen Schild und Wehre,
Bald wär' ich wieder frei!« –
»Dein Schwert ist: deutsche Ehre,
Dein Schild ist: deutsche Treu!«
Wer ruft's? Wer drängt zurück den Tod?
Ein deutsches Herz. Ja, das tat not;
Schild – Leib – 's ist einerlei.
Das taten ihrer Zweie,
Fragten nicht lange nach,
Heinrich, genannt der Leue,
Otto von Wittelsbach;
Der zweite trägt die Ehre
Voran als Fahn' dem Heere,
Den Kaiser trägt der Leu gemach.
Auf dem dritten Bild sehen wir den Sohn jenes Otto, Herzog Ludwig, wie er bei der schönen Ludmilla, der Tochter des Böhmenkönigs und Witwe Adalberts von Bogen um Gewährung süßer Minne fleht (1203). – Dem Rat eines Treuen folgend, ließ die holde Frau drei Ritter auf einen Teppich malen, und als der feurige Herzog aufs neue warb, versprach sie ihm Gewährung, wenn er vor den drei Rittern ihr die Ehe gelobe. Er tat's, und alsbald traten hinter dem Teppich drei dort verborgene Ritter als lebendige Zeugen hervor. Zürnend, daß er überlistet worden war, eilte der Herzog von hinnen und mied die Geliebte ein Jahr lang. Nach Ablauf dieser Frist aber beging er zu Kelheim mit ihr fröhliche Hochzeit.
Das vierte Bild zeigt den Kampf Herzog Ludwigs mit dem Heer der Kreuzfahrer gegen die Sarazenen in Ägypten (1221). Auf Ludwigs Rat sollte das Heer, da die Not stündlich wuchs, in der Nacht vom 26. zum 27. August nach Damiette zurückkehren. Aber die Unvorsichtigkeit einzelner weckte die Sarazenen, welche die Schleusen des Nils aufzogen und einen Hauptdamm durchstachen. Mit den Fluten und den Feinden ringend, gewannen die Kreuzfahrer von Sultan Kamel endlich den Vertrag, daß alle Gefangenen wechselseits zurückgegeben, Damiette von den Christen geräumt und der Friede acht Jahre lang gehalten werden sollte. Unter den Geiseln, die beide Teile stellten, befanden sich von christlicher Seite Ludwig von Bayern, König Johann von Zypern und der Kardinal Pelagius. Vgl. Raumers »Hohenstaufen«, 7. Buch, 2. Hauptstück.
Auf dem fünften Bild sehen wir das Siegesmahl nach der Schlacht bei Mühldorf und Ampfing (28. September 1322), wobei Ludwig der Bayer das einzige Gericht, das in der ausgeplünderten Gegend zu erhalten war, den Kampfgenossen vorlegte und verteilte, seinem Feldhauptmann die Worte »Jedem Mann ein Ei, dem frommen Schweppermann zwei!« zurufend, die auf der Grabtafel des Tapferen im Kloster Kastel aufgezeichnet wurden.
»Hie leit begraben Herr Seyfried Schweppermann
Alles Thun's und Wandels lobesan,
Ein Ritter kek und fest,
Der bei Gamelsdorf und Ampfingen im Streite that das Besst,
Er ist nun todt,
Dem Gott genad,
Jedem Mann ein Ei,
Dem frommen Schweppermann zwei!«
Das sechste Bild verherrlicht die Versöhnung Ludwigs des Bayern und Friedrichs des Schönen (1325). Ludwig ritt selbst zu dem auf der Trausnitz gefangenen Gegner und bot ihm die Freiheit ohne Lösegeld; Friedrich aber gelobte, der Krone entsagend, treu gegen jeden für Ludwig zu stehen und, könne er dieses Versprechen nicht halten, in die Haft zurückzukehren; der Prior zu Mauerbach teilte den beiden Jugendfreunden, die der verblendende Glanz der Krone getrennt hatte, die geweihte Hostie. Wie Friedrich sein Wort gehalten hat und damit deutscher Treue Ruhm gewann, ist weltbekannt.
Das siebente Bild stellt den Kampf des Herzogs Christoph von München (dessen Riesenkraft bei unscheinbarer Gestalt noch die Wahrzeichen in der Münchner Residenz verkünden) Er erreichte im Sprung einen zwölf Fuß hohen Nagel in der Wand mit der Fußspitze u. dgl. mit dem Woiwoden von Lublin dar; bei der prachtvoll gefeierten Hochzeit des Herzogs Georg von Landshut mit Hedwig, der Tochter des Polenkönigs, geschah es, daß der starke Woiwode auf einem Roß, dessen Hufe mit Silber beschlagen waren, übermütig an die Schranken ritt, der deutschen Sitte spottete und tausend Gulden zur Wette setzte, wenn sich ein Ritter im scharfen Rennen mit ihm messen könne. Herzog Christoph stellte sich ihm; als aber beide in die Schranken ritten, gewahrten die Zuschauer lachend, daß der Pole sich mit starken Riemen an den Sattel festgebunden hatte; und allenthalben scholl Beifallsjubel, als der Herzog den Goliath wie einen Ball übers Roß weit hinweg auf den Sand schleuderte. »Ohne Teufels Hilfe hätte mir der magere schwarze Herr das Herz nicht entzweigestoßen«, Zschokke, »Bayrische Geschichte«, Bd. 4. meinte der Pole, dem der »Hochmut vor dem Fall« kurz darauf das Leben kostete.
Die Darstellungen im Schyrensaal beschließt würdig und bedeutsam das Bild Johann Turmayers (genannt Aventinus) von Abensberg, der die jungen Herzöge Ludwig und Ernst unterwiesen und nach Italien begleitet und nach zwanzig Jahren voll treuen Sammelfleißes die Jahrbücher der Bayern geschrieben hat. Der Ketzerei schuldig erklärt (weil er an Fasttagen Fleisch gegessen hatte, lautete der Vorwand!), wurde er auf Betrieb der Geistlichkeit in Abensberg plötzlich überfallen und von Henkersknechten fortgeschleppt, aber auf der Herzöge Gebot wieder freigegeben; die Nachwirkung des Schreckens und der Kränkung zehrten seither an ihm, häuslicher Gram und Dürftigkeit rafften seine ohnehin schwachen Kräfte zusehends dahin, bis ihm der Kanzler Leonhard von Eck die Erziehung seines Sohnes Oswald anvertraute und ihn zugleich der drückendsten Lebenssorgen enthob. Bald darauf starb er zu Regensburg am 9. Jänner 1534; in der Kirche zu St. Emmeran wurde er begraben.
Aus dem Schyrensaal treten wir jetzt in das mit Erinnerungen an die Reise des Kronprinzen geschmückte Gemach, wo Scheuchzer die Ansichten von Smyrna, Troja, Mytilene, den Dardanellen, Konstantinopel und Bujukdere; Monten die Einfahrt in Beylerbey, den Empfang des Kronprinzen beim Sultan und den Einzug des Kronprinzen mit König Otto in Athen gemalt hat.
Rechts von dem der Sage vom Schwanenritter geweihten Saal treten wir in das der Lokalgeschichte Hohenschwangaus gewidmete Gemach, das Lindenschmitt mit sieben Darstellungen schmückte. Die erste zeigt den Tod des von der Romfahrt heimkehrenden Kaisers Lothar II. in einer Hütte des nicht weit von Hohenschwangau gelegenen Dörfleins Breitenwang (1137), die zweite den Minnesänger Hiltebolt von Schwangau, die dritte den Abschied Konradins von seiner Mutter (1267), die vierte den Überfall auf das Kloster Raitenbuch durch Georg von Schwangau (1280), die fünfte die Rettung des von seinen Feinden auf der Heerstraße verwundeten Konrad von Schwangau in die Abtei Steingaden (1316), die sechste Luthers Empfang auf Hohenschwangau nach der Flucht aus Augsburg (1518), die siebente endlich Kaiser Max I., der von Augsburg, schon in Todesahnung, nach Füssen und von dort nach der Ehrenberger Klause gereist war. In Füssen nimmt der letzte Ritter Abschied.
Kaiser Max der Ehrenreiche,
Reitet fort aus Augsburgs Mauern,
Und der Reichsstadt Bürger trauern;
Ob sie je ihn wieder schauen?
Wie so trüb der alte, bleiche
Kaiser trabt auf sanftem Schimmel!
Wie so freundlich klar der Himmel
Blicket auf den Grauen!
»Lebe wohl« (mit matten Lippen
Spricht der Kaiser diese Worte),
»Lebe wohl, des Südens Pforte,
Augsburg, lieb mir sondergleichen!
Schon im Grab mit einem Fuße
Reich' ich euch die Hand zum Gruße,
Werd' sie nimmer reichen!«
Als er im Abzug zu der Rennsäule auf das Lechfeld kam, wandte er sich um und schlug ein Kreuz gegen Augsburg. Siehe Fuggers »Ehrenspiegel«.
Frauen, Männer, Greise, Knaben
Drängen sich, die Hand zu fassen,
Nimmer sahn der Reichsstadt Gassen
So bekümmert Volk wie heute.
Fernab jetzt die Rosse traben
Nach Tirols umfelsten Marken,
Wo, im Waidwerk zu erstarken,
Max so oft sich freute.
»Lasset uns nach Füssen reiten,
Nach dem Schlößlein«, spricht er winkend,
»Dessen Türme goldig blinkend
Stehn auf dreier Länder Luge. –
Ach, in unbekannte Weiten
Sehnt mein Herz sich, erdenmüde;
Flög' auf einem Heldenliede
Ich im letzten Fluge!
Auf dem Schloß ist gut zu rasten!
Hat nicht Luther dort gerastet,
Jener Mönch, den ihr verpaßtet,
Der am Leib euch sollte büßen?
Wie; im selben Schloß zu gasten? –
Wird das Auge mir schon trüber?
Ach, die Sonne ziehet drüber,
Scheidend mir's zu küssen!
Sonne! Fürsten sind wir beide;
Du wirst wieder bald gefunden,
Bringst die altgewohnten Stunden
Deinem Volk – den Menschen – wieder.
Ich auch fühl's, wie bald ich scheide;
Doch mit mir, dem alten Knaben,
Wird die alte Zeit begraben,
Und sie kommt – nicht wieder!
Rüst'ger Hände kühne Taten,
Namen, hell vom Waffenruhme,
Und die schöne Wunderblume
Rittertum, wird mitbegraben.
Keinem werden neue Saaten,
Treten werden in die Schranken
Neue Ritter – die Gedanken
Leuchtend, hoch erhaben.
In der Abendsonne Klarheit
Seh' ich schon zum Kampf sie jagen,
Kühn das Wort als Lanze tragen,
Seit der Aufruf donnernd hallte.
Ihre Dame ist – die Wahrheit;
Ach, im Scheiden macht mir's Wonne,
Daß um's Licht, o Mutter Sonne,
Kampf sich, Sieg entfalte!«
Das nächste Zimmer hat Glinck nach Moritz von Schwinds Kompositionen mit fünf Bildern nach den Hauptmomenten der Sage von Karls des Großen Geburt geziert.
Von König Pippin wird berichtet, daß er in Bayern waltete und daß seine Burg zu Weihenstephan bei Freising stand. Der König von Karlingen trug ihm, dessen edler Mut weit und breit gerühmt wurde, seine Tochter Bertha zur Gattin an und schickte ihm deren Konterfei. Pippin war davon sehr erfreut und sandte seinen Hofmeister, um die Braut ihm zu werben und heimzubringen; der Hofmeister aber beschloß, die Königstochter heimlich zu töten und statt ihrer sein eigenes Kind dem Herrn zuzuführen. Der König von Karlingen nahm den Hofmeister und das Gefolge mit Ehren auf, verlobte seine Tochter Bertha an König Pippin und vertraute sie dem Hofmeister.
In der Nacht vor dem letzten Nachtlager, bevor sie zu Pippin wiederkamen, führte nun des Hofmeisters Hausfrau diesem ihr eigenes Kind zu; beide stahlen Berthas Kleider und Ring und gaben sie ihrer Tochter. Bertha aber wurde durch zwei Knechte frühmorgens aufgeweckt und in die Wildnis geführt, dort sollte sie sterben. Doch die beiden Knechte jammerte das junge Blut, und sie verrieten der Königstochter, was ihnen befohlen worden war, dann geboten sie ihr, ihnen ihr Hemd und ihr Hündchen zu geben. Und als sie beides empfangen hatten, töteten sie das Hündchen, tauchten das durchstochene Hemd in dessen Blut und brachten das blutige Gewand mit der abgeschnittenen Zunge des Hündchens ihrem Herrn, zum Beweis, daß sie dessen Befehl vollzogen hätten. Der Hofmeister brachte nun seine Tochter in Berthas Kleidern zu Pippin, und dieser machte sie zu seiner Königin.
Bertha aber irrte zwei Tage lang in der Wildnis umher; am Abend des dritten traf sie endlich einen Köhler, der sich ihrer erbarmte und sie in die Reismühle bei Gauting führte, wo gute Leute wohnten. Der Müller nahm nun die Königstochter, die er nicht kannte, um Gottes willen auf, und sie diente ihm als Magd; aber in den Feierstunden wirkte sie kostbare Gewirke aus Gold- und Silberfäden, die sie mitgebracht hatte; der Müller trug die Borten nach Augsburg und verkaufte sie dort für gutes Geld und brachte ihr davon neue Stoffe heim. So lebte die Königstochter sieben Jahre und mehr.
Da geschah's, daß Pippin im Wald jagte und sich von seinem Gefolge verirrte und niemand mehr bei sich hatte als einen Knecht und seinen Sternseher. Den Knecht ließ er einen hohen Tannenbaum hinaufklettern, und als dieser einen Rauch sah, schritten sie drauflos und kamen zu dem Köhler; der aber brachte sie zu dem Reismüller, bei dem sie sich für reiche Kaufleute ausgaben. Als sie gegessen hatten, ging der Sternsucher vors Haus und las in den Sternen, daß der König Pippin in dieser Nacht am Herzen seines ehelichen Weibes liegen und einen Sohn gewinnen werde, der über Christen und Heiden zu herrschen bestimmt sei. Der König verwunderte sich über die Maßen, aber der Sternsucher las abermals in den Gestirnen, daß der König in dieser Nacht bei seiner Hausfrau liegen werde, die es schon vor sieben Jahren gewesen war. Nun fragte Pippin den Müller, ob er nicht eine Frau oder Jungfrau bei sich verberge, und der Müller erzählte ihm von der Magd, die ihm sieben Jahre diente, und brachte die Verschämte. Da erkannte sie Pippin, und am anderen Morgen zeigte sie ihm seinen eigenen Ring, den er ihr durch den treulosen Diener gesandt hatte.
Nun vertraute er seine rechte Hausfrau dem Müller und zog nach Freising zurück; dort erforschte er jene zwei barmherzigen Knechte, und als er aus ihrem Mund die Bestätigung der Schuld vernommen hatte, ließ er dem Hofmeister das Urteil sprechen; dessen Frau wurde eingemauert, die Königin aber starb bald darauf aus Gram um ihre Eltern. Danach zog Pippin wider die Heiden und schlug sie allerorten.
Als er aber wieder heimkam, waren neun Monate vergangen, und der Müller trat auf ihn zu und gab ihm einen Pfeil, zum Zeichen, daß Bertha ihm einen Sohn geboren hatte. Alsbald zog er mit allen Fürsten zur Reismühle hinaus, und der Müller übergab ihm seine Hausfrau wieder. Der König aber fuhr mit ihr in großer Pracht gen Frankreich und krönte sie dort, und das Kind, das sie ihm in der Reismühle geboren hatte, wurde Karl getauft, und als er König und Kaiser geworden war, hieß er der Große. –
Das letzte Zimmer im ersten Stockwerk wird mit Szenen aus dem häuslichen Leben der Burgfrauen geschmückt.
Den großen Heldensaal des oberen Stockwerks füllen sechzehn nach Moritz von Schwinds Kompositionen von Neher, Glinck u.a.m. ausgeführte Gemälde aus der Wilkyna-Saga. Die gewählten Vorwürfe sind folgende: Die Tochter Siegfrieds bringt ihrem Geliebten Dietlieb den Siegerstein / Sisilie mit ihrem neugeborenen Kind / Herbert wirbt am Hof des Königs Artus für Dietrich von Bern / König Osantrix schmückt seine Braut / Dietrich von Bern und Hildebrand nehmen die Schätze der Riesen Grimm und Hilde / Dietrich von Bern und Wittich fechten / Die Königin von Nibelungenland und der Elf (Hagens Empfängnis) / Rüdiger und Osid entführen die Töchter des Osantrix, Erka und Bertha / Dietrich und Dietlieb in Rom / Der schlafende Sintram und der Drache / Dietrich und Erntenden / Bolfriana / Herburg wirft ihrem Geliebten den Apfel zu / Erka rüstet ihre Söhne / Wieland der Schmied entflieht vor Nidung / Dietrich siegt bei Gronsport.
Das Zimmer links enthält die von W. Lindenschmitt gemalten Kompositionen aus der Geschichte der Hohenstaufen. Es sind deren sechs. Die erste zeigt Mailands Demütigung durch Friedrich Rotbart (1162), da das unglückliche Volk mit Stricken um den Hals zu dem Sieger kam und den Mast des Caroccios vor ihm neigte. – Auf der zweiten sehen wir den Sieg Friedrich Rotbarts über die Ungläubigen bei Iconium (1190), gewonnen im Feldgeschrei »Christus herrscht!«, auf der dritten Rotbarts Tod im Fluß Saleph, wenige Tage nach jener glorreichen Schlacht. Die vierte Darstellung verherrlicht Friedrich II., wie er, zweiundvierzig Jahre nach Jerusalems Eroberung durch Selaheddin, sein in Aachen bei der Krönung getanes Gelübde lösend, die Heilige Stadt den Christen wiedergewinnt (1229); die fünfte weist Johann Frangipanis Verrat an Konradin nach der Schlacht bei Skurkola (1268), zwei Monate nach dieser fiel das Haupt der letzten Staufen in Neapel unfern der Karmeliterkirche, und die Sage berichtet, wie
... aus Lüften rauschend nieder
Schießt ein Adler aufs Schafott,
Taucht ins Blut sein weiß Gefieder
Und entfleucht, vom Purpur rot.
Eh' aus eines Menschen Munde
Todesweh die Mutter trifft,
Bringt der Aar die Trauerkunde
In des Fittichs blut'ger Schrift.
Und von der unseligen Mutter, deren Ahnung beim Scheiden so gräßlich eintraf, erzählt die Sage weiter:
Durch der Alpen klippige Risse
Und wo der Strom im See sich verschnauft,
Pilgert die Mutter, wund die Füße,
Ihr blondes Haar in Jammer zerrauft.
Eh' ihr's sterbliche Lippen vertrauen,
Hat ihr's der König der Lüfte gesagt;
Tränen sind Balsam, aber sie tauen
Der Mutter nicht, die um Konradin klagt.
Drum, wem sie begegnet, Reichen und Armen,
Vertraut sie ihr Flehen zugleich mit dem Gruß:
»Mit einer Bettlerin habet Erbarmen,
Im Elend zum Elend wandelt mein Fuß.
Nicht Almosen begehr' ich zu haben,
Tränenlos bettl' ich um bessern Gewinn.
Ich möcht' in Tränen mein Kind begraben ...
Schenkt – eine Träne für Konradin!«
Enzios Gefangenschaft in Bologna schließt den Zyklus der Kompositionen aus der Geschichte der Hohenstaufen ab. Aus dem Staufengemach treten wir in das Tassozimmer, wo die Episode aus dem befreiten Jerusalem »Rinaldo und Armida« die Reihe der Erinnerungen an das Morgenland fortsetzt, die durch die zweite, die dritte und die vierte Komposition im Staufenzimmer angeregt wurden. Glinck hat jene Episode dargestellt.
Rechts vom Heldensaal bildet das Gemach mit sechs von Lindenschmitt gefertigten Darstellungen aus der Geschichte der Welfen ein würdiges Gegenstück zu dem den Staufen geweihten. Heinrich der Löwe wurde mit Recht als Vertreter des ganzen Geschlechtes angenommen, dessen Ursprung die Sage von Isenbart (dem Sohn Warins, eines Grafen zu Altorf und Ravensburg), und dessen Hausfrau Ilmentrud ableitet, die einst, als sie von einem mit Drillingen gesegneten armen Weib gehört, ausgerufen hatte, das Weib sei eine Ehebrecherin und darauf selbst in Isenbarts Abwesenheit zwölf Knaben geboren habe. Aus Furcht, nun selbst des Ehebruchs geziehen zu werden, habe sie elf von den Neugeborenen ihrer Schaffnerin gegeben, sie zu ertränken; aber der Vater sei eben dazwischen gekommen und habe die Schaffnerin gefragt, was sie trüge; worauf ihm die Antwort geworden sei, es seien Welfen oder junge Hündchen. Aber der Graf habe die Kinder entdeckt und heimlich erziehen lassen und, als sie groß geworden, sie der Mutter gebracht, die ihre Einfalt und ihr Verbrechen alsbald bekannte und Gnade fand; und seither habe das Geschlecht der Grafen von Altorf den Namen der Welfen. Woher der gewaltige Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen, der Gründer Münchens, Braunschweigs und Lübecks, der Friedrich Rotbart als Freund wie als Feind gleich mächtig gegenüberstand, der des Glückes Gipfel bis zu jener unerreichbaren Kuppe erklomm, auf der die Kaiserkrone schimmerte, und so herrlich und trotzig noch im tiefsten Unglück war, daß dem Kaiser um ihn das Auge trüb wurde – woher er den Beinamen »der Löwe« erhalten hat, verkündet uns der Meistergesang, Hormayrs »Historisches Taschenbuch für 1836«. der in der Schlußwendung der Sage an die vom edlen Möringer erinnert.
Von Christi Geburt eilfhundert und vierzehn Jahr
Herzog Heinrich von Kunig Konrad vertrieben war,
Dass ihm allein belieb Braunschweig die Städte.
Nachdem zug er mit sei'm Adel zum heilling Grab.
Seim Weib zuletzt ein halb güldnes Ringlein gab,
Das ander Halbtheil er behalten hatte.
Auf dem Meer ihn der Wind verschlug,
In's Kleber-Meer that sich das Schiff einheften,
Ein Greif her in den Lüften flug
Und zucht ein Mann aus seinem Schiff mit Kräften;
Bald liess der Fürst sich nähen ein
In ein' Rosshaut, mit sein'm stählen Gewände,
Zu erretten das Leben fein.
Der Greif kam wieder, führt' ihn auch zu Lande
Auf ein Hochgebirg in sein Nest.
Zur Speis' sein'n Jungen wieder
Der alte Greif von dem Neste floch,
Der Fürst auszoch
Sein Schwerd, die Jungen schlug zu Tod,
Stieg eilend vom Fels hernieder.
Ging um in den Holz, fund weder Weg noch Strass,
Wurzel und Kräuter da in seinem Hunger frass,
Sah, wie ein Low mit einem Drachen fachte.
Der Fürst dem Löwen half und den Drachen erschlug,
Der Low darnach mit dem Fürsten im Holze umzug,
Kam nimmer von ihm weder Tag noch Nachte.
Das währt bis auf das siebent Jahr
Dass er kein Menschenbilde könnt ersehen.
Der Fürst wurd hart betrübet gar.
Ein's Nachts kam der bös' Geist, thut zu ihm jehen:
»Herzog Heinrich, auf morgen Tag
Hat ein Andrer Hochzeit mit deinem Weibe.
Heint ich dich wohl heim bringen mag,
Wo du mein willt sein mit Seel' und Leibe.«
Er sprach: »Bringst du den Löwen und mich
Schlafen hin vor die Städte
Braunschweig, gesund und schadlos fein,
So bin ich dein.«
Zu Nacht führt sie der Teufel beid
Hin schlafend also spatte,
Für die Stadt Braunschweig. Der Low fing zu schreien an
Mit lauter Stimm, dass der Herzog erwacht davon,
Der Teufel satzt sie beid' in Zoren.
Der Fürst ging auf die Burg, da man die Hochzeit hat.
Um Herzog Heinrichs willen ein Trunk Weine bat,
Ein Scheuren schickt ihm die Braut hochgeboren.
Der Fürst sein halbes Ringelein
Liess heimlich in die gülden Scheuren sinken,
Schickt der Braut wiederum den Wein,
Die sah das Ringlein, alsbald sie thät trinken,
Bey dem der Fürste wurd' erkennt.
Sie umfing ihn, Freud' war im ganzen Lande,
Dass der Fürst kam aus dem Elend
Und ward Herzog Heinrich der Leu genannte
Sei'm Leuen baut er Leuenburg,
Zu Gedächtnis der Liebe.
Als nun der Fürst mit Tod ging ab,
Auf seinem Grab
Der Leu blieb liegen bis er starb;
Die Chronika beschriebe.
Das erste Gemälde im Welfenzyklus hat die Gründung Münchens durch Heinrich den Löwen (1158) zum Vorwurf. Bischof Otto von Freisingen hatte bei Föhring eine Brücke über die Isar geschlagen und an derselben ein Zollhaus, eine Münzstätte und eine Salzniederlage gebaut, wodurch Heinrich der Löwe in seinem eigenen Land sich beeinträchtigt fühlte. Drum überfiel er Föhring, zerstörte den Flecken und die Brücke und ließ das Salz eine Stunde stromaufwärts führen, in das Dörflein Munichen, wo er Brücke, Zollhaus, Salzniederlage und Münzstätte erbaute. Sechs Jahre später war München schon mit Mauern umgeben; ein an dem früheren Oberrichterhaus in München (im »Tal«) eingemauerter steinerner Löwe gilt als ein Denkmal des Gründers.
Auf dem zweiten Gemälde sehen wir Heinrich den Löwen, wie er die Slaven besiegt und bekehrt (1170); während die Priester den heiligen Hain zerstörten, jagte der Gewaltige die Haufen der Besiegten in den Schweriner See.
Das dritte Bild zeigt den festlichen Empfang Heinrichs des Löwen (auf seiner Rückreise vom Gelobten Land) bei dem Sultan zu Iconium (1172).
Auf dem vierten Bild sehen wir ihn dem Kaiser Friedrich I. gegenüber, Zu Partenkirchen; nach Raumer zu Chiavenna. der ihn um Unterstützung gegen die Lombarden bat. Heinrich blieb unbeugsam in seinem Starrsinn; das Gefühl der Macht schwellte seinen Stolz. Da stand der Kaiser, der alten Freundschaft des Löwen gedenkend, vom Sitz auf und umfaßte flehend dessen Knie; wo die Ehre deutschen Namens auf dem Spiel stand, vergaß er für einen Augenblick die Majestät. Erschrocken hob Heinrich den Kaiser auf. Dennoch gab er nicht nach; vielleicht vernahm er in den Worten des Jordanus Truchseß: »Die Krone, die du zu deinen Füßen sahst, wird deinen Scheitel zieren«, seine eigenen geheimsten Gedanken. Da trat die Kaiserin zu dem Gatten und sprach zu ihm: »Steh auf; Gott und du gedenkt einst dieses Tages!« – Des Kaisers Niederlage bei Lignano und die Ächtung des Löwen (1180) waren die Folge der Weigerung des Stolzen, und die Wittelsbacher wurden seitdem Bayerns Herrscher.
Das fünfte Bild zeigt des Löwen Einzug in Braunschweig mit seinen gefangenen Gegnern.
Das sechste Bild zeigt den alten Helden auf seinem Sterbelager (1195).
Auf seinem Sterbelager
Ruht still der alte Leu,
Den Leib so welk und hager,
Den Geist noch stark und frei.
Rings um den müden Welfen
Preßt all' ein dumpfer Schmerz,
Denn keiner kann ihm mehr helfen –
Bald schlug's zuletzt, dies kühne Herz!
Er ließ sich – horchend – lesen
Aus altem Pergament,
Von ritterlichem Wesen,
Das manche Sage nennt,
Von hohen Ruhms Geschichten,
Von Helden keck und frei;
Was Schriften treu berichten –
Er hat's erlebt, was Größe sei!
Da jetzt vorm Aug' ihm's grauet,
Denkt er ans Einst zurück,
Wie er um sich geschauet,
Ausfordernd keck das Glück,
Wie er mit starken Banden
Den Nord schloß an den Süd,
Im Mittagsglanz gestanden –
Es klingt jetzt wie Fabellied.
Er denkt's, wie kniend, flehend,
Vor ihm der Rotbart lag,
Wie er, den Herrn verschmähend,
Stolz süßen Taumels pflag,
Wie ihm von hohem Mute
Das Herz, frei lachend, schwoll,
Die Stirn rot wie von Blute,
Die Seele reich an sattem Groll.
»Ja, das war ich, der Kecke,
Stets vorwärts, nie kopfrum!
Hoch an des Himmels Decke
Schrieb dies mein Schwert den Ruhm.
War einst bei seltner Taufe
Vergnügt Gevattersmann,
Wohl tausend Heiden zu Haufe
Trieb ich ins Bad – ich denk' daran!«
Sein Aug' wird trüb und trüber,
Horch: draußen tobt's und fegt's.
Es keuchen die Wolken vorüber,
Und wild an die Scheiben schlägt's.
Der Wirbelwind jagt wie Kreisel
Im Hofe hoch den Staub
Und haut wie mit schwirrender Geißel
Vom Lindenbaum herab das Laub.
Von allen vier Winden her wettert's,
Als gält's: Zu längst gelebt!
Ein Blitz! Ein Schlag! Laut schmettert's,
Daß jeder Quader bebt.
Es wankt wie in Pulsschlägen
Das ganze feste Haus;
Da zittert wohl mancher Degen
Und sinkt zu Boden im dumpfen Graus.
Heinrich, der alte Leu,
Erhebt sich ruhig allein,
Und spricht dann ohne Scheu:
»Reicht her den Abschiedswein.
Wohl manches Pulse stocken –
Ich seh's – vorm Donnerhall,
Manch Herz ist jetzt erschrocken,
Das nie gebebt vor Schwerterschall.
Ich aber, grau von Haaren,
Dank' meinem starken Gott,
Daß ich zu Grabe fahren
Soll freudig, ohne Spott,
Daß nicht ein dumpf Vergessen
Auf meinem Sterben sei.
Nach Wettern werd' ich gemessen,
In Wettern starb der alte Leu!«
An das Welfenzimmer reiht sich das Gemach, worin Glinck nach Moritz v. Schwinds Entwurf die Sage von der Bayern und Langobarden Vereinigung durch Autharis und Theodelinde behandelt hat.
Paul Warnefried erzählt von Autharis, dem König der Langobarden, daß er Boten an den Hof Garibalds, der über Bayern herrschte, gesendet habe, um dessen Tochter Theodelinde für ihn zu werben. Garibald versprach sie ihm, und die Boten, die zu Autharis wiederkehrten, konnten kein Ende finden, die Schönheit und Lieblichkeit der Jungfrau zu rühmen. Von solchem Lob in Neugier entbrannt, beschloß Autharis, selber gen Bayernland zu fahren und unerkannt die Verlobte zu sehen. Als sie nun am Hoflager Garibalds angekommen waren, sprach Autharis zu dem Bayernfürsten: »Mein König sandte mich her, daß ich seine Braut schaue und ihm recht nach Treuen schildere.« Alsbald ließ nun Garibald Theodelinde kommen, und als Autharis sie anblickte, sprach er mit Freuden: »O wohl, sie ist wert, über uns zu herrschen!« Und er erbat sich, daß sie ihm den Becher reiche. Theodelinde schenkte den Becher voll, reichte ihn zuerst dem Ältesten und dann dem König, den sie kannte; Autharis trank, und als er ihr den Becher zurückgab, berührte er, ohne daß die anderen es merkten, mit seiner Hand Theodelindes Finger und fuhr sich mit der Rechten über das Gesicht. Theodelinde vertraute voll Scham, was ihr widerfahren war, ihrer Amme an, diese aber erwiderte ihr: »Gewiß war der, so dich berührte, dein Bräutigam selber, denn ein Geringerer hätte es nicht gewagt; dieser aber ist so hoch und herrlich von Gestalt, daß er ein König und dein Gemahl zu sein wohl verdient.« Autharis zog bald darauf mit seinen Genossen von Garibalds Hof fort, und die Bayern gaben den Langobarden bis an die Grenze das Geleit. Beim Abschied aber erhob sich der Langobardenkönig im Bügel, warf seine Streitaxt in einen Baum und rief: »Solche Wurf e tut Autharis!« Daran erkannten ihn die Bayern. Nicht lange Zeit darauf kam Theodelinde ins Langobardenland, und die Hochzeit wurde auf dem Sardisfeld oberhalb Verona mit großer Pracht und Herrlichkeit begangen.
Das nächste Gemach ist mit neun Szenen aus dem Ritterleben (nach Schwinds Kompositionen von Glinck, Neher und Nielson) geschmückt; wir sehen, wie der Knabe die Kunst, Rosse zu tummeln, erlernt, wie der Jüngling die erste Waffenwache tut, wie er den Ritterschlag erhält, wie der Ritter den Preis des Turniers empfängt; Falkenjagd, erste Liebe, des Kreuzfahrers Abschied, Kampf im Morgenland und Heimkehr runden sich zum schönen Ganzen.
Und so hätten wir denn alle Räume Hohenschwangaus durchwandert und verlassen diese Stätte, die einst dem Schöpfer einer neuen Zeit, dem Mönch von Wittenberg, zum Asyl geworden ist, freudig, daß wir, wohin wir im Vaterland uns auch wenden – in Königsstädten wie im Schoß der Gemeinwesen und im stillen, von der Welt abgeschlossenen Alpental –, der deutschen Kunst Hand in Hand mit der Geschichte begegnen. Und dennoch hallt uns gerade hier, wo das Geräusch des Menschenverkehrs uns nicht erreicht, wieder das Bedenken in den Ohren, das schon mancher, der den blendenden Schein vom Wesen zu scheiden lernte, schweren Herzens erwog: »Ob unsere Geschichte nicht schon abgeschlossen ist, da uns nichts zu tun übrig scheint, als sie durch die Kunst zu verherrlichen? Ob jene Zeiten nicht den Abend eines Volks verkündigen, in welchen es bewundernd und jauchzend die Stein- und Erzbilder großer Vorfahren umsteht?« – Nein! Fort mit solchen Bedenken, solange wir ein Fünkchen Lebenskraft in uns noch spüren und nicht jedem milzsüchtigen Exorzisten des Geistes, der die neue Zeit bewegt, freies Feld lassen wollen. Im Bewußtsein liegt die Macht der Gegenwart, und wie ihm die deutsche Kunst, gerüstet gleich Pallas, plötzlich entsprang, so bewahrt es noch schöpferische Kraft genug, um jene große Reihe von Geistestaten zu zeugen, die dem deutschen Volk, wenn es seine geschichtliche Aufgabe erfüllen will, noch zu vollenden stehen – Ulrich von Huttens ruheloser Geist harrt seit drei Jahrhunderten noch immer der Erlösung!
Und so laßt uns, von Zukunftshoffnungen erfüllt, die frische Bergluft saugen und, einem verheißungsreichen Omen folgend, die nächste Umgebung Hohenschwangaus, die Jugend, aufsuchen. Ein herrlicher Wald nimmt uns auf, und das Auge, vom Schauen so vieler Tatenbilder ermüdet, ruht auf den großartigen Massen der Laubpartien, durch deren Lichtung es den im reichsten Zauber des Farbenspiels sanft schimmernden Spiegel des Bannwaldsees erblickt. Von der Höhe bietet sich eine göttliche Fernsicht – das Schloß im Vordergrund, weiterhin die walddurchbrochenen, mit freundlichen Dörfern besäten Matten, der Lech wie eine Zauberschlange blitzend hingestreckt.
Sieben Stunden von der grünen Bank erreichen wir die Loisach und Garmisch, nicht weit davon liegt Partenkirchen in einer von Gebirgen umdämmten Ebene idyllisch gelegen. Von Garmisch aus lohnt sich eine Wanderung nach der Ruine Werdenfels, wo einst die Grafen Eschenloh saßen. An einer Quelle führt der Weg durchs Tal fort, an dem Teufelsbach (einem Wasserfall) und der Schweige Wank vorbei, die erste bewaldete Höhe des Kramers hinan. Da, wo einst der Burghof gewesen ist, entfaltet sich nun ein herrliches Panorama: das Dörfchen Wamberg, die Antoniuskirche zu Partenkirchen im Vordergrund, im Hintergrund die schroffen Wände des Wettersteins und der Zugspitze, an der Tiroler Grenze, 10 127 Fuß über der Meeresfläche, die rechte Warte und der stete Weiser im Hochland. Von der Terrasse des Schlosses aus erblicken wir das Farchanter Tal.
In Partenkirchen fesseln die Antoniuskirche mit Fresken von dem Tiroler Joh. Holzer und einem Altarblatt von dem Venezianer Litterini und die Pfarrkirche mit einem Altarblatt von dem Letztgenannten unsere Aufmerksamkeit. Früher war die Straße von Augsburg über Schongau und Partenkirchen nach Innsbruck – »die Rottstraße« – von nicht geringer Bedeutung für den Handel.
Auch Ettal ziehen wir in den Rayon von Hohenschwangau. Wir erwähnten früher die Überlieferung von dem alten freiheitsstolzen Ethiko, der sich aus Unmut, daß sein Sohn Heinrich »mit dem goldenen Pflug« um den Erwerb großer Lehen die alte Freiheit der Welfen aufgegeben, in die Wildnis des Scharnitzer Waldes zurückgezogen hat. Kaiser Ludwig der Bayer gründete in jener Waldeinsamkeit, die er lichten ließ, einem Madonnenbild zu Ehren, das ihm zu Rom (so meldet die Sage) ein unbekannter Mönch mitgegeben hatte, das Kloster Ettal und gab der neuen Stiftung höchst eigentümliche und den Geist des großen Kaisers scharf charakterisierende Satzungen (vom 17. August 1332). Zwanzig Benediktinermönche – darunter vierzehn Priester –, dreizehn Ritter mit ihren Frauen und Dienern, endlich sechs Witwen, deren Gatten sich durch Tapferkeit ausgezeichnet hatten, sollten Ettal gemeinschaftlich bewohnen. Einer aus der Zahl der Ritter sollte als Meister über das Kloster walten; daneben war auch eine Meisterin, die von dem Meister und den Rittern erwählt wurde, aber nicht des Meisters Frau zu sein brauchte; dieser sollten die im Kloster lebenden Frauen unterworfen sein; alle Gelübde aber empfing der Meister. Waren ein oder alle Ritter abwesend, so mußten die Frauen derselben bei der Meisterin schlafen. Die Kinder, die im Kloster geboren wurden, durften nur bis zum erreichten dritten Lebensjahr dort bleiben. Alle anständigen Vergnügungen, wie Falkenbeize, Jagd, Armbrustschießen, waren erlaubt; Tanz, Würfelspiel um Geld, Zechgelage jedoch verboten. Die Tafel war für beide Geschlechter gemeinsam, doch mußten die einzelnen täglich ihre Plätze wechseln; während des Mahls herrschte Stille und das Anhören einer geistlichen Vorlesung war geboten. Die Verpflichtungen der Ritter und der Frauen waren: den Chor zu halten und fünfmal im Jahr das Abendmahl zu empfangen. Die Tracht der Ritter war in Grau und Blau – goldene Gürtel, beschlagene Messer und ein Ring ihre Abzeichen; die Tracht der Frauen in Blau. Ritter und Frauen verloren ihre Pfründen, wenn sie wechselseits die Zucht vergaßen. So suchte der ebenso tief religiöse wie hell denkende Kaiser das Mönchstum mit dem Rittertum durch die Humanität einander zu nähern, das eine durch das andere zu veredeln. Nach seinem Tod zerfiel die Stiftung, die er mit manchen Schenkungen reich bedacht hatte, da seine Söhne die meisten Einkünfte derselben sich aneigneten, und sie bestand nur als Benediktinerabtei fort. –
Unseren vierten Ausflug von Hohenschwangau beginnen wir von der ein halbes Stündchen von der Burg entfernten »roten Bildsäule« auf dem Schwarzenberg. Da ist eine Platte, von der wir zu unseren Füßen den wilden Fall des Lechs schäumen – und den herrlichen Gau unabsehbar vor uns entfaltet sehen.
Der Ausflug nach dem Städtchen Vils, dem Vilstal, den Ruinen von Vilsegg und Falkenstein ist nicht weniger lohnend; der interessanteste jedoch von allen wohl der nach Reutte, dem Plansee und zur Ehrenberger Klause, den wir bereits früher angedeutet haben.
Wie von einem schönen Märchentraum erwachend, finden wir uns plötzlich wieder zu Schiff auf der Donau; statt jener himmelanstrebenden Felsen, deren graue Wände im Morgenrot wie Karfunkel glühen; statt jener lieblich einsamen Täler mit dem saftigen Grün ihrer Wälder, aus denen Turmspitzen hervorragen; statt jener schroff umhegten Seen, aus denen wir, wenn sie spätabends dampften, die schönen Nixen emporsteigen sahen, wie sie die Fülle der Glieder jungfräulich-üppig im klaren Wellenspiegel beschauten; statt der tosenden Wasserstürze, über denen hoch auf den Klippen die Herden ruhig grasen – bietet uns das linke Ufer des Stroms nur sanfte Anhöhen und das rechte eine weite, trostlose Fläche. Wir empfinden eine Stimmung, jener nicht unähnlich, die den wackeren Kater Murr nach reichlich genossenem Katzenpunsch überfiel und von der uns Goethe versichert, daß die Perser sie Bidamagbuden nennen. Kurz, wir sind aus den üppigen Armen der Poesie unversehens in die dürren der Prosa gekommen; und mag die letztere noch so geschäftig mit uns kosen, wir überhören alle historischen, merkantilischen und staatswissenschaftlichen Aufschlüsse, durch die sie uns zu zerstreuen und den Ufern, an denen sie uns vorüberführt, in unseren Augen Interesse zu verleihen sucht. Und dennoch übermannt uns, sosehr unsere verwöhnte Phantasie sich auch sträuben mag, in dieser Öde die erhabene Poesie, welche in der Konsequenz der Willenskraft liegt, die sich die Natur unterwirft.
Solche Gedanken erweckt uns der Anblick ebenjenes Mooses, der den Landschafter zur Verzweiflung bringt, wenn er es an einzelnen Stellen, wo keine Inselauen ihm die traurige Aussicht verwehren, gewahrt. Denn sobald wir das am linken Ufer auf einer Anhöhe gelegene Dörfchen Ried hinter uns haben, steuern wir bis Ingolstadt zwischen zahlreichen Inseln hindurch, um die der Strom sich in Arme zersplittert. Das Donaumoos zieht sich von Schloß Grünau bis Ingolstadt hin. Wahrscheinlich hatte die Donau, die in früheren Zeiten von Weichering nach Manching floß (wo noch heute der Graben die Alte Donau oder die Sanderach heißt) und bei hohem Wasserstand die Ach, die das Moos durchschneidet, in das Moos (einst wohl der Grund eines großen Sees) trieb, das allmähliche Austrocknen desselben verhindert. Es sei uns erlaubt, über das Donaumoos und dessen Kultivierung die Worte des wackeren Schultes »Donaufahrten«, Bd. 1. hier einzuflechten.
»Mehr als 2275 Millionen Quadratschuh oder mehr als 4 deutsche Quadratmeilen«, berichtet Schuhes, »lagern hier in einem Sumpf begraben, in dem das darauf weidende Vieh meist bis über die Knie, oft bis an den Bauch im Schlamm waten mußte und öfters ganz und gar in demselben versank. Einige geistreiche und patriotisch gesinnte Männer, Stephan Freiherr von Stengel, Karl Freiherr von Aretin, unternahmen es, des alten Grafen von Pappenheim und des Herrn Lanz Vorschläge zu prüfen, zu berichtigen und zu verbessern, ihrer Zeit und den Umständen anzupassen und durch Herrn von Riedl ausführen zu lassen. Der Sumpf wurde durch die Bemühungen dieser Männer trockengelegt, und die ganze weite Strecke von Pöttmes bis Oberst wurde, auf 20 Stunden im Umfang, dem Vaterland wieder geschenkt. Binnen drei Jahren, vom Jahre 1791 bis 1794, geschah diese herkulische Arbeit mit einem Aufwand von etwas mehr als einer halben Million (530 000) Gulden, die teils die Regierung, teils einige Freunde des Vaterlands auf Aktien vorgeschossen haben. 36 000 Tagwerke wurden an die ehemaligen Besitzer, welche diese Moorgründe bloß lehensweise besaßen, als Eigentum verteilt, und 12 000 Tagwerke fielen der Aktiensozietät zur Anlegung neuer Kolonien anheim; denn es wurde eine Gesellschaft für 30 Aktien, jede Aktie zu 10 000 Gulden, errichtet, um den nötigen Vorschuß zur Bestreitung der Ausgaben zu erhalten. Die Besitzer des Moors gaben ein Drittel desselben der Sozietät als Kulturkosten und erhielten dafür zwei Drittel trockengelegt und beieinanderliegend wieder zurück mit 15jähriger Steuerfreiheit, außer 4 Kreuzern jährlichen Beitrag für jedes Tagwerk zur Unterhaltung der Kanäle. 2307 5/8 Tagwerke hatte die Sozietät gekauft um 21 044 Gulden. Vor der Trockenlegung war das Moor höchstens 400 000 Gulden wert und trug dem Staat 6000; nach derselben wurde jedes Tagwerk bloß als Wiese auf 100 Gulden geschätzt: obige 36 000 Tagwerke also auf 3 600 000 Gulden. Von den übrigen 12 000 Tagwerken sind 8000 Acker geworden, 4000 Wiesen geblieben. Das Tagwerk Acker zu 300 Gulden angeschlagen, gibt 2 400 100 und mit den Wiesen 2 800 000 Gulden. Das ganze Moor wurde also durch die Trockenlegung wenigstens 6 Millionen wert. Zuvor konnte man es kaum auf 160 000 Zentner schlechtes Heu rechnen, dessen es nun an 800 000 Zentner gutes gibt, nebst 16 000 Scheffel Getreide. Der jährliche Ertrag wurde also um 78 4000 Gulden erhöht; wobei noch zu bemerken kommt, daß dort, wo zuvor kaum 6320 Stück Vieh gehalten werden konnten, jetzt über 20 000 genährt werden können. Wo ehedem nur Frösche und Kröten wohnen konnten, sind jetzt Nämlich im Jahre 1818. bloß in einer Kolonie – zu Karlskron – 726 Menschen. Wenn man sich eine deutliche Idee vom Zustand dieses Moores machen will, in dem nach den eigenen Worten des Freiherrn von Aretin ›Kultur noch mehr in ihrer Kindheit lag als irgendwo in Bayern, ja mehr, als man von einem zivilisierten Land Europas jemals glauben sollte; wo mancher Landmann von 80-100 Tagwerken nicht mehr als 24-32 Zentner Heu bekam; wo noch Eisschollen lagen, während überall das Getreide von den Feldern eingebracht war; wo Epidemien Hunderte von Menschen wegrafften und Viehseuchen nie aufhörten zu wüten‹ – so versetzte man sich auf einen Augenblick in seiner Phantasie an die Stymphalischen Sümpfe, und kaum wird die Wirklichkeit hier hinter diesem gräßlichen Ideal zurückbleiben.« – Zweiunddreißig Kolonien befinden sich jetzt auf dem Donaumoos, mit mehr als dreieinhalbtausend Bewohnern, in 210 Ortschaften, meist auf dem unteren und mittleren Teil jener großen Fläche.
Die Ortschaften zu beiden Ufern des Stroms – am linken Ried, Joßhofen, Bergheim, Ergötsheim und Gerolfing, am rechten das Jagdschloß Grünau mit dem unfernen Gestüt Rohrenfels, Weichering – sind unbedeutend. Bald erreichen wir Ingolstadt.
Die Lage Ingolstadts bietet dem Auge kein landschaftliches Interesse, und der Gesamteindruck der architektonischen Massen (die massiven neuen Festungsbauten schließen sich als steinerner Rahmen um die aneinandergedrängten Giebel, aus denen die Liebfrauenkirche emporragt) ist kein bleibender. Gleichwohl fordert uns der geschichtliche Charakter der Stadt auf, kurze Frist hier zu weilen. Aus Römersteinen, die man an der Schutter fand (die durch Ingolstadt fließt und bei der Brücke in die Donau mündet), glaubte man schließen zu können, daß die Weltherrscher auch hier eine Niederlassung – Anglipolis, Chrysopolis, Aureatum – gegründet hätten, und von dieser alten Engel- oder Angelnstadt oder Goldstadt wurden die wunderlichsten Fabeleien erzählt; ebenso brachte die Sage durch eine naive Verwechslung der Namen Karl den Großen mit Ingolstadt in Berührung. Gewiß aber ist, daß Ingolstadt zur Zeit Ludwigs des Deutschen ein Dorf war, das er an Niederaltaich schenkte. Durch Kaiser Ludwig den Bayern wurde es zur Stadt, dessen Mutter Mechthildis bald in Neuburg, bald hier wohnte. Nach Ludwigs Sieg bei Gamelsdorf, zu dem mit den Bürgern von Landshut, Moosburg und Straubing auch die von Ingolstadt tapfer beigetragen haben, gab der Fürst der letzteren den feuerspeienden blauen Panther (wie den Landshutern die drei Helme statt der Pickelhauben) ins Wappen der Stadt.
Bei der Teilung der Herrschaft unter die Söhne des Herzogs Stephan mit der Haft erkor der älteste, Stephan, der Knäufel zubenannt, Ingolstadt zu seinem Hofhalt, erweiterte und verschönerte die Stadt. Sein Sohn Ludwig im Bart, so genannt von der ritterlichen Gesellschaft der Gebarteten, brachte vom Hof seiner Schwester Isabella, der Gattin des unglücklichen Karls VI. von Frankreich, einen ungeheuren Schatz und kostbare Heiligtümer nach Ingolstadt; unter den letzteren ein Bild der Gottesmutter auf dem Thorn, von kunstreicher Goldschmiedearbeit und mit Juwelen geschmückt, das er später in die Liebfrauenkirche stiftete, deren Bau er 142.5 durch den Meister Konrad Glätzel (nach dem Vorbild des Ulmer Münsters) begann und 1439 vollendete.
Das lange Leben dieses Ingolstädter Herzogs Ludwig im Bart ist eine erschütternde, tragische Trilogie. Seine Jugend füllt der übermütige Trotz gegen den Vater, der ihm die Neigung des Herzens beschränkte, füllen Abenteuer mit schönen Frauen, mit deren Hingebung er, leichtsinnig von Lebenskraft strotzend, sein Spiel treibt, füllt das Glück, das ihm in Frankreich bei jedem Anlaß dient wie der Böse dem, der sich ihm verschrieben hat; im Mannesalter entfaltet sich Ludwigs Charakter in voller Fürstlichkeit; Mut, Freigebigkeit, Geschmack, Milde gegen die Armen, Strenge gegen die Geistlichkeit, Trotz gegen seinesgleichen, deren er keinem – dem Kaiser selber nicht – nachstehen will, liefern die Züge zu seinem Bild; aber schon weist ihm das Glück, die mephistophelische Seite herauswendend, hinter dem Rücken die Faust. Er will sein gutes Recht wider den Feind, den Beleidiger, den Meuchler Heinrich von Landshut erlangen, und bei all seinem Mut kann er es doch nicht gewinnen. Zudem: wie kann dieser gewaltige Geist in dem engen Ingolstadt Raum für Taten finden, den schon Paris zu klein dünkte? Der Unmut über die Erbärmlichkeit, die sich von allen Seiten her wider ihn auflehnt, verdüstert sein leidenschaftliches Gemüt. Soll er's ertragen, wenn ihm zu Konstanz der Heilige Vater, vor dem er, Genugtuung erflehend, niederkniet, statt solcher – den Segen gibt; wenn der Kaiser, statt ihm Gerechtigkeit zukommen zu lassen, ihm die Worte zuwirft: »Denkt an Euren bösen Fuß, lieber Oheim, und geht nach Hause«, und dem Herzog von Landshut, dem Meuchler, noch obendrein einen Begnadigungsbrief schreibt? Da drängt es ihn, sich selber Rache zu schaffen wider den »fahrigen Mörder, der sich Heinrich von Bayern nennt«; die Ritterschaft tritt unter Kaspar Törringer für ihn zusammen; aber jener Heinrich von Landshut bricht in des Törringers Abwesenheit dessen Burg mit Feuer und Schwert, und als Kaspar ihn auf die rote Erde vor das heimliche Gericht lädt, weiß Heinrich es arglistig so zu lenken, daß der Törringer selber dem Dolch der Feme erliegt. Ludwig im Bart aber wird (in der Allinger Schlacht) besiegt und geächtet.

Ingolstadt
Das letzte Drittel seines sturmbewegten Lebens füllt der Kampf, in dem er sich gegen den eigenen Sohn, Ludwig den Buckel, den ihm Anna von Bourbon geboren und den er seinem Bastard Wieland, dem Sohn Canetas von Freiberg, oft nachgesetzt hat, seines Lebens und seiner Freiheit wehren muß. Der unnatürliche Sohn erstürmt, mit des siebenundsiebzigjährigen Vaters altem Feind Heinrich von Landshut und mit Albrecht von Brandenburg im Bunde, Neuburg, wo jener sich gegen ihn hielt, läßt ihm Fesseln anlegen und wirft ihn in einen tiefen Kerker.
Aber kaum wenige Monate, nachdem der unnatürliche Sohn des Landes Huldigung empfangen hat, muß er selber dem Tod huldigen. Seine Witwe Margerethe aber, mit dem Hofmeister von Waldenfels in Buhlschaft lebend, verkauft den gefangenen Greis an Heinrich von Landshut, der ihn an der Brücke von Ingolstadt übernimmt und nach Burghausen am Inn in sicheren Gewahrsam führt. Noch im Kerker, fast achtzig Jahre alt, verwirft Ludwig im Bart jeden Vorschlag zu irgendeinem Vergleich und verlangt nichts als sein gutes Recht. In der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1477 stirbt er im Gefängnis zu Burghausen. Selbst noch seine Leiche sollte so bald nicht Ruhe finden; die Klöster alle, die einst die starke Hand des Herzogs empfunden hatten: Fürstenfeld, Scheuern, Münchsmünster, Indersdorf, Geißenfeld, Anger, Raitenhaslach, Baumburg, Seeligental, Altenhohenau und Chiemsee verweigerten dem Toten das christliche Begräbnis so lange, bis aller Schaden, der ihrem Besitz durch ihn widerfahren, ersetzt worden war. Heinrich von Landshut löste endlich, von seinem Gewissen oder vom Aberglauben gepreßt, die Leiche aus, und ohne Prunk wurde sie in Raitenhaslach bestattet.
Ingolstadt aber kam, da der Buckel, den des Himmels Arm getroffen hatte, keine Kinder hinterließ, an Heinrich von Landshut. Dessen Sohn, Ludwig der Reiche, gründete 1471 die Universität, die bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts blühte; 3000-4000 Studenten sollen die Hochschule zur Zeit ihrer Blüte besucht haben, darunter Ferdinand II. von Österreich (später Kaiser), 36 Grafen, 45 Barone, 70 Edelleute. Viel verdankte die Hochschule in ihrer ersten Blütezeit dem gelehrten Kanzler Leonhard von Eck. Als sie aber den Jesuiten anheimfiel, wurde die Strenge des Dogmas der Forschung gefährlich, und mit der Verknechtung der Wissenschaft begann der Verfall der Hochschule. 1800 wurde sie nach Landshut verlegt. Johann Reuchlin, Lorenz Hochwart, Peter Apianus, Conrad Celtes, Thurnmayer (Aventin), der Geschichtsschreiber Bayerns und der Wiens, Dr. Wolfgang Lazius (Ferdinands I. Leibarzt), Gewold, der Rechtsgelehrte und Geschichtsforscher (Verfasser der »Defensio Ludovici IV. imperatoris ratione electionis«), der gelehrte Arzt Leonhard Fuchs, der Odendichter Jakob Balde und viele andere in älterer, Kreittmayr, Weißhaupt, die Baader in neuerer Zeit sind der Stolz der Hochschule Ingolstadt; ob auch die Gesellschaft Jesu, seit Herzog Wilhelm einige Väter aus derselben sich vom Papst erbeten und Claude Jay, Alfons Salmeron und Peter Canisius von ihm erhalten hatte, 1557 kamen ihrer achtzehn, als Seelsorger und Lehrer, nach Ingolstadt. fast zwei Jahrhunderte lang dieselbe als Pflanzschule verwendete, um Bayern mit Männern nach ihrer Zucht zu versorgen, was Bayern empfand und in langer Nachwirkung zum Teil noch heute empfindet. Ludwig des Reichen Sohn, Herzog Georg von Landshut, stiftete für arme Studierende das Georgianum.
Nach dem Tod Ruprechts von der Pfalz und nach der Stiftung der jungen Pfalz an der Donau für dessen Waisen, endlich nach der Erklärung der Unteilbarkeit Bayerns durch Herzog Albrecht (1506) wurde Ingolstadt für immer altbayrisch. Die Befestigung der Stadt wurde durch den Sohn des Herzogs Wilhelm, Albrecht (V.), da er in Ingolstadt auf der Hochschule war, 1539 begonnen, später durch die Kurfürsten Maximilian I. und dessen Sohn Ferdinand Maria ausgeführt und verstärkt;
»München soll mich nähren,
Zu Ingolstadt will ich wehren«,
pflegte der erstere oft zu sagen. Im Schmalkaldischen Krieg beschossen der Landgraf von Hessen und Herzog Johann von Sachsen die Mauern Ingolstadts. Das schöne »Newe Landsknechtslied von M. D. XLVII.« singt von dem Landgrafen:
Zu morgen hub er zu schiessen an,
Wol vber die Kaiserlich kron
Mit kartaunen und schlangen,
Das trib er mer dann drey gantz tag,
Dieweil er dann vor Inglstat lag,
Der schimpff der wolt sich machen.
Und es gibt dann dem Landgrafen die prophetische Warnung in Kauf:
Landtgraff du darfst nit schelte noch fluche,
Der Kaiser wird dich selbst noch suche,
Auf mancher griener hayde,
Gschicht das nit bald, mit grossem walt,
Zu yeder zeit in seiner gstalt
Wirstu haben gross layde.
Im Jahr darauf traf diese Unglücksweissagung zu Mühlberg ein. Im April 1632 kam Gustav Adolf vor Ingolstadt, wo der greise Tilly mit dem Tod rang, ließ zweimal gegen die äußerste Schanze vor der Brücke Sturm rennen und büßte nebst zahlreichen Truppen den Markgrafen Christoph von Baden-Durlach ein, dem in seinem Zelt eine Falkonettkugel den Kopf wegriß; dem König selbst wurde durch ein Falkonett »die Feige«, das Pferd unterm Leib erschossen. Auch die Verräterei Farrensbachs, der dem König die Stadt zuwenden wollte, mißglückte. Im nächsten Jahr widerstand Ingolstadt ebenso glücklich dem Herzog von Weimar, später den Angriffen Horns und Banners, als sei dieser heilige Herd der Altgläubigkeit, von der Gesellschaft Jesu gepflegt, unüberwindlich vor den Helden des Evangeliums. Im Spanischen Sukzessionskrieg wurde Ingolstadt nach der Schlacht bei Höchstädt blockiert und endlich, als ganz Bayern österreichischem Regiment untertan geworden war, besetzt. 1742 erlitt Ingolstadt eine neue Belagerung durch österreichische Truppen und ergab sich. Moreau ließ die Festungswerke 1800 schleifen; gleichwohl verschanzten sich fünf Jahre danach die Österreicher und 1809 die Franzosen in Ingolstadt.
Von den interessanteren Bauten in Ingolstadt wollen wir zuerst die Liebfrauenkirche besuchen, deren Baugeschichte und Madonnenbild wir bereits früher erwähnten. Ein Sittenzug, den ein altes Buch bei Gelegenheit des letzteren mitteilt, charakterisiert die Glaubensnaivität in Altbayern so hübsch, daß wir uns nicht versagen können, ihn, so unbedeutend er an und für sich manchem scheinen mag, hier wiederzuerzählen. Bei der strengen Werbung unter dem Kurfürsten Karl Albrecht (berichtet der »Staatssekretarius«) wurde einer Bauersfrau ihr einziger Sohn unter die Soldaten gesteckt, und keine Supplik, ihn wiederzuerlangen, fruchtete bei dem Kurfürsten, ebensowenig das tägliche Gebet, das die betrübte Mutter zur Mutter Gottes richtete.
Da nahm jene in voller Verzweiflung dem Madonnenbild das Kind aus dem Arm, legte es in einen Winkel und sprach zur Mutter Gottes: »Nun kannst du auch sehen, wie es tut, wenn man kein Kind hat!« Die Begebenheit machte in der Kirche viel Aufsehen und kam endlich vor den Kurfürsten, der darauf der Mutter ihren Sohn freigab. – In der Liebfrauenkirche sehen wir unter andern die Gräber Herzog Stephans, des von allen Freigläubigen gefürchteten Doktors Eccius, des Ketzerrichters, Tillys und des edlen Gouverneurs von Ingolstadt, Generalfeldmarschall Mercy, der 1645 bei Allersheim fiel; in der Franziskanerkirche ruht Gewold.
Wir besteigen das Schiff wieder, um unsere Fahrt fortzusetzen, und siehe da, wir finden auf demselben so bunte Gesellschaft, wie wir sie bisher entbehren mußten. Wir wollen sie unseren Freunden hiermit vorstellen.
Nicht weit vom Steuerruder lehnt ein Mann in jenen Jahren, die man gemeinhin die besten nennt, soviel Schlimmes einem auch just darin widerfahren kann. Es scheint nicht, als ob unser neuer Bekannter das Gegenteil bezeugen wollte, und doch dampft er so ruhig aus seinem Ulmer Kopf und blickt so pfiffig und unternehmend in die Welt hinaus, als müßte er jedem Unglück, das ihm in die Quere kommt, zurufen: »Aufgepaßt! Der Herrgott verläßt keinen Schwaben.« – Er selbst ist nämlich ein Schwabe, bei Ulm zu Hause, und könnte ein Buch voll und dick schreiben von all den Schwabenstreichen, die ihm das Schicksal bereits gespielt hat. Aber lustig wie ein Husar in die Vierzig eingeritten, hat er jeden Streich parieren gelernt. Er war schon in Frankreich und drüber hinaus in Algier, und als es da nicht glücken wollte, ging er nach Amerika, und als er heimkam, wäre er bald auf den Asperg gekommen. Doch das schadet nichts. Er ist zwar ein Feuerkopf, aber er tut keiner Seele ein Leid. Als ihm alles schiefging, wollte er schon unter die Buchhändler gehen, wie man aus Verzweiflung unter die Soldaten geht; aber sein guter Genius riß ihn noch zu rechter Zeit am Schopf zurück, und nun schifft er nach Wien und will als Maschinist bei einem Theater sein Glück probieren. Ob er alles gelernt hat, wovon er spricht, wissen wir nicht; aber daß er mehr versteht, als man ihm auf sein Gesicht zutrauen sollte, darf man uns auf das unsrige hin glauben. Er sieht aus, als könnte er sich nicht von der Stelle rühren, und doch ist er flink bei der Hand, wo's was zu schaffen gibt. Er muß stets etwas zu tun haben und wäre der unglücklichste Mensch unter der Sonne, wenn man ihn, wie die Schauspieler irgendeines bekannten süddeutschen Hoftheaters, bloß für »Ruhe und Pension« engagieren wollte. Kurz, er ist ein Schwabe vollauf und tüchtig an Leib und Seele.
Der zweite von unserer neuen Bekanntschaft, den wir auf dem aus Latten roh gezimmerten Verdeck des Schiffes in süßem Schlaf ausgestreckt liegen sehen, sollte eigentlich nicht bloß doppelten Fahrpreis (in Anbetracht seines Gewichts), sondern in infinitum bezahlen, wenn man bedenkt, daß er, wo er auch immer sei, ob er stehe oder gehe, liege oder sitze, stets jedem im Weg ist, daß er wirklich auf eine so unanständige Weise gähnt, so zwar, daß die Handwerksburschen vor Schreck die Ruder aus der Hand fallen lassen und der Steuermann sich besorgt umsieht, woher der Windstoß kam. Überdies was das Schlimmste ist – spricht er, wie wir von den andern über ihn hören, von nichts als vom Bier und maßt sich eine solche Herrschaft über alle Schiffsgenossen an, als hinge es bloß von ihm ab, die Donau im Lauf aufzuhalten, wenn ihn irgend jemand geniert. Er ist das personifizierte Phlegma, seines Handwerks ein Bierbrauer, welches Volksstamms, mag jeder leicht erraten, der da weiß, daß er nach Regensburg reist, in Altötting Verwandte hat und über das Augsburger Bier schimpft. Zur größeren Deutlichkeit wollen wir jedoch nicht verhehlen, daß er ein Altbayer ist.
Der dritte von unseren neuen Bekannten ist ein langer, kränklich-gelbbraun aussehender Mann in den Sechzigern; er trägt einen fadenscheinigen zimtbraunen Rock ohne Schnitt, eine schwarze Tuchweste, schwarze Tuchbeinkleider mit Gamaschen, die bis an die Knie reichen, und einen Hut, der »anno damals« bereits außer Mode war, aber noch immer sein Sonntagshut ist. Sein Gepäck besteht in einem zwilchenen Säckchen, das er sorgfältig unterm Arm trägt, in einer weißen Zipfelmütze, die er, um den Hut zu schonen, jetzt aufsetzt, in einem verschossenen roten, baumwollenen Regenschirm und in einer Tabaksdose. Freundlich, fast demütig grüßt er nach allen Seiten hin, als sähe er in den wildfremden Menschen lauter gute alte Bekannte. Es ist so was Kindliches in dieser demütigen Freundlichkeit, daß wir uns von dem alten Mann unwillkürlich angezogen fühlen, und wie fromme Söhne möchten wir es ihm gern so bequem auf dem Schiff machen, wo sich doch niemand um ihn kümmert, daß er sich da wie zu Hause fühle. Es gibt Menschen, die man kennt, ohne sie früher je gesehen zu haben, Menschen, die gleichsam gar keine Individuen, sondern bloß Repräsentanten des Standes sind, dem sie angehören; ehe sie ihre Geschichte erzählen, kennt man diese bereits – und noch weiter hinaus als sie selbst, bis ans Grab. So geht es uns mit dem alten Herrn; er ist auch ein Bayer, seines Standes ein Benefiziat. Solange er noch rüstige Kraft genug hatte, war er Pfarrer gewesen; jetzt in seinen alten Tagen, da er gebrechlich geworden ist, machte man ihn zum »Benefiziaten«. Das ist eine Art von Ruhestand, bei dem es genug Arbeit gibt. Er braucht zwar bei Nacht nicht mehr mit der Wegzehrung zu Sterbenden zu gehen, aber Messe lesen muß er jeden Tag und – wenn Not an Mann – auch im Beichtstuhl sitzen, was im strengen Winter für einen Sechzigjährigen, der an der Gicht leidet, ein hartes Stück Arbeit für fünfhundert Gulden ist. (Wir wissen nicht, ist's mehr oder weniger.)
Und doch ist er bei diesen fünfhundert Gulden in seinem Gott vergnügter als alle eure staatspapierenen Weltkönige in dem ihrigen. Unser alter Benefiziat hat sein Gärtchen und seine Freude an dem darin selbst gezogenen Flor, die Blumen sind ihm wie Kinder; er ißt einen Tag über den andern Fleisch und alle vierzehn Tage sein Hühnchen, und zum Frühstück trinkt er, weil er den teuren Kaffee nicht erschwingen kann, ein Seidel Regensburger Bier. Wenn er sich ein rechtes Vergnügen machen will, so spielt er des Abends auf seiner Violine, derselben, die ihm schon im Seminar die einsamen Dämmerstunden erheiterte. »Und warum soll ich mich nicht freuen?« fragt er uns, die wir die Erzählung seiner einförmigen behaglichen Lebensweise anhörten. »Gott sei Dank; kommt doch im lieben Vaterland jetzt alles wieder ins alte Gleis zurück!« fuhr er freudig fort. Wir horchten auf. Ohne unsere Gegenbemerkung abzuwarten, fuhr er vergnügt fort: »Wissen Sie, woher ich komme?«
»Nun?«
»Von Scheyern«, erwiderte der alte Benefiziat; seine Augen glänzten, seine dürren Hände zitterten vor Freude. »Ja, ja, von Scheyern!« fuhr er hastig fort, als hätten wir ihm widersprochen oder als wollten wir es bezweifeln, was keinem von uns in den Sinn kam. »Das war ein Fest, das hätten Sie miterleben sollen, junger Herr!«
Indessen hatte sich ein schwarzer Pudel, von dem wir erst später erfuhren, daß er dem Schwaben gehörte, mit dem schlafenden Bierbrauer zu schaffen gemacht, und eben untersuchte er mit dem Eifer eines Mineralogen dessen Gesicht. Gleichwohl schlief dieser ruhig fort und rückte nur zuweilen mit dem Kopf hin und wieder, als fühle er eine Fliege auf der Nase. Mittlerweile eilten die Knechte des Schiffsherrn auf das Verdeck, um vom Ufer abzustoßen, und traten in der Hast über den im Weg liegenden Schläfer. Eine nationale Verwünschung ausstoßend, die wir nicht wiederholen mögen, fuhr dieser jetzt empor und gesellte sich schwerfälligen Gangs zu dem kleinen Kreis, der sich um den alten Benefiziaten gebildet hatte.
Dieser fuhr also fort: »Ach, und die prächtige Rede, die der Herr von Kreuzer gehalten hat!«
»Steht's in der Landbötin?« unterbrach ihn der Brauer.
Der Schwabe lächelte pfiffig vor sich hin und schwätzte: »Hab's schon gehört! Wieder eins! Sollten einmal in der Neuen Welt zugucken, meine Herren! Werden dort auch fertig. Herrgott, arbeiten doch die Menschen da drüben wie die Pferde, mit Respekt zu melden!«
Der Brauer glotzte ihn verdutzt an. Der alte Benefiziat war durch die Querreden auch etwas verblüfft; da stieß das Schiff vom Ufer ab. Die Einförmigkeit der Gegend lenkte unsere Aufmerksamkeit bald wieder auf den Benefiziaten, welcher wehmütig aufatmend in dem schön abgehegten, altertümlich zugeschnittenen Park seiner Innenwelt sich erging und endlich wieder begann: »Ja, damals! Die Leute waren gewiß besser und hatten noch Redlichkeit in Handel und Wandel, das kam von der Gottesfurcht und Andacht. Aber, heutzutage, lieber Gott! ... Wären die Klöster nicht aufgehoben worden, so wäre die Französische Revolution nicht ausgebrochen, und alles wäre halt viel gescheiter geblieben. Ach Gott, was haben wir denn von der sogenannten Aufklärung profitiert? Nichts als Unfrieden und Jammer.«
»Jawohl«, unterbrach ihn der Schwabe lächelnd; »meiner Seel', es ist ein schreckliches Unglück in der ganzen Welt! Und das allergrößte, wie fürchterlich viel die Leute schwätzen – Herrgott! Über alles und jedes; wollen alles wissen, was unsereins besser weiß, wollen unsereinem was weismachen; unsereinem!«
»Da haben Sie recht!« meinte der gutmütige alte Benefiziat. »Wenn wir nach Regensburg kommen, fragen Sie nur die Leute, was Ihnen die für Antworten geben werden! Ach, alles wünscht sich die Klöster zurück.«
»Besonders die geistlichen Herren«, bemerkte der dicke Brauer naiv, indem er dem Benefiziaten eine Prise bot. »Meiner Treu, Sie haben recht. Es ist auch himmelschreiend, wie anno anno mit den geistlichen Herren umgegangen worden ist. Und was haben uns die geistlichen Herren nicht alles genützt!«
»Jawohl, was alles nicht?!« meinte der Schwabe (wir müssen am Rande bemerken, daß er ein Protestant mit Leib und Seele ist).
»Es ist ein ganz anderes Korn«, fuhr der Brauer fort, »sein Stück Leben ruhig fortleben zu können, wenn man weiß, daß man auf den Todesfall versorgt ist; den geistlichen Herren kann man schon gar nicht genug danken, daß sie einem alles versorgen: Weib und Kind und Leib und Seel' und halt alles miteinander.«
»Na, es geschieht auch alles mögliche für die Religion«, sprach der alte Benefiziat gerührt; »ich habe schon vieles erleben müssen und werde, hoff's zu Gott, auch noch erleben, daß die Jesuiten in unserem lieben deutschen Vaterland die Schulen wieder in die Hände bekommen wie ehemals. Ach, schauen Sie: wie ich noch studiert habe – ich habe nämlich bei den Jesuiten in Ingolstadt auf dem Gymnasium studiert, bevor ich ins Seminar nach Regensburg gekommen bin –, die Zucht und Ordnung hätten Sie sehen sollen! Da ging Ihnen alles nach dem Schnürchen; alles hatte seine Zeit; und – hören Sie: was für perfekte Lateiner waren wir!? Gott weiß, was die Revolutionsleute den Jesuiten alles nachgesagt haben; aber schauen Sie, das hat ihnen noch keiner abgestritten, daß die jungen Leute Lateinisch bei ihnen lernten wie bei Cicero oder Horaz selber. Und die Ordnung und Sittsamkeit, die damals unter den jungen Leuten war! Ja, da hätte sich keiner unterstehen dürfen, mit der Tabakspfeife über die Straße zu gehen; aber in München sind ja die Studenten bis vor kurzem noch wie Straßenräuber herumgegangen, mit Schnauzbärten und Hetzpeitschen ... Ja, was ich sagen wollte ...«
»Apropos, was wollten Sie denn eigentlich sagen?« unterbrach ihn der Schwabe.
»Ich weiß es wahrhaftig nicht mehr«, erwiderte der Benefiziat gutmütig lächelnd, indem er seine Dose bei der kleinen Gesellschaft die Runde machen ließ; der Brauer, der mit dem Schiffsherrn ein Separatsbündnis abgeschlossen hatte, schlich sich indessen davon, um, wie sich später zeigte, seinem Fäßchen Extrabier zuzusprechen.
Wir hatten indessen Feldkirch (am linken Ufer) längst hinter uns und die langweilige Krümme durchmessen, die die Donau, zwischen öden Auen dahinfließend, bis Klein- und Großmehring beschreibt, und sahen bald Vohburg vor uns, einst der Sitz tatenlustiger und auf allen Turnieren berühmter Grafen, deren Geschlecht im 13. Jahrhunderte erlosch; später die Zeugin des Liebesglücks, das Herzog Albrecht von München mit Agnes Bernauer, seiner Neuvermählten, der schönen Baderstochter von Augsburg, genoß – nicht ahnend, wie bald des strengen Vaters Fürstenstolz es zerstören werde.
»Da liegt auch ein frommer Mann begraben!« sprach der Benefiziat, indem er auf den Ort wies. »Sehen Sie? Dort in der Andreaskirche, meine Herren!«
»Ein Heiliger?« fragte der Schwabe.
»Nein, ein Bauer«, erwiderte der Benefiziat. »Ach, es ist hier ein gar armes Volk, das wenig gute Tage hat. Die armen Leute kommen noch heute zu dem Grab und beten dort. Der fromme Bauer nämlich – müssen Sie wissen – lebte vor zwei- oder dreieinhalbhundert Jahren auf einem Hof nicht weit von dem Ort, verkaufte sein Gut, zog in eine einsame Hütte und gab dort den armen Leuten, sooft sie kamen und soviel er hatte. Aber gottlose Menschen schlichen bei Nacht hin, raubten ihm alles, was er hatte, und hängten ihn auf. Als sein Leichnam gefunden wurde, ging gar das Gerücht, der fromme Mann hätte sich selbst umgebracht, und so wurde er zur Strafe der vermeintlichen Sünde unter dem Galgen eingescharrt, bis endlich die Täter entdeckt wurden; da wurde der Leichnam wieder ausgegraben und feierlich in der Kirche bestattet.«
»Ja, das muß wahr sein«, nahm jetzt der Schiffsherr das Wort, der nur den Anfang gehört hatte und jetzt wieder zu uns trat; »arm ist das Volk in der Gegend, und doch halten die in Vohburg seit alten Zeiten her noch immer auf ihren Jungfernpreis.«
»Wieso?« fragte der Schwabe.
»Ei nun«, antwortete der Schiffsherr, »'s ist ein gar schöner Brauch bei der Gemeinde, daß sie den bravsten armen Mädeln eine Aussteuer gibt, wenn sie sich verheiraten.«
Wir fuhren indessen an Dunzing vorbei und sahen das auf einem aus der Donau emporsteigenden Felsen herrlich gelegene Schloß Wackerstein.
»Dort rechts im Land muß Münchsmünster liegen!« sprach der alte Benefiziat zu einem von den Schiffsleuten.
»Jawohl, geistlicher Herr!« versetzte dieser.
»Das gehörte auch den Jesuiten von Ingolstadt«, fuhr der alte Benefiziat fort; »ach Gott, was ist in Bayern nicht alles zugrunde gegangen. – Ja, was ich vorhin sagen wollte: ich war in Scheyern gewesen, das jetzt, Gott sei Dank, wieder ein Kloster geworden ist.«
»Ist dies dasselbe Scheyern, von dem die bayrische Fürstenfamilie ihren Ursprung herleitet?«
»In dem Völkerbund, der bald nach König Etzels jähem Tod und dem nicht minder jähen Zerfall seines Reiches das linke Donauufer einnahm und in der Folge mit dem Bundesnamen Bajuvarier auftrat, abenteuerten die Schyren, Heruler, Rugier und Turcilingen mit Odoaker nach Italien und stießen den Knaben Augustulus vom Thron. Später zogen die verschiedenen Schwärme der Heruler unter großen Unfällen wieder bis an die Ostsee hinauf. Es wurden die Schyren von den Goten fast vertilgt und nur jene Geschlechter erhalten, die als die ersten und edelsten, als der Hauptstamm, den Namen des Volkes selber trugen. (›De Scyrorum gente, quae tunc supra Danubium considebat, Gothi pene omnes extinxerunt, nisi qui nomen ipsum ferrent‹, sagt Jornandes.) – Das Haupt der Schyren, Luitpold, der Deutschen Held wider die drei großen Gefahren der Zeit – wider Normannen, Marhanen und Ungarn –, war im Kampf wider die letzteren gefallen. Sein Sohn Arnulf, der größte Bayernfürst, nannte sich ›Herzog und König Bayerns und der angrenzenden Lande‹. Sein Sohn, gleichfalls Arnulf, eine Burg an der Ilm sich erbauend, nannte sie nach dem uralten Geschlechtsnamen: Schyren (Scheyern).«
Aus Hormayr, »Historisches Taschenbuch für 1836«. unterbrachen wir ihn.
»Ei freilich, lieber Herr«, erwiderte er im gutmütigen Ton liebevoller Belehrung; »ebendie Stammburg der allergnädigsten Familie, nicht weit von Pfaffenhofen, meine ich. Wie gesagt, sie ist jetzt wieder zum Kloster eingeweiht worden, und Seine Majestät haben dort am ersten Oktober 1838 die königliche Gruft einrichten lassen. Der Herr Geheime Rat von Kreutzer waren als königlicher Kommissär dabei und haben eine wunderschöne Rede gehalten ... Warten Sie, ich habe mir die Hauptstücke davon aufgeschrieben ...« Und nun kramte er in seinem Säckchen, zog einen Bogen gebrochenes Papier heraus, setzte die Brille auf und fuhr fort: »Richtig; im Anfang sprachen der Herr Kommissär, wie Seine Majestät nicht bloß bedacht seien, Großes zu schaffen, sondern auch alles Gute und Bewährte, das im Strom der Zeit untergegangen sei, wieder ins Leben zurückzurufen; und wie Seine Majestät schon lange den Gedanken genährt hätten, diesen alten Sitz der Ahnen des königlichen Hauses, der später siebenhundert Jahre lang dem Gottesdienst geweiht gewesen sei, seiner alten Bestimmung wiederzugeben. Schon als Kronprinz hätte Seine Majestät die Klosterkirche vom Verfall gerettet. Dann sprachen der Herr Kommissär von der Geschichte der Burg und des Klosters. Daß die Burg durch Kaiser Arnulf entstanden sei, und seine beiden Schwiegertöchter, königliche Prinzessinnen von Ungarn, hätten dort vor ihrer Vermählung das heilige Sakrament der Taufe bekommen. Gisela, die Schwester des heiligen Kaisers Heinrich, hätte dort mit dem heiligen König Stephan von Ungarn, der auch in Scheyern getauft worden sei, ihre Hochzeit gehalten. – Und von hier sei die Sendung des heiligen Ulrich durch Kaiser Heinrich und die Grafen von Scheyern ausgegangen, die die Ungarn zu Christen machte. Durch die Teilung der Fürsten sei die Burg verödet und in Verfall gekommen, sagten der Herr Kommissär, und im 12. Jahrhundert habe der Herzog Otto von Bayern sämtliche Agnaten, die damals an Wittelsbach teilgehabt haben: die vom Nordgau, die von Wittelsbach, die von Andechs – wissen Sie, wo der heilige Berg ist –« schaltete der Benefiziat hier ein, »die von Vohburg – wo wir eben vorbeigekommen sind –, die von Valey, die von Dachau – das liegt bei München – und die rechten Scheyern zusammenberufen, ihrer 15 im ganzen, und da haben sie das Kloster ›Zu Unserer Lieben Frauen Ehren‹ gestiftet und sich darin ein ewiges Begräbnis erwählt. Und darin liegen 120 Grafen und Fürsten von Scheyern und Otto der Große, Ludwig I. und Otto der Erlauchte. 1291 aber ist die Gruft geschlossen worden. Und nun wollten Seine Majestät eine neue königliche Begräbnisstätte auf Scheyern erbauen. Dann erzählten der Herr Kommissär, wie die Abtei so viele Privilegien von den Heiligen Vätern und von Kaisern und Königen gehabt habe; und daß von dem ersten Abt des Klosters, namens Bruno, der ein Vetter des Kaisers Heinrich gewesen war, bis zum letzten – mit Namen Martin – vom Jahre 1124 bis 1830 die Abtei 46 Äbte gehabt hätte. Hierauf schilderten der Herr von Kreutzer die großen Verdienste des Ordens vom heiligen Benedikt, dem die Abtei angehörte und nun wieder eingeräumt worden ist – ich habe alles mit Bleifeder getreulich nachgeschrieben. Der Herr Kommissär erzählten auch, wie alles gekommen ist: ›Nachdem schon vor einigen Jahren aus königlicher Freigebigkeit eine bedeutende Stiftung geflossen ist zur Wiederbegründung des Benediktinerordens in Bayern, haben allerhöchstdieselben jüngst diese alte Klosterbesitzung von Scheyern aus Privathänden für allerhöchstpersönliche Rechnung an sich gekauft; gleichzeitig war schon früher die bedeutende Kapitalsumme auf Seiner Majestät Privatkasse angewiesen, die Klosterbaulichkeiten zu dem vorhandenen Zweck wieder herzurichten, welche Arbeiten ihrer Vollendung entgegengehen.‹ Und nun erzählten der Herr Kommissär, daß die braven Bewohner des Landgerichts Pfaffenhofen, in guter Erinnerung an die Wohltaten, die sie von dem Kloster sonst genossen, sich freiwillig angetragen haben, die innere Einrichtung desselben zu übernehmen.«
»Schau, schau«, unterbrach hier den Erzähler der Brauer, der den langsam vorgetragenen Bericht mit Aufmerksamkeit, Freude und Nationalstolz angehört hatte; »das ist brav von den Pfaffenhofnern. Aber in ganz Altbayern hätt's jeder auch so gemacht; da sollen uns die Fremden nur ja nichts nachsagen, die sich alleweil unser Bier schmecken lassen und hinterrücks über uns schimpfen; seit der Dampfschiffahrt ist's vor ihnen schon gar nicht mehr auszuhalten. Aber erzählen Sie nur weiter, geistlicher Herr.«
Das Wort »Dampfschiffahrt« wirkte auf den Schiffsherrn, als hätte er einen elektrischen Schlag bekommen. Er nickte wenigstens zehnmal vor Ärger mit dem Kopf und fing dann geradezu laut zu lachen an – vor Schadenfreude. »Die werden's auch schon empfinden«, rief er endlich, »die über Nacht gescheiter sein wollen als wir Schiffsleute von alters Zeiten her. Geben Sie acht, wie lang sie's treiben.«
»Oh«, entgegnete ihm der weitgereiste Schwabe, »warum nicht gar? Schlecht Wetter? He? Schlechte Prophezeiung? Herrgott! Sollten in Amerika zugucken, Herr Zebelmaier« – er blies durch die Finger –, »geht's wie der Wind! Vom Rhein will ich gar nichts sagen ...«
»Da haben Sie recht«, unterbrach ihn der Schiffsherr lachend, »weil ein solcher Teufelsdampfer dem andern dort in die Rippen stößt, daß es kracht. Alle Augenblicke ein Unglück! Und von eurem Schwäbischen Meer seid nur gar still; da ist's keine Kunst. Aber die Donau verträgt keine Maschinen – die hat ihre Kaprizen, an denen wir alten Schiffsleute, die wir jedes Fleckchen kennen, uns tollstudieren könnten. Heute rinnt das Fahrwasser da, morgen beliebt's ihm dort zu marschieren. Sie ist grad wie eine vornehme Madame, die alles nach ihrem Kopf haben will und alle Tage eine andere Mode mitmacht. Das müssen wir wissen. Wie hieß denn nur geschwind der Franzose, der anno – warten Sie ... anno 19, glaub' ich, in Wien ein Privilegium bekam?«
»Der Chevalier St. Léon«, halfen wir ihm ein.
»Richtig!« fuhr er ganz erhitzt fort. »Ein sauberer Chevalier! Kurz und gut, für die Donau passen keine Dampfschiffe, und der ganze Handel dauert kürzer als bis Sankt-Nimmermehrs-Tag.«
»Aber warum geht's denn in Ungarn?« fragte unser Oppositionsmitglied, der Schwabe.
»Was weiß ich?« rief der Schiffsmeister ganz ärgerlich. »Laßt mich ungeschoren. Verfluchte Neuerungen! Warum soll jetzt das auf einmal nicht mehr gut sein, was Gott weiß wie viele hundert Jahre lang gut gewesen ist? Hol's der Teufel!«
»Wenn aber die Menschheit durch die Neuerung gewinnt?!« hob der Schwabe im pathetischen Ton eines Kanzelredners an. »Bequemlichkeit, lieber Freund, Schnelligkeit, Billigkeit, Sicherheit was wollt ihr da mit euren alten Schlendrianswirtschaften?« Immer eifriger fuhr er fort: »Wir wollen's beim alten lassen, sagt ihr! Prost die Mahlzeit. Herrgott! Wenn ich bis über beide Ohren im Pech stecke, kann's mich da trösten, wenn ihr phlegmatisch sagt: ›Wir wollen's beim alten lassen‹, statt daß ihr mich aus dem Pech zieht? Ich will mir den Mund nicht verbrennen, aber Gedanken sind zollfrei ...«
»Und Ihr seid ein Ketzer von oben bis unten!« versetzte der Schiffsherr, indem er, in Ermangelung anderer Widerlegungsgründe, unserem Oppositionsmitglied den Rücken wandte und zu seinen Leuten ging.
Indessen sind wir an Pförring vorbeigesteuert, wo Römersteine und Römermünzen gefunden wurden und Karl der Große den Bayernherzog Tassilo umzingelte. Nicht weit davon erblicken wir Marching, von dessen Heilquelle, die ihrem eigentümlichen Geruch einen nicht sehr ästhetischen Namen verdankt, uns der alte Benefiziat wahre Wunder erzählt. Sie stürzt mit einem ziemlich dicken Strahl rauschend von einem Felsen herab, ist im Sommer eiskalt, im Winter dagegen lauwarm; das Wasser wird sowohl zum Bad als auch zum Trinken mit gutem Erfolg angewandt. Überhaupt sprudeln in der Umgegend viele Heilquellen, so auch bei Gögging eine sehr reichhaltige. Oberhalb Pförring und Marching beginnt die Römerstraße, die das Volk den Hochweg oder die Pfahlhecke nennt.
Dann erblickten wir Mauern mit seinem Gnadenbild und Neustadt, in dessen Nähe – nicht weit vom Goldausee, im Wald – noch Reste der Römerschanze sind. Der Überlieferung zufolge baute Theodo die Stadt, die urkundlich im Jahre 1272 (unter Ludwig dem Strengen) erwähnt wird. Unter Kaiser Ludwig dem Bayern war Albrecht von Rindsmaul, dem sich Friedrich der Schöne in der Ampfinger Schlacht um die deutsche Krone gefangengab, hier Pfleger. In den Zeiten der Teilungen Bayerns mußte Neustadt oft schlimmes Ungemach leiden; im Dreißigjährigen Krieg erlag es 1632 den Schweden unter Horn, 1632 dem Herzog von Weimar, 1648 abermals den Schweden. Viel wird von dem frommen Aberglauben erzählt, dem die Bewohner der Stadt und der Umgegend bei den häufigen Überschwemmungen, Seuchen und anderen Landplagen huldigten.
»Sehen Sie«, sprach der alte Benefiziat, »es leben hier gar brave Leute und haben von der Donau und von der Abens, die von Gögging her in die Donau fließt, schrecklich viel zu leiden. Es ist hier viel Morast und schlechtes Futter für das liebe Vieh, daß es gar zu oft krank wird und dahinstirbt.«
»Gerade wie der Mensch, wenn er nichts als saures Bier zu trinken bekommt«, meinte der Brauer.
»Wie der Menschengeist, wenn er sich auf etwas anderes als sich selber verläßt, verlassen ist und untersinkt«, ergänzte jemand aus der Gesellschaft in Gedanken den trivialen Vergleich des Altbayern.
»Aber die guten Leute haben ihr rechtschaffenes, frommes Vertrauen«, fuhr der Benefiziat fort, »und ein solches läßt nicht zuschanden kommen. Sehen Sie«, erklärte er uns wie ein treuer alter Vater seinen Kindern, »ich weiß nicht, ob's noch so ist wie in der schönen Zeit, da ich jung war und in den Vakanzen oft nach Neustadt kam; freilich jetzt ist alles in der Welt aufgeklärt worden, aber ich glaube doch, daß sie hier noch am guten Alten hängen. Also damals, wenn das Vieh krank wurde, trieben sie es auf die Weinlände und kamen in Prozession mit einem Heiligtum, und die Plage verschwand vor dem inbrünstigen Gebet. Zu dem heiligen Sebastian – ich weiß es noch wie heute – hatten sie ein besonderes Vertrauen; auch zu dem heiligen Magnus, und es sind wirklich, was man sagen kann, Wunder geschehen; aber freilich – der rechte Glaube gehört dazu; für den, der ihn nicht hat, liebe Herren, gibt's keine Wunder.«
Unwillkürlich fielen uns Fausts Worte ein: »Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind!« Und, wenn wir über die Ironie lächeln mußten, die sich in die salbungsvolle Rede des alten Landgeistlichen, ohne daß er sich deren bewußt war, eingedrängt hatte, so hätten wir doch weinen mögen über die Kindesunschuld, in der er so ruhig, so sicher stehengeblieben war, während alles ringsum seither groß geworden ist; und doch hätten wir es nicht vermocht, seinen schönen Kindheitstraum zu zerstören, und ohne deswegen Heuchler zu sein, nickten wir ihm so beiläufig zu, daß er unseren Beifall für Teilnahme an seiner Überzeugung halten konnte.
Neustadt fast gegenüber liegt Irnsing, unterhalb dessen die Römerwerke sich fortsetzen; am anderen Ufer, vor Eining (Aventins »Cenum«, Auch ein Jupitertempel und Spuren einer Römerstraße wurden hier entdeckt. zeigen sich die Reste eines Römerkastells. An Gögging vorbei eilt, wie wir durch den Benefiziaten bereits wissen, das Flüßchen Abens der Donau zu.
Wir können hier nicht umhin, des Städtchens Abensberg zu gedenken, das ungefähr 2. Stunden von Neustadt entfernt liegt, wo Johann Thurnmaier (Aventinus) geboren wurde: Einst herrschten dort die mächtigen Grafen von Abensberg, deren Namen in Bayerns Geschichte oft genannt werden. Von Babo von Abensberg erzählt die Sage, daß er eines Tages seinem Kaiser, Heinrich II, auf der Jagd nicht weniger als 32 Söhne zugeführt habe, die er (nebst 8 Töchtern) in zwei Ehen gezeugt hatte. Das Geschlecht der Abensberger zerteilte sich in viele Linien: zu Roteneck, zu Raning, zu Moosburg und auf dem Kastelberg. Der Stamm der Abensberger erlosch 1485 mit Nikolaus, an dem Herzog Christoph von München blutige Rache nahm, weil jener 1471 mit Burckhard Rohrbeck und mehreren anderen Rittern ihm, als er im Bad saß und auf Ränke wider Albrecht sann, auf des letzteren Geheiß die Haft angekündigt hatte. Herzog Christoph ritt, seine Rache zu sättigen – nachdem er erfahren hatte, wann Nikolaus von Abensberg München verlassen würde –, mit sechzig Männern von Adel gen Freising und lauerte ihm dort auf; seine Genossen barg er in einem nahen Gehölz, er selbst begab sich nach Weihenstephan und erspähte dort von der Kirchhofsmauer herab den Feind. Als er ihn endlich kommen sah, steckte er einen Eichenzweig auf den Hut, ritt seinen wie zur Schlacht geordneten Genossen voran, ließ den Trompeter lustig blasen und begann den Angriff. Der Pfleger Dießer nahm den Abensberger gefangen, Seitz von Frauenberg, des Herzogs Diener, erstach ihn; Christoph erlegte den Rohrbecker und den Bogner von Kelheim und rief, die Hände erhebend, als er die drei Leichen anblickte: »Geb's Gott, daß allen Falschen von Adel so geschähe, die die Fürsten verhetzen!« Die Güter der Abensberger fielen nach dem Erlöschen des Geschlechts dem Reich anheim und kamen in der Folge an Bayern.
Unterhalb Hienheim, dessen alten Turm wir am linken Ufer erblicken, beginnt der große Römerwall, den das Volk die Teufelsmauer nennt und dessen Spuren sich zwischen Donau und Neckar nachweisen lassen, bei Staubing krümmt sich der Strom zwischen immer höher emporgipfelnden, immer enger einander sich nähernden Kalksteingebirgen; wir schiffen an dem Dorf Weltenburg und dem gegenüberliegenden Stausacker vorbei und erblicken jetzt in lieblicher Abgeschiedenheit die weitläufigen Baulichkeiten des Benediktinerklosters Weltenburg, das uns zu kurzer Rast einlädt. Wir legen an und treten in die Höfe des Klosters, das für das älteste in Bayern und für eine Stiftung des heiligen Rupert gilt. Die Stiftskirche ist ein Werk im verdorbenen neuitalienischen Baustil; alle ihre Gemälde und Schnörkel, alle ihre Marmorarbeiten, selbst ihre – an Ort und Stelle – gepriesene Rotunde vermögen nicht uns zu fesseln; wir besteigen den Berg, der sich hinter ihr erhebt und wandeln zu dem Wallfahrtskirchlein, das auf der Stelle des alten römischen Orakeltempels die Gegend beherrscht. St. Rupert soll den letzteren, von dem man noch die Schallhöhle des Orakels zeigt, zu einer christlichen Kapelle eingeweiht haben; zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde die obere Kirche neu erbaut, stürzte aber bei der Einweihung ein; zu diesem Anlaß geschahen viele wunderbare Errettungen, von denen noch eine Menge von Votivbildern zeugt. Die Lage des Klosters weist sich von diesem Berg aus wie eine Halbinsel; so umspannt der Strom zu drei Seiten das Land wie ein Bogen, dessen Sehne die Römerschanzen bilden.
Wir steigen wieder zu Schiff. Eine der erhabensten Stromgegenden Europas tut sich alsbald vor uns auf; wir steuern durch das Tor des Engpasses, den die riesigen Felsen an beiden Ufern bilden; wie die Perspektive eines Amphitheaters schließen die Konturen der himmelanstrebenden, im Strom wurzelnden Gebirge den Horizont, als wären wir in eine Bucht eingelaufen.
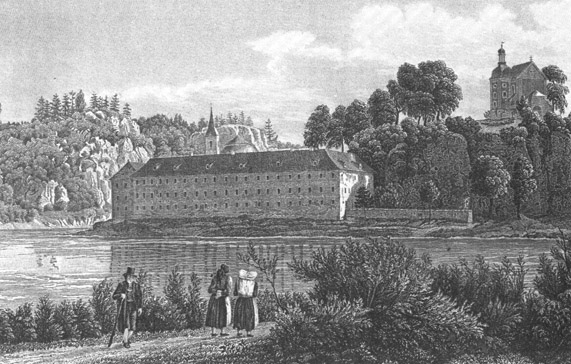
Weltenburg
»Jetzt geben Sie recht acht, lieber Herr!« so nimmt der gefällige alte Benefiziat wieder einmal das Wort (er war, während wir zu Weltenburg die Wallfahrtskirche besuchten, in der Stiftskirche geblieben, und wir hatten ihn wirklich beinahe vergessen). »Jeder von diesen Felsen rechts und links«, fuhr er fort, »hat seinen eigenen Namen, und von jedem erzählen die Leute hier in der Gegend eine Geschichte. Die mächtige Wand hier links zum Beispiel heißt der Kuchelfelsen, und die da rechts die Hohe Rinne; vor vielen, vielen Jahren stürzte sich von diesem Felsen ein Frauenzimmer herab – Gott sei der armen Seele gnädig –; wenn mir recht ist, so war die unglückliche Person verliebt und tat den Frevel aus purer Verzweiflung. Wie tröstlich blickt uns da – links, lieber Herr, links! – das Bild des heiligen Johannes von Nepomuk auf der abschüssigen Felsplatte an. Verzeihen Sie: Sie sind vielleicht lutherisch; Sie lächeln manchmal über unsere Heiligen, Sie haben freilich zu gute Manieren und wollen es mich nicht merken lassen; aber ich merk's doch.«
»Sie irren sich, geistlicher Herr«, erwiderten wir ihm, »wir sind katholisch.«
»Aber der Herr dort!« fuhr der alte Benefiziat beruhigt fort, indem er auf den Schwaben deutete. – »Ach, was ist es denn so Großes, über das Heilige zu spötteln und dem armen Volk sein bestes, sein höchstes Glück rauben zu wollen? Und schauen Sie: wir sind so glücklich in unserem heiligen Glauben; all eure Aufklärung draußen kann uns keinen so innigen Trost, keine solche Herzensberuhigung schaffen! Welch irdischer Freund bleibt uns so treu wie der Schutzpatron, den wir uns im Himmel wählten, dem wir unser Leid in jeder Stunde des Tages und der Nacht klagen können, der uns aus Gefahren rettet, wo alle irdische Hilfe nicht ausreicht? Denken Sie sich zum Beispiel nur, daß wir hier plötzlich von einem Sturm überfallen würden, der unser Schiff gegen diese Felswände schleuderte. Sehen Sie, da ist nirgends nur eine Handbreit Erde, auf die wir uns retten könnten; die Felsen steigen so schroff, daß kein Vogel nisten kann, aus der Donau empor. Und doch bin ich fest überzeugt, daß der heilige Johannes von Nepomuk uns vor dem Untergang retten würde, wenn ein Unglück käme – was Gott verhüten wolle –, denn der heilige Johannes ist ein starker Helfer in jeder Wassernot.«
»Ja, 's ist, weiß Gott, ein schlimmes Gefährt hier bei Sturm und Wetter«, nahm der Schiffsmeister das Wort. »Wie Sie das Bild des heiligen Johannes dort auf der Platte sehen, ist's – meines Gedenkens – schon zweimal weggeschwemmt worden. Auch bei gutem Wind und Wetter ist die ganze Sackgasse vom Haarhof und von der Lutherischen Kanzel, wo wir jetzt bald vorbeikommen, kein Spaß für unsereinen, zu Berg nämlich. Freilich, die Fremden reißen hier Augen und Maul auf, besonders die Maler. Weit und breit sei hier die Donau nicht so schön wie hier, und am Rhein sogar wäre nichts Gleiches, sagen sie! Was tu ich mit all der Schönheit, wenn wir zu Berg keinen Leinpfad haben? Da, gucken Sie hin; an den eisernen Ringen, die in den Felsen stecken, muß so 'n Schiff mit Haken gegen das Wasser gezogen werden. Da hat einer gut malen, während unsereinem das Wasser von der Stirn läuft.«
»... und am Johannistag in jedem Jahr«, fuhr der alte Benefiziat fort, als sei er gar nicht unterbrochen worden; »sehen Sie, lieber Herr, da kommt der keckste Bursche aus Kelheim und klettert zu dem Bild des heiligen Johannes hinauf und schmückt es mit Blumen und Bändern fürs ganze Jahr – das ist ein Fest!«
Wir sind an der »Langen Wand« – so heißt die mächtige Felswand, die wir hinanblicken. Das Herz wird einem beklommen, die Pulse jagen. Nichts als brausende Flut, nacktes Gestein und ein bißchen Himmel. Das ist das Heiligtum der keuschen Wasserfee. Wag es nicht, nach ihrem jungfräulichen Lager zu blinzeln, sonst erwacht ihr Zorn, und sie reißt dich hinab und bestraft dir die Neugier durch ewiges Schweigen. Wie mancher liegt hier unten im kristallenen Schrein, beschlossen unterm Zauber der Stromkönigin! Sie aber, die menschenscheue, die finstere, trauernde, liegt auf ihren feuchten Kissen, gehüllt in die sieben Schleier, und kümmert sich um ihre Opfer nicht.
Rechts die Blicke gewandt! Dort ragen drei flache Felsblöcke aus den Wellen hervor, die heißen »Die drei Brüder«. »Da sind einmal drei Brüder ertrunken; die zwei älteren hatten den jüngsten nicht lieb und wollten's ihm heimlich antun. Wie sie ihn nun ins Wasser stürzten, so zog die Strafe Gottes sie selbst mit hinab, und sie wurden alle drei zu Stein«, erzählte der alte Benefiziat; »drei Ave-Maria für die armen Seelen.«
Weiter rechts sehen wir die finstere Kluft, das »Rabenloch«, und einen einzelnen Fels, »Die schwangere Jungfer«. Hat sich keine Sage von der versteinerten Jungfrau im Andenken des Volkes erhalten? Die guten Leute blicken gleichgültig darauf hin und schweigen, der Benefiziat schlägt unwillkürlich ein Kreuz, und der Schwabe lächelt wie ein Faun, indem er die Gestalt des Felsens mit dessen Benennung vergleicht.
Aber die Wellen unter uns flüstern verstohlen, als wagten sie's nicht, die alte Geschichte laut zu verkünden; sie scheuen den Zorn der keuschen Stromkönigin. Horch, was wir von ihnen erlauschen: Eine Nixe taucht auf aus den Wellen; auf ihren hingebreiteten goldigen Haaren schwimmt sie. Der Schiffer, der hinter den Felsen lag, sah sie beim Mondenschein und fing sie im Netz. Er gelobte ihr Treue, der schöne, falsche Mann, und sie gab sich ihm hin. Und als er der Nixe die Treue brach und eine Dirne zum Weib nahm, trug jene unterm Herzen schon das Liebespfand. Der Schiffer jagte sie fort, als sie kam, des Schiffers Mutter lachte sie aus, der Pfarrer hat sie verflucht. Da ging sie schweren Schrittes zur Stromfee zurück und flehte bei der um Erbarmen. Aber die keusche Fee schalt sie im Zorn und verzauberte sie auf ewige Zeiten zu Stein, mitsamt ihrem Kind unterm Herzen. Als aber der Schiffer mit seinem jungen Weib vorbeikam und die verzauberte Nixe sah – die Wellen sagten's ihm an, was geschehen war, und das steinerne Gesicht blickte in Gram und Todesschmerz auf ihn –, da faßte ihn Verzweiflung. Er ging in die wilden Schluchten hinein, die Stromfee zu suchen und bei ihr um der Nixe Erlösung zu flehen. Sein junges Weib wartete Tag und Nacht und so drei Tage lang und sah mit Grausen das steinerne Gesicht. Der Schiffer aber kam nimmer zurück, und am dritten Tag kamen die Raben aus der Schlucht und krächzten so laut, daß das arme junge Weib bald erkannte, was geschehen war. Sie betete ein Vaterunser und fuhr heim, legte sich hin und starb sieben Tage darnach. Seither haben Regen und Schnee des steinernen Angesichts Züge verwischt, aber das Kind lebt noch im steinernen Schoß bis zum Jüngsten Tag; der Schiffer hört es wimmern.

Die Lange Wand bei Weltenburg
In einer Felsenschlucht daneben weist uns der Benefiziat »Unsere Liebe Frau«. Es ist ein einzelner Fels, der einer Nonne im langen Ordensgewand gleicht, welche die Hände vor der Brust faltet; schwärzliches Moos gibt dem weißen Gestein die phantastische Ähnlichkeit der Konturen und Formen. Von Stelle zu Stelle gipfeln jetzt immer mehr Einzelfelsen so keck und trotzig empor, als wären sie früher alle zusammen eine dicht aneinander geschlossene Schar von Kriegern gewesen, die das Gericht des Himmels auseinanderriß. Zerklüftet, kahl, angetobt vom Groll der Elemente stehn sie doch wie verzauberte Wächter vor dem Tor des Palastes, worin ihre Herrin, die Stromfee, wohnt.
Links, wo der Leinpfad wieder beginnt, zeigt sich jetzt ein überhängender Fels, den das Volk die »Lutherische Kanzel« taufte; dann der Haarhof, ein anmutiger Wiesengrund, von Wald und Felsen umfriedet; und der »Hohle Stein«, ein mächtiger Block, der den Leinpfad deckt (früher senkte sich auch hier der Fels in den Strom); rechts gegenüber zwei isolierte Felsen, »Peter und Paul«, die aus dunklem Gehölz hervorschimmern.
Allmählich weicht jetzt die Erhabenheit der sanfteren erquicklichen Schönheit; wir lassen den Trotz der Natur hinter uns und atmen wieder auf; der Strom dehnt und streckt sich breiter und behäbiger, die Aussicht auf Menschenwohnungen und Fruchtland tut sich auf. Bald erblicken wir am linken Ufer das »Klösterl« – früher eine Einsiedelei, dann einen Klostergarten der Franziskaner, jetzt ein von den Bewohnern des nahen Kelheim seiner erprobten Nützlichkeit wegen sehr besuchter Trinkort. Wenn wir aber in Bayern von einem Trinkort sprechen, so verstehen wir unter dem Getränk nicht etwa Mineralwasser, sondern immer Bier. Über diesem Klösterlbier aber scheint der den Ort beschützende Genius, scheinen die Manen der früheren Besitzer noch immer ebenso einflußreich zu walten, wie in Weltenburg, wo wahrhaft klassisches Bier gebraut wird.
Wir teilten letztere Bemerkung unserem Reisegefährten, dem Brauer, mit, der sie mit gerechtem vaterländischem Stolz aufnahm; unser Odysseus, der Schwabe, gab uns bei diesem Anlaß eine Tradition in Kauf, deren kurzen Sinn wir in minder langen Worten, als er selbst dazu brauchte, hier wiedergeben wollen: Es begab sich in einer Stadt, wo man noch heutzutage Bier trinkt – und zwar viel Bier –, daß das Bier in der einzigen Brauerei, die damals dort bestehend, in der der Kapuziner, durchaus nicht gelingen wollte; der alte Laienbruder, welcher dem Braugeschäft vorstand, war nämlich gestorben, und sein Nachfolger vermochte weder wissenschaftlich gebildete noch empirische Bierkenner zu befriedigen. Das Murren darüber wurde allmählich so groß, daß sich endlich ein erfahrener Konventual entschloß, dem ganzen Brauverfahren beizuwohnen. Gesagt – getan; wie aber ein Unglück nie allein kommt, so geschah es, daß er, als die Masse gerade im besten Sud war, in die Braupfanne fiel, ertrank und – versotten wurde. Niemand vermißte ihn; wie es aber kein Unglück gibt, das nicht auch sein Gutes am Schlepptau hintennach schleift, so war das Bier durch die neuen Ingredienzien so trefflich geraten, daß kein Bierkenner fortan ein anderes mehr trinken wollte. Als aber der Hergang bekannt wurde, nannte man jenen Sud das Kapuzinerbier, und der Volkswitz davon blieb bis auf den heutigen Tag.
Bald hätten wir noch eine Felsengruppe am linken Ufer übersehen: das »Nürnberger Tor«; zwei schroffe, einzeln stehende Kuppen vereinigen sich zu einem Bogen; daher der Name, wiewohl nicht ganz mit Recht, denn es ist keine Nürnberger Ware, welche die Natur – die selbst dann, wenn sie zerstört, immerfort schafft – hier zustande gebracht hat.
Wir nähern uns nunmehr allgemach der Stelle, wo der Kanal, der die Donau durch den Main mit dem Rhein verbinden soll, zu münden bestimmt ist, Bekannt ist, daß schon Kaiser Karl der Große diesen Plan gefaßt hat; eine Überlieferung läßt ihn wirklich, von Regensburg aus, auf dem Kanal in den Main und bis Frankfurt fahren. dem Keltege der Kelten, der Artobriga der Römer, dem Kelheim der Wittelsbacher. Aus einem reizenden Tal eilt hier die Altmühl hervor, wie eine geschäftige Dienerin der Donau zu, vor der sich reiches Fruchtland ausbreitet, sie festlich mit allen Segen zu empfangen; zahlreiche geschichtliche Erinnerungen säumen ihre Ufer.
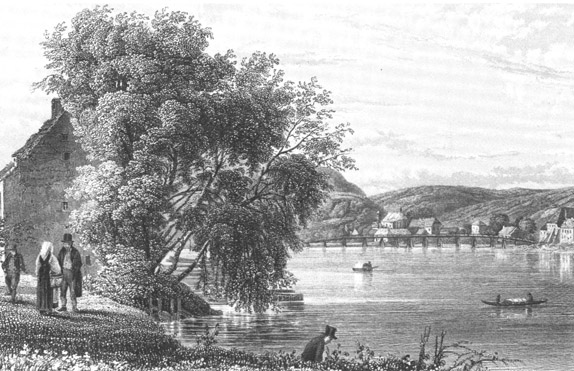
Kelheim
Die römischen Schanzen oberhalb der Stadt nennt das Volk noch heute den Heidengraben. In dem alten Keltenschloß, dessen Turm noch gezeigt wird, saßen die Scheyern. Jener Herzog Ludwig, den die schöne Ludmilla von Bogen überlistete, der in der unheilvollen Zeit des Zwistes zwischen Kaiser und Papst (Friedrich II. und Gregor IX.) dem ersteren auch gegen dessen falschen Sohn, den deutschen König Heinrich, Treue hielt, fiel, da er sich auf der Kelheimer Brücke erging, durch einen Meuchler, der ihm einen Brief überreichte und ihm während des Lesens den Dolch in den Hals stieß (1231); obwohl auch die Sage ging, der Täter sei ein Assassin gewesen – der schwerste Verdacht der Anstiftung lastete auf dem jungen König; Aventin hingegen erzählt, daß Stockher, des Herzogs Hofnarr, die Tat aus Rache für oft erlittene Unbill verübt hatte. Zum Gedächtnis wurde in Kelheim eine Kapelle erbaut.
Im Schwedenkrieg eroberte der tapfere Herzog Bernhard von Weimar die Stadt. Im großen Aufstand des Bayernvolkes für seinen unglücklichen Fürsten erwies auch Kelheim große Treue; das Beispiel Plinganser ermutigte den Metzger Kraus, das Joch der fremden Gewaltherrschaft zu zerbrechen; in der Nacht des 13. Dezember 1705 überrumpelte Kraus mit seinen gleichgesinnten Mitbürgern die feindliche Besatzung, nahm diese gefangen und rief das Volk in der Umgegend zu den Waffen. Doch der kaiserliche Oberst Truchseß vereitelte allzu rasch die Vollendung des Befreiungswerks, erstürmte Kelheim, würgte Männer, Weiber und Kinder, plünderte und brachte den kühnen Kraus mit seinen Genossen nach Ingolstadt, wo sie ihre Treue mit Blut besiegelten; sie wurden gevierteilt, so gebot das grausame Urteil.
Die Kolonie datiert ihren Ursprung dem Vermächtnis eines Fräuleins von Pürckhammer, das die Hälfte des Ainwalds »allen guten Gesellen« vergab, welche bis zum Jahre 1794 über ihre Befähigung und über die Erbschaft stritten; in jenem Jahr entschied eine Kommission und gab 1500 Tagwerke einer fleißigen Kolonie, die alsbald anwuchs. Westlich von Kelheim liegt das Schulerloch, eine Tropfsteinhöhle.
Wir schiffen jetzt an Hohenpfahl und Affeking (am rechten) und Kelheimwinzer (am linken Ufer) vorbei und erblicken links Herrnsaal, rechts die Obersaal und Postsaal, wo Adrian von Riedl 1797 durch Sprengung eines 180 Fuß hohen Felsens statt der gefahrvollen alten eine herrliche neue Straße gewann. Joseph Graf von Törring-Gronfeld ließ dem Meister jenes Denkmal an der Felswand errichten, welches unsere Aufmerksamkeit fesselt; die Inschrift desselben lautet: DER CHVRF[V]RSTLICHE OBRIST, GENERAL-STRASSEN- VND WASSERBAV-DIRECTOR, AVCH HOFKAMMERRATH ADRIAN VON RIEDL F[V]HRTE VND VOLLENDETE DIESEN STRASSENBAV IM IAHRE MDCCXCVII AVF BEFEHL.
Weitersteuernd erblickten wir am rechten Ufer Alkofen und links auf dem Berg Kapfelberg mit seinem Schloß, dann Poikam und rechts, wo der Strom sich krümmt, Lengfeld; nicht weit davon, wo die Chaussee (gleichfalls durch Sprengung gewonnen, ein Werk Riedls) sich dicht zwischen der Donau und den Felsen hinzieht, die beiden steinernen Löwen und in der Felswand die Gedächtnistafel: CAROLO. THEODORO. C. P. R. BOIORVM. DVCI. ELECTORI. OPTIMO. PRINCIPI. EVERSA. DETECTA. IMMINENTIVM. SAXORVM. MOLE. LIMITE. DANVBIO. POSITO. STRATA. A. SAAL. AD. ABACH. VIA. NOVA. MONVMENTVM. STATVI. CVRAVIT. IOS. AVG. TÖRRING. AER. BOIC. PRAEFECT. MDCCIV.
Abbach mit seinem Römerturm und mit der Heinrichsburg liegt jetzt vor uns, der Mittelpunkt einer reichen, herrlichen Landschaft; die Donau, die hier in rascher Wendung gen Norden strebt, bietet dem Naturfreund von Abbach aus zwei Täler, deren je eines das andere an Reizen überbieten zu wollen scheint. Abbach ist uralt, der Vater der bayerischen Geschichte, Aventin, nimmt aus Säulenschriften an, daß hier der Römerort Abudiacum gestanden sei. Die Nikolauskirche wird schon im 10. Jahrhundert erwähnt. Kaiser Heinrich II. soll hier geboren sein, und von ihm erzählt das Volk in der Umgegend noch heute, wie er täglich von Abbach nach St. Emmerans Kloster zu Regensburg zur Mette gegangen sei; noch weist man dort den steinernen Stuhl vor der Pforte, wo er gesessen, und an der Hälfte des Weges zwischen Abbach und Regensburg das Kreuz, an dem er gerastet hatte; malerisch blicken noch immer die Mauerreste seiner Burg vom Berg auf Strom und Land hernieder; Ludwig der Bayer ließ sie, da Bischof Otto von Bamberg sie aus Furcht vor den Bayern zerstört hatte, neu erbauen und verpfändete sie an Thomas von Frundsberg und Heinrich von Gumpenberg; 1532 trafen Karl V. und Herzog Wilhelm von Bayern hier zusammen, und hundert Jahre später widerstand es dem Anfall der Schweden. Der Flecken Abbach, der 1297 durch die Regensburger zur Wiedervergeltung verbrannt und 1778 von den Österreichern besetzt wurde, besitzt eine seit uralten Zeiten bekannte und sehr heilsame, aber allzu vernachlässigte Mineralquelle, die ungefähr 500 Schritte vom Ort aus den Felsen entspringt.
An Hofstätten vorübersteuernd, erblicken wir jetzt am rechten Ufer Oberndorf in pittoresker Lage. Wie anmutig hebt sich die Kirche aus grünem Waldhintergrund hervor! So friedlich lächelt uns das Örtchen zu, aber einst floß hier eines Kaisermörders Blut. Es war im Jahre 1208, als Heinrich Calatin, der Pappenheimer, des ermordeten Kaisers Philipp Marschall, in einem Meierhof den wilden Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach erreichte, der, geächtet und flüchtig nach seiner Freveltat, sich dort verborgen hielt. Der Pappenheimer vollstreckte die Rache der beleidigten Majestät, durchbohrte den Mörder, schlug ihm das Haupt vom Rumpf und warf es in die Donau.
Am linken Ufer zeigen sich uns jetzt Gundelzhausen und Lohstadt, am rechten Matting und Irating, diesem gegenüber Alkofen, weiter hinab am linken Ufer, wo die Berge in den schönsten abwechselnden Gruppen dem Strombett näher rücken, die Weichselmühle in einem herrlichen Waldtal. Am anderen Ufer abwärts, wo das Laabertal gegen die Donau zu sich öffnet, liegt Sinzing.
Allmählich weichen nun die Uferhöhen auseinander und gewähren eine freiere Aussicht. Rasch schiffen wir an Rigling und Klein- und Groß-Prüfening vorbei, wo einst Bischof Otto von Bamberg, einem nächtlichen Gesicht zu gehorchen, eine Kapelle und ein Kloster stiftete, dessen letzter Prälat der als Schriftsteller bekannte Rupert Kornmann war. Nicht weit davon liegt Dechbetten, einst eine Hofmark des Klosters, mit einem Gnadenbild.
»Die Kirche Maria Ort unterhalb Prüfening, an der Spitze des Winkels, den die Naab zur Donau, in die sie mündet, bildet, ist eine Ex-voto-Stiftung der Kaiserin Maria und bewahrt ein steinernes Gnadenbild der Mutter Gottes, das vor grauen Zeiten auf einem Wacholderstrauch bis hierher stromaufwärts schwamm« – so erzählte uns der wackere alte Benefiziat –, »und der Wacholder«, – so fügte er hinzu –, »grünt noch immer außen an der Kirche.«
Nicht weit davon ist ein Kalvarienberg mit einer heiligen Stiege, auf der die Gläubigen knien. Den schönsten Punkt des reizenden Naabtals bietet dem Lustwandelnden Schloß Etterzhausen an der Naab, einst der Besitz der Edlen von Erlbeck, dann der Fischbach und der Wildenauer; eine halbe Stunde hinter Etterzhausen liegt eine Höhle, deren nördliche Pforte eine Vedute des Tales als Rahmen umschließt.
Wir lassen Ort hinter uns, und vor uns breitet sich nun am rechten Ufer die weite Ebene aus, in der Regensburgs Türme im Abendrot glänzen, am linken Ufer ruht das Auge auf den nahen Bergen mit ihren Kirchen und Dörfern. Da erblickt es zuerst Kneiting, dann Kager, dann den Arlesberg, jetzt das freundliche Oberwinzer und Niederwinzer, wo die Nürnberger Straße längs des Ufers sich hinzieht, den Dreifaltigkeitsberg (zu dessen Kirche die Gläubigen wallfahrten und von wo aus die Österreicher 1809 Stadtamhof beschossen, um sich gegen die Franzosen den Rückzug nach Böhmen zu sichern), Stadtamhof und den Steinweg.
Am oberen Wörth wendet sich das Schiff dem rechten Ufer zu, wo es anlegt. Jeder will der erste an Land sein, und jede Sekunde Verzögerung dehnt sich zur Stunde; auch in der Freundschaft ist Egoismus, und er maskiert sich nicht, er fordert von jedem wildfremden Gesicht eine frohe Auskunft über unsere lang nicht gesehenen Lieben. Und so verlieren wir unseren freundlichen und gutmütigen alten Benefiziaten, der alle Legenden kennt und für die alten Zeiten schwärmt, unseren rührigen Schwaben, dem seine geraden Glieder zu lieb waren, als daß er seinem ironischen Kobold carte blanche geben mochte, und unseren derben, praktischen Altbayern, aus dem Gesicht; schon sind sie in den dunklen Gassen der uralten Stadt der Bayernfürsten verschwunden, und wir verfolgen die Schluchten dieses Häuserlabyrinths, die Spuren aufzusuchen, welche Geschichte und Sitten früherer Zeiten hier zurückließen, die Baudenkmäler zu betrachten, in deren Schatten die Sagen schlummern.
Regensburgs Geschichte steht auf römischen Grundfesten; aus allen Fluten der Geschicke, die über der Stadt zusammenschlugen, ragen die Erinnerungen altrömischer Herrschaft wie Leuchttürme hervor. Die Namen Augusta Tiberii, Colonia Tiberia Augusta, Tiburina bewahren das Andenken ihrer Stiftung durch den Despoten, der andere: Quartana jenes an die Legio tertia Italica, die in den Castris quartanis hier hauste; die anderen: Reginum, Regina castra, Metropolis Ripariarum im Noricum ripense zeugen nicht minder deutlich. Die Christianisierung Regensburgs schreibt die Legende dem heiligen Markus zu. Unter der Frankenherrschaft heißt Regensburg Regnoburgum, Rhaetabona, Ratisbona, und das Fürstengeschlecht der Agilolfinger, deren erster Garibald war, hält hier Hof.
Als der Glaubensbote Emmeram von Pictavium nach Regensburg zu Theodo dem Agilolfinger kommt, staunt er über die wohlgebaute, mit Mauern umgürtete Stadt, über die herrliche Burg des Herrschers und den prachtvollen Hof, über den Wohlstand der Bewohner, die er findet. Drei Jahre weilte Emmeram zu Regensburg bei Theodo, drei Jahre lang rottete er, von dort in die Gaue des Bayernlandes ziehend, die Reste des alten Heidentums im Volk aus. Nach Ablauf dieser Frist verließ er Regensburg heimlich, um nach Rom zu pilgern; da erhob Uta, Theodos Tochter, falsche Anklage gegen den abwesenden Frommen, als habe er an ihr Zucht und Sitte verletzt. Der Vater verstieß sie; Landpert aber, ihr Bruder, eilte dem vermeintlichen Verführer nach, holte ihn zu Helfendorf ein und ermordete ihn. Erst als die blutige Tat geschehen war, wurde der Name des Verführers bekannt und Emmerams Unschuld offenbar. Die Leiche des Märtyrers wurde mit großem Pomp nach Regensburg gebracht, wo Theodo mit allem Volk und der Priesterschaft ihr entgegenzog.
Auch Rupert, der Heilige, kam (unter Theodo II.) gen Regensburg und läuterte dort, bevor er nach Lorch und zu den Trümmern Juvavums zog, den verfallenen Glauben; auch Bonifazius kam zu gleichem Zweck. Durch Bonifazius soll auch, so meldet die Überlieferung, das Bistum gestiftet und Garibald als erster Bischof eingesetzt worden sein; eine andere Tradition (vergl. Hansitz) weist die Stiftung des Bistums dem heiligen Rupert zu. – Unter Odilo sah Regensburg eine Kirchenversammlung. Nach dem Fall Tassilos wurde Regensburg zur königlichen Stadt (urbis regia) erklärt, für kurze Zeit Karls des Großen und nach dessen Tod Ludwigs des Deutschen Herrschersitz, dessen Gemahlin, die schöne und tugendhafte Hemma, dort 876 starb.
891 wurde Regensburg ein Raub der Flammen, welche bloß die Kirchen zu St. Emmeram und St. Cassian verschonten; Kaiser Arnulf erbaute die Stadt ausgedehnter und prächtiger wieder mit der Königspfalz, dem Bischofshof, mehreren Kirchen, Klöstern und Gelehrtenschulen, mit einem eigenen Gau der Gewerker und Kaufleute; im St.-Emmerams-Stift, das er mit kostbaren Reliquien und geistlichen Schätzen beschenkt hatte, fand er 899 seine Ruhestätte. Bald blühte in Regensburg Handel und Wandel; 911 krümmte sich Regensburg unter Deutschlands Geißel, den Ungarn; 917 hielt Konrad, König der Deutschen, dort einen Reichstag, auf dem über Herzog Arnulf von Bayern Acht und Bann erging. Ebendieser festigte im darauffolgenden Jahr Regensburg, seine Hauptstadt, mit Mauern und Türmen; umsonst lag König Heinrich der Vogelsteller mit Heeresmacht davor. Unter Otto I. wurde Regensburg aufs neue dreimal belagert; nachdem Arnulf II. bei einem Ausfall geblieben war, und nach der Versöhnung des Königs mit seinem Sohn Ludolf ergab es sich. Nach der Ungarnschlacht auf dem Lechfeld berief Herzog Heinrich zu Regensburg die Stände des Landes, verlas das Salbuch und hielt Gericht über die Priester, die mit den heidnischen Feinden Gemeinschaft gepflogen hatten.
Aus den Ungarnkämpfen blieb die Sage vom Kampf des frommen christlichen Ritters Hans Dollinger mit dem riesigen Heiden Krako – auf dem Platz, der noch jetzt der »Haid-Platz« heißt. Von diesem Kampf singt das alte Lied:
Es rait ein Türck aus Türckenlandt, rait gen Regensburg in die stat.
Da Stechen wardt. Von Stechen war er wohlbekhannt.
Da rait er fuer des Kaysers thuer. Ist niemand hie, der kumd herfuer,
Der Stechen well umb Leib umb Seel, umb guet umb Ehr, wenn das
die Seel dem Teuffel wer?
Da warn die Stecher all verschwiegen, keiner wolt dem Türkhen nit
obliegen
Dem laidigen man, der so trefflich stechen khan.
Da sprach der Kayser zornigklich, wie steht mein hoff so lästerlich?
Hab ich khein man, der stechen khan,
Umb leib umb Seel umb guet umb ehr, und das unserm Herrn die
Seel wer?
Da sprang der Dollinger herfuer, wol umb wol umb, ich muss hinfuer,
An den laidigen Man, der so trefflich stechen khan.
Das erste reuten das sie da thaten Sie fuerten gegeneinander zwey
scharffe Speer,
Das eine ging hin das andre gieng her,
Da stach der Türck den Dollinger ab,
Das er an dem rukhen lag,
O Jhesu steh mir jetzt bey, Steck mir ein Zwey, sind Irer Drey,
Bin ich allein und fuer mein Seel in das ewig himmelreiche.
Da ritt der Kayser zum Dollinger so behendt, er fuert ein Kreutz in
seine hendt,
Er strichs dem Dollinger über sein Mundt, der Dollinger sprang auf,
war frisch und gesundt.
Das ander reuten das sie da thaten, da stach der Dollinger den
Thürcken ab, das er den ruckhen lag.
Du verfeyter Teuffl nun stehe im bey, sind ihrer Drey,
Bin ich allain, und fuer sein Seel in die bitter Hellenpein.
Über die Details und Varianten der Sage berichtet Hormayr In »Historisches Taschenbuch für 1835«, wo auch das obenstehende Lied mitgeteilt ist. folgendes: »Nach einigen erbot sich Dollinger aus freien Stücken, von dem Übermut des Heiden empört. Nach anderen lag er, unschuldig des Hochverrats angeklagt, in schwerer Haft auf Tod und Leben, und der Gottesgerichtskampf sollte zugleich seine Unschuld erproben. – Dem Krako halfen zwei Teufel in Rittertracht, allen unsichtbar. Nur der Dollinger erblickte sie in des freisamen Gegners Spiegelschild. Da soll er, nachdem ihn der Heide im zweimaligen Rennen zu Boden gestürzt hatte, auf den Rat des Niedermünsterer Kapellans hin ein Kreuz auf dem Platz haben aufstellen lassen. Nach anderen ritt der Kaiser zu ihm, hielt ihm das Kreuz vor und drückte es ihm segnend auf den Mund, wonach im dritten Rennen der Deutsche den Ungarn zu Boden gestürzt und ihm die spitze Lanze durch das Ohr in den Kopf gerannt habe, daß Krako unter dem Hohnjauchzen der Hölle die Seele aushauchte. – Der Dollinger hatte sich vor dem Streit durch Gebet gestärkt an St. Erhards Grab und dort das Abendmahl und jenen heilsamen Rat des Priesters empfangen. Drum schenkte er auch jetzt des Heiden Rüstung an dieses Grab der Äbtissin der Nonnen St. Erhards, Wiltrud. Sie blieb in Niedermünster, bis die fürstliche Äbtissin Barbara von Aham sie den erhabenen Brüdern Karl V. und Ferdinand I. schenkte, als sie wider den großen Suleiman zogen, der Wien zum zweiten Mal bedrohte. Sie kam in das Zeughaus der Kaiserstadt.
Der Dollinger ließ an seiner Regensburger Herberge den Kampf in Stein hauen. Die Stechlanzen der Kämpfer meinte man noch zu besitzen. Auch die Malerei verewigte den seltsamen Streit. Unter der Kämpfer Abbild waren die Verse zu lesen:
Barbarus hic solidis certant Germanus et armis
Germanus vicit, Barbarus occubuit.
Unter Kaiser Heinrichs Ebenbild steht:
Fertur equo celeri hic Henricus in ordine primus
Aucupio celeber nec minus imperio.
Die andere Königsfigur achteten spätere Tage für St. Oswald, des Dollingers Schutzheiligen, und schrieben darunter:
Haec statua Oswaldum, si nescis, scito, figurat,
Qui rex officio, gente Britannus erat.
In den Tagen der Kreuzzüge war es meist Regensburg, wo die Begeisterten zu Schiffe stiegen; derselbe Glaubenseifer, der die Gläubigen nach dem Gelobten Lande trieb, entflammte – auch zu Regensburg – die Judenhetzen; Kaiser Heinrich IV. gab dem unglücklichen Volk zu Regensburg (1097) Schutz. 1104 hielt Heinrich IV. einen Reichstag in Regensburg, auf dem die Ermordung des Grafen Sieghard von Burghausen allen Mißvergnügten willkommenen Anlaß bot, den Kaiser seiner Würde für unwert zu erklären und dessen Krone seinem Sohn Heinrich anzubieten; von Regensburg aus begann dieser die ruchlose Empörung. Im Jahre 1111 wurde das Schottenkloster zu St. Jakob erbaut, dessen Portal die Aufmerksamkeit des Freundes altdeutscher Kunst in hohem Grad in Anspruch nimmt.
Im Jahre 1135, da Heinrich der Stolze, welfischen Geschlechts, über das Bayernland herrschte, war eine solche Sommerhitze, daß das Bett der Donau beinahe ganz austrocknete. Da erbaute der Herzog mit Regensburgs Bürgerschaft jene in zahlreichen Volksliedern und Volkswitzen, durch Sagen und Wahrzeichen bekannte stattliche Brücke mit 15 granitenen Schwibbögen und drei Türmen; in elf Jahren wurde dieses interessante Denkmal alter deutscher Baukunst vollendet.
Die Sage verbindet die Erbauung dieser Brücke mit der (um fast anderthalb Jahrhunderte späteren) des Doms und meldet, daß der Baumeister des letzteren mit seinem Lehrling, der die Brücke erbaute, gewettet habe, wer von beiden sein Werk zuerst vollende. Da habe der Lehrling, da er an seinem Sieg zweifelte, den Bösen angerufen und ihm, wenn er das Werk fördere und zur früheren Vollendung helfe, die Seelen von drei Geschöpfen verschrieben, die zuerst die fertige Brücke betreten würden. Der Böse hielt Wort, und die Brücke wurde früher vollendet als der Dom. Wie nun der Meister vom Gerüst die fertig gewordene Brücke gesehen, habe er sich voller Verzweiflung herabgestürzt. Der Lehrling aber habe den Bösen schlau überlistet und, bevor er einen Menschen auf die Brücke gelassen habe, einen Hund, einen Hahn und eine Henne auf diese getrieben, die der Teufel erhascht und, da er sich betrogen sah, voll Wut zerrissen habe; zum Gedächtnis seien die Steinbilder der drei Tiere auf der Brücke eingesetzt worden; noch viele andere Wahrzeichen wurden auf dieser gewiesen, und noch heute zeigt man »den größten und den kleinsten Stein einander«.
Auf dem Reichstag zu Regensburg war's, daß Friedrich Rotbart 1180 Heinrich des Löwen Lehen für dem Reich verfallen erklärte; Regensburg wurde eine freie Stadt des Reichs; ein Burggraf des Bayernherzogs sollte hier Recht üben, ein Vizedomus ihm untergeben sein. Auch Kaiser Heinrich VI. hielt in Regensburg Reichstag und Gericht über den Grafen Adelbert von Bogen; Richard Löwenherz wurde hier im schmachvollen Judashandel aufs neue zum Kerker verdammt.
Regensburgs Wohlstand und Ansehen wuchsen indessen von Jahr zu Jahr, da die Bürgerschaft bei zwischen Herzog und Bischof geteilter Macht eifersüchtig an ihren Freibriefen hielt. Die Münzstätte zu Regensburg hatte guten Kredit; Regensburgs Handel reichte bis nach Rußland und Indien.
In den Tagen des Kampfes auf Leben und Tod zwischen geistlicher und weltlicher Macht wurde in Regensburg eine ruchlose Tat versucht; es war im Jahre 1251, da der König der Deutschen, Konrad, Friedrichs II. Sohn, mit seinem Schwiegervater, dem Bayernherzog Otto, gen Regensburg kam, das Weihnachtsfest da zu begehen. Bischof Albrecht von Regensburg, des Königs und der Regensburger Feind, der zu Donaustauf in dem festen Schloß saß, sandte seinen Dienstmann Konrad von Hohenfels nach Regensburg, den König zu ermorden. Die Meuchler schlichen in das Stift St. Emmeran, wo der König wohnte, erkundeten dessen Schlafgemach und drangen hinein, indessen der Bischof vor der Stadt des erwünschten Erfolges harrte. Die Treue Friedrichs von Ewesheim rettete den König, der sich unter einer Bank verbarg, indes sein Stellvertreter in seinem Bett ermordet wurde. Den Bischof und den Abt zu St. Emmeran traf des Reiches Acht, und das Stift büßte den Frevel, der in seinen Mauern versucht worden war.

Regensburg
In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts (1263) wurde der Bau des herrlichen Doms durch den Bischof Leo begonnen, 1280 durch Heinrich II. beendet. In der großen Judenverfolgung, die – um dieselbe Zeit – mit dem Fanatismus der Geißler zusammentraf, erhielten Regensburgs Bürger sich den Ruhm der Vernunft und Menschlichkeit und schützten die Juden, welche seit unvordenklichen Zeiten in der Stadt seßhaft waren Eine Tradition läßt bereits vor Christi Geburt zu Regensburg Juden wohnen, die die Sonnenfinsternis in Jerusalem bei Christi Kreuzigung zur selben Stunde auch in Regensburg wahrgenommen hätten; vor Schreck hätten ihre Bauleute aus dem Turm (nächst dem späteren Klarenkloster) einen Gerüstbalken herauszuziehen vergessen, der noch lange nachher als Wahrzeichen gezeigt worden sei. und große Reichtümer, die den Pöbel allenthalben sonst lockten und aufstachelten, besaßen; ein trauriges Gegenstück bildete 1519 die Vertreibung der Juden aus Regensburg. Freilich hatte sich während der langen Zwischenzeit (die fast nur durch die Belagerungen Regensburgs durch die Herzöge Otto und Stephan und den Kaiser Ludwig den Bayer markiert ist) der Charakter der Stadt fast völlig verwandelt, die großartige Physiognomie des Handels allmählich ein bleiches, bigottes Kolorit angenommen. Es ist charakteristisch, daß 1418 zwei Geistliche hier den Scheiterhaufen besteigen mußten, weil sie geäußert hatten, daß Johann Hus zu Konstanz allzuschwer gebüßt hätte; und nicht minder charakteristisch ist es, daß man bemerkt haben wollte, seit der Erbauung eines eigenen »Ketzerturms« seien das Glück und der Wohlstand Regensburgs gesunken.
In jene Zeit ungefähr fällt auch das Turnier, auf dem Herzog Albrecht um der schönen Bernauerin willen die Schranken verschlossen fand, obwohl er beschwor, daß sie sein eheliches Weib sei.
Die Reformation nahm dem Wappen der Stadt das Bild des heiligen Petrus und ließ nur dessen zwei Schlüssel zurück. Stephan Kastenhauer, Wolfgang Schauer und Arsazius Seehofer, die kühnen Prediger, von denen der erstere später um des Glaubens willen Gefängnis und Todesgefahr bestand, führten die neue Lehre in Regensburg ein, wo durch den Verfall der Kirchenzucht alle Bande aufgelockert waren und der Kämmerer Hans Portner wie der Reichshauptmann Thomas Fuchs, die den Mönch von Wittenberg zu Augsburg gesehen hatten, mächtig für Luther wirkten.
Jene früher erwähnte Judenvertreibung von 1519 trug in ihren Folgen nicht wenig zur Erbitterung des Volkes gegen die Mutterkirche bei. Als nämlich aufgrund des alten Märchens, daß die Juden sieben Christenkinder in den Kellern zu Tode gestochen hatten, alle Juden aus Regensburg vertrieben worden waren, ihre Synagoge geschleift und an deren Stelle eine hölzerne Kirche erbaut worden war, worin das Gnadenbild der »schönen Maria« Tausende und aber Tausende von Wallfahrern anlockte, forderte der Rat ein Recht über die reichen Opfer der Gläubigen für die Stadt, und da der Bischof dies für sein Stift in Anspruch nahm, entbrannte ein heftiger Zwist, und die Überzahl des Volkes bekannte sich nun zu Luthers Lehre. Mit unglaublicher Schnelligkeit vermehrten sich deren Freunde, wuchs der Freiheitstrotz der entfesselten Vernunft, verminderten sich das Ansehen und die Macht der alten Kirche. Die Klöster standen leer, das Volk eilte zu den Predigten Kalmünzers oder Teschlers, und während des Reichstags (1541) wurden die geheiligten Zeremonien des katholischen Ritus verhöhnt, dem Zorn des Bischofs und der Herzöge zum Trotz. Da empfand Regensburg gleich Augsburg die Nachwirkungen aller Wechselfälle der Feldzüge und des Interims.
Wohl atmete es auf, als Moritz von Sachsen (1551) siegreich in Augsburg einzog; als aber der fromme Herzog Wilhelm von Bayern (1589) den Bau einer Jesuitenkirche in Regensburg beschloß, wollte niemand – selbst gegen Lohn – Stein und Holz liefern oder Arbeit tun. Immerhin gelang im Lauf der Jahrhunderte den Jesuiten durch stilles Wirken, was Feuer und Schwert wohl schwerlich vermocht hätten; daß jetzt von 20 000 Bewohnern Regensburgs nur ungefähr 6000 Protestanten blieben, bezeugt am deutlichsten, wie eifrig sie gewesen sind.
Den Dreißigjährigen Krieg empfand auch Regensburg hart genug. 1632 kam bayrisches und kaiserliches Volk in die Stadt und verteidigte sie ein Jahr lang gegen die Schweden unter Horn; gleichwohl mußte sie auf den Verdacht geheimen Verkehrs mit diesen 60 000 Reichstaler zur Buße entrichten. 1633 wurde sie nach siebentägiger Belagerung durch Bernhard von Weimar, 1634 nach sechswöchiger durch die Bayern und die Kaiserlichen erobert, 1640 durch Banner – fruchtlos – belagert.
Von der Mitte des 17. Jahrhunderts an verändert sich abermals die Physiognomie der Stadt und trägt den Typus des deutschen Reichstags, der seit 1662 dort gehalten wurde – die Langeweile. 1703 gewann Max Emanuel Brücke und Stadt, aber schon im nächsten Jahr mußte er sie wieder aufgeben. 1713 wütete (wie schon 1094,1236, 1282, 1532, 1593 und 1613) die Pest. Den Groll der Elemente hatte Regensburg oft zu erfahren: den des Feuers 891 und 954, 1152, 1224, 1624, 1642 und 1809; den des Wassers 1236, 1342, 1650, 1709, 1740, 1784.
Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts öffnete sich für Regensburg die Reihe der furchtbarsten Mißgeschicke, deren Ende der völlige Ruin des Gemeinwesens schien. Die Kontribution, welche ihr die Franzosen 1800 auferlegten, saugte den letzten Rest des gesunkenen Wohlstands aus. Zwar wurde sie 1803 zur Residenz des Kurerzkanzlers erhoben, aber das verhängnisreiche Jahr 1809 brachte ihr die furchtbare Schlacht, die Belagerung, die Plünderung. Nach Auflösung des deutschen Reichskadavers kam die einstige Hauptstadt der alten Bayernfürsten 1810 endlich wieder an Bayern.
Die Geschichte des Regensburg gegenüberliegenden Stadtamhof hängt mit jener Regensburgs eng zusammen. Schon tausend Jahre vor Christi Geburt prangt im Zauberdämmer der Sage hier eine Stadt »Hermannsheim«, ein Pedepontum, das vor dem kaiserlichen Glanz Tibers verschwindet, aber bald als Tiberina – am anderen Stromufer – wieder auftaucht. Erst von der Zeit der Agilolfinger an eignet die Geschichte sich Stadtamhof zu, die Stiftung des Magnusklosters dort datiert vom 12. Jahrhundert; die Legende erzählt den Anlaß dazu in folgender Weise: Ein Greis und ein Jüngling suchten am Donauufer einen Fährmann, der sie noch spät am Abend nach Stadtamhof hinüberrudere. Endlich fanden sie einen Schiffer; doch dieser weigerte sich, ihrem Wunsch zu willfahren, bis jene beiden sich ihm entdeckten und er erkannte, daß sie – der heilige Abt Magnus und der Erzengel Michael seien; zum Zeichen der Wahrhaftigkeit empfing der Schiffer die Verheißung, ein gewisser Berthold werde ihm einen Scheffel Korn und ein Schwein zum Fuhrlohn geben. Berthold leistete willig, was ihm so wunderbar zugemutet worden war, und gab außerdem noch einen Platz, auf dem eine Betkirche, Sankt Magnus zu Ehren, erbaut würde. Diese gewann durch Wunder aller Art bald großen Zulauf der Gläubigen; 1138 stiftete Gebhard von Rotenburg das Kloster Zum Heiligen Magnus, das dessen weit und breit berühmten wundertätigen Stab bewahrte, 1634 durch die Schweden verwüstet wurde und 1697 aus den Trümmern wiedererstand. In der Fehde des Böhmenkönigs Wenzel und Ruprechts von der Pfalz mußte Stadtamhof Plünderung wie später im Dreißigjährigen Krieg durch Bernhard von Weimar Zerstörung und 1704 die Wut der verbündeten Feinde (Briten und Österreicher) erdulden; die Feuerzeichen von 1809 beschließen die Reihe blutiger Geschicke von Stadtamhof; heller leuchtet den Wittelsbachern von Regensburg herüber jener Tag (1180), der ihnen Bayern für immer gab. –
Beginnen wir jetzt eine Wanderung durch die Straßen der uraltbayrischen Reichs- und Handelsstadt Regensburg, die Monumente der Vergangenheit aufzusuchen. Von der Brücke ausgehend, aus dem Engpaß der Straße den »Großen Goliath« vor Augen habend, wenden wir uns alsbald links, um jenen imposanten Dombau zu erreichen, der mit seinen beiden stumpfen Türmen dem Wanderer schon von fern entgegenwinkt. Wie Kühnheit die Dome zu Straßburg und Wien charakterisiert, so Gediegenheit den zu Regensburg; hier ist's die Wirkung der Massen, welcher die der Formen untergeordnet ist; in diesen Massen tritt weniger der Ausdruck des Strebens als jener der Ruhe hervor; aber diese Ruhe ist eine Wirkung der Harmonie, in der die Verhältnisse sich vollständig ausgleichen. Und so ist auch der Eindruck, den das Innere des Regensburger Domes in uns hervorbringt, ein günstigerer als der, den der Anblick der Außenmassen anregt; und das Gemüt gibt sich willig der erhabenen Abgeschlossenheit einer Gedankenwelt hin, sobald du in die großartigen Hallen eingetreten bist, welche ganz im Geist altkirchlicher Weltanschauung wiederhergestellt wurden; dem Erhabenen der Räumlichkeit gesellt sich die sinnliche Pracht der Kunst zu; das Sonnenlicht selbst muß hier, indem es sozusagen als Farbenmedium wirkt, der Idealität des Kultus dienen.
Es ist bekannt, wer die Wiederherstellung des Regensburger Doms im alten Geist befahl, die Säuberung dieser festen Burg des Kultus von den steinernen Trabanten der Zopfzeit ins Werk setzte und die Fenster mit jenen prachtvollen Glasgemälden verzieren ließ, welche an Schönheit der Kompositionen die alten ebensosehr übertreffen, als sie – Werke der Münchner Künstler, wie jene Glasmalereien für die Aukirche zu München – in bezug auf die Technik als das Höchste gepriesen zu werden verdienten, was diese erreichen und vollenden kann. Aus der Restauration des Regensburger Doms spricht eine durchgreifende Konsequenz laut genug, zugleich eine bedeutungsreiche Symbolik; Wahrzeichen der Zeit, deren Geschöpfe – in wie mannigfachen und verschiedenartigen Gestalten sie uns immerhin erscheinen mögen – den gemeinsamen Ursprung doch nicht verleugnen können.
Der Bau des Regensburger Doms datiert in seinen ersten Anfängen schon von der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, vollendet wurde er 1488. Interessant sind im Inneren des Doms die Monumente des Fürsten Primas Karl von Dalberg, des Kardinals und Bischofs Philipp Wilhelm, des Fürstbischofs Fugger; interessanter jedoch der Kreuzgang mit seinen zahlreichen Leichensteinen und Denkmälern römischer und deutscher Vorzeit und Kunst. Der Kreuzgang ist durch ein Pförtchen mit dem »Alten Dom« verbunden und führt auf den Domfriedhof, nicht fern davon gewahren wir die uralte Ulrichskirche (früher Pfarrkirche); in deren Nähe der viereckige Heiden- oder Römerturm, in dessen Gewölben der Bayernherzog Theodo II. (so erzählt die Legende) durch den heiligen Rupert zum zweiten Mal die Taufe empfing.

Der Dom zu Regensburg
Nicht weit davon steht auf dem Kornmarkt das Kollegiatsstift »Zur Alten Kapelle«, von dem die fromme Überlieferung meldet, daß die Kirche an einen Heidentempel gebaut und durch das kaiserliche Heiligenpaar Heinrich II. und Kunigunde mit größerer Pracht erneuert worden sei, sowie daß sie in einer Kapelle ein kostbares Heiligtum bewahre: das Bild der jungfräulichen Mutter von der Hand des Evangelisten Lukas, des Schutzpatrons der christlichen Maler – ein Geschenk des Papstes an jenen heiligen Kaiser. Aus der in dieser Gegend zusammengedrängten Kirchengruppe tritt zuvörderst Niedermünster, hinter der alten Pfarr- oder Ulrichskirche gelegen, vor; einst ein gefürstetes, freies, weltliches Reichsstift (dessen Äbtissin durch das Gelübde gebunden war und zu den Reichsständen zählte), durch Judith, Herzogs Arnulfs, des Vielgelästerten, Tochter, auf einer Stelle gegründet, wo früher fromme Frauen das Grab Sankt Erhards gepflegt hatten – jetzt Pfarrkirche und bischöfliche Kurie. Jene fromme Judith und Otto II. mit seiner Mutter Adelheid fanden in Niedermünster die letzte Ruhestätte; auch St. Erhards Grab wird hier angenommen. Neben dem Dom ist die Kollegiats-Stiftskirche zum heiligen Johannes, 1129 gestiftet und 1380 auf der Stelle, wo sie jetzt steht, neu erbaut worden.
Wenden wir uns jetzt, über den Kräutermarkt hin und an der Stirnseite des Doms vorüberwandelnd, in die Domstraße, wieder über den Kornmarkt, so erblicken wir die Karmeliterkirche (1641 durch Ferdinand II. gegründet) und unfern davon, sobald wir um die Ecke bogen, die Minoritenkirche (1330 erbaut), die beide als Mauthallen verwendet werden. Der letzteren gegenüber stand einst das Klarenkloster, das 1809 niederbrannte und dessen Bewohnerinnen nunmehr in dem früher den Kapuzinern gehörigen, weitläufigen Kloster am Ausgang der Ostengasse ihrem schönen Beruf, dem Unterricht der weiblichen Jugend, obliegen.
Durch die Drei-Kronen- und die Schwarze-Bären-Straße gelangen wir nun an die Kassianskirche auf dem Hafenmarkt, die schon zu Anfang des 8. Jahrhunderts unter Theodo gestanden haben und 890 aus den Verheerungen des großen Brandes allein unversehrt geblieben sein soll. Wir wenden uns nun rechts zu der neuen Pfarrkirche, auf dem schönen, mit Platanen bepflanzten Platz; einst stand an der Stelle derselben die Synagoge der Juden, nach deren Vertreibung 1519 sich ein hölzernes Bethaus über dem Gnadenbild der »schönen Maria« erhob, zu dem oft einmal 50 000 Wallfahrer herbeikamen; so groß war deren Glaubenseifer, daß die Chronik jene Andacht eine »verzauberte« nennen mochte! Seit 1542 wurde die neue Pfarrkirche dem evangelischen Gottesdienst eingeräumt. Ihr gegenüber erhebt sich die Augustinerkirche, deren Turm, bis zur Spitze aus Steinquadern aufgeführt, als ein Wahrzeichen der Stadt galt, sprichwörtlich der »Turm ohne Dach«; die Kirche wurde 1255 erbaut, um den Platz zu sühnen und zu weihen, auf dem ein Priester am Gründonnerstag mit dem Sakrament gefallen war; die Augustiner bezogen das Kloster 1267.
Vom neuen Pfarrplatz aus durchmessen wir in gerader Richtung die Buchfelder Straße und sehen die dem heiligen Dionysius geweihte Kirche des ehemaligen freien weltlichen Reichsstiftes für Fräuleins von Adel, Obermünster, das jetzt zum Klerikalseminar eingerichtet ist. Die fromme Hemma, König Ludwigs des Deutschen Gemahlin, stiftete 831 Obermünster, wo sie und Herzog Heinrich I. von Bayern begraben liegen.
Nur eine kurze Strecke noch, und wir stehen vor dem seit uralten Zeiten hochberühmten Reichsstift Sankt Emmeran, zu dessen Gründung der Martertod des heiligen Emmeran Anlaß gab; Kaiser Karl der Große erweiterte und beschenkte Herzog Theodos Stiftung; der jetzige weitläufige Bau der Stiftskirche gehört der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts an; der frei vor der Halle stehende Turm wurde von 1575 bis 1579 erbaut. An die Stiftskirche schließt sich das ältere Gotteshaus zu St. Rupert an, die frühere Pfarrkirche. St. Emmeran rühmte sich, kostbare Heiligtümer und Bücherschätze zu besitzen; von ersteren die Leiber St. Emmerans, St. Dionys', des Areopagiten (den Arnulfs Kanzler, Bischof Tuto, durch List heimlich aus Frankreich nach Bayern brachte) u. a. m. Heiliger – von letzteren den berühmten Codex aureus Evangeliorum, ein Geschenk desselben Kaisers Arnulf, der dem Stift auch den ganzen Gau der Gewerbeleute übergab; Childerich, der flüchtige Frankenkönig, Kaiser Arnulf und Ludwig das Kind, Arnulf und der fromme Heinrich, die Bayernfürsten, Babo von Abensberg und die ersten Bischöfe, Aventin endlich, der Geschichtsschreiber der Bayern, u. a. m. ruhen zu St. Emmeran. Jetzt sind die ausgedehnten Klostergebäude in den Palast des Fürsten von Thum und Taxis umgewandelt, in dessen Wohnung, Reitschule und Stallungen, wovon die beiden letzteren das Auge durch gefällige architektonische Verhältnisse anziehen.
Vom Emmeransplatz biegen wir in die Herrenstraße ein, wandeln über den Gilgenplatz, wo das Deutsche Haus und die Ägidienkirche stehen, von da durch die Passage Am Ölberg zu der in edlen Verhältnissen 1277 erbauten St.-Blasius-Kirche, welche einst den Predigermönchen gehörte, deren ausgedehntes Kloster durch die Truchseß von Eckmühl gestiftet wurde und seit der Säkularisierung dem Seminar Sankt Paul wie dem Lyzeum dient. Aus dem Kreuzgang treten wir in die Kapelle, die eine Überlieferung als den Ort bezeichnet, wo Albertus Magnus lehrte, dessen Stuhl noch gezeigt wird. Wo die Predigergasse mit der Gesandtengasse zusammentrifft, steht die im 17. Jahrhundert erbaute, dem evangelischen Gottesdienst gewidmete, helle und freundliche Dreifaltigkeitskirche. Hier wenden wir uns in gerader Richtung nach der Promenade und dem oberen Jakobsplatz, wo wir das unter dem Fürsten Primas geschmackvoll erbaute Präsidentenhaus erblicken, in dessen Räumen der Schauspielsaal und der Redoutensaal, Harmonie und Frohsinn (zwei Privatgesellschaften) vereinigt sind.
In der Jakobsstraße weiter, dem Jakobstor zuschreitend, finden wir uns jetzt durch den Anblick des uralten, mit einer Menge von abenteuerlichen Steinbildern geschmückten Portals der Jakobskirche überrascht, einer Reliquie des 12. Jahrhunderts (sie wurde im Jahre 1111 für die schottischen Mönche des St.-Benedikts-Ordens erbaut). Wem ginge bei der Betrachtung jener rätselhaften Bildwerke, in deren Schöpfung sich gewiß mehr der phantastische Humor der alten Meister oder das Kindesalter ihrer Kunstfertigkeit zeigt, als sich in denselben Knospen einer geheimnisvollen Symbolik nachweisen lassen; wem ginge gleichwohl bei dem Anblick der ringenden, sich umschlingenden Ungetüme nicht die Erinnerung an den Kampf der Gesittung gegen Barbarei, der schöpferisch-geistigen mit den rohen Elementarkräften auf. Jene Schotten, vor deren Schwelle wir stehen, griffen im Laufe der Zeit mächtig fördernd in den großen sturmvollen Bildungs- und Gesittungsprozeß des deutschen Lebens ein; hier in Regensburg hatten sie gleichsam eine zweite Heimat gefunden, die des Papstes Exemptionsbulle mit dem Schutzring der Selbständigkeit umschloß; und wie ihr eigentliches Vaterland einst die vielen Glaubensboten nach dem heidnischen Deutschland, so sandten die Schotten zu Regensburg allenthalben fort und fort Kolonisten hin, neue Klöster zu gründen – so nach Wien, nach Würzburg, nach Kostnitz, nach Nürnberg –, und standen durch Zöglinge, die sie aus Schottland, England und Irland nach dem Kontinent beriefen, in immer frischer Wechselwirkung, die sie weiterhin vermittelten.
Wenn wir vom Schottenkloster zum unteren Jakobsplatz zurückkehren und in das Kreuzgäßchen einbiegen, kommen wir auf den Nonnenplatz an das 1237 gestiftete Kloster der Dominikanerinnen »Zum Heiligen Kreuz«, von da in nördlicher Richtung, am Judenstein vorbei, an die einst den Templern, dann den Maltesern gehörige, 1717 neu erbaute Leonhardskirche, in die vorzeiten, da frommer Aberglaube ohne Bedenklichkeit Heiliges mit Unheiligem vermischte, am St.-Leonhards-Tag die Pferde geführt wurden, um ein Jahr lang vor allem Gebrest gefeit zu bleiben. Von da führt uns unser Weg durch die Lederergasse bis zu der seit dem Beginn der Reformation dem protestantischen Gottesdienst gewidmeten kleinen St.-Oswalds-Kirche, mit der das im 12. Jahrhundert gestiftete Hospital in Verbindung steht.
Durch die Donaustraße, über den Weinmarkt und den Fleischhausplatz lenken wir nun wieder nach dem Kohlenmarkt ein, wo das Rathaus mit seinem Turm und seinem schönen Portal unsere Aufmerksamkeit fesselt. In dem sogenannten Alten Rathaus spukte bis 1806 der deutsche Reichstag. Von da durch die Waggasse gelangen wir auf den Haidplatz, wo der Dollinger den trotzigen Krako erlegte. Ein Spaziergang in den anmutigen Anlagen, die die Stadt im weiten Halbkreis umschließen und mit den Gärten des Fürsten Thurn und Taxis und der Botanischen Gesellschaft ein schönes Ganzes zu bilden scheinen, stimmt uns, wie wir dem düsteren Labyrinth der engen krummen Straßen entronnen sind, heiter, und der Anblick einer Reihe von Monumenten überrascht uns aufs erfreulichste; zuerst das Görzsche, dann das Gleichensche, dann der dem ersten Stifter der Anlagen, Carl Anselm Fürsten von Thurn und Taxis, durch Dalberg 1806 errichtete Obelisk, das Grubersche, das Zollersche Denkmal; vor allen aber die schöne offene Rotunde, in der sich Dannekers Marmorbasrelief »Keplers Genius, Uranien entschleiernd« Der berühmte Astronom starb zu Regensburg 1630. befindet.
Wie wenige andere Städte ist Regensburg reich an pittoresken Umgebungen. Das Herz wird weit im Genuß des ausgedehnten Panoramas, das sich von der Höhe der Dreifaltigkeitskirche über dem Steinweg aus vor uns entfaltet. In Nähe und Ferne zeigen sich reizende Ausflugsorte. Reinhausen mit Schloß und Park, die weiland Kartause Prül, die Höhe bei Ziegetsdorf am rechten; am linken Ufer, wo die Waldberge in schönen Gruppen hintereinander emporsteigen, Tegernheim, und vor allem die Ruinen der alten, den Bürgern Regensburg so oft furchtbaren Burg Donaustauf, die Bernhard von Weimar im Dreißigjährigen Krieg zerstörte, die Wallfahrtskirche und der großartige Säulenbau der Walhalla, weithin den majestätisch dahinflutenden Strom sowie die unabsehbare Ebene gegen Norden bis an den Böhmerwald beherrschend.
An dieser Stelle laßt uns eine Weile rasten und des Vaterlands gedenken, dessen großen Männern – von Armin, dem Befreier, an – der Tempel des Ruhms geweiht ist. Hier schlage lauter in Freude, deutsches Herz; nicht bloß in dem Erntefeld Vergangenheit, das sich weit und reich gesegnet wie die herrliche Landschaft vor dir ausbreitet – in schönen Zukunftsträumen auch schwelge vor der »Halle der Erwartung«, die den noch Lebenden, Wirkenden eingeräumt wird, und träume für wenige Sekunden über die Gegenwart hinweg! Schämst du dich nicht, daß dir der Mut schon öfter sinken wollte in der Schwüle des Tages, den du eben erlebtest? Daß du die deutsche Eiche schon verloren gabst, weil du an ihr auch dürre Äste sahst, und einige bedauernswerte arme Blinde auf Leitern daran, die das dürre Holz mit grüner Farbe überstrichen und glaubten, sie könnten dich glauben machen, die toten, dürren Äste hätten wieder frisches Leben getrieben? Was kümmert dich dieser Wahn? Was kümmert dich das Verlorene? Warum verzagst du? Die deutsche Eiche wurzelt ja noch fest, und frischer Saft kreist in ihr, und genug frisches Laub treibt aus ihrem Stamm, daß du von den verdorrten und verfaulten Ästen, von dem welken Laub, das noch trotzig zwischen grünem sich behauptet, wahrlich nichts zu fürchten brauchst. Mit Armin des Befreiers Blut ist die Wurzel gedüngt, und seine Stimme, vor der die Welschen zitterten, rauscht noch in deine Träume, wenn du sie nur hören willst! Siehst du den Cherub Freiheit nicht, der in die Rinde des Stammes, wo einer der kräftigsten Äste sich ihm entwand, den Namen Luther schrieb? Wach auf, wach auf, deutsches Herz; du schliefst schon zu lange!

Donaustauf und Walhalla
An einem 18. Oktober war's – nicht 1813, da Napoleon von Leipzig floh, sondern 1830, da die dreifarbige Fahne auf dem Palais royal wieder wehte –, als König Ludwig von Bayern ein Gelübde erfüllend, das er schon als Thronerbe dem Vaterland und sich geleistet Damals schrieb Johannes von Müller an ihn: »Es ist groß, daß Sie, Durchlauchtigster Kronprinz, jenen herrlichen Gedanken der Walhalla, der Zierde des Vaterlandes, nicht sinken lassen. Die deutsche Nation hatte nie ein größeres Bedürfnis, ihrer selbst nicht zu vergessen und in der neuen Ordnung der Zeiten mit Würde zu erscheinen. – – – Es ist eines eigenen Lorbeers würdig, das Gefühl der Nationalkraft nicht untergehen zu lassen und, wie mehrmals Ihre Altvorderen an entscheidenden Tagen, so als Verfechter des verkannten Werts zu erscheinen.« hatte, auf dieser Bergkuppe den Grundstein zu einem Tempel des deutschen Ruhmes legte, der, im Geist und Geschmack des klassischen Altertums auszuführend, allen Stämmen des deutschen Volkes als feste Burg der Einheit und Ganzheit entgegenleuchte. Der Meister der Glyptothek, Leo von Klenze, übernahm den Bau; Bildner aus allen Gauen des Vaterlandes sollten das Gedächtnis deutscher Männer und Frauen, sollten des deutschen Volkes Tatenherrlichkeit in Marmor verewigen – Walhalla ist des Ruhmestempels Name –, das Jahr 1840 sollte das der Vollendung sein. Prachtvolle Doppeltreppen führen vom Stand des Stroms, über dem der Tempel 304 Fuß hoch sich erhebt, den Berg hinan, den zyklopische Mauern umgeben. In der Mitte der Treppen nimmt die »Halle der Erwartung« die Bilder der lebenden Zeitgenossen auf, denen Anwartschaft auf einen Platz im Allerheiligsten oben eingeräumt worden ist. Den Tempel selbst tragen riesige dorische Säulen; die Stirnseite, dem Strom zugekehrt, beherrscht die weite Landschaft, von den Giebelfeldern aber leuchten die Hochbilder der Freiheitskämpfe!
Welch ein Moment – Deutsche aus allen Gauen –, wenn die hölzerne Umhüllung niedersinken wird, die den erhabenen Bau jetzt noch verdeckt; wenn der weiße Marmor der Tempelwände, wenn die mächtigen dorischen Säulen zuerst frei im Sonnenlicht glänzen, im Morgenrot des Tages der Herrlichkeit, der über dem ganzen deutschen Vaterland aufgehen möge; wenn die riesigen Löwen sich auf den Zugängen der prächtigen Treppe als Hüter der Vergangenheit hinlagern und ein ganzes Volk voll Tatenlust und Begeisterung erwartungsvoll die breiten Stufen hinanwogt und das Heiligtum füllt, von dessen Wänden die Bilder der alten deutschen Sitten, die deutschen Siegesgöttinnen und die Marmorbüsten der Edelsten des Vaterlands herabblicken!