
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die niedliche Eidechse, die wohl jedem meiner Leser aus eigener Anschauung bekannt sein dürfte, kann als Urbild aller Echsen gelten, obgleich diese Grundgestalt, wie ich mich ausdrücken möchte, vielfach abändert, indem Mißverhältnis der einzelnen Glieder untereinander bemerklich wird, sonderbare Stacheln und Hautkämme, Lappen und Falten vorkommen oder einzelne Glieder verkümmern, und die betreffenden Tiere dann den Schlangen ähnlich werden. Im allgemeinen haben die Schuppenechsen die Gestalt der Krokodile, und nur wenige von ihnen ähneln bezüglich ihrer Leibesgestalt und ihrer Fußlosigkeit den Schlangen: sie unterscheiden sich aber durch äußerliche und innerliche Merkmale von den Panzerechsen schärfer als von den Schlangen. Ihr Leib scheidet sich gewöhnlich deutlich in Kopf, Hals, Rumpf und Glieder; doch können die letzteren verkümmern oder gänzlich fehlen und die betreffenden Tiere dann den Schlangen ähnlich werden: auch diese Übereinstimmung aber, die der Unkundige zwischen ihnen und den letzteren wahrzunehmen glaubt, ist bloß eine oberflächliche, die bei genauerer Betrachtung verschwindet. Bezeichnend für alle Schuppenechsen sind: das aus Hornschuppen bestehende Kleid, die bewegliche Zunge und die ein- oder angewachsenen, nie eingekeilten Zähne. Die Augenlider sind beweglich, die Nasenlöcher getrennt. Der After ist nicht, wie bei den Schildkröten und Krokodilen, ein Längs-, sondern ein Querspalt.
Die bei den verschiedenen Arten vielfach abändernden Schuppen unterscheidet man als Täfel-, Schindel- und Wirtelschuppen. Unter ersteren versteht man kleine, runde oder vieleckige, mit ihrem ganzen Rande angeheftete Horngebilde, die nebeneinander liegen, sich also nicht decken, während die Schindelschuppen mit ihrem Vorderrande in der Haut festgewachsen, mit ihrem Hinterrande dagegen frei sind und sich mit den Seitenrändern, teilweise auch mit ihren Spitzen decken und die Wirtelschuppen in geraden Linien nebeneinander stehen. Diejenigen Schuppen, die sich durch ihre Größe auszeichnen und mit ihrer ganzen Fläche der Haut anliegen, werden Schilder genannt und ebensowohl nach ihrer Lage als nach ihrer Gestalt unterschieden. Der Schädel unterscheidet sich wesentlich von dem der Krokodile. Das den Oberkiefer ausnehmende Quadratbein ist regelmäßig beweglich am Schädel eingelenkt, der Oberkiefer mit einer einzigen Ausnahme unbeweglich. Eine vielfach schwankende Anzahl vorn ausgehöhlter, hinten gewölbter, ausnahmsweise auf beiden Seiten eingetiefter Wirbel setzt die Wirbelsäule zusammen. Die Rippen enden stets mit einfach abgerundeten Enden. Brustbein, Schulter und Beckengerüst können zwar verkümmern, fehlen aber niemals, wie bei den Schlangen der Fall ist. Die Zunge, für die Bestimmung der Familie von Bedeutung, kommt in vielerlei Gestalt vor: vorn gespalten und wurmförmig, dickfleischig, kaum ausgerandet oder zugerundet, kurz und an der Wurzel verdickt, verdünnt und mehr oder minder tief ausgeschnitten usw. Die Zähne heißen eingewachsen, wenn sie auf dem Rande der Kiefer aufgesetzt fest mit ihnen verwachsen sind, angewachsen, wenn sie mit der Außenseite ihres Wurzelendes an der inneren Seite der Kiefer angefügt erscheinen, so daß die Innenseite ihrer Wurzel frei liegt und nur vom Zahnfleische bedeckt wird. Außer diesen beiden Zahnarten tragen die Schuppenechsen auch noch sogenannte Gaumenzähne, solche, die im Gaumen auf dem Keilbeinflügelknochen festsitzen. Nach ihrer Gestalt ändern die Zähne mannigfach ab.
Die Schuppenechsen bilden die artenreichste Ordnung der Kriechtiere. Sie verbreiten sich, mit Ausnahme des kalten Gürtels, über alle Teile der Erde und finden sich vom Meeresgestade an bis zur Grenze des ewigen Schnees aus den verschiedensten Örtlichkeiten, im fruchtbaren Lande wie in Einöden und Wüsten, in der Nähe des Wassers wie in gänzlich wasserlosen Gegenden. In den kälteren Teilen der gemäßigten Gürtel werden sie nur durch wenige Arten vertreten; ihre Artenzahl und damit ihre Vielgestaltigkeit und Farbenschönheit nimmt jedoch gegen den Gleicher hin in überraschender Weise und mehr und mehr sich steigerndem Maßstabe zu. Einige Arten leben im Wasser und betreten das Land, nach Art der Krokodile, nur, um eine sich ihnen bietende Beute wegzunehmen oder um zu schlafen und sich zu sonnen; die Mehrzahl zählt zu den Landbewohnern im strengsten Sinne des Wortes und meidet schon feuchte Örtlichkeiten. Nicht wenige leben auf Bäumen, die große Menge jedoch auf festem Boden oder an Felsenwänden. Von ihrer Leibesgestalt läßt sich im voraus auf den Aufenthalt schließen. Diejenigen unter ihnen, deren Körper plattgedrückt erscheint, wohnen meist auf sandigen Ebenen und suchen unter Steinen, an Mauern oder in Höhlen Zuflucht; diejenigen, deren Leib seitlich zusammengedrückt ist, herbergen in Gebüschen oder auf Bäumen; jene endlich, deren Körper rundlich ist, hausen in Erd- und Baumlöchern. Doch erleidet auch diese Regel mancherlei Ausnahmen.
Der Mensch hat sich mit den Schuppenechsen befreundet, und sie verdienen eine solche Bevorzugung. Wir dürfen sie unbedingt zu den begabtesten aller Kriechtiere zählen. Wahrscheinlich stehen sie in keiner einzigen Fähigkeit hinter irgendeinem anderen Klassenverwandten zurück. Ihre Bewegungen sind vielseitig, gewandt, geschickt und meist sehr schnell. Auch sie schleppen beim Gehen den Leib fast noch auf dem Boden dahin, laufen aber sehr rasch, obwohl mit schlängelnder Bewegung, und wissen sich durch Aufschlagen ihres Schwanzes gegen den Boden über denselben emporzuschleudern, also ziemlich weite Sprünge auszuführen. Die wenigen Arten, die im Wasser leben, schwimmen und tauchen trotz ihrer nicht mit Schwimmhäuten ausgerüsteten Füße ganz vorzüglich, und auch andere, die das Wasser ängstlich scheuen, wissen sich, wenn sie zufällig in das feindliche Element geraten, hier mit vielem Geschick zu behelfen; diejenigen endlich, die an Felswänden, Mauerwerk oder auf Bäumen herumklettern, tun dies meist mit einer wahrhaft überraschenden Fertigkeit. Bei den meisten Baumechsen wird der lange Schwanz zur Erhaltung des Gleichgewichts mit Erfolg gebraucht, und sie sind imstande, fast ebenso schnell, wie die Verwandten auf dem Boden, längs der Zweige dahinzulaufen oder von einem Zweige zum andern zu springen. Einigen Schuppenechsen, die ebenfalls auf Bäumen leben, dient der Schwanz als Greifwerkzeug, und sie bewegen sich, wie alle Tiere, die in ähnlicher Weise ausgerüstet sind, verhältnismäßig langsam; andere laufen mit Hilfe ihrer scheibenartig verbreiterten, unten rauhäutigen Zehen in jeder beliebigen Richtung, kopfoberst oder kopfunterst, ebenso sicher auf der Ober- wie an der Unterseite der Zweige; einzelne endlich vermögen mit Hilfe ihrer faltbaren Haut Flugsprünge auszuführen, d. h. sich von höheren Zweigen herab auf tiefer stehende zu werfen. Bei den Schuppenechsen, deren Füße verkümmert sind oder gänzlich fehlen, geschieht die Fortbewegung genau in derselben Weise wie bei den Schlangen, obgleich bei ihnen die Rippen nicht in so ausgedehnte Wirksamkeit treten wie bei diesen.
Wenige Schuppenechsen besitzen eine eigentliche Stimme. Von den meisten vernimmt man im Zorne höchstens ein fauchendes Zischen oder Blasen; einzelne Arten aber, insbesondere die nächtlich lebenden, geben abgerundete, schallende Töne zu hören, Laute, die mit dem Gebrüll der Krokodile nichts gemein haben, vielmehr an die Stimme der Frösche erinnern.
Unter den Sinnen steht das Gesicht ausnahmslos obenan. Die Mehrzahl besitzt ein wohlentwickeltes Auge mit rundem Stern, der besonderer Zusammenziehung nicht fähig ist; einige aber haben einen spaltförmigen Stern und geben sich dadurch schon äußerlich als Nachttiere zu erkennen. Auf das Gesicht folgt wahrscheinlich das Gehör, das bei der großen Mehrzahl als fein bezeichnet werden mag. Hierauf folgt wohl das Gefühl, bezüglich der Tastsinn. Viele benutzen ihre Zunge genau in derselben Weise wie die Schlangen, hauptsächlich zum Tasten und nicht oder doch nur in untergeordneter Weise zum Schmecken. Über den Sinn des Geruchs wage ich nicht zu urteilen, weil die mir bekannten, hierauf bezüglichen Beobachtungen hierzu nicht berechtigen. Auch der Geschmack kann nur ein untergeordneter sein, da die Schuppenechsen feste Nahrung nicht zermalmen oder zerkauen, sondern ganz hinabschlingen und zwischen dieser und jener Speise kaum einen Unterschied machen.
An Verstand stehen die Schuppenechsen schwerlich hinter einem Kriechtiere zurück. Sie sammeln Erfahrungen und benehmen sich infolge derselben verschiedenartig. Bei uns zulande sehen sie in jedem größeren Geschöpfe und insbesondere im Menschen einen gefährlichen Feind; in den südlichen Ländern leben sie mit letztgenanntem in traulichen Verhältnissen, kommen dreist bis in unmittelbare Nähe desselben, bitten sich sozusagen in der menschlichen Wohnung zu Gaste und werden schließlich zu förmlichen Haustieren. Alle Liebhaber, die diese zierlichen Geschöpfe in Gefangenschaft halten, gewinnen die Ansicht, daß ihre Pfleglinge sie kennenlernen, und wenn damit auch nicht gesagt sein soll, daß sie ihren Pfleger von andern Menschen unterscheiden, wird dadurch doch bewiesen, daß sie ihr früheres Betragen infolge gesammelter Erfahrungen umändern. Ihr Wesen spricht uns an. Sie erscheinen, größtenteils mit Recht, als Bilder unschuldiger Fröhlichkeit und Heiterkeit, sind lebendig, regsam, vorsichtig und im Verhältnisse zu ihrer Größe außerordentlich mutig. Als Raubtiere lassen sie sich zuweilen Dinge zuschulden kommen, die wir von unserm Gesichtspunkte aus einseitig verurteilen, fressen beispielsweise ohne Bedenken ihre eigenen Jungen auf oder größere Arten kleinere Verwandten; trotzdem darf man bei ihnen noch immer eher als bei andern von Geselligkeit reden: denn man findet oft viele von ihnen vereinigt und kann beobachten, wie solche Gesellschaften längere Zeit in einem gewissen Verbande bleiben.
Einige Schuppenechsen nähren sich von Pflanzenstoffen, ohne jedoch tierische Beute gänzlich zu verschmähen; alle übrigen sind, wie eben bemerkt, Raubtiere, denen verschiedene Klassen des Tierreiches zollen müssen. Die größeren Arten stellen Wirbeltieren aller fünf Klassen nach, wagen sich an kleine Säugetiere und Vögel, sollen sogar größeren zuweilen gefährlich werden, rauben Nester aus, bedrohen alle Kriechtiere, Lurche und Fische und jagen außerdem auf alle niederen oder wirbellosen Tiere, deren sie habhaft werden können; die kleineren Arten nähren sich hauptsächlich von letztgenannten Geschöpfen, viele vorzugsweise von Kerbtieren, andere von Würmern und Schnecken. Ihre Verdauung ist lebhaft, insbesondere bei heißem Wetter; sie fressen dann auffallend viel und feisten sich bis zu einem gewissen Grade, können aber auch unter ungünstigen Umständen sehr lange und ohne ersichtlichen Schaden Hunger leiden. Die harten Teile ihrer Beute oder zufällig mit verschluckte Pflanzenteile geben sie mit ihrem Miste wieder von sich. Alle bekannten Arten trinken, und zwar mit Hilfe ihrer Zunge, die sie wiederholt ins Wasser tauchen und zurückziehen; den meisten genügt übrigens schon der Tau, der sich auf Blättern und Steinen sammelt, und einzelne scheinen das Wasser wirklich monatelang entbehren zu können.
Das tägliche Leben dieser Tiere ist wechselreicher als das anderer Angehörigen der Klasse, im ganzen jedoch ebenfalls eintönig. Am regsamsten zeigen sie sich in den heißen Ländern unter den Wendekreisen, insbesondere da, wo alle Jahreszeiten im wesentlichen gleichartig verlaufen, sie also nicht genötigt werden, zeitweilig Schutz gegen die Einflüsse der Witterung zu suchen. Hier beginnen sie schon in den frühen Morgenstunden ihr Tagewerk und treiben sich bis gegen Sonnenuntergang munter umher, ihren nächtlich lebenden Genossen von jetzt an bis zum frühen Morgen das Feld überlassend. Die ersten und letzten Stunden des Tages werden der Jagd, die Vormittags- und Nachmittagsstunden dem Vergnügen, d. h. geselligem Beisammensein, gewidmet, die heißesten in einem Halbschlummer verbracht; denn übergroße Sonnenhitze scheuen sie ebenso sehr als Kühle. In gemäßigten Landstrichen sieht man sie während der Mittagszeit behaglich hingestreckt auf den Sonnenstrahlen zugänglichen Plätzen liegen; in den Gleicherländern bevorzugen sie während dieser Zeit regelmäßig schattige Stellen. Jede einzelne Schuppenechse erwählt ein gewisses Wohngebiet und in demselben Passende Schlupfwinkel zum Wohnräume, bereitet sich wohl auch selbst einen solchen. Von diesem Wohnräume, den man als das Haus des Tieres bezeichnen kann, entfernt es sich niemals weit, und bei Gefahr eilt es demselben so eilig als möglich wieder zu. Hiervon machen auch diejenigen, die im Wasser oder auf Bäumen leben, keine Ausnahme. Wer die Warane sorgfältig beobachtet, bemerkt, daß sie mehr oder weniger auf derselben Stelle zum Sonnen oder Schlafen erscheinen, und wer sich mit denjenigen, die auf Bäumen leben, längere Zeit abgibt, erfährt, daß sie von dem Wohnbaume freiwillig nicht lassen. Es scheint, daß jede Echse mit gewissem Verständnisse eine Stelle auswählt, die mit ihrer Färbung im Einklange steht. Hier lauert sie auf Beute, jede Art in ihrer Weise. Alle diejenigen, die sich schnell bewegen, fassen das erspähte Opfer scharf ins Auge und stürzen unter Umständen mit einem weiten Sprunge auf dasselbe, packen es, zerquetschen es zwischen den Zähnen und würgen es, den Kopf voran, in den Schlund hinab; diejenigen hingegen, die nur gemächlich einen Fuß vor den andern setzen, nahen sich äußerst langsam ihrer Beute, schießen aber im rechten Augenblicke blitzschnell die lange Zunge hervor und erfassen die Nahrung geschickt und sicher mit dieser. Nach reichlicher Mahlzeit werden auch die Schuppenechsen träge; niemals aber fallen sie, wie die Schlangen, in einen Zustand völliger Abspannung und Gleichgültigkeit. Mit Sonnenuntergang ziehen sich die Tagechsen regelmäßig in ihren Schlupfwinkel zurück, und bei ungünstiger Witterung verweilen sie manchmal mehrere Tage, ja Wochen, in demselben. Alle Arten der Ordnung, die nicht in Ländern ewigen Frühlings auf Bäumen oder im Wasser leben, verbringen die ungünstige Jahreszeit in einem Zustande, der dem Winterschlafe der Säugetiere im wesentlichen ähnelt. Unsere deutschen Eidechsen verbergen sich im Herbste sämtlich in tiefen Löchern unter der Erde und verweilen hier, den Winter durchschlafend, bis zum Beginne des Frühjahres; dieselben Arten aber, die in Deutschland nur fünf Monate verschlafen, bringen im nördlichen Europa oder hoch oben im Gebirge acht bis zehn Monate in diesem Zustand der Erstarrung zu.
Bald nach dem Erwachen im Frühjahre, gleichviel in welcher Weise derselbe auftritt, regt sich der Fortpflanzungstrieb. Man bemerkt nunmehr unter den Schuppenechsen lebhafte Erregung, sieht, wie zwei Männchen sich heftig verfolgen, nicht selten miteinander in Zweikampf geraten und sich tüchtig beißen und herumzausen. Nur während dieser Zeit halten Männchen und Weibchen inniger zusammen. Einige Wochen später sind die sechs bis fünfzehn Eier, die das Weibchen zur Welt bringt, legereif, und die Mutter bereitet nunmehr, nicht ohne Anstrengung und Sorgfalt, ein passendes Nest zur Aufnahme derselben, indem sie in lockerer Erde oder im Moose, im Mulme zerfallener Baumstämme, in Ameisen- und Termitenhaufen usw. ein Loch ausgräbt, in dieses die Eier bringt und sie wieder leicht bedeckt. Die Eier selbst unterscheiden sich wenig von denen anderer Kriechtiere, besitzen die zähe, wenig kalkhaltige, lederartige, schmiegsame Schale derselben, den großen ölreichen Dotter und das dünnflüssige Eiweiß. Etwa einen oder zwei Monate, nachdem sie abgelegt wurden, sind sie gezeitigt. Die Jungen entschlüpfen ohne jegliche Hilfe seitens der Eltern und beginnen vom ersten Tage ihres Lebens an das Treiben der letzteren. Dies ist die Regel. Aber nicht alle Schuppenechsen legen Eier: viele bringen vielmehr lebende Junge zur Welt, d. h. tragen die Eier im Mutterleibe soweit aus, daß dieselben kurz vor dem Ablegen zerplatzen und anstatt ihrer die entschlüpften Jungen abgelegt werden. In nördlichen Ländern häuten sich die im Spätsommer zur Welt gekommenen Jungen noch einmal, dann suchen sie den günstigsten Ort zum Winterschlafe auf.
Die Schuppenechsen haben mehr als alle übrigen Kriechtiere von Feinden zu leiden. Ein wahres Heer von Raubtieren stellt ihnen nach und bedroht sie in allen Zuständen ihres Lebens. Die großen Arten sind, dank ihrer Stärke und des mit derselben sich paarenden Mutes, ziemlich gesichert vor den Angriffen anderer Tiere, die kleinen aber fallen Schleichkatzen, Mardern und Stinktieren, Schlangen, Geiern, Adlern, Falken und Bussarden, Eulen, Raben, Hühnern, Sumpf- und Wasservögeln sowie endlich den Stärkeren ihrer Art zur Beute, so daß man sich eigentlich wundern muß, wie sie so vielen Nachstellungen entgehen können. Auch der Mensch gesellt sich hier und da zu den Gegnern und Verfolgern der harmlosen Geschöpfe, oft nur aus reinem Übermute, rohe Lust zum Totschlagen betätigend. Einige werden mit Unrecht für giftig gehalten, da die schärfste Untersuchung bei den verdächtigten Arten der Ordnung Giftdrüsen nicht entdecken ließ, andere als Schlangen angesehen, und müssen dann unter den Folgen des allgemeinen Widerwillens gegen das kriechende Gewürm leiden. Wirklich ins Gewicht fallenden Nutzen bringen die Schuppenechsen nun zwar nicht: aber sie verursachen auch keinen Schaden. Das Fleisch von einigen großen Arten der Ordnung wird gegessen und selbst von Europäern als wohlschmeckend befunden, andere erfreuen durch ihre zierliche Behendigkeit im Freien, durch ihre Anmut und Harmlosigkeit im Käfige, und die Mehrzahl nährt sich zudem von Tieren, die uns unangenehm sind.
Die außerordentliche Reichhaltigkeit der Ordnung verwehrt in jedem volkstümlichen Werke, Mangel an Beobachtungen über die Lebensweise im »Tierleben« insbesondere, genaueres Eingehen auf den unendlichen Gestalten- und Artenreichtum der Schuppenechsen Ich werde daher nur die wichtigsten Vertreter der Gesamtheit besprechen.
*
Eine in jeder Beziehung auffallende Echse, die die Merkmale verschiedener Ordnungen in sich vereinigt, mag an die Spitze der von mir ausgewählten Arten gestellt werden. Die Brückenechse ( Hatteria punctata), die wir als Urbild einer besonderen Familie betrachten müssen und als Vertreterin einer eigenen, von allen übrigen gleichwertigen Abteilungen wesentlich verschiedenen Unterordnung ( Rhynchocephalia) ansehen mögen, ist eine sehr große, etwas plumpe Schuppenechse. Ihr Kopf ist vierseitig, der Leib gedrungen, der Gliederbau kräftig, der etwa der Längs des Rumpfes gleichkommende Schwanz zusammengedrückt dreieckig; die Vorder- und Hinterfüße haben fünf kräftige, kurze, runde Zehen, die kleine Spannhäute zeigen und mit kurzen Krallen bewehrt sind. An der Brust bemerkt man hinten eine Querfalte; im Nacken, längs der Rückenmitte und ebenso längs der Mitte des Schwanzes erhebt sich ein aus zusammengedrückten Dornen gebildeter, in der Schulter- und Lendengegend unterbrochener Kamm. Kleine Schuppen decken den Kopf, kleinere und größere den Leib, große, viereckige, flache, gekielte, in Querreihen angeordnete Schilder die Unterseite, kleine Schuppen den Schwanz und die Ober- und Unterseite der Zehen; die der ganzen Oberseite find körnelig, diejenigen, die die unregelmäßigen Hautfalten besetzen, größer als die übrigen. Ein düsteres Olivengrün bildet die Grundfarbe; kleine Weiße und dazwischen stehende größere gelbe Flecken tüpfeln Seiten und Glieder; die Stacheln des Nackens und Rückenkammes sind gelb, die des Schwanzkammes braun gefärbt.
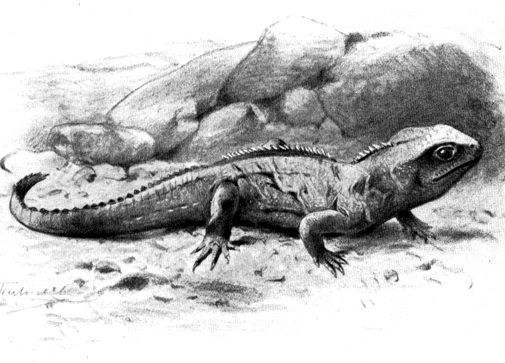
Brückenechse ( Hattaria punctata)
Viel auffallendere und bedeutsamere Merkmale, als die äußerlichen sind, ergeben sich bei der Zergliederung des Tieres. Das Quadratbein ist, im Gegensatze zu allen übrigen Schuppenechsen, mit dem Schädel unbeweglich vereinigt und der Antlitzteil des Schädels durch zwei über die Schläfengrube hinweggehende knöcherne »Brücken« – Name! – mit der Schläfengegend verbunden. Die Zähne sind in gewöhnlicher Weise mit ihrer Wurzel auf dem Rande der Kieferknochen befestigt, nutzen sich jedoch, mit Ausnahme der zwar ebenfalls sich verändernden, jedoch nicht verschwindenden beiden Vorderzähne, bei älteren Tieren derartig ab, daß diese, wie die Schildkröten, mit den Kieferrändern beißen müssen. Die Wirbel sind vorn und hinten eingehöhlt, wie dies bei einigen Lurchen und den Fischen der Fall ist oder bei vorweltlichen Kriechtieren, Ichthyo-, Megalo- und Teleosauren, der Fall war. Die Rippen stimmen insofern mit denen der meisten Schuppenechsen überein, als einige, und zwar drei Paare, mit dem Brustbeine sich verbinden, sodann mehrere, hier elf Paare, falsche vorhanden sind; allein die unteren Enden der falschen Rippen vereinigen sich wiederum mit eigenen Knochenleisten, Bauchrippen, die in der Unterhautschicht der Bauchdecken liegen und hinsichtlich ihrer Anzahl und Lage den in Querreihen angeordneten äußeren Bauchschildern entsprechen, die Anzahl der Wirbel und falschen Rippen aber um das Doppelte übertreffen, auch so fest mit den Bauchschildern zusammenhängen, daß sie nur mit Hilfe des Messers davon getrennt werden können: es entspricht daher eine Querreihe von Bauchschildern unseres Tieres dem einzelnen Bauchschilde einer Schlange. Letzterer ähnelt die Brückeneidechse auch darin, daß ihr das Trommelfell und damit eine begrenzte Trommelhöhle fehlt. Männliche Geschlechtswerkzeuge konnte Günther nicht auffinden; die Brückeneidechse gleicht also in dieser Beziehung wiederum den Lurchen. So kann man, wie Martens sich ausdrückt, nur sagen, »daß unsere Echse ein Kriechtier ist, das im großen und ganzen zu den Eidechsen gehört, in einigen wichtigen Bildungsmerkmalen jedoch auf der Stufe der Lurche stehen geblieben und ebenso andere Anpassungsmerkmale nach Art und Weise der Krokodile und Schlangen ausgebildet hat«.
Über Vorkommen und Lebensweise der Brückeneidechse haben wir bisher nur dürftige Berichte erhalten. Cook ist der erste, der in seiner »dritten Reise« ihrer Erwähnung tut. »Es soll in Neuseeland Eidechsen von ungeheurer Größe geben; denn sie sollen 2,6 Meter lang und ebenso dickleibig sein wie ein Mann, zuweilen auch Menschen angreifen und verzehren. Sie wohnen in Löchern unter der Erde, und man tötet sie dadurch, daß man vor dem Eingange ihrer Höhle ein Feuer anzündet.« Polack spricht ebenfalls von diesem Tiere. »Die riesige Eidechse oder Guana«, sagt er, »lebt vorzugsweise auf der Insel Victoria; einige wenige kommen auch auf den Inseln im Plentybusen vor. Die Eingeborenen erzählen Menschenfressergeschichten von ihr; sie ist jedoch ohne Zweifel ein harmloses Geschöpf.« Dieffenbach erfuhr ein wenig mehr. »Ich erhielt Nachricht von dem Vorhandensein einer großen Eidechse, die die Eingeborenen ›Tuatera‹ oder ›Narara‹ nennen und in hohem Grade fürchten; doch gelang es mir, obgleich ich alle ihr zugesprochenen Aufenthaltsorte nach ihr absuchte und eine bedeutende Belohnung auf ihren Fang setzte, erst wenige Tage vor meiner Abreise von Neuseeland, eine einzige zu erhalten. Sie war auf dem kleinen, in der Bucht von Plenty, ungefähr zwei Meilen von der Küste gelegenen Felseneilande Karewa gefangen worden. Aus allem, was ich erfuhr, scheint hervorzugehen, daß die Brückeneidechse vor Zeiten auf allen Inseln häufig war, in Höhlen, oft auch auf sandigen Hügeln an der Küste lebte und von den Eingeborenen ihres Fleisches halber verfolgt und getötet wurde. Infolge dieser Nachstellungen und zweifelsohne ebenso der Einführung von Schweinen ist das Tier so selten geworden, daß viele ältere Bewohner des Landes es nicht gesehen haben.« Die Brückeneidechse, die Dieffenbach lebend gebracht wurde, gelangte später in das Britische Museum und gab Grey Gelegenheit, der wissenschaftlichen Welt die Art bekannt zu machen. Nach Diefenbachs Zeit, Anfang der vierziger Jahre unseres Jahrhunderts, wurden noch einige andere Stücke tot oder lebend nach England gesendet, immerhin aber so wenige, daß Günther schon im Jahre 1867 die Befürchtung aussprechen konnte, die Brückeneidechse werde wahrscheinlich binnen kurzem zu den ausgestorbenen Tieren zu zählen sein. Später wird von Bennett mitgeteilt, daß das Tier bis zum Jahre 1851 auf einzelnen Inselchen des erwähnten Busens, insbesondere auf Rurima und Montoki, noch in namhafter Anzahl lebte. Eine Gesellschaft von Offizieren fing hier binnen einer halben Stunde ungefähr vierzig im Sonnenscheine sich reckende Brückeneidechsen von acht bis sechzig Zentimeter Länge. Im Jahre 1869 endlich gelangte wiederum eines dieser Kriechtiere lebend nach England, und zwar durch Vermittlung Hektors, der es in der Provinz Wellington in Neuseeland erbeutet hatte. Über dieses Stück erfahren wir, daß es Mehlwürmer und andere Kerbtiere begierig fraß, und durch Dieffenbach wissen wir, daß die gefangene Brückeneidechse im allerhöchsten Grade träge, aber auch sehr gutartig ist und ohne zu beißen oder überhaupt Widerstand zu leisten, sich behandeln läßt.
Anderweitige Mitteilungen über die Lebensweise sind mir nicht bekannt. Seitdem sind wir über die Brückenechse recht gut informiert worden. Sie lebt heute nur noch unter Naturschutz auf einigen Inseln der Plenty-Bucht und ist in der Tat als ein Überbleibsel der alten Saurier aufzufassen, Sie nimmt in der Kriechtierwelt etwa dieselbe Stelle ein wie die Beuteltiere in derjenigen der Säugetiere. Sie ist somit, obwohl sie Merkmale fast aller Reptilienordnungen in sich vereinigt, kein direkter Vorfahr der heutigen Kriechtiere, sondern ein noch zur engeren Gruppe und Nachkommenschaft dieser Vorfahren gehöriges Tier, das sich unter den besonderen tiergeographischen Bedingungen Neuseelands aus der Trias- und Jurazeit bis in unsere Tage hinüberretten konnte. Ausgewachsen wird es etwa 3/4 Meter lang, ist sehr stumpfsinnig, wie auch die meisten Beuteltiere, im übrigen aber völlig harmlos. Herausgeber.
Ein sonderbarer Irrtum deutscher Forscher hat einigen großen Echsen, die die erste Familie der Unterordnung bilden, zu dem Namen Warn-Eidechsen verholfen. Die bekanntesten Arten der Familie bewohnen Ägypten und werden dort Waran genannt; dieses Wort hat man in Warner umgewandelt und dieselbe Bedeutung auch durch den wissenschaftlichen Namen Monitor festgehalten: Waran und Warner aber haben durchaus keine Beziehung zueinander; denn Waran bedeutet einfach Eidechse.
Die Warane oder Wassereidechsen ( Varanidae) unterscheiden sich von den übrigen Eidechsen, denen sie hinsichtlich ihres langgestreckten Körpers, des breiten, ungekielten Rückens und der vollständig ausgebildeten, vorn und hinten fünfzehigen, mit kräftigen Nägeln bewehrten Füße ähneln, durch die Beschuppung, die Bildung der Zunge und die Anlage und Gestaltung der Zähne. Ihr Kopf ist verhältnismäßig länger als der anderer Eidechsen und dem der Schlangen nicht ganz unähnlich; aber auch ihr Hals und der übrige Leib, einschließlich des Schwanzes, übertrifft an Schlankheit die bezüglichen Leibesteile der Verwandten. Die Zunge liegt im zurückgezogenen Zustande gänzlich in einer Hautscheide verborgen, kann aber sehr weit hervorgestreckt werden und zeigt dann zwei lange, hornige Spitzen. Die Zähne, die der Innenseite der Kieferrinnen anliegen, stehen ziemlich weit voneinander und sind von kegelförmiger Gestalt, vorn spitzig, hinten stumpfkegelig.
Die Warane, von denen man ungefähr dreißig Arten kennt, bewohnen die östliche Hälfte der Erde, namentlich Afrika, Südasien und Ozeanien. Einige Arten sind vollendete Landtiere, die eine passende Höhlung zum Versteck erwählen und in der Nähe derselben, diese bei Tage, jene mehr in der Dämmerung oder selbst in der Nacht, ihrer Jagd obliegen; andere hingegen müssen zu den Wassertieren gezählt werden, da sie sich bloß in der Nähe der Gewässer, in Sümpfen oder an Flußufern aufhalten und bei Gefahr stets so eilig als möglich dem Wasser zuflüchten. Die einen wie die anderen sind höchst bewegliche Tiere. Sie laufen mit stark schlängelnder Bewegung, auf festem Boden so rasch dahin, daß sie kleine Säugetiere oder selbst Vögel einzuholen imstande sind, klettern trotz ihrer Größe vortrefflich und schwimmen und tauchen, obgleich sie keine Schwimmhäute besitzen, ebenso gewandt als ausdauernd. Zu längerem Verweilen im Wasser befähigen sie zwei größere Hohlräume im Inneren ihrer Oberschnauze, die mit den Nasenlöchern in Verbindung stehen, mit Luft gefüllt und durch die beweglichen Ränder der Nasenlöcher abgeschlossen werden können. In ihrem Wesen und Gebaren, ihren Sitten und Gewohnheiten erinnern die Warane an die Eidechsen, nicht aber an die Krokodile; sie sind jedoch, ihrer Größe und Stärke entsprechend, entschieden räuberischer, mutiger und kampflustiger als die kleineren Verwandten. Vor den Menschen und wohl auch vor andern größeren Tieren weichen sie stets zurück, wenn sie dies können, diejenigen, die auf der Erde wohnen, indem sie blitzschnell ihren Löchern, die, die im Wasser leben, indem sie ebenso eilfertig dem Wohngewässer zueilen; werden sie aber gestellt, also von ihrem Zufluchtsorte abgeschnitten, so nehmen sie ohne Bedenken den Kampf auf, schnellen sich mit Hilfe ihrer Füße und des kräftigen Schwanzes hoch über den Boden empor und springen dem Angreifer kühn nach Gesicht und Händen.
Ihre Nahrung besteht in Tieren der verschiedensten Art. Der Nilwaran, ein bereits den alten Ägyptern wohlbekanntes, auf ihren Denkmälern verewigtes Tier, galt früher als einer der gefährlichsten Feinde des Krokodils, weil man annahm, daß er dessen Eier aufsuche und zerstöre und die dem Eie entschlüpften jungen Krokodile verfolge und verschlinge. Wie viel Wahres an diesen Erzählungen ist, läßt sich schwer entscheiden; wohl aber darf man glauben, daß ein Waran wirklich ohne Umstände ein junges Krokodil verschlingt oder auch ein Krokodilei hinabwürgt, falls er des einen und andern habhaft werden kann. Leschenault versichert, Zeuge gewesen zu sein, daß einige indische Warane vereinigt ein Hirschkälbchen überfielen, es längere Zeit verfolgten und schließlich im Wasser ertränkten, will auch Schafknochen in dem Magen der von ihm erlegten gefunden haben; ich meinesteils bezweifle entschieden, daß irgendeine Art der Familie größere Tiere in der Absicht, sie zu verspeisen, angreift, bin aber von Arabern und Afrikanern überhaupt wiederholt berichtet worden, daß Vögel bis zur Größe eines Kiebitzes oder Säugetiere bis zur Größe einer Ratte ihnen nicht selten zum Opfer fallen. Die auf festem Boden lebenden Warane jagen nach Mäusen, kleinen Vögeln und deren Eiern, kleineren Eidechsen, Schlangen, Fröschen, Kerbtieren und Würmern; die wasserliebenden Mitglieder der Familie werden sich wahrscheinlich hauptsächlich von Fischen ernähren, ein unvorsichtig am Ufer hinlaufendes, schwaches Säugetier oder einen ungeschickten Vogel, dessen sie sich bemächtigen können, aber gewiß auch nicht verschmähen. Wo man sie nicht verfolgt, oder wo sie sich leicht zu verbergen wissen, werden sie wegen ihrer Räubereien an jungen Hühnern und Hühnereiern allgemein gefürchtet und gehaßt, und dies sicherlich nicht ohne Grund und Ursache.
An gefangenen Waranen kann man leicht beobachten, daß sie tüchtige Räuber sind. Obwohl sie auch tote Tiere nicht verschmähen, ziehen sie doch lebende Beute jenen entschieden vor. Ihr Gebaren ändert sich vollständig, wenn man ihnen ein Dutzend lebende Eidechsen oder Frösche in den Käfig wirft. Die träge Ruhe, in der auch sie gerne sich gefallen, weicht der gespanntesten Aufmerksamkeit: die kleinen Augen leuchten, und die lange Zunge erscheint und verschwindet in ununterbrochenem Wechsel. Endlich setzen sie sich in Bewegung, um sich eines der unglücklichen Opfer zu bemächtigen. Die Eidechsen rennen, klettern, springen verzweiflungsvoll im Räume hin und her oder auf und nieder; die Frösche hüpfen angstvoll durcheinander: der sie in Todesschrecken versetzende Feind schreitet langsam und bedächtig hinter ihnen drein. Aber Augen und Zunge verraten, daß er nur des Augenblicks wartet, um zuzugreifen. Urplötzlich schnellt der gestreckte Kopf vor; mit fast unfehlbarer Sicherheit ist ein Frosch, selbst die behendeste Eidechse gepackt, durch einen quetschenden Biß betäubt und verschlungen. So ergeht es einem Opfer nach dem andern, bis alle verzehrt sind, und sollten es Dutzende von Eidechsen oder Fröschen gewesen sein. Legt man dem Warane ein oder mehrere Eier in den Käfig, so nähert er sich gemächlich, betastet züngelnd ein Ei, packt es sanft mit den Kiefern, erhebt den Kopf, zerdrückt das Ei und schlürft behaglich den Inhalt hinab, leckt auch etwa ihm am Maule herabfließendes Eiweiß oder den Dotter sorgfältig mit der geschmeidigen, die ganze Schnauze und einen Teil des Kopfes beherrschenden Zunge auf. Genau ebenso wird er auch in der Freiheit verfahren.
Mehr als sonderbar ist, daß wir über die Fortpflanzungsgeschichte der Warane noch immer nicht genügend unterrichtet sind. Soviel mir bekannt, gibt nur Theobald über eine indische Art der Familie, den Gelbwaran(Varanus flavescens), kurzen Bericht. »Die Warane«, bemerkt er, »legen ihre Eier in die Erde. Zuweilen benutzen sie das Nest weißer Ameisen. Die gegen fünf Zentimeter langen Eier sind walzenförmig, an beiden Enden abgerundet und schmutzig weiß von Farbe, haben aber immer ein unreines Ansehen.«
Für den Menschen haben die Warane eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Durch ihre Räubereien an Haustieren und Eiern werden sie lästig; anderseits nützen sie auch wieder durch ihr vortreffliches Fleisch und ihre eigenen, höchst schmackhaften Eier. In vielen Ländern ihres ausgedehnten Verbreitungsgebiets betrachtet man allerdings Fleisch und Eier mit Abscheu, in andern dagegen schätzt man diese wie jenes nach Gebühr, verfolgt die Warane deshalb auch auf das eifrigste, und zwar gewöhnlich mit Hilfe von Hunden, die sie im Walde aufsuchen und verbellen. Laut Theobald wird ein Birmane, so träge er sonst ist, es nicht für eine allzu große Mühe erachten, einen Baum, in dem sich ein Waran verborgen hat, zu fällen, um nur des von ihm hochgeschätzten Leckerbissens habhaft zu werden. Waraneier verkauft man auf den Märkten Birmas teurer als Hühnereier; sie gelten auch mit vollstem Recht als Leckerbissen, sind jedes ekelerregenden Geruches bar, haben einen wahrhaft köstlichen Wohlgeschmack und unterscheiden sich nur dadurch von Vogeleiern, daß ihr Weiß beim Kochen nicht gerinnt. Das Fleisch genießen die Indier im gebratenen Zustande, wogegen es die Europäer meist zur Herstellung von Suppen verwenden. Kelaart, der solche versuchte, bezeichnet sie als ausgezeichnet, im Geschmack einer Hasensuppe ähnlich. Anderweitige Verwendung findet die schuppige Haut, mit der hier und da, beispielsweise in Nordostafrika, allerlei Gerät überzogen wird.
An gefangenen Waranen erlebt man wenig Freude. Anfänglich betragen sich die ihrer Freiheit beraubten Tiere äußerst ungestüm, zischen und fauchen nach Schlangenart, sobald man sich ihnen nähert, oder beißen wütend um sich, sowie sie glauben, den Pfleger erreichen zu können. Nach und nach werden sie etwas umgänglicher, wirklich zahm aber selten oder nie, bleiben vielmehr stets bissig und gefährlich, da man die Kraft ihrer zahnreichen Kinnladen durchaus nicht unterschätzen darf. Man kann sie nur in größeren Räumen halten; aber auch hier werden sie wegen ihres sinnlosen Umherrennens und Kletterns sowie wegen ihrer Gefräßigkeit und Unreinlichkeit früher oder später lästig.
Man hat auch die Familie der Warane in mehrere Unterabteilungen gefällt; doch ist diesen kaum die Bedeutung von Sippen beizulegen, da sich die hervorgehobenen Unterschiede auf geringfügige Eigenheiten beschränken. Ich halte es für unnötig, hierauf einzugehen.
Der Waran oder Nilwaran ( Varanus niloticus) unterscheidet sich von andern Familienverwandten durch den etwas zusammengedrückten, auf der Oberseite einen erhabenen Kiel bildenden Schwanz, die vorn kegelförmigen, hinten stumpfkronigen Zähne und die Stellung der Nasenlöcher. Ein ausgewachsener Waran erreicht eine Länge von zwei Meter, wovon der Schwanz fast die Hälfte wegnimmt. Die Grundfärbung ist ein düsteres Gelbgrün; die Zeichnung wird bewirkt durch schwarze Flecken, denen sich zwischen Schulter und Handwurzel hufeisenförmig gestaltete gelbe Tupfen und in Reihen geordnete grünlichgelbe Punkte zugesellen; vor jeder Schulter sieht man ein schwärzliches, halbkreisförmiges Band; das erste Drittel des Schwanzes trägt schwarze, der Rest gelbliche Ringe.
Der Waran scheint in den meisten Flüssen Afrikas vorzukommen, da man ihn nicht bloß in Ägypten und Nubien, sondern auch in Guinea und Senegambien und ebenso in Südafrika gefunden hat. In der Regel bemerkt man ihn, wenn er sich in Bewegung setzt und dem Flusse zurennt; im Wasser selbst hält er sich meistens verborgen, und auf dem Lande liegt er gewöhnlich regungslos in der Sonne. Abweichend von dem Krokodile wählt er sich zum Ausruhen und Schlafen nur im Notfalle flache Sandbänke, überall hingegen, wo er es haben kann, einen wagerechten Vorsprung des steil abfallenden Ufers und besonders gern ein Felsgesims in ähnlicher Lage; mitunter trifft man ihn auch im Ufergebüsch an, selten in bedeutender Entfernung von seinem Wohngewässer. Doch begegnete ihm Heuglin auch auf weiten Ausflügen, die er zuweilen unternahm, sogar noch in der Wüste. Im Ufergebüsch bildet das Gewurzel unterwaschener Bäume beliebte Schlupfwinkel für ihn, insbesondere an solchen Strömen, die zeitweilig gänzlich vertrocknen. Einen Sommerschlaf hält er wahrscheinlich nicht; obgleich entschiedener Freund des Wassers, ist er doch von diesem viel weniger abhängig als das Krokodil.
Es ist möglich, daß die alten Ägypter unsern Waran als Vertilger ihrer Gottheit Krokodil kennengelernt und ihm deshalb auf ihren Denkmälern einen hervorragenden Platz gegeben haben; gegenwärtig aber behilft sich das Tier auch ohne junge Krokodile recht gut. Es stellt, wie angegeben, kleinen Säugetieren und Vögeln, andern Eidechsen, die in Ägypten überall und somit auch in unmittelbarer Nähe des Stromes massenhaft sich finden, Fröschen, vielleicht auch jungen Schildkröten, hauptsächlich aber wohl Fischen nach, plündert die Nester der Standvögel, besucht selbst Taubenhäuser und Hühnerställe, um hier Eier und Geflügel zu rauben, und betreibt nebenbei Kerbtierjagd.
Ich habe mehrere Warane erlegt, immer aber nur zufällig, wenn ich sie einmal beim Beschleichen von Vögeln in der Sonne liegen sah und mich ihnen gedeckt nähern konnte. Gefangene sieht man zuweilen im Besitze der Fischer, in deren Netzen sie sich verwickelt hatten; eine regelmäßige Verfolgung aber hat das Tier in Ägypten nicht zu erdulden. Anders ist es in Mittel- und Südafrika. Unter dem »Leguan«, dessen Fleisch Livingstone als schmackhaft rühmt, versteht er wahrscheinlich unsern Waran. Schweinfurth erzählte mir, daß man in Galabat allen größeren Schuppenechsen, insbesondere aber den Waranen, eifrig nachstellt, die erlegten abzieht, auf Kohlen bratet und dann als köstliches Gericht betrachtet – gewiß nicht mit Unrecht. In Sansibar werden sie, nach Kersten, oft gefangen, fest auf einen Stock gebunden und in dieser hilflosen Lage zur Stadt gebracht, schwerlich aber für die Küche, da weder die mohammedanische Bevölkerung jener Gegend, noch die Eingeborenen der Küste des Festlandes derartige Tiere genießen. Die Eier des oben erwähnten trächtigen Weibchens, das ein Begleiter von der Deckens erlegt hatte, wurden gekocht und von den Europäern als ein köstliches Gericht befunden; vergeblich aber bot Kersten von dieser Speise den eingeborenen Begleitern der Reisenden an.
Die Dauerhaftigkeit und Lebenszähigkeit, die der Waran mit den meisten Eidechsen teilt, macht ihn für die Gefangenschaft sehr geeignet und sein Wechselleben zu Lande und zu Wasser zu einem anziehenden oder doch auffallenden Bewohner eines entsprechend hergerichteten Käfigs.
Auf dem Festlande von Indien und den benachbarten großen Eilanden wird der Waran durch den Binden- oder Wasserwaran, Kabaragoya der Singalesen ( Varanus salvator) vertreten, ein Tier, das sich durch den seitlich sehr stark zusammengedrückten Schwanz, die langen Zehen, die an der Spitze der Schnauze stehenden Nasenlöcher und die kleinen Schuppen von jenen unterscheidet. Die Oberseite zeigt auf schwarzem Grunde in Reihen geordnete gelbe Flecken; ein schwarzes Band verläuft längs der Weichen und eine weiße Binde längs des Halses; die Unterseite ist weißlich. Ausgewachsene Stücke erreichen ebenfalls zwei Meter an Länge.
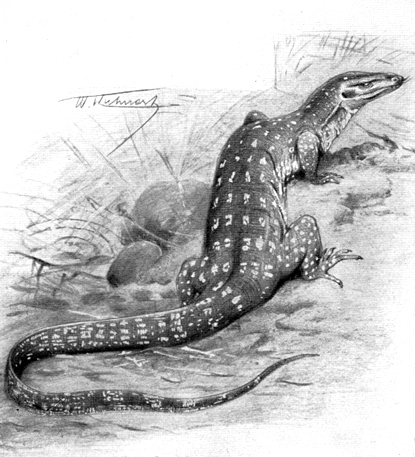
Bindenwaran ( Varanus salvator)
Schon Herodot berichtet von einem »Landkrokodil«, das im Gebiete der libyschen Wanderhirten lebt und den Eidechsen ähnlich sieht; Prosper Alpin hält dasselbe Tier für den » Scincus" der Alten, von dem man annahm, daß er sich von gewürzreichen Pflanzen nähre, insbesondere den Wermut liebe und dadurch stärkende Heilkräfte erhalte, während wir gegenwärtig mit demselben Namen eine andere Schuppenechse bezeichnen. Gedachtes Landkrokodil ist der Erd- oder Wüstenwaran ( Varanus griseus), ein Waran, der sich von den bisher genannten hauptsächlich durch seinen runden, ungekielten Schwanz, die rundlichen, nicht eiförmigen Schuppen und die kleinen, breiten Schneidezähne unterscheidet, etwas über 1,5 Meter lang wird, oben auf hellbraunem Grunde mit grünlichgelben, viereckigen Flecken gezeichnet, auf der Unterseite einfach sandgelb gefärbt ist und auf seinem Schwanze mehrere gelbliche Ringe zeigt.
Der Erdwaran wird nur in den trockensten Teilen Nordostafrikas, des steinigen Arabiens und Palästinas, insbesondere in den Wüsten gefunden und erwählt hier, wie sein südafrikanischer Verwandter, steinige Stellen, jagt jedoch zuweilen auch auf den sandigen Ebenen, zwischen den Felsenhügeln. Von den Arabern wird er mit Recht gefürchtet, weil er an Mut und Bosheit alle übrigen Eidechsen des Landes übertrifft, wenn man ihn im Freien überrascht, ohne weiteres sich zur Wehr stellt, mit Hilfe seines kräftigen Schwanzes meterhoch vom Boden aufschnellt und dem Menschen nach dem Gesichte oder gegen die Brust, den Reittieren aber nach dem Bauche springt, hier sich fest beißt, Kamele, Pferde und Esel auf das äußerste entsetzt und zum Durchgehen verleitet. Seine Nahrung besteht in dem verschiedensten Kleingetier: Wagler fand in dem Magen eines Erdwarans, den er untersuchte, außer zwei Kieselsteinen von Haselnußgröße, elf bis zwölf vollständige Heuschrecken, zwei Eier eines Laufvogels und einen fingerlangen, fast unversehrten Skorpion. Die Araber versicherten mir, daß das Tier hauptsächlich auf kleinere Eidechsen und Schlangen jage, aber auch Springmäuse und Vögel zu berücken wisse und insbesondere die Nester der letzteren arg gefährde.
Auf dem Markte zu Kairo sieht man nicht selten gefangene Erdwarane in den Händen eines Haui oder Schlangenbeschwörers, der das den Städtern unbekannte Tier den Söhnen und Töchtern der begnadeten Hauptstadt unter großem Aufwande von Redensarten und Gebärden vorführt, ihm die unglaublichsten Eigenschaften andichtet und so sein kärgliches Brot zu gewinnen sucht. Daß der kluge Betrüger dem bissigen Geschöpf vorher die Zähne ausgebrochen, ihm überhaupt durch Mißhandlung den größten Teil seiner Kraft und Bosheit genommen hat, versteht sich von selbst; denn mit einer wirklichen Pflege seiner Tiere gibt sich der Haui nicht ab. Der Waran wie die Brillen- oder die Hornschlange werden zunächst unschädlich gemacht und hierauf so lange in Gefangenschaft gehalten, als sie letztere ertragen. Ihr Käfig oder Behälter ist ein einfacher Ledersack oder eine mit Kleie angefüllte Kiste, aus der sie hervorgeholt werden kann, wenn die Gaukelei beginnen soll. Die »Arbeitstiere« erhalten weder zu fressen noch zu trinken; denn der Haui erachtet es für besser, nach Bedürfnis neue einzufangen und diese abzurichten, als seine Einnahme durch Ankauf von Fleisch und anderweitigem Futter zu schmälern. In den Augen der Beduinen gilt auch der Erdwaran, wie alle größeren Echsen überhaupt, als ein Wild, das seines leckeren Fleisches halber gejagt wird.
*
Die Eidechsen ( Lacertidae), die wir als Urbilder der Ordnung ansehen, wohlgestaltete Tiere mit vollständig ausgebildeten Gliedern, kennzeichnen sich durch den walzig gestreckten Leib, den vom Halse deutlich abgesetzten Kopf, den sehr langen, dünn auslaufenden Schwanz, die vier fünfzehigen Füße, das äußerlich sichtbare Trommelfell, die freien Augenlider und die knochigharten Augendecken, die vieleckigen Schilder, die den Kopf, die körnigen Schuppen, die Rücken und Seiten, die viereckig quergereihten Schilder, die den Bauch bekleiden, ferner durch ihre in einer Rinne der Ober- und Unterkinnlade, und zwar an deren inneren Seite angewachsenen kegelförmigen, geraden, am freien Ende etwas gebogenen, wurzellosen, zweispitzigen Zähne, die platte, vorn verschmälerte, schuppige, tief gespaltene, zweispitzige Zunge sowie endlich durch die deutlich sichtbaren Schenkelporen.
Alle Eidechsen sind in der Alten Welt zu Hause und werden schon in Europa durch viele Arten vertreten. Mit Ausnahme unserer Blindschleiche gehören sämtliche deutsche Schuppenechsen dieser Familie an; ihnen gesellen sich jedoch in Südeuropa noch viele andere zu, und ebenso ist Afrika und Asien sehr reich an ihnen. Die meisten Arten bewohnen den gemäßigten Gürtel der Alten Welt, die übrigen Südasien, Mittel- und Südafrika und Australien. Unserm Zwecke darf es genügen, wenn wir vor allen die deutschen Arten ins Auge fassen.
Die heimischen Eidechsen wählen die Abhänge sonniger Hügel, Mauern, Steinhaufen, Gewurzel von Baumstämmen, Hecken, Zäune und Gesträucher, sonnige Raine usw. zum Aufenthalt, graben sich hier eine Höhlung oder benutzen eine vorgefundene und entfernen sich selten weit von diesem Mittelpunkte ihres Gebietes. »Eine Sitte, die die Eidechsen mit sehr vielen niederen und höheren Tieren gemein haben«, sagt Leydig, »ist ihr zähes Festhalten an dem Fleck Erde, wo sie zur Welt kamen. Man wird in Gegenden, die uns durch viele Streifereien genau bekannt sind, bemerken, daß sich die Eidechsen jahraus, jahrein an gewisse Bezirke halten, ohne sich über andere Örtlichkeiten, die, soviel sich beurteilen läßt, gleich passend wären, auszubreiten. Das Wandern scheint also auch hier erst dann und als Notwendigkeit einzutreten, wenn der Platz überfüllt ist.«
Bei warmem Wetter liegen die Eidechsen im Freien, am liebsten im Sonnenschein auf der Lauer und spähen mit funkelnden Augen auf allerlei Beute, insbesondere auf fliegende Kerbtiere; an kühlen oder regnerischen Tagen halten sie sich in ihren Höhlen verborgen. Sie sind im eigentlichen Sinne des Wortes abhängig von der Sonne, lassen sich nur dann sehen, wenn diese vom Himmel lacht, und verschwinden, sobald sie sich verbirgt. Um sich zu sonnen, suchen sie stets diejenigen Stellen aus, die ihnen die meiste Wärme versprechen, steigen deshalb selbst an Baumstämmen, Pfählen und dergleichen in die Höhe, verbreitern durch Hebung der Rippen und Spannung der Haut ihren Leib und platten ihn so viel wie möglich ab, als ob sie fürchteten, daß ihnen ein einziger Strahl des belebenden Gestirnes verloren gehen könne. Je stärker die Sonne scheint, um so mehr steigert sich ihre Lebhaftigkeit, um so mehr wächst ihr Mut. In den Morgen- und Abendstunden zeigen sie sich zuweilen träge und auffallend sanft, in den Mittagsstunden nicht nur äußerst behend, sondern oft auch sehr mutig, ja förmlich rauflustig. Gegen den Herbst hin bringen sie viele Zeit im Innern ihrer Höhle zu, und mit Beginn des Oktober suchen sie bei uns zulande ihr Winterlager, in dem sie bis zum Eintritt des Frühlings, mindestens bis zu den letzten Tagen des März verweilen.
Welch unendlichen Einfluß die Wärme auf sie ausübt, bekunden alle Arten, deren Verbreitungsgebiet in nördlich-südlicher Richtung verhältnismäßig weit sich ausdehnt, ersichtlicher als alle übrigen Kriechtiere, die ihnen so verwandten Schlangen kaum ausgeschlossen. Eine und dieselbe Art zeigt sich im Süden ihres Wohnkreises oft wesentlich anders als im Norden. Die gesteigerte Wärme erhöht ihre Lebenstätigkeit und damit zugleich ihre Farbenschönheit; der länger währende Sommer, beziehentlich die einige Monate mehr andauernde Hitze, beschränkt ihren Winterschlaf, falls solcher überhaupt eintritt, auf einige Wochen; Ernährung und Stoffwechsel können demgemäß regelmäßiger und ausgiebiger stattfinden, brauchen vielleicht gar nicht unterbrochen zu werden, und die leicht verständliche Folge davon ist die stets merklich, oft erheblich gesteigerte Größe, die wir an den im Süden wohnenden Eidechsen im Vergleich zu den im Norden hausenden Artgenossen wahrnehmen.
Hinsichtlich der Färbung ist übrigens noch zu bemerken, daß alle Eidechsen imstande sind, bis zu einem gewissen Grade ihre Färbung zu verändern, beziehentlich, daß diese bei lebhafter Erregung sich erhöht, bei Erschlaffung mehr oder weniger verblaßt oder sonstwie sich abschwächt.
Fast alle Eidechsen tragen wesentlich zum Schmuck des von ihnen belebten Geländes bei. In unserm Vaterlande wird dies allerdings wenig, schon im Süden Europas aber sehr ersichtlich. Hier huscht und raschelt es überall; jedes Gemäuer, jede Straße, beinahe jeder Weg belebt sich durch sie, und wahrhaft schimmernde Pracht entzückt das Auge, wenn die schöngefärbten, glänzenden Arten in voller Lebenstätigkeit anscheinend spielend sich tummeln. Wie eine Edelsteinschnur windet sich, laut Ehrhard, der schlangenartige, in Kupfer-, Bronze- und Goldfarbe schillernde Leib der Goldeidechse durch das Gezweige und Gelaube der Feigen- und Johannisbrotbäume der sonst so öden, einförmigen Kykladen; Edelsteinschimmer blitzt auch von dem zierlichen Schuppenleibe anderer Arten dem entgegen, der sonstwo im Süden verweilt, und in Wohlwollen und Behagen wandelt sich bald das anfänglich durch das Rascheln in ängstlichen Gemütern wachgerufene Bangen um. Jedermann muß sie liebgewinnen, und ob er auch tiefere Kunde von ihrem anmutenden Tun und Treiben noch nicht erlangt habe.
Alle echten Eidechsen sind bewegliche, muntere, lebendige, feinsinnige und verhältnismäßig kluge Tiere. Wenn sie sich nicht sonnen, streifen sie gern innerhalb ihres Wohnkreises umher, machen sich überhaupt immer etwas zu schaffen. Hierbei betätigen und entfalten sie ihre Bewegungsfähigkeit nach allen Richtungen hin. Sämtliche Arten ähneln sich darin, daß sie äußerst rasch laufen, geschickt klettern und im Notfalle auch ohne ersichtliche Beschwerde schwimmen; der Grad der Beweglichkeit ist jedoch je nach der Art ungemein verschieden. Jede Bewegung wird durch Schlängeln des Leibes ausgeführt und ebenso wesentlich durch den Schwanz wie durch die Beine gefördert. Ihres Schwanzes beraubte Bekanntlich reißt der erste Schwanz einer Eidechse ab, wenn man sie an ihm ergreifen will. Er ist nur durch eine Art Gelenkscharnier mit dem Körper verbunden, wächst aber wieder zum zweiten Male nach, nunmehr aber ohne Gelenk. Wird der Schwanz nur teilweise abgetrennt, so regeneriert die Bruchstelle einen zweiten Schwanz. Daher die nicht seltenen mehrschwänzigen Tiere. Hrsgbr. Eidechsen verlieren das Gleichgewicht und damit die Lebhaftigkeit und Regelmäßigkeit jeder Bewegung; ja, fast will es scheinen, als ob der Verlust des Schwanzes sie mehr behinderte, als das Fehlen eines Beines. So gelenkig wie ihre Glieder, so vortrefflich entwickelt sind ihre Sinne, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Geruchssinnes. Ihr Gesicht ist scharf, den lebhaften Augen entsprechend, das Gehör so gut, daß schon das geringste Geräusch ihre Aufmerksamkeit erregt; feine Empfindung beweisen sie durch ihre Vorliebe für die Wärme, Schärfe ihres Tastsinnes durch das beständige Züngeln. Aber ihre Zunge scheint auch wirklich Geschmackswerkzeug zu sein, da man beobachten kann, daß sie süße Fruchtsäfte oder Honig gar wohl von anderer Nahrung unterscheiden. Im Einklange mit der Ausbildung ihrer Sinne steht ihr höheres Nervenleben. Sie sind ebenso lebhafte als unruhige, ebenso erregbare als bewegliche Geschöpfe, bekunden Neugier und Spannung, unterhalten und langweilen sich, gähnen wenigstens recht deutlich, zeigen sich ängstlich und furchtsam, dreist und mutig, je nach den Umständen, geraten leicht in Zorn, lassen sich aber auch bald wieder besänftigen; sie achten auf alles, daher auch auf Musik, der sie mit Behagen zu lauschen scheinen. An Verstand stehen sie gewiß nicht hinter irgendeinem andern Mitgliede ihrer Klasse zurück, übertreffen im Gegenteil auch in dieser Hinsicht die meisten ihrer Verwandten. Sie benehmen sich so klug, als sich ein Kriechtier überhaupt benehmen kann, unterscheiden richtig, sammeln Erfahrungen und verändern infolge davon ihr Betragen, gewöhnen sich an veränderte Verhältnisse und gewinnen Zuneigung zu Geschöpfen, die sie früher ängstlich flohen, beispielsweise zum Menschen.
Die Eidechsen sind tüchtige Räuber. Sie stellen Kerbtieren, Regenwürmern, Landschnecken eifrig nach, fallen ebenso kleine Wirbeltiere an, plündern Nester aus, verschlingen namentlich auch Eier von Kriechtieren. Fliegen verschmähen einzelne gänzlich, scheinen sich sogar vor den großen Summfliegen zu fürchten, wogegen andere solche Bedenken nicht zu erkennen geben, vielmehr große und kleine Fliegen ebenso gierig wie andere Kerfe hinunterschlucken; Spinnen verfolgen sie eifrig, um sie zu verzehren; nackte Gartenschnecken nehmen sie begehrlich, Regenwürmer minder gern an; Grillen, Heuschrecken, Nachtschmetterlinge, Käfer und deren Larven scheinen ihre Lieblingsnahrung zu bilden. Aber sie unterscheiden genau zwischen verschiedenen Arten, und ob dieselben auch so sich ähneln mögen, daß ein unkundiger Mensch sie verwechseln kann, und treffen, wenn sie es können, unter der ihnen sich bietenden Beute stets eine Auswahl, die ihren Geschmack ebenso ehrt wie ihren Verstand, geben z. B. weichschaligen Kerfen unter allen Umständen den Vorzug vor denen mit harter Schale und verschmähen einzelne Käfer wenigstens im Käfige gänzlich. Durch Leckerbissen, beispielsweise Mehlwürmer, kann man sie so verwöhnen, daß sie andere Nahrung längere Zeit nicht mehr anrühren. Gewisse Kerfe nehmen sie einige Male nacheinander, scheinbar ohne Widerstreben, lassen sie später jedoch hartnäckig liegen. Alles, was sie erbeuten, muß lebend sein; denn tote Kerfe berühren sie nicht, falls man sie nicht täuscht, d. h. vor gezähmten derartige Speise bewegt. Sie ergreifen ihren Raub plötzlich, oft mit weitem Sprunge, quetschen ihn mit den Zähnen und schlucken ihn dann langsam hinab. Größere Kerfe schütteln sie solange im Munde, bis dieselben betäubt sind, lassen auch wohl wieder los, betrachten und fassen die Beute von neuem. Das Verschlingen eines größeren Kerbtieres scheint den kleineren Arten viele Mühe zu verursachen; sie wenden den Bissen solange im Munde hin und her, bis der Kopf voran liegt, und würgen ihn hierauf langsam hinunter. Ist dies geglückt, so bezüngeln sie mit sichtbarem Wohlbehagen das Maul. Als echte Kriechtiere zeigen sie sich insofern, als sie ihre eigenen Jungen rücksichtslos verfolgen und wenn es ihnen gelingt, dieselben zu erhaschen, ohne weiteres umbringen und auffressen. An warmen Sonnentagen trinken sie viel, und zwar durch langsames, oft wiederholtes Eintauchen ihrer Zunge in die Flüssigkeit. Honig lecken sie begierig und mit sichtbarem Vergnügen auf, süße Fruchtsäfte sagen ihnen ebenfalls sehr zu; wahrscheinlich also verschmähen sie auch während ihres Freilebens Früchte nicht gänzlich.
Bald nach ihrem Wiedererwachen im Frühjahre regt sich die Paarungslust, und nunmehr vereinigen sich beide Geschlechter. Der Geschlechtstrieb scheint bei ihnen sehr heftig zu sein; denn die paarungslustigen Männchen zeigen sich ungemein streitsüchtig: das stärkere verfolgt schwächere wütend, richtet sich hoch auf den steifgehaltenen Beinen auf und rückt mit gesenktem Kopf auf den Gegner los, der seinen Angreifer eine Zeitlang betrachtet und dann, nachdem er sich von dessen Stärke überzeugt hat, sein Heil in der Flucht sucht. Der Angreifer verfolgt ihn in größter Eile und wird zuweilen so zornig, daß er sogar nach dem ihm in den Weg kommenden Weibchen beißt; erreicht er den Flüchtling, so versucht er, ihn am Schwanze zu packen; daher mögen die Verstümmelungen rühren, die man so oft bei den Eidechsen beobachten kann. Hat ein Männchen die Nebenbuhler aus dem Felde geschlagen, so nähert es sich, nach Glückseligs Beobachtungen, dem Weibchen in hochaufgerichteter Stellung mit an der Wurzel bogenförmig gekrümmtem Schwanze, umgeht dasselbe und wird zu weiterem Vorgehen ermutigt, wenn das Weibchen sich schlängelnd und zappelnd bewegt und damit seine Willfährigkeit bekundet. Es ergreift hierauf mit dem Kiefer das Weibchen oberhalb der Hinterfüße und preßt so den Leib desselben ziemlich stark zusammen, hebt und dreht ihn halb gegen sich um, stülpt durch Druck und Verdrehung des Körpers die Kloake heraus, setzt einen Fuß über den Rücken weg und drückt seine Geschlechtsteile fest gegen die des Weibchens. Beide bleiben etwa drei Minuten unbeweglich verbunden, das Männchen öffnet dann die Kiefer und läßt das Weibchen frei, das sich schnell entfernt. Die Begattung wird mehrmals im Laufe des Tages vollzogen; an ein Eheleben aber ist nicht zu denken, da sich ein Männchen mit mehreren Weibchen und ein Weibchen mit mehreren Männchen verbindet. Etwa vier Wochen nach der ersten Begattung legt das Weibchen, nach Tschudis Behauptung gewöhnlich des Nachts, seine sechs bis acht Eier, bohnengroße, länglichrunde Gebilde von schmutzig weißer Färbung, die je nach des Ortes Gelegenheit untergebracht werden, da man sie nicht bloß an sonnenreichen Orten im Sande oder zwischen Steinen, sondern auch im Moose, mitten in den Haufen der großen schwarzen Ameisen, die sie nicht berühren, und an ähnlichen Orten findet. Bedingung zu ihrem Gedeihen ist feuchte Umgebung; an der Luft trocknen sie sehr bald ein. Man beobachtete, daß sie die Fähigkeit haben, des Nachts, wenigstens zeitweilig, schwach zu leuchten. Die Jungen schlüpfen im August oder September aus, sind von Geburt an ebenso bewegungsfähig wie die Alten, häuten sich noch im ersten Herbste und suchen sich hierauf einen Schlupfwinkel, um Winterschlaf zu halten.
Die älteren Tiere häuten sich im Laufe des Sommers mehrmals zu unbestimmter Zeit, um so öfter, je stärker und größer sie sind. Vorher löst sich die alte Haut teilweise ab und wird durch Reiben an Steinen, Wurzeln, Grashalmen und dergleichen vollends entfernt. Bei schwächeren Tieren nimmt die Häutung oft acht Tage in Anspruch; bei gesunden und starken ist sie gewöhnlich schon in zwei Tagen beendet.
Unsere harmlosen Eidechsen haben nicht allein von der Kälte, sondern auch von einer namhaften Anzahl gewandter Feinde zu leiden. Alle die obengenannten Raubtiere bedrohen sie fortwährend: daher denn auch ihre Vorsicht und Scheu. Sinnbetörende Furcht scheinen ihnen die sie gefährdenden Schlangen einzuflößen: beim Anblicke derselben fliehen sie so eilig als möglich, und wenn sie es nicht können, bleiben sie unbeweglich mit geschlossenen Augen auf einer und derselben Stelle sitzen, scheinbar starr vor Entsetzen. Unbewegliche Starrheit ist meistens kein Ausdruck des Entsetzens, sondern die beste Einpassung in die vorliegende Situation; denn viele Tiere, wie z. B. auch die Eidechsen selbst, Stichlinge usw., machen nur auf sich bewegende Objekte Jagd. Herausgeber. Übrigens haben sie auch alle Ursache, vor ihren Klassenverwandten sich zu fürchten, da einzelne Schlangenarten fast ausschließlich Eidechsen erjagen und diese dem Giftzahne der Viper und Verwandten fast ebenso schnell als ein warmblütiges Tier erliegen. Sie unterscheiden die verschiedenen Schlangen sehr genau. Leydigs gefangene Eidechsen gebärdeten sich angesichts einer Jachschlange wie angegeben, ließen sich jedoch durch eine Würfelnatter nicht im geringsten behelligen.
Die Lebenszähigkeit der Echsen ist bei weitem nicht so groß als die anderer Kriechtiere. Der abgehauene Kopf stirbt in wenigen Augenblicken ab, und die lebhafte Bewegung des Leibes nach der Enthauptung sowie die einzelner abgeschnittener Glieder scheint sich nicht auf die Selbständigkeit des Nervensystems und dessen Unabhängigkeit vom Gehirne, vielmehr auf eine eigentümliche Beschaffenheit der Nerven selbst zu gründen. Die schwächsten tierischen Gifte töten bald und sicher die stärksten Eidechsen; schon die milchige Flüssigkeit der Schleimdrüsen einer Kröte genügt, sie umzubringen. Mineralischen und pflanzlichen Giften trotzen sie länger: eine Katze stirbt an einer zwanzigfach geringeren Gabe von Blausäure und in viel kürzerer Zeit als sie. Unter den pflanzlichen Giften scheint Nikotin am schnellsten verderblich zu werden: eine ihnen in das Maul gestopfte Prise Schnupftabak oder einige Tropfen Tabakssaft töten sie sehr schnell.
Gefangene Eidechsen gewähren Vergnügen und haben deshalb viele Liebhaber und Liebhaberinnen. Wenn man es recht anfängt, kann man sich leicht jede erwünschte Anzahl verschaffen, im entgegengesetzten Falle tagelang abmühen, ehe man eine einzige erlangt; denn der Fang dieser behenden Tiere ist keineswegs leicht. Am besten gelingt es, unsere hinfälligen Arten unversehrt zu erbeuten, wenn man sich mit einem feinen, langstieligen Hamen ausrüstet. Vor diesem Fangwerkzeuge fliehen sie nicht so leicht, als wenn man die Hand ihnen nähert, werden auch seltener verletzt, falls man sie von dem Hamen aus in einen leichten Sack aus dünnem Leder laufen läßt und in diesem nach Hause trägt. Der Käfig, den man ihnen anweist, muß teilweise mit Moos ausgelegt sein und Versteckplätze enthalten, vor allen Dingen aber der Sonne ausgesetzt werden können, weil deren Wärme ihnen ebenso nötig zu sein scheint als reichliche Nahrung. Solange sie lebhaft und munter bleiben, befinden sie sich wohl; wenn sie aber anfangen, halbe Tage lang unbeweglich mit geschlossenen Augenlidern auf einer und derselben Stelle zu liegen, fehlt ihnen gewiß etwas, entweder genügende Nahrung oder Wärme, und wenn man ihnen dann nicht bald entsprechende Behandlung angedeihen läßt, gehen sie meist schnell zugrunde. Wer sich viel mit ihnen abgibt, gewinnt schon nach wenigen Tagen, wenn auch nicht ihre Zuneigung, so doch ihr Vertrauen. Anfangs flüchten sie beim Erscheinen des Pflegers ängstlich nach dem verborgensten Winkel; später schauen sie von hier aus neugierig mit dem Köpfchen hervor; endlich lassen sie sich nicht mehr vertreiben, dulden, daß man sie anrührt und streichelt, und nehmen die ihnen vorgehaltene Nahrung geschickt und zierlich aus den Fingern weg. Wahrhaft ergötzlich ist es, wenn man mehreren von ihnen nur einen einzigen, längeren Wurm reicht: sie suchen sich dann gegenseitig um die Beute zu bestehlen, packen diese von mehreren Seiten zugleich und zerren sie hin und her, bis sie reißt, oder die eine der andern sie aus dem Munde zieht. Glückselig behauptet, daß sie sich sogar auf Neckereien einlassen. »Mein großes Männchen«, sagt er, »ist ungeachtet seiner Zahmheit sehr leicht zu erzürnen, wenn man mit den Fingerspitzen auf seinen Scheitel klopft; es flüchtet nicht, sondern stellt sich mutig zur Wehre, haut auf eine possierliche Art mit dem Hinterfuße auf die Hand und sucht zu beißen, geht auch wohl nach solcher Aufregung längere Zeit in seinem Käfige umher und greift seine Mitgefangenen an.« Letzteren gegenüber zeigen sich die harmlos genannten Eidechsen keineswegs immer freundlich, sondern oft sehr bissig, zänkisch, kampflustig und räuberisch.
Endlich müssen wir noch den Nutzen anerkennen, den uns die Eidechsen durch Wegfangen von allerlei schädlichem Kleingetier gewähren.
*
Nach vorstehender Schilderung der Eidechsen insgemein darf ich mich auf die Einzelbeschreibung weniger Arten beschränken. In erster Reihe mögen die Halsbandeidechsen ( Lacerta) Erwähnung finden, da zu ihnen alle deutschen Arten zählen. Die Merkmale der Sippe, die man ebenfalls in Unterabteilungen zerfällt hat, sind folgende: Der mehr oder weniger schlanke Leib ist walzig oder etwas von oben nach unten zusammengedrückt, der pyramidenförmige Kopf an den Seiten senkrecht, nach vorne mehr oder minder steil abfallend, der etwa kopflange Hals nicht sehr deutlich abgesetzt, der die Länge des Rumpfes stets übertreffende Schwanz schlankkegelig, oft sehr lang, dünn und spitzig. Die Bekleidung bildet auf dem Kopfe und Bauche Schilder, auf dem Rumpfe in Ringe geordnete, auf dem Schwanze quirlförmig zusammengestellte, am Halse durch ihre Größe hervortretende, zu einem Ringkragen vereinigte Schuppen. Die fünf sehr verschieden langen Zehen tragen sichelförmige, seitlich zusammengedrückte, unten mit einer Rinne versehene Krallen.
Unter den in Deutschland lebenden Arten steht, infolge ihrer Größe und Schönheit, die Smaragd- oder Grüneidechse, Gruenz der Tiroler ( Lacerta viridis), obenan. Sie erreicht hierorts vierzig, im Süden bis fünfundsechzig Zentimeter an Länge, wovon nur ein Drittel auf Kopf und Leib zu rechnen ist, und erscheint, des langen Schwanzes halber, sehr schlank, ist aber in Wahrheit kräftig gebaut. Die Beschilderung des Kopfes zeichnet sich dadurch aus, daß die zwei vorderen von den vier Zügelschildern gerade übereinander liegen, der Hinterhauptschild dreieckig und sehr klein ist und die Schläfengegend mit unregelmäßigen Schildern und Schuppen gedeckt wird; die des Leibes, daß die Bauchschilder in acht Längsreihen liegen und die Schilder des Halskragens gezähnelt sind. Im Zwischenkiefer stehen neun bis zehn, im Oberkiefer jederseits neunzehn bis zwanzig, im Unterkiefer dagegen dreiundzwanzig bis vierundzwanzig, am Gaumen endlich jederseits acht größere und einige kleinere Zähne. Die Färbung des Männchens, das sich vom Weibchen durch längeren und höheren Kopf, gewölbtere Schwanzwurzel, stärkere Hinterbeine und meist auch durch bedeutendere Größe unterscheidet, ist ein lebhaftes, oft schimmerndes Grün in verschiedenen Abstufungen, von Bläulich- durch Smaragd- bis zu Seladongrün, das auf der Unterseite in Grünlichgelb übergeht. Perlweiße und ebenso schwarze Punkte, erstere am Kopfe manchmal zu Perlflecken vergrößert, schmücken die Oberseite, wogegen die Unterseite, mit Ausnahme der oft blau gefärbten Kehle und Unterkiefer, stets einfarbig ist. Das Weibchen gleicht nicht selten dem Männchen bis auf die blaue Kehle, trägt aber in der Regel ein mehr oder weniger ins Braune spielendes, mit weißlichen, schwarzgesäumten Fleckenlängsreihen geziertes Kleid. Junge Tiere haben vorherrschend lederbraune Färbung. Beide Geschlechter ändern, je nach Alter und Heimat, nicht unwesentlich ab, und die aus dem Süden, insbesondere aus Dalmatien, stammenden Stücke sind immer schöner gefärbt als die im Norden lebenden.

Smaragdeidechse ( Lacerta viridis)
Als die eigentliche Heimat der Smaragdeidechse haben wir die Länder im Osten und Norden des Mittelmeeres anzusehen. Sie ist häufig in Portugal, nicht selten in Spanien, dringt in Frankreich bis Paris vor, findet sich in Italien, mit Ausnahme der Insel Sardinien, in der Süd- und Westschweiz, im südlichen Tirol, zählt auf der Balkanhalbinsel zu den gemeinsten Arten und erlangt hier auch leiblich ihre größte Entwicklung, bewohnt ebenso die Donauländer, Südrußland, die Krim, Kaukasien und Kleinasien, Syrien und Palästina und tritt endlich vereinzelt in Österreich und Deutschland auf, so im Donautale von Wien bis Passau, in Mähren, Böhmen und anderseits in der Rheinpfalz, im Elstertale bei Zeitz, bei Oderberg und auf den Rüdersdorfer Kalkbergen in der Mark Brandenburg, bei Danzig und auf der Insel Rügen; es ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, daß man ihr auch noch in andern Gegenden unseres Vaterlandes begegnen dürfte.
Zu ihren Aufenthaltsorten dienen ihr die verschiedensten Örtlichkeiten, gleichviel, ob es sich um Ebenen, Hügelgelände oder Gebirge handelt. Vom Meeresgestade an bis zu tausend Meter unbedingter Höhe und noch höher hat man sie in jeder Höhenschicht wahrgenommen. Wo sie häufig ist, begegnet man ihr überall: so, laut Gredler, in Tirol an Felsen oder steinigen, von der Sonne durchglühten Stellen längs der Straßen, Feldwege und Flußufer, in Vorbergen und Gebüschen, spärlicher in der Ebene oder in Weinbergen, so, nach Bedriaga, in Italien auf Kalkbergen, die hier und da mit niederem Gestrüppe bewachsen sind, so, laut Eber, in dem felsigen Dalmatien an allen Orten. Recht gern besteigt die Smaragdeidechse auch Sträucher, um sich zu sonnen, ebenso Bäume, um größere Sicherheit zu genießen.
Ihre Bewegungen sind wundervoll, ebenso schnell als gewandt, ebenso zierlich als anmutig. »Dem Blitze vergleichbar, kreuzt sie die Wege«, singt Dante von ihr; »beim Sprunge«, sagt Leydig, »schießt sie, mit gestrecktem Schwanze, pfeilähnlich, in geradester Richtung über ganze Flächen, und oft noch über das Ziel hinaus«. Verfolgt man sie, so sucht sie, laut Erber, auf Bäumen Zuflucht. Beunruhigt man sie auch hier noch, so entrinnt sie oft durch ungeheuere Sätze auf den Boden herab und verkriecht sich unter Steinen oder in Erdlöchern. »Welche Wichtigkeit für die eilige, geradlinige Bewegung der lange Schwanz hat«, bemerkt Leydig, »kann uns klar werden, wenn wir zufällig Tieren begegnen, die am Schwänze verstümmelt sind. Solche, obgleich sich in die Flucht stürzend, können nicht die pfeilschnellen Bewegungen gewinnen, sondern suchen durch einfachen Lauf, unter zahlreichen, raschen Schlängelungen des Leibes zu entkommen.«
Ihre gewöhnliche Nahrung besteht aus Kerbtieren, deren Larven, Schnecken und Würmern; doch bedroht auch sie Eier und Nestjunge der Vögel oder verzehrt ebenso kleinere Eidechsen ohne Bedenken, tut letzteres mindestens, wie Simons erfahren mußte, in der Gefangenschaft. Um eine so große Beute, wie eine Zaun- oder Mauereidechse, verschlingen zu können, packt sie dieselbe, laut Simons, in der Mitte des Leibes, zieht sie, kauend, mehrere Male vom Kopfe bis zum Schwanze durch das Maul, quetscht sie zusammen und verschlingt sie, ohne loszulassen, mit einer für Eidechsen überraschenden Leichtigkeit. Wie gefräßig sie ist, erfuhr Erber, der ihr, wie allen von ihm gepflegten Kriechtieren, die zur Ernährung bestimmten Kriechtiere zuzählte: eine einzige Smaragdeidechse verzehrte vom Februar bis zum November über dreitausend Stück größere Kerfe, darunter allein zweitaufendvierzig Mehlwürmer.
Südlich der Alpen zieht sich die Smaragdeidechse im November, in Deutschland fast einen Monat früher, zum Winterschlafe zurück; im Süden Griechenlands und Spaniens bleibt sie in manchen Wintern beinahe immer in Tätigkeit. Bei uns zulande schläft sie bis zum April; in Südtirol zeigt sie sich schon im März. Im Mai oder Juni beginnen die jetzt im vollsten Farbenschmucke, im Hochzeitskleide, prangenden Männchen erbitterte Kämpfe mit gleich ihnen paarungslustigen Nebenbuhlern, und nicht selten büßt dabei ein oder das andere, zuweilen auch jeder der verbissenen Kämpen, seine Hauptzierde, den Schwanz, ein. Um die genannte Zeit geschieht die Paarung; einen Monat später, in der Schweiz oder in Deutschland nicht vor dem Juli, legt das Weibchen fünf bis acht bohnengroße, fast kugelrunde Eier von schmutzig weißer Farbe an einem passenden Orte ab, ungefähr wiederum einen Monat später, also im August, schlüpfen die Jungen aus und treiben es bald ebenso wie die Alten.
Viel vertrauter als mit der Smaragdeidechse sind wir mit unserer allverbreiteten und überall gemeinen Zauneidechse ( Lacerta agilis). Ihre Länge beträgt höchstens zwanzig, meist nur zwölf bis fünfzehn Zentimeter; der Kopf ist verhältnismäßig dick und stumpfschnauzig, der Schwanz etwa halb so lang als der Leib. Von den vier Zügelschildern stehen die vorderen im Dreieck; der kleine Hinterhauptschild ist trapezförmig; die Schläfengegend wird mit regelmäßigen Schildern gedeckt; die Schuppen des Rückens und der Seiten unterscheiden sich wesentlich durch ihre Größe; die Bauchschilder bilden acht Längsreihen. Im Zwischenkiefer stehen neun, jederseits im Oberkiefer sechzehn, im Unterkiefer bis zwanzig, auf dem Gaumen, einschließlich der kleinen, zehn nach rückwärts und einwärts gerichtete Zähne. In der Färbung des Männchens herrscht oberseits ein mehr oder minder lebhaftes Grün, in der des Weibchens Grau vor; der Scheitel, ein Rückenstreifen und der Schwanz sind stets braun, Kinn und Unterseite grünlich oder gelblich. Der Rückenstreifen und beim Weibchen auch die Seiten werden durch weiße, in Längszügen angeordnete Punkte, die sich zu Augenflecken vergrößern können, gezeichnet, die Unterteile durch schwarze Punkte gesprenkelt. Vielerlei Abänderungen kommen vor, ohne jedoch das allgemeine Gepräge der Färbung und Zeichnung wesentlich zu beeinflussen.
Die Zauneidechse verbreitet sich über Mittel- und Osteuropa, in südlich-nördlicher Richtung von den Alpen an bis nach dem südlichen Schweden und vom Kaukasus an bis zum Finnischen Meerbusen, in westlich-östlicher Richtung vom mittleren Frankreich an bis zum Kaukasus, fehlt südlich der Alpen gänzlich und tritt je weiter nach Norden, je spärlicher auf. In Deutschland ist sie fast überall gemein, jedoch nicht allerorten gleich häufig. Die Abhänge sonniger Hügel, namentlich solcher, die mit krüppelhaftem Buschwerke bestanden sind, Heiden, Steinhalden, Hecken, Wald- und Straßenränder bilden von ihr bevorzugte Aufenthaltsorte; doch fehlt sie auch dürftig bestandenen Wiesen und nicht allzu feuchten Mooren nicht, siedelt sich im Gegenteil überall an, wo sie auf Beute rechnen darf. »Wenn«, sagt Leydig, »ein Markstein an einem Platze steht, wo die Zauneidechse sich findet, so wird dieser mit Vorliebe zum Wohnplatze erwählt. Das Tier sonnt sich auf demselben bei friedlicher Umgebung und scheint, indem es unter ihn sich flüchtet, eine Ahnung zu haben, daß dieser Stein in seiner Lage zu den bleibenden gehört.«
In ihrer Beweglichkeit steht sie hinter der Smaragdeidechse so weit zurück, daß Linné ihr sicherlich einen andern wissenschaftlichen Namen gegeben hoben würde, hätte er andere Arten ihrer Sippe im Freien beobachtet. Auch sie ist schnell und behend, aber doch nicht so, daß ein gewandter Fänger sich vergeblich abmühen sollte, ihrer so viele zu fangen, als er zu haben wünscht. Sie läuft nur da wirklich schnell, wo sie nicht behindert wird, schlüpft aber sehr gewandt durch dicht stehendes Gras und verschlungenes Gezweige, klettert recht leidlich, jedoch immer nur auf niederes Gebüsch, um hier sich zu sonnen, und schwimmt im Notfalle unter rasch schlängelnder Bewegung über Pfützen, Bäche und selbst kleine Flüßchen. In ihrem Wesen unterscheidet sie sich viel weniger von ihren Verwandten als hinsichtlich ihrer Bewegungen, entspricht daher im wesentlichen dem oben gezeichneten Bilde.
Bei uns zulande erscheint sie in den ersten Tagen, spätestens Mitte April, im Süden ihres Verbreitungsgebietes entsprechend früher, im Norden später, wird jedoch dort nur selten vor Ende März, hier bestimmt gegen Ende April beobachtet. Die alten Weibchen kommen, nach Leydig, um eine Woche später zum Vorschein als die Jungen. Im Mai, bei recht schönem Frühlingswetter auch wohl bereits Ende April, paaren sich die Männchen; in einer Juninacht legt das Weibchen seine fünf bis acht, stumpf eiförmigen, weißschaligen Eier auf sonnigen Orten in den Sand, zwischen Steine, laut Schinz auch wohl in die Haufen der schwarzen Ameisen, die sie nicht berühren; Ende Juli oder im Anfang August entschlüpfen die Jungen. Die Alten scheinen sich, wie Leydig glaubt, nach der Fortpflanzungszeit in Verstecke zurückzuziehen oder zu vergraben, um vielleicht in ähnlicher Weise, wie es bei Wassermolchen vorkommt, eine Art Sommerschlaf zu halten. »Es ist eine Tatsache, die jeder leicht bemerken wird, daß im Frühjahre an einem bestimmten Orte die Eidechsen sehr häufig sein können und später, etwa gegen Ende Juli hin, geradezu selten geworden sind, namentlich wenn starke Hitze sich eingestellt hat. Duges hat dies längst wahrgenommen und ebenfalls dahin ausgelegt, daß die Tiere entweder in eine Art Erstarrung, Sommerschlaf, verfallen oder in kühle, feuchte Verstecke sich zurückziehen.«
Unter dem fast zahllosen Heere von Feinden, die der Zauneidechse wie ihren kleineren Verwandten nachstellen, sind die Jachschlange und die Kreuzotter vielleicht in erster Reihe zu nennen. Erstere nährt sich ausschließlich von Eidechsen und ähnlichen Kriechtieren, letztere verfolgt, solange sie selbst noch zu klein ist, um andere minder schlanke und geschmeidige Tiere zu verschlingen, insbesondere die Jungen. Verschiedene Marder, Falken, Raben, Elstern, Häher, Würger, Haus- und Truthühner, Pfauen, Störche und Enten jagen ihr ebenfalls nach und verzehren sie anscheinend mit Behagen.
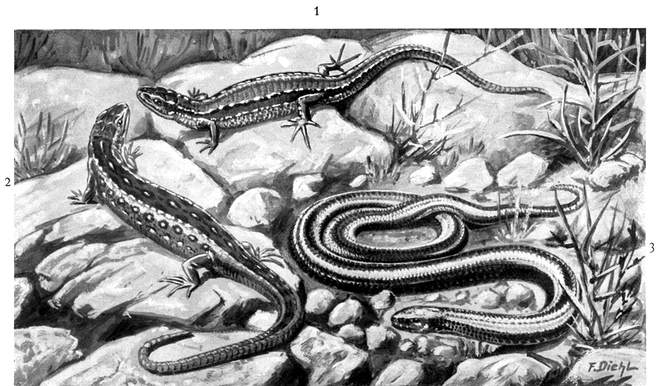
Neben der Zauneidechse tritt in vielen Gegenden unseres Vaterlandes auch die Berg- oder Waldeidechse ( Lacerta vivipara) auf. Wagler hat sie zur Vertreterin einer besonderen Sippe, der Gebäreidechsen (Zootoca), erhoben, weil ihr die Gaumenzähne fehlen und kleine unregelmäßige Schilder, in deren Mitte nicht selten ein größeres sich abhebt, ihre Schläfe decken; die neueren Tierkundigen legen auf diese Merkmale jedoch nicht so erhebliches Gewicht, daß sie die versuchte Trennung gutheißen sollten. Die Länge der Bergeidechse beträgt fünfzehn bis sechzehn Zentimeter, wovon der an der Wurzel gleichmäßig dicke Schwanz reichlich die Hälfte wegnimmt. Kopf, Leib und Zehen sind etwas zarter und feiner gebaut als bei der Zauneidechse. Im Zwischenkiefer stehen sieben, im Oberkiefer jederseits sechzehn, im Unterkiefer sechzehn bis einundzwanzig Zähne. Die Schuppen des Hinterrückens sind schwach gekielt, die des Halsbandes leicht gekerbt, die des Bauches in sechs Mittellängsreihen geordnet, zu denen jederseits noch eine Reihe von Schildern hinzugezählt werden muß, die von einzelnen Forschern nicht als Bauchschilder angesehen werden, weil sie denen der Seiten fast gleichen. Die Grundfärbung der Rückenseite ist ein mehr oder minder dunkles Braun, das deutlicher oder undeutlicher ins Schieferfarbene ziehen kann, stets aber auf der Rückenmitte und auf jeder Seite dunklere Streifen bildet. Letztere ändern vielfach ab, werden oberhalb von einer lichtgrauen Linie oder von einzelnen weißen Schuppenflecken begrenzt, nehmen dunkle Punkte oder Augenflecken in sich auf, zeigen aus diesen zusammengeflossene Längsstreifen usw. Die Unterseite ist auf bräunlich oder bläulich grauem, safrangelbem oder gelblich weißem Grunde schwarz gepunktet, die Kehle bläulich, nicht selten aber förmlich rosenrot. Das Männchen unterscheidet sich durch größere Schlankheit, flacheren Kopf, die geschwollene Schwanzwurzel und gewöhnlich auch durch lebhaftere Färbung und Zeichnung von dem Weibchen.
Das Verbreitungsgebiet der Bergeidechse umfaßt weitaus den größten Teil Europas und erstreckt sich außerdem über ganz Nordsibirien. Sie fehlt, wie es scheint, nur dem äußersten Süden unseres Erdteils, dringt aber nach Norden hin weiter als alle übrigen Arten ihrer Familie vor, findet sich, nach Nilsson, in namhafter Anzahl in Mittelskandinavien und steigt an den Fjelds bis zum Birkengürtel empor, lebt, nach Bärmann, sogar noch in der Nähe von Archangel und ist in den Alpen bis zu dreitausend Meter über dem Meere beobachtet worden. In solchen Höhen wie im Norden bringt sie drei Vierteile des Jahres winterschlafend zu und erfreut sich kaum mehr als zwei, höchstens drei Monate ihres Daseins. In unserm Vaterlande fehlt sie hier und da gänzlich, tritt aber an andern Orten häufig auf, so insbesondere in Gebirgsgegenden und Mooren. Auf der Schwäbischen Alb, dem Thüringer Walde, Harze, Glatzer Gebirge ist sie ebenso häufig wie in den Alpen, auf den Dünen Hollands, Belgiens und Nordfrankreichs nicht minder gemein als auf moorigen Stellen Brandenburgs, den Heiden Hannovers und Jütlands oder im südlichen Teile der Tundren Rußlands. Gredler bemerkt sehr richtig, daß sie mit Vorliebe in der Nähe von Wasser lebt, »so auf Gebirgen in Rünsten, an Bergbächen, auf oder an Wasserleitungen, zu Tal aber auf feuchten Wiesen, in Mooren und an Dämmen«. Dies gilt für Tirol wie für Brandenburg oder Schlesien, wo ich sie beobachtet habe.
In ihrer Lebensweise, ihren Bewegungen und ihrem Wesen unterscheidet sich die Bergeidechse nicht erheblich von der verwandten Zauneidechse. Doch ist sie minder gewandt und klettert seltener, schwimmt dagegen öfter und leichter als diese. Auf höheren Gebirgen soll sie merklich träger und langsamer sein als in der Tiefebene. Vor dem Menschen scheut sie sich wenig. Im Hochgebirge zeigt sie, laut Gredler, wenn ihr Zufluchtsort durch Abrollen der Steine plötzlich aufgedeckt wurde, in der Regel keine Neigung zu entfliehen; in den Mooren läßt sie sich ebenfalls leichter fangen als jede andere Art.
Entsprechend ihrem Vorkommen in nördlichen Ländern und auf hohen Gebirgen, erscheint die Bergeidechse im Frühjahre so zeitig, als es die Witterung irgend gestattet, in den warmen Ebenen also jedenfalls vor der Zauneidechse, im Norden ihres Verbreitungsgebietes wie auf den Gebirgen nicht vor Mai.
Hiermit vielleicht in Beziehung, nicht aber im Einklange, steht, daß die Zeit, in der sie ihre bereits im Mutterleibe gezeitigten Eier legt oder ihre Jungen zur Welt bringt, sehr verschieden ist. Mejakoff sah im wologdischen Gouvernement schon am neunundzwanzigsten Juni Junge und fand noch am ersten August trächtige Weibchen. Möglicherweise gebären ältere Weibchen früher als jüngere; möglicherweise beeinflußt die in einem Jahre herrschende Witterung das Fortpflanzungsgeschäft in erheblicher Weise. Im südlichen Deutschland gebären die Bergeidechsen durchschnittlich Ende Juli, und zwar immer des Nachts, ihre acht, höchstens zehn Jungen. Der Hergang bei der Geburt, den zuerst Mejakoff genau beobachtete, ist folgender: Das Weibchen zeigt sich vor dem Gebären sehr unruhig, kratzt den Boden auf, drückt sich von Zeit zu Zeit an harte Gegenstände, rollt den Schwanz ein, als ob es ihn auf den Rücken legen wollte, wird später, manchmal erst nach Tagen ruhig, stellt sich endlich abends breit auf die Füße, streckt sich, als ob es sich entleeren wolle, und gebiert wenige Augenblicke später, anscheinend ohne Anstrengung und Schmerzen, das erste, regelmäßig noch in der Eischale eingehüllte Junge. Ungefähr zwei Minuten später folgt das zweite Ei, und so fort. Nach jedesmaligem Legen schreitet die Alte einige Schrittchen vor, so daß die Eier, die zunächst vom Schwanze bedeckt werden, in eine Reihe zu liegen kommen. Inzwischen strengen sich die Jungen an, die Eihülle zu sprengen, und ehe eine halbe Stunde vergeht, sind sie derselben entronnen. Die Mutter scheint ihnen nicht die geringste Teilnahme zu schenken, sondern läuft auf und davon, sobald sie das letzte Ei gelegt hat. Kehrt sie später zufällig zu den Eischalen zurück, so frißt sie von denselben auch wohl, was freßbar ist. Die Jungen bringen die ersten Tage ihres Lebens in vollständiger Untätigkeit zu, liegen mit eingerolltem Schwanze schlafend in Ritzen und Spalten des Bodens, scheinen vollkommen taub zu sein, zeigen sich aber gegen die leiseste Berührung empfindlich und versuchen auf eine solche hin zu entfliehen. Sie wachsen, auch ohne Nahrung zu nehmen, auffallend rasch: solche, die bei der Geburt fünfzehn Millimeter lang waren, hatten nach zwanzig Tagen eine Länge von siebenundzwanzig Millimeter erreicht. Leydig ernährte sie mit Blattläusen, die sie begierig verzehrten.
Die Eihaut kann, nach Beobachtungen des letztgenannten Forschers, schon innerhalb der Gebärmutter gesprengt werden, und es findet dann ein wirkliches Lebendiggeborenwerden statt. »Sieht man«, schließt Leydig, »die aus der Mutter herausgekommenen acht bis zehn Jungen beisammen, so begreift man kaum, wie eine solche Anzahl wohlentwickelter Eidechsen in dem zarten, kleinen Weibchen Platz finden konnte.«
Den Ländern des Mittelmeerbeckens verdanken wir wahrscheinlich auch die ebenso zierliche als behende Mauereidechse ( Lacerta muralis). Sie erreicht eine Länge von achtzehn bis zwanzig Zentimeter und zeichnet sich vor ihren deutschen Verwandten durch die Schlankheit ihres Leibes, den langen, schmalschnauzigen Kopf und den mehr als die Hälfte der Gesamtlänge beanspruchenden, sehr spitzigen Schwanz in so merklicher Weise aus, daß sie kaum mit einer von jenen verwechselt werden kann. Über die Färbung läßt sich kaum etwas Allgemeingültiges sagen. Nach Leydig ist die Grundfarbe des Rückens braun oder grau, bei guter Beleuchtung, namentlich im Sonnenlichte, mit entschieden bronzegrünem Schiller; davon hebt sich ein dunklerer, schon am Kopfe beginnender Seitenstreifen und die fleckige oder wolkige Zeichnung ab; an der Übergangsstelle von der Seite zum Bauche tritt eine Längsreihe blauer Flecken hervor; der Bauch ist heller oder dunkler, von Milchweiß durch Gelb bis zu Kupferrot gefärbt, meist einfarbig, oft gewölkt oder gefleckt. Unter den zahllosen Abarten verdient die prachtvoll azurblaue, fast oder gänzlich fleckenlose hervorgehoben zu werden, die auf verschiedenen kleineren Inseln des Mittelmeeres, z. B. den Kykladen und Balearen, gefunden wurde.
In allen Ländern rings um das Mittelmeer ist die Mauereidechse, wenn nicht häufiger als jede andere Art ihrer Familie, so doch ungemein zahlreich und überall verbreitet. Man kennt sie aus ganz Nordafrika, Südeuropa und Nordwestasien. Auf vielen kleineren Inseln des Mittelmeeres ist sie die einzige hier vorkommende Art. Vom Süden Europas aus scheint sie allgemach nach der Mitte unsers Erdteils, und somit auch nach Deutschland, gewandert zu sein und sich festgesetzt zu haben. Doch ist sie hier noch keineswegs so allgemein verbreitet wie in Frankreich und Belgien, sondern findet sich, soviel bis jetzt festgestellt werden konnte, bloß im Gebiete des Rheins, insbesondere in Baden, im Elsaß, in der Pfalz, in Württemberg, Hessen und im Rheingau, nach Norden hin bis zur Lahn, sowie anderseits im Donautale, tritt aber auch innerhalb der Grenzen des von ihr besiedelten Gebietes nicht überall auf und läßt sich, wie fehlgeschlagene Versuche darzutun scheinen, da, wo sie fehlt, nicht ohne weiteres einbürgern. Im Gebirge steigt sie, laut Gredler und Leydig, bis zu mehr als fünfzehnhundert Meter unbedingter Höhe empor. Im Rhein- und Moseltale fand Noll die Mauereidechse niemals auf oder an den Höhen, sondern auf der Sohle des Tales, in den Löchern der nicht mit Mörtel geschichteten Weinbergs- und Ufermauern, und zwar immer nur an solchen Stellen, die der Mittagssonne ausgesetzt sind.
Anziehend schildert Gredler ihr Auftreten im südlichen Tirol. Kein Tier dürfte sich dem Auge des Nordländers, der im Sommer oder Herbste den Brenner übersteigt, eher und ausfälliger darbieten, als die Mauereidechse, die scharenweise alle sonnigen Stellen, Pfosten und Bäume, altes Gemäuer, Zäune, Schlagbäume, Hausmauern, ja selbst Kirchtürme bis zur Spitze hinauf belagert. Der Einheimische jedes Standes ist an die »unvermeidlichen flinken Tierchen, die Fliegen gleich hier kreuz und quer über Gemüse huschen, dort über Früchten, die zur Dörre ausgelegt sind, leidenschaftlich sich balgen und allenthalben ihr prüfendes Spitzschnäuzchen dareinhaben«, mit anerkennenswerter Gleichmütigkeit gewöhnt. Solche Gutmütigkeit seitens der Menschen erweckte gegenseitiges Vertrauen, so daß selbst im Freien lebende Eidechsen dargebotenes Gewürm, zappelnde Fliegen und dergleichen von der Hand nehmen: Gredler hatte eine Mauereidechse so an sich gewöhnt, daß sie, nachdem sie einige Male abgefüttert worden war, zur Mittagszeit regelmäßig auf einem Gartenpfahle sich einstellte und das Köpfchen so lange nach ihm drehte, bis sie »ihr Teil abbekommen hatte«. Ganz anders benehmen sich die klugen Geschöpfe da, wo sie Verfolgungen zu erleiden haben, so, laut Eimer, auf Capri, wogegen sie auf den nur selten von Menschen betretenen Faraglioneblöcken ganz in ähnlicher Weise furchtlos sind wie in Tirol.
In ihren Bewegungen, ihrem Tun und Treiben, Wesen und Gebaren ähnelt die Mauereidechse wohl am meisten ihrer smaragdfarbigen Verwandten. Durch ihre Schnelligkeit, Behendigkeit, Gewandtheit übertrifft sie die Zaun- wie die Waldeidechse bei weitem. Jede ihrer Bewegungen geschieht in jäher Weise, ohne jedoch der Anmut zu entbehren. Blitzschnell rennt sie in gerader Richtung über weite Strecken, und kaum noch nimmt man dann die schlängelnden Biegungen wahr, die ihr Leib auch hierbei beschreibt; ihre hervorragendste Fertigkeit entwickelt sie aber doch beim Beklettern senkrechter Wände. Hier genügt die geringste Unebenheit, um ihren langen, schlanken, weit ausgreifenden Zehen Halt zu gewähren, und so ist sie imstande, mit einem Geko zu wetteifern. Mit dieser Gewandtheit steht die Regsamkeit ihres Wesens im Einklange. Sie ist, infolge ihrer Häufigkeit und des dadurch teilweise bedingten geselligen Vorkommens, vielleicht auch mit aus Futterneid, die zanksüchtigste und streitlustigste unter unsern deutschen Arten und hat fast ununterbrochen Händel mit andern ihres Geschlechts, ändert ihr Wesen auch im Käfige nicht. Auch sie läßt sich in fast unbegreiflicher Weise betören. Eimer erfuhr, nachdem er sich auf Capri lange bemüht, die hier zwar ebenfalls ungemein häufigen, aber auch überaus menschenscheuen und vorsichtigen Mauereidechsen zu fangen, daß die dortigen Knaben ein fast unfehlbares Mittel anwenden, um sich der flinken und gewandten Tiere in beliebiger Menge zu bemächtigen. Die Knaben nehmen einen langen Grashalm und bilden aus dem dünnen Ende desselben eine Schlinge, spucken auf diese und stellen so ein dünnes Häutchen von Speichel her, das sich im Rahmen jener ausspannt. Sobald sie eine Eidechse sehen, legen oder hocken sie sich auf den Boden, nähern sich in dieser Stellung langsam dem Tierchen und halten ihm mit lang ausgestrecktem Arme plötzlich die Schlinge vor den Kopf. Die Eidechse bleibt wie gebannt stehen und sieht verwundert den seltsamen Gegenstand, vergißt vor Neugier ihre Furcht und läßt sich durch langsames Wegziehen des Halmes sogar von der Stelle locken, bis ihr plötzlich die Schlinge über den Kopf gezogen wird. Eimer war anfangs der Meinung, daß entweder das bunte Schillern des Speichelhäutchens oder der Umstand, daß es in letzterem sich spiegele, das Tier anziehe, erfuhr jedoch später, daß auch eine Schlinge ohne Speichelhäutchen zur Betörung ausreicht. Glänzende Erfolge krönten seine Jagden, als er sich auf seinen ferneren Ausflügen, nach gewonnener Entdeckung dieser Tatsache, der Hilfe fachkundiger Knaben bediente.
Im Süden ihres Verbreitungsgebietes hält die Mauereidechse keinen Winterschlaf; im südlichen Tirol zieht sie sich erst im Dezember zurück und erscheint bereits Mitte Februar, an besonders sonnigen Orten ausnahmsweise dann und wann selbst mitten im Winter wieder; im Südwesten unseres Vaterlandes treibt sie sich wenigstens bis gegen Mitte November noch im Freien umher und zeigt sich an den ersten sonnigen Tagen des Frühlings wiederum außerhalb ihres Versteckplatzes. Allerhand fliegendes und kriechendes Kleingetier, Kerfe, Spinnen, Würmer und wahrscheinlich ebenso junge, schwächliche Glieder ihrer Art oder Sippe bilden auch ihre Nahrung.
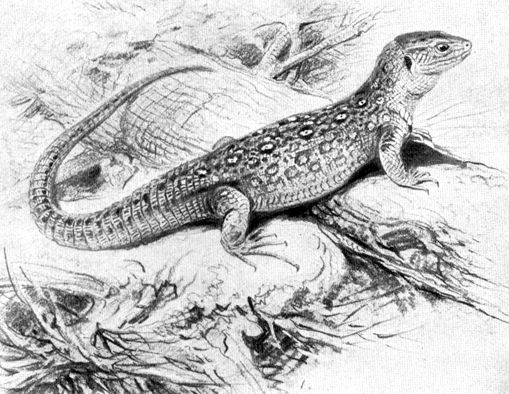
Perleidechse ( Lacerta ocellata)
Im Südwesten Europas tritt zu den bisher genannten eine der stattlichsten und prachtvollsten Arten der Familie: die Perleidechse ( Lacerta ocellata). Sie erreicht eine Länge von sechzig bis neunzig Zentimeter und zählt zu den schönsten Mitgliedern der ganzen Ordnung. Der Oberkopf ist mit breiten Schildern gedeckt, unter denen der Hinterhauptsschild und die beiden Seitenschilder besonders hervortreten, seine Färbung bräunlich, die der Kopfseiten grün, der Rücken auf dunklem Grunde so dicht mit grünen, verschlungenen Linien bezeichnet, daß die lichte Färbung manchmal zur vorherrschenden wird, jede Seite außerdem mit ungefähr fünfundzwanzig blauen, schwarz eingefaßten Flecken gezeichnet, der Unterleib gleichmäßig hellgelblichgrün, alle übrigen Teile mehr oder minder lebhaft grün oder grüngrau. Jüngere Tiere unterscheiden sich von den älteren durch die minder lebhafte Färbung und die zahlreicheren Flecken.
Die Perleidechse bewohnt die Iberische Halbinsel und Nordwestafrika, verbreitet sich außerdem aber auch über Südfrankreich, und zwar ebenso weit, als der Ölbaum reicht. In Süd- und Mittelspanien tritt sie fast überall häufig auf. Ich habe sie oft beobachtet. Gewöhnlich sieht man sie in der Nähe eines hohen Baumes sich umhertreiben, nicht selten in einiger Höhe über dem Boden und selbst kletternd im Gezweige. Bei Ankunft eines Menschen flüchtet sie rasch der von ihr bewohnten Höhlung zu, verschwindet in derselben, dreht sich um und erscheint nun mit dem Kopfe vor dem Ausgange, um zu sehen, was weiter vorgeht. Solange sie flüchten kann, entflieht sie immer, nicht jedoch vor Hunden oder Katzen, stellt sich diesen vielmehr mutig zur Wehr, springt ihnen entgegen und beißt sich an der Schnauze oder am Vorderhalse der Vierfüßler fest, sie hierdurch regelmäßig vertreibend. Wird sie zufällig von der Höhle abgeschnitten, so erklettert sie einen der nächsten Bäume, eilt auf schiefen Ästen empor und erwartet spähend und lauschend, ob sie verfolgt wird. Geschieht das letztere, so springt sie, oft in mächtigen Sätzen, von oben zum Boden herab und eilt nunmehr einer Höhlung zu. Wenn sie sich unter einem Steine verborgen hat und man diesen aufhebt, pflegt sie sich fest auf den Boden zu drücken und läßt sich dann leicht ergreifen. Faßt man sie ungeschickt, so beißt sie um sich, manchmal recht heftig, bedient sich auch ihrer scharfen Krallen zur Verteidigung.
Ihre Nahrung ist mehr oder weniger die unserer deutschen Arten; entsprechend ihrer Stärke aber jagt sie auch mit Vorliebe auf größere Tiere, insbesondere auf Mäuse, junge Schlangen, andere Eidechsen und kleine Frösche. »Bemerkt sie eine Beute«, sagt Schinz, »so lauert sie mit fest auf den Gegenstand gerichteten, glühenden Augen und springt mit größter Schnelligkeit nach demselben, ergreift ihn mit den Zähnen, schüttelt den Kopf einige Male heftig ab und läßt nun das gefangene und gequetschte Tier langsam hinuntergleiten. Dann leckt sie sich mit großem Wohlbehagen das Maul mit der Zunge, wie eine Katze, wenn sie Milch gefressen hat.« Duges beobachtete, daß sie auch Vögel oder Kriechtiere, selbst die der eigenen Art, frißt.
Schinz berichtet, daß man mehrere lebende Perleidechsen im Pflanzengarten zu Bern aussetzte, in der Absicht, sie hier einzubürgern. Zu ihrer Wohnung hatte man ihnen einen passenden Hügel angewiesen. Während der heißen Sommertage zeigten sie sich ebenso lebhaft wie in ihrer eigentlichen Heimat, an kühlen Tagen aber träge und frostig und mit Beginn der kälteren Herbstwitterung gar nicht mehr. Den Winter überlebten sie nicht.
Dank ihrer Wehrhastigkeit wird die Perleidechse von weniger Feinden bedroht als ihre kleineren Verwandten. Ihre gefährlichsten Gegner bleiben die Raubvögel, namentlich Schlangenadler und Bussarde, zu denen sich noch der Kolkrabe gesellt. Die Spanier halten sie für giftig, fürchten sich in wahrhaft lächerlicher Weise vor ihr und töten sie infolge dieser Furcht öfter, als zu wünschen wäre.
*
Seitenfaltler ( Zonuridae) nennt man diejenigen Schuppenechsen, an deren Leibesseite regelmäßig eine mit kleinen Schuppen bekleidete Falte verläuft, die hinter den Vordergliedern beginnt und Rücken- und Bauchseite voneinander sondert. Die Leibesgestalt ist entweder die der Eidechsen oder eine mehr verlängerte, infolge des sehr langen Schwanzes und des Verkümmerns der Gliedmaßen schlangenähnliche. Augenlider sind stets vorhanden; das Paukenfell liegt vertieft und wird nur ausnahmsweise von einer Haut überzogen. Den Rücken bekleiden große, schilderartige, meist gekielte, wirtelförmig in Querreihen gestellte Schuppen, den Kopf regelmäßige Schilder. In dieser Familie gibt es noch einzelne Glieder, die von der urbildlichen Gestalt der Echsen wenig abweichen, aber auch andere, die täuschende Ähnlichkeit mit Schlangen haben. Eine hierhergehörige, auch in Südeuropa vorkommende Art wollen wir hier vorführen.
In schattigen Tälern der Steppen Naryn und Kuman an der Wolga entdeckte Pallas einen Seitenfaltler, der von den Russen wie alles schlangenähnliche Getier insgemein Scheltopusik genannt wurde; später fand er ihn an den Flüssen Terek und Sarpa auf. Andere Forscher beobachteten ihn im südlichen Sibirien, in Ungarn, Istrien, Dalmatien, Griechenland, Kleinasien, Syrien, Palästina und sogar in Afrika. Erber traf ihn am häufigsten in der Nähe des Lago di Bocagnazza bei Zara in Dalmatien, jedoch auch sonst im ganzen Lande. Dick bebuschte Täler bilden den liebsten Aufenthalt des Scheltopusik, und in ihnen findet er so vortreffliche Versteckplätze, daß er trotz seiner Größe nicht eben leicht bemerkt wird, zumal er, seiner Wehrlosigkeit sich bewußt, bei Annäherung des Menschen regelmäßig entflieht. Alle Beobachter, die ihn sahen, stimmen in seinem Lobe überein. Er ist eines der nützlichsten Kriechtiere, weil er sich hauptsächlich von schädlichen Tieren nährt. Mäuse und Schnecken, welche letzteren er, laut Erber, samt den Schalen verzehrt, bilden seine Hauptnahrung; er stellt aber auch den Vipern nach, tötet und verspeist sie, ohne sich vor dem anderen Echsen verderblichen Giftzahne zu fürchten. Als Erber einmal einen Scheltopusik in den Käfig zu einer Kreuzotter setzte, nahm sowohl dieser als jene sofort eine drohende Stellung an, während sonst beide andern Schlangen gegenüber teilnahmslos und gleichgültig sich gezeigt hatten. Da unser Beobachter nur einen Scheltopusik besaß, wollte er denselben nicht aufs Spiel setzen und entfernte ihn wieder; später aber scheint er anderweitige Versuche angestellt zu haben, da er es ist, der uns gedachten Seitenfaltler als einen der wirksamsten Vipernvertilger kennen lehrte. So tüchtig der letztere als Raubtier auch sein mag: dem Menschen gegenüber benimmt er sich mit einer Harmlosigkeit und Gutmütigkeit, die ihm jederzeit die Zuneigung des Liebhabers erwerben. Er beißt nie, läßt sich also ohne jegliche Besorgnis behandeln, scheint bei längerer Gefangenschaft eine gewisse Zuneigung zu seinem Pfleger zu gewinnen und würde, wie Erber meint, zu einem empfehlenswerten Haustiere gewonnen werden können. Von andern Schuppenechsen unterscheidet er sich sehr zu seinem Vorteile durch seine Regsamkeit. Er ist beständig in Bewegung, schlängelt sich in anmutigen Windungen ohne Unterlaß durch seinen Käfig, züngelt und untersucht jede Ritze, jeden Spalt zwischen dem Gestein und Moos auf das genaueste. Läßt man ihn im Zimmer frei, so beginnt er sofort seine Jagd aus Geziefer aller Art, zunächst auf die in so vielen Wohnungen vorhandenen, häßlichen Küchenschaben, die er in allen ihren Schlupfwinkeln aufspürt und selbst bis in den Kamin verfolgt.
Auf meine Bitte hat Erber mir folgendes über das Freileben unseres Tieres mitgeteilt: »Der Scheltopusik, seiner wenigen Scheu, Harmlosigkeit und Nützlichkeit halber mein besonderer Liebling, ist ebenso anziehend im Freien als im Käfig. Dort kann man ihn, wenn man ihn oft besucht, zuletzt so an sich gewöhnen, daß er sich widerstandslos greifen läßt. Die einzige Waffe, die er dem Menschen gegenüber in Anwendung bringt, ist sein – After. Wenn man ihn fängt, weiß er es durch die merkwürdige Drehbarkeit seines sonst harten Körpers jederzeit so einzurichten, daß er einen mit seinem abscheulich stinkenden Unrate von oben bis unten besudelt. Hiermit begnügt er sich aber auch; denn die im Verhältnis sehr bedeutende Stärke seines Gebisses bringt er merkwürdigerweise dem Menschen gegenüber nie in Anwendung. Wenn man sieht, wie er im Freien mit einer ihm sonst nicht eigenen Schnelligkeit die Hornviper abfängt und sie mit Leichtigkeit entzweibeißt, nimmt es Wunder, daß er diese Kraft nicht auch zur Verteidigung anwendet; dies aber geschieht, soweit meine Beobachtungen reichen, niemals.
Wahrhaft fesselnd für den Beobachter wird der Scheltopusik, Wenn er eine Maus, einen Maulwurf usw. fängt und tötet. Sobald er eine solche Beute gepackt hat, dreht er sich samt derselben mit unglaublicher Schnelligkeit so lange um sich selbst, daß das gefangene Tier vollkommen matt und schwindelig wird, ihm also nicht mehr entwischen kann. Nunmehr erst zerdrückt er ihm den Kopf und fängt an, es zu verzehren. Letzteres erfordert geraume Zeit, da er seine Beute immer nur stückweise zu sich nimmt und sein Gebiß doch nicht so scharf ist, als daß es Haut und Sehnen durchschneiden könnte. Eidechsen haben an ihm einen höchst gefährlichen Nachbar; denn er beißt jenen die Schwänze ab und verzehrt dieselben, während ihm das übrige nicht zu munden scheint.
Die Liebe des Scheltopusik ist eine außerordentlich feurige. Während der Begattung vergißt er alles um sich her, läßt sich dann sogar durch den Fang nicht stören. Von einem Verstecke aus beobachtete ich, daß das Männchen während derselben nach allem schnappte, was ihm in die Nähe kam. Beide Gatten sind infolge der starken und zackigen Doppelrute des Männchens so innig vereinigt, daß man sie ohne letzteres zu beschädigen, vor vollzogener Begattung nicht zu trennen vermag. Die Eier werden unter dichtem Gebüsch und Laubschichten, dem beliebtesten Aufenthalte des Tieres selbst, abgelegt. Die Jungen sind von den Alten ganz verschieden, scheinen auch mehrere Jahre durchleben zu müssen, bevor sie ihren Erzeugern ähnlich werden. Inwiefern ich nach dem Wachstum meiner Gefangenen zu einem Urteil berechtigt bin, weiß ich nicht; trotzdem glaube ich nicht zu irren, wenn ich das Alter eines ausgewachsenen Scheltopusik auf vierzig bis sechzig Jahre annehme.«
Ich habe neuerdings viele Scheltopusiks gepflegt und kann Erbers treffliche Beobachtungen fast in jeder Beziehung bestätigen. Nur die Bewegungen der Tiere sind mir nicht so anmutig erschienen, als ich nach Erbers Bericht erwartete; denn dem Scheltopusik fehlt die Geschmeidigkeit der Schlangen ebenso wie die Behendigkeit der Eidechsen, und seine Bewegungen erscheinen daher, wie auch Leydig hervorhebt, ziemlich ungefüge, die Windungen kurz und hart. Hinzufügen will ich noch, daß man Scheltopusiks in beliebiger Anzahl und in allen Altersstufen zusammensperren darf, ohne Unfrieden oder vollends Umbringen und Auffressen der schwächeren durch stärkere befürchten zu müssen.
Der Scheltopusik ( Pseudopus apus) vertritt die Sippe der Panzerschleichen (Pseudopus) und kennzeichnet sich durch folgende Merkmale: Der Leib ist schlangenähnlich, lang, walzenförmig, seitlich etwas zusammengedrückt, fast von gleicher Dicke wie der Hals, der Kopf deutlich abgesetzt, viereckig, etwa ebensolang als hoch, an der Schnauze verlängert und zugespitzt, der Schwanz um ein Drittel länger als der Körper, dünn und einfach zugespitzt. Von den Vorderfüßen bemerkt man keine Spur, von den Hinteren nur eine Andeutung, in Gestalt unförmlicher Stummel. Die Augen haben einen runden Stern und vollständige Lider; die Ohren, die zwei Längsrinnen bilden, sind deutlich sichtbar. Viele fest den Knochen anliegende Schilder decken den Scheitel, knochenartige, mehr oder minder rhombenförmige, hintereinander liegende Schuppen den Rumpf; die der oberen Seite sind gekielt, die der unteren Seite am hinteren Rande ausgeschweift und, mit Ausnahme derer des Schwanzes, glatt; die Längsfurche ist deutlich sichtbar, beginnt etwas hinter den Ohröffnungen und endet seitlich der Afterspalte. Das Gebiß besteht aus stumpfen, dicken, runden Zähnen, von denen im oberen Kiefer achtundzwanzig, im unteren sechsundzwanzig stehen. Ein schmutziges Rotbraun oder dunkles Strohgelb, das auf dem Kopf etwas lichter wird und auf dem Unterleibe in Bräunlichfleischrot übergeht, ist die gewöhnliche Färbung. Alte Stücke nach der Häutung sehen auf der Oberseite dunkelkupferrot, am Kopfe grünrötlich aus. Junge sind auf grauem Grunde braun gefleckt und gebändert. Die Leibeslänge beträgt reichlich ein Meter; die Stummel der Hinterfüße messen ungefähr zwei Zentimeter.
*
Die in Nordamerika lebende Glasschleiche ( Ophiosaurus ventralis), das letzte Mitglied der Familie, das ich hier anführen will, und Vertreter der gleichnamigen Sippe ( Ophiosaurus), ähnelt den Schlangen noch mehr als die übrigen Verwandten, da bei ihr keine Spur der Hinterfüße zu sehen ist und diese nur im Gerippe der Schulter- und Beckengürtel bemerkt werden; doch kennzeichnen die beweglichen Augenlider und das noch sichtbare Trommelfell sowie die Seitenfalte auch diese Art äußerlich als Schuppenechse. Das Gebiß besteht aus fünfzehn oberen, sechzehn unteren, walzenförmig zurückgebogenen, einfach kegelig zugespitzten Zähnen; außerdem sind eine Menge von Gaumenzähnen vorhanden. Die Färbung ändert vielfach ab. Einzelne Stücke sind lebhaft grün und schwarz gefleckt, andere schwarz und weiß gestreift, andere auf braunem Grunde mit Augenflecken geziert. Die Länge beträgt ungefähr ein Meter.
Über die Lebensweise haben ältere Forscher, unter ihnen Catesby, einiges mitgeteilt. Zum Aufenthaltsorte bevorzugt das Tier sehr trockene Örtlichkeiten, jedoch solche, die ihm geeignete Versteckplätze darbieten. Das Gewurzel eines alten Stockes, Baumstrunkes, Höhlungen in Hügelgehängen und dergleichen dienen ihm als Zufluchtsort, nach denen es bei jeder Störung eiligst zurückkehrt. In Waldungen, die reich an Unterwuchs sind, kommt die Glasschleiche übrigens ebenfalls häufig vor, unzweifelhaft deshalb, weil solche Örtlichkeiten ihr die meiste Nahrung gewähren. Sie erscheint sehr zeitig im Frühjahre, viel früher als die eigentlichen Schlangen, und treibt sich bereits munter umher, während jene noch ihren Winterschlaf halten. Ihre Nahrung besteht aus Kerfen und kleinen Kriechtieren, insbesondere jungen Schuppenechsen und dergleichen.
Der Fang des schön gezeichneten und im Käfige angenehmen Geschöpfes ist aus dem Grunde besonders schwierig, weil die Glasschleiche ihren Namen mit vollstem Rechte trägt, nämlich bei Berührung auffallend leicht zerbricht. Say behauptet, daß sie den Schwanz, ohne berührt worden zu sein, von sich schleudern könne, da eine einzelne Zusammenziehung genüge, ihn abzubrechen; andere Berichterstatter stimmen darin überein, daß der leichteste Rutenhieb den Leib zerteilt, ja, daß man kaum imstande ist, ein vollständiges Stück zu erbeuten. In der Tat sind unbeschädigte Glasschleichen außerordentlich selten in den Sammlungen. Diese Hinfälligkeit mag wohl auch der Grund sein, daß das hübsche Tier selten oder nicht in Gefangenschaft gehalten wird; wenigstens sind mir hierüber keine Mitteilungen bekannt.
Die Wühlechsen oder Wühlschleichen ( Scincoidae), eine sehr reiche Familie, sind ebenso verschiedenartig gestaltet als die Seitenfaltler und zeigen, wie man sich auszudrücken pflegt, die allmählichen Übergänge von der Echsen- zur Schlangengestalt durch Verkümmerung der Gliedmaßen und Verlängerung des Leibes. Die Beine sind, wenn überhaupt vorhanden, stets kurz, bei einigen auf zwei herabgesunken, bei vielen verkümmert; die Zähne haften mit ihren Wurzeln dem inneren Rande der Zahnrinne an; die Zunge ist kurz, zweispitzig oder eingeschnitten, ganz oder teilweise schuppig; das meist sichtbare Ohr wird zuweilen durch die Haut überdeckt; das Auge besitzt Lider, deren unteres und größeres in der Mitte durchbrochen, beziehentlich an dieser Stelle mit durchsichtiger Haut, gleichsam einem Fenster, versehen sein kann. Regelmäßige Schilder bekleiden den Kopf, gleichartige in der Fünfform stehende Schindelschuppen Rücken, Bauch und Seiten. Eine Seitenfurche fehlt; auch Schenkel- und Leistenporen sind nicht vorhanden. Der Verbreitungskreis der Wühlechsen ist sehr ausgedehnt. Sie leben in allen Erdteilen und von den äußersten Grenzen der gemäßigten Gürtel an bis zum Gleicher hinab, besonders zahlreich in Neuholland, in namhafter Anzahl aber auch in Asien, Afrika und Amerika, während sie in Europa schwach vertreten sind.
Im allgemeinen dürfen wir wohl annehmen, daß alle Wühlschleichen mehr oder weniger an den Boden gebannt sind und nur ausnahmsweise und auch dann bloß in beschränktem Grade klettern. Dafür besitzen sie eine Fertigkeit, die den meisten übrigen Echsen abgeht; denn sie sind imstande, wenn auch nicht mit der Kraft, so doch mit der Gewandtheit des Maulwurfes, sich unter der Oberfläche der Erde zu bewegen. Fast alle bekannteren Arten nehmen ihren Aufenthalt auf trockenen Stellen und scheuen oder meiden das Wasser. Am liebsten hausen sie da, wo feiner Sand auf weithin den Boden deckt, außerdem zwischen Geröll, dem Gestein zerbröckelter Felskegel, an oder in weitfugigem Gemäuer und ähnlichen Orten; aber nur die wenigsten suchen in den hier sich findenden Ritzen und Spalten Zuflucht und Nahrung, sondern graben sich in den Sand ein und bewegen sich dicht unter der Oberfläche mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit. Ihr mit glatten Schuppen bekleideter, mehr oder minder spindelartiger Leib, die kurzen, stummelhaften Beinchen und die durchsichtigen Fenster in den unteren Augenlidern befähigen sie zu solcher Wühlerei und werden, um mich so auszudrücken, erst dann verständlich, wenn man ihr Tun und Treiben beobachtet hat.
Der schlangenähnliche Leib, das Fehlen der Vorder- und Hintergliedmaßen, das versteckte Ohr und die Bekleidung, die aus kleinen, sechsseitigen, in Längsreihen geordneten, glatten, glänzenden Schuppen besteht, die auf dem Kopf in größere Schilder sich wandeln, an den Seiten aber verkleinern, sind die äußerlichen, das echsenähnliche Geripp, schlanke und spitzige Zähne, von denen neun im Zwischenkiefer, achtzehn im Ober- und achtundzwanzig im Unterkiefer stehen, eine platte, etwas breite, vorn seicht eingeschnittene Zunge, und zwei wohlentwickelte Lungen die innerlichen Kennzeichen der Bruchschleichen ( Anguis), die durch die allbekannte Blindschleiche ( Anguis fragilis) vertreten werden. Die Färbung der Oberseite ist gewöhnlich ein schönes Bleigrau, das an den Seiten in Rötlichbraun, auf dem Bauche in Bläulichschwarz übergeht und hier durch gelbweiße Punkte geziert wird; es gibt jedoch kaum zwei Blindschleichen, die sich vollständig in der Färbung ähneln. Lenz versichert, daß er einmal in Zeit einer halben Stunde dreiunddreißig dieser Tiere in einem Umkreise von ungefähr sechshundert Schritt gefangen, unter ihnen aber nicht zwei gefunden habe, die vollkommen gleich gefärbt und gezeichnet gewesen wären. Sehr alte zeigen auf der Oberseite oft größere oder kleinere, in Längsreihen geordnete, schöne, blaue Flecken und Punkte; junge sehen oben gelblichweiß, auf dem Bauch schwarz aus und sind auf dem Rücken durch einen tiefschwarzen Streifen gezeichnet; die Geschlechter unterscheiden sich ebenfalls, und die einen wie die andern sind fähig, ihre Farbe zu verändern. So erhielt Leydig junge, auf deren weißen, schwarz gestreiften Rücken im Laufe der ersten Nacht zwei zarte Längsstreifen erschienen, beobachtete andere, deren kastanienbraune Rückenfärbung in Gelbbraun überging und durch zwei schwach bräunliche Längsstreifen gesäumt wurde, und sah, wie noch andere ihre besonders schöne Färbung verloren und wieder erhielten. Die Iris des Auges ist gelbrot. Erwachsene erreichen eine Länge von ungefähr 40 Zentimeter, wovon auf den Schwanz etwas mehr als die Hälfte kommt.
Die Blindschleiche bewohnt fast ganz Europa von Südschweden an bis Griechenland und Spanien, ebenso, wenn auch selten, Algerien, ferner Kaukasien und Georgien und vielleicht noch viele andere Teile Asiens, lebt überall, in der Tiefe wie in der Höhe, selbst noch auf höheren Bergen, auf feuchtem Grunde lieber als auf trockenem, und kommt auf den verschiedensten Örtlichkeiten vor, am meisten da, wo dichtes Buschwerk und hohes Gras den Boden bedecken oder wenigstens lockeres Gestein aufliegt. Je nach des Ortes Gelegenheit wählt sie sich ihre Behausung an verschiedenen Stellen. In dem lockeren Boden gräbt sie sich eine Höhle von mehr oder weniger Tiefe; an Stellen, die mit Moos oder Gras bedeckt sind, verbirgt sie sich zwischen den Pflanzen, im Gebüsch unter dem Gewurzel, auf steinigen Gehängen unter großen flachliegenden Steinen, die sie überhaupt sehr gern zu haben scheint. Da sie die Ameisen nicht scheut, haust sie oft mit diesen zusammen unter Steinen, ja selbst in Ameisenhaufen, trotz der unruhigen Kerbtiere, die sonst doch über jedes Tier herfallen.
Mitte oder Ende Oktober verkriecht sich die Blindschleiche in vorgefundene oder selbst gegrabene Löcher unter der Erde, um in ihnen Winterschlaf zu halten. Alle Winterherbergen, die Leydig untersuchen konnte, waren hinsichtlich ihrer Lage sorgfältig gewählt, derart, daß sie nicht bloß genau nach Süden sich richteten, sondern vor Nord- und Ostwinden Schutz hatten. Die Höhlungen graben sich die Tiere selbst aus, und zwar durch bohrende Bewegungen mit ihrem Kopfe. Mitunter findet man sie in ganz engen Löchern sieben bis dreißig Zentimeter tief unter der Erde, mitunter in einem gegen einen Meter langen, gekrümmten Stollen, der von innen mit Gras und Erde verstopft wurde, hier dann gewöhnlich auch zwanzig bis dreißig Stück beieinander, alle in tiefer Erstarrung, teils halb zusammengerollt, teils ineinander verschlungen, teils gerade gestreckt. Zunächst am Ausgang liegen die Jungen, auf sie folgen immer größere Stücke, und zu hinterst haben ein altes Männchen und Weibchen ihr Winterbett aufgeschlagen. Einmal fand Leydig auch eine Jachschlange, die Todfeindin aller schwächeren Echsen, in der Winterherberge der Blindschleichen. Alle liegen bei kaltem Wetter regungslos, als ob sie schlaftrunken wären, ermuntern sich aber, wenn man sie allmählich in die Wärme bringt. Zwanzig Stück, mit denen Lenz Versuche anstellte, waren bei anderthalb bis zwei Grad Wärme ziemlich steif, rührten sich aber doch noch, wenn sie angegriffen wurden; einzelne krochen auch, nachdem sie wieder in ihre Kiste gelegt worden waren, langsam umher. Alle hatten die Augenlider fest geschlossen, und nur zwei öffneten sie ein wenig, während sie in die Hand genommen wurden, die andern schlossen sie sofort wieder, wenn man sie ihnen gewaltsam öffnete. Als sich die Wärme bis auf drei Grad unter Null vermindert hatte, lagen alle starr in der sie schützenden Kleie; keine einzige aber erfror, während mehrere echte Schlangen, die denselben Aufenthalt zu teilen hatten, der Kälte erlagen. Bei noch härterem Frost gehen jedoch auch die Blindschleichen unrettbar zugrunde. Im Frühling erscheinen sie bei gutem Wetter bereits um Mitte März.
Die Nahrung der Blindschleiche besteht fast ausschließlich in Nacktschnecken und Regenwürmern; nebenbei nimmt sie auch glatte Raupen zu sich, ist aber außerstande, irgendein schnelleres Tier zu erbeuten. An Gefangenen beobachtete Lenz, daß sie dem ihr vorgeworfenen Wurm sehr langsam sich nähert, ihn meist erst mit der Zunge befühlt, sodann langsam den Rachen aufsperrt und das Opfer endlich packt. Der Wurm windet sich nach Leibeskräften; sie wartet, bis er sich ziemlich abgemattet hat und verschluckt ihn dann nach und nach, den Kopf bald rechts, bald links biegend und so mit den Zähnen vorwärts greifend. An einem einzigen Regenwurm, den sie verschluckt, arbeitet sie fünf bis sechs Minuten, hat auch an einem oder zwei mittelgroßen für eine Mahlzeit genug. Wasser trinkt sie ebensooft und in gleicher Weise wie die Eidechsen.
Es mag sein, daß sie bei Tage ein ihr vor das Maul kommendes Beutestück ergreift und hinabwürgt; in der Regel aber geht sie erst nach Sonnenuntergang auf Jagd aus. Übertags liegt sie, wie andere Kriechtiere, stundenlang im Sonnenschein, gewöhnlich mit auf den Boden gesenktem Kopfe, behaglich der ihr wohltuenden Wärme sich hingebend. Doch zeigt sie sich in heißen, trockenen Tagen selten oder nicht, wogegen sie sofort erscheint, wenn Regenwetter im Anzuge ist. »Wenn sie«, sagt Leydig, »schon in aller Frühe herumkriecht, deutet es entschieden auf eine Veränderung der Atmosphäre zum Regen.« Auch Gredler bezeichnet sie als einen ziemlich zuverlässigen Wetteranzeiger und bemerkt, wahrscheinlich mit vollstem Recht, daß ihr Erscheinen unmittelbar vor oder während eines Witterungswechsels mit dem gleichzeitigen Höhengang der Regenwürmer, ihrer Lieblingsnahrung, im Zusammenhange stehen möge.
Die Bewegungen der Blindschleiche sind langsam und weder denen der Eidechsen, noch denen der Schlangen ähnlich. Da nämlich, wie Leydig bemerkt, die Haut durch wirkliche Kalktafeln gepanzert ist, so geschehen ihre Bewegungen nicht in kurzen Wellenlinien, wie solches bei den Schlangen in hohem Maße eintreten kann, sondern, unter gewöhnlichen Umständen, auf dem Boden, in weiteren Biegungen. Bergab läuft sie mit einiger Schnelligkeit, auf ebenem Boden so gemäßigt, daß man mit ruhigem Schritt bequem nebenher gehen kann, bergauf noch viel langsamer. Legt man sie auf eine Glasscheibe, so wird es ihr sehr schwer, von der Stelle zu kommen; doch hilft sie sich nach und nach durch ihre seitlichen Krümmungen fort. In das Wasser geht sie freiwillig nicht; wirft man sie hinein, so schwimmt sie, indem sie sich seitlich krümmt, recht flink, gewöhnlich so, daß das Köpfchen über die Oberfläche erhoben wird, zuweilen jedoch auch auf dem Rücken; immer aber sucht sie bald das Trockene wieder zu gewinnen. Unter ihren Sinnen steht unzweifelhaft der des Gesichts obenan, trotz des schwer begreiflichen Volksnamens, der dem Tiere geworden ist. Sie hat zwei hübsche Augen mit goldgelber Regenbogenhaut und dunklem Stern, mit denen sie gut sieht. Ob die Blindschleiche aber auch in hellem Sonnenlichte sieht, ist eine andere Frage. Die gelbrote Färbung ihres Augenringes spricht weder dafür noch dagegen. Versuche an gefangenen Blindschleichen lassen glauben, daß das Gehör hinter dem Gesicht wenig oder nicht zurücksteht; ein bestimmtes Urteil hierüber zu fällen, ist aber schwer. Über die Entwicklung der übrigen Sinne, mit Ausnahme des Tastsinnes, läßt sich solches noch schwieriger erlangen; man kann wohl annehmen, daß die Zunge seine Empfindung besitzt, wird aber schwerlich so leicht über den Geruch- und Geschmacksinn ins klare kommen. Ihr Gebaren weicht in vielen Stücken von dem der Eidechsen ab. Sie zeigt sich nicht scheu und noch viel weniger listig und entgeht den meisten Feinden gewöhnlich bloß dadurch, daß sie, ergriffen, sich heftig, ja unbändig bewegt und dabei meist ein Stück ihres Schwanzes abbricht. das übrigens nicht wieder nachwächst. Es regeneriert nur ein kurzer, stummelartiger Wundverschluß. Herausgeber. »Während nun das abgebrochene Stück«, sagt Lenz, »noch voll Leben herumtanzt und von dem Feinde ergriffen wird, findet sie Gelegenheit, sich aus dem Staube zu machen. Dies kann man leicht beobachten, wenn man verschiedene Tiere mit Blindschleichen füttert.« Gewöhnlich läßt sie sich fangen, ohne sich irgendwie zu verteidigen; ausnahmsweise macht sie jedoch von ihrem Gebisse Gebrauch, selbstverständlich ohne dadurch irgendeinen ihrer Gegner abschrecken zu können. Im Verlaufe der Zeit fügt sie sich in die veränderten Umstände, so in die Gefangenschaft und in ihren Pfleger. »Ist sie«, nach Lenz, »einmal an den Menschen gewöhnt, so läßt sie sich recht gern in die Hand nehmen, schmiegt sich darin, vorzüglich zwischen die Finger mit dem Kopfe und dem Schwanzende und scheint somit ein Versteck zu suchen.« Mit Fröschen und Eidechsen verträgt sie sich sehr gut.
Gleich andern Kriechtieren besitzt sie eine auffallende Zählebigkeit. Tabakssaft, der Schlangen leicht umbringt, tötet sie nicht. Lenz gab zwei Blindschleichen an drei aufeinander folgenden Tagen Tabakssaft ein; sie wurden zwar anfangs betäubt, erholten sich aber dann wieder.
»Sie gebären läbendige junge, welches die erfahrung offtermals bewiesen und an den tag gegeben«, bemerkt schon der alte Geßner hinsichtlich der Fortpflanzung der Blindschleiche. Doch scheint es, als ob sie nicht vor dem vierten Jahre zur Vermehrung ihres Geschlechtes heranreift, da Lenz zur Entwicklung gelangte Eier nur bei erwachsenen oder fast erwachsenen fand. Die Begattung geschieht im Mai, und zwar, laut Meyer, nach Art sich paarender Eidechsen. Das Männchen packt das Weibchen mit den Zähnen so derb am Hinterkopfe, daß hierdurch eine Verletzung der Schuppen stattfindet, nähert sich hierauf mit dem Hinterteil dem After des Weibchens und verbleibt, nachdem es sich geschlechtlich vereinigt, mehrere Stunden neben dem Weibchen liegen, ohne sich mit ihr zu verschlingen. Die Geburt der Jungen fällt in die zweite Hälfte des August oder in die erste Hälfte des September; die Eier werden in Zwischenräumen von mehreren Minuten gelegt, und die Jungen winden sich sogleich aus der häutigen, dünnen, durchsichtigen Eischale los. Ihre Färbung ist weißlich, auf Kopf und Bauch ins Bläuliche spielend; längs der Rückenmitte verläuft eine bläuliche Linie.
Lenz sagt, daß er mehr als hundert Junge von seinem gefangenen Weibchen bekommen habe, dieselben jedoch in Zeit von einer bis sechs Wochen sämtlich verhungert seien. Andere Liebhaber, namentlich Erber, waren glücklicher, denn es gelang ihnen, die kleinen Tierchen aufzuziehen. Doch ist dies in der Tat nicht leicht, da die jungen Blindschleichen nur die allerzartesten Kerfe bewältigen können, und man nicht immer imstande ist, diese zu beschaffen. Alt eingefangene gehen gewöhnlich ohne Widerstreben ans Futter, lassen sich daher bei geeigneter Behandlung ohne besondere Schwierigkeit jahrelang erhalten. In einem teilweise mit Erde ausgefüllten, teilweise mit Steinen und Moos verzierten Käfige finden sie alle Erfordernisse, die sie an einen derartigen Raum stellen, nehmen sich hier auch niedlich aus. Mit Recht kann man sie jedermann empfehlen.
Noch heutigentags gilt die Blindschleiche in den Augen der ungebildeten Menschen als ein höchst giftiges Tier und wird deshalb rücksichtslos verfolgt und unbarmherzig totgeschlagen, wo immer sie sich sehen läßt, während man sie im Gegenteil schonen, insbesondere in Gärten hegen und Pflegen sollte. Daß sie nicht giftig ist, wußten schon die Alten.
*
Im Süden und Osten der Alten Welt tritt zu den bisher genannten Gruppen die zahlreiche Familie der Agamen ( Agamidae). Die Gestalt der hierher gehörigen Echsen ist in hohem Grade verschiedenartig. In Südasien erlangt die Familie ihre größte Entwicklung. Die übrigen Arten verteilen sich auf Australien, das verhältnismäßig reich an diesen Echsen ist, und verbreiten sich durch die Wüsten Mittel- und Westasiens sowie durch ganz Afrika bis Griechenland und Südrußland. Fast alle Arten sind mehr oder minder vollkommene Landtiere; nicht wenige von ihnen bewohnen sogar die dürrsten und trockensten Örtlichkeiten innerhalb ihres Gebietes, wogegen andere wiederum nur in feuchten Geländen, hier jedoch so gut als ausschließlich auf Bäumen Hausen. Gerade von den Agamen darf man behaupten, daß sie die Wüsten Afrikas und Mittelasiens ebenso beleben, als sie die in höchster Fülle prangenden Waldungen Südastens schmücken. Sie sind es, von denen schon die ältesten Reisenden mit mehr oder weniger Anerkennung und Bewunderung sprechen; sie rufen noch heute das Entzücken dessen wach, der sie in ihrer vollen Lebenstätigkeit, in der Pracht ihrer wunderbaren, jähem Wechsel unterworfenen Farben sehen kann. Alle Arten müssen als harmlose Tiere betrachtet werden.
»Man sagte mir«, so erzählt Herodot, »bei der Stadt Butus in Arabien sei ein Ort, wo es fliegende Schlangen gäbe. Ich reiste deshalb hin und sah daselbst eine unglaubliche Menge Knochen und Gräten in zahllosen größeren und kleineren Haufen. Der Ort liegt in einem von Bergen umgebenen Tale, das sich in die weite Ebene Ägyptens öffnet. Es wurde gesagt, diese geflügelten Schlangen flögen im Frühling aus Arabien nach Ägypten, begegneten aber beim Ausgang des Tales dem Ibis, von dem sie umgebracht würden; deshalb eben stünden diese Vögel bei den Ägyptern in so hoher Ehre. Die Gestalt dieser Schlangen ist die der Wasserschlangen; ihre Flügel aber haben keine Federn, sondern sind wie die der Fledermäuse gebildet. Arabien bringt Weihrauch, Myrrhen, Cassia und Zimmet hervor. Diese Weihrauchbäume werden von den geflügelten Schlangen gehütet (von denselben, die herdenweise nach Ägypten kommen); doch kann man sie durch den Rauch von Storax vertreiben.«
Von welchen Tieren der Vater der Geschichte erzählt, läßt sich nicht mehr bestimmen; möglich aber ist es immerhin, daß man schon damals von den kleinen, wenn auch nicht geflügelten, so doch mit einem Fallschirm versehenen Baumechsen Ostindiens einige Kenntnis hatte. Mit den fabelhaften Drachen oder Lindwürmern, die man bald als geflügelte Riesenschlangen, bald als befittichte Krokodile darstellte, haben diese harmlosen, kleinen Tierchen nichts weiter gemein als den Namen, den sie eben jenen eingebildeten Gestalten verdanken.
Die ersten fünf oder sechs falschen Rippen jederseits sind bei ihnen, den Drachen ( Draco), zu Trägern eines halbkreisförmigen Fallschirmes umgestaltet, der an die demselben Zweck dienende Flatterhaut der fliegenden Eichhörnchen und Flugbeuteltiere erinnert, aber nicht, wie bei diesen, mit den Beinen in Verbindung steht. Der Kopf ist dick und hoch, die Schnauze kurz und stumpf, der Hals ziemlich lang, der Leib eigentlich klapperdürr, der Schwanz lang, dünn und nach dem Ende zu gleichmäßig verschmächtigt. Sehr kleine Schuppen decken den Kopf und vergrößern sich am Lippenrande zu mäßigen Schildern; kleine, feine Schuppen bekleiden auch den übrigen Leib. Drei bis vier Vorderzähne, zwei wohlentwickelte Fang- und zahlreiche dreispitzige Backenzähne in jedem Kiefer bilden das Gebiß. Das auffallendste Merkmal der Drachen ist unzweifelhaft der durch die falschen Rippen gestützte Fallschirm, weil eine derartige Bildung bei keinem andern Tier weiter vorkommt. Die Schlangen sind bekanntlich die einzigen Geschöpfe, die ihre Rippen als Bewegungswerkzeuge verwenden; aber während bei ihnen alle Rippen einem Zweck dienen, für den anderweitige Werkzeuge fehlen, kommt bei den Drachen nur einem Teil der Rippen die Aufgabe zu, wohlentwickelte Glieder noch anderweitig zu unterstützen. Es erscheint, wie Martens hervorhebt, besonders auffallend, daß gerade in der Heimat der Drachen auch die meisten fliegenden oder richtiger luftspringenden Säugetiere sich finden, und daß hier sogar ein fliegender Frosch entdeckt worden ist, während es im heißen Afrika nur sogenannte fliegende Eichhörnchen und in den gleich gelegenen Ländereien Südamerikas überhaupt keine sogenannten vierfüßigen fliegenden Tiere gibt.

Flugdrache ( Draco volans)
Unter den Arten der Sippe, die man bis jetzt unterschieden hat, gilt der Flugdrache ( Draco volans) als die bekannteste. Das reizende Geschöpf erreicht nicht mehr als zwanzig Zentimeter Gesamtlänge, wovon zwölf Zentimeter auf den langen, schlanken Schwanz zu rechnen sind. Die Nasenlöcher liegen auf der Seite und sind nach aufwärts gerichtet; das Trommelfell ist unbekleidet. Beim Männchen läßt sich ein Nackenkamm unterscheiden; beide Geschlechter zeigen einen kurzen und kleinen Höcker am hintern Teil des Augenbogens. Unter sich fast gleiche, leicht gekielte Schuppen decken den Leib, größere, verschoben viereckige, gekielte, die Seiten. Die Färbung ändert, wie bei allen Drachen, vielfach ab, und nicht allein je nach der Örtlichkeit, sondern auch je nach dem einzelnen Stück. Ihre Schönheit spottet übrigens, wie Cantor ausdrücklich bemerkt, jeder Beschreibung. Der Kopf des lebenden Tieres ist metallisch braun oder grün gefärbt und mit einem schwarzen Flecken zwischen den Augen geziert, der Rücken und die innere Hälfte des Fallschirms ein Gemisch aus metallisch schillerndem Dunkelbraun und Rosenfarben, bei einzelnen Stücken in abwechselnden Querbändern, die zahlreiche schwarze Flecke und kurze, unregelmäßig gewobene Linien zeigen. Die Färbung der äußeren Hälfte des Fallschirms schwankt zwischen Orangegelb und Rosenrot und zeigt unregelmäßige, schwarze Querflecke; der Rand ist silbern gesäumt. Über die Glieder und den Schwanz verlaufen bei einzelnen abwechselnd rosenfarbene und braune Querbänder, über die Augenlider strahlenförmig kurze, schwarze Linien. Die Kehlwamme hat lebhafte gelbe Färbung; die Brust ist auf gleichem Grunde schwarz getüpfelt. Die Seitenwammen spielen ins Gelbe oder Rosigsilberfarbene, zeigen aber schwarze Flecken.
Der fliegende Drache bewohnt außer den Sundainseln auch Pinang und Singapore. Seine Lebensweise ist die der übrigen Glieder seiner Gruppe. Sämtliche Drachen sind Baumechsen in des Wortes vollster Bedeutung; sie kommen ungezwungen wohl niemals zum Boden herab. Obwohl weit verbreitet, sind sie doch im allgemeinen selten und schwer zu sehen, auch wenn sie in den Gärten der Europäer Wohnung genommen haben sollten. Denn stets hallen sie sich hoch in den Kronen der Bäume auf und liegen hier, namentlich mittags bei heißem Sonnenschein, ruhig auf einer und derselben Stelle. Ihre Farbenpracht fällt dabei nicht im geringsten auf. Man bemerkt die im Schatten der Blätter liegenden oder an die Stämme angeschmiegten Tiere nur, wenn man sehr nahe an sie herankommt, und sieht auch dann nichts weiter als ein der Baumrinde sehr ähnelndes Gemisch von Braun und Grau. Unter diesen Umständen gewahrt man selbst bei genauer Beobachtung kein anderes Zeichen des Lebens als die Rastlosigkeit der Augen, die nach vorüberfliegenden Kerbtieren spähen. Naht sich ein solches dem Drachen, so breitet er plötzlich seine Haut aus, springt mit ihrer Hilfe weit in die Luft hinaus, ergreift mit fast unfehlbarer Sicherheit die Beute und läßt sich auf einem andern Zweig nieder. Auch bei dieser Gelegenheit fällt die Farbenpracht nicht in die Augen: es bedarf der nahesten Besichtigung, um sie wahrzunehmen. Nach Angabe älterer Beobachter sollen sich die Drachen mit Hilfe ihres Fallschirms über Entfernungen von sechs bis zehn Meter schwingen, aber wie alle ähnlich ausgestatteten Tiere immer nur in schiefer Richtung von oben nach unten bewegen, also nicht oder nur mäßig sich erheben können. Ihre Bewegung unterscheidet sich von der anderer Baumeidechsen wesentlich dadurch, daß sie nicht ein fortgesetztes Rennen, sondern eine Reihe von mehr oder minder weiten Sprüngen ist. Die Weibchen legen drei bis vier walzige, an beiden Enden abgerundete, etwa zentimeterlange Eier von gelblich weißer Färbung. Nach älteren Angaben sollen sie dieselben Baumlöchern anvertrauen. In Gefangenschaft sollen Drachen sehr hinfällig sein.
*
Unter den noch zu besprechenden Gliedern der Familie stellen wir die Agamen im engsten Sinne ( Agama) obenan. Sie kennzeichnen sich durch kurzen, dreieckigen, hinten aufgetriebenen, nach vorn stark abschüssigen, an der Schnauzenspitze gerundeten Kopf, kräftigen, etwas abgeplatteten Leib, lange und schlanke Beine und mehr oder minder langen, rundlichen Schwanz. Die Nasenlöcher sind einander genähert, die Ohröffnungen, in denen das versenkte Trommelfell noch sichtbar ist, deutlich. Die Kehle zeigt selten eine entwickelte, der Hals dagegen gewöhnlich eine oder zwei sehr ausgebildete Querfalten. Mehr oder minder gleichmäßig angeordnete, deutlich geteilte und geschindelte Schuppen decken die Oberseite des Leibes, zahlreiche, meist ziemlich große, gerade oder aufgetriebene Schilder den Kopf, Schindelschuppen den Schwanz. Die Sippe verbreitet sich von Südosteuropa durch ganz Afrika, Südwestasien bis Indien, und die zu ihr gehörigen Arten treten da, wo sie vorkommen, gewöhnlich überaus zahlreich auf.
»Eine der auffallendsten und anziehendsten Erscheinungen für den Reisenden, der nach mehrmonatlicher ermüdender Seefahrt die Goldküste betritt«, so schreibt mir Reichenow, »ist eine dort ungemein häufige Echse. Wie die Webersiedlungen in den hohen Kronen der Kokospalme und die dumpfen Rufe der Tauben in den dorfumgürtenden Hecken Auge und Ohr des jene Gebiete des geheimnisvollen Erdteiles betretenden Vogelkundigen entzücken und berauschen, ebenso fesselt die feuerköpfige oder Siedleragame die Blicke des Ankömmlings. Aber auch bei längerem Aufenthalt lenken diese prächtigen Geschöpfe immer und immer wieder die Aufmerksamkeit sich zu: ich wenigstens habe mich niemals an ihnen satt sehen können.
Das alte Männchen der Siedleragame ( Agama colonorum) zeigt so schimmernde Farben, wie sie die verblichenen, in Weingeist aufbewahrten Stücke unserer Museen freilich nicht im entferntesten ahnen lassen. Der ganze Kopf des lebenden Tieres ist feuerrot, die Kehle gelb gesprenkelt; Körper und Beine glänzen dunkel stahlblau; über den Rücken verläuft ein heller, weißer Strich, der jedoch auch fehlen kann. Die Unterseite des Schwanzes, vom After bis zur Mitte, ist strohgelb, die entsprechende Oberseite an der Schwanzwurzel hell stahlblau, der Schwanz in fernerem Verlaufe feuerrot, seine Spitzenhälfte dunkel stahlblau. Bei alten Stücken ist der Schwanz an der Wurzelhälfte oben und unten hell stahlblau; hierauf folgt eine feuerrote Binde, die fast die ganze übrige Hälfte des Schwanzes einnimmt und nur einen kurzen, dunkel stahlblau gefärbten Teil an der Spitze übrig läßt. Das Weibchen trägt ein einfaches braunes Schuppenkleid mit heller Rückenlinie. Die Länge erwachsener Männchen beträgt zweiunddreißig Zentimeter, wovon auf den Schwanz zwanzig Zentimeter kommen.
Wie weit sich das Verbreitungsgebiet der Siedleragame an der Westküste Afrikas nordwärts erstreckt, weiß ich nicht. Nach Süden hin wird sie aber nach meinen Beobachtungen immer seltener. Es scheint also die Goldküste einer der Brennpunkte des Verbreitungsgebietes dieser reizenden Tiere zu sein. Hier bewohnen die Siedleragamen alle Ortschaften. Wie der Hausspatz sind diese Kriechtiere an die Behausung, an das Tun und Treiben der Menschen gebunden. Im Walde trifft man, abgesehen von der erwähnten Spielart, sie nur hin und wieder auf Lichtungen, in Bananen- und Pisang- oder Jamsfeldern, meist auch bloß, wenn einzelne Hütten der Wächter oder Arbeiter daselbst sich befinden, so daß sie selbst hier dem menschlichen Treiben nicht völlig entfremdet sind. Negerhütte, Sperling und Agame sind auf der Goldküste drei aufs engste verbundene Begriffe. In den Ortschaften treten die Agamen ungemein zahlreich auf. Überall sieht man sie hier an den Lehmwänden der Hütten, aus dem Stroh- und Mattendache, auf und an den weißen Mauern, die die Gebäude der Europäer umgeben, bald ruhig liegend und behaglich den senkrechten Strahlen der glühenden Tagessonne sich aussetzend, bald behende hin- und herrennend, um Kerbtiere zu erhaschen. Eigentümlich sind die Bewegungen dieser Tiere, sooft sie irgend etwas Auffallendes bemerken, sooft auch ein Mensch sich ihnen naht. Denn obwohl an den menschlichen Verkehr gewöhnt und diesen aufsuchend, zeigen sie sich doch ebenso scheu wie andere ihrer Verwandten und stets bedacht, vermeintlicher Gefahr zu entrinnen. In Unruhe versetzt, bewegen sie den Kopf heftig auf und nieder, indem sie gleichzeitig den ganzen Vorderkörper auf den Vorderbeinen erheben und senken, so daß es aussieht, als ob sie grüßend mit dem roten Kopfe nickten. Je näher man kommt, um so schneller werden diese nickenden Bewegungen, bis das Tier plötzlich mit der Schnelle des Blitzes in einer Mauerspalte oder zwischen dem Dachstroh verschwindet. Wenn ich zur Mittagszeit durch die Straßen von Akkra ging und allenthalben diese farbenprächtigen Tiere unter so seltsamen Bewegungen mir zunicken sah, konnte ich niemals widerstehen, mit dem Schmetterlingsnetze auf sie zu jagen. Doch wurde meine Jagd, dank der Geschwindigkeit der Agamen, nur selten von Erfolg gekrönt. Leichter erlangte ich dieselben durch einen Dunstschuß aus einer kleinen Vogelflinte. Ein einziges Dunstkörnchen, das ihnen durch den Leib ging, streckte sie stets leblos nieder. Dasselbe erfuhr ich, so auffallend es mir bei der bekannten Zählebigkeit der Kriechtiere erschien, bei Erlegung von Schlangen.«
Nicht minder zahlreich als an der Goldküste tritt die Siedleragame im Nordosten Afrikas auf. Ich fand sie zahlreich in Ägypten und Nubien, Schweinfurth noch im tiefsten Inneren des Erdteiles. »Am zahlreichsten«, so schildert er, »waren die gemütlichen Agamen vertreten, deren beständiges Kopfnicken die glaubenseifrigen Mohammedaner ärgert, da sie glauben, der Teufel spotte ihrer Gebete. Dieselbe Art hatte ich früher auf den Felsgehängen der öden Wüstentäler an der Küste des Roten Meeres beobachtet. Hier, im Bongolande, war sie sowohl bei den Hütten wie auf den Waldbäumen zu Hause, ihr Lieblingsaufenthalt aber das alte Holzwerk der Pfahlbauzäunung, und daselbst häuften sie sich zu Tausenden. Sehr schalkhaft ist ihr Benehmen, wenn man sich dem Baumstamme nähert, an dem sie auf- und ablaufen: sie halten sich immer auf der entgegengesetzten Seite, indem sie ab und zu haltmachen und listig hinter den Ästen hervorlugen, wobei ihre großen Augen in der Tat viel Ausdruck verraten.«
»Feinde haben die Agamen«, so schließt Reichenow, »in einigen Raubvögeln, namentlich in den Singsperbern und Gleitaaren. Mehr als diese sind es die Sporenkuckucke, die ihre Reihen lichten. Junge Stücke werden auch häufig die Beute der Waldlieste, die hier und da in den Ortschaften auf Baumstümpfen oder auf den breiten Blättern des Pisang sitzend lauern und, plötzlich herabschießend, das arglose Kriechtier ergreifen.«
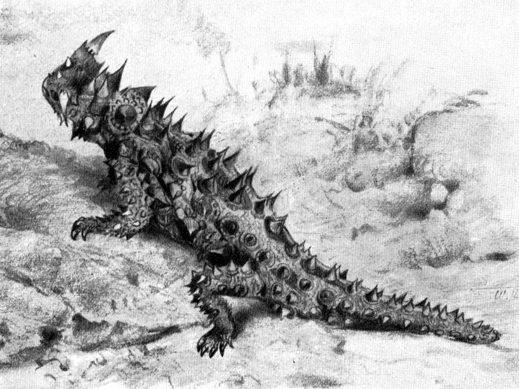
Moloch ( Moloch horridus)
Zu den Agamen zählt endlich noch eine der auffallendsten Echsen überhaupt, der Moloch ( Moloch horridus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Moloch), aus Australien. Der Kopf ist sehr klein und schmal, kaum breiter als der Hals, der Leib kräftig, in der Mitte verbreitert und flach gedrückt, also krötenartig, der ungefähr leibeslange Schwanz rundlich, am Ende abgestumpft. Die Beine sind lang und schwächlich, die fünfzehigen Füße kurz. Auf der Mitte des Halses erhebt sich ein länglicher Höcker, zu beiden Enden desselben stehen kleinere ab. Kopf, Hals und Leib sind mit unregelmäßigen Schildern bekleidet, von denen jeder einzelne einen rosendornähnlichen, jedoch ziemlich geraden Stachel trägt. Diese Stacheln sind verschieden lang und verschieden gebogen. Die größten und gekrümmtesten bewehren beide Seiten des Kopfes, gleichsam nach Art der Hörner eines Säugetieres; verschieden große finden sich auf der Halsmitte und an den beiden Seitenhöckern des Halses sowie längs des ganzen Schwanzes, die kleinsten endlich an den Beinen. Die Unterseite ist rauh, aber nicht stachelig. Zwar nicht besonders lebhafte, aber sehr ansprechende Färbung und Zeichnung schmücken das stachelige Tier in hohem Grade. Auf kastanienbraunem Grunde verläuft längs der Rippenmitte ein schmaler, mehrmal zu verschobenen Vierecken sich verbreitender Streifen von licht ocker- oder ledergelber Färbung; ein zweiter, gleich gefärbter beginnt an jeder Seite des Halses, zieht sich über die Schultern, verbreitert sich hier und zweigt einen andern, nach hinten verlaufenden und zuletzt beide Seiten des Schwanzes zierenden ab, während er selbst sich hinter der Achselgegend nach abwärts wendet. Die Grundfärbung der Unterseite ist licht ockergelb; die Zeichnung, die hier am Halse beginnt, über die ganze Brust verläuft und auch noch den Unterteil des Schwanzes einnimmt, besteht aus breiten, schwarz gesäumten Längs- und Querbändern, die unregelmäßige Figuren bilden. Die Gesamtlänge beträgt fünfzehn bis achtzehn Zentimeter.
Über die Lebensweise des Moloch, der von den Ansiedlern »Stachelechse« oder »Dornteufel« genannt wird, sind wir erst in neuester Zeit unterrichtet worden. Wilson sammelte mehrere Jahre nacheinander alle Nachrichten, die er über das absonderliche Geschöpf erhalten konnte, und hat diese nebst seinen eigenen Beobachtungen veröffentlicht. Man begegnet dem Moloch an verschiedenen Stellen bei Port Augusta; sein Verbreitungsgebiet dehnt sich jedoch unzweifelhaft weiter aus, als bis jetzt bekannt wurde. Das Tier lebt nur auf sehr sandigen Stellen. Gelegentlich sieht man vielleicht ihrer zwei oder drei zusammen auf der Spitze eines kleinen Sandhügels in der Nähe des Golfes sich sonnen. Oft vergraben sie sich auch unter dem Sande; immer aber dringen sie nur bis zu geringer Tiefe ein. Ihr kleines verstecktes Auge und ihr ganzes Wesen stempelt sie zu Tagtieren, die vielleicht nie, mindestens nur in seltenen Fällen des Nachts sich bewegen. Obgleich für gewöhnlich ungemein träge, hat man doch auch gesehen, daß sie mit großer Gewandtheit laufen können, wenn es sich darum handelt, eine nicht allzuweit entfernte Höhle zu gewinnen. Bei ruhigem Sitzen tragen sie ihren Kopf erhoben, so daß er mit dem Leibe in eine schiefe Ebene zu liegen kommt. Die Nahrung soll vorzugsweise in Ameisen bestehen; doch will man auch beobachtet haben, daß der Moloch nebenbei Pflanzenstoffe verzehre. Die Eier, die sich von denen anderer Echsen wenig unterscheiden, sollen in den Sand gelegt werden.
Auch der Moloch besitzt in einem gewissen Grade die Fähigkeit, seine Farbe zu verändern; es geschieht dies, nach den Beobachtungen Wilsons, jedoch niemals plötzlich, vielmehr immer nur sehr allmählich, obschon nicht selten. Die lebhafte Färbung geht dann in düsteres Schiefer- oder Rußfarben über, und die hübsche Zeichnung verschwindet dabei fast gänzlich.
Gefangene, die Wilsons pflegte, waren sehr langweilig, sie bewegten sich fast nie. Von allen, die unser Gewährsmann gefangen hielt, bequemte sich kein einziger, Nahrung anzunehmen. Daß sie trotzdem einen ganzen Monat lang aushielten und eine wesentliche Schwächung nicht bekundeten, darf bei der Lebenszähigkeit aller derartigen Tiere nicht befremden. Der Moloch verdient seinen Namen nicht mit Recht; denn nur sein Aussehen ist schrecklich, sein Wesen gänzlich harmlos.
*
Was die Agamen für die Alte Welt, sind die Leguane ( Iguanidae) für Amerika, nur daß sie in ungleich größerer Anzahl und Mannigfaltigkeit auftreten. Sie treten in Süd- und Mittelamerika allerorten überaus zahlreich auf, verbreiten sich auch bis in die wärmeren Teile von Nordamerika: im Westen bis Kalifornien, Britisch Kolumbien und Arkansas, im Osten fast bis zu den nördlichen Grenzen der Vereinigten Staaten, und bevölkern ebenso die Amerika zunächst gelegenen Inseln.
Entsprechend der Ausdehnung des Verbreitungsgebietes ist auch das Vorkommen dieser Echsen. Sie leben buchstäblich überall, wo Kriechtiere die erforderlichen Bedingungen für gedeihliches Dasein finden: auf dem Festlande wie auf den Inseln, in der Höhe wie in der Tiefe, auf dürren Ebenen wie in den feuchten schattigen Urwäldern, in unmittelbarer Nähe der menschlichen Behausungen, in Städten, Dörfern und andern Ortschaften, auf und in den Häusern wie in wüsten Geländen. Mehrere Arten dürfen als Wasserechsen angesehen werden, weil sie, wie die Warane der Alten Welt, bei Gefahr dem nächsten Wasser zustürzen und ebenso vorzüglich schwimmen wie tauchen. Eine Art gewinnt sogar im Meere ihre Nahrung. Auch unter ihnen gibt es wenig begabte, träge, stumpfe, dem Anscheine nach teilnahmlose Gesellen; die größere Mehrzahl jedoch steht an Lebhaftigkeit, Gewandtheit und leiblicher wie geistiger Regsamkeit hinter unsern Eidechsen nicht im geringsten zurück. Wie die Agamen den von ihnen bewohnten Waldungen, gereichen sie den ihrigen zu hohem Schmucke, und wie jene beleben auch sie die Behausungen der Menschen in anmutigster Weise. Ihre Nahrung besteht ebensowohl in Kerbtieren wie in Pflanzenstoffen. Für den Menschen haben mehrere Arten eine nicht zu unterschätzende Bedeutung erlangt, indem Fleisch und Eier mit Vorliebe gegessen werden. Als schädlich dürfte kaum eine einzige Art sich erweisen; gleichwohl haben sie vielfache Nachstellungen zu erleiden.
Unter Basilisk dachten sich die alten Griechen und Römer ein schlangenähnliches, mit übernatürlichen Kräften begabtes Scheusal der abschreckendsten Art, erzeugt auf unnatürlichem Wege, erbrütet durch zum Brüten unfähige Lurche, unheilvoll für alles Lebende, den Halbgott Mensch nicht ausgeschlossen. Haushahn, Schlange und Kröte wurden als die Erzeuger angesehen: der Hahn legte mißgestaltete Eier, und Schlangen und Kröten bemächtigten sich derselben, um sie zu zeitigen. Der Basilisk hatte einen geflügelten Leib, einen gekrönten Kopf, vier Hahnenfüße, einen Schlangenschwanz, funkelnde Augen und einen so giftigen Blick, daß derselbe noch schlimmer als das »böse Auge« der heutigen Südeuropäer und Morgenländer wirkte. Das von ihm ausgehende Gift erfüllte, so wähnte man, die Luft und tötete alles Sterbliche, das mit solcher Luft in Berührung kam: die Früchte fielen von den Bäumen und verdarben, Gras und Kraut verbrannten, die Vögel stürzten tot aus der Luft herab, Roß und Reiter erlagen. Nur ein Tier gab es, das den Basilisken zu bannen und unschädlich zu machen vermochte: seinen Miterzeuger, den Haushahn. Wie vor dessen Krähen die späteren Erzeugnisse des Wahnes, Teufel, Gespenster und andere Spukgestalten, weichen müssen, so war auch der Basilisk genötigt, bis in die Tiefe der Erde zu flüchten, wenn er das Krähen des Haushahnes vernahm. Der alberne Märchenkram wurde bis in die neuere Zeit geglaubt – nicht bloß von naturunkundigen Laien, sondern auch von sogenannten gelehrten Männern, die über Naturgegenstände schrieben, beispielsweise von dem englischen Naturkundigen Topsel, der eine köstliche Schilderung des Basilisken entwirfst. Kein Wunder, daß die neuere Tierkunde einen so bedeutsamen Namen sich nicht entgehen ließ und ihn ebenso wie die alter Götter und Göttinnen, Helden, Nymphen, Nixen, Dämonen, Teufel und ähnlicher Phantasiegebilde verwendete.
Die Basilisken, die eine einzige Sippe ( Basiliscus) bilden, tragen auf dem Rücken und auf dem Anfange des Schwanzes einen Hautkamm, der durch die Dornenfortsätze der Wirbel gestützt wird, und Schuppensäume an den Zehen der Hinterfüße. Kopf und Hals sind kurz; der Leib ist hoch und dürr, der Schwanz sehr lang und seitlich sehr zusammengedrückt. Kleine gekielte Schilder bekleiden den Kopf, rautenförmige Schuppen, die sich in Querreihen ordnen, den Rumpf. Zahlreiche, nahe aneinander stehende, gleichartige und gleichgroße, gerade, zusammengedrückte Zähne mit dreilappiger Krone bilden das Gebiß: in der oberen Kinnlade stehen etwa zweiundvierzig, in der unteren ungefähr ebensoviele; außerdem sind in Längsreihen geordnete Gaumenzähne vorhanden.
Der Helmbasilisk ( Basiliscus mitratus) trägt auf dem Hinterkopfe eine spitzige, äußerlich mit gekielten Schuppen bekleidete Kappe, die von einer knorpeligen Leiste gestützt wird. Die ursprüngliche Färbung seiner Haut mag grün sein; bei den in Weingeist aufbewahrten Tieren sieht sie oben rötlichbraun, unten schmutzigweiß aus; vom Rücken herab verlaufen unregelmäßige und unterbrochene Querstreifen über die Seiten; hinter dem Auge steht eine weiße Binde, hinter den Kinnladen eine andere. Die Länge beträgt über sechzig Zentimeter, wovon drei Fünfteile auf den Schwanz kommen.
Über die Lebensweise des Basilisken haben wir erst in neuerer Zeit einige Kunde erlangt. Der Helmbasilisk ist, laut Salvin, in Guatemala so gemein, daß der Naturforscher ohne alle Schwierigkeit so viele dieser Tiere erlangen kann, als er eben wünscht. Man sieht sie auf den niederen Zweigen der Bäume oder auf Büschen sitzen, und auf Beute zu lauern, oder auf gefällten Stämmen behaglich der wärmenden Sonne sich hingeben. Besonders häufig bemerkt man sie in der Nähe von Flüssen, deren Umgebung sie kaum zu verlassen scheinen. Ihre Bewegungen sind jedoch immerhin so rasch, daß nur ein geschickter Fänger sich ihrer zu bemächtigen vermag. Sumichraft schildert etwas eingehender einen Verwandten und entwirft uns damit wohl ein allgemein gültiges Lebensbild der Gruppe: »An allen Flußufern des heißen und gemäßigten Striches von Mexiko findet man häufig den Basilisken, ›Zumbichi‹ der Indianer, ›Pasarios‹ oder Fährmann der Mexikaner, ein reizendes Tier, dessen Sitten in keiner Weise an das Fabelwesen der Alten erinnern. Am leichtesten entdeckt man die Basilisken im Frühlinge zur Fortpflanzungszeit, weil dann das Männchen sich nicht allein durch seine zierlichen Formen, sondern auch durch seine lebhafte Farbe und anmutigen Bewegungen auszeichnet. Mit Tagesanbruch gehen sie auf Beute aus; gegen Mittag pflegen sie am Ufer aus dürren Baumstämmen sich zu sonnen. Bei jedem Geräusche erheben sie den Kopf, blasen die Kehle auf und bewegen lebhaft den häutigen Kamm. Das durchdringende Auge mit goldgelber Iris erkennt eine Gefahr sofort, und gleich einer Sprungfeder, schnell wie der Blitz, stürzt sich der Basilisk ins Wasser. Beim Schwimmen erhebt er Kopf und Brust, schlägt die Wellen mit den Vordertatzen wie mit einem Ruder und zieht den langen Schwanz nach Art eines Steuers hinterdrein, so daß der Name Fährmann verständlich erscheint. Ende April oder im Anfange des Mai legt das Weibchen zwölf bis achtzehn Eier in ein Loch am Fuße eines Baumstammes und überläßt deren Ausbrütung der Sonne. Sie sind zwanzig Millimeter lang und dreizehn Millimeter breit, gleichen im übrigen aber denen anderer Leguanen. Die nach wenigen Tagen ausschlüpfenden Jungen unterscheiden sich in der Färbung wesentlich von den Alten; denn der Kamm und der Schwanz ist bei ihnen wie bei den Weibchen olivenfarbig, während er bei alten Männchen schön blutrot aussieht.
Die Nahrung des Basilisken besteht wesentlich aus Kerbtieren, die er mit vieler Gewandtheit zu erhaschen weiß, wenn sie sich in der Nähe seiner Warte auf den über das Wasser herabhängenden Zweigen niederlassen.
*
»Zwei Arten blühender Ingas hatten eine zahllose Menge Kerbtiere herbeigezogen und diese wiederum eine ungewöhnlich große Anzahl Leguane herbeigelockt. Bei jedem Ruderschlage, den wir vorwärts taten, stürzten sich drei bis vier der großen Tiere von den Bäumen ins Wasser herab oder verschwanden, mit Gedankenschnelligkeit von Zweig zu Zweig schlüpfend, in der dichten Belaubung der Wipfel, einem Zufluchtsorte, der jedoch nicht vor dem Späherauge der Indianer und ihren sicher treffenden Pfeilen schützen konnte. Alles war Leben und Bewegung geworden; denn es galt, einen der köstlichsten Leckerbissen für die heutige Mahlzeit so reichlich als möglich in die Töpfe zu bekommen. Mit den Gewehren war die Jagd nicht so erfolgreich als mit den Pfeilen, da die mit Schrot angeschossenen Leguane, wenn sie nicht unmittelbar tödlich verletzt waren, sich augenblicklich ins Wasser stürzten und nicht wieder zum Vorscheine kamen, während die langen Pfeile solches verhinderten. Unter der Beute befanden sich mehrere Stücke, die zwei Meter lang und dreißig Zentimeter dick waren. Ungeachtet des erschreckenden Äußeren des Tieres, gehört das Fleisch doch zu dem zartesten, was es geben kann. Gleich wohlschmeckend sind auch ihre Eier. Diese gesuchten Eigenschaften tragen natürlich, namentlich an der Küste, wo sich zu den Eingeborenen auch noch die Europäer, Farbigen und Schwarzen gesellen, viel dazu bei, daß dort das Tier immer seltener wird.«

Leguan ( Iguana tuberculata)
Mit diesen Worten schildert Schomburgk eine Begegnung mit dem Leguan ( Iguana tuberculata), der bekanntesten Art seiner Familie. Die Merkmale der Sippe der Guanen ( Iguana), die er vertritt, sind zu finden in dem gestreckten, seitlich zusammengedrückten Leib, dem großen, vierseitigen Kopfe, kurzen Halse, den kräftigen Beinen, sehr langzehigen Füßen und dem sehr langen, am Grunde etwas zusammengedrückten, platten oder mit dornigen Wirtelschuppen besetzten Schwanze, einem großen hängenden Kehlsacke mit Stachelkamm am Vorderteile desselben und dem vom Nacken bis zur Schwanzspitze verlaufenden Rückenkamme, den vielseitigen, platten, hinsichtlich der Größe sehr verschieden gewölbten, höckerigen und gekielten Kopfschildern, den schwach gekielten Schuppen der Leibesseiten, den dreikieligen Schildern an der Unterseite der Zehen und dem Gebisse, in dem die Vorderzähne rundlich, spitzig und etwas nach hinten gekrümmt, die übrigen dreieckigen zusammengedrückt, an der Schneide gezähnelt sind. Außer den Kinnladen trägt auch der Gaumen jederseits noch eine doppelte Reihe von kleinen Zähnen, deren Anzahl wie die der Kinnladen je nach dem Alter schwankt. Der Leguan erreicht 1,6 Meter an Länge, wovon fast ein Meter auf den Schwanz kommt. Die Grundfärbung der Haut ist ein schönes Blattgrün, das hier und da in Blau, Dunkelgrün, Braun und Grau übergeht; Unterseite und Beine sind gestreift; den Schwanz umgeben mehrere deutliche, breite Binden. Die Gesamtfärbung ist übrigens vielfachem Wechsel unterworfen, um so mehr als auch der Leguan die Fähigkeit besitzt, seine Farben zu verändern.
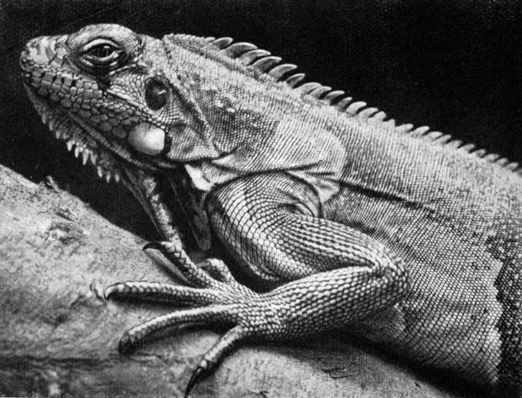
Leguankopf ( Iguana tuberculata)
Alle Leguane bewohnen den nördlichen Teil Brasiliens und die Länder um und in dem Meerbusen von Mexiko, also auch die Antillen, und alle leben auf Bäumen, am liebsten auf solchen, die an den Ufern von Gewässern stehen. Hier bewegen sie sich mit großer Gewandtheit, von Zweig zu Zweig kletternd und springend, wissen sich auch geschickt im Gelaube zu Verstecken und dem ungeübten Auge unsichtbar zu machen. Gegen Abend steigen sie nicht selten zum Boden herab, um auch hier Nahrung zu gewinnen, bei Gefahr aber flüchten sie, falls es ihnen irgendmöglich, wieder zu den hohen Wipfeln der Bäume empor oder, wie wir bereits wissen, in die Tiefe des Wassers hinab. In letzterem sind sie ebensogut zu Hause als der Waran, und ihr kräftiger Schwanz, der als Ruder gebraucht wird, fördert sie mit überraschender Schnelligkeit und Sicherheit. Sie tauchen ebenso geschickt wie sie schwimmen, verweilen sehr lange Zeit in der Tiefe, ermüden nicht und mögen durch ihre Gewandtheit allen sie in dem ihnen eigentlich fremden Elemente bedrohenden Feinden entgehen, kümmern sich mindestens nicht im geringsten um Krokodile oder Alligatoren, die in den von ihnen besuchten Flüssen Hausen.
Dumeril bemerkt, daß er in dem Magen aller von ihm untersuchten Leguane nur Pflanzenstoffe gefunden habe, und auch Tyler und Sumichrast stimmen hierin mit ihm überein. Letzterer fand in den Eingeweiden der von ihm zergliederten Stücke nur weiche Beeren, die zuweilen auch den Darm außerordentlich ausdehnten; Tyler bemerkt, daß man unter den halb verdauten Blättern zuweilen unzählbare Mengen kleiner Würmer finde, die, wie er annimmt, an den vom Leguan verzehrten Blättern gesessen haben und mit letzteren verschluckt worden sind. Doch bezeichnen alle Indianer die Leguane auch als Raubtiere, die nicht bloß Käfer, sondern ebenso kleine Eidechsen und ähnliche Tiere jagen. Belcher versichert, auf der Insel Isabella Schwärme von Leguanen gesehen zu haben, die als wahre Allesfresser Eier, Kerbtiere und weggeworfene Eingeweide von Vögeln gierig aufzehrten, und Liebmann beobachtete eine Art der Familie, die abends regelmäßig in der Steppe auf Heuschrecken jagte: Schomburgks Angabe steht also keineswegs vereinzelt da.
Das Wesen der Leguane hat wenig Anziehendes. Gewöhnlich entfliehen sie beim Anblicke des Menschen, weil sie gelernt haben, in diesem ihren gefährlichsten Feind zu sehen; in die Enge getrieben aber stellen sie sich mutig zur Wehr, blasen sich zunächst auf und dehnen den Halskamm aus, um sich ein furchteinflößendes Ansehen zu geben, zischen, fauchen, springen auf ihren Gegner zu, versuchen, an ihm sich festzubeißen, und lassen das einmal mit dem kräftigen Gebisse Erfaßte so leicht nicht wieder los, teilen auch mit dem kräftigen Schwanze heftige und schmerzhafte, ja selbst gefährliche Schläge aus. Während der Paarungszeit sollen sie sehr erregt und noch viel boshafter sein als sonst, das erwählte Weibchen nicht verlassen und auf jedes diesem sich nähernde Tier wütend losstürzen, auch unter sich grimmig um den Besitz der Weibchen kämpfen. Geraume Zeit nach der Paarung erscheinen letztere in der Nähe von Sandbänken, um hier ihre Eier abzulegen, und dies ist die Zeit, in der man die sonst sehr versteckt lebenden Tiere am häufigsten beobachtet. Auf Santa Lucia findet das Eierlegen in den Monaten Februar, März und April statt. Die Eier haben ungefähr die Größe der Taubeneier, sind weichschalig und von weißer oder licht strohgelber Färbung, hinsichtlich der Beschaffenheit ihrer Schale feinem Handschuhleder ähnlich, fallen dem Neuling auch, wie die meisten Kriechtiereier, dadurch auf, daß der Inhalt fast nur aus Dotter besteht. Die Weibchen legen sie in ein Loch im Sande und decken dasselbe sorgfältig wieder zu, bekümmern sich dann aber nicht mehr um die Brut. Schomburgk bemerkt, daß er in den Eierstöcken der von ihm erlegten Weibchen achtzehn bis vierundzwanzig befruchtete Keime fand. Nach Tylers Untersuchungen legen alte Weibchen beträchtlich mehr Eier als junge. Ein von ihm gefangen gehaltenes z. B. brachte an einem Tage deren fünf und fünf Tage später zweiunddreißig zur Welt. In dem Leibe der zergliederten Weibchen fanden sich, je nach der Größe des Tieres, acht, vierzehn und siebzehn Eier, die in zwei Reihen zu jeder Seite des Leibes gelagert und alle von gleicher Größe waren. Nach Sumichrasts Erfahrungen kommt es jedoch sehr häufig vor, daß mehrere Leguanweibchen gemeinschaftlich in eine und dieselbe Grube legen, so daß man zuweilen bis zehn Dutzend Eier in einer und derselben Bruthöhle finden kann. Viele Eier werden nicht allein von den Ameisen, sondern auch von Mäusen, insbesondere der auf Lucia vorkommenden sogenannten Moschusratte, zerstört. Es erscheint daher glaublich, daß die Leguanweibchen absichtlich die Seeküste aussuchen, deren Sand den erwähnten Feinden minder zugänglich ist als die Bänke an Flüssen. Die ausgeschlüpften Jungen scheinen längere Zeit zusammen zu bleiben, da Humboldt erwähnt, daß ihm von seinem Führer ein Nest junger, zehn Zentimeter langer Leguane gezeigt wurde. »Diese Tiere waren kaum von einer gemeinen Eidechse zu unterscheiden; die Rückenstacheln, die großen, aufgerichteten Schuppen, alle die Anhängsel, die dem Leguan, wenn er ein bis anderthalb Meter lang ist, ein so ungeheuerliches Ansehen geben, waren kaum in ihren ersten Anfängen vorhanden.«
In Westindien ist die Ansicht, daß das Fleisch der Leguane ungesund sei, in gewissen Krankheiten insbesondere die Zufälle vermehre, ziemlich allgemein verbreitet; gleichwohl kehrt sich niemand an diese Meinung, sucht vielmehr, fast mit demselben Eifer wie die Begleiter Schomburgks, ein so leckeres Gericht für die Küche sich zu verschaffen. Catesby sagt, daß die Leguane als gewöhnlicher und einträglicher Handelsgegenstand gefangen von Hand zu Hand gingen und auf dem Festlande endlich zu hohem Preise für die Tafel reicher Leute gekauft würden. Das Fleisch gilt für leicht verdaulich, nährend und schmackhaft und wird gebraten, häufiger aber noch gekocht gegessen. Die Eier, in denen sich fast kein Eiweiß befindet und die beim Kochen nicht erhärten, werden gewöhnlich zur Herstellung der Brühen benutzt. Eigene Fänger beschäftigen sich mit der Aufsuchung dieses sonderbaren Wildes und wenden verschiedene Fangarten an, um sich in Besitz desselben zu setzen. Gewöhnlich wendet man zur Jagd abgerichtete Hunde an, da es ohne deren Hilfe schwer hält, ja fast unmöglich ist, die den Blättern so ähnlichen Echsen wahrzunehmen. Liebmann berichtet, daß man an der Westküste Mittelamerikas den Leguanen auflauert, wenn sie abends von den Bäumen herabkommen, und sie durch Hunde stellen läßt, und Tyler fügt ergänzend hinzu, daß man die Hunde zu ihrer Jagd förmlich abrichtet. Geübte Hunde finden wahrscheinlich durch den Geruch die Leguane leicht auf und geben Standlaut, wenn das Wild auf den Bäumen sich befindet, oder stellen es, wenn sie dasselbe am Boden antreffen, einzelne von ihnen packen einen Leguan auch wohl ohne weiteres am Rücken und beißen ihn tot. Doch gibt es deren wenige, weil die durch Erfahrung gewitzigten und nicht besonders scharfen Hunde ebenso die kräftigen Schwanzschläge wie die Krallen und Zähne des wütend sich verteidigenden Leguans fürchten. Vermag letzterer noch zu flüchten, so wendet er sich zunächst einem Baume, in Ermangelung eines solchen aber einer Höhle zu und ist in beiden Fällen in der Regel verloren, da er sich ziemlich leicht von den Ästen abschütteln oder durch Abschneiden des Astes gewinnen läßt und anderseits sich verborgen wähnt, wenn er eine Höhlung findet, in der er eben seinen Kopf verbergen kann. Den glücklich überwältigten Gefangenen stößt man, um sie am Beißen zu verhindern, einen zähen Halm durch die Haut der Unterkinnlade und durch ein Nasenloch, bindet ihnen so das Maul zu, zieht ihnen alsdann die Sehnen der langen Mittelzehen heraus, benutzt dieselben, um ihnen beide Fußpaare auf dem Rücken zusammenzuschnüren und bringt am folgenden Morgen die so gequälten Opfer auf den Markt. Da die Lebenszähigkeit der Leguane, die selbst mit einem starken Schrotschusse im Leibe oft noch entrinnen, den Mexikanern bekannt ist, nehmen diese keinen Anstand, so gefesselte Gefangene monatelang aufzubewahren und gelegentlich zu verkaufen. Das geschieht namentlich vor der Fastenzeit, während welcher Leguane gern gekauft, in Maisteig eingebacken und als Leckerbissen verzehrt, auch als wertvolle Geschenke gesendet werden.
Gefangene Leguane benehmen sich anfänglich wild und zeigen sich ungemein tückisch, beißen nach ihrem Herrn und bedrohen jedes sich ihnen nähernde Tier, töten auch wohl schwächere Haustiere, die in ihr Bereich kommen, oder ihre Mitgefangenen. Allgemach mildert sich ihre Wut, und nach Verlauf mehrerer Wochen werden sie so zahm, daß sie sich behandeln lassen. In ihrem Vaterlande hält man sie zuweilen frei in den Gärten oder in den Häusern, wo sie sich durch Wegfangen von schädlichen Kerbtieren nützlich machen sollen; in Europa sieht man sie hier und da in Tiergärten oder in Sammlungen von Liebhabern. Diejenigen, die ich beobachten konnte, haben mich nicht angezogen. Sie waren zwar so zahm, daß sie die ihnen vorgehaltene Nahrung, Salatblätter, Kraut, Blumen, Blüten und dergleichen, ihrem Pfleger aus der Hand nahmen, taten übrigens jedoch nichts, was geeignet gewesen wäre, die Aufmerksamkeit zu erregen, saßen stundenlang langweilig auf einer und derselben Stelle und bekundeten die größte Gleichgültigkeit gegen ihre Umgebung. Ziemlich hohe und gleichmäßige Wärme ist zu ihrem Wohlbefinden unumgängliche Bedingung: schon bei geringer Abnahme der Wärme werden sie traurig, verschmähen fortan Nahrung zu nehmen und gehen bald darauf ein.
*
Die Galapagosinseln bilden eine eigene Welt für sich. Der größte Teil seiner Pflanzen und Tiere wird an keinem andern Orte gefunden. Unter letzteren spielen die Kriechtiere eine bedeutende Rolle; sie vertreten gewissermaßen die auf der Insel fast fehlenden Säugetiere, insbesondere die pflanzenfressenden. Nur wenige Arten sind dort heimisch; jede einzelne Art aber tritt ungemein zahlreich auf. Besonders beachtenswert sind zwei höchst merkwürdige, zur Leguanenfamilie zählende Schuppenechsen, die als Vertreter einer besonderen Gruppe der Sippe der Höckerköpfe ( Amblyrhynchus) angesehen werden, weil sie durch die Gestalt ihres Kopfes und dessen Beschilderungsweise, die Stärke der Kopfknochen und den Mangel eines Kehlsackes erheblich von den ihnen nächst verwandten engeren Leguanen abweichen. Beide kommen in ihrem allgemeinen Bau miteinander überein und haben in ihren Sitten ebenfalls manches gemein. Keine von beiden ist besonders bewegungsfähig; beide sind Pflanzenfresser, obgleich sie sich verschiedene Nahrung wählen: die eine aber lebt auf dem Lande, die andere ist auf das Wasser angewiesen und, was das merkwürdigste, die einzige Schuppenechse, die mit Recht ein Seetier genannt werden darf, die einzige, die ausschließlich von Wasserpflanzen lebt.
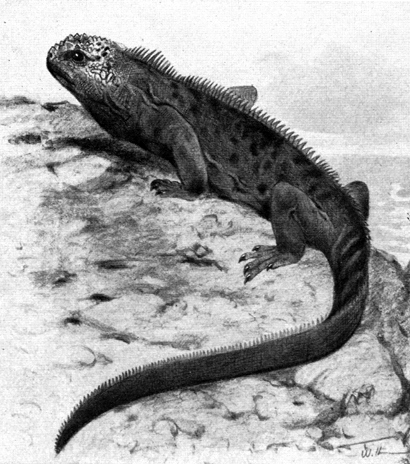
Meerechse ( Amblyrhynchus cristatus)
Die Meerechse, wie wir sie nennen wollen ( Amblyrhynchus cristatus), ist ein sehr großer Leguan, dessen Gesamtlänge fünfundachtzig Zentimeter, bei dreiundfünfzig Zentimeter Schwanzlänge, und dessen Gewicht bis zu zwölf Kilogramm ansteigen kann. Der kurze und breite Kopf fällt seitlich ab, verschmälert sich nach vorn und senkt sich, von der Seite gesehen, rasch und bogenförmig von der Stirngegend nach dem vorderen stumpfen Schnauzenrande zu. Der im allgemeinen sehr kräftige Leib trägt auf Hals, Nacken und Rücken einen seitlich stark zusammengedrückten Kamm, der sich ohne Unterbrechung bis zur äußersten Schwanzspitze fortsetzt, durch mehr oder minder tiefe Einschnitte am oberen Rande aber in einen Nacken-, Rücken- und Schwanzteil gesondert wird. Sämtliche Rückenschuppen erheben sich kegelförmig; die Schuppen der Seiten sind noch gewölbt, die etwas größeren Bauchschuppen dagegen völlig flach. Den langen, flossenartigen Schwanz bekleiden größere, viereckige, wie die Rückenschuppen in regelmäßigen Querreihen gelagerte Kielschuppen. Die Beine sind kurz und gedrungen, die Zehen durch ihre kurze Schwimmhaut verbunden und mit kräftigen, scharf gebogenen Krallen bewehrt. Die dicke Zunge füllt die ganze Breite der Mundhöhle aus. Kräftige, lange, dreizackige, an der äußeren Falte des tief rinnenförmig ausgehöhlten Kiefers angesetzte Zähne bilden das Gebiß.
Färbung und Zeichnung ändern sich je nach dem Alter. Bei jüngeren Meerechsen stehen auf beiden Seiten des Kopfes an dessen Unterseite wie an den Rumpfseiten zahlreiche hellgraue Flecken auf schwarzem Grunde und verdrängen zuweilen die dunkle Grundfärbung bis auf ein mehr oder minder schmales Maschennetz. Am Rücken selbst zeigen sich abwechselnd schmutzig graue und schwarze, mehr oder minder regelmäßig in Querbinden oder Querreihen stehende Flecken. Die ganze Ober- und Außenseite der Beine ist entweder grau punktiert oder mit großen, grauen Flecken geziert. Die Unterseite des Kopfes ist dunkel schmutziggrau, die Kehlgegend schwarz, die Unterseite schmutzig gelbbraun, die Oberseite der Finger und Zehen des Unterarmes und der Unterschenkel sowie die größere hintere Längenhälfte des Schwanzes tief schwarz, der Rückenkamm abwechselnd gelb oder grau und schwarz gebändert. Ausnahmsweise kommen vollkommen schwarz gefärbte Stücke vor. Die Meerechsen leben in ansehnlicher Menge auf den Galapagosinseln. Entsprechend ihrer Lebensweise halten sie sich stets auf dem felsigen Seeufer auf und werden, soweit die Beobachtungen Darwins reichen, niemals entfernter als zehn Schritt vom Ufer gefunden Schön oder anmutig kann man die Meerechse nicht nennen, muß sie vielmehr als häßlich bezeichnen; auch sind ihre Bewegungen nicht geeignet, für sie einzunehmen. »Man sah sie«, sagt Darwin, »zuweilen einige hundert Schritt vom Ufer umherschwimmen. Das Tier schwimmt mit vollkommener Leichtigkeit und Schnelligkeit unter schlangenförmiger Bewegung des Leibes und abgeplatteten Schwanzes, nicht aber mit Hilfe seiner Füße, die hart an die Leibesseite angelegt und niemals bewegt werden. Ihre Glieder und die starken Krallen sind trefflich geeignet, über die holperigen und zerspaltenen Lavamassen zu kriechen, die überall die Küste bilden. An solchen Plätzen sieht man eine Gruppe von sechs oder sieben dieser unschönen Kriechtiere auf dem schwarzen Felsen einige Meter hoch über der Brandung, woselbst sie sich mit ausgestreckten Beinen sonnen.
»Ich öffnete den Magen von mehreren und fand ihn jedesmal mit zermalmten Seetangen angefüllt, und zwar mit Überresten von der Art, die in dünnen, blätterartigen Ausbreitungen wächst und eine hellgrüne oder dunkel rotgrüne Färbung hat. Da ich mich nicht erinnere, diese Seepflanze in beträchtlicher Menge auf den von der Flut bespülten Felsen gesehen zu haben, muß ich annehmen, daß sie auf dem Grunde des Meeres in einer kurzen Entfernung vom Ufer wächst, und, wenn dies richtig, ist der Zweck, weshalb diese Tiere gelegentlich ins Meer gehen, vollkommen erklärt. Bynoe fand einmal ein Stück von einer Krabbe in dem Magen der Meerechse; diese Überreste dürften aber wohl zufällig mit verschluckt worden und die Angabe kaum von Gewicht sein. Die Gestalt des Schwanzes, die sichere Tatsache, daß man die Meerechse freiwillig im Meere hat schwimmen sehen, und die Nahrung endlich beweisen zur Genüge, daß sie dem Wasser angehört. Nun aber macht sich noch ein sonderbarer Widerspruch geltend, der nämlich, daß sie nicht in das Wasser flüchtet, wenn sie in Furcht gesetzt wird. Man kann sie leicht auf eine ins Meer vorspringende Stelle treiben; hier aber läßt sie sich eher am Schwanze greifen, als daß sie in das Wasser springt. Von der Verteidigung durch Beißen scheint sie keine Vorstellung zu haben. Wenn sie sehr in Furcht gejagt wird, spritzt sie einen Tropfen Flüssigkeit aus jedem Nasenlochs von sich. Vielleicht läßt sich diese Wasserscheu bei Gefahr durch den Umstand erklären, daß sie am Ufer keinem Feinde, im Meere hingegen den zahlreichen Haifischen oft zur Beute wird, das Ufer also als einen sicheren Aufenthalt kennengelernt hat.«
Die zweite Eidechse der Galapagosinseln, die wir Drusenkopf ( Amblyrhynchus subcristatus) nennen wollen, ist im allgemeinen Gepräge sowie auch durch den Mangel von Gaumenzähnen wesentlich von der Meerechse verschieden und im ganzen noch plumper und schwerfälliger als diese. Nur auf das feste Land angewiesen, entbehrt sie der Schwimmhäute zwischen den kürzeren Zehen der gedrungeneren Beine. Ihr Schwanz ist ebenfalls kürzer und mäßig zusammengedrückt, im Durchschnitte daher eiförmig und kammlos, der Hals dagegen bedeutend länger und unterseits zahlreich gefaltet, der Kopf endlich gestreckter, daher verhältnismäßig minder hoch und weniger rasch von der Schnauzengegend zum vorderen Mundrand abgeflacht. Hinsichtlich der Färbung unterscheidet sich der Drusenkopf ebenfalls nicht unerheblich von der Meerechse. Der Kopf zeigt eine mehr oder minder lebhafte zitronengelbe Färbung; der Rücken ist zunächst dem Kamm ziegel- oder rostrot, in seltenen Fällen querüber abwechselnd und sehr verschwommen gelblich oder rotbraun gebändert; gegen die Seiten hin geht die rotbraune Färbung in ein schmutziges, dunkles Braun über. Die Bauchseite ist dunkelgelb mit einem Stich ins Rötlichbraune. Die Vorderbeine sind nach außen und oben rötlich-, die Hinterfüße bräunlichgelb, die Krallen und deren nächste Umgebung aber schwärzlich.
Der Drusenkopf wurde von Darwin nur auf den mittleren Inseln der Galapagosgruppe beobachtet. Hier bewohnt die Echse sowohl die höheren und feuchten wie die tieferen und unfruchtbaren Teile; in den letzteren findet sie sich am zahlreichsten. »Ich kann hiervon«, bemerkt Darwin, »keine bessere Vorstellung geben, als wenn ich sage, daß wir auf der Jamesinsel eine Zeitlang keine passende Stelle zum Aufschlagen unseres Zeltes finden konnten, weil keine frei von ihren Höhlen war. Der Drusenkopf ist ebenso häßlich wie die Meerechse und hat wegen seines niederen Gesichtswinkels einen besonders dummen Gesichtsausdruck.
In ihren Bewegungen ist diese Echse träge und schläfrig. Wenn sie nicht in Furcht gesetzt wird, kriecht sie langsam dahin, Bauch und Schwanz auf dem Boden nachziehend, hält oft still, schließt die Augen minutenlang, als ob sie schlummere, und legt dabei ihre Hinterbeine ausgebreitet auf den Boden. Sie wohnt in Löchern, die sie zuweilen zwischen Lavatrümmern, häufiger auf ebenen Stellen des weichen, vulkanischen Gesteins aushöhlt. Diese Löcher scheinen nicht sehr tief zu sein und führen in einem kleinen Winkel in die Tiefe, so daß der Boden über ihnen stets nachgibt und eine derartig durchlöcherte Strecke den Fußgänger ungemein ermüdet. Wenn der Drusenkopf sich in seine Höhle gräbt, arbeitet er abwechselnd mit den entgegengesetzten Seiten seines Leibes; ein Vorderbein kratzt eine Zeitlang den Boden auf und wirft die Erde nach dem Hinterfuße, der so gestellt ist, daß er sie aus der Öffnung der Höhle schleudert. Wenn die eine Seite des Körpers ermüdet, beginnt die andere zu arbeiten, und so abwechselnd. Ich bewachte eines dieser Tiere eine Zeitlang, bis sein ganzer Körper sich eingewühlt hatte, dann trat ich näher und zog es am Schwanze; es schien sehr erstaunt zu sein, grub sich heraus, um nach der Ursache zu sehen und blickte mir starr ins Gesicht, als wenn es fragen wollte: ›Warum hast Du mich am Schwanze gezogen?‹
Die Drusenköpfe fressen bei Tage und wandern dabei nicht weit von ihrer Höhle weg. Werden sie in Furcht gesetzt, so stürzen sie sich auf eine sehr linkische Weise nach den Zufluchtsorten hin. Wegen der Steilstellung ihrer Beine können sie sich nicht sehr schnell bewegen, es sei denn, daß sie bergab laufen. Vor den Menschen fürchten sie sich nicht. Wenn man genau auf sie acht gibt, rollen sie ihren Schwanz, erheben sich auf ihre Vorderbeine, nicken mit dem Kopfe in einer schnellen, senkrechten Bewegung und geben sich ein sehr böses Ansehen, das der Tatsächlichkeit jedoch keineswegs entspricht: denn wenn man nur mit dem Fuße auf den Boden stampft, senken sie ihren Schwanz, und fort geht es, so schnell sie können. Ich habe oft bei kleinen fliegenfressenden Eidechsen bemerkt, daß sie mit ihrem Kopfe genau in derselben Weise nicken, wenn sie auf etwas Achtung geben; aber ich weiß durchaus nicht, weshalb es geschieht. Wenn der Drusenkopf festgehalten und mit einem Stocke gereizt wird, beißt er heftig; ich fing jedoch manchen beim Schwanze, und keiner von diesen machte einen Versuch, mich zu beißen. Dagegen kämpfen zwei von ihnen, wenn man sie auf die Erde setzt und zusammenhält, sofort miteinander und beißen sich, bis Blut fließt.
Alle diejenigen Drusenköpfe, die das niedere Land bewohnen, können während des ganzen Jahres kaum einen Tropfen Wasser kosten; aber sie verzehren viel von dem saftigen Kaktus, dessen Äste zufällig von dem Winde abgebrochen werden. Ich habe oft einem oder zweien ein Stück davon vorgeworfen, und es war ergötzlich zu sehen, wie jeder den Bissen zu ergreifen und wegzutragen suchte, gerade wie hungrige Hunde mit einem Knochen verfahren. Sie fressen sehr gemächlich, kauen aber die Nahrung nicht. Alle kleineren Vögel wissen, wie harmlos sie sind. Ich sah einen von den dickschnäbeligen Finken an einem Ende eines Kaktusstückes picken, während ein Drusenkopf an dem andern fraß, und der kleine Vogel hüpfte nachher mit vollkommener Gleichgültigkeit auf den Rücken des Kriechtieres. In dem Magen derer, die ich innerlich untersuchte, fand ich stets nur Pflanzenfasern und Blätter verschiedener Bäume, besonders solche einer Akazienart. In dem oberen Gürtel der Insel leben diese Echsen hauptsächlich von den sauren und zusammenziehenden Beeren der Guayavita, unter denen ich sie und die Riesenschildkröten zusammen habe fressen sehen. Um die Akazienblätter zu erhalten, suchen sie die niederen, zwerghaften Bäume auf, und es ist nichts Ungewöhnliches, daß man eine oder ein Paar meterhoch über dem Boden auf Ästen sitzen und ruhig fressen sieht.
Während der Zeit unseres Besuches hatten die Weibchen in ihrem Körper zahllose, große, längliche Eier. Diese legen sie in ihre Höhlen, und die Einwohner suchen sie für die Küche auf.
Das gekochte Fleisch sieht weiß aus und gilt bei denen, deren Magen über Vorurteile erhaben ist, für ein sehr gutes Essen.«
*
Die Unterordnung der Wurmzüngler ( Rhiptoglossa), die sich unter anderem durch den vollständigen Schläfenbogen kennzeichnet, umfaßt nur eine einzige Familie, die der Chamäleons ( Chamaeleontidae). Streng genommen bekunden die Chamäleons mit andern Echsen wenig Verwandtschaft. Ihr Rumpf ist seitlich stark zusammengedrückt und schmal und zeigt eine schneidigbogige Rückenfirste mit Hautkörnern, die größer, kräftiger, mit einem Worte entwickelter sind als die übrigen des Körpers und auf der Rückenfirste einen sehr bestimmten Saum bilden. Der Kopf ist pyramidenförmig erhaben, am Schnauzenteile oft merkwürdig vorgezogen, überhaupt kantig und eckig, der Hals kaum zu unterscheiden. Die Beine sind mager, rundlich und alle fast von gleicher Länge; die Zehen, fünf an jedem Fuße, werden je zwei und drei bis zum Grunde ihrer vorletzten Glieder von der allgemeinen Körperhaut umhüllt und bilden so zwei sich gegenüberstehende Stücke oder Bündel, mithin eine Art von Zange, die, da ihre innere Seite mit einer körnigen Haut überzogen ist, mit Sicherheit und Festigkeit einen Zweig umspannt. Die überall gleich kräftige Befestigung des ganzen Körpers auf seinem Standorte wird vorzüglich auch dadurch erzweckt, daß die Zehen nicht auf der Innen- oder Außenseite des Körpers allein, sondern wechselständig in ihrer größeren Anzahl miteinander verbunden sind, indem an den Vorderfüßen die drei inneren, an den Hinterfüßen die drei äußeren, an diesen die zwei inneren, an jenen die zwei äußeren im Zusammenhange miteinander stehen. Hieraus ergibt sich, daß die Füße dieser Echsen hinsichtlich ihrer Bildung einzig in ihrer Art sind. Der Schwanz ist rundlich, kräftig, verjüngt sich gegen sein Ende hin immer nur allmählich und kann von unten auf schneckenförmig zusammengerollt werden. Statt der Schuppen bedecken die Haut kleine, körnerförmige Erhöhungen, zwischen denen bisweilen kleine Schildchen stehen, immer aber zarte Fältchen verlaufen. Die Beschaffenheit der Haut gestattet ihr eine bedeutende Ausdehnung.
Noch auffallender als die Bildung der angegebenen Leibesteile erscheinen auch dem oberflächlichen Beobachter die Augen der Chamäleons. Sie werden von starken Lidern kapselförmig umschlossen und lassen nur eine runde Öffnung für den Stern frei. Beide sind in ihren Bewegungen vollständig unabhängig von einander, so daß das rechte vor- oder aufwärts, das linke rück- oder abwärts blicken kann und umgekehrt. Diese bei keinem Tiere sonst noch vorkommende Beweglichkeit gestattet dem Chamäleon, auch ohne sich zu bewegen, seine ganze Umgebung zu übersehen und seine Beute ausfindig zu machen.
Der innere Bau ist nicht minder merkwürdig als der äußere. Vor allem verdient die absonderlich gebaute, für das Leben des Tieres überaus wichtige Zunge eine eingehende Schilderung. Wenn man vergleichen will, darf man sagen, daß sie die der Ameisenbären und Spechte wiederholt; sie unterscheidet sich jedoch wesentlich von der beider Tiergruppen. Im Zustande der Ruhe liegt sie zusammengezogen im Schlunde; beim Gebrauche kann sie fünfzehn bis zwanzig Zentimeter weit vorgestoßen werden. Das Zungenbein hängt, nach Houston, nicht mit der Luftröhre zusammen und hat vier, zwei Zentimeter lange Hörner und einen Körper, der sich drei Zentimeter weit wie ein Griffel nach vorn verlängert und der Zunge im Zustande der Ruhe zur Stütze dient. Wenn sie vorgestoßen wird, ist sie so dick wie ein Schwanenkiel, fühlt sich elastisch an, läßt sich nur wenig eindrücken, sieht in der Mitte rötlich aus und zeigt an jeder Seite, etwa zwei Zentimeter vor der Spitze, ein weißes Band, gegen die Spitze hin auch einige dicke Hohladern, die von Blut strotzen. Bewegt wird sie von neun Muskeln jederseits, die die Hörner des Zungenbeines an den Brustkasten heften und zurückziehen. Das bewegliche Stück der Zunge besteht aus zwei Teilen, einem zum Ergreifen und einem zum Steifen; jener liegt vorn, hat eine Länge von zwei und einem halben Zentimeter und einen Umfang von zwei Zentimeter, ändert auch beim Vorschießen seine Länge nicht, weil er von einer faserigen Scheide umgeben ist; sein vorderes, vertieftes Ende wird von einer runzeligen Schleimhaut überzogen und erscheint wie mit einer klebrigen Masse beschmiert, die Ausfluß mehrerer Drüsen ist. Der andere Teil liegt zwischen jenem und dem Zungenbeine und ändert seine Lage nach den Umständen. In der Ruhe nimmt er einen sehr kleinen Raum ein, beim Vorschießen aber wird er von den beiden sehr großen Zungenschlagadern, die sich in ihm in zahllose Zweige teilen, mit Blut gefüllt und ausgedehnt; das Vorschnellen geschieht also infolge dieser lebhaften Einströmung von Blut in das Netz von Blutgefäßen, nicht aber durch Einpumpen von Luft, wie man geglaubt hat. Die Blutgefäße füllen sich ungefähr ebenso schnell, als sich die Wangen eines Menschen röten; die Zunge kann somit in einem einzigen Augenblicke ausgestreckt und zurückgezogen werden. »Auf einer Stelle tagelang stehend«, sagt Wagler, »erwartet das Tier mit einer gewissen Sorglosigkeit die Nahrung, die der Zufall herbeiführt. Der Fang derselben setzt der behaglichen Ruhe kein Ziel. Mit Blitzesschnelle rollt die Zunge über den Mund hinaus und ergreift in der Ferne das Kerbtier, auf das sie losgeschnellt wurde. Ihr heftigstes Vorstoßen ist nicht imstande, im Körper eine Erschütterung hervorzubringen und den Sonderling, stünde er auch auf einem noch so schwanken und glatten Zweige, herabzuwerfen, denn der muskelkräftige Greisschwanz, mit welchem er sich rücklings an seine Standebene knüpft, verhindert jedes Vorsinken des Körpers.«
Es ist denkbar, daß die eigentümliche Gestalt, das ernsthafte Aussehen, das langsame Herbeischreiten, das plötzliche Losschießen der Zunge aus die Beute die Beachtung der Griechen auf sich zog und sie veranlaßte, dem Chamäleon seinen hübschen Namen: »Klein-« oder »Erdlöwe« zu geben; mehr als dieses alles aber erregte im Altertume und bis in die neueste Zeit der Farbenwechsel die Aufmerksamkeit der Forscher und Laien. Früher nahm man an, das Tier könne seine Färbung beliebig wechseln, beispielsweise die seiner Umgebung annehmen und sich dadurch vor seinen Feinden verbergen, nannte deshalb auch einen Menschen, der seine Meinung je nach den Umständen, jedoch stets zu seinen Gunsten veränderte, ein Chamäleon, und erhob letzteres zu einem Sinnbilde der knechtischen Gefälligkeit der Schmeichler und Höflinge; sein bloßer Name gab Tertullian Stoff zu einer ernsthaften Betrachtung über den falschen Schein und die Unverschämtheit der Betrüger und Großsprecher. Die gelehrtesten und ungelehrtesten, scharfsinnigsten und abgeschmacktesten Ansichten und Deutungen über den Farbenwechsel wurden laut, und noch in neuester Zeit herrschte Meinungsverschiedenheit über die nicht genügend erklärte Erscheinung, bis endlich Brücke durch eingehende Forschungen die Frage löste.
Der Farbenwechsel hat seine Ursache im Vorhandensein zweier Lagen verschiedenartiger Farbstoffe (Pigmente), von denen die eine unter den Oberteilen der eigentlichen Haut abgelagert ist, abwärts aber auch in das Bindegewebe sich erstreckt und hier zwischen die Gewebeteile eindringt, die andere in der ganzen Haut, und zwar in verzweigten Zellen sich befindet, die unter oder auch in der Hautmasse der Lage liegen. Jener Farbstoff ist der Hauptsache nach weiß, nach außen zu jedoch gewöhnlich mehr oder minder lebhaft gelb, dieser bräunlichschwarz. Beide Lagen nun erzeugen den Farbenwechsel, je nachdem sie neben- oder hintereinandertreten, bezüglich einander durchdringen. Kommt der lichte Farbstoff allein zur Geltung, so sieht die Haut weiß oder gelb aus, wird er von dem schwarzen durchdrungen, braun oder schwarz; die dazwischen liegenden Farben bilden sich, je nachdem diese Durchdringung mehr oder minder vollständig wird. In welcher Weise der Farbenwechsel stattfindet und welches die ihn bewirkenden Ursachen zu sein scheinen, werden wir später sehen.
Alle Chamäleons gehören der Alten Welt oder, richtiger, der Osthälfte der Erde an und haben in Amerika weder Verwandte noch Vertreter im eigentlichen Sinne des Wortes. Sie zählen zu den bezeichnendsten Tieren Afrikas.
Das Chamäleon ( Chamaeleon vulgaris) kennzeichnet sich durch den nur zur Hälfte gezähnelten Rückenkamm, den vom Kinne bis zum After verlaufenden Bauchkamm, den dreiseitigen, stumpf pyramidenförmigen Helm auf dem Hinterkopfe, der durch die stark vortretende, rückwärts gekrümmte Scheitelleiste gebildet wird, und die gleichartigen kleinen Schuppen des Rumpfes, die nur auf dem Kopfe sich vergrößern. Über seine Färbung wird später noch einiges zu sagen sein; eine allgemein gültige Beschreibung derselben läßt sich nicht geben. Die Länge beträgt 25 bis 30 Zentimeter, wovon etwas mehr als die Hälfte auf den Schwanz kommt. Sein Verbreitungskreis erstreckt sich von Südspanien an über einen großen Teil Afrikas und Asiens: es lebt in Andalusien, in allen Ländern Nordafrikas von Marokko an bis Ägypten.

Chamäleon ( Chamaeleon vulgaris)
Alle Chamäleons leben nur in solchen Gegenden, in denen es zeitweilig regnet oder allnächtlich so starker Tau fällt, daß sie eines ihrer zwingendsten Bedürfnisse, Wasser zum Trinken, jederzeit befriedigen können. Aus diesem Grunde bewohnen sie in besonderer Häufigkeit Küstenländer und Inseln. Ein anderweitiges Bedürfnis von ihnen bilden höhere Gewächse, Bäume oder Sträucher, mindestens Buschwerk oder Gestrüpp; denn sie sind vollendete Baumtiere, die nur ausnahmsweise zum Boden hinabsteigen. Wo sie vorkommen, pflegen sie häufig aufzutreten; hier und da kann man unter besonders günstigen Umständen bei einer kurzen Wanderung Dutzende von ihnen wahrnehmen. Man sieht sie, gewöhnlich in kleinen Gesellschaften von drei bis sechs Stücken, auf einem Busche oder einer Baumkrone sitzen, unbeweglich, als wären sie ein dem Aste angewachsener Holzknorren, mit den vier Klammerfüßen und dem Schwanze an einem oder mehreren Zweigen befestigt. Tagelang beschränkt sich ihre Bewegung darauf, sich bald auf dem Aste, den sie sich zum Ruheplatze erwählten, niederzudrücken und wieder zu erheben, und erst, wenn besondere Umstände eintreten, verändern sie nicht bloß ihre Stellung, sondern auch ihre Plätze. Das verschriene Faultier und jedes andere derjenigen Geschöpfe, die auf Bäumen leben, bewegt sich mehr und öfter als sie, falls man absieht von Augen und Zunge; denn erstere sind in beständiger Tätigkeit, und letztere wird so oft, als sich Beute findet, hervorgeschnellt. Kein anderes Wirbeltier lauert ebenso beharrlich wie das Chamäleon auf seine Beute; es läßt sich in dieser Hinsicht nur mit den tiefststehenden, dem Felsen gleichsam angewachsenen wirbellosen Tieren vergleichen. Wer so glücklich gewesen ist, das keineswegs leicht zu entdeckende Geschöpf aufzufinden, sieht, wie beide Augen beständig, und zwar ruckweise sich drehen und unabhängig von einander nach den verschiedensten Richtungen auslugen. Hat längeres Fasten die sehr rege Freßlust nicht angestachelt, so verweilt das Chamäleon in derselben Stellung, auch wenn es glücklich Kerbtiere gesehen hat, und wartet ruhig, bis sich in entsprechender Entfernung von ihm ein solches auf einem Zweige oder Blatte niederläßt. Sowie dies geschehen, richtet sich der Kopf dem Kerbtiere zu, beide Augen kehren sich mit ihren Spitzen nach vorn, der Mund öffnet sich langsam, die Zunge schießt hervor, leimt die Beute an und wird zurückgezogen; man bemerkt sodann eine rasche, kauende Bewegung der Kiefer, und das Tier erscheint wieder so regungslos wie zuvor. War es aber längere Zeit im Fange unglücklich, so verfolgt es wirklich ein erspähtes Kerbtier auf einige Meter weit, ohne jedoch den Busch, aus dem es sich gerade befindet, zu verlassen.
Während meines Aufenthaltes in Alexandrien hielt ich einmal einige zwanzig lebende Chamäleons im Zimmer. Sie waren an einem und demselben Tage in meinen Besitz gelangt und hatten sich gleich vom Anfange an in den ihnen angewiesenen Raum geteilt. Auf jedem Vorsprunge, an den Fenstergewänden, auf den Türgesimsen, auf den in der Ecke stehenden Gewehren und Pfeifenröhren, auf Tischen, Stühlen, Kisten und Kasten saßen sie, jedes so lange als möglich auf einer und derselben Stelle. Durch ein mit Honig gefülltes Gefäß lockte ich Kerbtiere, also besonders Fliegen herbei; so viele von denselben aber auch kamen: der Hunger meiner Gefangenen schien unersättlich zu sein, oder die von ihnen gewählten Hinterhalte waren so ungünstig, daß sie sich wohl oder übel zu größeren Spaziergängen bequemen mußten. Diese Ausflüge brachten ihnen anfangs regelmäßig mehrere Fliegen ein; wenn ich aber das Fenster geschlossen und damit neuen Zuzug verhindert hatte, wurde die Jagd bald schwieriger; denn die Fliegen merkten die Verfolgung und wichen den sich ihnen nahenden Räubern vorsichtig aus. Bei dieser Gelegenheit habe ich die ausdauernde Geduld der Chamäleons bewundern lernen. Das eine Tier, das sich auf der Stuhllehne festsetzte, entdeckt, nachdem es seine Augen nach allen Richtungen hin hat spielen lassen, endlich auf dem benachbarten Tische eine Fliege. Die Entdeckung wird längere Zeit geprüft und der Fall scheinbar sorgfältig erwogen. Noch dürfte eine schwache Hoffnung vorhanden sein, daß die Fliege sich, zehn Zentimeter weit von der Schnauzenspitze entfernt, auf die Stuhllehne setzen könnte. Die erfreuliche Aussicht verwirklicht sich leider nicht. Jetzt kommt dem Chamäleon ein großer Gedanke, und es beeilt sich nach seiner Weise demselben die Tat folgen zu lassen. Bedächtig löst es seinen Vorderfuß, gemachsam erhebt es ihn ungefähr einen Zentimeter über die frühere Standfläche, langsam bringt es ihn vielleicht um zwei Zentimeter weiter, und von neuem klammert es ihn fest; einige Augenblicke später löst sich die Schwanzschlinge, die fünfte Hand wird ebenfalls etwas vorgezogen, wiederum befestigt, und nunmehr kann auch das eine Hinterbein aus seiner Lage gebracht werden. Man erwartet natürlich, daß das dem Vorderfuße entgegengesetzte Bein bewegt wird, bemerkt aber bald, daß es dem Chamäleon durchaus nicht darauf ankommt, eine Regel festzuhalten, daß es vielmehr die Beine einer und derselben Seite nacheinander, bald die Vorder- und Hinterfüße wechselseitig fürdersetzt. Ein Auge richtet sich fortwährend nach der Fliege, das andere dreht sich noch unablässig, als ob es auch seinerseits auf Jagd ausgehen müsse. Die Fliege bleibt sitzen: es kann also vorwärts gegangen werden. Mit überaus ergötzlicher, jedoch trotzdem qualvoller Langweiligkeit steigt der geduldige Räuber an der Stuhllehne herab, auf dem Sitzbrette vorwärts, klammert sich mit überraschendem Geschick von unten an den Tisch und hilft sich nach unsäglichen Mühen, kletternd und sich weiter haspelnd, bis zum Rande der Platte empor. Beide Augen drehen sich jetzt, so schnell dies überhaupt möglich ist; die Fliege sitzt glücklicherweise immer noch an derselben Stelle, kommt endlich in den Gesichtskreis, und die weitere Bewegung des Chamäleons wird wiederum eine geregelte. Endlich ist es bis in entsprechende Nähe gekommen, schon öffnen sich die Kiefer, der Kolben der Zungenspitze wird bereits sichtbar: da summt die besorgte Fliege davon, und das Chamäleon hat das Nachsehen. Von neuem drehen sich die Augen, lange Zeit vergeblich; endlich dort in der fernen Ecke bleibt wenigstens das eine unbeweglich haften. Richtig, hier sitzt die Fliege wieder, wenn nicht dieselbe, so doch eine andere. Jetzt scheint es, als ob der Ärger über den fehlgeschlagenen Versuch die Schritte beschleunige; denn mit einer wirklich bewundernswürdigen Hast ist das Chamäleon an dem Tische herabgestiegen und schreitet mit weit ausgebreiteten Beinen, den Schwanz als Stütze benützend, über den flachen Boden dahin, anscheinend mit größter Beschwerde, jedoch noch immer viel schneller, als man erwartet hat. Ein langes Pfeifenrohr bietet eine brauchbare Leiter, und nach einigen Minuten ist die Höhe derselben glücklich erreicht. Wenn das Rohr doch fünfzehn Zentimeter länger wäre! Als unser Chamäleon am Ende anlangt, bemerkt es nach minutenlangem Besinnen, daß jene fünfzehn Zentimeter fehlen. Da sitzt die Fliege scheinbar in größter Gemütsruhe, aber außer Schußweite; regungslos haften beide Augen auf ihr, lange, lange Zeit: die Fliege bleibt auf derselben Stelle und das Chamäleon auch. Möglich, daß sie im Verlaufe der Zeit sich um einige Zentimeter nähert, möglich, daß eine zweite herbeikommt. Im entgegengesetzten Falle wird unser Chamäleon so lange in der mühsam gewonnenen Lage verharren, bis die glücklich entdeckte Beute davongeflogen und eine neue anderswo aufgefunden worden ist. Man hat wiederholt behauptet, daß das Chamäleon, auch wenn es wolle, im Verlaufe eines Tages nur wenige Schritte zurücklegen könne. Dies aber ist, wie aus meinen Beobachtungen hervorgeht, keineswegs der Fall. Wenn es will, kann es schon binnen einer Stunde eine verhältnismäßig bedeutende Strecke durchmessen.
Von dem Farbenwechsel der Haut macht man sich gewöhnlich eine falsche Vorstellung. Man glaubt, daß das Tier plötzlich die verschiedensten Schattierungen und Abstufungen aller nur denkbaren Farben auf seiner Haut zeige, daß es sein Aussehen unbedingt den Gegenständen anpasse, auf denen es sich gerade befinde, und dementsprechend imstande wäre, jede beliebige Färbung anzunehmen, daß es überhaupt willkürlich sich verändern könne. Alles dies ist mehr oder minder unrichtig. Allerdings sieht das Tier in der Regel grünlich aus, dem Blattwerke ähnlich; es vermag seine Färbung jedoch keineswegs immer derjenigen eines jeden beliebigen Gegenstandes, auf den man es setzen könnte, anzupassen. In dieser Färbung kommen vor die Übergänge von Orange durch Gelbgrün bis Blaugrün und die Schattierungen und Übergänge jeder dieser Farben durch Grau oder Graubraun in Schwarz, Weiß, Fleischfarben, Rostbraun, Veilchenblau und Blaugrau, außerdem noch Schillerfarben, die durch die über der Oberhaut liegenden dünnen, platten, sechseckigen Zellen hervorgebracht werden. Alle Farbenveränderungen nun geschehen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, entweder infolge äußerer Einflüsse oder aber infolge von Gemütsbewegungen oder Äußerungen des Gemeingefühls: Hunger, Durst, Bedürfnis nach Ruhe, Sättigung, Wollust usw.; aber sie geschehen nicht bei allen Stücken in gleicher Weise oder Folge. Nicht alle Teile des Leibes sind dem Wechsel unterworfen: ein vom Kinne zum After verlaufender Streifen und die Innenseite der Hände und Füße verändern sich niemals. Die Innenseite der Arme und Schenkel unterliegen auch nur geringen Veränderungen. Van der Hoeven hat sehr genaue Beobachtungen über den Wechsel angestellt und die Chamäleons in verschiedenen Farben malen lassen. Auf den Seiten bemerkt man zwei breite, helle Längsstreifen und dazwischen vom Kopfe bis zum Schwanze und vom Rücken bis zum Bauche verlaufende dunkle, runde Tüpfel, die mehr als die andern Stellen dem Wechsel unterworfen sind. Morgens, wenn sich das Tier ruhig hält, ist die Haut gewöhnlich gelblich, und die zwei Streifen sehen rötlich aus; auch bemerkt man die Tupfen wenig oder nicht. Später am Tage hat sich die Haut noch wenig verändert, die Streifen aber sind weißlich und die Tupfen dunkelgrün geworden; außerdem treten längs des Rückgrates dunklere Schatten hervor. Nimmt man das Tier am Morgen in die Hände, so erscheinen die grünen Flecken ebenfalls. Im Zustande der Reizung wird die Haut grünlich, der Bauch bläulich, die Streifung weißlich, die Tüpfelung schwarz. Manchmal sieht das Tier rötlichbraun aus; die Streifen sind heller, die Tupfen und Schatten fast gänzlich verschwunden. Hiermit ist der Wechsel jedoch noch keineswegs erschöpft. Ich beobachtete, daß zwei Chamäleons während der Begattung eine milchweiße Färbung annahmen, und ebenso, daß sie, wenn man sie ärgerte, fast ganz schwarz wurden; andere Forscher sahen solche, welche blaßrot und purpurfarben und Veilchenfarben getüpfelt waren. Im allgemeinen sind Färbung und Zeichnung um so lebhafter, je gesünder und erregter das Tier ist. Aber auch diese Regel ist nicht ohne Ausnahme. Daß Licht und Wärme auf die Verfärbung wesentlichen Einfluß haben, läßt sich durch Versuche nachweisen. »Ist einem daran gelegen, die Farbe des Chamäleons schnell sich ändern zu sehen«, sagt Lenz, »so braucht man es nur, wenn es an einem kühlen Orte sitzt, rasch mit der Hand oder sonst zu erwärmen.« Man bedarf jedoch nicht einmal der Wärme: schon schwaches Licht genügt, um eine Veränderung hervorzubringen. Nähert man sich dem schlafenden Chamäleon nachts mit einem Lichte und hält dasselbe in einer Entfernung von sechs bis zehn Zentimeter vor die eine Seite, so bemerkt man, daß auf der gelblich unbefleckten Haut nach einigen Minuten hellbraune Flecke erscheinen, allmählich dunkler und endlich fast schwarz werden; nach Entfernung des Lichtes verschwinden sie allmählich wieder. Bringt man ein gefangenes Chamäleon aus einem dunklen Raume in die Sonne, so dunkelt seine Haut innerhalb weniger Minuten. Den außerordentlichen Einfluß des Lichtes, gleichzeitig aber auch die Unabhängigkeit der beiden Körperhälften von einander sieht man, wenn man es nur von einer Seite beleuchtet oder erwärmt; dann verändert sich diese, nicht aber die andere mit; und wenn das Tier geschlafen hat und gereizt wird, kann es wirklich geschehen, daß es auf der einen Seite erwacht, auf der andern Seite aber schlafend bleibt. Anderweitige Reize, beispielsweise Bespritzen mit Wasser, bewirken eine Veränderung der Färbung, insbesondere dann, wenn den Tieren längere Zeit Wasser gefehlt hatte. Aus alledem geht hervor, daß die Farbenveränderung vom Einflüsse der Nerven abhängig ist und erst infolge einer Reizung der letzteren entsteht.
Mit seinesgleichen verträgt sich das Chamäleon nicht besser als die meisten übrigen Kriechtiere. Ist seine Gleichgültigkeit gegen alles, was nicht Beute heißt, erst einmal einer gewissen Erregung gewichen, so geschieht es gar nicht selten, daß zwei sich gegenseitig erbosen, wütend übereinander herfallen und sich mit dem immerhin kräftigen Gebisse zu verletzen suchen. Unter mehreren, auf einen kleineren Raum beschränkten Chamäleons fehlt es selten an Gelegenheit zu Streit und Kampf. Ein bequemer Sitzplatz kann den Neid oder doch den Ärger eines minder bevorzugten Genossen erregen und drohende Gebärden und wirkliche Angriffe veranlassen; viel ernster jedoch gestaltet sich die Sache, wenn der Paarungstrieb erwacht. Jetzt bekunden sie nicht allein Erregungen der Eifersucht, sondern machen sich wirklich die Weibchen streitig, fallen wütend übereinander her, und beißen sich gegenseitig so heftig, als sie vermögen. Mit andern Klassenverwandten leben sie im tiefsten Frieden, richtiger vielleicht in gar keinem Verhältnisse, weil sie sich bloß um diejenigen Tiere kümmern, die ihnen verderblich werden oder zur Nahrung dienen können. Wenn ihnen ein Feind oder auch ein harmloser Vogel naht, pflegen sie sich zuerst aufzublasen, so daß ihr Leib im Querdurchschnitt fast kreisrund wird, und dann fauchend zu zischen. Ergreift man sie mit der Hand, so packen sie wohl auch zu und quetschen mit ihrem Gebisse die Haut ein wenig, immer aber viel zu schwach, als daß sie irgendeine Verletzung hervorrufen könnten. Dabei spielt ihre Haut selbstverständlich in sehr verschiedenen Färbungen, und die Gestalt wird durch das Aufblasen eine ganz andere: alle Rippen treten hervor, und das Tier gewinnt im buchstäblichen Sinne des Wortes eine gewisse Durchsichtigkeit, die so weit gehen kann, daß man imstande ist, Zweige oder die Sprossen eines Käfigs als dunkle Streifen durch den Leib hindurch wahrzunehmen.
Wie die meisten Kriechtiere vermag das Chamäleon wochen-, vielleicht monatelang ohne Schaden zu hungern, nicht aber auch ebensolang zu dursten. Ich erhielt einmal im Sommer von Alexandrien aus eine zahlreiche Gesellschaft dieser Tiere, die nur vierzehn Tage unterwegs gewesen waren. Über ein Drittel der vorher hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes geprüften und als vollkommen kräftig befundenen Chamäleons lagen tot am Boden des entsprechend eingerichteten Versandkäfigs, andere ließen sich widerstandslos angreifen, und alle trugen ein und dasselbe Kleid: ihre Haut zeigte ein gleichmäßiges, grauliches Strohgelb, ohne deutliche Abzeichnungen, ohne Lebhaftigkeit der Färbung. Meine Voraussetzung, daß die gestorbenen Tiere verhungert, die schwachen dem Verhungern nahe, die übrigen mindestens sehr hungrig seien, bestätigte sich nicht. Wohl richteten sich fast aller Augen nach der mit krabbelndem Gewürm, Mehlwürmern und Raupen beschickten Tafel sowie nach herbeigelockten Fliegen: aber kein einziger meiner Pfleglinge fraß, kein einziger versuchte auch nur, Beute zu gewinnen. Versuchsweise ließ ich jetzt einen künstlich erzeugten Sprühregen auf sie herniederrieseln. Zauberischer, belebender, als diese Labung sich erwies, wirkt nicht das erste Gewitter nach langer Dürre, erquickender nicht der erste Trunk, der dem verdurstenden Menschen wird. Jeder Tropfen, der auf die lederfarbene Haut fiel, gab ihr an der befeuchteten Stelle ihre Frische wieder, und wie Nebelgewölk vor der Sonne zerflockt, zerriß, verschwand das Kleid gezwungener Entbehrung, um dem Gewande der Üppigkeit zu weichen. Aber nicht bloß die verwelkte Haut erfrischte sich durch das belebende Naß: auch die Zunge leckte begierig die einzelnen Tropfen auf. Und als diese mehr und mehr abgefallen waren von den Blättern, faßten die verschmachteten Tiere letztere beiderseitig mit den harten Lippen, saugten förmlich an ihnen und suchten ein anderes Blatt, wenn das erstere abgeleckt und abgesaugt war. Endlich hatten sich alle an dem nach solchen Wahrnehmungen ihnen wiederholt gespendeten Trunke erlabt, und nunmehr erregten die krabbelnden Mehlwürmer, die honiglüsternen Fliegen gebührende Teilnahme. Aus den blätterdürren Leibern der Chamäleons waren wohlgerundete geworden, in die geknickten Beine Kraft und Strammheit, in die matten Augen Beweglichkeit gekommen: jetzt bewiesen die Chamäleons, daß sie nach längerem Fasten nicht allein begierig fressen, sondern auch hinsichtlich des Nahrungsverbrauchs geradezu erstaunliche Mahlzeiten halten können. Nach meinen bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen hatte ich sie für mäßige Geschöpfe gehalten; ich wußte, daß sie im Freien nur von kleinen und schwächlichen Kerbtieren, insbesondere Fliegen, Schmetterlingen, Käfern, Heuschrecken, Raupen, Spinnen, Asseln, vielleicht auch Würmern sich ernähren; ich vergegenwärtigte mir, daß sie geduldig abwarten müssen, bis irgendwelche Beute sich ihnen bietet; ich hatte endlich gelesen, daß sie niemals große Kerbtiere und immer nur eines von ihnen gleichzeitig ergreifen könnten: jetzt sollte ich fast von alledem das Gegenteil erfahren. An den Zweigen kletterten die Tiere auf und nieder; mit den Wickelschwänzen umschlangen sie sich gegenseitig, wenn es an Raum fehlte; um die besseren Plätze stritten sie sich mit drohenden Gebärden; alle Winkel der senk- und wagerechten Ebene durchspähten die von einander unabhängigen Augen. Dutzende solcher Augen zielten nach einer und derselben Beute; die von dem einen Zungenpfeile gefehlte Fliege fiel einem zweiten, dritten, zehnten gewißlich zum Opfer. Ziemlich große, mit Mehlwürmern gefüllte Schüsseln leerten sich im Umsehen; der Inhalt einer geräumigen Schachtel, den ein raupender Gärtner gespendet, war nach vierundzwanzig Stunden in den Magen meiner vierzig Chamäleons geborgen, und noch immer schauten sich die rollenden Augen nach fernerer Beute um: meine Gefangenen erschienen mir gefräßiger als irgendein anderes mir bekanntes Kriechtier.
Wie das Chamäleon eigentlich verfährt, um sich einer Beute zu versichern, habe ich mit Sicherheit nicht erkunden können. Es sieht aus, als leime es das ins Auge gefaßte Kerbtier an den Kolben der blitzschnell hervorschießenden und ebenso rasch wieder verschwindenden Zunge an; es will aber auch wiederum scheinen, als ob es den Kolben wie eine Greifzange zu verwenden wisse. So viel habe ich unzählige Male gesehen, daß ein von dem Zungenkolben getroffenes Kerbtier fast ausnahmslos verloren ist. Nach dem mit Mehlwürmern angefüllten Freßnäpfchen eröffneten meine Chamäleons ein wahres Kreuzfeuer von Schüssen, und niemals zog sich eine Zunge ohne Beute zurück; ja, sehr oft hingen zwei oder drei Mehlwürmer an dem Zungenkolben, ohne daß einer von ihnen beim Einziehen abgestreift worden wäre. Die Sicherheit der Schnellschüsse erregte aller Verwunderung.
Ältere Forscher haben angegeben, daß die Chamäleons lebendige Junge zur Welt bringen sollen; meine und anderer Beobachtungen beweisen das Gegenteil. Das Eierlegen ist wiederholt beobachtet worden, wenn auch, soviel mir bekannt, nur an gefangenen Tieren. »An einem meiner Chamäleons«, erzählt Vallisnieri, »bemerkte ich eines Tages, daß es sehr unruhig wurde und endlich von dem Gezweige, mit dem sein Käfig ausgeschmückt worden war, langsam mit aller ihm angeborenen Faulheit zum Boden herabstieg, hier unstet umherlief, endlich in einem Winkel des Käfigs, in dem weder Sand noch Staub, sondern nur harte Erde lag, sich festsetzte und mit einem Vorderfuße zu scharren begann. Das harte Erdreich setzte ihm so vielen Widerstand entgegen, daß es zwei Tage nacheinander ununterbrochen arbeiten mußte, um das zuerst gebildete Loch in eine Grube von zehn Zentimeter Durchmesser und fünfzehn Zentimeter Tiefe zu erweitern. In diese Grube kletterte es hinab und legte nun seine Eier, mehr als dreißig, wie ich mich überzeugen konnte. Nachdem dieses Geschäft, und zwar mit größter Sorgfalt ausgeführt worden war, scharrte es die Grube mit einem Hinterfuße wieder zu, genau so, wie Katzen tun, wenn sie ihren Kot bedecken wollen. Aber damit noch nicht zufrieden, brachte es noch trockene Blätter, Stroh und dürres Reisig herbei und bildete aus ihnen eine Art von Decke über dem entstandenen Hügel.« Die Eier der Chamäleons sind rundlich und gleichmäßig weißlich; ihre Schale ist kalkig, aber sehr porös. Wie lange ihre Entwicklung währt, ist zurzeit noch unbekannt.
»Ein gesehenes Chamäleon ist ein verlornes Chamäleon«, so behauptet ein welsches Sprichwort, und mit vollstem Rechte; denn die trotz aller Veränderung wenig auffallende Farbe ist sein bester Schutz gegen das zahllose Heer von Feinden, das ihm nachstellt. Nicht bloß alle kleinen, vierfüßigen Raubtiere und die meisten Raubvögel, sondern auch Raben und Hornvögel, Reiher, Störche und endlich die größeren Schlangen, vielleicht selbst Warane und andere Kriechtiere müssen als Feinde der harmlosen Geschöpfe bezeichnet werden. Der Mensch widmet ihnen überall eine größere Aufmerksamkeit, als ihnen gut ist. Nirgends wohl hält man sie für giftig oder gefährlich, und überall fällt die absonderliche Gestalt so ins Auge, daß man sich bemüht, des Tieres habhaft zu werden. Der Fang geschieht gewöhnlich in rohester Weise. Man reißt die Chamäleons, die man ergreifen kann, gewaltsam von den Zweigen ab oder versucht, die, die zu hoch sitzen, mit Steinwürfen zu Boden zu schleudern. Erst, wenn man den Leuten die größte Sorgfalt anempfiehlt, erhält man unverletzte Stücke; die Mehrzahl der erbeuteten geht infolge der erlittenen Mißhandlungen nach wenigen Tagen, spätestens nach wenigen Wochen zugrunde.
Anfänglich zeigen sich die Gefangenen sehr reizbar, fauchen und blasen, wenn man sich ihnen nähert, versuchen selbst zu beißen, wollen mit einem Worte von dem Pfleger nichts wissen; bald aber ändert sich ihr Benehmen, sie haben sich an den Menschen gewöhnt und lassen sich nun sehr viel gefallen. Bei zweckmäßiger Behandlung halten sie sich monatelang in der Gefangenschaft. Vor allem andern verlangen sie gleichmäßige Wärme. Der Anfang der späteren Herbsttage ist für sie Beginn des Mißbehagens. Sie hören auf zu fressen, welken und sterben dahin. Am besten halten sie sich in Gewächshäusern, deren gleichmäßige Wärme ihnen selbst eine längere Fastenzeit überstehen hilft. An genügender Nahrung darf es ihnen niemals fehlen: sie verlangen, wie aus vorstehendem ersichtlich geworden sein dürfte, eine erhebliche Menge von Fliegen, Mehlwürmern, Spinnen, Heuschrecken und dergleichen. Niemals gehen sie ein totes Kerbtier an, auch wenn es noch so lecker aussehen sollte: was sie verschlingen sollen, muß lebendig sein.
*
Über wenige Kriechtiere ist soviel gefabelt worden, als über die Haftzeher oder Gekos, eigentümlich gestaltete, nächtlich lebende Schuppenechsen, die in allen Erdteilen gefunden werden. Sie waren es, die die Alten mit dem Namen »Stellio« bezeichneten, und zwar, wie Ovid uns mitteilt, wegen der kleinen, sternförmigen Flecken auf dem Rücken. Aristoteles berichtet, daß der Stellio sich in Fenstern, Kammern und Gräbern aufhalte, an den Wänden umherklettere, oft auf den Tisch herab und ins Essen falle, in den Krippen schlafe, den Eseln in die Nase krieche und sie am Fressen verhindere, durch seinen Biß vergifte, während der vier kalten Monate des Jahres verborgen liege und nichts fresse, im Früh- und Spätjahre aber sich häute und dann die Haut aufzehre. Plinius versichert, daß der Geko ein sehr gefährliches Mittel liefere, indem er, im Weine ertränkt oder in Salbe getötet, bei denen, die Wein oder Salbe benutzten, Sommerflecken hervorbringe. »Manche reichen derartige Salbe hübschen Mädchen in der böswilligen Absicht, deren Schönheit zu verderben.« Glücklicherweise gibt es ein Gegenmittel: Eidotter, Honig und Laugensalz, das die schädliche Wirkung wieder aufhebt. Nach Ansicht desselben Naturforschers ist der Biß des Geko in Griechenland tödlich, in Silizien dagegen ungefährlich.
Ähnliche Schauergeschichten kann man in allen Teilen Amerikas, in Afrika, Indien und selbst in Südeuropa vernehmen. »Wenn ein Geko«, so erzählten Indianer und Farbige den Gebrüdern Schomburgk, »von der Decke oder den Balken des Daches auf die bloße Haut eines Menschen fällt, so lösen sich die Zehenscheiben, die das Gift enthalten, und dringen in das Fleisch ein, wodurch eine Geschwulst hervorgerufen wird, die schnellen Tod im Gefolge hat.« Daher scheuen denn auch jene Leute die Haftzeher ebenso wie die giftigsten Schlangen. In Südeuropa schwört jedermann auf deren Giftigkeit. Kurz, das Mißtrauen, der Abscheu gegen die Haftzeher sind allgemein – und doch gänzlich ungerechtfertigt! Wir werden sehen, daß unsere Tiere vollkommen unschädliche und harmlose Schuppenechsen sind und einzig und allein infolge ihres unschönen Äußeren und ihrer nächtlichen Lebensweise unter so bösem Leumund leiden müssen.
Die Haftzeher ( Gekotidae) sind kleine, plump gebaute, plattgedrückte und düsterfarbige Schuppenechsen. Ihr Kopf hat eine längliche, unter der Stirne etwas vertiefte, erweiterte, runde, abgeflachte, hechtartige, tiefgespaltene Schnauze und etwas höchst Auffallendes wegen der großen Nachtaugen, deren Stern im Lichte bis auf eine linienförmige, senkrechte Spalte sich zusammenzieht, und deren Lider zwischen dem Augapfel und den Augenhöhlenrändern eingerollt sind. Wirkliche Lider kommen nur bei einzelnen Sippen vor; bei den übrigen Gruppen und Arten zieht sich die durchsichtige Haut über das Auge hinweg und bildet eine kreisförmige, lidartige Falte. Die Ohröffnung erscheint als senkrechte Ritze. Der Hals ist sehr kurz und dick, der Rumpf gedrungen, rundlich, aber von oben nach unten plattgedrückt, bisweilen seitlich befranst, der sehr gebrechliche Schwanz mittellang, dick, an der Wurzel rundlich oder ebenfalls plattgedrückt, zuweilen auch seitlich mit Haut besetzt; die Beine zeichnen sich aus durch ihre Kürze, die Zehen durch eine ganz absonderliche Bildung, die als das Hauptmerkmal angesehen werden muß. Bei allen Arten dieser Abteilung sind sie verhältnismäßig kurz, in der Länge unter sich auch wenig verschieden, regelmäßig durch eine mehr oder minder weit ausgedehnte Bindehaut vereinigt und auf der Unterseite mit Blattkissen bedeckt, Verbreiterungen, welche querliegende, häutige Blättchen verschiedener Größe, Gestalt und Stellung zeigen und die Tiere befähigen, an sehr glatten Flächen, gleichviel in welcher Stellung, umherzulaufen. Bei einzelnen erweitert sich die ganze Unterfläche der Zehen; bei andern nimmt die Blattscheibe nur einen Teil derselben ein; bei diesen ist sie in der Mitte geteilt; bei jenen ungeteilt; bei manchen tragen bloß die Endglieder der Zehen erweiterte Scheiben, bei manchen wiederum werden die Blattscheiben durch runde Warzen ersetzt; bei andern endlich sind die Zehen ebenso gestaltet, aber noch eingeknickt usw.: kurz, die Gestalt der Zehen ist höchst mannigfaltig und gibt dem ordnenden Tierkundigen ein Mittel an die Hand, einzelne Sippen oder Unterfamilien zu bestimmen und abzugrenzen. Bei den meisten Arten sind scharfe, spitzige, bewegliche, gewöhnlich auch zurückziehbare Krallen vorhanden; diese können aber auch an einzelnen, zuweilen an allen Zehen fehlen. Die äußere Bekleidung besteht aus sehr kleinen, miteinander fest verbundenen Schuppen, zwischen denen größere sich einfügen. Das Gebiß zeichnet sich aus durch die große Anzahl, nicht aber durch Mannigfaltigkeit der Zähne.
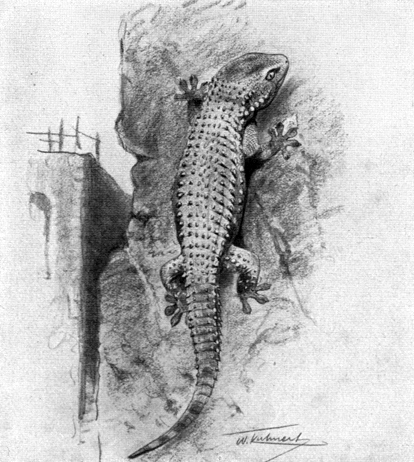
Mauergeko ( Platydactylus fascicularis)
Zur Sippe der Breitzeher ( Platydactylus) zählt der Mauergeko ( Platydactylus fascicularis), ein kleines Tierchen von nur 12 bis 15 Zentimeter Länge, wovon der Schwanz die Hälfte wegnimmt, und hellerer oder dunklerer, von Lichtgelblichgrau durch Grau, Braun- und Schwarzbraun bis zu Mattschwarz abändernder, bald gebändelter, bald mehr oder minder einfarbiger und dann wie mit Puderstaub überdeckter Ober- und schmutziggelber Unterseite. Der Kopf ist sehr rauh, der Rücken mit Warzen bedeckt, die aus je drei bis vier kleinen, dicht aneinanderstehenden Körnchen zusammengesetzt werden, die Bauchseite dagegen schuppig und glatt. Der Verbreitungskreis erstreckt sich über alle Länder rund um das Mittelländische Meer; besonders häufig ist das Tier in Spanien, Griechenland, Dalmatien und Nordafrika.
Zu den Fältlern ( Ptychozoon) gehört der Faltengeko ( Ptychozoon homalocephalum), eines der absonderlichsten Glieder der Familie. Er ist ungefähr 18 oder 20 Zentimeter lang und auf der Oberseite auf gelbgrünlich ölfarbenem, nach den Seiten hin in Rotbraun übergehendem Grunde mit figurenartigen oder im Zickzack verlaufenden Querbändern von brauner, dunkelbrauner oder schwarzer Färbung gezeichnet, die faltige Wangenhaut licht fleischfarben, dunkelblau getüpfelt, das Armgelenk durch einen weißlichen Ring geschmückt, die Unterseite graugelb, der Augenring goldgelb. Außer Java, woselbst der Faltengeko besonders häufig auftritt, kommt er noch auf einigen kleinen benachbarten Inseln vor.
Die Sippe der Halbzeher ( Hemidactylus) vertritt im Süden Europas der Scheibenfinger ( Hemidactylus turcica), ein kleiner, nur 10 Zentimeter langer Geko, der sich durch seine undeutlich dreieckigen, in Reihen geordneten Schuppen, die körnigen Querbänder und das graulichbraun gefleckte Fleischrot der Oberseite von seinen übrigen europäischen Verwandten unterscheidet. Er lebt in denselben Ländern wie der Mauergeko.
Die sehr formenreiche Familie der Gekos verbreitet sich über alle warmen Länder der Erde und bevölkert nicht allein die Festlande, sondern ebenso innerhalb des von ihr bewohnten Gürtels gelegene Eilande, selbst solche, die einsam in großen Weltmeeren liegen und keinerlei nachweislichen Zusammenhang mit anderen Erdfesten haben. Ebenso allverbreitet zeigen sich die Haftzeher innerhalb größerer Landmassen. Sie hausen im Tieflande wie im Gebirge, im Walde wie in der waldlosen Einöde, inmitten großer und volkreicher Städte wie in dem Gewölbe des einsamen Brunnens an der Wüstenstraße.
Alle Gekos haben ungefähr denselben Aufenthalt und führen mehr oder weniger dieselbe Lebensweise. Sie bewohnen Felswände und Bäume, Steingeröll, Gemäuer und sehr gern die menschlichen Behausungen, vom Keller an bis zum Dache hinauf. Einzelne Arten scheinen nur auf Bäumen Herberge zu nehmen, andere ebensowohl hier als auch an Mauern und in Häusern sich aufzuhalten. Wo sie vorkommen, treten sie in der Regel sehr häufig auf, und sie verstehen es auch, die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zu ziehen: sind sie doch die einzigen Schuppenechsen, die wirkliche Kehlkopflaute ausstoßen können oder, was dasselbe, eine Stimme besitzen.
Übertags machen sich die Gekos wenig bemerklich; denn sie sind Nachttiere und suchen meist schon bei Sonnenaufgang einen sie möglichst bergenden Versteckplatz auf, verkriechen sich unter Steine oder losgelöste Baumrinde, in Spalten und Ritzen und bleiben nur dann an einer Wand oder einem Baumstamme kleben, wenn die Färbung der Umgebung ihrer eigenen gleicht oder ähnelt, beziehentlich, wenn sie erfahrungsmäßig von der Gutmütigkeit der Hausbewohner, in deren Räumen sie Herberge genommen, sich überzeugt haben. Doch sieht man auch sie ebenso behaglich wie andere Kriechtiere im Strahle der Mittagssonne sich wärmen und an solchen Mauern, die nur zeitweilig beschienen werden, mit den fortschreitenden Schatten weiter bewegen. In Gegenden, wo man sie nicht stört, bemerkt man Hunderte an einer und derselben Mauer, Dutzende an einem und demselben Baume, weil sie, wenn auch nicht gerade in Frieden zusammenleben, doch die Geselligkeit lieben oder nach und nach die passendsten Wohnorte innerhalb eines Gebietes herausfinden und sich hier zu größeren Scharen ansammeln. Mit Einbruch der Nacht werden sie munter und beginnen ihre Jagd auf Geziefer verschiedener Art, namentlich auf Fliegen, Mücken, Spinnen, Käfer, Räupchen und dergleichen, deren sie sich mit überraschender Sicherheit zu bemächtigen wissen. Die größeren Arten jagen, laut Eduard von Martens, auch wohl auf kleinere Arten ihres eigenen Geschlechtes; alle überhaupt sind ebenso gefräßig wie irgendeine andere Echse. Den Anfang ihrer Tätigkeit zeigen sie gewöhnlich durch ein lautes oder doch wohl vernehmliches, kurzes Geschrei an, das durch die Silben »Gek« oder »Toke« ungefähr wiedergegeben werden kann, gelegentlich auch in höhere oder tiefere Laute übergeht.
Ihr Treiben währt die ganze Nacht hindurch und hat in der Tat etwas höchst Auffälliges. Kein Wunder, daß es den Neuling befremdet, zu sehen, wie der Geko, ein eidechsenähnliches Tier, mit wunderbarer Gewandtheit und unfehlbarer Sicherheit an senkrechten, glatten Wänden emporklettert, plötzlich diese verläßt und nunmehr an der Decke umherläuft, als wäre sie der Fußboden, wie er minutenlang an einer und derselben Stelle klebt und dann wieder hastig fortschießt, den dicken Schwanz anscheinend unbehilflich hin- und herschleudert und sich selbst durch schlängelnde Bewegungen forthilft, wie er alles beobachtet, was ringsum vorgeht, und mit den großen, jetzt leuchtenden Augen umherschaut, in der Absicht, irgendeine Beute zu erspähen; kein Wunder, daß das unscheinbare Tier, das der Reisende überall verleumden hört, anfänglich nicht gefallen will, ja selbst mit Ekel erfüllen kann: einen widerwärtigen Eindruck aber rufen die Gekos nur bei dem hervor, der sich nicht die Mühe gibt, ihr Treiben zu beachten. Ich habe wochen- und monatelang in Häusern gewohnt, in denen Gekos massenhaft sich aufhielten, und auch ich bin durch die ersten Stücke, die ich sah, in Verwunderung gesetzt worden: ich habe aber die eigentümlichen und harmlosen Geschöpfe sehr bald gern gesehen und manche Stunde durch sie mir verkürzen lassen. Haustiere sind sie im vollsten Sinne des Wortes, treuere noch als die Mäuse und jedenfalls nützlichere. Bei Tage haben ihre Bewegungen allerdings etwas Täppisches, namentlich dann, wenn man sie bedroht und sie so eilig als möglich ihrem Schlupfwinkel zuflüchten, und ebenso nimmt es nicht gerade für sie ein, wenn man sieht, daß sie in der Angst sich plötzlich, wie dies manche Käfer tun, zu Boden herabstürzen lassen und dabei gewöhnlich den Schwanz verlieren: wenn aber ihre Zeit gekommen, das heißt die Dunkelheit eingetreten ist, dann müssen sie, meine ich, jeden Beobachter und Forscher, wenn auch nicht entzücken, so doch fesseln. Uns verursachten sie stets großes Vergnügen, wenn wir nachts in unserm Wohnhause zu Kairo, Dongola, Khartum oder sonstwo in Nordafrika, in dem dunklen Lehmgebäude ebensowohl wie in der aus Stroh errichteten Hütte, den ersten Ruf der Gekos hörten und dann ihr wirklich geisterhaftes Treiben belauschen, ihrer mit größtem Eifer betriebenen Jagd zusehen, sie überhaupt bei allen ihren Handlungen verfolgen konnten.
Die Bewegungen der Gekos sind zwar sehr unstet, aber doch ungemein hurtig und überraschend gewandt. Sie drücken ihren Leib dicht an den Boden, auf dem sie sich bewegen, umfassen beim Beklettern senkrechter Wände eine weite Fläche, spreizen die Beine und ebenso die Zehen, stützen sich außerdem noch durch den Schwanz und bewegen sich so mit größerer Sicherheit als jede andere kletternde Echse. Sie sind während der Nacht ebenso unruhige, lebhafte und erregbare Geschöpfe wie die Eidechsen, stehen diesen überhaupt an Begabungen nicht nach, so verschiedenartig beider Anlagen auch sein mögen. So sind, um ein Beispiel zu geben, ihr Mut, ihre Rauf- und Kampflust ebenso groß wie bei den Eidechsen. Größere Gesellschaften leben meist in Unfrieden, jagen und verfolgen sich, beginnen Streit miteinander und gebrauchen ihr Gebiß mit Kraft und Nachdruck.
Unzählige Male habe ich Gekos gefangen, sie in der Hand gehabt und sie und ihre Blätterscheiben betrachtet, niemals aber auch nur den geringsten Nachteil von der Berührung und Handhabung der als so giftig verschrienen Geschöpfe verspürt, einen solchen aber auch nicht verspüren können, da eine »klebrige Feuchtigkeit« gar nicht vorhanden ist. Schon Home, der die Zehenblätter wirklich untersuchte, spricht sich dahin aus, daß der Geko einen luftleeren Raum hervorbringt und dadurch sich festhält, und – Home hat vollständig recht. Berührung der Blätterscheiben verursacht allerdings das Gefühl der Klebrigkeit; einen leimartigen Stoff aber, der vergiften könnte, hat sicherlich noch kein Forscher, der untersuchte, wahrgenommen. Und keiner von denen, die von diesem Leime gesprochen, hat bedacht, daß der Geko seine Füße bald gar nicht mehr würde gebrauchen können, wäre ein solcher Leim vorhanden, weil sich vermittels desselben eher Schmutz und Staub an die Blätterscheiben, als diese selbst an die Wand heften würden. Das Tier klebt nur infolge des Luftdrucks an dem Gegenstande, den es beklettert.
Um andere Kriechtiere oder Wirbeltiere überhaupt bekümmert sich der Geko nur insofern, als er in jedem stärkeren Geschöpfe einen Feind vermutet. In Südeuropa hält es ziemlich schwer, Haftzeher zu beobachten, wahrscheinlich deshalb, weil sie hier fast überall unnützerweise verfolgt und geschreckt werden; in Afrika hingegen bekunden sie oft wirkliche Menschenfreundlichkeit, d. h. zutunliches und vertrauenseliges Wesen, das sehr für sie einnimmt. Aber ebenso, wie sie es merken, wenn ihnen nachgestellt wird, ebenso lassen sie sich auch an andere Tiere und selbst an den Menschen gewöhnen und bis zu einem gewissen Grade zähmen. »In dem Zimmer, in dem die Frauen meiner Familie ihre Abende zubrachten«, erzählt Tennent, »hatte sich eines dieser zahmen und unterhaltenden kleinen Geschöpfe hinter den Bilderrahmen eingerichtet. Sobald die Lichter angezündet wurden, erschien der Geko an der Mauer, um die gewohnten Nahrungsbrocken in Empfang zu nehmen; wenn er aber vernachlässigt wurde, verfehlte er nie, durch ein scharfes, helles ›Tschick, tschick, tschick‹ die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.« Solche Beobachtungen, die jeder anstellen könnte, sollten, so möchte man meinen, überall für die harmlosen Tiere einnehmen, – statt dessen verfolgt und tötet man ihn nutzloserweise. »An dem Geko«, sagt Lucian Bonaparte mit vollstem Recht, »sieht man ein deutliches Beispiel von der Undankbarkeit der Welt. Dieses Tierchen hat kein anderes Bestreben, als die Orte, die es mit uns teilt, von Spinnen, Mücken und andern lästigen Kerbtieren zu reinigen; und für diese Wohltat bekommt es keinen andern Lohn als Verleumdung und Verfolgung!« Leider hält es sehr schwer, Gekos in enger Gefangenschaft zu halten, noch schwerer, sie, zumal bei uns zulande, zu überwintern. Sie sind äußerst hinfällig.