
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ziegen und Schafe bekunden eine so innige Verwandtschaft unter sich, daß es kaum möglich erscheint, für beide Gruppen durchgreifende Unterscheidungsmerkmale aufzustellen. Wir vereinigen beide in einer besonderen Unterfamilie und belegen diese zu Ehren der klügsten und gewecktesten Mitglieder mit dem Namen Geißen ( Caprina), haben dabei jedoch festzuhalten, daß gedachte Unterfamilie ebensogut als die der Schafe ( Ovina) bezeichnet werden darf und von verschiedenen Tierkundigen tatsächlich so benannt wird.
Alle hierher gehörigen Arten erreichen nur eine mittlere Wiederkäuergröße, sind kräftig, zum Teil sogar plump gebaut, haben einen kurzen Hals und meist auch gedrungenen Kopf, niedere und stämmige Beine mit verhältnismäßig stumpfen Hufen und kurzen, abgerundeten Afterklauen, runden oder breiten und dann mehr oder weniger dreieckigen, unten nackten Schwanz, kurze oder doch nur mittellange Ohren, ziemlich große Augen, mehr oder weniger zusammengedrückte und nicht selten schraubenartig gedrehte, regelmäßig runzelige und oft stark wulstige Hörner, die beiden Geschlechtern zukommen, bei den Weibchen jedoch beträchtlich kleiner sind als bei den Männchen, und ein sehr dichtes, aus langem Grannen- und reichlich wucherndem Wollhaar bestehendes, düsterfarbiges Kleid. Das Euter der Weibchen hat zwei Zitzen.
Der stämmige und kräftige Leib der Ziegen ( Capra), denen wir unbedenklich die höhere Stellung innerhalb ihrer Unterfamilie einräumen, ruht auf starken, nicht sehr hohen Beinen; der Hals ist gedrungen, der Kopf verhältnismäßig kurz und breit an der Stirn; der Schwanz, der aufrecht getragen zu werden pflegt, wie oben beschrieben, dreieckig und unten nackt. Die Augen sind groß und lebhaft, Tränengruben nicht vorhanden, die Ohren aufgerichtet, schmal zugespitzt und sehr beweglich. Die abgerundet vierseitigen oder zweischneidigen, deutlich nach den Jahreszuwüchsen gegliederten, vorn wulstig verdickten Hörner, die beiden Geschlechtern zukommen, wenden sich entweder in einfach halbmondförmiger Richtung nach hinten oder biegen sich dann noch leierartig an der Spitze aus. Bei den Böcken sind sie regelmäßig viel schwerer als bei den Ziegen. Das Haarkleid ist ein doppeltes, da die feinere Wolle von groben Grannen überdeckt wird. Bei manchen Arten liegen die Grannen ziemlich dicht an, bei andern verlängern sie sich mähnenartig an gewissen Stellen, bei den meisten auch am Kinn zu einem steifen Bart. Immer ist die Färbung des Pelzes düster, erd- oder felsenfarbig, vorzugsweise braun oder grau. Erwähnenswert, weil zur Kennzeichnung der Tiere gehörend, ist schließlich noch der durchdringende Geruch, bezeichnend Bockgestank genannt, womit alle Ziegen jederzeit, während der Brunstzeit aber in besonderer Stärke, unsere Nasen beleidigen.
Ursprünglich bewohnten die Ziegen Mittel- und Südasien, Europa, Nordafrika; heutzutage haben wir die gezähmten über die ganze Erde verbreitet. Sie sind durchgehends Bewohner der Gebirge, zumal der Hochgebirge, wo sie einsame, menschenleere Stellen aufsuchen. Die meisten Arten gehen bis über die Grenze des ewigen Schnees hinauf. Sonnige Stellen mit trockener Weide, dünn bestandene Wälder, Halden und Geröllabstürze, sowie auch kahle Klippen und Felsen, die starr aus dem ewigen Schnee und Eis emporragen, sind ihre Standorte. Alle Arten lieben die Geselligkeit. Sie sind bewegliche, lebendige, unruhige, kluge und neckische Tiere. Ohne Unterlaß lausen und springen sie umher; nur während des Wiederkäuens liegen sie ruhig an einer und derselben Stelle. Sie sind überaus geschickt im Klettern und Springen. Sicheren Tritts überschreiten sie die gefährlichsten Stellen im Gebirge, schwindelfrei stehen sie auf den schmälsten Kanten, gleichgültig schauen sie in die furchtbarsten Abgründe hinab, unbesorgt, ja förmlich tollkühn, äsen sie an fast senkrecht abfallenden Wänden. Sie besitzen eine verhältnismäßig ungeheure Kraft und eine wunderbare Ausdauer und sind somit ganz geeignet, ein armes Gebiet zu bewohnen, in dem jedes Blättchen, jedes Hälmchen unter Kämpfen und Ringen erworben werden muß. Neckisch und spiellustig unter sich, zeigen sie sich vorsichtig und scheu andern Geschöpfen gegenüber und fliehen gewöhnlich bei dem geringsten Lärm, obwohl man nicht eben behaupten darf, daß es die Furcht ist, die sie in die Flucht schreckt, denn im Notfall kämpfen sie mutig und tapfer und mit einer gewissen Rauflust, die ihnen sehr gut ansteht.
Man darf wohl sagen, daß alle Ziegen vorwiegend nützliche Tiere sind. Der Schaden, den sie anrichten, ist so gering, daß er kaum in Betracht kommt, der Nutzen dagegen sehr bedeutend, namentlich in solchen Gegenden, wo man die Tiere gebraucht, um Örtlichkeiten auszunutzen, deren Schätze sonst ganz verloren gehen würden. Die öden Gebirge des Südens unseres Erdteils sind förmlich bedeckt mit Ziegenherden, die auch an solchen Wänden das Gras abweiden, wo keines Menschen Fuß Halt gewinnen könnte. Von den wilden Arten kann man fast alles benutzen, Fleisch und Fell, Horn und Haar, und die zahmen Ziegen sind nicht bloß der Armen liebster Freund, sondern im Süden auch die beinahe ausschließlichen Milcherzeuger.
Die Unterscheidung der Wildziegen ist außerordentlich schwer, weil die Arten sich sehr ähneln und der Beobachtung ihres Lebens viele Hindernisse entgegentreten. Soviel scheint festzustehen, daß der Verbreitungskreis der einzelnen ein verhältnismäßig beschränkter ist und daß somit fast jedes größere Gebirge, das Mitglieder unserer Familie beherbergt, auch seine eigenen Arten besitzt.
*
Die Steinböcke ( Capra) bewohnen die Gebirge der Alten Welt und auf ihnen Höhen, woselbst andere große Säugetiere verkümmern würden. Mit dieser Lebensweise geht Hand in Hand, daß jede Steinbockart nur eine geringe Verbreitung hat. Infolgedessen haben wir in den Steinböcken ein reiches Geschlecht vor uns. Europa allein zählt zwei, vielleicht drei verschiedene Steinbockarten. Eine derselben ( Capra ibex) bewohnt die Alpen, eine ( Capra pyrenaica) die Pyrenäen und andere spanische Gebirge, eine dritte ( Capra caucasica) den Kaukasus. Außerdem findet sich ein Steinbock ( Capra sibirica) in Sibirien, einer ( Capra beden) im Steinigen Arabien, ein dritter ( Capra nubiana) in Abessinien, ein vierter ( Capra skyn) auf dem Himalaja. Alle diese Tiere sind einander sehr ähnlich in Gestalt und Färbung und unterscheiden sich hauptsächlich durch das Gehörn und den Bart am Kinn. Zurzeit besitzen wir noch keineswegs Stoff genug, um über die Frage, ob hier überall Artverschiedenheiten zugrunde liegen oder nicht, mit der notwendigen Sicherheit entscheiden zu können.

Alpensteinbock ( Capra ibex)
Unter allen Steinböcken geht uns selbstverständlich diejenige Art am nächsten an, die unsere Alpen bewohnt. Der Alpensteinbock Capra ibex) ist ein stolzes, ansehnliches und stattliches Geschöpf von 1,5 bis 1,6 Meter Leibeslänge, 80 bis 85 Zentimeter Höhe und 75 bis 100 Kilogramm Gewicht. Das Tier macht den Eindruck der Kraft und Ausdauer. Der Leib ist gedrungen, der Hals mittellang, der Kopf verhältnismäßig klein, aber stark an der Stirn gewölbt; die Beine sind kräftig und mittelhoch; das Gehörn, das beide Geschlechter tragen, erlangt bei dem alten Bock sehr bedeutende Größe und Stärke und krümmt sich einfach bogen- oder halbmondförmig schief nach rückwärts. An der Wurzel, wo die Hörner am dicksten sind, stehen sie einander sehr nahe; von hier entfernen sie sich, allmählich bis zur Spitze hin sich verdünnend, weiter voneinander. Ihr Durchschnitt bildet ein längliches, hinten nur wenig eingezogenes Viereck, das gegen die Spitze hin flacher wird. Die Wachstumsringe treten besonders auf der Vorderfläche in starken, erhabenen, wulstartigen Knoten oder Höckern hervor, verlaufen auch auf den Seitenflächen des Hornes, erheben sich hier jedoch nicht so weit als vorn. Gegen die Wurzel und die Spitze zu nehmen sie allmählich an Höhe ab; in der Mitte des Hornes sind sie am stärksten, und hier stehen sie auch am engsten zusammen. Die Hörner können eine Länge von 80 Zentimeter bis 1 Meter und ein Gewicht von 10 bis 15 Kilogramm erreichen. Das Gehörn des Weibchens ähnelt mehr dem einer weiblichen Hausziege als dem des männlichen Steinbockes. Die Hörner sind verhältnismäßig klein, fast drehrund, der Quere nach gerunzelt und einfach nach rückwärts gekrümmt. Ihre Länge beträgt selbst bei erwachsenen Tieren nicht mehr als 15 bis 18 Zentimeter. Schon im ersten Monate des Lebens sproßt bei dem jungen Steinbock das Gehörn hervor; bei einem etwa einjährigen Bock sind es noch kurze Stummel, die hart über der Wurzel die erste querlaufende, knorrige Leiste zeigen; an den Hörnern der zweijährigen Böcke zeigen sich bereits zwei bis drei wulstige Erhöhungen; dreijährige Böcke haben schon Hörner von 45 Zentimeter Länge und eine erhebliche Anzahl von Knoten, die nun mehr und mehr steigt und bei alten Tieren bis auf vierundzwanzig kommen kann. Einen sicheren Schluß auf das Alter des Tieres gewähren diese Knoten ebensowenig wie die wenig bemerklichen Wachstumsringe zwischen ihnen oder die flachen Erhebungen zu beiden Seiten des Hornes, aus deren Anzahl die Jäger die Jahre des Tieres bestimmen zu können vermeinen.

Junger Kaukasus-Steinbock ( Capra caucasica)
Die Behaarung ist rauh und dicht, verschieden nach der Jahreszeit, im Winter länger, gröber, krauser und matter, im Sommer kürzer, seiner, glänzender, während der rauhen Jahreszeit durchmengt mit einer dichten Grundwolle, die mit zunehmender Wärme ausfällt, und auf der Oberseite des Leibes pelziger, d. h. kürzer und dichter als unten. Außer am Hinterhalse und Nacken, wo die Haare mähnenartig sich erheben, verlängern sie sich bei dem alten Männchen auch am Hinterkopf, indem sie hier zugleich sich kräuseln und einen Wirbel herstellen, und ebenso am Unterkiefer, bilden hier jedoch höchstens ein kurzes Stutzbärtchen von nicht mehr als 5 Zentimeter Länge, das jüngeren Böcken, wie den Steinziegen, gänzlich fehlt. Im übrigen ist das Haar ziemlich gleich lang. Die Färbung ist nach Alter und Jahreszeit etwas verschieden. Im Sommer herrscht die rötlichgraue, im Winter die gelblichgraue oder fahle Färbung vor. Der Rücken ist wenig dunkler als die Unterseite; ein schwach abgesetzter, hellbrauner Streifen verläuft längs seiner Mitte. Mit zunehmendem Alter wird die Färbung gleichmäßiger. Das Haarkleid der Steingeiß entspricht im wesentlichen durchaus dem des Bockes, zeigt jedoch keinen Rückenstreifen und ist noch gleichartiger gefärbt.

Nubische Steinböcke ( Capra ibex nubiana)
Bereits vor Hunderten von Jahren waren die Steinböcke sehr zusammengeschmolzen, und wenn im vorigen Jahrhundert nicht besondere Anstalten getroffen worden wären, sie zu hegen, gäbe es vielleicht keinen einzigen mehr. Nach alten Berichten bewohnten sie in früheren Zeiten alle Hochalpen der Schweiz, in vorgeschichtlicher Zeit scheinen sie sich sogar auf den Voralpen aufgehalten zu haben. Während der Herrschaft der Römer müssen sie häufig gewesen sein; denn dieses prunkliebende Volk führte nicht selten ein- bis zweihundert lebendig gefangene Steinböcke zu den Kampfspielen nach Rom. Schon im fünfzehnten Jahrhundert waren sie in der Schweiz selten geworden. Im Kanton Glarus wurde 1550 das letzte Stück geschossen, in Graubünden konnte der Vogt von Kastel dem Erzherzog von Österreich im Jahre 1574 nur mit Mühe noch Böcke schaffen. In den Bergen des Bergell und Oberengadin zählten sie im sechzehnten Jahrhundert noch nicht zu den ungewöhnlichen Tieren. Im Jahre 1612 verbot man ihre Jagd bei fünfzig Kronen Geldbuße, schon einundzwanzig Jahre später bei körperlicher Strafe. Ende des achtzehnten Jahrhunderts traf man sie noch in den Gebirgen, die das Bagnetal umgeben, zu Anfang dieses Jahrhunderts noch in Wallis; seitdem hat man sie auf Schweizer Gebiet ausgerottet. Neuerdings hat man an verschiedenen, geeigneten Stellen den Steinbock in der Schweiz wieder eingebürgert und bereits sehr gute Zuchtresultate erzielt. Herausgeber. In Salzburg und Tirol sind sie, wie neuere Untersuchungen alter Urkunden glaublich erscheinen lassen, wahrscheinlich erst um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts eingebürgert worden, haben sich aber nur kurze Zeit dort gehalten.
Wie in den bisher erwähnten Teilen der Alpen nehmen sie auch auf den südlichen Zügen des Gebirges so jählings ab, daß schon im Jahre 1821 Zummstein bei der damaligen piemontesischen Regierung sich auf das wärmste für sie verwendete. In der Tat erwirkte er ein strenges Verbot, das edle Wild fernerhin zu jagen. Diesem Verbote haben wir es zu danken, daß der Steinbock noch nicht gänzlich ausgestorben ist und wenigstens auf einem, wenn auch sehr beschränkten Gebiete noch ständig vorkommt. Später hat dann vor allem König Victor Emanuel von Italien vom Antritt seiner Regierung an die größte Sorgfalt an den Tag gelegt, um der Ausrottung des edlen Wildes entgegenzutreten und seine Vermehrung zu fördern. Im Jahre 1858 haben nämlich die Gemeinden Cogne, Val Savaranche, Champorcher und Bomboset ihr Jagdrecht als ausschließliches Eigentum dem Könige überlassen, der nunmehr und nachdem er im Jahre 1863 auch die Gems- und Steinbockjagd von der Gemeinde Courmajeur im Val d'Aosta an der Gebirgskette des Montblanc von Col de Ferrex bis zum Col del la Seigne erworben hatte, einen Standort des Steinwildes schaffen und denselben allen Raubschützen ziemlich unzugänglich machen konnte.
Das Steinwild bildet Rudel von verschiedener Stärke, zu denen sich die alten Böcke jedoch nur während der Paarungszeit gesellen, wogegen sie in den übrigen Monaten des Jahres ein einsiedlerisches Leben führen. »Im Sommer«, so schreibt mir Graf Wilczek, »halten sie sich regelmäßig in den großartigsten und erhabensten, an furchtbaren Klüften und Abstürzen reichen, den Menschen also unzugänglichen Felsenwildnissen auf, und zwar meist die Schattenseite der Berge erwählend, wogegen sie im Winter tiefer ins Gebirge herabzusteigen pflegen.« Die Ziegen und Jungen leben zu allen Jahreszeiten in einem niedrigeren Gürtel als die Böcke, bei denen der Trieb nach der Höhe so ausgeprägt ist, daß sie nur Mangel an Nahrung und die größte Kälte zwingen kann, überhaupt in tiefere Gelände herabzusteigen. Stechende Hitze ist dem Alpensteinwilde weit mehr zuwider als eine bedeutende Kälte, gegen die es in hohem Grade unempfindlich zu sein scheint. Nach Berthoud von Berghem, dessen Angaben in die meisten Lebensbeschreibungen des Tieres übergegangen sind und noch heute Gültigkeit beanspruchen, nehmen alle über sechs Jahre alten Böcke die höchsten Plätze des Gebirges ein, sondern sich immer mehr ab und werden zuletzt gegen die strengste Kälte so unempfindlich, daß sie oft ganz oben, gegen den Sturm gewendet, wie Bildsäulen sich aufstellen und dabei nicht selten die Spitzen der Ohren erfrieren. Wie die Gemsen weiden auch die Steinböcke des Nachts in den höchsten Wäldern, im Sommer jedoch niemals weiter als eine Viertelstunde unter der Spitze einer freien Höhe. Mit Sonnenaufgang beginnen sie weidend aufwärts zu klettern und lagern sich endlich an den wärmsten und höchsten, nach Osten oder Süden gelegenen Plätzen; nachmittags steigen sie wieder weidend in die Tiefe herab, um womöglich in den Waldungen die Nacht zuzubringen. Wie Tuckott von einem Jagdaufseher des Königs Victor Emanuel erfuhr, sieht man Steinböcke am häufigsten vor sechs Uhr morgens und nach vier Uhr nachmittags; in der Zwischenzeit ruhen sie. Bei ihren Weidegängen halten sie nicht allein ihre Wechsel ein, sondern lagern sich auch regelmäßig auf bestimmten Stellen, am liebsten auf Felsenvorsprüngen, die ihnen den Rücken decken und freie Umschau gewähren. Erfahrene Jäger versichern, Steinböcke tagelang nacheinander auf einer und derselben Stelle wahrgenommen zu haben, und diese Angaben werden durch das Betragen gefangener nur bestätigt.
Kein anderer Wiederkäuer scheint in so hohem Grade befähigt zu sein, die schroffsten Gebirge zu besteigen, wie die Wildziegen insgemein und der Steinbock insbesondere. »Die geschwinde des springens und die weyte der sprung von einem felsen zu den anderen«, sagt schon der alte Geßner, »ist yemants müglich zu glauben, er habe es dann gesähen; dann wo es yenen mit seinem gespaltnen und spitzigen klawen behafften mag, so ist ihm kein spitz zu hoch, den er nit etlich schrit überspringet, auch selten kein fels so weyt von dem anderen, den es nit mit seinem sprung erreiche.« Alle Beobachter stimmen dieser Schilderung bei. Jede Bewegung des Steinwildes ist rasch, kräftig und dabei doch leicht. Der Steinbock läuft schnell und anhaltend, klettert mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit und zieht mit unglaublicher, weil geradezu unverständlicher Sicherheit und Schnelligkeit an Felswänden hin, wo nur er Fuß fassen kann. Eine Unebenheit der Wand, die das menschliche Auge selbst in der Nähe kaum wahrnimmt, genügt ihm, sicher auf ihr zu fußen; eine Felsspalte, ein kleines Loch usw. werden ihm zu Stufen einer gangbaren Treppe. Seine Hufe setzt er so fest und sicher auf, daß er auf dem kleinsten Raum sich erhalten kann. Graf Wilczek bestätigt diese Angaben. »Der starke Steinbock«, sagt er, »ist das schönste Jagdtier, das ich je gesehen. Er hat die würdevolle Hauptbewegung des Hirsches; das fast unverhältnismäßig große Gehörn beschreibt bei der kleinsten Kopfbewegung einen weiten Bogen. Seine Sprungkraft ist fabelhaft. Ich sah eine Gemse und einen Steinbock denselben Wechsel annehmen. Die Gemse mußte im Zickzack springen, wie ein Vogel, der hin- und herflattert, der Steinbock kam in gerader Linie herab wie ein Stein, der fällt, alle Hindernisse spielend überwindend. An fast senkrechten Felsenwänden muß die Gemse flüchtig durchspringen; der Steinbock dagegen hat so gelenkige Hufe, daß er, langsam weiter ziehend, viele Klafter weit an solchen Stellen hinschreiten kann; ich sah ihn beim Haften an Felswänden seine Schalen so weit spreizen, daß der Fuß eine um das Dreifache verbreiterte Fläche bildete.« Gefangene Steinböcke setzen nicht minder in Erstaunen wie die freilebenden. Schinz beobachtete, daß sie mit der größten Sicherheit den Platz erreichen, nach dem sie gezielt haben. Ein ganz junger Steinbock in Bern sprang einem großen Manne ohne Anlauf auf den Kopf und hielt sich daselbst mit seinen vier Hufen fest. Einen andern sah man mit allen vier Füßen auf der Spitze eines Pfahles, einen dritten auf der scharfen Kante eines Türflügels stehen und eine senkrechte Mauer hinaufsteigen, ohne andere Stützpunkte als die Vorsprünge der Mauersteine, die durch den abgefallenen Mörtel sichtbar waren, zu benutzen. Gleichlaufend mit der Mauer sprang er mit drei Sätzen auf dieselbe. Er stellte sich dem Ziele, das er erreichen wollte, gerade gegenüber und maß es mit dem Auge, durchlief sodann mit kleinen Schritten einen gleichen Raum, kam mehrmals auf dieselbe Stelle zurück, schaukelte sich auf seinen Beinen, als wenn er deren Schnellkraft versuchen wollte, sprang und war in drei Sätzen oben.
Die Stimme des Steinbocks ähnelt dem Pfeifen der Gemse, ist aber gedehnter. Erschreckt läßt er ein kurzes Niesen, erzürnt ein geräuschvolles Blasen durch die Nasenlöcher vernehmen; in der Jugend meckert er. Unter den Sinnen steht das Gesicht obenan. Das Auge des Steinwildes ist nach Wilczeks Erfahrungen viel schärfer, die Witterung dagegen weit geringer als bei dem Gemswild, das Gehör vortrefflich. Die geistigen Begabungen dürften mit denen der Ziegen insgesamt auf derselben Stufe stehen, wie auch das Wesen im allgemeinen mit dem Auftreten und Gebaren der Hausziegen übereinstimmt. Nach Art der Ziegen gefällt er sich in der Jugend in neckischen, noch im Alter selbst in mutwilligen Streichen, tritt aber immer selbstbewußt auf und bekundet erforderlichenfalls hohen Mut, Rauf- und Kampflust, die ihm keineswegs schlecht ansteht. Gefährlichen Tieren weicht er aus, schwächere behandelt er übermütig oder beachtet sie kaum. Mit den Gemsen will er, wie behauptet wird, nichts zu tun haben und hält sich, unbedrängt, fern von ihnen; Hausziegen dagegen sucht er förmlich auf, paart sich auch freiwillig mit ihnen.
In stillen, vom Menschen wenig besuchten Hochtälern äst das Steinwild in den Vor- und Nachmittagsstunden, in Gebieten dagegen, wo es Störung befürchtet, nur in der Früh- und Abenddämmerung, vielleicht auch des Nachts. Leckere Alpenkräuter, Gräser, Baumknospen, Blätter und Zweigspitzen, insbesondere Fenchel- und Wermutarten, Thymian, die Knospen und Zweige der Zwergweiden, Birken, Alpenrosen, des Ginsters und im Winter nebenbei auch dürre Gräser und Flechten bilden seine Äsung. Salz liebt es außerordentlich, erscheint daher regelmäßig auf salzhaltigen Stellen und beleckt diese mit solcher Gier, daß es zuweilen die ihm sonst eigene Vorsicht vergißt. Ein weithin vernehmbares, eigentümliches Grunzen drückt das hohe Wohlbehagen aus, das dieser Genuß ihm bereitet.
Die Brunstzeit fällt in den Januar. Starke Böcke kämpfen mit ihren gewaltigen Hörnern mutvoll und ausdauernd, rennen wie Ziegenböcke auf einander los, springen auf die Hinterbeine, versuchen den Stoß seitwärts zu richten und prallen endlich mit den Gehörnen so heftig zusammen, daß man das Dröhnen des Kampfes auf weithin im Gebirge widerhallen hört. An steilen Gehängen mögen diese Kämpfe zuweilen gefährlich werden. Fünf Monate nach der Paarung, meist in der letzten Woche des Juni oder im Anfang des Juli, wirft die Ziege ein oder zwei Junge, an Größe etwa einem neugeborenen Zicklein gleich, leckt sie trocken und läuft bald darauf mit ihnen davon. Das Steinzicklein, ein äußerst niedliches, munteres, wie Schinz sagt, »schmeichelhaftes« Geschöpf, kommt mit feinem, wolligem Haar bedeckt zur Welt und kleidet sich erst vom Herbst an in ein aus steiferen, längeren Grannen bestehendes Gewand. Bereits wenige Stunden nach der Geburt erweist es sich als fast ebenso kühner Bergsteiger wie seine Mutter. Diese liebt es außerordentlich, leitet es, meckert ihm freundlich zu, ruft es zu sich, hält sich, solange sie es säugt, mit ihm in den Felsenhöhlen verborgen und verläßt es nie, außer wenn der Mensch ihr gar zu gefährlich scheint und sie das eigene Leben retten muß, ohne das auch das ihres Kindes verloren sein würde. Bei drohender Gefahr eilt sie an fürchterlichen Gehängen hin und sucht in dem wüsten Geklüfte ihre Rettung. Das Zicklein aber verbirgt sich äußerst geschickt hinter Steinen und in Felsenlöchern, liegt dort mäuschenstill, ohne sich zu rühren, und äugt und lauscht und wittert scharf nach allen Seiten hin. Sein graues Haarkleid ähnelt den Felswänden und Steinen derart, daß auch das schärfste Falkenauge nicht imstande ist, es wahrzunehmen oder vom Felsen zu unterscheiden. Sobald die Gefahr vorüber ist, findet die gerettete Steinziege sicher den Weg zu ihrem Kinde wieder; bleibt sie aber zu lange aus, so kommt das Steinzicklein aus seinem Schlupfwinkel hervor, ruft nach der Alten und verbirgt sich dann schnell wieder. Wird die Mutter getötet, so flieht es anfangs furchtsam und entsetzt, kehrt aber bald und immer wieder um und hält lange und fest an der Gegend, wo es seine treue Beschützerin verloren, kümmerlich sein Leben fristend.
Bei Gefahr verteidigt die Steinbockziege ihr Junges nach besten Kräften. Der berühmte Steinbockjäger Fournier aus dem Wallis sah einmal sechs Steinziegen mit ihren Jungen weiden. Als ein Adler über ihnen kreiste, sammelten sich die Mütter mit den Zicklein unter einem überragenden Felsblocke und richteten die Hörner nach dem Raubvogel, je nachdem der Schatten des Adlers auf dem Boden dessen Stellung bezeichnete, nach der bedrohten Seite sich wendend. Der Jäger beobachtete lange diesen anziehenden Kampf und verscheuchte zuletzt den Adler.
Mit ihren nächsten Verwandten, unsern Hausziegen, paaren sich die Steinböcke ohne sonderliche Umstände und erzeugen Blendlinge, die wiederum fruchtbar sind. Solche Vermischungen kommen selbst während des Freilebens der Tiere vor: zwei Hausziegen im Cognetale, die den Winter im Gebirge zugebracht hatten, kehrten, wie Schinz mitteilt, im darauffolgenden Frühjahr trächtig zu ihrem Herrn zurück und warfen bald unverkennbare Steinbocksbastarde. Echte Steinböcke paarten sich in Schönbrunn wie in Hellbrunn wiederholt mit passend ausgewählten Hausziegen und erzeugten starke und kräftige Nachkommen, die in der Regel dem Steinbocke mehr glichen als der Ziege, obgleich sie im Gehörn mit dem Ziegenbocke noch große Ähnlichkeit hatten. Ihre Färbung war sehr veränderlich; bald ähnelten sie dem Vater, bald wiederum der Mutter.
Rechtmäßige Jagden wurden früher ausschließlich von König Victor Emanuel ausgeführt. Ich danke meinem Gönner und Freunde Wilczek, dem einzigen, der jemals die Ehre hatte, von dem hohen Jagdherrn eingeladen zu werden, die nachstehenden Mitteilungen über diese Jagden. Der König verwandte, seitdem er das Jagdrecht der oben namentlich aufgezählten Gemeinden erworben, verhältnismäßig bedeutende Summen auf die Hege des edlen Wildes und brachte alljährlich im Juli und August, d. h. sobald der Schnee auf den Gletschern geschmolzen war, mehrere Wochen im Gebirge zu, hier zwischen drei- und viertausend Meter über dem Meere gelegene Jagdhütten oder selbst ein offenes, nicht einmal dem Regen genügend widerstehendes Zelt bewohnend. Von solcher Herberge aus ritt er auf für ihn eigens hergerichteten, jedoch noch immer ungemein wilden Pfaden oft fünf bis sechs Stunden weit bis zu seinem Stande, nachdem seine Jäger am Tage zuvor durch das Fernrohr ausgekundschaftet hatten, ob Steinwild in der Kluft stand. In solchen Fällen wurden ein- bis zweihundert Treiber aufgeboten, um das scheue Wild gegen die Stände zu treiben. In letzteren, roh aufgeführten Steintürmen mit Schießlöchern, muß der vom Kopf bis zum Fuß in Grau gekleidete Schütze vollständig verborgen sein und regungslos verharren, um dem scharfsichtigen Wilde unbemerkt zu bleiben; wird er von ihm gesehen, so ist der Anstand auch trotz der vielen Treiber vergeblich. Da das Steinwild nur nach Verwundung oder in höchster Bedrängnis Gletscher annimmt, dienen solche oft als Seitenwand eines Treibens und werden ebensowenig wie für Wild unzugängliche Felswände durch Treiber verwahrt. Letztere gehen langsam vorwärts, Moränen, Halden und einigermaßen zugängliche Wände als Pfade benutzend, und treiben das Steinwild vor sich her. Dieses bewegt sich nur mit äußerster Vorsicht, beobachtet alles, was vorgeht, auf das genaueste, durchspäht die Gegend mit reger Aufmerksamkeit und verweilt, wenn nicht getrieben, zuweilen stundenlang äugend und windend auf einer und derselben Stelle, schreitet überhaupt nur mißtrauisch und zögernd weiter vor. Ungünstiger Wind hindert die Jagd weniger, braucht mindestens nicht in demselben Grade berücksichtigt zu werden wie bei der Gemsjagd; auch darf man ein und dasselbe Gebiet mehrmals nacheinander treiben, da die starken Böcke, die entkamen, an dem folgenden und zweitfolgenden Tage ihren alten Standplatz gewiß wieder aufsuchen. Der gegenwärtige Wildstand gestattet, alljährlich fünfzig Böcke abzuschießen; Geißen gelten selbstverständlich als unverletzlich. Außer auf diesen Treibjagden erlegt man das Wild auch wohl auf dem Anstande in der Nähe oft begangener Wechsel oder an den oben erwähnten Salzlecken. Jung eingefangene Steinböcke gedeihen, wenn man ihnen eine Ziege als Amme gibt, in der Regel gut, werden auch bald zahm, verlieren diese Eigenschaft jedoch mit zunehmendem Alter. Sie haben viel von dem Wesen unserer Hausziege, bekunden aber vom Anfange an größere Selbständigkeit als diese und gefallen sich schon in den ersten Wochen ihres Lebens in den kühnsten und verwegensten Kletterversuchen. Neugierig, neckisch und mutwillig wie junge Zicklein sind auch sie, und anfänglich so spiellustig und drollig, daß man seine wahre Freude an ihnen haben muß. Mit ihrer Amme befreunden sie sich schon nach wenigen Tagen, mit ihrem Pfleger nach geraumer Zeit, unterscheiden diesen bestimmt von andern Leuten und legen Freude an den Tag, wenn sie denselben nach längerer Abwesenheit wieder zu sehen bekommen. Ihre Anhänglichkeit an die Pflegemutter beweisen sie durch kindlichen Gehorsam; denn sie kehren stets zurück, wenn die Ziege meckernd sie herbeiruft, so gern sie auch möglichst ungebunden sich umhertreiben und dabei Höhen erklimmen, die der Pflegemutter bedenklich zu sein scheinen. Gegen Liebkosungen höchst empfänglich, lassen sie sich doch nicht das geringste gefallen und stellen sich bald auch ihrem Wärter trotzig zur Wehr, den Kopf mit dem kurzen Gehörn in unendlich komischer Weise herausfordernd bewegend. Lammfromm halten sie still, wenn man sie zwischen den Hörnern kraut, mutwillig aber vergelten sie solche Wohltaten nicht selten durch einen scherzhaft gemeinten, jedoch nicht unempfindlichen Stoß. Je älter sie werden, um so selbstbewußter und übermütiger zeigen sie sich. Schon mit halberwachsenen Steinböcken ist nicht gut zu scherzen, erwachsene aber rennen, sobald sie erzürnt wurden, den stärksten Mann über den Haufen und sind imstande, geradezu lebensgefährliche Verletzungen beizubringen.
In den ersten Novembertagen des Jahres 1856 unternahm ich in Gesellschaft meines Bruders Reinhold und eines gemeinschaftlichen Freundes, unter Leitung eines eingeborenen kundigen Jägers, eine Besteigung der Sierra Nevada in Südspanien, in der Absicht, auf Steinwild zu jagen. Die Zeit der Jagd fällt eigentlich in die Monate Juli und August, weil dann der Jäger einige Tage lang im Hochgebirge verweilen kann; wir aber kamen erst im November in die Nähe des reichen Gebirges und wollten nicht weiterziehen, ohne wenigstens versucht zu haben, ein Stück des stolzen Wildes zu erbeuten. Es war ein gewagtes Unternehmen, in der jetzigen Jahreszeit zu Höhen von dreitausend Meter über dem Meere emporzuklettern, und es stand von vornherein zu erwarten, daß unsere Jagd erfolglos sein würde. Dies hinderte uns jedoch nicht, bis zu dem Picacho de la Veleta aufzusteigen und die hauptsächlichsten Jagdgebiete abzusuchen; Schneegestöber und eintretende Kälte zwangen uns aber leider zur Umkehr, und so kam es, daß wir nur die frischen Fährten des ersehnten Wildes, nicht aber Steinböcke selbst entdecken konnten.
Um so erfolgreicher jagte mein Bruder später auf Steinböcke in den mittleren Teilen des Landes, nachdem er sich, zum Danke für geleistete ärztliche Hilfe, der Mitwirkung der Bewohnerschaft eines Dorfes am Fuße der Sierra de Gredos versichert und in den Jagdgebieten gedachter Ortschaft wertvollere Rechte erworben hatte als irgend jemand vor ihm. Ausgerüstet mit allen erforderlichen Mitteln, insbesondere aber mit einer vortrefflichen Beobachtungsgabe, gelang es ihm nicht allein, eine stattliche Reihe von Bergsteinböcken zu erlegen, sondern auch das Leben der Tiere so eingehend zu belauschen und zu erkunden, daß seine Angaben ebensowohl ein mustergültiges Lebensbild der in Rede stehenden Art zeichnen, wie sie unsere Kenntnis der Steinböcke überhaupt in dieser und jener Beziehung erweitern. Ich gebe im nachfolgenden Beobachtungen meines Bruders wieder und damit die erste eingehende Leibes- und Lebensbeschreibung des schönen, bis jetzt nur als Balg bekannten Wildes.
Der Bergsteinbock, wie ich das Tier, seinen spanischen Namen »Cabramontés« frei übersetzend, genannt wissen möchte, der Pyrenäensteinbock älterer Forscher ( Capra pyrenaica), erreicht vollkommen die Größe des Alpensteinbocks, unterscheidet sich jedoch von ihm sehr wesentlich durch die Gestalt und Bildung der Hörner. Der ausgewachsene Bock ist 1,45 bis 1,6 Meter lang, wovon auf den Schwanz ohne Büschel 12 Zentimeter zu rechnen sind, und am Widerrist 75 Zentimeter, am Kreuz dagegen 78 Zentimeter hoch; die Ziege erreicht höchstens drei Vierteile der angegebenen Länge und bleibt in der Höhe um durchschnittlich 10 Zentimeter hinter dem Bocke zurück. Die Gehörne des letzteren stehen an der Wurzel so dicht zusammen, daß vorn ein Zwischenraum von höchstens 4, hinten von nur 1 Zentimeter bleibt, steigen anfangs steil aufwärts, nur wenig nach außen sich wendend, biegen sich vom ersten Dritteil ihrer Länge an scharf nach außen, wenden sich, leierförmig auseinandertretend, fortan zugleich nach hinten, erreichen mit Beginn des letzten Dritteils ihren weitesten Abstand voneinander, kehren nunmehr die Spitzen wieder gegeneinander und richten sie ebenso etwas aufwärts. Länge und Dicke der Hörner nehmen beim Bock mit den Jahren merklich zu, wogegen das bei weitem schwächere Gehörn der Ziege sich kaum noch verändert. »Ich besitze«, schreibt mir mein Bruder, »das Gehörn eines alten Bergsteinbockes, dessen Stangen bei 76 Zentimeter Länge 22 Zentimeter Umfang an der Wurzel und doch nur elf Jahresringe zeigen, zweifle jedoch nicht, daß die Hörner, der Krümmung nach gemessen, bis zu einem Meter Länge erreichen können.«
Beschaffenheit und Färbung des im Winter ungemein dichten, im Sommer dünnen Haarkleides ändern nicht allein nach Jahreszeit, Alter und Geschlecht, sondern, wie bei allen Felsentieren, auch nach der Örtlichkeit nicht unwesentlich ab. Ein schönes, nur auf Nasenrücken, Stirn und Hinterkopf dunkelndes, hier oft mit Schwarz gemischtes Hellbraun ist die Sommerfärbung des Tieres; im vollendeten Winterkleide herrschen ein in das Braune spielendes Schwarz und Grau vor.
Das Verbreitungsgebiet des Bergsteinbocks erstreckt sich von der Küste des Golfs von Biscaya bis zum Mittelmeer und von den Pyrenäen bis zur Serrania de Ronda. Außer den obengenannten Gebirgen bewohnt er alle höheren Gebirgszüge Nord- und Mittelspaniens, in besonderer Häufigkeit namentlich die Sierra de Gredos, wogegen er auf den Gebirgen der kantabrischen Küste gänzlich zu fehlen scheint. Die Lebensweise des Bergsteinbocks ähnelt in jeder Hinsicht derjenigen unseres Alpensteinbockes.
*
Die Ziegen im engsten Sinne ( Hircus) sind durchschnittlich etwas kleiner als die Steinböcke, ihre Hörner mehr oder weniger zusammengedrückt, beim Männchen schneidig und mit Querwülsten oder Runzeln versehen, beim Weibchen geringelt und gerunzelt. Im übrigen ähneln die Ziegen den Steinböcken in jeder Beziehung.
Die Bezoarziege oder der Paseng ( Capra aegagrus) ist zwar etwas kleiner als der europäische Steinbock, aber doch merklich größer als unsere Hausziege. Der Leib ist ziemlich gestreckt, der Rücken schneidig, der Hals von mäßiger Länge, der Kopf kurz, das Auge verhältnismäßig, das Ohr ziemlich groß. Die sehr großen und starken, von beiden Seiten zusammengedrückten und hinten und vorn scharfkantigen, auf der äußeren Seite aber gerundeten oder gewölbten Hörner, die schon bei mittelgroßen Tieren über 40 Zentimeter, bei alten oft mehr als das Doppelte messen, bilden, von der Wurzel angefangen, einen starken, einfachen und gleichförmig nach rückwärts gekrümmten Bogen. Beide Geschlechter tragen einen starken Bart; die übrige Behaarung besteht aus ziemlich langen, straffen, glatt anliegenden Grannen und kurzen, mittelmäßig feinen Wollhaaren. Die Färbung ist ein helles Rötlichgrau oder Rostbräunlichgelb, die an den Halsseiten und gegen den Bauch hin wegen der hier reichlicher auftretenden weißspitzigen Haare lichter wird; Brust und Unterhals sind dunkelschwarzbraun, Bauch, Innen- und Hinterseite der Schenkel weiß. Ein scharf abgegrenzter, von vorn nach hinten sich verschmälernder, dunkelschwarzbrauner Längsstreifen verläuft über die Mittellinie des Rückens bis zu dem einfarbigen schwarzen Schwanz.
Das Verbreitungsgebiet der Bezoarziege erstreckt sich über einen ausgedehnten Landstrich West- und Mittelasiens. Sie findet sich auf der Südseite des Kaukasus, im Taurus und den meisten übrigen Gebirgen Kleinasiens und Persiens, bis weit nach Süden hin, kommt aber auch auf mehreren Inseln des Mittelländischen, insbesondere des Griechischen Meeres und vielleicht sogar auf den Gebirgen der Griechischen Halbinsel vor. Wie die neuesten Untersuchungen fast außer Zweifel stellen, ist sie nämlich dasselbe Tier, dessen Homer bei Schilderung der Kyklopeninsel gedenkt:
»Der Ziegen unendliche Menge durchstreift sie,
Wilden Geschlechts, weil nimmer ein Pfad der Menschen sie scheuchet.«
Über das Freileben der Bezoarziege auf den griechischen Inseln gibt Erhard eine später durch Sandwith vollkommen bestätigte Mitteilung. Auf Kreta findet man unsere Ziege noch auf den meisten Gebirgen, namentlich aber um und auf dem Ida, der sich zu 2500 Meter Höhe erhebt, in bedeutender Anzahl. Gewöhnlich sieht man Herden von vierzig bis fünfzig Stück beisammen, die sich jedoch mit Beginn der Paarungszeit, in der Mitte des Herbstes, in kleinere Rudel von sechs bis acht Stück auflösen. Die Ziege wirft meist noch vor Beginn des Frühlings zwei, seltener drei Junge, die vom Tage ihrer Geburt an der neu sich bildenden Herde zugesellt werden. Zuweilen begatten sich die Bezoarziegen auch mit ihren gezähmten Abkömmlingen oder Verwandten und erzeugen dann Blendlinge, die, der Sitte des wilden Vaters getreu, fern von jeder menschlichen Wohnung auf den hohen Spitzen des Ida schwer zugängliche Standorte suchen. Ein solcher Blendlingsbock, größer als jeder andere seiner Verwandten, soll in den fünfziger Jahren auf dem Ida sich umhergetrieben haben und wegen seines bis zum Weiß ergrauten Haares ein allen Hirten wohlbekanntes Tier gewesen sein. Saftige und dürre Kräuter fast ohne Wahl werden als Äsung gedachter Wildziegen angegeben; doch sollen sie den Kapernstrauch mit Vorliebe aufsuchen. Auf Eremomelos lebte unsere Ziege von jeher in viel kleineren Herden und in den oben erwähnten Jahren nur noch in einzelnen Stücken; ihre rasche Verminderung aber soll weniger der Jagd als dem Umstande zuzuschreiben sein, daß Schafe, die vor Jahren zur Weide auf Antimelos getrieben worden, ihnen eine Seuche mitgeteilt haben, an der viele zugrunde gingen. Da auf dem beschränkten Gebiete der kleinen Insel weder Baum noch Grashalm wächst, so kann die Äsung, laut Erhard, nur in Knospen der alle Inseln des Kykladenmeeres reichlich überziehenden Stachelkräuter, namentlich des Ginsters und Stachelginsters, Strauchbibernells, des Sumach, der Tamariske, des Thymians, Wundklees, Pfefferkrautes, der Flockenblume und anderer niederer Pflanzen bestehen.
In ihrem Auftreten, Wesen und Gebaren erinnert die Bezoarziege lebhaft an den Steinbock. Rasch und sorglos läuft sie auf schwierigen Wegen dahin, steht oft stundenlang, schwindelfrei in die ungeheuren Abgründe schauend, auf vorspringenden Felszacken, klettert vortrefflich und wagt gefährliche Sätze mit ebensoviel Mut als Geschick. Sie ist außerordentlich scheu und weiß den meisten Gefahren zu entgehen. Ihre Sinne sind vortrefflich entwickelt: sie wittert auf ungeheure Entfernungen hin und vernimmt auch das leiseste Geräusch. Auch ihre geistigen Fähigkeiten stehen ungefähr auf derselben Stufe wie die des Steinwilds.
Ein noch heute vielfach verbreiteter, obschon längst widerlegter Aberglaube ist Ursache, daß in vielen Ländern Asiens der Mensch den munteren Gebirgskindern eifrigst nachstellt. In dem Magen der erlegten Bezoarziegen vermeint man nämlich jene Kugeln, die zu dem Namen unserer Tiere Veranlassung gegeben haben, häufiger als bei andern Wiederkäuern zu finden und führt deshalb überall da, wo man noch an die Wunderkräfte der Bezoarkugeln glaubt, einen wahren Vernichtungskrieg gegen ihre Erzeuger. Bereits seit uralten Zeiten maßen sich die Fürsten das Vorrecht an, den Bezoarhandel in ihre Hände zu nehmen. Schon der alte Bontius weiß, daß alle diesen Wunderkugeln zugeschriebenen Kräfte durchaus keinen Arzneiwert haben; gleichwohl wird das leidige Quacksalbermittel noch heutigestags in ganz Indien und Persien hoch bezahlt und fordert unternehmende Jäger immer zu neuen Vertilgungszügen gegen die Bezoarziegen auf.
Weder auf den griechischen Inseln noch im Kaukasus oder Cilizischen Taurus scheint man etwas von dem Heilschwindel mittels der Bezoarkugeln zu wissen und stellt daher unsern Wildziegen einzig und allein des Wildbrets, der Decke und des Gehörns halber nach. Auf Antimelos wie auf Kreta wird die Jagd bloß an einzelnen Stellen von wenigen mit dem Gebirge wohlvertrauten Hirten betrieben; denn noch heute gelten für die Berge Kretas des Dichters Worte:
»Nie auch wandern hinein nachspürende Jäger, die mühvoll
Durch das Gehölz arbeiten und lustige Gipfel umklettern.«
Der durch die Jagd erzielte Nutzen ist selbst im Taurus nicht unbedeutend. Das ausgezeichnet schmackhafte Wildbret, das an das unseres Rehes erinnert und ebenso zart und mürbe wie letzteres ist, wird entweder frisch genossen oder in lange, schmale Streifen geschnitten und an der Luft getrocknet, um es später verwenden zu können, die im Winter erbeutete, langhaarige Decke von den Muselmännern als Gebetteppich benutzt und, weil man ihren scharfen Geruch angenehm findet, hoch geschätzt, die kurzhaarige Sommerdecke zu Schläuchen, das Gehörn zu Säbelgriffen, Pulverhörnern und andern Kleinigkeiten verarbeitet, so daß sich ein erlegter Bezoarbock immerhin gut bezahlt macht.
Bei dem Versuche, die Frage der Abstammung unserer Hausziege und ihrer ungemein zahlreichen Rassen zu lösen, lassen uns Sage und Geschichte vollständig im Stich. Bereits in den ältesten Zeiten waren Ziegenrassen vorhanden, die von den in unsern Tagen lebenden sich durchaus nicht unterschieden, und gerade diese Beständigkeit der betreffenden Rassen erschwert es, auch nur Mutmaßungen über ihren Ursprung auszusprechen.
Als die edelste unter allen Hausziegenrassen dürfen wir wahrscheinlich die Angoraziege ( Capra hircus angorensis) hinstellen, ein schönes, großes Tier von gedrungenem Leibesbau, mit starken Beinen, kurzem Halse und Kopfe, sehr eigentümlich gewundenem Gehörn und auffallendem Haar. Beide Geschlechter tragen Hörner. Diese sind bei dem Bocke stark zusammengedrückt, nicht gedreht, scharf gekantet und hinten stumpf zugespitzt, stehen gewöhnlich wagerecht von dem Kopf ab, bilden eine weite, doppelte Schraubenwindung und richten sich mit der Spitze nach aufwärts, erscheinen also dreifach gebogen. Die Ziege trägt kleinere, schwächere, runde, einfach gebogene Hörner, die in der Regel, ohne sich über den Kopf oder Hals zu erheben, sich um das Ohr herumdrehen, d. h. einfach stark nach abwärts und dann nach vorn und abwärts wenden, wobei die bis zum Auge reichende Spitze nach außen gerichtet ist. Nur das Gesicht, die Ohren und der unterste Teil der Läufe sind mit kurzen, glatt anliegenden Haaren bedeckt; das übrige Vlies ist überaus reichlich, dicht und lang, fein, weich, glänzend, seidenartig, lockig gekräuselt und besteht vorwiegend aus Wollhaaren, die die spärlich vorhandenen Grannen fast überwuchern. Beide Geschlechter tragen einen ziemlich langen, aus straffen oder steifen Haaren gebildeten Bart. Ein blendendes, gleichmäßiges Weiß ist die vorherrschende Färbung dieser Ziegenrasse; seltener kommen solche vor, die auf lichtem Grunde dunkle Flecken zeigen. Im Sommer fällt das Vlies in großen Flocken aus, wächst aber sehr rasch wieder nach. Französische Züchter haben gefunden, daß ein Vlies zwischen 1250 und 2500 Gramm wiegt.
Die Angoraziege scheint den Alten gänzlich unbekannt gewesen zu sein. Belon ist der erste, der einer Wollziege Erwähnung tut, deren Vlies fein wie Seide und weiß wie der Schnee sei und zur Verfertigung des Kamelot oder Kämmelgarns verwandt werde. Ihren Namen trägt die Ziege nach der Stadt Angora in Kleinasien, der schon bei den Alten hochberühmten Handelsstadt Ankyra. Von hier aus hat man sie weiter verbreitet, neuerdings mit Glück auch in Europa eingeführt. Ihre Heimatgegend ist trocken und heiß im Sommer, jedoch sehr kalt im Winter, obwohl dieser nur drei oder vier Monate dauert. Erst wenn es keine Nahrung auf den Bergen mehr gibt, bringt man die Ziegen in schlechte Ställe, wogegen sie das ganze übrige Jahr auf der Weide verweilen müssen. Sie sind höchst empfindlich, obwohl die schlechte Behandlung nicht dazu beiträgt, sie zu verweichlichen. Reine, trockene Luft ist zu ihrem Wohlsein eine unumgänglich notwendige Bedingung. Während der heißen Jahreszeit wäscht und kämmt man das Vlies allmonatlich mehrere Male, um seine Schönheit zu erhalten oder noch zu steigern.
Die Anzahl der Ziegen, die man überhaupt in Anatolien hält, wird auf eine halbe Million angeschlagen. Auf einen Bock kommen etwa hundert Ziegen und darüber. Im April ist die Schur, und unmittelbar darauf wird die Wolle eingepackt. Angora allein liefert fast eine Million Kilogramm, die einem Wert von 3 600 000 Mark entsprechen. Zehntausend Kilogramm werden im Lande selbst zur Fertigung starker Stoffe für die Männer und feinerer für die Frauen sowie auch zu Strümpfen und Handschuhen verarbeitet, alles übrige geht nach England. In Angora selbst ist fast jeder Bürger Wollhändler.
Man hat beobachtet, daß die Feinheit der Wolle mit dem Alter ihrer Erzeuger abnimmt. Bei einjährigen Tieren ist das Vlies wunderbar schön; schon im zweiten Jahre verliert es etwas; vom vierten Jahre an wird es rasch schlechter und schlechter; sechsjährige Tiere muß man schlachten, weil sie zur Wollerzeugung gar nicht mehr geeignet sind.
Schon seit der ersten Kunde, die man über die Angoraziege erhielt, hat man Versuche gemacht, sie bei uns einzuführen. Die spanische Regierung brachte im Jahre 1765 einen starken Trupp Angoraziegen nach der Iberischen Halbinsel; was aus ihnen geworden ist, weiß man aber nicht. Im Jahre 1787 führte man einige Hunderte in den französischen Niederalpen ein, woselbst sie so ausgezeichnet gediehen, daß man einen hübschen Gewinn erlangte. Später brachte man sie auch nach Toskana und selbst nach Schweden. Im Jahre 1830 kaufte Ferdinand VII. hundert Angoraziegen und setzte sie zuerst im Park des Schlosses El Retiro bei Madrid aus. Hier vermehrten sie sich so rasch, daß man sie auf Berge des Eskorials übersiedeln mußte. In dieser ihnen sehr günstigen Gegend machte man die Beobachtung, daß ihre Wolle sich ebenso fein erhielt wie in ihrem eigentlichen Vaterlande. Später wurden sie nach Südkarolina gebracht, und auch dort befanden sie sich wohl. Endlich führte die Kaiserlich Französische Gesellschaft für Einbürgerung fremder Tiere im Jahre 1854 die Angoraziege von neuem in Frankreich ein, und man hat bis jetzt keine Ursache gehabt, über das Mißgedeihen derselben zu klagen; es wird sogar behauptet, daß die Wolle der in Frankreich geborenen Tiere feiner wäre als die ihrer Eltern.
Kaum minder wertvoll als die eben beschriebene ist die Kaschmirziege ( Capra hircus laniger), ein ziemlich kleines, aber gefällig gebautes Tier von beinahe 1,5 Meter Gesamtlänge und 60 Zentimeter Schulterhöhe. Der auf stämmigen Läufen ruhende Leib ist gestreckt, der Rücken gerundet, das Kreuz kaum höher als der Widerrist, der Hals kurz, der Kopf ziemlich dick, die Augen sind klein, die Hängeohren etwas länger als der halbe Kopf, die langen, zusammengedrückten, schraubenförmig gedrehten, auf der Vorderseite scharf gekanteten Hörner biegen sich von der Wurzel seitlich auseinander und steigen schief nach auf- und rückwärts, kehren aber ihre Spitze wieder einwärts. Ein langes, straffes, feines und schlichtes Grannenhaar überdeckt die kurze, außerordentlich feine, weiche, flaumartige Wolle; nur Gesicht und Ohren sind kurz behaart. Die Färbung wechselt. Gewöhnlich sind die Seiten des Kopfes, der Schwanz und die übrigen Teile des Leibes silberweiß oder schwach gelblich, jedoch kommen auch einfarbige Kaschmirziegen vor, bald rein weiße, bald sanft gelbe oder hellbraune, bald dunkelbraune und schwarze. Das Wollhaar ist bei lichtgefärbten Tieren weiß oder weißlichgrau, bei dunkleren aschgrau.
Von Groß- und Kleintibet an reicht der Verbreitungskreis dieser schönen Ziege über die Bucharei bis zum Lande der Kirgisen. In Bengalen wurde sie eingeführt; in den Gebirgen Tibets, die auch im Winter und bei der heftigsten Kälte von ihr bewohnt werden, ist sie häufig.
Lange Zeit war man im Zweifel, von welchem Tier das Haar gewonnen werde, das man zur Anfertigung der feinsten aller Wollgewebe benutzt, bis Bernier, ein französischer Arzt, der im Jahre 1664 in Begleitung des Großmoguls Tibet besuchte, erfuhr, daß zwei Ziegen, eine wildlebende und eine gezähmte, solche Wolle lieferten. Später reiste ein armenischer Kaufmann im Auftrage eines türkischen Handelshauses nach Kaschmir und berichtet, daß man nur in Tibet Ziegen besitze, die so feine Wolle liefern, wie die Weber in Kaschmir sie bedürfen. Die Böcke liefern mehr, aber minder feine Wolle als die Ziegen. Im Mai und Juni findet die Schur statt. Das gewonnene Gemenge wird gereinigt und das Grannenhaar zur Fertigung gewöhnlicher Stoffe verwendet, wogegen das Wollhaar noch einmal der sorgfältigsten Prüfung und Ausscheidung unterliegt. Am gesuchtesten ist das reine Weiß, das in der Tat den Glanz und die Schönheit der Seide besitzt. Ein einzelnes Tier liefert etwa drei- bis vierhundert Gramm brauchbaren Wollflaums. Zur Verfertigung eines Gewebes von einem Geviertmeter sind fast achthundert Gramm oder das Erzeugnis von sieben bis acht Ziegen erforderlich.
Unter der Herrschaft des Großmoguls sollen vierzigtausend Schalwebereien in Kaschmir bestanden haben; als aber das Land unter die Afghanen kam, sank dieser gewichtige Erwerbszweig so sehr herab, daß von den sechzigtausend Menschen, denen die Weberei ihren Lebensunterhalt verschaffte, Tausende aus Mangel an Arbeit zum Auswandern gezwungen wurden. Noch jetzt hat sich die Weberei nicht wieder erholen können, weil ungeeignete Gesetze den freien Handel mit der Wolle hindern und Zölle aller Art den Verkehr lähmen. Auch die Kaschmirziege hat man mit großem Erfolg in Europa, besonders in Frankreich, eingebürgert.
Die Mamberziege ( Capra hircus mambrica) ähnelt wegen ihrer langen Haare einigermaßen der Kaschmirziege, unterscheidet sich von dieser aber durch ihre außerordentlich langen, schlaff herabhängenden Ohren, die in gleicher Größe und Gestalt bei keiner andern Ziege gefunden werden. Sie ist groß und hoch, aber gedrungen gebaut, der ziemlich gestreckte Kopf auf der Stirn sanft gewölbt, längs des Nasenrückens gerade. Beide Geschlechter tragen Hörner, der Bock gewöhnlich stärkere und mehr gewundene als die Ziege. Eine reichliche und dichte, zottige, straffe, seidenartig glänzende Behaarung deckt den Leib mit Ausnahme des Gesichts, der Ohren und der Unterfüße, die kurz behaart sind. Beide Geschlechter tragen einen mittellangen, schwachen Bart. Auch diese Form muß schon seit Jahrtausenden in den Hausstand übergegangen sein, da sie bereits Aristoteles kannte. Gegenwärtig findet man sie in der Nähe von Aleppo und Damaskus in großer Anzahl.
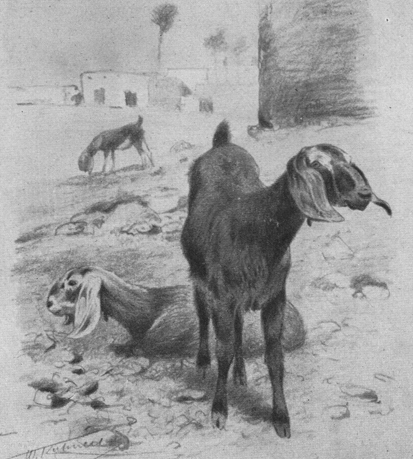
Nilziege ( Capra kircus aegyptiaca)
Ferner scheint mir die Nil- oder ägyptische Ziege ( Capra hircus aegyptiaca), dieselbe, die auf den Denkmälern so vielfach dargestellt wurde, der Erwähnung wert zu sein. In der Größe steht sie unserer Hausziege merklich nach, ist aber hochrückiger und kurzbeiniger und besonders ausgezeichnet durch ihren kleinen Kopf und die gewaltige Ramsnase. Ein Gehörn fehlt gemeiniglich beiden Geschlechtern oder ist, wenn vorhanden, klein, dünn und stummelhaft; auch einen Bart habe ich bei den von mir beobachteten vermißt. Die Färbung ist in der Regel gleichmäßig, meist lebhaft rotbraun, an den Schenkeln mehr ins Gelbliche ziehend. Das Tier wird im untern Niltale allgemein gezüchtet und reicht bis Mittelnubien herauf, von wo die Zwergziege ( Capra hircus reversa), ein Tier von höchstens 70 Zentimeter Länge, 50 Zentimeter Höhe am Widerrist und nicht über 25 Kilogramm Gewicht, an seine Stelle tritt. Sie gehört zu den anmutigsten Erscheinungen der ganzen Gruppe.

Kaukasische Hausziege ( Capra hircus caucasica)
Wegen des von allen Völkern anerkannten Nutzens bewohnen die Hausziegen gegenwärtig fast die ganze Erde, finden sich wenigstens bei allen Völkern, die ein nur einigermaßen geregeltes Leben führen, gewiß. Sie leben unter den verschiedensten Verhältnissen, größtenteils allerdings als freies Herdentier, das bei Tage so ziemlich eigenmächtig seiner Weide nachgeht, nachts aber unter Aufsicht des Menschen gehalten wird. Verwilderte Ziegen kommen wohl nur hier und da in den südasiatischen Gebirgen und auf einzelnen kleinen Eilanden des Mittelmeeres vor.
Die Ziege ist für das Gebirge geschaffen. Je steiler, je wilder, je zerrissener ein solches ist, um so wohler scheint sie sich zu fühlen. Im Süden Europas und in den übrigen gemäßigten Teilen der andern Erdfesten wird man wohl schwerlich ein Gebirge betreten, ohne auf ihm weidenden Ziegenherden zu begegnen. Sie verstehen es, das ödeste Gefelse zu beleben und der traurigsten Gegend Reiz zu verleihen.
Alle Eigenschaften der Ziege unterscheiden sie von dem ihr so nahestehenden Schafe. Sie ist ein munteres, launiges, neugieriges, neckisches, zu allerlei scherzhaften Streichen aufgelegtes Geschöpf, das dem Unbefangenen Freude gewähren muß. Lenz hat sie vortrefflich gezeichnet: »Schon das kaum ein paar Wochen alte Hippelchen«, sagt er, »hat große Lust, außer den vielen merkwürdigen Sprüngen auch halsbrechende Unternehmungen zu wagen. Immer führt sie der Trieb bergauf. Auf Holz- und Steinhaufen, auf Mauern, auf Felsen klettern, Treppen hinaufsteigen: das ist ihr Hauptvergnügen. Oft ist es ihr kaum oder gar nicht möglich, von da wieder herabzusteigen, wo sie sich hinaufgearbeitet. Sie kennt keinen Schwindel und geht oder liegt ruhig am Rande der fürchterlichsten Abgründe. Furchterregend sind die Gefechte, die gehörnte Böcke, ja selbst Ziegen liefern, die zum erstenmal zusammenkommen. Das Klappen der zusammenschlagenden Hörner tönt auf weithin. Sie stoßen sich ohne Erbarmen auf die Augen, das Maul, den Bauch, wie es trifft, und scheinen dabei ganz unempfindlich zu sein; auch läßt ein solcher, oft eine Viertelstunde dauernder Kampf kaum andere Spuren als etwa ein rotes Auge zurück. Ungehörnte Ziegen stoßen sich ebenfalls mit gehörnten und ungehörnten herum und achten es nicht, wenn ihnen das Blut über Kopf und Stirn herniederläuft. Ungehörnte legen sich aufs Beißen, doch ist dies ungefährlich. Mit den Füßen schlägt keine. Wenn man eine Ziege, die mit andern zusammengewöhnt, allein sperrt, so meckert sie ganz erbärmlich und frißt und säuft oft lange nicht. Wie der Mensch, so hat auch die Ziege allerhand Launen: die mutigste erschrickt zuweilen so vor ganz unbedeutenden Dingen, daß sie über Hals und Kopf Reißaus nimmt und gar nicht zu halten ist.
Der Bock hat etwas Ernstes und Würdevolles in seinem ganzen Betragen, zeichnet sich auch vor der Ziege durch entschiedene Keckheit und größeren Mutwillen aus. »Wenn es ans Naschen oder ans Spielen und Stoßen geht«, sagt Tschudi, »stellt er seine ganze Leichtfertigkeit heraus. Das Schaf hat nur in der Jugend ein munteres Wesen, ebenso der Steinbock; die Ziege behält es länger als beide. Ohne eigentlich im Ernste händelsüchtig zu sein, fordert sie gern zum muntern Zweikampfe heraus. Ein Engländer hatte sich auf der Grimsel unweit des Wirtshauses auf einem Baumstamme niedergesetzt und war über dem Lesen eingenickt. Das bemerkt ein in der Nähe umherstreifender Ziegenbock, nähert sich neugierig, hält die nickende Kopfbewegung für eine Herausforderung, stellt sich, nimmt eine Fechterstellung an, mißt die Entfernung und rennt mit gewaltigem Hörnerstoß den unglücklichen Sohn des freien Albions an, daß er sofort fluchend am Boden liegt und die Füße in die Luft streckt. Der siegreiche Bock, fast erschrocken über diese Widerstandslosigkeit eines Britenschädels, steigt mit dem einen Vorderfuße auf den Stamm und sieht neugierig nach seinem zappelnden und schreienden Opfer.«
Kämpfe mit dem Menschen und mit andern Tieren sind selten ernst gemeint; es scheint eher, daß es dem Bock darum zu tun ist, seine Bereitwilligkeit zum Kampfe zu zeigen, als den Gegner wirklich zu gefährden.
Die Ziege hat eine natürliche Zuneigung zum Menschen, ist ehrgeizig und für Liebkosungen im höchsten Grade empfänglich. Im Hochgebirge begleitet sie den Wanderer bettelnd und sich an ihn schmiegend oft halbe Stunden weit, und denjenigen, der ihr nur einmal etwas reichte, vergißt sie nicht und begrüßt ihn freudig, sobald er sich wieder zeigt. Weiß eine, daß sie gut steht bei ihrem Herrn, so zeigt sie sich eifersüchtig wie ein verwöhnter Hund und stößt auf die andere los, wenn der Gebieter diese ihr vorzieht. Klug und verständig wie sie ist, merkt sie es wohl, ob der Mensch ihr eine Unbilde zugefügt oder sie in aller Form Rechtens bestraft hat. Geschulte Ziegenböcke ziehen die Knaben bereitwillig und gern, selbst stundenlang, widersetzen sich aber der Arbeit aufs entschiedenste, sobald sie gequält oder unnötigerweise geneckt werden.
Auf den Hochgebirgen Spaniens wendet man die Ziegen, ihrer großen Klugheit wegen, als Leittier der Schafherden an. Die edleren Schafrassen werden dort während des ganzen Sommers auf den Hochgebirgen, im Süden oft in Höhen zwischen zwei bis dreitausend Meter über dem Meere geweidet. Hier können die Hirten ohne Ziegen gar nicht bestehen; allein sie betrachten die ihnen so nützlichen Tiere doch nur als notwendiges Übel.
»Glauben Sie mir, Señor«, sagte mir ein gesprächiger Andalusier auf der Sierra Nevada, »wenn ich sonst wollte, über meine beiden Leitziegen könnte ich mich totärgern! Sie tun sicherlich niemals das, was ich will, sondern regelmäßig das gerade Gegenteil, und ich muß sie gewähren lassen! Sie dürfen überzeugt sein, daß ich heute hier nicht weiden wollte, wo Sie mich gefunden haben; aber meine Ziegen wollten hier weiden, und ich mußte folgen. Nicht einmal mein Hund kann mit ihnen fertig werden. Wollte ich sie hetzen, sie führten meine ganze Herde in das Verderben. Da sehen Sie selbst!« Bei diesen Worten zeigte der gute Mann auf die beiden bösen Lockbuben der frommen, dummen Schafe, die soeben eine der gefährlichsten Felsenklippen erstiegen hatten und der Herde freundlich zumeckerten, zu diesem Punkte, der sicherlich eine schöne Aussicht versprach, aufzusteigen. Der Hund wurde abgesandt, um die störrischen Tiere herabzuholen; doch dies war keine so leichte Aufgabe. Zuerst zogen sich die beiden Böcke auf die höchste Spitze des Grates zurück, und Chizo, der ihnen folgen sollte, gab sich vergebliche Mühe, da hinauf und ihnen nachzuklettern. Der treue Diener des entrüsteten Hirten rutschte beständig von den glatten Felsen herab; sein Eifer wurde dadurch aber nur angespornt, und weiter und weiter kletterte er empor. Niesend begrüßten ihn die Ziegen, bellend antwortete der Hund, dessen Zorn sich mehr und mehr steigerte. Endlich glaubte er die Frevler erreicht zu haben; aber nein – sie setzten mit einem ebenso zierlichen als geschickten Sprunge über ihn weg und standen zwei Minuten später auf einem andern Felszacken, dort das alte Spiel von neuem beginnend. Die Schafherde hatte sich mittlerweile so vollständig in die Felsen eingewirrt und lief mit solcher Todesverachtung auf den schmalen Stegen dahin, daß dem Hirten und auch mir vom bloßen Zusehen bange wurde. Ängstlich rief jener den Hund zurück, und befriedigt nahmen die Ziegen dies wahr. Augenblicklich stellten sie sich wieder als Leiter der Herde und führten dieselbe nach Verlauf von einer reichlichen halben Stunde, ohne eins der teuren Häupter zu gefährden, aus dem Felsenwirrsal glücklich heraus. Ich war entzückt von dem unterhaltenden Lustspiel.
In vielen Orten überläßt man die Ziege sich selbst, so auch in den Alpen. Man treibt sie in ein bestimmtes, gänzlich abgelegenes Weidegebiet und sucht sie im Herbst wieder zusammen, wobei dann nicht selten manch teures Haupt fehlt, oder man schickt ihnen täglich oder auch nur wöchentlich durch einen Knecht etwas Salz, das sie auf einer bestimmten, ihnen wohlbekannten Steinplatte zur bestimmten Stunde sehnsüchtig erwarten. Da kommt es denn oft vor, daß sie sich zu den Gemsen begeben und mit diesen wochenlang ein ungebundenes Freileben führen. Solche von Jugend auf im Gebirge weidenden Ziegen ähneln ihren wilden Verwandten nicht allein hinsichtlich ihrer Gestalt, sondern auch in der Sicherheit und Kühnheit ihres Auftretens, klettern mit Gemsen und Steinböcken um die Wette und lernen die Höhe, ihre Freuden und Leiden, ihre Wirtlichkeit und Gefahren ebenso gut kennen wie wilde Gebirgstiere. In den Krainer Alpen habe ich die schönen, rotbraunen Hausziegen fast mit demselben Genusse, den Gemsen mir bereitet, stundenlang beobachtet. Sie weiden ohne alle Aufsicht, jederzeit in geschlossenen Trupps, nehmen bestimmte Wechsel an und halten sie ein, meiden Stellen, wo Rollsteine sie verletzen können, und weichen solchen, die sie bedrohen, mit ungemeinem Geschick und bewunderungswürdiger Gewandtheit aus. Letzteres erfuhr ich zufällig, als ich über eine steile, dem Anscheine nach tierleere Wand größere Steine rollte und plötzlich eine meinem Auge bisher verborgene, in wilder Flucht dahinstürmende Ziegenherde erblickte, die durch den rollenden Stein aus ihrer Ruhe aufgestört worden war. Die klugen Tiere flüchteten, sobald sie das Getöse des zur Tiefe stürzenden Steines vernahmen, und wählten, ohne sich zu besinnen oder zu täuschen, die der Sachlage und ihrer Absicht genau entsprechende Richtung. In der Tat werden selbst in den überaus wilden Kalkalpen Kärntens und Krains nur in seltenen Fällen Ziegen durch Rollsteine erschlagen, ebensowie es hier bloß ausnahmsweise einmal vorkommt, daß eine mit dem Gebirge vertraute Ziege sich versteigt oder durch Abstürzen ihr Leben verliert.
Im Innern Afrikas weiden die Ziegen ebenfalls nach eigenem Gutdünken, kommen aber abends in eine sogenannte Seriba oder Umzäunung von Dornen, wo sie vor den Raubtieren geschützt sind. Nicht selten begegnet man mitten im Urwalde einer bedeutenden Ziegenherde, deren eine Hälfte buchstäblich auf den Bäumen herumklettert, während die andere unten weidet. Unter allen Ziegen nämlich, die ich kennenlernte, ist mir die Zwergziege als die beweglichste und geschickteste erschienen; denn zu meiner nicht geringen Verwunderung hat sie mich belehrt, daß Wiederkäuer auch Bäume besteigen können. Es gewährt einen reizenden Anblick, wenn fünf bis zehn solcher kleinen Ziegen auf dem Wipfel einer größeren Mimose des Urwalds sich umhertreiben. Irgendein schiefgeneigter Stamm hatte das Erklimmen der Höhe ermöglicht, in der nun Äste und Zweige weitere Brücken bilden. Oft sieht man das kühne Geschöpf in Stellungen, die man Wiederkäuern kaum zutrauen möchte; mit jedem einzelnen Fuße steht die Ziege auf einem Zweige und weiß sich, unbekümmert um das Schaukeln ihres schwankenden Standorts, nicht allein im Gleichgewicht zu halten, sondern dehnt und reckt sich auch noch nach Bedürfnis, um den saftigen Mimosenblättern beizukommen. Unter den schirmförmigen Strauchbäumen der Steppen, die ihnen das Besteigen erschweren, erheben sich die Zwergziegen meist auf die Vorderfüße, um bis zu höheren Zweigen emporreichen zu können, und erscheinen dann, wie Schweinfurth sehr richtig hervorhebt, in so absonderlicher Weise, daß man sie, von fern betrachtet, als menschliche Gestalten ansehen kann. Nähert man sich solchem Baume, so sieht man sich plötzlich umringt von einer geringeren oder größeren Anzahl der heiteren Geschöpfe, die nach Art ihres Geschlechtes jeden sich nähernden Menschen bettelnd angehen. Dann trifft man wohl auch ein armseliges Zelt, in dem ein paar zerlumpte, sonnenverbrannte Araber hausen, deren ganzes Besitztum ein Wasserschlauch, ein Getreidesack, ein Reibstein und eine Tonplatte zum Rösten ihres Mehlbreis ist. Nachts geht es oft laut zu in der Seriba. Es gibt nicht viele Wiederkäuer, die so wenig schlafen wie die Ziegen; einige sind beständig rege, und selbst bei der größten Dunkelheit werden noch Gefechte ausgeführt, Wettläufe veranstaltet und Kletterkünste unternommen. Grauenvoll aber ist der Aufruhr, wenn sich ein Raubtier, zumal ein Löwe, einer solchen Seriba naht. Man glaubt, daß jede einzelne Ziege zehnerlei Stimmen zu gleicher Zeit ertönen läßt. Aus dem mutwilligen Meckern wird ein im höchsten Grade ängstliches Blöken oder Stöhnen; und wenn dann die eingepferchten Tiere die glänzenden Augen des Räubers durch den Dornenzaun hindurch leuchten sehen, kennt ihre Bestürzung keine Grenzen mehr. Wie besessen rennen sie in der Seriba auf und nieder, wie unsinnig stürzen sie sich gegen die dornigen Wände, klettern an diesen empor und bilden einen sonderbaren Kranz der Umhegung.
Amerika hat die Ziege erst durch die Europäer erhalten. Heutzutage ist sie über den Süden wie über den Norden des Erdteils verbreitet; doch betreibt man ihre Zucht nicht immer rätlich, scheint sie in manchen Gegenden sogar sehr zu vernachlässigen, so in Peru und Paraguay, in Brasilien und Surinam, wogegen man in Chile mehr auf sie achtet.
In Australien ist das nützliche Geschöpf erst neuerdings eingeführt worden, hat aber schon eine bedeutende Verbreitung erlangt.
Nach Beobachtungen, die man angestellt haben will, frißt die Ziege bei uns zulande von 576 Pflanzenarten 449. Ihre Unstetheit und Launenhaftigkeit zeigt sich deutlich bei dem Äsen. Sie hascht beständig nach neuem Genusse, pflückt allerwärts nur wenig, untersucht und nascht von diesem und jenem und hält sich nicht einmal beim Besten auf. Besonders erpicht ist sie auf das Laub der Bäume, richtet deshalb in Schonungen auch sehr bedeutenden Schaden an. Merkwürdigerweise frißt sie einzelne Pflanzen, die andern Tieren sehr schädlich sind, ohne den geringsten Nachteil: so Wolfsmilch, Schellkraut, Seidelbast, Pfaffenhütchen und Eberwurz, den scharfen Mauerpfeffer, Huflattich, Melisse, Salbei, Schierling, Hundspetersilie und ähnliches Kraut, mit Vergnügen auch Rauchtabak, Zigarrenstummel und dergleichen. Vom Genusse der Wolfsmilch bekommt sie gewöhnlich den Durchfall; Eibe und Fingerhut sind Gift für sie; Flohkraut und Spindelbaum behagen ihr ebenfalls schlecht. Am liebsten nimmt sie junge Blätter und Blüten von Hülsenpflanzen, Blätter der Kohl- und Rübenarten und die der meisten Bäume; am gedeihlichsten sind ihr alle Pflanzen, die auf trockenen, sonnigen, fruchtbaren Höhen wachsen.
Die Ziege ist schon mit einem Alter von einem halben Jahre zur Fortpflanzung geeignet. Ihre Paarungslust, die gewöhnlich in die Monate September bis November fällt und zuweilen noch ein zweites Mal im Mai sich einstellt, zeigt sich durch vieles Meckern und Wedeln mit dem Schwanze an. Läßt man ihr den Willen nicht, so wird sie leicht krank. Der Bock ist zu allen Zeiten des Jahres brünstig und reicht, wenn er im besten Alter, d. h. in seinem zweiten bis achten Jahre steht, für hundert Ziegen hin. Einundzwanzig bis zweiundzwanzig Wochen nach der Paarung wirft die Mutterziege ein, zwei, seltener drei und nur ausnahmsweise vier oder fünf Junge; in diesem Falle aber geht sie oder wenigstens ihre Nachkommenschaft gewöhnlich zugrunde. Wenige Minuten nach ihrer Geburt richten sich die Zicklein auf und suchen das Euter ihrer Erzeugerin; am nächsten Tage schon laufen sie herum, und nach vier bis fünf Tagen folgen sie der Alten überall hin. Sie wachsen rasch: im zweiten Monate sprossen die Hörnchen hervor; nach Verlauf eines Jahres haben sie fast ihre volle Größe erreicht.
Der Nutzen der Ziege, die man in vielen Gegenden als den größten Freund der Armen bezeichnen darf, ist sehr bedeutend. Ihre Unterhaltung kostet wenig, im Sommer sozusagen gar nichts: sie aber versorgt das Haus mit Milch und liefert dem Unbemittelten auch noch den Dünger für sein gemietetes Feldstück. Lenz hat gewissenhaft Buch geführt und gefunden, daß eine gut gefütterte Ziege im Jahre 1834 etwa achtzig Mark wert war; gegenwärtig aber wird sich der Ertrag einer Ziege entsprechend höher belaufen und der Überschuß immer erheblich sein.
Hier und da, so in Ägypten, treibt man die Ziegen mit strotzendem Euter vor die Häuser der Milchkäufer und melkt die gewünschte Menge gleich vor der Türe. Der Käufer hat dadurch den Vorteil, lauwarme Milch zu erhalten, und der Verkäufer braucht nicht erst zu Künsteleien, namentlich zu der ihm oft als notwendig erscheinenden Verbesserung durch Wasser, seine Zuflucht zu nehmen. Man begegnet selbst in den größten Städten Ägyptens einer Frau, hinter der eine zahlreiche Ziegenherde meckernd herläuft. Sie ruft » lebn, lebn hilwe«, d. h. »süße, süße Milch«, und hier und dort öffnet sich ein Pförtchen, und ein mehr oder minder verschleierter dienstbarer Geist weiblichen Geschlechts oder ein brauner Äthiopier, der die Küche eines Junggesellen zu besorgen hat, schlüpft heraus, kauert sich auf den Boden hin, die Verkäuferin melkt ihm sein Gefäß voll, und weiter geht die Rufende mit ihrer meckernden Gesellschaft. Die Ziegen der Nomaden und festwohnenden Sudanesen werden täglich zweimal gemolken und rennen, wenn die Milch sie drückt, wie toll zu dem einfachen Zelte oder Hause ihres Herrn, gleichviel, ob sie heute hier und morgen dort eingestellt werden; denn sie wissen den jeweiligen Wohnplatz ihres Gebieters mit aller Sicherheit aufzufinden.
Außer der Milch und dem von ihr gewonnenen Käse, der in Griechenland eine große Rolle spielt, oder der Butter und der Wolle nützt die Ziege durch ihr Fleisch, ihr Fell und ihre Hörner. Das Fleisch junger Zicklein ist sehr wohlschmeckend, obwohl fast etwas zu zart, das älterer Ziegen nicht schlecht; und wenn wir es nicht so hoch achten wie andere Völkerschaften, beispielsweise die Araber Sansibars, die es dem Rindfleisch vorziehen, beweisen wir damit nur, daß mit dem Geschmack nicht zu rechten ist. Das Fell wird zu Korduan und Saffian, seltener zu Pergament verarbeitet; für erstere Lederarten bildet das Morgenland immer noch die Hauptquelle. Aus den Fellen der Böcke verfertigt man Beinkleider und starke Handschuhe, in Griechenland Wein- und in Afrika Wasserschläuche. Das grobe Haar wird hier und da zu Pinseln benutzt oder zu Stricken gedreht. Die Hörner fallen den Drechslern, im Morgenlande dem Wundarzte anheim, der sie als Schröpfköpfe zu verwenden pflegt. So nützt also das vortreffliche Tier im Leben wie im Tode.
Auf den hohen Gebirgen Nordamerikas lebt eine Ziege, die durch ihr Gehörn sich so erheblich von den Familiengenossen unterscheidet, daß man sie zum Vertreter einer besonderen Sippe erhoben und als Antilope angesehen hat. Ich vermag nicht einer solchen Ansicht beizupflichten, muß vielmehr das fragliche Tier als eine echte Ziege erklären, weil mit Ausnahme des Gehörns alle übrigen Merkmale für meine Ansicht sprechen.
Die Schneeziege, Berg- oder Weißziege der Amerikaner, Nane der Kanadier ( Capra montana), hat durchaus die Gestalt der Hausziege, sieht jedoch infolge ihrer sehr reichen Behaarung gedrungener und kurzhälsiger aus als eine solche, obgleich ihr Leib eigentlich schlank genannt werden muß. Der Kopf ist gestreckt, das Auge groß, das Ohr mittellang und scharf zugespitzt. Die Hörner fallen durch ihre geringe Größe und Schlankheit, ihre Richtung und Wulstung auf, sind höchstens 20 Zentimeter lang, an der Wurzel fast rund und in der unteren Hälfte leicht geringelt, im zweiten Dritteil seitlich etwas zusammengedrückt, an der Spitze wieder gerundet. Das am ganzen Körper gleichfarbige, weiße Haarkleid besteht aus langem, hartem Grannenhaare und aus feiner, langer, schlichter Unterwolle, die beide teils einzeln, teils vereinigt auftreten, bedeckt den Leib und seine Glieder jedoch in sehr verschiedener Weise. Am Kinn und Unterkiefer hängt der üppige Bart in dichten, förmlich abgeteilten Locken herab; den Hals bedeckt ein über das Schulterblatt herabfallender Kragen langer Haare, der sich auf der Vorderseite der Schultern und der Oberarme in einen mähnenartigen Behang fortsetzt und die Vorderbeine fast verhüllt; eine ähnliche Mähne umkleidet die Vorderseite der Hinterbeine, entwickelt sich jedoch erst oberhalb der Ferse; der Schwanz endlich ist mit einer langen und dicken Grannenquaste bestanden. Im Gesicht bekleidet die Wolle alle Teile. Das Fell fühlt sich fettig an wie Schafwolle und besitzt einen ziemlich festen Zusammenhang, indem die einzelnen Haare merklich aneinander haften. Die Gesamtlänge des Tieres beträgt 1,2 Meter, die Schwanzlänge 9 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 68, die Kreuzhöhe 73 Zentimeter. Von dem vorstehend beschriebenen Tiere, einer im Museum zu Leyden befindlichen Ziege, unterscheidet sich, nach Angabe amerikanischer Forscher, der Bock einzig und allein durch etwas bedeutendere Größe, ein wenig stärkere, jedoch im wesentlichen gleichgestaltete Hörner und den längeren Bart.
Das Verbreitungsgebiet der Schneeziege beschränkt sich auf den nördlichen Teil des Felsengebirges und reicht nach Norden hin bis zum 65. Breitengrade. Laut Baird tritt sie am häufigsten auf den Hochgebirgen des Washingtongeländes, laut Prinz von Wied hier besonders im Quellgebiete des Columbiaflusses auf. Über ihre Lebensweise sind wir erst in der neuesten Zeit einigermaßen unterrichtet worden. Nach Angabe des ungenannten Berichterstatters bewohnt sie einen so bedeutenden Höhengürtel, daß sie zu ihrer Äsung nichts anderes findet als Flechten und Moose und Alpenpflanzen der ausdauerndsten Art, im günstigsten Falle einige wenige verkümmerte Gebüsche einer Kiefer ( Pinus contorta) und ähnliche dürftige Gebüsche. Gleichwohl führt sie um diese Zeit ein recht behagliches Leben, und die Sorge tritt erst an sie heran, wenn sie im Winter genötigt ist, ihre Hochalpenweiden zu verlassen. Während des Sommers klimmt sie bis zu fünftausend Meter unbedingter Höhe im Gebirge empor und wählt ihren Stand dann mit Vorliebe am unteren Rande der schmelzenden Schneefelder, im Winter pflegt sie etwas tiefer herabzusteigen, ohne jedoch das eigentliche Hochgebirge zu verlassen. In solchen Gebirgswildnissen, die nur ausnahmsweise von Menschen betreten werden, geht sie mit sorgloser Eile ihre verschlungenen Pfade, mit der Sicherheit ihres Geschlechts von einem Felsblock zum andern springend und die scheinbar unzugänglichsten Wände bekletternd. Abweichend von andern Ziegenarten sollen Böcke die Führung übernehmen und ihnen Ziegen und Kitzchen in einfacher Reihe folgen. Aufgescheucht, oder durch einen Schuß erschreckt, eilen die Trupps in vollem Galopp an den Rändern der fürchterlichsten Abgründe dahin oder kreuzen eine Schlucht, eine nach der andern dieselbe Stelle betretend, eher mit der Leichtigkeit und Anmut eines beschwingten Geschöpfes als nach Art des behendesten und gewandtesten Vierfüßlers. Außerordentlich vorsichtig und begabt mit ungemein scharfem Gehör und Geruch, vereitelt die Schneeziege in den meisten Fällen jede Annäherung seitens des Menschen und läßt sich deshalb ebenso schwer beobachten als erlegen. Die Satzzeit fällt in den Anfang des Juni; denn von dieser Zeit an sieht man kleine Kitzchen, und zwar regelmäßig je eins hinter jeder Mutterziege, in selteneren Fällen Zwillinge. Die Kitzchen sind überaus niedliche, wie alle Ziegen spiellustige, in der Behendigkeit ihrer Sprünge geradezu unübertreffliche Wesen.
In leiblicher Hinsicht stehen die Schafe ( Ovinae) den Ziegen außerordentlich nah, in geistiger Hinsicht haben nur die wild lebenden Arten beider Gruppen Ähnlichkeit miteinander. Die Schafe unterscheiden sich von den Ziegen durch die regelmäßig vorhandenen Tränengruben, die flache Stirn, die kantigen, etwa dreiseitigen, querrunzeligen, schneckenförmig gedrehten Hörner und den Mangel eines Bartes. Im allgemeinen sind sie schlankgebaute Tiere mit schmächtigem Leibe, dünnen, hohen Beinen und kurzem Schwanze, vorn stark verschmälertem Kopfe, mäßig großen Augen und Ohren und doppelter, zottiger oder wolliger Behaarung.
Alle wildlebenden Schafe bewohnen Gebirge der nördlichen Erdhälfte. Ihre eigentliche Heimat ist Asien; ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich jedoch bis Südeuropa, Afrika und den nördlichen Teil von Amerika. Jede Gebirgsgruppe Asiens besitzt eine oder mehrere ihr eigentümliche Arten, wogegen Europa, Afrika und Amerika sehr arm erscheinen und, soviel bis jetzt bekannt, je nur eine einzige Art aufzuweisen haben. Es hat sich herausgestellt, daß ungeachtet einer nicht unerheblichen Veränderlichkeit des Gehörns einer und derselben Art das Gepräge der Hornbildung unzweifelhaft als eins der Hauptmerkmale zur Bestimmung der Arten angesehen werden darf.
Sämtliche Schafe sind echte Gebirgskinder, scheinen sich nur in bedeutenden Höhen wohl zu fühlen und steigen meist bis über die Schneegrenze, einzelne bis zu sechs- und siebentausend Meter unbedingter Höhe empor, wo außer ihnen nur noch Ziegen, ein Rind, das Moschustier und einige Vögel leben können. In ebenen Gegenden hausen bloß zahme Schafe, und man sieht es denen, die in Gebirgsländern gezüchtet werden, deutlich genug an, wie wohl es ihnen tut, eine ihnen zusagende Örtlichkeit bewohnen zu dürfen. Grasreiche Triften oder lichte Wälder, schroffe Felsen und wüste Halden, zwischen denen nur hier und da ein Pflänzchen sprießt, bilden die Aufenthaltsorte der Wildschafe. Je nach der Jahreszeit wandern sie von der Höhe zur Tiefe oder umgekehrt; der Sommer lockt sie nach oben, der eisige Winter treibt sie in wohnlichere Gelände, weil er ihnen in der Höhe den Tisch verdeckt. Die Nahrung besteht im Sommer aus frischen und saftigen Alpenkräutern, im Winter aus Moosen, Flechten und dürren Gräsern. Die Schafe sind lecker, wenn sie reiche Auswahl haben, und genügsam im hohen Grade, wenn sich ihnen nur weniges bietet; dürre Gräser, Schößlinge, Baumrinden und dergleichen bilden im Winter oft ihre einzige Äsung, ohne daß man ihnen deshalb Mangel anmerkt.
Mehr als bei andern Haustieren, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Renntieres, sieht man an den Schafen, wie die Sklaverei entartet. Das zahme Schaf ist nur noch ein Schatten von dem wilden. Die Ziege bewahrt sich bis zu einem gewissen Grade auch in der Gefangenschaft ihre Selbständigkeit: das Schaf wird im Dienste des Menschen ein willenloser Knecht. Alle Lebhaftigkeit und Schnelligkeit, das gewandte, behende Wesen, die Kletterkünste, das kluge Erkennen und Meiden oder Abwehren der Gefahr, der Mut und die Kampflust, die die wilden Schafe zeigen, gehen bei den zahmen unter; sie sind eigentlich das gerade Gegenteil von ihren freilebenden Brüdern. Diese erinnern noch vielfach an die munteren, klugen, geweckten und übermütigen Ziegen: denn sie stehen ihnen in den meisten Eigenschaften und Fertigkeiten gleich und haben denselben regen Geist, dasselbe lebhafte Wesen; die zahmen sind unausstehliche Geschöpfe und können wahrhaftig nur den Landwirt begeistern, der aus dem wertvollen Vliese guten Gewinn zieht. Charakterlosigkeit ohnegleichen spricht sich in ihrem Wesen und Gebaren aus. Der stärkste Widder weicht feig dem kleinsten Hunde; ein unbedeutendes Tier kann eine ganze Herde erschrecken; blindlings folgt die Masse einem Führer, gleichviel ob derselbe ein erwählter ist oder bloß zufällig das Amt eines solchen bekleidet, stürzt sich ihm nach in augenscheinliche Gefahr, springt hinter ihm in die tobenden Fluten, obgleich es ersichtlich ist, daß alle, die den Satz wagten, zugrunde gehen müssen. Kein Tier läßt sich leichter hüten, leichter bemeistern als das zahme Schaf; es scheint sich zu freuen, wenn ein anderes Geschöpf ihm die Last abnimmt, für das eigene Beste sorgen zu müssen. Daß solche Geschöpfe gutmütig, sanft, friedlich, harmlos sind, darf uns nicht wundern. In den südlichen Ländern, wo die Schafe sich mehr überlassen sind als bei uns, erscheinen sie selbständiger, kühner und mutiger als hierzulande.
Die Vermehrung der Schafe ist ziemlich bedeutend. Das Weibchen bringt nach einer Tragzeit von zwanzig bis fünfundzwanzig Wochen ein oder zwei, seltener drei oder vier Junge zur Welt, die bald nach ihrer Geburt imstande sind, den Alten nachzufolgen. Die wilden Mütter verteidigen ihre Jungen mit Gefahr ihres Lebens und zeigen eine außerordentliche Liebe zu ihnen: die zahmen sind stumpf gegen die eigenen Kinder wie gegen alles übrige und glotzen den Menschen, der ihnen die Lämmer wegnimmt, unendlich dumm und gleichgültig an, ohne sich zu wehren. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit werden die Jungen selbständig und bereits vor ihrem erfüllten ersten Lebensjahre selbst wieder fortpflanzungsfähig.
Fast alle wilden Arten lassen sich ohne erhebliche Mühe zähmen und behalten ihre Munterkeit wenigstens durch einige Geschlechter bei, pflanzen sich auch regelmäßig in der Gefangenschaft fort. An Leute, die sich viel mit ihnen abgeben, schließen sie sich innig an, folgen ihrem Rufe, nehmen gern Liebkosungen entgegen und können einen so hohen Grad von Zähmung erlangen, daß sie mit andern Haustieren auf die Weide gesandt werden dürfen, ohne günstige Gelegenheiten zur Wiedererlangung ihrer Freiheit zu benutzen. Die zahmen Schafe hat der Mensch, der sie seit Jahrtausenden pflegte, ihres hohen Nutzens wegen über die ganze Erde verbreitet und mit Erfolg auch in solchen Ländern eingeführt, die ihnen ursprünglich fremd waren.
*
An die Spitze der zu schildernden Wildschafe dürfen wir eine Art stellen, die wegen des Mangels der Tränendrüsen und des noch wenig entwickelten Gehörns an die Ziegen erinnert: das Mähnenschaf ( Ovis tragelaphus), ein durch seine lang herabfallende Mähne sehr ausgezeichnetes Tier. Der Bau ist gedrungener als bei den meisten übrigen Schafen. Das auf der Stirn aufgesetzte Gehörn biegt sich anfangs ein wenig nach vorn, sodann gleichmäßig nach hinten und außen, mit den Spitzen etwas nach unten und innen, hat dreieckigen Querschnitt und ist von der Wurzel bis zur Spitze auf allen Seiten mit dicht aneinanderstehenden, wenig erhabenen, welligen Wülsten bedeckt, die nur an der abgeplatteten Spitze fehlen. Das Vlies besteht aus starken, harten, rauhen, nicht besonders dicht stehenden Grannen und feinen, gekräuselten, den Leib vollständig bekleidenden Wollhaaren. Jene verlängern sich auf dem Oberhalse, im Nacken und auf dem Widerriste zu einem aufrechtstehenden, kurzen, mähnigen Haarkamme und entwickeln sich vorder- und unterseits zu einer reichen und vollen, fast bis auf den Boden herabfallenden Mähne, die an der Kehle beginnt, einen längs des Halses verlaufenden, am Unterhalse sich teilenden und beiderseits in der Schlüsselbeingegend weiter ziehenden Streifen einnimmt, aber auch noch auf die Vorderläufe sich fortsetzt. Ein sehr gleichmäßiges Fahlrotbraun bildet die vorherrschende Färbung des Tieres. Das Weibchen unterscheidet sich hauptsächlich durch die schwächere Mähne vom Männchen; denn sein Gehörn ist ebenfalls groß und kräftig. Vollkommen erwachsene Böcke erreichen, einschließlich des etwa 25 Zentimeter langen Schwanzes, eine Gesamtlänge von 1,8 bis 1,9 Meter, bei einer Schulterhöhe von 95 Zentimeter bis 1 Meter, erwachsene Schafe eine Gesamtlänge von 1,55 Meter bei 90 Zentimeter Schulterhöhe.
Bereits im Jahre 1561 beschrieb Cajus Britannicus das Mähnenschaf, dessen Fell ihm aus Mauretanien gebracht worden war. Seitdem verging lange Zeit, ehe wieder etwas über das Tier verlautete; erst Pennant und später Geoffroy erwähnen es von neuem. Letzterer fand es in der Nähe von Kairo im Gebirge auf; andere Forscher haben es am oberen Nil und in Abessinien beobachtet. Am häufigsten tritt es im Atlas auf.
Neuerdings ist das Mähnenschaf öfter lebend nach Europa gekommen und gegenwärtig in Tiergärten keine Seltenheit. Über sein Gefangenleben läßt sich wenig sagen, weil das Tier, abgesehen von seiner Kletterfertigkeit, hervorragende Eigenschaften nicht bekundet. Seinen Wärter lernt es kaum von andern Menschen unterscheiden, ihn wenigstens nicht als Pfleger und Freund, sondern höchstens als einen ihm willigen Diener erkennen, der regelmäßig Futter bringt; in ein wirkliches Freundschaftsverhältnis zu ihm tritt es nie. Solange es jung ist, flieht es den täglich gesehenen Mann wie alle andern Menschen, im Alter stellt es sich trotzig und störrisch zur Wehr. Ein gewisser Ernst, den man fast Murrsinn nennen könnte, zeichnet es aus; das neckische Wesen der Ziegen fehlt ihm vollständig. Es kann wegen einer Kleinigkeit in Zorn, wegen einer Geringfügigkeit in Wut geraten und pflegt dann in beiden Fällen zu beweisen, daß es sich seiner Stärke wohl bewußt ist. Wenn er will, nimmt der Bock es mit dem stärksten Manne auf, indem er seinen Gegner einfach über den Haufen rennt. Mit andern Tieren scheint das Mähnenschaf leichter als mit dem Menschen in ein gewisses Einvernehmen zu treten; von einem wirklichen Freundschaftsverhältnisse kann aber auch in diesem Falle nicht gesprochen werden. Ihm auffallende oder gefährlich scheinende Tiere, Hunde zum Beispiel, fürchtet es und rennt bei ihrem Erscheinen mit der allen Schafen eigenen Sinnlosigkeit wie toll gegen die Gitterwände an; mit ihm nahestehenden Verwandten, Ziegen und Schafen, Steinböcken oder Mufflons, verträgt es sich zwar zuweilen, selten jedoch längere Zeit, denn sobald es, mindestens der Bock, in ihnen einen ihm ebenbürtigen Genossen erkennt, kämpft er ebenso wie mit andern Böcken seiner Art beharrlich ernst und ausdauernd, falls die Liebe ins Spiel kommt, tatsächlich auf Leben und Tod, da er unter Umständen nicht eher ruht, als bis einer der Kämpen leblos auf dem Platze bleibt. Nach alledem kann man das Mähnenschaf nicht als einen angenehmen Gefangenen bezeichnen; durch seine Größe, seine Gestalt und die eigentümliche Haarmähne macht es einen gewissen Eindruck auf den Beobachter, ist aber wenig geeignet, diesen länger zu fesseln.

Mähnenschafe ( Ovis tragelaphus)
Nur zwei Breitengrade trennen das Mähnenschaf von dem Mufflon ( Ovis musimon), dem einzigen Wildschafe, das Europa, und zwar die Felsgebirge der Inseln Sardinien und Korsika bewohnt. Ziemlich allgemein nimmt man an, daß der Mufflon in früheren Zeiten noch in andern Teilen Südeuropas vorgekommen sei, sich beispielsweise auch auf den Balearischen Inseln und in Griechenland gefunden habe, vermag diese Meinung jedoch in keiner Weise zu begründen. Zurzeit findet sich der Mufflon auf Sardinien und Korsika noch immer in Rudeln von fünfzig bis hundert Stück und ist dort allen Gebirgsbewohnern wohlbekannt. Aus alten Berichten erfahren wir, daß diese Wildschafe außerordentlich häufig waren. Bisweilen wurden auf einer einzigen großen Jagd vier- bis fünfhundert Stück erlegt; gegenwärtig ist man froh, wenn man einige Stücke bekommt.

Mufflon ( Ovis musimon)
Der Mufflon gehört zu den kleinsten Wildschafen, obgleich seine Länge, einschließlich des höchstens 10 Zentimeter langen Schwanzes, immerhin 1,25 Meter, die Höhe am Widerriste 70 Zentimeter und das Gewicht zwischen 40 und 50 Kilogramm beträgt. Die Hörner erreichen, der Krümmung nach gemessen, eine Länge von etwa 65 Zentimeter und ein Gewicht von 4 bis 6 Kilogramm. Der Leibesbau ist der gedrungene aller Wildschafe. Die ziemlich kurze Behaarung liegt glatt an, ist, zumal im Winter, weil dann das kurze, feine und krause Wollhaar in reichlicher Menge auftritt, außerordentlich dicht, verlängert sich an der Brust und bildet gleichsam eine kurze Mähne. Die Rückenlinie ist dunkelbraun, die übrige Färbung ein fuchsiges Rot, das am Kopfe ins Aschgraue spielt und an der Schnauze, am Kreuze, am Rande des Schwanzes, an den Fußenden und auf der Unterseite ins Weiße übergeht. Im Winter dunkelt das Fell und geht mehr ins Kastanienbraune über, und es sticht dann zu beiden Seiten ein großer, fast viereckiger, blaßgelblicher oder weißlicher Flecken von der allgemeinen Färbung ab. Das merklich kleinere Weibchen unterscheidet sich durch seine mehr ins Fahle spielende Färbung sowie durch das Fehlen oder seltene Vorkommen des Gehörns vom Bocke; seine Hörner sind, wenn überhaupt vorhanden, immer sehr kurz, höchstens 5 bis 6 Zentimeter lang, stumpfen Pyramiden vergleichbar.
Im Gegensatz zum Mähnenschafe soll sich der Mufflon in Scharen von fünfzig bis hundert Stück rudeln, deren Leitung ein alter und starker Bock übernimmt. Diese Rudel erwählen sich, laut Mimaut, die höchsten Berggipfel zu ihrem Aufenthalte und nehmen hier an schroffen und mehr oder weniger unzugänglichen Felsenwänden ihren Stand. Wie bei andern gesellig lebenden Wiederkäuern halten stets einige Stück sorgfältig Umschau, stoßen bei Wahrnehmung eines verdächtigen Gegenstandes einen Schreckruf aus und benachrichtigen dadurch die Genossen, die daraufhin mit jenen sofort flüchtig werden. Zur Brunstzeit trennen sich die Rudel in kleine, aus einem Bocke und mehreren Schafen bestehende Trupps, die der leitende Widder erst durch tapfere Kämpfe sich erworben hat. So furchtsam und ängstlich der Mufflon sonst ist, so kühn zeigt er sich im Kampfe mit seinesgleichen. In den Monaten Dezember und Januar hört man das Knallen der aneinander gestoßenen Gehörne im Gebirge widerhallen, und wenn man vorsichtig dem Schalle folgt, sieht man die starken Widder des Rudels gesenkten Kopfes sich gegenüberstehen und mit solcher Gewalt gegeneinander anrennen, daß man nicht begreift, wie die Streiter auf ihren Kampfplätzen sich erhalten können. Nicht selten geschieht es, daß einer der Nebenbuhler über die Felsenwände hinabgestoßen wird und in der Tiefe zerschellt.
Einundzwanzig Wochen nach der Begattung, im April oder Mai, bringt das Schaf ein oder zwei Junge zur Welt, die der Mutter schon nach wenigen Tagen auf den halsbrechendsten Pfaden mit der größten Sicherheit folgen und ihr bald in allen Kunstfertigkeiten gleichkommen. Im Alter von vier Monaten sprossen bei den jungen Böckchen die Hörner; nach Jahresfrist denken sie bereits an die Paarung, obwohl sie erst im dritten Jahre völlig ausgewachsen und mannbar sein dürften.
Die Bewegungen des Mufflon sind lebhaft, gewandt, schnell und sicher, aber nicht eben ausdauernd, am wenigsten auf ebenem Boden. Seine Meisterschaft beruht im Klettern. Cetti sagt, daß er sehr furchtsam ist und bei dem geringsten Geräusch vor Angst und Schrecken am ganzen Leibe zittert, auch sobald als möglich flüchtet. Wenn ihn seine Feinde so in die Enge treiben, daß er sich nicht mehr durch seine Kletterkünste retten kann, harnt er vor Angst, oder spritzt, wie andere glauben, den Harn seinen Feinden entgegen. Als solche darf man den Wolf und den Luchs ansehen; Junge fallen wohl auch den Adlern und möglicherweise dem Geieradler zur Beute.
Der Mensch gebraucht jedes Mittel, um das wertvolle Jagdtier zu erlangen. Während der Brunstzeit sollen die Böcke von den im Dickicht verborgenen Jägern durch das nachgeahmte Blöken der Schafe herbeigezogen werden können; die gewöhnliche Jagd ist jedoch die Birsche. Das Wildbret der erlegten Böcke liefert ein auserlesenes Gericht, da es würzigen Wildgeschmack mit dem Geschmack des Hammelfleisches vereinigt. Ende Mai beginnt die Feistzeit des Mufflons, der dann fast ebensoviel Fett angesetzt hat wie ein wohlgenährter, halbgemästeter Hammel. Als besonderer Leckerbissen gilt das gereinigte, strickartig zusammengedrehte und gebratene Gedärm, das Corda genannt wird. Außer dem Wildbret verwendet man Fell und Gehörn; höher als alles zusammen aber wertet man Bezoare, die man dann und wann in der ersten Abteilung des Magens findet und als unfehlbar wirkendes, schweißtreibendes Mittel betrachtet.
Alte, erwachsene Mufflons fängt man wohl nie, junge nur, nachdem man ihre Mutter weggeschossen hat. Sie gewöhnen sich, laut Cetti, bald an ihren Pfleger, bewahren aber ungeachtet der großen Zahmheit, die sie erlangen, immer die Munterkeit und das gewandte Wesen, das die wilden so auszeichnet. Auf Sardinien und Korsika trifft man in den Dörfern häufig gezähmte Mufflons an; einzelne zeigen sich so anhänglich an den Menschen, daß sie ihm, gleich einem Hunde, auf allen Pfaden folgen, auf den Ruf hören usw. Nur durch ihren Mutwillen werden sie lästig. Sie durchstöbern alle Winkel im Hause, stürzen dabei Geräte um, zerbrechen die Töpfe und treiben noch andern Unfug, zumal in denjenigen Räumen des Hauses, über die sie unumschränkte Herrschaft haben. Alte Böcke werden manchmal wirklich bösartig und lassen sich selbst durch Züchtigung nicht bändigen, verlieren überhaupt alle Scheu vor dem Menschen, sobald sie ihn kennengelernt, und kämpfen dann nicht bloß zur Abwehr, sondern aus reinem Übermut mit ihm. Sie sind schwachgeistig, ohne Urteilsfähigkeit und sehr vergeßlich. Ich legte ihnen Fallen und lockte sie durch vorgehaltenes Futter, zumal durch besondere Leckereien, in dieselben. Sie gingen ohne Besinnen immer wieder in die Schlingen und Netze, obgleich es ihnen höchst unangenehm zu sein schien, wenn sie sich gefangen hatten. Ein gewisser Ortssinn, schwache Erinnerung an empfangene Wohltaten, Anhänglichkeit an die gewohnten Genossen und Liebe zu den Jungen: das sind die Anzeichen ihrer geistigen Tätigkeit, die ich an ihnen beobachtet habe.
Schon die Alten wußten, daß Mufflon und Hausschaf sich fruchtbar vermischen, nicht aber, daß auch die Blendlinge, von ihnen Umber genannt, unter sich oder mit andern Hausschafen wiederum fruchtbar sind. In der kaiserlichen Menagerie zu Schönbrunn wurden, wie Fitzinger berichtet, mehrere Male Mufflons mit deutschen Landschafen gepaart. Die Bastarde aus dieser Kreuzung paarte man zuweilen wieder mit dem Mufflon, zuweilen mit dem Hausschafe, und immer mit Erfolg. Dagegen sollen Versuche, Mufflon und Hausziege zu kreuzen, fruchtlos geblieben sein.
Der berühmteste Reisende des Mittelalters, Marco Polo, der Ende des dreizehnten Jahrhunderts das Innere Asiens durchwanderte, erzählt, daß er auf der östlich von Bokara, etwa fünftausend Meter über dem Meere gelegenen Hochebene von Pamir riesige Schafe gesehen habe. Die Hörner derselben hätten eine Länge von drei, vier oder selbst sechs Handbreiten und würden von den Hirten als Gefäße zur Aufbewahrung ihrer Nahrungsmittel benutzt. Viele von besagten Wildschafen fielen den Wölfen zur Beute, und man finde daher große Mengen Von Gehörnen und Knochen, aus denen die Hirten Haufen aufzutürmen pflegten, um den Reisenden die Richtung des Weges anzugeben, wenn Schnee die Ebene decke. Bis in die neueste Zeit erfuhren wir nichts Näheres über das ausgezeichnete Tier, und es blieb erst Sewerzoff und Przewalski vorbehalten, uns nicht allein mit Gestalt und Färbung, sondern auch mit der Lebensweise dieses größten aller bisher beschriebenen Wildschafe bekanntzumachen. Sewerzoff, der im Tienschan nicht weniger als vier von ihm als verschieden angesehene Wildschafarten gefunden und beschrieben hat, traf zuerst im Hochlande des oberen Naryn auf die Spuren des bis dahin nur nach dem Gehörn bekannten Wiederkäuers und sammelte nicht bloß eine größere Anzahl von Schädeln mit den Gehörnen, sondern war auch so glücklich, mehrere Katschkare, wie er sie nennt, zu erbeuten. Fast gleichzeitig mit ihm, im Jahre 1874, beschrieb auch Stolicza, und drei Jahre später Przewalski dasselbe Schaf, und somit sind wir gegenwärtig in erwünschter Weise unterrichtet.
Der Katschkar ( Ovis polii) erreicht tatsächlich eine gewaltige Größe; denn die Gesamtlänge des erwachsenen Bocks beträgt nach Stolicza 1,96, nach Sewerzoff ohne Schwanz sogar 2,04 Meter, die Kopflänge 35, die Schwanzlänge 11 Zentimeter, die Schulterhöhe 1,2 Meter, das Gewicht 14 Pud oder rund 230 Kilogramm. Der stämmige Leib ruht auf starken, aber hageren und deshalb wohlgestalteten Beinen; der Kopf, der von dem Tier beständig erhoben getragen werden soll, ist trotz der leicht gebogenen Nase und der geneigten Muffel ausdrucksvoll, das Auge mäßig groß, aber lebhaft, sein Stern braun, das Ohr verhältnismäßig klein, schmal und scharf zugespitzt; mäßig große und tiefe Tränengruben sind vorhanden. Die fast dreiseitigen, auf der ganzen Oberfläche mehr oder weniger deutlich gewulsteten Hörner des alten Bocks berühren einander an der Wurzel, wenden sich sodann allgemach in einem weiten Bogen nach rück- und auswärts, beschreiben einen vollen Kreis, kehren sich mit ihren zusammengedrückten Spitzen wieder rück- und auswärts und erreichen, der Krümmung nach gemessen, eine Länge von 1,6 Meter und darüber, bei einem Wurzelumfang von 50 Zentimeter. Das Fell verlängert sich auf dem Hinterkopf und im Nacken, bildet auch rings um den Hals eine Mähne aus groben, wolligen, 13 bis 14 Zentimeter langen Haaren, wird auf dem Rücken etwa halb so lang und besteht aus starken, harten, sehr dichtstehenden Grannen, zwischen deren Wurzeln eine spärliche, aber außerordentlich feine Wolle hervorsproßt. Die allgemeine Färbung des alten Bocks im Winterkleide ist nach Stolicza ein schimmeliges oder wie bereift erscheinendes Braun, das auf dem Oberhalse und über den Schultern in Rötlich- oder Hellbraun übergeht, in der Lendengegend aber dunkelt; über den Rücken bis zum Schwänze herab verläuft eine dunkle Mittellinie; der Kopf ist oben und an den Seiten gräulichbraun, am dunkelsten am Hinterkopf, die Mitte des Unterhalses schimmligweiß, etwas mit Hellbraun getrübt; die Seiten des Körpers und der obere Teil der Beine sind braun und weiß gemischt, das Gesicht ist rein weiß. Das Weibchen hat ein sehr viel kleineres Gehörn, ähnelt im übrigen dem Männchen aber sehr.
Das Verbreitungsgebiet des Katschkar scheint keineswegs auf das Tienschangebiet und Nordtibet beschränkt zu sein, sondern auch auf andere Hochflächen Innerasiens sich zu erstrecken. Sewerzoff bezeichnet ihn als das eigentliche Hochland- oder Pamirschaf und betont ausdrücklich, daß eine über der Holzgrenze gelegene Hochebene unumgängliche Bedingung für sein Vorkommen sei. Höchstwahrscheinlich fesseln ihn an seinen Stand die in jenen Hochebenen wachsenden würzigen und nahrhaften Alpenkräuter, Schwingel, Wermut, Salzkraut und andere, die den Schafen insgemein am besten zusagen. Przewalski, dem wir die eingehendsten Nachrichten über seine Lebensweise verdanken, traf im Winter Herden von fünf bis fünfzehn, ausnahmsweise aber auch solche von fünfundzwanzig bis dreißig Stück an. In jeder Herde befinden sich ein, zwei oder drei Böcke, von denen einer die Führung und Leitung der Schafe übernimmt. Letztere vertrauen der Wachsamkeit des Führers unbedingt; sobald er zu laufen beginnt, stürzt die Herde ihm blindlings nach. Der Bock geht gewöhnlich voran, hält aber von Zeit zu Zeit an, um zu sichern, und ebenso tut die ganze Herde, drängt sich jedoch dabei eng zusammen und schaut scharf nach der Gegend, aus der Gefahr droht. Zu besserer Sicherung ersteigt der Bock von Zeit zu Zeit einen nahen Felsen oder Hügel. Hier nimmt er sich prachtvoll aus, weil auf der Felsenspitze seine ganze Gestalt sich frei zeigt und seine Brust im Strahl der Sonne glänzt wie frischgefallener Schnee.
In den Morgenstunden äsen die Katschkare auf den Berghängen oder in den Tälern; kaum aber hat die Sonne sich höher erhoben, so lagern sie, um wiederzukäuen. Hierzu wählen sie sanft geneigte, gegen den Wind geschützte Bergeshänge, die nach allen Richtungen freie Umschau gewähren. Nachdem sie den Boden aufgescharrt haben, legen sie sich in den Staub und verweilen mehrere Stunden auf derselben Stelle. Ruht die ganze Herde, so lagern die Böcke meist ein wenig abseits, um im Ausspähen nicht behindert zu werden; besteht die Herde ausschließlich aus Böcken, ihrer drei, höchstens vier, so lagern sie nebeneinander, wenden die Köpfe jedoch nach verschiedenen Richtungen. Niemals vergessen sie, solche Vorsichtsmaßregeln zu treffen.
Von den Mongolen erfuhr Przewalski, daß die Lammzeit in den Juni, die Bockzeit dagegen in den Spätherbst fällt. Ende November war im Norden Tibets diese Zeit bereits vorüber, und die Böcke lebten miteinander in Frieden und Freundschaft. Während der Brunstzeit dagegen kämpfen sie auf Leben und Tod miteinander, und diesen Kämpfen, nicht aber den Wölfen, schreibt Sewerzoff die auffallende, an einzelnen Stellen gehäufte Menge von Schädeln zu, die man findet. Wie bei der Mehrzahl der Wiederkäuer insgemein, genügt ein Bock für viele Schafe; folglich gibt es immer überflüssige Männchen, und gerade deshalb kämpfen diese miteinander um die Weibchen.
Die Jagd auf Katschkare überhaupt wird von den eingeborenen Jägern im Tienschan in eigentümlicher Weise betrieben. Einem einzelnen Jäger, möge derselbe auch noch so gewandt sein, gelingt es selten, eines der Wildschafe zu erlegen, weil diese nur in Ausnahmefällen auf den ersten Schuß zusammenbrechen. Aus diesem Grunde ziehen es Kirgisen wie Kosaken vor, gemeinsam zu jagen. Die Katschkare besitzen eine ganz erstaunliche Lebenszähigkeit. Der von Sewerzoff erbeutete alte Katschkarbock war durch die erste Kugel am Geschröt und an einem Hinterfuß verletzt worden, infolgedessen das Laufen ihm schwer und schmerzlich sein und er daher oft anhalten mußte; dies gewährte den beiden ihn verfolgenden Kosaken die Möglichkeit, wiederholt auf ihn zu schießen. Eine zweite Kugel, die die Eingeweide zerriß, fällte ihn nicht; zwei andere Kugeln auf die Hörner warfen ihn zwar jedesmal wie tot zu Boden, er stand jedoch immer wieder auf und lief weiter; auch eine fünfte Kugel, die die Lungen durchbohrt hatte, führte den Tod noch nicht herbei, und erst die sechste, die ihn in das Herz traf, machte seinem Leben ein Ende. Nach der Berechnung der Kosaken waren sie ihrer Beute über zehn Werst weit nachgeritten, und von diesen hatte das Tier die letzten drei noch zurückgelegt, nachdem ihm bereits zwei tödliche Wunden beigebracht worden waren. Das Wildbret eines von Sewerzoff erbeuteten jungen Katschkarbocks hielt ungefähr die Mitte zwischen feistem Hammelfleisch und Hirschwildbret und war äußerst schmackhaft, das des alten Bocks dagegen keineswegs gut und mit einem unangenehmen Moschusgeruch behaftet.
Mit dem Dickhornschaf ( Ovis montana) wird ein in Kamtschatka lebendes Wildschaf für gleichartig erachtet, obgleich es sich von ihm durch sein merklich schwächeres Gehörn unterscheidet.
Richardson und nach ihm Audubon geben an, daß das Dickhornschaf vom 68. Grade nördlicher Breite an bis ungefähr zum 40. hinab das Felsgebirge bewohnt und östlich von ihm nicht gefunden wird. Dagegen belebt es westlich dieses Gebirges alle Landstrecken, die man kennenlernte, namentlich auch Kalifornien, immer und überall aber die wildesten und unzugänglichsten Gebirgsstrecken gedachter Gegenden, insbesondere einen Teil des Felsgebirges, der von den französischen und kanadischen Jägern Mauvaises Terres genannt worden ist.
Die Kunde, die wir über das Dickhornschaf besitzen, ist dürftig genug, zumal was die Lebensweise anlangt. In letzter Hinsicht ist der erste Bericht Richardsons immer noch maßgebend; weder der Prinz Max von Wied noch Audubon wissen ihm Wesentliches hinzuzufügen. Erwachsene Böcke haben eine Länge von 1,9 Meter, wovon nur 12 Zentimeter auf den Schwanz kommen, bei 1,05 Meter Schulterhöhe; das Schaf ist 1,4 bis 1,5 Meter lang und 90 bis 95 Zentimeter hoch. Jene erreichen ein Gewicht von 176 Kilogramm, da das Gehörn allein bis 25 Kilogramm wiegen kann; dieses wird 130 bis 140 Kilogramm schwer. Die Gestalt ist gedrungen und muskelkräftig. Die Länge des gewaltigen Gehörns, längs der Krümmung auf der äußeren Seite gemessen, beträgt 68 Zentimeter, der Umfang an der Wurzel 35 Zentimeter. Die bedeutend schwächeren, denen der Ziegen ähnlichen, scharf zugespitzten Hörner des weiblichen Dickhornschafs biegen sich in einem einfachen Bogen nach oben, hinten und außen. Das Haar hat keine Ähnlichkeit mit Wolle, ist hart, obwohl sanft anzufühlen, leicht gewellt und höchstens fünf Zentimeter lang, seine vorherrschende Färbung ein schmutziges, längs des Rückens dunkelndes Graubraun; der Bauch, die innere und hintere Seite der Beine sind weiß.
In ihrer Lebensweise unterscheiden sich die Dickhornschafe nicht von ihren Verwandten, nicht einmal wesentlich von den Steinböcken. Wie diese sind sie unübertreffliche Meister im Bergsteigen. Jene Wege rund um ihre Felskegel bilden sie gar nicht selten an Stellen, wo die Wand Hunderte von Metern jäh abfällt. Vorsprünge von höchstens 30 Zentimeter Breite werden für die schwindelfreien Tiere zur gebahnten Straße, auf der sie in voller Flucht dahinrennen, zum größten Erstaunen des Menschen, der es nicht begreifen kann, daß ein Tier sich dort noch zu erhalten vermag. Sobald sie etwas Fremdartiges gewahren, flüchten sie zu steilen Höhen empor und stellen sich hier an den vorspringenden Kanten auf, um ihr Gebiet zu überschauen. Ein schnaufender Nasenton gibt bei Gefahr das Zeichen zur Flucht, und auf dieses hin stürmt die Herde in rasender Eile davon. Wenn die Gegend ruhig ist, steigen die Tiere übrigens gern in die Tiefe herab und kommen dann oft auf die Wiesenstellen und Grasplätze in den Schluchten oder an die Ufer der Flüsse, um zu äsen. Den Höhlungen des Gebirges, an deren Wänden Salpeter und andere Salze ausblühen, statten sie täglich Besuche ab, um zu sulzen, und solche Plätze sind es denn auch, wo sie dem Menschen noch am leichtesten zur Beute werden.
Ebensowenig wie über den Ursprung anderer Wiederkäuer, die in den Hausstand übergingen und zu vollständigen Haustieren wurden, sind wir imstande, etwas Bestimmtes über die Stammvaterschaft unseres Hausschafes anzugeben. Die Meinungen der Naturforscher gehen bei dieser Frage weit auseinander. Einige glauben, daß alle Schafrassen von einer einzigen wilden Stammart herrühren, die vermutlich schon seit undenklichen Zeiten vollständig ausgestorben oder gänzlich in den Hausstand übergegangen, also nirgends mehr zu finden ist, andere sprechen die Ansicht aus, daß, wie bei den Hunden, mehrere Wildschafarten in Betracht gezogen und die zahllosen Rassen des Hausschafes als Erzeugnis fortgesetzter Kreuzungen jener Rassen und ihrer Nachkommen angesehen werden müssen.
Neuerdings hat sich auch Darwin mit der Rassenfrage beschäftigt und dieselbe von einem neuen Gesichtspunkt beleuchtet. Nach den sorgfältigsten Erhebungen dieses ausgezeichneten Forschers hat fast jedes Land seine eigentümliche Rasse, und viele Länder haben viele bedeutend voneinander abweichende Rassen. Danach scheint die Ansicht gerechtfertigt zu sein, daß auch die verschiedenen Schafrassen nichts anderes sind als ein Kunsterzeugnis des Menschen, veränderlich in Gestalt und Größe, Gehörnbildung und Vlies, Lebensart, Betragen und allen sonstigen Eigenschaften.
Als das wichtigste und gewinnbringendste aller Hausschafe gilt gegenwärtig das Merinoschaf ( Ovis aries hispanica), das nachweislich in Spanien das ihm eigentümliche Gepräge erlangt hat und nach und nach zur Veredelung fast aller europäischen Rassen benutzt worden ist. Mittelgroß und voll gebaut, zeichnet es sich aus durch seinen großen, plattstirnigen, längs des Nasenrückens gewölbten, an der Schnauze abgestumpften Kopf, mit kleinen Augen und großen Tränengruben, mittellangen, schmal zugespitzten Ohren, starken, von der Wurzel an seitlich und rückwärts gebogenen und dann in Doppelschraubenwindungen nach vorn und aufwärts weiter gewendeten Hörnern, die in der Regel nur beim Bock vorkommen, den kurzen und dicken, stark gefalteten, unten gewammten, an der Kehle kropfartig ausgebauchten Hals, die verhältnismäßig niedrigen, aber starken und kräftigen Beine und stumpf zugespitzten Hufe sowie ein äußerst dichtes, aus kurzer, weicher und feiner, höchst regelmäßig gekräuselter Wolle bestehendes Vlies.
Neben dem Merinoschaf gedenke ich noch der Fettschwanzschafe ( Ovis aries steatopyga). In ganz Mittelafrika findet sich eine fettschwanzige Schafrasse in unschätzbarer Anzahl; alle Nomaden der nördlichen und inneren Länder ebensowohl als die freien Neger züchten sie. Dieses Fettschwanzschaf ist ein ziemlich großes Tier mit kleinen Hörnern, von den meisten übrigen zahmen Arten durch sein vollständig haariges Vlies unterschieden. Sein Kleid ähnelt, der gleichmäßigen Kürze und Dicke der Haare wegen, dem der eigentlichen Wildschafe und hat mit einem echten Wollvliese keine Ähnlichkeit mehr, liefert auch keine Wolle, die gesponnen und gewebt werden könnte. Nur die Lämmer tragen ein überaus feines Wollfell.
Das Hausschaf ist ein ruhiges, geduldiges, sanftmütiges, einfältiges, knechtisches, willenloses, furchtsames und feiges, mit einem Wort ein höchst langweiliges Geschöpf. Besondere Eigenschaften vermag man ihm kaum zuzusprechen; einen Charakter hat es nicht. Nur während der Brunstzeit zeigt es sich andern Wiederkäuern entfernt ähnlich, entfaltet dann wenigstens einige Züge des Wesens, die ihm die Teilnahme des Menschen erwerben können. Im übrigen bekundet das Schaf eine geistige Beschränktheit, wie sie bei keinem Haustier weiter vorkommt. Es begreift und lernt nichts, weiß sich deshalb auch allein nicht zu helfen. Nähme es der eigennützige Mensch nicht unter seinen ganz besonderen Schutz, es würde in kürzester Zeit aufhören zu sein. Seine Furchtsamkeit ist lächerlich, seine Feigheit erbärmlich. Jedes unbekannte Geräusch macht die ganze Herde stutzig, Blitz und Donner, Sturm und Unwetter überhaupt bringen sie gänzlich außer Fassung und vereiteln nicht selten die größten Anstrengungen des Menschen.
In den Steppen von Rußland und Asien haben die Hirten oft viel zu leiden. Bei Schneegestöber und Sturm trennen sich die Herden, rennen wie unsinnig in die Steppe hinaus, stürzen sich in Gewässer, selbst in das Meer, bleiben dumm an ein und derselben Stelle stehen, lassen sich widerstandslos einschneien und erfrieren, ohne daß sie daran dächten, sich irgendwie vor dem Wetter zu sichern oder auch nur nach Nahrung umherzuspähen. Zuweilen gehen Tausende an einem Tage zugrunde. Ein alter Hirt schildert, wie Kohl erzählt, die Not, die Schneestürme über Herden und Hirten bringen, mit lebendigen Worten: »Wir weideten unser sieben in der Steppe von Otschakow an zweitausend Schafe und anderthalbhundert Ziegen. Es war zum erstenmal, daß wir austrieben, im März: das Wetter war freundlich, und es gab schon frisches Gras. Gegen Abend fing es an zu regnen, und es erhob sich ein kalter Wind. Bald verwandelte sich der Regen in Schnee, es wurde kälter, unsere Kleider starrten, und einige Stunden nach Sonnenuntergang stürmte und brauste der Wind aus Nordosten, so daß uns Hören und Sehen verging. Wir befanden uns nur in geringer Entfernung von Stall und Wohnung und versuchten die Behausung zu erreichen. Der Wind hatte indessen die Schafe in Bewegung gesetzt und trieb sie immer mehr von der Wohnung ab. Wir wollten nun die Geißböcke, denen die Herde zu folgen gewohnt ist, zum Wenden bringen; aber so mutig die Tiere bei andern Ereignissen sind, so sehr fürchten sie die kalten Stürme. Wir rannten auf und ab, schlugen und trieben zurück und stemmten uns gegen Sturm und Herde; aber die Schafe drängten und drückten aufeinander, und der Knäuel wälzte sich unaufhaltsam während der ganzen Nacht weiter und weiter fort. Als der Morgen kam, sahen wir rund um uns her nichts als lauter Schnee und finstere Sturmwüste. Am Tage blies der Sturm nicht minder wütend, und die Herde ging fast noch rascher vorwärts als in der Nacht, während der sie von der dichten Finsternis noch mitunter gehemmt ward. Wir überließen uns unserem Schicksale; es ging im Geschwindschritte fort, wir selber voran, das Schafgetrappel blökend und schreiend, die Ochsen mit dem Vorratswagen im Trab, und die Rotte unserer Hunde heulend hinterdrein. Die Ziegen verschwanden uns noch an diesem Tage; überall war unser Weg mit dem tot zurückbleibenden Vieh bestreut. Gegen Abend ging es etwas gemacher; denn die Schafe wurden vom Hunger und Laufen matter. Allein leider sanken auch uns zugleich die Kräfte. Zwei von uns erklärten sich krank und verkrochen sich im Wagen unter die Pelze. Es wurde Nacht, und wir entdeckten immer noch nirgends ein rettendes Gehöft oder Dorf. In dieser Nacht erging es uns noch schlimmer als in der vorigen, und da wir wußten, daß der Sturm uns gerade auf die schroffe Küste des Meeres zutrieb, so erwarteten wir alle Augenblicke, mitsamt unserem Vieh ins Meer hinabzustürzen. Es erkrankte noch einer von unseren Leuten. Als es Tag wurde, sahen wir einige Häuser uns zur Seite aus dem Schneenebel hervorblicken. Allein obgleich sie uns ganz nahe, höchstens dreißig Schritte vom äußersten Flügel unserer Herde entfernt waren, so kehrten sich doch unsere dummen Tiere an gar nichts und hielten immer den ihnen vom Winde vorgezeichneten Strich. Mit den Schafen ringend, verloren wir endlich selber die Gelegenheit, zu den Häusern zu gelangen, so vollständig waren wir in der Gewalt des wütenden Sturmes. Wir sahen die Häuser verschwinden und wären, so nahe der Rettung, doch noch verloren gewesen, wenn nicht das Geheul unserer Hunde die Leute aufmerksam gemacht hätte. Es waren deutsche Ansiedler, und der, der unsere Not entdeckte, schlug sogleich bei seinen Nachbarn und Knechten Lärm. Diese warfen sich nun, fünfzehn Mann an der Zahl, mit frischer Gewalt unsern Schafen entgegen und zogen und schleppten sie, uns und unsere Kranken allmählich in ihre Häuser und Höfe. Unterwegs waren uns alle unsere Ziegen und fünfhundert Schafe verlorengegangen. Aber in dem Gehöfte gingen uns auch noch viele zugrunde; denn sowie die Tiere den Schutz gewahrten, den ihnen die Häuser und Strohhaufen gewährten, krochen sie mit wahnsinniger Wut zusammen, drängten, drückten und klebten sich in erstickenden Haufen aneinander, als wenn der Sturmteufel noch hinter ihnen säße. Wir selber dankten Gott und den guten Deutschen für unsere Rettung; denn kaum eine Viertelstunde hinter dem gastfreundlichen Hause ging es zwanzig Klafter tief zum Meere hinab.«
Ganz ähnlich benehmen sich bei uns zulande die Schafe während heftiger Gewitter, bei Hochwasser oder bei Feuersbrünsten. Beim Gewitter drängen sie sich dicht zusammen und sind nicht von der Stelle zu bringen. »Schlägt der Blitz in den Klumpen«, sagt Lenz, »so werden gleich viele getötet; kommt Feuer im Stalle aus, so laufen die Schafe nicht hinaus oder rennen wohl gar ins Feuer. Ich habe einmal einen großen abgebrannten Stall voll von gebratenen Schafen gesehen; man hatte trotz aller Mühe nur wenige mit Gewalt retten können. Vor einigen Jahren erstickte fast eine ganze Herde, weil zwei Jagdhunde in den Stall sprangen und sie in solche Angst setzten, daß sie sich fast übermäßig zusammendrängten. Eine andere Herde wurde durch den Hund eines Vorübergehenden so auseinander gejagt und zerstreut, daß viele im Walde verloren gingen.«
Diese Geschichten genügen, um das Wesen des Schafes zu kennzeichnen.
In gewissem Grad freilich bekundet auch das Schaf geistige Befähigung. Es lernt seinen Pfleger kennen, folgt seinem Ruf und zeigt sich einigermaßen gehorsam gegen ihn, scheint Sinn für Musik zu haben, hört mindestens aufmerksam dem Gedudel des Hirten zu, empfindet und merkt auch Veränderungen der Witterung vorher.
Das Schaf liebt trockene und hoch gelegene Gegenden mehr als niedere und feuchte. Nach Linnés Angaben frißt es von den gewöhnlichen mitteleuropäischen Pflanzen 327 Arten, während es 141 verschmäht. Hahnenfuß, Wolfsmilch, Zeitlose, Schachtelhalme, Fettkraut, Riedgras und Binsen sind ihm Gift. Am besten gedeiht es, wenn es verschiedenerlei getrocknete Pflanzen haben kann; Getreidefütterung macht es zu fett und schadet der Wolle. Salz liebt es sehr, und frisches Trinkwasser ist ihm ein unentbehrliches Bedürfnis.
Der Fortpflanzungstrieb regt sich zuerst im März und währt von dieser Zeit an den ganzen Sommer hindurch fort. Die alten Römer ließen ihre Schafe zwischen Mai und Juni zur Paarung; die Landwirte in kälteren Gegenden ziehen die Zeit von September bis Oktober vor. Dann werden die Lämmer, weil das Schaf hundertundvierzig bis hundertundfünfzig Tage trächtig geht, in der zweiten Hälfte des Februar geworfen und bekommen bald gutes und frisches Futter. Gewöhnlich bringt das Mutterschaf nur ein einziges Lamm zur Welt; zwei Junge sind schon ziemlich, drei sehr selten. Anfangs müssen die kleinen Tiere sorgfältig gegen Witterungseinflüsse gehütet werden, später dürfen sie mit auf die Weide gehen. Das Schaf ist schon mit einem Jahr, der Widder mit dem achtzehnten Monate paarungs- und zeugungsfähig. Alle Rassen unter sich pflanzen sich ohne Schwierigkeit fort, und ebendeshalb kann man das Schaf mit Leichtigkeit veredeln.
Bei uns zulande hat das geachtete Haustier wenig Feinde; schon im Norden und Süden Europas aber schleicht der Wolf häufig genug hinter den Herden her; in Asien, Afrika und Amerika stellen die großen Katzen und größeren Wildhunde, in Australien Dingo und Beutelwolf den wehrlosen Geschöpfen nach. Auch Braun, der Bär, holt sich hier und da ein Stück. Adler und Geieradler werden den Lämmern gefährlich. Dafür bleiben die am ärgsten von Feinden heimgesuchten Schafe am meisten von Krankheiten verschont, und der Schaden gleicht sich somit wieder aus. Die häufigste aller Krankheiten ist das Drehen, das sich hauptsächlich bei jungen Schafen zeigt. Es rührt von Blasenwürmern im Gehirn her, die auf noch nicht ermitteltem Wege in diesen edlen Teil gelangen. Andere Eingeweidewürmer, die sogenannten Leberegel, verursachen die Leberfäule, einige Fadenwürmer die Lungenfäule. Dazu kommen nun noch der Blutschlag oder die Blutseuche, die Klauenseuche, die Trabekrankheit, die Pocken, die Trommelsucht und andere oft sehr verderblich werdende Krankheiten.
Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Nutzen des Schafes ungleich größer als gegenwärtig. In einem vollständig angebauten Lande wird zurzeit kein großer Gewinn mehr mit dem Halten der Schafe erzielt. Die Wolle ist, seitdem man ganz Australien als Schafweide benutzt, bedeutend im Preise gefallen, und nur noch das Fleisch und der Mist kommen in Betracht. Im Süden Das geschieht aber auch in Norddeutschland, z. B. in Ostfriesland sehr viel. Besonders die Seedeiche sind hier sehr geschätzte Schafweiden. Herausgeber. benutzt man auch die Milch, um daraus geschätzten Käse zu machen; edle Schafe dagegen melkt man nirgends, weil man hierdurch den Wollertrag vermindert.
Das Schaf kann vierzehn Jahre alt werden; doch fallen ihm schon im neunten oder zehnten Jahre seines Lebens die meisten Zähne aus. Es wird dadurch unbrauchbar und muß so rasch als möglich gemästet und geschlachtet werden.
Die Stiere oder Rinder ( Bovina), die die dritte Unterfamilie der Horntiere bilden, sind große, starke und schwerfällige Wiederkäuer, deren Merkmale hauptsächlich in den mehr oder weniger runden und glatten Hörnern, der breiten Schnauze mit den weit auseinanderstehenden Nasenlöchern, dem langen, bis ans Handgelenk reichenden, gequasteten Schwanze, dem Mangel an Tränengruben und Klauendrüsen und dem vierzitzigen Euter des Weibchens liegen. Die meisten zeichnen sich auch durch eine hängende Wamme am Hals aus. Ihr Geripp zeigt sehr plumpe und kräftige Formen. Der Schädel ist breit an der Stirn und an der Schnauze wenig verschmälert; die runden Augenhöhlen stehen weit seitlich hervor, die Stirnzapfen, auf denen die Hörner sitzen, wachsen seitlich aus dem hinteren Schädel heraus; die Halswirbel sind sehr kurz, haben aber lange Dornfortsätze; dreizehn bis fünfzehn Wirbel tragen Rippen; am zwölften oder vierzehnten befestigt sich das Zwerchfell; sechs oder sieben Wirbel bilden den Lendenteil, vier oder fünf innig miteinander verschmolzene das Kreuzbein; die Anzahl der Schwanzwirbel wächst bis auf neunzehn an. Der Zahnbau ist nicht besonders auffallend. Gewöhnlich sind die inneren Schneidezähne jeder Seite die größten und unten die äußersten die kleinsten; unter den vier Backenzähnen in jedem Kiefer pflegen die vordersten klein, die hintersten aber sehr entwickelt zu sein. Die Kauflächen sind nach den Arten mannigfach verschieden. Die Hörner, die bei einigen Rindern an der Wurzel sich verbreitern und dann fast die ganze Stirn bedecken, lassen diese bei der großen Mehrzahl frei, sind glatt, rundlich oder höchstens am Grunde quer gerunzelt und krümmen sich in sehr verschiedener Weise nach außen oder innen, nach hinten oder nach vorn, nach aufwärts und nach abwärts, oder haben leierförmige Gestalt. Das Haarkleid ist gewöhnlich kurz und glatt anliegend, verlängert sich aber bei einzelnen Arten mähnenartig an gewissen Stellen des Leibes.
Ganz Europa und Afrika, Mittel- und Südasien sowie der höhere Norden Amerikas dürfen als die ursprüngliche Heimat der Stiere betrachtet werden; gegenwärtig sind die in die Knechtschaft des Menschen übergegangenen Arten über alle Teile des Erdballs verbreitet worden. Die wildlebenden bewohnen die verschiedensten Örtlichkeiten, diese dichtere Waldungen, jene freie Blößen oder Steppen, die einen die Ebene, die andern das Gebirge, wo sie sogar zu Höhen von fünf- bis sechstausend Meter über die Meeresfläche emporsteigen. Einige ziehen sumpfige Gegenden und Moräste, andere mehr trockene Örtlichkeiten vor. Die wenigsten sind Standtiere, führen vielmehr ein umherschweifendes Leben. Die, die das Gebirge bewohnen, kommen im Winter in die Täler herab, jene, die im Norden leben, ziehen sich südlicher, andere wandern aus Mangel an Nahrung von einer gewissen Örtlichkeit in nahrungsreichere Gegenden. Alle Arten ohne Ausnahme leben gesellig und schlagen sich herdenweise zusammen; einzelne bilden Heere von Tausenden. Starke, alte Tiere führen die Herden an; doch kommt es auch vor, daß bösartige Zugführer zuweilen vertrieben und zum Einsiedeln gezwungen werden.
Alle Rinder erscheinen zwar plump und langsam, sind aber doch imstande, sich rasch zu bewegen, und bekunden viel mehr Fertigkeiten, als man ihnen zutrauen möchte. Ihre gewöhnliche Bewegung ist ein langsamer Schritt; allein sie traben auch schnell dahin und fallen zuweilen in einen höchst unbeholfenen Galopp, der sie sehr rasch fördert. Die Arten, die Gebirge bewohnen, klettern meisterhaft, alle schwimmen leicht und gut, und einzelne setzen ohne Bedenken über die breitesten Ströme. Ihre Kraft ist außerordentlich, ihre Ausdauer bewunderungswert. Unter den Sinnen steht der Geruch obenan; das Gehör ist ebenfalls gut, das Gesicht nicht besonders entwickelt. Die geistigen Fähigkeiten sind gering; doch bekunden die wilden weit mehr Verstand als die zahmen, die ihre Geisteskräfte nicht anzustrengen brauchen. Ihr Wesen ist verschiedenartig. Im allgemeinen sanft und zutraulich gegen Geschöpfe, die ihnen nicht gefährlich oder beschwerlich werden, zeigen sie sich auch überaus wild, trotzig und in hohem Grade mutig, greifen, gereizt, unter Todesverachtung alle Raubtiere, selbst die stärksten, an und wissen ihre furchtbaren Waffen mit so viel Geschick zu gebrauchen, daß sie gewöhnlich Sieger bleiben; unter sich im ganzen verträglich, kämpfen sie doch zu gewissen Zeiten mit entschiedener Rauflust, und namentlich die Männchen führen während der Brunftzeit prachtvolle und dabei höchst gefährliche Kämpfe. Die Stimme besteht in hellerem oder dumpferem Gebrüll oder in einem Grunzen und Brummen, das hauptsächlich gehört wird, wenn sie erregt sind.
Sehr verschiedene Pflanzenstoffe bilden die Nahrung der Rinder. Sie verzehren Laub und zarte Knospen, Triebe und Zweige der allerverschiedensten Bäume, Gräser und Kräuter, Baumrinde, Moos und Flechten, Sumpf- und Wasserpflanzen, selbst scharfschneidiges Riedgras und rohrähnliche Gewächse. In der Gefangenschaft nähren sie sich von allen möglichen Pflanzenstoffen. Salz ist für alle ein Leckerbissen, Wasser ihnen Bedürfnis; manche wälzen sich mit Lust in schlammigen Lachen oder legen sich stundenlang in Flüsse und Teiche.
Der Begattung gehen gewaltige Kämpfe unter den Stieren voraus. Neun bis zwölf Monate nach ihr wirft die Kuh ein einziges Junges, sehr selten deren zwei. Das Kalb ist immer vollkommen ausgebildet und nach kürzester Zeit imstande, der Mutter zu folgen. Diese behandelt es mit warmer Zärtlichkeit, säugt und reinigt, beleckt und liebkost es und verteidigt es bei Gefahr mit tollkühnem Mut gegen jeden Angriff. Nach drei bis acht Jahren ist das Junge erwachsen und zur Fortpflanzung geeignet, nach fünfzehn bis fünfzig Jahren greisenhaft und altersmatt.
Sämtliche Rinderarten lassen sich zähmen und geben sich sodann willig dem Menschen hin, lernen ihre Pfleger kennen und lieben, folgen deren Ruf und gehorchen selbst einem schwachen Kinde, ziehen jedoch ihren Herrn eigentlich anderen Menschen nicht vor, sondern behandeln, wenn sie einmal gezähmt worden sind, alle Leute mit der gleichen Freundlichkeit.
Die Jagd der wilden Rinder gehört zu den ernstesten, die es gibt. Ein Löwe und ein Tiger können nicht gefährlicher sein als ein gereizter Stier, dessen blinde Wut keine Grenzen mehr kennt. Gerade deshalb aber betreibt man solche Jagd mit größter Leidenschaft, und manche Völker sehen sie als die rühmlichste von allen an.
Gegen den Nutzen, den die zahmen Rinder leisten, verschwindet der geringe Schaden, den die wildlebenden anrichten, fast gänzlich. Diese werden höchstens durch das Benagen der Bäume und Sträucher in den Wäldern, durch das Zerstören des Graswuchses und durch Verheerungen, die sie in Pflanzungen ausüben, dem Menschen lästig; die gezähmten dagegen nützen ihm mit ihren sämtlichen Kräften, durch ihr Fleisch und ihre Knochen, ihre Haut und ihr Gehörn, ihre Milch, selbst durch ihr Haar und ihren Mist.
Auch die Jagd der wildlebenden Rinder liefert einen nicht unerheblichen Ertrag, da nicht allein die Haut benutzt wird, sondern auch das Fleisch, ungeachtet des ihm stets und zu gewissen Zeiten in anwidernder Weise anhaftenden Moschusgeruches, eine vorzügliche Speise gibt.
*
Rings um den Nordpol der Erde zieht sich als breiter Streifen die Tundra, eine Wüste der traurigsten Art, obwohl in ihr nicht die Sonne, sondern nur das Wasser zur Herrschaft gelangt, ein einziges ungeheures Moor und Morast, unterbrochen von einzelnen ausdruckslosen Hügelreihen, zwischen denen sich größere und kleinere Flüsse ihr Bett gebahnt haben und unzählbare Seen, Teiche und Wasserlachen ausbreiten. Inselgleich heben sich jene Höhenzüge aus dem Moor hervor, und die wenigen Stellen, die der Mensch hier, von der Ungunst des Klimas gehindert, der Erde abrang, sind ebenfalls als Oasen zu bezeichnen. Aus ungeheuren Felsblöcken zusammengebautes und übereinander geschichtetes Geröll, dessen Entstehung schwer erklärlich erscheint, bildet den Untergrund, eine Schicht vertorfter Pflanzenreste lagert sich darüber, und nur in den geschütztesten Tälern erheben sich über dieser höhere Pflanzen, Bäume, die zu Gebüschen herabgesunken sind, Beerensträucher, Gräser und dergleichen, wogegen die Höhen, falls sie überhaupt noch Pflanzenwuchs zeigen, meist nur Flechten und Moose gedeihen lassen. Ein solches Gepräge zeigt aber nur der südlichste Teil der Tundra oder, wie wir im Deutschen sagen könnten, die Moossteppe; je weiter man nach Norden vordringt, um so öder, ärmer und unwirtlicher erscheint das Land. In den höchsten Breiten, die man gegenwärtig erreicht hat, im Norden Grönlands z. B., bringt es, wie Payer hervorhebt, die Pflanzenwelt fast nirgends dahin, die allgemeine, durch die Felsart des Bodens bedingte Färbung abzuändern, sondern vermag höchstens dieselbe zu schattieren. Moose, Flechten, graugrüne Gräser, Ranunkeln, Steinbrecharten bilden vereinzelte ärmliche Siedelungen zwischen den verwitterten Steinfugen; die Wälder sind hier und da durch wenige Zentimeter hohe Birken, deren Stämme manchmal ein Zündhölzchen an Stärke nicht übertreffen, oder durch niedriges Heidelbeergestrüpp, häufiger durch völlig am Boden hinkriechende, wurzelartig sich verzweigende Weiden vertreten. Das Gepräge dieser Landschaften bleibt dasselbe in der Höhe wie in der Tiefe; denn infolge des monatelangen Nordtages macht sich die Meereshöhe als Wachstumsbedingung weniger fühlbar als in Europa, wo sich die pflanzliche Bedeckung der Erde um jede dreihundert Meter Erhebung merklich ändert; nur nimmt man wahr, daß die größere Sommerwärme des felsigen Binnenlandes eine mannigfaltigere Pflanzenwelt erzeugt als jene der Küstenstriche. Frühere Eskimoniederlassungen lassen sich, wenngleich meist nur auf wenige Geviertklafter Fläche beschränkt, infolge der stattgehabten günstigen Bedingungen durch ihre grünere Farbe schon aus der Ferne erkennen; Wiesen in unserem Sinne gibt es nirgends.
So arm und öde aber auch die Tundra dem Südländer vorkommen will, immerhin erhält und ernährt sie noch verschiedene ihr eigentümliche Tierarten. Eine nicht unerhebliche Artenmenge von Vögeln bevölkert sie in großer Anzahl; außerdem wohnen und leben in ihr mehrere Nager, insbesondere Wühlmäuse, die wiederum Raubtiere, den Eisfuchs, den Vielfraß und einige Marderarten, nach sich ziehen, aber keineswegs die alleinigen von den genannten und hier und da von Wölfen verfolgten Bewohner sind, vielmehr noch im Renntiere und in einem der auffallendsten, falls nicht dem merkwürdigsten aller Rinder Genossen haben. Die Unwirtlichkeit und Öde der Tundra, ihre Armut und die Qual, die Milliarden von Mücken während ihres kurzen Sommerlebens all den genannten Tieren bereiten, treiben diese beständig von einem Ort zum andern, und es findet daher, wie in den eigentlichen Wüsten und Steppen, ein reges Wanderleben sämtlicher Tiere statt. Monatelang hausen die Wühlmäuse auf einer und derselben Stelle, durch rasch aufeinander folgende Geburten eine zahlreiche Nachkommenschaft nicht selten zu unzählbaren Herden vermehrend, die dann durch den nagenden Hunger zum Verlassen der Örtlichkeiten getrieben werden; fast beständig reisend, durchziehen die größeren, mehr Nahrung bedürftigen Tiere, das Renntier und der Schaf- oder Moschusochse, das Land, und wie jenen die kleineren, so folgen diesen die größeren Raubtiere nach.
Der Schaf- oder Moschusochse ( Ovibos moschatus), der heute noch im arktischen Nordamerika und in Grönland vorkommt, vereinigt in wundersamer Weise die Merkmale der Schafe und Rinder in sich. Durch den Mangel einer Kehlwamme und einer nackten Muffel, die Kürze des stummelhaften Schwanzes, die verschiedenartig, d. h. unter sich nicht gleich gebildeten Hufe und das Vorhandensein von nur zwei Zitzen unterscheidet sich das Zwittergeschöpf ebenso bestimmt von anderen Rindern, als es sich den Schafen annähert. Gleichwohl dürfen wir ihn den Rindern beizählen. Die Gesamtlänge des Tieres beträgt einschließlich des nur 7 Zentimeter langen Schwanzes 2,44 Meter, die Schulterhöhe 1,1 Meter. Ein außerordentlich dicker Pelz bekleidet den Leib, in auffallender Dichtigkeit auch das Gesicht und die Beine. Die verhältnismäßig starken Grannen sind überall lang und mehr oder minder wellig, verlängern sich aber vom Kinne an bis zur Brust zu einer fast den Boden streifenden Mähne, bilden zu beiden Seiten, namentlich an dem Hinterteile, einen bis zu den Hufen herabreichenden, 60 bis 70 Zentimeter langen Behang und decken ebenso in reichlicher Menge den Widerrist, hier einen kissenartigen Sattel darstellend, der hinter den Hörnern beginnt und den Hals von beiden Seiten überdeckt, selbst noch die Ohren einhüllt. Die allgemeine Färbung ist ein dunkles Umberbraun, das im Gesicht und an den Haaren der Mähne ins Dunkelbraune übergeht und auf dem Sattel sich lichtet.

Moschusochse ( Ovibos moschatus)
Innerhalb seines weiten Gebietes belebt der Schafochse alle Örtlichkeiten, die ihm wenigstens zeitweilig Unterkommen und Nahrung gewähren. Er nimmt, zu Herden von wechselnder Stärke geschart, vorzugsweise in Tälern und Niederungen seinen Stand, und seine Anzahl scheint nach Norden hinauf zuzunehmen; so wenigstens glauben unsere Nordfahrer im Osten Grönlands beobachtet zu haben. Sie begegneten Herden, die aus zwanzig bis dreißig Stück bestanden, ihre Vorgänger noch zahlreicheren. Mocham zählte am nördlichen Ufer des Siddongolfes, westlich vom Kap Smith der Melville-Insel, auf einer Strecke von zwei deutschen Meilen einhundertfünfzig Stück und auf der in Tafelbergen bis zu 250 Meter aufsteigenden Halbinsel zwischen Murray-Inlet und Hardybai siebzig, die im Umkreis einer halben deutschen Meile weideten. Im Verhältnis zu den Kühen gibt es immer nur wenige Stiere bei der Herde, selten mehr als zwei oder drei vollkommen erwachsene, weil dieselben um die Brunstzeit heftige Kämpfe miteinander bestehen und sich gegenseitig vertreiben, wobei wohl auch, wie die oft gefundenen Leichname von Stieren zu beweisen scheinen, einer den andern ums Leben bringt. Während des Sommers halten sich diese Herden im Norden des festländischen Amerika mit Vorliebe in der Nähe von Flüssen auf, ziehen aber mit einbrechendem Herbst nach den Wäldern zurück; gleichzeitig sammeln sie sich auch zu größeren Scharen, wogegen sie früher mehr vereinzelt weideten. Wenn eine feste Eisdecke es ermöglicht, sieht man sie in langen Zügen von einer Insel zur anderen wandern, um ein zeitweilig an Nahrung reiches Gebiet aufzufinden, das sie, nachdem sie es ausgenutzt, genau in derselben Weise verlassen. Wie weit sie ihre Wanderungen ausdehnen, weiß man übrigens noch nicht; denn nach den neuesten Erfahrungen der Polarisleute will es scheinen, als ob sie im höchsten Norden Grönlands Sommer und Winter auf einer und derselben Stelle verweilen. Eine schneefreie und mit einer verhältnismäßig üppigen Pflanzenwelt bestandene Ebene in der Nähe von Dankgotthafen unter 81° 38' nördlicher Breite war während des Aufenthalts gedachter Nordfahrer von Moschusochsen zahlreich bevölkert, und die Tiere blieben hier auch während des Winters, obgleich es so kalt war, daß man mit Kugeln aus gefrorenem Quecksilber eine fünf Zentimeter dicke Bohle durchlöchern konnte, und sie alle Nahrung unter dem Schnee hervorscharren mußten. Einzig und allein ihre unendliche Genügsamkeit ermöglicht es ihnen, den furchtbaren Winter zu überstehen. Langsam und bedächtig durchwandern sie die Schneewüste, um nach einer ihnen Unterhalt versprechenden Oase zu gelangen, und geduldig und beharrlich gewinnen sie die wenigen verdorrten Grashalme, die hier und da aus dem Schnee hervorragen. Mit der Schneeschmelze beginnt für sie die an Sorgen ärmste, aber doch nicht aller Leiden bare Zeit. Gegenüber einem solchen Winter, der ihnen außer den Halmen und einzelnen Blättern der unter dem Schnee vergrabenen Pflanzen nur noch Flechten bietet, ernähren sie sich jetzt ohne Mühe von den wenigstens zeitweilig mit einiger Üppigkeit gedeihenden Kräutern und Bäumchen, haben aber nunmehr wie alle übrigen Tiere viel von den Mücken zu leiden und gleichzeitig die Härung zu überstehen, die wegen des dicken Wollvlieses nicht so leicht vor sich geht, sie zwingt, sich oft im Schlamm und Morast zu wälzen, um sich von dem lästigen Pelz zu befreien, und sie längere Zeit an eine und dieselbe Stelle zu fesseln scheint, da sie erst, nachdem sie sich vollständig gehärt haben, wieder stetig und ruhig ihres Weges weiter ziehen.
Gegen Ende des August rindern die Tiere, und Ende Mai, also nach neun Monaten, bringen die Kühe ihr Kalb zur Welt; ein kleines, ungemein niedliches Geschöpf, das von der Alten auf das zärtlichste geliebt und nötigenfalls mit größtem Mute verteidigt wird. Bei einer ihrer Schlittenreisen trafen unsere Nordfahrer in einem breiten Tal mit verhältnismäßig üppiger Pflanzenwelt elf ausgewachsene Schafrinder und drei Kälber, die dort friedlich weideten. Einige von den Tieren ließen die Fremdlinge anfänglich scheinbar furchtlos und unbekümmert nahe herankommen, nahmen dann aber doch Reißaus; drei andere dagegen, denen zwei Kälber folgten, setzten sich in Verteidigungsstellung, drängten sich dicht aneinander, senkten die Köpfe und schnaubten ängstlich und wild, ohne jedoch wirklich zum Angriff zu schreiten. Die Kälber standen hinter den ausgewachsenen Tieren und wurden stets wieder zurückgeschickt, wenn sie neugierig hervorkommen wollten. Ein paar wohlgezielte Schüsse jagten die mutigen Tiere in die Flucht, und nunmehr legten die Alten, Bullen wie Kühe, eine bemerkenswerte Sorgfalt an den Tag, daß auch bei dem schnellsten Laufen keines von den Kälbern zurückbleibe. Letztere eilten, obgleich sie höchstens vierzehn Tage alt sein konnten, auf ihren wie bei so vielen jugendlichen Vierfüßlern unverhältnismäßig langen und dünnen Beinen mit überraschender Geschwindigkeit davon und kamen ihren Feinden bald aus dem Gesicht. Das Kalb behält bis zur Vollendung seines Wachstums eine helle Färbung und kleidet sich erst dann in die Tracht der Alten.
Ungeachtet der plumpen Gestalt der Schafochsen bewegen sich diese mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit, laut Roß mit der Gewandtheit und Behendigkeit der Antilopen. Ziegen gleich klettern sie auf den Felsen umher, ohne irgendwelche Anstrengungen erklimmen sie scharfe Steilungen, und schwindelfrei blicken sie von der Höhe in die Tiefe hinab. »Es war wirklich ein schöner Anblick«, so schildert Copeland, »sie an einem steilen, mit losen Steinen bedeckten Abhang mit wahrhaft überraschender Behendigkeit da hinaufspringen zu sehen, wo ein Mensch die größte Mühe gehabt haben würde, überhaupt nur festen Fuß zu fassen. Wie Tiere, die in Herden leben, zu tun pflegen, blieben sie beim Steigen immer dicht beieinander; denn wenn sie anders gehandelt, so würde der, der am weitesten unten war, einem regelrechten Steinhagel ausgesetzt gewesen sein, der durch die vordersten in ihrem Eifer, uns zu entkommen, herabgeschleudert werden mußte.« Wurde Copeland beim ersten Zusammentreffen mit Schafochsen durch ihre große Behendigkeit und Schnelligkeit in Erstaunen gesetzt, so wuchs seine Verwunderung, als er später erfuhr, wie sie an dem Abhang eines Basaltkegels hinaufjagten, der so steil war, als Basalttrümmer nur irgend sein können. In höchstens drei oder vier Minuten hatten sie eine Höhe von einhundertfünfzig Meter erstiegen, die ihre Verfolger derartig anstrengte, daß diese eine volle halbe Stunde brauchten, um dasselbe zu erreichen. Auch hierin also beweisen sie ihre Verwandtschaft mit den Schafen, haben wenigstens unter den Rindern nur einen einzigen Genossen, den Jak, der einigermaßen mit ihnen wetteifern könnte.
Dem Fleisch haftet stets ein merklicher Moschusgeruch an; derselbe ist jedoch bei Kühen keineswegs so heftig, daß er jenes ungenießbar machen kann, wie das bei Stieren, die während der Brunstzeit getötet wurden, der Fall sein soll. Unsere Nordfahrer fanden den Geschmack der Moschuskühe vortrefflich, und andere Europäer urteilen genau ebenso. In der Gegend des Fort Wales treiben die Indianer einen einträglichen Tauschhandel mit dem Fleisch des von ihnen erlegten Wildes. Sie hängen es, nachdem sie es in größere Stücke zerschnitten haben, in der Luft auf, lassen es vollständig austrocknen und liefern es dann in die Niederlassungen der Pelzjäger ab, wo es gern gekauft wird. Wolle und Haar werden von Indianern und Eskimos hoch geschätzt. Erstere ist so fein, daß man daraus sicherlich vortreffliche Gewebe erzeugen könnte, wenn man ihrer genug hätte. Aus dem Haare bereiten sich die Eskimos ihre Moskitoperücken, aus den Schwänzen Fliegenwedel und aus der Haut gutes Schuhleder.
*
Der Jak oder Yak ( Bos grunniens) vertritt die Untersippe der Grunzochsen. Ihr Leib ist durchgehends stark und kräftig gebaut, der Kopf mäßig groß, sehr breit, das Auge klein und von blödem Ausdrucke, das Ohr klein und gerundet, überall stark behaart, das Gehörn hinten zu beiden Seiten der Stirnleiste aufgesetzt, von oben nach unten zusammengedrückt, vorn rund, hinten zu einer Kante ausgezogen, an der Wurzel deutlich, aber flach gewulstet, zuerst nach seitwärts, hinten und außen, sodann wieder nach vorn und oben, mit der Spitze nach außen und hinten gewendet, der Hals kurz und stiernackig, der Hinterhals und vordere Teil des Widerristes höckerartig erhöht, der Rücken in reich bewegter Linie abfallend, der Leib in der Schultergegend schmal, in der Mitte stark ausgebaucht und hängend, der Schwanz lang und mit einer buschigen, bis auf den Boden herabreichenden Quaste geziert, das Bein kurz, kräftig, der Huf groß, breit gespalten und mit wohlentwickelten Afterhufen versehen. Das Kleid besteht durchgehends aus feinen und langen Haaren, die auf der Stirn bis zum Hinterkopf krauslockig und wellig sind, oft bis über das ganze Gesicht herabfallen, auf dem Widerrist und längs beider Seiten zu einer schwer herabhängenden, vorhangartigen, sanft welligen Mähne sich verlängern, die, wie die überaus reiche, roßschweifähnliche Schwanzquaste, auf dem Boden schleift, wogegen Bauch und Innenseite der Oberschenkel und Arme sowie die Beine vom Ellenbogen oder Kniegelenk an abwärts nur mit glatten, kurzen, schlichten Haaren bekleidet sind. Ein schönes, tiefes, auf dem Rücken und den Seiten bräunlich überflogenes Schwarz ist die Färbung der alten Tiere, längs des Rückens verläuft ein silbergrauer Streifen. Das Haar des Kalbes ist grau überflogen, das des Jungstieres rein schwarz. Die Gesamtlänge alter Stiere beträgt 4,25, die des Schwanzes ohne Haar 0,75, die Höhe bis zum Buckel 1,9 Meter, die Länge der Hörner 80 bis 90 Zentimeter, das Gewicht 650 bis 720 Kilogramm, die Länge einer alten Kuh dagegen kaum über 2,8, die Höhe 1,6 Meter, das Gewicht 325 bis 360 Kilogramm.

Jak ( Bos grunnieus)
Die Hochländer Tibets und alle mit ihnen zusammenhängenden Hochgebirgszüge beherbergen den Jak; Hochebenen zwischen vier- bis sechstausend Meter unbedingter Höhe bilden seine Aufenthaltsorte. Der nackte Boden der unwirtlichen Gefilde seiner Heimat ist nur hin und wieder mit ärmlichem Gras bedeckt, das rasende Stürme im Winter mit Schnee bedecken, wie sie im Sommer gedeihliche Entwicklung hindern. Inmitten solcher Wüsten findet der Jak Befriedigung seiner Bedürfnisse und Schutz vor dem Menschen, besteht deshalb leichter, als man annehmen möchte, den Kampf um das Dasein.
Erst dem trefflichen Przewalski danken wir eingehende Berichte über das Freileben des gewaltigen Tieres; alle früheren Mitteilungen, die ich kenne, sind dürftig oder gehaltlos. Der mutige Reisende fand in den von ihm durchzogenen Teilen Nordtibets emsiedlernde alte Stiere und kleine Gesellschaften des Jak allerorten, zahlreichere Herden dagegen nur auf Stellen, die reichere Weiden bieten. Solche Herden durchwandern auch wohl mehr oder minder regelmäßig weite Strecken, erscheinen, nach Aussage der Mongolen, im Sommer auf grasreichen Weiden, auf denen man sie im Winter nicht bemerkt, und bevorzugen ebenso die Nähe von Gewässern, in deren Nachbarschaft das Gras besser wächst als auf den kahlen Hochebenen, wogegen die alten Stiere, sei es aus Trägheit oder sonstigen Ursachen, jahraus, jahrein in demselben Gebiet verweilen und einsiedlerisch ihre Tage verbringen oder höchstens zu drei bis fünf sich gesellen. Jüngere, obschon bereits erwachsene Stiere schließen sich oft einer Herde älterer an, bilden jedoch häufiger eine eigene, die dann aus zehn bis zwölf Stück zu bestehen pflegt und zuweilen einen alten Stier in sich aufnimmt. Kühe, Jungstiere und Kälber dagegen vereinigen sich zu Herden, die Hunderte, nach Versicherung der Mongolen selbst Tausende zählen können. Solchen Massen wird es erklärlicherweise schwer, auf den ärmlichen Weiden genügende Nahrung zu finden, und sie zerstreuen sich daher, während sie äsen, über weite Flächen, sammeln sich aber, um zu ruhen, ebenso während heftiger Stürme, die sie zu lagern zwingen, wiederum zu geschlossenen Herden. Wittern die Tiere Gefahr, so schließen sie sich sofort zur Herde zusammen und nehmen die Kälber in die Mitte; einige erwachsene Stiere und Kühe aber suchen sich über die Bedeutung der Störung zu vergewissern und schweifen nach verschiedenen Seiten von der Herde ab. Naht sich oder feuert ein Jäger, so ergreift der ganze gedrängte Haufen plötzlich im Trabe, häufig auch im Galopp die Flucht, im letzteren Falle den Kopf zu Boden neigend und den Schwanz erhebend. So sprengen sie, ohne sich umzuschauen, über die Ebene dahin; eine Wolke von Staub umhüllt sie, und die Erde dröhnt, auf weithin vernehmlich, unter dem Stampfen ihrer Hufe. Solch wilde Flucht währt jedoch nicht lange; selten durcheilen die jählings erschreckten Tiere mehr als einen Kilometer, häufig weniger. Langsamer beginnt die Herde zu laufen, und bald ist die frühere Ordnung hergestellt, sind die Kälber wieder in die Mitte genommen worden, und haben die alten Tiere von neuem eine lebendige Schutzwehr um sie her gebildet. Erst wenn der Jäger zum zweitenmal herannaht und feuert, flüchtet die Herde anhaltender und weiter als früher. Alte Stiere fliehen, wenn sie aufgescheucht werden, nur während der ersten Sekunden im Galopp, sodann mit weitausgreifenden Schritten.
Zum Lager wählt die Herde womöglich den Nordabhang eines Berges oder eine tiefe Schlucht, um den Sonnenstrahlen auszuweichen. Der Jak scheut die Wärme mehr als die Kälte, legt sich daher, selbst wenn er im Schatten lagert, am liebsten auf den Schnee; falls solcher nicht vorhanden ist, scharrt er die Erdkruste auf und bildet sich eine Lagerstätte. Doch sieht man ihn hier und da, wenigstens im Winter, auch auf der Stelle liegen, wo er geweidet hat. Wasser ist ihm notwendige Lebensbedingung. Unzählbare Fährten und Kothaufen in der Nähe nicht zugefrorener Quellen bewiesen Przewalski, daß letztere regelmäßig aufgesucht werden. Nur an solchen Stellen, denen Wasser auf weithin mangelt, begnügt sich das Tier mit Schnee.
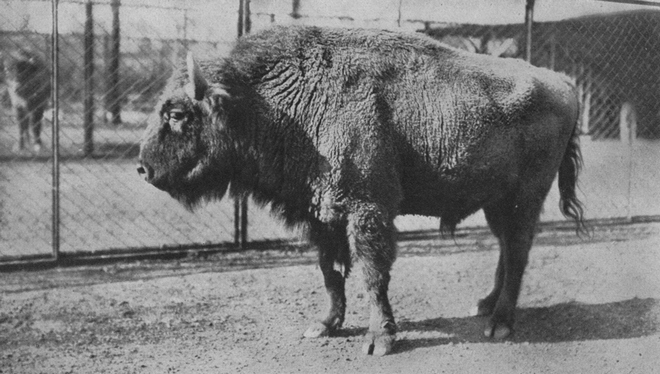
Kaukasus-Wisent ( Bison bonasus)
Ungeachtet seiner ungeheuren Kraft steht der Jak hinsichtlich seiner Begabungen anderen Tieren des Hochgebirges nach. Im Bergsteigen wetteifert er allerdings mit Wildschafen und Steinböcken, denn er klettert in dem höchsten und wildesten Gefelse, auf Graten und schroffen Abstürzen mit derselben Sicherheit wie diese; im Laufen auf ebener Fläche aber wird er von jedem Pferd eingeholt. Unter seinen Sinnen übertrifft der Geruch bei weitem alle übrigen. Einen Menschen wittert der Jak, nach Przewalskis Erfahrungen, schon aus einer Entfernung von einem halben Kilometer, unterscheidet ihn jedoch bei hellem Tage kaum auf tausend Schritte, bei bewölktem Himmel höchstens auf die Hälfte dieser Entfernung hin von einem andern Gegenstand und vernimmt so schwach, daß der Hall von Schritten oder sonstiges Geräusch erst dann Unruhe in ihm wachruft, wenn es aus nächster Nähe sein Ohr trifft. Daß der Verstand auf tiefer Stufe steht, beweist schon das unverhältnismäßig kleine Gehirn, mehr aber noch sein Gebaren im Falle der Gefahr und Not. »Die bemerkenswerteste Eigenschaft des Jak«, fagt Przewalski, »ist seine Trägheit. Früh und gegen Abend geht er auf die Weide; den Rest des Tages widmet er der Ruhe, der er stehend oder liegend sich hingibt. Währenddem bekundet nur das Wiederkäuen, daß er lebt; denn im übrigen ähnelt er einem aus Stein gemeißelten Standbilde.«

Wisent ( Bison bonasus)
Doch dieses Wesen ändert sich gänzlich, sobald die Brunst sich in ihm regt. Nach Aussage der Mongolen beginnt die Paarzeit im September und währt einen vollen Monat. Bei Tag und Nacht sind jetzt die Stiere in Unruhe und Ausregung. Die Einsiedler gesellen sich zu den Herden, laufen, Kühe suchend und dabei beständig grunzend, wie sinnlos umher, treffen aufeinander und treten sich streitlustig gegenüber, um im ernstesten Zweikampfe des Sieges Preis zu erringen. Unter furchtbaren Stößen, die zuweilen ein Horn an der Wurzel brechen, stürzen sich die gewaltigen Tiere auseinander; keiner der dicken Schädel aber bricht, und auch bedeutende Wunden, die einer dem andern zufügt, heilen schnell. Befriedigt oder übersättigt und ermattet ziehen sie sich nach der Brunstzeit wieder zurück, schweigen fortan und führen wiederum dieselbe Lebensweise wie früher.
Neun Monate nach der Paarung bringen die Kühe ihr Kalb zur Welt und pflegen es über ein Jahr lang, da sie nach Angabe der Mongolen nur alle zwei Jahre trächtig gehen sollen. Im sechsten bis achten Jahre soll der Jak erwachsen sein, im fünfundzwanzigsten altersschwach verenden, falls nicht Krankheit oder die Kugel eines Mongolen sein Leben kürzt. Andere Feinde, die ihm verderblich werden könnten, erklimmen seine heimatlichen Höhen nicht. Die Jagd des Jak ist für einen mutvollen und wohlbewaffneten Schützen ebenso verlockend wie gefährlich. Ohne Bedenken, wenn auch nicht unter allen Umständen, stürzt sich das gewaltige Tier, falls es nicht tödlich getroffen wurde, auf den Jäger, und dieser kann, auch wenn er Mut, Geschick, kaltes Blut und die besten Waffen besitzt, niemals mit Sicherheit darauf rechnen, den wütend anstürmenden, übermächtigen Gegner durch einen ferneren Schuß zu fällen. Die Kugel der schärfsten Büchse dringt nur dann zerstörend in den Kopf ein, wenn sie senkrecht auf die kleine Stelle trifft, die das wenige Hirn umschließt, und ein Blattschuß tötet nur in dem Falle, daß er das Herz durchbohrt. Aus diesen Gründen fürchten die Mongolen den Jak gleich einem Ungeheuer, gehen ihm gern aus dem Weg und feuern, wenn sie sich wirklich zur Jagd entschließen, immer nur aus sicherem Versteck und gemeinschaftlich, ihrer acht bis zwölf, auf den Riesen des Gebirges, hoffend, daß derselbe sie nicht wahrnehme, deshalb flüchte, nach zwei bis drei Tagen an seinen Wunden verende und dann glücklich von ihnen aufgefunden werde. Der Europäer verläßt sich auf seinen Hinterlader und die Unentschlossenheit des Jak. Trotz aller Wildheit vermag dieser seine Furcht vor einem kühn auf ihn andringenden Menschen nicht zu bemeistern, bleibt im Anlauf zögernd stehen, wendet sich wohl auch, empfangener Wunden ungeachtet, nachdem er zaudernd überlegt, zur Flucht.
Mehr als das Wildbret schätzt man in seiner traurigen Heimat den Kot des Jak. Ersteres ist zwar, wenn es von jungen Stieren oder gelten Kühen herrührt, recht gut, steht jedoch dem äußerst schmackhaften Fleisch zahmer Jaks bei weitem nach; letzterer dagegen liefert auf den kahlen Höhen Tibets den einzigen Brennstoff, den man verwenden kann. Einzig und allein dieser Kot ermöglicht den Aufenthalt des Menschen in jenen unwirtlichen Gefilden.
In allen Ländern, deren Hochgebirge den wilden Jak beherbergen, findet man ihn auch gezähmt als nützliches und wichtiges Haustier. Der zahme Jak unterscheidet sich hinsichtlich seiner Gestalt und seines Haarwuchses wenig von den wilden, wohl aber hinsichtlich der Färbung. Rein schwarze Jaks sind sehr selten; gewöhnlich zeigen auch diejenigen, die den wilden am meisten ähneln, weiße Stellen, und außerdem trifft man braune, rote und gescheckte an. Mehrere Rassen hat man, vielleicht durch Vermischung mit andern Rinderarten, bereits gezüchtet. Hier und da sind die zahmen Jaks auch wieder verwildert und haben dann ihre Urfärbung wieder angenommen. In der Gegend des heiligen Berges Bogdo am Altai setzten die Kalmücken ganze Herden aus, an denen sich außer den Geistlichen niemand vergreifen durfte. Radde traf im südlichen Teil des Apfelgebirges halbverwilderte Herden an, die auch in schneereichen Wintern nicht gefüttert wurden. Eine Stallung wird den gezähmten überhaupt nie zuteil. Auch die zahmen Herden gedeihen nur in kalten, hochgelegenen Gebirgsgegenden und gehen bei großer Wärme zugrunde, ertragen dagegen Kälte mit Gleichgültigkeit. Wenn der Jak kein Wasser hat, in dem er sich stundenlang kühlen kann, sucht er eifrig den Schatten auf, um der unangenehmen Wärme zu entgehen. »Die Jaks«, sagt Radde, »lagern alle auf dem Schnee, auch die Kälber; selbst die Frühgeborenen vom März bedürfen keiner Fürsorge seitens der Menschen.«
Die Kühe bekunden innige Zuneigung zu ihren Jungen, verlassen diese, wenn sie zur Weide gehen, später als die Hauskühe die ihrigen und kehren abends mehrere Stunden vor Sonnenuntergang zu den Kälbern zurück, lecken sie zärtlich und grunzen sanft und freundlich.
Der Tibetaner benutzt den Jak als Last- und Reittier. Gegen seine Bekannten benimmt er sich ziemlich freundschaftlich, läßt sich berühren, reinigen und vermittels eines durch seine Nase gezogenen Ringes an einem Stricke lenken; Fremden gegenüber zeigt er sich in der Regel anders, bekundet Unruhe, senkt den Kopf gegen den Boden und gebärdet sich, als wolle er seinen Gegner zum Kampf fordern. Manchmal überkommt ihn plötzlich rasender Zorn, er schüttelt den ganzen Körper, hebt den Schwanz hoch empor, peitscht mit ihm durch die Luft und schaut mit drohenden, grimmigen Augen auf seinen Zwingherrn. Einen gewissen Grad von Wildheit behält er stets. Gegen Hausrinder benimmt er sich artiger, und es hat deshalb keine Schwierigkeit, ihn zur Paarung mit andern Familiengenossen zu bringen.
Der Jak trägt ein- bis anderthalbhundert Kilogramm ohne Beschwerden, und zwar auf den allerschwierigsten Felsenpfaden und Schneefeldern. Man ist imstande, durch ihn Lasten über Gebirgspässe von drei- bis fünftausend Meter unbedingter Höhe zu schaffen; denn er bewegt sich auch dort oben, trotz der verdünnten Luft, die andere Geschöpfe ermattet und beängstigt, mit größter Sicherheit. Nur auf sehr klippenreichen Pfaden kann man ihn nicht benutzen, weil dann seine Last ihn hindert, über höhere Felsen zu springen, wie er es sonst wohl zu tun pflegt. Moorcroft sah ihn ohne Umstände drei Meter hohe Felsenwände herabsetzen, ja selbst in Abgründe von zwölf Meter Tiefe sich stürzen, ohne daß er dabei sich beschädigte.
Milch und Fleisch des Jak sind gleich gut. Aus der Haut gerbt man Leder, aus den Haaren dreht man Stricke. Das kostbarste ist der Schwanz, der die vielgenannten Roßschweife, jene altberühmten Kriegszeichen, liefert. Die Chinesen färben das weiße Haar brennend rot und tragen die Schwänze dann als Quasten auf den Sommerhüten. In seiner Heimat wird der Jak vorzugsweise als Saumtier geschätzt.
Die Provinz Grodno in Litauen, eine spärlich bevölkerte, zum größten Teile waldlose Ebene, enthält in ihrem Innern ein Kleinod eigentümlicher Art. Dies ist der Wald von Bialowies, ein echt nordischer Urwald von fünfzig Kilometer Länge und vierzig Kilometer Breite, also zweitausend Geviertkilometer Flächeninhalt. Er liegt abgesondert für sich, einer Insel vergleichbar, umgeben von Feldmarken, Dorfschaften und baumlosen Heiden. Im Innern des Waldes finden sich nur einige wenige Ansiedelungen der Menschen, in denen aber keine Landbauern, sondern bloß Forstleute und Jagdbauern wohnen. Etwa vier Fünfteile des Bestandes werden von der Kiefer gebildet, die auf große Strecken hin die Alleinherrschaft behauptet, in den feuchteren Gegenden treten Fichten, Eichen, Linden, Hornbäume, Birken, Ellern, Pappeln und Weiden zwischen die Kiefern herein. Alle Bäume erreichen hier ein unerhörtes Alter, eine wunderbare Höhe und gewaltige Stärke; denn der Wald zeigt heute noch dasselbe Gepräge wie vor Jahrhunderten, vielleicht vor Jahrtausenden. »Hier«, sagt ein Berichterstatter, »hat ein Sturmwind mehrere alte Riesenstämme entwurzelt und zu Boden geschleudert; wo sie hinstürzen, da sterben und verwesen sie auch, über jene erheben sich Tausende von jungen Stämmchen, die im Schatten der alten Bäume nicht gedeihen konnten und nun im regen Wetteifer nach oben streben, nach Luft, nach Licht, nach Freiheit. Ein jedes sucht sich zur Geltung zu bringen, aber doch können nicht alle dasselbe erreichen. Bald zeichnen sich einige vor den andern aus, und einmal erst mit dem Kopfe oben, fangen sie sich an breit zu machen, wölben eine prächtige Krone und unterdrücken erbarmungslos die schwächeren Pflanzen, die nun traurig zurückbleiben und verkümmern. Aber auch diese übermütig emporstrebenden werden einst in das Greisenalter treten, auch ihre Wurzeln von den Stürmen gelockert und herausgerissen werden, bis über ihren Sturz Freude unter dem jungen Nachwuchs sein wird, und dasselbe Spiel, derselbe Kampf beginnt. Außerhalb der gebahnten Wege, die der Jagd halber in Ordnung gehalten werden, ist der Wald kaum zu betreten, nicht einmal an Stellen, wo die Bäume lichter stehen, weil gerade dort ein dichter Unterwuchs von allen möglichen Straucharten wuchert. An andern Stellen hat der Sturm Hunderte von Bäumen umgebrochen, die so verworren über- und untereinander liegen, daß selbst das Wild Mühe hat, sich durchzuarbeiten. Ab und zu gewahrt man allerdings bedeutende Lichtungen durch das Dickicht schimmern, und schon glaubt man an einer Waldgrenze zu sein oder doch eine Ortschaft vor sich zu haben; wenn man aber auf eine solche Blöße zuschreitet, entdeckt man, daß sie ihre Entstehung einem Waldbrande zu verdanken hat, der in kurzer Zeit dieses ungeheure Loch fraß und dann genug hatte; denn menschliche Kräfte vermögen wenig oder nichts über die Gewalt des Feuers in diesen Niesenwaldungen, Alle acht bis zehn Jahre kommt durchschnittlich ein Brand von größerer Ausdehnung vor; kleinere Brände aber sind ganz an der Tagesordnung.«
Der Wald von Bialowies beherbergt heute noch das größte Säugetier des europäischen Festlandes, den Wisent ( Bison bonasus). Nur hier in einigen Waldungen des Kaukasus Durch Krieg und Revolution sind die Wisente in Europa nahezu völlig ausgerottet. Neuerdings unternommene Zuchtversuche werden das gänzliche Aussterben dieser gewaltigen Tiere nur um wenige Jahrzehnte hinausschieben können. Dasselbe gilt vom amerikanischen Bison. Der Herausgeber. lebt gegenwärtig noch dieses gewaltige Tier, auf der übrigen Erde ist es ausgerottet worden. Strenge Gesetze schützen es im Walde von Bialowies, und würden nicht schon seit mehreren Jahrhunderten die wechselnden Besitzer dieses wunderbaren Tiergartens solchen Schutz gewährt haben, der Wisent hätte sicherlich aufgehört, wenigstens ein europäisches Tier zu sein.
In früheren Zeiten war das freilich anders; denn der Wisent verbreitete sich nachweislich über ganz Europa und über einen großen Teil Asiens. Zur Zeit der Blüte Griechenlands war er in Päonien oder dem heutigen Bulgarien häufig; in Mitteleuropa fand er sich fast überall. Aristoteles nennt ihn »Bonassus« und beschreibt ihn deutlich; Plinius führt ihn unter dem Namen »Bison« auf und gibt Deutschland als seine Heimat an; Calpurnius bespricht ihn um das Jahr 282 n. Chr.; die » Leges allmanorum« erwähnen seiner im sechsten und siebenten Jahrhundert, das Nibelungenlied als im Wasgau vorkommend. Zu Karls des Großen Zeiten fand er sich im Harze und im Sachsenlande, um das Jahr 1000, nach Ekkehard, als ein bei St. Gallen vorkommendes Wild. Um das Jahr 1373 lebte er in Pommern, im fünfzehnten Jahrhundert in Preußen, im sechzehnten in Litauen, im achtzehnten zwischen Tilsit und Labiau in Ostpreußen, woselbst der letzte seiner Art sogar erst im Jahre 1755 von einem Wilddiebe erlegt wurde. Länger als in Preußen lebte, nach mir gewordenen Mitteilungen des verstorbenen Grafen Lázár, der Wisent in Ungarn und namentlich in dem waldreichen Siebenbürgen, worauf auch der Umstand hindeutet, daß das Volk, vielleicht zur Erinnerung an glückliche Jagden, manchen Berg, manche Quelle und selbst Ortschaften nach ihm benannt hat. Mehrere ungarische Adelsfamilien beweisen noch heutzutage durch ihre Wappen, daß ihre Vorfahren den Wisent kannten.
Bevor ich zur Leibes- und Lebensbeschreibung des gedachten Wildochsen übergehe, muß ich bemerken, daß ich unter dem Namen Wisent dasselbe Tier verstehe, das von den meisten neueren Schriftstellern Auer oder Auerochs genannt wird. Mit letzterem Namen bezeichneten unsere Vorfahren ein von jenem durchaus verschiedenes, längst ausgestorbenes Rind.
Obwohl mit Sicherheit angenommen werden muß, daß der Wisent an Größe abgenommen hat, ist er doch immer noch ein gewaltiges Tier. Ein im Jahre 1555 in Preußen erlegter Wisentstier war 7 Fuß hoch und 13 Fuß lang, dabei 19 Zentner 5 Pfund schwer. Heutzutage erreicht auch der stärkste Stier selten mehr als eine Höhe von 1,3 und eine Länge von 3,6 Meter, bei einem Gewicht von sechs- bis achthundert Kilogramm. Der Wisent erscheint uns als ein Bild urwüchsiger Kraft und Stärke. Sein Kopf ist mäßig groß und durchaus nicht plump gebaut, vielmehr wohlgestaltet, die Stirne hoch und sehr breit, der Nasenrücken sanft gewölbt, der Gesichtsteil gleichmäßig nach der Spitze zu verschmächtigt, die Schnauze plump, die Muffel breit, den ganzen Raum zwischen den großen, runden, schief gestellten Nasenlöchern einnehmend, das Ohr kurz und gerundet, das Auge eher klein als groß, seine Umrandung über die Gesichtsfläche erhöht, der Hals sehr kräftig, kurz und hoch, unten bis zur Brust gewammt, der Leib, der auf kräftigen, aber nicht niedrigen, mit großen, länglichrunden Hufen und ziemlich kleinen Afterhufen beschuhten Beinen ruht, massig, vom Nacken bis zur Rückenmitte stark gewölbt, von hier an bis zum Kreuze sanft abfallend, der Schwanz kurz und dick. Die weit seitlich angesetzten, verhältnismäßig zierlichen, runden und spitzigen Hörner biegen sich zuerst nach außen, sodann nach oben und zugleich etwas nach vorn, hierauf nach innen und hinten, so daß die Spitzen fast senkrecht über die Wurzeln zu stehen kommen. Ein überall dichter und reicher, aus langen, meist gekräuselten Grannen und filzigen Wollhaaren bestehender Pelz deckt den Leib, verlängert sich aber auf dem Hinterkopfe zu einem aus schlichten Haaren gebildeten, breiten, nach vorn über die Stirn und seitlich über die Schläfe herabfallenden Schöpfe, längs des Rückens zu einem mäßig hohen Kamme, am Kinne zu einem zopfig herabhängenden Barte und am Unterhalse zu einer die ganze Wamme einnehmenden, breit herabwallenden Mähne, bekleidet auch das Gesicht sehr reichlich, beide Ohrränder fast zottig und bildet an der Spitze der Brunstrute einen dichten Busch, am Ende des Schwanzes eine starke und lange, bis über die Fesselgelenke herabreichende Quaste. Ein mehr oder weniger ins Fahle spielendes Lichtbraun ist die allgemeine Färbung des Pelzes, geht aber auf den Kopfseiten und am Barte in Schwarzbraun, auf den Läufen in Dunkelbraun, an der Schwanzquaste in Schwarz und auf dem über den Scheitel herabhängenden Haarbusche in Lichtfahlbraun über. Die Wisentkuh ist merklich kleiner und zierlicher gebaut als der Stier, ihr Gehörn schwächer, die Mähne weit weniger entwickelt als bei letzterem, in der Färbung ihm jedoch gleich. Das neugeborene Kalb hat merklich lichtere Färbung.
Im Sommer und Herbst lebt der Wisent an feuchten Orten des Waldes, gewöhnlich in Dickungen versteckt; im Winter zieht er höher gelegenes und trockenes Gehölz vor. Sehr alte Stiere leben einsam, jüngere während des Sommers in Rudeln von fünfzehn bis zwanzig, während des Winters in kleinen Herden von dreißig bis fünfzig Stück. Jede einzelne Herde hat ihren festen Stand und kehrt immer wieder nach demselben zurück. Bis zum Eintritt der Brunstzeit herrscht Einigkeit unter solchem Trupp; zwei verschiedene Herden aber vertragen sich anfangs nicht gut miteinander, und die kleinere weicht soviel als möglich der größeren aus.
Die Wisente sind ebensowohl bei Tage wie bei Nacht tätig, weiden aber am liebsten in den Abend- und Morgenstunden, zuweilen jedoch auch während der Nacht. Verschiedene Gräser, Blätter, Knospen und Baumrinde bilden ihre Nahrung; sie schälen die Bäume ab, soweit sie reichen können, und reiten jüngere, biegsame Stämme nieder, um zu der Krone zu gelangen, die sie dann meist gänzlich vernichten. Ihr Lieblingsbaum scheint die Esche zu sein, deren saftige Rinde sie jeder andern bevorzugen? Nadelbäume dagegen lassen sie unbehelligt. Im Winter äsen sie fast ausschließlich von Rinden, Zweigen und Knospen der ihnen zugänglichen Laubbäume, außerdem auch wohl von Flechten und trockenen Gräsern. Das im Bialowieser Walde auf den Wiesen geerntete Heu wird für sie aufgeschobert, anderes nehmen sie, nachdem sie die Umhegungen niedergebrochen haben, gewaltsam in Besitz. Frisches Wasser ist ihnen Bedürfnis.
Obwohl die Bewegungen der Wisente schwerfällig und plump erscheinen, sind sie doch, bei Licht betrachtet, lebhaft genug. Der Gang ist ein rascher Schritt, der Lauf ein schwerer, aber schnell fördernder Galopp, wobei der Kopf zu Boden gesenkt, der Schwanz emporgehoben und ausgestreckt wird. Durch Sumpf und Wasser waten und schwimmen sie mit Leichtigkeit. Unter ihren Sinnen steht der des Geruches obenan; Gesicht und Gehör sind minder, Geschmack und Gefühl zu durchschnittlicher Höhe entwickelt. Das Wesen ändert sich mit den Jahren. Jüngere Tiere erweisen sich als muntere, lebhafte und spiellustige, auch verhältnismäßig gutmütige, zwar nicht sanfte und friedfertige, aber doch auch nicht bösartige Geschöpfe, ältere dagegen, zumal alte Stiere, erscheinen als ernste, fast mürrische, leicht reizbare und jähzornige, jeder Tändelei abholde Wesen. Im allgemeinen lassen zwar auch sie Menschen, die sie nicht behelligen wollen, ruhig an sich vorübergehen; allein die geringste Veranlassung kann ihren Zorn erregen und sie äußerst furchtbar machen. Im Sommer pflegen sie dem Menschen stets auszuweichen, im Winter gehen sie gewöhnlich niemand aus dem Wege, und es ist schon vorgekommen, daß Bauern lange warten mußten, ehe es einem Wisent gefiel, den von ihm gesperrten Fußpfad zu verlassen, auf dem es für jenen kein Ausweichen gab. Wildheit, Trotz und Jähzorn sind bezeichnende Eigenschaften auch dieser Wildrinder. Der erzürnte Wisent streckt die bläulichrote Zunge lang heraus, rollt das gerötete Auge, sein Blick wird grimmig, und mit beispielloser Wut stürzt er auf den Gegenstand seines Zornes los. Jüngere Tiere sind immer scheuer und furchtsamer als die alten Stiere, unter denen namentlich die einsiedlerisch lebenden zu einer wahren Geißel für die Gegend werden können. Sie scheinen ein besonderes Vergnügen darin zu finden, mit dem Menschen anzubinden. Ein alter Hauptstier beherrschte eine Zeitlang die durch den Bialowieser Wald führende Straße, wich nicht einmal Fuhrwerken aus und richtete viel Unglück an. Wenn er auf einem durchziehenden Schlitten gutes Heu witterte, erhob er gewaltsam seinen Zoll, indem er trotzig vor die Pferde trat und den Fuhrmann mit Gebrüll aufforderte, ihm Heu herabzuwerfen. Verweigerte man, ihm das Verlangte zu gewähren, und versuchte man, die Peitsche gegen ihn anzuwenden, so geriet er in furchtbaren Zorn, hob den Schwanz empor und stürzte sich mit niedergebeugten Hörnern auf den Schlitten los, packte ihn und warf ihn mit einem einzigen Stoße über den Haufen. Reisende, die ihn neckten, schleuderte er einfach aus dem Schlitten heraus. Pferde bekunden von vornherein Furcht und Abscheu vor dem Wisent und pflegen durchzugehen, wenn sie ihn wittern. Tritt ihnen aber der entsetzliche Stier plötzlich in den Weg, so gebärden sie sich wie unsinnig, bäumen, werfen sich nieder und verraten auf jede Weise ihr Entsetzen.
Die Brunstzeit, die gewöhnlich in den August, manchmal auch erst in den September fällt, währt zwei oder drei Wochen. Um diese Zeit sind die Wisente im besten Stande, feist und kräftig. Eigentümliche Spiele und ernste Kämpfe unter den Stieren gehen dem Sprunge voraus. Dem liebestollen Tiere scheint es ein besonderes Vergnügen zu bereiten, mittelstarke Bäume aus der Erde zu wühlen und auf diese Weise zu fällen. Nach und nach gesellen sich die alten Einsiedler der Herde zu, und nunmehr werden die Zweikämpfe noch viel bedeutsamer; denn jenem muß ein jüngerer, schwächerer Stier entweder weichen oder erliegen.
Sofort nach Beendigung der Brunst trennen sich die alten Einsiedler wieder von der Herde und kehren zu ihrem stillen, beschaulichen Leben zurück. Die Kühe kalben neun Monate nach der Brunstzeit, gewöhnlich im Mai oder anfangs Juni. Vorher haben sie sich von der Herde abgesondert und im Dickichte des Waldes in einer einsamen, friedlichen Gegend einen geeigneten Platz aufgesucht. Hier verbergen sie sich und ihr Kalb während der ersten Tage, treten aber bei etwaiger Gefahr mit außerordentlichem Mute für dessen Sicherheit ein. In der ersten Jugend drückt sich das Kalb im Notfalle Platt auf den Boden nieder, hebt und dreht das Gehör, öffnet Nüstern und Augen und schaut ängstlich nach dem Feinde, während die Alte sich anschickt, diesem entgegenzutreten. Jetzt ist es für Menschen und Tier gefährlich, sich einer Wisentkuh zu nahen; sie nimmt ohne weiteres den Gegner an, rennt ihn zu Boden und zerfleischt ihn mit den Hörnern. Einige Tage nach seiner Geburt folgt das Kalb seiner Mutter, die es mit außerordentlicher Zärtlichkeit behandelt. Solange es noch nicht ordentlich gehen kann, schiebt sie es sanft mit dem Kopfe vorwärts; wenn es unreinlich ist, leckt sie es glatt; beim Säugen stellt sie sich auf drei Beine, um ihrem Sprößling das Euter leichter zu bieten, und während es schläft, wacht sie für dessen Sicherheit.
Diese Kälber sind niedliche, anmutige Tiere, obgleich schon in der Jugend das in ihnen liegt, was im Alter aus ihnen werden soll. Sie wachsen sehr langsam und haben wahrscheinlich erst im achten oder neunten Jahre ihre volle Größe erreicht. Das Alter, das die Wisente überhaupt erreichen können, wird auf etwa dreißig bis fünfzig Jahre angegeben. Kühe sterben ungefähr zehn Jahre früher als Stiere; aber auch diese werden im Alter gewöhnlich blind oder verlieren die Zähne und sind dann nicht mehr fähig, gehörig zu äsen, können namentlich nicht mehr die jungen Zweige abbeißen, welken rasch dahin und gehen schließlich zugrunde.
Im Vergleich zu andern Rindern vermehren sich die Wisente langsam. Im Walde von Bialowies hat man in Erfahrung gebracht, daß die Kühe kaum alle drei Jahre einmal trächtig werden und bei nur einigermaßen gereifterem Alter oft eine Reihe von Jahren hintereinander unfruchtbar bleiben, dann jedoch manchmal wieder empfangen. Im Jahre 1829 warfen von zweihundertachtundfünfzig Kühen nur dreiundneunzig; von den übrigen hundertfünfundsechzig war der größte Teil unfruchtbar, der kleinere Teil zu jung. Hierin dürfte eine der Ursachen des Aussterbens der Wisente gefunden werden.
Gegen ihre Feinde wissen sich die gewaltigen Tiere vortrefflich zu verteidigen. Bären und Wölfe können den Kälbern gefährlich werden, aber nur dann, wenn die Mutter durch irgendwelchen Zufall ihr Leben verloren hat und das Junge unbeschützt ist. Bei sehr tiefem Schnee soll es vorkommen, daß hungrige Wölfe auf einen erwachsenen vereinzelten Wisent sich stürzen, ihn mit vereinten Kräften anfallen, durch Umhertreiben ermatten und schließlich, wenn auch erst nach harten Verlusten, erlegen. Der schlimmste Feind der Wisente ist natürlich der Mensch.
Im Walde von Bialowies erschienen die Herrscher früherer Jahrhunderte mit zahlreichem Gefolge, boten alle Beamten des Waldes auf, zwangen die umwohnenden Bauern zu Treiberdiensten und bewegten somit eine Mannschaft von zwei- bis dreitausend Köpfen, die ihnen die Wisente nach den Orten treiben mußte, wo sie auf sicheren Kanzeln sich angestellt hatten. Von einer der glänzendsten Jagden, die König August III. im Jahre 1752 abhielt, berichtet heute noch eine sechs Meter hohe Spitzsäule aus weißem Sandstein in deutscher und polnischer Sprache. An dem einen Tage wurden zweiundvierzig Wisente, dreizehn Elentiere und zwei Rehe erlegt. Die Königin allein schoß zwanzig Wisente nieder, ohne auch nur ein einziges Mal zu fehlen, und hatte dabei noch immer Zeit zum Lesen eines Romans. Die Schützen waren den Tieren, die niedergemeuchelt wurden, unerreichbar. Um einen Begriff von der Großartigkeit der damaligen Jagd zu geben, will ich bloß noch anführen, daß auf des Königs Befehl schon Monate vor derselben viele Tausende von Leibeigenen aufgeboten wurden, um das Wild von allen Seiten des damals noch viel bedeutenderen Waldes nach der zur Jagd bestimmten Abteilung hinzutreiben. Dort wurden die scheuen Tiere eingelappt und zuerst durch drei Meter hohe Netze, später durch ein noch höheres Holzgatter umfriedigt. Dicht neben dem Gatter war ein Söller errichtet worden, auf dem der König mit den vornehmsten seiner Gäste Platz nahm. Etwa zwanzig Schritte von diesem Söller entfernt war eine Lücke in den Umhegungen gelassen, durch die alles hier eingeschlossene Wild getrieben wurde. Sobald ein Wisent stürzte, bliesen die Jagdgehilfen auf ihren Halbhörnern. Nach der Jagd besichtigte der Hof unter Hörnerklang die gefallenen Stücke, deren Wildbret unter die umwohnenden Bauern verteilt wurde. Dann ließ der König das erwähnte Denkmal setzen, zum ewigen Gedächtnis seiner ritterlichen Taten.
In unsern Tiergärten halten die Wisente bei einigermaßen geeigneter Pflege vortrefflich aus, schreiten auch ohne Umstände zur Fortpflanzung, vermehren sich sogar stärker als im Freien. Nach den Beobachtungen von Schöpff beträgt ihre Trächtigkeitsdauer zweihundertundsiebzig bis zweihundertvierundsiebzig Tage. Die Mutter behandelt das neugeborene Junge mit größter Zärtlichkeit, falls dasselbe nicht von menschlicher Hand berührt wird, wogegen sie in die größte Wut gerät und diese an dem harmlosen Kälbchen ausläßt, wenn sich ein Wärter wider ihren Willen mit letzterem zu schaffen macht. Der Stier muß stets von der trächtigen Kuh getrennt werden, weil ein Familienleben in engem Raume bei diesen Tieren nicht durchzuführen ist. Ein am 22. Mai 1865 in Dresden geborenes Wisentkalb wurde von seinem Erzeuger sofort aufgegabelt und durch die Einfriedigung des Geheges geschleudert. Hier kam es wieder auf die Beine zu stehen, und man brachte es nunmehr in den Stall zu der inzwischen von dem Stiere getrennten Mutter; diese aber, nachdem sie es berochen und wahrscheinlich gefunden hatte, daß es von menschlicher Hand berührt worden war, warf es sofort in die Höhe und stampfte es zu Tode. Schon mehrere Wochen vor der Geburt zeigt sich auch die sanfteste Wisentkuh wild und bösartig, und wenn sie geboren und ihr Kalb angenommen hat, benimmt sie sich regelmäßig so, wie ich oben geschildert habe.
Mehrere Naturforscher haben die Ansicht verfochten, daß der Wisent einen gewissen Anteil an der Entstehung einzelner Rassen unseres Rindes habe; nach den neueren Erfahrungen scheint jedoch das Gegenteil erwiesen zu sein. Zwischen Wisent und Hausrind besteht ein heftiger Abscheu, und selbst wenn man, wie es im Bialowieser Walde geschehen ist, jung eingefangene Wisentkälber stets mit zahmen Rindern zusammenhält, ändert sich dieses Verhältnis in der Regel nicht. Als man versuchte, eine junge Wisentkuh mit einem Hausstiere zur Paarung zu bringen und diesen dicht neben ihr einstellte, durchbrach sie wütend den Verschlag, der sie von ihm trennte, fiel ihn rasend an und trieb ihn mit Wut und Kraft aus dem Stalle, ohne daß der seinerseits nun ebenfalls gereizte Stier Gelegenheit gefunden hätte, sich ihr zu widersetzen. Und doch liegen auch in dieser Beziehung Belege für das Gegenteil vor. »Im Csiterkreise«, schreibt Franz Sulzer in einem im Jahre 1781 erschienenen Werke, »verliebte sich ein Wisentstier in eine mit der Herde täglich zur Weide gehende Kuh und wurde mit dieser so vertraut, daß er zu nicht geringem Schrecken der Dorfbewohner allabendlich derselben nicht allein das Geleite bis zur Haustür gab, sondern auch in ihren Stall eindrang. Schließlich gewöhnten sich die Leute an dieses zarte Verhältnis und trieben allmorgendlich den Wisentstier mit seiner Liebsten zur Weide.«
Über den Schaden und Nutzen des Wisents ist jetzt nicht mehr zu reden.
Dasselbe Schicksal, das sich am Wisent nahezu erfüllt hat, steht seinem einzigen Verwandten, dem Bison, bevor. Auch er verbreitete sich früher fast über die ganze Nordhälfte der westlichen Erde und ist bereits in vielen Ländern gänzlich vernichtet, wird auch von Jahr zu Jahr weiter zurückgetrieben und mehr und mehr beschränkt. Indianer und Weiße sitzen ihm beständig auf dem Nacken, und das Morden, die Vernichtung gehen unaufhaltsam ihren Gang. Der Bison oder »Büffel« der Amerikaner ( Bos bison) ist unter den nordamerikanischen Tieren dasselbe, was der Wisent in Europa: der Riese aller dortigen Landsäugetiere. Die Länge des Bullen beträgt 2,6 bis 2,9 Meter, ungerechnet des 50, mit den Haaren aber 65 Zentimeter langen Schwanzes, die Höhe am Widerrist zwei Meter, die Kreuzhöhe 1,7 Meter; das Gewicht schwankt zwischen sechshundert und tausend Kilogramm. Die Kuh erreicht etwa vier Fünftel der Größe des Stieres. Die Unterschiede zwischen Bison und Wisent, mit denen einzelne Naturforscher jenen als gleichartig erklären wollen, sind größer als bei andern gleich nahe verwandten Rindern. Der Kopf des Bison ist sehr groß, verhältnismäßig viel größer und breitstirniger, auch plumper und schwerer, der Nasenrücken stärker gewölbt, das Ohr länger als beim Wisent, das blöde, tief dunkelbraune Auge, dessen Weiß getrübt erscheint, mäßig groß, das Nasenloch sehr schief gestellt, länglich eirund, in der Mitte oben vor-, unten ausgebuchtet; der kurze, hohe und schmale Hals steigt steil an zu dem unförmlich erhöhten Widerrist, von dem ab die Rückenlinie bis zur Wurzel des kurzen, dicken Schwanzes stark abfällt, ebenso wie sich der in der Brustgegend verbreiterte Leib nach hinten zu außerordentlich verschmächtigt; die Beine sind verhältnismäßig kurz und sehr schlank, die Hufe und Afterhufe klein und rund. Somit müssen die Größe des Kopfes, die ungewöhnliche Entwicklung des Brustteils bei auffallender Verschmächtigung des Hinterteils und die Kürze des dicken Schwanzes wie der schlanken Beine als bezeichnende Merkmale des Tieres gelten. Die Hörner, die bedeutend stärker, an der Wurzel dicker, an der Spitze stumpfer, in ihrer Biegung einfacher als die des Wisents sind, biegen sich nach hinten, außen und oben, ohne daß die Spitzen wieder erheblich sich nähern. Das Haarkleid ähnelt dem des Wisent. Kopf, Hals, Schultern, Vorderleib und Vorderschenkel, Vorderteil der Hinterschenkel und Schwanzspitze sind lang, die Schulterteile mähnig, Kinn und Unterhals bartähnlich, Stirn- und Hinterkopf kraus, filzig behaart; und alle übrigen Leibesteile tragen nur ein kurzes, dichtes Haarkleid. Im Winter verlängert sich das Haar bedeutend; mit Beginn des Frühlings wird der Winterpelz in großen Flocken abgestoßen.

Bison ( Bos bison)
Mit dieser Veränderung steht die Färbung im Einklang. Sie ist eigentlich ein sehr gleichmäßiges Graubraun, das in der Mähne, d. h. also an Vorderkopf, Stirn, Hals und Wamme dunkler wird, nämlich in Schwarzbraun übergeht. Das abgestoßene Haar verbleicht und nimmt dann eine graulich gelbbraune Färbung an. Hörner und Hufe sowie die nackte Muffel sind glänzend schwarz. Weiße und weiß gefleckte Spielarten sind beobachtet worden, kommen aber selten vor.
Im Gegensatz zu dem Wisent, einem entschiedenen Waldbewohner, muß der Bison als ein Charaktertier derjenigen Steppengebiete angesehen werden, die die Amerikaner Prärien nennen. »Unter diesen«, so schildert Finsch, »stellt man sich bei uns gewöhnlich Ebenen vor, die mit dem üppigsten, mannshohen Graswuchse, gemischt mit einer Fülle der verschiedenartigsten Blumen, bedeckt sind. Ein solches durch Baum- und Gehölzgruppen abwechselndes Bild gewährt die Prärie nur an ihren Ausläufern und da, wo Wasserausflüsse eine reiche Pflanzenwelt begünstigen, wogegen sie im übrigen ein durchaus verschiedenes Gepräge zeigt. Anstatt der erwarteten unbegrenzten, ebenen Fläche finden wir sanftwellige Hochländer, die vom Flusse nach den Bergen in einer Reihe hochaufsteigender, mehr oder weniger größerer Wogen sich erheben, und in die durch die aus schmelzendem Schnee und Eis gebildeten Gewässer oft steil und tiefabfallende Rinnsale gewühlt werden. Man glaubt den Gipfel oder Kamm einer solchen Erhebung, die kaum als eine unbedeutende Hügelkette erscheint, in höchstens einer Viertelstunde zu erreichen; aber das Auge hat auf diesen Flächen, wo eine ungemein reine und dünne Luft die Fernsicht in ungeahnter Weise begünstigt, Entfernungen noch nicht abschätzen gelernt, und man ist froh, vielleicht erst nach einer Stunde an dem erwünschten Ziele angelangt zu sein. Nichts bietet sich dem Auge als Anhaltspunkt; nur da, wo reiche Bäche Tümpel stehenden Wassers gebildet haben, finden sich Weiden und Sträucher, unter denen sich zuweilen, als weithin sichtbare Wahrzeichen, einige Bäume mächtig erheben. Im übrigen steht die Pflanzenwelt mit der Einförmigkeit der Landschaft im vollsten Einklang. Zwar sind Blumen, unter ihnen namentlich die reizende goldgelbe Zwergsonnenblume, und weiter südlich zwergartige, niedrig dahinkriechende Kakteen mit haarigen gelben und roten Blüten häufig; aber die Charakterpflanze bleibt doch stets das eigentümliche »Büffelgras«, eine kaum mehr als drei Zentimeter erreichende Grasart, die daher keinen ununterbrochenen Rasenteppich im Sinne unserer Wiesen bildet. Dieses unscheinbare Gras ist das Lieblingsfutter der Bisonten.«
Der Bison ist, wie es scheint, noch geselliger als die übrigen Rinder; jedoch bilden die Massen, die man früher auf ein und derselben Ebene erblickte, Diese schönen Schilderungen Brehms gehören heute ja leider der Vergangenheit an. Herausgeber. nicht eine einzige Herde, sondern zerfallen in zahllose kleinere Gesellschaften. Rücksichtlich der verschiedenen Geschlechter vereinigt sich das Tier überhaupt nur in gewissen Monaten, zur Brunstzeit nämlich; den übrigen Teil des Jahres hindurch bilden die Stiere für sich abgesonderte Trupps, die Kühe mit ihren noch nicht zeugungsfähigen Kälbern andere. Die Gesamtheit bleibt übrigens in einer gewissen Verbindung: eine Herde zieht der andern nach. Im Sommer zerstreuen sich diese in den weiten Ebenen, im Winter vereinigen sie sich mehr und suchen dann die waldigen Gegenden auf. Dann findet man sie auf baumreichen Inseln der Ströme und Seen oder längs deren waldigen Ufern in zahlloser Menge. Alljährlich unternehmen sie mit größerer oder geringerer Regelmäßigkeit eine Wanderung. Vom Juli an ziehen sie südwärts, mit Beginn des Frühjahrs kehren sie wieder nach Norden zurück, und zwar in kleinere Trupps oder Herden aufgelöst. Diese Wanderungen dehnen sie von Kanada bis zu den Küstenländern des Mexikanischen Golfs und von Missouri bis zu den Felsengebirgen aus. Dessenungeachtet findet man allerorten, wo sie hausen, einzelne zurückgebliebene, die sich dem großen Strom nicht angeschlossen haben. Dies sind gewöhnlich alte Stiere, schon zu steif und zu träge, um den Heersäulen zu folgen, vielleicht auch zu bösartig, als daß sie von der jüngeren Gesellschaft geduldet würden, und deshalb zum Einsiedlerleben gezwungen. Die wandernden Herden sind auch dann noch kenntlich, wenn man die Büffel selbst nicht wahrnimmt; denn ebenso wie Meuten magerer Wölfe folgen ihnen Geier und Adler und Raben in den Lüften, die einen wie die andern sicherer Beute gewiß. Es scheint, als ob die Büffel bestimmte Straßen auf ihrer Wanderung einhalten. Da, wo sie sich fest angesiedelt haben, wechseln sie mit großer Regelmäßigkeit hin und her, namentlich von den saftigen Weideplätzen zu den Flüssen, die sie besuchen, um sich zu tränken oder badend zu kühlen, und auf ihren Wanderungen treten sie jene Wege aus, die unter dem Namen »Büffelpfade« allen bekannt geworden sind, die die Prärien durchreisten. Die Büffelpfade führen meist in gerader Richtung fort, Hunderte nebeneinander, überschreiten Gebirgsbäche und Flüsse da, wo die Ufer zum Ein- und Aussteigen bequem sind, und ziehen sich viele, viele Meilen weit durch die Steppen dahin.
Das Gesellschaftsleben der Bisonten wird hauptsächlich durch zwei Ursachen bedingt, durch den Wechsel des Jahres und durch die Fortpflanzung. Der Frühling zerstreut, der Herbst vereinigt.
In den Monaten Juli und August stellen sich die wohlgenährten Stiere bei den Kühen ein, und jeder einzelne von ihnen erwählt sich eine Lebensgefährtin. Ungeachtet solcher Genügsamkeit geht es ohne Kampf und Streit nicht ab, denn auch unter den »Büffeln« befinden sich häufig genug mehrere Bewerber um ein und dieselbe Kuh. Dann entbrennen furchtbare Kämpfe, bis ein Stier als unanfechtbarer Sieger aus solchen hervorgeht. Hierauf sondert sich das Paar von der Herde und hält sich nur bis zu dem Monat zusammen, in dem der aus solcher Vereinigung hervorgehende Sprößling geboren wird. Sobald ein Paar sich wirklich vereinigt hat, tritt der Frieden unter der Gesamtheit wieder ein. Alle Beobachter versichern, daß man sich kaum ein prachtvolleres Schauspiel denken könne, als solcher Kampf zwischen zwei kräftigen Stieren es gewährt. Der zum Gefecht sich anschickende Bison stampft wütend den Grund, brüllt laut, schüttelt mit dem tief zu Boden gesenkten Kopfe, erhebt den Schwanz, peitscht mit ihm durch die Luft und stürzt sodann plötzlich mit überraschender Eile auf seinen Gegner zu. Die Gehörne, die Stirnen prallen laut schallend aneinander. Dessenungeachtet hat man, wie Audubon versichert, niemals beobachtet, daß ein Stier von dem andern in solchem Kampfe getötet worden wäre. Der dicke Schädel, der außerdem durch den Wollfilz auf ihm wohlgeschützt ist, hält einen gewaltigen Stoß ohne Schaden aus, und die kurzen Hörner bilden keine geeigneten Waffen, einen gleich starken Gegner tödlich zu verletzen.
Die Brunst währt ungefähr einen Monat lang; Stiere aber, die ihren Trieb nicht befriedigen können, bleiben noch wochenlang nach der eigentlichen Brunstzeit wütend und bösartig. Ein unausstehlicher Moschusgeruch erfüllt die Luft, macht sie auch dem Jäger schon von weitem kenntlich und durchdringt das Wildbret in einem Grade, daß es, für Europäer wenigstens, vollkommen ungenießbar wird. Die heftige Erregung bringt das Tier außerdem sehr vom Leibe; es vergißt zu äsen, magert ab, entkräftet schließlich und bleibt hinter den eigentlichen Herden zurück. Nun erst kommt es nach und nach wieder zur Besinnung. Die Einsamkeit beruhigt, die Äsung kräftigt, und gegen den Herbst hin ist die unglückliche Liebe vergessen.
Neun volle Monate nach der Paarung, gewöhnlich in der Mitte des März oder im April, bringt die Kuh ihr Kalb zur Welt. Schon früher hat sie sich von dem Stier, mit dem sie vorher wochenlang zusammenlebte, getrennt und dafür andern hochbeschlagenen Kühen angeschlossen. Solche nur aus Muttertieren bestehende Gesellschaften erwählen sich die saftigsten Weideplätze und verweilen auf ihnen mit den Kälbern, solange sich Weide findet. Die Kälber werden überaus zärtlich behandelt und gegen Feinde mit wildem Mut verteidigt, verdienen aber auch solche Liebe; denn sie sind muntere, bewegliche, spiellustige, zu heiteren Sprüngen und zu neckischen Scherzen aufgelegte Geschöpfe. Unter regelmäßigen Umständen wachsen sie rasch heran, werden bereits im Herbst entwöhnt und treiben es dann wie die Alten.
Der Bison ist keineswegs ein so faules und der Bewegung abholdes Wesen, wie einzelne Beschreiber behauptet haben. Das uns plump erscheinende Tier bewegt sich mit überraschender Leichtigkeit. Aufmerksame Beobachter wollen gefunden haben, daß es oft mit seiner eigenen Kraft zu scherzen und zu spielen scheint. Ungeachtet seiner kurzen Läufe durchmißt der Bison rasch bedeutende Strecken. Er geht niemals in der faulen Weise, wie ein zahmes Rind, langsam dahin, sondern stets eiligen Schrittes, trabt rasch und ausdauernd und bewegt sich im Galopp mit so großer Schnelligkeit, daß ein Pferd sich anstrengen muß, um mit ihm fortzukommen. Seine Bewegungen sind eigentümlich kurz abgebrochen und beschreiben, wenn sie beschleunigt werden, sonderbare Wellenlinien, die dadurch entstehen, daß er die Masse des Leibes bald vorn, bald hinten aufwirft. Das Schwimmen übt er mit derselben Kraft und Ausdauer, die seine Bewegungen überhaupt kennzeichnen, nimmt auch nicht den geringsten Anstand, sich in das Wasser zu begeben. Clarke sah eine Herde über den Missouri setzen, obgleich der Strom an der betreffenden Stelle über eine englische Meile breit war. In ununterbrochener Reihe zogen die Tiere mit großer Schnelligkeit durch das Wasser, eines dicht hinter dem andern, und während die ersten drüben bereits wieder festen Fuß gefaßt hatten, stürzten sich hüben die letzten noch immer in die Wogen. Die Stimme ist ein dumpfes, nicht eben lautes Brummen, mehr ein Grollen in tiefer Brust als ein Brüllen. Wenn Tausende und andere Tausende zugleich sich vernehmen lassen, einen sich die Stimmen zu einem Dröhnen, das mit dem Rollen fernen Donners verglichen wird.
Unter den Sinnen stehen Geruch und Gehör obenan. Der Bison wittert vorzüglich und vernimmt auf weite Strecken hin. Das Gesicht wird von allen Beobachtern gleichmäßig als schwach bezeichnet, obgleich das Auge wohlgebildet ist und sich wohl kaum von dem anderer Wiederkäuer unterscheidet. Hinsichtlich der geistigen Fähigkeiten unterscheidet sich dieser nicht von andern Verwandten. Er ist wenig begabt, gutmütig und furchtsam, schneller Erregungen unfähig, kann aber, gereizt, alle Rücksichten, die er sonst zu nehmen pflegt, vergessen und dann sehr mutig, boshaft und rachsüchtig sein. Unsere Tiere sind der Zähmung durchaus nicht unzugänglich, wie früher oft behauptet worden ist, treten mit dem Menschen, der sie recht zu behandeln weiß, in ein fast freundschaftliches Verhältnis, lernen wenigstens ihren Wärter kennen und in gewissem Grade lieben. Aber freilich währt es lange, ehe sie ihre angeborene Scheu ablegen. Der Stier zeigt sich unter allen Umständen selbstbewußter, anspruchsvoller, herrschsüchtiger und deshalb mutiger und kampfeslustiger als die Kuh.
Während des Sommers bietet das unscheinbare, aber saftige Gras der Prärien den grasenden Bisonten ein gedeihliches Futter, im Winter müssen sie mit geringerer Nahrung vorliebnehmen und sind zufrieden, wenn sie neben Zweigspitzen und verdorrten Blättern dürres Gras, Flechten und Moos erlangen können. Daß sie zwischen gutem und schlechtem Futter unterscheiden, unterliegt keinem Zweifel; sie bevorzugen wohl das bessere, begnügen sich aber auch mit dem geringsten.
Viele und ernste Gefahren bedrohen das Leben des Bisons. Auch er hat zu kämpfen um das Dasein. Der auf der Prärie meist schwere Winter vernichtet Hunderte seines Geschlechts, nachdem er sie erst entkräftete und ermattete. Zwar ist der Bison wohl gerüstet, ihm zu widerstehen; sein dichter Wollfilz schützt ihn unter günstigen Umständen genügend gegen die Witterung, und der Haarwechsel seines Kleides steht, wie zu erwarten, in so genauem Einklang mit der Jahreszeit, daß ihn, sozusagen, der Winter unvermutet nicht überrascht; aber die Umstände können sehr traurig werden, wenn die Schneedecke allzu hoch den Boden bedeckt und das nach Nahrung suchende Tier trotz aller Anstrengungen nicht genug Äsung findet, um sein Bedürfnis zu befriedigen. Dann verzehrt sich rasch das Feist, das er während des Sommers sich sammelte, die Entkräftung nimmt mehr und mehr überhand, und es schwindet die Möglichkeit, das Leben zu fristen. Endlich bleibt das ermattete Tier mit verzweifelnder Entsagung ruhig liegen und läßt sich widerstandslos unter der Schneedecke begraben. Auch an lebenden Feinden fehlt es dem Bison ebensowenig wie irgend einem andern seines Geschlechts. Es wird gesagt, daß der Griselbär selbst den Kampf mit dem wehrhaften Stier nicht scheue, und ebenso, daß auch der Wolf wenigstens jüngere Büffel gefährde. Der schlimmste Feind aber bleibt doch der Mensch, zumal der in Amerika erst eingewanderte. »In früheren Zeiten«, so schildert Möllhausen, »als der Büffel gewissermaßen als Haustier der Indianer betrachtet werden konnte, war keine Verminderung der unabsehbaren Herden bemerkbar; im Gegenteil, sie gediehen und vermehrten sich auf den üppigen Weiden. Nun kamen die Weißen in diese Gegenden. Die reichhaarigen großen Pelze gefielen ihnen, das fette Büffelfleisch fanden sie nach ihrem Geschmack, und von beidem versprachen sie sich reichen Gewinn. Tausende von Büffeln wurden allein der Zungen wegen erlegt, und in wenigen Jahren war eine bedeutende Verminderung derselben auffallend bemerkbar. Sicher ist die Zeit nicht mehr fern, Sie ist heute, wie angemerkt, bis auf die Tiere, die in den Naturschutzparken systematisch gehegt werden, bereits da. wann die gewaltigen Herden nur noch in der Erinnerung leben.«
Gegen die Angriffe der Wölfe und die noch schlimmeren der Bullenbeißer weiß sich der Bison mit großer Gewandtheit zu sichern. Wenn einer jener Räuber in dem zottigen Felle des Bison sich festbeißt, wird er von diesem durch eine einzige Bewegung über den Kopf hinweggeschleudert, unter Umständen aber auch auf den Hörnern aufgefangen und dann sehr bald abgetan. Selbst gut eingehetzte Doggen mußten dem Bison unterliegen. Sie griffen ihn nur von vorn an und verbissen sich fest in seine Oberlippe; allein der Stier wußte sich zu helfen, stellte rasch die Vorderbeine auseinander, zog die Hinterbeine nach, stürzte sich nach vorn auf den Hund und erstickte ihn unter seiner gewaltigen Last.
Das getrocknete Fleisch, das unter dem Namen » Pemmikan« in Amerika bekannt ist, wird weit und breit versandt und von allen Reisenden als wohlschmeckend gerühmt; die Zunge gilt als Leckerbissen. Das Fleisch der Kühe ist noch fetter als das der Stiere und das der Kälber überaus zart. Aus dem Fell verfertigten sich die Indianer warme Kleidungsstücke, Zeltwandungen und Betten, Sättel, Gurte usw., beschlagen auch wohl das Geripp ihrer Kähne damit. Die Knochen müssen ihnen Sattelgestelle und Messer liefern, mit denen sie dann die Häute abhären; aus den Sehnen zwirnen sie sich Saiten für ihre Bogen und Faden zum Nähen; aus den Füßen und Hufen bereiten sie durch Kochen einen haltbaren Leim; die starken Haare des Kopfes und des Halses werden zu Stricken gedreht; aus den Schwänzen macht man Fliegenwedel; der Mist dient als Brennstoff. Auch die Europäer sind Liebhaber der Bisonfelle. Das Leder ist vorzüglich, obgleich etwas schwammig, und das Fell mit den Haaren zu Decken aller Art zu gebrauchen. Die Wolle, von der ein einziges Vlies bis vier Kilogramm liefern kann, läßt sich ebenso gut wie Schafwolle verarbeiten, wird auch in manchen Gegenden zur Erzeugung warmer und sehr dauerhafter Stoffe verwendet.
Leider werden viel mehr Bisonten der unbezwinglichen Jagdlust der Weißen als dem wirklichen Nutzen geopfert. »Man führt«, klagt Möllhausen, »den Ausrottungskrieg gegen die Zierde der Grassteppen auf unbarmherzige Weise fort, und keinem Gedanken auf Schonung wird Raum werden, bis der letzte Büffel, bald nach ihr die letzte Rothaut und mit ihr die einzige Naturdichtung des großen amerikanischen Festlandes verschwunden sein wird.« Amerikanische Blätter der neuesten Zeit stimmen diesen Klagen vollständig bei. »Noch vor wenigen Jahren«, heißt es in einem mir zugegangenen Zeitungsberichte, »trabten zahllose Bisonherden über die unendliche Prärie östlich der Felsenberge; jetzt sieht man dort nur noch deren bleichende Gebeine. In welcher Weise man den Krieg gegen die Tiere führt, welches unverzeihliche Gemetzel man anrichtet, geht am besten aus einer Angabe hervor. Am Rickareeflusse allein lagerten im vergangenen Sommer (1874) zweitausend Büffeljäger, und mehrere von ihnen rühmten sich, daß sie im Laufe des Sommers gegen zwölfhundert dieser Tiere erlegt hatten; ein aus sechzehn Jägern bestehender Trupp erklärte, im Laufe einer Jahreszeit achtundzwanzigtausend Bisonten getötet zu haben.« Das ist keine Jagd mehr, sondern nur noch ein sinnloses Morden, ein nichtswürdiges Abschlachten, das gebildet sein wollenden Menschen offenbar zur Schande gereicht und den Untergang der Tiere notwendig herbeiführen muß. Auch Finsch, der minder trübe als Möllhausen in die Zukunft sieht, kann nicht umhin, die abscheuliche Verwüstungssucht der Amerikaner zuzugestehen. »Während der rote Mann«, sagt er, »den Bison nur zu seinem Lebensunterhalt jagt, schießt der Weiße Tausende ausschließlich zu seinem Vergnügen, zum Spaß, aus ungezügelter Jagdlust tot. Es macht einen traurigen Eindruck, in der Prärie überall diesen Spuren nutzloser Verwüstung zu begegnen. Bald stoßen wir auf einzelne Schädel, bald auf mehr oder minder vollständige Gerippe und Leichname, an denen Raben, Heul- und Falbwölfe nagen, oder die durch Präriebrand gebraten und zu einer unförmigen Masse umgestaltet sind; bald ist es ein verwundeter Bison, der todeswund daliegt oder sich mühsam hinschleppt. So verwerflich diese Vernichtungen sind, man wird milder über ihre Urheber urteilen, wenn man bedenkt, daß in der menschenleeren Einöde ohne Fuhrwerk das Fortschaffen solcher zehn bis fünfzehn Zentner schweren Fleischmassen eben eine Unmöglichkeit ist, und daß der glückliche Jäger seine herrliche Beute den Raubtieren oft überlassen muß, um sich mit der Zunge oder der Endhälfte des Schwanzes zu begnügen. Doch bleibt dieses zwecklose Hinmorden dem Indianer natürlich unbegreiflich und ein Rätsel, dem er am liebsten mit Tomahawk und Skalpiermesser ein Ende machen möchte.
»Wenn«, so schließt mein kundiger Freund, »in nicht näher zu berechnendem Zeitraum der schwarze, fette Boden der Prärie durch den Fleiß und die Ausdauer des Weißen Mannes in lachende Fluren und Gefilde verwandelt sein wird, dann werden wir den Bison nur noch in geschützten Gehegen und in unseren Tiergärten finden.« Ist buchstäblich heute eingetreten. Vergl. Anmerkung auf S. 71 und 84. Herausgeber.
Die Kinder im engsten Sinne ( Bos), zu denen unsere Haustiere gehören, bilden eine Gruppe für sich, die sich durch lange, platte Stirn, große, an ihrer Wurzel nicht übermäßig verdickte, in gleicher Höhe mit der Stirnleiste stehende Hörner, eine ziemlich dichte und kurze Behaarung und innerlich durch dreizehn oder vierzehn rippentragende, sechs rippenlose und vier Kreuzwirbel kennzeichnen.
Als das schönste aller bekannten wildlebenden Rinder muß ich den Banteng ( Bos banteng) erklären, ein Tier, das hinsichtlich der Zierlichkeit seines Baues mit mehr als einer Antilope wetteifern kann und sich außerdem durch ansprechende Färbung auszeichnet. Der Kopf ist klein, aber breit, an der Stirnleiste erhaben, die Stirn eingebuchtet, der Gesichtsteil bis zur Schnauze verschmälert, das tief dunkelbraune Auge groß und feurig, das Ohr groß, länglichrund, der Hals kurz, unmittelbar hinter dem Kopf auffallend verschmächtigt und hierauf sehr verdickt, der Leib kräftig, aber nicht massig, der Widerrist wenig erhaben, einen sehr in die Länge gezogenen Buckel darstellend, der Rücken gerade, der Hinterteil sanft abgerundet, das Kinn mit einer kleinen, der Unterhals mit einer großen hängenden Wamme geziert, der Schwanz mittellang, schwach, nach der Spitze zu gleichmäßig verjüngt, das Bein kurz, aber ebenfalls zierlich, der Huf rund und fein. Die an der Wurzel verdickten, unregelmäßig gewulsteten, gerundeten und ziemlich scharf zugespitzten Hörner biegen sich zuerst in einem einfachen Bogen nach außen und rückwärts, hierauf nach oben und vorn, mit der Spitze aber nach oben und innen und erreichen eine Länge von 40 bis 50 Zentimeter. Das überall gleichmäßige, dicht anliegende Haarkleid hat dunkelgraubraune, nach hinten etwas ins Rötliche spielende Färbung. Bei der merklich schlanker und zierlicher gebauten Kuh herrscht anstatt der graubraunen eine hellrötlichbraune Färbung vor. Die Gesamtlänge wird, einschließlich des 85 Zentimeter langen Schwanzes, auf 2,9 Meter, die Höhe am Widerrist auf 1,5 Meter angegeben. Die Anzahl der Rippenpaare beträgt dreizehn, die der Lendenwirbel sechs, der Kreuzwirbel vier, der Schwanzwirbel achtzehn.
Nach Angabe Solomon Müllers erstreckt sich das Verbreitungsgebiet des Banteng über Java, Borneo und den östlichen Teil Sumatras. Laut Junghuhn und Haßkarl beschränkt sich sein Aufenthalt auf gebirgige Wälder, innerhalb eines zwischen 600 bis 2000 Meter über dem Meer gelegenen Höhengürtels; Müller dagegen sagt ausdrücklich, daß er auch in den Waldungen längs der Küste gefunden werde. »Am liebsten nimmt er in feuchten oder moorigen, überhaupt wasserreichen Waldesteilen seinen Stand, weshalb ihm flache Bergtäler mit langsam strömenden Flüssen mehr als alle übrigen Waldesteile gefallen.«
Nach Angabe desselben Forschers lebt auch dieses schöne Wildrind in kleinen Gesellschaften, die aus einem leitenden Stier und vier bis sechs Kühen bestehen. Alte unverträgliche Stiere werden von dem jungen Nachwuchs gemeinschaftlich vertrieben und pflegen dann grollend und mürrisch zu einsiedeln. Die weichsten und saftigsten Gräser, die den Waldboden decken, Blüten, Blätter und Triebe verschiedener Bäume und Sträucher bilden die Nahrung des Banteng; insbesondere äst er von jungen Sprossen und Blättern des Bambus und des Allangallanggrases.
Die Wildheit und Scheu dieses Wildstieres macht seine Jagd zu einer ebenso gefährlichen wie beschwerlichen. Zwar flüchtet in der Regel auch er, wenn er die Annäherung eines Menschen wahrnimmt, achtet jedoch, in die Enge getrieben oder verwundet, den Jäger wenig, nimmt ihn nicht selten an und gebraucht dann seine spitzen Hörner mit ebensoviel Geschick als Nachdruck. Nächst den einsiedlerisch lebenden Stieren sind die Kühe, die saugende Kälber führen, am meisten zu fürchten. Man erlegt den Banteng mit der Kugelbüchse oder bei den Treibjagden im Allangallang mittels des schweren Weidmessers, das der javanische berittene Jäger zum Niederhauen des getriebenen und von ihm eingeholten Wildes gebraucht, in diesem Falle jedoch nur Kühen und jungen Stieren gegenüber und durchaus nicht, ohne gefährdet zu sein, in Anwendung zu bringen pflegt, stellt ihm außerdem Schlingen oder fängt ihn in Erdgruben, die mit Zweigen und Blättern bedeckt sind, um des Fleisches und Felles habhaft zu werden. Das Wildbret der jungen und halb erwachsenen Bantengs findet, seiner Zartheit und des ihm eigenen feinen Wildgeschmackes wegen, auch der Europäer vortrefflich, das zähe und harte, etwas nach Moschus riechende Fleisch alter Stiere dagegen nur der arme Javane überhaupt genießbar.
Erwachsene Bantengs lassen sich nicht zähmen, Kälber hingegen vollständig zu Haustieren gewinnen, da das Wesen des Tieres sanfter und milder zu sein scheint als das aller übrigen bekannten Wildstiere. Solche Kälber weiden dann in Gemeinschaft der Hausrinder, paaren sich und erzeugen später mit ihnen wohlgestaltete Blendlinge, so daß auf Java von jeher die Gewohnheit bestand, zahme Kühe in die Wälder zu treiben, um sie von den wild lebenden Bantengstieren beschlagen zu lassen.
In den letzteren Jahren sind mehrere Bantengpaare lebend nach Europa gekommen und im Verlauf der Zeit in alle größeren Tiergärten gelangt, da sie sich auch bei uns zulande leicht in der Gefangenschaft fortpflanzen. Ihr mildes und sanftes Wesen unterscheidet sie sehr zu ihrem Vorteil von den meisten ihrer Verwandten und steht so recht eigentlich im Einklang mit ihrer Schönheit, die das Auge des Forschers wie des Landwirts auf sich lenkt. Schon im zweiten oder dritten Geschlecht betragen sie sich kaum anders als unsere Hausrinder, begeben sich willig unter die Oberherrschaft des Menschen, lernen ihren Pfleger nicht allein kennen, sondern gewinnen nach und nach eine entschiedene Zuneigung zu ihm, gewöhnen sich an das bunte Getriebe der Besucher des Gartens, nähern sich auch Fremden vertrauensvoll, um ihnen gereichte Leckerbissen entgegenzunehmen und lassen überhaupt kaum merken, daß sie nicht von altersher Haustiere gewesen sind. Nur der Stier tritt dann und wann noch nach Art eines freigeborenen Rindes auf, indem er sich zuweilen launisch und widerspenstig zeigt, unter Umständen auch wohl in Zorn gerät und dann sogar seinen Wärter bedroht; doch läßt sich selbst mit ihm mindestens ebensogut umgehen wie mit einem gewöhnlichen Hausbullen, von den halbverwilderten Hausrindern Spaniens oder der südosteuropäischen und südamerikanischen Steppenländer ganz zu schweigen. Jedenfalls dürfte sich der Banteng mindestens ebenso leicht wie der Jak, ja um so leichter zum Haustier gewinnen lassen, als fast alle Kälber der in den verschiedenen Tiergärten gehaltenen Paare im Sommer geboren wurden. Diese Kälber stelzen in auffallend plumper Weise einher, weil sie, abweichend von anderen mir bekannten Rindern, nur auf den äußersten Rand ihrer Hufe sich stützen und demgemäß ihre Beine und Füße sehr steif halten, treten aber bereits nach etwa acht oder zehn Tagen kräftig auf, gefallen sich dann, wie andere im Kindesalter stehende Verwandte, in munteren Spielen aller Art und bekunden dabei eine Behendigkeit und Gewandtheit, die von den ungeschickten Bewegungen anderer, selbst von wilden Rindern stammenden Kälber höchst vorteilhaft absticht. Die Mutter nimmt sich ihrer mit wahrhaft rührender Zärtlichkeit an, und ihr so mildes Wesen gelangt auch bei Behandlung des Sprossen in ersichtlicher Weise zum Ausdruck. Damit steht nicht im Widerspruch, daß sie jede von außen kommende Störung nach besten Kräften abzuwehren sucht und sich, solange das Kälbchen klein ist, selbst gegen ihren sonst geliebten Wärter unwillig, trotzig und sogar angriffslustig benimmt.
Das Dunkel, das über dem Ursprung unseres Hausrindes liegt, will zwar nicht so tief erscheinen wie das, das uns die Entstehungsgeschichte anderer Haustiere verhüllt, konnte jedoch bisher ebensowenig wie bei letzteren vollkommen gelichtet werden. Ziemlich übereinstimmend nimmt man gegenwärtig an, daß die Rinder, die in allen drei Teilen der Alten Welt mehr oder weniger gleichzeitig in den Hausstand übergingen, nicht auf eine einzige, sondern auf verschiedene Stammarten zurückzuführen sind; zur Bestimmung besagter Stammarten reicht aber auch die kühnste Deutung der bisher aufgefundenen Schädel ausgestorbener Wildstiere nicht aus. Wie aus Vorstehendem ersichtlich geworden, werden allerdings auch heutigentags noch wilde Rinder gezähmt und zu Haustieren gewonnen oder wenigstens zur Veredelung der Hausrinderstämme benutzt; die Zeit aber, in der der Mensch zuerst den wilden Stier bändigte oder, was wahrscheinlicher, aus seinen jung eingefangenen Nachkommen eine Herde bildete, liegt jenseits aller Geschichte und Sage. Die frühesten Erzählungen gedenken zahmer Rinderherden; auf den ältesten Denkmälern der Länder, die wir als die Pflanzstätten der Bildung und Gesittung betrachten, finden wir sie abgebildet; aus dem schlammigen Grund rings um die Pfahlbauten wühlen wir ihre Überreste hervor. Nicht mit Unrecht legen wir auf letztere ein sehr bedeutendes Gewicht; ihre sorgfältigste Untersuchung aber bringt ebensowenig wie die Vergleichung uralter bildlicher Darstellungen mit den heutzutage lebenden Rinderrassen vollständige Klarheit in die noch in mehr als einer Beziehung rätselhafte Frage, enthüllt uns das Geheimnis des Ursprungs noch keineswegs.
Der bereits erwähnte Sanga ( Bos africanus), der sich seit Jahrtausenden nicht merklich verändert hat, darf wohl als die schönste Rasse aller Buckelochsen angesehen werden; er ist groß, schlank, aber doch kräftig gebaut, hochbeinig und ziemlich langschwänzig, der Buckel wohl entwickelt, das Gehörn sehr stark und von dem der meisten europäischen Rassen wesentlich verschieden.

Zebu ( Bos zebu)
Obwohl merklich von ihm verschieden und ebenfalls in eine Reihe von Unterrassen zerfallend, müssen wir doch den Zebu- oder Höckerochsen ( Bos zebu) als ein ihm nahestehendes Rind betrachten. Derselbe ist ungefähr ebenso groß, in der Regel aber verhältnismäßig stärker und kurzbeiniger als der Sanga, das Ohr lang und hängend, das Gehörn auffallend kurz, die Färbung minder gleichmäßig, da das gewöhnlich vorkommende Rot- oder Gelbbraun häufig auch in Fahlgelb oder Weiß übergeht, wie auch gescheckte Zebus keineswegs selten sind.
Die meisten Naturforscher von Linné bis Darwin sehen in diesem Zebu eine eigene Rinderart, andere betrachten ihn wie den Buckelochsen bloß als Spielart des Hausrindes überhaupt. Für beider Artselbständigkeit spricht, daß einzelne Teile des Gerippes wesentlich von denen unseres Hausrindes abweichen, daß der Zebu beispielsweise einen Kreuz- und zwei Schwanzwirbel weniger hat als das gemeine Rind, sowie ferner, daß er, wie Blyth hervorhebt, auch in der Lebensweise nicht unerheblich sich unterscheidet, selten den Schatten sucht und nicht in das Wasser geht, um hier, wie die europäische Art, knietief zu stehen usw. Woher aber stammt nun das afrikanische wie das indische in so viele Spielarten und Rassen zerfallende Höckerrind? Welcher wilden Art haben wir seine Entstehung zu verdanken? Auf diese Frage müssen wir zunächst noch die Antwort schuldig bleiben.
Verhältnismäßig leichter erscheint die Lösung der Frage über die Stammvaterschaft der höckerlosen, also unserer europäischen Rinderrassen zu sein, obgleich auch in diesem Falle von einer Erledigung der Frage nicht gesprochen werden kann. Nach Rütimeyer sollen drei verschiedene Wildstierarten an der Stammvaterschaft der bis jetzt unterschiedenen vierzig bis fünfzig Rassen des in Europa lebenden Hausrindes beteiligt sein: erstens der Vorweltstier ( Bos primigenius), der wahrscheinlich mit dem oben erwähnten Auer als gleichartig angenommen werden muß, zweitens der Langstirnstier ( Bos longifrons) und der Breitstirnstier ( Bos frontosus), deren Reste man in verschiedenen Teilen Europas gefunden hat. Nach Rütimeyers Ansicht leben unmittelbare, wenn auch entartete Nachkommen des Vorweltstieres noch heutigestages in halbwildem Zustande in größeren Tierparken Nordenglands und Schottlands; wenigstens versichert er nach sorgfältigen Vergleichungen der Schädel des Vorweltstieres und eines ihm vom Lord Tankerville gesandten Schädels des Parkrindes, daß letzteres von dem Vorweltstier weniger abweicht als irgend eine andere Rasse. Das Parkrind ( Bos scoticus) ist mittelgroß, stark, jedoch nicht plump gebaut, seine Behaarung dicht und kurz anliegend, auf Scheitel und Hals länger und gekräuselt, längs der Firste des Nackens bis zum Widerriste schwach vermähnt, seine Färbung, bis auf die Schnauze, die Ohren, Hörner und Hufe, milchweiß; das Parkwild kommt also zunächst mit dem Banteng, dem Zebu und dem Büffel überein und unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Hausrinde durch geringere Anzahl der Kreuz- und Schwanzwirbel.
Die vornehmen Besitzer aller in Schottland noch bestehenden Parks zeigen einen gewissen Stolz darin, diesen aus alter Zeit übriggebliebenen Tieren ihren besonderen Schutz angedeihen zu lassen, und verwenden nicht unerhebliche Summen auf dessen Erhaltung; eigene Aufseher wachen über die Rinder, bemühen sich soviel als möglich, Gefahren von ihnen abzuhalten und schießen endlich die wegen höheren Alters zu bösartig oder sonst unbrauchbar gewordenen Bullen ab.
Black erzählt 1851 von den im Park von Hamilton lebenden wilden Rindern, daß sie bei Tage auf den ausgedehnten Triften weiden und abends sich in den Wald zurückziehen. Die gereizten Bullen sind äußerst rachsüchtig. Ein Vogelsteller, der auf einen Baum gejagt worden war, mußte dort sechs Stunden verharren, weil ihn der wütende Stier hartnäckig belagerte. Als er sah, daß ihm sein Feind unerreichbar war, zitterte er am ganzen Leib vor Wut, grunzte und stürmte mit Kopf und Huf gegen den Baum. So tobte er sich müde und legte sich nieder; sobald aber der Mann sich rührte, sprang er wütend wieder auf und raste von neuem. Einige Schäfer erlösten den Geängstigten. Ein Schreiber wurde ebenfalls auf einen Baum gejagt und mußte dort die Belagerung bis zum andern Nachmittag aushalten.
Ludwig Beckmann hat jedoch bei seinem Besuche des Parks von Hamilton von einer besonderen Wildheit unseres Rindes nichts bemerkt. »Ich fand«, so fährt er fort, »die Herde, etwa zweihundert Schritte vom Wege entfernt, behaglich im Grase liegend und wiederkäuend. Zwischen den Rindern stand, hoch aufgerichtet wie eine Schildwache, ein alter Fuchswallach. Bei meiner Annäherung erhoben sich die Rinder und staunten mich unverwandt an. Die Köpfe wurden dabei nicht über die Rückenhöhe erhoben; ja, die mir zunächststehenden jüngeren Rinder senkten denselben tief bis zu den Knien herab, um mich schärfer ins Auge fassen zu können, was ihnen ein ungemein pfiffiges Ansehen gab. Als ich bis auf etwa achtzig Schritte herangekommen war, setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Ich war gespannt auf das Benehmen des stärksten Stieres, den ich nach langem Suchen hinter mehreren Kühen versteckt fand. Derselbe hatte indes keine Lust, sich unnötigerweise einer Gefahr auszusetzen; es fiel ihm gar nicht ein, die Führung zu übernehmen, und sein einziges Bestreben schien darauf gerichtet zu sein, seine eigene werte Person fortwährend durch einige Kühe oder jüngere Stiere zu decken, so daß mein beim Fuhrwerk zurückgebliebener Begleiter endlich entrüstet ausrief: ›Der alte Feigling; er sollte vorausgehen und versteckt sich hinter seinen Weibern‹. Die aus etwa dreißig Stück bestehende Herde fiel nun allmählich in Trab; hier und da galoppierte bereits ein Kalb, um nicht zurückzubleiben; dann wurden Plötzlich alle flüchtig, und im rasenden Galopp, die hoch gehobenen Schweife flatternd, eilte die lange Weiße Reihe mit Donnergepolter über eine Anhöhe, zwischen den mächtigen altersgrauen Stämmen hindurch; ein majestätischer Anblick! Leider wurde derselbe etwas abgeschwächt durch die Gegenwart des alten Fuchswallachs, der, seinen stumpfen Hahnenschwanz ebenfalls lüftend, dicht hinter dem Trupp einhergaloppierte und allen Schwenkungen desselben auf das genaueste folgte. Der flüchtige Trupp entfernte sich in weitem Bogen und machte dann auf einer Blöße plötzlich halt, wobei sich die Köpfe sämtlicher Rinder wiederum unbeweglich nach mir richteten. Ich versuchte nun zum zweiten Male mich anzubirschen; jetzt aber wurde die Herde bereits auf hundertzwanzig Gänge flüchtig und machte erst in weiter Ferne wieder halt. Die Tiere waren nunmehr bereits so scheu geworden, daß ich sie bei einem dritten Annäherungsversuch sicher gänzlich aus den Augen verloren haben würde; ich hielt es daher für das beste, vorläufig zu unserem Fuhrwerk zurückzukehren und sie von dort aus mit Hilfe eines guten Fernglases zu beobachten. Nach wenigen Minuten beruhigten sie sich, und ein Stück nach dem andern legte sich an der Stelle, wo es stand, nieder, um wiederzukäuen.«
Die Art und Weise, wie man noch bis kurz vor Ende des verflossenen Jahrhunderts einen Parkstier tötete, erinnert lebhaft an die in alter Zeit bestandenen Jagden. An dem bestimmten Tag versammelten sich die Einwohner der ganzen Nachbarschaft, teils zu Pferd, teils zu Fuß und sämtlich mit Flinten bewaffnet. Nicht selten erschienen zu einer solchen Jagd fünf- bis sechshundert Jäger, von denen oft mehr als hundert beritten waren. Die unberittenen nahmen ihre Plätze auf den Mauern ein, die den großen Park umzäunen, oder kletterten mit ihren Gewehren auf die Bäume in der Umgegend des freien Platzes, auf dem der bestimmte Stier erlegt werden sollte, während die Reiter den Wald durchstreiften und die Herde nach jenem freien Ort hintrieben. War dies gelungen, und hatte man den rings von Pferden eingeschlossenen Stier einmal ziemlich in seine Gewalt gebracht, so stieg einer von den Reitern, dem die Ehre zugedacht gewesen, die erste Kugel abzufeuern, von seinem Pferde ab und schoß auf das ungestüme und durch die Angst in die höchste Wildheit versetzte Tier. Hierauf feuerten alle übrigen, die zum Schuß kommen konnten, und oft geschah es, daß mehr als dreißigmal nach dem Stier geschossen wurde, ehe man ihn tötete. Durch den heftigen Schmerz der Wunden und das lärmende Geschrei der Jäger in rasende Wut versetzt, achtete das blutende Tier nicht mehr auf die zahlreichen Menschen, sondern stürzte mit den letzten Kräften auf Roß und Reiter. Nicht selten brachte der Stier den Angreifern gefährliche Verwundungen bei, oder richtete unter ihnen derartige Verwirrung an, daß er sich ferneren Verfolgungen entziehen konnte. Die Unglücksfälle, die diese Jagden herbeiführten, wurden Ursache, daß solche Feste nach und nach gänzlich abkamen.
Nach allen bei der Domestikation von Tieren gemachten Erfahrungen darf es uns nicht wundernehmen, zu sehen, wie die in den Hausstand übergegangenen Rinderrassen unter der oft ganz bestimmte Zwecke verfolgenden Pflege des Menschen nach und nach, unter Umständen in nicht allzulanger Zeit, wesentlich abweichende Merkmale annehmen und dieselben ebenso wie die übrigen Haustiere auch vererben, mit anderen Worten also, wie im Verlauf einer gewissen Zeit neue Rassen entstehen und wieder vergehen. Es erscheint daher nicht einmal notwendig, anzunehmen, daß außer dem Auer noch andere, ebenfalls und vor ihm ausgestorbene Wildrinderarten an der Erzeugung unseres Hausrindes beteiligt gewesen sein müssen, und ist jedenfalls überflüssig, zu wunderlichen Mutmaßungen seine Zuflucht zu nehmen. Wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir zugestehen, daß wir bis jetzt noch nicht imstande sind, auch diese Frage zu lösen. – Um einzelne Rassen des höckerlosen Hausrindes anzuführen, will ich drei besonders hervorragende wenigstens erwähnen.
Als Vertreter des Alpenrindviehs, das in sehr vielen und merklich verschiedenen Schlägen gezüchtet wird, mag das Freiburger Rind ( Bos taurus fribugensis) gelten, ein wohlgestaltetes Tier mit mäßig großem, breitstirnigem Kopf, kurzem und dickem, stark gewammtem Hals, gestrecktem, breitrückigem Leib, stämmigen Gliedern, langem, stark bequastetem Schwanz und verhältnismäßig kurzen, ziemlich schwachen, aber sehr spitzigen Hörnern, glatthaarigem Fell und schwarzer oder braunroter Fleckenzeichnung auf weißem Grund.
Man züchtet diesen Schlag vorzugsweise in Freiburg und den benachbarten Kantonen der Schweiz und gewinnt von ihm ebenso vorzügliches Fleisch wie ausgezeichnet gute und viele Milch.
Der verbreitetste Schlag der Marschenrinder dürfte das Holländerrind ( Bos taurus hollandicus) sein, nach Fitzingers Ansicht der unmittelbare Nachkomme des Auers. Stattliche Größe, ziemlich gleichmäßige Entwicklung aller Körperteile und sehr gleichmäßige Färbung und Zeichnung bilden seine hervorragendsten Merkmale. Der Kopf ist lang, an der Schnauze zugespitzt, der Hals lang und dünn, der Leib tonnenförmig, d. i. gestreckt und weit, der Widerrist schmal, das Kreuz breit, der Schwanz mäßig lang, das vordere wie das Hintere, besonders ausgebildete Beinpaar hoch und kräftig, nicht aber plump, das Gehörn kurz, schwach und meist seit- und vorwärts gerichtet, die Färbung buntscheckig, da auf weißem oder grauweißem Grund in der Regel schwarze, zuweilen aber auch braune und rote, mehr oder weniger große und sehr verschieden gestaltete Flecken stehen.
Abgesehen von Holland, woselbst dieses Rind schon seit Jahrhunderten gezüchtet wird, hält man es in den meisten Marschgegenden Deutschlands in mehr oder minder reinen Schlägen, benutzt es auch im Innern des Landes nicht selten zur Kreuzung mit einheimischen Rassen. Milchergiebigkeit und leichte Mastfähigkeit zeichnen es aus.
Als wahrhaft abscheuliches Erzeugnis fortgesetzter planmäßiger Züchtung mag endlich noch das Durham- oder Kurzhornrind, »Shorthorn« der Engländer ( Bos taurus dunelmensis), erwähnt sein; ein geradezu ungestaltetes Tier mit kleinem Kopf und sehr schwachem Gehörn, geradem Rücken und kurzen Beinen, dickem Hals und unförmlichem Leib, vorzugsweise bestimmt, als Mastvieh größtmöglichen Fleischertrag zu liefern. Die Färbung des glatten Haarkleides wechselt vielfach.
Ursprünglich wurde das Durhamrind fast ausschließlich in den Grafschaften der Ostküste von England gezüchtet; gegenwärtig sieht man es in allen Grafschaften Englands und Irlands, hier und da, obschon immer noch selten, auch wohl in Deutschland, Holland und Frankreich. An Milchertrag steht es hinter vielen Schlägen merklich zurück, an Fleischertrag übertrifft es sämtliche Rassen, da einzelne Stiere bis dreitausend Kilogramm schwer werden sollen.
Obgleich auch die wieder verwilderten Rinder kaum dazu beitragen, das Dunkel des Ursprungs unseres wichtigen Haustieres aufzuhellen, verdienen sie doch ebenfalls in Betracht gezogen zu werden. Ebenso leicht, als ein wild lebendes Rind sich zähmen und in den Hausstand überführen läßt, nimmt es, der Obhut und Pflege des Menschen entronnen, wiederum die Sitten und Gewohnheiten der Urarten an. Verwilderte Rinder finden sich hauptsächlich da, wo die Spanier herrschten oder noch herrschen. Das hängt wohl zum Teil mit den in spanischen Ländern so beliebten Stierkämpfen zusammen.
In den Hochgebirgen Südspaniens und in den größeren Waldungen Kastiliens begegnet man nicht selten solchen Stierherden, tut aber unter allen Umständen wohl, ihnen aus dem Wege zu gehen. Noch im November traf ich eine Herde in einer Höhe zwischen zwei- und dreitausend Meter über dem Meere, in der Nähe des Picacho de la Veleta, ohne jegliche Aufsicht weidend. Kein Wolf wagt es, solcher Gesellschaft sich zu nahen, kein Bär greift sie an; denn in geschlossener Reihe stürmen die mutigen Geschöpfe auf das Raubtier los, und fast niemals kommt es vor, daß eines dem Feinde erliegt. Mit Vergnügen beobachtete ich, wie sämtliche Mitglieder einer solchen Herde dem Kampfe zwischen zwei jugendlich kräftigen Stieren mit größter Aufmerksamkeit folgen. Wir gingen einmal an einer Herde vorüber, die so von einem Kampfspiel in Anspruch genommen wurde, daß sie uns gar keine Beachtung schenkte. Während des Sommers ziehen sich die Stiere mehr nach den Höhen empor, und erst der dort frühzeitiger als unten fallende Schnee treibt sie wieder zur Tiefe zurück. Den Dörfern weichen sie vorsichtig aus. Auf Vorübergehende stürzen sie sich oft ohne die geringste Veranlassung. Nur mit Hilfe gezähmter Ochsen ist es möglich, sie nach den für die Gefechte bestimmten Plätzen zu treiben. Keiner dieser verwilderten Stiere verträgt eine Fessel, keiner eine Mißhandlung. Die Fortschaffung der für das Gefecht Erwählten ist für die Beteiligten immer ein Spielen mit Tod und Leben.
Um das Jahr 1540 verpflanzte man Stiere aus Spanien nach den südlichen Ländern Amerikas. Sie fanden auch hier das Klima der Neuen Welt für ihr Gedeihen so ersprießlich, daß sie sich in kurzer Zeit von dem Menschen, der sie ohnehin nur lässig überwachte, gänzlich befreiten. Hundert Jahre später bevölkerten sie bereits in solch ungeheurer Anzahl die Pampas, daß man sie einzig und allein deshalb erlegte, um ihre Haut zu benutzen. Ehe der Bürgerkrieg die Platastaaten zerstörte, wurde jährlich fast eine Million Ochsenhäute allein von Buenos Aires nach Europa ausgeführt. Eine eigene Genossenschaft, die der »Baqueros«, bildete sich aus den Gauchos heraus, Leute, die ohnehin gewöhnt waren, für wenige Groschen ihr Leben in die Schanze zu schlagen, trotzigkühne, tolldreiste Männer, die den Stieren mit der Wurfschlinge entgegentraten und sie mit einem verhältnismäßig schwachen Gewehr zu bändigen wußten. Manche Landwirte hielten auf ihren ungeheuren Gütern an acht- bis zehntausend Stück Rinder, die man fast gar nicht beaufsichtigte, gegen die Schlachtzeit hin aber in Pferche oder Umpfählungen trieb und hier entweder mit Feuergewehren massenhaft niederschoß oder einzeln herausjagte, von den Hirten verfolgen und mit den Wurfschlingen niederreißen, in jedem Falle aber töten ließ. Das Fleisch und Fett verblieb den zahmen und wilden Hunden und den Geiern. Solcherart betriebene Metzeleien lichteten selbst diese ungeheuren Herden, und erst die neuzeitliche bessere Verwertung der Stücke führte zu einer Änderung des früheren Verfahrens.
Nur in Amerika hat sich das Hausrind wieder von der Herrschaft des Menschen befreit; in allen übrigen Erdteilen ist es dessen Sklave, und zwar, wie schon bemerkt, seit uralter und vorgeschichtlicher Zeit. Im allgemeinen wurde und wird das Rind außerordentlich hoch geehrt. Ein Blick auf das Leben des Hausrindes in den verschiedenen Ländern ist ebenso lehrreich als fesselnd. Wenden wir, gewissermaßen um geschichtlich zu beginnen, unsere Aufmerksamkeit zunächst jenen Herden zu, die sich noch in denselben Verhältnissen befinden wie unter der Herrschaft der alten Erzväter. In den Nomaden des Ostsudan sehen wir Herdenzüchter, die ihre Geschäfte noch heute genau ebenso betreiben, wie ihre Ururväter vor Jahrtausenden sie betrieben. Die Viehherden, die sie besitzen, sind ihr einziger Reichtum. Man schätzt sie nach der Anzahl der Schafe und der Rinder, wie man den Lappen nach der Menge seiner Renntiere schätzt. Ihr ganzes Leben hängt mit der Viehzucht aufs innigste zusammen. Nur durch Räubertaten erwerben sie sich noch außerdem manches, was sie zu ihrem Leben bedürfen; im allgemeinen aber muß ihr zahmes Vieh sie ausschließlich erhalten. Viele Stämme der Araber, die die nahrungsreicheren Steppen südlich des 18. Grades nördlicher Breite durchwandern, liegen, ihrer Herden wegen, in beständigem Kriege miteinander und sind aus dem gleichen Grunde ohne Unterlaß auf der Wanderung. Es versteht sich von selbst, daß es in jenen Gegenden nur freie Zucht gibt, daß niemand daran denkt, für seine Haustiere einen Stall zu erbauen. Bloß da, wo der Löwe häufiger auftritt, versucht man nachts Rinder, Schafe und Ziegen durch einen dicken Hag aus Mimosendornen, der einen Lagerplatz kreisförmig umgibt, zu schützen. Da, wo man dem Könige der Wildnis keinen Zoll entrichten muß, läßt man die Herde dort übernachten, wo sie sich weidesatt lagert.
Auch die größten unserer Rittergutsbesitzer und Viehzüchter, die Holländer und Schweizer inbegriffen, machen sich wohl schwerlich eine Vorstellung von der Anzahl der Herden jener Nomaden. Nahe dem Dorfe Melbeß, dessen ich schon einmal Erwähnung getan habe, tieft sich die Steppe zu einem weiten Kessel ein, in dessen Grunde man Brunnen an Brunnen angelegt hat, einzig und allein zu dem Zwecke, die täglich hier während der Mittagsstunden zusammenströmenden Herden zu tränken. In diesem Kessel kann man vom frühen Morgen an bis zum späten Abend und während der ganzen Nacht ein kaum zu beschreibendes Gewühl von Menschen und Herdentieren bemerken. Neben jeden Brunnen hat man sechs bis acht flache Tränkteiche aufgebaut, große natürliche Tröge, die mit toniger Erde eingedämmt sind. Diese Tröge werden alltäglich gefüllt und von den zur Tränke kommenden Herden vollständig wieder geleert. Vom Nachmittag an, die ganze Nacht hindurch bis gegen Mittag hin, sind fast hundert Menschen eifrig beschäftigt, aus der Tiefe der Brunnen Wasser heraufzuheben und in diese Teiche zu schütten, woselbst man der Tränke noch etwas salzhaltige Erde zuzusetzen pflegt. Gewöhnlich sind die Teiche noch nicht völlig gefüllt, wenn die Herden ankommen. Von allen Seiten ziehen unzählbare Scharen von Schafen, Ziegen und Rindern herbei, zuerst das Kleinvieh, später die Rinder. In wenigen Minuten hat sich der ganze große Kessel vollständig gefüllt. Man sieht nichts als eine ununterbrochene Herde von eifrig sich hin- und herdrängenden Tieren, zwischen denen hier und da eine dunkle Mannesgestalt hervorragt. Tausende von Schafen und Ziegen strömen ohne Unterbrechung zu, und ebenso viele ziehen getränkt von dannen. Sobald der Kessel sich einigermaßen geleert hat, stürmen die Rinder, die bis jetzt kaum zurückgehalten werden konnten, heran, und nun gewahrt man nur eine braune, wogende Masse, über die ein Wald von Spitzen sich erhebt. Das Braun wird zur einzigen hervortretenden Farbe; von den dazwischen hin- und hergehenden Männern ist keine Spur mehr zu entdecken. Der ganze Tränkplatz gleicht einem Stall, in dem seit Monaten kein Reinigungswerkzeug in Bewegung gesetzt wurde. Ungeachtet der dörrenden Sonne liegt der Kot überall mehr als knietief auf dem Boden; nur die Tränkteiche werden sorgfältig rein gehalten. Gegen Abend verlieren sich endlich die letzten durstigen Seelen, und nun beginnt augenblicklich das Schöpfen von neuem, um die für den folgenden Tag nötige Wassermenge rechtzeitig beschaffen zu können. An manchen Tagen kommen auch langbeinige Kamele dahergestelzt, ebenfalls fünfhundert bis tausend Stück aus einmal, trinken sich satt und ziehen wieder von dannen. Ich halte es für unmöglich, die Menge der Rinder zu berechnen; denn in dem dichten Gewirr hört das Zählen gar bald auf; dennoch glaube ich nicht zuviel zu sagen, wenn ich die Anzahl der täglich hierher kommenden Herdentiere auf mindestens sechzigtausend Stück anschlage, wovon etwa vierzigtausend auf die Rinder kommen mögen.
Auch die Dinka besitzen zahlreiche Herden und pflegen dieselben ebenso sorgfältig wie die genannten Araber, treiben sie auf die Weide und beherbergen sie des Nachts in freien, von ihnen »Murach« genannten Stallungen. »Bei Anlage einer solchen Stallung unter freiem Himmelsdache«, sagt Heuglin, »wählt der Neger vor allem einen möglichst erhabenen und trockenen Platz, Bedingungen, die sich am Weißen Nil überhaupt selten finden. Dieser Platz wird mit rohem Pfahlwerk umfriedigt und, wenn das Vieh des Abends eingetrieben worden, der Zugang mit Stämmen oder Dornbüschen geschlossen. Den Tag über hat man den sorgfältig gesammelten Kot der Kühe ausgebreitet und an der Sonne getrocknet, so daß davon immer ein größerer Vorrat vorhanden ist, von dem dann gleiche Haufen gemacht und gleichförmig im Innern der Umpfählung verteilt werden. Kommen die Herden an, so wird unter jeden dieser Haufen etwas Feuer gelegt, und es entwickelt sich über dem Murach bald eine ziemlich dichte Ranchwolke, wie an einem großen Meiler. Es hat dies den Zweck, die vielen Stechfliegen abzuhalten und dem Vieh, das ohnedem nur wenig Milch gibt, die nötige Nachtruhe zu verschaffen. Diese sonderbare Art von Räucherung währt die ganze Nacht durch, und die eingepferchten Tiere scheinen sich recht wohl dabei zu befinden. Gleichzeitig bildet sich durch diese Verbrennung eine feine Asche, die den Tag über ebenfalls in Haufen gesammelt und abends glatt über den ganzen Platz ausgebreitet wird, um als Streu und weiteres Schutzmittel gegen die Fliegen zu dienen. Die Rinder tragen somit Räucherwerk und Streu selbst ein, und die Masse vermehrt sich nach und nach derart, daß eine merkliche Erhöhung des Bodens eintritt und die Kühe wie ihre Herren tief im feinsten weichen Aschenbette sich begraben können. Beim Austreiben ist man nicht minder vorsichtig; es geschieht dies erst, nachdem gemolken worden und man sich überzeugt hat, daß der gewöhnlich in Menge sich niederschlagende Tau abgetrocknet ist.« Schweinfurth, der den Murach in ähnlicher Weise schildert, bemerkt, daß ein solcher Viehstall selten unter zweitausend, meist bis dreitausend Stück Rinder enthält und daß man auf jeden Kopf der Bevölkerung dieses Negerstammes mindestens drei Rinder rechnen müsse, obgleich es unter den Dinka ebensogut wie überall Arme und Unbemittelte gibt.
In den Gebirgen von Habesch müssen die Rinder als Last- und Zugtiere Dienste leisten, im Sudan und in Kordofan hält man sie hauptsächlich zur Zucht, benutzt jedoch ihre Milch, um aus derselben Butter zu bereiten. Die Dinka betrachten sie als Augenweide. »Es ist wohl begreiflich,« sagt Schweinfurth, »wie Menschen bloß am Besitze eines wohlgediehenen Viehstandes ihre Freude haben können; unverständlich aber muß uns das Zwecklose der von den Dinka geübten Verschneidung bleiben, wenn wir sehen, wie diese Hirten Bullen und Böcke bloß in der Absicht verschneiden, um ihre Augen an einer Fettentwicklung zu werden, die für den Magen stets unverwertet bleiben soll. Wenn ich Dinka befragte: ›Was nützen euch Ochsen, was sollen sie bezwecken?‹ erhielt ich stets zur Antwort: ›Es geschieht, damit sie recht fett werden und schön aussehen.‹ So äußert sich ihr Stolz und ihre Freude am Besitz.«
In Südrußland, in der Tatarei und wahrscheinlich auch in einem großen Teile des inneren Asiens hält man ebenfalls bedeutende Rinderherden. Die ganze südrussische Steppe ist überall mit Pferde-, Schaf- und Rindviehherden bedeckt. Im Sommer leben alle diese Haustiere Tag für Tag im Freien, im harten, langen Winter finden sie hinter einem Erdwall einigen Schutz gegen die Stürme. Wenn besagter Wall an der einen Seite ein elendes Stück Dach hat, gilt er als vorzüglicher Stall. Unter den genannten Tieren stehen die Rinder ihrer Anzahl nach obenan und haben auch in vieler Hinsicht große Vorzüge vor jenen; denn sie verunglücken nicht so leicht während der Schafen und Pferden so gefährlichen Schneestürme, weil sie die Besinnung nicht verlieren, sondern, falls die Stürme nicht allzu heftig sind, geradenwegs nach Hause eilen. In den meisten Gegenden bleiben die Herden sich selbst überlassen und werden nur insofern von den Hirten bewacht, als diese sich bemühen, sie einigermaßen zusammenzuhalten und die herangewachsenen Stierkälber von den Müttern zu trennen. Die Rinder selbst sind unglaublich genügsam, fast unempfindlich gegen die Witterung und auch bei schlechter Nahrung noch sehr ausdauernd. Bei den Kirgisen und Kalmücken, von denen sie auch zum Lasttragen verwendet werden, führen sie ein echtes Wanderleben. Im Sommer gibt die Steppe überall reiche Weide, im Winter wählt man sich Gegenden aus, die reich an Schilf sind, mit dessen dürr gewordenen Blättern die Rinder sich begnügen müssen. In den südrussischen Steppen treibt man das Rindvieh, nachdem es am Morgen getränkt wurde, in die Einöde hinaus; gegen Abend kommt die Herde von selbst zurück, und die Mütter vereinigen sich jetzt mit den Kälbern, die am Morgen von ihnen getrennt wurden. Die Milchkühe und Kälber werden im Winter zu Hause gefüttert, die Ochsen jedoch nur dann, wenn viel Schnee liegt. Gewöhnlich sind die jungen, frei auf der Steppe aufgewachsenen Ochsen unbändig wild, widerspenstig und dabei so faul, daß man ihrer acht bis zehn an einen Pflug spannen muß, wenn man wirklich etwas leisten will. Um sie an das Joch zu gewöhnen, treibt man ein Paar in einen Hof, wirft ihnen eine Schlinge um die Hörner und zieht sie nunmehr bis an einen Pfahl, wo man ihnen dann das Joch auf den Nacken legt. Sobald dasselbe gehörig befestigt ist, treibt man sie wieder zur großen Herde auf die Steppe und läßt sie weiden. Alles Streben, des Joches sich zu entledigen, hilft ihnen nichts; sie gewöhnen sich endlich daran und werden, wie Schlatter versichert, schließlich so anhänglich aneinander, daß sie, auch wenn sie frei vom Joche sind und unter den andern weiden, immer sich zusammenhalten und einander in allen Nöten beistehen. Einige Tage, nachdem man sie zum erstenmal unter das Joch legte, fängt man sie wieder ein und spannt sie vor einen Wagen. Ein Tatar besteigt den Bock, nimmt eine gewaltige Hetzpeitsche zur Hand und jagt nun, so schnell die Tiere laufen wollen, mit seinem Gespann in die Steppe hinaus, läßt ihm die vollste Freiheit und erlaubt ihm, dahin zu laufen, wohin sein Sinn es führt. Nach einigen Stunden wütenden Dahinjagens nehmen die gedemütigten Stiere Knechtssinn an und lassen sich nunmehr ohne sonderliche Beschwerde lenken.
In Ungarn verfuhr man früher mit den dort gezüchteten Rindern in ähnlicher Weise. Noch heute müssen sie sich selbst ernähren und genießen weder Schutz noch Pflege. Manche sind so wild, daß sie keinem Menschen gestatten, sich ihnen zu nähern. Die Kälber saugen so lange, als sie Bedürfnis dazu fühlen, und die Hirten denken gewöhnlich erst im zweiten Jahre ihres Lebens daran, sie von den Müttern zu trennen. Dies verursacht Schwierigkeiten, weil die Kühe sich wütend auf die Hirten zu stürzen pflegen und diese unter Umständen schwer verletzen oder sogar töten. Noch heutzutage ist die Rindviehzucht in ganz Ungarn sehr bedeutend, obgleich der lohnenderen Schafzucht wegen im Abnehmen begriffen.
Selbst in Italien lebt noch ein großer Teil der Rinder im halbwilden Zustande. In der Maremma, jenem beinahe vollkommen flachen, hier und da fruchtbaren, sonst aber sumpfigen Küstenstrich zwischen Genua und Gaeta, der wegen seines ungesunden Klimas sehr verrufen und dünn bevölkert ist, treiben sich zahlreiche Herden des italienischen Rindes umher, die jahraus, jahrein unter freiem Himmel leben, weite Wanderungen ausführen und nur von den rohesten, abgehärtetsten Menschen beaufsichtigt werden. In der Wallachei, in Serbien, Bosnien, Bulgarien und Syrien finden wir das Rind unter ähnlichen Verhältnissen.
Eine ganz andere Pflege genießt das geschätzte Haustier in den Gebirgsländern Mitteleuropas, namentlich in den Alpen, obgleich auch hier noch manches zu wünschen übrig bleibt. Nach Tschudis gemachten Angaben hält die Schweiz etwa 850 000 Stück Rindvieh, und zwar nimmt sonderbarerweise in den ebenen Gegenden, wo der Weidegang nach den Alpen aufgehoben wurde, die Viehzucht zu, in den Alpen dagegen ab, »weil man«, wie Tschudi sagt, »leider wenig Tröstliches von dem Zustande der Rinderherden auf den Alpen erzählen kann. Meistens fehlt eine zweckmäßige, mitunter sogar jede Stallung. Die Kühe treiben sich auf ihren Alpen umher und weiden das kurze, würzige Gras ab, das weder hoch noch breit wächst. Fällt im Früh- oder Spätjahr plötzlich Schnee, so sammeln sich die brüllenden Herden vor den Hütten, wo sie kaum Obdach finden, wo ihnen der Senn oft nicht einmal eine Handvoll Heu zu bieten hat. Bei andauerndem kalten Regen suchen sie Schutz unter Felsen oder in Wäldern. Hochträchtige Kühe müssen oft weit entfernt vom menschlichen Beistande kalben und bringen am Abend dem überraschten Sennen ein volles Euter und ein munteres Kalb vor die Hütte. Nicht selten aber geht es auch schlimmer ab. Und doch ist selbst dem schlecht geschützten Vieh die schöne, ruhige Zeit des Alpenaufenthaltes eine überaus liebe. Man bringe nur jene große Vorschelle, die bei der Fahrt auf die Alp und bei der Rückkehr ihre weithin tönende Stimme erschallen läßt, im Frühling unter die Viehherde im Tal, so erregt dies gleich die allgemeine Aufmerksamkeit. Die Kühe sammeln sich brüllend in freudigen Sprüngen und meinen das Zeichen zur Alpfahrt zu vernehmen, und wenn diese wirklich begonnen, wenn die schönste Kuh mit der größten Glocke am bunten Bande behangen und wohl mit einem Strauß zwischen den Hörnern geschmückt wird, wenn das Saumroß mit Käsekesseln und Vorrat bepackt ist, die Melkstühle den Rindern zwischen den Hörnern sitzen, die sauberen Sennen ihre Alpenlieder anstimmen und der jauchzende Jodel weit durchs Tal schallt, dann soll man den trefflichen Humor beobachten, in dem die gut- und oft übermütigen Tiere sich in den Zug reihen und brüllend den Bergen zumarschieren. Im Tal zurückgehaltene Kühe folgen oft unversehens auf eigene Faust den Gefährten auf entfernte Alpen.
Freilich ist es bei schönem Wetter für eine Kuh auch gar herrlich hoch in den Gebirgen. Frauenmäntelchen, Mutterkraut und Alpenwegerich bieten dem schnoppernden Tiere die trefflichste und würzigste Nahrung. Die Sonne brennt nicht so heiß wie im Tal, die lästigen Bremsen quälen das Rind während des Mittagsschläfchens nicht, und leidet es vielleicht noch von einem Ungeziefer, so sind die zwischen den Tieren ruhig herumlaufenden Stare und gelben Bachstelzen stets bereit, ihnen Liebesdienste zu erweisen; das Vieh ist munterer, frischer und gesünder als das im Tal und pflanzt sich regelmäßiger und naturgetreuer fort; das naturgemäße Leben bildet den natürlichen Verstand besser aus. Das Rind, das ganz für sich lebte, ist aufmerksamer, sorgfältiger, hat mehr Gedächtnis als das stets verpflegte. Die Alpkuh weiß jede Staude, jede Pfütze, kennt genau die besseren Grasplätze, weiß die Zeit des Melkens, kennt von fern die Lockstimme des Hüters und naht ihm zutraulich, weiß, wann sie Salz bekommt, wann sie zur Hütte oder zur Tränke muß, spürt das Nahen des Unwetters, unterscheidet genau die Pflanzen, die ihr nicht zusagen, bewacht und beschützt ihr Junges und meidet achtsam gefährliche Stellen. Letzteres aber geht bei aller Vorsicht doch nicht immer gut ab. Der Hunger drängt oft zu den noch unberührten, aber fetten Rasenstellen, und indem sich die Kuh über die Geröllhalde bewegt, weicht der lockere Grund, und sie beginnt bergab zu gleiten. Sowie sie bemerkt, daß sie sich selber nicht mehr helfen kann, läßt sie sich auf den Bauch nieder, schließt die Augen und ergibt sich ruhig in ihr Schicksal, indem sie langsam fortgleitet, bis sie in den Abgrund stürzt oder von einer Baumwurzel aufgehalten wird, an der sie gelassen die hilfreiche Dazwischenkunft des Sennen abwartet.
Sehr ausgebildet ist namentlich bei dem schweizerischen Alprindvieh jener Ehrgeiz, der das Recht des Stärkeren mit unerbittlicher Strenge handhabt und danach eine Rangordnung aufstellt, der sich alle fügen. Die Heerkuh, die die große Schelle trägt, ist nicht nur die schönste, sondern auch die stärkste der Herde und nimmt bei jenem Umgange unabänderlich den ersten Platz ein, indem keine andere Kuh es wagt, ihr voranzugehen. Ihr folgen die stärksten Häupter, gleichsam die Standespersonen der Herde. Wird ein neues Stück hinzugekauft, so hat es unfehlbar mit jedem Gliede der Genossenschaft einen Hörnerkampf zu bestehen und nach dessen Erfolgen seine Stelle im Zuge einzunehmen. Bei gleicher Stärke setzt es oft böse, hartnäckige Zwiegefechte ab, da die Tiere stundenlang nicht von der Stelle weichen.
Bei jeder großen Alpenviehherde befindet sich ein Zuchtstier, der sein Vorrecht mit sultanischer Ausschließlichkeit und ausgesprochenster Unduldsamkeit bewacht; es ist selbst für den Sennen nicht ratsam, vor seinen Augen eine rindernde Kuh von der Sente zu entfernen. In den öfters besuchten tieferen Weiden dürfen nur zahme und gutartige Stiere gehalten werden; in den höheren Alpen trifft man aber oft sehr wilde und gefährliche Tiere. Da stehen sie mit ihrem gedrungenen, markigen Körperbau, ihrem breiten Kopf mit krausem Stirnhaar am Wege und messen alles Fremdartige mit stolzen, jähzornigen Blicken. Besucht ein Fremder, namentlich in Begleitung eines Hundes, die Alp, so bemerkt ihn der Herdenstier schon von weitem und kommt langsam mit dumpfem Gebrüll heran. Er beobachtet den Menschen mit Mißtrauen und Zeichen großen Unbehagens, und reizt ihn an der Erscheinung desselben zufällig etwas, vielleicht ein rotes Tuch oder ein Stock, so rennt er geradeaus mit tiefgehaltenem Kopfe, den Schwanz in die Höhe geworfen, in Zwischenräumen, wobei er öfters mit den Hörnern Erde aufwirft und dumpf brüllt, auf den vermeintlichen Feind los. Für diesen ist es nun hohe Zeit, sich zur Hütte, hinter Bäume oder Mauern zu retten; denn das gereizte Tier verfolgt ihn mit der hartnäckigsten Leidenschaftlichkeit und bewacht den Ort, wo es den Gegner vermutet, oft stundenlang. Es wäre in solchem Falle töricht, sich verteidigen zu wollen. Mit Stößen und Schlägen ist wenig auszurichten, und der Stier läßt sich eher in Stücke hauen, ehe er sich vom Kampfe zurückzieht.
Die festlichste Zeit für das Alpenrindvieh ist ohne Zweifel der Tag der Alpfahrt, die gewöhnlich im Mai stattfindet. Jede der ins Gebirge ziehenden Herden hat ihr Geläute. Die stattlichsten Kühe erhalten, wie bemerkt, die ungeheuren Schellen, die oft über einen Fuß im Durchmesser halten und vierzig bis fünfzig Gulden kosten. Es sind die Prunkstücke des Sennen; mit drei oder vier solchen in harmonischem Verhältnis zueinander stehenden läutet er von Dorf zu Dorf seine Abfahrt ein. Zwischenhinein tönen die kleinen Erzglocken. Trauriger als die Alpfahrt ist für Vieh und Hirt die Talfahrt, die in ähnlicher Ordnung vor sich geht. Gewöhnlich ist sie das Zeichen der Auflösung des familienartigen Herdenverbandes.«
Solches Herdentreiben ist sozusagen die Dichtung im Rinderleben. In den meisten übrigen Ländern hat das gute Haustier kein so schönes Los. In Deutschland genießt es bloß in den Gebirgen und in den nördlichen Marschgegenden während des Sommers eine mehr oder weniger beschränkte Freiheit. Die Herden im Thüringer Walde erinnern noch lebhaft an jene, die auf den Alpen weiden. In keiner größeren Waldung dieses lieblichen Gebirges wird man die Rinder vermissen. Jede Herde besitzt ihr eigenes vollstimmiges Geläute, und gerade in ihm suchen die Hirten ihren größten Stolz. Es gibt gewisse Tonkünstler, die Schellenrichter, die im Frühjahr von Dorf zu Dorf ziehen, um das Geläute zu stimmen. Jede Herde muß wenigstens acht verschiedene Glocken haben, die großer, mittlerer und kleiner Baß, Halbstampf, Auchschell, Beischlag, Lammschlag und Gitzer genannt werden. Man hat beobachtet, daß die Rinder das Geläute ihrer Herde genau kennen und verirrte Kühe durch dasselbe sich zurückfinden. Die Tiere weiden während des ganzen Sommers im Walde; erst im Spätherbst stallt man sie ein.
In Norwegen lebt das Rindvieh in ähnlichen Verhältnissen wie in der Schweiz. Das norwegische Rind ist abgehärtet, wie alle Haustiere es dort sind, und treibt sich sehr viel im Freien umher; immer aber kehrt es abends in seinen warmen Stall zurück. Das Leben auf dem Hochgebirge in den Sennerwirtschaften hat sicherlich für Menschen und Tiere dieselben Reize wie das Hirten- und Herdenleben in den eigentlichen Alpen; aber nicht alle Kühe genießen die liebevolle Pflege der schmucken und reinlichen Sennerinnen, die das Gebirge des Nordens anmutigerweise beleben. In den Waldgegenden z. B. läßt man die Tiere ohne Aufsicht umherstreifen, und da kommt es oft genug vor, daß ein Stück tagelang verirrt in den Wäldern umherstreift, mühselig durch Sumpf und Moor sich arbeitet und nur im günstigsten Fall wieder zu den Menschen kommt, abgemattet, mager, halb verhungert. Auch die bösen Mücken schaffen dem Vieh während der Hochsommermonate arge Plage und zwingen den Besitzer zu denselben Maßregeln, wie die Dinka sie ergreifen. Auf den nördlichen Weiden Norwegens zündet man allnächtlich Torffeuer an, um den zur Vertreibung der Mücken dienenden Rauch zu erzeugen und den an diese Art von Räucherung gewöhnten Rindern zu der nötigen Ruhe zu verhelfen. Im höchsten Norden ist namentlich der Winter eine schlimme Zeit für das Rindvieh. Der kurze Sommer Norlands und Lapplands kann nicht genug Winterfutter erzeugen; deshalb füttert man im Winter nicht bloß Heu und Stroh, Laub und Birkenzweige, Renntiermoos und Pferdemist, Meerespflanzen, Algen und dergleichen, sondern auch Fische und namentlich die Köpfe der Dorsche, die man gerade zur Zeit des Futtermangels in großen Mengen fängt. Diese Fischköpfe, nebst Tangen aller Art und Moosen, werden in einem Kessel so lange gekocht, bis die Knochen weich oder zur Gallerte werden; dann schüttet man die breiige Masse den Kühen vor, und diese fressen die ihnen so unnatürliche Nahrung mit Begierde. Die Bewohner der Lofoten haben mir versichert, daß man die Gerüste, auf denen die Dorsche getrocknet werden, vor den Kühen bewahren müsse, weil diese ohne Umstände an den halbtrockenen Fischen sich satt zu fressen pflegen.
In den meisten übrigen Ländern Europas ist das Rindvieh ein trauriger Sklave des Menschen; in Spanien dagegen kommt zwar nicht das Rind, wohl aber der Ochse zur Geltung. Er genießt hier eine Achtung, wie sie einem indischen Zebu zuteil werden mag; er kann sich zum Helden des Tages emporschwingen und unter Umständen weit mehr Teilnahme erregen als alles übrige, was den Spanier näher angeht. Dieser hat für die Schönheiten eines Stieres ein besonderes Auge; er prüft und schätzt ihn wie bei uns ein Kundiger ein edles Pferd oder einen guten Hund. Nicht einmal an einem frommen Zugstiere geht er gleichgültig vorüber; gegen ein vielversprechendes Kalb zeigt er sich sogar zärtlich. Dies hat seinen Grund darin, daß ebensowohl die Spanier, die ihr ursprüngliches Vaterland, als diejenigen, die die Neue Welt bewohnen, leidenschaftliche Freunde von Schauspielen sind, wie sie wohl die alten Römer aufführten, nicht aber gebildete und gesittete Völker leiden mögen, und daß man jeden vor das Auge kommenden Stier daraufhin ansieht, ob und wieviel er wohl bei einer Stierhatze oder einem Stiergefechte zu leisten vermöge.
Die Stierhatzen sind Vergnügungen, die einen Sonntagnachmittag in erwünschter Weise ausfüllen und der Menge erlauben, tätig mit einzugreifen; bei den Stiergefechten kämpfen geübte Leute, die Toreros, falls nicht junge vornehme Nichtstuer als besonderen Beweis ihrer Gesittung ein solches Schauspiel veranstalten, d. h. das Amt der Stierkämpfer übernehmen.
Die Stierhatzen werden auf den Märkten der Städte abgehalten. Alle nach dem Platz führenden Straßen sind durch ziemlich feste Holzplanken abgesperrt. Einer dieser Abschlüsse dient als Eingang, und hier entrichtet jeder Eintretende eine gewisse Summe. Ein Kaufmann in Játiva de San Felipe hatte uns gelegentlich einer Stierhatze zu sich eingeladen, weil wir von seinem Hause aus den ganzen Marktplatz übersehen konnten. Wir genossen ein sehr eigentümliches Schauspiel. Die Haustüren waren geschlossen, alle Erker aber geöffnet und gedrängt voll Menschen; insbesondere die Frauen nahmen den lebhaftesten Anteil. In der Mitte des Marktes erhob sich ein Gerüst für die Musik, die um so lauter spielte, je toller der Lärm wurde. Der ganze Markt war voll von Menschen. Ich konnte mir gar nicht erklären, wo sie hergekommen und wohin sie sich zurückziehen wollten, wenn der Held des Tages auf dem Platz erscheinen würde. Man sah wohl einige Gerüste aufgeschlagen; aber diese konnten doch unmöglich die Menschenmenge fassen, die jetzt auf dem Markt umherwogte. Und doch war es nicht anders. Einige Schläge an die Türe des Gehöftes, in dem sich die Stiere befanden, benachrichtigten von dem baldigen Erscheinen des vierfüßigen Schauspielers. Augenblicklich stob die Masse auseinander. Alle Gerüste, oder vielmehr die Pfahl- und Bretterverbindungen waren im Nu bis oben hinauf mit Menschen besetzt. Wie Affen hockten die Leute übereinander. Unten auf der Erde, unter den Gerüsten, lag die liebe Jugend auf dem Bauch. An manchen Häusern waren andere Vorrichtungen getroffen worden, um geschützte Plätze gegen den herannahenden Ochsen zu erhalten. Man hatte drei bis fünf starke Stäbe oder Bohlen in Seile eingebunden und letztere an den Erkern befestigt. Die Bohlen waren so schmal, daß eben nur ein Fuß darauf Platz fand, genügten aber, wie ich bald sah, vollständig zum Ausweichen. Von oben herab hingen so viele Leinen, als möglicherweise Leute auf diesen Schieferdeckergerüsten Platz finden konnten. Die Leinen waren von Fuß zu Fuß Entfernung in Knoten geschlungen und dienten zum rascheren und sicheren Erklettern des Gerüstes sowie zum Sichfesthalten da oben. Andere Zuschauer hatten auf den Bänken, die man hier und da in den Haustüren sieht, Platz genommen, andere standen in den Türen, immer bereit, dieselben augenblicklich zu schließen, wieder andere hatten die Tore mittels schwerer Tafeln befestigt. An dem Gerüste, auf dem die Musikbande thronte, hingen noch außerdem über hundert Menschen, und es brach deshalb später auch glücklich zusammen.
Jetzt öffneten sich die Flügeltüren des Gehöftes. Der Gegenstand der allgemeinen Verehrung und Unterhaltung, ein zünftiger Ochse, stürmte heraus. Augenblicklich saßen alle Menschen auf ihren schwebenden Gerüsten. Die achtbare Versammlung begrüßte den herausgetretenen Stier mit endlosem Gebrüll. Verwundert sah sich der Ochse um. Die bunte Menschenmenge, der ungewohnte Lärm machten ihn stutzig. Er stampfte mit dem Fuß und schüttelte das Haupt, die gewaltigen Hörner zu zeigen, bewegte sich aber nicht von der Stelle. Das verdroß die Leute natürlich. Die Frauen schimpften und schwenkten ihre Tücher, nannten entrüstet den Ochsen ein erbärmliches Weib, eine elende Kuh; die Männer gebrauchten noch ganz andere Kraftworte und beschlossen endlich, den faulen Gesellen in Trab zu setzen. Zuerst sollten Mißklänge aller Art ihn aus seiner Ruhe schrecken. Man war erfindungsreich im Hervorbringen eines wahrhaft entsetzlichen Lärmes, pfiff auf wenigstens zwanzigfach verschiedene Weise, schrie, kreischte, klatschte in die Hände, schlug mit Stöcken auf den Boden, an die Wände, an die Türen, zischte, als ob Schwärmer in Brand gesetzt würden; man schwenkte Tücher, schwenkte von neuem; der Ochse war viel zu sehr verwundert und stand nach wie vor unbeweglich. Ich fand dies ganz natürlich. Sein Fassungsvermögen war eben schwach, und wenn es auch sonst bei derartigen Geistern gewöhnlich nicht lange dauert, um zu begreifen, daß man selbst als Ochse der Held des Tages sein kann, schien unser Stier sich doch noch nicht in die ihm gewidmeten Ehrenbezeigungen finden zu können. Zudem war die Lage des guten Tieres wirklich ungemütlich. Überall Menschen, von denen man nicht wissen konnte, ob sie verrückt oder bei Verstande waren, und aus diesem allgemeinen Irrenhause kein Ausweg; das mußte selbst einen Ochsen zum Nachdenken bringen.
Aber solches Nachdenken sollte gestört werden. Spaniens edles Volk wollte mit dem Ochsen sich unterhalten, verbrüdern. Man griff deshalb zu andern Mitteln, um den erstaunten Stier zu stören. Langsam öffnete sich eine Tür; ein langes, am vorderen Ende mit spitzigen Stacheln bewehrtes Rohr wurde sichtbar; weit schob es sich heraus, endlich erschien auch der Mann, der es am andern Ende festhielt. Bedächtig richtete und lenkte er besagtes Rohr; ein furchtbarer Stoß nach dem Hinterteil des Ochsen wurde vorbereitet und ausgeführt, gelang auch, doch ohne die gehoffte Wirkung. » Toro« hatte den Stoß für einen Mückenstich gehalten. Er schlug zwar wütend nach hinten aus, das stechlustige Kerbtier zu vertreiben, blieb aber stehen. Neue Mittel ersann man; sogar das Parallelogramm der Kräfte wurde in Anwendung gebracht; von zwei Seiten zielte und stieß man zu gleicher Zeit nach dem Hinterteile des Stieres. Das trieb ihn endlich einige Schritte vorwärts. Jetzt brachten Stachelbolzen, die man aus Blasröhren nach seinem Felle sandte, ihm zugeworfene Hüte, vorgehaltene Tücher und das bis zum äußersten gesteigerte Brüllen die gewünschte Wirkung hervor. Todesmutig, zitternd vor Wut, stürmte das Tier an einer Seite des Marktplatzes hinauf und fegte dieselbe gründlich rein, – aber nur für einen Augenblick; denn kaum war der Stier vorüber, so war auch die Menge wieder von ihren schwebenden Sitzen herunter und rannte ihrem Lieblinge nach.
Man benahm sich nicht bloß dreist, sondern wirklich frech. Wenn der Stier längs der Häuser dahintobte, faßten ihn einige der verwegensten Gesellen auf Augenblicke an den Hörnern, traten ihn andere von oben herab mit Füßen, stellten sich andere auf kaum mehr als zehn Schritte vor ihn hin und reizten ihn auf alle denkbare Weise, waren aber, wenn der Stier auf sie losstürzte, immer noch geschwind genug, eines der Gerüste zu erklettern. Die meisten bewiesen Mut, einige aber waren doch recht feig. Sie stachen durch kleine Löcher in den Haustüren hindurch oder machten nur Lärm, wie ein Mann, der unsere Verachtung im reichsten Maße auf sich zog, weil er bloß die Türe öffnete, mit der Hand oder dem Stocke daranschlug, sie aber, sowie der Stier die geringste Bewegung machte, schleunigst wieder verschloß. Während der Hatzen lernte ich einsehen, wie genau die Spanier ihren guten Freund kannten. So waren die untersten Planken, auf denen die Leute standen, kaum mehr als anderthalb Meter über den Boden erhöht, der Stier konnte sie also bequem mit seinen Hörnern leer machen; er kam aber nie dazu; denn kurz vor seiner Ankunft faßten die auf solchen Planken Stehenden mit ihren Händen höhere Teile des Gerüstes, zogen die Beine an und erhielten sich so lange in der Schwebe, bis das wütende Tier vorüber gestürmt war.
Um zum Schlusse zu kommen. Sechs Stiere wurden durch Menschen und Hunde so lange auf dem Markte herumgehetzt, bis sie wütend und später müde wurden. Dann war es für sie stets eine Erlösung aus allem Übel, wenn der zahme Leitochse erschien, dem die Pflicht oblag, sie in ihre Ställe zurückzubringen. Solche Hatzen sind einfache Sonntagsvergnügen der Spanier, die Stiergefechte dagegen außerordentliche Feste, man darf wohl sagen, die größten des Jahres. In Madrid und in Sevilla werden während der heißen Sommermonate bei gutem Wetter jeden Sonntag Stiergefechte aufgeführt, in den übrigen Städten des Landes nur einmal im Jahr, dann aber gewöhnlich drei Tage lang nacheinander. Der Reisende, der sich längere Zeit in Spanien aufhält, kann solchem Schauspiele nicht entgehen. Ich beschreibe ein Stiergefecht, dem ich in Murcia beiwohnte.
Schon in den ersten Nachmittagsstunden des festlichen Sonntags drängten sich die Menschen in den dahin führenden Straßen. Überfüllte Wagen aller Art kreuzten sich mit leeren, die vom Platz zurückkehrten, um neue Schaulustige herbeizuführen. Am Eingang des Schauplatzes wogte die bunte Menge unter Fluchen und Toben durcheinander, obgleich die Türen seit mehreren Stunden geöffnet waren und die ärmeren Stadtbewohner schon seit Mittag ihre Plätze gewählt und besetzt hatten. Fünf Stunden lang mußten diese Erstlinge die furchtbare Sonnenglut aushalten, um dann während der Vorstellung Schatten zu haben, ertrugen jedoch alles gern, um nur das erhabene Schauspiel in Ruhe genießen zu können. Der Anblick des Amphitheaters war überraschend. Die Menschenmenge verschmolz zu einem bunten Ganzen, aus dem nur die roten Binden der Männer der Fruchtebene und die lebhaft gefärbten Halstücher der Frauen hervorstachen. Einige junge Leute schwenkten rote Fahnen mit darauf gestickten Ochsenköpfen und andern passenden, d. h. auf das Rindvieh bezüglichen Sinnbildern des Festes; viele waren mit Sprachrohren versehen, um den wüsten Lärm, der herrschte, noch vermehren, das Gekreisch und Gebrüll vervollständigen zu können.
Unsere anfangs noch den Sonnenstrahlen ausgesetzten Plätze befanden sich hart an der zum Stierzwinger führenden Türe. Links vor uns hatten wir die Pforte, durch die die Kämpfer hereintreten und die getöteten Tiere hinausgeschafft werden, rechts über uns war der Schausitz der Obrigkeit, dicht vor uns, bloß durch eine Planke getrennt, der Kampfplatz. Dieser mochte ungefähr sechzig oder achtzig Schritte im Durchmesser halten und war ziemlich geebnet, jetzt aber voller Pfirsichkerne und anderer Fruchtreste, die man von oben herabgeworfen hatte und beständig noch herabwarf. Die Planke, die anderthalb Meter hoch sein mochte, hatte an der inneren Seite in einer Höhe von einem halben Meter ziemlich breite Leisten, dazu bestimmt, den vor dem Stier fliehenden Kämpfern beim Überspringen Unterstützung zu gewähren. Zwischen dieser Umhegung und den Schauplätzen war ein schmaler Gang für die Toreros leer gelassen worden; hierauf folgten »in weiten, stets geschweiften Bogen« die für die Menge bestimmten Bänke, etwa zwanzig oder dreißig an der Zahl, auf diese Sitzreihen die gesperrten Plätze und auf sie endlich die Logenreihen, in denen man die Frauen der Stadt im höchsten Putz sehen konnte, und auf deren Dächern noch Hunderte von Menschen, den Regenschirm gegen die Sonnenstrahlen ausgespannt, erwartend standen, wahrscheinlich, weil sie unten keine Sitze gefunden hatten. Erst beim Anblick dieser Menschenmenge wurde es glaublich, daß eine Arena zwölf- bis zwanzigtausend Menschen fassen kann.
Mit dem Schlage der bestimmten Stunde erschien der Alcalde in seiner reich verzierten, mit dem Wappen der Stadt geschmückten Loge. Die großen Tore öffneten sich, und die Toreros traten herein. Vor ihnen her ritt ein Alguazil in seiner uralten Amtstracht; auf ihn folgten die Espadas, Bandarilleros und Cacheteros, hierauf die Picadores und zuletzt ein Gespann mit drei reichgeschmückten Maultieren. Die Fechter trugen enge, überreich gestickte Kleider und darüber rote, mit Goldschmuck überladene Sammetmäntel; die kurze Jacke war förmlich mit Gold und Silber überdeckt, weil man nicht allein die Schultergegend mit dicken Goldtroddeln verziert, sondern auch dicke Silberplatten, die Edelsteine umfaßten, darauf geheftet hatte. Die schwarzen Käppchen, die alle Köpfe bedeckten, waren aus dickem Wollzeuge eigentümlich gewebt; die Bekleidung der Füße bestand aus leichten Schuhen mit silbernen Schnallen. Die Bandarilleros trugen anstatt der Mäntel buntfarbige, wollene Tücher über dem Arm. Ganz abweichend waren die Picadores gekleidet. Nur die Jacken waren ebenso kostbar gestickt wie bei den übrigen; die Beinkleider aber bestanden aus dickem Leder und waren über schwere, eiserne Schienen gezogen, die die Unterschenkel und die Füße sowie den rechten Oberschenkel umhüllten; auf dem Haupt saßen breitkrempige, mit buntfarbigen Bandrosen verzierte Filzhüte. Diese Leute ritten erbärmliche Klepper, altersschwache Pferde, die sie mit einem wirklich furchtbaren Sporn am linken Fuß antrieben, und saßen in Sätteln mit hohen Rückenlehnen und überaus schweren, wie grobe Holzschuhe gestalteten eisernen Steigbügeln. Alle Fechter trugen dünne Haarzöpfe von größerer oder geringerer Länge.
Der Zug der hereingetretenen Männer bewegte sich nach der Loge des Alcalden, verbeugte sich vor diesem und grüßte sodann die schauende Menge. Hierauf rief der Alguazil einige Worte, die aber von ungeheurem Gebrüll der Zuschauer vollkommen verschlungen wurden, zum Manne des Gesetzes hinauf, um sich dessen Genehmigung zum Beginn der Vorstellung zu erbitten. Der Alcalde erhob sich und warf dem Alguazil den Schlüssel zum Stierzwinger zu. Dieser fing denselben auf, ritt zu der Tür des Zwingers und gab ihn einem dort stehenden Diener, der die Türe aufschloß, aber nicht öffnete. Die Espadas warfen ihre Mäntel ab, hingen sie an der Umplankung auf, ordneten ihre Degen und nahmen, wie die Bandarilleros, bunte Tücher zur Hand; die Picadores ritten zu einem besonderen Beamten, der Quäl- und Schlachtwerkzeuge bewahrte, und erbaten sich von diesem Lanzen, drei bis vier Meter lange, runde, etwa vier Zentimeter im Durchmesser haltende Stangen, an deren Ende eine kurze, dreischneidige, sehr scharfe Spitze befestigt ist, aber nur soweit hervortritt, als sie in das Fleisch des Stieres eindringen soll. Nachdem sie ihre Waffen empfangen hatten, waren alle zum Beginn des Gefechtes nötigen Vorbereitungen beendet.
Es läßt sich nicht verkennen, daß bis jetzt das Schauspiel etwas Großartiges und teilweise auch Anziehendes hatte; von jetzt aber sollte es anders kommen.
Man öffnete die Türe des Stalles, um dem eingepferchten Stiere einen Ausweg zu verschaffen. Der Stier war vorher regelrecht in Wut versetzt worden. Der Stierzwinger ist ein breiter Gang mit mehreren kleinen, gemauerten oder aus Holz bestehenden Kämmerchen, in die je ein Stier getrieben wird, oft mit großer Gefahr und Mühe, hauptsächlich durch Hilfe der zahmen Ochsen, die gegen ihre wilden Brüder ähnlich verfahren wie die zahmen Elefanten gegen die frisch gefangenen. In seinem Kämmerchen nun wird der zum Kampf bestimmte Stier erst stundenlang mit einem Stachelstock gepeinigt oder, wie der Spanier sagt, » gestraft«. Die Spitzen sind nadelfein, so daß sie wohl durch die Haut dringen und Qualen verursachen, aber kaum Blutverlust hervorrufen. Man kann sich denken, wie sehr sich die Wut des gefangenen Tieres, das sich nicht einmal in seinem Kämmerchen umdrehen kann, steigert und mit welchem Grimm es ins Freie stürzt, sobald sich ihm dazu Gelegenheit bietet.
Sofort nach dem Öffnen des Zwingers erschien der erste der Verdammten:
»Ein Sohn der Hölle schwarz und wild,
Unbänd'ger Kraft ein schaurig Bild;
Dumpf drang aus seiner Brust die Stimme,
Er schnaubte wild im Rachegrimme«.
Um ihn noch mehr in Wut zu versetzen, hatte man ihm eine Minute vorher die sogenannte »Devise«, eine große buntfarbige Bandrose, mittels einer eisernen Nadel mit Widerhaken durch Haut und Fleisch gestochen und damit die vorhergehenden Qualen würdig beschlossen. Beim Heraustreten stutzte er einen Augenblick, nahm sodann sofort einen der Bandarilleros an und stürzte gesenkten Hauptes auf diesen los. Der Fechter empfing ihn mit der größten Ruhe, hielt ihm das Bunttuch vor und zog sich sodann gewandt zurück, um ihn einem der Picadores zuzuführen. Diese saßen mit vorgehaltenen Lanzen unbeweglich auf ihren Pferden, denen sie, weil sie die wütenden Stiere immer von der rechten Seite auflaufen ließen, das rechte Auge verbunden hatten, oder ritten den Stieren höchstens einige Schritte entgegen, um sie dadurch zum Angriff zu reizen. Ihre Aufgabe war es, den Stier von den Pferden abzuhalten! allein die armen, altersschwachen, dem Tode geweihten Mähren besaßen selten genug Widerstandsfähigkeit, um dem Stoß des Picador den erforderlichen Nachdruck zu verleihen, und wurden deshalb regelmäßig das Opfer des anstürmenden Feindes. Wenn der Stier vor einem Reiter angekommen war, blieb er eine Zeitlang unbeweglich stehen, stampfte mit den Vorderfüßen den Boden und schleuderte den Sand hinter sich, schlug mit dem Schweife, rollte die Augen, senkte plötzlich den Kopf und rannte auf das Pferd los, dabei aber mit seiner vollen Kraft in die vorgehaltene Lanze, die der Picador nach seinem Nacken gerichtet hatte. Pferd und Reiter wurden durch den Stoß des Stieres zurückgeschleudert, beide aber blieben diesmal unversehrt. Brüllend vor Schmerz und Wut zog sich der Angreifer zurück und schüttelte den blutigen, von der Pike weit aufgerissenen Nacken. Dann stürzte er sich von neuem auf die vor ihm hergaukelnden Fußfechter, deren Mäntel ihn in immer größere Wut versetzten, oder auf einen andern Picador. Beim zweiten Anlauf gelang es ihm fast immer, bis zu dem Pferd vorzudringen, und dann bohrte er im selben Augenblick die spitzen Hörner tief in den Leib des letzteren. Glücklich für das gefolterte Tier, wenn der erste Stoß in die Brust gedrungen und tödlich war; wehe ihm, wenn es nur eine klaffende Wunde in das Bein oder in den Unterleib erhalten hatte! Wenn auch ein Stier dem Pferde den Unterleib aufgeschlitzt hatte und die Gedärme herausquollen oder selbst auf der Erde nachschleppten, so daß das gepeinigte edle Geschöpf mit seinen eigenen Hufen auf ihnen herumtrat, seine Marter war dann noch nicht beendigt. Die Picadores zerstießen mit ihren Lanzen die nachschleppenden Eingeweide, damit deren Inhalt ausfließen sollte, oder die Pferde traten jene selbst ab, und von neuem trieben die Reiter sie dem Stiere entgegen. Am ganzen Leibe zitternd, die Lippen krampfhaft bewegend, standen die Pferde und erwarteten einen zweiten, dritten Angriff des wütenden Stieres, bis der herannahende Tod ihrer Qual ein Ende machte. Hingemartert brachen sie zusammen; die Picadores schleppten sich schwerfällig bis zur Umplankung und erschienen nach einiger Zeit auf einem neuen Pferde wiederum auf dem Kampfplatze. Wenn die gefallenen Pferde noch Leben zeigten, wurden sie geschlagen und gemartert, in der Absicht, sie nach dem gemeinschaftlichen Totenbette zu schaffen. Dort wurden ihnen, während die Bandarilleros den Stier auf einer andern Seite beschäftigten, die Sättel abgerissen, und wenn es anging, schlug, stieß, schob und zog man sie von neuem, um sie von dem Platze zu bringen; denn nur ein tot zusammengestürztes oder wenigstens schon mehr als halbtotes Pferd ließ man ruhig auf der Walstatt liegen.
Bei jedem gut abgewiesenen Anlauf des Stieres spendeten die Zuschauer dem Picador, bei jeder Verwundung, die ein Pferd erhielt, dem Stiere Beifall. Stimmen der empörendsten Gefühllosigkeit wurden laut: »Geh', Pferd, nach dem Krankenhause und laß dich dort heilen! Sieh, Pferdchen, welch einen Stier du vor dir hast! Weißt du jetzt, mit wem du es zu tun hattest?« Solche und ähnliche Worte vernahm man, und rohes Gelächter begleitete solche Ausrufe. Je tiefer die Verwundung eines Pferdes war, um so stürmischer erbrauste der Beifall des Volkes; mit wahrer Begeisterung aber begrüßte man die Niederlage eines Picador. Während des ganzen Gefechtes geschah es mehrere Male, daß einer dieser Leute samt seinem Pferde von dem Stier zu Boden geworfen wurde. Einer derselben stürzte mit dem Hinterkopfe gegen die Holzwand, daß er für tot vom Platze getragen wurde, kam aber mit einer Ohnmacht und einer leichten Schramme über dem Auge davon. Ein zweiter erhielt eine bedeutende Verrenkung des Armes und wurde dadurch für die nächste Zeit kampfunfähig. Den ersteren würde der Stier ebenso wie sein Pferd getötet haben, hätten die Fußfechter nicht die Aufmerksamkeit des gereizten Tieres durch ihre Tücher auf sich gelenkt und es dadurch von jenem abgezogen.
So dauerte der erste Gang des Gefechtes ungefähr fünfzehn Minuten oder länger, je nach der Güte, d. h. nach der Wut des Stieres. Je mehr Pferde er tötete oder tödlich verwundete, um so mehr achtete man ihn. Die Picadores kamen oft in Gefahr, wurden aber immer durch die Fußfechter von dem Stier befreit; diese selbst entflohen im Notfall durch rasches Überspringen der Umplankung. Ihre Gewandtheit war bewunderungswürdig, ihre Tollkühnheit überstieg allen Glauben. Der eine Fechter faßte den Stier beim Schwanze und drehte sich mit ihm mehrere Male herum, ohne daß das hierdurch in Raserei versetzte Tier ihm etwas anhaben konnte. Andere warfen, wenn der Stier sie schon fast mit den Hörnern erreicht hatte, ihm noch geschwind das Tuch über die Augen und gewannen so immer noch Zeit zum Entfliehen.
Nachdem der Stier genug Pikenstöße empfangen hatte, gab ein Trompetenstoß das Zeichen zum Beginn des zweiten Ganges. Jetzt nahmen einige Fußfechter die Bandarillas zur Hand. Die Picadores verließen den Kampfplatz, die übrigen behielten ihre Tücher bei. Die Bandarilla ist ein starker, ungefähr 75 Zentimeter langer, mit Netzen bekleideter Holzstock, der vorn eine eiserne Spitze mit Widerhaken hat. Jeder Bandarillero ergriff zwei dieser Quälwerkzeuge, reizte den Stier und stieß ihm, sowie derselbe auf ihn losstürzte, beide Bandarillas gekreuzt in den durch die Pikenstöße zerfleischten Nacken. Vergeblich versuchte der Stier sie abzuschütteln, und immer höher steigerte sich seine Wut. Im grimmigsten Zorne nahm er den zweiten und den dritten Bandarillero auf. Jedesmal erhielt er neue Bandarillas, ohne jemals den Mann erreichen zu können, der sofort nach dem Stoß gewandt zur Seite sprang. Binnen fünf Minuten war ihm der Nacken mit mehr als einem halben Dutzend Bandarillas gespickt. Beim Schütteln schlugen dieselben klappernd aneinander und bogen sich allgemach zu beiden Seiten herab, blieben aber stecken.
Ein neuer Trompetenstoß eröffnete den dritten Gang. Der erste Espada, ein echtes Bravogesicht, schritt auf den Alcalden zu, verneigte sich und brachte ihm und der Stadt ein Hoch. Dann nahm er ein rotes Tuch in die linke, die Espada in die rechte Hand, ordnete Tuch und Waffe und trat dem Stier entgegen. Den langen, spitzen und starken zweischneidigen Degen, der ein Kreuz und einen sehr kleinen Handgriff hat, faßte er so, daß die drei hinteren Finger in dem Bügel staken, der Zeigefinger auf der Breitseite des Degens und der Daumen auf dem Handgriff lag. Das Tuch breitete er über einen Holzstock aus, an dessen Ende es durch eine Stahlspitze festgehalten wurde. Mit dem Tuche reizte er den Stier, bis dieser auf ihn losstürzte; aber nur dann, wenn das Tier in günstiger Weise anlief, versuchte er, ihm einen Stoß in den Nacken zu geben. Gewöhnlich ließ er den Stier mehrere Male anlaufen, ehe er überhaupt zustieß. Bei einem Stier gelang es ihm erst mit dem dritten Stoße, die geeignete Stelle hart am Rückgrat zwischen den Rippen zu treffen; die früheren Stöße waren durch die Wirbelkörper aufgehalten worden. Nach jedem Fehlstoße ließ der Mann die Espada stecken und bewaffnete sich mit einer andern, während der Stier die ersteren durch Schütteln abwarf. Wenn der Stoß gut gerichtet war, senkte sich der Degen bis zum Hefte in die Brusthöhle und kam gewöhnlich unten wieder zum Vorschein. Sofort nach dem tödlichen Stoße blieb der Stier regungslos stehen; ein Blutstrom quoll ihm aus Maul und Nase; er ging einige Schritte vorwärts und brach zusammen. Nunmehr näherte sich der Cachetero oder Matador, stieß dem sterbenden Tiere einen breiten Abfänger ins Genick und zog die Bandrose aus dem Nacken.
Beifallsgebrüll der Zuschauer vermischte sich mit rauschender Musik. Die breite Pforte öffnete sich, um das Gespann der Maultiere einzulassen, die den Stier mittels eines zwischen und um die Hörner gewundenen, am Zugholze befestigten Strickes in vollem Rennen zum Tore hinausschleiften. Hierauf wurden die gefallenen Pferde in ebenderselben Weise fortgeschafft, die Blutlachen mit Sand bestreut, sonstige Vorkehrungen für das zweite Gefecht getroffen.
Ein zweiter, dritter, sechster Stier erschienen auf dem Kampfplatze. Der Gang des Gefechtes war bei allen derselbe, nur mit dem Unterschied, daß der eine mehr, der andere weniger Pferde tötete, daß dieser erst mit dem zehnten, jener mit dem ersten Degenstoße zu Boden fiel. Bei solchem Heldenstück wollte das Brüllen der Zuschauer kein Ende nehmen. Der Espada selbst schnitt sich stolz ein Stück Haut des Tieres ab und warf es laut jubelnd in die Luft. In den Zwischenpausen spielte die Musik oder brüllten die Zuschauer. Nach sechs Uhr war das Schauspiel beendet. Auf blutgetränktem Bette lagen zwanzig getötete Pferde und der letzte der Stiere; die übrigen hatte man bereits fortgeschafft. Zehn oder zwölf mit Ochsen bespannte Karren hielten auf dem Platze, um die Mähren abzuräumen. Einzelne Pferde lebten noch, ohne daß eine mitleidige Hand sich gefunden hätte, ihrem Dasein ein Ende zu machen. Man schnitt ihnen, unbekümmert um ihr Röcheln und ihre Zuckungen, Mähnen und Schwänze ab; man lud sie endlich auf und überließ es ihnen, zu sterben, wo und wann sie konnten.
Die Leidenschaft, mit der die Spanier den Stiergefechten beiwohnen, ist unglaublich groß. Nicht nur Männer schwärmen für diese fluchwürdigen Spiele, auch Frauen versäumen, wenn sie können, kein einziges, nehmen selbst ihre säugenden Kinder mit auf den Kampfplatz. Stierfechter erwerben sich gewöhnlich ein bedeutendes Vermögen und werden zu Helden des Tages, obgleich sie sonst in sehr geringer Achtung stehen; der reiche und vornehme Pöbel befreundet sich mit ihnen, obgleich sie der Hefe des Volkes angehören. Mehr noch als sie selbst bewundert man die Stiere; einzelne, die viele Pferde töteten, genießen jahrelangen Nachruf, und von ihnen her schreibt sich die Achtung, mit der die Spanier das Rindvieh überhaupt behandeln.
Nach dem Vorhergegangenen brauche ich über das geistige Wesen des Hausrindes nicht viel zu sagen. Das Tier steht unzweifelhaft auf niederer Stufe, denn es ist neben dem Schafe das dümmste unserer Haustiere. Seinen Pfleger lernt es kennen und in gewissem Grade lieben, gehorcht dem Rufe und folgt der Lockung, beweist auch eine gewisse Teilnahme gegen den, der sich viel mit ihm beschäftigt; Gewohnheit scheint aber mehr zu wirken als eigentliche Erkenntnis.
Das Rind ist im zweiten Jahre seines Lebens zeugungsfähig. Paarungstrieb verrät die Kuh durch Unlust am Fressen und Saufen, durch Unruhe und vieles Brüllen. Die Brunst hält nur einen halben Tag an, kehrt aber, wenn die Lust nicht befriedigt wurde, oft wieder. Die Tragzeit währt in der Regel 285 Tage, kann jedoch erheblich länger oder kürzer sein. Das Kalb erhebt sich bald nach seiner Geburt auf die Füße und saugt schon am ersten Tage seines Lebens. Die Kuh bemuttert es, bis sie wieder brünstig wird. Bei der Geburt bringt das junge Rind acht Schneidezähne mit auf die Welt, nach Vollendung des ersten Jahres wechselt es die beiden mittelsten, ein Jahr später die beiden diesen zunächststehenden, nach Verlauf des zweiten Jahres das dritte Paar und ein Jahr später endlich die beiden letzten. Mit dem fünften Lebensjahre gilben sich die anfänglich milchweißen Zähne, zwischen dem sechzehnten und achtzehnten beginnen sie auszufallen oder abzubrechen. Von dieser Zeit an gibt die Kuh keine Milch mehr, und der Stier ist zur Paarung kaum noch geeignet. Die Lebensdauer scheint fünfundzwanzig, höchstens dreißig Jahre nicht zu übersteigen.
Verschiedene Pflanzen im frischen und getrockneten Zustande, Wicken, Erbsen, junges Getreide und saftiges Gras sind die Lieblingsnahrung des Rindes. Schädlich werden ihm Flachs, Eibe, Wasserschierling, Läusekraut, Binsen, Froschlauch, Zeitlose, Wolfsmilch, Eisenhut, junges Eichenlaub und Walnußblätter, nasser Klee und dergleichen. Petersilie, Sellerie, Lauch und Zwiebeln wirken der Milcherzeugung entgegen. Thymian, Saalbreit, Hahnfuß, Wegerich werden im Notfall, Früchte aller Art, Kartoffeln, Obst und Möhren leidenschaftlich gern gefressen; Salz ist Bedürfnis. Eine erwachsene Kuh bedarf täglich etwa zehn bis zwölf, ein Ochse fünfzehn bis achtzehn Kilogramm Futter. Erstere verursacht dem, der alles Futter kauft, einen Kostenaufwand von etwa 200 Mark, bringt aber dafür etwa 250 Mark ein. Noch besser verwertet der Landwirt das Rind, wenn er es mästet, und zumal in der Neuzeit erzielt man durch geeignete Fütterung außerordentliche Erfolge. Das Rind gilt mit Recht als das einträglichste aller Haustiere.
An die bisher betrachteten Tiere schließen sich die Büffel ( Bubalus) an, plump gebaute Rinder mit schwerem, ungefälligem Leibe, verhältnismäßig kurzen, kräftigen und dicken Beinen und ziemlich langem, an der Spitze gequastetem Schwanze, kurzem Halse, breitem, an der niederen Stirn stark gewölbtem Kopfe, unschöner Schnauze und großer, nackter Muffel, blöden und düster blickenden Augen, seitlich abstehenden, meist großen und breiten Ohren, an den hintersten Ecken des Schädels eingesetzten, gewulsteten oder wenigstens mit höckerartigen Auswüchsen versehenen Hörnern, die sich zuerst nach unten und hinten, sodann nach außen und zuletzt nach oben oder in einem sanften Bogen nach unten und in einer schwachen Krümmung nach außen kehren, sowie endlich auffallend dünnem Haarkleide, das bei älteren Tieren auch fast vollständig fehlen kann.
Unter den hierher gehörigen Arten steht der Kafferbüffel ( Bos caffer), das stärkste und wildeste, durch sein eigentümliches Gehörn besonders ausgezeichnete Mitglied der Sippschaft, unzweifelhaft obenan. Er ist gedrungener gebaut als andere Büffel, der Kopf verhältnismäßig wohlgeformt, der Hals ziemlich dick und lang, der Leib am Widerriste wenig erhöht, so daß nur ein flacher Buckel sich bemerklich macht, der Bauch voll und gesenkt, der Schwanz lang und dünn, mit einer die Hälfte der Länge einnehmenden starken und reichen Quaste geziert. Das von der Wurzel an seit- und hinterwärts, sodann auf- und rückwärts, mit der Spitze merklich nach innen gebogene, abgeflachte und mit dicken Runzeln bedeckte Gehörn überlagert die ganze Stirn, so daß nur in der Mitte ein schmaler Streifen frei bleibt. Die Behaarung ist ungemein dünn, so daß einzelne Stellen fast nackt erscheinen und man eigentlich nur an Kopf und Beinen von einem Haarkleide sprechen kann. Die Färbung des Tieres wird daher weniger durch das schwarze, an der Spitze etwas lichtere Haar, als vielmehr durch die dunkelbräunlichgraue Haut hervorgebracht. Das Verbreitungsgebiet des Kafferbüffels umfaßt noch heutigestags nahezu ganz Süd- und Mittelafrika. Innerhalb der Ansiedlungen am Vorgebirge der Guten Hoffnung ist er gegenwärtig so gut als vollständig ausgerottet und auch im Südosten von Natal bis zum Sambesi in das Innere zurückgedrängt worden. Nach Heuglin liebt er die Ebene mehr als das Gebirge und wählt sich zu seinem ständigen Aufenthalt stets eine Gegend, in der es an Wasser nicht fehlt; denn dieses oder doch wenigstens Schlamm scheint für sein Wohlbefinden Bedingung zu sein. Von dem einmal gewählten Stande läßt sich die Herde nicht so leicht vertreiben; Schweinfurth wenigstens beobachtete, daß eine und dieselbe Gesellschaft innerhalb zweier Monate sich nicht von der Stelle bewegt hatte. Den Wald durchwandert ein solcher Trupp auf den Pfaden, die Elefanten und Nashörner hergestellt haben, oder bahnt sich eigene durch das Dickicht, da es, wie Heuglin hervorhebt, für das kraftvolle Tier Bodenhindernisse sozusagen gar nicht gibt und es mit gleicher Schnelligkeit an den Wänden der steilsten Schluchten hinabstürzt, wie durch das dichteste Gelaube des Waldes bricht oder watend durch den tiefsten Sumpf sich wälzt und wie alle Glieder seiner Sippschaft breite Gewässer mit größter Leichtigkeit durchschwimmt.
Seiner Natur nach ein geselliges Wesen, bildet der Kafferbüffel mit andern seiner Art regelmäßig Genossenschaften, gemeiniglich Herden von vierzig bis sechzig, nach Cummings Versicherung unter Umständen aber auch solche von sechs- bis achthundert Stück. Die Kühe leben immer, die Stiere bis gegen die Brunstzeit untereinander in Frieden, kämpfen dann wütend um die Oberherrschaft in Sachen der Liebe und vertreiben hierdurch, laut Drayson, nicht allzu selten einen alten, griesgrämigen, sämtliche übrigen männlichen Glieder der Herde belästigenden Bullen aus ihrer Mitte, der sich fortan die düstersten und zurückgelegensten Orte aussucht und hier, über sein Geschick und den Undank der Welt brütend, seine Tage dahinbringt, fast jedem andern Geschöpf grollend und Mensch und Tier gefährdend. Die Geburt der Kälber fällt ebenso, wie die Brunstzeit, in verschiedene Monate des Jahres, je nachdem in diesem oder jenem Teile Afrikas der Frühling früher oder später eintritt.
Während der heißen Stunden des Tages liegt der Kafferbüffel still und regungslos, ruhend, schlafend und dazwischen träumerisch wiederkäuend, auf einer und derselben Stelle, am liebsten in einer Wasserlache oder in einem Schlammloch, weshalb er auch nur ausnahmsweise anders als mit Schlamm bedeckt erscheint. In Ermangelung einer derartigen, seinen Wünschen am besten entsprechenden Lagerstätte wählt er die schattigste Stelle eines Waldes, ein Dickicht oder selbst eine Schlucht, um sich hier ungestörter Ruhe zu erfreuen. In den späteren Nachmittagsstunden oder gegen Abend erhebt er sich und äst von jetzt ab in Unterbrechungen bis zum frühen Morgen, nicht aber in behaglicher Gemächlichkeit wie andere Rinder, sondern in Absätzen, als ob er immer dieselbe Tücke fürchte, die er selbst andern Geschöpfen gegenüber an den Tag legt. Laut Heuglin weidet er Gras und Blätter mit unruhiger Hast ab, wehrt die lästigen Fliegen, läßt oft sein dumpfes Grunzen hören, windet mit der stets feuchten, dicken Muffel, richtet die breiten, mit stattlichem Haarkranze gezierten Ohren auf, peitscht mit dem flockigen Schweife unmutig die Weichen und stürzt plötzlich, ohne irgendeine bemerkbare Veranlassung, in das dichteste Dorngebüsch. Scheinbar ewig grollend und jeder Anwandlung eines heiteren Gedankens vollkommen unzugänglich, grimmig, böswillig und tückisch, trägt er den durch die ungeheuren Hörner teilweise verdeckten, breiten und massigen Kopf halb geneigt, wie stets zum Angriff bereit. Einmal erregt und in Wut gebracht, kennen diese Büffel kein Hindernis mehr, stürzen im unaufhaltsamen Sturme sinnlos in gerader Richtung dahin und überrennen, was ihnen in den Weg kommt, nicht allein Tiere, sondern auch Umzäunungen und Häuser. »Als es Nacht geworden war«, erzählt Schweinfurth, »und ich es mir eben bequem gemacht hatte, ereignete sich ein im Verlaufe meiner Reise wiederholt vorgekommener Zwischenfall. Ein Dröhnen erschütterte den Erdboden, als ob ein Erdbeben heranzöge, und das ganze ziemlich ausgedehnte Lager schien in Verwirrung zu geraten; denn von allen Seiten ertönten Geschrei und Flintenschüsse. Eine ungewöhnlich große Büffelherde war wieder einmal auf ihrem nächtlichen Wechsel mit einem Teil des Lagers zusammengestoßen und stürmte nun in wilder Flucht nach allen Richtungen durch die Gebüsche. Mehrere Hütten waren dabei umgestürzt und die im Schlafe überraschten Insassen einer nicht geringen Gefahr des Zertretenwerdens ausgesetzt.« Ohne eigentlich scheu zu sein, ergreifen die Tiere doch vor dem sich nähernden Menschen regelmäßig die Flucht und meiden, namentlich wenn öfter auf sie gejagt wurde, die Nähe ihres furchtbarsten Feindes so viel als möglich, stellen sich aber, in die Enge getrieben und gereizt, diesem ohne alles Bedenken zur Wehr und achten dann in blinder Wut weder der Lanze noch der sie schwer verletzenden Kugel. Geradezu furchtbar werden die von den Herden abgetriebenen alten Einsiedler. Diese scheuen sich nicht einmal, eine Jagdgesellschaft anzugreifen, wie aus nachstehender Erzählung Schweinfurths hervorgeht. »Der 14. Januar brachte den ersten Unglückstag, den ich selbst heraufbeschworen. In der Frühe war eine andere Barke zu uns gestoßen, und die Leute wollten sich zusammen vergnügen und haltmachen. Wir waren aber an einer für mich sehr langweiligen Stelle, und so zwang ich sie weiterzufahren, um an einer kleinen anziehenden Insel ans Land steigen zu können. Der Ausflug, den ich, von zweien meiner Leute begleitet, antrat, sollte für den einen der beiden verhängnisvoll werden. Mahammed Amin, so hieß dieser, wurde an meiner Seite von einem wilden Büffel überrannt, dem ich nicht das geringste Leid zuzufügen beabsichtigte, dem aber der Unglückliche im hohen Grase gar zu nahe gekommen war. Der Büffel hielt jedenfalls sein Mittagsschläfchen und geriet durch diese Störung in die äußerste Wut; aufspringen und den Störenfried in die Lüfte wirbeln, war für ihn das Werk eines Augenblicks. Da lag er nun, mein treuer Begleiter, über und über mit Blut bedeckt, vor ihm mit hoch erhobenem Schweife der Büffel, in drohender Haltung, bereit, sein Opfer zu zerstampfen. Zum Glück war indes seine Aufmerksamkeit durch die zwei andern Männer gefesselt, die sprachlos vor Staunen als Zeugen dastanden. Ich hatte kein Gewehr in der Hand, mein schöner Hinterlader hing vorläufig noch am linken Horn des Büffels; Mahammed hatte ihn getragen; mein anderer Begleiter, der meine Büchse trug, hatte gleich angelegt, aber der Hahn knackte vergebens, Mal auf Mal versagte das Gewehr. Man stelle sich vor, daß die Zeit nicht erlaubte, ihm zuzurufen: ›Die Sicherung ist vor‹; es galt den Augenblick. Da griff der Mann nach einem kleinen Handbeil, das ganz aus Eisen bestand, und schleuderte es unverzagt dem Büffel an den Kopf auf eine Entfernung von kaum zwanzig Schritten. Da war denn die Beute dem Feinde entrissen. Mit einem wilden Satze warf sich der Büffel seitwärts ins Röhricht, unter gewaltigem Rauschen der Halme dahinsausend, brüllend und den Boden erschütternd. Nach rechts und links sah man ihn unter Grunzen und Brüllen die gewaltigsten Sätze machen, und da wir in seinem Gefolge eine ganze Herde vermuteten, griffen wir zunächst zu den Gewehren und eilten einem nahen Baume zu; doch es wurde alles still, und unsere nächste Sorge wandte sich jetzt dem Unglücklichen zu. Mahammeds Kopf lag wie angenagelt am Boden, da seine Ohren von scharfen Schilfhalmen durchbohrt waren; aber eine flüchtige Untersuchung überzeugte uns sofort davon, daß die Verletzungen nicht tödlich sein konnten. Das Büffelhorn hatte gerade den Mund getroffen, und außer vier Zähnen im Oberkiefer und einem Knochensplitter hatte er keine weiteren Verluste zu beklagen, war auch in drei Wochen wiederhergestellt.« Derartige Zusammenstöße sind in allen Ländern Afrikas, in denen Kafferbüffel leben, etwas Gewöhnliches, und fast in jedem Dorfe findet man Leute, die einen ihrer Angehörigen durch Büffel verloren haben; denn in den meisten Fällen enden solche Begegnungen minder glücklich als die von Schweinfurth uns geschilderte.
Aus Vorstehendem läßt sich entnehmen, daß die Jagd auf Kafferbüffel unter allen Umständen ein gefährliches Unternehmen bleibt. Die Haut des Tieres ist stark genug, um allein schon einer Kugel bedeutenden Widerstand entgegenzusetzen, und wenn diese wirklich eingedrungen, bleibt sie in vielen Fällen auf den Knochen sitzen, wird von letzteren sogar, wie von der Decken erfuhr, förmlich zerschnitten oder zerteilt. Demgemäß stürzt der Büffel in den meisten Fällen nicht unter dem ersten Schuß zusammen und behält dann noch Zeit genug, seinem Angreifer entgegenzutreten. Alte Büffel gebärden sich, auch wenn sie tödlich verwundet wurden, als hätten sie nur einen leichten Streifschuß empfangen, laufen mit der Kugel in den edelsten Eingeweiden noch weit und verenden erst nach längerer Zeit. Aus diesem Grunde ist der Jäger stets gefährdet. »Ich kenne«, erzählt Drayson, »einen Kaffer, der an sich selbst des Büffels Kraft und List erfuhr und das Andenken an dieselben für sein Leben trug. Er jagte eines Tages im Walde und kam auf einen alten Einsiedler, den er verwundete. Der Bulle brach durch, aber der Kaffer, glaubend, daß er sein Wild tödlich verwundet hatte, folgte ihm auf seinem Wege, ohne irgendwelche Vorsichtsmaßregeln zu beobachten. Er hatte ungefähr hundert Schritte des Waldes durchschlüpft und durchkrochen und untersuchte eben sorgfältig die Fährte seines verwundeten Wildes; da hörte er plötzlich ein Geräusch dicht neben sich, und ehe er sich noch fortbewegen konnte, fühlte er sich fliegend in der Luft, infolge eines furchtbaren Stoßes, den ihm der Büffel gegeben hatte. Glücklicherweise fiel er auf die Zweige eng verschlungener Bäume eines Dickichts und wurde hierdurch gerettet; denn der Büffel wäre keineswegs mit seiner Arbeit zufriedengestellt gewesen, sondern würde ihm unzweifelhaft noch den Garaus gemacht haben. Nachdem er sich überzeugt hatte, daß sein Opfer unnahbar war, verließ er es und trollte in den Wald. Der Kaffer, der zwei oder drei Rippen gebrochen hatte, schleppte sich mühsam nach Hause und gab von diesem Tage an das Büffelschießen für immer auf. Wie es schien, hatte das lästige Geschöpf sich bloß zurückgezogen, um seinen Feind im Walde wieder zu erwarten und von neuem anzufallen.« Ähnliche Geschichten erzählen alle Reisenden, die mit diesem grimmigen Vieh zusammenkamen.
Der Nutzen des glücklich erlegten Kafferbüffels ist nicht unbedeutend. Die Haut wird geschätzt, und das Wildbret wetteifert, laut Schweinfurth, mit dem Fleische gemästeter Rinder an Güte des Geschmacks; es ist zwar derber und grobfaseriger, ungeachtet des Fettmangels aber sehr saftig und mundend, ganz im Gegensatz zum Fleisch der zahmen ägyptischen Art, die selbst dem Kamelfleisch noch nachsteht und auch bei den Eingeborenen keinen Wert hat.

Büffel ( Bos bubalus)
Nicht der Kafferbüffel, sondern der noch heutigestags in Indien lebende Wildbüffel ist der Stammvater der in den Hausstand übergegangenen und vollständig gezähmten Rinder seines Geschlechtes, die man schon in den Donautiefländern und in Italien, in viel beträchtlicherer Anzahl aber in Ägypten und Indien sieht. Der Büffel ( Bosbubalus) erreicht, einschließlich des 50 bis 60 Zentimeter langen Schwanzes, bis 2,8 Meter Gesamtlänge bei 1,4 Meter Schulterhöhe. Der Kopf ist kürzer und breiter als beim Rinde, die Stirn groß, der Gesichtsteil kurz, der Hals gedrungen und dick, nicht aber gewammt, der Leib etwas gestreckt, übrigens voll und gerundet, am Widerrist höckerig erhöht, längs des Rückens eingesenkt, der Schwanz ziemlich kurz; die kräftigen Beine sind verhältnismäßig niedrig und mit langen und breiten Hufen beschuht; das kleine Auge hat einen wilden und trotzigen Ausdruck; das seitlich und wagerecht gestellte Ohr ist lang und breit, außen kurz behaart, innen dagegen mit langen Haarbüscheln besetzt. Die langen und starken, bis gegen die Mitte stark quergerunzelten, nach der Spitze zu wie auf der Hinterseite aber vollkommen glatten Hörner haben einen unregelmäßig dreieckigen Querschnitt, stehen am Grunde nahe zusammen, wenden sich zuerst seitlich und abwärts, sodann nach rück- und aufwärts und krümmen sich mit den Enden nach oben, ein- und vorwärts. Hinterrücken, Kreuz, Brust und Bauch, Schenkel und der größte Teil der Beine sind fast völlig kahl und lassen deshalb mehr die Färbung der in der Regel dunkelschwarzgrauen Haut als die der blaugrauen, bald mehr ins Bräunliche oder Rotbraune ziehenden Haare zur Geltung kommen. Weiß gefärbte oder gefleckte Stücke kommen vor, sind jedoch selten. Die Kuh unterscheidet sich nur durch etwas geringere Größe von dem Stier, von andern Rindern aber dadurch, daß die vier Zitzen ihres Euters fast in einer Querreihe stehen.
Wie alle Arten seines Geschlechtes ein großer Wasserfreund, findet sich der Wildbüffel nur in sumpfigen Gegenden seines Wohngebietes, entweder in Flußniederungen oder in unmittelbarer Nähe kleiner, wenn auch bloß zeitweilig wasserhaltiger Seen, oder endlich in der Umgebung seichter Lagunen am Meeresgestade. »Hier«, so berichtet Haßkarl, »gefällt sich das Tier darin, bis zu dem Kopfe eingetaucht im Wasser zu liegen oder aber mit Schlamm sich zu umhüllen, um sich gegen die Angriffe der Kerbtiere zu schützen; hier schwelgt es in dem langen Seggengrase, das die Ränder der Gewässer begrünt. Wenn der Büffel weidet, sieht man oft eine mit Aufsuchen von Zecken und andern Schmarotzern eifrig beschäftigte Krähe auf seinem Rücken, der wegen der Nacktheit des Felles in der Sonne unangenehm schimmert. Bewegt sich das Tier, so legt es sein plumpes Haupt so weit zurück, daß die Nasenlöcher in eine wagerechte Linie mit den Augen und die gewaltigen Hörner auf die Schultern zu liegen kommen.« Seine Bewegungen sind zwar plump, aber kräftig und ausdauernd; namentlich im Schwimmen erweist es sich als Meister. Unter den Sinnen scheinen Geruch und Gehör obenan zu stehen, Gesicht und Gefühl dagegen wenig entwickelt und der Geschmack eben auch nicht besonders ausgebildet zu sein, da es sich mit dem schlechtesten Futter, das andere Rinder verschmähen, begnügt. Seine Stimme ist ein tief dröhnendes Gebrüll. An blinder Wut und rasendem Zorn steht es keinem andern Rinde nach; selbst in der Gefangenschaft verliert es diese Eigenschaften nicht ganz. William Rice erzählt, daß zuweilen erwachsene Büffelstiere vom Tiger angefallen werden, sich aber furchtbar wehren und nicht allzuselten dem Raubtier für alle Zeiten das Handwerk legen. Wenn ein Büffel überfallen wird, eilen ihm die andern zu Hilfe und jagen dann den Angreifer regelmäßig in die Flucht. Selbst die Hirten, die zahme Büffel hüten, durchziehen, auf einem ihrer Tiere reitend, ruhig das Dickicht. Rice sah einmal, daß die Büffel einer Herde, als sie das Blut eines angeschossenen Tigers rochen, sofort dessen Spur aufnahmen, diese mit rasender Wut verfolgten, die Gesträuche dabei umrissen, den Boden aufwühlten, schließlich in förmliche Raserei gerieten und zum großen Kummer des Hirten untereinander zu kämpfen begannen. Johnson erzählt, daß ein Tiger den hintersten Mann einer Büffelkarawane angriff. Ein Hirt, der Büffel in der Nähe hütete, eilte jenem Mann zu Hilfe und verwundete das Raubtier mit seinem Schwerte. Dieses ließ sofort seine erste Beute los und packte jetzt den Hirten; die Büffel aber stürzten, als sie ihren Herrn in Gefahr sahen, augenblicklich auf den Tiger los, warfen ihn sich einige Male gegenseitig mit den Hörnern zu und mißhandelten ihn bei diesem Spiel derart, daß er tot auf dem Platze blieb.
In denjenigen Gegenden Ceylons, wo die Singalesen Büffel zähmen und zum Reisbau verwenden, haben die Dörfler durch die wilden Büffel oft viel auszustehen, weil diese sich unter die weidenden Herden mischen und sie zum Ungehorsam verleiten, ja gar nicht selten sich an die Spitze einer zahmen Herde stellen und alle Anstrengungen der Besitzer, diese gegen Sonnenuntergang heimzutreiben, mit dem entschiedensten Erfolge vereiteln.
Wann und auf welchem Wege der zahme Büffel sich weiterverbreitet hat, wissen wir nicht, nehmen jedoch an, daß er wahrscheinlich im Gefolge der großen Kriegsheere oder wandernden Völker nach Persien kam, woselbst ihn die Begleiter Alexanders des Großen bereits antrafen. Später mögen ihn die Mohammedaner nach Ägypten und Syrien verpflanzt haben. Im Jahre 596 unserer Zeitrechnung, unter der Regierung Agilulfs, gelangte er, zu nicht geringem Erstaunen der Europäer, nach Italien. Anfangs scheint er sich sehr langsam verbreitet zu haben; denn der »heilige« Gilibald, der zu Anfang des achten Jahrhunderts Sizilien und Italien durchwanderte, kannte ihn noch nicht und staunte, als er ihn später am Jordan antraf. Gegenwärtig findet er sich außer in Hindostan durch ganz Afghanistan, Persien, Armenien, Syrien, Palästina bis zum Kaspischen und Schwarzen Meere hin, in der Türkei, Griechenland und in den Donautiefländern, in Italien und sehr häufig auch in Ägypten, nicht aber in Nubien.
Heiße, sumpfige oder wasserreiche Gegenden sagen ihm wie allen seinen Verwandten am meisten zu. Das Nildelta ist für ihn ein Paradies; in den gifthauchenden Pontinischen Sümpfen, in den Sumpfgegenden Calabriens, Apuliens, in der Maremma von Toscana, in den unteren Donauländern befindet er sich sehr wohl. In den italienischen Sümpfen ist er der einzige seiner Familie, weil alle übrigen der ungesunden Gegend erliegen, in Unterägypten überall gemein, nächst der Ziege eigentlich das einzige Haustier, von dem man Milch und Butter gewinnt. Jedes Dorf im Delta und auch die meisten Ortschaften Oberägyptens haben mitten zwischen den Hütten eine große Lache, die einzig und allein dazu dient, den Büffeln einen bequemen Badeplatz zu gewähren. Weit öfter als auf der Weide sieht man diese im Wasser, wenn sie es haben können, so tief versenkt, daß nur der Kopf und ein kleiner Teil des Rückens über den Wasserspiegel hervorragen. Zur Zeit der Nilüberschwemmung beginnt für sie eine Zeit des Genusses. Schwimmend treiben sie sich jetzt auf den überfluteten Feldern umher, fressen das Gras an den Rainen und das harte Riedgras der noch unbebauten Flächen ab, vereinigen sich zu großen Herden, spielen im Wasser miteinander und kommen nur dann nach Hause, wenn die Kühe von der Milch gedrückt werden und gemolken sein wollen. Sehr hübsch sieht es aus, wenn eine Büffelherde über den fast durchschnittlich einen Kilometer breiten Strom setzt. Mehrere der Hirten, meistens Kinder von acht bis zwölf Jahren, sitzen auf dem Rücken und lassen sich sorglos von den treuen Tieren über die furchtbare Tiefe und durch die hochgehenden Wogen schleppen. Man kann die Meisterschaft im Schwimmen, die die Büffel zeigen, nicht genug bewundern. Sie gebärden sich, als ob das Wasser ihr eigentliches Element wäre, und bringen mindestens sechs bis acht Stunden täglich in ihm zu und besorgen hier, behaglich ausgestreckt, das Wiederkäuen. Jeder Büffel wird unruhig und sogar bösartig, wenn er geraume Zeit das Wasser entbehren mußte. Auf dem festen Lande erscheint er entschieden unbeholfener als im Wasser. Sein Gang ist schwerfällig und der Lauf, obgleich ziemlich fördernd, doch nur ein mühseliges Sichfortbewegen.
Wenn man zahmen Büffeln zum erstenmal begegnet, erschrickt man förmlich vor ihnen. Der Ausdruck ihres Gesichts deutet auf unbändigen Trotz und auf versteckte Wildheit; in den Augen scheint man Tücke und Niederträchtigkeit lesen zu dürfen. Bald überzeugt man sich, daß man sich täuschen würde, wenn man den Büffel nach dem Aussehen beurteilen wollte. In Ägypten wenigstens ist er ein überaus gutmütiges Tier, das jeder Bauer, ohne etwas zu befürchten, der Leitung des schwächsten Kindes anvertraut. Mehr als zwanzigmal habe ich gesehen, wie kleine Mädchen, die auf mit Klee gefüllten, dem Tiere auf den Sattel geschnallten Netzballen saßen, Büffel vermittels eines Stockes nach Hause trieben, unter Umständen Gräben und Nilarme übersetzend; aber niemals habe ich gehört, daß ein Büffel Unglück angerichtet hätte. Unerschütterliche Gleichgültigkeit gegen alles, was nicht Wasser oder Fressen anlangt, vielleicht mit noch alleiniger Ausnahme des Kalbes, das eine Büffelkuh vor kurzem geboren hat, kennzeichnen das geistige Wesen des Tieres.
Der Nutzen des Büffels ist verhältnismäßig größer als der unseres Rindes, weil er so gut als gar keine Pflege beansprucht und sich mit Pflanzen sättigt, die von allen übrigen Haustieren verschmäht werden. Für Sumpfgegenden erweist er sich als ein ausgezeichnet nützliches Geschöpf auch zum Bestellen der Feldarbeiten; denn was ihm an Verstand abgeht, ersetzt er durch seine gewaltige Kraft. In Ceylon benutzt man ihn ebensowohl als Last- wie als Zugtier, im ersteren Falle, um schwere Ladungen Salz von der Küste nach dem Innern zu bringen, in letzterem Falle, um Karren auf Wegen fortzuschieben, für die die schwache Kraft anderer Rinder nicht ausreichen würde. Das Fleisch des Büffels wird seiner Zähigkeit und des ihm anhaftenden Moschusgeruches halber wenigstens von Europäern nicht gegessen, das der Büffelkälber dagegen soll gut sein und das Fett an Wohlgeschmack und Zartheit dem Schweinefett fast gleichstehen. Die dicke, starke Haut liefert treffliches Leder; aus den Hörnern endlich fertigt man dauerhafte Gerätschaften verschiedener Art.