
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Wiederkäuer oder Zweihufer sind weit verschiedene und doch auch wieder innig verwandte, gehörnte oder ungehörnte, schön gestaltete oder plump gebaute, anmutige oder häßliche Säuger von außerordentlich schwankender Größe. Sehr übereinstimmend ist der Bau der Zähne und des Gerippes. Mittelhand und Mittelfuß bestehen aus je einem stark verlängerten Knochen, der sich ursprünglich aus zweien zusammensetzte. Bei allen Wiederkäuern ohne Ausnahme sind nur zwei Zehen, die dritte und vierte, vollkommen entwickelt. Der Magen besteht aus vier, mindestens drei verschiedenen Teilen: dem Pansen oder Wanst, dem Netzmagen oder der Haube, Mütze, dem Faltenblättermagen oder Buche, Kalender, Psalter und Löser und dem Lab- oder Fett- und Käsemagen. Ersterer steht mit der Speiseröhre, letzterer mit dem Darmschlauche in Verbindung. Der Pansen, der durch ein Muskelband in zwei Abteilungen getrennt wird, nimmt das grob zerkaute Futter auf und stößt es in kleinen Mengen in den Netzmagen hinüber, dessen gitterartige Falten es vorverdauen und in Kügelchen formen, die sodann durch Aufstoßen wieder in den Mund hinaufgebracht, hier mittels der Mahlzähne verarbeitet, gründlich eingespeichelt und sodann zwischen zwei, eine Rinne bildenden Falten der Speiseröhre in den Blättermagen hinabgesandt und von diesem endlich dem Labmagen zugeführt werden. Den Kamelen und Zwergmoschustieren fehlt die dritte Magenabteilung. Der Blinddarm ist sehr kurz, eine Gallenblase ist bei den Hirschen nicht vorhanden.
Nicht unwichtig zur Gruppierung und Bestimmung der Arten sind die Gehörne und Geweihe, die die Wiederkäuer tragen. Man unterscheidet zunächst zwei größere Gruppen: die scheidenhörnigen und die geweihtragenden Zweihufer. Unter Scheidenhörnern oder Hörnern schlechthin versteht man diejenigen Gebilde aus Hornmasse, die, auf einer knochigen Unterlage der sich fortsetzenden Stirnbeine ruhend, eigentlich nichts anderes sind als eine hornige Schale, und die niemals erneuert werden, sondern bei fortgesetztem Wachstume nur an Größe zunehmen; Geweihe dagegen heißen Hörner, die auf verhältnismäßig kurzen Erhöhungen der Stirnbeine sitzen, durchaus aus fester Knochenmasse bestehen und mit zunehmendem Alter bis zu einem gewissen Grade sich mehr und mehr verästeln. Die Geweihe werden alljährlich abgeworfen und nach Verlauf von einigen Monaten durch neue ersetzt. In der Regel tragen sie bloß die männlichen Tiere, während die Gehörne meist beiden Geschlechtern gemeinsam zu sein pflegen. Die Hufe ändern in ihrer Gestalt und Größe vielfach ab.
Die Wiederkäuer bewohnen mit Ausnahme Neuhollands alle Erdteile. Eine regelmäßige Verbreitung der Hauptgruppen läßt sich nicht verkennen. Am weitesten verbreitet sind die Stiere und Hirsche, auf den engsten Kreis beschränkt die Giraffen und Moschustiere; Antilopen und Hirsche gehören allen in Betracht kommenden Erdteilen an; die Böcke, Schafe und Stiere fehlen in Südamerika; die Moschustiere sind nur in Asien und auf den südasiatischen Inseln heimisch.
Fast alle Wiederkäuer sind scheue, flüchtige, friedliche, leiblich sehr wohl ausgerüstete, geistig beschränkte Tiere. Viele leben in Herden, alle in Gesellschaften. Die einen bewohnen das Gebirge, die anderen die Ebenen; keine einzige Art haust eigentlich im Wasser, wohl aber ziehen einige Sumpfniederungen den trockenen Ebenen vor. Ihre Nahrung besteht ausschließlich in Pflanzen. Sie lieben Gras, Kräuter, Blätter, junge Triebe und Wurzeln, einzelne auch Körner, andere Flechten. Das Weibchen wirft gewöhnlich nur ein Junges, seltener deren zwei und bloß ausnahmsweise drei. Die meisten Wiederkäuer nützen, gezähmt wie im wilden Zustande, mehr als sie schaden, wenn auch einzelne Arten da, wo die Bewirtschaftung des Bodens eine gewisse Höhe erreicht hat, nicht mehr geduldet werden können. Von den wildlebenden wie von den zahmen werden Fleisch und Fell, Horn und Haar aufs vielseitigste verwendet: die Wiederkäuer liefern, wie bekannt, den größten Teil unserer Kleidung. Im gezähmten Zustande zeigen sie sich zwar nicht klug, aber folgsam, geduldig und genügsam und werden deshalb dem Menschen geradezu unentbehrlich. Bloß von den drei Familien der Moschustiere, Giraffen und Antilopen ist bis jetzt noch keine Art als Haustier verwendet worden; von den übrigen hat sich der Mensch das eine oder das andere Mitglied zu seinem Diener und Sklaven gemacht. Alle wildlebenden bilden einen Hauptgegenstand der Jagd und sind deshalb wahrhaft königlicher Ehren teilhaftig.
Die Wiederkäuer erschienen in der Tertiärzeit auf unserer Erde, und zwar so ziemlich in den noch gegenwärtig lebenden Formen, obwohl in beschränkterer Verbreitung.
Die Familie der Schwielensohler oder Kamele ( Tylopoda) kennzeichnet sich durch die schwieligen Sohlen, den Mangel der Hörner und Afterklauen, die gespaltenen Oberlippen und den Zahnbau. Hinsichtlich des letzteren weichen die Kamele von allen übrigen Wiederkäuern ab. Die Hufe sind sehr klein und eigentlich bloß Zehennägel an den schwieligen Sohlen. Der Magen ist nur dreiteilig, weil der Blättermagen wegen seiner geringen Größe zu dem Labmagen gerechnet werden kann. Die Kamele sind sehr große Wiederkäuer mit langem Halse, gestrecktem Kopfe, in den Weichen eingezogenem Rumpfe und zottigem, fast wolligem Felle. Die Halswirbel sind ansehnlich lang und fast ohne Dornen, die Rippen breit, die Knochen der Beine sehr kräftig.
Nordafrika, Mittelasien und Südwestamerika bilden die ursprüngliche Heimat dieser Tiere. Die wenigen Arten sind in der Alten Welt gänzlich, in der Neuen teilweise zu Haustieren geworden. Diese bewohnen das Hochgebirge bis zu viertausend Meter über dem Meeresspiegel, jene befinden sich nur in den heißen, trockenen Ebenen wohl. Gräser und Kräuter, Baumblätter, Zweige, Disteln und Dornen dienen ihnen zur Nahrung. Sie sind genügsam in hohem Grade und können lange hungern und dürsten. Ihr Gang ist ein Paß und ihr Lauf, obwohl er trefflich fördert, schwankend und scheinbar in hohem Grade unbeholfen. Alle leben in Herden oder lieben wenigstens Geselligkeit. Ihr geistiges Wesen steht auf ziemlich tiefer Stufe. Das Weibchen wirft nur ein einziges Junges und pflegt dieses mit vieler Liebe.
Das Dromedar oder einhöckerige Kamel ( Camelus dromedarius), der Djemmel der Araber, ein gewaltiger Wiederkäuer, erreicht im Durchschnitt 2 bis 2,3 Meter Höhe und von der Schnauzenspitze bis zum Schwanzende 3 bis 3,3 Meter Länge. Obgleich nicht so reich an Rassen wie das Pferd, zeigt doch auch das Kamel sehr erhebliche Abänderungen. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Kamele der Wüsten und Steppen schlanke, hochgewachsene, langbeinige Geschöpfe, die der fruchtbaren Länder dagegen, namentlich die in Nordafrika einheimischen, plumpe, schwere Tiere sind. Zwischen einem » Bischarin« oder einer Rasse, die von den Bischarin- Nomaden gezüchtet wird, und dem ägyptischen Lastkamel macht sich ein ebenso großer Unterschied bemerklich wie zwischen einem arabischen Rosse und einem Karrengaul. Das erstgenannte Kamel ist das vorzüglichste Reittier, das letztere das kräftigste Lasttier unter allen.
Der Araber unterscheidet mehr als zwanzig verschiedenartige Rassen der Wüstenschiffe; denn es gibt ebensogut eine Wissenschaft der Kamele wie eine solche der Pferde, und man spricht auch beim Dromedar von edlen und unedlen Tieren. Der ungehörnte Kopf ist ziemlich kurz, die Schnauze aber gestreckt und aufgetrieben, der stark erhabene Scheitel gerundet und gewölbt; die Augen, deren länglichrunder Stern wagerecht liegt, sind groß und von erschrecklich blödem Ausdruck, die Ohren sehr klein, aber beweglich, und stehen weit hinten am Schädel. Die Oberlippe überhängt die Unterlippe, die ihrerseits aber auch nach unten fällt, gleichsam, als ob die Masse den Muskeln zu schwer wäre und von ihnen nicht bewältigt werden könnte. Wenn man ein Kamel von vorn ansieht, zeigen sich die Lippen fast immer geöffnet und die Nasenlöcher seitlich zusammengezogen; bei schneller Bewegung des Tieres schwingen die häßlichen Lefzen beständig auf und nieder, als ob sie sich nicht in ihrer Lage erhalten könnten. Am Hinterhaupt befinden sich eigentümliche Absonderungsdrüsen, die mittels zweier Ausführungsgänge unmittelbar auf der Hautoberfläche münden und beständig, zur Zeit der Brunst aber ganz besonders, eine widerwärtig riechende, schwarze Flüssigkeit ausströmen lassen. Der Hals ist lang, seitlich zusammengedrückt, in der Mitte am dicksten, der Leib bauchig und eigentlich nach allen Seiten hin zugerundet. Die Rückenlinie steigt von dem Halse an in Bogen nach oben, bis gegen den Widerrist hin, und erhebt sich dort sehr steil zu der Spitze des einen Höckers, von wo aus sie nach hinten wieder jäh abfällt. Der Höcker steht aufrecht, wechselt aber im Laufe des Jahres bedeutend in seiner Größe. Je reichlichere Nahrung das Kamel hat, um so mehr erhebt sich sein Höcker; je dürftiger ihm die Kost zugemessen wird, um so mehr fällt er zusammen. Zur Regenzeit, die saftige Weide bringt, wächst der während der dürren Hungermonate kaum sichtbare Höcker erstaunlich rasch an, und sein Gewicht kann dann bis auf 15 Kilogramm steigen, während es im Gegenteil auch auf zwei oder drei Kilogramm herabsinken kann. Die Beine sind schlecht gestellt, und namentlich die Hinterschenkel treten fast ganz aus dem Leibe heraus, vermehren dadurch also das wüste Aussehen des Tieres. Die ziemlich langen und breiten Zehen werden von der Körperhaut bis gegen die Spitze hin umhüllt und scheinen gleichsam an ihr angeheftet zu sein; ihre Trennung ist auf der obern Seite des breiten, schwieligen Fußes durch eine tiefe Furche angedeutet; unten buchtet sich der Fuß wie ein Kissen ein und rundet sich nur vorn und hinten. Die Fährte, die das Tier hinterläßt, ist ein länglichrunder Abdruck mit zwei Einschnürungen und zwei von den Zehen herrührenden, spitzigen Ausbuchtungen nach vorn. Der dünn bequastete Schwanz reicht bis zum Fersengelenk hinab. Das Haar ist weich, wollig und auf dem Scheitel, im Nacken, unter der Kehle, an den Schultern und auf dem Höcker gegen das übrige auffallend verlängert, am Schwanzende aber verdickt. Eigentümlich sind noch die Schwielen, die sich auf der Brust, dem Ellenbogen und dem Handgelenk, an Knien und Fersengelenken finden und mit dem Alter an Größe und Härte zunehmen. Die Brustschwiele tritt als eigentümlicher Höcker weit über die andere Haut hervor und bildet eine förmliche Unterlage, auf der der Körper ruht, wenn das Tier sich niederlegt.
Die Färbung des Tieres ist eine sehr unbeständige. Am häufigsten findet man allerdings lichtsandfarbene; doch gibt es auch graue, braune und ganz schwarze Kamele oder solche mit blassen oder lichteren Füßen, niemals aber gescheckte. Die Araber halten alle schwarzen Kamele für schlechtere, wertlosere Tiere als die lichteren und pflegen sie deshalb schon in früher Jugend zu schlachten. Jüngere Tiere unterscheiden sich von den älteren durch das weiche Wollhaar, das sie am ganzen Körper deckt, sowie auch die anmutige rundere Gestalt, denn das kantig Eckige der letzteren tritt erst mit dem zunehmenden Alter deutlich hervor.
Gegenwärtig findet man das Dromedar bloß in der Gefangenschaft, und zwar in allen nördlich des zwölften Breitengrades gelegenen Ländern Afrikas und des äußersten Westens von Asien. Sein Verbreitungskreis fällt fast mit dem Wohnkreise des arabischen Volksstammes zusammen. Von Arabien oder Nordostafrika aus verbreitete es sich nach Westen hin über Syrien und Kleinasien und über Persien bis nach der Bucharei, wo das zweihöckerige Kamel auftritt; von Ostafrika aus reicht es durch die ganze Sahara hindurch bis an das Atlantische Meer und von dem Mittelmeer an bis zu dem erwähnten Breitengrade.
Das Kamel ist ein eigentliches Wüstentier und befindet sich bloß in den trockensten und heißesten Landstrichen wohl, während es im angebauten und feuchten Lande sein eigentliches Wesen verliert. In Ägypten hat man, wahrscheinlich durch das reichlichere Futter, nach und nach sehr große und schwere Kamele erzüchtet; aber diese haben mehrere der schätzbarsten Eigenschaften: Leichtigkeit ihres Ganges, Ausdauer und Enthaltsamkeit, verloren und werden deshalb von den Arabern der Wüste gering geachtet. In den Tropenländern Afrikas aber, wo die Pflanzenwelt das Gepräge der südamerikanischen und südasiatischen Wendekreisländer annimmt, kommt das Kamel nicht mehr fort. Vielfache Versuche, um mit ihm nach dem eigentlichen Herzen von Afrika vorzudringen, sind gescheitert. Bis zum zwölften Grade befindet sich das Tier wohl und gedeiht vortrefflich; weiter südlich gegen den Gleicher hin wird es schwächlich, und wenn man es noch ein paar Grade südlicher führt, erliegt es bei dem reichlichsten Futter, ohne eigentlich erklärliche Ursache. Zwar behaupten die Araber, daß eine Fliege, die sie außerordentlich fürchten, die Schuld an dem Zugrundegehen ihrer Kamele trage; es beruht diese Meinung jedoch entschieden auf einem Irrtum; das Kamel kann die feuchtheißen Landstriche nicht ertragen.
Im ganzen Norden und Osten Afrikas wird das Kamel gegenwärtig in unzählbarer Menge gezüchtet. Manche Araberstämme besitzen Tausende und Hunderttausende. Im Sudan lernte ich Häuptlinge kennen, die allein fünfhundert bis zweitausend Stück Kamele zu eigen hatten; in den Steppen Kordofans sah ich Herden von mindestens anderthalbtausend Stück auf der Weide. Auch im Glücklichen und Steinigen Arabien werden viele Kamele gezogen, und namentlich das Land Nedjed gilt als das reichste an diesen Tieren. Es versorgt Syrien, den Hedjas und Jemen mit ihnen, liefert auch jährlich viele Tausende allein nach Anatolien. Die Anzahl der Kamele, die jährlich an den Wüstenstraßen zugrunde gehen, läßt sich nicht berechnen; wie groß sie aber ist, kann man am besten ersehen, wenn man selbst durch die Wüste reist. In der nubischen Wüste sowohl wie in der Bahiuda fand ich am Ein- und Ausgange der vorhin genannten Straßen auf viele Meilen hin ein Kamelgerippe so dicht neben dem andern, daß die Straße durch die weißgebleichten Knochen vollkommen bezeichnet wurde. Die Wüste ist nicht bloß die Heimat und der Geburtsort, sondern auch die Sterbestätte und das Grab des Kamels; die wenigen, die geschlachtet werden, kommen gegen die, die auf ihren Berufswegen verenden, kaum in Betracht.
Das Kamel nimmt seine Nahrung einzig und allein aus dem Pflanzenreiche und ist dabei durchaus nicht wählerisch. Man darf wohl behaupten, daß gerade seine Genügsamkeit seine größte Tugend ist; das schlechteste Futter genügt ihm. Wenn es die dürrsten und trockensten Wüstenpflanzen, scharfschneidiges Riedgras und halbverdorrte Äste hat, kann es wochenlang aushalten. Unter Umständen ist ihm ein alter Korb oder eine Matte, aus den zerschlissenen Blattriefen der Datteln geflochten, ein willkommenes Gericht. In Ostsudan muß man die Hütten der Eingebornen, die aus einem Gerippe von schwachen Stangen bestehen und dann mit Steppengras bekleidet werden, vor den Kamelen durch eine dichte Umzäunung von Dornen schützen: die Tiere würden sonst das ganze Haus bis auf seine Grundfesten auffressen. Wahrhaft wunderbar ist es, daß selbst die ärgsten Dornen und Stacheln das harte Maul des Kamels nicht verwunden. Mehr als hundertmal habe ich gesehen, daß Kamele Mimosenzweige, an denen Dornen an Dornen saßen, ohne weiteres hinunterwürgten. Nun muß man wissen, daß diese Mimosennadeln außerordentlich scharf sind und selbst das Sohlenleder durchdringen; dann versteht man erst, was dies sagen will. Mehrere Male haben wir uns bei der Jagd empfindlich verletzt, wenn wir auf solche Dornen traten; ich selbst habe mir einen von ihnen durch die Sohle des Schuhs, die große Zehe und auch noch durch das Oberleder des Schuhs gestochen: – und solche Dornen zermalmt das Tier mit der größten Seelenruhe! Wenn die Karawane abends rastet und die Kamele freigelassen werden, damit sie sich ihre Nahrung suchen, laufen sie von Baum zu Baum und fressen hier alle Äste ab, die sie erreichen können. Sie besitzen ein merkwürdiges Geschick, mit ihren Lippen die Zweige abzubrechen; dann aber würgen sie dieselben hinunter, ganz unbekümmert, in welcher Richtung die Dornen vom Zweige abstehen. Können sie einmal saftige Nahrung haben, so ist das ihnen sehr genehm; in den Durrha- und Dohhenfeldern hausen sie oft in abscheulicher Weise und verwüsten dort ganze Stellen; auch kleine Bohnen, Erbsen, Wicken verzehren sie sehr gern, und Körner aller Art erscheinen ihnen als wahre Leckerbissen. Auf den Wüstenreisen, wo es notwendig ist, daß die Last soviel als möglich verringert wird, nimmt jeder Araber bloß etwas Durrha oder auch Gerste für sein Kamel mit sich und füttert dem Tier davon allabendlich ein paar Hände voll, gewöhnlich gleich aus seinem Umschlagetuch bezüglich aus seinem Schoße. In den Städten gibt man ihnen Puffbohnen; in den Dörfern erhalten sie oft nichts anderes als verdorrtes Riedgras oder Durrhastroh. Es scheint aber, als ob das Laub verschiedener Bäume und anderer Gesträuche ihre liebste Nahrung wäre; wenigstens bemerkt man, daß die Kamele wie die Giraffen immer nach den Bäumen hin ihre Schritte lenken.
Bei saftiger Pflanzennahrung kann das Kamel wochenlang das Wasser entbehren, falls es nicht beladen und besonders angestrengt wird und sich nach Belieben seine Pflanzen aussuchen kann. Die Nomaden der Bahiuda bekümmern sich zuweilen einen ganzen Monat nicht um ihre Kamele, sondern lassen sie nach eigenem Gutdünken ihre Weide sich wählen, und oft kommt es vor, daß diese Tiere während der ganzen Zeit nur mit den taufrischen Blättern und dem Pflanzensaft ihren Durst löschen müssen. Anders verhält sich die Sache während der Zeit der Dürre. Man hat zwar vielfach behauptet, daß Kamele auch dann noch vierzehn bis zwanzig Tage Wasser entbehren könnten; allein solche Erzählungen sind Fabeln, die jeder Eingeweihte belächeln muß. Als ich im Dezember 1847 und Januar 1848 die Bahiudawüste durchzog, bekamen unsere Kamele während der achttägigen Reise nur ein einziges Mal Wasser; aber um diese Zeit gab es noch viel Grünes, und die Tiere hielten vortrefflich aus. Als ich aber zwei Jahre später im Juni beinahe denselben Weg wanderte, waren die Kamele, die neben dem Durst auch noch Hunger zu ertragen hatten, bereits am sechsten und siebenten Tage der Reise, obwohl wir sie am vierten getränkt hatten, so matt, daß sie unter uns zusammenbrachen und nur mit größter Mühe bis an den Nil gebracht werden konnten, – nur erst, nachdem wir andere entlastet und auf ihnen unsern Ritt fortgesetzt hatten. In der Gluthitze der afrikanischen dürren Zeit muß ein Kamel auf Reisen, bei genügendem Futter, hinreichendes Wasser und mindestens alle vier Tage volle dreißig bis vierzig Stunden Ruhe haben, wenn es aushalten soll. Aber nur in seltenen Fällen lassen es die Araber so lange dürsten, gewöhnlich nur dann, wenn einer der Brunnen am Wege, auf dessen Wasser man hoffte, inzwischen versiegt ist. In früheren Zeiten glaubte man, diese Genügsamkeit des Kamels, was das Trinken anbelangt, aus seiner eigentümlichen Bildung des Magens erklären zu können. Man meinte, daß die großen Zellen in den beiden ersten Magenabteilungen als Wasserbehälter angesehen werden dürften, und in manchen älteren Reisebeschreibungen, noch mehr in den traurigen Werken der Stubenhocker und Büchermacher, ist zu lesen, daß die Reisenden in der Wüste im allerletzten Notfalle in dem Magen ihres Kamels noch Wasservorräte finden könnten. Ich habe, obgleich ich von Hause aus an solchen Geschichten zweifelte, mit aller Absicht alte, in der Wüste ergraute Kamelführer befragt; kein einziger wußte von dieser Geschichte etwas, kein einziger hatte jemals solch eine ungeheure Lüge auch nur erzählen hören. Und später habe ich mich beim Schlachten der Kamele, die noch am Tage vorher getränkt worden waren, selbst überzeugt, daß es ganz unmöglich ist, Wasser zu trinken, das tagelang mit den im Magen aufgehäuften Nahrungsstoffen und dem Magensafte vermengt war. Das ganze Kamel hat einen widerwärtigen Geruch; solcher Magenbrei aber muß selbst einem Halbverdursteten unüberwindlichen Ekel erregen. Der Gestank eines frisch aufgebrochenen Kamelmagens ist geradezu unerträglich.
Wahrhaft lustig sieht es aus, wenn ermüdete, hungrige und ermattete Kamele in die Nähe eines Brunnens oder Flusses gelangen. So dumm die häßlichen Geschöpfe auch sind, solche Orte, wo sie früher schon getränkt wurden, vergessen sie so leicht nicht. Sie heben die Köpfe hoch empor, schnüffeln mit halb zugekniffenen Augen in die Luft, legen die Ohren zurück und beginnen nun plötzlich zu laufen, daß man sich fest im Sattel halten muß, um nicht herausgeschleudert zu werden. Kommen sie dann zum Brunnen, so drängen sie sich an das Wasser, und eines sucht durch abscheuliches Gebrüll das andere zu vertreiben. Am Ausgange der Bahiudawüste kamen drei unserer Kamele an einen Bewässerungsgraben, der von einem Schöpfrade gespeist wurde und immerhin ein lebhaftes Bächlein Wasser nach dem Felde sandte; dort stellten sie sich nebeneinander auf und tranken drei Minuten lang ohne Unterbrechung und buchstäblich alles Wasser auf, das in dem Graben dahinfloß. Ihr Leib schwoll augenscheinlich an, und beim Weiterreiten verursachte das im Magen angesammelte Wasser ein Geräusch, wie man es vernimmt, wenn man eine halbgefüllte Tonne ausschwenkt. Während der Regenzeit, wenn viel Wasser vorhanden, lösen die Araber Ostsudans salzhaltige Erde oder reines Kochsalz in kleinen Tränkteichen auf und treiben dahin ihre Kamele. Das Salz vermehrt die Freßlust der edlen Wüstenschiffe außerordentlich, und diese mästen sich nun bald einen recht hübschen Höcker an.
Wenn man ein ruhig stehendes Kamel betrachtet, wird man schwerlich denken, daß dieses Tier fast an Schnelligkeit mit einem Pferd wetteifern kann. Und doch ist dies der Fall. Die in der Wüste und Steppe geborenen Kamele sind vortreffliche Läufer und imstande, ohne Unterbrechung Entfernungen zurückzulegen wie kein anderes Haustier. Alle Kamele gehen einen scheinbar sehr schwerfälligen Paß, sie mögen nun im Schritt oder im Trab laufen; allein dieser Paßgang ist bei abgerichteten Reitkamelen wahrhaft leicht und zierlich. Der gewöhnliche Gang ist ein sonderbares Dahinstelzen, und das Kamel bewegt dazu bei jedem Schritt noch in so auffallender Weise den Kopf vor- und rückwärts, daß man sich kaum einen häßlichern Anblick denken kann als solche Mißgestalt in ihrer langsamen Bewegung. Bringt man einen Läufer wirklich in Trab, und gehört er zu den guten Rassen, die ohne Unterbrechung in der angefangenen Schrittweise dahinziehen, so erscheint das schwere Geschöpf leicht und schön. Schon schwerbeladene Lastkamele legen bei gewöhnlichem Schritt in fünf Stunden Zeit sechs Wegstunden oder drei geographische Meilen zurück und gehen in dieser Weise von früh morgens fünf Uhr an bis abends sieben Uhr ohne Unterbrechung fort; gute Reitkamele aber können bequem den dreifachen Raum durchlaufen. Man bezeichnet in Afrika die leichten und abgerichteten Reitkamele mit dem Namen » Hedjin« oder Pilgerkamel und nennt den auf ihnen Reitenden Hedjan, versteht aber zunächst bloß die eigentlichen Botenreiter unter diesem Worte. Solche Botenreiter nun legen in kurzer Zeit fast unglaublich große Strecken zurück. Berühmt sind die Kamele, die in der Nähe von Esneh in Oberägypten gezüchtet werden, und noch berühmter die wirklich unübertrefflichen der Bischarin in Ostsudan. Auf einem solchen Hedjin ritt Mohammed Aali flüchtend in einem Zuge von Kairo nach Alexandrien und brauchte hierzu nur zwölf Stunden. Da nun die Entfernung zwischen beiden Städten mindestens fünfundzwanzig Meilen beträgt, kann man auf die Schnelligkeit und Ausdauer dieser Tiere einen Schluß ziehen. In Ägypten und Nubien nennt man Kamele, die zehn Mahhadas oder Haltestellen auf dem Karawanenwege in einem Tage durchlaufen, geradezu »Zehner« (Aaschari) und schätzt sie mit Recht sehr hoch; denn eine Mahhada liegt in der Regel zwischen anderthalb und zwei, auch zweieinhalb Meilen von der andern. Ein solcher Aaschari lief von Esneh in Oberägypten nach Geneh und fast wieder dahin zurück, war aber so angestrengt worden, daß er drei Meilen vor seinem Zielpunkte zusammenbrach. Er hatte in neun Stunden fünfundzwanzig Meilen durchwandert und dabei zweimal über den Nil gesetzt, also mindestens noch eine Stunde an Zeit verloren. Einen solchen Ritt hält kein Pferd aus, es mag so gut sein wie es will. Im Anfange übertrifft die Schnelligkeit eines trabenden Pferdes die des Kamels, wenn es im gleichen Schritt geht; sehr bald aber bleibt das erstere weit zurück, und das Kamel trabt nach wie vor seinen Gang weiter. Läßt man ein Reitkamel in der Mittagszeit ruhen, reitet es sonst aber vom frühen Morgen an bis zur späten Nacht, so kann man das Tier sechzehn Stunden lang Trab laufen lassen und dann bequem eine Entfernung von zwanzig Meilen durchreiten. Ein gutes Kamel, das ordentlich gefüttert und getränkt wird, hält solche Anstrengungen, ohne Rasttag dazwischen, drei und selbst vier Tage aus. Man ist demnach imstande, mit einem einzigen Reittiere in der kurzen Zeit von vier Tagen achtzig geographische Meilen zu durchreisen.
Dreierlei verlangt der Araber von einem guten Kamele: es muß einen weichen Rücken haben, darf die Peitsche nicht verlangen und soll beim Auf- und Niederlegen nicht schreien. Bloß derjenige, der viel mit Kamelen umgegangen ist, weiß, was dies zu bedeuten hat.
Ein gewöhnliches Lastkamel ist das fürchterlichste aller Reittiere. Bei der Paßbewegung wird der Reiter in absonderlichen Bogen, einer in Bewegung gesetzten chinesischen Pagodenfigur vergleichbar, auf- und nieder-, hin- und hergeschleudert. Sobald das Kamel in Trab fällt, ist es anders. Bei der bestehenden Wechselbewegung wird das seitliche Hin- und Herschaukeln aufgehoben, und wenn sich der Reiter geschickt im Sattel zurücklegt, spürt er die immer noch heftigen Stöße eben auch nicht mehr, als wenn er zu Pferd sitzt.
In Gebirgsgegenden läßt sich das Kamel nur in sehr beschränktem Maß gebrauchen, weil ihm das Klettern höchst beschwerlich fällt. Namentlich bergab kann es, weil es ziemlich stark überbaut ist, nur mit äußerster Vorsicht gehen. Doch sieht man auf der Weide die Kamele immerhin einigermaßen klettern, freilich so tölpelhaft wie möglich. Noch ungeschickter benimmt sich das Tier im Wasser. Schon wenn es in dasselbe getrieben wird, um zu trinken, gebärdet es sich wie unsinnig; viel schlimmer aber wird die Sache, wenn es über einen großen Strom setzen soll. Die Nilanwohner sind oft genötigt, ihre Kamele von einem Ufer auf das andere zu schaffen, und tun dies in einer nach unsern Begriffen wirklich haarsträubenden Weise. Das Kamel kann nicht schwimmen, muß aber gleichwohl schwimmend über den Strom setzen, weil die Überfahrtsbarken nicht nach Art unserer Fähren eingerichtet, sondern gewöhnliche Boote sind, in welche das ungeschickte Geschöpf nicht wohl gebracht werden kann. Deshalb verfährt man, um ein Kamel über das Wasser zu schaffen, folgendermaßen: Ein Araber bindet eine Schlinge um den Kopf und Hals, doch so, daß dieselbe nicht würgt, und zieht an dieser das Tier in den Strom hinab; zwei oder drei andere helfen mit der Peitsche nach. Das Tier möchte brüllen nach Herzenslust, aber die Schlinge läßt es dazu nicht kommen; es möchte entfliehen, allein der Strick hält es, und wenn es nicht gutwillig folgt, schnürt der Halfter die Schnauze noch recht fest zusammen; es muß also wohl oder übel in das Wasser. Sobald es den Grund verliert, öffnen sich die häßlichen Nüstern, treten die Augen aus den Höhlen hervor, werden die Ohren krampfhaft auf- und niederbewegt. Einer, der weiter hinten im Boote sitzt, packt es am Schwanze, ein anderer hebt mit der Schlinge den Kopf über das Wasser, so daß es kaum Atem schöpfen kann: und dahin geht die Fahrt unter Strampeln und Stampfen des geängstigten Tieres. Wenn es am andern Ufer ankommt, rennt es gewöhnlich davon, und erst, nachdem es sich vollständig überzeugt hat, daß es wieder festen Grund unter den Füßen besitzt, erhält es nach und nach seine Ruhe wieder.
Die Stimme des Kamels läßt sich nicht beschreiben. Gurgeln und Stöhnen, Knurren, Brummen und Brüllen wechseln in der sonderbarsten Weise miteinander ab. Unter den Sinnen dürfte das Gehör am besten ausgebildet sein; das Gesicht steht jenem Sinn entschieden nach, und der Geruch ist sicherlich schlecht. Das Gefühl dagegen scheint fein zu sein, und Geschmack zeigt es wenigstens manchmal. Im ganzen muß man das Kamel als ein sehr stumpfsinniges Geschöpf betrachten. Nicht viel günstiger fällt eine Beurteilung der geistigen Eigenschaften aus. Um ein Kamel würdigen zu können, muß man es unter Umständen betrachten, unter denen es die geistigen Eigenschaften auch zu offenbaren vermag, muß man etwa eines sich auswählen, das das Schwerste ertragen, mit anderen Worten, arbeiten soll. Versetzen wir uns im Geiste in das Einbruchsdorf einer Wüstenstraße!
Die zur Fortschaffung des Gepäcks bestimmten Kamele sind seit gestern angekommen und fressen mit der unschuldigsten Miene die Wandung einer Strohhütte auf, deren Besitzer eben abwesend ist und es versäumte, sein Haus durch Dornen zu schützen. Die Treiber sind mit dem Umschnüren und Abwiegen des Gepäckes beschäftigt und zanken sich dabei, scheinbar mit solcher Wut, daß man glauben muß, im nächsten Augenblicke einen Mord begehen zu sehen. Einige Kamele unterstützen in Erwartung des Kommenden das Gebrüll mit ihrem eigenen; bei den übrigen, die noch nicht mitbrüllen, bedeutet dies bloß so viel, wie: »Unsere Zeit ist noch nicht gekommen, aber sie kommt!« Ja, sie kommt! Die Sonne zeigt die Zeit des Nachmittagsgebets, die Zeit jedes Beginnes nach arabischen Begriffen, an. Nach allen Seiten hin stürmen die braunen Männer, um ihre häuserfressenden oder sonstwie unheilstiftenden Kamele einzufangen; bald darauf sieht man sie mit ihnen zurückkehren. Jedes einzelne Kamel wird zwischen die bereits gerichteten Stücke seiner Ladung geführt und mit einem unbeschreiblichen Gurgellaute gebeten oder durch einige, die Bitte unterstützende Peitschenhiebe aufgefordert, sich niederzulegen. Mit äußerstem Widerstreben gehorcht das ahnungsvolle Geschöpf, dem eine Reihe schwerer Tage in grellen Farben vor der Seele steht. Es brüllt zuerst mit Aufbietung seiner Lunge in markerschütternder Weise und weigert sich verständlich und bestimmt, seinen Nacken der Bürde zu bieten. Selbst der mildeste Beurteiler würde sich vergeblich bemühen, jetzt auch nur einen Schimmer von Sanftmut in seinem wutblitzenden Auge zu lesen. Es fügt sich ins Unvermeidliche, nicht aber mit Ergebung und Entsagung, nicht mit der einem Dulder wohl anstehenden Seelenruhe und Geistesgröße, sondern mit allen Zeichen der im höchsten Grade gestörten Gemütlichkeit, mit Augenverdrehungen, Zähnefletschen, mit Stoßen, Schlagen, Beißen, kurz, mit beispiellosem Ingrimme. Alle nur denkbaren oder richtiger undenkbaren Untöne orgelt es fugenartig ab, ohne auf Takt und Tonfall die geringste Rücksicht zu nehmen. Endlich scheint die Lunge erschöpft zu sein. Aber nein: es werden bloß andere Stimmen gezogen und in greulicher Folge etwas kläglichere Weisen angestimmt. Aber das Herz der Kameltreiber ist härter als ein Stein, der Peiniger taub für die wehmütigen Kundgebungen der zartbesaiteten Seele des tief und innig fühlenden Tieres. Nicht einmal eine seinen Unmut ausdrückende Bewegung wird ihm gestattet. Einer der Treiber stellt sich auf die zusammengelegten Beine des Lammes und faßt mit starker Hand die Nase, um an dieser empfindlichen Stelle gelegentlich einen nach Erfordernis stärkeren oder gelinderen Druck ausüben zu können. Allerdings behauptet der Mann, daß er seine Glieder vor den Bissen des Tieres schützen müsse; er versichert, daß ein wütendes Kamel das scheußlichste aller Scheusale sei; allein meine Gerechtigkeitsliebe verlangt, daß ich den Standpunkt des Kamels würdige.
Welche Schändlichkeit! Das edle Tier kann sich kaum rühren und soll belastet werden mit der schwersten Bürde, die außer dem Elefanten überhaupt ein sterbliches Wesen zu tragen vermag, soll tagelang die seiner unwürdige Last schleppen, über solche Erniedrigung bricht es in Erbarmen beanspruchende Klagen aus, und der Unmensch schließt beide Nasenlöcher und entzieht ihm den zu solchen Klagen doch unentbehrlichen Atem! Selbst ein Engel würde bei solch einer schnöden Behandlung zum Teufel werden; aber ein Kamel hat nie daran gedacht, irgendwelche Ansprüche auf die unerläßlichen Eigenschaften eines Engels zu erheben. Wen mag es wundernehmen, daß es seine namenlose Entrüstung durch anhaltendes kräftiges Schütteln des Kopfes kundgibt; wer wird es ihm verargen, daß es zu beißen, mit den Beinen zu stoßen, aufzuspringen, die Last abzuwerfen, durchzugehen versucht und dann von neuem zu brüllen beginnt, daß man das Trommelfell vor dem Zerspringen besonders schützen möchte? Und gleichwohl schimpfen und fluchen die Araber noch über solche Ausbrüche gerechten Zornes! Sie, die sonst alle Tiere menschlich behandeln, rufen ihm jetzt Verwünschungen zu, stoßen es mit Füßen, prügeln es mit der Peitsche. Den inständigsten Bitten, den herzerschütterndsten Klagen, der unsäglichsten Wut setzen sie kalte Mißachtung und höchst empfindliche Schmähungen entgegen. Während der eine das Kamel an der Nase packt, legt ihm der andere bereits den Sattel auf den Rücken; ehe es noch halb ausgeklagt hat, liegt auf dem Sattel die schwere Last. Jetzt läßt der vorderste die Nase los, der hinterste handhabt die Peitsche wieder, das niedergebeugte Tier soll sich erheben. Noch einmal sucht es seinen Zorn in einen einzigen Schrei zusammenzufassen, noch einmal brüllt es beim Aufspringen wutschnaubend auf, dann schweigt es den ganzen übrigen Tag, wahrscheinlich im Gefühle seiner eigenen Größe und Erhabenheit. Es erachtet es für zu kleinlich, den tiefen Schmerz seiner Seele über die ihm angetane Entwürdigung noch durch äußere Zeichen dem Menschen kundzugeben, und geht von nun an bis zum Abend »in stiller Billigung und ohne Schmerzensseufzer seine Stelzenschritte fort«. Aber beim Niederlegen, beim Entladen der Last scheint seine Brust noch einmal frei aufzuatmen; denn dann läßt es nochmals seinen Ingrimm los.
Ich glaube im vorstehenden den Standpunkt des Kamels gewahrt und somit meine Gerechtigkeitsliebe bewiesen zu haben. Vom Standpunkte des Menschen sieht sich die Sache freilich anders an. Es läßt sich nicht verkennen, daß das Kamel wahrhaft überraschende Fähigkeiten besitzt, einen Menschen ohne Unterlaß und in unglaublicher Weise zu ärgern. Ihm gegenüber ist ein Ochse ein achtungswertes Geschöpf, ein Maultier, das sämtliche Untugenden aller Bastarde in sich vereinigt, ein gesittetes, ein Schaf ein kluges, ein Esel ein liebenswürdiges Tier. Dummheit und Bosheit sind gewöhnlich Gemeingut; wenn aber zu ihnen noch Feigheit, Störrigkeit, Murrköpfigkeit, Widerwille gegen alles Vernünftige, Gehässigkeit oder Gleichgültigkeit gegen den Pfleger und Wohltäter und noch hundert andere Untugenden kommen, die ein Wesen sämtlich besitzt und mit vollendeter Fertigkeit auszuüben versteht, kann der Mensch, der mit solchem Vieh zu tun hat, schließlich rasend werden. Dies begreift man, nachdem man selbst vom Kamel abgeworfen, mit Füßen getreten, gebissen, in der Steppe verlassen und verhöhnt worden ist, nachdem einen das Tier tage- und wochenlang stündlich mit bewunderungswerter Beharrlichkeit und Ausdauer geärgert, nachdem man Besserungs- und Zuchtmittel erschöpft hat. Daß das Kamel in einer Weise ausdünstet, die den Bocksgestank als Wohlgeruch erscheinen läßt, daß es das Ohr durch sein Gebrüll ebenso martert wie die Nase durch seinen Gestank oder das Auge durch den gezwungenen Anblick seines unsäglich dumm aussehenden Kopfes auf dem langen Straußenhalse, gehört nicht hierher; daß es aber mit Bewußtsein dem Willen seines Herrn jederzeit entgegenhandelt, das ist es, was es in meinen Augen so tief stellt. Ich habe auf allen meinen Reisen in Afrika unter den Tausenden von Kamelen, die ich beobachten konnte, nur ein einziges gesehen, das eine gewisse Anhänglichkeit an seinen Herrn zeigte.
Die einzige Eigenschaft, in der das Kamel groß ist, dürfte seine Freßgier sein; in ihr gehen alle geistigen Regungen unter. Sein Verstand ist ungemein gering. Es zeigt, ungereizt, weder Liebe noch Haß, sondern bloß Gleichgültigkeit gegen alles, mit Ausnahme des Futters und seines Jungen. Gereizt wird es, sobald es sich anstrengen soll; hilft ihm seine Wut nichts, dann fügt es sich mit derselben Gleichgültigkeit in die Arbeit wie in alles übrige. In seiner Wut wird es boshaft und gefährlich. Wahrhaft abscheulich ist seine grenzenlose Feigheit. Das Gebrüll eines Löwen zersprengt augenblicklich die Karawane; jedes Kamel wirft sofort seine Last ab und stürzt davon. Das Heulen einer Hyäne beunruhigt es außerordentlich; ein Affe, ein Hund, eine Eidechse sind ihm entsetzliche Geschöpfe. Ich kenne kein anderes Tier, mit dem es in Freundschaft lebt. Der Esel scheint sich ziemlich gut mit ihm zu vertragen; das Roß dürfte in ihm das widerwärtigste aller Tiere erblicken. Seinerseits scheint das Kamel die übrigen Geschöpfe mit demselben Mißmute anzusehen, mit dem es den Menschen betrachtet.
Das Kamel steht an Adel hinter sämtlichen übrigen Haustieren zurück; es besitzt keine einzige wirklich großartige Eigenschaft des Geistes; es versteht die Kunst, den Menschen rasend zu machen. Und deshalb hat auch die Bezeichnung Kamel, die unsere Hochschüler anwenden, einen tiefen Sinn; denn wenn man mit diesem Titel einen Menschen bezeichnen will, der die hervorragendsten geistigen Eigenschaften eines Ochsen, Esels, Schafes und Maultieres in sich vereinigt, kann man kein besseres Sinnbild wählen.
Abschreckend wird das Kamel zur Brunstzeit. Diese fällt im Norden in die Monate Januar bis März und währt acht bis zehn Wochen. Um diese Zeit wird der Kamelhengst zu einem unerträglichen Geschöpfe. Er lärmt, brüllt, beißt, stößt und schlägt nach seinen Gefährten und seinem Herrn, wird unruhig und oft so wütend, daß man ihm einen Maulkorb anlegen muß, um Unglücksfälle zu verhüten. Einer meiner Kameltreiber war von einem brünstigen Kamele verstümmelt worden. Das wütende Tier hatte ihn, während er das Aufladen besorgte, am rechten Arm gepackt und das Ellenbogengelenk mit einem einzigen Bisse zersplittert. Der Mann blieb sein Leben lang ein Krüppel. Es sind Beispiele bekannt, daß Kamele Leute durch Bisse getötet haben.
Die Unruhe des Tieres steigert sich im Verlaufe der Brunst. Es verliert die Freßlust, knirscht mit den Zähnen und treibt, sobald es ein anderes Kamel sieht, eine große, ekelhafte Hautblase, den Brüllsack, aus dem Halse heraus und kollert, gurgelt, knurrt, brüllt und stöhnt dabei in der widerwärtigsten Weise. Der Brüllsack ist ein nur dem erwachsenen Kamele eigentümliches Organ und wird als zweites vorderes Gaumensegel angesehen. Bei dem jungen Hengst ist die Blase noch nicht so weit entwickelt, daß sie aus dem Maul hervortritt; bei dem alten erreicht sie eine Länge von 30 bis 35 Zentimeter und kann, wenn sie aufgeblasen wird, die Größe eines Menschenkopfes erlangen. Oft bemerkt man auf beiden Seiten des Maules Blasen; gewöhnlich aber tritt bloß eine auf einer Seite hervor. Beim Austreiben wirft das Tier den Kopf vorwärts und bläst Luft in die eigentümliche Hülle, auf der dann die mannigfach verzweigten Gefäße, die sie durchflechten, grell hervortreten. Beim Einatmen entleert sich die Blase wieder und erscheint nunmehr als ein rundlicher Hautsack, der sogleich in das Maul zurückgeschlürft, bald darauf aber von neuem wieder hervorgestoßen wird. Ein Männchen genügt für sechs bis acht Weibchen. Nach elf bis dreizehn Monaten wirft die Kamelstute ein einziges Junges. Dieses ist allerdings von dem ersten Tage seines Lebens an eine kleine Mißgestalt, hat aber, wie alle jungen Tiere, etwas Drolliges und Lustiges. Es wird mit offenen Augen geboren und ist mit ziemlich langem, dichtem, weichem, wolligem Haar bedeckt. Der Höcker ist sehr klein, und die Schwielen sind kaum noch angedeutet. An Größe übertrifft es ein frisch geworfenes Füllen bedeutend; es ist etwa einen Meter hoch, nach Verlauf einer Woche aber schon beträchtlich mehr. Bei weiterem Wachstume nimmt die Wolle sehr an Dichtigkeit und Länge zu, und das junge Kamel hat dann wirklich auffallende Ähnlichkeit mit dem Paco, seinem amerikanischen Verwandten. Sobald es trocken geworden ist, folgt es seiner Mutter, die mit Liebe sich seiner annimmt. Wenn zwei Stuten mit ihren Füllen zusammenkommen, spielen die jungen Geschöpfe in liebenswürdiger Weise, und die Alten brummen Beifall. Über ein Jahr lang säugt das Kamel sein Junges, und während dieser Zeit zeigt es einen mehr als gewöhnlichen Mut, indem es unter Umständen seinen Sprößling nach Kräften verteidigt. Nur die eigene Mutter bekümmert sich um ihr Kind, niemals dagegen ein Kamel um ein fremdes Füllen.
Mit Beginn des zweiten Jahres entwöhnen die Araber die Kamelfüllen. Hier und da erreicht man dies, indem man dem jungen Kamele einen an beiden Seiten zugespitzten Pflock durch die Nasenscheidewand sticht. Der Pflock kitzelt oder verletzt die Kamelstute am Euter, und sie schlägt deshalb selbst ihr Junges ab. Wenige Tage, nachdem eine Stute geworfen hat, wird sie wieder zum Arbeiten benutzt; das Junge trabt ledig hinterdrein. Auch die entwöhnten jungen Kamele werden mit auf die Reise genommen, damit sie frühzeitig weite Wege ertragen lernen. Je nach ihrer größeren oder geringeren Schönheit richtet man sie vom dritten Jahre an zum Reiten oder zum Lastentragen ab. Da, wo es viele gibt, beladet man sie erst mit Beginn des fünften Lebensjahres, während man es in kamelärmeren Gegenden bereits mit Ablauf des dritten Jahres zur Arbeit zwingt. Die Reittiere werden von Knaben abgerichtet. Dem jungen Kamele wird ein leichter Sattel aufgelegt und eine Schlinge um die Schnauze geschnürt. Der junge Reiter setzt sich in den Sattel und treibt es zum Traben an; sobald es in Galopp verfällt, bändigt er es, legt es nieder und prügelt es; sobald es Schritt gehen will, ermuntert er es durch Zurufen und durch Fuchteln mit der Peitsche, bis es sich gewöhnt, im Trabe zu laufen, wenn es den Reiter auf sich hat. Mit Ende des vierten Jahres wird es zu größeren Reisen benutzt.
Bei Wüstenreisen wird ein Lastkamel mit höchstens hundertundfünfzig Kilogramm beladen. Dem ägyptischen Kamele dagegen wurden zuweilen so außerordentliche Lasten auferlegt, daß es die Regierung für nötig befand, ein Gesetz zu erlassen, das die Belastung auf höchstens sieben arabische Zentner oder zweihundertundfünfzig Kilogramm festsetzte. Während meiner Anwesenheit in Ägypten erläuterte mein Freund Latif-Pascha den Ernst dieses Gesetzes einem Fellah oder ägyptischen Bauer in erzväterlicher Weise. Eines Tages sitzt Latif zu Gericht. Da tritt ein riesiges, mit einer gewaltigen Last befrachtetes Kamel durch die breiten, hohen Pforten in den Gerichtssaal. »Was will das Tier?« fragt der Pascha; »seht, es ist unverantwortlich beladen! Wiegt seine Last!« Man tut es und findet, daß das Kamel tausend arabische Pfund getragen hat. Nach kurzer Zeit erscheint der Eigentümer des Tieres und sieht zu seinem höchsten Erstaunen, mit welcher Arbeit die Amtsfrone beschäftigt sind. »Weißt du nicht«, donnert der Pascha ihn an, »daß du deinem Kamele nur siebenhundert und nicht tausend Pfund aufbürden darfst? Gewiß, die Hälfte dieser Summe, in Hieben dir zugemessen, würde dich drücken; wie viel mehr drückt das Doppelte dein Tier! Aber beim Barte des Propheten und bei Allah, dem Erhabenen, der Menschen und Tiere geschaffen hat zu Brüdern, ich will dir beweisen, was es heißt, ein Tier zu quälen. Ergreift ihn und zählt ihm fünfhundert Streiche auf!« Dem Befehle wird gehorcht. Der Fellah erhält die ihm bestimmte Strafe. »Jetzt entferne dich«, sagt der Richter, »und wenn dein Kamel dich noch einmal verklagt, dann erwarte Schlimmeres!« »Der Herr erhalte dich, Herrlichkeit, und segne deine Gerechtigkeit«, erwiderte der Fellah und geht.
Das Kamel ist mancherlei Krankheiten unterworfen; aber nur unter niederen Breiten treten diese Krankheiten seuchenartig auf. Im Sudan soll, wie ich schon andeutete, eine Fliege schreckliche Verheerungen anrichten; wahrscheinlich ist es das Klima, das die Tiere umbringt. Weit mehr Kamele aber, als durch alle Krankheiten zugrunde gehen, sterben auf ihren Berufswegen, und nur die wenigsten werden geschlachtet. Der Tod des Tieres hat immer etwas Dichterisches, er mag nun auf dem fahlen Sandbette der Wüste oder vor der Schlachtbank erfolgen. In den Wüsten ist der Samum der schlimmste Feind der Kamele. Sie wittern diesen gifthauchenden Wind schon Stunden vor seinem Ausbruche. Die furchtbare Schwüle, die dem Sandsturme vorausgeht, wissen auch sie zu deuten: sie werden ängstlich, scheu, wild und störrisch und traben, trotz sichtlicher Ermüdung, so schnell als möglich vorwärts. Sobald der Sturm wirklich losbricht, sind sie durch kein Zureden zu bewegen weiterzugehen, sondern lagern sich, das Hinterteil gegen die Windrichtung gekehrt, den Kopf lang vorgestreckt und auf den Boden gelegt, in einer gewissen Ordnung nieder. Unzweifelhaft leiden sie verhältnismäßig ebensoviel wie der Mensch, der nach jedem Samum sich an allen Gliedern wie zerschlagen fühlt und eine Mattigkeit verspürt, wie sie sonst wohl nur anhaltende Krankheiten hervorrufen. Wenn nun, nachdem der Glutwind vorüber ist, die Tiere wieder belastet werden und von neuem ihren beschwerlichen Weg antreten, beweisen sie deutlich genug, daß ihnen jeder Schritt zur Qual wird. Ihr Durst hat sich sicherlich ungemein vermehrt, und ihre Mattigkeit nimmt mehr und mehr überhand. Da geschieht es denn oft, daß eines plötzlich niederstürzt und durch kein Zureden, auch nicht einmal durch die Peitsche, zu vermögen ist, sich wieder zu erheben. Trauernden Herzens nimmt ihm der Araber die Last ab und überläßt, vielleicht mit einer Träne im Auge, das beklagenswerte Geschöpf seinem Schicksale; denn auch ihn hetzt das Gespenst des Durstes rastlos vorwärts. Am nächsten Morgen ist das Kamel eine Leiche, und ehe noch der Mittag herankommt, ziehen bereits hoch über ihm die Geier ihre Kreise, und einer nach dem andern senkt sich hernieder; ein scheußliches, gieriges Schlachten beginnt auf dem Leichnam, und am Abende findet der hungrig umherschleichende Schakal oder die gierige Hyäne kaum noch so viel vor, um sich zu sättigen. Wahrhaft ergreifend ist es, wenn der Metzger dem Kamel befiehlt niederzuknien, um den Todesstreich zu erleiden. Nichts ahnend gehorcht es dem Zurufe seines Herrn, kauert sich auf den Boden nieder und empfängt plötzlich mit einem haarscharfen Messer den tödlichen Stoß in die Kehle. Wie wenn der Samum über die Wüste hereinbricht, legt es seinen Kopf vor sich nieder auf die Erde, zuckt noch ein paarmal auf und ist eine Leiche. Dann wird es umgewälzt, längs des Bauches aufgeschnitten, ausgeworfen und abgehäutet und das Fell gleich als Mulde benutzt. Das Fleisch ist hart und zähe; das Kilogramm kostet deshalb im Sudan kaum zehn Pfennige unseres Geldes. Aus dem Felle verfertigt man allerlei Gerätschaften, obwohl das Leder des Tieres nicht besonders haltbar ist.
Die Milch des lebenden Tieres ist so dick und fettig, daß ihr Genuß widersteht, findet daher wenig Verwendung. Dagegen wird die Losung vielfach gebraucht. Auf Wüstenreisen, wo das Brennholz mangelt, sammelt man am Morgen die kleinen, rundlichen, walnußgroßen Brocken der harten, festen und trockenen Losung, die für den nächsten Abend als Brennstoff dienen soll, und auch in dem holzarmen Ägypten wird der Dünger des Kamels, wie der der Rinder, Pferde und Esel, sorgfältig aufgelesen, zu einem Teige geknetet, in rundliche Kuchen geformt, in der Sonne getrocknet und dann als Brennstoff aufgespeichert.
Fast dieselbe Rolle, die das Dromedar in den oben angegebenen Gegenden spielt, ist in Ost- und Mittelasien dem Trampeltier ( Camelus bactrianus) beschieden. Zwei Rückenhöcker, von denen der eine auf dem Widerrist, der andere vor der Kreuzgegend sich erhebt, unterscheiden es vom Dromedar. Seine Gestalt ist schwerfällig und plump, die Körpermasse größer, die Behaarung weit reichlicher als bei dem Dromedar, die Färbung regelmäßig dunkler, gewöhnlich tiefbraun, im Sommer rötlich.
Das Trampeltier wird in allen Steppenländern Mittelasiens gezüchtet und dient insbesondere dem Warenhandel zwischen China und Südsibirien oder Turkestan. Hier tritt allmählich das Dromedar an seine Stelle und verdrängt es da, wo die Steppe Wüstengepräge annimmt, gänzlich. Die Kirgisen achten es hoch, betreiben seine Zucht jedoch lässiger als die aller übrigen Haustiere der Steppe und benutzen es ungleich weniger als das Pferd; den Mongolen Ostasiens dagegen ist es ebenso wichtig wie den Arabern das Dromedar. Man kennt nicht viele, aber merklich verschiedene Rassen, dessen Eigentümlichkeiten streng sich erhalten. Die besten Trampeltiere der Mongolei werden in der Provinz Chalcha gezüchtet.
Obgleich man sagen darf, daß das Trampeltier in seinem Wesen und in seinen Eigenschaften mit dem Dromedar übereinstimmt, kann man doch nicht verkennen, daß es durchgängig frömmer und gutartiger ist als dieses. Leicht läßt es sich einfangen, willig gehorcht es dem Befehle seines Herrn, ohne sonderliche Umstände und nur unter leisem Murren, nicht aber unter ohrzerreißendem Brüllen, legt es sich nieder, und aus freiem Antriebe hält es an, wenn die Last auf seinem Rücken sich verrückt hat. Ein Kamel in des Wortes vielsagendster Bedeutung bleibt es aber doch. Abgesehen von seiner Genügsamkeit, Stärke, Ausdauer und Beharrlichkeit läßt sich wenig zu seinem Ruhme sagen. Seine geistigen Begabungen stehen auf ebenso tiefer Stufe wie die des Dromedars; es ist ebenso dumm, gleichgültig und feig wie dieses. Manchmal versetzt es, laut Przewalski, ein vor seinen Füßen aufspringender Hase in Todesangst. Entsetzt schnellt es zur Seite und stürmt wie sinnlos davon, und alle übrigen folgen, ohne erkannt zu haben, weshalb. Ein großer schwarzer Stein am Wege, ein Haufen Knochen, ein herabgefallener Sattel erschrecken es dermaßen, daß es alle Besinnung verliert und eine ganze Karawane in Verwirrung setzt. Wenn es von einem Wolfe angefallen wird, denkt es nicht an Gegenwehr. Es vermöchte solchen Feind mit einem einzigen Schlage zu fällen; aber es spuckt ihn nur an und schreit aus voller Kehle. Selbst der Kolkrabe schädigt das geistlose Geschöpf, fliegt ihm auf den Rücken und reißt mit dem Schnabel halb vernarbte, vom Satteldruck herrührende Wunden auf oder zerfleischt ihm den Höcker, ohne daß das Trampeltier etwas anderes zu tun wüßte, als zu spucken und zu schreien. Eine Ausnahme von der Regel bilden nur die brünstigen Männchen, die so wütend werden können, daß man sie, um sich vor ihnen zu schützen, mit Ketten fesseln muß. Sobald die Brunstzeit vorüber ist, wird auch der Hengst wieder fromm oder gleichgültig und stumpf wie zuvor.
Auf üppiger Weide gedeiht auch das Trampeltier nicht, verlangt im Gegenteil Steppenpflanzen, die andern Tieren kaum genügen, beispielsweise Wermut, Lauch, Schößlinge von allerlei Gestrüpp und dergleichen, insbesondere aber Salzpflanzen, wenn es zu Kräften kommen oder bei Kräften sich erhalten soll. Salz gehört zu seinen unabweisbaren Bedürfnissen; es trinkt das salzhaltige Wasser der Steppengegenden mit Wohlbehagen und nimmt das an ihren Rändern ausgeblühte Salz gierig und in Mengen auf. Muß es an Salz Mangel leiden, so magert es auch auf der ihm sonst am besten zusagenden Weide ab. Vom Hunger gepeinigt, frißt es, was es erlangen kann, laut Przewalski sogar Lederriemen, Filzdecken, Knochen, Tierbälge, Fleisch, Fische und andere Gegenstände solcher Art.
Die Brunstzeit fällt in die Monate Februar bis April. Dreizehn Monate später bringt die Stute unter Mithilfe ihres Herrn ein Junges zur Welt. Dieses ist so unbehilflich, daß es in den ersten Tagen seines Lebens an das Euter seiner Mutter gelegt werden muß, folgt letzterer aber bald auf allen Wegen nach und wird von ihr sehr geliebt. Einige Wochen nach seiner Geburt beginnt es zu fressen und wird nunmehr zeitweilig von seiner Mutter getrennt, weil man diese ebensogut melkt wie jedes andere Herdentier der Steppe. Im zweiten Jahre wird dem Füllen die Nase durchstochen und der Zaumpflock in die so gebildete Öffnung gesteckt; denn von jetzt ab beginnt seine Abrichtung. Im dritten Jahre seines Alters wird es zu kurzen Ritten, im vierten zum Tragen leichter Lasten benutzt; im fünften Jahre gilt es als erwachsen und arbeitsfähig. Bei guter Behandlung kann es bis zum fünfundzwanzigsten Jahre Dienste leisten.
Um Satteldruck zu vermeiden, legt man auf beide Höcker mehrere Filzdecken und erst auf diese den meist gepolsterten Lastsattel, an dem die Frachtstücke festgeschnürt werden. Ein kräftiges Trampeltier legt mit 220, ein sehr starkes mit noch 50 Kilogramm mehr täglich 30 bis 40 Kilometer, mit der Hälfte der Last aber im Trabe fast das doppelte zurück, vermag im Sommer zwei oder drei, im Winter fünf bis acht Tage zu dursten, halb so lange ohne Beschwerde zu hungern und beansprucht bei längeren Reisen nur alle sechs bis acht Tage eine Rast von vierundzwanzig Stunden Dauer. In der Mongolei belastet man es im Sommer bloß ausnahmsweise, in den von Kirgisen durchzogenen Steppen höchstens, um eine Jurte von einem Lagerplatze zum andern zu schleppen; hier wie dort aber mutet man ihm im Winter schwere Dienstleistungen zu. Auf der Straße von Peking nach Kiachta gönnt man ihm erst nach Ablauf der Reise, die einen vollen Monat währt, zehn bis vierzehn Tage Rast und läßt es mit solchen Unterbrechungen während des ganzen Winters, also sechs bis sieben Monate, arbeiten; in den westlichen Steppen strengt man es niemals in gleicher Weise an. Mit Beginn der Härung, vom März an, schont man es hier wie dort so viel wie möglich; nachdem der größte Teil des Haares ausgefallen oder ausgekämmt worden ist, bekleidet man es mit Filzdecken, läßt es auch stets auf solchen ruhen, damit es sich nicht erkälte. Während dieser Zeit, in der östlichen Mongolei sogar während des ganzen Sommers, gewährt man ihm die größtmögliche Freiheit, gestattet ihm, fast nach Belieben in der Steppe zu weiden, und treibt nur die Stuten, die täglich fünfmal gemolken werden, allabendlich in der Nähe der Jurten zusammen. Dieses ungebundene Leben behagt dem Tiere ungemein. Rasch ersetzt es auf der nach eigenem Ermessen gewählten Weide die verbrauchten Kräfte wieder, und förmlich stolz schreitet es, wenn das neu gewachsene Haar seine im Frühjahr fast nackte Haut wieder deckt, durch die Steppe.
Ersprießliche Behandlung des Trampeltieres erfordert genaue Kenntnis seines Wesens, reiche Erfahrung und unverwüstliche Geduld. Kirgisen und Mongolen betrachten es als das hinfälligste ihrer Haustiere und schweben beständig in Sorge um sein Wohlbefinden. So wenig es die eisigen Schneestürme des Winters scheut, so kräftig es allen Beschwerden längerer Reisen während dieser Jahreszeit widersteht, so leicht erliegt es ungünstigen Einflüssen im Sommer. Die Hitze des Tages wie die Kühle der Nacht kann ihm dann verderblich werden. Während des Winters entsattelt man es auch bei längeren Reisen niemals, sondern läßt es, sobald man am Lagerplatze angelangt ist und ihm die Last abgenommen hat, mit Sattel und Zeug zur Weide gehen; im Sommer dagegen muß es auch bei leichterem Dienste stets entsattelt werden, um Druckwunden zu vermeiden; das Entsatteln darf jedoch nicht geschehen, bevor es nicht vollständig abgekühlt ist, weil es sonst unfehlbar sich erkälten und zugrunde gehen würde. Überlastung erträgt es nicht. Aus Liebe zur Geselligkeit geht es im Reisezuge, solange seine Kraft ausdauert; legt es sich jedoch aus Ermattung nieder, so vermag keine Gewalt es wieder zum Aufstehen zu bringen. Man pflegt es in solchen Fällen dem Besitzer der nächsten Jurte anzuvertrauen und von ihm später, nachdem es durch längere Ruhe zu Kräften gekommen, wieder abzuholen.
Aller Mängel ungeachtet muß auch das Trampeltier als eines der nützlichsten Geschöpfe angesehen werden, die der Mensch seinem Dienste unterwarf. Es leistet viel nach jeder Richtung hin und kann durch kein anderes Haustier ersetzt werden. Man nutzt Haar und Milch, Fell und Fleisch, spannt es an den Wagen und verwendet es als Lasttier. Seinem Nacken bürdet man Lasten auf, die man auf vier Pferde verteilen müßte; mit ihm durchzieht man die wasserlosen wüstenhaften Steppen, in denen Pferde ihre Dienste versagen würden; auf ihm erklimmt man Gebirge bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe, in denen nur der Jack noch aushält. Das Pferd ist der Genosse, das Trampeltier der Diener des Steppenbewohners.
*
Auch die Kamele beweisen uns, daß die amerikanischen Tiere, die als Vertreter altweltlicher Arten oder Sippen auftreten, gegen diese betrachtet, nur Zwerge sind. Die Lamas ( Auchenia) sind Kamele; aber sie stehen hinter den altweltlichen Arten in ihrer Größe ebensoweit zurück wie der Puma hinter dem Löwen oder wie der größte Dickhäuter Amerikas hinter den Riesen der Alten Welt. Freilich kommt hinzu, daß die amerikanischen Kamele Bewohner der Gebirge sind und schon deshalb nicht dieselbe Größe erreichen können wie ihre altweltlichen Verwandten, die der Ebene angehören. Die Lamas unterscheiden sich von den eigentlichen Kamelen aber nicht bloß durch ihre geringere Größe, sondern auch durch den verhältnismäßig großen, stark zurückgedrückten Kopf mit spitzer Schnauze, ihre großen Ohren und Augen, den dünnen, schmächtigen Hals, die hohen und schlanken Beine mit mehr gespaltenen Zehen und nur geringen Schwielen und durch das lange, wollige Haarkleid. Dem Rumpfe fehlt der Höcker; die Weichen sind noch mehr eingeschnürt als bei den echten Kamelen. Die lange, schmale Zunge ist mit harten, hornigen Wärzchen bedeckt; der Pansen wird in zwei Hälften geteilt, der Psalter fehlt gänzlich; der Darmschlauch erreicht ungefähr die sechzehnfache Länge des Leibes.
Die Lamas zerfallen in vier verschiedene Formen, die schon seit alten Zeiten die Namen Huanaco oder Guanaco, Lama, Paco oder Alpaca und Vicuña führen. Noch haben die Forscher sich nicht geeinigt, ob sie diese vier Tiere sämtlich als besondere Arten ansehen sollen oder nicht. Die einen erblicken in dem Guanaco die Stammart des Lama und des Paco und glauben vornehmlich darin eine Unterstützung ihrer Meinung zu finden, daß Lama und Guanaco sich fruchtbar miteinander vermischen und fruchtbare Blendlinge erzeugen; die andern erachten die geringen Unterschiede in der Gestalt für wichtig genug, um die vier Lamas, wie die Eingeborenen es immer getan haben, als besondere Arten anzusehen.
Guanaco und Vicuña leben noch heutigestags wild; Lama und Paco sind schon seit undenklichen Zeiten zu Haustieren geworden. Bereits die ersten Entdecker Amerikas fanden beide im gezähmten Zustande vor; die Überlieferung der Peruaner verlegt die Zähmung der Tiere in das früheste Zeitalter menschlichen Daseins und bringt sie mit der irdischen Erscheinung ihrer Halbgötter in Verbindung. Abergläubische Anschauungen herrschten unter jenen Völkerschaften hinsichtlich der Verwendung des Lama beim Opferdienste; namentlich die Färbung der zum Weihopfer der Götter bestimmten Tiere war, je nach den verschiedenen Festen, genau vorgeschrieben. Die zuerst landenden Spanier fanden überall bedeutende Lamaherden im Besitze der Gebirgsbewohner und beschrieben die Tiere so ausführlich, daß man selbst die einzelnen Formen ohne Mühe erkennen kann.
Alle Lamas sind Bewohner der Hochebenen des gewaltigen Gebirges der Kordilleren. Sie befinden sich nur in den kalten Gegenden wohl und steigen deshalb bloß im äußersten Süden der Andeskette bis in die Pampas oder großen Ebenen Patagoniens herab. In der Nähe des Gleichers liegt ihr Aufenthaltsort in einer Höhe zwischen vier- und fünftausend Meter über dem Meere, und tiefer als zweitausend Meter über dem Meere gedeihen sie hier nicht, während ihnen dagegen das kalte Patagonien auch in geringeren Meereshöhen zusagende Aufenthaltsorte bietet. Die wildlebenden ziehen sich während der nassen Jahreszeit auf die höchsten Kämme und Rücken der Gebirge zurück und steigen während der trockenen Zeit in die fruchtbaren Täler herab. Sie leben in größeren oder kleineren Gesellschaften, nicht selten in Rudeln von mehreren hundert Stück, und bilden Gegenstände der eifrigsten Jagd.
Der Guanaco oder Huanaco ( Auchenia Huanaco) ist mit dem Lama das größte und, obgleich nur im freien Zustande vorkommend, eines der wichtigsten aller südamerikanischen Landsäugetiere. In der Größe gleicht er etwa unserm Edelhirsche; in der Gestalt ist er ein sonderbares Mittelding zwischen Kamel und Schaf. Bei vollkommen erwachsenen Tieren beträgt die Gesamtlänge des Leibes 2,25 Meter, die Länge des Schwanzes 24 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 1,15 Meter, die Höhe vom Boden bis zum Scheitel 1,6 Meter. Das Weibchen ist kleiner, dem Männchen aber vollkommen gleich gestaltet und gleich gefärbt. Der Leib des Guanaco ist verhältnismäßig kurz und gedrungen, in der Brust und Schultergegend hoch und breit, hinten aber schmal, und in den Weichen sehr stark eingezogen; der Hals lang, dünn, schlank und nach vorn gekrümmt; der Kopf lang und seitlich zusammengedrückt, die Schnauze stumpf zugespitzt, die Oberlippe vorspringend, tief gespalten, schwach behaart und sehr beweglich, die Nasenkuppe behaart; die länglichen, schmalen Nasenlöcher sind verschließbar; die Ohren haben ungefähr die halbe Kopflänge, länglich eiförmige Gestalt und sind schmal, beiderseitig behaart und sehr beweglich; das Auge ist groß und lebhaft, sein Stern ist quer gestellt; an den Lidern, zumal an den unteren, sitzen lange Wimpern. Die Beine sind schlank und hoch, die Füße länglich, die Zehen bis zur Mitte gespalten und an ihren Spitzen von unvollkommenen, kleinen, schmalen und zugespitzten, etwas nach abwärts gekrümmten Hufen umschlossen, die Sohlen groß und schwielig; in den Beugegelenken der Vorderfüße fehlen die Schwielen, die die andern Arten, wie die Kamele, besitzen. Der Schwanz, der aufgerichtet getragen wird, ist sehr kurz, auf der oberen Seite stark behaart und auf der untern Seite fast gänzlich kahl. Das Euter des Weibchens hat vier Zitzen. Ein ziemlich langer, reichlicher, aber lockerer Pelz bedeckt den Körper. Die allgemeine Färbung ist ein schmutziges Rotbraun; die Mitte der Brust, der Unterleib und der After sowie die Innenseite der Gliedmaßen sind weißlich, die Stirn, der Rücken und die Augen schwärzlich, die Backen- und die Ohrengegend dunkelgrau, die Innenseiten der Ohren schwarzbraun und die Außenseiten derselben schwarzgrau.
Der Guanaco verbreitet sich über die Kordilleren, von den bewaldeten Inseln des Feuerlandes an bis nach dem nördlichen Peru. Namentlich im südlichen Teile der Andeskette ist er häufig; in den bewohnteren Gegenden haben ihn die vielfachen Nachstellungen sehr vermindert; doch traf Göring noch einzelne in der Nähe der Stadt Mendoza an. Er bevorzugt Gebirgshöhen, ohne jedoch auf Tiefebenen zu fehlen. Darwin begegnete ihm auf den Ebenen des südlichen Patagonien in größerer Anzahl als auf irgend einer andern Örtlichkeit. Im Gebirge steigt er während des Frühlings oder der Zeit, in der es frische Pflanzen in der Höhe gibt, bis zu der Schneegrenze empor, wogegen er bei Beginn der Trockenheit sich in die fruchtbaren Täler der Tiefe zurückzieht. Die Schneefelder selbst meidet er sorgfältig, wahrscheinlich, weil seine Sohlen nicht geeignet sind, festen Fuß auf dem schlüpfrigen Boden zu fassen. In der Tiefe sucht er die saftigsten Weideplätze auf. Zuweilen unternehmen die Guanacos weite Wanderungen, förmliche Entdeckungsreisen. In Bahia Blanca, wo sie innerhalb dreißig Meilen von der Küste sehr selten sind, sah Darwin eines Tages die Spuren von dreißig oder vierzig, die in einer geraden Linie zu einer schlammigen und salzigen Bucht herabgekommen waren. Wahrscheinlich hatten sie gemerkt, daß sie sich dem Meere näherten; denn sie hatten sich so regelmäßig wie Reiterei herumgedreht und in einer ebenso geraden Linie, wie sie gekommen waren, den Rückweg angetreten. Vor dem Meere scheuen sie sich übrigens nicht, gehen vielmehr ohne viel Besinnen ins Wasser und schwimmen von einer Insel zur andern.
Sie leben gesellig in Rudeln. Meyen sah solche von sieben bis hundert Stück an Bächen weiden; Darwin bemerkt, daß man in der Regel Trupps von einem Dutzend bis zu dreißig Stück zusammenfinde, daß er jedoch an den Ufern des Santa Cruz einmal eine Herde von mindestens fünfhundert Stück gesehen habe. Das Rudel besteht gewöhnlich aus vielen Weibchen und nur einem alten Männchen; denn bloß die jungen, fortpflanzungsunfähigen Tiere werden von den Leithengsten geduldet. Wenn die Jungen ein gewisses Alter erreichen, entstehen Kämpfe; die Schwachen werden gezwungen, den Stärkeren zu weichen, und schlagen sich dann mit anderen ihresgleichen und jungen Weibchen zusammen. Während des Tages ziehen die Tiere von einem Tal zum andern, fast beständig äsend; in der Nacht fressen sie niemals. Zur Tränke gehen sie am Morgen und am Abend, und zwar trinken sie salziges Wasser ebenso gern, vielleicht lieber noch als süßes: Darwins Begleiter sahen eine Herde bei Kap Blanco zu einer Saline kommen und das stark salzhaltige Wasser derselben mit Begierde schlürfen. Saftige Gräser und im Notfalle Moos bilden die Nahrung.
Eigentümlich ist die Gewohnheit der Guanacos und aller Lamas überhaupt, nach Art einzelner Antilopen ihre Losung immer auf einem bestimmten Haufen abzusetzen und nur, wenn dieser größere Ausdehnung erreicht hat, dicht daneben einen neuen zu bilden. Den Indianern kommt diese Anhäufung der Losung sehr zustatten, da sie letztere als Brennstoff verwenden und somit der Mühe des Sammelns überhoben sind.
Alle Bewegungen des Guanaco sind rasch und lebhaft, wenn auch nicht so schnell, als man vermuten sollte. In der Ebene holt ein gutes Pferd das flüchtende Rudel bald ein; gewöhnliche Hunde aber haben Mühe, ihm nachzukommen. Der Lauf besteht aus einem kurzen, schleppenden Galopp und ist wie bei den echten Kamelen ein Paßgang. Der lange Hals wird bei beeiligter Flucht wagerecht ausgestreckt und auf und nieder bewegt. Das Klettern versteht der Guanaco ausgezeichnet; er läuft gemsenartig an den steilsten Gehängen und Abstürzen dahin, selbst da, wo der geübteste Bergsteiger nicht Fuß fassen kann, und schaut mit Gleichgültigkeit in die Tiefe hinab. In der Ruhe liegt das Tier wie das Kamel auf der Brust und den Beinen, und wie dieses läßt es sich nieder und steht auf. Während der Ruhe käut es wieder.
Gewöhnlich sind die Guanacos wild und sehr scheu. Sie achten auf alles, was um sie her vorgeht, beherrschen einen weiten Gesichtskreis und entfliehen, sobald sich innerhalb desselben etwas Verdächtiges zeigt. In Furcht gesetzt, flüchten sie oft meilenweit, halten jedoch währenddem ihre Wechsel, die meist als tief ausgetretene Pfade sich darstellen, nach Möglichkeit ein. Der leitende Hengst steht fast immer einige Schritte von dem Rudel entfernt und hält mit größter Vorsicht Wache, während seine Herde unbekümmert weidet. Bei der geringsten Gefahr stößt er ein lautes, wieherndes Blöken aus; alle Tiere des Rudels erheben im Augenblick ihre Köpfe, äugen scharf nach allen Seiten hin und wenden sich dann rasch zur Flucht, die anfangs zögernd, später aber mit immer mehr sich steigernder Eile ausgeführt wird. Bei der Flucht gehen, laut Meyen, die Weibchen und Jungen voraus und werden von den folgenden Männchen oft mit dem Kopfe vorwärts gestoßen. Nur selten kommt es vor, daß ein weibliches Guanacorudel den Menschen sich nähern läßt. Meyen begegnete solchen zuweilen, ohne daß sie Miene gemacht hätten zu flüchten; sie gingen dicht vor den Pferden vorbei, standen still und sahen sie an; dann erst trabten sie weiter. Darwin schreibt dieses auffallende, auch von ihm wiederholt beobachtete Betragen mit Recht ihrer sehr ausgeprägten Neugierde zu. »Trifft man«, sagt er, »zufällig plötzlich auf ein einzelnes Tier oder auf einige, so bleiben sie gewöhnlich bewegungslos stehen und sehen einen starr an, bewegen sich sodann einige Schritte fort, drehen sich herum und äugen wieder. Auf den Bergen des Feuerlandes und an anderen Plätzen habe ich mehr als einmal Guanacos gesehen, die, wenn man sich ihnen näherte, nicht nur wieherten und schrien, sondern auch auf die lächerlichste Weise, gleichsam als Herausforderung, sich bäumten und in die Höhe sprangen. Daß sie neugierig sind, ist gewiß, denn wenn sich jemand auf den Boden legt und allerlei fremdartige Bewegungen macht, kommen sie fast immer zur Erforschung des Gegenstandes allmählich näher und näher heran.«
Die Brunstzeit fällt in die Monate August und September. Häufige Kämpfe zwischen den um die Herrschaft streitenden Männchen gehen ihr voraus. Mit unglaublicher Erbitterung und heftigem Geschrei stürzen die Nebenbuhler aufeinander los, beißen, schlagen sich, jagen sich gegenseitig umher und versuchen einander niederzuwerfen oder in die Tiefe zu stürzen. Nach zehn bis elf Monaten Tragzeit wirft das Weibchen ein vollkommen ausgebildetes, behaartes und sehendes Junge, säugt es vier Monate lang, bewacht es sorgsam, behandelt es mit großer Zärtlichkeit und behält es bei sich, bis es vollkommen erwachsen ist und nun seinerseits das Kämpfen und Ringen in Sachen der Liebe beginnt.
Der Guanaco verteidigt sich gegen seinesgleichen mit Schlagen und Beißen, wogegen er vor allen einigermaßen wehrhaften Feinden furchtsam entflieht, ohne an Abwehr zu denken. Selbst ein großer Hund kann eines von diesen Tieren festhalten, bis der Jäger herankommt. Wenn sie sich an Menschen und Haustiere gewöhnt haben, werden sie dreister, greifen zuweilen kühn einen Widersacher an, versuchen ihn zu beißen oder zu schlagen, bedienen sich mindestens eines allen Lamas eigentümlichen Verteidigungsmittels, lassen den Gegner dicht an sich herankommen, legen die Ohren zurück, nehmen einen sehr ärgerlichen Ausdruck an und spucken ihm plötzlich mit Heftigkeit ihren Speichel und die gerade im Munde befindlichen oder ausdrücklich zu diesem Behufe heraufgewürgten Kräuter ins Gesicht.
Der Mensch ist und bleibt der furchtbarste Feind unserer Tiere; gegen andere Angreifer schützt sie ihre Schnelligkeit. Ob der Kondor ihnen wirklich so viel Schaden tut, als man angibt, steht dahin. Die Südamerikaner betreiben die Jagd der Guanacos mit Leidenschaft, weil dieselbe, des unschätzbaren Fleisches und Felles wegen, einen hübschen Gewinn abwirft. Man sucht die weidenden Tiere mit Hilfe guter Hunde in eine Schlucht zu treiben, jagt ihnen dort nach und wirft ihnen das Lasso mit Bolas oder Wurfkugeln um den Hals. Erfahrene Jäger machen sich mit bestem Erfolge die Neugierde der Guanacos zunutze, indem sie sich angesichts einer schwachen Herde derselben auf den Boden werfen und durch die oben erwähnten absonderlichen Bewegungen das sonst scheue Wild heranlocken. Nach Darwins Versicherung können sie dann in den meisten Fällen mehrere Schüsse abgeben, weil sich die Tiere dadurch nicht behelligen lassen, die Schüsse vielmehr als zu dem sie fesselnden Spiele gehörig anzusehen scheinen. In den Ebenen werden sie oft in Menge erlegt, weil sie sich wie dumme Schafe durch gleichzeitiges Heranreiten mehrerer, von verschiedenen Seiten herbeikommender Jäger leicht verwirren lassen, längere Zeit unschlüssig bleiben, nach welcher Richtung sie laufen sollen, und endlich gestatten, daß man sie einer geeigneten Einschließungsstelle zutreibt, aus der es für sie keinen Ausweg mehr gibt. An den Berggehängen dagegen entgehen sie leicht ihrem Verfolger; hier ist es schwer, sich ihnen auch nur auf Schußweite zu nähern.
Im Gebirge wie in der Ebene fängt man nicht selten Guanacos ein, um sie zu zähmen. Solange sie jung sind, benehmen sie sich allerliebst. Sie zeigen sich zutraulich und anhänglich, folgen ihrem Herrn wie ein Hund auf dem Fuße nach und lassen sich wie Lämmchen behandeln; je älter sie aber werden, um so geringer wird ihre Liebe und Anhänglichkeit an den Menschen. Nicht selten kommt es vor, daß man die Zahmen dahin bringen kann, frei aus- und einzugehen und, nach Art der Lamas, sich ihre Äsung selbst zu suchen; ältere freilich geben sich alle Mühe, der Zwingherrschaft des Menschen zu entrinnen, und beweisen ihm auch durch ihr Anspucken, welche Gesinnung sie gegen ihn hegen. Die Gefangenen sind leicht mit Heu, Gras, Brot und Getreide zu erhalten, auch bei uns in Europa, woselbst sie sich bei geeigneter Pflege fortpflanzen.
Das Lama, eigentlich Llama, sprich Ljama ( Auchenia Lama), wird vorzugsweise in Peru gefunden und gedeiht dort am besten auf den Hochebenen in der bezeichneten Höhe. Es wird etwas größer als der Huanaco und zeichnet sich durch die Schwielen an der Brust und an der Vorderseite des Handwurzelgelenkes aus. Der Kopf ist schmal und kurz, die Lippen sind behaart, die Ohren kurz und die Sohlen groß. Die Färbung ändert vielfach ab; es gibt weiße, schwarze, gescheckte, rotbraune und weißgefleckte, dunkelbraune, ockerfarbene, fuchsrote und andere. Das ausgewachsene Tier erreicht von der Sohle bis zum Scheitel eine Höhe von 2,6 bis 2,8 Meter; am Widerrist wird es etwa 1,2 Meter hoch.

Lama (Auchenia lama)
Acosta erzählt uns, daß die Indianer ganze Herden »dieser Schafe« wie Saumtiere beladen, über das Gebirge führen, oft Banden von drei- bis fünfhundert, ja manchmal von tausend Stück. »Ich habe mich oft gewundert«, schildert er, »diese Schafherden mit zwei- bis dreitausend Silberbarren, die über 300 000 Dukaten wert sind, beladen zu sehen, ohne eine andere Begleitung als einige Indianer, die die Schafe leiten, beladen und abladen, und dabei höchstens noch einige Spanier. Sie schlafen alle Nächte mitten im Felde, und dennoch hat man auf diesem langen Wege noch nie etwas verloren; so groß ist die Sicherheit in Peru. An Ruheplätzen, wo es Quellen und Weiden gibt, laden sie die Führer ab, schlagen Zelte auf, kochen und fühlen sich wohl, ungeachtet der langen Reise. Erfordert diese nur einen Tag, so tragen jene Schafe acht Arrobas (zwei Zentner) und gehen damit acht bis zehn Leguas; das müssen jedoch bloß diejenigen tun, die den armen, durch Peru wandernden Soldaten gehören. Alle diese lieben die kalte Luft und befinden sich wohl im Gebirge, sterben aber in Ebenen wegen der Hitze. Bisweilen sind sie ganz mit Frost und Eis bedeckt und bleiben doch gesund. Die kurzhaarigen geben oft Veranlassung zum Lachen. Manchmal halten sie plötzlich auf dem Wege an, richten den Hals in die Höhe, sehen die Leute sehr aufmerksam an und bleiben lange Zeit unbeweglich, ohne Furcht und Unzufriedenheit zu zeigen. Ein anderes Mal werden sie plötzlich scheu und rennen mit ihrer Ladung auf die höchsten Felsen, so daß man sie herunterschießen muß, um die Silberbarren nicht zu verlieren.«
Nur die Männchen werden zum Lasttragen benutzt, die Weibchen dienen ausschließlich zur Zucht.
»Nichts sieht schöner aus«, sagt Stevenson, »als ein Zug dieser Tiere, wenn sie mit ihrer etwa einen Zentner schweren Ladung auf dem Rücken, eines hinter dem andern, in der größten Ordnung einherschreiten, angeführt von dem Leittiere, das mit einem geschmackvoll verzierten Halfter, einem Glöckchen und einer Fahne auf dem Kopfe geschmückt ist. So ziehen sie die schneebedeckten Gipfel der Kordilleren oder den Seiten der Gebirge entlang, auf Wegen, wo selbst Pferde oder Maultiere schwerlich fortkommen möchten; dabei sind sie so folgsam, daß ihre Treiber weder Stachel noch Peitsche bedürfen, um sie zu lenken und vorwärtszutreiben. Ruhig und ohne anzuhalten schreiten sie ihrem Ziele zu.«
Über die Fortpflanzung der Lamas berichtet Tschudi etwa folgendes: »Die Begattung geht erst nach dem Ausbruch der rasendsten Brunst vor sich, indem sich die Tiere schlagen, stoßen, beißen, niederwerfen und bis zur größten Ermattung umherjagen. Alle Lama-Arten werfen nur ein Junges, das etwa vier Monate saugt, bei den eigentlichen Lamas gewöhnlich etwas länger; sehr häufig saugen bei dieser Art sogar die Jungen vom zweiten Jahre mit denen vom ersten zugleich.« Von demselben Naturforscher erfahren wir, daß die Bedeutung der Lamas seit Einführung der Einhufer bedeutend gesunken ist, und ferner, daß die Lamaherden durch Krankheiten oft in entsetzlicher Weise heimgesucht werden.
Lamafleisch wird überall gern gegessen, das der sogenannten Chuchos oder einjährigen Tiere gilt sogar als Leckerbissen. Ältere Lamas werden hauptsächlich geschlachtet, um Trockenfleisch, in Peru und Bolivia Charqui genannt, zu gewinnen. Aus der Wolle bereitet man nur grobe Zeuge und Stricke; ihr Wert ist gering.
Gegenwärtig sieht man das Lama fast in allen Tiergärten. Wenn es mit andern seiner Art zusammengehalten wird, scheint es viel freundlicher zu sein, als wenn es allein ist und sich langweilt. Es verträgt sich mit seinen Artgenossen und Artverwandten vortrefflich, und namentlich die Paare hängen mit inniger Zärtlichkeit aneinander. Sie lernen ihre Wächter kennen und behandeln sie erträglich; gegen fremde Menschen aber zeigen sie sich als echte Kamele, d. h. beständig mehr oder weniger übelgelaunt und außerordentlich reizbar. Im Berliner Tiergarten lebte vor mehreren Jahren ein Lama, das sich durch besondere Ungemütlichkeit auszeichnete; an seinem Gitter hing eine Tafel mit der Bitte, das Lama ja nicht zu ärgern, was selbstverständlich den Erfolg hatte, daß jedermann erst recht das Tier zu reizen versuchte. Demzufolge sah man dieses in beständiger Aufregung. Sobald sich jemand nahte, endigte es sein gemütliches Wiederkäuen, legte die Ohren zurück, sah den Fremdling starr an, ging plötzlich gerade auf ihn los und spuckte ihn an. In ähnlicher Weise benahmen sich auch die übrigen Lamas, die ich sah oder selbst pflegte, und ich kann wohl sagen, daß ich nie eines kennenlernte, das sanft oder gutmütig gewesen wäre. Mit seiner Pflege und Wartung hat man wenig Umstände. Es gedeiht in Europa ebensogut wie der Guanaco, verlangt keinen warmen Stall und höchstens einen gegen rauhe Winde geschützten Pferch, begnügt sich mit gewöhnlichem Futter und schreitet leicht zur Fortpflanzung.
Die dritte Form der Gruppe, der Paco oder die Alpaca ( Auchenia Paco), ist kleiner als das Lama und gleicht im Körperbau dem Schafe, hat aber einen längeren Hals und einen zierlichen Kopf; sein Vließ ist sehr lang und ausnehmend weich, an einigen Stellen, z. B. an den Seiten des Rumpfes, erreicht es eine Länge von zehn bis zwölf Zentimeter. Die Färbung ist meistens ganz weiß oder schwarz; es gibt aber ebenfalls buntscheckige.
»Die Pacos«, sagt Tschudi, »werden in großen Herden gehalten, die das ganze Jahr auf den Hochebenen weiden; nur zur Schur treibt man sie nach den Hütten. Es gibt vielleicht kein widerspenstigeres Tier als dieses Lama. Wenn eins von der Herde getrennt wird, wirft es sich auf die Erde und ist weder durch Schmeicheln noch durch Schläge zu bewegen, wieder aufzustehen. Es erleidet lieber die heftigsten Züchtigungen und selbst den qualvollsten Tod, als daß es folge. Einzelne können bloß fortgeschafft werden, indem man sie den Herden von Lamas und Schafen beigesellt. Die Indianer verfertigen aus der Wolle des Paco und Lama schon seit uralten Zeiten wollene Decken und Mäntel.«
»Zierlicher als das Lama«, sagt Tschudi, »ist die Vicuña, sprich Wikunja ( Auchenia Vicunna). An Größe steht sie zwischen dem Lama und Paco, unterscheidet sich aber von beiden durch viel kürzere und gekräuseltere Wolle von ausnehmender Feinheit. Der Scheitel, die obere Seite des Halses, der Rumpf und die Schenkel sind von eigentümlicher, rötlichgelber Färbung (Vicuñafarbe); die untere Seite des Halses und die innere der Gliedmaßen hell ockerfarben, die 12 Zentimeter langen Brusthaare und der Unterleib weiß.
Während der nassen Jahreszeit halten sich die Vicuñas auf den Kämmen der Kordilleren auf, wo die Pflanzenwelt sich nur höchst spärlich zeigt. Sie bleiben, weil ihre Hufe weich und empfindlich sind, immer auf den Rasenplätzen und ziehen sich, auch verfolgt, niemals auf die steinigen, nackten Gipfel und noch viel weniger, wie unsere Gemsen, auf Gletscher und Schneefelder zurück. In der heißen Jahreszeit steigen sie in die Täler herab. Der scheinbare Widerspruch, daß Tiere, die im Winter die kalten, im Sommer die heißen Gegenden aufsuchen, erklärt sich dadurch, daß während der trockenen Jahreszeit die Kordillerenrücken ganz ausgedörrt sind und die überhaupt spärliche Pflanzenwelt ihnen nur in den Tälern, wo es Quellen und Sümpfe gibt, hinreichende Nahrung darbietet. Sie grasen fast den ganzen Tag, und es ist eine Seltenheit, einmal ein liegendes Rudel dieser Tiere zu überraschen. Während der Brunstzeit kämpfen die Männchen mit der größten Erbitterung um die Stelle des Anführers der Rudel von Weibchen; denn jedes duldet nur ein Männchen. Die einzelnen Scharen bestehen aus sechs bis fünfzehn Weibchen. Das Männchen hält sich immer zwei bis drei Schritte von seiner Weiberschar zurück und bewacht sie sorgfältigst, während sie sorglos weidet.« Acosta teilt mit, daß die Vicuñas sehr flüchtig und furchtsam sind und augenblicklich vor den Jägern und selbst vor andern Tieren davonlaufen, wobei sie ihre Jungen vor sich hertreiben. Sie vermehren sich nicht stark, und deshalb haben die Inkas die Jagd verboten, selbstverständlich nur unter ihren Untertanen; denn sie stellen der Jagd halber große Feste an. Seit die Spanier in das Land gekommen sind, haben sich die schönen Tiere wesentlich vermindert, weil die Christen ihnen weniger Schonung zuteil werden ließen als die Indianer, die zwar ebenfalls viele von ihnen fingen und töteten, die Weibchen aber laufen ließen und somit der Vermehrung keinen Eintrag taten. In der Neuzeit scheint dies anders geworden zu sein.
»Jung eingefangene Vicuñas lassen sich«, so erzählt Tschudi weiter, »leicht zähmen und benehmen sich sehr zutraulich, indem sie sich an ihre Pfleger mit Liebe anschließen und ihnen, wie wohlgezogene Haustiere, auf Schritt und Tritt nachlaufen; mit zunehmendem Alter aber werden sie, wie alle ihre Verwandten, tückisch und durch das ewige Spucken unerträglich.« Schon zu Acostas Zeiten schoren die Indianer auch die Vicuñas und verfertigten aus der Wolle Decken von sehr hohem Werte, die das Aussehen weißseidenen Stoffes hatten und, weil sie nicht gefärbt zu werden brauchten, sehr lange ausdauerten. Die Kleider von diesen Zeugen waren besonders für heiße Witterung geeignet. Noch gegenwärtig webt man die feinsten und dauerhaftesten Stoffe aus dieser Wolle und filzt haltbare, weiche Hüte aus ihr.
*
Einzelne Naturforscher vereinigten mehrere kleine, höchst zierlich gebaute Wiederkäuer, unter denen sich auch die Zwerge der ganzen Ordnung befinden, die Moschustiere ( Moschidae) nämlich, mit den Hirschen. Von diesen aber unterscheiden sie sich durch das Fehlen eines Geweihes, den Mangel der Tränendrüsen, das Vorhandensein der Gallenblase und anderweitige Merkmale erheblich genug, um die gegenwärtig allgemein anerkannte Trennung beider Familien zu rechtfertigen.
Mittel- und Südasien mit seinen Inseln und der westliche Teil von Mittelafrika sind die Heimat der Moschustiere. Dort leben die größeren Arten in den felsigen Gegenden der Hochgebirge, selten in den Tälern, in die sie eigentlich bloß dann herabstreichen, wenn sie der strenge Winter von ihren Höhen vertreibt und der Nahrungsmangel sie zwingt, sich nach günstigeren Gebieten zu wenden. Die kleinen Arten wohnen in dichteren Waldungen, zumal auf dem Gebirge und in felsigen, buschreichen Gegenden, selbst in unmittelbarer Nähe der Ortschaften. Bei weitem die meisten leben einzeln, oder bloß zur Fortpflanzungszeit paarweise; nur eine Art schlägt sich in größere Rudel zusammen.
Vertreter der ersten Gruppe ( Moschus) ist das Moschustier ( Moschus moschiferus), ein zierlicher Wiederkäuer von Rehgröße, also etwa 1,15 Meter Leibeslänge und 40 Zentimeter Höhe am Widerrist, gedrungen gebaut, am Hinterteile höher gestellt als vorn, schlankläufig, kurzhalsig, mit länglichem, an der Schnauze stumpf zugerundetem Kopf, der mittelgroße, langgewimperte Augen mit sehr beweglichem Stern und eigestaltige Ohren von halber Kopfeslänge trägt. Ziemlich kleine, lange, schmale und spitzige Hufe umschließen den Fuß; sie können aber, vermöge einer zwischen ihnen befindlichen Hautfalte, sehr breit gestellt werden und ermöglichen, in Verbindung mit den bis auf den Boden herabreichenden Afterklauen, ein sicheres und unbeschwerliches Dahinschreiten auf Schneefeldern oder Gletschern. Der Schwanz ist kurz und dick, fast dreieckig gestaltet, bei dem Bock mit Ausnahme der Spitze nackt, hier mit einem Haarbüschel besetzt. Ein dicht anliegendes Haarkleid, das zu beiden Seiten der Brust, zwischen den Hinterschenkeln und am Hals sich verlängert, bedeckt den Leib. Die Färbung soll so vielfachem Wechsel unterworfen sein, daß man, laut Adams, kaum zwei gleichgefärbte Stücke sieht. Einzelne sind oben sehr dunkel, unten aber schmutzigweiß, andere rotbraun, andere oben gelblichbraun, unten weiß, andere zeigen eine Längsreihe lichter Flecken auf dem Rücken.
Der Moschusbeutel liegt am Hinterbauche zwischen Nabel und Geschlechtsteilen und erscheint als ein sackförmiger, etwas hervorragender, rundlicher Beutel von etwa 6 Zentimeter Länge, 3 Zentimeter Breite und 4 bis 5 Zentimeter Höhe. Straff anliegende, gegeneinander geneigte Haare besetzen ihn von beiden Seiten, lassen aber auf der Mitte eine kreisförmige Stelle kahl. Hier liegen zwei kleine Öffnungen hintereinander, die durch kurze Röhren mit dem Beutel selbst verbunden werden. Die vordere, halbmondförmige ist außen mit gröberen, innen mit feinen, langen und verworrenen Haaren besetzt; die hintere, die mit den Geschlechtsteilen in Verbindung steht, wird von einem Büschel langer Grannen umgeben. Kleine Drüsen im Innern des Beutels sondern den Moschus ab, und durch die erste erwähnte Röhre wird der Beutel entleert, wenn er zu voll ist. Erst bei dem erwachsenen Moschustier hat letzterer seine volle Größe und seinen vollen Gehalt an Moschus erlangt. Man darf als Durchschnittsmenge 30 Gramm des kostbaren Stoffes annehmen; doch hat man in einzelnen Beuteln auch schon mehr als das Doppelte gefunden. Junge Böcke liefern etwa den achten Teil. Bei Lebzeiten des Tieres ist der Moschus selbst salbenartig; getrocknet wird er zu einer körnigen oder pulverigen Masse, die anfänglich eine rotbraune Färbung zeigt, mit der Zeit aber bis zu kohlschwarz dunkelt. Der Geruch nimmt in demselben Maß ab, als der Moschus dunkler wird, und er verliert sich gänzlich, wenn man den sonderbaren Stoff mit Schwefel, Goldschwefel oder Kampfer vermischt. In kaltem Wasser löst er sich zu etwa dreiviertel, in kochendem zu vierfünftel, in Weingeist ungefähr zur Hälfte auf. Beim Erhitzen verbrennt er unter Entwicklung eines peinlichen Gestankes.
Die schroffen Gehänge und die Waldungen des hinterasiatischen Gebirgsbereichs bilden die eigentlichen Wohnsitze des berühmten Tieres. Im westlichen Himalaja findet es sich, laut Adams, hauptsächlich in dem mittlern und tiefern Gürtel des Gebirges, niemals in Herden und selten mehr als zu zweien zusammen. Es bevorzugt Gehänge, auf denen grasige Weideplätze mit kleinen Buschwaldungen abwechseln. In letzteren verbirgt es sich bei Tage; denn erst in der Dämmerung oder in den Morgenstunden betritt es die buschlosen Weideplätze. Sein Gang besteht aus einer Reihe hüpfender Sprünge, auf die ein kurzer Stillstand folgt, jedenfalls nur in der Absicht, zu sichern; sodann beginnt es wieder mit langsamen Schritten und fällt von neuem in seinen absonderlichen Galopp. Obgleich es des Moschus halber außerordentlich verfolgt wird, ist es hier doch nichts weniger als scheu und läuft, aufgestört, selten weit weg. Jagt man es aber im Dickichte, so verläßt es dasselbe nicht, sondern sucht sich in den dunkelsten Gebüschen zu verbergen. Niemals vernimmt man einen Laut von ihm; selbst in der Brunftzeit schweigt es, und nur, wenn man es gefangen hat, stößt es ein lautes und gellendes Kreischen aus. Seine Fährte unterscheidet es sogleich von allen gebirgsbewohnenden Wiederkäuern, weil die beiden Afterzehen einen deutlichen Eindruck hinterlassen. Findet man seine Spuren, so kann man mit Sicherheit darauf rechnen, es auf demselben Wechsel wiederzusehen, denn es hält diesen auf das genaueste ein. Radde nennt es den Bewohner öder, vielfach zertrümmerter Gebirgswände und sagt, daß es sich vornehmlich die stumpfen Kegelspitzen der Höhen zu seinem Aufenthalte erwähle. Es steigt ebensowenig nach oben hin über die Baumgrenze hinaus, als es in die reicheren Gegenden der Tiefe herabkommt. Höhen zwischen tausend bis zweitausend Meter über dem Meere bilden seinen bevorzugten Aufenthalt; ausnahmsweise nur kommt es in Talmündungen herab, die bloß dreihundert Meter über dem Meere gelegen sind. Am liebsten wohnt es in dem Alpengürtel an der obern Baumgrenze. Es hält fest an dem einmal gewählten Stande. Bis zur Brunstzeit lebt es einzeln, bei Tage verborgen im Gebüsch, bei Nacht seiner Äsung nachgehend. Seine Bewegungen sind ebenso rasch als sicher. Es läuft mit der Schnelligkeit einer Antilope, springt mit der Sicherheit des Steinbocks und klettert mit der Kühnheit der Gemse. Auf Schneeflächen, wo jeder Hund einsinkt und ein Mensch sich kaum fortbewegen kann, trollt das Moschustier noch gemächlich dahin, fast ohne eine sichtbare Spur zurückzulassen. Verfolgte springen, wie die Gemsen, aus bedeutenden Höhen ohne Schaden herab oder laufen an Wänden hin, an denen sich ihnen kaum die Möglichkeit zum Fußen bietet. Im Falle der Not schwimmt das Tier ohne Besinnen über breite Ströme.
Die Sinne sind vortrefflich, die Geistesfähigkeiten aber gering. Das Moschustier ist scheu, jedoch nicht klug und berechnend. Wenn es von einem Mißgeschick überrascht wird, weiß es sich oft gar nicht zu benehmen und rennt wie sinnlos oder verrückt umher. So benimmt sich auch das frischgefangene.
Im Spätherbste, gewöhnlich im November und Dezember, schlagen sich die Rudel der Brunst halber zusammen. Die Männchen bestehen heftige Kämpfe und gebrauchen ihre scharfen Zähne in gefährlicher Weise. Sie gehen aufeinander los, suchen sich mit den Hälsen zu umschlingen, um die Zähne einzusetzen, und reißen dann tiefe Wunden in Fell und Fleisch. Man findet, daß fast alle erwachsenen Männchen die Narben solcher Kämpfe an sich tragen. Während der Brunstzeit verbreiten die Böcke einen wahrhaft unausstehlichen Moschusgeruch. Die Jäger sagen, daß man ihn auf eine Viertelmeile wahrnehmen könne. Sechs Monate nach der Begattung, im April, Mai oder Juni, setzt das Weibchen ein einziges oder zwei buntgefleckte Junge, die es mit treuer Liebe bis zur nächsten Brunstzeit bei sich behält, dann aber abschlägt. Die Jungen sind vollständig ausgebildet, und ihr Schwanz ist noch behaart; doch schon in der ersten Jugend unterscheiden sich die Männchen durch eine stumpfe Schnauze und durch ein bedeutenderes Gewicht von den Weibchen. Mit Ende des dritten Jahres sind die Jungen erwachsen.
Je nach dem Aufenthaltsorte ist die Nahrung eine verschiedene. Im Winter besteht sie hauptsächlich in Baumflechten, im Sommer in Alpenkräutern der höher gelegenen Matten des Gebirges. Wie man sagt, suchen sich die sehr wählerischen Moschustiere nur die besten und würzigsten Pflanzen aus.
Die Jagd des so wichtigen und gewinnbringenden Geschöpfes ist, wenigstens in Sibirien, sehr schwierig. Seine außerordentliche Scheu läßt den Jäger selten zum Schusse kommen. Gewöhnlich legt man, um der gesuchten Beute habhaft zu werden, Schlingen auf den Wechsel und bekommt sie so bald lebendig, bald erwürgt. Am Jenissei und Baikal sperrt man die Täler durch zaunartig nebeneinander eingeschlagene Pfähle bis auf einen engen Durchgang ab und legt in diesen die Schlingen. Die Tungusen blatten die Moschustiere, d. h. locken sie durch Nachahmung des Blökens der Kälber mit zusammengeschlagener Birkenrinde an sich heran und schießen sie dann mit Pfeilen nieder. Dabei kommt es nicht selten vor, daß anstatt der erwünschten Wiederkäuer Bären, Wölfe und Füchse erscheinen, die sich durch das Blatten ebenfalls täuschen ließen und eine Beute erhofften. Das Wildbret ist für Europäer ungenießbar; der Moschusbeutel aber wirft einen bedeutenden Gewinn ab und lohnt die Jagd reichlich.
*
Die zweite Gruppe umfaßt die Zwergmoschustiere ( Tragulus). Alle hierher gehörigen Tiere sind überaus niedliche Geschöpfe. Man denke sich ein rehartiges, zierliches Tierchen mit ziemlich dickem Rumpf, schlankem, wohlgeformtem Kopf, schönen, hellen Augen und Läufen, die kaum mehr als Bleistiftsdicke haben, mit äußerst niedlichen Hufen, einem kleinen, netten Stumpfschwänzchen und weichem, anliegenden Haarkleid mit ansprechender Färbung; so hat man ein Zwergmoschustier.
Der Kantjil ( Tragulus pygmeus) ist etwa 45 Zentimeter lang, wovon nur 4 Zentimeter auf den Schwanz kommen; die Höhe am Widerrist beträgt 20 Zentimeter, die am Kreuze 2 Zentimeter mehr. Das ziemlich feine Haar ist am Kopf rötlichfahl, an den Seiten heller, auf dem Scheitel dunkel und fast schwarz, auf der Oberseite des Körpers rötlichgelbbraun, längs des Rückens stark mit Schwarz gemengt, gegen die Seiten zu lichter, an der obern Seite des Halses weiß gesprenkelt und auf der Unterseite weiß. Java, Singapore, Pinang und andere umliegende Eilande sowie die Malaiische Halbinsel sind die Heimat dieses reizenden Geschöpfes; auf Sumatra, Borneo und Ceylon wird es durch verwandte Arten ersetzt. Es lebt auf Java mehr im Gebirge als in der Ebene, am untern Rande der alle Gebirge bedeckenden Urwälder, und zwar in deren Vorgebüschen, von wo aus es die grasbewachsenen Abhänge binnen wenigen Minuten zu erreichen vermag. Niemals trifft man es in Rudeln an; denn es hält sich einzeln und höchstens zur Brunstzeit paarweise. Während des Tages liegt es zurückgezogen, im dichtesten Gebüsch ruhend und wiederkäuend; mit Einbruch der Dämmerung geht es auf Äsung aus und sucht allerlei Blätter, Kräuter und Beeren zur Nahrung. Wasser ist ihm unentbehrlich.
Alle Bewegungen des Tierchens sind äußerst zierlich und leicht, dabei aber sehr lebhaft. Es versteht verhältnismäßig weite Sätze auszuführen und mit viel Geschick allerlei Schwierigkeiten im Wege zu überwinden. Aber die zarten Glieder versagen ihm bald den Dienst, und es würde leicht in die Gewalt der Feinde fallen, wenn es nicht noch ein Verteidigungsmittel besäße, das in einer eigentümlichen List besteht. Gewöhnlich sucht es sich bei Verfolgungen im Gebüsch zu verstecken; sobald es aber sieht, daß es nicht weiter kann, legt es sich ruhig auf den Boden und gibt sich, wie das Opossum unter ähnlichen Umständen, den Anschein, als ob es tot wäre. Der Feind kommt heran und denkt mit einem Griff seine Beute aufzunehmen, aber siehe da, ehe er noch diese erreicht hat, macht unser Tierchen einen oder zwei Sprünge und eilt mit Blitzesschnelle davon.
In der Neuzeit hat man dieses und jenes Zwergmoschustier häufig nach Europa gebracht und hier längere Zeit in Gefangenschaft gehalten. Ich pflegte es wiederholt und sah es oft. Sein Aussehen ist schmuck und nett; es hält sich außerordentlich reinlich und putzt und leckt sich beständig. Die großen, schönen Augen lassen ein geistig hochbegabtes Tier in ihm vermuten; dies ist es jedoch nicht, denn es bekundet in keiner Weise besondern Verstand, ist vielmehr ruhig, still und langweilig. Der Tag teilt sich bei ihm in Fressen, Wiederkäuen und Schlafen. Selten vernimmt man seine zarte, leise Stimme, einen Ton, vergleichbar einem schwachen Blaselaute.
Die Javanesen, die das Tierchen Poetjang nennen, sollen ihm eifrig nachstellen und sein weiches und süßliches Fleisch gern essen. Auch faßt man die zarten Füßchen hier und da in Gold und Silber ein und benutzt sie dann zum Stopfen der Tabakspfeifen.
*
Hirsche. Keine einzige Gruppe der ganzen Ordnung läßt sich leichter kennzeichnen als die Familie der Hirsche ( Cervina). Sie sind geweihtragende Wiederkäuer. Mit diesen Worten hat man sie hinlänglich beschrieben; denn alles übrige erscheint dieser Eigentümlichkeit gegenüber als nebensächlich. Von den Moschustieren unterscheiden sich die Hirsche durch bedeutendere Größe, durch den Besitz von Tränengruben, durch die nur sehr kurzen Eckzähne bei den Männchen mancher Arten und durch eine Haarbürste an den Hinterfüßen. Ihr Bau ist schlank und zierlich, der Leib wohlgeformt und gestreckt, der Hals stark und kräftig, der Kopf nach der Schnauzenspitze zu stark verschmälert; die Beine sind hoch und fein gebaut; die Füße haben sehr entwickelte Afterklauen und schmale, spitzige Hufe. Große, lebhafte Augen, aufrechtstehende, schmale, mittellange und bewegliche Ohren, die glatte, ungefurchte Oberlippe und sechs Backenzähne in jedem Kiefer sind anderweitige Merkmale der Gruppe.
Die Geweihe kommen meist nur den Männchen zu. Sie sind, wie oben angegeben, paarige, knöcherne, verästelte Fortsetzungen der Stirnbeine und werden alljährlich abgeworfen und aufs neue erzeugt. Ihre Bildung und die Absterbung steht im innigen Zusammenhang mit der Geschlechtstätigkeit. Verschnittene Hirsche bleiben sich hinsichtlich des Geweihes immer gleich, d. h. sie behalten es, wenn die Verschneidung während der Zeit erfolgte, wo sie das Geweih trugen, oder sie bekommen es niemals wieder, wenn sie Verschnitten wurden, als sie das Geweih eben abgeworfen hatten; ja einseitig Verschnittene setzen bloß an der unversehrten Seite noch auf. Schon vor der Geburt des Hirsches ist die Stelle, die das Geweih tragen soll, durch eine starke Verknöcherung des Schädels angedeutet. Mit dem sechsten oder achten Monate des Alters bildet sich durch Erhebung der äußern Decke am Stirnbeine ein Knochenzapfen, der während des ganzen Lebens hindurch stehen bleibt: der sogenannte Rosenstock, auf dem die Geweihe sich aufsetzen. Anfänglich sind die Stangen nur einfach spitzig, später verästeln sie sich mehr und mehr, indem von der Hauptstange Sprossen auslaufen, deren Anzahl bis zwölf an jeder Stange ansteigen kann. »Mit dem Alter der Hirsche«, sagt Blasius, »geht eine gewaltige Umänderung der Geweihe vor sich. Die erste und allgemein auffallende Veränderung ist die der Rosenstöcke, die mit der zunehmenden Größe der Stirnzapfen sich mit jedem Jahr erweitern und nach der Mitte der Stirn einander näher rücken; ebenso verringert sich auch mit dem Aufrücken der Stirnkante die Rose und der Schädel in jedem Jahr. Noch auffallender aber sind die Veränderungen in der Gestalt der Geweihe und der Anzahl der Enden.
Die jungen Geweihe, in deren ersten Bildungsanfängen der Grund zum Abwerfen der alten liegt, sind anfangs von einer gefäßreichen, behaarten Haut umgeben, kolbig, weich und biegsam. Erst lösen sich die tieferen, dann die höher stehenden Enden von der Hauptstange los, und nachdem alle in bleibende Verhältnisse ausgebildet und die Enden vereckt sind, stockt der Blutumlauf, und der Hirsch hat das Bedürfnis, die Haut oder den Bast abzuschlagen, der nun auch anfängt, sich von selbst abzulösen.« Die Veränderung des Geweihes, gewissermaßen seine Weiterausbildung, geht nun in folgender Weise vor sich: Schon ehe der Hirsch das erste Lebensjahr erreicht, bilden sich als unmittelbare Fortsetzungen der Rosenstöcke Stangen, die bei manchen Arten der Familie wohl abgeworfen, aber immer in gleicher Weise wieder ersetzt werden, wogegen bei den meisten Hirschen die auf die ersten Stangen, die sogenannten Spieße, folgenden Geweihe, also der Kopfschmuck des zweiten Jahres, einen, bisweilen wohl auch zwei Zacken, Sprossen oder Zinken erhalten. Im Frühjahr des dritten Jahres wiederholt sich derselbe Vorgang; aber die neu aufgesetzte Stange enthält einen Sprossen mehr als im vorigen Jahr, und so geht es fort, bis die größtmöglichste Ausbildung des Tieres erreicht worden ist. Krankheiten oder schlechte Nahrung bringen bisweilen einen Rückgang hervor, indem dann die neu aufgesetzten Stangen je einen oder zwei Sprossen weniger zählen als vorher, und ebenso kann die Geweihbildung durch reichliche Nahrung und ruhige, sorgenlose Lebensweise beschleunigt werden.
Max Schmidt hat über die Bildung und Entwicklung der Geweihe so übersichtlich und wahrheitsgetreu berichtet, daß ich nichts Besseres zu tun weiß, als mich im nachfolgenden auf seine Ausführungen zu stützen. Bei dem neugeborenen Hirsch sind die Stellen, an denen später die Geweihe sich entwickeln, in der Regel durch Haarwirbel angedeutet und erscheinen häufig eher etwas vertieft als erhöht. Gegen Ende des ersten oder zu Anfang des zweiten Jahres treten die Rosenstöcke allmählich hervor, und sobald sie ihre völlige Länge erreicht haben, werden die ersten Spuren eigentlicher Geweihbildung bemerklich. Der stets mit Haut bekleidete Rosenstock hat, je nach der Art, eine sehr verschiedene Höhe, indem er bald kaum über die Fläche der Stirnbeine sich erhebt, bald eine Länge von zwei bis fünf, in einzelnen Fällen sogar bis fünfzehn Zentimeter erreicht. Die im zweiten Lebensjahre zum Vorschein kommenden Geweihfänge sind entweder niedere, höckerige Gebilde oder aber mehr gestreckte, kegelförmige Hervorragungen von ebenfalls sehr verschiedener Länge, je nach Art des Tieres; bei der ersteren Form tritt immer, bei der zweiten zuweilen eine Teilung ein. Hierauf folgt in späteren Jahren die weitere Ausbildung der Geweihe in der angegebenen Weise.
Die Befestigung des Geweihes auf dem Rosenstocke findet derartig statt, daß kleinere oder größere Hervorragungen der Geweihwurzel in entsprechende Vertiefungen der obern Fläche des Rosenstockes eingreifen und umgekehrt. Diese Verbindung ist eine so innige, daß sie auf einem senkrechten Durchschnitt eines frischen ausgebildeten Geweihes und des Rosenstockes nicht sichtbar wird, sondern erst nach dem Austrocknen als eine feingezackte Linie auf der Schnittfläche sich darstellt. Daher kommt es auch, daß bei Anwendung von Gewalt ein Geweih, das nicht dem Abwerfen nahe ist, nicht leicht an dieser Stelle bricht, sondern weit eher der Rosenstock von der Stirnbeinfläche abgesprengt wird.
Bei den meisten Hirschen bemerkt man einige Tage vor dem Abwerfen eine Auftreibung des Hautrandes, der Rosenstock und Geweihwurzel umgibt; der Hirsch schont das Geweih, vermeidet damit anzustoßen und beweist dadurch, daß er ein ungewohntes Gefühl an dieser Stelle verspürt.
Das Abwerfen selbst geschieht infolge des eigenen Gewichts der Stangen oder eines geringen äußern Anstoßes. Höchst selten werden beide Stangen zugleich abgeworfen; es bleibt vielmehr ein Zwischenraum von verschiedener Dauer, die bald wenige Minuten bald mehrere Tage umfaßt, zwischen dem Abwerfen der ersten und der zweiten Stange. Durch sein ganzes Benehmen, besonders aber durch die Haltung des Kopfes und Hängenlassen der Ohren, bekundet der Hirsch, daß das Abwerfen, wenn nicht schmerzhaft, so doch jedenfalls mit einem unbehaglichen Gefühle verbunden ist. Schon mehrere Tage vorher stößt er nicht mehr, sondern wehrt sich wie das Tier durch Schlagen mit den Vorderläufen. Nach dem Abwerfen einer Stange veranlaßt ihn das ungleiche Gewicht, den Kopf schief nach einer Seite geneigt zu tragen, und er schüttelt oft, als wolle er dadurch die andere Stange ebenfalls entfernen. Anwendung von Gewalt findet zwar auch, jedoch seltener statt, insbesondere dann, wenn der Hirsch verstümmelte Geweihe trug.
Unmittelbar nach dem Abwerfen beginnt die Neubildung des Kopfschmuckes. Sömmering hat sich der Mühe unterzogen, den Aufbau des Geweihes eines gefangen gehaltenen Edelhirsches genau zu beobachten und zu beschreiben, und seine Schilderung gibt ein sehr getreues Bild dieses Vorgangs. »Nach dem Abwerfen beider Stangen sucht der Hirsch im Freien die Ruhe, tut sich an einsamen Plätzen nieder und scheint ermattet zu sein. Er trägt den Kopf gern gesenkt und meidet jeden Anstoß, jede Berührung desselben. Schon am zweiten Tage nach dem Abwerfen ist die Mitte der Wundfläche mit schwärzlich rotbraunem Schorfe bedeckt, die sich immer mehr nach der Mitte zusammenzieht, während der Ringwulst breiter und höher wird. Am vierten Tag ist die eigentliche Wundfläche schon sehr verkleinert, im Durchmesser 28 Millimeter, der Ringwulst dagegen 12 Millimeter breit, letzterer erhabener gewölbt und gefurcht, seine dünne Oberhaut so empfindlich, daß sie leicht blutet. Dasselbe beobachtet man auch noch am achten Tage; nur ist inzwischen der Ringwulst wieder merklich breiter und höher geworden, jedoch noch völlig rund geblieben, ohne den behaarten Hautrand seitlich zu überragen. Am vierzehnten Tage hat die mittlere Wundstelle sich wiederum bedeutend verkleinert. Der Wulst ist im Umfang allenthalben, am meisten aber nach vorn, über den Rand des behaarten Rosenstockes ausgedehnt, so daß man sehr deutlich den Anfang zu dem zuerst sich bildenden untersten Ende des Geweihes, des Augensprosses, wahrnimmt. Von dessen Spitze aus gemessen hat der Wulst oder Kolben nur einen Durchmesser von 72 Millimeter, während jener der mittlern Vertiefung nur noch 16 Millimeter beträgt. Am zwanzigsten Tage beginnt der nun nach allen Seiten stark hervortretende grauschwarze Kolben mit weißlichen Haaren sich zu bedecken; seine Oberhaut ist fester geworden und nicht allein der Ansatz zu den Augensprossen stärker hervorgetreten, sondern namentlich der hintere Teil des Kolbens, aus dem die Stange sich erheben soll, breiter, höher, massenhafter ausgebildet. Von nun an verschwindet die kleine vertiefte Mittelfläche bald gänzlich, und der Kolben wächst rascher in die Breite und Höhe. Außer dem, am dreiundzwanzigsten Tage bereits 60 Millimeter langen Augensproß teilt er sich in eine kleinere vordere und eine stärkere hintere Halbkugel, aus der das zweite Ende, der Eissproß, und die Stange selbst sich bilden. Er ist nur dicht mit weißlichen Haaren bedeckt und hat daher eine graue Färbung bekommen. Im Verlaufe der nächsten zehn Tage hat sich das Ansehen der Kolben bedeutend verändert. Das ganze Geweih ist gleichsam in der Anlage schon vorhanden; alle Enden sind durch mehr oder minder hervorragende Abteilungen und Einschnitte des Kolbens angedeutet. Letzterer gleicht einer Pflanze, die im Frühling nach der Winterruhe schon ihren Stengel gebildet hat, aus dem Blätter und Blüten hervortreiben, nachdem das Wachstum der Wurzel vollendet ist. Nun erst sieht man deutlich einen über den Rand des behaarten Rosenstockes hervorragenden bläulichen, gefäßreichen Ring, den Anfang der sich bildenden Rose und ihrer Perlen, am Grunde des Geweihes. Darüber ragt der Augensproß hervor. Die Spitze ist sehr breit geworden und beginnt durch Furchung sich zu gabeln. Zwölf Tage später, am fünfundvierzigsten des Wachstums, ist die letzte Gablung oder Teilung der Kolben noch nicht vollständig; am neunundfünfzigsten Tage sind alle vorhandenen Enden bereits ziemlich lang geworden, und der Augensproß hat sich bereits zugespitzt. Der obere Teil des Geweihes teilt sich jedoch erst am zweiundsechzigsten Tage und ist am neunundsiebenzigsten Tage fertig, aber noch mit stark behaartem und gefäßreichem Bast überzogen, der sehr empfindlich sein muß, weil der Hirsch noch immer das Geweih schont. Noch am hundertundzwanzigsten Tage, um welche Zeit das Geweih vollständig ausgewachsen ist und seine Enden bis zu den Spitzen knochenhart sind, blutet der Augensproß bei der geringsten Verletzung. Erst zwanzig Tage später fegte der in Rede stehende Hirsch.«
Der hier beschriebene Hergang der Neubildung des Geweihes gilt für alle Hirsche, nur mit der Maßgabe, daß das Wachstum bei dem einen längere, bei dem andern kürzere Zeit beansprucht. Nachdem der Bast oder häutige Überzug des Geweihes seine Dienste getan hat, trocknet er ein, und der Hirsch reibt nunmehr die sich loslösenden Fetzen desselben an Bäumen und Gesträuchen ab, wodurch gleichzeitig die Geweihe, hauptsächlich wohl von dem Safte der dabei beschädigten Pflanzen, dunkler gefärbt werden.
Im allgemeinen ist die Gestalt des Geweihes eine sehr regelmäßige, obgleich Örtlichkeit und Nahrung Veränderungen zur Folge haben können. Für die Artbestimmung bleibt das Geweih immer noch eines der Hauptmerkmale.
Schon in der Vorzeit waren die Hirsche über einen großen Teil der Erdoberfläche verbreitet. Gegenwärtig bewohnen sie mit Ausnahme des größten Teils von Afrika und von ganz Australien alle Erdteile und so ziemlich alle Klimate, die Ebenen wie die Gebirge, die Blößen wie die Wälder. Manche leben gemsenartig, andere so versteckt als möglich in dichten Waldungen, diese in trockenen Steppen, jene in Sümpfen und Morästen. Nach der Jahreszeit wechseln viele ihren Aufenthalt, indem sie, der Nahrung nachgehend, von der Höhe zur Tiefe herab- und wieder zurückziehen; einige wandern auch und legen dabei unter Umständen sehr bedeutende Strecken zurück. Alle sind gesellige Tiere, manche rudeln sich oft in bedeutende Herden zusammen. Die alten Männchen trennen sich gewöhnlich während des Sommers von den Rudeln und leben einsam für sich oder vereinigen sich mit ihren Geschlechtsgenossen; zur Brunstzeit aber gesellen sie sich zu den Rudeln der Weibchen, rufen andere Gesinnungstüchtige zum Zweikampfe heraus, streiten wacker miteinander und zeigen sich überhaupt dann außerordentlich erregt und in ihrem ganzen Wesen wie umgestaltet. Die meisten sind Nachttiere, obwohl viele, namentlich die, die die hohen Gebirge und die unbewohnten Orte bevölkern, auch während des Tages auf Äsung ausziehen. Alle Hirsche sind lebhafte, furchtsame und flüchtige Geschöpfe, rasch und behend in ihren Bewegungen, feinsinnig, geistig jedoch ziemlich gering begabt. Die Stimme besteht in kurz ausgestoßenen, dumpfen Lauten bei den Männchen und in blökenden bei den Weibchen.
Nur Pflanzenstoffe bilden die Nahrung der Hirsche; wenigstens ist noch keineswegs erwiesen, ob die Renntiere, wie man behauptet hat, Lemminge fressen oder nicht. Gräser, Kräuter, Blüten, Blätter und Nadeln, Knospen, junge Triebe und Zweige, Getreide, Obst, Beeren, Rinde, Moose, Flechten und Pilze bilden die hauptsächlichsten Bestandteile ihrer Äsung. Salz erscheint ihnen als Leckerei, und Wasser ist ihnen Bedürfnis.
Die Hirschkuh wirft ein oder zwei, in seltenen Fällen drei Junge, die vollständig ausgebildet zur Welt kommen und schon nach wenigen Tagen der Mutter folgen. Bei einigen Arten nimmt sich auch der Vater seiner Nachkommenschaft freundlich an. Die Kälber lassen sich Liebkosungen seitens ihrer Mutter mit vielem Vergnügen gefallen, und diese pflegt jene aufs sorgfältigste, schützt sie auch bei Gefahr.
In Gegenden, wo Ackerbau und Forstwirtschaft den Anforderungen der Neuzeit gemäß betrieben werden, sind die Hirsche nicht Mehr zu dulden. Der Schaden, den die schönen Tiere anrichten, übertrifft den geringen Nutzen, den sie bringen. Sie vertragen sich leider nicht mit der Land- und Forstwirtschaft. Wäre die Jagd nicht, die mit Recht als eine der edelsten und männlichsten Vergnügungen gilt, man würde sämtliche Hirsche bei uns längst vollständig ausgerottet haben. Noch ist es nicht bis dahin gekommen; aber alle Mitglieder dieser so vielfach ausgezeichneten Familie, die bei uns wohnen, gehen ihrem sichern Untergange entgegen und werden wahrscheinlich schon in kurzer Zeit bloß noch in einem Zustande der Halbwildheit, in Tierparks und Tiergärten nämlich, zu sehen sein.
Die Zähmung der Hirsche ist nicht so leicht, als man gewöhnlich annimmt. In der Jugend betragen sich freilich alle, die frühzeitig in die Gewalt des Menschen kamen und an diesen gewöhnt wurden, sehr liebenswürdig, zutraulich und anhänglich; mit dem Alter aber schwinden diese Eigenschaften mehr und mehr, und fast alle alten Hirsche werden zornige, boshafte und rauflustige Geschöpfe. Hiervon macht auch die eine, schon seit längerer Zeit in Gefangenschaft lebende Art, das Ren, keine Ausnahme. Seine Zähmung ist keineswegs eine vollständige, wie wir sie bei andern Wiederkäuern bemerken, sondern nur eine halbgelungene.
*
Wir stellen die Riesen der Familie obenan, obgleich sie nicht die vollendetsten, sondern eher die am mindesten entwickelten Hirsche sind. Die Elentiere ( Alces), die gegenwärtig noch einen einzigen oder, wenn man das amerikanische Mostier als besondere Art erklärt, zwei Vertreter haben, sind gewaltige, plump gebaute, kurz- und dickhalsige, hoch- und kurzleibige, hochbeinige Geschöpfe, mit schaufelartig ausgebreiteten, fingerförmig eingeschnittenen, vielfach gezackten Geweihen, an denen die Augen- und die Mittelsprossen fehlen; sie besitzen kleine Tränengruben, Haarbüschel an der Innenseite der Fußwurzel und Klauendrüsen, aber keine Eckzähne. Der Kopf ist häßlich, die obere Lippe hängt über; die Augen sind klein, die Ohren lang und breit; der Schwanz ist sehr kurz.

Elch (Alces palmatus)
Schon seit alten Zeiten ist der Elch oder das Elen ( Alces palmatus) hoch berühmt. Über den Ursprung des Namens ist man noch nicht im klaren. Einige behaupten, daß er aus dem alten Worte »elend« oder »elent« gebildet sei und soviel wie stark bedeute; andere nehmen an, daß er von dem slawischen Worte »Jelen« – Hirsch – herstammen soll. So viel ist sicher, daß der lateinische Name nach dem deutschen gebildet wurde. Bereits die alten römischen Schriftsteller kennen den Elch als deutsches Tier. »Es gibt im Hercynischen Walde«, sagt Julius Cäsar, » Alces, den Ziegen in Gestalt und Verschiedenheit der Färbung ähnliche Tiere, aber größer und ohne Hörner, die Füße ohne Gelenke. Sie legen sich auch nicht, um zu ruhen, und können nicht aufstehen, wenn sie gefallen sind. Um zu schlafen, lehnen sie sich an Bäume; daher graben diese die Jäger aus und hauen sie so ab, daß sie leicht umfallen, samt dem Tiere, wenn es sich daran lehnt.« Plinius gibt noch an, daß das Elen eine große Oberlippe hat und deshalb rückwärts weiden müsse. Pausanias weiß, daß bloß das Männchen Hörner trägt, nicht auch das Weibchen. Unter Gordon III., zwischen den Jahren 238 bis 244 nach Christus, wurden zehn Stück Elentiere nach Rom gebracht; Aurelian ließ sich mehrere bei seinem Triumphzuge voranführen. Im Mittelalter wird das Tier oft erwähnt, namentlich auch im Nibelungenliede, wo es unter dem Namen »Elk« vorkommt. Wenn die Sage recht berichtet, wäre zu dieser Zeit das Elentier durch ganz Deutschland bis zum äußersten Westen hin vorgekommen; denn gerade bei der Beschreibung der Jagd Siegfrieds im Wasgau heißt es:
»Danach schlug er wieder ein Wisent und einen Elk,
Starker Auer viere und einen grimmen Schelk.«
In den Urkunden des Kaisers Otto des Großen vom Jahre 943 wird geboten, daß niemand ohne Erlaubnis des Bischofs Balderich in den Forsten von Drenthe am Niederrhein Hirsche, Bären, Rehe, Eber und diejenigen wilden Tiere jagen dürfe, die in der deutschen Sprache Elo oder Schelo heißen. Dasselbe Verbot findet sich noch in einer Urkunde Heinrichs II. vom Jahre 1006 und in einer andern von Konrad II. vom Jahre 1025. In den norddeutschen Torfmooren, bei Braunschweig, in Hannover, Pommern, in alten Hünengräbern usw., findet man jetzt noch Elengeweihe, gewöhnlich in versteinertem Zustande. Der oftgenannte Bischof von Upsala, Olaus Magnus, ist der erste, der den Elch näher kennzeichnet. »Wie die Hirsche«, sagt er, »schwärmen diese Tiere herdenweise in den großen Wildnissen umher und werden häufig von den Jägern in ausgespannten Netzen oder in Klüften gefangen, wohinein man sie durch große Hunde treibt und mit Spießen und Pfeilen erlegt; auch das Hermelin springt ihnen manchmal, wenn sie auf dem Boden weiden oder auch aufrecht stehen, an die Kehle und beißt sie dermaßen, daß sie verbluten. Die Elentiere kämpfen mit den Wölfen und schlagen sie oft mit den Hufen tot, besonders auf dem Eise, wo sie fester stehen als die Wölfe.« »In Pommern«, sagt Kantzow in seiner Pomerania (1530), »hat's auch große Heiden, daselbst pflegt man elende. Das thier hat von seiner vnmacht den namen bekhomen, den es hat nichts, damit es sich veren khan; es hat wol breite hörner, aber es weiß sich nicht mit zu behelffen, sondern es verbirgt sich in die vnwegsamsten sümpfe und walde, da es sicher sey. Es khan aber einen minschen oder hundt weit erwittern; dasselbige ist ihme offt zu heyl, sobald aber die hunde zu jme khomen, ist's gefangen. Die klawen helt man für die fallende sucht gut, darumb macht man ringe daraus und traget sie über den Fingern. Etzliche haben gemeint, es habe keine knie oder gelenke, aber das ist falsch« usw. Auch der alte Geßner, der die Fabeln der Alten wiedergibt, ist der Meinung, daß der Name Elen dem Tiere gebührt: »Ist sunst ein wol geplaget thier, vnd mit dem rechten namen genannt ein Ellend, das täglichs vor dem fallenden siechtiger ernider geworffen wirt, vnd daruon nit er erledigt ee es sein klawen des rechten hindern lauffs in das linck or stoßt.«
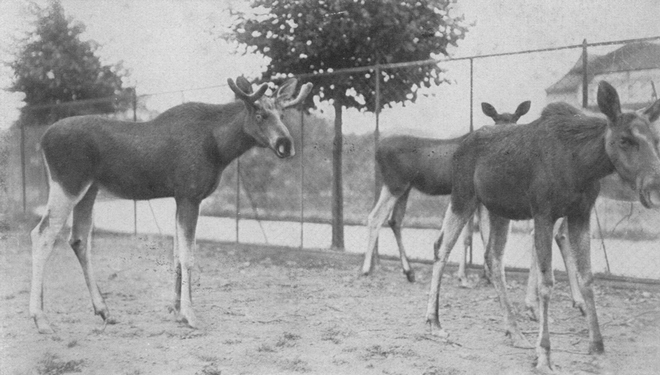
Junge Elche (Alces palmatus)
In den letzten Jahrhunderten hat sich der Elchwildstand in Europa überall in rasch zunehmender Steigerung vermindert. Noch im siebenzehnten, möglicherweise sogar im achtzehnten Jahrhundert ist der Elch hier und da in Sachsen und Schlesien vorgekommen. In Sachsen wurde das letzte Elen im Jahre 1746, in Schlesien, laut Haugwitz, das letzte im Jahre 1776 erlegt. In Pommern scheint es sich ebensolange erhalten zu haben; in Ostpreußen war es um diese Zeit noch ziemlich verbreitet; doch mußte auch hier schon nach dem Siebenjährigen Kriege ein Gebot zur Schonung des Elchwildstandes erlassen werden. Zu Anfang dieses Jahrhunderts gab es in den Forsten Schorell, Tzulkien und Skallisen noch viel Elenwild. Im Forste Ibenhorst bei Tilsit hat es sich, geschützt durch königliche Bestimmung, bis auf unsere Tage erhalten. Zwar waren die Tiere im Jahre der Jagdfreiheit 1848 auch hier bis auf sechzehn vermindert worden und im darauffolgenden Jahre sogar bis auf elf zurückgegangen; strengste Schonung aber hob nach und nach den Wildstand wieder, so daß derselbe gegenwärtig (1874), laut Angabe des königlichen Oberförsters Axt, in den Ibenhorster Forsten sechsundsiebenzig Stück beträgt. Bis zum Weltkrieg war die Zahl dieser Tiere weiterhin auf etwa 300 Stück angewachsen. Durch den Krieg aber sind sie dann nahezu völlig dezimiert worden
Abgesehen von diesen unter strengster Aufsicht stehenden Gehegen findet man den Elch in den höheren Breiten aller waldreichen Länder Europas und Asiens. In unserm Erdteile ist er auf die baltischen Niederungen, außer Ostpreußen also auf Litauen, Kur- und Livland, sowie auf Schweden und Norwegen und einige Strecken Großrußlands beschränkt. In Norwegen bewohnt er die östlichen Provinzen des Südens, in Schweden die daranstoßenden westlichen oder mit andern Worten, die ungeheuren Waldungen, die das sogenannte Kjölengebirge bedecken, namentlich also Wermeland, Dalekarlien, Herjedalen, Oesterdalen, Hedemarken, Gulbrandsdalen und Valdersdalen. Weit häufiger als in Europa lebt der Elch in Asien. Er breitet sich hier über den ganzen Norden bis an den Amur aus und kommt überall vor, wo es große ausgedehnte Wälder gibt, nach Norden hin, soweit der Baumwuchs reicht. Im Stromtale der Lena, am Baikalsee, am Amur, in der Mongolei und Tungusien hält er sich noch immer in ziemlicher Anzahl.
Das Elen ist ein gewaltiges Tier. Die Leibeslänge eines erwachsenen Elchhirsches beträgt 2,6 bis 2,9 Meter, die Länge des Schwanzes ungefähr 10 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 1,9 Meter, am Kreuze einige Zentimeter weniger. Sehr alte Tiere können ein Gewicht von fünfhundert Kilogramm erreichen; als Durchschnittsgewicht müssen jedoch drei- bis vierhundert Kilogramm betrachtet werden. Der Leib des Elchs ist verhältnismäßig kurz und dick, breit an der Brust, hoch, fast höckerig am Widerrist, gerade am Rücken, niedrig am Kreuze. Er ruht auf sehr hohen und starken Beinen von gleicher Länge, die mit schmalen, geraden, tiefgespaltenen und durch eine ausdehnbare Bindehaut vereinigten Hufen beschuht sind; die Afterklauen berühren leicht den Boden. Auf dem kurzen, starken und kräftigen Halse sitzt der große, langgestreckte Kopf, der vor den Augen verschmälert ist und in eine lange, dicke, aufgetriebene, sehr breit nach vorn abgestutzte Schnauze endet. Diese ist durch die knorpelige Nase und die den Unterkiefer weit überragende, dicke, sehr stark verlängerte, höchst bewegliche, gefurchte Oberlippe fast verunstaltet. Die kleinen und matten Augen liegen tief in den stark vortretenden Augenhöhlen; die Tränengruben sind unbedeutend. Große, lange, breite, aber zugespitzte Ohren stehen nach seitwärts gerichtet am Hinterkopfe, neigen sich aber oft schlotternd gegeneinander. Das Geweih des erwachsenen Männchens besteht aus einer großen, einfachen, sehr ausgebreiteten, dreieckigen, platten, schaufelförmigen, gefurchten Krone, die an ihrem äußern Rande mit zahlreichen Zacken besetzt ist, und wird von kurzen, dicken, gerundeten, mit wenigen Perlen besetzten Stangen getragen, die auf kurzen Rosenstöcken sitzen und sich sogleich seitlich biegen. Im ersten Herbste bemerkt man beim jungen Bocke da, wo das Geweih aufsitzt, einen dichten Haarwulst, im nächsten Frühjahre erhält er die Rosenstöcke, im zweiten einen etwa 30 Zentimeter langen Spieß, der erst im folgenden Winter abgeworfen wird. Allmählich zerteilt sich das Geweih mannigfaltiger. Im fünften Jahre entsteht eine flache Schaufel, verbreitert sich fortan und teilt sich an den Rändern in immer mehr Zacken, deren Anzahl bis in die zwanzig steigen kann. Das Geweih erreicht ein Gewicht von etwa zwanzig Kilogramm.
Die Behaarung des Elen ist lang, dicht und straff. Sie besteht aus gekerbten, dünnen und brüchigen Grannen, unter denen kurze, feine Wollhaare sitzen; über die Firste des Nackens zieht eine starke, sehr dichte, der Länge nach geteilte Mähne, die sich gewissermaßen am Halse und an der Vorderbrust fortsetzt und bis zwanzig Zentimeter lang wird. Sonderbarerweise sind die Bauchhaare von rückwärts nach vorn gerichtet. Die Färbung ist ein ziemlich gleichmäßiges Rötlichbraun, das an der Mähne und den Kopfseiten in glänzendes Dunkelschwarzbraun, an der Stirne ins Rötlichbraune und am Schnauzenende ins Graue zieht; die Beine sind weißlichaschgrau, die Augenringe grau. Vom Oktober bis zum März ist die Färbung etwas heller, mehr mit Grau gemischt. – Das weibliche Tier ist kaum kleiner, trägt aber kein Geweih und hat längere und schmälere Hufe sowie kürzere und wenig nach auswärts gerichtete Afterklauen. Sein Kopf erinnert an den eines Esels oder Maultiers. Im Winterkleide unterscheidet sich das weibliche Elentier vom Hirsche durch einen senkrecht gestellten, schmalen Streifen unter dem Feigenblatte.
Wilde, einsame, an Brüchen und unzugänglichen Mooren reiche Wälder, namentlich solche, in denen Weiden, Birken, Espen und andere Laubbäume stehen, bilden den Stand des Elchwildes. Der Forst von Ibenhorst besteht aus zweitausend Morgen mit Kiefern, Fichten und Birken bestandenem Höhenboden, sechstausend Morgen Torfmooren und einigen vierzigtausend Morgen Erlenbruch, in dem einzelne Birken und Eschen eingesprengt sind. Zwischen den Erlenstöcken und an den Rändern der Gräben wachsen in großer Ausdehnung Weidenwerft, Rohr, Schilf, Gräser, Brennesseln von gewaltiger Höhe und dergleichen mehr, wodurch die wildesten Dickungen hergestellt werden. Ein so beschaffenes und bestandenes Gebiet gewährt diesem Hirsche alle Bedingungen zu einem ihm behaglichen Leben; nicht minder zusagend sind ihm übrigens auch ausgedehnte, nasse Schwarzholzwaldungen, vorausgesetzt, daß in ihnen Weidenarten nicht gänzlich fehlen. Sümpfe und Moore scheinen zu seinem Gedeihen und Wohlbefinden unumgänglich notwendig zu sein. Das plumpe Geschöpf durchmißt Moräste, die weder Mensch noch Tier gefahrlos betreten könnten, mit Leichtigkeit. Vom April bis zum Oktober hält es sich in den tiefer gelegenen, nassen Gegenden auf, später sucht es sich erhöhte, die den Überschwemmungen nicht ausgesetzt und im Winter nicht mit Eis bedeckt sind. Bei stillem, heiterem Wetter bevorzugt es Laubhölzer, bei Regen, Schnee und Nebel Nadelholzdickungen. Aus Mangel an Ruhe oder hinlänglicher Äsung verändert es leicht seinen Standort. Im Ibenhorster Forste begibt es sich im Winter, den Erlenbruch verlassend, nach den Torfmooren und in die hochgelegenen Kieferwaldungen; in Livland, Rußland und Skandinavien streift es weit umher; in Ostsibirien tritt es, wenn auf den Höhen viel Schnee fällt, in die Ebenen herab, zieht in sehr schneereichen Wintern sogar bis in die außerdem streng gemiedenen kahlen Hochsteppen hinaus. Die Tiere mit ihren Kälbern suchen hier, laut Radde, zum Winterstande besonders gern die Nordabhänge gut bewaldeter, namentlich bestrauchter Gebirge auf, wohin der alte Hirsch nicht folgt, weil ihm diese Hölzer, seines weit seitwärts ausgelegten Geweihes halber, hinderlich werden. Ein Bett bereitet sich der Elch in keinem Falle, legt sich vielmehr stets ohne weiteres nieder, gleichviel, ob es Sumpf oder Moor oder ob es trocknen oder schneebedeckten Waldboden zum Orte seiner Ruhe erwählt.
Um die Lebensgeschichte des Elen möglichst vollständig und wahrheitsgemäß schildern zu können, habe ich in Ibenhorst selbst Erkundigungen eingezogen und durch die Güte der Herren Forstmeister Wiese, Oberförster Axt und Förster Ramonaht ebenso ausführliche wie unsere Kenntnis des Tieres bereichernde Miteilungen erhalten. Infolge der ihm seit Jahrzehnten gewährten Schonung lebt der Elch in den Ibenhorster Forsten allerdings unter andern Verhältnissen als in den übrigen Teilen seines Verbreitungsgebietes und hat insbesondere die Scheu vor dem Menschen fast gänzlich verloren, benimmt und beträgt sich jedoch nicht wie ein gefangenes, sondern wie ein freies Tier, bekundet alle Eigenarten eines solchen und darf deshalb immerhin für eine Lebensschilderung als maßgebend erachtet werden.
In seiner Lebensweise weicht das Elentier vielfach von der des Hirsches ab. Wie dieser schlägt es sich zu Rudeln von sehr verschiedener Stärke zusammen, und nur gegen die Satzzeit hin sondern sich von diesen Rudeln die alten Hirsche ab, gewöhnlich eigene Gesellschaften für sich bildend. In Gegenden, wo es zwar allgemein verbreitet ist, aber doch nicht häufig auftritt, wie beispielsweise in Ostsibirien, rudelt es sich im Winter zu kleinen Trupps, geht dagegen im Sommer stets einzeln oder höchstens das Tier mit seinem Kalbe; in den Ibenhorster Forsten vereinigt es sich im Spätherbste, wenn die Überschwemmung der Bruchwaldungen es zwingt, auf den Mooren und im Hochwalde Stand zu nehmen, zu Rudeln von fünfundzwanzig bis vierzig Stücken. Diese Gesellschaften bestehen regelmäßig aus Hirschen und noch nicht fertigen Tieren, weil das Mutterwild, aus übergroßer Sorge um seine Kälber, nicht allein die Hirsche höchst unfreundlich behandelt, sondern ebenso andere Tiere und deren Kälber meist abschlägt. Von einem friedfertigen Zusammenleben der Elche bemerkt man überhaupt wenig. Jedes einzelne Stück hat oft mit dem andern etwas auszumachen, eins vertreibt das andere von der warmgelegenen Stelle, und dem Mutterwilde muß alles übrige weichen; dieses bekundet nicht einmal gegen verwaiste Kälber freundliche Gesinnung, sondern vertreibt sie ebenso rücksichtslos wie jedes sonstige Stück des Rudels aus seiner Nähe. Solange die Brunst sie nicht beeinflußt, zeigen sich die Hirsche weit geselliger als die Tiere, nehmen beispielsweise mutterlose Kälber ohne weiteres in ihre Rudel auf; während der Brunst dagegen betätigen auch sie die Unfriedsamkeit ihres Geschlechts, suchen, jeder für sich, so viele Tiere als möglich zusammenzutreiben und zusammenzuhalten und schlagen alle andern Hirsche von sich ab. Im Frühjahr zerstreuen sich die Rudel vollständig und leben, abgesehen von den Tieren mit ihren Kälbern, einzeln oder zu zweien und dreien vereinigt.
Mehr noch als den übrigen Hirschen sind dem Elche Störungen aller Art aufs tiefste verhaßt. Er verlangt unbedingte Ruhe und verläßt eine Gegend, in der er wiederholt behelligt wurde. In den Ibenhorster Forsten, wo er sich an den Menschen und sein Treiben nach und nach gewöhnt hat, ist unser Wild sorglos geworden.
Wo er sich ungestört weiß, bettet er, abgesehen vielleicht von kurzer Ruhe, nur in den Vor- und Nachmittagsstunden und streift schon von vier Uhr nachmittags an, in den Abend-, den ersten Nacht-, den Früh- und Morgenstunden umher; im entgegengesetzten Falle wählt er die Nachtzeit, um nach Äsung auszuziehen. Nach Wangenheim besteht diese in Blättern und Schößlingen der Moorweide, Birke, Esche, Espe, Eberesche, des Spitzahorn, der Linde, Eiche, Kiefer, Fichte, in Heide, Moorrosmarin, jungem Röhricht und Schilfe, in schossendem Getreide und Lein. In den Ibenhorster Forsten geht der Elch alle Baum- und Straucharten an, die daselbst wachsen, außer den genannten beispielsweise noch Faulbaum, Hasel und Erle. Von letzterer nimmt er, namentlich seitdem die Weidenarten seltener geworden sind, besonders gern die jährigen Ausschläge, zweijährige Schößlinge ab und zu, jedoch schon seltener, ältere Zweige und Schossen dagegen niemals. Im Moore äst er vorzugsweise von Heidekraut, Wollgras und Schachtelhalmen, mit denen er zuweilen seinen Wanst vollständig anfüllt. In den Monaten Mai und Juni bilden letztere und Kuhblumen seine hauptsächlichste Äsung. Junge Saat nimmt der Elch ebensowenig wie in den Ähren stehendes Getreide, wohl aber letzteres, während es schoßt, den Hafer, während er in Milch steht. Dementsprechend besucht er Getreidefelder im Mai und Juni sehr regelmäßig, wogegen er dieselben früher oder später nicht betritt. In Ostsibirien äst der Elch hauptsächlich von den niedrigen Gebüschen der Zwerg- und Buschbirke, mit besonderer Leckerhaftigkeit aber auch von den fleischigen Wurzeln einiger Wasserpflanzen, denen zu Liebe er im Sommer zu den Talseen herabsteigt, und die er tauchend gewinnen muß. Ähnlich verfährt er auch in Ibenhorst, um sich einzelner im Wasser stehender Pflanzen zu bemächtigen. Grasend zu äsen, wie andere Hirsche tun, vermag er nicht, weil ihn die lange, schlotternde Oberlippe daran hindert, wohl aber ist er imstande, ebenso wie schossendes Getreide höhere Grashalme abzupflücken. Hierzu wie zum Abbrechen von Gezweigen weiß er seine rüsselförmige Hängelippe sehr geschickt zu gebrauchen. Beim Abrinden setzt er seine Schneidezähne wie einen Meißel ein, schält ein Stückchen Rinde los, packt dieses mit den Zähnen und Lippen und reißt dann nach oben zu lange Streifen der Rinde ab. Höhere Stangen biegt er mit dem Kopfe nieder, bricht dann die Kronen ab und äst von dem Gezweigs und von der Rinde. Hierbei bevorzugt er, wie leicht erklärlich, alle saftrindigen Bäume und Gesträuche, als da sind Espe, Esche, Weide und Pappel, derart, daß er nicht selten selbst sehr starke Espen noch vollständig entrindet. Unter den Nadelbäumen zieht er die Kiefer allen übrigen vor, wogegen er die Fichte nur im höchsten Notfalle angeht. In Ibenhorst kümmert er sich so wenig um die Waldarbeiter, daß er in deren Gegenwart auf frischen Kiefernschlägen sich einfindet, um die Nadeln der gefällten Bäume zu verzehren. Selbst mehr als fingerdicke Zweige vermag er auszunutzen; er zermalmt dieselben so vollständig, daß man in der Losung stets nur sehr fein zerschrotene Holzfasern findet. Wasser zum Trinken ist ihm jederzeit Bedürfnis, und er bedarf davon viel, um sich zu sättigen.
Die Bewegungen des Elentieres sind weit weniger ebenmäßig und leicht als die des Edelwildes. Es vermag nicht anhaltend flüchtig zu sein, trollt aber sehr schnell und mit unglaublicher Ausdauer; manche Schriftsteller behaupten, daß es in einem Tage dreißig Meilen zurücklegen könne. Beim Sichtbarwerden eines Menschen oder vor dem Nehmen eines Hindernisses pflegt es einen Augenblick haltzumachen und dann erst weiterzugehen, bei Gefahr sich selten zurückzuwenden, vielmehr mit derselben Gemächlichkeit wie früher fortzutrollen.
Eine höchst sonderbare Bewegungsart in wasserreichen Mooren schildert Wangenheim. Der Elch läßt sich da, wo der Boden ihn nicht mehr tragen kann, wenn er läuft, auf die Hessen nieder, streckt die Vorderläufe gerade vorwärts aus, greift mit den Schalen ein, stemmt die Hessen nach und gleitet so über die schlammige Fläche; da, wo diese ganz schlotterig ist, legt er sich sogar auf die Seite und hilft sich durch Schlagen und Schnellen mit den Läufen fort. Förster Ramonaht versichert, dasselbe wiederholt gesehen zu haben und bestätigt Wangenheims Mitteilungen in jeder Beziehung. »In gar zu grundlosen Sümpfen«, bemerkt O. von Löwis hierzu, »bleibt das Elen zuweilen doch jämmerlich stecken. So versank im April des Jahres 1866 auf dem Gute Ohlershof in Livland ein starker Hirsch derartig in dem Schlamme eines abgelassenen Sees, daß herzukommende Leute ihn mit Stricken anbinden konnten, hierauf mit vieler Mühe herauszogen und auf das Gehöft brachten, woselbst er sodann drei Wochen lang in einem Pferdestalle gehalten wurde.« Gefährlich werden ihm insbesondere schlammige Stellen mit steilen Ufern, deren Höhe er mit den Vorderläufen nicht erreichen kann, wogegen er auch solche Hindernisse leicht überwindet, wenn er die Vorderläufe zusammengeknickt auf nicht nachgebendes Erdreich legen kann, worauf er dann den Leib ohne sonderliche Anstrengung nachzieht und damit wieder festen Boden gewinnt. Im Schwimmen ist der Elch Meister. Er geht nicht bloß aus Not in das Wasser, sondern, wie manche Rinderarten, zu eigener Lust und Freude, um sich zu baden und zu kühlen, sucht auch in Ostsibirien die tieferen Gebirgsschluchten auf, in denen der Schnee lange liegen bleibt, und liebt es sich, auf ihm herumzuwälzen. Auf glattem, schneefreiem Eise kann er nicht lange gehen, und wenn er auf dem glatten Spiegel einmal gefallen ist, kommt er nur sehr schwer wieder auf die Läufe. Anfänglich, so versichern meine Ibenhorster Freunde, läuft unser Hirsch auch auf glattem Eise recht gut, bald aber »erwärmen sich« oder, was wohl richtiger sein dürfte, erweichen die Schalen seiner Hufe, und dann stürzt er leicht und öfters nacheinander. Während des Trollens vernimmt man ein hörbares Anschlagen der Afterklauen an die Ballen; dieses Geräusch nennt der Weidmann »Schellen«. Bei eiligem Laufe legt der Elchhirsch das Geweih fast wagerecht zurück und hebt die Nase hoch in die Höhe; deshalb strauchelt er öfters und fällt auch leicht nieder; dann zuckt er, um sich wieder aufzuhelfen, in eigentümlicher Weise mit den Läufen und greift namentlich mit den Hinterläufen weit nach vorwärts. Hierauf gründet sich die Fabel, daß das Tier an der Fallsucht leide.
Der Elch vernimmt ausgezeichnet, äugt und wittert oder windet aber weniger gut. Hinsichtlich seiner geistigen Fähigkeiten scheint er sein plumpes und dummes Aussehen nicht Lügen zu strafen. Seine Handlungen deuten auf geringen Verstand. Er ist wenig scheu und noch viel weniger vorsichtig, lernt kaum, wirkliche Gefahr von bloß eingebildeter zu unterscheiden, betrachtet seine Umgebung im ganzen teilnahmlos, fügt sich nur schwer in veränderte Verhältnisse und bekundet überhaupt ein wenig bildsames Wesen. Seine geselligen Eigenschaften sind in keiner Weise entwickelt; von einem festen Zusammenhalte des Rudels bemerkt man nichts; jedes einzelne Stück desselben handelt vielmehr nach eigenem Ermessen, und nur das Kalb folgt seiner Mutter, nicht aber das gesammte Rudel einem Leittiere, wie dies bei andern Hirschen der Fall zu sein pflegt. Fressen und Ruhen scheinen dem Elche als die höchsten Lebensaufgaben zu gelten; nur die Brunst verändert das gleichmäßige Einerlei seines Wesens.
Alte Elchhirsche werfen im November, frühestens im Oktober, jüngere um mehr als einen Monat später ab; erstere fegen im Juli, letztere erst im August, zuweilen noch später. Die Neubildung des Geweihes geschieht insofern in eigentümlicher Weise, als dasselbe anfänglich ungemein langsam und erst vom Mai an schneller wächst. Sichtbar werden die Kolben nicht vor Ende des genannten Monats oder vor dem Anfange des Juni, weshalb auch das Verecken kaum eher als zwei oder drei Monate vor Beginn der Brunftzeit stattfindet. Diese tritt in den Ostseeländern Ende August, im asiatischen Rußland im September oder Oktober ein. Um diese Zeit sind die Hirsche auf das höchste erregt. Während man sonst nur in seltenen Fällen einen dem Schrecken des Rotwildes ähnelnden, jedoch bedeutend stärkern und tiefern, hell nachklingenden Laut und auch diesen vielleicht bloß vom alten Tiere vernimmt, orgeln die Elchhirsche jetzt nach Art des Edelhirsches, jedoch in kurzen Absätzen und mehr plärrend als schreiend, fast wie der Damhirsch, nur in viel tieferem Tone, fordern damit alle gleichstrebenden Hirsche zum Zweikampf heraus und fechten diesen mit Wut und Ingrimm durch, nehmen leicht auch selbst den Menschen an, laufen, die Nase zum Boden herabgesenkt, als wollten sie eine Fährte aufnehmen, unstet und rastlos bei Tage und Nacht umher, tagtäglich viele Meilen durchmessend, treiben die Tiere tagelang ununterbrochen, verfolgen sie weit und schwimmen ihnen selbst durch die breitesten Ströme nach. Junge Hirsche werden von den älteren abgeschlagen und finden selten Gelegenheit, ihren Trieb zu befriedigen; dann trollen sie wie unsinnig in gerader Richtung fort, besuchen selbst bebaute Gegenden, die sie sonst ängstlich meiden, und kommen endlich ebensosehr vom Leibe wie die Alten durch das wirkliche Brunften. Ende April oder Anfang Mai setzt das Elchtier zum erstenmal nur ein Kalb, bei jedem folgenden Satze aber deren zwei, meist ein Pärchen, seltener zwei desselben Geschlechts. Die Geburt scheint schwieriger vonstatten zu gehen als bei andern Hirscharten; denn das setzende Tier bekundet nach den Beobachtungen des Försters Romonaht durch sein Gebaren, daß die Wehen sehr heftig und schmerzhaft sein müssen, beißt sich an den Zweigen oder in der Moosdecke fest, streckt und windet sich abwechselnd beim Treiben der Frucht und verendet in nicht allzu seltenen Fällen während der Wehen. Sofort nach glücklicher Geburt der Kälber verzehrt es, wie viele andere Säugetiere, Wiederkäuer insbesondere, ebenfalls zu tun pflegen, den Mutterkuchen und wendet sich dann liebevoll seinen Kälbern zu, um sie zunächst zu reinigen. Gleich nach dem Ablecken springen diese auf, taumeln aber noch wie berauscht mit dem Kopfe hin und her und müssen anfangs von der Mutter fortgeschoben werden, wenn sie sich bewegen sollen; doch schon am dritten oder vierten Tage folgen sie dem Elchtiere, das sie fast bis zur nächsten Brunftzeit besaugen, selbst dann noch, wenn sie bereits so groß geworden sind, daß sie sich unter die Mutter hinlegen müssen. In den ersten Tagen ihres Lebens sind sie so ungestaltet, daß sie in mehr als einer Hinsicht an einen Esel erinnern, und mit diesem Aussehen steht ihre Unbeholfenheit vollständig im Einklang. O. von Löwis schreibt mir, daß sie sich während der ersten Jugendzeit, wenn sie überrascht wurden, sofort niederlegen und widerstandslos aufnehmen und forttragen lassen. Sehr groß ist die Anhänglichkeit und Liebe der Mutter zu ihren Kälbern. Sie verteidigt selbst die getöteten Jungen und irrt, wenn diese ihr geraubt wurden, oft noch tagelang suchend auf der Unglücksstelle umher.
Außer dem Menschen werden dem Elch, trotz seiner Stärke, mehrere andere Feinde gefährlich; vor allen Wolf, Luchs, Bär und Vielfraß. Der Wolf reißt die Elche gewöhnlich im Winter bei hohem Schnee nieder; der Bär pflegt meistens nur einzelne Tiere zu beschleichen und steht vom Angriffe eines Rudels ab; der Luchs und unter Umständen der Vielfraß springen auf ein unter ihnen weggehendes Elen, krallen sich am Halse fest und beißen ihm die Schlagadern durch. Sie sind als die gefährlichsten Feinde des wehrhaften Wildes anzusehen; Wölfe und Bären dagegen haben sich vorzusehen, denn der Elch versteht sich, auch wenn er das kräftige Geweih nicht besitzt, erfolgreich zu verteidigen, indem er die harten und scharfen Schalen seiner Vorderläufe mit ebensoviel Geschick als Nachdruck gebraucht. Ein einziger, richtig angebrachter Schlag mit diesen durchaus nicht zu unterschätzenden Waffen genügt, um einen Wolf für immer niederzustrecken oder ihn doch lendenlahm zu machen. Für diese Annahme liefern selbst die Ibenhorster Elche dann und wann überzeugende Belege. So wurde vor mehreren Jahren der Hund eines dortigen Forstbeamten, angesichts seines Herrn, von einem alten Elchtiere, das aus der benachbarten Feldmark eines Aasjägers zurückgetrieben werden sollte, angenommen, verfolgt und, da derselbe in dem tiefen Schnee nicht rasch genug flüchten konnte, bald eingeholt, zu Boden geschlagen und auch nunmehr noch mit den Schalen der Vorderläufe so heftig bearbeitet, daß er binnen wenigen Minuten zu einer unförmlichen Masse geworden war. Der Hund fiel als Opfer der seinem Herrn bewiesenen Treue; denn dieser konnte sich einzig und allein dadurch vor dem in Wut geratenen Tiere retten, daß er jenen auf dasselbe hetzte. Alte Tiere mit Kälbern sind regelmäßig angriffslustiger als die Hirsche; aber auch diese nehmen, namentlich in der Brunstzeit, den Menschen an. Dies erfuhr unter andern der Ibenhorster Forstwart Müller, als er im September 1873 mit seinem Hunde über die Wiesen der tieferen Stellen des Forstrevieres ging. Ohne von dem Manne und seinem Hunde gereizt worden zu sein, näherte sich ihm ein starker Elchhirsch, nahm ihn in der nicht zu verkennenden Absicht, ihm den Garaus zu machen, ohne weiteres an, zwang ihn, unter einem auf erhöhten Rosten stehenden Heuhaufen Schutz zu suchen, belagerte ihn hier, verfolgte ihn, als er sich, von einem Heuhaufen zum andern flüchtend, zu retten suchte, bis vor die Türe eines Hauses, die er schließlich glücklich erreicht hatte, und wollte sich selbst von hier nicht verjagen lassen. Wahrscheinlich erregte auch in diesem Falle der unsern Forstwart begleitende Hund den Zorn des Elchhirsches; es sind jedoch Fälle bekannt, daß auch nicht von Hunden begleitete Männer von ergrimmten Elchen angenommen wurden. Nach Versicherung des Försters Ramonaht soll man dem verfolgenden Elchhirsche übrigens verhältnismäßig leicht, und zwar dadurch entgehen können, daß man bei jedem von ihm unternommenen Angriffe rasch zur Seite springt. Kurze Wendungen soll der Elchhirsch nicht gern ausführen und in der Regel von dem Verfolgten ablassen, wenn dieser ihm in der angegebenen Weise auszuweichen sucht.
Jung eingefangene Elentiere werden zahm und können selbst zum Aus- und Eingehen gebracht werden; bei uns halten sie jedoch die Gefangenschaft selten längere Zeit aus. In Schweden sollen früher gefangene Elche so weit abgerichtet worden sein, daß man sie zum Ziehen der Schlitten verwenden konnte; ein Gesetz verbot aber derartige Zugtiere, »weil deren Schnelligkeit und Ausdauer die Verfolgung von Verbrechern unmöglich gemacht haben könnte«. Spätere Versuche, Elche zu Haustieren zu gewinnen, sind gescheitert. Die Jungen schienen zwar anfangs zu gedeihen, magerten aber später mehr und mehr ab und starben regelmäßig bald dahin. Ein junger Elch war von dem Oberförster Ulrich in den Ibenhorster Waldungen verlassen aufgefunden und aufgezogen worden. »Der Pfleger«, so berichtete mir Freund Bolle, »ernährte ihn während des ersten Vierteljahres ausschließlich mit frischer Milch einer eigens dazu bestimmten Kuh, wovon er täglich fünfzehn Stof oder achtzehn Liter erhielt. Doch blieb er hierbei matt, schwächlich und gleichwohl scheu. Demnächst wurde die Menge der Milch auf sechs Stof täglich herabgesetzt. Es wurden dafür gleichzeitig Weidenblätter gefüttert, wieder einige Monate lang. Zuletzt erhielt er jeden Tag Roggenmehl mit drei Stof Milch. Außerdem nährte er sich frei im Garten mit allerlei Kräutern, mit Beeren, Runkelrübenblättern usw., verschmähte auch den reifenden Roggen auf dem Felde nicht und fraß mit Begierde Knospen, Rinde und junge Zweige von Weiden, Espen, Birken, Faulbäumen, Ebereschen usw., dabei vielen Schaden anrichtend. Im Laufe des Jahres wurde er ziemlich zahm. Bei großer Hitze hielt er sich am liebsten in einem kühl gelegenen, leeren Anbau des Hauses auf. Erst gegen Abend ging er auf Äsung aus.«
»Das Tier«, sagt August Müller, der von Ulrich selbst berichtet wurde, »wuchs heran, lies den Menschen nach wie ein zahmer Hammel und leckte seinem Herrn beim Wiedersehen zärtlichst Hand und Gesicht. Für den Garten, in den er anfangs nur zur Gesellschaft ging, entwickelte der junge Elch bald eine besondere Teilnahme, da ihm, nachdem er der Amme entwachsen war, auch die Nützlichkeit solcher Anlagen einleuchtend wurde. Da sich bald der Garten vor ihm schloß, sprang er gewandt über den Zaun. Dieser wurde bis gegen zwei Meter erhöht; aber auch diese Probe bestanden seine wohlgeratenen Glieder. Wenn sein Herr in den Forst ging, mochte er ihn gern begleiten und mußte oft gewaltsam zurückgetrieben werden. Einst wurde ihm gestattet mitzugehen. Er folgte kreuz und quer und fand im Walde auch seinesgleichen. Die sah er aufmerksam an, und sie schienen ihn auch lebhaft anzuregen; jedoch gefiel es ihm beim Herrn Oberförster besser, und er kehrte getreulich mit ihm aus dem Walde zurück.«
Gegen andere Tiere zeigt sich der gefangene Elch sehr gleichgültig, beachtet Hunde, die die übrigen Hirsche in große Aufregung versetzen, nicht im geringsten, bekümmert sich aber auch um Verwandte, die in oder neben seinem Raume eingestellt sind, nur wenig. Mit Renntieren verträgt er sich vortrefflich, vielleicht weil ihm deren ruhiges Wesen zusagt. Die flinken und lebendigen Hirscharten scheinen ihm verhaßt zu sein; er versucht auch sie zu schlagen und duldet sie, ohne feindliche Versuche zu machen, erst dann, wenn er sich von der Nutzlosigkeit seiner Anstrengungen überzeugt hat.
Man erlegt den Elch entweder auf dem Anstande oder auf großen Treibjagden und in Lappen und Netzen. Im hohen Norden versuchen die Jäger im Winter ihr Wild auf Schneeschuhen zu jagen und bemühen sich, ihn auf das Eis zu treiben, wo sie ihm dann bald den Garaus machen. Der Gewinn, den der Mensch von dem erlegten Tiere zieht, ist beträchtlich. Wildbret, Fell und Geweihe werden ebenso wie beim Hirsche verwendet. Das Fleisch ist zäher, das Fell aber fester und besser als das des Edelwildes. Elenhaut wurde, namentlich im Mittelalter, hochgeachtet und teuer bezahlt. Auch noch in späterer Zeit schätzte man dieses Wildleder viel höher als anderes und verfolgte deshalb den Elch mehr als billig. So ließ Kaiser Paul der Erste in Rußland einen förmlichen Vernichtungskrieg gegen die Elche führen, um die zur Beinkleidung seiner Reiter nach seiner Ansicht unbedingt erforderlichen Elenhäute zu erhalten. Bei mehreren nördlichen Völkern gelten die knorpeligen Stangen, die Ohren und die Zunge als Leckerbissen. Lappländer und Sibirier spalten die Sehnen und verwenden sie wie die der Renntiere. Besonders die harten und blendend Weißen Knochen werden ungemein gerühmt.
Aller Nutzen, den das Elentier bringen kann, wiegt bei weitem den Schaden nicht auf, den es verursacht. Das Tier ist ein wahrer Holzverwüster und wird geregelten Forsten so gefährlich, daß Hegung nirgends, Schonung kaum stattfinden darf, wenn es sich darum handelt, Forstbau den Erfordernissen unserer Zeit gemäß zu betreiben. In jenen Wäldern, die seine Heimat bilden, fällt der Schaden nicht so ins Gewicht, wie man von vornherein annehmen möchte; denn jene sind ohnehin halbe Urwälder. Aber auch in den Ibenhorster Forsten richtet das Elchwild nicht so viel Unfug an, daß man deshalb auf seine Ausrottung dringen müßte; ich bin vielmehr, nachdem ich mich an Ort und Stelle unterrichtet habe, übereinstimmend mit den Ibenhorster Forstleuten zu der Überzeugung gekommen, daß »ein dem Elchwilde etwa gebrachtes Opfer mit dem Werte des schönen und lebendigen Denkmals, das diesem berühmten Ureinwohner Preußens in den Ibenhorster Forsten errichtet ist, in keinem Verhältnis steht.«
*
Bei den Renntieren ( Rangifer) tragen beide Geschlechter Geweihe, die von dem kurzen Rosenstock an bogenförmig von rück- nach vorwärts gekrümmt, an ihren Enden wie an dem Augensproß schaufelförmig ausgebreitet, fingerförmig eingeschnitten und schwach gefurcht sind. Sehr breite Hufe und längliche, aber stumpf zugespitzte Afterklauen zeichnen diese Hirsche aus. Ihre Gestalt ist im allgemeinen ziemlich plump, namentlich der Kopf unschön; die Beine sind verhältnismäßig niedrig; der Schwanz ist sehr kurz. Nur die alten Männchen haben im Oberkiefer kleine Eckzähne.

Renntiere (Rangifer tarandus)
Man darf das Renntier als den wichtigsten aller Hirsche bezeichnen. Ganze Völker danken ihm Leben und Bestehen; denn sie würden ohne dieses sonderbar genug gewählte Haustier aufhören zu sein. Dem Lappen und Finnen ist das Ren weit notwendiger als uns das Rind oder das Pferd, als dem Araber das Kamel oder seine Ziegenherden; denn es muß die Dienste fast aller übrigen Herdentiere leisten. Das zahme Renntier gibt Fleisch und Fell, Knochen und Sehnen her, um seinen Zwingherrn zu kleiden und zu ernähren; es liefert Milch, läßt sich als Lasttier benutzen und schleppt auf dem leichten Schlitten die Familie und ihre Gerätschaften von einem Ort zum andern; mit einem Wort, das Renntier ermöglicht das Wanderleben der nördlichen Völkerschaften.
Das Ren ( Rangifer tarandus) ist ein stattliches Geschöpf von Hirschgröße, nicht aber Hirschhöhe. Seine Länge beträgt 1,7 bis 2 Meter, die Schwanzlänge 13 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 1,08 Meter. Das Geweih steht zwar an Größe und noch mehr an Schönheit dem des Hirsches nach, ist aber immerhin ein sehr stattlicher Kopfschmuck. Der Leib des Ren unterscheidet sich von dem des Hirsches vielleicht nur durch größere Breite des Hinterteils; Hals und Kopf sind aber viel plumper und weniger schön und die Läufe bedeutend niederer, die Hufe viel häßlicher als bei dem Edelwilde; auch fehlt dem Renntier unter allen Umständen die stolze Haltung des Hirsches, es trägt sich weit weniger schön als dies edle Geschöpf. Der Hals hat etwa Kopflänge, ist stark und zusammengedrückt und kaum nach aufwärts gebogen, der Kopf vorn nur wenig verschmälert, plumpschnauzig, längs des Nasenrückens gerade; die Ohren sind kürzer als beim Edelhirsche, jedoch von ähnlicher Bildung, die Augen groß und schön, die Tränengruben klein und von Haarbüscheln überdeckt; die Nasenkuppe ist vollständig behaart, die Nasenlöcher stehen schräg gegeneinander; die Oberlippe hängt über, der Mund ist tief gespalten. Das Geweih der Rennkuh ist regelmäßig kleiner und weniger gezackt als das des Rennhirsches, bei beiden Geschlechtern aber dadurch besonders ausgezeichnet, daß die Stangen sehr dünn und nur am Grunde rundlich, nach oben dagegen abgeplattet sind, und daß die Augensprossen, die vorn in eine breite Schaufel enden, so dicht auf der Nasenhaut aufliegen, daß man kaum einen Finger dazwischen durchbringen kann. In der Mitte der Stange tritt außer dem Eissproß, der sich ebenfalls schaufelt und auszackt, nur ein Sproß, und zwar nach hinten hervor; das Ende des Geweihes ist eine langausgezogene Schaufel mit verschiedenen Zacken. Äußerst selten findet man ein regelmäßig gebautes Geweih wie beim Hirsch; es kommt oft vor, daß selbst Hauptsprossen, wie z. B. die Augensprossen, gänzlich verkümmern. Die Schenkel sind dick, die Beine immer noch stark und dabei niedrig, die Hufe sehr groß, breit, flach gedrückt und tief gespalten; die Afterklauen reichen bis auf den Boden herab. Bei zahmen Renntieren nehmen die Schalen so an Breite zu, daß man wildes und zahmes Rennwild unbedingt als Arten trennen müßte, wenn man den Bau der Hufe allein in Betracht ziehen wollte, überhaupt sind die wilden Renntiere bei weitem zierlicher und ansprechender gebaut als die zahmen, die unter der Obhut und Pflege des Menschen durchaus nicht veredelt wurden, vielmehr verkrüppelt und verhäßlicht worden zu sein scheinen.
Die Decke ist so dicht wie bei keinem andern Hirsch. Das Haar ist sehr lang, dick, gewunden, gewellt, zellig, spröde und brüchig, nur am Kopf und Vorderhalse sowie an den Beinen, wo es sich noch mehr verlängert, biegsamer und haltbarer. An der Vorderseite des Halses befindet sich eine Mähne, die zuweilen bis zur Brust herabreicht, und auch an den Backen verlängern sich die Haare. Im Winter werden sie überall bis sechs Zentimeter lang, und weil sie sehr dicht übereinander liegen, bildet sich dann eine Decke von mindestens vier Zentimeter Dicke, die es sehr erklärlich macht, daß das Renntier mit Leichtigkeit eine bedeutende Kälte ertragen kann. Nach dem Vorkommen und noch mehr nach der Jahreszeit ist die allgemeine Färbung verschieden. Die wilden Renntiere ändern mit ziemlicher Regelmäßigkeit zweimal im Jahr ihr Haarkleid und dessen Färbung. Mit Beginn des Frühlings fällt das reiche Winterhaar aus, und ein kurzes, einfarbig graues Haar tritt an dessen Stelle; es wachsen nun mehr und mehr andere Haare dazwischen hervor, deren weiße Spitzen das graue Haar immer vollständiger verdrängen, bis endlich das ganze Tier weißgrau, fast fahl, der Färbung schmelzenden, schmutzigen Schnees täuschend ähnlich erscheint. Diese Umfärbung beginnt immer zuerst am Kopf, zunächst in der Augengegend, und verbreitet sich dann weiter und weiter. Die Innenseite der Ohren ist stets mit weißen Haaren besetzt; dieselbe Färbung hat auch ein Haarbüschel an der Innenseite der Ferse; die Wimpern sind schwarz. Beim zahmen Renntiere ist die Färbung im Sommer am Kopf, Rücken, Bauch und an den Füßen dunkelbraun, am dunkelsten, fast schwärzlich, auf dem Rückgrate, heller an den Seiten des Leibes, über die aber gewöhnlich zwei lichtere Längsstreifen laufen. Der Hals ist viel lichter als der Rücken, die Unterseite weiß, die Stirn gewöhnlich schwarzbraun, ein Kreis um die Augen schwarz, die Kopfseite weiß. Im Winter verschwindet die braune Färbung, und das weiße Haar tritt ebenfalls mehr hervor; doch gibt es auch viele Renntiere, die sich im Winter nur durch verlängerte Haare auszeichnen, in der Färbung aber sich gleichbleiben.
Schon die Alten kannten das Ren. Julius Cäsar beschrieb es ziemlich richtig. »Im Hercynischen Walde«, sagt er, »gibt es einen Ochsen von der Gestalt des Hirsches, dem mitten auf der Stirn ein viel größeres Horn steht, als es die übrigen haben; die Krone desselben breitet sich handförmig in viele Zacken aus. Das Weibchen hat ebensolche Hörner.« Aelian erzählt, daß die wilden Scythen auf gezähmten Hirschen wie auf Pferden reiten. Olaus Magnus (1530) weiß, daß die Nahrung des Renntieres aus Bergmoos besteht, das es unter dem Schnee hervorscharrt, daß man es in Herden hält und hütet, daß es in einem anderen Klima bald zugrunde geht; er erzählt, daß die Hirten mit ihren ziehenden Hirschen in den Tälern an jedem Tage fünfzigtausend Schritte zurücklegen, und gibt auch schon deren Nutzen und Verwendung an, denn er sagt, daß das Fell zu Kleidern, Betten, Sätteln und Blasebälgen, die Sehnen zu Schnüren und als Zwirn, die Knochen und Hörner zu Bogen und Pfeilen, die Klauen als Krampfmittel benutzt werden usw. Die auf ihn folgenden Naturforscher mischen Wahres und Falsches durcheinander, bis auf Scheffer aus Straßburg, der im Jahre 1675 in seinem Werk über Lappland das Ren ziemlich richtig schildert. Doch erst der große Linné ist es, der es selbst und zwar genau beobachtet hat. Ich selbst habe die wilden Rudel und die zahmen Herden beobachten können und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, aus eigener Anschauung zu sprechen. Sehr vieles habe ich auch von meinem alten Jäger Erik Swensen und von andern glaubwürdigen Norwegern erfahren.
Der hohe Norden der Alten und, da man den amerikanischen Karibu zu unserer Art zählen kann, auch die nördlichsten Gegenden der Neuen Welt sind die Heimat des Ren. Es findet sich in allen Ländern nördlich des 60. Grades, steigt in manchen Gegenden bis zum 52. Grade nördlicher Breite herab und kommt nach Norden hin noch jenseits des 80. Grades regelmäßig vor. Wild trifft man es auf den Alpengebirgen Skandinaviens und Lapplands, in Finnland, im ganzen nördlichen Sibirien, in Grönland und auf den nördlichsten Gebirgen des festländischen Amerika. Auch auf Spitzbergen lebt es; auf Island ist es, nachdem es vor mehr als hundert Jahren dort eingeführt wurde, vollständig verwildert und hat sich bereits in namhafter Anzahl über alle Gebirge der Insel verbreitet. In Norwegen fand ich es auf dem Dovre-Fjeld noch in ziemlicher Anzahl vor. Im nördlichen Asien fehlt es wohl kaum jenseits des 50. Grades nördlicher Breite und findet sich innerhalb dieses Gebietes, ebensowohl wild wie gezähmt, hier und da in sehr bedeutender Anzahl.
Das Renntier ist ein echtes Alpenkind wie die Gemse und findet sich nur auf den baumlosen, mit Moos und wenigen Alpenpflanzen bestandenen, breiten Rücken der nordischen Gebirge, die die Eingeborenen so bezeichnend » Fjelds« nennen. In Norwegen bildet der Gürtel zwischen ein- und zweitausend Meter unbedingter Höhe seinen gewöhnlichen Aufenthalt. Niemals steigt es hier bis in den Waldgürtel herab, wie es überhaupt ängstlich die Waldungen meidet. Die kahlen Bergebenen und Halden, zwischen deren Gestein einzelne Pflanzen wachsen, oder jene weiten Ebenen, die dünn mit Renntierflechten überspannen sind, müssen als Standorte dieses Wildes angesehen werden, und nur dann, wenn es von einem Höhenzuge nach dem andern streift, trollt es über eine der sumpfigen, morastähnlichen, niederen Flächen hinweg; aber auch bei solchen Ortsveränderungen vermeidet es noch ängstlich den Wald. Pallas gibt an, daß es im nördlichen Sibirien zuweilen in Waldungen vorkomme, und auch von Wrangel bestätigt dies. Von beiden Schriftstellern erfahren wir, daß es in Sibirien weite und regelmäßige Wanderungen ausführt. Um den Dasselfliegen zu entgehen, steigt es, laut Pallas, im Sommer aus den offenen Gegenden auf die waldigen Berge und kehrt von hier aus erst gegen den Winter hin in die Ebenen zurück. Ebensowohl bei der Reise zu Berge wie bei der Wanderung zu Tal vereinigt es sich zu zahlreichen Herden, die in langgestreckten Zügen, einem wandelnden Walde vergleichbar, dahinziehen, auf weithin zu verfolgende Pfade austreten und breite Ströme, namentlich den Ob, Jenissei, Anadir und die Lena, mehr oder weniger an denselben Stellen alljährlich überschwimmen. Die Kühe mit den Kälbern eröffnen, die Hirsche beschließen diese Züge. »Gegen Ende des Mai«, ergänzt Wrangel, »verläßt das wilde Ren in großen Herden die Wälder, wo es den Winter über einigen Schutz gegen die grimmige Kälte sucht, und zieht nach den nördlichen Flächen, teils, weil es dort bessere Nahrung auf der Moosfläche findet, teils aber auch, um den Fliegen und Mücken zu entgehen, die mit Eintritt des Frühlings in ungeheuren Schwärmen die Luft verfinstern. Der Frühlingszug ist für die dortigen Völkerschaften nicht vorteilhaft; denn in dieser Jahreszeit sind die Tiere mager und durch die Stiche der Kerbtiere ganz mit Beulen und Wunden bedeckt; im August und September aber, wenn die Renntiere aus der Ebene in die Wälder zurückkehren, sind sie gesund und wohlgenährt und geben eine schmackhafte, kräftige Speise. In guten Jahren besteht der Renntierzug aus mehreren Tausenden, die, obgleich sie in Herden von zwei- bis dreihundert Stück gehen, sich doch immer einander ziemlich nahe bleiben, so daß das Ganze eine ungeheure Masse ausmacht. Ihr Weg ist stets unabänderlich derselbe. Zum Übergang über den Fluß wählen sie eine Stelle, wo ein trockener Talweg zum Ufer hinabführt und an dem gegenüberstehenden eine flache Sandbank ihnen das Hinaufkommen erleichtert. Hier drängt sich jede einzelne Herde dicht zusammen, und die ganze Oberfläche bedeckt sich mit schwimmenden Tieren.« An dem Baranicha in Sibirien sah Wrangel zwei unabsehbare Herden wandernder Renntiere, deren Züge zwei Stunden brauchten, um vorüberzukommen. Mindestens ebenso großartig sind die Wanderungen, die unsere Hirsche im Westen der Erde alljährlich ausführen. Sie erscheinen, vom Festlande Amerikas kommend und die Eisdecke des Meeres als Brücke benutzend, im Frühjahr in Grönland und verweilen hier bis Ende Oktober, worauf sie die Rückreise antreten. In Norwegen wandern die Tiere nicht, sondern wechseln höchstens von einem Gebirgsrücken auf den andern; wie weit, ist nicht ermittelt. Jene Gebirge sind aber auch so beschaffen, daß sie ihnen alle Vorteile, die den sibirischen die Wanderungen bieten, gewähren können. Zur Zeit der Mücken ziehen die wilden Renntiere einfach nach den Gletschern und Schneefeldern hinauf, die sie ohnehin so lieben, daß sie mindestens ein Paar Stunden des Tages auf ihnen ruhend verweilen; im Herbst, im Winter und im Frühling kommen sie weiter an den Bergen herab.
Die Renntiere eignen sich ganz vortrefflich, jene nördlichen Länder zu bewohnen, die im Sommer eigentlich nur ein Morast und im Winter nur ein einziges Schneefeld sind. Ihre breiten Hufe erlauben ihnen, ebensogut über die sumpfigen Stellen und die Schneedecke hinwegzugehen wie an den Halden umherzuklettern. Der Gang des Renntieres ist ein ziemlich schneller Schritt oder ein rascher Trott. So flüchtig wie unser Edelhirsch wird es selbst dann nicht, wenn eines aus der Herde zusammengeschossen worden ist und alle übrigen in die höchste Angst geraten. Dabei hört man fast bei jedem Tritt ein eigentümliches Knistern, dem Geräusch vergleichbar, das ein elektrischer Funke hervorbringt. Ich habe mir viele Mühe gegeben, die Ursache dieses Geräusches kennenzulernen, und bin zahmen Renntieren stundenlang nachgegangen, habe auch einige niederwerfen lassen und alle möglichen Beugungen ihrer Fußgelenke durchgeprobt, um meiner Sache sicher zu werden, bin aber noch heute so unklar, als ich es früher war. Nachdem ich das Tier so genau als möglich längere Zeit beobachtet hatte, glaubte ich annehmen zu dürfen, daß das fragliche Geräusch von einem Zusammenschlagen des Geästers herrühre, und wirklich konnte ich durch Aneinanderreihen der Füße ein ähnliches Knistern hervorbringen; allein die Renntiere, die ich in den Tiergärten beobachtete, belehrten mich, daß meine Ansicht falsch sei; denn sie bringen auch dasselbe Knistern hervor, ohne daß sie einen Fuß von der Erde erheben; sie knistern, sobald sie sich, auf allen vier Füßen feststehend, ein wenig nach vorn oder zur Seite beugen. Daß bei solchen Beugungen das Geäster nicht an die Hufe schlägt, glaube ich verbürgen zu können. Und so bleibt bloß, die Annahme übrig, daß das Geräusch im Innern des Gelenkes entsteht, Neuerdings ist von E. Mohr ermittelt worden, daß das Knacken der Renntiere im Fesselgelenk entsteht. Herausgeber ähnlich wie wenn wir einen Finger anziehen, bis er knackt.
Bei langsamem Gange über morastige Flächen breitet das Renntier seine Hufe so weit aus, daß eine Fährte entsteht, die weit mehr an die einer Kuh als an die eines Hirsches erinnert, und in gleicher Weise schreitet es auch über den Schnee, auf dem es, sobald derselbe sich nur einigermaßen gesetzt hat, nicht mehr einsinkt.
Das Schwimmen wird dem Ren sehr leicht; es setzt ohne weiteres über ziemlich breite Ströme, und die Lappen treiben ganze Herden durch die Fjords von einer Insel zur andern. Die zahmen Renntiere entschließen sich allerdings nur nach einigem Widerstreben, in das Wasser zu gehen; die wilden dagegen scheuen dieses nicht und gehen, wenn sie flüchtig sind, durch Dick und Dünn.
Alle höheren Sinne des Renntieres sind vortrefflich. Es wittert ganz ausgezeichnet, wie ich mich wirklich überzeugt habe, bis auf fünf- oder sechshundert Schritte hin; es vernimmt mindestens ebenso scharf wie der Hirsch und äugt so gut, daß der Jäger alle Ursache hat, auch wenn er gegen den Wind herankommt, sich aufs sorgfältigste zu verbergen. Dabei ist das Tier lecker, denn es sucht sich nur die besten Alpenpflanzen heraus, und sein Gefühl beweist es sehr deutlich, wenn es die Mücken plagen; das zahme Renntier zuckt bei der leisesten Berührung zusammen. Alle Jäger, die wilde Renntiere beobachteten, schreiben ihnen Klugheit, ja selbst eine gewisse List zu; scheu und vorsichtig im höchsten Grad sind sie unzweifelhaft. Gegen andere Tiere beweisen sie nicht die geringste Scheu. Sie kommen vertrauensvoll an die Kühe und Pferde heran, die in ihren Höhen weiden, und vereinigen sich da, wo es Zahme ihrer Art gibt, sehr gern mit diesen, obgleich sie recht wohl wissen, daß sie es nicht mit ihresgleichen zu tun haben. Hieraus geht hervor, daß ihre Scheu und Furcht vor den Menschen ein Ergebnis ihrer Erfahrung ist, und somit muß man ihnen einigermaßen entwickelten Verstand zugestehen.
Das wilde Ren äst im Sommer saftige Alpenkräuter, namentlich die Blätter und Blüten der Schneeranunkel, des Renntierampfers, der Saponarien, des Hahnenfußes, Schwingels usw. Während des Winters gräbt es mit seinen Hufen Renntierflechten aus und frißt von den Steinen die Schnee- und Osterflechten ab. In Norwegen meidet es auch im Winter den nahrungsreichen Wald, geht aber dann öfters in den Sumpf, um dort von allerlei Kräutern zu äsen. Sehr gern frißt es die Knospen und jungen Schößlinge der Zwergbirke, nicht aber die anderer Birkenarten. Die Auswahl unter der Nahrung ist immer eine höchst sorgfältige, auf sehr wenige Pflanzen beschränkte. Niemals gräbt das Ren mit dem Geweih, wie oft behauptet worden ist, sondern immer mit seinen Vorderläufen. Am eifrigsten geht es in den Morgen- und Abendstunden der Nahrung nach; während der Mittagszeit ruht es wiederkäuend, am liebsten auf Schneefeldern und Gletschern oder wenigstens ganz in der Nähe derselben. Ob es auch des Nachts schläft, ist nicht bekannt.
In Norwegen tritt der Hirsch Ende September auf die Brunft. Sein Geweih, das Ende Dezember oder im Januar abgeworfen wurde, ist jetzt wieder vollständig geworden, und er weiß es zu gebrauchen. Mit lautem Schrei ruft er Mitbewerber heran, orgelt wiederholt in der ausdrucksvollsten Weise, angesichts der jetzt sehr verstärkten Rudel häufige Kämpfe mit den betreffenden Mitbewerbern bestehend. Die wackeren Streiter verschlingen sich oft mit ihren Geweihen und bleiben manchmal stundenlang aneinander gefesselt; dabei kommt es dann auch vor, wie bei den Hirschen, daß die schwächeren Renntierböcke, die von den älteren während der Fortpflanzungszeit übermütig behandelt werden, sich die Gelegenheit zunutze machen und die brünstigen Tiere beschlagen. Gegen das Alttier benimmt sich der Hirsch sehr ungestüm, treibt auch das erkorene Stück oft lange umher, bevor es zur Paarung kommt. Dann wird er zärtlicher. Hat er nach längerem Lauf endlich haltgemacht, so beleckt er die auserkorene Gattin, hebt den Kopf in die Höhe und stößt hierbei rasch und hintereinander dumpfe, grunzende Laute aus, bläht seine Lippen auf, schlägt sie wieder zusammen, beugt den hintern Teil des Leibes nieder und gebärdet sich überhaupt höchst eigentümlich. Der Beschlag selbst geht sehr rasch vor sich und währt nur kurze Zeit; dabei faucht der Hirsch niesend mit der Nase. Mitte April ist die Satzzeit; das alte Tier geht also etwa dreißig Wochen hochbeschlagen. Niemals setzen wilde Renntiere mehr als ein Kalb. Dieses ist ein kleines schmuckes Geschöpf, das von seiner Mutter zärtlich geliebt und lange gesäugt wird. In Norwegen nennt man das junge Renntier entweder Bockkalb oder Semlekalb, je nachdem es männlich oder weiblich ist; die erwachsenen Renntiere werden ebenfalls als Bock und Semle unterschieden. Schon gegen das Frühjahr hin trennt sich das hochbeschlagene Tier mit einem Bock von seinem Rudel und schweift nun mit diesem bis zur Satzzeit und auch nach ihr noch umher. Solche Familien, die aus dem Bock, der Semle und dem Kalb bestehen, trifft man häufig; die Schmaltiere und die jungen Böcke bilden ihrerseits stärkere Rudel, bei denen ein geltes Alttier die Leitung übernimmt. Erst wenn die Kälber groß geworden sind, vereinigen sich die Familien wieder zu Rudeln; dann teilen sich die Alttiere in die Leitung. Die Renntiere sind so besorgt um ihre Sicherheit, daß das Leittier, auch wenn alle übrigen Mitglieder des Rudels wiederkäuend ruhen, immer stehend das Amt des Wächters ausübt; will es sich selbst niederlassen, so steht augenblicklich ein anderes Alttier auf und übernimmt die Wache. Niemals wird ein Rudel Renntiere an Halden weiden, wo es gegen den Wind beschlichen werden kann; es sucht sich stets Stellen aus, auf denen es die Ankunft eines Feindes schon aus weiter Entfernung wahrnehmen kann, und dann trollt es eilig davon, oft meilenweit. Es kehrt aber nach guten Plätzen zurück, wenn auch nicht in den nächsten Tagen. Gewisse Halden des Dovre-Fjeld, die reich an saftigen Pflanzen sind, haben als gute Jagdplätze Berühmtheit erlangt.
Die Jagd des wilden Ren erfordert einen leidenschaftlichen Jäger oder einen echten Naturforscher, dem es auf Beschwerden und Entbehrungen nicht ankommt; für gewöhnliche Sonntagsschützen ist sie durchaus kein Vergnügen. Es gibt in jenen Höhen, wo das vorsichtige Wild sich aufhält, keine Sennhütten oder Sennhäuschen mit allerliebsten Sennerinnen oder zitherschlagenden Sennbuben, sondern nur Beschwerden und Mühsale. Wie bei der Gemsenjagd muß man sich für mehrere Tage mit Lebensmitteln versehen, wie der Steinbockjäger in Felsklüften oder, wenn es gut geht, in verlassenen Steinhütten, die man vorher gegen den Luftzugang zu schließen hat, während der Nachtzeit Unterkommen suchen; denn wenn man in einer der Sennhütten, die sich auch nicht überall finden, übernachten will, muß man im günstigen Fall um drei- bis fünfhundert Meter hinab- und am andern Morgen natürlich wieder hinaufsteigen. Auf der Jagd heißt es aufpassen! Alles muß beobachtet werden, der Wind und das Wetter, der Stand der Sonne usw. Man muß die Lieblingsplätze des Renntieres kennen, mit seinen Sitten vertraut sein und zu schleichen verstehen wie eine Katze. Ganz besonders notwendig ist es auch, daß man die Fährten wohl zu deuten weiß, um zu erfahren, ob sie von heute oder gestern oder von noch früherer Zeit herrühren. Jedes abgerissene Blatt auf den Halden, jeder weggetragene Stein gibt Fingerzeige. In Norwegen ist bei der Renntierjagd allerdings nicht an Gefahr zu denken, aber Beschwerden gibt es genug. Die Halden bestehen nur aus wirr durch- und übereinander geworfenen Schieferplatten, die, wenn man über sie weggeht, in Bewegung geraten oder so scharfkantige Ecken und Spitzen hervorstrecken, daß jeder Schritt durch die Stiefel hindurch fühlbar wird; die außerordentliche Glätte der Platten, über die das Wasser herabläuft, vermehrt noch die Schwierigkeit des Weges, und das jede Viertelstunde notwendig werdende Überschreiten der schlüpfrigen Rinnsale erfordert viele und nicht eben belustigende Springübungen, falls man es vermeiden will, im kalten Gebirgswasser ein unfreiwilliges Bad zu nehmen und sich dabei Arme und Beine blutig zu schlagen. Und selbst, wenn man alle diese Unannehmlichkeiten nicht achten wollte, würde die Jagd noch immerhin ihre eigenen Schwierigkeiten haben. Die Färbung des Wildes stimmt stets so genau mit dem jeweiligen Aufenthaltsort überein, daß es überaus schwer hält, ein einzelnes Renntier, das sich gelagert hat, wahrzunehmen; an eine weidende Herde aber kommt man so leicht nicht heran. Die Geröllhalden spiegeln dem Jäger oft tückisch das Bild des gesuchten Wildes vor, er glaubt sogar Sprossen der Geweihe zu erkennen, und selbst das Fernrohr hilft solche Lügen bestärken; man geht eine volle Stunde lang, kommt zur Stelle und sieht, daß man sich getäuscht und anstatt der Tiere nur Felsblöcke ins Auge gefaßt hatte. Oder, was noch schlimmer, man hat die Renntiere für Steine angesehen, ist guten Mutes auf sie losgegangen und sieht nun plötzlich, daß sich das Rudel in einer Entfernung von ungefähr zwei- bis dreihundert Schritten erhebt und das Weite sucht. Die größte Vorsicht wird nötig, wenn man endlich nahe an das Wild kommt. Jede rasche Bewegung ist jetzt aufs strengste verpönt. Die norwegischen Jäger haben eine eigene Art, niederzuknien und aufzustehen; sie sinken Zentimeter um Zentimeter mit gleichmäßiger Langsamkeit förmlich in sich zusammen und verschwinden so allgemach, daß ein weidendes Renntier, selbst wenn es die sich mehr und mehr verkleinernde Gestalt sähe, doch sicherlich in ihr keinen Menschen erkennen würde. Sobald der Jäger auf dem Boden liegt, probt er nochmals durch kleine Stücke Moos, die er losreißt und in die Höhe wirft, den Wind, und dann beginnt er auf dem Bauche fortzukriechen, um sich soviel als möglich dem Rudel zu nähern. Mein alter Erik verstand diese Art, sich zu bewegen, so meisterhaft, daß ich, der ich mir einbildete, auch schleichen und kriechen zu können, wie ein beschämter Schulbube vor ihm stand oder vielmehr lag; denn mit Ausnahme der Fersengelenke bewegte sich an dem ganzen Manne kein Glied, und dennoch glitt er, wenn auch höchst langsam, immer und immer vorwärts. Wenn ein Wässerchen dem Jäger in den Weg kommt, kann er natürlich nicht ausweichen; aber da das Rinnsal etwas vertieft ist, kommt er auch darüber hinweg. Das Gewehr wird über den Nacken gelegt, so daß Schloß und Mündung vor dem Wasser gesichert sind, Pulverhorn oder Geschosse zwischen Hemd und Brust gelegt; ob das übrige naß wird, kümmert den Mann natürlich nicht, und so läuft er auf allen Vieren durch den Wildbach -, wir haben es auch getan. Kleinere Gräben werden ohne weitere Umstände durchkrochen; denn schon die Renntierflechten sind so feucht, daß der kriechende Jäger auf der ganzen Vorderseite ebenso naß wird, als ob er sich im Wasser gebadet hätte. Derart nähert man sich mehr und mehr dem Rudel und ist sehr froh, wenn man näher als zweihundert Schritte an dasselbe herankommt. Die meisten norwegischen Jäger schießen nicht aus bedeutender Entfernung und können dies, der geringen Güte ihrer Waffen halber, auch nicht tun; vermöchten sie aber aus einer Entfernung von dreihundert Schritten mit Sicherheit zu schießen, so würde gewiß jede Jagd ihnen eine Beute bieten; denn bis zu dieser Entfernung lassen die Renntiere einen geschickten Jäger regelmäßig an sich herankriechen. Sind nun Steine in der Nähe, so setzt der Kriechende seinen Weg fort, selbstverständlich so, daß er immer einen größern Stein zwischen sich und dem Leittier hat, also gedeckt wird. So kann es kommen, daß er bis auf hundertundzwanzig Schritte an das Rudel heranschleicht und dann seine alte, erprobte Büchse mit Sicherheit zu brauchen vermag. Er legt bedächtig auf einem Steine auf, zielt lange und sorgfältig und feuert dann nach dem besten Bock des Rudels hin, falls dieser sich günstig gestellt hat. Auf laufende Renntiere geben alle nordischen Gebirgsjäger nur sehr ausnahmsweise einen Schuß ab.
Nach meiner Erfahrung ist das Rudel nach dem ersten Schuß so verblüfft, daß es noch eine geraume Zeit verwundert stehen bleibt; erst nachdem es sich von der Gefahr vollständig überzeugt hat, wird es flüchtig. Diese Beobachtungen haben auch die norwegischen Jäger gemacht, und deshalb gehen sie gern selbander oder zu dreien und vieren auf die Jagd, schleichen zugleich nach einem Rudel hin, zielen verabredetermaßen auf bestimmte Tiere und lassen einen zuerst feuern; dann schießen auch sie. Ich bin fest überzeugt, daß Jäger, die mit guten, sicheren Doppelbüchsen bewaffnet sind, aus einem und demselben Rudel fünf bis sechs Renntiere wegschießen können, wenn sie sonst geschickt sich angeschlichen haben und regungslos hinter den Steinen liegen bleiben. Die geringste Bewegung freilich scheucht das Rudel augenblicklich in die wildeste Flucht.
Das wilde Ren hat außer dem Menschen noch viele Feinde. Der gefährlichste von ihnen ist der Wolf. Er umlagert die Rudel stets, am schlimmsten aber doch im Winter. Wenn der Schnee so fest geworden ist, daß er die Renntiere trägt, gelingt es dem bösen Räuber bei der Wachsamkeit seiner Beute nur äußerst selten, an eine Herde heranzukommen, und im ungünstigsten Falle sind dann auch die Renntierböcke noch so kräftig, daß sie ihm mit den Vorderläufen genügend zusetzen können; die Umstände ändern sich aber bei frischem Schneefall. Dann sinkt das Ren tief ein in die flaumige Decke, ermüdet leicht und wird von dem irgendwo hinter einem Felsblock oder dichten Busch lauernden Räuber viel leichter gefangen als sonst. Auf den Hochgebirgen rotten sich Meuten von Wölfen gerade um die Zeit zusammen, in der sich die Renntiere in starke Rudel schlagen, und nun beginnt ein nicht endender Kampf um das Leben. Durch Hunderte von Meilen ziehen die Wölfe den wandernden Renntierherden nach, und es kommt dahin, daß selbst die Menschen, eben der Wölfe wegen, solche Renntierzusammenrottungen verwünschen. In Norwegen mußten die Renntierzuchten, die man auf den südlichen Gebirgen anlegen wollte, der Wölfe wegen aufgegeben werden. Und dieser gierige Räuber ist noch nicht der einzige Feind. Der Vielfraß stellt den Renntieren, wie ich selbst gesehen, eifrig nach, der Luchs wird ihnen sehr gefährlich, und der Bär raubt, wenn auch nicht gerade in derselben Weise wie der Wolf, immer noch viele der bedrohten Tiere. Nächst diesen großen Räubern sind es kleine, scheinbar erbärmliche Kerbtiere, die mit zu den schlimmsten Feinden der Renntiere gezählt werden müssen. Es sind dies eine Stechmücke und zwei Dasselfliegen oder Bremsen. Die Mücken veranlassen und bestimmen die Wanderungen der Renntiere. Vor ihnen flüchten sie zum Meere hinab und in die Gebirge hinauf; von ihnen werden sie Tag und Nacht oder vielmehr während des monatelangen Sommertages unablässig in der fürchterlichsten Weise gequält. Nur wer selbst von jenen kleinen Ungeheuern tage- und wochenlang stündlich gestochen und geschröpft worden ist, kann die Qual begreifen, die die armen Geschöpfe zu leiden haben. Und diese Plage ist nicht die schlimmste, denn die Dasselfliegen bereiten den Renntieren vielleicht noch ärgere Pein. Eine Art legt ihre Eier in die Rückenhaut, eine zweite in die Nasenlöcher des Ren; die Larven entwickeln sich, und die der ersten Art bohren sich durch die Haut in das Zellgewebe ein, leben hier von dem Eiter, den sie erregen, verursachen im höchsten Grade schmerzhafte Beulen, wühlen sich weiter und weiter und bohren sich endlich, wenn sie der Reife nahe kommen, wieder heraus. Die Larven der zweiten Art gehen durch die Nasenhöhle weiter, dringen bis in das Hirn und verursachen die unheilbare Drehkrankheit, oder sie schlüpfen in den Gaumen und verhindern das Ren wegen des Schmerzes, der beim Kauen entsteht, am Äsen, bis endlich das gequälte Tier sie durch heftiges Niesen oft klumpenweise heraustreibt, aber erst, nachdem sie sich dick und voll gemästet haben. Im Juli oder Anfang August werden die Eier gelegt, im April oder Mai sind die Larven ausgebildet. Gleich im Anfang geben sich die Leiden des bedauernswerten Geschöpfes durch schweres Atmen zu erkennen, und oft genug ist der Tod, namentlich bei jüngeren Tieren, das wohltätige Ende aller Qual. Solchen von den Dasselfliegen gepeinigten Renntieren erscheinen Nebelkrähen und Schafstelzen als wohltätige Freunde. Sie vertreten die Stelle der Kuhvögel, Madenhacker und Kuhreiher, die wir später kennenlernen werden, fliegen auf den Rücken der armen Tiere und bohren aus den Geschwüren die Maden hervor, und die Renntiere verstehen ganz genau, wieviel Gutes die Vögel ihnen antun, denn sie lassen sie ruhig gewähren.
Jung eingefangene Renntiere werden sehr bald zahm; man würde sich aber einen falschen Begriff machen, wenn man die Renntiere, was die Zähmung anlangt, den in den Hausstand übergegangenen Tieren gleichstellen wollte. Nicht einmal die Nachkommen derjenigen, die schon seit undenklichen Zeiten in der Gefangenschaft leben, sind so zahm wie unsere Haustiere, sondern befinden sich immer noch in einem Zustande von Halbwildheit. Nur Lappen und deren Hunde sind imstande, solche Herden zu leiten und zu beherrschen.
Das zahme Renntier ist die Stütze und der Stolz, die Lust und der Reichtum, die Qual und die Last des Lappen; nach seinen Begriffen steht derjenige, der seine Renntiere nach Hunderten zählt, auf dem Gipfel menschlicher Glückseligkeit. Einzelne Lappen besitzen zwei- bis dreitausend Stück, die meisten aber höchstens deren fünfhundert; niemals jedoch erfährt ein Normann die eigentliche Anzahl der Herde eines dieser Biedermänner, denn alle Lappen glauben, daß Wolf und Unwetter sofort einige Renntiere vernichten würden, wenn sie, die Herren, unnötigerweise über ihre Renntiere, zumal über deren Anzahl, sprechen sollten. Mit Stolz schaut der Fjeldlappe, der eigentliche Renntierzüchter, auf alle andern seines Volkes herab, die das Nomadenleben aufgegeben und sich entweder als Fischer an Flüssen, Seen und Meeresarmen niedergelassen oder gar als Diener an Skandinavier verdingt haben; er allein dünkt sich ein echter, freier Mann zu sein; er kennt nichts Höheres als sein »Meer«, wie er eine größere Renntierherde zu nennen Pflegt. Sein Leben erscheint ihm köstlich; er meint, daß ihm das beste Los auf Erden zugefallen wäre.
Und was für ein Leben führen diese Leute! Nicht sie bestimmen es, sondern ihre Herde; die Renntiere gehen, wohin sie wollen, und die Lappen müssen ihnen folgen. Der Fjeldlappe führt ein wahres Hundeleben. Monatelang verbringt er den größten Teil des Tages im Freien, im Sommer gequält und gepeinigt von den Mücken, im Winter von der Kälte, gegen die er sich nicht wehren kann. Oft kann er sich nicht einmal Feuer schüren, weil er in den Höhen, die seine Herde gerade abweidet, kein Holz findet; oft muß er hungern, weil er sich weiter entfernt, als er will. Dürftig geschützt durch die Kleidung, ist er allen Unbilden der Witterung Preisgegeben; seine Lebensweise macht ihn zu einem halben Tiere. Er wäscht sich nicht; er nährt sich von geradezu abscheulichen Stoffen, die ihm der Hunger eintreibt; er hat oft keinen andern Gefährten als seinen treuen Hund und teilt mit diesem ehrlich und redlich die geringe Nahrung, die ihm wird. Und alles dies erträgt er mit Lust und Liebe, seiner Herde wegen.
Das Leben der zahmen Renntiere unterscheidet sich fast in jeder Hinsicht von dem geschilderten des wilden Ren. Jene sind, wie ich oben angab, kleiner und häßlicher gestaltet, werfen später ab, pflanzen sich auch zu einer andern Zeit im Jahre fort als die wilden und wandern beständig. Manchmal unmittelbar unter der Herrschaft des Menschen lebend, genießen sie zu gewissen Zeiten ihre Freiheit im vollsten Maße. Bald wächst ihnen die Nahrung so reichlich zu, daß sie kräftig und feist werden, bald müssen sie Hunger und Kummer erdulden wie ihr Herr. Im Sommer leiden sie entsetzlich von den Mücken und Renntierbremsen, im Winter von dem Schnee, der die Weide verdeckt und ihnen durch seine harte Kruste oft die Füße verwundet.
In Norwegen und Lappland wandern die Lappen gewöhnlich längs der Flüsse nach dem Gebirge oder dem Meere zu, getrieben durch die Mücken, und von den Gebirgen wieder zur Tiefe herab oder von dem Meere nach dem Innern des Landes, genötigt durch das Herannahen des Winters. In den Monaten Juli und August leben die Renntiere auf den Gebirgen und am Meeresstrande, vom September an findet die Rückwanderung statt, und um diese Zeit läßt der Lappe, wenn er bei seinen Herbststellen, kleinen Blockhäusern, in denen er die notdürftigsten Lebensbedürfnisse verwahrt, angelangt ist, seine Renntiere die Freiheit genießen, falls »Friede im Lande« ist, d.+h. falls keine Wölfe in der Nähe umherstreifen. In diese Zeit fällt die Brunft, und dabei geschieht es, daß die zahmen mit den wilden sich vermischen, zur lebhaften Freude der Herdenbesitzer, die hierdurch eine bessere Zucht erzielen. Mit dem ersten Schneefalle werden die Renntiere wieder eingefangen und gehütet, denn um diese Zeit gilt es, sie mehr als je vor den Wölfen zu bewahren. Nun kommt der Frühling heran und mit ihm eine neue Zeit der Freiheit. Dann werden die Tiere nochmals zur Herde gesammelt, denn jetzt setzen die Kühe ihre Kälber und liefern die köstliche Milch, die nicht verlorengehen darf; sie werden also wieder nach den Orten getrieben, wo es wenig Mücken gibt. So geht es fort, von einem Jahre zum andern.
Eine Renntierherde gewährt ein höchst eigentümliches Schauspiel. Sie gleicht allerdings einem wandelnden Walde, wohlverstanden, wenn man annimmt, daß der Wald gerade blätterlos ist. Die Renntiere gehen geschlossen wie die Schafe, aber mit behenden, federnden Schritten und so rasch, wie keines unserer Haustiere. Auf der einen Seite wandelt der Hirt mit seinen Hunden, welch letztere ihrerseits eifrig bemüht sind, die Herde zusammenzuhalten. Ohne Aufhören umkreisen sie die Tiere, jedes, das heraustritt, augenblicklich wieder zur Herde treibend. So bringen sie es dahin, daß der Trupp immer geschlossen bleibt. Durch sie wird es dem Lappen sehr leicht, jedes beliebige Renntier mit seiner Wurfschlinge, die er geschickt zu handhaben versteht, aus dem Haufen herauszufangen.
Wenn es gute Weide in der Nähe gibt, bauen sich die Lappen zur Erleichterung des Melkens eine Hürde, in die sie allabendlich ihre Tiere treiben. Wenn man sich der Hürde nähert, vernimmt man zuerst das beständige Blöken und dann, bei der ununterbrochenen Bewegung, ein Knistern, als ob Hunderte von elektrischen Batterien in Tätigkeit gesetzt würden. In der Mitte der Hürde liegen mehrere große Baumstämme, an die die Renntiere beim Melken angefesselt werden. Ohne Wurfschlinge läßt sich kein Renntier seiner Milch berauben; deshalb trägt jeder Lappe und jede Lappin eine solche beständig bei sich. Sie besteht entweder aus einem langen Riemen oder einem Strick, wird leicht in Ringe zusammengelegt, an beiden Enden festgehalten und so geworfen, daß sie um den Hals oder das Geweih des Tieres zu fallen kommt; dann faßt man sie kürzer und kürzer, bis man letzteres ganz nahe an sich herangezogen hat, bildet eine Schifferschlinge und legt sie ihm um das Maul, hierdurch es fest und sicher zäumend und zu unbedingtem Gehorsam nötigend. Hierauf bindet man es an dem Klotz fest und beginnt das Melkgeschäft. Sofort nach dem Melken öffnet man die Hürden und zieht wieder auf die Weide hinaus, gleichviel, ob man am frühen Morgen oder am späten Abend die Tiere versammelt; denn man weidet Tag und Nacht.
Während der Sommermonate bereiten die Lappen kleine, sehr wohlschmeckende, wenn auch etwas scharfe Käse aus der wenigen Milch, die ihre Herdentiere ihnen geben. Diese Käse dienen später als eines ihrer vorzüglichsten Nahrungsmittel. Sie wissen daraus unter anderm auch eine Art Suppe zu bereiten, die sie als höchst schmackhaft schildern. Im September ist die eigentliche Schmaus- und Schlachtzeit; denn das Renntierfleisch, namentlich das von Böcken herrührende, nimmt einen schlechten Geschmack an, wenn die Hirsche gebrunstet haben. Das Ren wird, um es zu Boden zu werfen, genickfangt; dann stößt der Schlächter sein Messer in das Herz des Opfers, sorgfältig darauf achtend, daß sich alles Blut in der Brusthöhle sammle. Während des Abhäutens wird die Stichwunde durch ein eingeschobenes Holzstückchen verschlossen. Nachdem die Haut abgezogen worden ist, nimmt man die Eingeweide heraus und schöpft das übrige Blut in den geleerten und etwas gereinigten Wanst, den der Lappe nunmehr eine »Renntierbrust« nennt. Aus dem Blut wird Suppe bereitet, und erst wenn diese fertig ist, geht es an ein Zerteilen des Schlachtopfers. Kopf, Hals, Rücken, Seiten und Brust werden voneinander abgetrennt und dann außer dem Bereiche der Hunde an ein Gerüst gehängt. Etwa noch ausfließendes Blut sammelt man in Gefäßen. Bei fernerem Zerteilen schneidet man die Sehnen sorgfältig heraus, weil sie später Zwirn und Rockschnüre geben sollen. Das Mark dient als besonderer Leckerbissen. Der Hausvater besorgt ebensowohl das Schlachten wie die Zubereitung der Speise, kostet dabei von Zeit zu Zeit, und zwar so ernstlich, daß er bereits vor dem Mahle gesättigt sein könnte, ißt hierauf noch soviel, als sein Magen aufnehmen kann, und gedenkt nun erst der Kinder und schließlich der Hunde. Zu solchen Renntierschmäusen werden auch die umwohnenden Lappen eingeladen; während des September gibt es daher eine Völlerei nach der andern.
Mancherlei Seuchen richten oft arge Verheerungen unter den Renntieren an, und außerdem trägt das rauhe Klima dazu bei, daß sich die Herden nicht so vermehren, als es, der Fruchtbarkeit des Ren angemessen, sein könnte. Junge und zarte Kälber erliegen der Kälte oder leiden von den heftigen Schneestürmen, so daß sie, vollkommen ermattet, der Herde nicht weiter folgen können; ältere Tiere können bei besonders tiefem Schnee nicht mehr hinlänglich Nahrung finden, und wenn der Lappe unter solchen Umständen sich auch bemüht, ihnen in den Wäldern einige Äsung zu verschaffen, indem er die mit Flechten reich behangenen Bäume niederschlägt, er kann der Herde doch nicht das erforderliche Futter bieten. Sehr schlimm ist es, wenn zwischen den Schneefällen einmal Regen eintritt und der Schnee dadurch eine harte Kruste erhält. Eine solche verwehrt dem Ren, durch Wegschlagen der Schneedecke zu seiner Äsung zu gelangen. Dann entsteht oft bittere Not unter den Lappen, und Leute, die nach dortigen Volksbegriffen als reich gelten, werden unter solchen Umständen manchmal in einem einzigen Winter arm.
Der gesamte Nutzen, den die zahmen Renntiere ihrem Besitzer bringen, würde, auf unsere Verhältnisse übertragen, gar nicht zu berechnen sein. Alles, was das Tier erzeugt, wird verwendet, nicht bloß das Fleisch und die Milch, sondern auch jeder einzelne Teil des Leibes. Die noch knorpeligen Hörner werden ebenso gern gegessen wie die des Elentieres in gleichem Zustande; aus den weichen Fellen der Renntierkälber verfertigt man sich die Kleider, das Wollhaar wird gesponnen und verwebt; aus den Knochen macht man sich allerlei Werkzeuge, die Sehnen benutzt man zu Zwirn und dergleichen. Außerdem muß das Tier auch noch, namentlich während des Winters, die ganze Familie und ihr Hab und Gut von einem Orte zum andern schaffen. In Lappland benutzt man das Ren hauptsächlich zum Fahren, weniger zum Lasttragen, weil ihm letzteres, des schwachen Kreuzes wegen, sehr beschwerlich fällt. Die Tungusen und Koräken aber reiten auch auf den stärksten Rennhirschen, indem sie einen kleinen Sattel gerade über die Schulterblätter legen und sich mit abstehenden Beinen auf das sonderbare Reittier setzen. In Lappland reitet niemand auf Renntieren, und bloß die stärkste« Böcke oder »Rennochsen « wie die Norweger sagen, werden zum Fahren benutzt. Kein Ren wird vorher zum Zuge abgerichtet; man nimmt ohne viel Umstände ein beliebiges, starkes Tier aus der Herde und spannt's vor den höchst passenden, der Natur des Landes und des Renntieres durchaus entsprechenden Schlitten. Dieser ist von dem bei uns gebräuchlichen freilich ganz verschieden und ähnelt vielmehr einem Boote. Er besteht aus sehr dünnen Birkenbrettern, die von einem breiten Kiel an bootartig gekrümmt aneinander genagelt werden und so eine Mulde bilden, deren Vorderteil bedeckt ist. Ein senkrecht stehendes Brett am Hinterteil dient zur Rückenlehne, ein starkes Ös am Vorderteil als Deichsel. Selbstverständlich kann bloß ein einziger Mann in einem solchen Bootschlitten sitzen, und notwendigerweise muß er die Beine gerade vor sich hin, ausstrecken. Da nun aber der Schlitten mit Renntierfellen ausgefüttert ist, ruht man sehr bequem und warm in dieser sonderbaren Stellung. Für das Gepäck oder für zu befördernde Ware hat man Schlitten, die oben mit Schiebedeckeln verschlossen werden können, den andern aber sonst ganz ähnlich sind.
*
An das Ren reihen sich naturgemäß die Damhirsche ( Dama) an. Die Kennzeichen der Sippe liegen in den unten runden, zweisprossigen Geweihstangen, die sich oben zu einer verlängerten Schaufel mit Randsprossen erweitern. Der Damhirsch ( Dama vulgaris) steht seinem edlen Verwandten an Größe bedeutend nach. Seine Gesamtlänge, einschließlich des 19 Zentimeter langen Wedels, beträgt 1,7 Meter, die Höhe 90 Zentimeter; Haupthirsche sind 1,8 Meter und darüber lang und gegen 1 Meter hoch, hinten noch 5 bis 7 Zentimeter mehr. Von dem Edelwilde unterscheidet sich das Damwild durch die kürzeren und minder starken Läufe, den verhältnismäßig stärkeren Körper, den kürzeren Hals, das kürzere Gehör und durch den längeren Wedel sowie auch durch die Färbung. Keine unserer heimischen Wildarten zeigt so viele Abänderungen in der Färbung wie der Damhirsch, ebensowohl nach der Jahreszeit als nach dem Alter. Im Sommer sind Oberseite, Schenkel und Schwanzspitze braunrötlich, Unterseite und Innenseite der Beine dagegen weiß; schwärzliche Ringe umranden Mund und Augen; die Rückenhaare sind weißlich am Grunde, rotbraun in der Mitte und schwarz an der Spitze. Im Winter wird die Oberseite an Kopf, Hals und Ohren braungrau, aus dem Rücken und an den Seiten schwärzlich, die Unterseite aschgrau, manchmal ins Rötliche ziehend. Nicht eben selten sind ganz weiße, die ihre Farbe zu keiner Jahreszeit wechseln und im Winter nur durch das längere Haar sich auszeichnen. Manche Hirsche tragen in der Jugend auch ein gelbliches Kleid; seltener endlich kommen schwarz gefärbte vor.

Damhirsch (Dama vulgaris)
Hinsichtlich seiner Lebensweise und Bewegung ähnelt das Damwild dem Edelhirsch in vieler Beziehung. Die Sinne beider Tiere stehen auf gleicher Stufe, und auch die geistigen Eigenschaften sind ungefähr dieselben. Doch ist das Damwild minder scheu und vorsichtig als der Edelhirsch, treibt sich oft bei Hellem Tage auf lichten Stellen des Waldes umher und wechselt weder so regelmäßig noch so weit wie sein Verwandter. An Schnelligkeit, Sprungkraft und Gewandtheit gibt das Damwild dem Edelhirsch kaum etwas nach? in der Art der Bewegung aber unterscheiden sich beide, denn das Damwild hebt im Trollen die Läufe höher, springt in nicht ganz voller Flucht nach Art der Ziegen satzweise mit allen vier Läufen zugleich und trägt den Wedel dabei erhoben. Sein Gang hat etwas Anmutiges; es trollt mit großer Leichtigkeit und springt über eine zwei Meter hohe Wand. Unter Umständen schwimmt es auch gut. Immer tut es sich auf seine vier Läufe nieder, niemals auf die Seite. Beim Niederknien fällt es zuerst auf die Vorderläufe, beim Aufstehen hebt es sich zuerst mit den Hinterläufen. Die Äsung beider Hirscharten ist ganz dieselbe; doch schält das Damwild mehr als das Rotwild, und gerade hierdurch wird es schädlich. Sehr auffallend ist es, daß unser Wild zuweilen von giftigen Pflanzen äst, deren Genuß ihm den Tod bringt. So gingen in einem Tiergarten in Preußen einmal ganze Trupps von Damwild ein, wie sich herausstellte, nur infolge der Äsung giftiger Schwämme.
An seinem Stande hält das Damwild sehr fest. Es bildet größere oder kleinere Trupps, die sich vor der Brunstzeit verstärken, dann aber wieder verteilen, weil die starken Hirsche während des Sommers einzeln, die schwächeren aber mit den Tieren und Kälbern vereinigt gehen. Um die Mitte des Oktober suchen die Damhirsche ihre Rudel auf und treiben die Spießer und geringen Hirsche vom Rudel ab, sie hierdurch zwingend, wenig zählende Trupps unter sich zu bilden; sobald aber die stärkeren Hirsche gebrunstet haben, erscheinen die schwächeren wieder beim Rudel. Die Damhirsche sind um die Brunstzeit sehr erregt. Sie rufen des Nachts laut, und gleichstarke kämpfen heftig miteinander um die Tiere. In Tiergärten duldet man bloß drei- oder vierjährige Schaufler, weil die älteren so kampflustig sind, daß dadurch die Vermehrung des Standes wesentlich beeinträchtigt wird. Ein Hirsch genügt ungefähr acht Tieren; aber auch schon Spießer sind imstande, fruchtbar zu beschlagen. Nach ungefähr vierzehn Tagen ist die Brunst vorüber.
Das Damtier geht acht Monate hochbeschlagen und setzt gewöhnlich im Juni ein Kalb, seltener deren zwei. Das Junge ist in den ersten Tagen seines Lebens sehr unbehilflich und muß deshalb von den Alten sorgfältig beschützt und gehütet werden. Kleinere Raubtiere, die ein Gelüst nach dem bunten Kälbchen zeigen, treibt die Mutter durch Schlagen mit den Vorderläufen ab; vor größeren Raubtieren geht sie langsam dahin, um sie von dem Platze abzulocken, wo ihr Kind verborgen ruht, entflieht eiligst und kehrt unter unzähligen Haken und Widergängen nach dem alten Platze zurück. Wenn das Damhirschkalb sechs Monate ist, zeigen sich bei dem männlichen Erhebungen aus dem Rosenstocke, aus denen zu Ende des nächsten Februar die Spieße hervortreten und bis zum Fegen im August sich ausbilden. Nun heißt das Kalb ein Spießer; im zweiten Jahr wird ein Gabler daraus; im dritten Jahr treten kurze Augensprossen, bei recht guter Äsung auch wohl an jeder Stange eine oder zwei kurz abgestumpfte Enden hervor, die im folgenden Jahr sich noch mehr zu vermehren pflegen. Erst im fünften Jahr beginnt die Bildung der Schaufeln, die mit der Zeit ebensowohl an Größe zunehmen als auch mehr und mehr Randsprossen erhalten. Geweihe recht alter Damhirsche sind oft sehr schön und 7 bis 9 Kilogramm schwer. Solche alte Hirsche heißen Schaufler, gute und Hauptschaufler, je nach der Größe ihres Geweihes; jüngere nennt man Hirsche vom zweiten und dritten Kopfe. Aus dem Kalbe weiblichen Geschlechts wird, wenn es ein Jahr alt ist, ein Schmaltier und, wenn es zum erstenmal gebrunstet hat, ein Alttier. Die alten Hirsche werfen im Mai, die Spießer erst im Juni ab, gewöhnlich jedoch nicht beide Stangen zu gleicher Zeit, sondern im Verlauf von zwei bis drei Tagen. Bis zum August sind die Stangen ausgebildet.
Die Spur des Damwildes ist vorn mehr zugespitzt und verhältnismäßig länger als die des Rotwildes; sie ähnelt am meisten der Fährte einer Ziege, ist aber selbstverständlich um vieles stärker.
Man jagt das Damwild entweder in großen Treiben oder auf Pirschgängen; auch ist, weil es sehr genau Wechsel hält, der Anstand lohnend. Am leichtesten ist ihm pirschend anzukommen, wenn man in Gesellschaft eines Gefährten seinen Weg trällernd oder pfeifend dahinwandelt, sich aber dabei auf einer oder der andern Seite unmerklich heranzieht. In gehöriger Büchsenschußweite bleibt dann der Schütze, der sich durch einen Baumstrauch oder auf andere Weise gedeckt hat, stehen, während der Begleiter immer trällernd oder pfeifend seinen Weg fortsetzt, bis der erste geschossen hat. An ein einzeln äsendes Stück kann man sich ziemlich leicht heranschleichen, falls man den Wind gut wahrnimmt. Vor Pferden und Fuhrwerken hält es fast immer aus; wenn es aber einmal scheu geworden ist, flüchtet es bei der geringsten Gefahr auf weite Entfernungen.
Die Haut des Damwildes wird ihrer Dehnbarkeit und Weiche halber mehr geschätzt als die des Edelwildes. Das Wildbret ist sehr lecker, am besten vom Juli bis zur Mitte des September, wo der Hirsch viel Feist auflegt. Nur wenn die Brunstzeit herannaht, nimmt das Wildbret des Hirsches einen Bockgeruch an, weshalb auch in dieser Zeit kein Damwild erlegt werden darf.
Für Tierparke eignet sich ein Stand dieses Wildes vortrefflich. Auf fünfzig Morgen Land kann man sechzig Stück halten und davon jährlich acht abschießen. Das Damwild ist munter und zum Scherzen aufgelegt und nur bei stürmischer Witterung unstet und unruhig. Dieselben Eigenschaften behält es in der engern Gefangenschaft, an die es sich leicht gewöhnt. Jung eingefangene, mit Kuh- oder Ziegenmilch aufgezogene Kälber werden ungemein zahm und können dahin gebracht werden, daß sie ihrem Herrn wie ein Hund auf dem Fuß nachlaufen. Für Musik scheint das Damwild eine ganz besondere Liebhaberei an den Tag zu legen? selbst das freilebende kommt, wenn es die Töne des Hornes vernimmt, näher und näher, um zuzuhören. Männliche Damhirsche werden in der Gefangenschaft, wenn die Brunstzeit herannaht, böse und kampflustig, wie alle im engen Gewahrsam gehaltenen Hirsche, gehen dreist auf den Menschen los und können diesen trotz ihres nicht eben tüchtigen Geweihes empfindlich verletzen. Nach eigenen Erfahrungen suchen sie im tollen Übermute sogar mit anderen, stärkeren Hirschen anzubinden und lassen sich selbst durch derbe Abfertigung nicht belehren. Angenehme, d. h. ihres Wesens halber ansprechende Gefangene sind sie ebensowenig als andere Hirsche.
*
Bei den Hirschen im engsten Sinne (Cervus) tragen ebenfalls bloß die männlichen Glieder Geweihe mit runden Ästen oder Stangen. Von den mehr oder weniger zahlreichen Sprossen sind mindestens drei nach vorwärts gerichtet, Augen- und Mittelsprossen immer, die Eissprossen weniger regelmäßig vorhanden. An der Außenseite des Mittelfußes befinden sich Haarbüschel. Die Tränengruben sind deutlich. Bei alten Männchen (seltener auch bei sehr alten Weibchen) treten die Eckzähne im Oberkiefer über die anderen weit hervor.

Edel- oder Rothirsch (Cervus elaphus)
Eine der stattlichsten und edelsten Gestalten dieser Gruppe, für uns die wichtigste aller Arten, ist der Edel- oder Rothirsch (Cervus Elaphus). Ungeachtet seiner Schlankheit ist er doch kräftig und schön gebaut und seine Haltung eine so edle und stolze, daß er seinen Namen mit vollstem Rechte führt. Seine Leibeslänge beträgt etwa 2,3 Meter, die des Schwanzes 16 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 1,6 Meter und die am Kreuz einige Zentimeter weniger. Das Tier ist bedeutend kleiner und gewöhnlich auch anders gefärbt. Hinsichtlich der Größe bleibt unser Edelhirsch nur hinter dem Wapiti und dem persischen Hirsch zurück, wogegen er die übrigen bekannten Arten seiner Sippe übertrifft. Er hat gestreckten, in den Weichen eingezogenen Leib mit breiter Brust und stark hervortretenden Schultern, geraden und flachen Rücken, der am Widerrist etwas erhaben und am Kreuz vorstehend gerundet ist, langen, schlanken, seitlich zusammengedrückten Hals und langen, am Hinterhaupte hohen und breiten, nach vorn zu stark verschmälerten Kopf, mit flacher, zwischen den Augen ausgehöhlter Stirn und geradem Nasenrücken. Die Augen sind mittelgroß und lebhaft, ihre Sterne länglichrund. Die Tränengruben stehen schräg abwärts gegen den Mundwinkel zu, sind ziemlich groß und bilden eine schmale, längliche Einbuchtung, an deren inneren Wänden eine fettige, breiartige Masse abgesondert wird, die das Tier später durch Reiben an den Bäumen auspreßt. Das Geweih des Hirsches sitzt auf einem kurzen Rosenstocke auf und ist einfach verästelt, vielsprossig und aufrechtstehend. Von der Wurzel an biegen sich die Stangen in einem ziemlich starken Bogen, der Stirn gleichgerichtet, nach rückwärts und auswärts, oben krümmen sie sich wieder in sanftem Bogen nach einwärts und kehren dann ihre Spitzen etwas gegeneinander. Unmittelbar über der Nase entspringt auf der Vorderseite der Stange der Augensproß, der sich nach vor- und auswärts richtet; dicht über derselben tritt der kaum minder lange und dicke Eissproß hervor; in der Mitte der Stange wächst der Mittelsproß heraus, und am äußern Ende bildet sich die Krone, die ihre Zacken ebenfalls nach vorn ausdehnt, aber je nach dem Alter oder der Eigentümlichkeit des Hirsches mannigfaltig abändert. Die Stange ist überall rund und mit zahlreichen, teils geraden, teils geschlängelten Längsfurchen durchzogen, zwischen denen sich in der Nähe der Wurzel längliche oder rundliche, unregelmäßige Knoten oder Perlen bilden. Die Spitzen der Enden sind glatt. Mittelhohe, schlanke, aber doch kräftige Beine tragen den Rumpf, und gerade, spitzige, schmale und schlanke Hufe umschließen die Zehen; die Afterklauen sind länglichrund, an der Spitze flach abgestutzt und gerade herabhängend, berühren aber den Boden nicht. Der Schwanz ist kegelförmig gebildet und nach der Spitze zu verschmälert. Ein feines Woll- und ein grobes Grannenhaar deckt den Leib und liegt ziemlich glatt und dicht an, nur am Vorderhalse verlängert es sich bedeutend. Meiner Ansicht nach besteht die Winterdecke nicht aus Grannen, sondern ausschließlich aus überwuchernden, eigentümlich veränderten Wollhaaren, zwischen denen sich noch einige wenige wie gewöhnlich gebildete befinden. Die richtige Deutung der Haare des Winterkleides unserer Wildarten ist übrigens schwer und eine irrige Ansicht in dieser Beziehung leicht möglich. Die straffe, nicht überhängende Oberlippe des Edelhirsches trägt drei Reihen dünner, langer Borsten! ähnliche Haargebilde stehen auch über den Augen. Nach Jahreszeit, Geschlecht und Alter ändert die Färbung des Rotwildes. Im Winter sind die Grannen mehr graubraun, im Sommer mehr rötlichbraun! das Wollhaar ist aschgrau mit bräunlicher Spitze. Am Maule fällt das Haar ins Schwärzliche, um den After herum ins Gelbliche. Nur die Kälber zeigen in den ersten Monaten weiße Flecke auf der rotbraunen Grundfarbe. Mancherlei Farbenänderungen kommen vor, indem die Grundfärbung manchmal ins Schwarzbraune, manchmal ins Fahlgelbe übergeht. Hirsche, die auf farbigem Grund weiß gefleckt oder vollkommen weiß sind, gelten als seltene Erscheinung.

Suhlende Hirsche (Cervus elaphus)
In der Weidmannssprache gebraucht man folgende Ausdrücke: Der männliche Hirsch heißt Hirsch, Edelhirsch oder Rothirsch, der weibliche Tier, Rottier und Stück Wild, das Junge Kalb, mit Rücksicht des Geschlechtes aber Hirsch- oder Wildkalb. Das Hirschkalb wird, nachdem es das erste Jahr vollendet hat, Spießer genannt; im zweiten Jahre erhält es den Namen Gabelhirsch oder Gabler; im dritten Jahr heißt es Sechsender usw., je nach der Anzahl der Enden oder Sprossen des Geweihes. Wenn dieses ganz regelmäßig gebildet erscheint, ist der Hirsch ein gerader Ender, wenn eine Stange nicht genau wie die andere ist, ein ungerader. Erst wenn der Hirsch zwölf Enden hat und 300 Pfund wiegt, wird er ein jagdbarer oder guter Hirsch genannt; mit zehn Enden ist er noch ein schlecht jagdbarer. Ein sehr alter und starker, guter Hirsch heißt Kapitalhirsch; er trägt ein gutes, braves, prächtiges Gewicht oder Geweih. Ein starker und großer Hirsch sieht gut, ein magerer schlecht aus am Leibe; einen irgendwie unvollkommenen Hirsch nennt man Kümmerer. Der Hirsch hat kein Fleisch, sondern Wildbret, kein Blut, sondern Schweiß, kein Fett, sondern Feist; seine Beine heißen Läufe, die Schultern Blätter, die Schenkel Keulen, der Unterrücken Ziemer, die Dünnungen Flanken, die Luftröhre Drossel, der Kehlkopf Drosselknopf, der Schwanz Wedel, die Augen Lichter, die Ohren Gehör, die Hörner Geweih, das Fell Haut, die Gedärme Gescheide, die inneren Teile Lunge, Geräusch oder Gelänge, der After Weideloch, die Hufe Schalen, die Afterklauen Oberrücken oder Geäster, das Euter Gesäuge. Eine Gesellschaft Edelwild wird ein Trupp oder ein Rudel genannt, und auch hierbei unterscheidet man einen Trupp Hirsche von einem Trupp Wild. Das Edelwild steht in einem Revier, steckt in einem Teil desselben, wechselt aus einem bestimmten Wege hin und her, zieht auf Äsung oder zu Holze, tritt aus dem Holz auf die Felder, oder Gehaue; es geht vertraut, wenn es im Schritt läuft, trollt oder trabt, ist flüchtig, wenn es rennt, fällt über Jagdzeuge oder ins Garn; es tut sich nieder, wenn es ruht, und löst sich, wenn es ein natürliches Bedürfnis befriedigt. Der Hirsch orgelt, röhrt oder schreit, das Tier mahnt (beide klagen, wenn sie bei Verwundungen aufschreien); es verendet, wenn der Tod infolge von Verwundung entsteht, oder fällt und geht ein, wenn es einer Krankheit unterliegt; es brunstet oder brunftet; das Tier geht hochbeschlagen und setzt ein Kalb. Bei guter Äsung wird das Hochwild feist, bei magerer schlecht; der Hirsch setzt sein Geweih auf und vereckt es oder bildet es vollkommen aus; den Bast, der an ihm sitzt, fegt er; die abfallenden Stücke sind das Gefege. Das Urteil eines Weidmanns über den Hirsch heißt der Anspruch usw.

Äsendes Rot- und Schwarzwild
Noch gegenwärtig bewohnt das Edelwild fast ganz Europa, mit Ausnahme des höchsten Nordens, und einen großen Teil Asiens. In Europa reicht seine Nordgrenze etwa bis zum 65., in Asien bis zum 55. Grad nördlicher Breite; nach Süden hin bilden der Kaukasus und die Gebirge der Mandschurei die Grenzen. In allen bevölkerten Ländern hat es sehr abgenommen oder ist gänzlich ausgerottet worden, so in der Schweiz und einem großen Teil von Deutschland. Am häufigsten ist es noch in Polen, Galizien, Böhmen, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Kärnten, Steiermark und Tirol; viel häufiger aber als in allen diesen Ländern findet es sich in Asien, namentlich im Kaukasus und in dem bewaldeten südlichen Sibirien. Es liebt mehr gebirgige als ebene Gegenden und vor allem große, zusammenhängende Waldstrecken, namentlich Laubhölzer. Hier schlägt es sich zu größeren oder kleineren Trupps zusammen, die nach dem Alter und Geschlecht gesondert sind. Alte Tiere, Kälber, Spießer, Gabler und Schmaltiere bleiben gewöhnlich vereinigt; die älteren Hirsche bilden kleine Trupps für sich, und die starken oder Kapitalhirsche leben einzeln bis zur Brunstzeit, wann sie sich mit den übrigen Trupps vereinigen. Die stärksten Rudel werden demgemäß von den Tieren und den jungen Hirschen, die schwachen von Hirschen mittleren Alters gebildet. Die Kälber bleiben bis zur nächsten Satzzeit bei der Mutter und gesellen sich sodann als Spießer oder Schmaltiere zu den aus älteren Hirschen und Schmaltieren gebildeten Trupps, wogegen die Alttiere, sobald die Kälber ihnen folgen können, neue Rudel bilden und erst im Spätsommer, jedoch nicht immer, mit jenen Rudeln sich wieder zusammenschlagen. An der Spitze des Rudels steht stets ein weibliches Tier, nach dem sich alle übrigen richten. Dies geschieht selbst während der Brunstzeit, solange der Hirsch die Tiere nicht treibt. Jener erscheint im Rudel stets zuletzt, und zwar um so gewisser, je stärker er ist. »Sieht man«, sagt Blasius, »in der Brunstzeit mehrere starke Hirsche beim Rudel, so kann man immer mit Sicherheit auf einen noch stärkern rechnen, der oft fünfhundert Schritte hinterdrein trollt.« Im Winter ziehen sich die Trupps von den Bergen zur Tiefe zurück, im Sommer steigen sie bis zu den höchsten Spitzen der Mittelgebirge empor; im allgemeinen aber hält das Edelwild, solange es ungestört leben kann, an seinem Stande treulich fest, und nur in der Brunstzeit oder beim Aufsetzen der neuen Geweihe und endlich bei Mangel an Äsung verändert es freiwillig seinen alten Wohnort. Der Schnee treibt es im Winter aus den höheren Gebirgen in die Vorberge herab, und das weiche Geweih nötigt es, in sehr niederem Gebüsch oder im Holze, wo es an den Zweigen nicht anstreicht, sich aufzuhalten. Wird der Wald sehr unruhig, so tut es sich zuweilen in Getreidefeldern nieder. Den Tag über liegt es in seinem Bett verborgen, gegen Abend zieht es auf Äsung aus, im Sommer früher als im Winter. Nur in Gegenden, wo es sich völlig sicher weiß, äst es zuweilen auch bei Tage. Beim Ausgehen nach Äsung pflegt es sich in raschem Trabe zu bewegen oder zu trollen; der Rückzug am Morgen dagegen erfolgt langsam, weshalb ihn die Jäger den Kirchgang nennen. Auch wenn die Sonne bereits aufgegangen ist, verweilt es noch in den Vorhölzern; denn der Morgentau, der auf den Blättern liegt, ist ihm unangenehm.
Alle Bewegungen des Edelwildes sind leicht, zierlich und anstandsvoll; namentlich der Hirsch zeichnet sich durch seine edle Haltung aus. Der gewöhnliche Gang fördert hinlänglich; im Trollen bewegt sich das Wild sehr schnell und im Laufe mit fast unglaublicher Geschwindigkeit. Beim Trollen streckt es den Hals weit nach vorn, im Galopp legt es ihn mehr nach rückwärts. Ungeheure Sätze werden mit spielender Leichtigkeit ausgeführt, Hindernisse aller Art ohne Aufenthalt überwunden, im Notfall breite Ströme, ja selbst – in Norwegen oft genug – Meeresarme ohne Besinnen überschwommen. Den Jäger fesselt jede Bewegung des Tieres, jedes Zeichen, das es bei der Spur zurückläßt, oder das überhaupt von seinem Vorhandensein Kunde gibt. Schon seit alten Zeiten sind alle Merkmale, die den Hirsch bekunden, genau beobachtet worden. Der geübte Jäger lernt nach kurzer Prüfung mit unfehlbarer Sicherheit aus der Fährte, ob sie von einem Hirsch oder von einem Tier herrührt, schätzt nach ihr sogar ziemlich richtig das Alter des Hirsches. Die Anzeichen werden gerechte genannt, wenn sie untrüglich sind, und der Jäger spricht nach ihnen den Hirsch an. Unsere Vorfahren kannten zweiundsiebzig solcher Zeichen; Dietrich aus dem Winckell aber glaubt, daß man diese auf siebenundzwanzig herabsetzen kann. Ich will nur einige von ihnen anführen. Der Schrank oder das Schränken besteht darin, daß, wenn der Hirsch feist ist, die Tritte des rechten und linken Laufes nicht gerade hinter-, sondern nebeneinander kommen; an der Weite des Schrittes erkennt man die Schwere des Hirsches. Der Schritt kennzeichnet den Hirsch, weil die Eindrücke der Füße weiter voneinander stehen als bei dem Tier; schreitet er weiter als 75 Zentimeter ans, so kann er schon ein Geweih von zehn Enden tragen. Der Burgstall oder das Grimmen ist eine kleine, gewölbte Erhebung in der Mitte des Trittes, der Beitritt, der den feisten Hirsch anzeigt, der Eindruck des Hinterlaufes neben dem Tritt des Vorderlaufes. Der Kreuztritt entsteht, wenn der Hirsch so weit ausschreitet, daß der Tritt des Hinterlaufes in den zu stehen kommt, den der Vorderlauf zurückließ; das Tier geht niemals in dieser Weise. Das Ballenzeichen bildet sich, wenn die Ballen an allen vier Tritten ausgedrückt sind, das Blenden, wenn der Hirsch mit der Hinterschale fast genau in die Vorderfährte tritt. Die Stümpfe deuten auf die stumpfere Form der Schale des Hirsches, während die eines alten Tieres spitziger sind. Das Fädlein ist ein kleiner, schmaler, erhabener Längsstrich zwischen den beiden Schalen, das Insiegel ein von der Schale abgeworfener Ballen Erde, den der Hirsch bei feuchtem Wetter aufgenommen hat, der Abtritt ein Eindruck auf Rasen, der die Halme abgeschnitten hat (das Tier zerquetscht sie bloß), der Einschlag wird bezeichnet durch Pflanzenblätter und Halme, die der Hirsch zwischen den Schalen aufnahm und auf harten Boden fallen ließ, der Schloßtritt durch den ersten Eindruck, den der Hirsch macht, wenn er sich aus dem Bett erhebt usw. Zu diesen gerechten Zeichen kommen nun noch die Himmelsspur, d. h. die Merkmale, die der Hirsch beim Fegen an Bäumen zurückgelassen hat, und andere mehr. Für den Ungeübten dürfte es schwer sein, die Fährten des Hirsches und des alten Tieres, selbst wenn er sie soeben nebeneinander gesehen hat, ein paar Schritte davon wieder zu unterscheiden.
Unter den Sinnen des Edelwildes sind Gehör, Geruch und Gesicht vorzüglich ausgebildet. Es wird allgemein behauptet, daß das Wild in Entfernungen von vier- bis sechshundert Schritt einen Menschen wittern kann, und nach dem, was ich an dem wilden Renntier beobachten konnte, wage ich nicht mehr, an jener Behauptung zu zweifeln. Auch das Gehör ist außerordentlich scharf; ihm entgeht nicht das geringste Geräusch, das im Walde laut wird. Manche Töne scheinen einen höchst angenehmen Eindruck auf das Rotwild zu machen; so hat man beobachtet, daß es sich durch die Klänge des Waldhorns, der Schalmei und der Flöte oft herbeilocken oder wenigstens zum Stillstehen bringen läßt.
Über Wesen und geistige Eigenschaften des Edelhirsches gehen die Ansichten ziemlich weit auseinander. Der Jäger ist geneigt, in seinem Lieblingswilde den Inbegriff aller Vollkommenheit zu erblicken, der weniger eingenommene Beobachter, der den Hirsch mit andern Tieren vergleicht, urteilt minder günstig. Nach neuerem Dafürhalten ist dieser weder gescheiter noch liebenswürdiger als andere wildlebende Wiederkäuer. Er ist sehr ängstlich und scheu, nicht aber klug und verständig. Sein Gedächtnis scheint schwach, seine Fassungsgabe gering zu sein. Nach und nach sammelt auch er sich Erfahrungen und verwertet sie nicht ungeschickt; von einem ernstern Nachdenken über seine Handlungen aber dürfte bei ihm kaum gesprochen werden können. Er handelt unvorsichtig, nicht überlegt, ist scheu, jedoch nicht klug. Wenn seine Leidenschaften erregt wurden, vergißt er häufig seine Sicherheit, auf die er sonst stets zuerst Bedacht zu nehmen pflegt. Liebenswürdig ist er in keiner Weise. Selbstsüchtig denkt der männliche Hirsch ausschließlich an seinen eigenen Vorteil und ordnet diesem alles übrige unter. Das Tier behandelt er stets grob und roh, während der Brunstzeit am schlechtesten. Anhänglichkeit bekundet nur das Tier seinem Kälbchen gegenüber, der Hirsch kennt dieses Gefühl nicht. Solange er andrer Hilfe bedarf, ist er schmiegsam und für Freundlichkeit empfänglich; sobald er seiner Kraft sich bewußt geworden, erinnert er sich früher empfangener Wohltaten nicht mehr. Andre Tiere fürchtet er, oder sie sind ihm gleichgültig, wenn nicht geradezu unangenehm; schwächere mißhandelt er. Sobald er sich beleidigt wähnt oder gereizt wird, verzerrt er rümpfend die Oberlippe, knirscht mit den Zähnen, verdreht ingrimmig die Lichter, beugt den Kopf nach unten und macht sich zum Stoßen bereit. Während der Brunstzeit ist er förmlich von Sinnen, vergißt alles, vernachlässigt selbst eine regelmäßige Äsung und scheint einzig und allein an das von ihm sonst sehr wenig beachtete Mutterwild und andere gleichstrebende Hirsche zu denken. Ein Brunsthirsch im freien Walde ist eine herrliche, ein Brunsthirsch im engen Gitter eine abscheuliche Erscheinung. Der beschränkte Raum drückt die großen Leidenschaften des Hirsches zum Zerrbilde herab und macht diesen deshalb selbst widerlich. Das Tier erscheint sanfter, hingebender, anhänglicher, kurz liebenswürdiger, ist aber im wesentlichen ebenso geartet wie der Hirsch. Im Freien tritt es, weil ihm die Waffen fehlen, noch furchtsamer auf als dieser, übernimmt deshalb auch regelmäßig die Leitung eines Rudels; wirklich verständig aber zeigt es sich ebensowenig wie jener. Die außerordentlich feinen Sinne, die jede Gefahr gewöhnlich rechtzeitig zum Bewußtsein bringen, lassen Hirsch und Tier klüger erscheinen, als sie wahrscheinlich sind.
Unzweifelhaft zeigt sich das Edelwild deshalb so furchtsam, weil es erfahrungsmäßig den Menschen als seinen schlimmsten Feind kennt und dessen Furchtbarkeit würdigen gelernt hat. An Orten, wo es sich des Schutzes vollkommen bewußt ist, wird es sehr zutraulich. Im Prater bei Wien standen früher starke Trupps der stattlichen Geschöpfe, die sich an das Heer der Lustwandelnden vollkommen gewöhnt hatten und, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann, ohne Scheu einen Mann bis auf dreißig Schritte an sich herankommen ließen. Einer dieser Hirsche war nach und nach so kühn geworden, daß er dreist zu den Wirtschaften kam, zwischen den Tischen umherging und die schönen Hände der Frauen beleckte, sie hierdurch bittend, ihm, wie es gewöhnlich geworden war, Zucker oder Kuchen zu verabreichen. Dieses prächtige Tier, das niemandem etwas zuleide tat, der es gut mit ihm meinte, aber jedem Necklustigen oder Böswilligen sofort das kräftige Geweih zeigte, verendete auf eine klägliche Weise. Bei einer ungeschickten Bewegung verwickelte es sich mit den Sprossen seines Geweihs in eine durchlöcherte Stuhllehne, warf beim Aufrichten den darauf Sitzenden unsanft zu Boden, erschrak hierüber, bohrte die Sprossen noch fester in den Stuhl ein, wurde durch diese unfreiwillige Bürde aufs äußerste entsetzt und raste nun mit höchster Wut in den Parkanlagen umher, machte alle übrigen Hirsche scheu und stürzte wie unsinnig auf die Vorübergehenden los, so daß man es endlich erschießen mußte. Bei den Futterplätzen wird das Edelwild oft überraschend zahm. »In Dessau«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »stehen an jeder der beiden Fütterungen siebzig, achtzig und mehr Hirsche. Haben sie sich, um besondere Äsung zu suchen, davon entfernt, so kann sie der Jäger mit dem Pferde gemächlich näher treiben. Hat er dann Heu auf die Raufen gesteckt und Hafer oder Eicheln in kleinen Häufchen auf dem Erdboden herumgestreut, so kommen sie, dem wiederholten Rufe: ›Komm Hirsch!‹ zufolge, heran und sind so ruhig bei der Äsung, daß der ihnen bekannte Jäger unter ihnen umherreiten, auch zuweilen einige mit den Händen berühren kann. Dies Schauspiel, an dem mehrere Zuschauer ganz in der Nähe teilnehmen dürfen, gewährt gewiß jedem Jagdliebhaber ein hohes Vergnügen.«
Anders verhält es sich, wenn der Hirsch in einen engen Raum gesperrt wird oder wenn die Brunstzeit eingetreten ist. In beiden Fällen wird er oft durch die geringste Kleinigkeit gereizt und nimmt auch den Menschen an. Vor dem von ihm beabsichtigten Angriff biegt er den Kopf herab, richtet die Spitzen der Augensprossen gerade auf seinen Feind und fährt mit so viel Schnelligkeit auf denselben los, daß schwer zu entkommen ist. Ältere und neuere Jagdbücher wissen von vielen Hirschen zu erzählen, die Menschen, oft ohne Veranlassung, angriffen und verwundeten oder umbrachten. » Anno 1637«, erzählt von Flemming in seinem › Teutschen Jäger‹, »wurden auf dem Schlosse Hartenstein täglich ein junger Hirsch und eine arme Magd aus der Hofküche gespeiset. Im Herbste trifft der Hirsch das arme Mensch im Walde an und stößt es tot. Er wurde aber, ehe sie begraben worden, erschossen und vor die Hunde geworfen.« In Wildgärten, wo die Hirsche ihre angeborene Scheu vor dem Menschen nach und nach verlieren, werden sie viel gefährlicher als im freien Walde. Lenz sah einen Hirsch auf dem Kallenberge bei Koburg, der schon zwei Kinder getötet hatte und selbst auf den Fütterer lebensgefährlich losstieß, wenn dieser ihm kein Futter mehr geben wollte. »Da der vierbeinige Wüterich«, so erzählt unser Gewährsmann, »gerade kein Geweih und statt dessen nur weiche Kolben hatte, also an sich schon weniger gefährlich war, so bat ich den Wärter, Futter zu holen, dies in kleinen Gaben meiner linken Hand zu überliefern, die rechte aber mit einem guten Knüppel zu bewaffnen. Ich fütterte nun den Hirsch. Sooft eine Gabe alle war, trat er zurück, um Anlauf zu nehmen, zuckte boshaft mit der Nase, sah mich schief und wütend an, wich aber jedesmal, wenn ich die Waffe drohend schwang, und kam dann ganz getrost wieder, wenn die neue Futtergabe sich zeigte.« In Gotha stieß ein zahmer Hirsch seinen sonst sehr von ihm geliebten Wärter in einem Anfall von Bosheit durchs Auge ins Gehirn, daß der Verletzte augenblicklich tot zur Erde sank; in Potsdam mordete ein ganz zahmer weißer Hirsch seinen Versorger, mit dem er im besten Einverständnis lebte, auf gräßliche Weise. Ähnliche Fälle ließen sich noch viele aufführen. In den Tiergärten fürchtet man die eingehegten Edelhirsche mehr als Tiger und Löwen; denn diesen sieht man auf den ersten Blick an, ob sie gute oder schlechte Laune haben, jene dagegen sind unberechenbar und während der Brunstzeit förmlich von Sinnen. Nur in der Jugend beweisen sie ihrem Wärter eine gewisse Anhänglichkeit; je älter sie werden, um so mehr zeigen sie sich geneigt, gerade ihre besten Bekannten zu mißhandeln. Wirklich vertrauen darf man ihnen nie, weil sie kein Vertrauen verdienen. Das Tier ist nicht im geringsten liebenswürdiger und ansprechender als der Hirsch, nur minder wehrhaft und gefährlich. Aber auch sein Zorn flammt wie Strohfeuer auf, und es gebraucht seine Schalen mit ebensoviel Kraft wie Geschick, sobald es sich darum handelt, seine Abneigung oder schlechte Laune kundzugeben. Gleichwohl lassen sich Hirsch und Tier bis zu einem gewissen Grade zähmen, auch zu mancherlei sogenannten Kunststückchen abrichten; jede Ziege aber leistet in dieser Beziehung mehr als sie. August III. von Polen fuhr im Jahre 1739 mit acht Hirschen; die Herzöge von Zweibrücken und Meiningen hatten Gespanne, die aus weißen Hirschen bestanden. Heutzutage sieht man höchstens bei Bereitern und Seiltänzern noch eine derartige Verwendung der edlen Tiere. An Futter und Pflege stellen gefangene Edelhirsche wenig Ansprüche, halten sich deshalb auch im engen Gewahrsam sehr gut, pflanzen sich ohne Umstände fort und erzeugen mit ihren nächsten Verwandten fruchtbare Blendlinge. Dies benutzend, hat man in neuerer Zeit mehrfach und nicht gänzlich ohne Erfolg Versuche gemacht, den Edelhirsch mit dem Wapiti zu kreuzen, um in geschützten Gegenden stärkeres Wild zu erzielen.
Je nach der Jahreszeit ist die Äsung des Edelwildes eine verschiedene. Im Winter besteht sie in grüner Saat und vielen Pflanzen, die in der Nähe von Quellen hervorsprießen, in Knospen, Holzrinde, Heidekraut, Brombeerblättern, Misteln und dergleichen, im Frühling in Knospen und frischen Trieben mit oder ohne Laub, allerlei Grasarten und Kräutern, später aus Getreidekörnern, Rüben, Kraut, verschiedenen Früchten, Kartoffeln, Bücheln und Eicheln. Nach Blasius soll das Edelwild in Norddeutschland erst seit etwa fünfzig Jahren den Kartoffeln nachgehen, auch Fichtenrinde früher nicht abgeschält haben, überhaupt seine Neigungen im Verlaufe verschiedener Geschlechter mehrfach geändert haben. Während der Brunstzeit nehmen die alten Hirsche nur das Notdürftigste zu sich und fressen dann meist Pilze, und zwar auch solche, die für den Menschen giftig sind. Salz liebt das Rotwild ebensosehr wie die meisten übrigen Wiederkäuer.
Starke Hirsche werfen ihre Geweihe bereits im Februar, spätestens im März ab und ersetzen sie bis zu Ende Juli vollständig wieder; junge Hirsche, zumal Spießer, tragen die Stangen oft noch im Mai, haben jedoch ebenfalls im August bereits vereckt und gefegt.
Mit dem Geweihwechsel steht die Härung in gewisser Beziehung, mit beiden die Geschlechtstätigkeit im Einklange. Nachdem das Geweih abgeworfen worden ist, bildet sich mit ihm das Sommerhaar aus, und sobald letzteres vollendet ist, setzt das Tier sein Kalb. Der Hirsch brunstet im vollen Sommerhaare und verliert die Grannen bald nach der Brunst, worauf die Entwickelung des Winterhaares vor sich geht.
»Die Brunstzeit des Edelwildes«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »fängt mit Eintritt des Monats September an und dauert bis zur Mitte des Oktober. Schon gegen Ende des August, wenn die Hirsche am feistesten sind, erwachen in den stärksten die Triebe zur Brunst. Sie äußern dies durch ihr Schreien – einen Laut, der dem Jäger angenehm, dem musikalischen Ohr aber nichts weniger als schmeichelnd ist -, infolgedessen ihnen gleich anfangs der Hals anschwillt. Denselben Ort, wo der Hirsch einmal gebrunstet hat, wählt er, solange das Holz nicht abgetrieben wird, und falls er Ruhe hat, in den folgenden Jahren immer wieder. Solche Stellen nennt man Brunstplätze. In der Nachbarschaft derselben zieht sich dann auch das Wild in kleine Trupps zu sechs, acht, zehn bis zwölf Stück zusammen, verbirgt sich aber, vielleicht aus Gefallsucht, vor dem Brunsthirsche. Dieser trollt unaufhörlich mit zu Boden gesenkter Nase umher, um zu wittern, wo es gezogen ist und steht. Findet er noch schwache Hirsche oder Spießer dabei, so vertreibt er sie und bringt sich in den Besitz der Alleinherrschaft, die er von nun an mit der größten Strenge ausübt. Keine der erwählten Geliebten darf sich nur auf dreißig Schritte weit entfernen; er treibt sie sämtlich auf den gewählten Brunstplatz. Hier, von so viel Reizen umgeben, vermehrt sich der Begattungstrieb stündlich; aber noch immer weigern sich wenigstens die jüngeren Spröden, die Schmaltiere, die er unausgesetzt umherjagt, so daß der Platz ganz kahl getreten wird.
Abends und morgens ertönt der Wald vom Geschrei der Brunsthirsche, die sich jetzt kaum den Genuß des nötigen Geäses und nur zuweilen Abkühlung in einer benachbarten Suhle oder Quelle, wohin die Tiere sie begleiten müssen, gestatten. Andere, weniger glückliche Nebenbuhler beantworten neidisch das Geschrei. Mit dem Vorsatze, alles zu wagen, um durch Tapferkeit oder List sich an die Stelle jener zu setzen, nahen sie sich. Kaum erblickt der beim Wilde stehende Hirsch einen andern, so stellt er sich, glühend vor Eifersucht, ihm entgegen. Jetzt beginnt ein Kampf, der oft einem der Streitenden, nicht selten beiden, das Leben kostet. Wütend gehen sie mit gesenktem Gehörn aufeinander los und suchen sich mit bewundernswürdiger Gewandtheit wechselweise anzugreifen oder zu verteidigen. Weit erschallt im Walde das Zusammenschlagen der Geweihe, und wehe dem Teile, der aus Altersschwäche oder sonst sich zufällig eine Blöße gibt! Sicher benutzt diese der Gegner, um ihm mit den scharfen Ecken der Augensprossen eine Wunde beizubringen. Man kennt Beispiele, daß die Geweihe beim Kampfe sich so fest ineinander verschlungen hatten, daß der Tod beider Hirsche die Folge dieses Zufalls war, und auch dann vermochte keine menschliche Kraft, sie ohne Verletzung der Enden zu trennen. Oft bleibt der Streit stundenlang unentschieden. Nur bei völliger Ermattung zieht sich der Besiegte zurück; der Sieger aber findet seinen Lohn im unersättlichen, immer wechselnden Genuß von Gunstbezeugungen der Tiere, die dem Kampfe zusahen. Während desselben gelingt es zuweilen ganz jungen Hirschen, sich auf kurze Zeit in den Besitz der Rechte zu stellen, um die jene sich mit so großer Hartnäckigkeit streiten, indem sie sich an das Wild heranschleichen und das genießen, was ihnen sonst erst drei Wochen später, wenn die starken, ganz entkräftet, die Brunstplätze verlassen, zuteil wird.
Vierzig bis einundvierzig Wochen geht das Tier tragend. Es setzt, je nachdem es während der Brunst zeitig oder spät beschlagen wurde, zu Ende des Mai oder im Monat Juni ein Kalb, selten zwei. Wenn die Setzzeit herannaht, sucht es Einsamkeit und Ruhe im dichtesten Holze. Die Kälber sind in den ersten drei Tagen ihres Lebens so unbeholfen, daß sie sich nicht von der Stelle bewegen. Man kann sie sogar mit der Hand aufnehmen. Nur selten und auf kurze Zeit verläßt die Mutter sie in dieser Zeit, und selbst wenn sie verscheucht wird, entfernt sie sich bloß so weit, als nötig ist, um durch vorgegebene Flucht die wirkliche oder eingebildete Gefahr abzuwenden. Und diesen Zweck sucht sie, vorzüglich wenn ein Hund oder Raubtier sich naht, mit vieler Schlauheit zu erreichen. Trotz ihrer sonstigen Furchtsamkeit flieht sie nicht eher und nicht schneller, als sie muß, um zu entkommen, weil sie weiß, daß dies das beste Mittel ist, die Aufmerksamkeit des Feindes vom Kalbe ab- und auf sich zu ziehen und jenen, indem er ihr mit Eifer folgt, irrezuführen. Kaum ist er gänzlich entfernt, so eilt sie an den Ort zurück, wo sie ihren Liebling verließ. Nachdem das Kalb nur eine Woche überlebt hat, würde die Mühe vergeblich sein, es ohne Netze fangen zu wollen. Überall folgt es nun der Mutter und drückt sich sogleich im hohen Grase, wenn diese sich meldet, d. h. einen Laut des Schreckens von sich gibt oder mit dem Vorderlaufe schnell und stark auf den Boden stampft. Es besaugt das Tier bis zur nächsten Brunstzeit und wird von diesem über die Wahl der ihm dienlichen Äsung von Jugend auf belehrt.«
Von nun an beginnt das wechselreiche Leben des Edelwildes. Das Wildkalb ist bereits im dritten Jahre erwachsen, das Hirschkalb braucht eine Reihe von Jahren, ehe es sich alle Rechte der Alleinherrschaft erworben hat. Im siebenten Monat seines Alters setzt es zum ersten Male auf, und von nun an wechselt es seinen Hauptschmuck in jedem Jahre. Wenn auch in der Anzahl der Enden oft eine Unregelmäßigkeit des Fortschritts bemerkt wird und sogar die Hirsche nicht selten wieder zurücksetzen, findet doch eine strenge Gesetzmäßigkeit in der Reihenfolge der Entwicklung statt, und die Bestimmung einer solchen Entwickelungsreihe bringt die Anzahl der Enden nicht so oft in Widerspruch mit der Stärke des Geweihes der Hirsche als die jagdmäßige Zählung. Für eine naturgeschichtliche Betrachtung erscheint die Gestalt der Geweihe von viel größerer Wichtigkeit als die Anzahl der Enden. Bei der Zählung der Enden kommt ihre Stellung wieder viel mehr in Betracht als die Anzahl selber. Nur diejenigen Enden sind von Bedeutung, die mit der Hauptstange in Berührung kommen, alle Verzweigungen, entfernt von der Hauptstange, können nur als zufällige, keine wesentlichen Veränderungen des Bildungsgesetzes bedingende Abweichungen angesehen werden. Die Hauptstange hat anfangs nur eine einzige, gleichmäßige und schwache Krümmung; dann erhält sie eine plötzliche, knieförmige Biegung an der Stelle, wo der Mittelsproß entsteht, nach rückwärts, während die Spitze immer nach innen gerichtet bleibt. Eine zweite knieförmige Biegung erhält sie in der Krone des Zwölfenders; sie biegt sich wieder rückwärts und macht am Fuße der Krone einen Winkel; eine dritte tritt beim Vierzehnender, eine vierte beim Zwanzigender immer höher hinauf in der Krone ein, während die Spitze oder Außenseite sich nach innen kehrt. Jede dieser Biegungen bleibt für alle folgenden Entwicklungsstufen als Grundlage. Ebenso auffallend ist die Veränderung des Augensprosses im Verlaufe der Entwicklung. Zuerst steht er ziemlich hoch, später tritt er der Rose immer näher. Anfangs macht er mit der Hauptstange einen spitzen Winkel, später vergrößert sich dieser immer mehr. Ähnliche Veränderungen gehen der Mittelsproß, der Eissproß und die Krone ein. Der Spießhirsch trägt schlanke und zerteilte Hauptstangen mit gleichmäßiger Krümmung nach außen, ohne alle knieförmige Biegung; die Spitzen sind wieder nach innen gerichtet. Der Gabelhirsch hat an einer entsprechenden Hauptstange schwache, aufwärtsstrebende, von der Rose sehr entfernte Augensprossen. Beim Sechsender hat die im ganzen noch ähnlich gebogene Hauptstange gegen die Mitte eine plötzliche, knieförmige Biegung; ihre beiden Hälften verlaufen in untergeordneten, nach hinten gekrümmten Bögen; an dem nach vorn gekehrten Knie steht der aufstrebende, schwache Mittelsproß; der Augensproß hat sich mehr gesenkt. So wie an einer Stange, kann auch an beiden der Mittelsproß fehlen; dann hätte man der Form nach einen Sechsender, der jagdgemäß als Gabelhirsch zählen würde; fehlt auch der Augensproß, so hätte man einen Spießer, den man der Form nach als Sechsender ansprechen müßte. Beim Achtender tritt eine Endgabel zum Augen- und Mittelsproß, die stärker und mehr senkrecht gestellt sind. Auch hier sind die Nebensprossen oft nur durch die Winkelbildung der Hauptstange angedeutet; man kann der Form nach Achtender haben, die jagdmäßig nur als Sechsender angesprochen werden dürften. Beim Zehnender tritt zum erstenmal der Eissproß oder zweite Augensproß auf; er kann aber auch durch eine bloße scharfe Kante an der Hauptstange angedeutet sein; dann hat man Achtender, die als Zehnender angesprochen werden müssen. Nun kann auch der äußere Gabelsproß verkümmern; dann hat man Sechsender, anstatt der Zehnender; ja, es kann vorkommen, daß auch der Mittelsproß verkümmert, und man hat Gabelhirsche, die tierkundlich als Zehnender angesprochen werden müssen. Beim Zwölfender zeigt sich zum erstenmal die Krone. Die Hauptstange tritt rückwärts knieförmig heraus, mit der Spitze nach innen gekehrt. Hier liegen zuerst nicht mehr alle Enden in einer und derselben gleichmäßig gekrümmten Fläche; das Ende der Hauptstange macht durch die zweite knieförmige Biegung eine Ausnahme. Es tritt mit den beiden Enden der Gabel des Horns von der unzerteilten Oberhälfte der Hauptstange in einem und demselben Punkt hervor, und dies bedingt das Gepräge der Krone. Hier treten oft Verkümmerungen auf. Am häufigsten fehlen die Eissprossen; dadurch entstehen die sogenannten Kronzehnender, die mit vollem Recht tierkundlich als Zwölfender angesprochen werden; es fehlt auch der äußere Nebensproß der Gabel, der Gipfel des Geweihes ist dann wieder eine Gabel; allein die Enden liegen noch in einer und derselben gleichmäßig gekrümmten Fläche; auch solche Zehnender müssen als Zwölfender gelten. Die Verkümmerung kann so weit gehen, daß Hirsche jagdmäßig als Sechsender angesprochen werden, die, tierkundlich betrachtet, Zwölfender sind; solche Geweihe sind aber selten. Am Vierzehnender bildet die nach hinten gerichtete Spitze des Zwölfenders wieder eine regelmäßige Gabel, d. h. es tritt nach außen ein Nebensproß an ihr hervor; hierdurch bildet sich eine zweite Gabel hinter der ersten, deren Teilung etwas höher als die der vorderen Gabel stattfindet. Diese Doppelgabel kennzeichnet die Krone des Vierzehnenders; fehlt solchem Geweihe der Eissproß, so wird der Hirsch jagdmäßig als Zwölfender angesprochen usw. In der Krone des Sechzehnenders biegt sich die Hauptstange hinter der Doppelgabel des Vierzehnenders aufs neue zurück, wendet aber die Spitze wieder nach innen; die fünffache Krone des Achtzehnenders entwickelt die Spitze der Hauptstange des Sechzehnenders und wieder einen Nebensproß nach außen; hierdurch entsteht eine dreifache Gabel über- und hintereinander, von vorn nach hinten allmählich höher ansteigend; sie, mit der doppelten Biegung der Hauptstange, kennzeichnet den Achtzehnender. Beim Zwanzigender biegt sich hinter der dreifachen Kronengabel des Achtzehnenders die Hauptstange aufs neue knieförmig nach rückwärts, die Krone zählt also sieben Enden und drei knieförmige Biegungen. Die Krone des Zweiundzwanzigenders würde vier Kronengabeln hintereinander und eine dreifache knieförmige Biegung in der Hauptstange einer Krone haben usw. In diesen Zügen liegt die regelrechte Entwicklungsreihe angedeutet, und der Zusammenhang der Gestalt und Anzahl ist unverkennbar; die Form der Geweihe erscheint als Hauptsache, als das bedingende, die Anzahl der Enden schließt sich der Form als das Unwesentliche, Bedingte an. Alle Abweichungen sind für den Tierkundigen nebensächlich, auch solche, wo die Nebensprossen sich ungewöhnlich zerteilen; denn solche Zerteilung kann jede Verzweigung der Hauptstange treffen und ins Unbegrenzte fortgehen. Sie zeigen sich nicht selten in den Enden der Kronen von sehr alten Hirschen und kommen auch häufig an dem Mittelsproß vor. So kommt es, daß in den Augen des Naturforschers die hohe Endenzahl vieler berühmter Geweihe, z. B. des Sechsundsechzigenders aus der Moritzburg, der vom Kurfürsten Friedrich III. 1696 bei Fürstenwalde geschossen wurde, sehr gewaltig zusammenbricht. Mehr als zwanzig regelrechte Enden sind wohl sehr selten vorgekommen; Achtzehnender sieht man schon in jeder mäßig großen Sammlung, und unter den lebenden Hirschen kommen Sechzehnender noch immer nicht selten vor. Bei reichlicher Äsung geschieht es, daß die Hirsche bei neuen Aufsätzen Geweihe von sechs und zehn Enden überspringen; noch häufiger aber kommt das Wiederholen der Endenanzahl und ebensooft das Zurücksetzen auf eine geringere Endenanzahl vor. In dieser Beziehung bildet der Zehnender eine auffallende Grenze. Ein Hirsch, der einmal eine Krone getragen hat, setzt nie weiter als auf einen regelmäßigen Zehnender zurück.
In gewisser Hinsicht auffallend ist es, daß jeder gesunde Hirsch sein Geweih in eben der Form und Stellung wieder aufsetzt, wie er es im vorigen Jahre hatte. Wenn es weit oder eng, vorwärts oder rückwärts stand, bekommt es auch in der Folge wieder ebendieselbe Gestalt, und wenn der Augen- oder Eissproß oder andere Enden eine besondere Biegung machen, erscheint diese in gleicher Weise beim nächsten Aufsetzen. Jäger, die Gelegenheit zu vielen Beobachtungen hatten, behaupten sogar, daß gewisse Eigentümlichkeiten der Geweihe sich der Nachkommenschaft durch viele Geschlechter hindurch vererben. Sie versichern, daß sie gewisse Familien sofort am Geweih zu erkennen vermöchten. Daß auch die Örtlichkeit auf Bildung des Geweihes Einfluß hat, dürfte kaum zu bezweifeln sein. Die Hirsche der Donauinseln z. B. tragen, so schwach von Wildbret sie auch sind, auffallend vielendige Geweihe; Vierundzwanzigender unter ihnen gehören nicht zu besonderen Seltenheiten, obschon die Geweihe nicht so schwer als bei Berghirschen sind. Das Gewicht, das das Geweih erreichen kann, ist sehr verschieden; bei schwachen Hirschen wiegt es 9 bis 10, bei sehr starken 16 bis 18 Kilogramm.
Die Feinde des Edelwildes sind der Wolf, der Luchs und der Vielfraß, seltener der Bär. Wolf und Luchs dürften wohl die schlimmsten genannt werden. Der erstere verfolgt bei tiefem Schnee das Wild in Meuten und hetzt und mattet es ab; der letztere springt ihm von oben herab auf den Hals, wenn es, nichts ahnend, vorüberzieht. Der schlimmste Feind aber ist und bleibt unter allen Umständen der Mensch, obgleich er das Edelwild gegenwärtig nicht mehr in der greulichen Weise verfolgt und tötet wie früher. Ich glaube hier von der Jagd absehen zu dürfen, weil eine genaue Beschreibung derselben uns zu weit führen dürfte und man darüber, wenn man sonst will, in andern Büchern nachschlagen kann. Gegenwärtig ist dieses edle Vergnügen schon außerordentlich geschmälert worden, und die meisten der jetzt lebenden Jäger von Beruf haben keinen Hirsch geschossen; solches Wild bleibt für vornehmere Herren aufgespart. Es mag wohl eine recht lustige Zeit gewesen sein, in der die Grünröcke noch die liebe deutsche Büchse fast ausschließlich handhabten und in den glatten Schrotgewehren nur ein notwendiges Übel erblickten! Mit großartigem Schaugepränge zog man zu den Jagden hinaus, und fröhlich und heiter ging es zu, zumal dann, wenn einer oder der andere von den Sonntagsschützen oder noch nicht ganz weidgerechten Jägern sich irgendein Versehen zuschulden hatte kommen lassen.
Auch das Edelwild wird von einigen Bremsenarten arg geplagt. Diese widerlichen Kerfe legen ihre Zuchten, ganz in der Weise wie bei dem Ren, auf dem Wilde an, und die Schweißbrut durchlöchert den armen Geschöpfen fast das ganze Fell. Auch eine Laus, die sich in den Haaren einnistet, Fliegen und Mücken quälen das Wild in hohem Grade. Um diesen, ihm äußerst verhaßten Geschöpfen zu entgehen, suhlt es oft stundenlang im Wasser. Außerdem ist das Wild manchen Krankheiten unterworfen. Der Milzbrand tritt oft seuchenartig auf, die Leberfäule, die Ruhr, der Zahnkrebs und die Auszehrung richten zuweilen große Verheerungen an, und in schlechten Jahren gehen auch viele Hirsche aus noch unerklärten Ursachen ein.
Leider ist der Schaden, den das Rotwild anrichtet, viel größer als der Nutzen, den es bringt. Nur aus diesem Grunde ist es in den meisten Gegenden unseres Vaterlandes ausgerottet worden. Obschon Wildbret, Decke und Geweih hoch bezahlt werden und man die Jagdfreude sehr hoch anschlagen darf: der vom Wild verursachte Schaden wird hierdurch nicht aufgehoben. Ein starker Hochwildstand verträgt sich mit unsern forstwirtschaftlichen Grundsätzen durchaus nicht mehr.
In früheren Zeiten beschäftigte sich der Aberglaube lebhaft mit allen Teilen des Hirsches; heutzutage scheinen bloß die Chinesen, die die noch weichen Hirschgeweihe als Arzneimittel verwenden und mit außerordentlich hohen Preisen bezahlen, an ähnlichen Anschauungen festzuhalten. Bei uns zulande wurden vormals die sogenannten Haarbeine, die Tränendrüsen, die Eingeweide, das Blut, die Geschlechtsteile, die im Magen nicht selten vorkommenden Bezoare, ja selbst die Losung als vielversprechendes Heilmittel in hohen Ehren gehalten. Aus Hirschklauen verfertigte man sich Ringe als Schutzmittel gegen den Krampf; Hirschzähne wurden in Gold und Silber gefaßt und von den Jägern als Amulette getragen.
Das Edelwild hat wenige ihm wirklich nahestehende Verwandte. In erster Linie ist der größte aller eigentlichen Hirsche, der Wapiti Nordamerikas ( Cervus canadensis), hierher zu rechnen. Alle übrigen Hirsche stimmen wenig mit dem unsrigen überein, der auch ihnen gegenüber immerhin den Namen Edelhirsch verdient.
Unter ihnen steht meiner Ansicht nach der Barasinga ( Cervus Duvaucelii) obenan. Er ist schlank gebaut und hoch gestellt, der Kopf verhältnismäßig kurz, nach der Muffel zu pyramidenförmig zugespitzt, das Gehör groß, namentlich auffallend breit, das Auge sehr groß und schön; die Läufe sind hoch, aber kräftig; der Wedel ist kurz, beträchtlich länger als bei unserm Edelwild, aber nur etwa halb so lang als bei dem Damwild. Das Geweih zeichnet sich durch Breite und wiederholte Verästelungen aus. Im ganzen betrachtet, hat es mit dem Schaufelgeweih des Elches einige Ähnlichkeit, obwohl von Schaufeln nicht gesprochen werden kann. Die Behaarung ist reich und dicht, das einzelne Haar lang und ziemlich fein; die Decke erscheint aber struppig, weil die Haare nicht gleich lang sind. Die Gesamtfärbung erscheint im Sommer goldig-rotbraun, geht aber nach unten hin durch Grau in Lichtgelb über, weil die Spitzen der Haare hier grau und bezüglich lichtgelb gefärbt sind. Über den Rücken verläuft ein breiter Streifen von dunkelbrauner Färbung, der auch den größten Teil des an der Spitze lichtgelben Wedels einnimmt und jederseits durch eine Reihe von kleinen goldgelben Flecken besonders gehoben wird. Der Kopf ist auf Stirn und Schnauzenrücken rotbraun, goldig gesprenkelt; Kopf und Schnauzenseiten sind grau, die Unterseite der Schnauze, Kehle und Kinn grauweiß. Hinter der nackten Muffel verläuft ein ziemlich breites, dunkelbraunes Band, das auf der fast weißen Unterlippe noch angedeutet ist. Ein zweites, wenig bemerkbares Band, gewissermaßen die Fortsetzung der dunklen Braue, verläuft, nach der Muffel zu ausgeschweift, von einem Auge zum andern. Eigentümlich sind lange borstenartige Haare, die, einzeln stehend, die Muffel und das Auge umgeben. Das Gehör ist bräunlich, auf der Außenseite dunkel gerandet, an der Wurzel hingegen gelblichweiß; dieselbe Färbung zeigen die Haare der Innenmuschel. Bauch und Innenschenkel sind gelblich, die Schienbeine der Vorderläufe braungrau, die Fußwurzeln lichtfahlgrau; an den Hinterläufen sind die Fesseln dunkler als die Schenkel. Die Schalen sind groß und können sehr breit gestellt werden. Soviel bis jetzt bekannt, bewohnt dieses zierliche Tier ganz Hinterindien. Cuvier, der Entdecker, bestimmte es nach den Geweihstangen, die ihm eingesandt wurden; viel später bekam man den Hirsch selbst im Balge und erst in der Neuzeit lebend zu Gesicht.
Nach meinen Beobachtungen an einem von mir gepflegten Gefangenen glaube ich, daß der Barasinga zur Einbürgerung bei uns sich eignen würde. Er scheint unser Klima vortrefflich zu vertragen und ist ein so anmutiges Geschöpf, daß er jedem Parke oder Walde zur größten Zierde gereichen müßte. Seine Haltung ist stolz und etwas herausfordernd, sein Gang zierlich, jedoch gemessen, sein Betragen anscheinend lebendiger, ich möchte sagen mutwilliger, als das anderer Hirsche. Mein Gefangener war ein übermütiger Gesell, der sich mit allem möglichen versuchte. Er stand mit seinem Wärter auf dem besten Fuße, hörte auf seinen Namen und kam gern herbei, wenn er gerufen wurde, nahm aber jede Gelegenheit wahr, dem Manne, mehr aus Spiellust als im Ernste, einen Stoß beizubringen. Den neben ihm stehenden Hirschen trat er oft herausfordernd entgegen und begann dann selbst mit den stärksten durch das Gitter hindurch einen Zweikampf. Ein weißer Edelhirsch, ihm gegenüber ein Riese, wurde ohne Unterlaß von ihm geneckt, gefoppt und zum Kampfe herausgefordert, so daß ich ihn schließlich versetzen mußte, um den Barasinga nicht zu gefährden. Die Stimme des letztern ist ein ziemlich hoher, kurzer blökender Ton, der dem Schrei einer geängstigten jungen Ziege sehr ähnelt, jedoch viel kürzer hervorgestoßen wird. Abweichend von andern Hirschen schreit der Barasinga zu jeder Jahreszeit, gewissermaßen zu seiner Unterhaltung: er pflegt auch einen Anruf mit Regelmäßigkeit zu beantworten.
In Nordamerika wohnen die Mazamahirsche, zierliche, anmutige Tiere, die sich ebenso durch ihren Bau wie durch die Geweihe der Hirsche auszeichnen. Die bekannteste Art der Gruppe, der Virginiahirsch ( Cervus virginianus), hat in mancher Hinsicht Ähnlichkeit mit unserm Damhirsche, dem er auch in der Größe ungefähr gleichkommt, unterscheidet sich aber sofort durch den zierlichen Bau und namentlich durch den langgestreckten, feinen Kopf, der vielleicht der schönste aller Hirsche genannt werden darf. Nach Versicherung des Prinzen von Wied wird der virginische Hirsch übrigens oft bedeutend größer als unser Damhirsch und gibt dem Edelhirsche nicht viel nach. Die Färbung ändert sich den Jahreszeiten entsprechend. Im Sommerkleide ist ein schönes, gleichmäßiges Gelbrot, das auf dem Rücken dunkelt und nach den Seiten in Gelbrot übergeht, die vorherrschende Färbung; Bauch und Innenseite der Glieder sind blässer; der Wedel ist oben dunkelbraun, unten und auf den Seiten blendend weiß. Bezeichnend erscheint die Färbung des Kopfes, der immer dunkler als der übrige Körper, und zwar bräunlichgrau, gefärbt ist. Im Winter ist die Oberseite graubraun, etwa der Winterfärbung unseres Rehes entsprechend, die Unterseite rötlich; der Bauch, die innere und die Vorderseite des Hinterschenkels, die untere Fläche des Schwanzes sind reinweiß. Das Kalb ist auf dunkelbraunem Grunde sehr zierlich weiß oder gelblichweiß gefleckt, im übrigen seinen Eltern ähnlich.
Nach den Angaben der amerikanischen Forscher verbreitet sich dieser schöne Hirsch, mit Ausnahme der nördlichst gelegenen, über alle Waldungen von Nordamerika. In den Pelzgegenden soll er sich nicht finden; wohl aber kommt er in Kanada vor. Von der Ostküste Nordamerikas reicht er bis zu den Felsgebirgen und südlich bis nach Mexiko. Früher soll er aller Orten in zahlreicher Menge gefunden worden sein; gegenwärtig ist er aus den stark bevölkerten Teilen schon fast ganz verdrängt oder hat sich wenigstens in die größeren Gebirgswaldungen zurückziehen müssen.
Im allgemeinen ähnelt sein Leben dem unseres Edelwildes. Der virginische Hirsch bildet wie dieses Trupps und Rudel, zu denen sich die starken Hirsche während der Brunstzeit einfinden, tritt ungefähr zu derselben Zeit wie unser Hirsch auf die Brunst und setzt auch das Kalb oder die beiden Kälber ungefähr in den gleichen Monaten, in denen unser Edelwild geboren wird. Der Hirsch wirft im März ab und fegt Ende Juli oder im August, verfärbt sich dann im Oktober und tritt um diese Zeit auf die Brunst.
Bei den Sprossenhirschen, deren Heimat Südamerika ist, verästeln sich die aufrechtstehenden Geweihe in drei bis fünf Sprossen, von denen einer sich nach auswärts richtet. Die bekannteste Art dieser Untersippe, der Pampashirsch ( Cervus campestris), ein für unsere Familie mittelgroßes Tier von 1,1 bis 1,3 Meter Leibeslänge und 10 Zentimeter Schwanzlänge, am Widerrist 70 Zentimeter, am Kreuz 75 Zentimeter hoch, hat Hirschgestalt und Färbung. Sein Geweih erinnert an das unseres Rehes, ist aber schlanker, feiner und durch die längeren Sprossen unterschieden. Der größte Teil Südamerikas ist die Heimat dieses überall häufigen Hirsches. Nach Rengger kommt er hauptsächlich auf offenen und trockenen Feldern in den wenig bevölkerten Gegenden vor, während er, selbst wenn er heftig verfolgt wird, die Nähe von Sümpfen und die Wälder meidet. Er lebt paarweise und in kleinen Rudeln; alte Böcke einsiedeln. Bei Tage ruht er im hohen Grase und hält sich so still in seinem Bette, daß man dicht neben ihm vorbeireiten kann, ohne daß er sich bewegt. Dies tut er, weil er sich dadurch zu verbergen sucht; denn seine Sinne sind schärfer und seine Bewegungen schneller und gewandter als bei vielen andern Hirschen. Nur sehr gute Pferde können ihn einholen; wenn er aber einigen Vorsprung hat, vermag ihn auch der beste Renner nicht zu erreichen. Nach Sonnenuntergang zieht er auf Äsung aus und streift dann während der ganzen Nacht umher. Das Tier setzt nur ein Kalb, entweder im Frühling oder im Herbst. Nach wenigen Tagen führt es dasselbe dem Hirsche zu, und beide Eltern bekunden große Sorgfalt und Liebe für das Kleine. Sobald Gefahr droht, verstecken sie es im hohen Grase, zeigen sich selbst dem Jäger, führen ihn von der Spur des Kalbes ab und kehren dann auf Umwegen wieder zu diesem zurück. Wird das Junge gefangen, so entfernen sie sich, falls sie nicht von den Hunden verfolgt werden, niemals weit von dem Jäger, sondern gehen unruhig in großen Kreisen um ihn herum und nähern sich, wenn sie die meckernde Stimme des Kalbes vernehmen, sogar auf Schußweite. Ein Paar dieser Hirsche verfolgte Rengger, der ein Junges mit sich wegführte, einmal eine halbe Stunde lang.
Auch das Reh vertritt eine besondere Untersippe ( Capreolus), deren Merkmale in dem drehrunden, wenig verzweigten, gabelig verästelten, rauhen Geweih ohne Augensprossen zu suchen sind. Das Gebiß besteht aus 32 Zähnen, da die Eckzähne fehlen oder doch nur selten vorkommen.

Rehe (Cervus capreolus)
Das Reh ( Cervus Capreolus) wird 1,3 Meter lang und am Kreuze bis 75 Zentimeter hoch; das Stumpfschwänzchen erreicht kaum eine Länge von 2 Zentimeter. Sein Gewicht beträgt 20 bis 25, in seltenen Fällen sogar bis 30 Kilogramm. Im Vergleich zum Edelhirsch ist das Reh gedrungen gebaut, der Kopf kurz und abgestumpft, der Hals schlank und länger als der Kopf, der Leib verhältnismäßig wenig schlank, vorn etwas stärker als hinten, auf dem Rücken fast gerade, am Widerriste niederer als am Kreuze; die Läufe sind hoch und schlank, die Hufe klein, schmal und spitzig, die Lichter sind groß und lebhaft, am obern Lide lang gewimpert, ihre Tränengruben sehr klein, eigentlich nur schwach angedeutet, da sie bloß bis 6 Millimeter lange, seichte, kahle Vertiefungen von abgerundeter, dreieckiger Gestalt bilden; das Gehör ist mittellang und steht weit auseinander. Das Gehörn zeichnet sich durch breite Rosen und durch verhältnismäßig starke, mit weit hervortretenden Perlen besetzte Stangen aus. Gewöhnlich setzt die Hauptstange nur zwei Sprossen an; allein die Entwicklung, die das Rehgehörn erreichen kann, ist damit noch nicht beendet. »Die jagdmäßige Zählung der Rehbocksenden«, sagt Blasius, »beabsichtigt nicht, einen Ausdruck für das Naturgesetz der Gehörnbildung zu geben. Will man das tierkundliche Bildungsgesetz aussprechen, so kommt es weniger auf die Anzahl der Enden als auf die Gesamtform des Gehörns an, mit deren Verbindung die Endenzahl eine Bedeutung gewinnt. Im ersten Winter erhält der Schmalbock unzerteilte, schlanke Spieße mit schwacher Rose an der Wurzel der Stange; beim Gabelbock ist die Stange ungefähr in der Mitte geteilt. Die Hauptstange richtet sich von der Teilung an in einem Winkel nach hinten, der Nebensproß nach vorn. Diese knieförmige Biegung der Hauptstange ist weit wichtiger als der vordere Nebensproß, und man kann den Bock dem Alter nach für einen Gabler ansprechen, wenn die Biegung vorhanden ist und der Nebensproß fehlt. Beim Sechsender teilt sich die nach hinten gebogene Hauptstange zum zweitenmal und biegt sich nach der Teilung wieder nach vorn vor, während sich der zweite hohe Nebensproß nach hinten wendet. Die zweite knieförmige Biegung kennzeichnet den Sechsender, und man kann den Bock dem Alter und Gehörn nach als Sechser ansprechen, wenn er beide knieförmigen Biegungen der Hauptstange zeigt, auch wenn die Nebensprossen beliebig fehlen. Mit dem Sechsender schließt gewöhnlich die Gesamtentwicklung ab, indem der Rehbock bei ferneren Aufsätzen in der Regel dieselbe Anzahl von Enden wiedererhält. Die regelrechte Entwicklung kann jedoch weiter fortschreiten. Beim Achter teilt sich die über der zweiten Gabel oder Kniebiegung und die nach oben oder nach hinten gerichtete Spitze aufs neue und setzt einen Nebensproß ab. Der Zehnender ist die höchste regelmäßige Entwicklung des Rehgehörns, die ich kenne. Er entsteht, wenn die beiden oberen Spitzen des Sechsenders sich gabelig zerteilen; das Gehörn besteht dann aus einem vorderen Mittelsproß, einer oberen Endgabel und einer hinteren Nebengabel. Gehörne dieser Form kenne ich nur aus Syrmien und Kroatien. Häufig zeigen die Rehgehörne eine Neigung, inwendig an der Hauptstange, unterhalb des nach vorn gerichteten Mittelsprosses und gleichmäßig an jeder Seite eine auffallend lange Perle zu entwickeln. Diese Perle wird zuweilen bis 25 Millimeter lang und kann dann jagdmäßig als Ende gezählt werden.«
Mißbildungen aller Art sind bei dem Rehgehörn außerordentlich häufig. In Sammlungen sieht man Stangen von der sonderbarsten Gestaltung; manche mit einer ganzen Reihe von jagdgerechten Enden, andere schaufelartig verbreitert und mit Randsprossen besetzt. Es kommen Rehböcke mit drei Stangen und drei Rasenstücken oder solche mit einer einzigen Rose und einem einfachen Stock vor usw. Auch sehr alte Ricken erhalten einen kurzen Stirnzapfen und setzen schwache Gehörne auf. Radde erhielt im Sajan ein solches, das die Ricke mitten auf der Stirn trug. Es zeigt vier längere, aus einem Grunde entspringende Sprossen, die in abweichender Richtung zueinander ausgewachsen sind. Von einem andern derartigen Gehörn teilt mir Block mit, daß es aus zwei gegen fünf Zentimeter langen Stangen bestand und selbst einen alten Weidmann täuschen konnte, der die Ricke als Bock ansprach und erlegte.
Die dichte Behaarung des Rehes ändert sich je nach der Jahreszeit, indem, meiner Auffassung nach, wie beim Hirsch im Sommer nur das Grannenhaar, im Winter ausschließlich das Wollhaar zur Entwicklung gelangt. Ersteres ist kurz, straff, hart und rund, letzteres lang, gewellt, weich und zerbrechlich, auch durchaus anders gefärbt als jenes. Ober- und Außenseite des Körpers sind im Sommer dunkelrostrot, im Winter braungrau, Unterseite und Innenseite der Gliedmaßen immer Heller gefärbt. Auf der Stirn und dem Nasenrücken mischt sich Schwarzbraun, an den Seiten des Kopfes und rückwärts über den Augen Rotgelb ein; Kinn, Unterkiefer und ein kleiner Fleck jederseits der Oberlippe sind weiß; hinter der Mitte der Unterlippe tritt ein kleiner brauner Fleck hervor. Das Gehör ist auf der Außenseite etwas dunkler als der übrige Leib, innen mit gelblichweißen Haaren besetzt. Steiß und der Hinterteil der Keulen sind, scharf abgegrenzt, lichtfarbig, im Sommer gelblich, im Winter weiß. Bei den Kälbern treten auf der rötlichen Grundfarbe kleine, rundliche, Weiße oder gelbliche Flecken in Reihen hervor.
In der Weidmannssprache heißt das männliche Reh nach seiner Geburt Bockkalb oder Kitzbock, nach zurückgelegtem ersten Jahre Spießbock oder Schmalrücken, nach vollendetem zweiten Jahre Gabelbock, vom dritten Jahre ab endlich Bock, guter und braver Bock, das weibliche Reh dagegen in denselben Altersstufen Reh- oder Kitzkalb und Kitzchen, sodann Schmalreh, endlich Rike, Ricke, Hille, Rehgeitz, Rehziege und zuletzt alte, beziehentlich gelte Rike. Der lange Haarbüschel, der am vordern Ende der Brunstrute des Bockes herabhängt, heißt Pinsel, der Haarbüschel, der aus dem Feigenblatte oder Geburtsgliede der Rike hervortritt, Schürze oder Wasserzeichen, die lichte Stelle am Steiß der Spiegel. Das Reh bildet einen Sprung oder ein Rudel, wenn es sich gesellschaftsweise vereinigt; es schreckt, schmält oder meldet sich, wenn es seinen kurzen Schrei von sich gibt, oder klagt, wenn es von Hunden oder Raubtieren ergriffen wird und laut aufschreit. Im übrigen gebraucht man von ihm dieselben Ausdrücke wie vom Hochwild.
Das Reh verbreitet sich mit Ausnahme der nördlichsten Länder über ganz Europa und den größten Teil von Asien. Im allgemeinen kann man sagen, daß es sich innerhalb seines Verbreitungsgebietes in allen größeren Waldungen findet, gleichviel, ob solche in Gebirgen oder ebenen Gegenden liegen, ob sie aus Schwarz- oder Laubholz bestehen. Gerade das letztere scheint dem Reh besonders zu behagen, während es anderseits wieder trockene Gegenden vorzieht. Waldungen mit viel Unterholz, junge Baumschläge, Vor- und Feldhölzer, die Dunkel und Schatten bieten, sagen ihm zu. Im Winter zieht es sich von den Höhen zur Tiefe herab, im Sommer steigt es höher empor. In Sibirien wandert es mit einer gewissen Regelmäßigkeit überall, wo es ihm beschwerlich oder unmöglich wird, auf seinen Sommerständen zu überwintern. Schon in unsern Hoch- und Mittelgebirgen findet etwas Ähnliches statt, nur daß hier die Wanderungen nicht über so weite Strecken sich ausdehnen; in Sibirien aber verläßt es mit Eintritt der kalten Jahreszeit bestimmt seine sommerlichen Aufenthaltsorte, schart sich in zahlreiche Rudel und meidet nun das Gebirge gänzlich, um in den Wäldern der Ebene den Winter zu verbringen. Die Wanderungen beginnen unmittelbar nach der Brunst und dauern, streng genommen, während des ganzen Winters fort, wogegen mit Beginn der Schneeschmelze ein allmähliches Aufrücken in den Gebirgen stattfindet. Sowohl im Sommer wie im Winter meidet das Reh in Sibirien die reinen Schwarzwälder, bevorzugt dagegen die Talmündungen, die flachen Vorländer, die sanfthügeligen, nicht sehr dicht bewaldeten Vorberge oder hält sich in den dichten Unterhölzern des alpinen Gürtels auf, hier mit Vorliebe die Dickichte der Eiche, Kiefer und sibirischen Tanne zu seinem Standorte wählend. Bei uns zulande lebt es gern in Vorhölzern, auch in solchen, die mit geschlossenen Waldungen nur lose zusammenhängen, nicht selten inmitten größerer Feldfluren, zieht sich auch im Vorsommer gänzlich in die Felder zurück und tut sich tagsüber im hohen Getreide nieder. Standwild im strengsten Sinne des Wortes ist es nur da, wo es sich vollkommen sicher fühlt; aber auch hier unternimmt es gern weitere Streifzüge, sei es um eine gewisse Äsung, sei es, um andere seiner Art aufzusuchen. Mehr als der Hirsch, ungleich mehr als der Damhirsch, liebt es Freiheit in jeder Beziehung, insbesondere Veränderung des Standes, der Äsung, selbst der Gesellschaft. Es ist nicht allein wählerisch, sondern förmlich launenhaft, gefällt sich heute hier, morgen dort, läßt sich unter Umständen allerlei Störungen gefallen und nimmt sie wiederum so übel, daß es gelegentlich gänzlich auswechselt.
Die Bewegungen des Rehes sind behend und anmutig. Das Reh kann erstaunlich weite, bogenförmige Sätze ausführen und über breite Gräben, hohe Hecken und Sträucher ohne irgendwelche bemerkbaren Anstrengungen fallen, schwimmt sehr gut und klettert recht leidlich. Es vernimmt, wittert und äugt vortrefflich, ist listig, vorsichtig und sehr scheu. »Freundlichkeit, Zutunlichkeit«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »spricht aus jedem seiner Blicke, und doch läßt es nur, von der zartesten Jugend an von dem Menschen künstlich erzogen, sich zähmen; im entgegengesetzten Falle behält es selbst bei der besten Pflege die im wilden Zustande eigene Schüchternheit und Furcht vor Menschen und Tieren bei. Diese geht so weit, daß es, wenn es überrascht wird, nicht nur zuweilen einen kurzen Laut des Schreckens von sich gibt, sondern auch den Versuch, sich durch die Flucht zu retten, oft aufgeben muß, indem es leicht völlig aus dem Sprunge kommt und dann, auf einem engen Raume sich ängstlich gleichsam herumtummelnd, nicht selten ein Opfer gemeiner, gar nicht rascher Bauernhunde, vorzüglich aber der Raubtiere wird. Nur in Gehegen, wo die Rehe sehr wenig beschossen werden und immer Ruhe haben, legen sie ihre Scheu vor dem Menschen insoweit ab, daß sie, wenn er in einer Entfernung von zwanzig bis dreißig Schritten an ihnen vorübergeht, sich im Äsen nicht stören lassen. Im Bett wird keine andere Wildart häufiger überrascht als das Reh; wahrscheinlich muß es schlafen oder, wenn es sich wachend niedergetan hat, um das Geschäft des Wiederkäuens zu verrichten, unter einem dicken Strauche oder in hohem Grase vor den spähenden Blicken seiner Verfolger sich hinlänglich gesichert glauben.« Im übrigen ähnelt das Wesen des Rehes dem unseres Edelwildes sehr. Es ist ebensowenig ein kluges und ebensowenig ein liebenswürdiges Tier wie der Hirsch, vielmehr ebenfalls heftig, reizbar und jähzornig, auch rauf- und kampflustig. Von der »Freundlichkeit und Zutunlichkeit«, die Winckell rühmend hervorhebt, nimmt man bei innigerem Umgange mit dem Reh herzlich wenig wahr. Solange es jung ist, zeigt es sich allerdings höchst liebenswürdig, im Alter aber sehr eigenwillig, trotzig und bösartig. Schon die alte Rike hat ihre Mucken, jedoch zu wenig Kraft, um ihren Absichten den erwünschten Aus- und Nachdruck zu geben; der Bock aber ist ein unverträglicher, boshafter, selbst- und herrschsüchtiger Gesell, behandelt schwächere seiner Art stets, die Rike nicht selten, ganz abscheulich, mißhandelt ohne Erbarmen seine Sprößlinge, sobald er meint, daß sie seinen Gelüsten im Wege stehen könnten, zeigt allen Geschöpfen, die er nicht fürchten muß oder aus Gewohnheit nicht mehr fürchtet, das Gehörn und gebraucht es in höchst gefährlicher Weise. Zu trauen ist ihm nie; denn sein Sinn ist im höchsten Grade unbeständig und wetterwendisch, seine Reizbarkeit unglaublich groß und seine störrische Beharrlichkeit nicht zu unterschätzen. Wirkliche Anhänglichkeit, hingebende Aufopferung kennt er nicht; bei Gefahr ist er der erste, der sich, nicht ohne bemerkenswerte List und Verschlagenheit, davonzumachen sucht; Verteidigung der Rike und seines Sprößlings kommt ihm nicht in den Sinn. Er hält sich nicht immer, aber oft, zu beiden, jedoch kaum aus warmer Zuneigung, sondern wohl hauptsächlich aus Liebe zur Geselligkeit und Bequemlichkeit, da er weiß, daß die vorsichtige Rike unablässig um die Sicherheit ihres Kälbchens besorgt ist, und er sich dies zunutze zu machen sucht. Selbst während der Brunftzeit bekundet er der Rike gegenüber eigentlich weder Liebe noch Zärtlichkeit, sondern nur Sinnlichkeit und Begierde. Vollendete Selbstsucht ist der Grundzug seines Wesens.
Niemals bildet das Reh so starke Trupps wie das Edelwild. Während des größten Teils des Jahres lebt es familienweise zusammen, ein Bock mit einem, seltener mit zwei bis drei Riken und deren Jungen; nur da, wo es an Böcken fehlt, gewahrt man Trupps von zwölf bis fünfzehn Stück. Der Bock trennt sich wahrscheinlich bloß dann von der Familie, wenn jüngere seine Stelle vertreten und er es für gut befindet, sich grollend in die Einsamkeit zurückzuziehen. Dies geschieht hauptsächlich im Frühsommer, währt aber nie länger als bis zur Brunftzeit; dann trollt er unruhig umher, um Schmalrehe aufzusuchen. Nach der Blattzeit bleibt er meistens beim Schmalreh; wenn die nunmehrige Rike aber hochbeschlagen ist, sucht er sich eine andere, und diese bleibt bis zum nächsten Frühling seine bevorzugte Gefährtin. Im Winter vereinigen sich zuweilen mehrere Familien und leben längere Zeit miteinander. Die Kälber halten sich bis zur nächsten Brunftzeit zu den Rehen, werden dann von diesen abgeschlagen und bilden oft eigene Trupps für sich.
Tagsüber hält sich das Reh in einem ruhigen und Deckung bietenden Teil des zeitweiligen Wohngebiets auf, gegen Abend, in geschützten Gehegen bereits in den späteren Nachmittagsstunden, tritt es auf junge Schläge, Wald- und Flurwiesen oder Felder heraus, um zu äsen; gegen Morgen begibt es sich wieder nach der Dickung oder ins hohe Getreide zurück, schlägt mit den Vorderläufen die Moos- oder Rasendecke weg und bereitet sich so sein Bett oder Lager, um hier zu ruhen. Einen bestimmten Wechsel hält es gern, obschon nicht ganz regelmäßig, ein, und auf ihm pflegt der Bock vorauszuschreiten, während bei der Flucht regelmäßig die Rike die Spitze nimmt. Während der Brunftzeit ändert das Reh wie alle Hirsche seine gewohnte Lebensweise sehr wesentlich.
Die Äsung ist fast dieselbe, die das Edelwild genießt; nur wählt das leckere Reh mehr die zarteren Pflanzen aus. Blätter und junge Schößlinge der verschiedensten Laubbäume, Nadelholzknospen, grünes Getreide, Kraut und dergleichen bilden wohl die Hauptbestandteile der Äsung. Bei uns zulande ernährt es sich von den Blättern und jungen Trieben der Eiche, Ulme, Birke, Aspe, des Hornbaumes, Spitzahorns sowie der Nadelhölzer, insbesondere der Fichte, von jung aufschießendem Raps, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Kraut und Klee, allerlei Gräsern, auch Eicheln und andern Baumfrüchten, in Sibirien außer diesen und ähnlichen Pflanzenarten auch von den Trieben der Wermutarten, Potentillen usw. Salz leckt es sehr gern, und reines Wasser ist ihm Bedürfnis; es begnügt sich aber bei Regen oder starkem Taufall mit den Tropfen, die auf den Blättern liegen. Hier und da kommt es zuweilen auch wohl in die Gärten herein, deren leckere Gemüse ihm behagen, und setzt dabei kühn und geschickt über ziemlich hohe Zäune hinweg. Vom Hirsch unterscheidet es sich dadurch, daß es die Kartoffeln nicht ausscharrt und in den Feldern nicht soviel Getreide durch Niedertun umlegt; dagegen verbeißt es in Forsten und Gärten die jungen Bäume oft in schlimmer Weise und wird dann empfindlich schädlich.
Die Fortpflanzungsgeschichte des Rehes ist kurz folgende. Nachdem sich das im Oktober oder November abgeworfene Gehörn des älteren Bocks neu gebildet und vereckt, der Bock auch gefegt hat, was zu Ende März, spätestens im April zu geschehen pflegt, zeigt sich der Bock zwar nicht mehr so harmlos als während der Zeit seiner Waffenlosigkeit, aber doch auch noch nicht erregt, sondern benimmt sich eher als erträglicher Genosse der Rike und zuweilen selbst als teilnehmender Vater seiner oder anderer Böcke Sprößlinge. Um die Mitte des Juli endet dies schöne Verhältnis. Unruhe, Rauf- und Kampflust machen sich geltend; der starke Bock trennt sich unter allen Umständen von den bisherigen Genossen, beziehentlich der Familie, schweift weit umher, tritt andern Böcken herausfordernd entgegen, läßt öfters seine Stimme, ein dumpfes, kurz ausgestoßenes »bäö, bäö« oder »bö, bö, bö«, vernehmen und beginnt junge, zwar sehr verliebte, aber züchtige Riken zu treiben, d. h. hitzig hin und her zu jagen. Seine Erregung steigert sich von Tag zu Tag; er bekämpft mit oft sinnloser Wut seine Nebenbuhler, bindet selbst mit andern Geschöpfen, in seltenen Fällen sogar mit dem Menschen an, mißhandelt, ja tötet die Kitzen, falls deren Vorhandensein ihm hinderlich zu sein scheint, und behandelt auch die Riken, die sich seinen Wünschen nicht sofort fügen wollen, mit ebensoviel Ungestüm als Rücksichtslosigkeit. Seine Eifersucht und Rauflucht geht so weit, daß er die begehrte Schöne meist ob des Nebenbuhlers hintansetzt, indem er auf Böcke, die gleich ihm eine Rike treiben, wütend und kampfeifrig losstürzt, ohne sich um die Geiß weiter zu bekümmern. Diese ist fast ebenso erregt als er, gibt ihren Gefühlen auch entsprechenden Ausdruck, indem sie den Bock durch einen »fippenden« Laut, der wie »ī, ī, īĕ, īĕ, ī, īĕ« klingt, auf sich aufmerksam macht und zu sich einladet. Auf dieses Zeichen hin eilt der junge Bock hitzig und unbedacht, der ältere vorsichtiger, der alte, erfahrene schleichend wie ein Fuchs herbei, um der Minne Sold zu fordern. Die alte Rike gewährt letzterem meist ohne Umstände, das Schmalreh dagegen widerstrebt dem ungestümen Bewerber, läßt sich längere Zeit treiben, gerät auch meist in große Angst und gibt diese durch die Laute »ī, īă, īăīă« zu erkennen, fügt sich jedoch endlich ebenfalls dem Willen des Bockes. Da dieser, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, regelmäßig Schmalrehe treibt und die alten Riken mehr oder weniger vernachlässigt, finden gemeiniglich die jungen Böcke bei letzteren williges Entgegenkommen. Überwiegt in einem Revier das eine Geschlecht, so wandert der nicht zur Paarung gelangende Teil aus, um anderswo sein Glück zu suchen.
Das befruchtete Ei geht, wie die Untersuchungen des Jägermeisters von Veltheim, Pockels, Zieglers und zumal Bischoffs mit nicht mehr anzufechtender Bestimmtheit dargetan haben, in kurzer Zeit durch den Eileiter, furcht sich hier und gelangt in seiner ursprünglichen Größe in die Gebärmutter, in der es gewöhnlich übersehen wird, da es nur die allersorgfältigste Beobachtung zu entdecken vermag. Etwa vier Monate, bis nach Mitte Dezember, entwickelt es sich kaum merkbar, beginnt aber sodann mit ungewöhnlicher Schnelligkeit in regelrechter Weise sich auszubilden, bis der Keimling im Mai oder Juni seine vollständige Reife erlangt hat. Somit geht das Reh ebenfalls ungefähr vierzig Wochen hochbeschlagen, und die Entwicklung seiner Frucht unterscheidet sich, soviel bekannt, einzig und allein dadurch von der anderer Hirsche, daß der Keimling eine allerdings ungewöhnlich lange Zeit in einem sich gleichbleibenden Zustande verharrt.
Dies ist die Regel, Ausnahmen hat aber auch sie. Es kann nämlich vorkommen, daß eine Rike erst mehrere Wochen später beschlagen wird und dennoch rechtzeitig setzt. Gefangene Riken z. B. die während der Brunstzeit mit dem Bock nicht zusammenkommen konnten und erst im Spätherbste einen solchen zum Gesellen erhielten, werden unter besonders günstigen Umständen ausnahmsweise um diese Zeit noch brünstig, empfangen ebenfalls und bringen kaum später als andere ihr Kälbchen zur Welt. Es sind mir über diese verspätete Rehbrunst von den verschiedensten Seiten her übereinstimmende Mitteilungen zugegangen, daß ich an der Richtigkeit der Beobachtungen nicht wohl zweifeln darf. Gerade das lange Verharren des befruchteten Eies in einem Zustande scheinbarer Nichtentwicklung dürste es ermöglichen, daß die zwischen der Befruchtung und der ersichtlichen Weiterbildung liegende Zeit abgekürzt werden kann. Ich unterlasse es, die an gefangenen Rehen gesammelten Erfahrungen auch auf frei lebende zu beziehen, bemerke jedoch noch, daß auch unter diesen ein Beschlagen im Oktober und November tatsächlich beobachtet worden ist.
Etwa vier oder fünf Tage vor dem Setzen sucht die Rike in einem einsamen, möglichst abgelegenen Teil des Waldes einen stillen Platz und bringt dort ihre Kälber zur Welt. Jüngere Riken setzen gewöhnlich nur ein einziges Kalb, ältere deren zwei, in seltenen Fällen selbst drei. Die Mutter verbirgt ihre Sprößlinge vor jedem sich nahenden Feind mit Sorgfalt und gibt ihnen bei der leisesten Ahnung einer Gefahr warnende Zeichen durch Aufstampfen mit dem einen Lauf oder durch einen kurzen zirpenden Laut. In der zartesten Jugend drücken sich die Kälber, sobald sie diesen vernehmen, auf der Stelle nieder; späterhin entfliehen sie mit der Mutter. Während der ersten Tage des Lebens, wenn die Kälber noch zu unbehilflich sind, nimmt die Rike zur Verstellungskunst ihre Zuflucht und sucht den Feind von sich abzulenken. Wird ihr ein Junges geraubt, ohne daß sie es hindern kann, so folgt sie dem Räuber, auch dem Menschen, lange nach und gibt ihre Sorgen durch beständiges, ängstliches Hin- und Herlaufen und durch Rufen zu erkennen. »Mich hat diese Mutterzärtlichkeit«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »mehr als einmal dahin vermocht, das Kalb, das ich schon mitgenommen hatte, wieder in Freiheit zu setzen, und die Mutter belohnte mich reichlich dafür durch die sorgsamen Untersuchungen, ob dem Kinde ein Unfall zugestoßen sei oder nicht. Freudig sprang sie um das unbeschädigt gefundene Kleine herum und schien es mit Liebkosungen zu überhäufen, indem sie ihm zugleich das Gesäuge zur Nahrung darbot.« Etwa acht Tage nach der Geburt nimmt die Rike ihre Kälber mit auf die Weide, und nach zehn bis zwölf Tagen sind sie vollkommen stark genug, ihr nachzueilen. Nun kehrt sie mit ihnen auf den alten Stand zurück, gleichsam in der Absicht, dem Vater seine Sprößlinge jetzt vorzuführen. Diese besaugen ihre Mutter bis zum August, nehmen aber schon im zweiten Monat ihres Lebens feineres, grünes Geäse mit an; die Mutter lehrt sie die Auswahl treffen. Im Alter von vierzehn Monaten sind sie fortpflanzungsfähig geworden und bilden nunmehr eine Familie für sich.
Schon zu Ende des vierten Monats wölbt sich das Stirnbein des jungen Bockes, in den folgenden vier Wochen bilden sich kleine, immer höher werdende Kolben, und in den Wintermonaten brechen dann die ersten, acht bis zehn Zentimeter langen Spieße hervor. Im März fegt der junge Bock »mit Wollust und wahrem Übermute«, im nächsten Dezember wirft er die Spieße ab. Binnen drei Monaten hat sich das zweite Gehörn gebildet. Es wird seinerzeit etwas früher als im vorigen Herbst abgeworfen und durch das dritte ersetzt. Alte Böcke werfen, wie bemerkt, schon im November ab.
Man jagt das Reh fast in derselben Weise wie anderes Hochwild, obwohl man gegenwärtig mehr das glattläufige Schrotgewehr als die Kugelbüchse zu seiner Erlegung anwendet. Von geübten Jägern wird der Bock in der Brunstzeit durch Nachahmung des zirpenden Liebeslautes seines Weibchens herbeigelockt und dann erlegt. In Sibirien errichtet man auf den Wechseln der Rehe Fallgruben, hetzt sie, wenn der Schnee beim Schmelzen sich mit einer dünnen Eisdecke belegt, mit Hunden und Pferden, fährt sie mit dem Schlitten an und erlegt sie, nachdem sie sich an das Gefährt gewöhnt haben, sticht sie nieder, wenn sie bei ihren Wanderungen die Flüsse übersetzen, treibt jedoch im ganzen nicht ärgere Aasjägerei als unsere Wildschützen und Bauern. Außer dem Menschen stellen Luchs und Wolf, Wildkatze und Fuchs den Rehen nach, erstere großen und kleinen ohne Unterschied, letztere namentlich den Rehkälbern, die zuweilen auch dem zwerghaften blutgierigen Wiesel zum Opfer fallen sollen.
Der Nutzen, den das Reh dem Menschen gewährt, ist beziehentlich derselbe wie der des übrigen Hochwildes, der Schaden, den es anrichtet, verhältnismäßig gering, jedoch immer noch viel bedeutender als der Nutzen. Namentlich in jungen Schlägen haust es oft schlimm und vereitelt in wenigen Tagen jahrelange sorgsame Arbeiten des Forstmannes. Bei uns zulande nützt man das köstliche Wildbret, das Gehörn und die Decke wie das Fell; in Sibirien verarbeitet man die Decke zu Pelzen, die allgemein getragen werden, weil sie sehr leicht und billig sind.
Im Wildgarten wie im Tierzwinger oder im engern Gewahrsam überhaupt hält sich das Reh minder leicht als andere Hirsche, weil seinem ungebundenen Wesen aller Zwang zuwider ist. Ist der Wildgarten zu klein, so kümmert es, geht immer mehr zurück und schließlich ein, auch wenn es reichliche und ihm zusagende Äsung hat, beziehentlich gefüttert wird. Nach den Erfahrungen des Grafen von Mengersen, der einen gut bestandenen Rehpark unterhält, muß man mindestens sieben Morgen Landes auf ein Reh rechnen, aber auch dann noch im Winter Kleeheu, Kartoffeln, Rüben und Eicheln füttern, falls man auf Erfolg zählen will. In den Tiergärten rechnet man das Reh unter diejenigen Tiere, deren Erhaltung schwierig ist. Das Reh erweist sich als ein sehr wählerisches, heikles und schwer zu befriedigendes Geschöpf, ist weichlich und hinfällig, pflanzt sich daher auch keineswegs regelmäßig im Zwinger fort und geht oft infolge einer sehr unbedeutenden Veranlassung ein. Jung aufgezogen, wird es leicht und in hohem Grad zahm, befreundet sich mit Menschen und Tieren, benimmt sich wie ein wirkliches Haustier und gewährt dann viel Vergnügen. Doch erlebt man auf die Dauer nur an der Rike, nicht aber an dem Bock Freude; denn letzterer bekundet mit der Zeit sein eigentliches Wesen, wird dreist, zudringlich und unverschämt, während die Rike in der Regel sanftmütig bleibt.
»Einer meiner Brüder«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »besaß eine gezähmte Rike, die sich in der menschlichen Gesellschaft fast am besten zu gefallen schien. Oft lag sie zu unsern Füßen, und gern machte sie sich die Erlaubnis zunutze, auf dem Sofa an der Seite meiner Schwägerin zu ruhen. Hund und Katze waren ihre Gespielen. Fand sie sich von ihnen beleidigt, so wurden sie durch tüchtige Schläge mit den Läufen hart bestraft. Die liebe Rike ging mit uns oder auch für sich allein im Freien spazieren. Zur Brunstzeit blieb sie gewöhnlich, kurze Besuche abgerechnet, die sie ihrem Wohltäter abzustatten nicht vergaß, einige Tage und Nächte hindurch im Walde, kam dann, wenn sie sich hochbeschlagen fühlte, nach Hause und setzte zur gehörigen Zeit. Die Kälber aber, mit der Muttermilch dieses zahmen Rehes genährt, blieben wild und wurden deshalb im folgenden Oktober ausgesetzt. Sogar während der Brunstzeit verließ unsere Rike, wenn sie von ihrem Herrn beim Namen gerufen war, den Bock und folgte dem Gebieter bis ans Ende des Waldes; hier aber trennte sie sich von ihm und gab dem Gatten den gewöhnlichen Ruf, ein Zeichen zur Annäherung.«
Das Benehmen gezähmter Böcke ist regelmäßig ein anderes als der Riken. Die ihnen angeborene Furchtsamkeit wird durch Gewohnheit abgestumpft; sie kennen den Menschen und wissen, daß weder er noch die Hunde ihnen etwas tun dürfen, und zeigen sich dann nicht bloß anmaßend, sondern werden sogar gefährlich. Ein junger Rehbock, den der meinem Vater befreundete Oberförster Heerwart hielt, hatte sich in den Kopf gesetzt, daß die Hundehütte für ihn ein ganz bequemes Lager wäre, und ging, sooft es ihm einfiel, da hinein. Wenn nun der Hund gerade in der Hütte lag, schlug er mit seinen Vorderläufen kühn auf den gewaltigen Feind seines Geschlechts los, bis dieser mit eingeklemmtem Schwänze die Hütte verließ und dem übermütigen Gesellen Platz machte. Der vortreffliche Hund wußte recht wohl, daß er dem Liebling seines Herrn nichts abschlagen durfte, und ließ sich von ihm in wirklich lächerlicher Weise beherrschen. Ältere Böcke dürfen unter keiner Bedingung als Spielgenossen von Kindern angesehen werden. Sie fürchten sich nicht einmal vor erwachsenen Männern, geschweige denn vor Frauen und Kindern, nehmen bei der unbedeutendsten Veranlassung eine drohende Miene an, gehen auf denjenigen, der sie beleidigte oder auch nicht beleidigte, mit niedergebogenem Gehörn los und wissen dieses so kräftig zu gebrauchen, daß selbst starke Männer ihrer kaum sich erwehren, Frauen und Kinder aber durch sie ernstlich gefährdet, schwer verletzt und selbst getötet werden können.
Den Hirschen reiht sich naturgemäß ein Wiederkäuer an, der bis in die neueste Zeit als Antilope angesehen werden konnte, obschon die absonderliche Bildung seines Gehörns, das sich von den Gewaffen aller übrigen Horntiere unterscheidet, jener Ansicht widersprechen mußte. Unser Wiederkäuer, der Gabelbock, unterscheidet sich von allen Ordnungsverwandten dadurch, daß er ein hohles, aber gegabeltes Gehörn trägt, das nicht, wie bei den Horntieren, stetig weiter wächst, sondern von Zeit zu Zeit wie das Geweih der Hirsche, jedoch in durchaus verschiedener Weise, abgeworfen und neu gebildet wird. Der Gabelbock, auch Gabelantilope genannt ( Antilocapra americana), hat im allgemeinen die Gestalt einer kräftigen Antilope und etwas mehr als Rehgröße. Der Kopf ist unschön, schafartig, das ringsum von den stark hervortretenden Augenhöhlenrandknochen umgebene und geschützte Auge groß, dunkel und ausdrucksvoll, das beiden Geschlechtern zukommende, über und zwischen den Augen steil aufsteigende, ein wenig nach rückwärts gerichtete Gehörn beim alten Bocke unten von beiden Seiten her zusammengedrückt, deshalb fast doppelt so breit als dick, seine Oberfläche eigentümlich rauh und höckerig, an einzelnen Stellen mit fast zentimeterhohen spitzigen Auswüchsen unregelmäßig besetzt. Drei verschiedene, meist scharf voneinander abstechende Farben machen die Decke zu einer sehr bunten. Ein schönes, zartes Rostisabell erstreckt sich über den größten Teil des Halses, den ganzen Rücken sowie die Oberschenkel und geht an der Außenseite der Läufe und Ohren in sanftes Rostfahlgelb über; weiß dagegen sind die Leibesseiten fast von der Körpermitte an, die Unter- und Innenseite des Leibes und der Oberteil der Glieder, der Scheitel, Kinn und Kehle. Dunkel- bis schwarzbraune Färbung endlich haben die Oberseite des Gesichtsteiles vom Scheitel an bis zur Nase herab. Hörner und Hufe sind schwarz. Die Gesamtlänge des erwachsenen Bockes beträgt nach den Messungen des Prinzen von Wied 1,53 Meter, wovon 30 Zentimeter auf den Kopf und 19 Zentimeter auf den Schwanz kommen, die Höhe des Vordergestelles 80 Zentimeter, die Höhe des Hintergestelles 96 Zentimeter. Das Weibchen oder die Ziege ist merklich kleiner als der Bock, trägt nur sehr kurze, meist bloß 6 bis 8 Zentimeter lange Hörner, unterscheidet sich aber im übrigen nicht von dem Männchen. Das Verbreitungsgebiet des Gabelbocks erstreckt sich über den größten Teil des westlichen Nordamerika, vom Saskatschawan bis in das mittlere Mexiko und vom Missouri bis zu den Küsten des Stillen Weltmeeres. Wie der Bison ein bezeichnendes Tier der Ebenen und gleich ihm Waldungen und Gebirge meidend, nimmt er seinen Stand in jenen unabsehbaren, bäum- und teilweise wasserlosen, nur mit äußerst kurzem Grase bestandenen Ebenen, die in Amerika »Bisonsteppen« genannt und mit Recht von den sehr abweichenden Hochgrassteppen unterschieden werden.
Über das tägliche Leben der Gabelböcke wie über die Veränderungen, die dasselbe im Laufe des Jahres erleidet, berichtet am genauesten Canfield. »Ich lebte«, so erzählt er, »einige Jahre in einem mehrere Meilen langen, etwa eine halbe Meile breiten, von grasbewachsenen Hügeln umgebenen Tale im südlichen Teile des Kreises Monterey in Kalifornien, habe die Gabelböcke ebenso lange beobachtet, gejagt und über hundertfünfzig Stück von ihnen erlegt, gefangen und großgezogen. Kaum ein Tag ist vergangen, ohne daß sie in Sicht meines Hauses vorübergegangen oder, um zu trinken, zu dem etwa hundert Schritte von meiner Wohnung entfernten Wasser gekommen wären. Es war nicht eben schwierig, sie bei letzterwähnter Gelegenheit mit einem Coltschen Revolver zu erlegen. Sie erschienen in Rudeln von sechs bis acht oder in Herden, die mehrere Hunderte zählten.«
Die Äsung des Gabelbockes besteht, wie wir schon durch die früheren Beobachter wissen, hauptsächlich aus dem kurzen saftigen Grase der Prärie, verschiedenen andern Gewächsen, Moos, Zweigen und dergleichen Stoffen. Salziges Wasser oder reines Salz lieben die Gabelböcke, wie die meisten übrigen Wiederkäuer, ganz außerordentlich, und man sieht sie daher in der Nähe salzhaltiger Stellen mit besonderer Vorliebe ihren Stand nehmen, auch um die Sulzen herum, nachdem sie sich satt geleckt haben, stundenlang der Ruhe pflegen. Erst der Hunger, so scheint es, treibt sie wieder von dannen. Bei guter Weide werden sie im Herbste sehr feist, leiden dagegen im Winter oft große Not, wenn der Schnee fußhoch ihren Weidegrund deckt und sie sich mit der spärlichsten Nahrung begnügen müssen. Unter solchen Umständen kommen sie rasch vom Leibe, weil sie das Laufen im Schnee ermattet, und oft genug gehen sie erbärmlich zugrunde.
Alle Beobachter stimmen überein in der Bewunderung der Schnelligkeit und Behendigkeit der Gabelböcke. Wenn auch vielleicht von einzelnen Antilopen überboten, stehen sie doch unter den Tieren der Prärie unübertroffen da. Leicht und gewandt, mit den hohen Läufen weit ausgreifend und dabei an Ausdauer jedes andere amerikanische Säugetier beschämend, »jagen sie wie der Sturmwind über die Ebene dahin.« Die Tiere bewegen sich, längs der Hügel dahineilend, bergauf oder bergab mit derselben Gewandtheit und Sicherheit wie auf der Ebene und schnellen, nach Audubons Ausdruck, ihre vorderen Läufe so rasch nacheinander auf den Boden, daß man die einzelnen Glieder, wie die Speichen eines sich drehenden Rades, nicht mehr unterscheiden kann. Wenn sie flüchtig werden, laufen sie, nach Angabe Canfields, niemals geradenwegs fort, vielmehr im Zickzack vor dem Gegenstande ihrer Furcht hin und her und bleiben dann auf etwa hundert Schritte Entfernung stehen. Auch Pflegen sie zunächst etwa dreißig bis vierzig Schritte weit zu trotten, und zwar nach Art des Damwildes, indem sie mit allen vier Läufen zugleich aufspringen. Nach dieser Einleitung aber strecken sie ihren Leib und durchmessen in voller Flucht mehrere Meilen im Verlaufe weniger Minuten. Auch schwimmen sie über breite Ströme mit größter Leichtigkeit. Das leitende Tier zieht voran, die übrigen bilden allgemach die indianische Reihe, und das ganze Rudel setzt in schönster Ordnung über den Strom. Die Gabelböcke sind scharfsinnige Tiere. Sie äugen in weite Ferne, vernehmen ausgezeichnet und wittern einen unter dem Winde heranschleichenden Feind auf mehrere hundert Schritte. Wachsam und scheu wählen sie ihren Stand und insbesondere die Plätze, auf denen sie um die Tagesmitte wiederkäuend zu ruhen Pflegen, immer so, daß ihnen eine freie Aussicht nicht verwehrt ist, wissen auch die herrschende Windrichtung trefflich zu benutzen und stellen außerdem besondere Wachen aus. Menschliche Niederlassungen meiden sie sorgsam, bekümmern sich dagegen wenig um Herdentiere, nicht einmal um Pferde und Rinder, werden vielmehr oft ohne Scheu in deren Nähe. Sie kennen den Menschen als den furchtbarsten ihrer Feinde, verstehen aber auch die übrigen zu würdigen und lassen sich dieselben nur höchst selten so nahe aus den Leib rücken, daß sie gefährlich werden können. Das leitende Tier faßt den heranschreitenden Menschen scharf ins Auge, richtet das Gehör nach ihm hin, beobachtet ihn genau, stampft im geeigneten Augenblick mit einem der Vorderfüße auf den Boden oder läßt ein scharfes, pfeifendes Schnaufen vernehmen. Damit gibt es das Zeichen zur Flucht, die augenblicklich beginnt und mit unermüdlicher Ausdauer, solange es nötig, fortgesetzt wird. Ein einzelner Gabelbock stampft und schnauft ebenfalls auf, bevor er flüchtig wird, sträubt auch gleichzeitig die langen Haare der Mähne und des Spiegels und erhält dadurch ein ebenso absonderliches als bezeichnendes Ansehen. Da das gleiche geschieht, wenn ein Rudel in Aufregung gerät, trägt dieses Gebaren wesentlich dazu bei, den Eindruck, den das flüchtende Tier auf den Beschauer macht, zu erhöhen.
Die Brunstzeit beginnt im September. Ungefähr sechs Wochen lang zeigen sich die Böcke sehr erregt und fechten unter sich mit einer gewissen Wildheit. Wenn einer mit dem andern zusammentrifft, schauen sich beide ärgerlich an, rennen dann mit niedergebeugten Köpfen wütend gegeneinander los, und der Kampf beginnt. Beide Gegner bringen sich mit großer Schnelligkeit und Heftigkeit Stöße bei, oft sehr gefährliche, bis der eine genug hat und dem andern das Feld überläßt. Das Tier setzt frühestens im Mai, spätestens Mitte Juni, gewöhnlich zwei, den Eltern gleichgefärbte, ungefleckte Kälber; Schmaltiere bringen selten mehr als ein einziges. Die Mutter verweilt bei ihrem Kalbe während der ersten Tage nach seiner Geburt und äst unmittelbar in der Nähe desselben. Wenn das Kalb vierzehn Tage alt ist, hat es hinlängliche Kraft und Schnelligkeit erlangt, um mit der schnellläufigen Alten einer Verfolgung des Wolfes oder eines andern vierfüßigen Feindes zu entgehen. Wie alle Wiederkäuer wachsen auch die jungen Gabelböcke verhältnismäßig sehr rasch heran. Schon gegen Ende des Juli brechen beim Bocke wie beim Tiere die Hörner durch, und zwar zunächst kurze, stumpf kegelförmige Spitzen, die im Dezember zwei bis fünf Zentimeter an Länge erreicht haben, von nun an aber nicht weiter wachsen, vielmehr abgeworfen und durch neue ersetzt werden.
Noch vor zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren betrieb man die Jagd des Gabelbockes ziemlich lässig, nach Angabe des Prinzen von Wied »nur im Notfalle, wenn man kein Bisonfleisch haben konnte.« Zu jener Zeit war der Indianer noch der schlimmste Feind des Tieres, gegenwärtig hat er dem europäischen Jäger schon vielfach weichen müssen. Die gewöhnliche Jagdweise ist der Pirschgang, derselbe fordert mindestens ebensoviel Geduld und Anstrengung wie unsere Gemsjagd. Während aber dem Jäger bei dieser der Wechsel des Wildes zugute kommt, ist er bei der Jagd auf Gabelböcke einzig und allein auf seine Geschicklichkeit im Anschleichen angewiesen, und nur wer die baum- und strauchlosen Steppen des Westens aus eigener Anschauung kennt, weiß, was dies besagen will. Der Nutzen der Jagd ist nicht bedeutend. Manchen Leuten widersteht zwar das Wildbret dieses Tieres wegen des ihm anhaftenden starken und abstoßenden Geruches; die meisten Europäer aber finden, daß es einen von dem unseres Hirsches oder Rehes ganz verschiedenen, äußerst feinen Wildgeschmack hat und deshalb mit Recht unter die vorzüglichsten Gerichte des Westens gezählt werden darf. Das Feist zeichnet sich durch seine Härte aus und dient deshalb zur Bereitung vortrefflicher Kerzen; das leichte und weiche, aber wenig haltbare Fell wird von den Indianern zur Anfertigung ihrer Hemden, von den Europäern zur Herstellung von Handschuhen benutzt.
Auch unter den Wiederkäuern gibt es Gestalten, die mit den jetzt lebenden Geschöpfen gleichsam nicht mehr in Einklang zu bringen sind und an die märchenhaften Gebilde längst vergangener Erdentage erinnern; die auffallendste von allen ist die Giraffe. Varro hat so unrecht nicht, wenn er dieses sonderbare Wesen »ein Gemisch von Panther und Kamel« nennt; und auch wir gebildeten Europäer staunen heute noch, wenn wir das uns durch Abbildungen hinlänglich bekannte, märchengestaltige Wesen zum erstenmal lebend vor uns sehen. Die Giraffe ist der Vertreter einer eigenen Familie ( Devexa). In dem Sivatherium, dessen versteinten Schädel man in Indien ausgrub, glaubt man ein zu derselben Familie zu rechnendes Geschöpf entdeckt zu haben; in der gegenwärtigen Schöpfung aber ist die Giraffe ( Camelopardalis Girafa) das einzige Mitglied der Familie, das durch den alles gewohnte Maß überschreitenden langen Hals, die hohen Beine, den dicken Rumpf mit abschüssigem Rücken, den zierlich gebauten, feinen Kopf mit großen, schönen, klaren Augen und durch zwei sonderbare, mit Haut überkleidete Knochenzapfen sich kennzeichnet. Die hohen Läufe und der lange Hals machen die Giraffe zu dem höchsten und verhältnismäßig kürzesten aller Säugetiere. Ihre Leibeslänge beträgt nämlich bloß 2,25 Meter, die Schulterhöhe dagegen bereits 3 Meter und die Höhe des Kopfes 5 bis 6 Meter. Der Schwanz wird mit der Haarquaste 1,1 Meter, ohne dieselbe nur 80 Zentimeter lang. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel beträgt 4 Meter, das Gewicht 500 Kilogramm. Aus diesen Maßen allein schon geht hervor, daß die Giraffe hinsichtlich ihrer Gestaltung von allen übrigen Säugetieren abweicht; der Leibesbau ist aber so merkwürdig, daß er eine eingehende Beschreibung erfordert. Die Giraffe scheint gleichsam aus den Bestandteilen verschiedener Tierleiber zusammengesetzt zu sein. Der Kopf und der Leib scheinen vom Pferde, der Hals und die Schultern vom Kamele, die Ohren vom Rinde, der Schwanz vom Esel, die Beine von einer Antilope entlehnt zu sein, während Färbung und Zeichnung des glatten Felles an den Panther erinnern. Eine solche Zusammensetzung kann nur Mißgestaltung des ganzen Tieres zur Folge haben, und wirklich wird niemand die Giraffe schön oder ebenmäßig nennen mögen. Der kurze Leib steht mit den hohen Beinen und dem langen Hals in keinem Verhältnis; der auffallend abschüssige Rücken muß nach allen kunstgerechten Begriffen häßlich genannt werden, und die ungeheure Höhe des Tieres trägt durchaus nicht zu seiner Zierde bei. Schön ist der Kopf, wundervoll das Auge, angenehm die Zeichnung, alles übrige auffallend und sonderbar.
Der langgestreckte Kopf der Giraffe erscheint, der ziemlich dünnen Schnauze wegen, noch länger, als er ist, trägt sehr große, lebhaft glänzende und doch ungemein sanfte, wirklich geistige Augen, große, zierlich gebaute, äußerst bewegliche Ohren von etwa 15 Zentimeter Länge und die zwei erwähnten Stirnzapfen, die entfernt an Hörner erinnern und etwas kürzer sind als die Ohren. Zwischen beiden erhebt sich eine rundliche Knochenanschwellung, gleichsam als drittes Horn. Der Hals ist etwa ebenso lang wie die Vorderbeine, dünn, seitlich zusammengedrückt und hinten mit einem hübschen Haarkamme geziert. Der Leib ist breit an der Brust, am Widerriste viel höher als am Kreuze und längs der Mittellinie etwas eingesenkt, vorn durch die fast rechtwinkelig vorspringenden Schulterblätter sehr ausgezeichnet, hinten ausfallend verschmälert, so daß man den Hinterleib, wenn man das Tier gerade von vorn ansieht, gar nicht bemerkt. Die Beine sind verhältnismäßig zart und fast gleich lang, ihre Hufe zierlich gebaut. An den Beugegelenken der Läufe zeigt sich eine nackte Schwiele, wie sie das Kamel besitzt. Die Haut ist sehr dick und, mit Ausnahme des erwähnten Hornkegels, des Halskammes und der Schwanzquaste, überall gleichmäßig behaart. Ein fahles Sandgelb, das auf dem Rücken etwas dunkler wird und auf der Unterseite ins Weißliche übergeht, bildet die Grundfärbung; auf ihr stehen ziemlich große, unregelmäßig gestaltete, meist eckige Flecken von dunklerer oder lichterer rostbrauner Färbung, und zwar so dicht, daß der helle Grund nur netzartig hervortritt. Am Halse und an den Beinen sind diese Flecken kleiner als auf dem übrigen Leibe. Der Bauch und die Innenseite der Beine sind ungefleckt. Die Mähne ist fahl und braun gebändert; die Ohren sind vorn und an der Wurzel weiß, hinten bräunlich; die Haarquaste ist dunkelschwarz. Ungeborne, noch nicht völlig ausgetragene Giraffen haben ein sehr weiches, mausgrau gefärbtes Fell ohne Flecken; zur Zeit der Geburt sind diese aber schon vorhanden. Sehr alte Männchen sehen oft sehr dunkel, die alten Weibchen regelmäßig licht aus, als ob ihr Fell verblichen wäre.
»Daß die Giraffe«, bemerkt Dümichen, »den alten Ägyptern bekannt war, würde man schon daraus schließen können, weil das Bild derselben in der Hieroglyphenschrift als ein Silbenzeichen auftritt; es finden sich aber auch an den Wänden verschiedener Tempel und Grabkammern Darstellungen, die uns belehren, daß Giraffen als Tribute aus dem Süden herbeigeführt wurden. Das mittels der Giraffe geschriebene Silbenzeichen hat den Lautwert »ser«, und ihm kommt die Bedeutung »groß, hoch, erhaben« zu; ob aber »ser« auch der Name der Giraffe gewesen, steht nicht fest, da bisher noch keine Darstellung aufgefunden zu sein scheint, der bei der Abbildung der Tiere in hieroglyphischer Beischrift auch der Name hinzugefügt worden ist.«
Gegenwärtig bewohnt die Giraffe das mittlere und südlich« Afrika oder denjenigen Teil des Landes, der etwa zwischen dem 17. Grade nördlicher Breite und dem 24. Grade südlicher Breite liegt. Im Norden beginnt ihre Heimat an der südlichen Grenze der Sahara, im Süden verschwindet sie in der Nähe des Oranjeflusses. Wie weit sie von Osten hin in das Innere und nach Westen geht, ist zur Zeit noch nicht ermittelt. Am Kongo und in Senegambien fehlt sie gänzlich, wahrscheinlich weil das Land dort gebirgig ist; denn sie hält sich nur in ebenen Steppengegenden, niemals in den Gebirgen oder in den dichteren Urwäldern auf. Im Norden des Erdteils bewohnt sie noch in beträchtlicher Anzahl die ausgedehnten Steppen des Tieflandes von Habesch, sowie Taka, Sennar, Kordosan, Dar el Fur und das Gebiet des Weißen Flusses, jenseit des Gleichers alle steppenartigen Ebenen, die bis jetzt noch wenig oder nicht von dem Europäer besucht wurden. Ihr Vorkommen ist an das Vorhandensein verschiedener Mimosen gebunden.
In ihren heimischen Wäldern nimmt sich die Giraffe freilich anders aus als in dem engumzäunten Räume eines Tiergartens. Die merkwürdige Übereinstimmung der Gestalt und allgemeinen Erscheinung eines Tieres mit der Örtlichkeit, in der es lebt, macht sich auch hier bemerklich. »Wenn man eine Herde Giraffen«, sagt Gordon Cumming, »in einem Haine der malerischen, sonnenschirmförmigen Mimosen, die ihre heimischen Ebenen schmücken und an deren letzten Zweigen sie infolge ihrer gewaltigen Höhe nagen können, zerstreut sieht, müßte man wirklich nicht viel Sinn für Naturschönheiten haben, wollte man den Anblick nicht überaus anziehend finden.« Alle übrigen Beobachter stimmen vollständig mit diesen Worten überein. »So malerisch«, drückt sich Baker aus, »wie die Giraffe in ihren heimatlichen Aufenthaltsorten, ist kein Tier in der ganzen Natur.« Man begegnet der Giraffe hauptsächlich da, wo überständige verwitterte Stämme vorkommen, die dank den Flechten, die auf ihnen sich ausbreiten, manchmal dem langen Halse einer Giraffe täuschend ähneln. »Oft bin ich«, fährt der genannte Jäger fort, »über die Anwesenheit eines ganzen Trupps von Giraffen in Zweifel gewesen, bis ich zu meinem Fernglase Zuflucht nahm; sogar meine halbwilden Begleiter mußten bekennen, daß ihre scharfen, geübten Augen zuweilen getäuscht wurden; denn sie sahen bald jene verwitterten Stämme für Giraffen an und verwechselten wiederum wirkliche Giraffen mit den hochbejahrten Bäumen.« Um so deutlicher treten jene hervor, wenn sie sich in der baumlosen Steppe am Rande des beschränkten Gesichtskreises bewegen; sie erscheinen dann, laut Heuglin, im Hohlichte, vorzüglich bei günstiger Abendbeleuchtung, noch viel länger und übernatürlicher, als sie in Wirklichkeit sind.
Gewöhnlich trifft man die Giraffe in kleinen Trupps von sechs bis acht Stück; da hingegen, wo sich das edle Tier sicher weiß, kommt es häufiger vor. Cumming spricht von Herden, die aus dreißig bis vierzig Stück bestanden haben sollen, meint aber, daß sechzehn als durchschnittliche Zahl betrachtet werden muß; Baker will sogar Scharen von siebzig bis hundert begegnet sein. Ich habe das stolze Wild nur einmal, und zwar zu dreien, gesehen und in Kordosan auch immer bloß von schwachen Trupps reden hören.
Alle Bewegungen der Giraffe sind sonderbar. Am vorteilhaftesten nimmt sie sich bei ruhigem Gange aus; sie erscheint dann würdig und anmutig. Der Gang selbst ist ein langsamer und gemessener Paßschritt, da sie beide Läufe einer Seite gleichmäßig bewegt. Ganz anders sieht sie aus, wenn sie flüchtend in Galopp fällt. Lichtenstein schildert in sehr anschaulicher Weise den Eindruck, den das Tier dann auf den Beobachter macht. »Ich hatte mich«, so erzählt er, »zwei Giraffen beinahe auf bequeme Schußweite genähert, als sie mich bemerkten und entflohen. Aber dieses Entfliehen war so über alle meine Erwartungen wunderbar, daß ich vor Lachen, Staunen und Freude fast die ganze Jagd vergessen hätte. Bei dem sonderbaren Mißverhältnisse der vordern zur hintern Höhe und der ganzen Höhe zur Länge hat nämlich die schnelle Fortbewegung des Tieres große Schwierigkeiten. Wenn Levaillant behauptet, er habe es traben gesehen, erspart er mir dadurch die Mühe, ihm zu beweisen, daß das Tier ihm nie lebendig vor Augen gekommen. Wie in aller Welt soll eine Giraffe bei der großen Ungleichheit der Vorder- und Hinterläufe traben? Nur galoppieren kann sie, wie ich aus Erfahrung versichern kann. Aber dieser Galopp ist so schwerfällig, lahm und plump, daß man in einem Abstande von mehreren hundert Schritten, der es erschwert, den zurückgelegten Raum mit der Größe des Tieres und der umgebenden Gegenstände zu vergleichen, aus der Langsamkeit, mit der die Bewegung geschieht, fast schließen sollte, ein Mensch könnte es zu Fuß einholen. Diese Langsamkeit wird aber ersetzt durch die Weite des Schrittes, indem nach einer ungefähren Messung ein jeder Sprung vier bis fünf Meter beträgt. Wegen der Größe und Schwere des Vorderteiles ist die Giraffe nicht imstande, sich durch die Kraft der Muskeln allein vorn zu heben, sondern dazu muß eine Zurückbiegung des Halses, wodurch der Schwerpunkt mehr nach hinten gerückt wird, zu Hilfe kommen; dann erst ist es ihr möglich, die Vorderbeine von der Erde zu bringen. Dies geschieht, ohne sie zu biegen, und ebenso steil setzt sie dieselben mit einer gleichmäßigen Bewegung des Halses nach vorn und, durch die Kraft der Hinterschenkel vorwärts getrieben, wieder nieder. Mit der neuen Bewegung des Halses erfolgt das Nachspringen der Hinterfüße. So bewegt sich der Hals in stetem Hin- und Herschwunge fast wie der Mast eines auf den Wellen tanzenden oder nach der Schiffersprache stampfenden Schiffes.« Während der Flucht schlägt sie mit dem langen Schwanze wie mit einer Reitgerte klatschend über den Rücken; auch dreht sie den Kopf mit den schönen, klugen Augen oft rückwärts, um nach ihren Verfolgern hinzusehen.
Höchst eigentümlich ist eine Stellung, die das Tier einnimmt, wenn es etwas von dem Boden aufnehmen, oder wenn es trinken will. In älteren Beschreibungen wird behauptet, daß die Giraffe zu diesem Ende auf die vordern Fußwurzelgelenke (Knie) niederfalle. Dies ist falsch. Sie bewirkt die Erniedrigung ihres Vorderteils, indem sie beide Vorderläufe so weit auseinander stellt, daß sie bequem mit dem langen Halse auf den Boden herabreichen kann. Wer dies nicht selbst gesehen hat, hält es geradezu für unmöglich, und ich habe deshalb die auf voriger Seite gegebene Abbildung zeichnen lassen. Um sich niederzutun, senkt sie sich zuerst auf die Beugegelenke der Vorderbeine, knickt hierauf die Hinterbeine zusammen und legt sich endlich auf die Brust wie das Kamel. Während des Schlafes liegt sie zum Teil auf der Seite und schlägt dabei beide oder nur eins ihrer Vorderbeine ein; den Hals wendet sie rückwärts, den Kopf läßt sie gern auf den Hinterschenkeln ruhen. Ihr Schlaf ist leise und dauert nur kurze Zeit. Sie kann auch tagelang den Schlaf entbehren und scheint sich dann stehend auszuruhen.
Es versteht sich von selbst, daß die Nahrung der Giraffe im Einklange steht mit ihrer Gestalt und ihrem Wesen. Das Tier ist wenig geeignet, Gras vom Boden abzuweiden, um so mehr aber befähigt, Laub von den Bäumen zu brechen. Hierbei unterstützt es seine ungemein bewegliche Zunge sehr wesentlich. Wie bekannt, gebrauchen die meisten Wiederkäuer die Zunge zum Abpflücken ihrer Nahrung; kein einziger aber bedarf dieses Werkzeug so ausschließlich wie die Giraffe. Was dem Elefanten der Rüssel, ist ihr die Zunge. Sie vermag die kleinsten Gegenstände damit aufzunehmen, das zarteste Blatt zu pflücken und in den Mund zu ziehen. »In unserm Tiergarten«, bemerkt Owen, »ist mehr als eine Dame beim Beschauen der Giraffen von diesen der künstlichen Blumen beraubt worden, die ihre Hüte schmückten. Es scheint, daß die Giraffe weniger durch den Geruch als durch das Auge in der Auswahl ihres Futters geleitet wird, und so kommt es oft vor, daß das Tier sich betrügt, wie in den erwähnten Fällen, wo es mit der gewandten Zunge die künstlichen Blumen ergriff und von den Hüten abriß.« In der Freiheit sind es hauptsächlich die Zweige, Knospen und Blätter der Mimosen, die der Giraffe zur Nahrung dienen. Die Kameldorn- und »Warteinbißchenmimose« bilden im Süden Afrikas den Hauptbestandteil ihres Futters; im Norden Afrikas frißt sie die gewöhnlichen oder die Karratmimosenblätter, entlaubt auch gern die Schlingpflanzen, die in so reicher Fülle die Bäume der Wälder jener Gegenden umhüllen. Da die erwähnten Bäume nicht viel höher werden als sie selbst, bemächtigt sie sich der Äsung ohne Schwierigkeit; denn gegen die nadelscharfen Dornen sind Lippen und Zunge ebenso unempfindlich wie die des Kamels. Von Steppengras äst sie selten, verschmäht dasselbe, solange es noch grün ist, jedoch keineswegs. Bei saftiger Nahrung kann sie, wie das Kamel, lange Zeit das Wasser entbehren. Für gewöhnlich genügt ihr die Feuchtigkeit der frischen Blätter und Schößlinge, und man trifft sie daher auch in Gegenden, wo auf Meilen hin kein Wasser zu finden ist. In der trockenen Jahreszeit aber, wenn die Bäume größtenteils ihres Blätterschmuckes beraubt sind und die hohen, verdorrten Gräser ihr dürftige Kost bieten, geht sie oft meilenweit nach pfuhligen Wasserbecken oder zu den übriggebliebenen Tümpeln der während der Regenzeit fließenden Ströme herab, um sich zu tränken. Solche Orte sind es, an denen Freiligraths schönes Gedicht zur Wahrheit werden kann. Das Wiederkäuen besorgt die Giraffe stehend, hauptsächlich aber nachts; doch scheint es ihr nicht soviel Zeit zu kosten wie andern ihrer Ordnung.
Die höheren Begabungen stellen die Giraffe sehr hoch. Ihre Sinne, zumal Gesicht und Gehör, sind vortrefflich entwickelt, die geistigen Fähigkeiten nicht minder ausgebildet. Sie ist klug und verständig, auch äußerst liebenswürdig und im Verhältnis zu ihrer Größe ein höchst gutmütiges, friedliches und sanftes Geschöpf, das nicht bloß verträglich mit seinesgleichen, sondern auch mit andern Tieren lebt, solange ihr diese nicht beschwerlich oder gefährlich werden. Im Notfalle weiß sie sich recht gut zu verteidigen, – nicht mit ihren Hörnern, die überhaupt bloß zum Schmucke zu dienen scheinen, sondern mit kräftigen Schlägen ihrer langen, sehnigen Füße. In dieser Weise kämpfen die verliebten Männchen unter sich um die Weibchen; durch Ausschlagen beschützt die Giraffenmutter ihr Junges vor der tückisch herbeischleichenden Katze, und die Kraft des Schlages ist so gewaltig, daß er selbst einen Löwen fällen kann. Wärter in den Tiergärten müssen sich manchmal sehr in acht nehmen vor den Giraffen, obgleich sie sonst recht gut mit diesen auskommen.
Über die Fortpflanzung der Giraffe hat erst die Neuzeit uns belehrt. Aus den bisherigen, in verschiedenen Tiergärten gesammelten Beobachtungen geht hervor, daß die Paarung im März oder Anfang April, der Wurf im Mai oder Juni stattfindet, die Dauer der Tragzeit also 431 bis 444 Tage oder 14¼ bis 14½ Monate beträgt. Während der Paarungszeit vernahm man von beiden Geschlechtern ein sanftes Blöken. Die Männchen sprangen ohne besondere Heftigkeit aufeinander los und rieben sich gegenseitig mit ihren Stirnzapfen den Rücken und die Seiten. Ernste Kämpfe wurden nicht ausgefochten. Die Geburt ging schnell und leicht vonstatten. Das junge Tier kam zuerst mit den Vorderfüßen und dem Kopfe zur Welt. Nach seiner Geburt lag es etwa eine Minute bewegungslos, dann begann die Atmung; nach einer halben Stunde versuchte es aufzustehen, zwanzig Minuten später wankte es nach der Mutter hin. Diese blickte ziemlich gleichgültig auf ihren Sprößling herab, und man mußte am andern Tage eine Kuh herbeibringen, an der die junge Giraffe etwa einen Monat lang saugte. Zehn Stunden nach der Geburt lief das Junge umher, am dritten Lebenstage übte es sich bereits in Sätzen. Bei seiner Geburt war es 2,1 Meter lang, die Vorderglieder hatten eine Höhe von 1,5 Meter, der Schwanz maß bereits 50 Zentimeter. Etwa neun Monate nach der Geburt dieses Jungen nahm die Mutter das Männchen von neuem an und warf nach 431 Tagen wiederum ein Junges, das zwölf Stunden nach seiner Geburt kräftig an dem Euter der Alten saugte. Nach drei Wochen genoß es Pflanzen, und mit dem Alter von vier Monaten begann es wiederzukäuen. In der ersten Woche seines Lebens war es zwei, nach neun Monaten bereits drei Meter hoch.
Die Jagd der Giraffe wird von den Eingebornen Afrikas wie von den Europäern mit Leidenschaft betrieben. Erstere jagen mit Hilfe des Kameles oder Pferdes und schlagen dem müde gehetzten Tiere, wenn sie es erreicht haben, mit ihrem Schwerte die Achillessehne durch, lähmen es auf diese Weise und schlachten es dann ab, um das überall sehr geschätzte Fleisch und andere Teile des Giraffenleibes zu benutzen. Die Europäer bedienen sich des Feuergewehres, erlegen aber auch mit weittragenden Waffen das vorsichtige Tier in der Regel erst nach längerer Hetzjagd. Die außerordentliche Höhe der Giraffe verleiht ihr insofern einen großen Vorteil, als sie ihr gestattet, einen ungemein weiten Gesichtskreis zu beherrschen und jeden sich nähernden Feind rechtzeitig wahrzunehmen. Heuglin erwähnt zwar, daß es ihm im Waldgürtel Wiederholt gelungen sei, Giraffen ohne Anwendung besonderer Vorsichtsmaßregeln bis auf Pistolenschußweite zu beschleichen, scheint aber der einzige zu sein, dem dies gelungen ist. Alle übrigen Beobachter und Jäger kommen darin überein, daß sich kein Tier der afrikanischen Wildnis schwerer nahekommen läßt als die Giraffe. Wenige der dort lebenden Wildarten ermüden die Pferde der nachsetzenden Jäger mehr als sie. Zwar begnügt sie sich, eine gewisse Entfernung zwischen sich und ihrem Verfolger innezuhalten, dauert aber im Laufe länger aus als das beste Pferd, vorausgesetzt, daß der Boden nicht ungünstig für sie ist; denn gegen eine Anhöhe hinaufzulaufen, wird ihr begreiflicherweise im höchsten Grade beschwerlich. Nach Baker hat der Jäger bei Verfolgung der Giraffe folgende Regel zu beobachten. In dem Augenblicke, in dem sie ansetzt, muß man ihr nachspringen, und die Sporen müssen gerade beim Anfange der Jagd in Tätigkeit sein, die Pferde soviel als möglich angetrieben werden, damit gleich vom Anfange an ein Wettrennen im schnellsten Laufe stattfinde. Läßt man die Giraffe in den ersten fünf Minuten einen Vorteil gewinnen, so fällt das Rennen gegen das Pferd ans.
Die Jagd selbst schildert Gordon Cumming in sehr lebhafter Weise. »Keine Feder und keine Worte«, sagt er, »können dem Jagdfreund beschreiben, was es heißt, in der Mitte eines Trupps riesenhafter Giraffen zu reiten; man muß das selbst erfahren, um es zu verstehen. Gewöhnlich eilen die verfolgten Giraffen durch die dornigen Gebüsche aller Art, und die Arme und Beine des verfolgenden Jägers sind, lange bevor er seinem Wilde nachkommt, mit Blut bedeckt. Bei meiner ersten Jagd eilten zehn gewaltige Giraffen vor mir her. Sie galoppierten gemächlich dahin, während mein Pferd genötigt war, seine äußerste Schnelligkeit aufzubieten, um nicht hinter ihnen zurückzubleiben. Meine Empfindungen bei dieser Jagd waren verschieden von allem, was ich während einer langen Jägerlaufbahn bis jetzt erfahren; ich war durch den wunderschönen Anblick vor mir so in Anspruch genommen, daß ich gleichsam wie bezaubert dahinritt und fast nicht glauben konnte, wirklich lebende, dieser Welt angehörende Geschöpfe vor mir herzujagen. Der Boden war fest und zum Reiten günstig. Mit jedem Satze meines Pferdes kam ich der Herde näher, schoß endlich mitten unter sie hinein und sonderte das schönste Weibchen von ihr ab. Als sich die eine Giraffe von ihren Genossen getrennt und hitzig verfolgt sah, lief sie noch schneller und galoppierte in ungemein weiten Sprüngen, während ihr Hals und ihre Brust mit den dürren, alten Zweigen der Bäume in Berührung kamen, sie abrissen und fortwährend meinen Weg damit bestreuten. Bald war ich etwa noch acht Schritte hinter ihr, feuerte im Galopp ihr eine Kugel in den Rücken, ritt dann noch schneller, so daß ich ihr zur Seite kam, hielt die Mündung meiner Büchse nur wenige Fuß von ihr entfernt und schoß ihr meine zweite Kugel hinter das Blatt, ohne daß diese jedoch große Wirkung zu äußern schien. Da stellte ich mich gerade vor sie, während sie begann, im Schritte zu gehen, stieg ab und lud schnell beide Läufe meiner Büchse wieder. Im trockenen Bette eines Baches brachte ich sie nochmals zum Stehen und feuerte auf die Stelle, wo ich das Herz vermutete. Sie lief sogleich weiter: ich lud nochmals, folgte und brachte sie wiederum zum Stehen. Jetzt stieg ich ab und schaute sie verwundert an. Ihre außerordentliche Schönheit bezauberte mich, ihr sanftes, dunkles Auge mit seinen seidenen Wimpern schien bittend auf mich herabzuschauen. Ich fühlte in diesem Augenblick wirklich Reue über das Blut, das ich vergoß. Aber der Jagdtrieb behielt die Oberhand. Nochmals richtete ich meine Büchse empor und schoß der Giraffe eine Kugel in den Hals. Sie bäumte hoch auf den Hinterbeinen in die Höhe und stürzte dann wieder nach vorn zu Boden, daß die Erde erzitterte. Ein dicker Strom schwarzen Blutes sprudelte aus der Wunde hervor, die riesigen Glieder zuckten – noch einen Augenblick, und das Tier hatte verendet.«
Vielfach ist die Verwendung der erlegten Giraffe. Man benutzt die Haut zu allerlei Lederwerk, die Schwanzquaste zu Fliegenwedeln, die Hufe zu Horngegenständen und genießt das vortreffliche Fleisch. Noch lieber aber sieht man es, wenn man eine Giraffe lebend bekommen kann, überall ist man dem auffallenden Tiere gewogen, überall freut man sich, es um sich zu haben. In den innerafrikanischen Städten sieht man oft ein paar Giraffenhäupter über die hohen Umfassungsmauern eines Gartens hervorragen, und nicht selten begegnet man in der Nähe von Ortschaften gezähmten Tieren, die nach Belieben umhergehen. Bei unserer Ankunft in Karkodj, einer Ortschaft am Blauen Flusse, kam zuerst eine Giraffe an unsere Barke, gleichsam in der Absicht, uns zu begrüßen. Sie ging vertraulich auf uns zu, trat dicht an unser Boot heran, fraß uns Brot und Durrahkörner aus der Hand und behandelte uns so freundlich, als wären wir ihre alten Bekannten. Gar bald merkte sie, wie große Freude wir an ihr hatten; denn sie kam nun alle Tage, solange wir uns in der Nähe dieser Ortschaft aufhielten, mehrmals zu uns, um sich liebkosen zu lassen. Der arabische Name » Serafe« – die Liebliche -, den unser Wort Giraffe verstümmelt wiedergibt, wurde mir verständlich. Ich freute mich unaussprechlich, einmal ein so sonderbares Tier in allen seinen Bewegungen beobachten zu können; denn im freien Zustande hatte ich es nur einmal ganz von fern gesehen, obgleich ich mich wochenlang in Gegenden herumtrieb, die reich an Giraffen genannt werden müssen.
In Europa erregten die Giraffen, die man seit fast dreihundert Jahren zum erstenmal wieder im Jahre 1827 lebend zu sehen bekam, ungeheures Aufsehen. Das Tier war inzwischen beinahe zu einem Fabelwesen geworden, obgleich Levaillant es verhältnismäßig genau geschildert hatte. Um die angegebene Zeit erfuhr der Pascha von Ägypten, daß Araber von Sennar ein paar junge Giraffen mit Kamelmilch glücklich aufgezogen hatten, bestimmte diese Tiere zu Geschenken für europäische Monarchen, ließ sie nach Kairo bringen, dort drei Monate lang in seinen Gärten für die weitere Reise ausruhen und pflegen und hierauf auf großen Barken nach Alexandrien befördern, woselbst sie eingeschifft wurden. Die Konsuln von England und Frankreich losten um die beiden weiblichen Tiere, die auch glücklich an ihrem Bestimmungsorte anlangten, das für London bestimmte am 11. August 1827. In Paris bemächtigte sich die Mode der abenteuerlichen Tiere: man trug sich noch im Jahre 1828 à la girafe. Thibaut, ein mir wohlbekannter Bewohner Kordosans, brachte im Jahre 1834 andere Giraffen, die er in den Steppen des von ihm bewohnten Landes gejagt und gefangen hatte, lebend nach Europa. Die Jungen bekam er erst in seine Gewalt, nachdem die Alten getötet waren. Nach seinen Berichten verursacht der Fang unglaubliche Mühen und Beschwerden. Man muß wochenlang in den Steppen verweilen, vortreffliche Pferde, Kamele und Kühe mit sich nehmen und den Arabern, ohne deren Mithilfe das Unternehmen vergeblich sein würde, verhältnismäßig hohe Preise für die Gefangenen bezahlen. Die jungen Giraffen ergeben sich ohne Umstände in ihr Schicksal, verlangen aber die sorgfältigste Behandlung, wenn sie gedeihen sollen. Eben aus diesem Grunde nimmt man melkende Kühe mit auf die Jagd, um den erbeuteten Tieren sogleich geeignete Nahrung bieten zu können. Von dem Fangplatze aus führt man sodann die inzwischen gezähmten nebst ihren Ammen langsam in kleinen Tagereisen der Küste zu. Neuerdings erhalten wir die meisten lebenden Giraffen aus Taka oder den zwischen dem Blauen Flusse und dem Roten Meer gelegenen Steppenländern. Durch Casanova, einen unlängst verstorbenen Tierhändler, der seit der Römer Zeiten zum erstenmal den afrikanischen Elefanten lebend in Europa einführte, sind die dort ansässigen und umherstreifenden Araber zum Fange der Giraffen angeregt und im Verlaufe weniger Jahre zu wichtigen Versorgern unserer Tiergärten geworden. Leider ertragen die nach Europa gebrachten Giraffen die Gefangenschaft nur bei bester Pflege längere Zeit. Die meisten gehen an einem eigentümlichen Knochenleiden zugrunde, das man »Giraffenkrankheit« genannt hat. Ursachen der letztern dürften Mangel an Bewegung und ungeeignete Nahrung sein.
Die zweite Hauptabteilung der Wiederkäuer wird gebildet durch die Horntiere ( Cavicornia), die nach ziemlich übereinstimmender Ansicht der Forscher eine einzige, nach außen wohlabgegrenzte Familie bilden. So nahe verwandt die Hirsche den Horn- oder scheidenhörnigen Tieren auch zu sein scheinen, so bestimmt unterscheiden sie sich durch die Gestalt und Beschaffenheit sowie den Bildungsgang ihrer Gehörne, weil deren Entwicklung und Weiterbildung eine stetig fortschreitende ist. Zur anderweitigen Kennzeichnung der Familie mag dienen, daß alle zu ihr gehörigen Tiere nur im Unterkiefer Schneidezähne haben, acht an der Zahl, oder, wie andere wollen, sechs Schneide- und zwei Eckzähne, und außerdem in jedem Kiefer oben und unten sechs Mahl- oder Backenzähne besitzen, daß ferner die Schädelknochen an den Kopfseiten vor dem Auge dicht und undurchbrochen sind, der Huf ziemlich plump und breiter als die Dicke der Zehen ist, die Behaarung gleichmäßiger als bei den Hirschen zu sein pflegt und Haarwülste an den Hinterläufen nicht oder doch nur ausnahmsweise vorhanden sind.
Für den Menschen haben die Horntiere eine viel höhere und wichtigere Bedeutung als alle übrigen Wiederkäuer, mit alleiniger Ausnahme der Kamele. Ihnen entnahmen unsere Vorfahren die für die Menschheit wichtigsten Nähr- und Nutztiere; ihnen danken wir einen wesentlichen Teil unserer regelmäßigen Nahrung wie unserer Kleiderstoffe; ohne sie würden wir gegenwärtig nicht mehr imstande sein zu leben. Auch die noch ungebändigten, unbeschränkter Freiheit sich erfreuenden Arten der Familie sind durchgehends mehr nützlich als schädlich, da ihre Eingriffe in das, was wir unser Besitztum nennen, uns nicht so empfindlich treffen wie das Gebaren anderer großer Tiere und sie durch ihr fast ausnahmslos schmackhaftes Wildbret, durch Fell, Haare und Horn den von ihnen dann und wann angerichteten Schaden wenigstens so ziemlich wieder aufwiegen, im großen ganzen sogar überbieten. Fast sämtliche wildlebende Horntiere zählen zum Wilde, nicht wenige von ihnen zu Jagdtieren, die der Weidmann den Hirschen als vollkommen ebenbürtig an die Seite stellt. Außer dem Menschen hängen sich viele andere Feinde an die Fährte der Scheidenhörner; mehr aber noch als alle Gegner zusammengenommen beschränken Mangel, Hunger und infolgedessen sich einstellende Seuchen ihre Vermehrung.
*
Unter den Horntieren stellen wir die Antilopen, die eine besondere Unterfamilie ( Antilopina) bilden, obenan. Die Abteilung enthält die meisten Arten der Gesamtheit und begreift in sich die zierlichsten und anmutigsten Horntiere überhaupt. Jedoch läßt sich dies nur im allgemeinen sagen; denn gerade unter den Antilopen gibt es einige, die dem von uns gemeiniglich mit dem Namen verbundenen Begriffe wenig entsprechen. Die Abteilung wiederholt im großen und ganzen das Gepräge der Gesamtheit; es finden sich in ihr die schlankesten und zierlichsten aller hohlhörnigen Tiere und ebenso plumpe, schwerfällige Geschöpfe, die man auf den ersten Blick hin eher zu den Rindern als zu ihnen zählen möchte. Aus diesem Grunde verursacht ihre allgemeine Kennzeichnung ebenso erhebliche Schwierigkeiten wie die der ganzen Familie, und auch die Abgrenzung der Gruppe ist keineswegs leicht, da einzelne Antilopen anscheinend weit mehr mit den Rindern und Ziegen übereinstimmen als mit dem Urbilde, als das wir die schon seit den ältesten Zeiten hochberühmte Gazelle anzusehen haben.
Im allgemeinen kann man die Antilopen als schlankgebaute, hirschähnliche Tiere mit kurzem, fast immer eng anliegendem Haarkleide und mehr oder minder gewundenem Gehörn bezeichnen, das zumeist beiden Geschlechtern zukommt. Die verschiedenen Arten ähneln sich im ganzen außerordentlich, und nur die Bildung der Hörner, der Hufe und des Schwanzes sowie einzelne Abänderungen des Haarkleides geben sichere Unterscheidungsmerkmale. Aber die Anzahl der Antilopen ist so groß, daß die Grenzglieder der Reihe kaum noch Ähnlichkeit miteinander zu haben scheinen; denn mit der großen Artenzahl geht natürlich die Verschiedenheit der Gestaltung Hand in Hand, und deshalb übertrifft die Familie an Mannigfaltigkeit alle übrigen der Ordnung. Es finden sich Anklänge an die plumpen Rinder wie an die zierlichen Rehe, an die kleinen zarten Moschustiere wie an die Pferde. Der gewöhnlich kurze Schwanz verlängert sich wie bei den Rindern oder ähnelt dem mancher Hirsche. Am Halse bildet sich eine kleine Mähne; um den Mund herum verlängern sich eigentümlich die Haare, so daß sie fast einen Bart bilden wie bei den Ziegen. Die Hörner biegen sich gleichmäßig oder winden und drehen sich in dreifachen Bögen; ihre Spitze krümmt sich nach hinten oder nach vorn, nach innen oder nach außen; das ganze Gehörn erscheint leierartig oder die einzelne Stange wie eine gewundene Schraube oder auch wieder ganz gerade, wenigstens nur unbedeutend gekrümmt. Bald ist es rund, bald gekantet, bald gekielt, bald zusammengepreßt; die Querrunzeln, die das Wachstum bezeichnen, sind im allgemeinen deutlich, aber auch nur angedeutet usw. Bei einer Sippe besteht das Gehörn sogar aus vier Stangen.
Ganz Afrika, Süd-, West- und Mittelasien, Süd- und Mitteleuropa sind die Heimat der Antilopen. Die meisten lieben die Ebene, einige aber ziehen das Hochgebirge entschieden der Tiefe vor und steigen bis zur Grenze des ewigen Schnees empor; diese bewohnen offene, spärlich mit Pflanzen bewachsene Gegenden, jene finden sich in dünn bestandenen Buschwäldern, einzelne auch in den dichtesten Waldungen, einige sogar in Sümpfen und Brüchen. Die größeren Arten schlagen sich in Trupps oder Rudel, oft in solche von außerordentlicher Stärke; die kleineren leben mehr paarweise oder wenigstens in minder zahlreicheren Gesellschaften. Sie sind Tag- und Nachttiere, unterscheiden sich also auch hierdurch von den Hirschen, die, wie bekannt, zur Nachtzeit äsen, umhertummeln, sich aber bei Tage lagern und schlafen. Ihre Bewegungen sind meist lebhaft und behend, auch ungemein zierlich. Die Schnelligkeit mancher Arten wird von keinem andern Säugetier übertroffen, die Anmut ihres Wesens von keinem erreicht. Luft, Licht und ungemessene Freiheit lieben sie über alles; deshalb bevölkern gerade sie die arme Wüste, deshalb beleben sie die tote Einöde. Nur wenige Arten trollen plump und schwerfällig dahin und ermüden schon nach kurzer Verfolgung; die übrigen vergeistigen sich gleichsam während ihrer Bewegung. Sie besitzen sehr scharfe Sinne, äugen, vernehmen und wittern ausgezeichnet, sind lecker und empfindlich für äußere Einflüsse. Neugierig, munter, heiter und neckisch wie die Ziegen, benutzen sie gemachte Erfahrungen, stellen Wachen aus, wenn sie Verfolgungen erlitten haben, und werden dann in hohem Grade scheu. Viele zeichnen sich durch Friedfertigkeit aus, andere können recht bösartig sein. Ihre blökende, stöhnende oder pfeifende Stimme hört man selten, gewöhnlich bloß zur Brunstzeit, wenn die Böcke und Ziegen sich miteinander streiten.
Die Nahrung besteht nur in Pflanzenstoffen, hauptsächlich in Gräsern und Kräutern, in Blättern, Knospen und jungen Trieben. Einigen muß die dürftigste Äsung genügen, andere zeigen sich ungemein wählerisch und genießen nur die saftigsten und leckersten Pflanzen. Bei frischem grünem Futter können die meisten lange dürsten, die in der dürren Wüste lebenden sogar tage- und wochenlang Wasser vollständig entbehren.
Man darf die Antilopen nützliche Tiere nennen und braucht kaum eine Ausnahme zu machen. An den Orten, wo sie leben, bringen sie selten erheblichen Schaden; wohl aber nützen sie durch ihr Fleisch, durch ihr Gehörn und durch ihr vortreffliches Fell. Sie sind deshalb ein Gegenstand der eifrigsten Jagd bei allen Völkern, die mit ihnen die gleiche Heimat teilen. Noch größer aber dürfte der Nutzen sein, den sie dem Menschen gewähren durch die Freude an ihrer Schönheit, Anmut und Liebenswürdigkeit und durch das außerordentliche Vergnügen, das ihre Jagd bereitet. Manche seit uralter Zeit hochberühmte Antilopen sind von Dichtern und Reisenden laut gepriesen worden, wegen anderer setzt der Alpenjäger hundertmal sein Leben ein. In derselben Weise fühlt sich der Mensch zu allen übrigen Antilopen hingezogen. Dazu kommt noch, daß die meisten, wenigstens in ihrem Vaterland, die Gefangenschaft leicht und dauernd aushalten, sich in derselben fortpflanzen und ihren Pfleger durch Zahmheit und Zutraulichkeit erfreuen. Manche werden förmlich zu Haustieren und sind in früherer Zeit buchstäblich als solche betrachtet und behandelt worden.
Die Reihe der von mir zur Besprechung erwählten Arten mag durch die Antilopen im engsten Sinne ( Antilope) eröffnet werden. Die unter diesem Namen aufgestellte Sippe kennzeichnet sich durch mittlere, unserem Rehe annähernd gleiche Größe und verlängerte, leierförmige oder schraubenartig gedrehte, in der Regel beiden Geschlechtern zukommende Hörner. Hirschziegenantilopen nennt man die Arten mit runden, auf- und rückwärts gerichteten, schraubenförmig gedrehten und geringelten, fast geraden Hörnern, die aber bloß dem Männchen zukommen. Das Weibchen besitzt zwei Zitzen.
Die Hirschziegenantilope ( Antilope cervicapra) spielt in der indischen Götterlehre eine wichtige Rolle. Sie findet sich auf der Himmelskarte, gespannt vor den Wagen des Mondes, dargestellt als ein Pfeil der Götter, nimmt in dem Tierkreise der Hindus die Stelle des Steinbocks ein und ist neben vielen andern Arten der Göttin Tschandra oder dem Monde geheiligt. Sie ist etwas kleiner, schlanker und weit zierlicher als unser Damhirsch; ihre Leibeslänge beträgt 1,3 Meter, die Länge des Schwanzes 15 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 80 Zentimeter. Der Leib ist schwach gestreckt und untersetzt, der Rücken ziemlich gerade und hinten etwas höher als am Widerrist, der Hals schmächtig und seitlich zusammengedrückt, der Kopf ziemlich rund, hinten hoch, nach vorn zu verschmälert, an der Stirn breit, längs der Nase gerade und an der Schnauze gerundet. Die Beine sind hoch, schlank und dünn, die hinteren etwas länger als die vorderen. Unter den verhältnismäßig großen und außerordentlich lebhaften Augen befinden sich Tränengruben, eine Art von Tasche bildend, die willkürlich geöffnet und geschlossen werden kann. Die Ohren sind groß und lang, unten geschlossen, in der Mitte ausgebreitet, gegen das Ende verschmälert und zugespitzt. Das Gehörn wird bis 40 Zentimeter lang, ist nach vorn und rückwärts gerichtet, fast gerade, jedoch mehrere Male schwach ausgebeugt und schraubenförmig gedreht. An der Wurzel stehen beide Stangen nahe zusammen, an der Spitze ungefähr 35 Zentimeter voneinander entfernt. Je nach dem verschiedenen Alter sind die Hörner stärker oder schwächer und nahe der Wurzel mit mehr oder weniger ringförmigen Erhabenheiten versehen. Bei alten Tieren zählt man mehr als dreißig solcher Wachstumsringe, bei dreijährigen ungefähr zehn, bei fünfjährigen bereits gegen fünfundzwanzig; ihre Anzahl steht aber nicht in einem geraden Verhältnisse zu dem Wachstume. Die Behaarung ist kurz, dicht und glatt, das einzelne Haar ziemlich steif und, wie bei den meisten hirschähnlichen Tieren, etwas gedreht. Ans der Brust, an der Schulter und zwischen den Schenkeln bildet es deutliche Nähte, in der Horn- und Nabelgegend Wirbel, auf der Innenseite der Ohren verteilt es sich in drei Längsreihen, am Handgelenk und an der Spitze des Schwanzes verlängert es sich zu kleinen Haarbüscheln, auf der Unterseite des letzteren fehlt es gänzlich. Nach Alter und Geschlecht ist die Färbung eine verschiedene. Beim alten Bock sind Vordergesicht, Hals, Rücken, Außenseite und ein bis auf die Fesselgelenke herabreichender, nach unten sich verschmälernder Streifen auf den Beinen dunkelbraungrau, Stirn, Scheitel, Ohren, Nacken, Hinterhals und Hinterschenkel nebst Oberschwanz fahlgrau, der Vorderteil der Schnauze, ein Ring ums Auge, Kinn, der schmal rostrotbraun eingefaßte Spiegel und die ganze Unterseite von der Brust an sowie die Innenseite weiß, die bis auf eine schmale Stelle zwischen den Nasenlöchern behaarte Muffel, die Hörner, die zierlichen, mittelgroßen, zusammengedrückten und spitzigen Hufe und die mittelgroßen, abgeplatteten und abgestumpften Asterklauen schwarz, die Iris bräunlichgelb, der quergestellte Stern dunkelschwarz. Die Ziege ist viel lichter als der Bock, dunkelisabellbraun, ein verwaschener Streifen längs der Seiten dunkelisabellgelb, die Stirn schwarzbraun, ein Ring um das Auge und die Ohrwurzel weiß, das übrige wie bei dem Bock gefärbt und gezeichnet. Junge Tiere sollen sich durch vorherrschend rötliche Färbung von den alten Weibchen unterscheiden.
Die Hirschziegenantilope bewohnt Vorderindien, namentlich Bengalen, und lebt in Herden von fünfzig bis sechzig Stück, die von einem alten dunkelfarbigen Bock angeführt werden. Unter allen Umständen ziehen die Tiere offene Gegenden den bedeckten vor; denn sie sind stets im hohen Grade für ihre Sicherheit besorgt. Kapitän Williamson erzählt, daß immer einige junge Männchen und auch alte Weibchen zum Vorpostendienst beordert werden, wenn sich die Herde an einem Lieblingsplatze zum Weiden anschickt. Namentlich Büsche, hinter denen sich Jäger heranschleichen und verstecken können, werden von diesen Wachen aufs sorgfältigste beobachtet. Es würde Narrheit sein, versichert dieser Beobachter, Windhunde nach ihnen zu Hetzen; denn nur, wenn man sie überrascht, ist einiger Erfolg zu erwarten: sonst ergreifen sie augenblicklich die Flucht und jagen in wahrhaft wundervollem Laufe dahin. Die Höhe und Weite ihrer Sprünge versetzt jedermann in Erstaunen; sie erheben sich mehr als drei Meter (?) über den Boden und springen sechs bis zehn Meter weit, gleichsam als ob sie den nachsetzenden Hund verspotten wollten.« Deshalb denken die indischen Fürsten auch nicht daran, sie mit Hunden zu jagen, beizen sie vielmehr mit Falken oder lassen sie vom schlauen Tschita oder Jagdleoparden fangen, wie dies in Persien gewöhnlich ist.
Die Äsung der zierlichen Tiere besteht in Gräsern und saftigen Kräutern. Wasser können sie auf lange Zeit entbehren.
Über die Fortpflanzung fehlen noch sichere Nachrichten. Es scheint, daß die Paarung nicht an eine bestimmte Zeit gebunden ist, sondern, je nach der Gegend, während des ganzen Jahres stattfindet. Neun Monate nach der Begattung wirft das Weibchen ein einziges, vollkommen ausgebildetes Junge, verbirgt es einige Tage lang im Gebüsch, säugt es mit Sorgfalt und bringt es dann zur Herde, bei der es verweilt, bis es die Eifersucht des Leitbocks vertreibt. Dann muß es in der Ferne sein Heil suchen und sehen, ob es sich andern Rudeln anschließen kann. Die Weibchen sind bereits im zweiten Jahre, die Männchen wenigstens im dritten fortpflanzungsfähig. Es scheint, daß mit der Begattung ein eigentümliches Erregtsein des Tränensackes in Verbindung steht. An Gefangenen hat man beobachtet, daß der ganze Hautbeutel unter dem Auge, die Tränengrube, die sonst nur als ein schmaler Schlitz erscheint, wenn das Tier gereizt wird, weit hervortritt und sich förmlich nach außen umstülpt. Die glatten Innenwände des Sackes sondern einen stark riechenden Stoff ab, der durch Reiben an Bäumen oder Steinen entleert wird und wahrscheinlich dazu dient, das andere Geschlecht auf die Spur zu leiten. Während der Brunftzeit vernimmt man auch die Stimme des Männchens, die sonst schweigt, eine Art von Meckern; das Weibchen gibt, sooft es erzürnt wird, blökende Laute von sich.
In Indien sind Tiger und Panther schlimme Feinde der Hirschziegenantilope. Die Inder stellen ihr ebenfalls eifrig nach und fangen sie auf sonderbare Weise lebendig. Hierzu bedient man sich eines zahmen Männchens, das man, nachdem man ihm einen mit mehreren Schlingen versehenen Strick um die Hörner gebunden hat, unter die wilde Herde laufen läßt. Sobald der fremde Bock dort anlangt, entspinnt sich zwischen ihm und dem Leitbock des Rudels ein Kampf, an dem bald auch Riken teilnehmen, und hierbei verwickeln sich gewöhnlich mehrere Stücke in den Schlingen des Strickes, reißen und zerren nach allen Richtungen hin und stürzen endlich vollständig wehrlos zu Boden.
Jung eingefangene Hirschziegenantilopen werden außerordentlich zahm. Sie dauern leicht in Gefangenschaft aus, vertragen sich bis gegen die Paarzeit hin mit ihresgleichen und erfreuen durch ihre Zutunlichkeit und Anhänglichkeit. Doch muß man sich hüten, sie zu necken oder zu foppen. Sind sie z. B. gewöhnt, Brot aus der Hand zu fressen, so richten sie sich, wenn man ihnen diese Lieblingsspeise hochhält, wie die zahmen Hirsche auf die Hinterbeine auf, um dieselbe zu erlangen; täuscht man sie auch dann noch, so werden sie böse, beginnen zu zittern und suchen ihren Unmut durch Stoßen mit den Hörnern an den Tag zu legen. Am besten halten sie sich, wenn man ihnen freien Spielraum gibt. In größeren Parken gewähren sie wegen ihrer außerordentlichen Anmut und Zierlichkeit ein prächtiges Schauspiel, werden hier auch viel zahmer als in den Käfigen, wo namentlich die Männchen manchmal ihren Wärter anfallen und nach ihm stoßen. In Indien wird die Hirschziegenantilope als ein heiliges Tier oft zahm gehalten. Frauen sind mit der Pflege des Halbgottes betraut und tränken ihn mit Milch; Musiker spielen ihm Tonstücke vor. Nur die Brahminen dürfen sein Fleisch genießen. Aus seinen Hörnern bereiten sich die Geistlichen und Heiligen der Hindu eigentümliche Waffen, indem sie dieselben unten durch eiserne oder silberne Querzapfen so befestigen, daß die Spitzen nach beiden Seiten voneinander abstehen. Diese Waffe trägt man wie einen Stock und gebraucht sie wie einen Wurfspieß.
Die Gazellen sind schlanke, höchst anmutige Antilopen mit geringelten, leierförmigen Hörnern, Tränengruben, Leistenbälgen, langen, spitzigen Ohren, kleinen Afterklauen und zwei Zitzen. Ihr Schwanz ist kurz und an der Spitze bequastet; anderweitige Haarbüschel stehen nur an der Handwurzel. Beide Geschlechter sind gehörnt.
Eine Gazelle in der Wüste ist ein so ansprechendes Bild, daß schon seit alten Zeiten die morgenländischen Dichter mit aller Glut ihrer Seele sie besungen haben. Selbst der Fremdling aus den Abendländern, der sie in ihrer Freiheit sieht, muß es verstehen, warum sie gerade den Morgenländern als ein so innig befreundetes Wesen erscheint; denn auch über ihn kommt ein Hauch jener Glut, die zu den feurigsten Lobliedern dieses Tieres die Worte läuterte und die Reime flüssig werden ließ. Das Auge, dessen Tiefe das Herz des Wüstensohnes erglühen und erblühen macht, vergleicht er mit jenem der Gazelle; den schlanken, Weißen Hals, um den sich seine Arme ketten in trauter Liebesstunde, weiß er nicht schmückender zu bezeichnen, als wenn er ihn dem Halse jenes Tieres gleichstellt. Der Fromme findet in der zierlichen Tochter der Wüste ein sinnlich wahrnehmbares Bild, um des Herzens Sehnsucht nach dem Erhabenen verständlich zu machen. Die Gazelle übt einen Zauber aus auf jedermann. Ihrer Anmut halber weihten sie die alten Ägypter der erhabenen Gottheit Isis und opferten die Kälber der Götterkönigin; ihre Schönheit muß dem Dichter des Hohen Liedes zum Bilde dienen; denn sie ist »das Reh« und »der junge Hirsch«, mit denen der Freund verglichen wird, das Reh oder die Hindin des Feldes, bei denen die Töchter Jerusalems beschworen werden. Für die schönsten Reize des Weibes nach morgenländischen Begriffen hat jener Dichter nur den einen Vergleich: sie sind ihm »wie zwei junge Rehzwillinge, die unter den Rosen werden.« Die arabischen Dichter aller Zeiten finden nicht Worte, sie zu schildern; die ältesten Werke dieses Volkes preisen sie, und die Minnesänger auf den Straßen rühmen sie noch heutigestags.
Die Gazelle ( Gazella dorcas) erreicht nicht ganz die Größe unseres Rehs, ist aber viel zarter und schlanker gebaut, auch schöner gezeichnet als dieses. Alte Böcke messen 1,1 Meter, mit dem Schwänze 1,3 Meter in der Länge und sind am Widerrist 60 Zentimeter hoch. Der Körper ist gedrungen, obwohl er der hohen Läufe wegen schmächtig erscheint; der Rücken schwach gewölbt, am Kreuz höher gestellt als am Widerrist, der Schwanz ziemlich lang, an der Spitze stark behaart. Die Beine sind außerordentlich zart, schlank und höchst zierlich behuft. Auf dem gestreckten Halse sitzt der mittellange Kopf, der hinten breit und hoch, nach vorn verschmälert und an der Schnauze schwach gerundet ist; die Ohren haben etwa drei Viertel der Kopfeslänge; die großen, feurigen und lebhaften Augen zeigen einen fast runden Stern; die Tränengruben sind von mittlerer Größe. Das Gehörn ist nach dem Geschlecht ziemlich verschieden. Der Bock trägt immer stärkere Hörner als die Rike, und die Wachstumsringe sind dort stets mehr ausgeprägt als hier. Bei beiden richten sich die Hörner nach auf- und rückwärts, wenden sich aber mit den Spitzen wieder nach vorn und etwas gegeneinander, so daß sie, von vorn betrachtet, an die Leier der Alten erinnern. Die vorherrschende Färbung ist ein sandfarbiges Gelb, das aber gegen den Rücken hin und auf den Läufen in ein mehr oder weniger dunkles Rotbraun übergeht. Ein noch dunklerer Streifen verläuft längs der beiden Leibesseiten und trennt die blendend weißgefärbte untere Seite von der dunkleren oberen. Der Kopf ist lichter als der Rücken, ein von den Augenwinkeln bis zur Oberlippe verlaufender Streifen braun, Nasenrücken, Kehle, Lippen, ein Ring um die Augen und ein Streifen zu beiden Seiten des Nasenrückens sind gelblichweiß, die Ohren gelblichgrau, schwarz gesäumt und mit drei Längsreihen ziemlich dicht aneinanderstehender Haare besetzt. Der Schwanz ist an seiner Wurzel dunkelbraun wie der Rücken, in seiner letzten Hälfte aber schwarz. Bei manchen Stücken zieht die Färbung mehr ins Graue und ähnelt dann sehr dem Kleide der persischen Gazelle, die, wie mehrere andere Ab- oder Spielarten, von einigen Forschern als besondere Art betrachtet wird.
Nordostafrika ist die Heimat der Gazelle. Sie reicht von der Berberei an bis nach dem steinigen Arabien und Syrien und von der Küste des Mittelmeeres bis in die Berge Abessiniens und in die Steppen des innern Afrika. Der ganze Wüstenzug und das ihn begrenzende Steppengebiet kann als ihre Heimat betrachtet werden; in den Gebirgen von Habesch steigt sie, laut Heuglin, höchstens bis zu 1500 Meter empor. Je pflanzenreicher die Einöde, um so häufiger findet man das Tier; jedoch muß hierbei festgehalten werden, daß eine pflanzenreiche Gegend nach afrikanischen Begriffen von einer gleichbezeichneten in unserm Klima sehr verschieden ist. Man würde sich irren, wenn man die Gazelle in wirklich fruchtbaren Talniederungen als ständigen Bewohner vermuten wollte; solche Strecken berührt sie nur flüchtig, ungezwungen wohl kaum. Sie zieht Niederungen den durchglühten Hochebenen vor, aber nur Niederungen der Wüste; in Flußtälern findet man sie ebenso selten wie auf dem Hochgebirge. Mimosenhaine und noch mehr jene sandigen Gegenden, in denen Hügelreihen mit Tälern abwechseln und die Mimosen überall sich finden, ohne eigentlich einen Hain oder Buschwald zu bilden, sind ihre Lieblingsplätze, weil die Mimose als ihre eigentliche Nährpflanze angesehen werden muß. In den Steppen kommt sie ebenfalls, und zwar an manchen Orten sehr häufig vor; allein auch hier bevorzugt sie dünnbestandene Buschgegenden dem wogenden Halmenwalde. In den Steppen Kordosans sieht man Rudel von vierzig bis fünfzig Stück, die, vielleicht nicht das ganze Jahr hindurch, ziemlich weit umherstreifen; an ihren Lieblingsplätzen gewahrt man sie jedoch nur in kleinen Trupps von zwei, drei bis acht Stück, sehr oft auch einzeln. Nahe der Mittelmeerküste ist sie selten. Je weiter man nach Nubien hin vordringt, um so häufiger wird sie; am gemeinsten dürfte sie in den zwischen dem Roten Meer und dem Nil gelegenen Wüsten und Steppen zu finden sein. Die schwachen Rudel sind gewöhnlich Familien, bestehend aus einem Bock mit seinem Tier und dem jungen Nachkommen, der bis zur nächsten Brunstzeit bei den Eltern verweilen darf. Ebenso häufig aber findet man auch Trupps, die nur aus Böcken, und zwar wohl aus solchen bestehen, die von den stärkeren abgetrieben wurden. Diese Junggesellen halten bis gegen die Brunstzeit hin treu zusammen.
Jeder Reisende, der auch nur auf einige Meilen hin die Wüste durchzieht, kann eine Gazelle zu sehen bekommen, und wer erst ihre Lebensweise kennt, findet sie mit Sicherheit in allen Teilen ihres Heimatkreises auf. Als Tagtier zeigt sie sich gerade zur günstigsten Zeit dem Auge. Nur während der größten Hitze des Tages, in den Mittagsstunden bis etwa vier Uhr abends, ruht sie gern wiederkäuend im Schatten einer Mimose; sonst ist sie fast immer in Bewegung. Aber man sieht sie nicht so leicht, als man glauben möchte; die Gleichförmigkeit ihres Kleides mit der herrschenden Bodenfärbung erschwert ihr Auffinden. Schon auf eine Achtelmeile hin entschwindet sie unserm schwächlichen Gesicht, während die Falkenaugen der Afrikaner sie oft in mehr als meilenweiter Entfernung noch wahrnehmen. Gewöhnlich steht der Trupp unmittelbar neben oder unter den niederen Mimosenbüschen, deren Kronen sich von unten aus schirmförmig nach oben ausbreiten und somit den Tieren unter ihnen ein schützendes Dach gewähren. Die wachhaltende Gazelle äst, die andern liegen wiederkäuend oder sonst sich ausruhend unweit von ihr. Nur die stehende fällt ins Auge, die liegende gleicht einem Stein der Wüste so außerordentlich, daß selbst der Jäger sich oft täuschen kann. Solange nicht etwas Ungewöhnliches geschieht, bleibt das Rudel auf der einmal gewählten Stelle und wechselt höchstens von einem Ort zu dem andern, hin- und herziehend; sowie es aber Verfolgungen erfährt, vertauscht es augenblicklich seinen Stand. Auch der Wind ist schon hinreichend, um die Gazelle zu solchem Wechsel zu bewegen. Sie steht stets unter dem Winde, am liebsten so, daß sie von dem Berghange aus die vor ihr liegende Ebene überschauen und durch den Luftzug von einer Gefahr im Rücken Kunde erhalten kann. Aufgestört flüchtet sie zunächst auf die Höhe des Hügels oder Berges, stellt sich auf dem Kamm auf und prüft nun sorgfältig die Gegend, um den geeignetsten Ort zur Sicherung zu erspähen.
Es läßt sich nicht verkennen, daß man in der Gazelle ein hoch begabtes Tier vor sich hat. Sie ist so bewegungsfähig wie irgendeine andere Antilope, dabei lebhaft, behend und überaus anmutig. Ihr Lauf ist außerordentlich leicht; sie scheint kaum den Boden zu berühren. Ein flüchtiges Rudel gewährt einen wahrhaft prachtvollen Anblick; selbst wenn die Gefahr ihm nahe kommt, scheint es noch mit seiner Befähigung zu spielen. Oft springt mit zierlichen Sätzen von ein bis zwei Meter Höhe eine Gazelle, gleichsam aus reinem Übermute, über die andere hinweg, und ebensooft sieht man sie über Steine und Büsche setzen, die ihr gerade im Wege liegen, aber sehr leicht umgangen werden könnten. Alle Sinne sind vortrefflich ausgebildet. Sie wittert ausgezeichnet, äugt scharf und vernimmt weit. Dabei ist sie klug, schlau und selbst listig, besitzt ein vortreffliches Gedächtnis und wird, wenn sie Erfahrung gesammelt hat, immer verständiger. Ihr Betragen hat viel Ansprechendes. Sie ist ein harmloses und etwas furchtsames Geschöpf, keineswegs aber so mutlos, als man gewöhnlich glaubt. Unter dem Rudel gibt es oft Streit und Kampf, wenn auch bloß unter den gleichgeschlechtigen Gliedern desselben, zumal unter Böcken, die gern zu Ehren der Schönheit einen Strauß ausfechten, während sie die Riken bis gegen die Brunftzeit hin mit Liebenswürdigkeit, ja mit Zärtlichkeit behandeln und Gleiches von diesen empfangen. Mit allen übrigen Tieren lebt die Gazelle in Frieden; deshalb sieht man sie auch gar nicht selten in Gesellschaft anderer, ihr nahestehender Antilopen.
Man kann nicht eben sagen, daß die Gazelle scheu wäre; aber sie ist vorsichtig und meidet jeden ihr auffallenden Gegenstand oder jedes ihr gefährlich scheinende Tier mit Sorgfalt. In Kordofan ritt ich einmal durch eine von der gewöhnlichen Straße abgelegene Gegend, die nur wenig bevölkert ist und ausgedehnte Graswälder besitzt. Hier sah ich während des einen Tages wohl zwanzig verschiedene, und zwar ausnahmslos sehr starke Rudel. Wahrscheinlich hatten diese Tiere das Feuergewehr noch nicht kennengelernt. Sie ließen mich bis auf etwa vierzig Schritt herankommen, ungefähr so weit, als ein Sudaner seine Lanze zu schleudern vermag. Dann zogen sie vertraut weiter, ohne mich groß zu beachten. Im Anfang fesselten mich die schönen Tiere so, daß ich nicht daran dachte, mein Gewehr auf sie zu richten. Aber die Jagdbegierde beseitigte bald jedes Bedenken. Ich feuerte auf den ersten besten Bock, der sich mir zur Zielscheibe bot, und schoß ihn zusammen. Die andern flüchteten, blieben aber schon nach hundert Schritten Entfernung stehen und trollten gemächlich weiter. Ich konnte mich von neuem bis auf achtzig Schritte nähern und erlegte den zweiten Bock, und schließlich schoß ich noch einen dritten aus demselben Rudel, bevor es eigentlich flüchtig wurde.
Die Verschiedenheit der klimatischen Verhältnisse Nordostafrikas bedingt auch eine sehr verschiedene Brunftzeit der Gazellen. Im Norden fällt sie etwa in die Monate August bis Oktober, in den Gleicherländern beginnt sie erst Ende Oktober und währt dann bis Ende Dezember. Die Böcke fordern einander mit laut blökendem Schrei zum Kampf auf und streiten sich so heftig, daß sie sich gegenseitig die Hörner abstoßen; ich habe viele von ihnen erlegt, bei denen die eine Stange an der Wurzel abgebrochen worden war. Von dem Tier vernimmt man nur ein sanftes, helles Mahnen. Der stärkste Bock wird natürlich von ihm bevorzugt, duldet auch keinen Nebenbuhler. Traulich zieht das Tier mit ihm hin und her und nimmt gern Liebkosungen von seiten des Herrn Gemahls entgegen. Dieser folgt seiner Schönen auf Schritt und Tritt nach, beriecht sie von allen Seiten, reibt den Kopf zart an ihrem Hals, beleckt ihr das Gesicht und sucht ihr überhaupt seine Liebe auf alle Weise zu erkennen zu geben. Im Norden setzt die Rike Ende Februar oder Anfang März, im Süden zwischen den Monaten März und Mai, also nach etwa fünf- oder sechsmonatiger Tragzeit, ein einziges Kalb. Zu Ende des März und im Anfange des April waren die meisten weiblichen Gazellen, die ich erlegte, hoch beschlagen, und manche trugen bereits ein sehr ausgebildetes Junge. Das zur Welt gekommene Kälbchen ist in den ersten Tagen seines Lebens ein verhältnismäßig unbehilfliches Geschöpf, und daher kommt es auch, daß viele junge Gazellen von den flinken Arabern und Abessiniern mit den Händen gefangen werden. Je hilfsbedürftiger das Tierchen ist, um so mehr wird es von der Mutter geliebt. Nicht allzu mächtigen Feinden geht sie mutig entgegen; so weiß sie einen etwa heranschleichenden Fuchs, der schlimme Absichten verraten sollte, mit den scharfen Hufen abzutreiben. Doch hat das junge Tier viele Gefahren auszustehen, ehe es so flüchtig wird, daß es mit den Eltern gleichen Schritt halten kann. Man dürfte schwerlich übertreiben, wenn man sagt, daß die Hälfte der Nachkommenschaft unserer Gazellen und anderer Schwächlinge ihrer Verwandtschaft den zahllosen Räubern, die sie beständig umlauern, zum Opfer fällt. Freilich würden sich die Gazellen ohne diese, das Gleichgewicht herstellenden Glieder der Tierwelt auch so vermehren, daß sie, wie im Süden Afrikas die Springböcke und andere in Herden lebende Antilopen, die niedere Pflanzenwelt so gut als vernichten könnten.
Jung ins Haus gebrachte Gazellen werden nach wenigen Tagen zahm, ertragen auch, zumal in ihrer Heimat, leicht und dauernd die Gefangenschaft. Die Schönheit der Augen dieser Tiere ist unter allen morgenländischen Völkern so vollständig anerkannt, daß schwangere Frauen Gazellen nur aus dem Grunde zu halten pflegen, um ihrer Frucht die Schönheit des Tieres einzuprägen. Oft setzen sie sich längere Zeit vor das Tier hin und sehen ihm in die schönen Augen, streichen ihm mit den Fingern über die weißen Zähne, berühren dann die ihrigen und sagen dabei verschiedene Sprüche her, denen sie noch besondere Kraft zutrauen. In den europäischen Häusern der größeren Städte Nord« und Ostafrikas sieht man regelmäßig gezähmte Gazellen, und unter ihnen findet man viele, die sich so an den Menschen gewöhnt haben, daß sie als echte Haustiere angesehen werden können. Sie folgen ihrem Herrn wie Hunde nach, kommen in die Zimmer herein, betteln bei Tisch um Nahrung, unternehmen Ausflüge in die benachbarten Felder oder in die Wüste und kehren, wenn der Abend kommt, oder wenn sie die Stimme ihres geliebten Pflegers vernehmen, gern und freudig wieder nach Hause zurück. Auch bei uns zulande kann man Gazellen jahrelang am Leben erhalten, falls man ihnen die nötige Pflege angedeihen läßt. Wie zu erwarten, müssen die höchst empfindlichen Kinder des Südens vor allen Einflüssen der rauhen Witterung sorgfältig behütet werden; ein warmer Stall für den Winter und eine größere Parkanlage für den Sommer sind deshalb zu ihrem Wohlbefinden unentbehrlich. Ein Rudel Gazellen verleiht jedem größern Garten oder Park eine Zierde, die schwerlich von einer andern übertroffen werden kann. Das schmucke Reh erscheint der Gazelle gegenüber plump und schwerfällig; steht ihr ja doch fast jeder andere Wiederkäuer an Anmut und Lieblichkeit nach! Zahme Gazellen zeigen sich auch gegen fremde Leute sanft und zutraulich; nur die Böcke gebrauchen bisweilen ihr Gehörn, doch immer mehr, um zu spielen, als in der Absicht zu verletzen. Heu, Brot und Gerste, im Sommer Klee und anderes Grünzeug genügen zur Ernährung der Gefangenen; sehr gut bekommt ihnen auch ein Kleientrank, wie ihn Ziegen erhalten. Wasser bedürfen sie nur sehr wenig, täglich ein mittelgroßes Glas voll befriedigt ihren Durst vollständig. Dagegen verlangen sie Salz, das sie begierig auflecken.
Überall, wo man solche gefangene Gazellen gut hält, schreiten sie zur Fortpflanzung, im Süden natürlich leichter als in unserem rauhen Norden. In Kairo hat eine Gazelle fünf Jahre nacheinander je ein wohlgebildetes Junge zur Welt gebracht und glücklich aufgezogen; in unfern Tiergärten gehören derartige Vorkommnisse eben auch nicht zu den Seltenheiten.
Die Gazelle bildet in ihrer Heimat einen Gegenstand der eifrigsten, ja der leidenschaftlichsten Jagd. Alle Völkerschaften, die mit ihr denselben Wohnkreis teilen, wetteifern miteinander in Ausübung dieses herrlichen Vergnügens. Der edle Perser und der vornehme Türke jagen die Gazelle mit derselben Lust wie der Beduinenhäuptling und der Sudaner. Im Norden Afrikas bildet das Feuergewehr die Hauptwaffe; in Persien und im Herzen der Wüste, auch schon in Ägypten, beizt man das Wild mit Falken oder hetzt es mit Windhunden zu Tode. Ich habe in Ägypten oft genug die hohen Herren mit dem Falken auf der Faust zur Gazellenbeize hinausreiten sehen, zufällig aber niemals Gelegenheit gehabt, derselben beizuwohnen, und muß mich daher, um solche Jagd zu schildern, auf die Mitteilungen Heuglins und Sponys stützen. Die Edelfalken, die man im Norden abzutragen versucht, sind der Wander-, Würg- und Rotnackenfalke. Um sie auf Gazellen abzurichten, wirft man sie, nachdem sie einigermaßen gezähmt worden sind, gefesselt auf eine ausgestopfte Gazelle, deren Augenhöhlen mit Fleisch gefüllt wurden. Die Entfernung, in der sich der Wärter von der Gazelle stellt, wird täglich etwas vergrößert, bis der Jagdfalke sich gewöhnt hat, diese auf weithin zu suchen. Nachdem er von dem in den Augenhöhlen aufgespeicherten Fleische geäst hat, wird er wieder zurückgenommen und jedesmal auf der Hand gekröpft. Nach und nach befreit man ihn von allen Fesseln und sucht ihn dahin zu bringen, daß er auf den Ruf zu dem Falkner zurückkehrt. Das Schwierigste der Lehre besteht darin, daß er auch auf lebende Gazellen stößt. Zu diesem Zweck versucht man ihn zuerst an eingefangenen Jungen; hat man solche nicht, so werden sie in der Wüste ausgesucht, womöglich von der alten Nike getrennt und durch eine längere Jagd ermüdet; alsdann häubelt man den Falken ab und wirft ihn auf das junge Tier. So lernt er nach und nach auch auf ältere Gazellen stoßen, und wenn er erst einmal Kämpfe mit solchen bestanden hat, ist er zur Jagd geeignet.
Die Gazellenbeize erfordert eine große Anzahl von Menschen, Pferden, Hunden und Falken, ist also sehr kostspielig und wird daher nur von den Großen des Reiches betrieben. Halim Pascha richtete, laut Spony, in der letzten Zeit jährlich wenigstens fünfzehn Pferde und dreißig Hunde dabei zu Grunde. Vor der Jagd wird die erwählte Örtlichkeit, die erfahrungsmäßig Gazellen beherbergt, durch mehrere Tage genau untersucht und der zeitweilige Wechsel des Lagerplatzes des Wildes sorgfältig erkundet. Noch im Dunkel der Nacht zieht man im tiefsten Schweigen zur Wüste hinaus und dem Jagdplatze zu, der schon vorher von den Jägern umstellt worden ist. Hier gewahrt man einen Falkner zu Pferde mit dem Stoßvogel auf der Faust und dem Hunde an der Leine, dort einen andern zu Fuß mit einem Falken auf der Faust, einem zweiten auf der Schulter, einem dritten vielleicht noch auf dem Kopf; hinter ihm schreiten die Hundejungen mit einer Meute gefesselter Windspiele. Außerdem befinden sich mit Wasser und Lebensmitteln beladene Kamele zur Stelle. Den Vortrupp bilden die Jäger, vollkommen fährtegerechte, mit allen zur Jagd erforderlichen Kenntnissen ausgerüstete Leute, denen das Amt obliegt, von den sich findenden Erhöhungen aus das Wild zu erkunden, durch Zeichen die Richtung, wo solches steht, anzugeben und unter Berücksichtigung der Windrichtung die Jäger anzuweisen, wie sie reiten sollen. Langsam und still, soviel wie möglich gegen den Wind, nähert man sich nun einem Rudel Gazellen, indem man alle vorhandenen Bodenverhältnisse weidmännisch benutzt. In geeigneter Entfernung läßt man einen erprobten Falken abhäubeln und wirft ihn, sobald er die Gazelle eräugt hat. Der Falke erhebt sich hoch in die Luft und eilt in pfeilschnellem Flug auf die Gazelle zu, stürzt sich von oben herab auf sie und versucht, in der Augengegend die Fänge einzuschlagen. Das überraschte Wild ist bemüht, durch Rütteln und Überschlagen sich des Raubvogels zu entledigen, während dieser nötigenfalls den Kopf des Opfers verläßt, um ihn sofort wieder von neuem zu packen. Obgleich die Hunde bis dahin von den Gazellen noch nichts gesehen haben, wissen sie doch erfahrungsgemäß, daß die Jagd mit dem Enthauben des Falken beginnt, werden hitzig, zerren an den Leinen und lassen sich nicht mehr halten. Abgekoppelt folgen sie sogleich dem Falken, den sie fest im Auge behalten, und hinter ihnen drein jagen nun im vollsten Laufe die Jäger. Wenn der Falke gut ist, hält er jede nicht allzu große Antilope auf, bis die Hunde herangekommen sind und sie niederreißen. Für die Beteiligten ist die Jagd entzückend. Jedesmal, wenn der Falke die flüchtige Gazelle überholt, sie stößt und die Fänge in Hals und Kopf zu schlagen versucht, ertönt ein Freudengeschrei aus allen Kehlen; wenn ein guter Falke sich von der Gazelle, in deren Hals er seine Fänge eingeschlagen hat, eine längere Strecke mit fortschleppen läßt, vernimmt man von allen beteiligten Jägern die lautesten Beifallszeichen. Wird das Wild von den Windspielen ereilt und niedergerissen, so bilden Hunde und Gazellen dann nur eine für das Auge unentwirrbare Masse, und nunmehr ist es Zeit, daß wenigstens einer der Jäger auf der Walstatt anlangt. Er bemächtigt sich des Falken, gibt dem lebenden Wilde den Gnadenstoß, treibt die Hunde weg und kröpft den Falken.
Ich habe die Gazellenjagd nur mit der Büchse betrieben und mehr als einmal an einem Tage sechs Stück erlegt, auch wenn ich es mit schon gewitzigten zu tun hatte. Der Pirschgang führt unbedingt am sichersten zum Ziel. Auf meiner letzten Reise in Habesch hatte ich Gelegenheit genug, Gazellen zu jagen, obgleich ich eigentlich niemals vom Wege abging. Wenn wir, mein Begleiter van Arkel und ich, einen Trupp stehen sahen, ritten wir, höchstens mit einer geringen Abweichung, ruhig unseres Weges weiter und so nahe, als es uns passend erschien, an die Gazellen heran. Dann sprang einer von uns hinter einem Busch vom Maultiere, übergab dieses dem begleitenden Diener und schlich nun, oft kriechend, mit sorgfältigster Beobachtung des Windes an das Wild heran. Der andere zog seines Weges fort, weil wir sehr bald erfahren hatten, daß die Gazelle auf Reiter weit weniger achtet als auf Fußgänger, und ebenso auch, daß sie augenblicklich davongeht, wenn ein Reiterzug plötzlich haltmacht. Gewöhnlich schaute das Leittier des betreffenden Rudels neugierig den Dahinziehenden nach und vergaß dabei, die übrige Umgebung prüfend zu beobachten. Der Jagende benutzte seine Zeit so gut als möglich und konnte auch in den meisten Fällen von einem der dichteren Büsche aus einen glücklichen Schuß tun, in der Regel nicht weiter als auf neunzig bis hundertfünfzig Schritte. Die überlebenden Gazellen eilten nach dem Schuß so schnell als möglich davon, am liebsten dem nächsten Hügel zu, an dem sie bis zu dem Gipfel eilfertig hinaufkletterten. Dort aber blieben sie stehen, gerade als wollten sie sich genau von dem Vorgegangenen überzeugen, und mehr als einmal ist es uns gelungen, uns selbst bis an diese, dort wie Schildwachen aufgestellten Tiere mit Erfolg heranzuschleichen. Doch kam es auch vor, daß das Wild rührende Beweise seiner Anhänglichkeit an den Gefährten gab. Zweimal in wenigen Jagdtagen habe ich zwei Gazellen von einem Busche aus erlegt. Auf den ersten Schuß blieb eine Gazelle, gleichsam starr vor Schrecken, neben dem verendenden Genossen stehen, ließ von Zeit zu Zeit ein ängstliches Blöken vernehmen und ging im Kreise um den Gefallenen herum, ihn mit sichtlicher Angst betrachtend. Da wurde rasch die Büchse wieder geladen und noch eine zweite tödliche Kugel entsandt. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich nur das eine Mal ein Paar aus diese Weise erlegte, die zweiten, die ich nacheinander zusammenschoß, waren Böcke; aber sie zeigten nicht geringere Anhänglichkeit aneinander als jene, bei denen die Gattenliebe ins Spiel kam. An einigen Orten beleben sich nach und nach die höheren Hügel mit Gazellen, die, durch unsere Schüsse erschreckt, von allen Seiten herbeikamen, um von ihrer Warte aus die Gegend zu überschauen. Ich darf wohl behaupten, daß die meist unbewachsenen Berge hierdurch einen wunderbaren Schmuck erhielten. Die schönen Gestalten zeichneten sich so klar gegen den tiefblauen Himmel ab, daß man auch auf große Entfernung hin jedes Glied deutlich wahrnehmen konnte. Oft kam es auch vor, daß die erschreckten Gazellen über einen der unzähligen niederen Hügel, an denen die Sahara so reich ist, weggingen und gleich hinter denselben, d. h. sobald sie den Jäger aus dem Auge verloren hatten, stehenblieben. Im Anfange foppten sie mich einige Male durch dieses sonderbare Betragen. Ich kletterte höchst behutsam an dem Hügel empor und suchte mein Wild in der Entfernung, während es doch dicht unter mir stand. Das Herabrollen eines Steines oder ein anderes Geräusch, das ich verursachte, schreckte dann die Gazellen auf, und sie eilten jetzt in solch rasender Flucht dahin, daß die Fehlschüsse, die ich mir zuschulden kommen ließ, wohl verzeihlich erscheinen dürften. Niemals aber sah ich von Menschen verfolgte Gazellen in ihrer wahren Schnelligkeit; denn diese nehmen sie bloß an, wenn ihnen ein Hund auf den Fersen ist. Ich vermag es nicht, das Schauspiel zu beschreiben, das die beiden Tiere gewähren; ich könnte höchstens sagen, daß eine so dahineilende Gazelle nicht mehr zu laufen, sondern zu fliegen scheint; aber damit hätte ich ihre Flüchtigkeit noch immer nicht geschildert!
Großartige Treibjagden werden zeitweilig von den Beduinenstämmen angestellt und dabei unter günstigen Umständen Hunderte von Gazellen mit einem Male getötet. In den an Antilopen reichen Wüstenstrecken sieht man hier und da aus Steinen aufgeschichtete Mauern von Mannshöhe und darüber, die in auseinandergehender Richtung auf weithin durch die Wüste geführt wurden, derartig, daß sie an dem einen Ende mindestens auf eine halbe Meile voneinander entfernt sind, während sie an dem andern in einen ringsumschlossenen hofartigen Raum übergehen. Zur Zeit nun, wenn viele Antilopen in der Nähe dieser Mauern stehen, macht sich der Beduinenstamm zur Jagd auf, umreitet in weitem Bogen das Wild und sucht es der Einhegung zuzutreiben. Nicht immer, wohl aber in den meisten Fällen, gelingt die Absicht vollkommen, und wenn die Gazellen erst einmal zwischen die Mauern geraten sind, bleibt ihnen kein Ausweg mehr übrig, denn in der Angst versuchen sie kaum, über die Mauern wegzuspringen. Endlich erfüllen sie den geschlossenen Raum, und nunmehr beginnt ein abscheuliches, durchaus unweidmännisches Abschlachten des edlen Wildes unter Triumphgeschrei der Beteiligten.
Außer den Menschen stellen der erwachsenen Gazelle wenige Feinde nach, vor allem Leopard und Jagdpanther, Hyänenhunde, Schakalwölfe und andere Windhunde und vielleicht noch ein und der andere Adler.
Mit den Gazellen haben die Springantilopen große Ähnlichkeit, unterscheiden sich jedoch durch ein wesentliches, einzig und allein ihnen zukommendes Merkmal von den genannten und allen übrigen Verwandten. Längs des Rückens nämlich, etwa von der Mitte desselben beginnend, verläuft eine durch Verdopplung der Oberhaut gebildete, mit sehr langen Haaren ausgekleidete Falte, die bei ruhigem Gang der Tiere geschlossen ist, bei heftiger Bewegung, insbesondere beim Springen, aber entfaltet wird. Der einzige Vertreter dieser Gruppe ist der Springbock ( Antilope Euchore), eine wundervolle Antilope von anderthalb Meter Länge, wovon 20 Zentimeter auf den Schwanz gerechnet werden müssen, und 85 Zentimeter Schulterhöhe. Die Färbung ist ein lebhaftes, dunkles Zimmetgelb; ein Streifen, der von der Wurzel der Hörner durch die Augen und gegen die Nase verläuft, und ein breiter anderer, der sich längs der Seite zwischen den Oberarm und Oberschenkel erstreckt, sind nußbraun, alle übrigen Teile weiß, und deshalb hat Lichtenstein so unrecht nicht, wenn er die Hauptfärbung des Tieres schneeweiß nennt und bemerkt, daß sich von den Schultern bis zu den Keulen zu beiden Seiten des Rückens ein breiter, isabellfarbiger, unten kastanienbraun gesäumter Streifen hinzieht. Die schwarzen Hörner erreichen, der Krümmung nach gemessen, eine Länge von 30 bis 40 Zentimeter und zeigen ungefähr zwanzig vollständige Ringe, sind jedoch an der Spitze glatt. Die schneeweißen Haare, die die Rückenfalte auskleiden, haben eine Länge von 20 bis 26 Zentimeter. Das Weibchen gleicht in der Färbung dem Männchen vollständig, ist jedoch kleiner und sein Gehörn weit schwächer, demgemäß auch minder stark gebogen; sein Euter hat zwei Zitzen.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Ansiedelung am Vorgebirge der Guten Hoffnung bis jenseits des Gleichers, möglicherweise noch weiter nach Norden hin, da einzelne Reisende das Tier sogar in den Steppen von Westkordofan beobachtet haben wollen. Im Kaplande, insbesondere in der Karu, überhaupt in den nördlichen Teilen der Ansiedlung, kommt der Springbock noch regelmäßig, in einzelnen Jahren in ungeheuren Scharen vor, obgleich sein eigentliches Wohngebiet mehr im Innern Südafrikas zu suchen ist. Im Norden des Kaplandes liegen ausgedehnte, quellenlose Ebenen, in denen der Mensch nur während der Regenzeit wohnen kann. Am Ende der letzteren bleiben noch Tümpel schlechten Wassers übrig, die dem Wilde genügen. Diese Einöden, wahre Wüsten, sind die eigentliche Heimat der Springböcke. Hier leben sie unter regelrechten Verhältnissen in kleinen oder größeren Trupps; hier ernähren sie sich von den wenigen, aber saftigen und würzigen Pflanzen, die der arme Boden hervorbringt; hier pflanzen sie sich fort; hier vermehren sie sich zu Hunderttausenden und aber Hunderttausenden, das unendlich weite Gebiet förmlich erfüllend. Wenn nun, wie es etwa alle vier oder fünf Jahre geschieht, anhaltende Dürre eintritt und die Tümpel austrocknen, treibt der Mangel die Millionen Tiere südwärts nach dem Kaplande, und hier brechen sie ein, alles verheerend und vernichtend, was grün ist. Erst wenn es wieder regnet und das verbrannte Land sich von neuem mit Pflanzen bedeckt, ziehen sie in ihre friedlichen Ebenen zurück. Tausende und aber Tausende vereinigen sich zu diesen sonderbaren Pilgerschaften oder »Treckbocken«, wie die holländischen Boers sie nennen, und die Schwärme wachsen an wie die der Heuschrecken.
»Jeder Reisende«, sagt Kapitän Gordon Cumming, »der die ungeheuren Massen, in denen der Springbock bei seinen Wanderungen erscheint, gesehen hat, wie ich, und von dem, was er gesehen, eine wahrhafte und getreue Beschreibung gibt, muß fürchten, Unglauben zu ernten, so wunderbar ist der Anblick der wandernden Herde. Treffend und richtig hat man sie mit den verheerenden Heuschreckenschwärmen verglichen, die dem Wanderer in diesem Lande der Wunder so gut bekannt sind; ebenso wie diese verzehren sie in wenigen Stunden alles Grün auf ihrem Wege und vernichten in einer einzigen Nacht die Frucht langjährigen Fleißes eines Landwirtes.
Am 28. Dezember hatte ich die Freude, zum erstenmal einen Treckbock zu sehen. Es war dieses, glaube ich, in bezug auf Jagdtiere das großartigste, gewaltigste Schauspiel, das ich jemals gehabt habe. Seit ungefähr zwei Stunden vor Tagesanbruch hatte ich wach in meinem Wagen gelegen und auf das Grunzen der Böcke gehört, die ich in einer Entfernung von ungefähr zweihundert Schritten wahrnahm. Ich glaubte, daß irgendeine große Herde von Springböcken neben meinem Lager grase; als es aber hell geworden und ich aufwachte, sah ich die ganze Ebene buchstäblich mit einer ungeheuren Menge dieser Tiere bedeckt. Sie zogen langsam hin und her. Von einer Öffnung in der langen Hügelreihe gegen Westen, durch die sie wie das Wasser eines großen Flusses zu strömen schienen, erstreckten sie sich bis an eine Anhöhe, ungefähr eine Meile nordöstlich, hinter der sie verschwanden. Ich stand beinahe zwei Stunden auf dem Vorderkasten meines Wagens, verloren in Erstaunen über den wundervollen Anblick, und es kostete mir einige Mühe, mich zu überzeugen, daß es Wirklichkeit war, was ich hier sah, und nicht etwa das abenteuerliche Traumbild eines Jägers. Während dieser Zeit strömten die unzählbaren Massen ohne Ende durch jene Hügelöffnung hindurch. Diese Herde von Springböcken wurde noch bei weitem von der übertroffen, die ich abends erblicken sollte. Denn als wir die niedere Hügelkette, durch deren Paß die Springböcke geströmt waren, überstiegen hatten, sah ich die Ebene und sogar die Hügelabhänge, die sich ringsum hinzogen, dicht, nicht mit Herden, sondern mit einer einzigen Masse von Springböcken bedeckt. Soweit das Auge reichte, wimmelte die Landschaft von ihnen, bis sie endlich in ein undeutliches Wirrsal lebendiger Geschöpfe verschwammen. Es wäre vergebliche Mühe gewesen, die Anzahl der Antilopen, die ich an diesem Tage sah, zu schätzen; doch nehme ich nichtsdestoweniger keinen Anstand zu behaupten, daß einige hunderttausende sich innerhalb meines Gesichtskreises befanden.« Wir könnten versucht sein, diese lebendige Schilderung des bekannten afrikanischen Jägers für eine echte Jagdgeschichte zu halten, wenn nicht alle Reisenden die Wahrheit jener Angaben bestätigten. Auch Le Vaillant spricht von Herden von zehn- bis fünfzigtausend Stück, die von Löwen, Leoparden, Luchsen und Hyänen verfolgt werden, und Eduard Kretschmar erzählt von Massen, die er nach Millionen schätzt.
Die Richtung, die die wandernden Antilopen einschlagen, ist nicht immer dieselbe. Gewöhnlich kehren sie auch aus einem andern Wege zurück als auf dem, den sie gezogen waren. Ihre Weglinie bildet deshalb gewöhnlich ein ungeheures langgezogenes Eirund oder ein großes Viereck, dessen Durchmesser vielleicht einige hundert Meilen beträgt. Diese Bahn wird von den Tieren in einer Zeit von sechs Monaten bis zu einem Jahre durchzogen. Wunderbar ist der Zusammenhalt einer so sich bewegenden Herde. Harris erzählt, daß eine Schafherde, die einmal zufällig unter die wandernden Springböcke gekommen war, gezwungen wurde, mit diesen zu laufen, wohin sie gingen, ohne daß der Hirt vermochte, seine Schutzbefohlenen wieder zu befreien. Selbst der mächtige Löwe, der diesen Antilopen eifrig nachstellt, soll manchmal von den Herden geradezu gefangen werden. So groß auch der Schrecken sein mag, den das Raubtier den wehrlosen Wiederkäuern bereitet: diejenigen, die den Schrecken empfinden, sind nicht imstande, dem Andrängen der andern, die von dem fürchterlichen Räuber nichts wissen, zu widerstehen, und der Löwe seinerseits muß wohl oder übel mit der Masse fortwandern, weil er sich durch die lebenden Haufen, die jeden Augenblick wechseln und sich neu ersetzen, unmöglich einen Ausgang bahnen kann. Die Angabe klingt sehr sonderbar, scheint jedoch nicht gänzlich unwahrscheinlich zu sein. Die Nachzügler des Heeres freilich können den zahllosen hungrigen Feinden, die diesen Zügen folgen, nicht widerstehen; aber alle die Löwen, Leoparden, die Hunderte von Hyänen und Schakalen, die die Herde umschwärmen, die Tausende von Geiern, die in den Lüften über ihr kreisen, brauchen sich auch nicht eben anzustrengen; denn von den Hunderttausenden der wandernden Antilopen gehen täglich so viele an Nahrungsmangel zugrunde, daß alle Räuber genug zu fressen haben.
Noch wird erwähnt, daß beständig der Vor- und Nachtrab wechselt. Diejenigen, die den Haufen anführen, finden selbstverständlich mehr Nahrung als die, die da weiden wollen, wo schon Tausende vor ihnen sich gesättigt haben; jene erwerben sich also ihr tägliches Brot mit leichter Mühe und werden feist und faul. Damit aber ist ihre gute Zeit auch vorbei; denn jetzt drängen sich die Hungrigen mit Macht hervor, und mehr und mehr bleiben die Gemästeten zurück, bis sie an das Ende des Zuges gelangen. Einige Tage der Reise und des Mangels spornen sie dann wieder an, ihre Stelle im Vortrab sich von neuem zu erobern, und so findet ewig ein Hin- und Herwogen in der gesamten Herde statt.
Der Springbock hat von den Ansiedlern seinen Namen mit Recht erhalten. Verfolgt flüchtet die von ihm gebildete Herde und macht eine Reihe seltsamer, senkrechter Sprünge, indem sich einer nach dem andern mit gekrümmten Läufen hoch in die Lüfte erhebt und gleichzeitig das schneeweiße und lange Haarkleid längs des Rückens flattern läßt, hierdurch ein wahrhaft feenhaftes Aussehen erlangend, das diese Antilope von jeder andern unterscheidet. Sie springen zuweilen über zwei Meter hoch und mit jedem Sprunge über vier bis fünf Meter weit, ohne daß es ihnen die geringste Anstrengung zu kosten scheint. Vor dem Sprunge beugen sie den Kopf nieder gegen die Vorderläufe, schnellen sodann mit allen vier Läufen zugleich auf, erheben sich mit stark gebogenem Rücken bis zu der angegebenen Höhe, gewöhnlich jedoch minder hoch, und breiten, während sie emporsteigen, fächerförmig ihre Hautfalte aus. Einen Augenblick lang scheinen sie gleichsam in der Luft zu schweben, kommen sodann mit allen vier Füßen zugleich herunter, fallen auf den Boden und steigen wieder in die Höhe, als ob sie davonfliegen wollten. So bewegen sie sich nur einige hundert Schritte weit, nehmen dann einen leichten federnden Trab an und neigen ihren schön geformten Hals und die Nase auf den Boden. Wenn sie einen Feind erblicken, machen sie plötzlich halt, drehen sich herum und fassen den Gegenstand ihres Schreckens ins Auge. Kommen sie an einen Weg oder an eine Fahrstraße, die vor kurzem von Menschen betreten wurde, oder kreuzen sie einen Pfad, auf dem ein ihnen furchtbares Raubtier wandelte, so springen sie mit einem einzigen Satze darüber hinweg, und wenn eine Herde von vielleicht vielen Tausenden einen derartigen Weg verfolgt, gewährt sie einen überaus schönen Anblick, weil jeder einzelne Bock denselben kühnen Sprung tut.
Obwohl der Springbock häufig eigene Herden bildet, trifft man ihn doch gewöhnlich in Gesellschaft von Gnus, Bläßböcken, Quaggas und Straußen an. Flüchtig wie der Wind und seiner Schnelligkeit sich vollkommen bewußt, schlendert er, laut Harris, in jenen bunten Herden anscheinend äußerst sorglos umher, nähert sich gelegentlich mit emporgehobenem Halse einer gefallsüchtigen Rike seiner Art und öffnet dann und wann seine Rückenfalte, so daß das hervortretende weiße Haar mit einem Male eine vollständige Umwandlung seines Äußern hervorbringt, da hierbei die braune Färbung fast gänzlich verschwindet. Niemals aber setzt er bei derartigen Spielen seine Sicherheit aus dem Auge. Wachsamer als irgendeine andere Antilope, gibt er stets zuerst das Zeichen zur Flucht und leitet dann die sich zurückziehende Herde. Beim Erscheinen eines fremden Gegenstandes spitzt er das Gehör, erhebt sein Haupt, trottet ungeduldig ein wenig vor, um sich zu überzeugen, ob das Gesehene wohl feindlich sein möge, biegt im bejahenden Falle den Kopf zum Boden und beginnt nun, wie die Ansiedler sagen, zu prunken, d. h. in der eben beschriebenen Weise emporzuspringen und dabei seine volle Schönheit zu entfalten. Auch Harris versichert, daß das Tier, einmal flüchtig geworden, sich bis zu drei Meter über den Boden erhebe und bis fünf Meter weite Sätze ausführen kann.
Die Kalaharikaffern, denen diese wandernden Herden Nahrung in Hülle und Fülle bringen und eine Reihe von Festtagen gewähren, zünden der Springböcke wegen vor der Regenzeit weite Strecken der Steppe an, damit hier um so leichter ein frisch grüner Teppich von saftigem Grase, den Böcken zum höchst willkommenen Weideplatze, über den verbrannten Boden sich legen möge. Selten gewahrt man diese in dem hohen, schilfartigen Grase, das so große Strecken ihrer Heimat überzieht. Sie sind entschiedene Liebhaber der zartesten Pflanzen und kommen zu solchen frischgrünen Orten von weither herbeigezogen, dem Menschen reiche Beute versprechend.
Jung aufgezogene Springböcke werden bald zahm. Diejenigen, die ich sah und pflegte, waren scheu und vorsichtig Fremden gegenüber, zeigten sich aber mutwillig, wenn sie es mit Bekannten zu tun hatten. Mehrere zusammen in einem Raume vertragen sich nicht immer; zumal die Böcke zeigen sich als zänkische Gesellen, die selbst die Riken quälen oder mindestens plagen. Abgesehen von dieser Unfriedfertigkeit sind die gefangenen Springböcke reizende Erscheinungen. Ihr weiches, farbenprächtiges Kleid, ihre anmutige Gestalt und die Zierlichkeit ihrer Bewegungen fesseln auch dann noch jedermann, wenn die Tiere im engen Raume des Geheges eigentlich gar nicht zur Geltung kommen. Leider gelangen wenige von ihnen lebend zu uns. Die lange Seereise raubt mehr als die Hälfte von denen, die am Kap eingeschifft werden; das Klima und mehr noch die so vielen Antilopen entsetzliche Enge des Aufenthaltsortes, den man ihnen anweisen kann, wird den übrig gebliebenen oft verderblich. Bei weitem die meisten von allen, die in Tiergärten zugrunde gehen, verlieren ihr Leben durch eigene Schuld. Ohne erklärliche Ursache stürmen sie manchmal gegen die Gitter an und brechen sich die Läuse oder verletzen sich anderweitig, so daß sie plötzlich tot zusammenbrechen.
*
Auf die Gazellen mögen die Kuhantilopen ( Bubalis) folgen, da sie gewissermaßen Übergangsmitglieder von jenen zu den schweren Formen der Familie bilden. Die schon den Alten bekannte Steppenkuhantilope, Tetel der Araber, Tori und Tora der Abessinier ( Bubalis bosalaphus), erreicht fast Hirschgröße, nämlich eine Länge von 2,8 Meter, wovon der Schwanz beinahe einen halben Meter wegnimmt, und reichlich 1,5 Meter Höhe am Widerrist. Die starken, hoch oben am Scheitel aufgesetzten, in den unteren zwei Dritteilen mit schraubenförmigen Wülsten versehenen Hörner entspringen dicht beieinander, beugen sich anfangs in einem sanften, aufrechten Bogen etwas aufwärts, sodann mit einer stärkeren Schwingung nach hinten, um endlich mit aufwärts gerichteten, stumpfen Spitzen zu enden. Das glatte Haar ist gleichmäßig lichtrotbraun, die dicke Schwanzquaste schwarzbraun gefärbt.
Von der Steppenkuhantilope unterscheidet sich die südafrikanische Kama, das Hartebeest, zu deutsch Hirschkuhantilope, der Ansiedler ( Bubalis caama) durch ihren noch mehr verlängerten und schmäleren Kopf und die stärkeren, in schärferen Winkeln gebogenen Hörner, die verhältnismäßig kleineren Ohren und die Färbung. Das an der Wurzel sehr starke, kurze Gehörn, das ungefähr sechzehn Knoten zeigt, steigt anfangs nebeneinandergehend aufwärts, zieht sich sodann in gleichlaufender Richtung etwas nach vorn und biegt sich im letzten Dritteil mit der scharfen Spitze wieder auswärts und fast rechtwinklig nach rückwärts. Auch bei dieser Antilope ist die vorherrschende Färbung ein schönes, lichtes Zimtbraun; die Stirn und die Vorderseite des Kopfes sind dunkelbraun, zwei Längsstreifen, die auf den Unterschenkeln der Vorder- und Hinterläufe beginnen und sich verschmälert auf der Vorderseite der Fußwurzel herabziehen, sowie die Schwanzquaste schwarz, ein brillenartiger Fleck um das Auge, Unterbrust, Bauch, Innenseite der Hinterschenkel und ein breiter, halbmondförmig in den Schenkel eingreifender Spiegel endlich weiß.
Alle diese Antilopen geben sich auch in bezug auf Lebensweise, Wesen und Betragen als nahe Verwandte zu erkennen. Der Buntbock ( Bubalis pygarga), wohl die schönste Art der Gruppe, bevölkert mit seinem nächsten Verwandten, dem Bläßbock ( Bubalis albifrons), in sehr zahlreichen Herden die Hochebenen des inneren Südafrika, von hier aus bis zum Gleicher und vielleicht noch weiter nördlich sich verbreitend und Steppengelände mit stehenden Gewässern allen übrigen Örtlichkeiten vorziehend. Da, wo der weiße Mann mit seinen vernichtenden Geschossen sich nur selten zeigt, sieht man, laut Harris, Hunderte und aber Hunderte dieser Antilopen, zu mehr oder minder zahlreichen Herden geschart, in der Nachbarschaft solcher Lachen sich umhertreiben, das ausblühende Salz begierig lecken, zu bestimmten Zeiten zur Tränke kommen und dann wiederum auf der weiten Steppe sich verteilen, um hier zu äsen. In früheren Zeiten bewohnte die schöne Antilope auch das Kapland, und zwar in kaum geringerer Anzahl als der Springbock; die Schlächtereien aber, in die die ungezügelte Jagd- oder richtiger Mordlust der Bauern ausartete, haben sie ausgerottet, und es bedurfte des Eingreifens der Regierung, die eine Strafe von fünfhundert Reichsdollars auf das Töten eines Buntbocks setzte, um sie in dem einzigen Gebiet von Zwellendam zu erhalten. Dem Bläßbock würde unzweifelhaft bereits dasselbe Schicksal beschieden sein, läge der Mittelpunkt seines Verbreitungsgebiets nicht weiter im Norden als der seines Verwandten. Über die Senegalantilope ( Bubalis senegalensis) haben wir erst durch Heuglin nähere Nachrichten erhalten. Lange Zeit kannte man nichts weiter als Schädel und Gehörn dieses schönen Tieres, das neuerdings dann und wann auch lebend nach Europa gelangt. Im Innern Afrikas bewohnt diese Antilope besonders häufig die Ebenen zwischen dem Kir- und Djurflusse. Während der nassen Jahreszeit lebt sie auf den trockeneren, offenen Triften in Rudeln von zehn bis dreißig Stück; wenn die Teiche und Regenbetten vertrocknen, sammelt sie sich in den Sumpfgebieten um die größeren Flüsse. Besonders gern hält sie sich auf lichten Weideplätzen und namentlich in Gegenden auf, wo sich viele Termitenhügel und Bauhiniengebüsche finden. Ihre etwas schwerfälligen Bewegungen erinnern an die der Steppenkuhantilope, mit der sie auch die geringe Scheu vor dem Menschen teilt. Letztere kommt nur im Herzen Afrikas, dann und wann mit den bisher genannten zusammen vor, da ihr Verbreitungsgebiet weiter im Norden und namentlich im Nordosten des Erdteils liegt. In den Steppen an den Westabfällen des abessinischen Hochlandes wie in den weiten Gebieten um den Barka und Atbara ist sie häufig. Soweit sich jedoch auch ihr Verbreitungsgebiet ausdehnt, es steht an Umfang noch bedeutend zurück hinter dem der verwandten Kama; denn diese bewohnt nicht allein die ganze südliche Hälfte Afrikas, sondern in großer Anzahl auch die Mitte und den Westen des Erdteils, da sie von Heuglin und Schweinfurth in den oberen Nilgebieten überall in namhafter Menge angetroffen wurde. Dank den Beobachtungen der letztgenannten Forscher und namentlich Schweinfurths kennen wir gegenwärtig die Kama genauer als ihre Verwandten und dürfen sie deshalb vorzugsweise ins Auge fasten, wenn es sich darum handelt, ein Gesamtbild ihrer Gruppe zu entwerfen.
In früheren Zeiten überall häufig im Gebiet der Ansiedlungen am Vorgebirge der Guten Hoffnung, ist das Hartebeest infolge unablässiger Verfolgungen gegenwärtig hier sehr zusammengeschmolzen, und kein Verbot hindert seine gänzliche Vernichtung. Erst im Norden der Ansiedlungen oder der durch Jäger besuchten Gegenden findet es sich in größerer Anzahl, und im Herzen Afrikas gehört es auf geeigneten Örtlichkeiten zu den häufigsten Antilopen. Heuglin beobachtete es paarweise und in Familien in dem lichteren Waldgürtel am Bahar el Djebel nicht selten, Schweinfurth lernte es als einen der gemeinsten Bewohner der Bongo- und Niam-Niam-Länder kennen. »Am häufigsten« sagt er, »stößt man auf Rudel von fünf bis zehn Stück in den unbewohnten Grenzwildnissen; in den bebauten Gegenden bevorzugt das Tier den lichten Buschwald in der Nachbarschaft der Flußniederungen, ohne diese selbst zu betreten. Es hat die Gewohnheit, um die Mittagszeit an Baumstämmen oder an hell von der Sonne beschienenen Termitenhügeln stehenden Fußes zu rasten, und entzieht sich alsdann durch seine beharrliche Ruhe und die bevorzugte Wahl eines völlig gleichfarbenen Hintergrundes oft lange den Blicken des Spähenden.« Laut Harris steht jedem Rudel ein alter Bock vor, der, wie so viele andere Antilopen auch, bei dem von ihm beherrschten, sich Untertan gemachten Trupp keinen zweiten seinesgleichen duldet. Trotz der unschönen Gestalt und des häßlichen und ungeschlachten Kopfes, der der Kama, wenn sie ausschreitet, ein ebenso auffallendes als plumpes Ansehen verleiht, macht sie doch einen majestätischen Eindruck auf den Beschauer, und zwar den besten, wenn sie sich in Galopp setzt. Im Anfang des Laufs sieht es freilich aus, als wäre sie auf den Hinterbeinen gelähmt; sobald sie jedoch einmal ordentlich in Bewegung gekommen ist, verschwindet dieser Eindruck vollständig. Sie fördert sich dann mittels eines wiegenden und gefügigen Trottes, trägt den Kopf mit dem schweren Gehörn erhaben wie ein edles Roß, hebt die Füße wie ein Schulpferd, peitscht den weißen Spiegel mit dem glänzend schwarzen Schwanz und stürmt so ziemlich eilfertig dahin. Bewegungslustig wie irgendeine andere Antilope, gefällt sie sich oft in wundersamen Sprüngen und Wendungen, gar nicht selten auch in eigentümlichen Spielen. »In einem Abstande von kaum fünfhundert Schritten vom Wege«, erzählt Schweinfurth, »fesselte ein Trupp tändelnder Hartebeests unsere Aufmerksamkeit. Sie spielten miteinander in einer Weise, daß man glauben konnte, sie machten ihre Schwenkungen, gelenkt von unsichtbaren Reitern. Und dies alles geschah angesichts einer Karawane von einer halben Wegstunde Länge. Paarweise umjagten sie ein großes Baumwäldchen, wie in einer Arena im Kreise um dasselbe laufend; dabei standen andere Trupps von drei bis vier Hartebeesten als aufmerksame Beschauer still beiseite und lösten nach einer Weile die kreisenden ab. So ging es fort, bis endlich meine Hunde auf sie losstürzten und sie nach allen Richtungen zerstreuten. Diesen Vorgang habe ich genau so beobachtet, wie ich denselben mit obigen Worten zu schildern versuchte. Ich glaube, die Tiere befanden sich in der Brunstzeit und waren in diesem Zustande blind gegen äußere Gefahr.« Inwiefern die Auffassung Schweinfurths berechtigt ist, geht am besten daraus hervor, daß solche Spiele beim Hartebeest und allen seinen Verwandten in ernste Zweikämpfe ausarten, sobald ein zweiter starker Bock sich bei dem Rudel einfindet. Wie schon die Alten von ihrem Bubalus erzählten, stürzen sie sich bei solchen Kämpfen auf den Boden, den Kopf zwischen die Vorderläufe gebeugt, nähern sich Stirn an Stirn und schlagen nun mit größter Wut die Gehörne gegeneinander, so daß ein auf weithin hörbares, geräuschvolles Rasseln entsteht. Nicht selten verfangen auch sie sich wie kämpfende Hirsche und vermögen dann entweder gar nicht oder nur unter Verlust eines Hornes sich zu trennen. Die Wunden, die kämpfende Böcke einander beibringen, sind tief und zerrissen, deshalb auch in hohem Grade gefährlich. In derselben Weise sollen sie sich gegen ihre Feinde verteidigen und die meisten derselben sich erfolgreich vom Leibe halten.
Die Setzzeit des einzigen Kalbes soll, laut Harris, am Vorgebirge der Guten Hoffnung in die Monate April und September fallen, woraus also hervorgehen würde, daß diese Antilope zweimal im Laufe des Jahres brünftig wäre. Gefangene haben sich auch in unsern deutschen Tiergärten wiederholt fortgepflanzt und Junge erzielt, die man ohne Schwierigkeiten aufziehen konnte. Ein im Tiergarten zu Frankfurt geborenes Kalb der Steppenkuhantilope war größer als ein Hirschkalb, glich noch viel mehr als die Alten den Rindern, einem Kuhkalbe, hatte sehr hohe Beine, zeigte schon einigermaßen den langen Kopf, aber eine sehr gewölbte Stirn und war rötlichgelb gefärbt wie die Alten. Sofort nach seiner Geburt lief es mit der Mutter durch sein Gehege, obwohl seine Bewegungen noch überaus ungelenk waren und sein Galopp an den der Giraffen erinnerte. Nach anderweitigen Beobachtungen brechen ungefähr im dritten Monat des Lebens die Hörner durch! es bedarf jedoch mehrerer Jahre, bevor sie ihre eigentümliche Krümmung erhalten, und sie sind demgemäß in verschiedenen Zeitabschnitten von denen der alten Tiere gänzlich verschieden, ändern auch ihre Gestalt und Biegung bis zum vollendeten Wachstum fast ununterbrochen.
Außer den großen Katzenarten, namentlich Löwen und Leoparden, die den Kuhantilopen eifrig nachstellen sollen, werden diese von Schmarotzern überaus gequält. Eine Biesfliegenart legt ihre Eier unter der Haut, eine andere in der Nasenschleimhaut der Antilopen ab, und es entwickeln sich Maden, die zwar durch Niesen und Schnauben oft bündelweise entfernt werden, dem Nährtier aber entsetzliche Qualen bereiten.
Gejagt werden Kuhantilopen überall, wo sie vorkommen, und zwar von den Eingeborenen wie von den Weißen. Sie haben die Gewohnheit, wenn sie sich verfolgt sehen, immer einen bestimmten Abstand zwischen sich und dem Jäger einzuhalten, diesen somit gewissermaßen zu foppen und zu verspotten, da sie nur für die weittragendsten Büchsen schußgerecht aushalten. Berittene Jäger kommen ihnen eher nahe; niederhetzen aber, wie andere schwere Antilopen, lassen sie sich nicht. Das Wildbret wird überall hochgeschätzt, da es zu dem schmackhaftesten zählt, das die Antilopenfamilie liefert. Am Kap pflegt man es in Streifen zu schneiden, an der Luft zu dörren und später zur Herstellung kräftiger Suppen zu verwenden. Das Fell benutzt man zu Decken, aus der gegerbten Haut bereitet man Riemen und Geschirre, die Hörner werden ihrer Härte und des Glanzes halber zu allerlei Gerätschaften und Schmuckgegenständen verarbeitet.
*
Ebenso wie die Kuhantilopen ähneln auch die Riedantilopen (Redunca) den Gazellen. Unter den zu dieser Gruppe gehörenden Antilopen ist der Riedbock (Redunca eleotragus) die bekannteste. Das schöne Tier wird mit dem Schwanz 1,4 bis 1,5 Meter lang, am Widerrist etwa 95 Zentimeter und am Kreuz 80 Zentimeter hoch; die Hörner erreichen eine Länge von 30 Zentimeter und sind unten ungefähr 3 Zentimeter dick. Im allgemeinen ähnelt der Riedbock unserm Reh, ist jedoch etwas schlanker gebaut. Der Leib ist schwach gestreckt, am Hinterteil ein wenig stärker als vorn, der Hals lang und dünn, seitlich zusammengedrückt und hirschähnlich gebogen, der Kopf verhältnismäßig groß, nach vorn verschmälert, mit breiter Stirn, geradem Nasenrücken und stumpf zugespitzter Schnauze; die Ohren, aus beiden Seiten mit dichtem Haar bedeckt, sind groß, lang, schmal und zugespitzt, an der Wurzel geschlossen, gegen das Ende geöffnet, an der Spitze verengt, die Augen groß und lebhaft, die Hufe mittelgroß, etwas gewölbt, die Afterklauen abgeplattet und quergestellt. Der Schwanz reicht mit dem zottigen Haarbusch fast bis an die Knie und erscheint wegen seiner reichlichen Behaarung viel dicker und breiter, als er wirklich ist. Die verhältnismäßig starken und kräftigen Hörner stehen ziemlich entfernt voneinander, steigen von der Wurzel rückwärts in die Höhe, krümmen sich dann in einem sanften Bogen nach vorwärts und weichen dabei ziemlich weit auseinander, nähern sich aber wieder mit den Spitzen um ein wenig. Ihre untere Hälfte ist von tiefen und regelmäßigen Längsfurchen durchzogen, die obere glatt, die Wurzel zehn- bis zwölfmal quergerunzelt. Die ziemlich kurze und dichte Behaarung liegt nicht so glatt an dem Leibe an als bei den übrigen, bis jetzt genannten Antilopen, verlängert sich am Unterleibe und den Hinterseiten der Oberarme sowie am Vorderhalse bis zur Brust und bildet auf der Mitte des Rückens, am untern Ende des Vorderhalses und aus dem Scheitel Haarwirbel. Unterhalb der Ohren, in der Schläfengegend, liegt ein runder, kahler Flecken. Die Ober- und Außenseite des Leibes ist gewöhnlich rotgraubraun, die Unterseite und Innenseite der Vorderbeine weiß. An der Außenseite der Beine zieht die Färbung mehr ins Gelbliche, am Kopf und Hals sowie der Außenseite der Ohren ins Fahle. Das Weibchen unterscheidet sich durch den Mangel des Gehörns, auch durch geringere Größe vom Männchen.
Sumpfige, mit Schilf und Riedgras bedeckte Gegenden Süd- und Mittelafrikas sind die Heimat des Riedbocks, der eben seinen Namen von seinem Aufenthaltsort erhielt. In den Ansiedlungen des Vorgebirges der Guten Hoffnung, im Lande der Namaquas und in der Kafferei ist er an manchen Orten sehr häufig; im Innern Afrikas tritt er, nach Schweinfurths Beobachtungen, erst jenseits der großen Sümpfe des obern Nilgebiets auf. Hier belebt er paarweise die Buschwaldungen in der Nähe von Gewässern oder Sümpfen. Infolge seiner zurückgezogenen Lebensweise sieht man ihn viel seltener, als sein häufiges Vorkommen glauben läßt.
Über die Lebensweise berichtet Drahson in seinen vortrefflichen »Jagdbildern aus Südafrika.« Wenige Tiere sind für den Jäger so vielversprechend wie der Riedbock. Gewöhnlich liegt er versteckt in dem Riedgrase, bis man fast an ihn herangekommen ist, und wenn er aufgeschreckt wird, flieht er nur auf kurze Strecken hin, bleibt dann stehen und schaut nach seinen Verfolgern zurück. Dabei hört man ihn ein eigentümliches Niesen ausstoßen, das augenscheinlich der Warnungsruf ist. Das dadurch bewirkte Geräusch wird ihm aber öfters zum Verderben, denn es macht den Jäger erst aufmerksam auf ihn. Er ist ein großer Freund von jungem Getreide und deshalb den Kaffern sehr verhaßt. Sie geben sich alle Mühe, ihn zu vertreiben, und betrachten schon die Vernichtung eines Riedbocks als ein höchst günstiges Ergebnis ihrer Jagden, weil es ihnen hauptsächlich darauf ankommt, die Brandschatzer ihrer Pflanzungen zu vernichten. Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich mir die ewige Freundschaft eines ganzen Dorfes dadurch gewonnen, daß ich einige › Umsekes‹ wegschoß, die die Leute mehrere Wochen lang geärgert hatten.
Wirklich wunderbar ist die Lebenszähigkeit dieser Antilope. Es kommt oft vor, daß sie noch lustig dahinläuft, nachdem ihr eine Kugel durch den ganzen Leib gegangen ist, und wenn ihr auch in vielen Fällen die Flucht nichts hilft, geht sie doch dem Jäger verloren. Wenn sie in einer abgelegenen Waldschlucht sich zu verbergen sucht, um ihren Verfolgern zu entgehen, finden sie doch andere Feinde auf, und wenn es nur ein Haufen hungriger Hyänen wäre, die der blutigen Fährte durch Meilen hin folgen, nachts in ihren Schlupfwinkel eindringen und sie zerreißen.«
*
Als nahe Verwandte der Riedantilopen sieht man die Wasserböcke (Kobus) an, große, ziemlich langbehaarte, oft gemähnte Antilopen von regelmäßiger Gestalt mit langen, spitzigen, in sanften Bogen erst rück- und vorwärts, dann auf- und abwärts sich krümmenden, geringelten Hörnern, die jedoch nur dem Männchen zukommen. Der Wasserbock ( Kobus ellipsiprymnus), ein stattliches, fast hirschgroßes Tier von 2 Meter Gesamt- und 50 Zentimeter Schwanzlänge, bei 1,3 Meter Kreuzhöhe, trägt, der Krümmung nach gemessen, 80 Zentimeter lange, stark geringelte Hörner und ein reiches, auffallend fettiges und grobes, nur auf dem Oberkopfe, den Lippen, der Außenfläche der Ohren und den Läufen kurzes und dichtes, sonst langes und zottiges, vorherrschend grau gefärbtes Kleid, da nur die Spitzen der Haare braun sind. Am Kopf, Rumpf, Schwanz und den Schenkeln zieht diese Färbung in das Gelbrote oder Rotbraune; die Augenbrauen, ein schmaler Streifen unter dem Lide, Oberlippe, Muffel, die Halsseiten und eine schmale Binde an der Kehle sowie eine andere, die über den hintern Teil der Schenkel vom Kreuz an nach vorn und unten verläuft und eiförmig gebogen ist, sind weiß. Das Weibchen ist blasser und zarter gebaut.

Weiblicher Wasserbock (Kobus ellipsiprymnus)
A. Smith fand den Wasserbock nördlich von Kurrichano in Südafrika in kleinen Herden auf, die acht bis zehn Stück stark waren und sich an den Ufern der Ströme aufhielten; Heuglin und nach ihm Schweinfurth lernten ihn auch als Bewohner des innern Afrika kennen. Unter jedem Rudel sieht man zwei oder drei Böcke, jedoch nur einen einzigen starken, da dieser die schwächeren abzutreiben scheint; doch behaupten die Eingeborenen, daß es überhaupt mehr Geißen als Böcke gäbe, weil viel mehr Tier- als Bockkälber gesetzt würden. Ungeachtet seiner fast plumpen Gestalt macht der Wasserbock einen guten Eindruck auf den Beschauer. Seine Augen sind lebhaft, ausdrucksvoll, Selbständigkeit des Wesens, ja fast Wildheit widerspiegelnd, seine Bewegungen verhältnismäßig zierlich. Solange er weidet, sieht er etwas unbehilflich aus; erregt aber nimmt er etwas Stattliches und Würdevolles an, und besonders, wenn er den Kopf hebt, gewinnt er ein lebhaftes, geistvolles Ansehen. Nach Heuglin ist er kein eigentlicher Sumpfbewohner, sondern liebt Stellen, die mit mehr als mannshohem Schilf bewachsen sind. Wie die Pferdeantilopen hat er die Gewohnheit, Termitenbaue zu besteigen und von ihnen aus in majestätischer Haltung sein nasses Gebiet zu überschauen. Aus diesem Grunde wird man seiner leicht ansichtig; aber auch wenn er durch das Gebüsch geht, leuchten die weißen Spiegelstreifen weithin aus durch das Dunkel des Gelaubes. Besonders scheu ist er nicht, läßt vielmehr den Schützen gewöhnlich ziemlich nahe an sich herankommen. Wittert der Leitbock wirklich Gefahr, so eilt er in sausendem Galopp dahin und das ganze Rudel hinter ihm drein. Die Flucht geht regelmäßig dem Wasser zu, und hier stürzt sich die geängstigte Herde mit einem Male plumpsend in die Wellen. Wahrscheinlich sind die Wasserböcke gewöhnt, vor ihrem schlimmsten Feinde, dem Löwen, in dieser Weise die Flucht zu ergreifen. Die Äsung besteht in Sumpf- und Wasserpflanzen sowie in dem saftigen Grase, das sich in allen Niederungen Südafrikas findet.
Die Eingeborenen der Länder des Vorgebirges der Guten Hoffnung lassen die Wasserböcke unbehelligt, die Neger des innern Afrika erlegen sie auf Treibjagden so gut wie jedes andere Wild. Harris fand das Wildbret alter Böcke vollkommen ungenießbar und versichert, daß er durch den heftigen Gestank manchmal geradezu von seiner Beute verjagt worden und nicht einmal imstande gewesen wäre, das erlegte Wild abzuhäuten; Schweinfurth dagegen bemerkt, daß ihm das zarte, wenn auch fettarme Fleisch der erlegten Kälber vortrefflich geschmeckt habe.
*
Zu den stattlichsten Erscheinungen der ganzen Familie zählen die Pferdeböcke oder Roßantilopen (Hippotragus), so genannt wegen der starken Nacken- und Halsmähne, die die hierher gehörigen Arten besitzen. Zunächst ist da die Schimmelantilope, der Bastardgemsbock der Ansiedler des Vorgebirges der Guten Hoffnung ( Hippotragus leucophoeus), ein ebenso gewaltiges als schönes Tier von fast 3 Meter Gesamt- oder 2,2 Meter Leibes- und 75 Zentimeter Schwanzlänge, 1,6 Meter Schulterhöhe und rostfarbig gelblichmilchweißer Hauptfärbung, zu erwähnen. Eine von Harris entdeckte zweite Art der Gruppe, die Rappenantilope (Hippotragus niger), steht an Größe hinter der Verwandten kaum zurück. Die vorherrschende Färbung ist ein tiefes, glänzendes Schwarz, das hier und da einen Schimmer in das Tiefnußbraune zeigt.
Während man früher annahm, daß diese beiden Roßantilopen dem Süden Afrikas eigentümlich seien, wissen wir jetzt, daß das Innere Afrikas ihre eigentliche Heimat ist und die Nachbarländer der Ansiedlungen am Vorgebirge die südliche Grenze ihres Verbreitungsgebiets darstellen. Nach Norden hin reicht dieses im Osten bis zum Atbara, im Westen bis zum Senegal und Gambia. Beide Arten bewohnen Gebirgsgegenden, namentlich felsige, dürftig mit niederem Buschwerk bewachsene Bergzüge, bilden kleine Trupps von sechs bis höchstens zwölf Stück, von denen jeder einzelne ein ziemlich großes Gebiet zu behaupten scheint, bewegen sich mit Kraft, stehen aber an Ausdauer hinter vielen ihrer Verwandten zurück.
Eine allerliebste Jagdgeschichte erzählt Schweinfurth. »Einer meiner tagtäglichen Streifzüge durch Busch und Wald gestaltete sich mir spielend zu einem Jagdabenteuer unerhörter Art. So etwas kann man nur im Innern Afrikas erleben. Im tiefen Schatten eines Butterbaumes und versteckt von dem in seinem Schutze hoch aufgeschossenen Grase hatte ich wohl eine halbe Stunde lautlos zusammengekauert dagesessen, ganz versunken in die Zergliederung meiner Pflanzen. Meine drei Begleiter schliefen wie gewöhnlich den Schlaf der Gerechten; weit im Umkreise herrschte die feierliche Stille der Waldeinsamkeit, daß man den Tritt einer Ameise am Boden zu hören vermochte; ab und zu drang ein seines Knistern von dem rastlosen Arbeiten in den Werkstätten der Termiten zu dem Ohr des Zeichnenden. Da schwankte ein riesiger Schatten an meinem Auge vorbei, und wie ich den Blick erhob, stand mir auf kaum Pistolenschußweite ein mächtiger Antilopenbock gerade gegenüber. Die Schönheit eines noch nie gesehenen Tieres erhöhte meine Überraschung, und mit pochendem Herzen starrte ich auf das rätselhafte Bild, das gleichsam dem Erdboden entwachsen zu sein schien. Es war ein Bastardgemsbock von hellgraubrauner Färbung, an der Brust mit langem Haar und weiß am Bauche. Von dem stolz gehobenen Kopfe mit seinem langen, spitzen und massiven Gehörn bis hinab zu den schwarzen Läufen mit den weißen Knöchelbinden stand der Bock frei da vor meinen Blicken, in solcher Majestät, wie ein gewaltiger Büffel, der drohend nach allen Seiten äugt und sichert, bevor er sich zur Fortsetzung seines Weideganges anschickt. Die rotbraune, steife Mähne, die vom gebogenen Nacken her über den ganzen Widerrist sich erstreckte, gab seiner Erscheinung etwas unbeschreiblich Keckes und Herausforderndes. Rauschend legte sich das Gras vor seinen wuchtigen Tritten. Jetzt schwenkte er auf die Seite, mir die ganze Spiegelgegend zukehrend; man konnte die Fliegen erkennen, die den hin und her fuchtelnden Giraffenschweif umkreisten, durch den diese Antilopenart ausgezeichnet ist, einer Quaste von dreiviertel Fuß langen schwarzbraunen Haaren vergleichbar, die auf schlankem Stil befestigt ist. Von meinen Leuten regte sich keiner; behutsam streckte ich daher die Hand aus nach der neben mir liegenden Büchse, schob die Sicherung zurück, und bei der nächsten Körperwendung des Tieres fiel meine Kugel mitten aufs Blatt, ein Ziel von kaum dreißig Schritten Entfernung. Mit mächtigem Satze fuhr der Bock in die Höhe; dann stand er einen Augenblick still, die Läufe gespreizt und wie betäubt mit etwas gesenktem Haupte. Eben wollte ich zur zweiten Büchse greifen, da gab es einen gewaltigen Krach, und das Jagdglück hatte mir die stolzeste Beute in den Schoß geworfen, in den Schoß – dann hätte es wohl noch gefehlt, daß ein Bastardgemsbock mir auf die offene Zeichenmappe fiele?
Der Schuß hatte meine Leute kaum wach gemacht; hierzulande war ein einziger Schuß des Blickes nicht wert, es bedurfte erst meines Triumphgeschreis, um sie auf die Beine zu bringen. Nun wurden wie gewöhnlich einige Neger aus den nächsten Hütten herbeigeholt, die sich geschäftig an die Arbeit des Abhäutens und Zerwirkens machten. Der Kopf allein wog fünfunddreißig Pfund. Ich erfuhr von den Eingeborenen, daß der Manja, so nennen die Bongo diese Antilopenart, zu den selteneren Tieren der Gegend gehört, obgleich er sich in allen Teilen des Gebiets wiederfindet, und daß derselbe für gewöhnlich einzeln oder weit abgesondert von seinesgleichen der Äsung nachgeht. Er soll die einzige von den größern Arten sein, die den Jäger annimmt und Wutanfälle hat wie ein wilder Büffel.«
*
Schon seit alter Zeit bekannte und berühmte Antilopen sind die Spießböcke ( Oryx), von denen wenigstens eine Art häufig auf den Denkmälern Ägyptens und Nubiens abgebildet wurde. Man sieht hier den Oryx in den mannigfachsten Stellungen, gewöhnlich mit einem Strick um den Hals, zum Zeichen, daß man ihn gejagt und gefangen hat. In den Gemächern der großen Pyramide Cheops sieht man dasselbe Tier, zuweilen nur mit einem Horne dargestellt, und hierauf wollen einige Naturforscher die Behauptung gründen, daß der Oryx zur Sage von dem Einhorn Veranlassung gegeben habe, während unter dem Reem der Bibel oder dem Einhorn doch entschieden nur das Nashorn gemeint sein kann. Von diesem Oryx erzählen sich die Alten wunderbare Dinge. Sie behaupten, daß er ebenso wie die Ziegenherden den Aufgang des Sirius erkenne, sich diesem Gestirn entgegenstelle und es gleichsam anbete, daß er Wasser trübe und verunreinige und deshalb den ägyptischen Priestern verhaßt wäre, daß er sein Gehörn beliebig wechseln könne und bald vier, bald nur zwei, bald gar nur eine Stange trage, und dergleichen mehr.
Die Spießböcke gehören zu den größten und schwersten aller Antilopen, machen jedoch trotz ihres etwas plumpen Baues einen majestätischen Eindruck auf den Beschauer. Der Kopf ist gestreckt, aber nicht ungestaltet, die Gesichtslinie fast gerade oder nur wenig gebogen, der Hals mittellang, am Ende stark bequastet; die Augen sind groß und ausdrucksvoll, die Ohren verhältnismäßig kurz, breit und abgerundet, die Hörner, die von beiden Geschlechtern getragen werden, sehr lang und dünn, von der Wurzel an geringelt und entweder gerade oder in flachem Bogen nach rück- und auswärts gebogen. Alle bekannten Arten ähneln sich und haben zu der Ansicht verleitet, daß man es nur mit verschiedenen Ausprägungen eines und desselben Tieres zu tun habe; wenn man jedoch die verschiedenen Spießböcke nebeneinander sieht, erscheint diese Ansicht als eine hinfällige.
Als das Urbild der Gruppe betrachtet man gewöhnlich den Passan, von den Ansiedlern des Vorgebirges der Guten Hoffnung Gemsbock genannt ( Oryx gazella), ein stolzes Tier von 2,3 Meter Gesamt- bzw. 2,4 Meter Leibes- und 40 Zentimeter Schwanzlänge und 1,2 Meter Schulterhöhe. Das Gehörn, das bei der Geiß zwar dünner, auffallenderweise aber noch länger zu sein pflegt als beim Bock, wird über 1 Meter lang, ist nur äußerst wenig gebogen oder selbst schnurgerade, steigt schief nach hinten und außen auf und ist in der untern Hälfte dreißig- bis vierzigmal stark geringelt, an der Spitze aber glatt und scharf. Die Decke liegt dicht und glatt an und besteht aus kurzen, straffen Haaren, die mit Ausnahme des aufrechtstehenden, mähnenartigen Haarkammes auf Oberhals und Vorderrücken sowie eines Büschels langer, borstiger Haare am Unterhalse überall ziemlich gleichlang sind. Hals, Nacken, Rücken und Seiten haben gelblichweiße, der Kopf, die Ohren, der obere Teil der Hinterschenkel, die Brust, der Bauch und die Läufe vom Fesselgelenk an blendend weiße Färbung; ein Streifen auf der Stirn, ein breiter Fleck auf der Vordernase, eine von dem Gehörn an durch das Auge nach der Unterkinnlade verlaufende, und eine zweite längs der letztern sich herabziehende, das Weiß des Kopfes von dem Isabell des Halses trennende Binde und der äußere Rand der Ohren sind schwarz, weshalb der Kopf halfterartig gezeichnet erscheint; ebensolche Färbung zeigen auch ein auf dem Rücken beginnender, auf dem Kreuze sich ausbreitender und rautenförmige Gestalt annehmender Flecken, die vorderen und Hinteren Unterschenkel, ein Streifen auf der Vorderseite der Fesseln, ein bandartig von der Mittelbrust nach vorn und oben in die Weichengegend verlaufender Streifen sowie endlich die starke Quaste, wogegen Nacken-, Mähnen- und Halsbusch mehr ins Schwarzgraue spielen.
Der Passan findet sich, soviel bis jetzt bekannt, nur im südlichen Afrika, wird aber im Nordosten durch eine ihm sehr nahestehende Art vertreten.
Diese, die Beisa ( Oryx Beisa), wahrscheinlich der eigentliche Oryx der Alten, dessen Färbung sein soll gleich »der Milch des Frühlings«, steht dem Passan an Größe nicht nach, hat ebenfalls mehr oder weniger gerade, meterlange Hörner und ist jenem sehr ähnlich gefärbt und gezeichnet. Die Grundfärbung ihres Felles erscheint lichter als beim Passan, isabellfahlgrau oder gelblichweiß. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt. Die Beisa bewohnt das Küstenland von Habesch, nach Norden hin bis zum Wendekreise, nach Süden hin sich bis zum Gebiete der Somalen verbreitend.
Die dritte Art der Gruppe, von uns gewöhnlich Säbelantilope, von den Arabern Wild- oder Steppenkuh genannt ( Oryx leucoryx), ist etwas plumper als die Verwandten und trägt ebensolange, dreißig- bis vierzigmal geringelte, aber sanft gebogene, nach außen und hinten gerichtete, mit der Spitze nach unten geneigte Hörner. Das kurze, grobe, nur längs des Rückgrats und der Nackenfirste verlängerte, übrigens glatt anliegende Haarkleid ist ziemlich gleichmäßig gefärbt. Ein mehr oder weniger reines Gelblichweiß, das auf der Unter- und Innenseite der Läufe heller, am Halse dagegen durch Rostfarben ersetzt wird, bildet die Grundfärbung; sechs Flecken von mattbrauner Farbe stehen am Kopfe, und zwar einer zwischen den Hörnern, zwei zwischen den Ohren, zwei andere zwischen den Hörnern und Augen und der sechste endlich als Streifen auf dem Nasenrücken. Alte Böcke erreichen eine Länge von reichlich 2 Meter bei einer Schulterhöhe von 1,3 Meter.
Das Verbreitungsgebiet der Säbelantilope erstreckt sich über den nördlichen Teil von Innerafrika, von der Regengrenze an südlich. Sie ist nicht selten in Sennar und Kordofan, in Mittel- und Westsudan, kommt aber auch nach Norden hin in der Bahiudasteppe und in einzelnen Wüstentälern Nubiens bis zur ägyptischen Grenze vor.
Hinsichtlich ihrer Lebensweise dürften die Oryxantilopen im wesentlichen miteinander übereinstimmen; doch fehlen zurzeit noch genügende Beobachtungen über ihr Freileben, und die Naturgeschichte dieser altberühmten Tiere ist noch immer lückenhaft und dürftig.
»Der Gemsbock«, sagt Gordon Cumming, »scheint von der Natur dazu bestimmt, die trockenen Karus des heißen Südafrika zu bevölkern, für die er seiner Natur nach vortrefflich sich eignet. Er gedeiht in unfruchtbaren Gegenden, wo man glauben sollte, daß darin kaum eine Heuschrecke Nahrung finde, und ist, trotz der Glut seiner Heimat, doch völlig unabhängig vom Wasser. Dieses trinkt er, wie ich nach meiner Beobachtung und der wiederholten Behauptung der Bauern überzeugt bin, niemals, auch wenn er es haben würde.« Unter ganz ähnlichen Umständen leben die nördlichen Arten, obwohl sie durchaus nicht Wasserverächter sind wie der Passan. Allerdings trifft man die stattlichen Tiere, die sich schon von weitem durch ihre gewaltige Größe auszeichnen, in den heißen, wasserlosen Steppen Südnubiens und Kordofans an, ohne daß man begreift, wo sie ihren Durst löschen könnten; allein an denselben Orten leben auch noch eine Menge anderer Tiere, die Wasser trinken. Auch verschmähen die Oryxböcke letzteres wenigstens in der Gefangenschaft nicht.
Man steht die Oryxantilopen gewöhnlich paarweise oder in sehr kleinen Trupps, häufig auch nur eine Mutter mit ihren Jungen. Höchst selten rudeln sich zahlreiche Gesellschaften, und solche von zweiundzwanzig Stück, wie sie Gordon Cumming sah, mögen wohl nur ausnahmsweise sich vereinigen. In den unbevölkerten Gegenden sind die herrlichen Tiere nirgends selten, aber auch nirgends häufig und dabei immer so scheu und furchtsam, daß man die wenigsten von denen, die in einer bestimmten Gegend leben, überhaupt zu sehen bekommt. Sie fliehen, ehe der Reiter sich ihnen nähert. Nach meinen Beobachtungen meiden sie den Wald; in Kordofan halten sie sich nur in der Steppe auf. Dort gibt ihnen die so reiche Pflanzenwelt hinlängliche Nahrung, und wenn dann die Zeit der Dürre und Armut, der Winter, kommt, haben sie sich so viel Feist zugelegt, daß sie eine Zeitlang auch mit magerer Kost, mit ausgedörrten Halmen und blätterlosen Zweigen, vorlieb nehmen können. Nur einzelne Mimosenbüsche bieten ihnen dann noch frischere Äsung. Beim Weiden recken sie ihren Hals hoch empor, stemmen sich auch wohl mit den Vorderhufen gegen den Stamm an, um höher hinauflangen zu können.
Die Oryxböcke sind schnell. Ihr Schritt ist leicht, ihr Trab hart, ihr Galopp sehr schwer, aber ausdauernd und gleichmäßig fördernd. Nur die besten Pferde sind imstande, ihnen zuweilen nachzukommen. Die Araber der Bahiuda wie die Bakhara, die ausgezeichnete Rosse besitzen, machen sich ein besonderes Vergnügen daraus, die Schnelligkeit ihrer Pferde an dem Laufe des Oryx zu erproben, und stechen diesem, sowie er sich im letzten Augenblick der Gefahr gegenüberstellt, die Lanze an den Hörnern vorüber von oben in die Brust. Man muß den Spießböcken überhaupt nachrühmen, daß sie, so scheu sie auch sein mögen, doch keineswegs die Furchtsamkeit anderer Antilopen zeigen, sondern eher etwas vom Wesen des Stieres haben. Gereizt gehen sie in heller Wut auf den Angreifer los und suchen ihn in boshafter Weise zu verletzen. Gegen den anlaufenden Hund wissen sie sich erfolgreich zu verteidigen, indem sie den Kopf vorbiegen und in schnellen Wendungen nach rechts und links mit solcher Kraft ausschlagen, daß sie einem Hunde ihre Hörner durch den ganzen Leib rennen, wenn jener nicht geschickt ausweicht. Lichtenstein erzählt, daß einer seiner Begleiter in der großen Karu das Gerippe eines Panthers und eines Oryx nebeneinander liegen fand. Der Bock hatte seinen gefährlichen Feind mit einem Hornstoße getötet, war aber selbst den vorher empfangenen Wunden erlegen. Harris hält es nicht für unmöglich, daß unter Umständen dem Löwen ein gleiches Schicksal werde.
Die Jagd auf alle Oryxantilopen wird mit Vorliebe zu Pferde betrieben. Cumming beschreibt eine solche in lebhafter Weise und erzählt dabei, daß er den ganzen Tag einem bereits verwundeten Passan nachgeritten sei, bis endlich das Tier nicht mehr weiter konnte. Die Hottentotten wagen nicht, einzeln Gemsböcke anzugreifen oder zu verfolgen, weil diese sich augenblicklich gegen sie wenden. Keine andere Antilope soll einen prachtvolleren Anblick gewähren als der fliehende Oryxbock. Man trifft ihn nicht selten unter andern Antilopenherden, wo er sich die Führerschaft erkämpft hat. Sobald er merkt, daß er verfolgt wird, stößt er, wie man erzählt, ein heftiges, durchdringendes Geschrei aus, hebt den Kopf empor, so daß die Hörner auf den Rücken zu liegen kommen, streckt den Schwanz gerade von sich und eilt nun in wilder Jagd über die Ebene dahin, alles, was ihm in den Weg kommt, vor sich niederwerfend oder durchbohrend, über Büsche, die ihn hindern wollen, schnellt er mit einem einzigen gewaltigen Satze hinweg; durch die Herden der Zebras bricht er hindurch, Straußenherden jagt er in die tollste Flucht. Erst nach vielstündiger Verfolgung ist es möglich, in schußgerechte Entfernung von ihm zu kommen; denn er hält auch dann noch die Verfolgung aus, wenn er vom Schweiße trieft.
Man benutzt Fleisch und Fell der Oryxantilope in der gewöhnlichen Weise. Die geraden Hörner des Passan und der Beisa werden oft als Lanzenspitzen verwendet. Man wartet, bis die Hornschalen bei beginnender Fäulnis von den starken Zapfen sich lösen, zieht sie dann ab, setzt sie auf gewöhnliche Lanzenstäbe, und die Waffe ist fertig. Die Europäer am Kap lassen die Hörner auch wohl polieren, mit silbernen Knöpfen versehen und gebrauchen sie sodann als Spazierstöcke.
Die Mendesantilopen ( Addax nasomaculatus) schließen sich den Oryxböcken am nächsten an, da ihre leichten, schrauben- oder leierförmig gewundenen, der Länge nach geringelten, schlanken und langen Hörner das einzige gewichtige Unterscheidungsmerkmal bilden. Schon die alten Griechen und Römer kannten sie recht gut; Plinius erwähnt sie unter dem griechischen Namen » Strepsicero« und unter dem lateinischen Addax, welch letzterer seit uralten Zeiten der Landesname dieser Antilope sein muß, weil sie heute noch von den Arabern Abu-Addas genannt wird.
Das Verbreitungsgebiet der Mendesantilope beschränkt sich auf Ostafrika. In den Ländern Südnubiens, zumal in der Bahiuda, sieht man sie zuweilen in zahlreichen Herden und häufig in kleinen Familien. Sie bewohnt auch die dürrsten Stellen, wo, nach der Versicherung der Nomaden, weit und breit kein Tropfen Wasser sich findet. Sie ist scheu und furchtsam wie die übrigen Antilopen, behend und ausdauernd im Laufe, dennoch aber vieler Verfolgung ausgesetzt. Unter den Tieren stellen ihr wohl nur der Hyänenhund oder Simir und der Karakal nach; um so eifriger aber verfolgen sie die Edlen des Landes, unter denen sie lebt. Die Machthaber der Nomaden und Beduinen sehen in ihr eines der edelsten Jagdtiere und hetzen sie, teils um ihr Fleisch zu nützen, teils um die Schnelligkeit ihrer Pferde und Windhunde zu erproben, teils auch, um Junge zu erbeuten, die sie dann aufziehen.
*
Drehhorn- oder Schraubenantilopen ( Strepsioeros) nennt man einige große Antilopen mit schraubenförmig gewundenen, zusammengedrückten und gekielten Hörnern, die nur von dem Bock getragen werden, und buntem, gestreiftem oder sonstwie durch lichte Farben gezeichnetem Fell. Als Vertreter dieser Gruppe gilt der stattliche Kudu ( Strepsiceros Kudu, eine Antilope, die unsern Edelhirsch an Größe übertrifft und kaum hinter dem Elch zurücksteht, obgleich sie dessen Gewicht nicht erreicht. Alte Böcke messen von der Nase bis zur Spitze des etwa 50 Zentimeter langen Schwanzes 3 Meter, bei 1,7 Meter Höhe am Widerrist, und erlangen ein Gewicht von 300 Kilogramm und darüber. Das Weibchen ist bedeutend kleiner: doch maß ein von mir untersuchtes Alttier immer noch 2,5 Meter in der Länge und 1,5 Meter Höhe am Widerrist. Hinsichtlich des Leibesbaues erinnert der Kudu in vieler Hinsicht an den Hirsch. Der Leib ist untersetzt, der Hals mittellang, der Kopf ziemlich kurz, an der Stirn breit, vorn zugespitzt, die Oberlippe behaart bis auf die Furche; die Augen find groß, die Ohren länger als der halbe Kopf. Diesem verleiht das Gehörn einen herrlichen Schmuck. Es gehört zu den größten, die irgendeine Antilope trägt. Schon bei mittelalten Böcken messen die einzelnen Stangen in gerader Linie von der Spitze zur Wurzel gegen 60 Zentimeter, bei sehr alten aber erreichen sie beinahe das Doppelte dieser Länge. Man begreift wirklich kaum, wie das Tier imstande ist, die Last des Kopfschmucks zu schleppen, oder wie es ihm möglich wird, mit solchen Hörnern durch das Dickicht eines Buschwaldes zu flüchten. Von der Wurzel aus richtet sich das Gehörn schief nach hinten und mehr oder weniger weit nach auswärts. Bei einigen Gehörnen stehen die Spitzen fast einen Meter weit voneinander. Die Schraubenwindungen der Stange finden sich immer an derselben Stelle, die erste etwa im ersten, die zweite ungefähr im zweiten Drittel der Länge. Auch die Spitzen sind etwas schraubenartig nach außen gewendet, bei alten Tieren mehr als bei jungen. An der Wurzel der Hörner beginnt ein scharfkantiger Kiel, der in seinem Verlauf dem Schraubengange folgt und erst gegen die vollkommen runde Spitze hin sich verliert. Die kurze, glatt anliegende, etwas rauhe Behaarung verlängert sich auf der Firste des Halses und Rückens, beim Bock auch vom Kinn bis unter die Brust herab zur Mähne. Ein schwer zu beschreibendes rötliches Braungrau, das auf den hintern Teilen des Bauches und den innern Seiten der Läufe in Weißlichgrau übergeht, bildet die Grundfärbung: die Nackenmähne ist dunkelbraun oder schwarz, bei sehr alten Tieren aber wenigstens längs des ganzen Vorderhalses weißgrau, der Schwanz oben dunkelbraun, unten weiß und an der Quaste schwarz. Rötliche Kreise umgeben die Augen. Von jener Grundfärbung heben sich scharf ab weiße Streifen, meist sieben oder neun an der Zahl, von denen einige sich gabeln. Sie verlaufen in gleichen Abständen längs der Seite von dem Rücken nach unten. Bei dem Weibchen sind alle Streifen schwächer und blässer. Wie es scheint, bewohnt der Kudu ausschließlich den Wald, am liebsten jene in Afrika so häufigen dornigen Buschwälder. Wir fanden ihn in den Bogosländern erst in einer Höhe von sechshundert Meter über dem Meere und bis zu zweitausend Meter hinauf, immer an den Bergwänden, wo er zwischen den grünen Mimosen majestätisch dahinschritt. Die starken Böcke leben einzeln; die Tiere dagegen vereinigen sich gern in schwache Trupps von vier bis sechs Stück.
Nach den Beobachtungen, die wir anstellen, und nach den Erkundigungen, die wir einziehen konnten, ähnelt der Kudu in seiner Lebensweise und seinem Wesen unserm Hochwild. Er durchstreift ein ziemlich großes Gebiet und wechselt regelmäßig hin und her. Haltung und Gang erinnern an den Hirsch. Erstere ist ebenso stolz, letzterer ebenso zierlich und dabei doch gemessen wie bei dem Edelwild unserer Wälder. Solange der Kudu ungestört ist, schreitet er ziemlich langsam an den Bergwänden dahin, dem dornigen Gestrüpp vorsichtig ausweichend und an günstigen Stellen äsend. Knospen und Blätter verschiedener Sträucher bilden einen guten Teil seines Geäses; doch verschmäht er auch Gräser nicht und tritt deshalb, zumal gegen Abend, auf grüne Blößen im Walde heraus. Aufgescheucht trollt er ziemlich schwerfällig dahin, und nur auf ebenen Stellen wird er flüchtig. Aber auch dann ist sein Lauf noch verhältnismäßig langsam. In den Buschwäldern muß er, um nicht aufgehalten zu werden, sein Gehörn so weit nach hinten legen, daß die Spitzen desselben fast seinen Rücken berühren. Ehe er flüchtig wird, stößt er ein weithin hörbares Schnauben und zuweilen ein dumpfes Blöken aus. Wie Pater Filippini mir sagte, rührt letzteres aber bloß vom Tier her; der Bock schreit nur zur Brunftzeit, dann aber in derselben ausdrucksvollen Weise wie unser Edelhirsch.
In Habesch soll der Bock Ende Januar auf die Brunft treten. Von der Höhe herab vernimmt man um diese Zeit gegen Abend sein Georgel, mit dem er andere Nebenbuhler zum Kampfe einladet. Daß heftige Streite zwischen den verliebten Böcken ausgefochten werden, unterliegt wohl kaum einem Zweifel; denn der Kudu zeigt sich auch sonst als ein höchst mutiges und wehrhaftes Tier. Der Satz fällt mit dem Anfang der großen Regenzeit zusammen, gewöhnlich Ende August; das Tier würde also sieben bis acht Monate hochbeschlagen gehen. Nur höchst selten findet man noch Böcke bei den Tieren, nachdem sie gesetzt haben; die Mutter allein ernährt, bewacht und beschützt ihr Kalb.
In allen Ländern, wo der stolze, schön gezeichnete Kudu vorkommt, ist er der eifrigsten Verfolgung ausgesetzt. Sein Wildbret ist, wie ich mich selbst überzeugt habe, ganz vorzüglich und erinnert im Geschmack an das unseres Edelhirsches. Das Mark der Knochen gilt manchen südafrikanischen Völkerschaften als ein unübertrefflicher Leckerbissen. Zumal die Kaffern haben, wenn sie einen Kudu erlegten, nichts Eiligeres zu tun, als das Fleisch von den Knochen abzuschälen, diese zu zerbrechen und dann das Mark aus den Röhren zu saugen, roh, wie es ist. Auch das Fell wird im Süden Afrikas hochgeschätzt und gilt für manche Zwecke geradezu als unersetzlich. Die holländischen Ansiedler kaufen es zu hohen Preisen, um Peitschen, insbesondere die sogenannten Schmitzen oder Vorschläge, die als Haupterfordernis einer zum Knallen geeigneten Peitsche angesehen werden, daraus zu verfertigen. Außerdem verwendet man das Leder zu Riemen, mit denen man Häute zusammennäht oder Päcke schnürt, ebenso auch zu Geschirren, Satteldecken, Schuhen usw. In Habesch gerbt man das Fell und bereitet sich aus den Stangen des Gehörns, nachdem man sie mit Hilfe der Fäulnis von ihrem Knochenkern befreit hat, Füllhörner zur Aufbewahrung von Honig, Salz, Kaffee und dergleichen.
Jung eingefangene Kudus werden sehr zahm. Anderson, der ein kleines Kalb fing, rühmt es als ein niedliches, spiellustiges Geschöpf. Das kleine Ding war, als man es erlangte, noch so zart, daß man ihm die Milch aus der Flasche reichen mußte, die man mit einem leichten Pfropfen leicht verkorkt hatte. Bald aber gewöhnte sich der Pflegling so an seinen Herrn, daß er zu einem vollständigen Haustiere wurde. Am Kap würde man unzweifelhaft schon Versuche gemacht haben, Kudus zu zähmen und für die Haushaltung zu verwenden, hätte man nicht in Erfahrung gebracht, daß sie der furchtbaren »Pferdekrankheit«, die so viele südafrikanischen Tiere dahinrafft, unterworfen sind und ihr fast regelmäßig unterliegen.
*
Die Gruppe der Rindsantilopen ( Buselaphus) stellt gewissermaßen ein Verbindungsglied dar zwischen den Antilopen und den Rindern. Der Leib der hierher zu rechnenden Arten ist plump, schwerfällig, dick und stark, der Hals kurz und gedrungen, der Kopf groß, der Wedel einem Kuhschwanze ähnlich, die Haut des Vorderhalses zu einer weit herabhängenden Wamme verlängert, das Gehörn, das beide Geschlechter tragen, auf der Höhe des Stirnbeins aufgesetzt, in der Gesichtslinie zurückgebogen, ziemlich gerade oder leicht ausgeschweift, kantig und infolge des schraubenförmig umlaufenden Kieles mehrfach gedreht, unten querrunzelig, die Muffel klein, schmal, aber deutlich, Tränengruben sind nicht vorhanden. Das Weibchen ähnelt dem Männchen; sein Euter hat vier Zitzen.
Vertreter dieser Gruppe ist die Elenantilope, das größte und schwerste Mitglied der ganzen Unterfamilie. »Wahrscheinlich«, sagt Schweinfurth sehr richtig, »verdankt das stattliche Tier der kühnen Phantasie irgendeines belesenen Ansiedlers seinen Namen Eland, dessen hochnordisches Urbild den holländischen Boers doch wohl nur als ein Tier der Mythe und der Heldensage vorschweben konnte. So wenig nun auch Färbung und Hörner dieser Antilope etwas mit dem Elen gemein haben, so zeigt es mir in seiner Natur immerhin einige Anklänge an das stolze Wild unserer nordischen Heimat; der kropfartige, zottige Haarbesatz vorn unter dem Halse, die buschigen Borstenhaare auf der Stirn, vor allem der gewaltige Schwanz und gemähnte Widerrist rechtfertigen einigermaßen diesen Vergleich. Weit auffallender dagegen ist die Ähnlichkeit dieser Tiere mit den Zeburassen der afrikanischen Rinder, die an und für sich das Antilopengepräge in hohem Grade verraten. Das kurze Gestell, der aufgetriebene, runde Leib, die lang herabhängende Wamme, der buckelartige Widerrist, das isabellfarbige Fell schließlich sind noch weit bessere Merkmale als die vorher genannten, die für einen solchen Vergleich sprechen.«
Die Elen- oder Elandantilope ( Buselaphus Oreas) erreicht eine Länge von fast 4 Meter, wovon 70 Zentimeter auf den Schwanz kommen, bei 2 Meter Höhe am Widerrist und 500, nach Harris sogar bis 1000 Kilogramm an Gewicht, kommt also einem mittelgroßen Ochsen an Größe und Schwere vollkommen gleich. Die Färbung ändert sich nach dem Alter. Erwachsene Böcke sind auf der Oberseite hellbraun oder gelblichgrau, rostrot überlaufen, an den Seiten weißgelblich, unten und auf den Außenseiten der Unterschenkel gelblichweiß, am Kopf hellgelblichbraun, während die Nackenmähne und ein Haarbüschel am Unterhalse gelblichbraun oder dunkelbraunrot aussehen. Der Rückenstreifen hat etwa dieselbe Färbung. Ein Fleck über dem Beuggelenke der Vorderbeine ist braun und ein Ring, der sich um die Fesseln zieht, rotbraun. Die Kuh ist weit kleiner und leichter gebaut, ihr Gehörn länger und schlanker, in der Regel auch weiter auseinandergestellt und verschieden gebogen, die Wamme klein oder fehlend, die Färbung stets dunkler als die des Bockes.
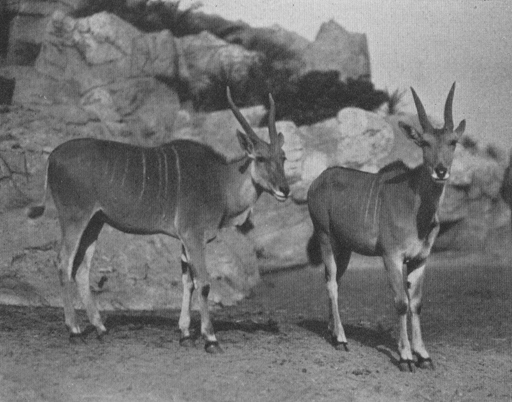
Elenantilope (Buselaphus oreas)
Das Verbreitungsgebiet der Elenantilope erstreckt sich über einen viel größeren Teil von Afrika, als man früher angenommen hatte. Bis zu Heuglins und Schweinfurths Forschungen nahm man an, daß das Tier nur im Süden des Erdteils vorkomme; gegenwärtig wissen wir, daß es von hier aus in allen geeigneten Gegenden der Südhälfte und noch bis weit diesseit des Gleichers auftritt. Im vorigen Jahrhundert lebte es noch innerhalb der Ansiedlungen des Vorgebirges der Guten Hoffnung; anfangs dieses Jahrhunderts, als Lichtenstein genannte Gegenden besuchte, hielt es sich noch in ziemlich großen Herden von zwanzig bis dreißig Stück an den Grenzen der Ansiedlungen aus; gegenwärtig ist es weiter nach dem Innern zurückgedrängt und jenseits des Wendekreises des Steinbocks bereits so selten geworden, daß Fritsch glaubt, der letzte Europäer gewesen zu sein, der einen Trupp von fünfzig Stück südlich dieses Wendekreises gesehen hat. Häufig dagegen tritt es auch jetzt noch überall in den südlich und nördlich des Gebirges gelegenen Teilen von Mittelafrika auf. Im Bongolande, am oberen Weißen Nil, ist es, nach Schweinfurth, gemein, obschon es hier nur selten in so starke Herden sich zusammenschlagen dürfte, wie dies, laut Harris, im südlichen Afrika geschieht. Seine bevorzugten Weideplätze sind die mit Mimosen spärlich bestandenen grasigen Ebenen, von denen aus es zur Zeit der Dürre noch den wasserreichen Niederungen herabkommt. Auffallenderweise findet es sich aber auch in gebirgigen Gegenden und hier auf den rauhesten Stellen, auf schwer zugänglichen Gipfelflächen z. B., wo es, in hohem Grade begünstigt durch die Örtlichkeit, vor den Nachstellungen des Jägers meist gesichert ist. Am häufigsten bemerkt man es in Trupps von acht bis zehn Stück, von denen eins, höchstens zwei männlichen Geschlechts sind. Zu gewissen Zeiten des Jahres aber rudeln sich solche Trupps zuweilen zu Herden von bedeutender Anzahl: Harris spricht von einer solchen, die gegen dreihundert Stück zählen mochte. Eine derartige Herde ähnelt, von fern gesehen, der des Hausrindes in so hohem Grade, daß man sie mit solcher verwechseln kann. Einige der Tiere gehen, langsam grasend, auf und nieder, andere sonnen sich, andere ruhen wiederkäuend im dürftigen Schatten der Mimosen; kurz der Trupp gleicht friedlich weidenden Kühen auf das täuschendste. Beim Verändern des Weidegebiets trollt die Elenantilope unter Leitung eines alten Bullen in geschlossenen Massen ihres Weges fort, einem Reiterregiment vergleichbar, das unter sicherer Führung langsam feines Weges zieht. Verfolgt fallen die Tiere in einen zwar nicht raschen, aber doch ungemein fördernden Trab, hart bedrängt in sausenden Galopp, bei dem, wie Schweinfurth sagt, die runden, dünnen Leiber auf den schwachen und kurzen Beinen förmlich vorüberzufliegen scheinen. Junge Bullen und Kühe laufen weit schneller und ausdauernder als die alten und schlagen häufig das beste Pferd, wogegen die alten Böcke in der Regel nur kurze Zeit ausdauern und jedem gut berittenen und geübten Reiter sicher zur Beute werden. Gleichwohl ersteigen sie Hügel und Berge mit Leichtigkeit, wissen auch über unzugängliche Gipfel zu kommen.
Die Äsung der Elenantilope besteht, nach Lichtenstein, in denselben Kräutern, die in den bewohnteren Gegenden das treffliche Futter für die Schafe und Rinder abgeben, und deren würzige Eigenschaften allem Vieh so besonders wohltätig zu sein scheinen. Wie manche Rinder- und viele Antilopenarten verbreiten die alten Bullen einen so starken Moschusgeruch, daß man an diesem nicht allein das Tier auf weithin wahrnehmen, sondern auch die Plätze, auf denen es der Ruhe pflegte, noch geraume Zeit, nachdem es sie verlassen, deutlich zu erkennen vermag.
Mit Ausnahme der dürren Monate, die Mangel und damit eine gewisse Entmutigung über die Herden der Elenantilopen bringen, liegen die alten Böcke oft miteinander im Streit, und ihre Kämpfe werden zuweilen so heftig, daß sie sich gegenseitig tiefe Wunden zufügen oder ihre Hörner abstoßen. Einzelne bösartige Bullen vertreiben in der Regel alle übrigen Männchen von der Herde und zwingen sie, sich ihrerseits zusammenzurudeln, während sie einzig und allein die Kühe unter ihre Obhut nehmen. Eine bestimmte Brunftzeit scheint nicht stattzufinden; Harris versichert wenigstens, daß man zu allen Jahreszeiten trächtige Kühe und neugeborene Kälber finde. Die Dauer der Trächtigkeit beträgt, wie man an Gefangenen beobachtet hat, 282 Tage.
Jung eingefangene Elenantilopen lassen sich ebenso leicht, vielleicht leichter noch zähmen als gutmütige Wildrinder, begeben sich ohne Bedenken unter die Pflegerschaft einer kalbfreundlichen Kuh, mischen sich später unter die Herden des Weidehornviehes und erweisen sich selbst noch in höherem Alter als verhältnismäßig sanftmütig und lenksam. In der Neuzeit sind sie in den Tiergärten Europas eine gewöhnliche Erscheinung geworden.
Der Nutzen der Elenantilopen ist sehr bedeutend. Ein schweres Eland wiegt über 500, das unter dem Herzen abgelagerte Fett allein zuweilen 25 Kilogramm. Das Fleisch wird auf dem Jagdfelde selbst zerschnitten und entweder gedörrt oder eingesalzen, in Felle gepackt und auf dem mitgenommenen Wagen nach Hause gebracht, wo es geräuchert einen Vorrat von einem sehr gesunden und wohlfeilen Nahrungsmittel abgibt; das Fett wird, mit etwas Rindertalg und ein wenig Alaun vermischt, zu guten Kerzen verwendet, die ungemein dicke, zähe Haut endlich zu vortrefflichen Riemen verarbeitet. Das Elandwildbret hat, noch Lichtenstein, am meisten Ähnlichkeit mit dem unseres Rindfleisches, jedoch einen Nebengeschmack, der vorzüglich auffallend und unangenehm wird, wenn man genötigt ist, mehrere Tage hintereinander von frischem Elandfleisch sich zu nähren: geräuchert aber verliert es diesen Geschmack ganz und gar, und besonders die sogenannten » Biltongen« oder Keulenzungen, die man roh genießt, bilden eine wahre Leckerei. Dieselben bestehen aus geräucherten Muskeln der Keule, die man nach ihrer ganzen Länge ausschneidet, sodann schwach räuchert und zu dünnen Scheiben schneidet, mit denen man Butterbrot belegt.
Abgesehen von dem Menschen hat die Elenantilope zwar von mancherlei Feinden zu leiden, aber doch nur wenige derselben zu fürchten. Schmarotzer verschiedener Art quälen sie ebenso wie das am Vorgebirge lebende Rindvieh, von Raubtieren dürfte ihr aber wohl nur der Löwe gefährlich werden.
*
Eine der merkwürdigsten Arten der ganzen Familie, ja aller Wiederkäuer, ist die Schikara ( Tetraceros quadricornis), eine Vertreterin der Sippe der Vierhornantilopen ( Tetraceros). Unter den gezähmten Wiederkäuern kommen einzelne vor, die vier, ja sogar acht Hörner tragen; sie begründen aber niemals eine eigene Art, sondern sind als sonderbare Ausnahmen zu betrachten. Kein einziges wild lebendes Tier zeigt eine ähnliche Wucherung der Hörner wie die genannte Antilope. Sie steht deshalb, nach den bisherigen Erfahrungen wenigstens, durchaus vereinzelt für sich da.
Die Vierhornantilope oder Schikara ist ein kleines, zierliches Tier. Ihre Länge beträgt 85 Zentimeter, die des Schwanzes 14 Zentimeter, die Höhe am Widerrist 50 Zentimeter. Das vordere Hörnerpaar sitzt oberhalb des vorderen Augenwinkels und ist etwas nach rückwärts geneigt, das hintere Paar steht über dem hinteren Augenwinkel, wendet sich in seiner unteren Hälfte stark nach hinten und krümmt sich in der oberen nach vorn, ist unten geringelt, nach der Spitze aber glatt und gerundet. Große abgerundete Ohren, lang ausgezogene Tränengruben, eine breite, nackte Nasenkuppe, schlanke Läufe und ein langes und straffes Haarkleid, das auf der oberen Seite braunfahl, unten weiß und bei dem Weibchen lichter als beim Männchen ist, kennzeichnen das Tier noch außerdem.
Nach Hartwickes Berichten ist die Schikara in Indien durchaus nicht selten, in den westlichen Gegenden Bengalens sogar häufig. Sie bewohnt dort die Hügel und die bewaldeten Gegenden. Ihre große Scheu und Behendigkeit machen die Beobachtung der frei lebenden schwierig, und von den wenigen, die man in der Gefangenschaft hielt, weiß man auch bloß, daß selbst jung eingefangene mit zunehmendem Alter immer bösartiger wurden. Böcke zeigten sich zur Brunstzeit so aufgeregt, daß sie dreist auf jedes andere Haustier losgingen und mit boshafter Entschlossenheit selbst den bekannten Wächter angriffen, der sie täglich fütterte. Die Gefangenen, die Hartwicke hielt, pflanzten sich fort. Das Weibchen setzte zwei Kälber auf einmal.
*
In der Gruppe der Zwergantilopen ( Neotragus) vereinigt man die kleinsten Arten der Familie, überaus zierlich gebaute, einander höchst ähnliche Tierchen, bei denen nur die Männchen sehr kleine und dünne, aufrechtstehende, pfriemenartige, unten mit wenigen Ringen oder Halbringen umgebene Hörner tragen; der rundliche Kopf, die spitzige Nase mit kleiner Muffel kennzeichnen sie außerdem. In ihrer Lebensweise und ihrem Wesen ähneln sich alle bekannten Arten, so daß es genügen dürfte, wenn ich vorzugsweise eine von mir selbst beobachtete Zwergantilope ins Auge fasse und mit dieser Schilderung das über andere Arten Bekannte verbinde. Die Windspielantilope, Beni Israel der Bewohner Massauas, Edro der Tigrier ( Neotragus Hemprichii), ist einer der zierlichsten Wiederkäuer, die es gibt. Der Bock trägt ein kleines Hörnerpaar mit zehn bis zwölf Halbringen an der unteren Hälfte der Außenseite und mit nach vorn gebogenen Spitzen, die von dem stark entwickelten Haarschopfe fast verdeckt und durch die sehr langen Ohren gänzlich in den Schatten gestellt werden. Der Leib ist gedrungen, der Schwanz ein kurzbehaarter Stummel; die Läufe sind mittellang, aber außerordentlich schwach, die Hufe lang, schmal und zugespitzt, die Afterklauen kaum bemerklich. Sehr feine und ziemlich lange Haare decken den Leib. Das Kleid erscheint fuchsig und graubläulich, weil die einzelnen, an der Wurzel graubräunlich aussehenden Haare vor der dunklen, aber kaum bemerklichen Spitze licht und rötlich umrandet sind. Auf dem Rücken geht die Färbung in das Rotbraune, auf dem Nasenrücken und der Stirn in das Fuchsrote über; die Vorderschenkel sind oft gefleckt, die unteren Teile und die Innenseite der Läufe weiß. Ein breiter Streifen über und unter den Augen ist weiß; die Ohren sind schwärzlich gesäumt, die Hörner, Hufe und Tränengruben schwarz.
In Abessinien wird man vom Meeresstrande an bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe unsere Beni Israel (zu deutsch: Kinder Israel) an geeigneten Orten selten vermissen. Fast alle Zwergantilopen sind Bewohner der Buschwälder, an denen Afrika so reich ist. Dickichte, die für andere, größere Antilopen so gut wie undurchdringlich sein würden, gewähren diesen Liliputanern prächtige Wohnsitze. Für sie findet sich auch zwischen den engsten Verschlingungen noch ein Weg und in den ärgsten Dornen noch ein Pförtchen. Der Edro zieht das Tal entschieden der Höhe vor. Am liebsten sind ihm die grünen Waldsäume der Regenstrombetten. Hier gibt es herrliche Versteckplätze, Mimosen, Christusdornen, einige Wolfsmilchgesträuche und andere größere Pflanzen werden von einem wahren Netze von Schlingpflanzen umflochten und durchwebt. Es finden sich köstliche Lauben und nach außen vollkommen abgeschlossene Gebüsche, deren Inneres wohnlich und gänzlich verborgen ist, oder aber schmale Dickichte, die jedoch auf lange Strecken hin ununterbrochen verbunden sind. Weiter von der belebenden Wasserader weg stellen sich die Büsche einzelner, und ein grünes, saftiges Gras kann sich dort erheben. Hier begegnet man dem Edro mit aller Sicherheit. Er lebt wie die meisten seiner Verwandten, über die wir Kunde haben, streng paarweise, niemals in Trupps, es sei denn, daß ein Pärchen einen Sprößling erhalten habe, der der Mutterpflege noch bedarf. Dann trollt auch dieser hinter den Eltern her.
An dem einmal gewählten Standorte scheint jedes Paar der Windspielantilope treulich festzuhalten, solange es von dort nicht vertrieben oder ihm in der Nähe ein noch besserer Versteckplatz geboten wird. An einigen Regenstrombetten in der Samhara Abessiniens, die ich während meines kurzen Aufenthaltes viermal berührte, fand ich den Edro immer genau auf denselben Stellen, wo ich ihn früher gesehen hatte. Alle Zwergantilopen äsen vorzugsweise von dem Blätterwerk der Gebüsche, in denen sie hausen. Dem Beni Israel gibt wahrscheinlich die Mimose den größten Teil seiner Nahrung. Außer den zart gefiederten Blättern, denen man es gleich anzumerken meint, daß sie solchen kleinen Leckermäulern wohl genügen müssen, werden aber grüne Triebe und Knospen auch nicht verschmäht, und oft sieht man, wie südafrikanische Jäger versichern, die gewandten Geschöpfe sogar an schiefen Stämmen der Buschwälder emporsteigen, um an höheren Ästen zu äsen.
Auch der Beni Israel schlägt sich, wie die Gazelle, seichte Kessel aus, in denen er seine Losung absetzt. Diese, in Gestalt, Größe und Färbung Hasenschroten gleich, gibt dem Jäger jederzeit den sichersten Anhaltspunkt zu der nicht unwichtigen Bestimmung, ob das Pärchen, von dem der Kessel herrührt, noch zu finden sein wird oder bereits getötet, bezüglich vertrieben wurde. Gewöhnlich findet sich ein solcher Abort der reinlichen Tiere zwischen zwei dichteren Büschen, unweit der Laube, die den Lieblingsaufenthalt bildet.
Wenn man erst die Sitten des Edro kennengelernt hat, ist seine Jagd ebenso einfach als ergiebig. Zwei Jäger brauchen sich keine große Mühe zu geben. Der eine folgt dem satzweise dahinflüchtenden Pärchen, der andere bleibt dort stehen, von wo es aufging. Oft genug kommt der Verfolgende zum Schuß, sicher der, der sich anstellt. Ist die Jagdgesellschaft größer, so bildet sie einen einfachen Halbmond und läßt durch Treiber oder durch Hunde den Buschrand an beiden Ufern des Regenstromes absuchen. Nach einigen Schüssen geht der Beni Israel regelmäßig zurück und muß die Schützenlinie kreuzen. An Orten, wo er noch keine Nachstellungen erfuhr, bleibt er häufig ruhig auf den Blößen in der Dickung stehen, vielleicht, weil er seine Gleichfarbigkeit mit der Umgebung überschätzt. Anfänglich gebrauchte ich bei meinen Jagden die Büchse, später das Schrotgewehr, und dieses ist auch die einzige geeignete Waffe zur Jagd unseres Tierchens. Ganz abgesehen, daß der Zwerg, wenn er selbst nur auf siebzig oder achtzig Schritte draußen steht, mit der Büchse auf das Korn genommen sein will, hat der Jäger selten Freude, wenn er seine Lieblingswaffe benutzte, weil die Kugel fast regelmäßig ein so ungeheures Loch in den kleinen Körper reißt, daß er das erlegte Wild nicht gern mehr ansehen mag. Das Schrotgewehr kommt übrigens auch zu seinem Recht; denn eine in voller Flucht dahinjagende Zwergantilope ist vor jedem Sonntagsschützen sicher; sie verlangt ein sehr gutes Auge und eine geübte Hand. Zudem wimmeln dieselben Büsche, in denen das Zwergböckchen lebt, von Frankolinen und Perlhühnern, die man doch auch nicht gern unbehelligt wegfliegen läßt, aber selbstverständlich mit der Büchse nicht erlegen kann.
Das Wildbret des Beni Israel ist ziemlich hart und zähe, obwohl noch immer eine leidliche Speise. Es eignet sich fast mehr zur Bereitung von Suppe als zum Braten. Auf Draysons Rat habe ich mich hauptsächlich an die Leber der Zwergantilope gehalten und muß jenem Gewährsmanne recht geben, daß sie ein wahrer Leckerbissen ist.
Nächst dem Menschen ist der schlimmste Feind der Zwergantilopen wohl überall der Leopard. In Habesch zieht er gerade die Dickichte, wo sich Edros aufhalten, allen übrigen Jagdplätzen vor. Wenn auch die Windspielantilopen den ganzen Tag über in Bewegung sind, zeigen sie doch in den Frühstunden und noch mehr gegen Abend eine besondere Regsamkeit. Um diese Zeit begegnet man der gewandten Katze häufig auf ihren Schleichwegen, und noch viel öfter mag sie vorhanden sein, ohne daß man eine Ahnung hat. Im Süden mag der Serwal und im Sudan die Falbkatze dem widerstandsunfähigen Zwerge ebenfalls nachstellen, und höchst wahrscheinlich nimmt auch der Raubadler hier und da wenigstens ein Kälbchen weg.
*
Alle Bergantilopen zeichnen sich vor den übrigen durch ihren gedrungenen, kräftigen Leibesbau aus. Die Schlankheit der Formen und namentlich die Höhe der Läufe, die einzelne Arten uns so anmutig erscheinen läßt, ist bei den Gebirgskindern fast ganz verschwunden. Sie sind im Gegenteil verhältnismäßig dickleibig und kurzbeinig und ihre Hufe so gestellt, daß das ganze Gewicht des Tieres auf den Spitzen ruht. Der Fuß bekommt hierdurch etwas sehr Bezeichnendes, der Huf verkürzt sich, die Schale läuft nach vorn hin nicht so spitzig aus, sondern ist mehr gerundet; auch reichen die Afterklauen weiter herab als bei denen, die nur die Ebene beleben. Ein mehr oder weniger dichtes und straffes Haarkleid kennzeichnet die Bewohner der kühlern Höhe nicht minder. Solcher Leibesbau ist allen gemeinsam; hinsichtlich der Behornung aber finden sich Unterschiede, indem bald beide Geschlechter, bald nur die Männchen bewaffnet sind; auch ändern die Hörner vielfach ab.
Unter den hierher zu zählenden Antilopen vertritt der Klippspringer der Ansiedler des Vorgebirges der Guten Hoffnung oder die Sassa der Abessinier ( Oreotragus saltatrix) eine besondere Gruppe. Hinsichtlich seiner Gestalt steht dieses reizende Tier zwischen der Gemse und manchen kleinen Ziegenarten ungefähr in der Mitte. In der Gesamtfärbung ähnelt die Sassa unserm Reh. Sie ist oben und außen olivengelb und schwarz gesprenkelt, unten blässer, aber immer noch gesprenkelt; nur die Kehle und die Innenseiten der Beine sind einförmig weiß. Die Länge beträgt gegen 1 Meter, die Höhe etwa 60 Zentimeter.
»Oft habe ich«, sagt Gordon Cumming, »wenn ich in einen Abgrund hinunterschaute, zwei oder drei dieser anziehenden Geschöpfe nebeneinander liegen sehen, gewöhnlich auf einer großen, flachen Felsenplatte, die durch den freundlichen Schatten des Sandels oder anderer Gebirgsbäume vor der Gewalt der Mittagssonne geschützt war. Scheuchte ich die Flüchtigen auf, so sprangen sie in unglaublicher Weise mit der federnden Kraft eines Gummiballes von Klippe zu Klippe, über Klüfte und Abgründe hinweg; immer mit der größten Behendigkeit und Sicherheit.« Diese Worte des berühmten Jägers fielen mir ein, als ich im Mensatale zum erstenmal hoch oben auf haarscharfem Grate zwei Antilopen stehen sah, gemächlich hin und her sich wiegend, als gäbe es keine Abgründe zu beiden Seiten. Das mußten Klippspringer sein; ich wußte es, ohne jemals vorher einen von ihnen oder auch nur eine Gemse im Freileben gesehen zu haben. Später fand ich Gelegenheit, die schmucken Geschöpfe noch etwas besser kennenzulernen.
Der Klippspringer oder die Sassa findet sich auf nicht allzu niederen Gebirgen, in den Bogosländern etwa auf solchen zwischen 600 und 2500 Meter unbedingter Höhe. Sie lebt paarweise; dennoch sieht man von ihr häufig kleine Trupps aus drei und selbst aus vier Stücken bestehend, entweder eine Familie mit einem Jungen oder zwei Pärchen, die sich zusammengefunden haben und eine Zeitlang miteinander dahinziehen. Bei gutem Wetter sucht jeder Trupp soviel als möglich die Höhe auf, bei anhaltendem Regen steigt er tiefer in das Tal hinab. Solange das Gras taunaß ist, treiben sie sich stets auf den Blöcken und Steinen umher; in der Mittagsglut aber suchen sie unter den Bäumen oder auch unter großen Felsplatten Schutz, am liebsten gelagert auf einen beschatteten Block, der nach unten hin freie Aussicht gewährt. Von Zeit zu Zeit erscheint wenigstens einer der Gatten auf der nächsten Höhe, um von dort aus Umschau zu halten. Jedes Paar hält an dem einmal gewählten Gebiete mit großer Zähigkeit fest. Pater Filippini in Mensa konnte mir mit vollster Bestimmtheit sagen, auf welchem Berge ein Paar Sassas ständen; er wußte die Aufenthaltsorte der Tiere bis auf wenige Minuten hin sicher zu bestimmen.
Das Geäse des Klippspringers besteht aus Mimosen- und andern Baumblättern, Gräsern und saftigen Alpenpflanzen und wird in den Vormittags- und späteren Nachmittagsstunden eingenommen. Um diese Zeit versteckt sich die Sassa förmlich zwischen den Euphorbiensträuchern oder dem hohen Grase um die Felsblöcke herum, und der Jäger bemüht sich vergeblich, eines der ohnehin schwer wahrnehmbaren Tiere zu entdecken.
Man darf nicht behaupten, daß die Sassa besonders scheu sei; jedoch ist dies wahrscheinlich bloß deshalb der Fall, weil die Abessinier wenig Jagd auf sie machen. Mehrmals habe ich sie von niederen Bergrücken ruhig und unbesorgt auf uns unten im Tale herabäugen sehen, obgleich wir in gerechter Schußnähe dahinzogen. Sie stand gewöhnlich, starr wie eine Bildsäule, auf einer vorspringenden Felsplatte, die Lichter fest auf uns gerichtet, das große Gehör seitlich vom Kopf abgehalten, ohne durch eine andere Bewegung, als durch Drehen und Wenden der Ohren, Leben zu verraten. Augenscheinlich hatte sie die Tücke des Menschen hier noch nicht in ihrem vollen Umfange erfahren; denn überall, wo sie schon Verfolgung erlitten hat, spottet sie der List des Jägers und entflieht schon auf ein paar hundert Meter Entfernung vor ihm. Der Knall eines Schusses bringt bei dem Klippspringer eine merkwürdige Wirkung hervor. Wenn der Jäger fehlte, sieht er ihn bloß noch eine Viertelminute lang; später ist er verschwunden. Mit Vogelschnelle springt das behende Geschöpf von einem Absatz zum andern, an den steilsten Felswänden und neben grausigen Abgründen dahin, mit derselben Leichtigkeit, wenn es aufwärts, wie wenn es abwärts klettert. Die geringste Unebenheit ist ihm genug, festen Fuß zu fassen; seine Bewegungen sind unter allen Umständen ebenso sicher als schnell. Am meisten bewundert man die Kraft der Läufe, wenn die Sassa bergaufwärts flüchtet. Jede ihrer Muskeln arbeitet. Der Leib erscheint noch einmal so kräftig als sonst, die starken Läufe wie aus federndem Stahl geschmiedet. Jeder Sprung schnellt das Tier hoch in die Luft; bald zeigt es sich ganz frei den Blicken, bald ist es wieder zwischen den Steinen oder in den meterhohen Pflanzen verschwunden, die die Gehänge bedecken. Mit unglaublicher Eile jagt es dahin; wenige Augenblicke genügen, um es außer Bereich der Büchse zu bringen.
Wie es scheint, fällt in Habesch die Satzzeit der Sassa zu Anfang der großen Regenzeit. Im März traf ich ein Pärchen, in deren Geleite sich der etwa halbjährige Sprößling noch befand. Genaues wußten mir die Abessinier nicht anzugeben, obwohl der Klippspringer ihnen allen ein sehr bekanntes Tier ist. In Habesch hält man die Sassa nirgends in der Gefangenschaft; wohl aber jagt man sie ihres Wildbrets halber. Die Decke wird hier nicht benutzt, während man sie am Kap zu Polstern, Satteln und dergleichen verwendet.
*
An diese fremden Antilopen können wir unsere deutschen anschließen. Das anmutige, vielfach verfolgte Kind unserer Gebirge, die Gemse oder Gams ( Capellarupicapra), die einzige Art der Sippe, erreicht eine Länge von 1,1 Meter, wovon auf den Schwanz 8 Zentimeter kommen, bei einer Höhe am Widerrist von 75, am Kreuz von 80 Zentimeter, sowie ein Gewicht von 40 bis 45 Kilogramm. Die Hörner sind, der Krümmung nach gemessen, ungefähr 25 Zentimeter lang, stehen bei dem Bock weiter auseinander und sind auch stärker und gekrümmter als bei der Geiß. Im übrigen gleichen sich beide Geschlechter fast vollständig, obwohl die Böcke in der Regel etwas stärker sind als die Geißen. Das Haar ist ziemlich derb, im Sommer kurz, d. h. höchstens 3 Zentimeter lang, an der Wurzel braungrau, an der Spitze hellrostfarben, im Winter dagegen 10 bis 12 Zentimeter, das der Rückenfirste, das den sogenannten Bart bildet, sogar 18 bis 20 Zentimeter lang und am Ende schwarz. Hierdurch wird je nach der Jahreszeit ein verschiedenfarbiges Kleid bedingt. Im Sommer geht die allgemeine Färbung, ein schmutziges Rotbraun oder Rostrot, auf der Unterseite ins Hellrotgelbe über; längs der Mittellinie des Rückens verläuft ein schwarzbrauner Streifen; die Kehle ist fahlgelb, der Nacken weißgelblich; auf den Schultern, den Schenkeln, der Brust und in den Weichen wird diese Färbung dunkler; ein Streifen auf der Hinterseite zeigt eine Schattierung der gelben Farbe fast bis zum Weiß. Der Schwanz ist auf der Oberseite und an der Wurzel rotgrau, auf der Unterseite und an der Spitze schwarz. Von den Ohren an über die Augen hin läuft eine schmale, schwärzliche Längsbinde, die scharf von der fahlen Färbung absticht. Über den vordern Augenwinkeln, zwischen den Nasenlöchern und der Oberlippe stehen rotgelbe Flecken. Während des Winters ist die Gemse oben dunkelbraun oder glänzend braunschwarz, am Bauch weiß; die Beine sehen unten heller aus als oben und ziehen mehr ins Rotfarbene; die Füße sind gelblichweiß wie der Kopf, der auf dem Scheitel und an der Schnauze etwas dunkelt. Die Längsbinde von der Schnauzenspitze zu den Ohren ist dunkelschwarzbraun. Beide Kleider gehen so allmählich ineinander über, daß das reine Sommer- und Winterkleid immer nur sehr kurze Zeit getragen werden. Junge Tiere sind rotbraun und heller um die Augen gefärbt.

Gemse (Capella rupicapra)
Lichtfarbige Spielarten oder Weißlinge werden selten beobachtet; unter mindestens viertausend Gemsen, die Graf Hans Wilczek zu sehen Gelegenheit hatte, befand sich nur eine einzige von weißlicher Färbung. Auch Mißbildungen des Gehörns sind selten. Hier und da zeigt man zwar Schädel mit vier Hörnern; sie sind aber nichts anderes als in betrüglicher Absicht mit Krickeln besetzte vierhörnige Ziegenschädel. Wenn Mißbildungen vorkommen, war stets eine Verletzung des Gehörns deren Ursache.
Alle Jäger unterscheiden Grat- und Waldtiere, oder aber Kees-, d. i. Gletscher-, und Laubgemsen. Erstere sind stets schwächer von Wildbret als letztere, jedenfalls nur infolge der minder reichlichen Nahrung, über die sie verfügen können, und in der Regel auch weniger dunkel gefärbt; beide aber dürfen nicht einmal als Spielarten aufgefaßt werden.
Einzelne Forscher haben die Ansicht ausgesprochen, daß die auf den Pyrenäen und den Gebirgen der kantabrischen Küste und ebenso die aus dem Kaukasus lebenden Gemsen von der unsrigen bestimmt sich unterscheiden und deshalb als besondere Arten zu betrachten seien; es fehlen uns jedoch zur Zeit genügende Beweise für die Richtigkeit dieser Auffassung.
Die iberische Gemse, auf den Pyrenäen » Ifard« genannt ( Capella pyrenaica), ist, wie mir mein Bruder schreibt, durch ihre geringere Größe und die auffallend kleinen Hörner sowie durch das fuchsrote Sommerkleid ohne Rückenstreifen sehr ausgezeichnet, und auch die im Kaukasus lebende » Atschi« genannte Form ( Capella caucasica) soll von der Alpengemse nicht unwesentlich verschieden sein; ich glaube jedoch, daß es sich bei beiden einzig und allein um örtliche Spielarten handeln dürfte, wie solche bei den meisten weit verbreiteten Säugetieren beobachtet werden, und trage deshalb Bedenken, beide Formen als besondere Arten aufzuführen.
Als die wahre Heimat der Gemse dürfen die Alpen bezeichnet werden. Ihr Verbreitungsgebiet dehnt sich allerdings noch bedeutend weiter aus, da Gemsen auch in den Abruzzen, Pyrenäen, den Gebirgen der kantabrischen Küste, Dalmatiens und Griechenlands, auf den Karpathen, insbesondere den Gipfeln der Hohen Tatra, den transsylvanischen Alpen und endlich auf dem Kaukasus, in Taurien und Georgien gefunden werden; als Brennpunkt dieses Gebietes dürfen wir jedoch unsere Alpen ansehen. Vergeblich hat man versucht, in Norwegen sie einzubürgern, die Angelegenheit freilich auch nicht mit Nachdruck betrieben. In den Alpen findet sie sich gegenwärtig in der Schweiz selten, jedenfalls in ungleich geringerer Anzahl als in den östlichen Alpen, wo sie namentlich in Oberbayern, Salzburg und dem Salzkammergute, Steiermark und Kärnten, gehegt und geschont durch wohlhabende und jagdverständige Großgrundbesitzer oder Jagdpächter, in sehr bedeutender Menge lebt. Auch die steilen, unzugänglichen Höhen der Mittelkarpathen beherbergen sie, obgleich sie dort keine Hegung genießt, in erfreulicher Anzahl.
Die allgemein verbreitete Meinung, daß die Gemse ein Alpentier im engsten Sinne des Wortes sei, d. h. ausschließlich über dem Waldgürtel, in unmittelbarer Nähe der Gletscher, sich umhertreibe, ist falsch; denn sie gehört von Hause aus zu den Waldantilopen. Überall, wo sie geschont wird, bewohnt sie mit entschiedenster Vorliebe jahraus, jahrein den oberen Holzgürtel. Von diesem aus steigt sie im Sommer allerdings in mehr oder minder großer Anzahl zu den höheren Lagen des Gebirges empor, hält sich wochen- und monatelang in der Nähe des Firnschnees und der Gletscher auf, die höchstgelegenen Matten und das baumlose Gefelse zeitweilig zu ihrem Aufenthalte erwählend; die Mehrzahl aller Gemsen eines Gebiets aber wird auch im Laufe des Sommers im oberen Waldgürtel angetroffen, und selbst die sogenannten Grat- oder Gletschertiere finden sich bei heftigem Unwetter, insbesondere vor starken Stürmen, die sie oft schon zwei Tage vorher zu ahnen scheinen, oder im Spätherbst und Winter im Walde ein, kehren jedoch sobald als möglich wieder zur gewohnten Höhe zurück, weil hier der Schnee fast immer früher abgeweht wird oder wegtaut als im Tal. Der zeitweilige Stand wird im Sommer auf den westlichen und nördlichen Bergseiten, in den übrigen Jahreszeiten dagegen auf den östlichen und südlichen gewählt, und dies erklärt sich auch einfach dadurch, daß die Gemse, wie alles feinsinnige Wild, ihren Aufenthaltsort der jeweiligen Witterung anpaßt. Ungestört hält das Rudel so ziemlich an demselben, freilich stets weit begrenzten Stande fest; doch wechselt es ebenso ohne äußere Ursache, und zwar je nach der Gegend verschieden, mir gewordenen glaubwürdigen Mitteilungen erfahrener Gemsjäger zufolge, sogar bis zu zehn oder zwölf Gehstunden weit, gelangt dabei zuweilen, obschon in seltenen Fällen, auch wohl in Gebiete, in denen seit Menschengedenken Gemswild nicht mehr vorgekommen ist. Alte Böcke sind zu derartigen Streifzügen stets mehr geneigt als Geißen und junge Böcke oder überhaupt Gemsen, die sich rudeln.
Wie der größere Teil aller Antilopen, gehört auch die Gemse zu den Tagtieren. Sie ist bei Tage in Bewegung und ruht des Nachts. Mit Beginn der Morgendämmerung erhebt sie sich von dem Lager, auf das sie sich mit Dunkelwerden eintat, und tritt auf Äsung, hierbei in der Regel langsam abwärts schreitend; die Vormittagsstunden verbringt sie wiederkäuend im Schatten vorstehender Felsen oder unter den Zweigen älterer Schirmtannen, größtenteils, auf den zusammengebogenen Läufen liegend, behaglich hingestreckt; um die Mittagszeit steigt sie langsam bergauf, ruht nachmittags wiederum einige Stunden unter Bäumen, auf vorspringenden, glatten Felsenplatten, auf Firnschnee und ähnlichen Örtlichkeiten, meist auf freien und nicht auf bestimmten, regelmäßig wieder aufgesuchten Stellen, sondern beliebig bald hier, bald dort, tritt gegen Abend nochmals auf Äsung und legt sich nach Eintritt der Dämmerung zur Ruhe nieder. Von diesem Tageslauf soll sie während des Sommers in hellen Mondscheinnächten dann und wann eine Ausnahme machen. Im Spätherbst und Winter weidet sie während des ganzen Tages, und nachdem Schnee gefallen ist, steigt sie in den tiefen Lagen des Gebirges, die sie jetzt bezogen hat, besonders gern auf die Sonnenseite der Berge, weil hier der Schnee nicht so leicht haftet wie auf der im Schatten gelegenen Seite. Das nächtliche Lager wird sehr verschieden gewählt, immer aber auf solchen Stellen aufgeschlagen, die eine weite Umschau und namentlich einen mühelosen Überblick der Tiefe gewähren. Besondere Vorbereitungen trifft unsere Antilope nicht, lagert sich vielmehr an jeder ihr passend erscheinenden Stelle ohne weiteres auf den Boden und den Felsen.
Als höchst geselliges Tier vereinigt sich die Gemse zu Rudeln von oft sehr beträchtlicher Anzahl. Diese Gesellschaften werden gebildet durch die Geißen, deren Kitzchen und die jüngeren Böcke bis zum zweiten, höchstens bis zum dritten Jahr. Alte Böcke leben außer der Brunstzeit für sich oder vereinigen sich vielleicht mit einem, zweien oder dreien ihresgleichen, pflegen jedoch, wie es scheint, mit diesen niemals längere Zeit innige Gemeinschaft. Im Rudel übernimmt eine alte erfahrene Geiß die Leitung, wird aber keineswegs dazu von den übrigen Mitgliedern des Trupps erwählt und noch weniger bei mangelnder Wachsamkeit aus demselben ausgestoßen, wie vormals von alten Jägern behauptet worden ist. Dieses Leittier regelt meist, aber durchaus nicht immer, die Bewegungen des Rudels, ebensowenig als dieses sich einzig und allein auf seine Wachsamkeit verläßt. Allerdings bemerkt man bei jedem gelagerten Rudel regelmäßig eine oder mehrere aufrecht stehende und um sich blickende Gemsen, und diese sind es zumeist auch wohl, die den übrigen vom Herannahen eines gefahrdrohenden Wesens Kunde geben; sie üben aber nicht ein ihnen übertragenes Amt aus, sondern folgen einfach einem Triebe, der alle gleichmäßig beherrscht und sich bei allen in gleicher Weise äußert. Jede Gemse, die etwas Verdächtiges gewahrt, drückt dies durch ein auf weithin vernehmbares, mit Aufstampfen des einen Vorderfußes verbundenes Pfeifen aus, und das Rudel ergreift, sobald es sich von der Tatsächlichkeit der Gefahr überzeugt hat, nunmehr sofort die Flucht, wobei immer eine, wahrscheinlich die älteste Geiß die Führung übernimmt. Ihr folgt, laut Grill, das zuletzt gesetzte Kitzchen, diesem der sogenannte Jährling und hierauf das übrige Rudel in mehr oder minder bunter Reihe.
Hinsichtlich ihrer Bewegungen wetteifert die Gemse mit den uns bereits bekannten Bergsteigern ihrer Familie. Sie ist ein geschickter Kletterer, ein sicherer Springer und ein kühner und rüstiger Bergsteiger, der auch aus den gefährlichsten Stellen, wo keine Alpenziege hinaufzuklettern wagt, rasch und behend sich bewegt. Wenn sie langsam zieht, hat ihr Gang etwas Schwerfälliges, Plumpes und die ganze Haltung etwas Unschönes; sowie aber ihre Aufmerksamkeit erregt und sie flüchtig wird, ändert sich das ganze Tier gleichsam um. Es erscheint frischer, kühner, edler und kräftiger und eilt mit raschen Sätzen dahin, in jeder Bewegung ebensoviel Kraft als Anmut kundgebend. Über die außerordentliche Sprungfähigkeit sind einige bestimmte Beobachtungen gemacht worden, v. Wolten maß, wie Schinz berichtet, den Sprung einer Gemse und fand ihn sieben Meter weit. Wo nur immer ein kleiner Vorsprung sich zeigt, kann die Gemse ansetzen, und sie erreicht in wenigen Sätzen die Höhe wie im Fluge, indem sie dabei einen Anlauf nimmt und schief aufwärts zu kommen sucht. Über die steilsten Klippen läuft sie mit derselben Sicherheit wie ihre Geistes- und Leibesverwandten, und da, wo man glauben sollte, es sei unmöglich, daß ein Tier von solcher Größe Fuß fassen könnte, eilt sie mit Blitzesschnelle sicher davon. Sie springt leichter bergauf als bergab und setzt mit außerordentlicher Behutsamkeit die Vorderfüße, in denen sie eine große Gelenkigkeit besitzt, auf, damit sie keine Steine lostrete. Selbst schwer verwundet stürmt sie noch flüchtig auf den furchtbarsten Pfaden dahin; ja sogar dann, wenn ihr ein Bein weggeschossen wurde, zeigt sie kaum geringere Behendigkeit, als solange sie noch gesund ist. »Wie oft man es auch gesehen haben mag«, sagt Kobell, »immer ist zu staunen, wie die Gemsen an ganz steilen Wänden, wo nur ein Wechsel, den sie selber mit einer gewissen Vorsicht annehmen, beim fallenden Schusse durcheinander rumpeln, ohne daß eine ungetroffen herunterstürzt. Es reicht eine hervorragende Stelle von zwei Zentimeter hin, um ihnen fortzuhelfen, wobei sie oft mit gewaltigen Sprüngen über ganz unhaltbare Stellen wegsetzen und doch gleich wieder anhalten können. Unter Umständen vertragen sie auch ein Abstürzen, das man gesehen haben muß, um es für möglich zu halten.« Eine Bestätigung der letzteren Angabe wurde mir durch Herrn Mühlbacher, den verläßlichen Oberjäger des Grafen Wilczek, der sah, daß ein Gemsbock, im Springen das ins Auge gefaßte Ziel verfehlend, ohne die Wand zu berühren, in eine Tiefe stürzte, die, nach Mühlbachers Schätzung, wenig unter hundert Meter betragen konnte. Glücklicherweise fiel das Tier auf eine sogenannte Schütte, einen feinkörnigen Schotterkegel, der die Wucht des Sturzes brach. Ohne erkennbare Verletzung, ja sogar ohne merkliches Unbehagen setzte dieser Bock nach kurzem Besinnen seinen Weg fort und erklomm, rüstig wie ein gesunder, die Wand an einer andern Stelle. Ungeachtet ihrer Geschicklichkeit und Gewandtheit sollen sich, laut Schinz, die Gemsen zuweilen doch so versteigen, daß sie weder vorwärts noch rückwärts kommen, keinen Fuß mehr fassen können und entweder durch Hunger verderben oder in den Abgrund stürzen müssen. Tschudi berichtigt diese Angabe dahin, daß die Gemse unter allen Umständen versuche, das Unmögliche möglich zu machen, indem sie in den Abgrund springt, ob sie auch unten zerschelle. Daß die Gemsen an steilen Felsenwänden hinunterschnurren, ist eine allen Kärntner und steierischen Jägern wohlbekannte Tatsache; mein alter, erfahrener Jagdfreund Morhagen erzählte mir auch, daß hartbedrängte Gemsen nötigenfalls ohne Bedenken, weil in der Regel mit Glück, zwölf bis sechzehn Meter tief hinabspringen. Höchst vorsichtig bewegt sich die Gemse beim Überschreiten schneebedeckter Gletscher und weicht hier verschneiten Spalten stets sorgfältig aus, obgleich sie dieselben durch das Gesicht nicht wahrnehmen kann. Ebenso geht sie auf Felsengehängen äußerst besorglich und langsam dahin. Einige Glieder des Trupps richten ihre Aufmerksamkeit auf die Pfade; die übrigen spähen unablässig nach anderer Gefahr. »Wir haben gesehen«, erzählt Tschudi, »wie ein Gemsenrudel ein gefährliches, sehr steiles, mit Geröll bedecktes Felsenkamin überschreiten wollte, und uns über Geduld und Klugheit der Tiere gefreut. Eines ging voran und stieg sacht hinauf, die übrigen warteten der Reihe nach, bis es die Höhe ganz erreicht hatte, und erst als kein Stein mehr rollte, folgte das zweite, dann das dritte und so fort. Die oben angekommenen zerstreuten sich keineswegs auf der Weide, sondern blieben am Felsenrande auf der Spähe, bis die letzten sich glücklich zu ihnen gesellt hatten.« Dieselbe Vorsicht und dasselbe Geschick beweist die Gemse, wie mir ein erfahrener Gemsenjäger mitteilte, beim Übersetzen der rauschenden Wildbäche des Gebirges. Nötigenfalls springt sie allerdings mitten ins Wasser und schnellt sich dann weiter; wenn sie jedoch nicht bedrängt ist, überlegt sie erst lange, an welcher Stelle sie den Übergang bewerkstelligen soll, läuft zu diesem Ende am Wildwasser hinauf und herab, besichtigt die verschiedenen Stellen, die ihr Vorhaben ausführbar erscheinen lassen, und wählt schließlich die geeignetste. Mein Gewährsmann sah eine Gemse den hochgeschwollenen, über sechs Meter breiten Wildbach des Elendtales in Kärnten mit zwei gewaltigen Sätzen überspringen. Hart verfolgt, geängstigt oder verwundet wirft sie sich selbst in die Wellen eines Alpsees, in der Hoffnung, schwimmend Rettung zu finden.
Eine ungewöhnliche Ortskenntnis kommt der Gemse bei ihren kühnen Wanderungen sehr zustatten. Sie merkt sich jeden Weg, den sie nur einmal gegangen, und kennt in ihrem Gebiet sozusagen jeden Stein; gerade deshalb zeigt sie sich ebenso heimisch im Hochgebirge, wie sie unbeholfen erscheint, wenn sie dasselbe verläßt. »Im Sommer 1815«, berichtet Tschudi ferner, »stellte sich, zu nicht geringem Erstaunen der Augenzeugen, plötzlich ein wahrscheinlich gehetzter Gemsbock auf den Wiesen bei Arbon ein, setzte ohne unmittelbare Verfolgung über alle Hecken und stürzte sich in den See, wo er lange irrend umherschwamm, bis er, dem Verenden nahe, von einem Kahn aufgefangen wurde. Einige Jahre vorher wurde im Rheintal eine junge Gemse im Morast steckend lebend ergriffen.«
Ungemein scharfe Sinne befähigen die Gemse in gleich hohem Grade wie irgendein anderes Tier ihrer Verwandtschaft. Geruch und Gehör scheinen am besten ausgebildet, das Gesicht minder gut entwickelt zu sein. Die Schärfe des ersteren Sinnes offenbart sich nicht allein durch ihre feine Witterung, sondern auch durch ein überraschendes Spürvermögen, das sie befähigt, eine Fährte aufzunehmen und ihr mit Sicherheit zu folgen. So sieht man bei Treibjagden in Hochgebirgswäldern zuweilen versprengte Kitzchen denselben Weg, den mehrere Minuten vorher die Muttergeiß notgedrungen wählen mußte, mit solcher Sicherheit aufnehmen, daß man sich dieses genaue Folgen nur durch Annahme eines außerordentlichen Spürvermögens erklären kann. Ebenso gewahrt man, daß Gemsen jederzeit stutzen, nicht selten sogar zurückkehren, wenn sie die Spur eines Menschen kreuzen. Hinsichtlich der Witterung stehen unsere Gebirgsantilopen wahrscheinlich keinem Mitgliede ihrer Familie nach. Wer Gemsen beobachten oder sich ihnen nähern will, hat den Wind auf das sorgfältigste zu prüfen, weil sonst die scheuen Tiere unbedingt entfliehen. Auf wie weit hin ihre Witterung reicht, läßt sich mit Bestimmtheit nicht feststellen, wohl aber behaupten, daß sie die Entfernung eines Büchsenschusses noch erheblich übersteigt. Jedenfalls ist der Sinn des Geruches noch derjenige, der die Gemse stets am ersten und am untrüglichsten vom Herannahen einer Gefahr überzeugt und, was dasselbe, sofort zur Flucht bewegt. Das Gehör täuscht sie, obgleich es ebenfalls sehr fein ist, weit eher. Um das Poltern der herabfallenden Steine bekümmert sie sich gewöhnlich sehr wenig, denn dieses ist sie im Gebirge gewohnt; selbst das Krachen eines Schusses macht nicht immer einen besonderen Eindruck auf sie. Wenn Gemsen erfahren haben, was der Schuß zu bedeuten hat, und sie das Krachen desselben richtig erkennen, ergreifen sie freilich ohne Besinnen die Flucht; in vielen Fällen aber stutzen sie nach dem Knall und geben unter Umständen dem Jäger Gelegenheit, ihnen eine zweite Kugel zuzusenden. Dies erklärt sich zum Teil daraus, daß es im Gebirge auch für den Menschen sehr schwer ist, zu beurteilen, in welcher Richtung ein Schuß fiel, oder selbst, ob man einen solchen und nicht das Knallen eines sich loslösenden und unten aufschlagenden Steines vernahm. Das Gesicht unserer Tiere beherrscht unzweifelhaft weite Fernen, muß aber doch viel schwächer sein als bei andern Wiederkäuern, weil die Gemsen einen still sitzenden oder stehenden Jäger meist übersehen oder von dem umgebenden Gestein nicht zu unterscheiden vermögen. Obgleich mir meine Jagdfreunde dies im voraus mitgeteilt hatten, war ich bei meiner ersten Gemsjagd doch nicht wenig überrascht, die getriebenen Gemsen anscheinend in vollster Sorglosigkeit auf mich zukommen und in verhältnismäßig sehr geringer Entfernung an mir vorüberlaufen zu sehen. Wie die meisten niederen Wirbeltiere, namentlich die Fische, scheinen sie den sich ruhig verhaltenden Menschen nicht als solchen zu erkennen und erst dann einen Gegenstand der Furcht in ihm zu erblicken, wenn er sich bewegt. Aus diesem Grunde flüchten sie vor dem gehenden Jäger, wenn sie ihn einmal wahrgenommen haben, meist schon in weiter Entfernung, während sie den sich unter Benutzung des Windes herbeischleichenden Schützen nicht selten bis auf günstige Schußweite herankommen lassen.
Wie alles Wild beträgt die Gemse sich da, wo sie verfolgt wird, ganz anders als in Gehegen, in denen sie Schonung erfährt. Dem Menschen mißtraut sie zwar immer, meidet hier und da aber doch seine Nähe und sein Treiben nicht so ängstlich, als man von vornherein annehmen möchte. So wenig sie sonst in die Nachbarschaft der Gebäude kommt, so geschieht es doch zuweilen, daß sie sich einzeln gelegenen Alm- oder Jägerhütten bis auf wenige Schritte Entfernung nähert und unbekümmert um den aus den Essen aufsteigenden Rauch auf den Matten vor dem Hause äst. So beobachtete mein Gewährsmann, der erfahrene Gemsenjäger Klampferer, von dem oberen Jägerhause des Elendtales aus, daß zwei Gemsen mehrere Tage nacheinander in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung erschienen und Äsung nahmen. Mit dem Verstande paart sich List und Verschlagenheit. Wenn die Gemse einen Menschen wahrnimmt und als solchen erkennt, verhält sie sich oft ganz ruhig auf einer und derselben Stelle, eilt aber, sobald sie glaubt, daß man sie nicht mehr sehen könne, so schleunig als möglich davon. Neugierig ist sie freilich ebenfalls und läßt sich daher in derselben Weise täuschen wie Gazellen und Wildziegen, insofern man nämlich ihre Aufmerksamkeit beschäftigen und damit von sich selbst ablenken kann. Hierin erinnert die Gemse lebhaft an die Ziege, mit der sie außerdem den Hang zu Neckereien und allerlei Spielen teilt. Junge Böckchen führen oft die lustigsten Scheinkämpfe aus und üben sich gleichsam für den Streit, den das Alter ihnen sicher bringt. »Auf den schmälsten Felsenkanten«, schildert Tschudi, »treiben sie sich umher, suchen sich mit den Hörnchen herunterzustoßen, spiegeln an einem Ort den Angriff vor, um sich an einem andern bloßzustellen, und necken sich auf die mutwilligste Art. Oft sieht man ganze Rudel stundenlang an mutwilligen Sprüngen sich ergötzen, zuweilen förmlich in allerlei Turnkünsten sich überbieten.« Von einer ganz absonderlichen Art ihrer Spiele berichtet mir der vorher erwähnte Gemsenjäger, und seine Angaben wurden mir später durch Förster Wippel so vollständig bestätigt, daß ich nicht wohl einen Zweifel an denselben hegen darf. Wenn nämlich Gemsen im Sommer bis zu dem Firnschnee emporgestiegen sind und sich vollkommen ungestört wissen, vergnügen sie sich oft damit, daß sie sich an dem oberen Ende stark geneigter Firnflächen plötzlich in kauernder Stellung auf den Schnee werfen, mit allen Läufen zu rudern beginnen, sich dadurch in Bewegung setzen, nunmehr auf der Schneefläche nach unten gleiten und oft hundert bis hundertundfünfzig Meter in dieser Weise, gleichsam schlittenfahrend, durchmessen, wobei der Schnee hoch aufstiebt und sie wie mit Puderstaub überdeckt. Unten angekommen springen sie wieder auf die Läufe und klettern langsam denselben Weg hinauf, den sie herabrutschend zurückgelegt hatten. Die übrigen Mitglieder des Rudels schauen den gleitenden Kameraden vergnüglich zu, und eines und das andere Stück beginnt dann dasselbe Spiel. Oft fährt eine und dieselbe Gemse zwei-, drei- und mehrmal über den Firnschnee herab; oft gleiten mehrere unmittelbar nacheinander in die Tiefe. So sehr sie übrigens ein derartiges Spiel auch beschäftigen mag, ihre Sicherung lassen sie deshalb niemals aus dem Auge, und der bloße Anblick eines Menschen, befände sich derselbe selbst noch in weitester Ferne, beendigt sofort das Spiel und ändert mit einem Schlage das Wesen und Benehmen der mißtrauischen Geschöpfe.
Mit andern harmlosen Säugetieren befassen sich die Gemsen wenig; mit einzelnen, beispielsweise mit den Schafen, leben sie sogar in erklärter Feindschaft, betrachten sie wenigstens mit entschiedenem Widerwillen. Sobald Schafe auf den Höhen weiden, die sonst von Gemsen besucht werden, verschwinden letztere, kehren auch erst im Spätherbst auf solche Stellen zurück. Die Ziegen, die mehr noch als die Schafe ihnen nachsteigen, die meisten der von ihnen bewohnten Plätze besuchen können und deshalb viel mehr angetan scheinen, sie zu behelligen, werden von ihnen durchaus nicht gemieden, im Gegenteil oft freiwillig aufgesucht. Auch Rinder, Hirsche und Rehe haben die Gemsen gern, fürchten sich wenigstens nicht vor ihnen und erscheinen nicht selten in deren unmittelbarer Nähe.
Gegen die Brunstzeit hin, die um die Mitte des November beginnt und bis Anfang Dezember währt, finden sich die starken Böcke bei den Rudeln ein, streifen von einem zum andern, laufen ununterbrochen hin und her und verlieren dabei ihr Feist in sechs bis acht Tagen. So schweigsam sie während der übrigen Zeit des Jahres zu sein pflegen, so oft lassen sie jetzt ihre Stimme, ein schwer zu beschreibendes dumpfes und hohles Grunzen, vernehmen. Bei ihrem Erscheinen stieben die jungen Böcke erschreckt auseinander; alte Recken dagegen, die sich bei einem Rudel treffen, halten regelmäßig stand und kämpfen miteinander, da der starke Bock einen zweiten nicht bei dem Rudel duldet, und ob dasselbe auch aus dreißig bis vierzig Stück bestehe. Ihre Eifersucht wird nur von ihrem Ungestüm überboten; mißtrauisch spähen sie in die Runde, in ihrer Erregung zuweilen sogar den Jäger übersehend und vergessend; kampflustig gehen sie jedem von fern sich zeigenden starken Bock entgegen und nehmen, sowie er standhält, mit ihm den Kampf auf. Auf ihre blinde Eifersucht hat man in den östlichen Alpen eine eigene Jagdweise begründet, indem man eine weiße Schlafhaube oder eine eigens hierzu verfertigte und mit Krickeln besetzte Kappe aufsetzt, angesichts eines Gemsbocks sich in gebückter Stellung auf Augenblicke zeigt und wieder verbirgt, den Bock hierdurch auf sich aufmerksam und eifersüchtig macht und ihn so bis auf Schußweite heranlockt. Gegen die Geißen zeigen sich die verliebten Böcke ungeduldig und rücksichtslos, treiben sie heftig und mißhandeln diejenigen, die nicht gutwillig sich fügen wollen. Wie bei den Hirschen geschieht es, daß sie oft um der Minne Sold geprellt werden, da sie vor lauter Eifer nicht zum Beschläge kommen und junge Böcke sich jede Gelegenheit zunutze machen, um den auch bei ihnen sich regenden Geschlechtstrieb zu befriedigen. Letzterer scheint bei den Geißen nicht minder lebhaft zu sein als bei den Böcken. So spröde jene anfänglich sich zeigen, so willig geben sie später den Liebkosungen des Bocks sich hin, fordern diesen, wie Beobachtungen dargetan haben, sogar förmlich zum Beschlag auf und begnügen sich keineswegs mit einer ein- oder zweimaligen Paarung.
über die Trächtigkeitsdauer widersprechen sich die Angaben verschiedener Beobachter. Schöpff erfuhr, daß seine gefangenen Gemsen genau hundertundfünfzig Tage nach der Paarung setzten, und konnte um so weniger getäuscht werden, als die Böswilligkeit des Bockes seine Absperrung nach dem Beschläge nötig machte; alle Gemsenjäger dagegen nehmen eine längere Tragzeit an. In den Alpen Steiermarks und Kärntens beginnt die Brunst nicht vor der angegebenen Zeit und scheint gegen den zehnten Dezember hin bestimmt zu Ende zu sein; die Satzzeit aber fällt erst in die letzten Tage des Mai oder in den Anfang des Juni, und es würde somit die Trächtigkeitsdauer auf etwa achtundzwanzig Wochen oder zweihundert Tage anzunehmen sein. Je nach der Lage, Höhe und Beschaffenheit des Gebirges verrücken sich Brunst- und Satzzeit um einige Tage, möglicherweise um Wochen; schwerlich aber unterliegt die Tragzeit so großen Schwankungen, wie dies aus den beiden sich entgegenstehenden Angaben hervorzugehen scheint. Alte Geißen setzen manchmal zwei, in Ausnahmefällen sogar drei, jüngere stets nur ein Kitzchen. Die Jungen, allerliebste, mit dichten, wolligen, blaßfahlroten Haaren bekleidete Geschöpfe, folgen ihrer Mutter, sobald sie trocken geworden sind, auf Schritt und Tritt und zeigen sich schon nach ein paar Tagen fast ebenso gewandt wie diese. Mindestens sechs Monate lang behandelt sie die Geiß mit der wärmsten Zärtlichkeit, zeigt sich äußerst besorgt um sie und lehrt und unterrichtet sie in allen Notwendigkeiten des Lebens. Mit einem entfernt an das Meckern der Ziege erinnernden Laut leitet sie ihre Sprossen, lehrt sie klettern und springen und macht ihnen unter Umständen manche Sprünge ausdrücklich so lange vor, bis sie geschickt genug sind, das Wagestück auszuführen. Die Jungen hängen mit inniger Zärtlichkeit an ihrer Mutter und verlassen dieselbe, solange sie jung sind, nicht einmal im Tode. Mehrfach haben Jäger beobachtet, daß junge Gemsen zu ihren erlegten Müttern zurückkehrten und klagend bei ihnen stehen blieben; ja, es sind Beispiele bekannt, daß solche Tiere, obgleich sie ihre Scheu vor dem Menschen durch einen dumpfen, blökenden Laut deutlich zu erkennen gaben, von der Leiche ihrer Mutter sich wegnehmen ließen. Verwaiste Kitzchen sollen von Plegemüttern angenommen und vollends erzogen werden. Der Bock bekümmert sich nicht im geringsten um seine Nachkommenschaft, behandelt jedoch junge Gemsen, solange bei ihm die Erregung der Brunst nicht ins Spiel kommt, wenigstens nicht unwirsch, erfreut sich trotz seines Ernstes vielleicht sogar an ihrem lustigen und heiteren Wesen. Die Kitzchen wachsen ungemein rasch heran, erhalten schon im dritten Monat ihres Lebens Hörner und haben im dritten Jahr fast die volle Größe der Alten erlangt, sind mindestens zur Fortpflanzung geeignet. Das Alter, das sie erreichen, schätzt man auf zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre, ob mit Recht oder mit Unrecht, läßt sich kaum bestimmen.
Zuweilen geschieht es, daß ein Gemsbock sich unter die auf den Alpen werdenden Ziegen mischt, die Zuneigung einer oder der andern Geiß gewinnt und sich mit ihr paart. Wiederholt und noch in der Neuzeit hat man auch von Erzeugnissen derartiger Liebesverhältnisse, also von zweifellosen Gemsen- und Ziegenblendlingen gesprochen. Für unmöglich halte ich eine fruchtbare Vermischung von Gemse und Ziege zwar nicht, meine jedoch, daß derartige Angaben, solange nicht unzweifelhafte, jede Täuschung ausschließende Beobachtungen vorliegen, immer mit dem entschiedensten Mißtrauen aufgenommen werden müssen.
Ungeachtet mancherlei Gefahren vermehren sich die Gemsen da, Wo sie gehegt und nur in vernünftiger Weise beschossen werden, außerordentlich rasch; denn sie sind, wie der erfahrene Kobell sagt, das einzige Wild, das von harten Wintern verhältnismäßig wenig leidet. Auf den steilen Gehängen, von denen der Schnee meist weggeweht wird, oder unter den Felsen und Schirmbäumen, die ihn etwas abhalten, finden sie noch immer Äsung, während Hirsche und Rehe zu Tale getrieben werden und ohne künstliche Fütterung häufig erliegen. Diese Vermehrung hat jedoch, wie Kobell hervorhebt, ihre Grenze, insofern sie von der Örtlichkeit bedingt ist. Denn eine gewisse Anzahl Gemsen verlangt, wie jedes Wild, einen Standort von einer bestimmten Größe, und wenn ihrer zu viele werden, so verläßt der Überschuß den Platz und wechselt nach andern Bergen.
Während des Sommers äst die Gemse von den besten, saftigsten und leckersten Alpenpflanzen, insbesondere von denen, die nahe der Schneegrenze wachsen, außerdem von jungen Trieben und Schößlingen der Sträucher jener Höhen, vom Alpenröschen an bis zu den Sprossen der Nadelbäume; im Spätherbste und im Winter dagegen müssen ihr das lange Gras, das aus dem Schnee hervorragt, sowie allerlei Moose und Flechten genügen. Salz scheint ihr, wie den meisten andern Wiederkäuern, unentbehrlich zu sein; Wasser zum Trinken dagegen bedarf sie ebensowenig wie andere Antilopen, da sie, ohne ihren Stand zu wechseln, auch auf vollkommen quellenlosen Gebirgsrücken lebt. Wahrscheinlich stillt sie ihren Durst durch Belecken der taunassen Blätter zur vollständigen Genüge. Sie ist lecker, wenn sie es sein kann, und anspruchslos, wenn sie es sein muß, nimmt bei guter Äsung rasch an Feist und demgemäß beträchtlich an Umfang und Gewicht zu, magert aber auch bei dürftiger Äsung sehr bald wieder ab. Wenn tiefer Schnee den Boden deckt, hat auch sie oft Not, um ihr Leben zu fristen; denn selbst in den niederen Waldungen findet sie nicht immer genügende Nahrung, obgleich sie sich unter allen Umständen tage- und wochenlang nur von den langen, bartartigen Flechten nährt, die von den untern Ästen herabhängen. Um die Heuschober, die man in einzelnen Alpengegenden im Freien aufstapelt, sammeln sich manchmal Rudel von Gemsen und fressen nach und nach tiefe Löcher in die Schober, daß sie sich im Heue gleich gegen Stürme decken können; auf andern Örtlichkeiten dagegen, wo sie solche Heuschober nicht kennen, nehmen sie selbst im strengsten Winter kein Futter an und leiden und kümmern. Tschudi hält es für unwahrscheinlich, daß Gemsen im Winter verhungern; erfahrene Jäger aber wissen nur zu gut, daß ein strenger Winter innerhalb nicht allzu ausgedehnter Gebiete oft Dutzenden und selbst Hunderten von ihnen das Leben raubt.
Außer dem Mangel, den der Winter mit sich bringt, bedroht er die Gemsen auch noch durch Schneelawinen, die zuweilen ganze Gesellschaften von ihnen begraben. Die Tiere kennen zwar diese Gefahr und suchen Stellen auf, wo sie am sichersten sind; das Verderben aber ereilt sie doch. Auch herabrollende Steine und Felsenblöcke erschlagen gar manche von ihnen; Krankheiten und Seuchen räumen ebenfalls unter ihnen auf, und eine Reihe von Feinden, namentlich Luchs, Wolf und Bär, Adler und Bart- oder Lämmergeier, sind ihnen beständig aus der Ferse. Luchse lauern ihnen im Winter in den Wäldern auf und richten oft große Verheerungen unter ihnen an; Wölfe folgen ihnen namentlich bei tiefem Schnee nach, und Bären beängstigen sie wenigstens in hohem Grade. Im Engadin soll es geschehen sein, daß ein Bär einer Gemse bis in das Dorf nachlief, in dem sie sich in einen Holzschuppen rettete. Adler und Bartgeier gefährden sie nicht minder, da sie sich wie ein Blitz aus heiterem Himmel auf sie herniederstürzen, junge Kitzchen ohne weiteres vom Boden aufnehmen und ältere trotz deren Abwehr in den Abgrund zu stoßen suchen. Zu diesen in den gehegten Gebieten glücklicherweise fast ausgerotteten Verfolgern gesellt sich als schlimmster Feind der Mensch überall da, wo nicht bestimmte Jagdgesetze oder Jagdgebräuche eine geregelte Schonung dieses edlen Wildes erstreben und gewährleisten.
»über die Gemsjagd«, sagt Franz v. Kobell, »ist gar viel geschrieben worden, und manchmal hat einer, der kaum ein paar Jagden gesehen, die Feder ergriffen und je nach Stimmung und Erlebnissen diese Jagd zur gefährlichsten aller gemacht oder sie auch wieder in der Weise dargestellt, als wäre sie nicht viel mehr als ein Treiben auf Hasen und Rehe. Daß diese Jagd romantischer ist als die meisten andern, liegt in der Natur des Gebiets, auf dem sie sich bewegt; was aber die Gefahren des Jägers betrifft, so kommt es auf die Art und Weise des Jagens und auf die Verhältnisse an, unter denen man jagt. Wer viele Gemspirschen mitgemacht hat, wird schwerlich den Gefühlen inneren Grausens entgangen sein, wenn er über eine Wand oder durch eine Schlucht stieg und plötzlich über ihm ein Steingerumpel von flüchtigen Gemsen losging und kaum der Vorsprung eines Felsens den Leib zu decken vermochte, oder wenn er, einer angeschossenen Gemse nachsteigend, unversehens an Stellen kam, wo für das Mißlingen eines Schrittes oder Sprunges, der unvermeidlich gemacht werden mußte, die Folgen nur zu deutlich vor Augen lagen. Es ist dann ganz eigen, einem Steine nachzusehen, den der Fuß von der Wand löste, wie er gellend in die Tiefe fällt und auf dem Grunde steiler Gräben in weithin geschleuderte Trümmer zerschellt. Und nun bedenke man, daß gar oft ein Jäger den erlegten Bock von dem Platze, wo er verendete, nicht anders fortbringen kann, als indem er ihn auf den Rücken ladet und eine Wildschlucht hinuntersteigt oder quer durchs Felsengehänge, und das allein, ohne Gefährten, fern von aller Hilfe, auf sich selbst angewiesen, auf seine Gewandtheit und seinen Mut.
Das Steigen will geübt sein. Wer z. B. an einer Wand, an der überhaupt noch fortzukommen ist, in der Art herniedersteigen wollte, daß er mit dem Gesicht gegen die Wand, mit Händen und Füßen sich anklammernd, den Versuch machte, wie man auf einer Leiter herniedersteigt, der würde geradezu das Leben wagen, weil er die Stelle, wohin er den Fuß setzen will, nicht sieht, sondern mit diesem nur fühlt und nicht weiß, was dann weiter kommt. Man hat in solchen Fällen sich niederzusetzen und sitzend mit den Händen zu halten, während man hinuntersieht und die Stellen erforscht, die verläßlich erscheinen, die Füße darauf niederzulassen, weil man nur so einen Plan des Weiterkommens entwerfen kann. Dabei ist die Büchse und der Stock oft sehr hinderlich, und man muß diesen manchmal hinunterwerfen, wenn er dadurch nicht verloren geht; man trennt sich aber nicht gern vom Stock, der eine große Hilfe gewährt, und ist oft schlimm genug daran, wenn er einem an solchen Plätzen aus der Hand gleitet und abfährt. Solange man noch etwas anzufassen hat und nicht gezwungen ist, zu springen oder zu laufen, geht es noch gut; wenn aber das Anfassen nicht mehr möglich und man auf einem schiefen, schmalen Grate gehen oder durch eine Stelle in einem steilen Graben laufen oder darüber springen muß, dann ist es bedenklich; und doch soll man nicht viel darüber nachdenken und keine Furcht haben. Es kommen Fälle vor, wo Gehen- und Rutschenwollen weit gefährlicher ist, als ein paar flinke Schritte zu machen, und derjenige, der darüber ängstlich ist, tut besser umzukehren, wobei freilich auch zuweilen das Umkehren noch schlimmer ist als das Weitergehen. Alles dies steigert oder mindert die Gefahr unter sonst gleichen Umständen, je nachdem man allein ist oder ein Jäger vorsteigt. In Gesellschaft eines solchen macht man Wege mit Leichtigkeit, die drohend und schreckhaft erscheinen, wenn man allein steigt. Es ist dabei nicht die Hilfe, die der Jäger gewährt; denn dieser kann oft gar nichts helfen; aber es ist die erlangte Gewißheit, daß der Gang überhaupt zu machen, und es ist die Vorzeichnung des Weges, den man nehmen soll, was wesentlich ermuntert und forthilft. Steigeisen sind nur mit Vorsicht und vorzüglich auf Graslaanen zu gebrauchen; man verwöhnt sich aber leicht damit, und ich kenne ausgezeichnete Steiger, die ein Eisen nur selten an den Fuß nehmen, außer auf gefrorenem Boden oder wo es schwer zu tragen gibt. Die Graslaanen sind übrigens nur zu scheuen, wenn sie sehr steil, vom Regen naß oder verschneit, oder auch wenn sie sehr trocken sind. Enden sie nach unten an einer Wand, so sind sie natürlich doppelt gefährlich; fällt man auf einer solchen und kommt auf den Rücken zu liegen, so ist's vorbei, wenn man sich nicht sogleich auf den Bauch herumwirft und auf dem Rasen noch anklammern kann. Es ist in der Tat merkwürdig, wie wenig Unglücksfälle beim Steigen vorkommen; wenn sie aber vorkommen, so geschieht es selten bei Jagden, dagegen oft genug beim Brechen des verlockenden Edelweiß. An Stellen, wo die Gefahr augenscheinlich ist, geschieht auch weniger ein Unfall, weil man behutsam zu Werke geht. Außerdem wird leicht übersehen, daß beim Fallen und Abfahren ein Sichhalten nicht immer möglich und somit auch keine Rettung ist. Am gefährlichsten sind schief hängende Steinplatten, wo man die Schuhe ausziehen und in Strümpfen oder besser noch barfuß gehen muß. Es versteht sich nach dem Gesagten von selbst, daß man schwindelfrei sein muß, um fortzukommen.«
Man muß sich natürlich nicht vorstellen, daß Gemsen und Jäger immer an den Gehängen herumzukrabbeln haben wie die Fliegen an der Wand. Die Örtlichkeit ist oft so günstig, daß man ohne besondere Kunst und Mühe seine Beute erringt, besonders beim Treiben, wenn z. B. die Wechsel über einen Alpenweg gehen oder durch einen Waldgrund oder durch die Talsohle selbst. Es gibt kaum eine Jagd, wo diese Verhältnisse mannigfaltiger und wechselnder wären.
Einen guten Bock auf der Pirsche zu schießen, hat immerhin seine Schwierigkeiten; aber wie der Zufall manche Pirsche verdirbt, so begünstigt er auch wieder manche andere. Besonders die Jäger kommen bei den vielen Gängen, die sie machen, oft da zum Schusse, wo sie gar nicht daran denken. Der Gang solcher Pirschen ist mitunter ziemlich weitläufig. Da muß man am frühen Morgen von einem geeigneten Platze aus das Einziehen der Gemsen beobachten und sehen, wo der Bock sich niedertut, was gewöhnlich unter einer Wand auf einem Felsenvorsprung geschieht, wo er eine schöne Aussicht hat. Wenn man nun weiß, wo er sich niedergetan, hat man sich vom Beobachtungsplatze möglichst ungesehen wegzubirschen und zu warten, bis die Sonne hoch genug steht, daß der Wind aufwärts zieht; dann steigt man über den Bock oft auf weiten Wegen und rutscht dann auf dem Bauche über die Wand, unter der er sich niedergetan hat, vorsichtig und die Büchse immer schußfertig, hinaus und schießt so liegend hinunter. Nun geschieht es aber nicht selten, daß man den in der Ruhe befindlichen Bock, ob man gleich an der rechten Wand ist, von oben nicht sehen kann, z. B. wenn die Wand etwas überhängig, eine hinderliche Latsche (Knieholz) vorhanden ist usw. Dann hat man zu warten, bis der Bock zum Äsen freiwillig wieder aufsteht, oder man wirft einige Steinchen hinunter, um das Aufstehen zu veranlassen. Mancher beschwerliche Gang aber wird trotz aller Vorsicht umsonst gemacht.
Die Art, wie die Gemsen beim Treiben kommen, ist sehr verschieden und bietet tausenderlei Bilder dar; denn die Gehänge, Gräben und Schluchten wechseln auf das vielartigste. Je nachdem sie nur den entfernten Lärm der Treiber hören und ihr Standort nicht zu tief im Bogen ist, steigen sie oft ganz vertraut auf eine hohe Kuppe und bleiben da, nach dem Treiben sich öfter hinwendend, wohl eine halbe Stunde oder länger, ehe sie weiter vorwärts gehen; kommt ihnen aber ein Treiber plötzlich zu Gesicht, so springen sie oft mit unglaublicher Geschwindigkeit einen Hang herunter und verschwinden in dem Graben, um dann an einer Scharte des Grates wieder zu erscheinen. An scharfen Wänden nimmt das Rudel, wenn es nicht beschossen wird, fast immer denselben Weg; über eine Kluft springt eines wie das andere, und manchmal geht es im Zickzack herunter ohne Aushalten. In den Latschen verstecken sie sich gern, und es ist kaum zu begreifen, wie schnell sie durch ihre widerstrebenden und wirr sich deckenden Stämme und Äste fortkommen können. Wenn der Wind gut ist, sind sie in der Regel leicht vorwärts zu treiben; Hauptsache aber bleibt es, daß sie den Treiber sehen, denn abgelassene Steine sprengen sie wohl auf, wenn sie nahe niederrasseln, bekümmern sie aber nicht viel. Sie wissen recht wohl, ob ihnen die Steine etwas anhaben können oder nicht; deckt sie also ein Felsenvorsprung, so bleiben sie trotz alles Steinregens, der darüber heruntergeht, ganz ruhig stehen. Wenn Nebel liegt, ist mit der Gemsjagd nur dann etwas auszurichten, wenn der Treiber sehr viele sind und diese geschlossen vorkommen können. Die Felsengrate bieten mancherlei enge Schluchten und Kamine, die die Gemsen gern annehmen. Wenn sie in solchen ansteigen und der Schütze oben ist, sind sie leicht zu schießen. Es gibt Wechsel, wo die Rudel kommen, und andere, wo nur ein guter Bock kommt; man kann je nach den Umständen darüber ebenso sicher sein wie über einen guten Fuchsriegel. Die alten Böcke sind übrigens sehr schlau, und ich habe manchen in einen Graben hinaufsteigen sehen, während ein Treiber in einem ganz nahe daran gelegenen mit lautem Rufen und Pfeifen herniederstieg. Nicht selten verstecken sich die Gemsen so, daß sie erst unmittelbar vor den Treibern zum Vorschein kommen. Ist der Wind schlecht, so bringt sie nichts vorwärts. Wenn ein Rudel naht, kann man nicht selten mit Vergnügen beobachten, daß die Gemsen ein leichtsinniges Volk sind. Denn der Haupttrupp überläßt die Sorgen der anführenden Kitzgeiß, und wenn diese anhält, um zu horchen und zu sichern, was zu tun ist, so stoßen und raufen sich oft die andern, es wäre denn, daß ihnen das Treiben gar zu nahe gekommen.
»Je wilder die Gegend, desto schöner ist diese Jagd. In den hohen Gebirgsgürteln von Berchtesgaden, am Funtnsee, Simmelsberg usw. ist es wild und einsam genug, daß es zuweilen den Schein hat, als hätten manche Vögel, denen man begegnet, noch keinen Menschen gesehen; denn mit offenbarer Neugier umfliegen sie den auf dem Stande lauernden Schützen. Den herrlichen Karminspecht (Mauerläufer) hätte ich manchmal mit einem Schmetterlingsnetze leicht fangen können; die hell kreischenden Steindohlen mit den roten Ständern stoßen sogar zuweilen auf das fremde Menschenwesen. Dabei gewährt es einen eigentümlichen Reiz, Stellen zu betreten, von denen man wohl sagen kann, daß sie vorher nie ein menschlicher Fuß berührt. Wenn man nun an einem solchen Platze oft mehrere Stunden in mancherlei Betrachtungen weilt und plötzlich durch das Klingen und Sausen fallender Steine aufgeschreckt wird, und es steigt ein starker Bock, schwarz wie der Teufel, herein über ein Eck und kommt am Gewänd herunter, immer näher und näher – wär's ein Wunder, wenn einen da das Jagdfieber befiele? Es befällt wohl manchen jungen Schützen, daß ihm die Zähne klappern! Geht's aber gut, und sitzt der Schuß am rechten Fleck, und der Bock stürzt durch Gestein und Alpenrosen in den Graben, während die Echos widerhallen von Berg zu Berg – was soll ich schreiben, wie einem da wird? Nennt es einen materiellen Genuß, eine bedauerliche Grausamkeit, nennt es, wie ihr wollt, ihr Jagdbekrittler; wir andern rufen freudig: Es lebe das Weidwerk!«
Das Wildbret der Gemse darf sich an Wohlgeschmack mit jedem andern messen, übertrifft meiner Ansicht nach sogar das unseres Rehes, das bekanntlich als das zarteste und schmackhafteste der einheimischen Wildarten gilt, noch bei weitem, da es sich durch einen würzigen, mit nichts zu vergleichenden Beigeschmack auszeichnet. Nur während der Brunstzeit soll es etwas bockig schmecken und an Ziegenfleisch erinnern, welch letzteres, nachdem es eine besondere Beize durchgemacht hat, von den betriebsamen und erfindungsreichen Schweizer Gastwirten durchreisenden Fremden sehr oft als Gemsbraten aufgetischt wird. Fast ebenso wertvoll als das Wildbret ist die Decke, die man zu vorzüglichem Wildleder verarbeitet. Auch die Hörner finden mancherlei Verwendung; die Haare längs der Rückenfirste endlich dienen als Hutschmuck ebensowohl der zünftigen Jäger wie jagdlustiger Sonntagsschützen, und wenn dieselben auch noch keine freilebende Gemse gesehen haben sollten.
Die Gemse spielt in der Volksdichtung unserer Alpenbewohner genau dieselbe Rolle, die der Gazelle durch die Morgenländer zugesprochen wurde. Hunderte von Liedern schildern sie und ihre Jagd in ebenso treffender wie anmutender Weise; mancherlei Sagen umranken ihre Naturgeschichte, soweit diese dem Volke zum Bewußtsein gekommen ist. Ein allgemein verbreiteter Aberglaube bestimmt den Jäger, das Herz des aufgebrochenen Wildes zu öffnen und das sich hier noch findende Blut zu trinken, in der Zuversicht, dadurch Muskeln und Sinne zu stählen und den gefürchteten Schwindel zu vertreiben; ein anderer Volksglaube schützt eine weiße Gemse vor dem tödlichen Blei, weil derjenige, der eine solche erlegte, sein Leben stets durch einen Sturz in die Tiefe enden soll. Die Begriffe von Recht und Unrecht verwirren sich selbst in den klarsten Köpfen der ehrlichsten Gebirgsleute, wenn es sich um die Gemse handelt, und der Sohn der Alpen sieht in ihr noch heutigestags das ihm gehörende Eigentum, das Wild, das er jagt, wo es auch sei.
Jung eingefangene Gemsen lassen sich zähmen. Man ernährt sie mit Ziegenmilch, mit saftigem Grase und Kräutern, mit Kohl, Rüben und Brot. Wenn man gutartige Ziegen hat, kann man diesen das Pflegeelterngeschäft anvertrauen. Dabei gedeihen die kleinen, heiteren Gebirgskinder nur um so besser. Lustig spielen sie mit dem Zicklein, keck und munter mit dem Hunde; traulich folgen sie dem Pfleger, freundlich kommen sie herbei, um sich Nahrung zu erbitten. Ihr Sinn strebt immer nach dem Höchsten. Steinblöcke in ihrem Hofe, Mauerabsätze und andere Erhöhungen werden ein Lieblingsort für sie. Dort stehen sie oft stundenlang. Sie werden zwar nie so kräftig wie die freilebenden Gemsen, scheinen sich aber ganz wohl in der Gefangenschaft zu befinden. Bei manchen bricht im Alter auch eine gewisse Wildheit durch; dann gebrauchen sie ihre Hörnchen oft recht nachdrücklich. Ihre Genügsamkeit erleichtert ihnen die Gefangenschaft. Im Alter zeigen sie sich noch weniger wählerisch hinsichtlich ihrer Nahrung als in der Jugend. Abgehärtet sind sie von Mutterleibe an. Im Winter genügt ihnen ein wenig Streu unter einem offenen Dächlein. Sperrt man sie in einen Stall, so behagt es ihnen hier nicht; einen Raum zur Bewegung und frisches Wasser müssen sie unbedingt haben. Alt eingefangene bleiben immer furchtsam und scheu.
*
Von allen bekannten Antilopen weicht die im Nordosten unseres Erdteils häufige Steppenantilope oder Saiga ( Colus tataricus) durch wesentliche Eigentümlichkeiten so erheblich ab, daß man sie mit Fug und Recht als Vertreter einer besonderen Sippe ansieht. Sie erinnert in Gestalt und Wesen an das Schaf, in gewisser Beziehung aber auch wieder an das Ren. Ihre Gestalt ist sehr plump, der Leib dick und gedrungen, auch verhältnismäßig niedrig gestellt, da die Läufe wohl schlank, aber nicht hoch sind, das Fell außerordentlich langhaarig und so dicht, daß es eine glattwollig erscheinende Decke bildet. Mehr als durch jedes andere Merkmal aber zeichnet sich die Saiga durch die Gestaltung ihrer Schnauze und insbesondere durch die Bildung ihrer Nase aus. Die Schnauze ragt über die Kinnlade vor, ist von der Stirn an zusammengedrückt, durch eine Längsfurche geteilt, knorpelhäutig, in Runzeln zusammenziehbar und deshalb sehr beweglich, an der abgestutzten Spitze von runden, am Rande behaarten, in der Mitte nackten Nasenlöchern durchbohrt, so daß das Ganze einen förmlichen Rüssel bildet und man deshalb der Gruppe den Namen »Rüsselantilopen« geben könnte. Die Hörner des Bockes, die etwas entfernt voneinander über der Augenhöhe stehen, sind leierförmig, unten mit etwas verwischten Ringen gezeichnet und gestreift, an der Spitze verdünnt und glatt, blaß von Farbe und durchscheinend. Das Weibchen ist hornlos und trägt ein zweizitziges Euter. Im Sommer erreicht das kurze Haar höchstens 2 Zentimeter an Länge, wogegen es im Laufe des Spätherbstes bis zu 7 Zentimeter und darüber nachwächst. Rücken und Seiten sehen im Sommer graugelblich, die Gliedmaßen unter dem Knie dunkler, Hals- und Unterseiten des Rumpfes sowie die inneren Seiten der Läufe weiß, Stirn und Scheitel gelbgrau oder aschgraulich aus. Gegen den Winter hin lichtet sich die Decke, und das Tier erhält dann ein blasses, graugelbliches, nach außen hin weißliches Haarkleid. Die Länge des erwachsenen Bockes beträgt 1,3 Meter, wovon 11 Zentimeter auf den Schwanz zu rechnen sind, die Höhe am Widerriste kaum 80 Zentimeter, die Länge der Hörner eines ausgewachsenen Bockes der Krümmung nach gemessen 25 bis 30 Zentimeter.

Saiga-Antilope (Colus tataricus)
Die Saiga bewohnt die Steppen Osteuropas und Sibiriens, von der polnischen Grenze bis zum Altai. Von den südlichen Donauländern und von den Karpathen an begegnet man ihr in den Steppen des südöstlichen Polen, in Kleinrußland längs des Schwarzen Meeres, um die kaukasischen Gebirge, das Kaspische Meer und den Aralsee bis zum Irtysch und den Ob, nach Norden hin bis zum 55. Breitengrade. Sie lebt stets in Gesellschaften, sammelt sich mit Beginn des Herbstes aber in Herden von mehreren tausend Stück, die ziemlich regelmäßig wandern und erst gegen das Frühjahr hin rudelweise nach ihren früheren Standorten zurückkehren. Äußerst selten sieht man eine einzelne Steppenantilope; denn auch während des Sommers halten sich die alten Böcke zur Herde. Eine solche stellt unter allen Umständen Wachen auf: wenigstens beobachtete Pallas, daß niemals alle auf einmal ruhten, sondern einzelne stets weideten und sicherten, während die andern wiederkäuend am Boden lagen, auch keines von ihnen sich zur Ruhe begab, ohne vorher ein anderes Stück durch ein eigentümliches Zunicken und ein nicht minder absonderliches Entgegenschreien zum Aufstehen eingeladen oder zur Ablösung bestimmt zu haben. Erst wenn dieses sich erhob und die Wache übernahm, legte jenes sich nieder. Ungeachtet dieser Vorsicht kann man nicht sagen, daß die Saigas besonders begabte Tiere wären. Sie betätigen nur geringe Gewandtheit, durchschnittlich nicht eben scharfe Sinne und unbedeutende geistige Fähigkeiten. Erwachsene laufen zwar so schnell, daß weder Pferde noch Windhunde sie einholen können, jüngere werden aber leicht atemlos, und auch die älteren fallen vereinten Anstrengungen der Raubtiere, beispielsweise der Wölfe, bald zur Beute. Ihr Gang ist querbeinig und sieht deshalb nicht anmutig aus, weil sie den Hals weit vorstrecken und den Kopf niederhängen lassen; die Sprünge greifen zwar ziemlich weit aus, erinnern aber kaum noch an die zierlichen Sätze anderer Antilopen, sind vielmehr plump und ungeschickt. Unter ihren Sinnen steht der des Geruchs obenan, denn man bemerkt, daß sie vorzüglich winden; das Gesicht hingegen scheint sehr schwach zu sein, denn sie laufen bisweilen, von der Sonne geblendet, auf Wagen zu oder sehen sich angesichts eines Feindes unentschlossen und blöde um, als ob sie den Gegenstand nicht zu erkennen vermöchten.
Die Äsung der Saiga besteht vorzugsweise aus Salzkräutern, die die sonnigen, dürren, von Salzquellen öfter unterbrochnen tatarischen Steppen hier und da in ungeheuren Massen bedecken. Wohl infolge der eigentümlichen Nahrung erhält das Wildbret der Saiga einen scharfen balsamischen Geruch, der wenigstens den Neuling derartig anwidert, daß er nicht imstande ist, es zu genießen. Die Böcke treten gegen Ende November auf die Brunst und kämpfen unter sich lebhaft um die Riken: die Riken gehen bis zum Mai tragend und setzen um diese Zeit, gewöhnlich schon vor der Mitte des Monats, ein einziges, anfänglich sehr unbehilfliches Junge.
Ungeachtet des schlechten Wildbrets jagen die Steppenbewohner Saigas mit Leidenschaft. Man verfolgt sie zu Pferde und mit Hunden und holt sie in der Regel ein, wenn sie weit flüchten müssen. Auch Wölfe richten arge Verwüstungen unter ihnen an, reißen oft ganze Rudel nieder und fressen die getöteten bis auf Schädel und Gehörn auf. Letzteres sammeln dann die Kirgisen oder die Kosaken und verkaufen es wohlfeil nach China. Und noch ist die Zahl der Feinde nicht erschöpft. Eine Dassel- oder Biesfliegenart legt ihnen Eier in die Haut, oft in solcher Menge, daß die auskriechenden Maden brandige Geschwüre verursachen und das Tier umbringen.
Jung aufgezogene Steppenantilopen werden sehr zahm, folgen ihren Herren wie Hunde, selbst schwimmend durch die Flüsse, fliehen vor wilden ihrer Art und kehren des Abends aus freien Stücken wieder in den Stall zurück.
*
Wohl die auffälligsten aller Antilopen sind die Gnus ( Catoblepas), höchst absonderliche Wiederkäuer, Mittelglieder, falls man so sagen darf, zwischen Antilope, Rind und Pferd, wahre Zerrbilder der edlen und zierlichen Gestalten ihrer Familie. Man bleibt im Zweifel, welches Geschöpf man eigentlich vor sich hat, wenn man ein Gnu zum ersten Male ansieht. Das Tier erscheint als ein Pferd mit gespaltenen Hufen und einem Stierkopfe, und es beweist durch sein Betragen, daß sein ganzes Wesen mit dieser Zwittergestalt bestens im Einklänge steht. Unmöglich kann man das Gnu ein schönes Tier nennen, so zierlich auch der Bau mancher einzelner Teile sein mag. Der aus mäßig hohen, schlanken Läufen ruhende Leib ist gedrungen, vorn merklich höher gestellt als hinten, der Kopf fast viereckig, die Muffel breit wie bei Rindern, das Nasenloch wie gedeckelt, das wie von einem Sternenkranze weißer Borsten kreisartig umgebene Auge von wildem und bösartigem Ausdrucke, das Ohr klein und zugespitzt, das Gehörn, das beide Geschlechter tragen, auf der Stirnleiste aufgesetzt, plattgedrückt, sehr breit, narbig, seitlich abwärts und mit den Spitzen aufwärts gebogen, der Schwanz lang bequastet wie ein Roßschweif, die Gesichtsfirste, der Hals, Rücken, die Kehle und Wange stark bemähnt, das Haar übrigens glatt anliegend. Im Innern der Nasenlöcher befindet sich eine bewegliche Klappe; auf der Wange stehen an Stelle der fehlenden Tränengruben drüsige Warzen.
Das Weitzschwanzgnu oder Wildebeest, der Ansiedler des Vorgebirges der Guten Hoffnung ( Catoblepas gnu), erreicht eine Gesamtlänge von 2,8 Meter, einschließlich des Schwanzes, der ohne Haare 50 Zentimeter, mit den Haaren aber 80 bis 90 Zentimeter mißt, bei 1,2 Meter Schulterhöhe. Die vorherrschende Färbung ist ein dunkles Graubraun, das an manchen Stellen heller, an manchen dunkler erscheint und bald mehr ins Gelbe oder Rötliche, bald mehr ins Schwärzliche zieht; die Nackenmähne sieht weißlich aus, weil die Haare derselben an der Wurzel grauweiß, in der Mitte schwarz und an der Spitze rötlich sind; dagegen haben Brust- und Halsmähne, die Haarbüschel auf dem Nasenrücken und unter dem Auge braune, die Borstenhaare um die Augen, die Schnurrborsten, der Kinnbart und das Schweifhaar weißliche, die Haare der Schwanzrute an der Wurzel graubraune und an der Spitze weißliche Färbung. Das Weibchen ist kleiner und sein Gehörn leichter, seine Färbung der des Männchens vollkommen gleich. Jung geborene Kälber haben noch kein Gehörn, aber schon die Hals- und Nackenmähne.
Das Gnu bewohnt Südafrika bis gegen den Gleicher hin. Früher im Kaplande häufig, sind diese Antilopen dort jetzt ausgerottet, soweit der Europäer vorgedrungen ist: im Lande der Hottentotten und Kaffern dagegen finden sie sich noch in zahlreicher Menge. Nach den Angaben glaubhafter Beobachter wandern sie alljährlich, nach der Meinung A. Smiths wie die Vögel, aus angeborenem Wanderdrange, der sie zwingt, blindlings ihrem Geschicke entgegenzugehen, selbst wenn dieses ihr Verderben sein sollte, nach unserer Ansicht wie die übrigen Antilopen, aus Mangel an Weide. Es sind höchst bewegliche, mutwillige Tiere, die es meisterhaft verstehen, die weiten Ebenen zu beleben. »Unter allen Tieren«, sagt Harris, »erscheint das Gnu als das ungeschickteste und das absonderlichste, ebensowohl was sein äußeres Ansehen als was seine Sitten und Gewohnheiten anlangt. Die Natur hat es in einer ihrer Launen gestaltet, und es ist kaum möglich, seine ungeschickten Gebärden ohne Lachen zu betrachten, nach allen Richtungen hin sich schwenkend und beugend, das zottige und bebartete Haupt zwischen die schlanken, muskelkräftigen Glieder herabgebogen, den langen, weißen Schwanz dem Winde preisgebend, macht dieses possenhafte und stets scheue Tier gleichzeitig einen ebenso wilden als lächerlichen Eindruck. Plötzlich steht es still, gibt sich den Anschein, als ob es sich verteidigen wolle, und legt das bärtige Haupt zum Stoße zurecht, sein Auge scheint Blitze zu sprühen, und sein Grunzen, das an das Brüllen des Löwen erinnert, erschallt mit Kraft und Ausdruck; dann plötzlich wieder peitscht es die Seiten mit dem langen Schwänze, springt, bäumt und dreht sich, fällt auf die Fesselgelenke nieder, erhebt sich und saust einen Augenblick später über die Ebene dahin, daß der Staub hinter ihm in Wolken aufwirbelt.« So lernt es jeder Reisende kennen, der das Innere Südafrikas betritt; denn es ist neugierig im höchsten Grade und nähert sich absichtlich jedem Gegenstande, der seine Aufmerksamkeit erregt, namentlich aber dem sich zeigenden Menschen. Gesellig, lebhaft und ungemein rastlos, weder an Wasser, noch an Gras, noch an Schatten gebunden, wandert es je nach der Jahreszeit von einem Platze zum andern, und der Reisende begegnet deshalb ihm fast allerorten in großen Herden, regelmäßig in Gesellschaft des Quaggas und des Springbocks, die mit ihm gemeinsame Verbände bilden. Eine solche Herde ist in ununterbrochener Bewegung, weil die Gnus kaum der Ruhe bedürfen und sich beständig in den tollsten Possen gefallen. Zuweilen geschieht es, daß der Reisende zwischen ihren Herden förmlich Spießruten laufen muß, da sie mit neckischen Sprüngen, immer in einer gewissen Entfernung sich haltend, den Menschen umgehen und ihn gleichsam verhöhnen zu wollen scheinen.
Gordon Cumming erfuhr, daß das Wildebeest auch dann nicht den Platz verläßt, wenn es von einer größeren Anzahl von Jägern getrieben wird. In endlosen Ringen umherkreisend, die merkwürdigsten und sonderbarsten Sprünge ausführend, umlaufen die zottigen Herden dieser sonderbar und grimmig aussehenden Antilopen ihre Verfolger. Während diese auf sie zureiten, um diese oder jene zu erlegen, umkreisen sie rechts und links die andern und stellen sich auf dem Platze auf, über den die Jäger wenige Minuten vorher hinwegritten. Einzeln und in kleinen Trupps von vier bis fünf Stück sieht man zuweilen die alten Wildebeestböcke in Zwischenräumen auf der Ebene einen ganzen Vormittag regungslos stehen und mit starren Blicken die Bewegungen des andern Wildes betrachten, wobei sie fortwährend ein lautes, schnaubendes Geräusch und einen eigentümlichen kurzen, scharfen Schneuzer von sich geben. Sobald sich ein Jäger ihnen naht, beginnen sie, ihre weißen Schwänze hin und her zu schleudern, springen dann hoch auf, bäumen sich und folgen einander in gewaltigen Sätzen mit der größten Schnelligkeit. Plötzlich machen sie halt, und zuweilen fangen zwei dieser Stiere einen furchtbaren Kampf an. Mit vieler Kraft gegeneinander rennend, stürzen sie auf die Knie nieder, springen jählings wieder auf, rennen im Kreise umher, wedeln auf höchst bewunderungswürdige Weise mit dem Schwanz und jagen, in eine Staubwolke gehüllt, über die Ebene.
Mehrere Reisende nennen das Gnu ein Bild unbegrenzter Freiheit und schreiben ihm Stärke und Mut im hohen Grade zu. Seine Bewegungen sind eigentümlich. Das Gnu ist ein entschiedener Paßgänger und greift selbst im Galopp noch häufig mit beiden Füßen nach einer und derselben Seite aus. Alle seine Bewegungen sind rasch, mutwillig, wild und feurig. Dabei zeigt es eine Neck- und Spiellust wie kein anderer Wiederkäuer. Wenn es ernste Kämpfe gilt, beweisen die Böcke denselben Mut wie die Ziegen. Ihre Stimme ähnelt dem Rindergebrüll. Die holländischen Ansiedler übersetzen das eigentümliche Geschrei jüngerer Tiere mit den Worten: »Nonja, gudtn avond« oder »Jungfrau, guten Abend!« und behaupten, oft vom Gnu getäuscht worden zu sein, so deutlich habe es in ihrer Sprache sie angeredet.
Die Sinne, zumal Gesicht, Geruch und Gehör, sind vortrefflich; die geistigen Fähigkeiten dagegen scheinen gering zu sein. Die Spiele haben mehr etwas Verrücktes und Tolles als etwas Vorherbedachtes an sich. In der Gefangenschaft zeigt sich das Gnu oft unbändig und wild, unempfänglich gegen Schmeicheleien und gegen die Zähmung, aber auch ziemlich gleichgültig gegen den Verlust der Freiheit. Es kommt wohl an die Gitter seines Behälters heran, wenn man ihm etwas vorwirft, beweist sich aber keineswegs dankbar und geht ohne Wahl von einem Zuschauer zum andern. Seine Haltung im ruhigen Zustande ist ganz die der Rinder; der Paßgang unterscheidet es aber sofort von diesen. Dabei bewegt es den Hinterfuß immer etwas eher als den vordern. In Trab ist es nur schwer zu bringen, und wenn man ihm Gewalt antun will, gerät es wohl in Zorn, ist aber nicht zu vermögen, weite Sätze zu machen.
Die weiblichen Gnus bringen in verschiedenen Monaten des Jahres ein Junges zur Welt, das sich schon wenige Tage nach seiner Geburt in denselben Sprüngen und Possen gefällt wie seine Eltern, seiner geringen Größe halber aber noch drolliger erscheint als diese. Die Mutter liebt es mit warmer Zärtlichkeit und gibt sich seinetwegen ohne Bedenken Gefahren preis. Grausame Jäger reiten oft ein Kalb zu Boden, um die Mutter zu erbeuten, da diese sich ihrem gestürzten Kinde regelmäßig naht und nunmehr leicht eine Beute des Schützen wird.
Die Jagd des erwachsenen Gnu hat ihre Schwierigkeiten wegen der unglaublichen Schnelligkeit und Ausdauer des Tieres. Es wird behauptet, daß dieses wütend auf den Jäger losrenne und ihn durch Stoßen und Schlagen mit den Vorderläufen zu töten versuche, falls es zweifelt, in der Flucht Rettung zu finden. Verwundete sollen sich zuweilen, um ihren Qualen ein Ende zu machen, in Abgründe oder in das Wasser stürzen. Die Hottentotten gebrauchen vergiftete Pfeile, um es zu erlegen, die Kaffern lauern ihm hinter Büschen auf und schleudern ihm die Lanze oder den sicheren Pfeil durchs Herz. Gejagte Gnus zeigen eine auffallende Ähnlichkeit mit verfolgten wilden Rindern. Ihr Benehmen, wenn sie aufgestört werden, die Art und Weise, wie sie den Kopf auswerfen, wie sie sich niederducken, wie sie ausschlagen, bevor sie fliehen, alles erinnert lebhaft an diese Wiederkäuer. Wie die Rinder haben auch sie die eigentümliche Gewohnheit, vor dem Rückzüge die Gegenstände ihrer Furcht zu betrachten. Deshalb fliehen, wie schon aus Cummings Berichten hervorgeht, die Wildebeeste selbst dann nicht, wenn das tödliche Geschoß mehrere aus ihrer Mitte niedergestreckt hat. Es soll nicht selten geschehen, daß eine Herde Gnus einen Zug von Jägern herankommen läßt, ohne die Flucht zu ergreifen. Das Knallen der Gewehre versetzt sie freilich in großen Schrecken und bewegt sie zu den possenhaftesten Sprüngen.
Nur zufällig fängt man ein Gnu in Fallgruben oder in Schlingen. Alteingefangene gebärden sich wie toll und unsinnig, Junge dagegen werden, wenn man sie mit Kuhmilch aufzieht und sich viel mit ihnen abgibt, bald so zahm, daß man sie mit den Herden auf die Weide gehen lassen und ihnen alle Freiheiten eines Haustieres gewähren kann. Da die Bauern jedoch glauben, daß solche Junge zu Hautkrankheiten neigen und ihre Haustiere anstecken könnten, befassen sie sich nur selten mit der Aufzucht junger Gnus, und diese gelangen daher auch nicht eben oft lebend in unsere Tiergärten.

Streifengnu (Catoblepas taurinus)
Der Nutzen des erlegten Gnus ist derselbe, den andere Wildarten Afrikas bringen. Man ißt das Fleisch seiner Saftigkeit und Zartheit halber, benutzt die Haut zu allerlei Lederwerk und verfertigt aus den Hörnern Messerhefte und andere Gegenstände.
Die zweite Art der Sippe, das Streifen- oder Rindergnu, Baas der Hottentotten, Bastardwildebeest der Ansiedler ( Catoblepas taurinus), ist merklich größer als das Gnu, da seine Gesamtlänge reichlich 3 Meter, die Höhe am Widerrist 1,6 Meter beträgt, unterscheidet sich auch durch die stark gebogene Rammsnase, den bedeutend höheren Widerrist sowie die längere Nacken- und Halsmähne wesentlich von dem Verwandten. Die vorherrschende Färbung ist ein dunkles Aschgrau, von dem schwarze Querstreifen deutlich sich abheben. Das Streifengnu bewohnt in außerordentlich zahlreichen Herden das innere Südafrika und dehnt sein Verbreitungsgebiet von hier an bis in die oberen Nilländer aus. Lieblingsplätze von ihm sind jene mit kurzem Grase bedeckten Ebenen, auf denen verschiedene Mimosenarten hier und da zu Hainen zusammentreten oder mindestens aus wenigen Bäumen bestehende Gruppen bilden; hier lebt es, zu gewissen Zeiten ebenfalls wandernd, ebenso regelmäßig in Gesellschaft von Zebras wie das Weißschwanzgnu. In seinen Sitten und Gewohnheiten weicht es wenig von den Verwandten ab.