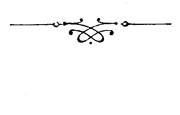|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
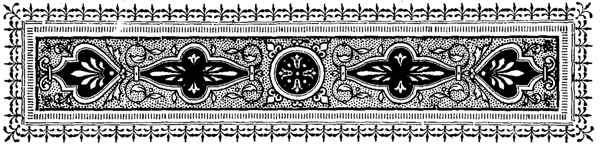
 Die Rolle, welche aristokratische Schriftsteller in der schönen Literatur gespielt haben, ist je nach dem Charakter der Zeit und der Beschaffenheit der Persönlichkeit eine sehr verschiedene gewesen. Das Mittelalter kannte das Volk als solches nicht und vermochte daher die Pflege der Kunstpoesie in keine anderen Hände als diejenigen des Adels und der Ritterschaft zu legen. Von ihrer Sorge behütet, entwickelte sich die romantische Dichtung zu den Blüthen und Blumen des Minnegesangs und des Epos. Erst später, als das Städteleben aufkam und bei der modernen Culturarbeit neue Kräfte in's Spiel traten, ließ die Muse ihre Jünger auch aus dem Volke erstehen und suchte den Schutz der Großen und Mächtigen nur auf, um sich gegenüber der Gleichgiltigkeit und dem Stumpfsinne der Welt in künstlerischer Reinheit zu erhalten. Seitdem nimmt die Kunst, dem demokratischen Zuge der neuen Zeit entsprechend, das Genie wo sie es findet, unbekümmert um die Schranken, welche wir in
unserem gesellschaftlichen Leben aufgerichtet haben. Ein Cardinal Richelieu mochte die ganze Fülle weltlicher und geistlicher Macht, die ihm gegeben war, aufbieten, er mochte sich des Theaters in edler Gönnerschaft annehmen, und konnte doch, wenn er selbst zur Feder griff, von einem einfachen Rechtsgelehrten wie Pierre Corneille unendlich übertroffen werden, so daß ein Werk der »rothen Eminenz« wie »Mirame« sich zu den Schöpfungen des Begründers der französischen Tragödie verhielt, wie ein trüb brennender Lichtstumpf zur Sonne. Von nun an war es entschieden, daß alle Vortheile der Herkunft, der Erziehung und der socialen Bedeutung nichtssagend sind gegenüber der Ueberlegenheit des Talentes, der echten, zu Kampf und Sieg berufenen Begabung. Mit Vorliebe hat seitdem die Poesie zu Verkündern ihrer hehrsten Offenbarungen Vertreter jener mittleren Stände gemacht, in denen bereits eine geistige Entwickelung als höchstes Ziel erscheint, während sich Seele und Phantasie noch in einem frischen, empfänglichen Zustande befinden.
Die Rolle, welche aristokratische Schriftsteller in der schönen Literatur gespielt haben, ist je nach dem Charakter der Zeit und der Beschaffenheit der Persönlichkeit eine sehr verschiedene gewesen. Das Mittelalter kannte das Volk als solches nicht und vermochte daher die Pflege der Kunstpoesie in keine anderen Hände als diejenigen des Adels und der Ritterschaft zu legen. Von ihrer Sorge behütet, entwickelte sich die romantische Dichtung zu den Blüthen und Blumen des Minnegesangs und des Epos. Erst später, als das Städteleben aufkam und bei der modernen Culturarbeit neue Kräfte in's Spiel traten, ließ die Muse ihre Jünger auch aus dem Volke erstehen und suchte den Schutz der Großen und Mächtigen nur auf, um sich gegenüber der Gleichgiltigkeit und dem Stumpfsinne der Welt in künstlerischer Reinheit zu erhalten. Seitdem nimmt die Kunst, dem demokratischen Zuge der neuen Zeit entsprechend, das Genie wo sie es findet, unbekümmert um die Schranken, welche wir in
unserem gesellschaftlichen Leben aufgerichtet haben. Ein Cardinal Richelieu mochte die ganze Fülle weltlicher und geistlicher Macht, die ihm gegeben war, aufbieten, er mochte sich des Theaters in edler Gönnerschaft annehmen, und konnte doch, wenn er selbst zur Feder griff, von einem einfachen Rechtsgelehrten wie Pierre Corneille unendlich übertroffen werden, so daß ein Werk der »rothen Eminenz« wie »Mirame« sich zu den Schöpfungen des Begründers der französischen Tragödie verhielt, wie ein trüb brennender Lichtstumpf zur Sonne. Von nun an war es entschieden, daß alle Vortheile der Herkunft, der Erziehung und der socialen Bedeutung nichtssagend sind gegenüber der Ueberlegenheit des Talentes, der echten, zu Kampf und Sieg berufenen Begabung. Mit Vorliebe hat seitdem die Poesie zu Verkündern ihrer hehrsten Offenbarungen Vertreter jener mittleren Stände gemacht, in denen bereits eine geistige Entwickelung als höchstes Ziel erscheint, während sich Seele und Phantasie noch in einem frischen, empfänglichen Zustande befinden.
Trotzdem hat es aber auch in der Neuzeit keiner Literatur an Männern gefehlt, die auf der Menschheit Höhen geboren sind und das Verlangen bekundet haben, dem ererbten Adel einen noch schöneren hinzuzufügen, den das Talent und der Fleiß ertheilen. Das Auftreten solcher Männer kann dem geistigen Leben eine eigenthümliche, wohlthuende Färbung verleihen, wenn sie ihre Muße und bevorzugte Stellung, die es ihnen gestattet, von niederen Rücksichten des Erwerbes abzusehen, für die Förderung eines feinen und geläuterten Geschmacks ausnützen und ihr Formgefühl auch in der Literatur zum Ausdrucke bringen. Die russische Poesie hat während der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts diesem Umstande einen vornehmen Charakter zu verdanken, der auf das Vortheilhafteste absticht von den Roheiten, die eine so junge Kunst sonst im Gefolge zu haben pflegt. Alexander Herzen, der bekannte radicale Schriftsteller und Agitator, konnte daher folgendes Bekenntniß ablegen: »Es ist für unsere Literatur ein großer Vortheil gewesen, daß ihre ersten Vertreter Männer der vornehmen Welt waren. Durch sie wurde in unser Schriftthum die Eleganz der guten Gesellschaft, Lauterkeit des Ausdrucks und Adel der Empfindung eingebürgert.« Auch unsere Literatur hat in der neuesten Zeit einige aristokratische Dichter von seltenem Talente aufzuweisen, und namentlich beachtenswerth erscheint ihre Vorliebe für die verschiedenen Formen der Lyrik, die in ihren Schöpfungen einen ganz neuen Aufschwung genommen hat. So erscheint Graf Platen als ein Classiker der Form, der sich an den höchsten Aufgaben in seiner Kunst versuchte und als echter Priester derselben die falschen Götter aus dem Tempel trieb; so tritt uns Zedlitz entgegen, der seine »Todtenkränze« auf die Gräber großer Dichter und weiser Regenten niederlegte; so strömte auch Graf Auersperg, dem die Literaturgeschichte als Anastasius Grün einen Ehrenplatz angewiesen hat, den modernen Geist der Freiheit in seinen Versen aus. Diese Männer haben den erhabensten Vorstellungen den Wohllaut ihrer Sprache geliehen und in ihren Dichtungen eine Summe von Geschmack und Formschönheit zu Tage gefördert, die sie zum dauernden Besitze unserer Nation machen.
In den Kreis dieser Schriftsteller, die durch hervorragende poetische Leistungen und durch allgemeine Pflege der Kunst die Verpflichtung ihrer vornehmen Geburt eingelöst haben, tritt auch Graf Adolf Friedrich von Schack. Wohl ist er bisher mehr als geistvoller Vermittler der Literatur und Beschützer der Kunst, denn als schöpferisches Talent bekannt geworden, aber gerade in der letzteren Eigenschaft hat er so viel Rühmliches und Mustergiltiges vollendet, daß nur seine Geringschätzung des Modegeschmacks im Stande war, ihm die verdiente Anerkennung verhältnißmäßig spät zu Theil werden zu lassen. Freilich sind seine Dichtungen nicht darnach angethan, um auf dem großen Markte von stoffhungrigen Lesern massenhaft begehrt zu werden, denn hier wird nicht Der beachtet, der am besten spricht, sondern nur Derjenige, welcher seine Stimme am lautesten zu erheben vermag. Freilich hat der Dichter dem Roman in Prosa, der für die Menge allein die Poesie darstellt, keine Zugeständnisse gemacht und auch die gebundene Form immer nur für geistig bedeutende Aufgaben gebraucht. Der Bänkelsängerton, der immer nur von Wein, Weib und Gesang schwärmt und diese Themata für die Bedürfnisse des Philisters zurecht macht, ist in seinen Werken nirgends zu finden. Sie haben eine festere und aus edlerem Material gefügte Grundlage: die modernen Interessen der fühlenden und denkenden Menschheit, jene Gedanken und Empfindungen, die zu allen Zeiten als das Ideal der Humanität angesehen wurden.
Kein Reisender, der von Norden kommt und seinen Weg nach der Schweiz, Tyrol oder Italien nimmt, wird es, wenn er die bayerische Hauptstadt betritt, versäumen, der Gemäldegalerie des Grafen Schack in der äußeren Briennerstraße einen Besuch abzustatten. Die Sammlung ist ohne Frage die reichste, die sich in Deutschland in den Händen eines Privatmannes befindet und hat die Errichtung eines eigenen Gebäudes nothwendig gemacht. Das Interesse der Kunstfreunde hat sie namentlich dadurch auf sich gezogen, daß sie die alte und die moderne Kunst in eigenartiger Weise einander gegenüberstellt und den Beschauer von den Werken neuerer Maler, die sonst nicht häufig vertreten sind, vor die Nachbildungen von Gemälden alter Meister treten läßt, die zu den größten Errungenschaften der Kunst gehören. Schack hat eine ganze Anzahl von Talenten in freigebigster Weise und nicht selten zu einer Zeit mit seinen Aufträgen unterstützt, in der sie mit dem äußeren Erfolg noch mühsam zu kämpfen hatten und keineswegs allgemein anerkannt waren. Ein solches Mäcenatenthum, welchem die Liebe zur Kunst das feinste, an den Meisterwerken gereifte Urtheil und Verständniß zugesellte, konnte nicht verfehlen, die schönsten Früchte zu tragen. Wer die zarte und duftige, dabei aber doch so gesunde Romantik und keusche Naivetät eines Moritz von Schwind, die aus der Tiefe der Seele in wilden Sturzbächen hervorschäumende Originalität eines Arnold Böcklin, die edle, zur classischen Würde erhobene Einfachheit eines Anselm Feuerbach kennen lernen, wer Franz Lenbach's unübertroffene Copien von Gemälden Tizian's, Giorgione's, Velasquez' u. A. studiren will, die einen so reinen und lebhaften Abglanz von dem Zauber der Originale enthalten, wird seine Schritte zu dieser Sammlung lenken müssen. Da das Publikum sich im Laufe der Jahre immer lebhafter für diese Galerie interessirt, hat sich ihr Besitzer veranlaßt gefühlt, in dem Buche: »Meine Gemäldesammlung« (3. Auflage, Stuttgart 1884) über die Geschichte derselben und die Grundsätze nach denen sie gebildet wurde, einen höchst anziehenden Bericht zu erstatten. Das Buch fesselt in gleicher Weise durch die geschmackvolle Darstellung wie durch den Geist künstlerischer Nachempfindung, der aus ihm spricht, und bringt mit der Schilderung der einzelnen Kunstwerke und Künstler manche anziehende Erinnerung aus dem Leben das Verfassers in Verbindung. Der Sammler von Werken aus der Welt des Schönen zeigt denselben idealen, von der Tagesmode unbeeinflußten Sinn, der auch die Grundlinien in der Physiognomie des Dichters bildet.
Graf Schack erfreute sich lange Jahre des ausgezeichnetsten Rufes durch seine literarhistorischen und Uebersetzungsarbeiten, bevor auch nur eine Zeile von seinen selbstständigen Dichtungen bekannt war. Er hatte durch diese Studien ganz neue Gebiete der Poesie erschlossen und dabei Leistungen ersten Ranges zu Tage gefördert. Mit feinerem poetischen Verständnisse und virtuoserer Behandlung der Sprache, mit mehr Sachkenntniß und sichererem ästhetischen Urtheile, als es durch diesen Autor geschehen ist, sind uns die Literaturen fremder Völker niemals vermittelt worden, obwohl unsere Nation in der Zahl der Uebersetzungskünstler und Interpreten ausländischer Dichtungen von keiner anderen übertroffen wird. Wir besitzen große Formtalente ohne tiefere Bildung, bedeutende Gelehrte ohne Sinn für poetische Wirkungen, die sie an ähnlichen Aufgaben versucht haben, während sich bei Schack der Künstler und der Gelehrte das Gleichgewicht hielten und ihn in den Stand setzten, ästhetischen und wissenschaftlichen Ansprüchen in gleicher Weise gerecht zu werden. Sogar die als Jugendwerk anzusehende »Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien« ist, was lichtvolle Darstellung und unparteiische Kritik angeht, nicht übertroffen worden. Den Gewohnheiten kritischer Schulmeister, mit feststehenden und unmotivirten Censuren vor die Werke der Schriftsteller zu treten, setzt der Autor das liebevollste Eingehen auf die Sache, die Wärme natürlicher Begeisterung entgegen. Ihm ist die Poesie kein von den übrigen Culturbedingungen unabhängiges Abstractum, sondern nur verständlich im Hinblick auf die gesammte historische Entwickelung. Seine Kritik maßregelt nicht, sondern gestaltet die Figuren der großen Dichter für uns aus, sie fertigt uns nicht in eitlem Besserwissen mit souveränen Urtheilen ab, sondern verfährt malend und bildend, wodurch sie selbst zu einer Kunst wird, indem sie uns in die Geheimnisse des Schönen einführt. Schack's Analysen der Dramen Lope's, Calderon's und Moreto's, sowie seine Charakteristiken dieser Dramatiker sind der Gegenstand der Bewunderung bei allen Kennern, welche sich mit dieser Periode beschäftigt haben, und sind auch von dem Geschichtsschreiber des Dramas, J. L. Klein, als mustergiltig anerkannt worden. Ein späteres Buch »Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien« ist mit der Kraft der besten Mannesjahre geschrieben und als die schöne Frucht eines längeren Aufenthaltes in Andalusien und zweier in Granada verlebten Sommer anzusehen. Es enthält eine wahrhaft prachtvolle Darstellung der Menschen und Zustände, der Dichter und Fürsten, der Natur und Kunst, in welcher die mohamedanische Cultur einst ihren Höhepunkt erreichte. Bei der Lectüre dieses Werkes glaubt man durch einen von Blüthenduft erfüllten, im Frühlingssonnenschein erglänzenden Garten zu wandern.
Auch der Uebersetzungen des Autors müssen wir gedenken, nicht nur weil sie eine Meisterhand verrathen, sondern auch weil sie zur Betrachtung des Dichters hinüberleiten. Seine Hauptleistung auf diesem Gebiete ist das dreibändige Werk, das er dem persischen Dichter Firdusi und seinem großen Epos von Iran widmete, und in welchem er den Reiz des Originals, das Gemisch von Großartigkeit und Anmuth, von erschütterndem Pathos und sanft hinschmelzender Lieblichkeit in den deutschen Versen auf das treueste zu wahren wußte. Andere ebenso treffliche Arbeiten sind der mit Emanuel Geibel herausgegebene »Romanzero der Spanier und Portugiesen«, das »Spanische Theater«, die Uebertragungen der reizenden Vierzeilen des Omar Chijam, in welchen bereits der Geist des zwei Jahrhunderte später geborenen Hafis lebt und der seelenvollen indischen Sagen von Sakuntala, Nalodaya u. A. in den »Stimmen vom Ganges«, in welchen uns die Romantik des Ostens so träumerisch anblickt.
Was Uebersetzungen im Allgemeinen betrifft, so wird man sich den Zweifeln des Licentiaten im »Don Quijote«, ob sie trotz aller Mühe und Sorgfalt die letzten Feinheiten des Originals wiedergeben können, ohne Frage anschließen müssen. Es handelt sich dabei immer um die Annäherung an ein unerreichbares Ideal. Ebenso wenig dürfte indessen darüber eine Meinungsverschiedenheit herrschen, daß das Uebersetzen einer Dichtung keine mechanische Arbeit ist, die sich äußerlich durch das Uebertragen der einzelnen Worte aus einer Sprache in die andere zusammenstücken läßt. Vielmehr gehört hierzu ein völliges Aufsaugen und Wiedererzeugen der fremden Poesie durch die Person des Uebersetzers, ein Nachempfinden und Nachschaffen des Originals, was selbst dichterische Eigenschaften voraussetzt. Die Bedeutung der Schack'schen Uebersetzungen liegt nicht allein in ihrer Formschönheit, sondern wesentlich auch in dem Talente ihres Verfassers, die Ideen und Vorstellungen des Dichters so mit dem Genius unserer Sprache in Einklang zu bringen, daß der Eindruck auf den Leser ein durchaus harmonischer und ungestörter ist. In diesen Werken erreicht das Nachfühlen und Verstehen der Poesie eine Höhe, auf welche sich nur ein wirklicher Künstler hinaufschwingen kann. Dasselbe gilt von den literar-historischen Schriften, die in einem so wunderbar plastischen Style abgefaßt und von einer Wärme des Ausdrucks durchdrungen sind, wie sie keinem nur gelehrten Schriftsteller zu Gebote stehen. Wer die Einleitung zum Firdusi und die darin enthaltene Charakteristik des persischen Epos oder die Schilderung der Alhambra gelesen hat, bei welcher alle Farben und Formen für die Phantasie des Lesers lebendig werden, wird gestehen, daß aus ihnen kein lediglich reproducirendes Talent zu ihm spricht. Die folgende Beschreibung des Wunderbaues der maurischen Architektur mag uns gleichzeitig als Probe der Schack'schen Prosa dienen, von welcher wir nunmehr Abschied nehmen:
»Ihren vollen Reiz enthüllt die Alhambra erst bei wiederholter Betrachtung. Man muß diese Feenräume bewohnen, muß in ihren kühlen Steingrotten und Säulenlauben die Mittagsschwüle verträumen und sich dem Eindruck der wechselnden Reize hingeben, die jede Tageszeit in ihnen hervorruft, sei es, daß der Morgen in seiner himmlischen Frische auf ihre Terrassen und Galerien niederschaut und mit steigendem Strahl über ihre wie mit Perlen besäeten Wände hinzittert, sei es, daß der Abend sie mit der vollen Glorie des Südens und einem Glanze umstrahlt, der nicht von dieser Welt zu sein scheint. Man muß die Dichter des Orients in Händen, auf den schwebenden Balkonen des Schlosses die Düfte dieser balsamischen Einsamkeit einathmen, oder am Löwenbrunnen sitzend dem Murmeln der unterirdischen Wasser lauschen, während das Mondlicht einer andalusischen Sommernacht von Säule zu Säule rückend, die Hallen mit schwebenden Schatten wie mit Geistern der Vergangenheit erfüllt. Wer sich so mit dem Genius des Ortes vertraut gemacht hat, dem erschließen sich auch dessen Geheimnisse und die Verse der Inschriften, die sich wie magische Zeichen um Wände und Pfeiler ranken, gestalten sich ihm zur lebendigen Menge, so daß das ganze Gebäude gleichsam in ein architektonisches Gedicht verwandelt wird. Verödet sind jetzt diese Räume; das fröhliche Leben, das einst in ihnen gewaltet, ist verstummt; nie mehr tönt die Schellentrommel zur festlichen Zambra; nie mehr lauscht Zaide vom Balkon dem Saitenspiel ihres Ritters; aber bisweilen an festlichen Tagen, wenn die springenden Wasser in Bewegung gesetzt werden, belebt sich das stille Schloß von Neuem; überall, mächtig und unaufhaltsam, wie lang zurückgedrängte Gefühle aus dem Herzen hervorbrechen, sprudelt dann das klare Element hervor, hier in Silberfäden hinschießend, dort sich in Cascaden durch die Marmorrinnen ergießend und in leuchtenden Garben aus den Becken sprühend, und es ist als erhöbe sich mit ihm die alte Herrlichkeit wieder aus dem Abgrund, wo sie so lange begraben gewesen, als tauchten die Schutzgeister dieser Zauberhallen, die Peri's und Dschinnen Arabiens mit den verborgenen Schätzen der Tiefe aus den Cisternen, um ihren Lieblingssitz in der alten Pracht zu schmücken. Ein Frühling aus dem Orient scheint in Glanz und Wärme das Gestein zu umhauchen und rings beginnt ein Knospen und Regen; der Ostwind gießt die Düfte, die er im Palmenlande eingesogen, über die Säle aus, die zarten Wölbungen, vom blitzenden Gischte der Springquellen angestrahlt, wallen und leuchten gleich ziehenden Morgennebeln, und in allen Höfen wird es laut von verklungenen Stimmen der alten Zeit und alle hallen in einem Jubelruf zusammen.«
Hinter dem Kenner, Erläuterer und Uebersetzer der verschiedenen Literaturwerke konnte sich in der That der selbstständige Dichter auf die Dauer nicht verbergen, und wenn er lange zögerte hervorzutreten, so geschah es nur, weil ihn die Beschäftigung mit den großen Meisterwerken der Künste zur feinsten Selbstkritik erzogen hatte und ihn vor allem Halben und Unreifen zurückschrecken ließ. Aber endlich gelang es ihm, sich nicht nur als eine vollpoetische Natur zu zeigen, sondern auch einen Besitz von Gedanken und Vorstellungen nachzuweisen, die zwar von den Denkern und Dichtern aller Zeiten befruchtet sind, aber doch im Lichte des modernen Lebens, das auf sie fällt, als das unmittelbare Eigenthum des Autors betrachtet werden müssen. Nun aber trat der wunderliche Fall ein, daß der Dichter gerade durch seine ausgezeichneten gelehrten Arbeiten sich den Weg zur allgemeinen Anerkennung seiner Poesien zunächst versperrt hatte. Mit seinem Namen verband das Publikum die Vorstellung eines Gelehrten und Kunstkritikers hohen Ranges und hatte Jahre lang nur Kopfschütteln und Gleichgiltigkeit, wenn ihm von Kennern erzählt wurde, daß die Bedeutung des Mannes sich hierin keineswegs erschöpfe. Aber ein in unserer Literatur feststehendes Urtheil zu beseitigen, auch wenn es noch so falsch ist, scheint eine Herkulesarbeit zu sein. Wie Schauspieler, die in Folge eines Schreibfehlers in der Rolle ihrem Gedächnisse einen Widersinn eingeprägt haben und ihn trotz aller Ermahnungen des Regisseurs auf der Probe beständig wiederholen, war auch unsere Leserwelt nicht zu überreden, dem Grafen Schack einen anderen Platz als neben den Uebersetzern und Literarhistorikern anzuweisen. Wir wissen aus anderen Beispielen, wie schwer unser Publikum ein aus Grund bestimmter Eindrücke gefälltes Urtheil über einen Künstler der besseren Einsicht zu Liebe umwirft und darnach umformt. Weil Grillparzer mit seinem Erstlingswerke der Schicksalstragödie huldigte, mußte er sein ganzes Leben den Titel Schicksalsdramatiker herumtragen, obwohl er in allen seinen späteren Werken sich von der Weltanschauung eines Müllner, Zacharias Werner, Houwald u. A. vollständig befreit hatte. Weil Franz Liszt sich als Claviervirtuose einen Weltruhm erworben hatte, glaubte man seine unzweifelhafte und echte Begabung als Componist gänzlich übersehen zu dürfen. Auch unser Dichter hat unter einer ähnlichen Verkennung zu leiden gehabt, die erst in der letzten Zeit einer gerechten Anerkennung seines schöpferischen Talentes Platz gemacht hat. Seine Dichtungen sind weder die dilettantische Ausfüllung von Mußestunden, noch der Widerhall jener Klänge, die er aus dem Oriente und Spanien nach Deutschland hinübergetragen hat, sondern der Ausdruck eigensten Wollens, Fühlens und Denkens.
Wie Graf Schack die Anregungen fremder Literaturen voll auf sich wirken ließ, so war es ihm auch vergönnt, in der unabhängigen Stellung, deren er sich zu erfreuen hatte, die verschiedensten Culturländer und deren Eigenthümlichkeiten gründlich kennen zu lernen. Der am 2. August 1815 zu Brüsewitz bei Schwerin geborene Dichter hat in Bonn, Heidelberg und Berlin Rechtswissenschaft studirt und in letzterer Stadt einige Zeit beim Kammergericht gearbeitet. Ein unwiderstehlicher Wandertrieb führte ihn frühzeitig dem Süden und Osten entgegen, wo seine Aufmerksamkeit in gleicher Weise durch die herrliche Natur und die historischen Erinnerungen gefesselt wurde. Spanien, Sicilien, Italien einerseits, Egypten, die Türkei, Griechenland andererseits gehörten zu seinen ersten Reisezielen. Aehnliche Studienreisen machte er in Gesellschaft des Großherzogs von Mecklenburg, dem er als Kammerherr und Legationsrath zuerst nach Italien und Constantinopel, später nach Spanien und dem Orient folgte. Während er als Geschäftsträger in Berlin lebte, gab er sich einem eingehenden Studium der orientalischen Sprachen hin, dem wir die erwähnten vorzüglichen Uebersetzungen aus dem Arabischen, Persischen und Sanskrit zu verdanken haben. Nachdem er im Jahre 1855 seinen Wohnsitz in München aufgeschlagen hatte, wurde er 1876 vom Deutschen Kaiser in den Grafenstand erhoben. Das Alter hat an seiner Gewohnheit, fremde Länder und Völker zu studiren, nichts geändert, und noch jetzt pflegt er beim Beginne des Winters seine Heimat zu verlassen und das Land der Orange und des Lorbeers aufzusuchen, welchem seine Muse eine Reihe glücklicher Eingebungen zu danken hat.
Es gehörte eine besonders feste, in sich abgeschlossene Natur dazu, die Buntheit dieser Eindrücke so zu verarbeiten, daß sie den eigentlichen Kern des Talentes nicht auflösten und zu einem leeren Widerspiele der mannigfachsten Studien machten, sondern ihn vielmehr aus der Hülle herausschälten und in seinem Werthe erkennen ließen. Die Gefahr lag nahe, die Poesie zu einer bloßen Illustration des Gelesenen und Gesehenen zu machen und ganz in der Nachahmung jener Muster aufzugehen, die mit so vielem Fleiß und Verständniß studirt waren. Aber ebensowenig wie die Reisen durch die europäischen Culturstaaten in Schack das Gefühl für Vaterland und Nationalität erstickt haben, sind seine Uebersetzungen und Literaturstudien im Stande gewesen, ihn in die akademische Richtung der Poesie hineinzudrängen, welche sich in einem leeren Spiele mit Formen gefällt, heute auf den Spuren Goethe'scher Einfachheit wandelt, morgen nach der marmornen Schönheit Platen'scher Verse trachtet, jetzt mit Eichendorff träumt und gleich darauf mit Heine spottet, in diesem Augenblicke mit romanischer, in jenem mit orientalischer Anschauung liebäugelt. Solche lebendige Musterkarten der Poesie hat unsere Literatur in einer ganzen Anzahl von Exemplaren aufzuweisen und das Schellengeklingel von Sapphischen Strophen, Makamen, Terzinen, Sonetten, Ghashelen, Slokas u. A., das den eigentlichen Inhalt ihrer Werke bildet, hat etwas Chinesenhaftes und vereinigt den Spieltrieb des Knaben mit der Empfindungslosigkeit des Greises. Daß die Kunst vor Allem Sinnlichkeit, Farbe, Gestalt, Leben bedinge, daß sie nur eine Existenzberechtigung habe, wenn sie von der Phantasie geschaffen und im Feuer einer gesteigerten Empfindung gestählt wird, ist eine Wahrheit, zu deren Anerkennung sich die bloßen Formvirtuosen niemals aufschwingen können. Das Gegengewicht gegen solche Versuchungen, welchen manche schöne Begabung zum Opfer gefallen ist, liegt bei unserem Dichter in zwei Momenten, die bei seiner Charakterisirung auf das Entschiedenste betont werden müssen. Wir meinen den deutschen Grundzug seines Wesens, der in seinen Poesien scharf hervorgekehrt ist, und den Umstand, daß er ein unbedingt moderner Mensch ist und ein gläubiges Vertrauen bekundet, sobald er sich den Interessen der Gegenwart, der Culturarbeit unserer Zeit im Verfolgen geistiger, künstlerischer oder poetischer Aufgaben zuwendet. Aus der Vergangenheit zieht es ihn immer wieder mit Allgewalt in die Gegenwart, aus der Fremde in die Heimat zurück, er verliert sich in seinen Studien nicht, sondern vertieft sich nur durch sie. Schack gehört nicht zu den Beklagenswerthen, die in einem inhaltslosen Kosmopolitismus stecken geblieben sind und ihr Vaterland aufgegeben haben, ohne eine neue heimatliche Stätte zu finden, dem Baum vergleichbar, den man mit seinen Wurzeln aus der Erde gegraben hat, ohne daran zu denken, ihn auf neuem Boden in den Schooß derselben einzusenken. Der Dichter ist ein Patriot aus innerster Ueberzeugung, nur reicht sein Patriotismus so weit, daß er den Blick frei und ungehindert über die anderen Werkstätten der Civilisation. schweifen läßt. Wohl konnte er in den Eingangsversen seiner »Gedichte« von sich sagen:
»Mit Indiens Weisen in den Siedelei'n,
Wo Ganga rauscht an Wasserlilienbeeten,
Mit Zoroaster bei des Feuers Schein,
Des heiligen, zu dem die Parsen beten,
Wie mit Arabiens kühnen Wüstensöhnen
Sprach ich vertraut in ihrer Sprache Tönen«;
aber der Autor ist nur deshalb in die weite Welt gezogen, um sein Vaterland an den fremden Nationen zu messen, er hat seine Individualität unter ihnen nicht ausgegeben, sondern im Gegentheile erst recht gekräftigt und sich dabei als treuer Sohn der deutschen Mutter erkannt. Die Liebe zu ihr, die Zuversicht, daß ihr eine ruhmreiche Zukunft beschieden sei, klingt bald lauter, bald leiser als Grundmelodie durch viele seiner Werke hindurch. Schon in den »Gedichten« findet dieses Heimatgefühl rührende und ergreifende Töne, die aber zu mächtigem Pathos anschwellen in »Lothar«, den politischen Lustspielen und den »Nächten des Orients«, wo die Verherrlichung der Gründung des Deutschen Reiches eine besonders schöne und wirkungsvolle Instrumentation erhalten hat.
Modern ist der Dichter insofern, als er sich mit der Bildung seiner Zeit allseitig erfüllt hat und ihren Resultaten mit begeisterter Anerkennung gegenübersteht. Es liegt in dem positiven und bejahenden Charakter der Schack'schen Poesie, daß sie sich dem Guten und Schönen zuwendet und diese Ideale der Menschheit aus dem Widerstreite der Kräfte stets siegreich hervorgehen läßt. Im Gegensatze zu der Tagesströmung, in welcher die Muse dem Evangelium des Weltelends und Nichtseins zu huldigen liebt, verherrlicht Schack den Optimismus, wenn er ihn auch nicht als feststehende und unbestreitbare Thatsache von vornherein auffaßt, sondern ihn als Resultat einer Entwickelung geltend macht, welche die Leiden der Existenz siegreich überwindet. Das wahrhaft Erlösende erblickt er in der Steigerung der Intelligenz, welche die Menschheit von Stufe zu Stufe zu immer höherer Gesittung geleitet und sie einen immer vollkommeneren Gebrauch der Freiheit lehrt. Wohl wissen wir, daß unsere Poesie im Allgemeinen mit der Modephilosophie im Einklang steht und deren Thesen künstlerisch zu verwerthen sucht, aber wir glauben, daß die Dichtung des Pessimismus in Lord Byron und Alfred de Musset, in Heinrich Heine und Giacomo Leopardi Höhepunkte erreicht habe, mit welchen die Versuche der neueren Weltschmerztalente sich auch nicht im Entferntesten vergleichen lassen. Es ist eben ein Unterschied zwischen der Wehmuth und Verzagtheit großer Männer, welche den Empfindungen einer ganzen Epoche einen mustergiltigen Ausdruck verliehen haben, und den zimperlich-koketten Miniaturtalenten, welche die Trauerweide als Symbol ihrer Kunst ausgeben. Es ist viel Mißbrauch mit den erhabenen Vorstellungen der Entsagung und des Schmerzes getrieben worden, so viel, daß wir alle Veranlassung haben, uns wieder den Dichtern zuzuwenden, welche Schwung und Kraft genug besitzen, um die Lebensfreudigkeit und Weltschöne in vollen Accorden zu feiern und zu ihnen wie zu ewigen Sternen auf dem Culturwege des Menschengeschlechtes emporzublicken.
Es ist bezeichnend für das eigenthümliche Talent des Dichters, daß ihm die einfachen Formen der Lyrik, in welchen die Empfindung unmittelbar ausströmt, nicht unbedingt zu Gebote stehen. In der Kunst, ein individuelles Gefühl in Worten und Versen so auszudrücken, daß es eine allgemein giftige Bedeutung gewinnt und als Lied von Mund zu Mund geht, hat die Schack'sche Muse wenig Hervorragendes geleistet. Sollte hierin Jemand einen Mangel an Subjectivität und ursprünglichem Gefühl erblicken und diesen Mangel dem Autor zum Vorwurfe machen, so könnte man mit vollem Rechte darauf erwiedern, daß es in dem Wesen geistig hoch entwickelter Individuen liegt, nicht in zufälligen Seelenstimmungen, wie sie das Alltagsleben eingibt, zu verharren, sondern den Blick auf den großen Zusammenhang der Dinge und Menschen, der Ideen und Vorstellungen zu richten. Wenn andere Dichter sich einreden möchten, daß ihr subjectives Gefühl, in dem sie ohne Beziehung zur Außenwelt wie der Vogel in seinem Bauer leben, die ganze Welt sei, erblickt Schack in seinem Talente nur das Mittel, die höchsten Ideen des Wahren, Guten und Schönen wiederzuspiegeln und den Inhalt des modernen Lebens in Rhythmus und Wohllaut zu verwandeln. Wie er Natur und Menschenschicksale ansieht, erweitern sich diese Vorstellungen zu prächtigen Bildern des Alls, und der philosophische Gedanke vermält sich mit der dichterischen Anschauung in der glücklichsten Weise. Was dem weichen Fluß, dem nur hingehauchten Laut des Liedes Abbruch thut, wird dem Autor zum Sprungbrett, von welchem er sich zu den höchsten Gattungen der Lyrik, wie Ode, Hymne und Ballade mühelos emporschwingt. Mit seinem schweren geistigen Ballast kann er sich in einem kleinen Kahn nicht gut vorwärtsbewegen, aber seiner prächtig geschmückten Fregatte, die alle Segel aufgezogen hat, verleiht die stolze Ladung Ruhe und Sicherheit bei der Fahrt auf hoher See. Und wie geschickt, besonnen und kühn zugleich weiß der Steuermann die einmal eingeschlagene Richtung weiter zu verfolgen! Da ist kein Ziel zu weit, er erringt es, keine Brandung zu hochgehend, er dringt hindurch und erreicht glücklich das Land. Alle Zonen eröffnen ihm ihre Schätze, alle Epochen geben ihm Stoff für die Wiedergeburt der Dinge in der Phantasie des Dichters.
Wenn wir erwähnten, daß unter den »Gedichten« die Lieder uns das eigentliche Wesen des Dichters nicht nahe bringen, so wäre es doch ungerecht, ihm für diese Gattung Lyrik jegliche Begabung absprechen zu wollen. Schon der Umstand, daß ein Componist vom Range Johannes Brahms' sich von ihnen zu musikalischen Schöpfungen begeistern ließ, spricht für ihren künstlerischen Werth. Am gehaltvollsten dürften die »Lieder der Trauer« sein, in denen der Schmerz um eine früh Verstorbene einen rührenden Ausdruck annimmt und. sich in eigenthümlicher Weise verklärt:
»Süß ist die Trauer im Gemüthe,
Die von vergang'nen Wonnen spricht,
O raubt die Düfte nicht der Blüthe,
Dem Herzen seinen Kummer nicht.«
Immer wird ihm das Einzelne zum Allgemeinen, und dieses Allgemeine ist nicht die Entsagung der Pessimisten, sondern der Glaube an die Entwickelung unseres Geschlechtes. Das spricht sich in doppelter Weise aus: in der Anlehnung an die mannigfaltigen Erscheinungen des Naturlebens und die bedeutsamen Wendepunkte der Völkergeschichte. Das Naturbild und das Geschichtsbild sind das heimatliche Gebiet des Schack'schen Talentes, auf dem ihm eine Reihe der glänzendsten Würfe gelungen ist. In den »Gedichten«, die zuerst zu Anfang der sechziger Jahre und seitdem mehrere Male neu aufgelegt erschienen, kann man deutlich wahrnehmen, wie sich Raum und Zeit für den Autor erweitern und nach allen Richtungen prachtvolle Aussichten eröffnen. Dort, wo die Natur sich am gewaltigsten offenbart, zwischen den eisbedeckten Gipfeln der Hochalpen oder dort, wo sie ein ganzes Füllhorn voll Schönheiten auf ihren blumendurchwirkten Teppich ausschüttet, wie im romanischen Süden, oder dort endlich, wo sie malerische Ruinen als Zeugen einer herrlichen Vergangenheit hingestellt hat, wie in Griechenland, weilt der Dichter am liebsten. Die Trümmer des »Tempels von Theben« werden ihm zum Symbol der Vergänglichkeit alles Lebendigen und regen ihn zu zweifelsschweren Fragen an:
»Du dort im mystischen Dunkel
Zwischen steinernen Tafeln und Himmelskugeln,
Mächtige Göttin,
Die seit dem grauenden Morgen der Welt
Unter dem nie gelüfteten Schleier
Gedanken der Ewigkeit sinnt,
Löse die bangen Zweifel mir!
Ueber der Erde weiten Todtenacker
Bin ich gewandert;
Vom Auf- zum Niedergang versank mir der Fuß
In der Asche zerstörten Lebens,
Wirbelte der Völker Staub
Unter meinem Tritt.
Werke von Uebermenschen
Fand ich wie Kinderspielzeug zerbrochen,
Reiche und Religionen
Bis auf die Namen verschollen.
Und ist im ew'gen Vergehen und Werden
Denn nirgend ein Halt?
All' der Myriaden Menschen Geschick,
Die über die Erde geschritten,
Ist es, ein Irrlichttanz,
Im großen Dunkel erloschen,
Und taumelt Geschlecht auf Geschlecht
Der Vernichtung entgegen,
Daß Ein Weltalter das and're betrauert,
Bis Vergessenheit Alles verschlingt?
O, in die öde Nacht des Gedankens
Lass' einen Lichtstrahl gleiten,
Daß in der Verzweiflung finstern Abgrund
Nicht die zagende Seele versinke!
Stille ringsum, nur vom Knistern
Der zerbröckelnden Trümmer unterbrochen.
Schweigend hat die Göttin den Schleier
Um ihre Träume gebreitet;
Fort und fort brüten die Sphinxe
Ueber der Zeiten großes Räthsel;
Aber droben, wo aus der weiten Unendlichkeit
Mit leuchtenden Sternenaugen
Die Nacht herabsieht,
Ruht das Geheimniß
Ewig unenthüllt
Ueber allen Himmeln.«
In den Gedichten »Der Tempel von Aegina« und »Das Theater des Dionysos« wächst dem Dichter aus dem Anblick der Ruinen das Bild entschwundener, ruhmvoller Zeiten hervor, er sieht die Priesterin mit goldenem Kranz im Lockenhaare, wie sie zum Altare schreitet, oder das Griechenvolk, wie es einem Chorgesang seiner Tragödiendichter lauscht. Ebenso erfüllen sich in den »Gedichten aus Granada« die Grotten der arabischen Schlösser mit Erinnerungen an die vergangene Herrlichkeit, und wie die Menschen neu erstehen, die einst durch diese jetzt verödeten Räume schritten, so erklingen auch die Gesänge wieder, die ihre Thaten priesen. Diese Erhebung des Vergänglichen zum Ewigen zeigt am besten, wie gesund und kraftvoll die Weltanschauung unseres Dichters ist. In Schöpfungen wie »Die Jungfrau« und »Auf dem Pik von Teneriffa« ergibt sich aus dem Anschauen einer überwältigend großartigen Natur ein Zwiegespräch mit dem Unendlichen, wie es schwungvoller und inhaltsschwerer nicht gedacht werden kann. Eigenthümlich düster gefärbt, dabei von markiger Kraft und straffem sittlichem Pathos sind die Romanzen, wie: »Mahmud der Gasnewide«, »Ragnar's Tod«, der auf einen frischen Soldatenton gestimmte »Husar von Auerstädt« und viele Andere, während in der Ballade »Die Athener in Syrakus« der auf der Situation lastende Druck aufgehoben wird und sich Alles in der Bewunderung der Euripideischen Chorgesänge vereinigt, durch deren Vortrag sich die Sclaven die Freiheit erringen.
Die Vorzüge der Gedichte sind noch schärfer und erfreulicher ausgeprägt in drei Büchern, die wir zusammen betrachten, weil sie uns gleichfalls zu fernen Ländern und Zeiten führen und den liebenswürdigen Idealismus des Dichters genauer erkennen lassen. Es sind dies die »Weihgesänge«, die »Episoden« und die »Nächte des Orients«, die wir zu den schmackhaftesten Früchten der modernen deutschen Poesie zählen, weil sie Gedanken und Empfindungen edelster Art mit seltenem Formgeschick ausdrücken. In ihnen ist ein starker Zug von Reflexion unverkennbar, die sich indessen nicht etwa unterfängt, graues Gespinnst für farbiges Leben auszugeben, sondern nur die einzelne Erscheinung auf das Piedestal des Gedankens heben und dadurch in ihrem Werthe für unser Interesse bedeutend erhöhen will. Hier hat die bewußte Gedankenarbeit durchaus jene Bedeutung, die ihr Richard Wagner zuerkannte, als er einmal an Hanslick schrieb: »Schlagen Sie die Kraft der Reflexion nicht zu gering an; das bewußtlos producirte Kunstwerk gehört Perioden an, die von der unseren fern abliegen: das Kunstwerk der höchsten Bildungsperiode kann nicht anders als im Bewußtsein producirt werden. Die christliche Dichtung des Mittelalters z.B. war diese unmittelbare, bewußtlose; das vollgiltige Kunstwerk wurde aber damals nicht geschaffen – das war Goethe in unserer Zeit der Objectivität vorbehalten. Daß nur die reichste menschliche Natur die wunderbare Vereinigung dieser Kraft des reflectirenden Geistes mit der Fülle der unmittelbaren Schöpferkraft vereinigen kann, darin ist die Seltenheit der höchsten Erscheinungen bedingt.« Den ersten Preis möchten wir den »Weihgesängen« zuerkennen, dithyrambischen Ausmalungen von Eindrücken, welche Kunst, Natur und Leben in ihren höchsten Offenbarungen auf den Verfasser gemacht haben. Wie immer steht er auf luftiger Höhe, aber fest und sicher, kein Schwindel erfaßt ihn bei der Unendlichkeit der Aussicht, kein noch so steiler Pfad vermag seinen Fuß zum Straucheln zu bringen. Wenn wir so oft vernehmen, daß die wissenschaftliche Anschauung der Welt die Poesie aus ihr vertrieben habe, können wir bei Schack gerade das Umgekehrte nachweisen, daß nämlich die gelehrte Forschung der Dichtung ganz neue Unterlagen und Anschauungen dargeboten habe. Die Lehre von der Einheit des Alls und der stufenweisen Vervollkommnung der auf der Erde lebenden Wesen wird in den »Weihgesängen« höchst glücklich verherrlicht und zur Stütze der optimistischen Weltanschauung gemacht, die der Dichter mit feurigen Worten verkündet. Für einen Religionsstifter wie »Zoroaster«, Künstler wie Tizian und Michel Angelo, Dichter wie Wolfram von Eschenbach und Dante, Staatsmänner wie Perikles hat der Sänger ein in vollen Accorden erklingendes Lob in Bereitschaft. Er weiß den springenden Punkt bei der Charakteristik dieser Männer ausfindig zu machen und auf ihn alle Strahlen seines Talentes zu richten. Seine Sprache ist so voll Wärme und Glanz, daß die einzelnen Worte sich in die aufschwebenden und wieder herabsinkenden Silbertropfen eines Springbrunnens zu verwandeln scheinen, auf den der Himmel seine reinsten Farbentöne, die Sonne ihre reichsten Strahlen herabgeschickt hat. Aus diesem ununterbrochenen Perlen und Schäumen entwickeln sich die Gedanken in anmuthiger Folge, die kein anderes Ziel haben, als das rein Menschliche, wo es bereits verkörpert ist, zu preisen und überall, wo es in seiner Vollendung noch aufgehalten ist, aus der Hülle des Unvollkommenen und Unreinen herauszuschälen. So preist der Dichter den ältesten Genius, »Eros«, der die Elemente schied und später in den Menschen das reine Feuer heiliger Empfindungen entzündete. In drei Gedichten: »Osterfest«, »Wann kehrst Du wieder?« und »Die Märtyrer«, wendet sich die Begeisterung des Autors gegen die Priester, die durch ihre Irrlehre die menschlich schöne Weisheit des Religionsstifters in ihr Gegentheil verkehrt und namenloses Elend in die Welt getragen haben. Die Unterdrückung der Natur und des freien Geistes ist für ihn immer ein Verbrechen an der Majestät des Menschengeschlechtes, die falschen Bevormunder und Erzieher desselben sind die Feinde, auf die er es abgesehen hat. Wie ein Wächter auf hohem Thurm hält er getreulich Umschau und wenn er einen derselben erblickt, gibt er das Signal zum allgemeinen Angriff.
Eine bemerkenswerthe Rolle spielt in den »Weihgesängen« Amerika, das Land der Zukunft, der frischen Kräfte und unendlichen Hoffnungen, das alle Mühseligen und Beladenen einlädt, an den Ufern seiner Flüsse, in dem Schatten seiner Wälder sich niederzulassen. Schon Goethe pries es an Amerika, daß es keine verfallenen Schlösser habe und nicht durch unnützes Erinnern und vergeblichen Streit in seiner Entwickelung gestört werde. Später nahm Auerbach das Thema in seinen »Schwarzwälder Dorfgeschichten« wieder auf, durch welche sich die Sehnsucht nach der neuen Welt als versöhnender Grundton bei allen widrigen Lebenslagen hindurchzieht. Bei Schack ist Amerika gleichfalls das Land der Freiheit:
»Freiheit nicht, wie der blutige Marat
Sie zum Vernichtungsfeuer entfacht,
Wie beim Donnern des Niagara
Washingtons großer Geist sie gedacht.«
Die Gedichte »Atlantis« und »Amerika« sind unbedingt die schönste poetische Verherrlichung, welche die neue Welt bisher erfahren hat. Die Wirkung, die sie auf den Leser ausüben, ist deshalb eine so starke, weil sich Natur und Geist in ihnen so innig verschmelzen, daß mit jeder der ersteren entlehnten Vorstellung auch der letztere sich immer höher schwingt und diese Steigerung sich ungezwungen fortsetzt. Namentlich wirft die Begeisterung des Dichters in »Amerika« immer höhere und schäumendere Wellen, ohne daß die Klarheit der durchgehenden Idee hiedurch beeinträchtigt würde. Die Verse, die von der »Menschheit Siege[s]fest auf den Cordilleren« erzählen, sind von einer Farbenpracht, die selbst von Freiligrath nur in wenigen Gedichten erreicht wird:
»Ja müde des Vergangenen und seiner Qualen rüsten
Die Völker alle sich zur Fahrt westwärts an deine Küsten.
Im Sturme hinter ihnen mag Europa's Weh verhallen,
Wie seine Reiche untergeh'n, wie seine Tempel fallen!
Sie seh'n vor sich den jungen Tag der kommenden Geschichte,
Um Deine Aetherhöhen glüh'n mit morgenrothem Lichte,
Und in der Riesenströme Flut, vom Felsen niederbrausend,
Lallt ihnen seinen Kindesgruß ein werdendes Jahrtausend.
Wo, von des Menschen Odem nie durchweht, des sorgenmatten,
Die erstgebornen Wälder steh'n mit unentweihtem Schatten,
Wird heil'ge Sabbathruhe sanft auf sie herniederthauen
Und Palmen gleich der Hütte Dach umsäuseln, die sie bauen.
Dort in der großen Mutter Arm, an ihrem Busen hangend,
Blüht auf Geschlecht Geschlecht empor, in rein'rer Schönheit prangend.
An deiner Wasserstürze Bett, an deinen Urwelt-Seen
Wird eine junge Menschheit, groß und frei wie sie, erstehen,
Und in dem Bade der Natur, der heil'gen, ewig treuen,
Das jeden Flecken von ihr nimmt, unsterblich sich erneuen.
Ihr bieten Wald und Flur und Schlucht, Gebirge ihr und Thale
Den Trank, d'raus sie Begeisterung schöpft in immer voller Schale,
Und mit der Wunderwelt umher, wo Ranke sich an Ranke
Auf zu den Baumgiganten schlingt, erhebt sich ihr Gedanke
Und wuchert mit dem Wald und wiegt im Sturm der Tropenzonen,
Wenn Donner durch die Zweige hallt, sich in den Wipfelkronen.
Hinab, wo Riesenstämme sich vorüber an gezackten
Felsklippen wälzen, stürzt ihr Geist sich mit den Katarakten
Und überfliegt der Anden Haupt, daß er aus fernstem Blaue,
Wo sonnennah der Condor schwebt, den Erdball überschaue.
So, wenn schon längst jenseits des Meers durch öder Schlösser Mauern,
Durch eingesunkener Dome Dach des Herbstes Stürme schauern,
Erschließest du, Amerika, die mächt'gen Tempelhallen,
Wo fort und fort im Feierchor der Völker Hymnen schallen,
Und bei der Menschheit Siegesfest auf deinen Cordilleren
Der Opferbrand zum Himmel steigt, hoch von den Eisaltären.«
Das ist eine moderne Poesie von unbestreitbarem Vollgehalt, eine Dichtung, die mitten im geistigen Ringen der Gegenwart steht und aus ihren Tiefen schöpft. Mit ihren großen Gesichtspunkten und Gedankenverbindungen erhebt sie sich unendlich über die rein persönlichen, von keinem Licht des Geistes getroffenen Empfindungen unserer Mondschein- und Frühlingssänger, die in der engen Sphäre ihres Denkens und Fühlens keine Ahnung davon haben, daß nur eine männliche, durch Gedanken gestählte Poesie in unserer Zeit auf Berechtigung Anspruch machen könne. Seitdem die philosophischen Titanen die Götter gestürzt haben, bleibt uns nichts Anderes übrig, als das Göttliche in der höchsten Manifestation des Menschlichen zu suchen, und jene Erbauung, die einst das Gebetbuch gab, im Anschauen des Idealen zu finden. Die »Weihgesänge« scheinen uns in ganz besonderem Maße dazu berufen zu sein, den überlieferten Kirchenglauben von seinen überlebten Bestandtheilen zu säubern und an ihre Stelle den Glauben an eine schöne Menschlichkeit zu setzen und in den Herzen aller denkenden Leser zu festigen.
Die »Episoden« enthalten zehn Novellen in Versen, in welchen meistens eine Liebesgeschichte den Grundton angibt. Der Reiz dieser Erzählungen liegt neben dem melodischen Fluß der Verse, in denen unserer Sprache ein seltener Wohllaut abgewonnen ist, in den charakteristischen Schilderungen der jedesmaligen Culturepoche, der diese Bilder entnommen sind. Das Colorit derselben ist deshalb so fein nach der Wirklichkeit aufgetragen, weil es sich um Oertlichkeiten handelt, die dem Dichter fast alle aus eigener Anschauung bekannt sind. Und nicht nur seine Erfahrung, die er auf zahlreichen Reiseunternehmungen machte, auch sein culturhistorisches und künstlerisches Wissen kommen ihm hiebei bestens zu statten. Von den Novellen spielen »Glycera« und »Lais« im alten Griechenland, »Giorgione«, »Ubaldo Lapo«, »Fiordispina«, »Stefano« und »Heinrich Dandalo« in Italien, »Rosa« in Deutschland und der »Flüchtling von Damascus« im Orient, während der »Regenbogenprinz« einen märchenhaften Stoff behandelt und eine wohlthuende Abwechslung hervorbringt, indem er den Humor zu Worte kommen läßt.
Gehen wir kurz den bunt wechselnden Inhalt der Novellen durch. In »Glycera« lernen wir den Komödiendichter Menander kennen, der, von Eifersucht erfüllt, seine Geliebte und deren vermeintliche Untreue dadurch strafen will, daß er sie in einem neuen Lustspiele auf die Bühne bringt. Aber das edle, ungerecht beschuldigte Mädchen weiß dieser Absicht dadurch zu begegnen, daß sie selbst die Person, welche der Dichter zum Abbild ihrer Treulosigkeit machen wollte, auf dem Theater darstellt und zum Schluß die Maske abnimmt und vor allem Volke ihre Unschuld versichert. Die Fabel ist, wie man sieht, sehr einfach, und würde sich vielleicht in einer mehr humoristischen Behandlung besser ausnehmen, als in der pathetischen, welche ihr der Verfasser zu Theil werden läßt. Voller ist das psychologische Detail schon in »Lais« entwickelt, einer Erzählung, die das Aufkeimen der Liebe im Herzen einer Priesterin der Aphrodite darstellt. Der Jüngling, dem zu Liebe sie ihrer Pflichten als Dienerin der Göttin uneingedenk wird und in eine fremde Stadt geht, ist bei ihrer Ankunft gerade im Begriff sich zu vermählen, und die unglückliche Priesterin vermag nur noch im Tode dem Paare einen Segenswunsch zu spenden.
Die auf italienischem Boden spielenden Novellen zeichnen sich durch eine besondere Frische und Wärme der Schilderung aus. Zu den besten und gelungensten zählen wir »Giorgione«, in welcher die Schilderung Venedigs den Localton gibt, während sich der Conflict zwischen dem alternden Maler und seinem Schüler Sebastian wegen der schönen Angela, der Pflegetochter des ersteren, entspinnt. Die einander kreuzenden Empfindungen der Dankbarkeit gegen den Meister und der Liebe zur Jungfrau geben der Erzählung die dramatische Bewegung. Giorgione legt schließlich selbst die Hand des Mädchens in diejenige seines Schülers und verleiht, bevor ihm das Auge bricht, dem Bilde der Geliebten in der »Lautenspielerin« ewiges Leben. »Ubaldo Lapo« spielt gleichfalls in der Welt der bildenden Künste und zeigt uns in Michel Angelo und dessen Schüler Ubaldo den Gegensatz zwischen dem gottbegnadeten Genie und dem Dilettanten, der seinen Beruf verkennt. Erst als Ubaldo sich überzeugt, daß die tadelnden Worte Michel Angelo's aus einem treuen und väterlich gesinnten Herzen kommen, vertauscht er den Meißel mit dem Schwerte, um als Soldat seinem Vaterlande zu dienen und den Heldentod zu finden. »Fiordispina« behandelt einen Liebesconflict mit tragischem Ausgange, indem ein edelgesinnntes Mädchen durch ihren Tod den Kampf zweier feindlichen Familien beendigt und das Wohl ihres Vaterlandes begründet. »Stefano« und »Heinrich Dandolo«, die beiden letzten Novellen, die ihren Stoff dem Leben Italiens entnehmen, bringen uns die Poesie und Majestät des Meeres auf dem landschaftlichen Hintergrunde Sorrents und Venedigs nahe. Der kühne Ruderer und Bergsteiger, der sich selbst die größten Gefahren auferlegt, um die Liebe des von ihm angebeteten Mädchens zu erringen, ist eine ebenso packende Figur wie der edle Venetianer, der seine Liebe zum Vaterlande damit bezahlen muß, daß er seiner Freiheit, seiner Geliebten und seines Augenlichtes beraubt, und hilflos in einem Kahne den Wellen der See überlassen wird, bis die Republik ihn für solche Treue durch Verleihung der Dogenwürde auszeichnet. »Der Flüchtling von Damascus« ist Abderrahman, der zu Beginn der mohamedanischen Herrschaft sich vor den blutigen Verfolgungen seines Geschlechtes nach Spanien rettet und der Begründer des Chalifats von Cordova wird. Die Erzählung »Rosa« drängt in einem kleinen Rahmen zu viel des schwersten Unglücks zusammen und läßt in dieser ununterbrochenen Kette von Unglücksfall, Selbstmord, Tod, die rechte psychologische Vertiefung vermissen. Der »Regenbogenprinz« enthält eine reizvoll-phantastische Gegenüberstellung des Luftreiches, das der Dichter mit seinem ironisch gezeichneten Hofstaat bevölkert, und des Erdenvölkchens, sowie die Begegnung von Vertretern beider Regionen in einer flüchtigen und romantisch zerfließenden Liebesgeschichte. Der Humor, der hier bereits einige prächtige Blüthen aufweist, war schon in den »Gedichten« mannigfach vorbereitet. Seine reichste Entfaltung haben wir jedoch erst von den Romanen und politischen Lustspielen zu erwarten.
Das Geschick, mit welchem der Dichter die verschiedensten Versmaße je nach der Natur der Stoffe behandelt, verdient das höchste Lob. Wie fein unterscheidet sich auch in der Sprache die rührende Entsagung Giorgiones von dem jähen Wechsel des Schicksals des Flüchtlings von Damascus, das Erwachen selbstloser Liebe in Lais von den aus Licht und Luft gewobenen Erlebnissen des Regenbogenprinzen. Diese Erzählungen gehören zu dem Trefflichsten und Abgerundetsten, was wir dem Dichter zu verdanken haben.
Noch weiter holt der Verfasser in der Schilderung der verschiedenen Culturepochen in den »Nächten des Orients« aus, einer philosophischen Dichtung von großem Wurfe, in welcher uns die einzelnen Weltalter in breiten Bildern vorgeführt werden und der Glaube an den Fortschritt der Menschheit, dieses Lieblingsthema unseres Poeten, zuerst mannigfachen Zweifeln begegnet, um später eine desto glänzendere Verherrlichung zu erfuhren. Schack hat in einem Nachwort den Grundgedanken der Dichtung kurz und treffend zusammengefaßt: »Der Mensch ist nicht von einem ursprünglich reinen und glücklichen Zustande später entartet, hat sich vielmehr im Laufe unzählbarer Jahrtausende allmälig aus thierischer Roheit erhoben und steigt zu immer höherer Entwickelung auf; nicht in der Vergangenheit liegt das goldene Zeitalter, sondern in der Zukunft.« Der Erzähler schildert sich selbst als europamüde und des Haders der Parteien überdrüssig; das vatikanische Concil bringt seinen Entschluß, nach dem Orient zu reisen, vollends zur Reife. Die Fahrt durch Arabien wird zum Anlaß einer prächtigen Schilderung des Landes und seiner Bewohner, sowie der gewaltigen Ruinen, die zu Betrachtungen über den Urzustand der Menschen anregen. Da trifft der Held unserer Erzählung einen alten Magier, Hadschi Ali, der im Besitze eines Elixirs ist, welches die Eigenthümlichkeit besitzt, die Zeiten der Vergangenheit für Jeden, der davon genießt, wieder lebendig zu machen. Der Dichter trinkt von dem Elixir und sinkt sofort in einen tiefen Schlaf, der ihm die Zeiten der Urwelt als Traumbild vorführt und ihm eine Periode wilder fürchterlicher Kämpfe zeigt, die sein Herz erbeben machen und ihn sehr enttäuscht über das vermeintliche paradiesische Glück der Urzeit erwachen lassen. Wiederholt erneuert sich das Experiment des geheimnißvollen Schlafes bei dem Dichter, der von einer Periode zur anderen geführt wird und sich dabei gestehen muß, daß kein Zeitalter den idealen Vorstellungen seiner Phantasie entsprochen habe. Er sieht sich zuerst in ein Pfahldorf versetzt, wo er einem Häuptlinge als Knecht dient und Zeuge gräßlicher Menschenopfer und Gewaltthätigkeiten wird, von denen sich zartere Empfindungen wie verlorene Lichtstrahlen in dunkler Nacht abheben. Selbst die höchste Blüthezeit der griechischen Cultur in der perikleischen Periode enthüllt ihm ihre Schattenseiten, da er als Sclave dem Hause eines wohlhabenden Atheners zugetheilt ist. Desgleichen schreckt er vor der Zeit des romantischen Mittelalters bei dem Anblick der Hörigen und der Auswüchse des Aberglaubens zurück, und auch der Humanismus und die Renaissance stellen für ihn wegen der gräulichen Hexenprocesse durchaus nicht die ersehnte Vollkommenheit dar. Der Magier ergänzt die Bilder, die sich dem Dichter erschlossen haben, und läßt in ihm die Ueberzeugung reifen, daß zwar kein Zeitalter vollkommen gewesen sei, aber im Verhältniß zum vorausgegangenen doch stets etwas Höheres und Besseres vorgestellt habe. Diese Ueberzeugung spricht er in den Worten aus:
»Aufwärts geht der Menschheit Gang;
Ob sich ihr Pfad auch krümmt und windet,
Ja, ob er auch Jahrhundert lang
In dunkle Abgrundtiefen schwindet,
Nach oben reißt sie doch ihr Drang.«
Die Wanderung des Dichters durch die verschiedenen Zeitalter und die Erkenntniß, welche sie in ihm erstehen läßt, übt nun auch auf den Magier insofern eine Rückwirkung aus, als sie für ihn zur Bestätigung seiner eigenen Muthmaßung wird. Zwischen Spott und Hohn einerseits und gläubigem Ernste anderseits hin- und herschwankend, enthüllt er sich zum Schlusse, als er die Wahrheit durch den Dichter erkannt sieht, als Prophet einer glorreichen Zukunft, als Seher, der von erhabenen Gedanken und schönen Hoffnungen erfüllt ist. Diese Doppelnatur ist nicht immer richtig erkannt worden und hat zu mancherlei falschen Beurtheilungen Veranlassung gegeben. Schack hat deshalb wohl daran gethan, in seinem Nachwort auch diesen Punkt zu berühren: »Diesem Magier, welcher selbst die Jahrtausende durchwandelt hat, ist unter allen erlebten Schrecknissen dennoch die Ahnung aufgegangen, daß die Menschheit sich nach und nach von niederen Stufen zu höheren emporringe; aber er schwankt und zweifelt noch und will nun am Dichter erproben, zu welcher Ueberzeugung derselbe auf seiner Reise durch die Weltalter gelangen werde. Um ganz sicher zu gehen, läßt er ihn nicht allein in jeder Epoche der Vergangenheit schweres Weh erleben, sondern fügt auch noch Commentare hinzu, welche Alles in noch schwärzeren Farben schildern und förmlich Weltverzweiflung predigen; er meint, wenn der Dichter trotzdem den Glauben an ein Fortschreiten der Menschheit gewinne, so müsse dieser um so tiefer begründet sein und zugleich finde dann seine Ahnung eine um so zweifellosere Bestätigung. Der bittere Hohn, den er über Alles ergießt, ist also theils Resultat der eigenen finsteren Weltanschauung, aus der er sich emporzuarbeiten begonnen hat, die ihn aber momentan immer wieder in ihr Dunkel hinabreißt, theils Uebertreibung einer Maske, die er dem Dichter gegenüber annimmt.«
Die »Nächte des Orients« bilden eine Geschichtsphilosophie in Versen, ähnlich derjenigen in Farben, welche Kaulbach für das Treppenhaus des Neuen Museums in Berlin gemalt hat. Die schwierige Aufgabe ist von unserem Dichter trefflich gelöst worden, und es liegt weit mehr in der Natur dieser Stoffe als in ihrer Behandlung, wenn sich zuweilen ein zu gleichmäßiger Schwung der Gedanken und der Sprache bemerkbar macht, der weniger aufmerksame Leser ermüden dürfte. Mancher unter ihnen könnte vielleicht bei der Lectüre die Empfindungen des Regenbogenprinzen haben, der es über den Wolken nicht lange aushält und sich nach unmittelbarem frischen Leben sehnt. Aber wenn wir auch zugeben müssen, daß die »Nächte des Orients« weit mehr Gedanken und Begriffe in schöner Form als eigentliche Gestalten und Vollbilder enthalten, können wir doch nicht leugnen, daß jene einer echten Begeisterung entströmen und dem Gemüthe einen durchaus edlen Inhalt zuführen. Wie sehr erscheint es heutzutage als ein Lob, wenn man einem Dichter vorwirft, zu hoch hinaus gewollt zu haben und wie selten kann man ihm die Goethe'schen Worte vorhalten: »Habe die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne!«, da unsere Alltagspoeten von Sternen nur dann etwas wissen wollen, wenn sie sich dieselben auf die Aufschläge ihres Fracks nähen lassen können. Was bei Schack immer wieder zur Bewunderung nöthigt, ist der ideale Grundzug seines Wesens, die mächtige Architektonik seiner Schöpfungen. Mag sich in ihnen auch die Atmosphäre manchmal verdünnen wie in einem Luftballon, sie bleibt stets aus reinen, der Gesundheit zuträglichen Bestandtheilen zusammengesetzt. Wohl sind auch ihm nicht alle Würfe gleichmäßig gerathen, aber immer ist sein Ziel ein hohes und schwer zu erreichendes gewesen. Das muß auch den Ausstellungen, die man gegen Einzelnes vorbringen kann, jene Färbung des Wohlwollens und der freudigen Anerkennung geben, die sich in einem schönen Worte von Thomas Carlyle ausdrückt: »Gesetzt, das Schiff läuft mit beschädigtem Segel- und Takelwerk in den Hafen ein, so ist der Lootse tadelnswerth; er ist nicht allmächtig und nicht allweise gewesen. Um aber zu wissen, wie tadelnswerth er ist, müssen wir erst fragen, ob er eine Reise um die Erde oder blos nach Ramsgate und der Hundsinsel gemacht hat.«
Wir sind von Schack's lyrischen Dichtungen zu seinen epischen übergegangen und dabei zumeist auf Schöpfungen gestoßen, die auf philosophischer Grundlage ganze Zeitperioden in den Kreis der Darstellung ziehen und nicht wie die alten Volksepen die Götterwelt, sondern die Religion des Geistes verherrlichen und sich auf die Errungenschaften der Wissenschaft stützen. Es entsprach aber dem modernen Zuge des Dichters, wenn er sich damit nicht begnügen wollte, sondern die realen Erscheinungen der Gegenwart erfassen mußte, um sie in seiner Weise darzustellen. Selbstverständlich entbehren auch diese Arbeiten nicht einer ideellen Voraussetzung, aber sie gehen doch in ganz anderer Weise als die bisher genannten vom Thatsächlichen aus, um es zu schildern und zu gestalten. Der Autor hat sich auf zweierlei Weise seinem Ziele zu nähern gesucht, in der ernsten und in der humoristischen Erzählung. »Lothar« entspricht der ersten, »Durch alle Wetter« und »Ebenbürtig« gehören der zweiten Gattung an.
Ueber »Lothar« hat der Dichter in seiner Widmung an Ferdinand Gregorovius, den ausgezeichneten Geschichtsschreiber und Dichter, einen interessanten Aufschluß gegeben, indem er sagt: »Ich schrieb ihn zum größten Theil angesichts der Gegenden, durch welche ich meinen Helden führe, unter den Palmen und Zelten Syriens und auf dem Dache des lateinischen Klosters von Jerusalem, an den Ufern des Guadalquivir und auf der herrlichen, über dem Abgrund hängenden Alameda von Ronda, auf einer Nilbarke und inmitten der ungeheuren Trümmer von Theben.«
Das Werk ist die Frucht jugendlicher Begeisterung für die Freiheit und Größe des deutschen Vaterlandes und bringt es trotz vieler Vorzüge in der wechselvollen Schilderung von Land und Leuten doch über eine gewisse Allgemeinheit der Empfindungen und Anschauungen für unser Gefühl nicht hinaus. An Einzelheiten, wie der Wiederholung desselben Motivs, daß der Held durch die Liebe eines Mädchens aus Lebensgefahr gerettet wird, merkt man, daß dem Dichter die Erfindung noch nicht in so reichem Maße zuströmte, wie es später der Fall ist. Die Handlung ist in dieser wie in den beiden anderen Erzählungen reich an abenteuerlichen Wechselfällen, auf deren Schilderung der Autor viel Fleiß verwendet hat. Die Liebe zum Vaterlande bildet, wenn wir uns eines technischen Ausdruckes von Richard Wagner bedienen dürfen, das Leitmotiv des Ganzen. Sie ist der reichverzierte Rahmen, der dieses Bild aufschäumender, sich zu männlichem Thun erziehender Jugendkraft umschließt. Die Schilderung des Schlosses an der Hardt, wo der Held seine Kinderjahre verlebt, ist von idyllischem Reiz und der Autor verräth uns wiederholt, daß er Eindrücke und Erlebnisse aus seiner eigenen Jugend in den Strom seiner Erzählung habe einfließen lassen. Von gleicher Wärme ist die Dichtung auch in dem Berichte über die Erziehung des Knaben und Jünglings durch den Pfarrer Eberhard und ein schönes Licht fällt auf das Freundschaftsverhältniß zwischen Lothar und seinem Schul- und Universitätsgenossen Hugo. Lothar's Vater, ein Veteran der Freiheitskriege, lebt nur in den Erinnerungen dieser großen Zeit und hat auch auf seinem Sterbebette keinen anderen Gedanken, als seinen Sohn mitten unter den Streitern für Freiheit und Recht zu wissen. Das Schicksal nimmt den jungen Mann bald darauf in seine herbe Schule, denn als Lothar zu seinem aristokratischen Oheim kommt und die Neigung von dessen Tochter Adele gewinnt, wird er durch den anmaßenden Junkerhochmuth seines Vetters gezwungen, sich mit ihm in ein Duell einzulassen. Lothar erschießt seinen Gegner, was wiederum zur Folge hat, daß ihn seine Geliebte aufgibt, und muß umsomehr an seine Flucht denken, als er durch seine Theilnahme an der Burschenschaft der Polizei verdächtig geworden ist. In Spanien nimmt er an dem Aufstande des edlen Riego Theil, um die Rechte der Freiheit gegen den Absolutismus zu vertheidigen, aber er unterliegt sammt seinen Mitstreitern und verdankt die Rettung seines Lebens nur dem heldenmüthigen Sinne einer Spanierin, die für ihn in den Tod geht. Nach einem Schiffbruch, den er auf dem Mittelländischen Meere erleidet, kommt er in die Gefangenschaft der Mauren, welche die schwersten Arbeiten von ihm erzwingen. Nach seiner Befreiung durch das Lösegeld eines Engländers, eilt er, um sich als wahrer Sohn seines Vaters zu zeigen, nach Griechenland zur Theilnahme an dem Freiheitskampfe gegen die Türken. In Missolunghi gefangen genommen, wird er wiederum gerettet, und zwar durch seine Jugendgeliebte Adele, mit der er als Gattin in die so lange gemiedene Heimat zurückkehrt. Die in gereimten vier- und fünffüßigen Jamben geschriebene Dichtung schließt mit folgender schwungvollen Apostrophe:
O nimm mich wieder auf an deinem Herde,
Du deutsches Land, du herrlichstes der Erde!
Wo wär' ein edler Volk als dein's
Vom traubenduftenden Gestad' des Rheins
Bis zu der Ostmark fernsten Gauen?
Wo strahlt der ganze Himmel so aus blauen,
Aus unergründlich klaren Tiefen wieder,
Wie aus den Augen deiner Frauen?
In deinen Schooß dereinst die müden Glieder
Zu betten gönne mir! Allein nicht eher
Lass' schließen mich die Augenlider,
Bis jenen neuen Morgen, den als Seher
Mein Vater sterbend prophezeit,
Ich über dich, das einige, befreite,
Aufsteigen sah. – Verraucht ist mir der Wahn,
Der nur vom allzerstörenden Orkan
Verjüngung hofft; doch jener Genius,
Der früh' aus mich gedrückt den Flammenkuß,
Ich fühl's, umrauscht mich noch mit seinen Schwingen,
Und mahnt mich, neu zu streben und zu ringen,
Damit das heiße Sehnen deiner Söhne
Die endliche Erfüllung kröne!
Er leihe Milde mir zur Stärke
Und weises Maß zum Thatendrang –
Dann, nach vollbrachtem Tagewerke,
Wie sollt' ich zagen vor dem letzten Gang?
Ein froher Zeuge noch im Tod
Von meines Volkes Auferstehen,
In seiner Größe Morgenroth
Werd' ich beglückt von hinnen gehen.«
»Lothar« enthält die ganze Schwärmerei der Jugend, das unbestimmte Sehnen und Hoffen eines Feuerkopfes, der mit der Welt schnell fertig zu werden meint, bis er einsieht, daß das Leben auch ihn Geduld und Entsagung lehrt und vor seine Preise die ernste Arbeit stellt. Der Ausdruck einer solchen Schwärmerei ist das Pathos in seiner verschiedenen Schattirung, die naive Hingabe an gewisse ideale Vorstellungen. – Ganz neue Seiten seines Wesens entfaltet der Dichter in den beiden anderen Erzählungen: »Ebenbürtig« und »Durch alle Wetter«, die ihn im Besitze eines reizenden Humors zeigen, der mit den Dingen anmuthig spielt und den Esprit in tausend glitzernden Funken wie bei einem Feuerwerk sprühen läßt. Aus ihnen spricht nicht mehr das unendliche Sehnen des Jünglings, sondern die geistige Ueberlegenheit des Mannes. Jenem kam es nicht in den Sinn, mit Zuständen und Menschen zu scherzen, er mußte vor Allem glauben und sich begeistern, sich mit allem Guten und Schönen, welches das Leben bietet, erfüllen. Dieser dagegen hat die wonnigen Auen des Ahnens bereits hinter sich gelassen und das kühlere Land der Erkenntniß betreten. In seinem Busen ist ihm ein Besitz gereift, den ihm Niemand rauben kann. Aber weil er dessen sicher ist, erscheinen ihm die Dinge nicht im starren Nebeneinander, sondern im Flusse des Humors. Er begnügt sich nicht mehr damit, nur von einer Seite zu beobachten, sondern will auch den Revers der Medaille kennen lernen, denn – das weiß er – wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Durch den Scherz nimmt er harmlose Rache an der Natur, die ihm nichts Vollkommenes hat zu Theil werden lassen; im Lachen vergißt er die Beschränktheit alles Irdischen, und wenn er auch einmal seine Pfeile höher hinauf richtet, sein Witz wird nie zum Scheidewasser, seine Lustigkeit hat nichts Verbittertes. Daß sich Schack auch der heiteren Muse mit Glück zuwenden konnte, verdanken wir der Vielseitigkeit, dem Ausgereiften und Welterfahrenen seines Wesens, und es beweist einen nicht geringen künstlerischen Ernst, daß er sich auf epischem wie auf dramatischem Gebiete einem Genre zugewendet hat, das mit großem Unrecht in der jüngsten Zeit vernachlässigt worden ist. Auf die politischen Lustspiele werden wir später zu sprechen kommen; zunächst handelt es sich für uns aber um die komischen Epen, die wir erwähnt haben und in deren ottave rime etwas von Ariosto's heiterer Phantastik lebt. Zwar hat unser erster deutscher Aesthetiker Vischer erklärt: »Es gibt kein komisches Epos«, doch ist dagegen von Carrière mit Recht die Frage aufgeworfen worden, wohin dann Voltaire's »Pucelle«, Byron's »Don Juan«, Heine's »Atta Troll« und »Wintermärchen« gehören, und Gottschall hat in seiner Poetik das komische Epos eine Form genannt, die nur des schöpferischen Talentes harre, welches den Geist der Gegenwart in sie hineinbannt. Sache des Dichters ist es, den Humor nicht zur Posse ausarten zu lassen, sondern ihm eine Haltung zu geben, die wahrhaft künstlerisch erscheint. Das Spielen mit den Verkehrtheiten und Thorheiten der Welt kann eine nicht geringere ideale Voraussetzung haben als das positive Eingehen auf das Schöne und Erhabene. Alle gröberen Wirkungen auf die Lachlust des Lesers macht schon die rhythmische Form unmöglich, aber auch in ihr wird der wahrhaft freie Humor seinen höheren geistigen Ursprung nicht verleugnen, sondern ihn überall in goldenen Strahlen durchschimmern lassen. Das trifft nun bei den Schackschen Dichtungen in hohem Maße zu. Inmitten des heiteren Festes, das dem Humor zu Ehren gegeben wird, stehen die Bildung, der Geschmack, die gute Sitte und schrecken jeden unsauberen oder lärmenden Gast zurück. Innerhalb dieser vornehmen Gesellschaft darf man aber nach Herzenslust lachen, sich und die Welt verspotten und Alles im Hohlspiegel der Satire erblicken.
In einer treffenden Charakteristik unseres Dichters in »Unsere Zeit« (1880, erster Band) hat Albert Möser mit Recht darauf hingewiesen, wie verfehlt es ist, bei diesem Genre immer sofort an Lord Byron als Muster zu denken und wie viel mehr die alten Italiener Pulci und Berni als Schöpfer dieser Gattung genannt werden müssen. In der That, wer die kleinen komischen Epen des siebzehnten Jahrhunderts verfolgt, weiß, daß sie alle auf Italien als auf ihre Heimat zurückweisen. Tassoni's »Geraubter Wassereimer« wirkte nach einander auf Boileau's »Chorpult« und Pope's »Lockenraub« ein. Byron erweiterte nur in seinem »Don Juan« diesen Rahmen und fügte ihm ein ganzes Weltbild voll Witz, Humor, Gluth und Farbe ein. Einen so heißen Athem der Leidenschaft haben die Schack'schen Romane nicht, sie berühren zwar eine Fülle von Tagesfragen und gehen kaum an einer Erscheinung des modernen Lebens theilnahmslos vorüber, aber sie sind in ihrer ganzen Haltung gutmüthig und liebenswürdig. Es würde Schack unmöglich sein, eine Fülle von Haß in sich ansammeln zu lassen und dieselbe dann in breitem Strahl auszuspritzen. Dazu ist sein Wesen zu weich und harmonisch, zu sehr auf die Versöhnung und das Ausgleichen der Gegensätze angelegt. Zähne hat er auch, aber mehr beim Lachen als beim Beißen werden sie sichtbar. Was ihm an Schärfe abgeht, ersetzt er in seinen komischen Epen durch Glätte und den Wohllaut seiner Diction, die den Leser mit dem sinnlichen Reiz des virtuosesten italienischen Gesanges gefangen nimmt und wie dieser seine kecken Passagen und Fiorituren, sanft hingehauchte mezza voce's, blitzschnelle Staccato's, effectvolle Crescendo's und Decrescendo's hat. Das heitere Schaukeln und Wiegen der ottave rime erscheint bei ihm oft wie das Haschen nach einer von der Geliebten dargebotenen Rose, nach der wir dreimal vergebens die Hand ausstrecken, bis wir sie dann endlich an unsere Lippen drücken können.
Das Stoffliche an sich hat in diesen Romanen nur eine nebensächliche Bedeutung. Es wiegt als Erfindung nicht schwer und bietet kaum irgend welche psychologische Feinheiten. Dagegen bildet es das Spalier, um welches sich die Schlingpflanzen weit ausholender Vergleiche, die Blumen geistreicher Anspielungen und witziger Bemerkungen emporranken. Politik und Parteileben, Adel und Bürgerthum, Belletristik und Literatur, Musik und Gesellschaft, das Alles schwirrt durcheinander, stößt und drängt sich und findet doch wieder durch die Hand des Dichters die entsprechende Ordnung. In »Ebenbürtig« bildet die Verspottung der Adelsvorurtheile das immer wiederkehrende Thema; sie ist zugleich die Frucht einer menschlich schönen Empfindung und der geistigen Freiheit, zu welcher er sich hindurchgearbeitet hat. Der Gedanke, daß nur das Selbsterworbene den Werth des Mannes ausmache und daß der Adelstitel ohne entsprechenden Inhalt das lächerlichste Ding von der Welt sei, durchdringt all' die verschiedenen Zustände und Menschen, mit denen wir bekannt gemacht werden. Es ist einem Scharnier zu vergleichen, in welchem sich die Dichtung hin- und herbewegt. Freilich, etwas bunt geht es in dieser ausgedehnten Familiengeschichte zu, und der Leser wird gut aufpassen müssen, um zwischen den vier Söhnen und den drei Töchtern dieses alten Fürsten Friedrich unterscheiden zu können, dem sein Adel und sein orthodoxes Christenthum unveräußerlich sind, während es mit seinen Finanzen schlecht bestellt ist. Der Spaß liegt nun darin, daß der alte Herr, den der Gedanke an eine Mesalliance empören würde, es zu seinem Entsetzen erleben muß, wie seine ganze Nachkommenschaft in bürgerliche Kreise herabsteigt. Doch damit noch nicht genug: auch er selbst wird belehrt und heiratet eine Gouvernante, während sein Diener einer alten ungarischen Fürstin die Hand reicht. An Ereignissen, welche die Ironie des Dichters zum Ausdruck bringen, fehlt es in keiner Weise, im Gegentheil fürchten wir weit eher, daß er des Guten zu viel gethan habe und in der Häufung überraschender Schicksalsfälle zu weit gegangen sei. Am einfachsten gestaltet sich noch die Geschichte des ältesten Sohnes Nicolas, der dem elterlichen Hause den Rücken zuwendet, in der Schweiz in die Hände einer Gaunerin fällt, die sich als die spanische Tänzerin Lola Montez enthüllt und sich nach mannigfachen Abenteuern in München und Wien mit der Tochter des Bürgermeisters von Prenzlau verheiratet. Viel buntere Erlebnisse haben die anderen Söhne des Fürsten aufzuweisen: Otto, der sich als Seconde-Lieutenant in eine Künstlerin des Circus Renz verliebt hatte, sieht sich durch einen unzeitigen Scherz derselben um sein Officierspatent gebracht, muß abwechselnd Stallknecht, Modell und selbst Kunstreiter spielen und wird schließlich Steinmetz und Bildhauer. Der dritte Sohn Karl, der eine russische Großfürstin heiraten sollte, wird aus Versehen nach Sibirien geschleppt, wo er in den Bergwerken arbeiten muß, macht hierauf als Demokrat das »tolle Jahr« in Berlin mit, flieht dann nach Amerika und heiratet dort die Tochter eines Brauers, die ihm eine Million als Mitgift bringt. Der vierte Sohn Max endlich muß sich, nachdem er das Geld seines Vaters vergeudet hat, zerlumpt und ohne Mittel wie ein Vagabund durch die Schweiz schleppen, wird Knecht und heiratet schließlich die Tochter seines Lohngebers. Nicht besser machen es die Töchter des Fürsten: die erste nimmt einen Maler zum Mann, die beiden anderen gehen gar mit zwei Musikern der fürstlichen Capelle durch. Ohne Frage ist das Ganze mehr eine fröhliche Maskerade, bei der alle Puppen tanzen müssen, als ein ernsthaft zu nehmendes Bild des wirklichen Lebens. Aber die Grenzlinien zwischen der Wahrscheinlichkeit und der Unmöglichkeit ist durch den Humor des Dichters so geschickt verwischt, daß selbst die Uebertreibungen und Superlative des Romanes nicht unangenehm berühren. Es ist eben ein Fasching, der zum Besten einer sehr löblichen Bestrebung veranstaltet wird, und da können die Luftsprünge, wenn sie so elegant und geschickt wie in »Ebenbürtig« ausgeführt werden, unmöglich verstimmen.
»Durch alle Wetter« schildert die Abenteuer eines Gesandtschafts-Attaché's und einer Opernsängerin, die an einander Gefallen gefunden haben und ohne bestimmten Zweck in die weite Welt reisen. Ihr erster Besuch gilt Baden-Baden zur Blüthezeit der Saison, von wo sie sich nach London begeben, um von hier nach Neapel zu reisen. In London werden die Liebenden aber durch eine wunderliche Verkettung von Umständen von einander getrennt und auf beiden Erdtheilen bunt vom Zufall hin- und hergeworfen. Die Sängerin wird durch einen schlauen Impresario nach Amerika entführt, tritt dort in Concerten auf, reist in Begleitung eines jugendlichen Verehrers, eines beim Examen durchgefallenen Seecadeten, von Ort zu Ort, macht auf der Pacificbahn die Gefahren eines Waldbrandes und eines Ueberfalles der Indianer durch, lebt längere Zeit im Urwalde und tritt dann die Rückreise nach Neapel an, in der Hoffnung, ihren Geliebten zu finden. Dieser war in nicht minder großer Gefahr, da ihn italienische Räuber gefangen genommen hatten und mit dem Tode bedrohten, von dem ihn nur die Liebe der Tochter des Räuberhauptmanns zu retten vermochte. Da sich der Attaché in weiblicher, die Sängerin in männlicher Begleitung befindet, indem jenem seine Befreierin, dieser ihr jugendlicher Verehrer folgt, entsteht eine Eifersuchtsscene, die sich dadurch in Versöhnung auflöst, daß der Engländer und die Italienerin sich schnell in einander verlieben. Auch dieser Dichtung gibt weder das Stoffliche noch die psychologische Entwicklung ihren eigenthümlichen Werth, sondern nur der anmuthige Humor, der an geheimnißvollen Fäden Alles leitet und mit seinem schelmischen Lächeln die Handlung fortwährend begleitet. Er ist in beständiger Bewegung, schlägt die kecksten Purzelbäume und thut nur gelegentlich so, als ob er dem Ernste Platz machen wollte, um desto herzlicher aufzulachen. Wie es dem Wesen dieser Dichtungen entspricht, sind alle möglichen Tagesereignisse und Modeerscheinungen in die Erzählung hineingezogen worden und die Fülle bezeichnender, in den drolligsten Sprachkunststücken aufschnellender Reime erhöht die Wirkung, indem dieselben wie bunte Seifenblasen und Jongleurkugeln vor dem Leser aufsteigen. Schon wegen der Seltenheit ähnlicher Erscheinungen müssen die mit vollendeter Anmuth und Kunst ausgeführten komischen Epen Schack's unserer Literatur zur Zierde gereichen.
Auch auf dramatischem Gebiete hat Graf Schack eine ausdauernde Thätigkeit entwickelt und nur das urtheilslose Anbeten des Erfolges kann diesem Theile seiner Production die Anerkennung versagen. Allerdings haben sich die Bühnen diesen Stücken gegenüber ablehnend verhalten, wenn wir von vereinzelten Aufführungen, wie der »Pisaner« im Münchener Hoftheater, der »Timandra« auf den Hofbühnen zu München und Hannover und des »Gaston« im Berliner Ostendtheater absehen, aber wir wissen leider nur zu gut, daß dieses Schicksal fast allen Dichtern zu Theil wird, die das Drama höheren Styles pflegen und sich von sensationellen oder possenhaften Zugeständnissen an die Mode frei halten. Die moderne deutsche Bühne scheint der Dichter entbehren zu können; was Wunder, wenn die letzteren so selten dazu kommen, in das Geheimniß der Theaterwirkung einzudringen und eine Technik zu erlernen, die man sich nur bei unmittelbarem Verkehre mit der Bretterwelt aneignen kann! Unter solchen Umständen erhält das Buchdrama eine Berechtigung, die ihm allerdings bei einem würdigeren Verhältnisse zwischen Literatur und Bühne bestritten werden müßte. In einzelnen Perioden, wie zu Ende des vorigen Jahrhunderts, ist dieses Verhältniß ein einigermaßen erträgliches gewesen, doch selbst Schiller und Goethe klagten, daß nicht ihre Stücke, sondern diejenigen Kotzebue's die Bühne beherrschten. Gegenwärtig sind wir dahin gekommen, daß fast alle Erfolge hinter dem Rücken des guten Geschmacks oder von Talenten erzielt werden, die von dichterischer Begeisterung und schöpferischer Kraft weit entfernt sind und ihre Arbeiten nur in handwerksmäßiger Weise äußerlich zusammenleimen.
Die Schack'schen Dramen sind fast alle einheitlich angelegt und klar und wirksam durchgeführt, nirgends finden wir die Auswüchse einer übertreibenden Kraftdramatik oder einer redseligen Rhetorik. Einzelne sind mit geringerer dichterischer oder theatralischer Intuition geschrieben, aber in mehreren lassen sich ein echt tragischer Conflict und die Energie wahrer Leidenschaft nachweisen.
»Gaston« versetzt uns nach Savoyen gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts und entnimmt seine dramatische Bewegung der Feindschaft, die zwischen den finstern Ketzerrichtern der römischen Kirche und den Waldensern herrschte. Graf Gaston von Lucerna neigt sich nicht nur dieser Lehre zu, sondern schenkt auch seine Liebe der Pflegetochter des Predigers der Waldenser. Aber am Hofe des Herzogs von Savoyen gewinnt ihm seine Ritterlichkeit das Herz der Tochter, an welche ihn das Gefühl der Dankbarkeit fesselt. Indem dieser Bund vor dem Altar besiegelt wird, bekennt sich Gaston als Lehensmann des Herzogs, und diese Abhängigkeit wird für ihn zum tragischen Verhängniß, als das geistliche Gericht in Savoyen wieder eingeführt und den Waldensern hierdurch der bisherige Schutz entzogen wird. Der Flammentod, dem die Glaubenshelden erliegen, führt Gaston mit dem Gegenstande seiner früheren Liebe zusammen, und diese Begegnung ergibt eine Peripetie, der Niemand dramatischen Schwung und theatralische Kunst absprechen kann. Ueberhaupt sind die Steigerungen des leidenschaftlichen Ausdrucks in den letzten Acten überaus gelungen, indem der Held niemals zu einem unentschlossenen Schwächling herabsinkt, sondern im Vollbesitze männlicher Kraft den Conflict, in den ihn seine tragische Schuld gebracht hat, kühn durchkämpft und schließlich mit dem Tode besiegelt.
In »Heliodor« hat der Dichter in dem Griechen Heliodor, der, aus einem alten Geschlechte Athens stammend, die Unabhängigkeit seines Vaterlandes wiederherstellen will und dabei untergeht, eine menschlich rührende Figur geschaffen, und nur die Aufeinanderfolge verschiedener Conflicte zerstört die Einheit, den Guß der Arbeit. Zuerst ist die Liebe des Helden zu einer christlichen Jungfrau Makrina, die jedoch dem griechischen Götterglauben mehr anhängt und deshalb, als sie Athene ein Opfer darbringen will, von ihrem Bruder ermordet wird, die Triebfeder der Handlung, bis im vierten Akt der Gothenkönig Alarich als Rächer seines von den Griechen ermordeten Vaters auftritt und sowohl die Kirchen der Christen wie die Tempel der Hellenen mit Untergang bedroht. Aus dem Tumulte wild entfesselter Leidenschaften steigt die Idee allgemeiner Menschenliebe empor, welcher die eleusinischen Priester ihre Gesänge darbringen. Ein Schluß voll Schönheit und Poesie, der aber doch individueller ausgestattet sein müßte, wenn mit ihm eine volle dramatische Wirkung erzielt werden soll. Dagegen hat das Drama eine Anzahl anderer Vorzüge, die das Reifen und Wachsen des Schack'schen Talentes in schöner Weise bekunden. Schon die Sprache hat Fülle und Kraft. Einzelne Figuren sind durchaus plastisch herausgearbeitet und in einen fesselnden Gegensatz zu einander gebracht. Namentlich stehen sich die Vertreter des Christenthums, Heidenthums und Hellenenthums, Eusebia, Alarich und Heliodor, als bedeutende Persönlichkeiten gegenüber. Die Erste, ganz erfüllt von Jesu Lehre, der sie in Liebe und Barmherzigkeit nachstrebt, der Zweite der wilde, von seinem Instincte der Rache ganz erfüllte Naturmensch, der Alles, was sich ihm in den Weg stellt, mit Füßen tritt und endlich Heliodor, in dem nur die Erinnerung an die Größe seines Volkes lebt und von dessen Stirn der Glanz hellenischer Kunst und Bildung zu leuchten scheint. Man wird dem Drama als einer formvollendeten und gedankenvollen Dichtung, die nur in Einzelnem unserer modernen Bühnentechnik widerstrebt, die Anerkennung nicht versagen können.
Für die beiden gelungensten Dramen Schack's halten wir »Timandra« und die »Pisaner«, Dichtungen, die in keiner Weise aus dem Rahmen der Bühne heraustreten, sondern ihn vielmehr mit scharf charakterisirten Menschen und spannender Handlung ausfüllen. In jener läßt die Heldin die Mutterliebe und die Vaterlandsliebe mit einander in Conflict treten, bis die erstere von der letzteren überwunden wird; in dieser erschüttert uns das Furchtbare einer ungezähmten Leidenschaft, die zugleich Freund und Feind zerstört. In Timandra leben der alte spartanische Ernst, die Sitten und Anschauungen, die das Volk groß gemacht haben, während ihr Sohn, der siegreich aus Byzanz zurückkehrende Pausanias, sich der Starrheit und Strenge der Heimatsitten zu entfremden anfängt. Und weil sich sein Geist dem Fremdländischen zugewendet hat, so thut es auch sein Herz, das nicht mehr der Spartanerin Diotima, sondern der leidenschaftlichen Tochter des Perserkönigs, Mandane, gehört. Die Liebe zur letzteren und die Unfähigkeit, den Anklagen der Ephoren Rede zu stehen, treiben Pausanias zum Vaterlandsverrath, zur Unterhandlung mit den Persern, mit deren Hilfe er sich zu behaupten gedenkt, um seinem Volke die bisher unbekannt gebliebene verfeinerte Cultur aufzuzwingen:
»Mich, der ich Hellas
Durchschweifte, der ich Ioniens, Persiens
Glanzvolle Städte sah, wie müssen hier
Die Hütten Lehms, die Sparta heißen, mich
Bedünken? Als ich Lacedämons Boden
Betrat und wilden Thieren gleich das Landvolk
In Höhlen hausend fand, unwillig wandt' ich
Den Blick hinweg; und da ich weiter nun
An die Helotenjagd, die Sclavenfolter,
Den Mord schwächlicher Kinder, mitleidslos
Zum Fraß den Bären ausgesetzt, gedachte,
Schwoll wild empört mein Herz empor... –
Gebrochen vor die Füße will ich mir
Die Macht der tückischen Ephoren legen,
Daß mir stumpfsinn'ge Sclaven nicht die Hand
Mehr binden. Wo des Faustkampfs wüster Lärm
Jetzt schallt, da soll die Himmelstochter Muse
Einzieh'n. Nicht mehr ein Wohnsitz plumper Bauern
Sei diese Stadt! Mit Säulenhallen prangen
Soll sie, wie Ephesus, Athen, Korinth
Und ihr Theater von der Masken Scherz,
Dem Chor des Dionysos widerhallen!«
Unter allen Figuren des Stückes erhebt sich um Haupteslänge die Mutter des Pausanias, Timandra, die den irregeleiteten Sohn bald mit Liebe auf den richtigen Weg der Sitteneinfachheit und Vaterlandstreue zurückführen will, bald mit Strenge und ernsten Vorwürfen auf ihn einzuwirken sucht und sich trotz aller Versprechungen immer wieder getäuscht sieht. Die Figur ist von Hause aus als die zärtlich liebende Mutter angelegt, und der seelische Proceß, den sie erleidet, indem sie allmälig alle weicheren Gefühle unterdrückt und nur noch Gedanken für die Ehre und Würde des Vaterlandes hat, ist bewunderungswerth, ebenso wahr wie einfach durchgeführt. Als die Ephoren im dritten Acte die Entsetzung des Pausanias von seinem Amte aussprechen wollen, ruft Timandra:
»In keines Gottes Heiligthume, glaubt,
Ruht Sparta's Wohl so sicher wie bei mir,
Und hier gelob' ich: wer es immer sei,
Der es bedrohen mag, mehr noch als ihr
Will ich ihm feindlich sein. Hört mich, ich schwöre
Bei Himmel, Sonn' und Mond und bei der Erde,
Der großen Mutter Aller: ehe durch Verrath
Mein Sohn dem Vaterland, dem theuren Sparta,
Das kleinste Uebel nur bereiten soll,
Eh' geb' ich selbst, ich, seine Mutter, ihn
Dem Untergange preis.«
Ein echt dramatischer Zug, diese Hinweisung auf die in der Zukunft liegende Katastrophe, dieses Bloßlegen des innersten Nervs! Wenn Pausanias nach der Niederlage der Perser sich in den Tempel flüchtet und Timandra zu dessen Vermauerung einen Stein herbeiträgt, aber dabei zusammensinkt, so hat dieser historisch beglaubigte Zug im Zusammenhange mit der Charakteristik die glücklichste Verwendung gefunden. Die Spartanertugend ist vermenschlicht und dabei doch in keiner Weise verkleinert worden, denn wie die Rolle der Timandra gehalten ist, gehört sie zu den bedeutendsten Aufgaben, die einer Darstellerin von Heldenmüttern gestellt werden können. Groß und mächtig schreitet sie einher, den abtrünnigen Sohn zuerst mit Worten der Liebe zum Guten mahnend, bis der alte Stolz in ihr erwacht und den Willen zu einer That zwingt, bei deren Vollbringung ihr Mutterherz brechen muß.
Im Vorwort zu »Timandra« ist der Dichter mit edler Entrüstung auf die geringe Beachtung eingegangen, welche das höhere Drama in Deutschland zu finden pflegt. Er entschuldigt eine solche nur bei Stücken, welche sich im nachweisbaren Gegensatz zu den Anforderungen der Bühne befinden und kommt dann auf die thörichten Entschuldigungen zu sprechen, mit welchen die Theaterleiter ihre Unfähigkeit, in der Auswahl der Novitäten auch das literarische Gefühl sprechen zu lassen, zu bemänteln suchen: »Man bezeichnet mit dem verächtlichen Ausdruck »Buchdrama« auch solche Schauspiele, welche, durchaus für die Bühne berechnet, nur wegen der bei uns herrschenden Theaterzustände nicht zur Aufführung gelangen und sucht somit dem Dichter auch den literarischen Erfolg seines Strebens zu vereiteln. Sage man nicht, man lese ja die classischen Stücke! Abgesehen davon, daß die ungeheure Mehrzahl diese nur auf Autorität schätzt, stellt sich eine Nation das kläglichste Armuthszeugniß aus, wenn sie, mit dem einmal errungenen Besitz zufrieden, nicht trachtet, denselben fortwährend zu mehren. Nur im rastlosen Ringen nach einem unerreichten Ziele besteht ihr geistiges Leben, selbst die früher erworbenen Schätze werden eine todte Masse für sie, sobald sie aufhört, weiterzustreben, und wer ihr einen dahin gehenden Rath ertheilt, stellt an sie das Ansinnen, daß sie ihr eigenes Todesurtheil unterschreibe. Mit welchem Unwillen würden unsere großen Dichter, die zugleich wahrhaft große Männer waren und, frei von Selbstsucht, nur das Gedeihen der Kunst im Auge hatten, nicht sehen, wie dünkelhafte Impotenz sie zu Götzen umzuwandeln und an ihren Altären die Zukunft unserer Literatur abzuschlachten sucht! Nur in der Zeit unserer tiefsten nationalen Erniedrigung konnten Ideen ausgebrütet werden wie die, daß die deutsche Poesie erschöpft sei, wenigstens während einiger Menschenalter nicht mehr cultivirt werden dürfe, oder daß alle folgenden Generationen, die man mit dem Namen Epigonen brandmarkte, als geistige Krüppel und Invaliden zur Welt kämen. Schon damals, als Hoffnungslosigkeit auf vielen Geistern lag, hat es doch in Manchen Verwunderung erregt, wie solche von greisenhafter Blasirtheit aufgestellte Sätze, die, wenn adoptirt, allgemeine Entmuthigung und Geistesarmuth nach sich ziehen müßten, mit Gleichmuth hingenommen werden konnten; wenn Dieselben aber erleben müssen, daß heute noch Aehnliches wiederholt wird und Zustimmung findet, möchten sie fragen, ob denn die großen Ereignisse des Jahres 1870 nur ein Traum gewesen seien und ob die gerühmte Erhebung Deutschlands wirklich stattgefunden habe.«
Das Recht, mit diesen mannhaften und überzeugenden Worten der Ueberhebung eines Gervinus und der Unwissenheit unserer Bühnenvorstände gegenüberzutreten, würde Graf Schack besitzen, auch wenn er nur Ein Drama, »Die Pisaner«, geschrieben hätte. Das Werk erinnert in seinem Sujet an die Tragödie »Ugolino« von Gerstenberg, einem Vorläufer der deutschen Kraftgenies des vorigen Jahrhunderts. Dieser Dichter hat die Erzählung Dante's im dreiunddreißigsten Gesänge der Hölle von dem furchtbaren Hungertode, den Ugolino mit seinen drei Söhnen erlitt, zu einem fünfactigen Drama erweitert und darin eine Malerei des Gräßlichen, eine Veranschaulichung des Entsetzens und der Verzweiflung geboten, die man bewundern muß, auch wenn man mit Lessing sagen wird: »Mein Mitleid ist mir zur Last geworden oder vielmehr, mein Mitleid hörte auf, Mitleid zu sein und ward zu einer gänzlich schmerzhaften Empfindung.« Gerstenberg wurde durch die Uebertreibung des Shakespeare'schen Styles dazu veranlaßt, den Beginn und das Wachsen des Hungers bis zu seiner höchsten Steigerung, je nach der Empfindungsart und dem Alter des Vaters und der Söhne psychologisch zu entwickeln und damit sein ganzes Stück auszufüllen. Bei Schack bildet diese Katastrophe nur eine kurze Scene im fünften Act, während sich der übrige Theil des Drama's mit dem Kampf der Welfen und Ghibellinen beschäftigt in der Person ihrer Führer, des Grafen Ugolino und des Erzbischofs Ruggieri. Es ist eine düstere Geschichtsperiode, in welche wir versetzt werden, eine Zeit, in der die Leidenschaften den sittigenden und mäßigenden Einfluß der Vernunft nicht zu kennen oder doch nicht anzuerkennen scheinen. Das Blut dieser Menschen meistert beständig den Verstand und macht ihr Leben zu einer ununterbrochenen Kette von Schuld und Sühne. Der Erste zu sein und auf Kosten des Anderen zu herrschen, das ist ihr höchstes Ziel, wobei nur ein furchtbares Gesetz gilt: Aug' um Aug', Zahn um Zahn. Ugolino sagt von sich:
»O, dunkel war's um mich, tiefdunkel, seit
Ich denken kann. Nicht frohe Kinderjahre
Hab' ich gekannt, noch süße Elternliebe;
Wüst lag und öd' das Leben um den Knaben,
Ein Trümmerhaufe meiner Väter Burg,
Die Meinen all' erwürgt durch Ghibellinen.
In Haß und ungestilltem Rachedurst
Wuchs ich zum Jüngling so – kurz kam's wie Friede
Da in mein Herz; vor eines Weibes Blick
Schmolz in ein nie gekannt Gefühl, ich glaube,
Die Menschen nennen's Liebe, all mein Grimm.
O, daß die Engelgleiche das nicht war,
Was sie mir schien! Ein And'rer wär' ich worden!
Doch tiefer in den Abgrund schleuderte
Ihr Treubruch mich; wie nie durchwühlten Gram und Wuth
Die Seele mir; mit grausen Nachtgestalten,
Die nur die Hölle kennt, ward ich vertraut
Wie mit Geschwistern.«
Der Gegenstand seiner unglücklichen Liebe, die schöne Blanca, verließ den Grafen, um dem Erzbischof anzugehören, dem sie ein Pfand der Liebe schenken sollte, als Ugolino's Reisige das Haus Ruggieri's umzingelten und ihn und das kranke Weib in die kalte Winternacht hinausstießen. So hat das Schicksal eine üppig aufkeimende Saat des Hasses in die Herzen beider Männer gelegt, und ihre Söhne hängen in treuer Freundschaft als Kriegsgefährten aneinander und geben sich auf dieser Folie maßlosen Hasses edleren und schöneren Empfindungen hin. Von den beiden Gegnern erkennen wir Ugolino als die energischere, unmittelbarere Natur, die mit Gewalt Pisa groß machen und, wenn möglich, Italien aus der Zerrissenheit befreien und in Eins verschmelzen möchte. Dieser Ungestüm scheint ihm zum Siege verholfen zu haben, denn als Ruggieri und Ugolino die Republik gemeinsam als Oberherren leiten sollten, zog sich der Erzbischof von dem Amte mit dem Hinweis auf sein Alter und seine Kränklichkeit zurück und überließ dem Grafen die ungeschmälerte Herrschaft. Aber der Kirchenfürst hat sich nur nach Katzenart zurückgezogen, um sein Opfer durch einen geschickten Sprung desto sicherer zu fassen. Vor der Welt den Interessen der Politik abgeneigt und nur seines geistlichen Amtes waltend, unterwühlt er seinem Gegner doch den Boden nach allen Richtungen. Er schickt Geld nach Genua, in dessen Kerkern fünftausend Bürger Pisa's gefangen gehalten werden, und erwirkt Einem der Unglücklichen, Marco Lombardo, die Freiheit, damit er mit der Schilderung seiner und seiner Leidensgefährten Qualen, deren Auslösung Ugolino verweigert, die Bevölkerung gegen den Oberherrn aufreize. Bei einem Feste Ugolino's erscheint dieser Lombardo, um den Grafen der Tyrannei zu beschuldigen, ja, ihn als Landesverräther anzuklagen. Während ein Aufruhr die Stadt erfüllt und der Graf die Widerspänstigen mit den Waffen zum Gehorsam zurückbringen muß, blickt der Erzbischof mit Genugthuung auf den Beginn seines Werkes.
Dem trefflich entwickelten ersten Acte, der den geschichtlichen Hintergrund zeichnet und den Conflict der beiden Helden in seiner Reife zeigt, folgt im zweiten die weitere Ausführung und Vertiefung in dem Charakter Ugolino's, der sich zu jäher Gewaltthat hinreißen läßt und dadurch in seinem Gegner das höchste Rachepathos entzündet. Vor den Seinigen, denen er seine weiteren, aus die Einigung Italiens zielenden Pläne enthüllt, reinigt er sich durch einen Eidschwur von dem Verdachte, den Lombardo's Beschuldigungen auf ihn geworfen hatten. Indem er die Kraft des Volkes, das von Hungersnoth bedroht ist und den Frieden mit Genua wünscht, auf das Aeußerste anspannen will, verwirft und überhört er in sich und um sich jede Stimme des Mitleids. Da tritt der Sohn Ruggieri's, Ato, vor ihn hin mit der Bitte, sich der Noth der Bevölkerung zu erbarmen, und als ihm sein Begehren abgeschlagen wird, vergißt er sich so weit, dem Grafen seine ehrgeizigen politischen Absichten vorzuwerfen und ihm mit der Enthüllung derselben bei dem Volke zu drohen. Der in seinen heiligsten Empfindungen getroffene Ugolino stößt wüthend dem Jüngling den Dolch in die Brust und vernichtet damit auch die letzte Möglichkeit, den Haß im Herzen des Erzbischofs zum Schweigen zu bringen.
Der dritte Act zeigt die Folgen dieser That, indem Ruggieri, der so lange wie Sixtus V. den gebrochenen ohnmächtigen Greis gespielt hatte, zur Heldengröße anwächst. Der folgende Monolog an der Bahre seines Sohnes faßt die Situation wie die Charakteristik des Mannes in intensivster Weise zusammen und ist in der Sprache von einer echt dramatischen Musculatur:
»Nun brich, du lang zurückgedämmte Glut,
Aus allen Tiefen, den versunkensten
Abgründen meines halbzerstörten Wesens
Brich nun hervor und schmelze jegliches
Gefühl, mein Denken und Empfinden all'
In deinem Feuerstrom dahin, bis Alles
Ein großer, ungeheurer Schmerz ist! – Da,
Da liegst du nun, geliebter Sohn, du Pfand
Der einzig Theuren, letztes Band, das mich
Mit Menschen noch zusammenhielt! Kalt! starr!
Dein blüh'nder Leib geknickt, dein süßes Leben
Hinweggetropft! Wen drück' ich nun statt deiner
An meine Brust? Mit wem soll nun ich plaudern?
Versiegelt hat, mein Knabe, Dir der Tod
Die blassen Lippen, doch dein stummer Mund
Ruft lauter als Posaunenton der Engel
Beim Weltgericht, und seine Stimme pocht
An aller Herzen Thore, bis der Haß,
Gepanzert und gewaffnet wie ein Held,
Hervortritt, deines Mörders Haupt zu fällen. –
Hör' mich, o Gott, du großer Vater Aller,
Hör' eines Vaters Fleh'n! An dieser Leiche,
An der ich, elend, kraftgebrochen, siech
Daliege, gieße neues Lebensblut
Mir durch die Adern! Alle Nerven stähle
Und alle Sehnen spann in mir, daß jede
Ganz Mann sei, stark genug, den Mord von Sohn
Und Weib in einer ungeheuren Rache
An dem zu rächen, der in ihnen mir
Das Dasein doppelt hingewürgt. Hör' Gott,
Erhöre mich! In deinem Feuer schmiede
Mir diesen welken Leib zum eh'rnen Schwert,
Zum doppelschneid'gen Werkzeug meiner Seele,
Daß sie, mit ihm bewehrt, all' ihren Grimm
In Strömen Blutes lösche; und nicht eher
Nimm von der Erde dieses Schwert hinweg,
Bis unter ihr die Schlachtbank ächzt
Und seine Klinge, morsch vom Morden, bricht! –
Ja, Herr, ich fühl' es, du erhörst mein Flehen;
Schon raff' ich mich empor, und Jugendstärke
Schwellt mir die Glieder, jeder Puls klopft Thatkraft;
»An's Werk! An's Werk!«
Die Versammlung des großen Rathes entwirft uns ein Bild des damaligen Parteilebens und treibt den Hader auf seinen Höhepunkt. Die Mehrzahl erklärt sich für den Frieden mit Genua und Befreiung der gefangenen Pisaner, aber Ugolino bleibt unbeugsam und droht, die Versammlung durch Waffengewalt seinem Willen dienstbar zu machen. Während sich die Rathsherren von den Soldaten bedroht sehen, springt Ruggieri, der während der Berathung sein ganzes Vermögen dem Volke hinzugeben versprochen hatte, plötzlich auf, schlägt sein geistliches Gewand zurück und gibt in voller Rüstung mit gezücktem Schwerte das Zeichen, daß er nunmehr im wildentfesselten Bürgerkriege zum Rachewerk schreite.
Die Peripetie des vierten Actes besteht darin, daß Ugolino unterliegt und von Ruggieri verurtheilt wird, mit seinen Söhnen in einem tiefen, am Arno gelegenen Kerker des Hungertodes zu sterben. Zugleich tritt aber ein neuer, bisher nur in allgemeinen Umrissen gehaltener Charakter in die Action: Ugolino's Gattin, Cornelia, der es versagt wird, die über Gatten und Kinder verhängte Strafe gleichfalls erdulden zu dürfen und die sich, um Erbarmen flehend, dem unversöhnlichen Feinde ihrer Familie zu Füßen wirft. Allein den einzigen Preis, durch den sie die Freiheit der Ihrigen erkaufen kann, vermag sie nicht zu zahlen; er besteht darin, daß sie ihrem Gatten die Erklärung abnöthigt, er habe in der Schlacht bei Meloria sein Vaterland verrathen, während doch Marco Lombardo, der öffentliche Ankläger Ugolino's, diese Beschuldigung sich nur von seinem blinden Hasse hatte eingeben lassen. Nachdem Ruggieri den Schlüssel zum Gefängniß in den Arno fallen gelassen hat, ist das Schicksal des Grafen unabwendbar. In der ersten Scene des fünften Actes erschöpft sich bei Schack der Inhalt des Gerstenberg'schen Dramas: die Schilderung des mit seinen Söhnen dem Hungertode preisgegebenen Grafen; doch fehlt auch das dramatische Gegenspiel in den Gewissensbissen, die den Erzbischof peinigen, keineswegs. Er läßt den Kerker öffnen, in dem die Kinder bereits gestorben sind und den Ugolino nur verläßt, um seinen: letzten Seufzer auszuhauchen, während Ruggieri gleichfalls dem Todesengel erliegt, der in diesem Stücke seinen fürchterlichen Rundgang mit so unheimlicher Energie zu Ende führt.
Die Vorzüge dieses Dramas sind durchaus seltener Art. Es bildet nicht nur das Beste, was Schack für die Bühne geschrieben hat, sondern gehört auch wegen der lichtvollen Composition, der scharfen Charakterisirung der Hauptpersonen und der sich ununterbrochen steigernden Leidenschaft zu dem Gelungensten, was auf dem Gebiete der theatralischen Production in den letzten Jahrzehnten in Deutschland hervorgebracht worden ist. Wenn unsere Bühne sich solchen Arbeiten gegenüber theilnahmslos verhält, zeigt sie am Besten, wie wohlverdient alle gegen sie erhobenen Beschuldigungen sind. Was uns als ein Fehler des trefflichen Stückes erscheinen will, liegt durchaus nicht in der Führung der Fabel, sondern in der Gesammtstimmung des Dramas, das sich immer mehr verdüstert und keinen freundlichen Wechsel der Farben aufkommen läßt, nachdem einmal die Leidenschaften entzündet sind. Das erhellende Licht, welches durch die Freundschaft Ato's und Guelfo's in die Handlung hineingezogen wird, leuchtet nach unserem Gefühl nicht hell genug und geht zu früh aus. Eine Liebesgeschichte wäre jedenfalls wirksamer gewesen, auch wenn sie nur episodisch in das Stück eingegriffen hätte. So wie es vorliegt hat es nur einen einzigen weiblichen Charakter, den von Ugolino's Gattin, in der etwas von dem Stolze der Corneille'schen Frauen lebt. Allein das Bedenken, welches sich gegen das allzu Herbe der Fabel wendet, muß völlig zurücktreten, wenn wir an die ungewöhnliche dramatische Kraft denken, mit welcher hier ein fesselnder Stoff ausgestaltet und zu einer Fülle charakteristischer Figuren verarbeitet worden ist. Wenn unser Theater mit einem solchen Drama nichts anzufangen weiß, muß es anständigerweise den künstlerischen Bankerott anmelden.
Ein ebenso großes Verdienst wie durch die Pflege des komischen Epos hat sich Graf Schack durch seine Versuche, das idealistische Lustspiel anzubauen, um unsere Literatur erworben. Er gedachte damit Wirkungen nach einer Richtung zu erzielen, in der bereits treffliche Muster vorliegen, ohne daß es ihnen gelungen wäre einen tieferen Eindruck hervorzurufen. Die Comödien Ludwig Tieck's »Die verkehrte Welt«, »Zerbino« u. a., die »Politische Wochenstube« von Prutz und Platens »Romantischer Oedipus« konnten für unser Publicum nur wenig Anziehendes haben. Viel zu abstract, persönlich und beziehungsreich waren diese Lustspiele, um allgemein bekannt zu werden. Nun können wir allerdings auch die Schack'schen Comödien »Der Kaiserbote« und »Cancan« nicht als bühnenfähige Stücke ansehen; immerhin sind sie aber aus einem vollen humoristischen Kern entwickelt und bei den tollsten Sprüngen der Laune und Satire für Jedermann verständlich. »Der Kaiserbote« ist bald nach 1848 geschrieben und schildert die Strömungen im »tollen Jahre« nach den verschiedensten Richtungen und mit Zugrundelegung der Idee, daß Kaiser Barbarossa durch einen Boten auskundschaften läßt, ob Deutschland für die Einheit und Freiheit schon reif sei. Aber der Bote macht die traurigsten Erfahrungen und kann dem Kaiser nur rathen, in seinem Kyffhäuser ruhig weiter zu schlafen. »Cancan« führt uns die Herrschaft des zweiten Kaiserreiches unmittelbar vor dessen Zusammensturz vor und zeigt Paris in einer Anzahl charakteristischer Typen bis zur Einschließung und Einnahme der Stadt durch die deutschen Truppen. Vieles von der aristophanischen Form ist in diesen Stücken beibehalten worden, so z. B. die Parabasen, in denen die Ueberzeugung des Dichters zu schwungvollem Ausdruck kommt, aber sonst ist jeder philologische Zwang bei dieser Anlehnung an das griechische Vorbild vermieden. Der Humor schaltet frei und richtet Menschen und Dinge nicht nach den Geboten einer Partei, sondern stets im Hinblick auf die Einheit und Größe unseres Vaterlandes, dessen Beleuchtung durch die Kunst des Dichters wieder eine rhetorisch glanzvolle ist.
Es ist unmöglich und für unseren Zweck auch unnöthig, in die Fülle von Beziehungen politischer und socialer, literarischer und künstlerischer Natur näher einzudringen, die der Dichter in diesen Lustspielen nach allen Richtungen bunt ausgestreut und mit dem Glanz seines in allen Formen geübten Sprachtalentes umgeben hat. Schack enthüllt uns in diesen Komödien seine persönlichen Anschauungen über Welt und Menschen weit mehr, als in seinen Gedichten, und dem Kenner jener Zeitabschnitte wird es nicht schwer fallen, hier das Porträt eines öffentlichen Charakters, dort eine Anspielung auf eine pikante historische Episode zu bemerken. Doch braucht der Leser sich durchaus nicht an solchen Nüssen, wenn sie ihm zu hart sind, die Zähne auszubeißen. Die Stücke bedürfen keines Commentars, keines geheimnißvollen Errathens von Andeutungen, die uns das Ganze erst verständlich machen. Die Stimmung der beiden Lustspiele athmet frische, fröhliche Studentenlaune, die sich in einer dichten Gruppe von Vornehm und Niedrig, Arm und Reich behaglich tummelt. In »Cancan« treten sogar Napoleon III., Eugenie, Lulu, Olivier leibhaftig auf, indem sie von den Sturzbächen eiskalten Hohnes übergossen werden. Allein während in den komischen Epen des Dichters der Humor unbeschränkter Souverain ist und bis zum Schluß Alles zum Gegenstand seiner Neckerei stempelt, macht sich das Gefühl des Autors in den Lustspielen auch in pathetischen Wendungen, besonders gegen das Ende hin Lust, wenn der Dichter als Chorus erscheint. Der patriotischen Begeisterung Schack's haben wir oft gedenken müssen; nirgends gelangt sie zu schönerem und erhebenderem Ausdruck, als in diesen Schöpfungen. Die Prophezeiungen im letzten Acte des »Kaiserboten«, welcher die Einigung Deutschlands mit machtvollen Worten verkündet, ist nicht aus der vollzogenen Thatsache rückwärts datirt, sondern zwanzig Jahre vorher gemacht worden, als die Erfüllung so schöner Hoffnungen Allen als frommer Wunsch erschien. Ebenso hat der Dichter seine Begeisterung für die Hohenzollern am Schlusse des »Cancan« in schwungvollen Versen ausströmen lassen und dem Deutschen Kaiser eine Huldigung dargebracht, die weit entfernt von niederem Byzantinismus nur der Ausdruck der in der Gesammtheit unseres Volkes lebenden Empfindungen ist:
»Doch du, dem alle deutschen Herzen schlagen,
Der du von Riesenschlacht zu Riesenschlacht
Das Banner deinem Volk voraufgetragen,
Und es zu Einheit neu geführt und Macht!
Wer dürft' ein Denkmal dir zu bauen wagen?
Zu groß dafür ist, Herr, was du vollbracht.
Dein Werk steht selbst an des Jahrhunderts Ende
Als Markstein einer großen Zeitenwende.
Auf daß dein Reich in Herrlichkeit gedeihe,
Daß frei dein Volk und einig sei und groß,
Mag Deiner Enkel eine lange Reihe
Sie schirmen treu wie du und wandellos!
Herab auf sie ruf' ich des Himmels Weihe
Und was auch birgt der Zukunft dunkler Schooß,
Es sei ihr Thron dem Frieden und dem Rechte,
Ein Bollwerk von Geschlechte zu Geschlechte.«
Wenn auch die poetischen Werke des Grafen Schack sämmtlich in verhältnißmäßig kurzer Zeit, nämlich in den letzten zwanzig Jahren erschienen sind, so vertheilt sich doch diese Production auf eine viel längere Zeit, da der Dichter seine Hefte lange in seinem Pulte verschlossen gehalten hat, bevor er sie für das größere Publicum öffnete. Er hat gleichsam seine Jugend in sein Alter hinübergenommen und die Früchte einer für alles Ideale erglühenden Begeisterung an der Sonne der Lebenserfahrung und weiser Erkenntniß ausreifen lassen, so daß sie sich an Geschmack und Güte jeden Vergleich gefallen lassen dürfen. Dadurch erklärt es sich auch, wie dieser Reichthum dichterischer Hervorbringungen möglich war in einer Zeit, die den Autor zugleich mit seinen gelehrten Studien beschäftigt fand. Wie wenig die letzteren dem poetischen Schaffen Schack's Eintrag gethan haben, zeigt sein unlängst vollendetes episches Gedicht »Die Plejaden«, das auf dem Hintergründe des Freiheitskampfes der Griechen gegen die Perser ein meisterhaftes Bild des hellenischen Lebens entwirft und in die Mitte desselben und die Zeit mächtiger nationaler Erhebung ein anmuthiges Liebespaar stellt, welchem der Verfasser die Wärme und die Herzinnigkeit seines deutschen Empfindens eingehaucht hat. Der junge Athener Kallias, der sich den olympischen Siegeskranz errungen hat und auf der Reise nach Sardes die liebliche Arete kennen und lieben lernt, ist eine jener Jünglingsgestalten, die wir bei dem Dichter mehrfach antreffen und denen er den Idealismus seiner eigenen Natur geliehen hat. Der Schwung einer jugendlichen, männlich erstarkenden Seele und das stille Gemüthsleben einer vom Schicksal zu allem Würdigen und Hehren bestimmten Jungfrau geben dem Gedichte etwas Verklärtes, wir möchten sagen, Frommes, das die Handlung in einen rosigen Schimmer zu tauchen scheint. Das Paar wandelt durch das Gedicht, wie zwei Täubchen durch einen von Blumen erfüllten Raum schwirren. Daß sich in der Geschichte ihrer Liebe keine Sentimentalität im modernen Sinne einschleicht, dafür sorgt das kraftvoll Verhaltene der Empfindung dieser zugleich starken und milden Seelen. Wie Kallias durch den Anblick des himmlischen Gestirns, das ihm als glückverheißendes Zeichen leuchtet, immer wieder auf den rechten Weg zurückgelenkt wird, wenn er in Versuchung geräth, ihn einmal aus den Augen zu verlieren, bildet den anmuthigen Grundgedanken dieser schönen poetischen Gabe, die mit der Schilderung der Schlacht bei Salamis prächtig ausklingt. – Nicht minder beachtenswerth sind: die neueste Sammlung trefflicher lyrischer Gedichte: »Lotosblätter«, sowie die kleinen poetischen Erzählungen, die der Dichter unter dem Titel: »Tag- und Nachtstücke« vor kurzem herausgegeben hat und die einen bunten Wechsel der Stoffwahl und Tonart verrathen. Sage, Geschichte und Selbsterlebtes, Ernst und Spaß sind hierin anmuthig in einander geflochten und dem entsprechend läßt sich dieser Inhalt von einer großen Mannigfaltigkeit virtuos gehandhabter Formen anmuthig tragen.
Je mehr Graf Schack bemüht gewesen ist, in seinem literarischen Schaffen den Genius des Schönen, überall, wo er sich ihm offenbart hat, nach Verdienst zu würdigen, je mehr er selbst an der Aufmunterung und Förderung junger Talente theilgenommen, desto mehr mußte es ihn verdrießen, daß das Publicum verhältnißmäßig so langsam seinen dichterischen Arbeiten Interesse entgegengebracht hat. In einem Augenblick des Unmuths konnte er beim Abschluß des Buches »Meine Gemäldesammlung« sogar folgendes Bekenntniß nicht zurückhalten: »Bei der eisigen Kälte und tödtlichen Gleichgiltigkeit, welche die ganze deutsche Nation von jeher meinem eigenen poetischen und literarischen Schaffen gezeigt hat und noch jetzt zu zeigen fortfährt, wo mein Abend hereinbricht, liegt es wohl oft nahe, daß mich tiefe Niedergeschlagenheit befällt und daß ich den Wunsch nicht zurückweisen kann, lieber in England oder Italien, Frankreich oder Spanien geboren zu sein. Ich kenne diese Länder genug, um zu wissen, daß mir dort nicht die Theilnahmlosigkeit begegnet, wie im »Lande der Denker und Dichter«. Es ist hart, an der Neige eines von ernster Arbeit und begeistertem Streben erfüllten Lebens sich so trüben Gedanken hingeben zu müssen; wofern es dabei für mich einen Trost gibt, so liegt er, neben der Hoffnung auf eine empfänglichere Nachwelt, in dem Bewußtsein, daß ich nicht theilgenommen habe an der Schuld, welche das deutsche Volk gleichzeitig gegen einige Andere geübt hat, vielmehr bemüht gewesen bin, das ihnen zugefügte Unrecht nach meinen schwachen Kräften zu sühnen. Und wenn es mir gelungen ist, den Bann der Verkennung, unter dem Deutschland schon so viele seiner besten Söhne verkümmern ließ, auch nur von Einem derselben hinwegzuheben, so werde ich mir in meiner letzten Stunde sagen können, daß ich nicht vergebens gelebt habe.«
Die aus diesen Worten sprechende Bitterkeit ist leider nicht ohne Berechtigung. Noch verbinden sich in Deutschland mit dem Worte Schriftsteller und Dichter Vorstellungen, welche die Thätigkeit großer Männer als etwas überflüssiges oder wenigstens doch als einen Luxus erscheinen lassen um den man sich nicht zu kümmern braucht. Kotzebue's »Armer Poet« ist aus der Mode gekommen, aber unsterblich scheint bei uns der »Literat« zu sein, über den sich jeder reich gewordene Krämer ein geringschätziges Urtheil zu fällen gestattet, weil er mit seinem Artikel im Monat so viel verdienen kann, wie Jener mit der Feder im ganzen Jahre. Kommt nun einmal Jemand aus einer vornehmen gesellschaftlichen Stellung dazu, sich durch literarische Arbeit ein geistiges Adelsdiplom zu verdienen, so findet man das unbegreiflich, zuckt mitleidig die Achsel und überläßt es der nächsten Generation, Gerechtigkeit zu üben. Noch ist in Deutschland ein Dichter wie Victor Hugo, der mit seinen Schöpfungen die Wirkungen einer Parlamentsrede oder einer politischen Action übertönte, ein Autor wie Turgenjew, der in völliger Unabhängigkeit dem inneren poetischen Triebe folgte, ohne der künstlichen Ruhmeserhöhung zu bedürfen, eine vollkommene Unmöglichkeit. Aber es wäre undenkbar, daß unsere Nation das Wirken eines Dichters wie Schack dauernd unbeachtet an sich vorübergehen lassen sollte. Die schöne, in sechs Bänden erschienene Gesammtausgabe der poetischen Werke des Autors, welche die J. G. Cotta'sche Buchhandlung in Stuttgart veranstaltet hat, ist endlich zum Stichworte einer allgemeineren und gerechteren Würdigung seiner Leistungen geworden. Aus tiefster Ehrfurcht vor den Meisterwerken der Kunst find' diese Werke hervorgegangen, und alle tragen den Stempel des Ausgereiften, Harmonischen, der strengsten Selbstkritik. Ueberall macht sich das Streben nach den höchsten Gattungen der Poesie und das Bedürfniß geltend, die Aufgaben nach den Stylgesetzen unserer classischen Dichter zu lösen. Graf Schack hat den Inhalt einer ungewöhnlich reichen Erfahrung und eines umfassenden Wissens in Formen gegossen, die nur dem Meister zu beherrschen vergönnt ist. In seiner vornehmen Stellung als Autor hat er nicht mit einer Zeile den Lockungen der Mode, den Verheißungen flüchtiger Erfolge nachgegeben. Nachdem er sich als Uebersetzer und Literarhistoriker einen ersten Namen errungen hat, darf er begründeten Anspruch darauf erheben, daß ihm seine Nation auch als Dichter einen Ehrenplatz anweise. Zur Feier seines siebzigsten Geburtstages am 2. August 1885 will die vorliegende Betrachtung einen bescheidenen Beitrag, liefern, indem sie dieser edlen Menschen- und Dichternatur, der das Abendroth des Lebens noch lange mit seinen erquickendsten Strahlen leuchten möge, gerecht zu werden versucht.