
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Rudolf Kaemmerer Verlag
Dresden
MCMXXI
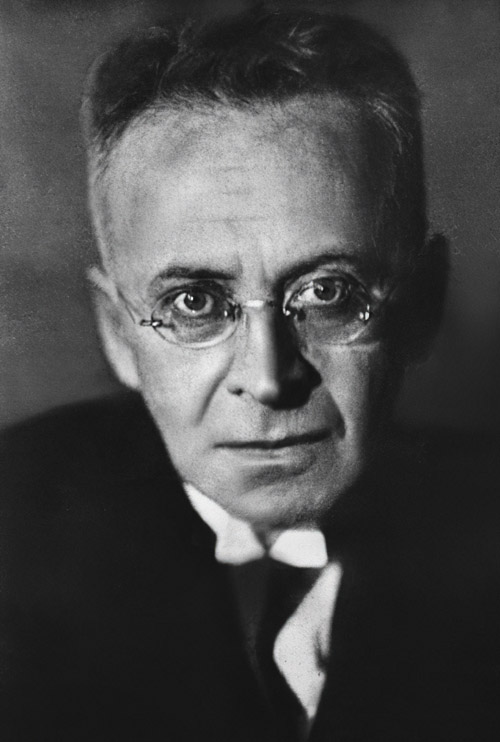
»Die Volkszählung hat ergeben, daß Wien 2 030 834 Einwohner hat. Nämlich 2 030 833 Seelen und mich.« Indem mir dieses Rechenexempel des Karl Kraus durch den Kopf geht, erschrecke ich vor den achtzehn Jahren der »Fackel«, einer Wiener Zeitschrift. Ich sehe die Schrift aus der Zeit treten und sich ihr gegenüberstellen. Durch die Zeit geht ein Bruch; wer entkäme ihrer unheilbaren Zerstückelung? In der Schrift ist Zusammenhang; ihre einzelnen Buchstaben verbindet ein starker Zug und prägt sie zum Charakter.
Diese einzige Erscheinung zwingt mich, sie furchtlos zu ehren. Ich war in den achtzehn Jahren nicht immer bei Karl Kraus gewesen. Wie viele Überraschungen hatte dieser leidenschaftliche Geist, als er sich entwickelte, dem Jüngeren geboten! Wie bewegte er sich im Zickzack der Widersprüche; oder schien nicht von der Stelle zu rücken, während wir zu laufen glaubten! Heute aber überrascht mich an ihm nichts so sehr wie die überlegene Deutlichkeit des innern Zusammenhanges. Und daß mein Weg so sicher zu ihm zurückgeführt hat! Nur der eine große Widerspruch blieb übrig, der mit diesem Menschen in die Welt gekommen zu sein scheint; oder den die Welt in diesem Menschen ohne Ende erregt. Aber es ist der uralte Widerspruch in Welt und Mensch, wenn auch in der Konstellation eines besondern Individuums und einer besondern Epoche sich entfaltend. Daß Karl Kraus ein Widerspruchsgeist ist, scheint mir heute nur noch zu bedeuten, daß er ein Geist ist.
Ich will sofort gestehen: nichts hat mich in der Übereinstimmung mit meinem Original so sehr gefördert wie die Entschiedenheit, mit der ich seiner Fragestellung, seinem Entweder-Oder widersprochen hatte. Ich bin darauf gefaßt, diesen Gegensatz wieder aufzunehmen, auf höherer Ebene, mit der Möglichkeit einer noch tiefern Übereinstimmung. Die Anhängerschaft des Knaben dereinst war ein Vorgefühl gewesen, sicher, aber noch unerprobt durch die Wirklichkeit. Später kam ich dem Menschen Karl Kraus nahe, dem Patienten seiner Gaben; ich erlebte den tyrannischen Formwillen und zugleich das widerspenstige, teuflische Material, aus dem er formte. Jede häßliche oder komische Einzelheit wuchs in dieser Nähe übergroß und verstellte den Horizont der Tage. Ich sah einen Gebannten und glaubte, dem Bann entweichen zu können, indem ich die Welt umso zärtlicher suchte. Es mußte doch eine Art geben, die Menschen unbedenklicher zu lieben! Der Wunsch nach Güte mußte es leichter haben, die Schönheit sollte milder und üppiger gedeihen – als bei dem puritanischen, kämpf verhärteten Opponenten und Satiriker! War es nicht das Recht der Jugend, den streng Bannenden seinem Bann zu überlassen und den Verheißungen der Zeit zu folgen? Selbst auf die Suche zu gehen?
Vielleicht hatte ich damals schon Karl Kraus gekannt, jedenfalls aber nicht die Zeit, mit der er rang. Und es blieb mir die Einsicht nicht erspart, daß ich, als ich vor Karl Kraus geflohen war, eigentlich nur das überscharfe Spiegelbild der Epoche und ihres Menschentums geflohen hatte, das in solcher Nähe vom Spiegel schmerzhaft zurückschlagen mußte. Als nun aber die ersehnte Wirklichkeit zwischen mir und dem Spiegel lag, belehrte mich diese Distanz eines Besseren. Ich schaute hinüber und sah erst jetzt wieder das ganze Bild. Die Über- und Unterwerte des Persönlichen einigten sich da drüben zum Gleichmaß einer Persönlichkeit. Sie trug, zur bedeutungsvollen Paradoxie zusammengeballt, ein Menschenangesicht: das des hoffenden, liebenden, gläubigen Menschen. Und indem ich mich jetzt dem Werk wieder zuwandte, lernte der Mann verstehen, was der Knabe gefühlt hatte, und die heftigen Schwankungen der Empfindung beruhigten sich zur Gewißheit der Entscheidung.
Vieles freilich hat diese Zeit dazu getan, daß einer das scheinbar Altbekannte neu erfasse! Diese Zeit gibt Distanz sogar den Unglücklichen noch, die sie in ihre tödlichen Wirbel reißt. Hat sie doch eine Kluft eingeschaltet, welche unser aller Leben in zwei rätselhaft ungleiche Stücke auseinandersprengt. Jenes Wien, das uns so schmeichelnd umgeben hatte, liegt heute – wo? In einem Hinterland. Wer uns verläßt, um ein Wiener in Wien – im schönen Wien! – zu sein, hat uns verlassen; und ist in eine unwiederbringliche Vergangenheit zurückentwichen, wie ein Gespenst, das ins Reich der Schatten heimkehrt. Und wenn wir uns vorstellen, daß auch wir nach Wien heimkehren werden – so sehr wir es wünschen, wissen wir doch nicht, ob wir es hoffen oder fürchten sollen. Der unwahrscheinliche Ort, wo wir jetzt stehen, ist der Schnittpunkt zweier entgegengesetzter Bewegungen; zweier kontradiktorischer Blicklinien – oder vielmehr: hier scheint die Zeit gleichzeitig vorwärts und rückwärts zu laufen. Da weiß keiner, wohin er gelangen wird. Keiner weiß, was ihm bestimmt ist; ob er, indem er jetzt lebt, der Vergangenheit oder der Zukunft angehört. Sonst pflegte man wohl in den Tag hineinzuleben – jetzt treibt es übergewaltig aus dem Tag hinaus, und auch in den Jahren ist kein Verweilen mehr. Man versuche, sich am geistigen Himmel zu orientieren! Vergebens. Der Rauch, der vom vergossenen Blut aufsteigt, verdunkelt ihn. Und die bewährtesten Zeichendeuter sind durch die doppelsinnige Bewegung der verhexten Zeit drehkrank geworden. Sie taumeln, es reißt sie hierhin, dorthin. Die Gewissenhaftesten, also Vorsichtigsten sind bestrebt, stehen zu bleiben, wo sie gerade standen, als der Boden unter ihren Füßen ins Rollen geriet.
Der Eine, den ich betrachte, Karl Kraus, scheint mir nun mit ganz besonderer Kraft und Zuverlässigkeit gegen die Zeit gestellt zu sein. Nicht, daß er sich seine neue und kunstreiche Kunstform schuf – aus dem sprödesten Material, dem häßlichsten Stimmengewirr der Zeit und der Reflexion des Einzelnen, welche diese Mißform herrisch durchdringt und prägt –, macht ihn einzig. Es gibt neben und über ihm Künstler, deren Werk bleiben wird. Aber sein Denken, das den Kampf nicht aufgibt und den Halt nicht verliert, wo das Leben so grauenhaft leidet und schwindet, offenbart jetzt seine besondere Mission. Es müssen nicht alle Begabungen aufzugeben sein, die im Kriegs-Chaos, diesem Interregnum der Notwehr, zweifelhaft wurden. Mancher wirkt freilich gespenstisch, indem er auch weiterhin, der Kulturträger, die Gebärde des gewichtigen Tragens macht – da ihm doch sein Pack abhanden kam, da er doch nur noch eine Leere schleppt. Auch das Hinterland des Geistes wird gut daran tun, Verlustlisten anzulegen. Karl Kraus aber trägt unbeirrt seinen Widerspruch mitten in unsre Tage hinein – und viele sehen erst jetzt, wie schwer die Last ist, wie leicht und sicher er sie schultert. Wir haben Erfahrungen ohne gleichen gemacht; wir haben erlebt, was wir uns nie hätten träumen lassen. Aber grade das scheint der Satiriker bei hellichter Sonne vorhergesehen zu haben. Der Schatten, den der Krieg zurückwirft, wird von der »Fackel« plötzlich so grell erleuchtet, daß es manchen Blick hinzwingt. Was jener längst sagte, enthüllt erst heute für manchen schmerzlich Überprüfenden den ganzen furchtbaren Sinn. Aber wird nicht hinter den blutigen Taten und blutigen Opfern ein andrer, ein beglückender Sinn auftauchen? Ich weiß es nicht und hoffe es, wie jeder lebende Mensch. Und ich müßte einen Witzbold grenzenlos verabscheuen, der im gesicherten Hinterhalt an den Härten, welche andre erdulden, seine Munterkeit wetzte. Aber nur wer Karl Kraus nicht als den restlos Verzehrten seiner Fragwürdigkeit erkennt, mag ihn mit einem Kriegsgewinner des Geistes verwechseln, der an der Fragwürdigkeit der Zeit verdient, ohne tieferes Verdienst! Ginge uns seine Frage nur nicht so innig an! Wäre es nur nicht unser aller bohrende Frage! Wäre das Wehtun seines Witzes nicht so kräftigend! Diese geistige Notwehr des Einzelnen gegen die ungeheure Übermacht der blutigen Ideenlosigkeit!
Wäre nur nicht der Stern Europas so lichtlos hinter dem gigantischen Berg des Beklagenswerten versunken! Erblickte man doch ein Ziel über den Zwecken der Politik und der Wirtschaft! Hätte nur von allen Errungenschaften des Wissens, Könnens und Lebens, welche die Kinder der Zeit als ihren Ruhm ausposaunten, ein geistiger Rest sich als so dauerhaft bewährt wie der Widerspruch eines Widerspruchsgeistes! Nein, wir wissen noch nicht, welche Flecken der Menschheit die Ströme des Blutes – ein Niagarafall von Blut! – hinweggewaschen haben werden, wenn sie erst abgeflossen sind. Sollten wir deshalb weniger bereit sein, an der Reinigung der öffentlichen Begriffe teilzuhaben, welche ein Züchtiger mit dem Worte durchführt, indem er die strengste Selbstzucht übt? Mag man immerhin heute keinen Wert gelten lassen neben dem unerhörten Opfer, dem unausdenkbaren Martyrium der Völker. Aber kein Sieg könnte die tausendfache Frage ersticken, die jeden sofort anfällt, den die äußern Ereignisse für einen Augenblick mit sich allein lassen. Und wie an den Fronten er, der am besten kämpft, so ist der Menschlichkeit jener Andre unentbehrlich geworden, der am besten fragt! Allzu selten wurde solche Kunst der Frage: die bereitwillige Ja-Sagerei schoß überall üppig ins Kraut. Jenes Ja grassiert, das keine Antwort ist. So will ich freudig einen Eigensinnigen ehren, der in der Zeit, die vom Wortbruch der Könige gekennzeichnet wird, sein einzelnes Wort gehalten und hochgehalten hat.
Es gehört wohl zum Wesen des Satirikers von Rang, daß ein Weltgericht wie dieser Krieg uns schärfer auf ihn einstellt. Und von Ostgalizien her hebt sich die Apokalypse Wiens – die Apokalypse einer urbs des Friedens von gestern – als eine überhelle Fata morgana gegen einen unvergleichlich dunkeln und tiefen Hintergrund ab. Scheiden uns von dieser damaligen Welt wirklich nur drei Jahre? Es läßt sich nicht abschätzen. Denn die Zeit verläuft nicht mehr in continuo, es geht ein Sprung durch die Zeit. Die Zeit bewegt sich doppelsinnig, wir werden plötzlich wieder sein, wo wir waren. Und ich werde, indem ich das Beispiel Karl Kraus betrachte, über vergangene Zukünftigkeiten sprechen, zugleich über zukünftige Vergangenheiten. Das bedeutet, daß er steht, wo wir standen, wo wir stehen, wo wir stehen werden.
Ein wahres Ärgernis für Statistiker, wie glatt die Wiener Rechnung aufgegangen wäre ohne Karl Kraus – diesen periodischen Bruch! Weil er war, stimmte es nicht. Deshalb hat ihn denn auch die Tagespresse aus ihrem Cliché ausgemerzt – um das Ärgernis zu tilgen. Der indiskretesten Reportage war sein Name seit achtzehn Jahren: wunderbar unaussprechlich. Hätte alles, was durch Karl Kraus verneint wurde, ihn so unerbittlich boykottiert, er hätte im schmausenden Wien zuletzt Verneinung essen müssen, wie König Midas Gold. Ließe sich das Leben abschrecken, einem Manne verbunden zu bleiben, der sich aus Fanatismus abzusondern strebt – der letzte Atemzug wäre längst ausgeschöpft. Aber die Natur wußte, daß dieser Eiferer ihr innigst anhing; daß der Streit seine Art war, sie zu lieben. So gedieh er denn an besonderen Kräften und wuchs von der üppigen Wurzel her, weit über alles Erwarten hinaus.
Er hat es arg getrieben. Sogar seine Bündnisse, seine Lobe, seine Duldungen wurden ihm: Schulfälle seiner Selbstbefreiung zu Karl Kraus. Er hat Brücke auf Brücke abgebrochen, um seinen Weg zu verdeutlichen. Er hat durch hartnäckige Aberkennung von Merkmalen seine und unsre Begriffe gereinigt. Die Vivisektion, aber die humane, die satirische, war und blieb seine erprobte Methode eines Autodidakten. Er hatte viel zu lernen. Und die Leidenschaft erlahmte nicht, der Witz stumpfte sich nicht ab. Wer aus der Geborgenheit des Privatlebens, des wahren Privatlebens, das dem Satiriker heilig ist, sich in die Öffentlichkeit hinauswagte, mußte gefaßt sein, daß Karl Kraus seiner Popularität entscheidend nachhalf. Seither ist so mancher Eintagsruhm im Begriff, auf die lachende Nachwelt zu kommen, welche ich mir als eine ganz besonders boshafte Welt vorstelle. In diesen achtzehn Jahren haben die Zeitungen nur höchst ausnahmsweise einem Getroffenen einen Aufschrei, einem Erbitterten einen Wutausbruch gestattet. Karl Kraus äußerte sich maßlos, unumschränkt, so oft er nur wollte. Gegen einen so gefährlichen Mann ist erstaunlich wenig unternommen worden. Das Cliché hatte keine Stimme, um einem starken Sprecher zu erwidern, der alles persönlich nahm. Die ihn persönlich nehmen wollten, legten ihm nur tückische Straßenunfälle in den Weg, ohne ihn aufhalten zu können. Während man ihn also erduldete – indem man sich den Anschein gab, ihn zu dulden –, war die »Fackel« längst eine Institution geworden; ein lebendiges Korrektiv des öffentlichen Geistes. Und die Beherrschten hatten sich in aller Stille an diese eigenartige Tyrannis gewöhnt. Und wie so manche Tyrannis, war auch die der »Fackel« nicht ohne Süßigkeit, nicht ohne Wollust. Nur die »Neue Freie Presse« blieb so charaktervoll, sich niemals zu gewöhnen. Sie tilgte das Ärgernis, indem sie die geistige Volkszählung fälschte. Sie erhielt sich ihr Wien als einen ewigen Gemeinplatz, indem sie den Blick wegwendete vom aufregenden Wahrzeichen, vom großen Obelisken des Widerspruchs. – Wie jeder Tyrann war Karl Kraus ungerecht. Er mißbrauchte hemmungslos die Überlegenheit seiner Urteilskräfte; er verschwendete Witz und Temperament, die Gottesgaben, an arme Schächer und Schacherer die Worte, die er für würdig erachtete, ihm Anlaß zu sein. Er verhalf Unschuldigen zum Martyrium, indem er zufällige Ausüber, unverantwortliche Nutznießer wahrzeichenhaft an Probleme festnagelte. Die Leute treiben ihr Geschäft und stecken bis über die Ohren in den täglichen Sorgen. Wie sollen sie auch noch imaginäre Werte verteidigen, für die er, der Müßiggänger, seine aufgesparte und gepflegte Kraft einsetzt! Sie sind in tausend Rücksichten und Verbindlichkeiten verschlungen und verstrickt. Ihm gab ein Gott die Unabhängigkeit, zu sagen, was er leidet – und was er nicht leiden kann. Und dennoch war dieser unbeugsame Vereinzelte nicht nur ein Jäger, der trifft, sondern auch ein umstelltes Wild, auf das es ringsum abgezielt war. Und ich würde ihm stets zubilligen, daß er in Notwehr handelt. Er sah sich umgeben von Fratzen, Karikaturen, wüsten Mißbildungen, Albdrücken, welche ihn umscharten, ihn auf Schritt und Tritt zudringlich umkreisten, ihn reizten, quälten, bedrückten, erstickten! Das war ein Orchester von unreinen Tönen, ein Labyrinth von falschen Linien, ein allgemeiner Blocksberg der Gesinnungs- und Meinungsteufelei, ein Ansturm von Dummheiten, Schäbigkeiten, Ekligkeiten, ein Gegrinse und Getuschel und Gemecker! Jede Zeile, mit der er solch ein Unding abfing und bannte, erlaubte ihm einen freiern Atemzug; jeder Witz, der traf, machte Raum für seine fünf Sinne; für jede Unze kritischen Aufwandes gewann er eine Fülle eigenen Lebens. Indem er seine Zeitgenossenschaft satirisch abschoß, erlöste er sich von ihr. Wir sagten: er habe den bösen Blick. Er sagte: wir hätten die schrecklichen Gesichter. Wer wollte dem unglücklichen Genie Arnold Kramer beweisen, daß sein Auge falsch sehe? Daß er schlecht zeichnete, behauptete niemand.
Als ich mit vierzehn Jahren die »Fackel« zu lesen begann, da spannten, fanatisierten und entzückten mich alle die Reporter, Librettisten und andere Kobolde; und ich fand sie zum Sprechen, zum Totschlagen ähnlich, obwohl ich keinen der Herren ihres Namens persönlich kannte. Als ich später Personen der Satire kennen lernte, war ich enttäuscht. Sie waren in der Wirklichkeit garnicht so aufregend, so anregend, so strittig wie bei Karl Kraus. Und wirkten lange nicht so komisch, nicht so witzig, nicht so pathetisch. Sie waren der Wirklichkeit lange nicht so gelungen. Dagegen hatten sie klägliche Milderungsgründe aufzuweisen, die er vernachlässigte; vielleicht sogar bürgerliche Tugenden, die er übersah; anerkannte Fähigkeiten, die ihm nichts taugten. Er las nicht ihre Wälzer und belangte sie wegen eines Satzes. Er kümmerte sich nicht um ihr geheimes Herz, das oft noch wie neu war (völlig ungebraucht); dagegen erhaschte er einen Tonfall, der ihnen unversehens einmal entfuhr. Weit entfernt davon, zu Hexenspuk, zur Dämonie sich zu entwickeln, wie Karl Kraus seine Geschöpfe entwickelt, waren sie wohl gar ordentliche Bürger mit Kredit und Ehrenwort, wenn auch vor Gott schuldbeladen genug! Ich verstehe die Wut von Berufsmenschen, die immerzu leisten und aufbauen, ohne daß sie eine rechte Ahnung haben können, was sie da eigentlich zusammenbauen, über einen Unberufenen, der von außen zusieht, ihre Resultate verhöhnt und immerzu bestrebt ist, Fundamente zu entziehen und Zusammenbrüche zu veranstalten. Aber wie talentlos wäre er, wenn er nicht sein eigenes Höllenfeuer in die lauen Geblüte spritzte und die Alltagswelt nicht auflodern ließe im flackernden Gelächter und Funkentanz seiner satirischen Begeisterung.
Seine Satire hätte nicht das unbändige Eigen-Leben, das ihr Glück und ihren Wert ausmacht, wenn sie sich nicht, über die Grenzen der Gegebenheiten hinaus, die tapfersten Übergriffe ins Unbedingte erlaubte. Ein im bürgerlichen Sinne vorsichtiger Satiriker würde sofort zum Winkeladvokaten der Unzulänglichkeit. Der Satiriker ist unbestechlich. Sein großzügiges Vorurteil läßt sich nicht durch mittelmäßige Werte begütigen. Und nähme er die Bagatelle nicht so fanatisch, man hätte ihn längst bagatellisiert. Hätte der böse Lehrer nicht durch das Überkleinliche, durch Leidenschaft bis ins Allerkleinste imponiert: die Klasse hätte ihn davongejagt. »Das ist doch alles nur Gift und Galle, subalterner Neid, tückisches Ressentiment, hämische Scheelsucht« – behaupten gerne Die, welche unter seiner Laune leiden. Aber er schafft Leiden aus Leidenschaft; Karl Kraus ist Künstler. Ich erkenne die Formung der Kunst daran, daß sie auf die gesetzmäßige Beschäftigung mit ihrem Gegenstand eine hohe Lustprämie setzt und der Gegenstand dabei an Wirklichkeit gewinnt. Während sonst auch das matteste Leben die Nachbildungen des Stümpers an Wahrheit überbieten wird. Die Modelle sollten gestehen: sie werden nicht verpfuscht, wenn Karl Kraus sie zeichnet. Wo er ihre Naturwahrheit vergewaltigt, bringt er alles im Überfluß durch die Wahrheit seiner Natur wieder herein. Seine Themen wuchsen an ihm, wurden repräsentativ; der Geist reinigte sich an seiner Kritik; die Natur belebte sich an seinem Wort. Er brachte eine große Ordnung in die kleinen Verhältnisse, indem er mit ihnen aufräumte. Das vermag nicht der Unfug eines Einzelnen, dauerndes Abbröckeln, Benagen, Bestutzen; banaler Witz ohne Ende. Da hätten wir, grenzenlos angeödet, längst gemeutert. Er aber hat uns erfrischt und verjüngt, so jung wir auch waren. Er hat uns Idee eingehaucht und schöpferische Wärme. Seine Epoche sollte zu schätzen wissen, daß sie hier einem Gegner begegnete, der genug Liebe aufbrachte, sie von Grund aus zu hassen. Da gewann die Epoche gerade aus ihren Mängeln die Reinigung der Satire. Als er die Zeit verwarf, vermochte sie sich erst zu finden. Sie war aller Traditionen bar; da erneuerte er die Tradition des großen Pamphletisten. Zwischen den Bruchstücken der Vergangenheit, die wir zerbrochen hatten, und der Zukunft, die wir noch nicht zusammenzufügen vermochten, ein Unverkümmerter, der forderte! Welche Ermutigung für die Werte, sich kräftiger zu regen!
Ich beantrage: streichen wir heute schon die odiosen Namen, welche die inappellable Zeit – grausamer als Karl Kraus – ohnehin fast alle bald gestrichen haben wird. Die Meisten, die er verneinte, als sie öffentliche Hoffnungen waren, haben seither sogar den Anspruch auf Verzweiflung in unbeschreiblicher Weise verwirkt, in unbeschreiblicher Weise – man würde es heute nicht mehr verstehen, wenn ich ihre Namen abschriebe. Nehmen wir die Satire als einen Widerstreit des Satirikers gegen Geschöpfe seiner Erfindung, als ein Spiel der Einbildungskraft – meinetwegen als ein Ringen des Karl Kraus mit seinem Ich um sein Selbst (was es zuletzt ja auch ist)! Lesen wir die »Fackel« wieder wie damals, als wir die Personen der Satire noch nicht kannten und die Selbstdarstellung des Satirikers uns beglückte! Denn so wird sie die Nachwelt lesen, ohne die kleinlichen Rücksichten und Gebundenheiten der Gegenwart, auf bleibende Bedeutung hin. Jene Welt, von der Karl Kraus prophezeit: »Viele werden einst recht haben. Es wird aber Recht von dem Unrecht sein, das ich heute habe.«
Wiens zartester Dichter verkündete soeben das elegische Geständnis einer vergeblichen Jugend, daß in dieser Welt nichts mehr zu erleben sei. Dem feinern Geiste schien nur ein Tor zum Tod geöffnet. Da hatte Karl Kraus, das Weltkind, ein Erlebnis von erschütternder Banalität: die Presse. Er las die Zeitung, und an jenem Tage las er nicht mehr weiter. Er war auf einen Druckfehler gestoßen, bei dem zu verweilen er unbesorgt die welthaften Gegenstände der Politik versäumte. Es wurde seine Manie, es wurde ein Schicksal. Der jugendliche Antikorruptionist hatte sich eben noch über den Mißbrauch der Presse ereifert und eine schlechte Presse zu bessern versucht. Aber schon im nächsten Augenblick zündete in diesem Kopf ein Erkenntnisblitz, der ihn vorerst blendete. Dem genius loci verdankte er die gründliche Erleuchtung. Wien besaß, so erkannte er, die beste Presse, und deshalb die schlechteste! In ihrer Macht und in ihrem Glanze hatte er sie erschaut, die reizvolle, die verführerische Presse Wiens, von der Begabung einer Stadt genährt, deren alte Kultur sie verpraßte, deren neue Geistestriebe sie an der Wurzel aussog. Vielleicht war es wirklich die Berufswahl seines publizistischen Ehrgeizes, die für Karl Kraus entscheidend wurde, als sie ihn bei der Möglichkeit der Presse wählend verweilen ließ. Er erkannte, daß er sich dem Verderben nicht verpflichten konnte. Die Verderblichkeit war das Wesen selbst der Presse! Je lockender sie war, um so verderblicher! Die unterirdischen Interessen der wie eine Litfaßsäule mit Idealen beklebten Zeitung, ihre Funktion als Werkzeug des Kapitalismus, als Hehlerin der Politik, als gängiges Falsifikat der öffentlichen Meinung – das alles mochten auch andre Prediger durchschauen und aussagen. Die äußere Macht der Presse erschien Karl Kraus unbedeutend neben ihrer innern Macht über das Erlebnis und den Geist. Der Mißbrauch der äußern Macht mochte ein würdiger Gegenstand sein für einen Publizisten, der aus dem Übel der Sekunde in die Not der Stunde strebte. Ein Publizist nahm etwa das Wort gegen die Presse. Karl Kraus, der Künstler, konnte das Wort nicht annehmen, wie er es vorfand. Das Wort selbst war ja verdorben. Das Ungeheure, das dem Worte hier geschah, war sein satirisches Erlebnis. Das unfaßbare, formlose Wesen aus Druckerschwärze und Suggestion, das hier zur Macht über den Geist gekommen war, konnte nicht sachlich erledigt, es mußte persönlich genommen werden. Es galt aus einem noch unberührten, unerforschten Chaos eine bunte Welt hervorzuholen. Erst wenn hier der Geist wieder über den Wassern schwebte, war Publizität wieder möglich. Daß Karl Kraus sich der allerbagatellenhaftesten Erscheinung der Presse in Druck auf Papier mit großer Liebe zuwandte, den scheinbar fliegennichtigsten Stoff (denn die Presse ist Eintagsfliegenflug vor der Ewigkeit) formend, damit wandelte er, was uns verflüchtigte und vernichtigte, zu Wesen und Dauer.
Da mußte jeder kleine Schreiber ans Licht, der bisher unauffällig die suggestive Anonymität bewirkt hatte. Das groteske Mißverhältnis zwischen dem einzelnen Handlanger und der Maschine, die er bediente, sollte Figur werden. Man sollte sie sehen, die Männer ohne Kopf, wie sie die Köpfe aller Welt entmündigten. Und die Talente, wie sie allgemeinverständlichen Geist prompt lieferten, ungeborenen, massenhaft produzierten Geist für das Publikum. Männer und Weiber, wie sie den Überzeugungsakt mißbrauchten, um die geschlechtslose Meinung zu bedienen. Da nährte sich die Sensation vom Blute des Privatlebens, und die Gotteswelt wurde Papier. Eine abscheuliche Intelligenz gedieh auf Kosten der Empfänglichkeit. Der Nerv der Dinge war unterbunden, alle Wege der Erkenntnis waren verstopft, damit die sterile Phrase wuchern konnte. Aus tausend satirischen Einzelzügen wuchs blamabel und erschreckend der Mechanismus einer banalen Dämonie, der die einfältigen Werte des Daseins zu erliegen drohten.
Was die Presse sprach, mochte den Tatsachen entsprechen oder gelogen sein. Wie sie sprach, darin offenbarte sich ihr wahres Wesen. Von der Börsennotiz im Jargon bis zum übergoethischsublimen Essay hat Karl Kraus dieses Kauderwelsch von seinem Deutsch erleben und erdenken lassen. Jahrelang durchfeilte er die brüchigen Zeilen, trieb jedes Wort ins Relief und stach jeden Tonfall an. Da wurde auch die greisenhafteste Neuigkeit beredt. Da wurde das Volapük der Jetztzeitgemäßheit blutiger Witz und prophetisches Pathos. Und wie verräterisch erwies sich das saloppe Geschwätz, wie deutlich ward überall zwischen den klaffenden Lettern das Futter der ungewollten Aufrichtigkeit sichtbar, wie hemmungslos plauderte das Unterbewußtsein des Alltags! Der Satiriker, der die Zeitung geißelte, traf die Schreiber, er traf die Leser, er traf die Millionen Sprecher dahinter. Sitte, Recht, Trieb – alles schrie auf! Im Schalltrichter der Presse hallte ja alles wider was sich irgendwo in den verstecktesten Räumen der Sozialität begab – wenn man nur richtig zu lauschen verstand! Die Zeitung war für Karl Kraus jenes Ohr des Dionys, das schwatzhafte Loch an der Wand, das die Geheimnisse preisgab. Die Fäulnis des Geistes und Herzens, die Ohnmacht und Not des Geschlechts, die Ratlosigkeit der verwirrten Begriffe: die fadenscheinige Diktion der Zeitung entblößte die Karikaturen der Werte. Das Lesen und Zitieren der Blätter wurde durch Karl Kraus eine satirische Kunst. Und die Sprachschulden summierten sich zur großen tragischen Schuld der Epoche. Der Pamphletist forderte sie ein – und die Kultur machte Bankrott, lange vor dem Weltkrieg.
Wunderbare Macht der Kunst! Man kann keine Zeitung mehr aufschlagen, ohne überall Karl Kraus wiederzufinden, und noch nie dagewesene Neuigkeiten ereignen sich bereits in seinem Stil. Mögen die Zeitungen seinen Namen verschweigen: sie werden seine Wirkung nicht mehr los. Die Fama verkündigt ihn, indem sie sich in jede ihrer tausend Zungen beißt, wo er unverlöschbar sein Zeichen eingestochen hat. Und als er so die Zeitung gestaltete, gestaltete er zugleich das Publikum. Man kannte das Publikum als jenes undefinierbare Geschöpf, dem die Zeitung seinen Geist liefert; als jene internationale, großstädtische Masse der »Gebildeten«, welche die Zeitung nicht mehr entbehren können und Geist nur noch von der Zeitung beziehen. Nach Karl Kraus wage ich nicht zu entscheiden, ob das Publikum die Zeitung geschaffen hat oder die Zeitung das Publikum. Das Publikum kauft die Zeitung, es liest sie – es schreibt sie auch. Und es lebt sie. Jetzt im Kriege stirbt es sie sogar.
Wie viele Köpfe und Gesichter hat Karl Kraus dem Publikum gegeben! Und wieder war Wien das Glück des Satirikers, die Stadt der »Persönlichkeiten«, welche dem Publikumskultus ihr kurzlebiges Scheindasein verdanken. Die Beliebtheiten konnten sich nicht beklagen, daß der Satiriker sie vernachlässigte. Wie der Tag sie brachte, holte er sie aus den Spalten der Blätter hervor, die Publikumsmenschen, all diese netten und tüchtigen Wiener und Europäer, die einbekannten Repräsentanten des Zeitgeists. Diese Gesellschaft hatte den Satiriker mit Huld bewillkommt – Wien bot seinem besondern Sohne sofort die Schoßkindschaft an. Raisonnieren, Raunzen, Frozzeln gehörte hier seit je zur Lebenskunst. Das Salz sollte das leckere Mahl würzen. Der Leichtsinn hatte es leichter, wenn ihm einer die Gewissensbisse abnahm. Aber die Nachdenklichkeit durfte beileibe nicht in Denken ausarten! Alle Sachlichkeiten: Staat und Kirche, Politik und Justiz, Wissenschaft und Geschäft, traten in dem Reigen dieser Stadt als bunte Figuren auf, der Prophet als Wurstel – warum sollte nicht auch der Satiriker mitspielen? Schlug und vertrug sich doch hier, was sonstwo Todfeindschaft hielt! Wien erwartete von Karl Kraus eine ergötzliche chronique scandaleuse. Er hätte als der ungezogene Liebling der Wiener Grazie alt werden können, rosig noch unter weißem Haar, wie die Lieblinge hier altern. Jede Extravaganz hätte man ihm verziehen, Genie etwa, wie einem Peter Altenberg – Charakter sogar, wenn er auf einer so ungemütlichen, ungefälligen Verschärfung bestand! Und ihm ein hölzernes Schwert gestattet, das leichte Schrammen hinterläßt.
Karl Kraus nahm alle Unliebenswürdigkeit zusammen und wurde ein Spielverderber. Die vielfache Blutmischung war für sein Auge trüb und schmutzig geworden. Der alte Naturlaut klang für sein Ohr immer schwächer, immer hohler. Auch die biegsamste passive Resistenz hatte die neuen, die banalen Zeiten nicht aufzuhalten vermocht. Der Tanz dieses Lebens lahmte. Was da in den Tag hineinlebte, solange der Kulturvorrat reichte, solange dem Raubbau an Talent und Temperament das Rohmaterial nicht ausging: das waren nicht mehr die leichtsinnigen Wiener, sondern die klobigen Ausbeuter des Wiener Leichtsinns. Der Satiriker trieb sie an, mit den schönen Resten rascher fertig zu werden! Zwischen Skepsis und Drah-Laune, zwischen Stimmung und Katzenjammer, während die häßlichen Parasiten sich überaßen und die Gaukler der Politik sich den Mund nicht weniger fett und voll nahmen, würgte der Sonderling an der trockensten Existenzfrage nach dem täglichen Brot des Lebens. Karl Kraus rückte die Vision einer riesenhaften Ernüchterung an den Horizont dieses ewig blauen Himmels: Berlin! Berlin, dieser Rausch von Besonnenheit, diese exakte Phantastik, dieses zukunftsschwangere Chaos von Ordnung! Freilich, was die Reize Wiens nicht vermocht hatten, konnte auch den Tüchtigkeiten Berlins nicht gelingen: den verzweifelten Hunger zu sättigen nach dem fundamentalen Geist, nach dem elementaren Leben. Der Fragende stand schließlich an jenem Abgrund, der ganz Europa verschlingen sollte, ohne doch ausgefüllt zu sein.
Sie sprachen von Kultur und meinten bestenfalls Geschmack. Sie verfeinerten die Nerven und verzärtelten die Reize, aber das Gehirn blieb leer und das Herz roh. Sie rühmten sich einer unheimlichen Routine, mit der sie um die Ecken und Kanten der Welt stets unverpflichtet herumkamen. Diese Kinder der Zeit waren so intelligent geboren, daß sie nichts mehr zu empfinden brauchten, um doch alles besser zu wissen. Nichts Menschliches war ihnen fremd. Was ihnen fremd geworden war, verpönten sie als unmenschlich: das Entweder-Oder, die Grenze, das Wesen, die entschlossene Behauptung und Vertretung. Sie wollten das Eintönige – Ja oder Nein! – nicht mehr hören: sie mußtens am eignen Leibe fühlen. Sie hatten vergessen, daß die Welt aus Tat und Leid gemacht ist: der Satiriker tat, daß sie litten. Sie wiegten sich in Gleichgewicht ohne Schwergewicht: er belastete sie. Sie schwankten zwischen Gut und Böse – er entschied sich für das Böse: für den herzhaften Angriff, den passionierten Tadel, den stürmischen Widerspruch, den verbissenen Gegensatz.
Wir mitschuldigen Enthusiasten wissen, daß es nicht mehr weiterging. Wir hatten versucht, mit dem Lobe die Löblichkeiten hinaufzutreiben. Wir hatten das Lob gepachtet, wir hatten es verroht. Wir lobten in Saus und Braus, auf unbeschränkten Kredit, ohne mehr zu merken, daß wir irgend einem schlichten Ding Genauigkeit schuldig blieben. Es war so lange Umwertung gespielt worden, bis die Werte kaput gegangen waren. Das Adjektivum, das alte brave Eigenschaftswort, war darüber wahnsinnig geworden. Wir türmten den Parnaß auf den Olymp, wenn eine Maus hervorkam, und wir tobten in einem Mauseloch, um die Geburt des furchtbaren Löwen zu feiern. Jeder Lehrling schmiß mit Farben und Essenzen, ohne daß ein Ladenhüter ihn beim Schöpfe erwischte. Jeder dumme August zerdröhnte die Posaune – kein Stallmeister fing ihn mit der Peitsche ab. Unser Lob war schließlich die bare Verzweiflung. Es wollte kein Hund so länger gelobt sein!
Wohin die goldene Vorzeit, da wir Knaben den Lessing verschlangen! Wieviel Saft quoll aus der reinlichen Trockenheit! Da war eine gesunde Wurzel, aus der wuchs ein fester Baum und trug Geistesblüte. Die Zweige waren grob, die Blätter fein, das Licht spielte gedankenvoll in der Krone. Karge Sprache, reicher Sinn! Der Kritiker unsrer Kindheit hatte Lob und Tadel auf dem rechten Fleck. Sein starkes Herz schlug Liebe oder Zorn – so kam einst der deutsche Stillstand in Schwung. Das Urteil eines Mannes rodete Unkraut aus – deshalb war Kritik eine erbauende und auferbauende Tätigkeit gewesen.
Seither war es ein verdächtiges Gewerbe geworden, Worte zu machen. Man schämte sich bald, Guten Tag zu sagen. Die impressionistische Wortkrankheit, eine Epidemie, hatte Gedanken und Gefühl der Sprache aufgefressen. Solchen Schwund hätte die lebendige Anschauung nicht allzu lange überlebt. Die Schriftsteller irrten – liebenswürdig, wie Frauen, tödlich, wie Kinder irren –, wenn sie die unbequemen Superioritäten Logik und Ethik abzusetzen beschlossen, um den fünf mal fünf Sinnen und Sinnigkeiten die anarchische Freiheit zu geben. Die Sinne verarmten ohne den Sinn. Man legte sie bloß, man riß sie auf – sie verbluteten. Man schrieb schließlich mit weiß Gott was: mit Nerven, mit Weiberhaaren, mit Wolken, mit dem Pinsel, mit dem Violinbogen, dem Meißel – nghur nicht mit der Feder. Es erfolgte ein Gallimathias. Es kamen die sieben fetten Jahre der Sprachverwirrung, des Wortschwindels, des Potemkinschen Geistes. Sie sind noch nicht zu Ende.
Der Teufel sollte dieses Unwesen holen! Ein solcher Teufel war Karl Kraus. Er kam und schrieb mit einer Feder, welche scharf schrieb wie eine Feder. Er war von zu harter Konstitution, um sich in den modischen Brei vermengen zu lassen. Er war zu scharfsinnig, zu genausinnig, als daß man ihn hätte mit Gerüchen und Geschmäcken und dem verwirrten Widerhall halber Töne abfertigen können. Sein blanker Witz durchschnitt die aufgeregte Flut der Sentiments wie ein gepanzerter Kiel. So geschehen in der Gründerperiode des neuen Literatengeistes. Einer bewegte sich im Kaffeehaus der Neuwiener Literatur – ein Zusammenstoß, ein Krach: und der ganze Kram lag demoliert unter den Trümmern des fidelen Gefängnisses.
Die satirische Wirkung des Karl Kraus war so reinigend, daß er wieder zu loben vermochte. Kaum ein zweiter deutscher Publizist hat so wie er dem Lobe die Unschuld zurückgegeben. In seinem Bereich wurde das Lob wieder zum Ereignis.
Gerade deshalb, weil es das Ausgesparte seines Tadels blieb; weil die Würze seines Tadels es frisch erhielt. Wenn einer, der nichts gelten läßt, eine Ausnahme macht, kann er sie umso entscheidender zur Geltung bringen. Das ist der Vorzug der Anti- Autorität. Und stand nicht der Satiriker hinter jedem Lob bewaffnet bis an die Zähne, die er zeigte?
Ich würde es jederzeit wagen, für die paradoxe Behauptung: der Satiriker sei ein Genie des Lobens, den Beweis anzutreten, und könnte die Satire erschöpfend beschreiben als die Kunst, zu loben. Ihr Tadel ist ja nichts als perspektivisches Lob, ihr Aberkennen durchaus nur die unterscheidende Gestaltung ihrer Erkenntnis vom Anerkennenswerten. Die Satire entwertet, auf daß richtiger gewertet werde; sie ist in jedem Augenblick die Kunst der wertenden Leidenschaft. Man erfühle die ursprünglichste Regung, man besinne den naiven Zustand, woraus die Tat der Satire entspringt: der Eiferer gehorcht dem moralischen Antrieb, das Echte gegen das Falsche zu erhärten und zu bewähren. Durch die Sprache des Karl Kraus geht ein steigernder Grundton, die Erbärmlichkeit erbarmungslos überbietend. Und seine Betrachtung des Kleinen gilt der Größe. Man belausche den Ton, wenn er sich in direktem Lob genug tut, und man wird reine, einfache Heldenverehrung zu hören bekommen. Der Satiriker seufzt: »Es ist halt ein Unglück, daß mir zu jedem Lumpen etwas einfällt. Aber ich glaube, daß es sich immer auf einen abwesenden König bezieht.« Heldenverehrung im Zerrspiegel der Alltäglichkeit. Der Satiriker ist ein pathetischer Mensch. Sein Witz entsteht, wenn sein Pathos in die Klemme der Trivialität gerät und sich freimacht mit einem Ruck, der die Trivialität zur Satire umstülpt. Man denke an Andersens Märchen vom kleinen Kay, dem ein Splitter des Teufelsspiegels mitten ins Herz gedrungen ist. Ein Geschenk dieser Art erlegte die Natur dem Satiriker auf, indem sie ihm seinen überscharfen Wirklichkeitssinn eingab. Aber sie verlieh ihm auch die fanatische, polarisierende Idealität. Wenn er die Welt in jener grausamsten Verkürzung erblickt, die in der Realität nur noch den Unwert, den Wert aber nur mehr in der Idee zeigt, hat er zugleich den Blickpunkt des Humors erreicht: die Idee strahlt erbarmend in die Realität zurück.
Das direkte Lob bedeutet einen Ruhepunkt in dieser dramatisch bewegten Gegensätzlichkeit, in diesem antinomischen Gedankenspiel, das die Satire als ihren heiligen Ernst betreibt. Der Satiriker läßt die Hände sinken, wenn er einfach anerkennt; das Maß ist erfüllt, er hat nichts zu tun und wird für einen Augenblick zum Privatmann. Die Wage der Gerechtigkeit steht still, mit ausgeglichenen Schalen, wenn ein Gerechter vorübergeht! Und wie lange hallt der liebe Schritt nach! Im ersten Jahr der »Fackel« hat Karl Kraus vor reiner Gesinnung, etwa vor Joseph Schöffel oder Victor Adler, ehrend den Degen gesenkt. Seither kein Wort! Politik war ihm das Unbegreifliche geworden, Gesinnung ein Axiom geblieben. Aber heute noch spüre ich, der ich damals als Knabe horchte, den wohltätigen Ernst einer Einsilbigkeit, die respektiert. Das dauernde Schweigen, womit Karl Kraus die Tätigkeit eines Mannes wie des Sozialisten Victor Adler seither umgab, ließ ohne Ende jene eine ferne Silbe der Achtung nachklingen.
Es gibt in seinem Stil Augenblicke, da empfindet man, wie der Satiriker eine satirische Gelegenheit ungenützt entläßt, weil eine alte Treue ihn bindet. Dem Leser, der sich auf die feinen Grade dieser Verantwortlichkeit eingestellt hat, entgeht es nicht, wenn Karl Kraus die Fühler seiner Satire ausstreckt, um sie leise wieder einzuziehen. Er kündigt an, er mahnt, er wahrt etwa das Niveau einer Persönlichkeit gegen eine Äußerung der Person (wie bei Gerhard Hauptmann, dem Kriegslyriker). Wenn aber Karl Kraus verachten muß, wo er verehrt hatte, wenn ein geistiges Bündnis in Kriegszustand übergeht, dann ist der heilige Krieg der Satire ausgebrochen; dann fühlt der Leser mit freudigem Erschrecken die Überwindung, die es eine Liebe gekostet hat, in Haß umzuschlagen, und daß nur die unerbittliche satirische Notwendigkeit so überwinden konnte – fühlt es an der begeisterten Rache, welche als ein wildes Wasser, dem ein Damm entzogen wurde, hereinbricht, sodaß die Satire von Bildern und Gedanken, von den Springfluten des Witzes und der Stromkraft der Pathetik überquillt.
Man erzählt oft und ausdauernd, daß Karl Kraus, der Antijournalist, sich in halbwüchsigem Alter als Reporter versucht habe. Wenn es wahr ist – es war ein folgenschweres Experiment! Aber ich möchte lieber rekonstruieren, welche Feste der Begeisterung dieser Knabe gefeiert, wie er die Nachklänge des alten Wien, die seine Kindheit streiften, in die Seele gesogen haben mag. Alle Götzenanbetung Wiens, die heute in tausend Couplets kreischt und dudelt, in tausend Feuilletons schmatzt und säuselt, ist ein ohnmächtiges, herzloses Gelalle neben dem Abschiedsgruß, den der Satiriker dem letzten Wiener, Alexander Girardi, erschüttert nachrief, als der »Nur-für-Natur«-Mensch der modernen Operetten-Börse resigniert den Rücken kehrte. Was in Raimund volkstümliche Einfalt war, was in Strauß und Millöcker und Suppé Laune zauberte, was sich in Grillparzer erhöhte und in Stifter vertiefte: kein Austriacus hat es zarter und glühender paraphrasiert. Wehe dem, der diese holden Gewesenheiten respektlos antastet! Ein Nachkomme, der unsagbare Verluste betrauert, verteidigt jede gute Wiener Stunde, die ihm ans Herz schlug, erbittert gegen die Anmaßungen vertierter Erben. Wenn er vom alten Burgtheater spricht, wird sein Wort zur Hymne, und niemand hat der Jugend, die es nicht selbst gesehen hat, einen gleich erhabenen Bericht geliefert. Die Halbgötter sind dahin; nur dieser Zeuge vermag uns noch einen Begriff zu geben von Riesenmaßen, die wir sonst nicht mehr fassen könnten. Wenn seine Erinnerung von jeder Vollgestalt der entschwundenen Bühne zehrt, verhungern wir mitten im Überfluß unsres Theater-Raffinements. Ein staunendes Wohlgefallen lenkt unser Gehör nach dem feierlichen Echo, das in der einen Kehle zurückblieb. Und wir fühlen schmerzhaft, was da verging: eine Landschaft und eine Gesellschaft. In der Maienblüte seiner Sünden war dieses Wien der Natur näher gewesen als dem Geist. Nun, der Natur bar geworden und der Geistlosigkeit verfallen, wollte es immer noch den schönen Schein wahren, wo doch seine Wirklichkeit der Bankrott eines Reiches war, das seine Naturschätze nicht zu verwalten und seine Völker nicht zu entwickeln verstanden hatte, und dem der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus ebenso wenig gelungen war wie der Umschwung einer Hausmacht: Politik, die den wüsten Konkurrenzkampf der Nationalitäten verbrecherisch ausnützte, indem sie sie gegeneinander ausspielte, in einen freiwilligen Bund zu ihrem wahren Selbst erwachter Stämme.
Es könnte immer noch die Teufelei eines Weltfeindes sein, daß einer seiner Stadt jene Feste gibt, die nicht wiederkehren. Aber hat er nicht geschwelgt und uns schwelgen gemacht, wo immer in diesen Tagen, von Liliencron bis Else Lasker-Schüler, eine innere Melodie erklang, die sein kritisches Ohr bezwang? Wo immer in dieser naturentblödeten Zivilisationswüste eine Echtheit ihm zu Herzen drang? Hat er nicht, als er die Neuwiener Literatur demolierte, den Rhapsoden und Troubadour des zeitgenössischen Wien, Peter Altenberg gerettet? Eine ideale Rettung, die zugleich mit dem Wunder der Dichtung das Lebenswunder des Dichters rettet, das zwischen Humor und Prophetie die sonderbarste Wiener Existenz führte. Hier war schonungslose Kritik von tiefer Ehrfurcht durchschauert, und der Satiriker konnte nicht genug danken für die Wohltat, daß es im eigensten Bereich seiner Satire eine Verzerrung gab, in der eine unbändige Natur sich auslebte. Wie gerne hätte er einen zigeunerischen Reichtum zartester Eingebung, der sich sorglos an die Skizze vergeudete, neben all der bürgerlichen Dürftigkeit, die mit sich sparte, und endlose Wälzer zusammenknauserte, aus ganzem Herzen überschätzen wollen, wenn es nicht seine Mission gewesen wäre, geistige Zucht zu halten! Ach, unter all den unrechtmäßigen Genießern suchte dieser Einzige, P.A., die Seele des Genusses. Daß sie an seiner Zuspät-Romantik schmarotzten, büßte er mit dem Lose, ihr Clown zu sein. Aber weil er, diesem Völkchen ewig zu früh, mitten in Nachtschwärmen auch das wahre Heil tagen lassen wollte, weil er auch Besinnung predigte und Umkehr auf neuen Wegen erstrebte, mußte er sich überschreien und überschlagen, um gehört und bemerkt zu werden. Wo das Tam-Tam dieses Jahrmarktes ihn ansteckte, verfiel auch er dem Satiriker. Denn wo es not tut, straft der Satiriker auch seine Dichter, mit Innigkeit und Galanterie; er ist zur Besonnenheit verdammt, sie aber müssen nicht wissen, was sie tun; sie wahren sich das Vorrecht, Kinder geblieben zu sein, während ihn eine harte Schule unter die Erwachsenen eingereiht hat.
Umso wehrhafter nimmt er die Partei der kühnen Idee, der gefährdeten und gefährlichen Schönheit unter den Erwachsenen. Wie ein Mann aus einem Gedanken eine entscheidende Konsequenz zieht, das hat er, vor die Offenbarungen Otto Weiningers gestellt, im moralischen Sinne nicht weniger vorbildlich dargetan als Otto Weininger selbst. Otto Weininger entschied sich, am äußersten Punkte der Geschlechtsmoral angelangt, für den Tod, Karl Kraus für das Leben. Er trat schützend vor das Andenken des Toten, der sich gegen die Natur geopfert hatte, und ging hin und feierte die Natur. Und mit welch einer aus innerstem Erlebnis vorbrechenden Geste bot sich Karl Kraus an Stelle Frank Wedekinds dem fauligen Gelächter dar, das den tragischen Possenreißer begeiferte! Man hatte den Boten, der das letzte Röcheln kapitalistisch erdrosselter Leidenschaft überbrachte, übel empfangen, Karl Kraus übernahm die Botschaft. Die denkwürdige Uraufführung der »Büchse der Pandora«, die er veranstaltete, war ein Selbstbekenntnis von solcher Wucht und Würde, daß der intime Skandal der Geilheit in eine Weihe umschlug, zu deren Bereitung der triumphierende Eros mit dem erliegenden Ethos zu wetteifern schien.
So wurde das Lob des Karl Kraus beides: Ereignis des Gedankens und Ereignis der Tat. Er lobte als ein Mensch, zum Irrtum berechtigt, weil zur Erkenntnis berufen. Sein Lob konnte maßlos werden an Temperament, stets blieb es keuschen Sinnes und karg im Wort; stets ließ es die lebensvollste Deutung zu und holte seine Kraft aus der Bedeutung. Man kann von diesem Nörgler lernen, wie ein Mann zu ehren, eine Frau zu preisen ist; wie man das Wort eines Dichters zitiert, sodaß es sich ungeahnt steigert; ein Philosophem ins Leben stellt, damit das Leben daran wahrer und würdiger werde. Zeitgenössische Geister, die ihm führend vorschwebten, wissen, wie er zu folgen, zu lernen, zu danken vermag. Neidlos erneuerte er sich mit den Neuerern. Und war nur deshalb unfähig, Mitarbeiter zu halten und als Lehrer zu wirken, weil es – außerhalb des religiösen Kultus – wohl einen rastlos Verzehrten des Geistes geben kann, aber keine Mitverzehrten; weil das Äußerste seines Standpunkts und die Spannung seines Temperaments sich ebenso wenig mitmachen ließen, wie sein unerbittliches Höhertreiben der Form; weil keine weichere Seele (und keine härtere) den fanatischen Argwohn des Vereinzelten zu mildern und kein Schüler seine subjektive und objektive Wertgier auf die Dauer zu befriedigen vermochte. So war er für die Einsamkeit bestimmt. Und wird keine Tradition hinterlassen. Wohl aber ermöglichte ihm eine nie aussetzende Verbindung des Gefühls, heroische Traditionen zu halten und zu erhalten, bei qualvoller Bewußtheit, empfänglich zu bleiben wie ein Jüngling, reiner Geistesquellen nicht zu ersättigen, und der leidenschaftlichste Verteidiger des Lebens, der es noch in der Verlorenheit segnet, dem stummen Hinschwinden ohne Klage das anklagende Wort leiht und nie ohne erbitterten Protest den lebensverblendeten Verbrecher einem froschblütigen, herzabdrückenden Richter überläßt.
Dieser mitreißenden und mitgerissenen Jugendlichkeit seines Empfindens flogen denn auch die jugendlichen Herzen zu. Oft verführt der Lästerer die Jugend, aber nie der unfromme Lästerer. Bei Karl Kraus genoß sie in vollen Zügen, auf den ersten schönen Durst, die Satire: war doch Begeisterung vom Grunde des Bechers her durchzuschmecken – ward doch hier den neuerwachten Seelen unbedingt zu Mute.
Ich habe noch nicht von Karl Kraus dem Juristen gesprochen, dem Beflissenen des öffentlichen Rechtes, der entschlossen und befähigt schien, in den alten Schlendrian eine neue ratio zu bringen, indem er dem Unwesen auf exakt juristisch beizukommen trachtete. Grade diese Vordergrunds-Erscheinung der ersten Kampfjahre der »Fackel« und ihre gesetzesreformatorische Meinung hatte in den ernsten Leuten trügerische Hoffnungen erweckt. Was darüber sofort unbändig hinausging: das Zuviel an Offensiv-Geist, das Satirische, Ästhetische, die besondere Art eines Staats- und Weltbürgers, Personenwerte zu über- und unterbieten, und Gedanken anzuschauen, indem er Karikaturen sah – das mutete zwar die Wiener an und befremdete die seriösen Leser, aber es war doch nur ergötzliche Zutat. Man glaubte, ein satirisches Talent vor sich zu haben und hatte es mit einem satirischen Charakter zu tun; man ahnte nicht, wie böse sich diese Schärfe noch verschärfen sollte, und daß diese Spitze, auf das Herz der Epoche zielend, bis zum empfindlichsten Punkt des Lebens eindringen werde. Die eindimensionale grade Linie, in der man den Publizisten vorwärts bewegt sehen wollte, wurde durch manchen entscheidenden Knick zur Entwicklung ins Zwei- und Dreidimensionale abgelenkt, und auch noch vor der vierten Dimension gab es keinen Halt. Man erlebte an Karl Kraus die Eigenart einer Reflexion, die, je heftiger sie nach außen fuhr, umso bohrender nach innen, in den Seelenkern, zurückschnellte.
Den Juristen Karl Kraus, der aber schließlich die Berufung gegen so viele Justizmorde und die Berichtigung so vieler Gesetzesirrtümer auf die Tagsatzungen eines nächsten Daseins sorglos verschob, kennzeichnet nichts so erschöpfend, wie die Besonderheit des Rechtsgutes, das er mit dem ganzen Fanatismus seiner satirischen Praxis verfocht und verdeutlichte: des Privatlebens. Wenn man dieses Rechtsgut auch in genaue Begriffe faßte: man erschöpfte damit nicht die gradezu mystische Tiefe seines Gefühlsinhaltes, und je strenger, je knapper Karl Kraus die gesetzliche ratio berechnete, die es schützen sollte, umso überquellender wurde der irrationale Reichtum frei, auf den es eigentlich abgesehen war. Das Privatleben konnte der dürftige Anteil einer Person sein oder die verschwenderische Fülle einer Persönlichkeit. Man rettete in ihm bescheidene Reste, oder es gehörte die Natur und die Kunst eines Künstlers dazu, um seine unfaßbaren Schätze zu bergen. Die entscheidende Wendung bei Karl Kraus, um derentwillen er mir zum großen Beispiel wird, ist: daß immer ungehemmter, immer selbsttätiger den freien Raum, den er für das Privatleben schuf, seine lebendige Persönlichkeit ausfüllte. Der Rechtsbegriff war der feste Punkt, von dem aus er zuerst die äußere Welt der Mängel, dann aber die innere Welt der Werte bewegte. Was aber gelten sollte, mußte intensives Privatleben gewesen sein oder werden können. Die Presse korrumpierte das Privatleben: sie lähmte, sie tötete es durch Bespiegelung in einem gefälschten Bewußtsein und durch Vergiftung der Sprachquelle. Politik, wie sie war, ein unmenschliches Kaleidoskop untermenschlicher Interessen, konnte nicht Inhalt und Erfüllung eines Privatlebens sein. Kunst sollte endlich wieder reine Empfindung werden, die allein ein Privatleben nährt, sodaß es wächst. Welche Eifersucht, welche Gegenwehr hielt den Eiferer in Atem, der für uns alle eiferte? War sein Privatleben so reizbar, so empfindlich, so verletzlich? Oder war es so reich, so kostbar, so besonders? Nie hat Karl Kraus heftiger reagiert, als da es um das Privateste, um den Nerv allen Lebens, um das erotische Erlebnis ging.
In dieser Angelegenheit des Blutes, welche die Satire des Karl Kraus in ihre wildesten Paroxismen trieb, wurde zugleich sein heißestes Pathos geboren. Die tierische Brutalität der Ereignisse, Dummheit gepaart mit Grausamkeit, bedrängte eine fühlende Natur und entriß ihr die lebenkrasseste Drastik und eine unaufhaltsame Willenswucht. Über dem brodelnden Sumpf der großstädtischen Geschlechtspraxis, in der erstickenden Atmosphäre des Alltags, daraus jeder geistige Ozongehalt geschwunden war, entlud sich ein moralisches Gewitter ohnegleichen; dem diabolischen Wetterleuchten des Blitzes folgten die rollenden Donner der Pathetik, wie sie die Epoche sogar auf ihrer tragischen Bühne zu hören nicht mehr gewohnt gewesen war. Die fulminante Reihe jener Artikel begann – jener flammenden Plaidoyers für Sittlichkeitsverbrecher, an denen das Verbrechen der Sittlichkeit verübt wurde – das Buch »Sittlichkeit und Kriminalität« entstand als ein Produkt konzentriertester rhetorischer Schriftstellern, die heißeste Lebensnähe mit der freiesten Meinung verbindend: jedes Argument zugleich eine Pointe, jedes Wort scharfsinnig und für die Dauer geprägt, jeder Satz ein Sprung und ein Schlag und eine Erledigung; ein Durchbruch der Logik, eine Revolution des Instinkts. Was damals wild, ja zuchtlos anmutete, was als eine schier unbegreifliche Ursprünglichkeit des Fühlens reizte und wie das zerstörende Denken eines Lästerers ängstigte –: wer es heute nachliest, wird klassische Lesestücke und die grundlegende Leistung eines Sozialkritikers, zugleich mit dem befreiten Herzschlag des Selbstbekenntnisses, finden. Und nie handelte der Jurist nüchterner und zielbewußter als hier, bis auch seine Besonnenheit vom empörten Element mitgerissen und verschlungen wurde.
Das Programm – reinliche Scheidung der Sittlichkeit von der Kriminalität –, welches in diesem selbständigen Kopfe fertig geworden war, äußert sich etwa in solchen Sätzen: »Das ›Rechtsgut der Sittlichkeit‹ ist ein Phantom. Mit der ›Moral‹ hat die kriminelle Gerichtsbarkeit nichts, hat nur die des Bezirksklatsches zu schaffen. Was die Justiz hier erreichen kann, ist der Schutz der Wehrlosigkeit, der Unmündigkeit und der Gesundheit. Auf diese noch arg verwahrlosten Rechtsgüter werfe sich die Sorge, die heute das Privatleben von Staats wegen belästigt.« »Eine Gesittung, die der zwischen Arbeitstier und Lustobjekt gestellten Frau gleisnerisch den Vorrang des Grußes läßt, die Geldheirat erstrebenswert und die Geldbegattung verächtlich findet, die Frau zur Dirne macht und die Dirne beschimpft, die Geliebte geringer wertet als die Ungeliebte, muß sich wahrlich eines Strafgesetzes nicht schämen, das den Verkehr der Geschlechter ein ›unerlaubtes Verständnis‹ nennt.« »Jene Ethik aber, die (die wahren) Rechtsgüter nicht achtet, sondern gefährdet, könnte man die ›blinde Ethik‹ nennen.« Mit so blinder Wut wüteten die »Hexenprozesse« der Sitte, Prozeduren von hoher Not und Peinlichkeit, die Sünde, den Genuß, ausjätend, um Elend und Schande zu pflanzen. Ein Trifolium von Institutionen: die lebensfremde Justiz, die sensationslüsterne Presse und die pharisäische Gesellschaft vereinigten sich, nicht: um dem Individuum nach Möglichkeit seinen wohltätigen Wahn, seinen Wunsch, seine Wonne zu garantieren, sondern: um es in sein menschlichstes, unentrinnbarstes Bedürfnis wie in eine Falle zu locken und dortselbst zu ruinieren. Und siehe da: ein so verdummender Nebel liegt über diesem irregeleiteten Tun, daß die Leuchten der Wissenschaft (heillose Heilkünstler und entrechtende Rechtsvertreter!) nicht weniger trüb brannten als die lichtlose Enge im Gehirn einer alten Klatschbase. »Paragraphen und Phrasen werden mit einer Materie fertig, an der Kunst und Psychologie nur stümpern.« Ein Genius wie Oscar Wilde wird »für eine Laune seiner Nerven schändlich hingemordet«. Huren und Prinzessinnen finden sich am Schandpfahl, den die domestizierte Geilheit des Publikums umdrängt. Die mißbrauchte und entrechtete Kreatur seufzte noch aus der Letzten von ihnen, und der ästhetische Wert ging in Fleisch und Blut den öffentlichen Passionsweg. Und vielleicht war nichts von alledem trostloser, als daß, so gefördert, die kapitalistischen Formen der Liebe, Ehe und Prostitution, immer formloser und immer leerer an menschenwürdigem Inhalt wurden!
Und es zeigt sich hier jedem, der mit den eigenen Augen sehen will, daß der so wieder lebendig und überlebensgroß gewordene Begriff des Privatlebens, ins Geistige erhoben, ausreicht, um mit der Sünde auch die Erbarmung, mit der Hingabe auch die Entsagung, mit dem Erlebnis auch die Treue und mit der Brunst auch die Keuschheit zu umfassen: daß, wer ein ressentimentales Strafgesetz von den Bezirken der Nerven und der Seele zurückweist, dem göttlichen Richter seine Kompetenzen wiedergibt und solcherart von einem Freigeist mit der individuellsten Freiheit auch die religio gerettet werden kann. Es ist zuletzt die Sittlichkeit selbst, die sich von einer Kriminalität wird reinigen müssen, zu der sie sich von der Sitte hat verführen lassen.
Kein andrer hat so wie der boshafte Karl Kraus in diesen Aufsätzen ein werktätiges Erbarmen mit dem nackten Leben, mit dem von der Zivilisation drangsalierten animal humanum bewährt. Mitleid, fieberndes Mitleid zerriß hier in Raserei den Schleier der Maja, den sonst der soziale Hochmut dicht um die niedrigen Gestaltungen des allgemeinsamen Triebes wickelt. Aber zuletzt entscheidend war für Karl Kraus, daß auch noch bei dem banalsten dieser Anlässe eine subalterne Gesinnung sich mit rohen Fäusten am Zauber des Eros vergriff. Die Rachsucht des Satirikers war schrecklich. Der Jurist ward zum advocatus diaboli. Wie die eifervolle Norm die sexuelle Pathologie zu bewältigen suchte, das bot er dem blutigen Gelächter als ein schaudervolles Spektakel dar; und das Duell zwischen dem Gesetz und der Nervenbeschaffenheit artete in eine grausige Knockabout-Nummer aus. Immerhin: den Nerven war durch sexuelle Routine, vielleicht auch durch ein routiniertes Gesetz zu helfen. Dem Eros aber konnte kein reformatorischer Vorschlag dienen, ihm half nur künstlerische Gestaltung. Und, ein Wunder, indem der scharfsinnige Pamphletist die Natur sehnsüchtig umarmt hatte, war er in einen Dichter verwandelt worden. Sein rationalistischer Todfeind hat Recht behalten, der in jenen Tagen als Conferencier eine Frage aus dem Wiener Publikum nach dem »Kritiker Kraus« mit einem feinen bösen Lächeln erledigte: »Kritiker?! Sie meinen wohl – Dichter?!« Ja. Denn der verführerische Sinnentrug, den die von Karl Kraus auf die Füße gestellte Gesellschaft von Kupplern, Zuhältern, Huren ausstrahlt, kann kein Denkprodukt sein, sondern ist und bleibt gedichtet. Noch diese erbärmliche, deklassierte, notdürftige Welt saugt mit ihren siechen Wurzeln den unerschöpflichen Genuß, den Lebensquell der Schöpfung, und das verlorene, verwelkte Blut schmeckt süß. Immer bunter, blühender, belebten sich die armen, verzerrten Bilder der Lebensfreude, immer kühner formte dichterische Unmittelbarkeit die Gesichte einer verlorenen Welt, sodaß kümmerlichste Reste noch ein gewesenes Paradies ahnen ließen. Und die Beschwörungen eines Lebenskenners und Lebensanwalts, die in dem Buch »Die chinesische Mauer« nachzulesen sind (»Der Prozeß Veith«), erwarten keine Hilfe mehr von einer befreienden Rationalisierung des Staates, von einer wohltätigen Ernüchterung der Justiz: sie beklagen und erneuern eine unendliche Illusion, von der das nach Glück und Liebe hungernde, vom Abglanz der Schönheit bezauberte Herz des Menschen nie wird lassen können, auch nicht, wenn der Mensch seinem Herzen die äußersten Martern der Widernatur auferlegt. »Ein Sittlichkeitsprozeß ist die zielbewußte Entwicklung einer individuellen zur allgemeinen Unsittlichkeit, von deren düsterm Grunde sich die erwiesene Schuld des Angeklagten leuchtend abhebt«, hieß es in »Sittlichkeit und Kriminalität«. Dieses Leuchten wurde nun immer reiner, immer mächtiger gesteigert. Und immer größer, immer wilder wuchs der von solchem Unsinn und Unrecht aufgepeitschte Zeuge, der Eiferer, der satirische Prophet – Aug in Aug mit der Epoche; ihr Wohltaten anbietend, die sie verschmähte, ihre tiefste Not ergründend, die sie ableugnete, Trost, Gnade, Milde, Kindlichkeit, Unschuld, Ritterlichkeit vergeblich verschwendend. So sanft konnte er sein und so grausam! Als unerbittlicher Gläubiger trat er dem modernen Menschen gegenüber: dem Herrn über die Technik, den aber die Natur, die scheinbar bezwungene, um ihren einfältigen Segen gefoppt hat; dem allwissenden Intellektuellen, der ahnungslos und gottverlassen vor dem primitivsten Geheimnis stockt; dem weltbesteuernden Geschäftemacher, aber Bankerotteur der innern Welten! Die Reflexion des Karl Kraus, die sich so aus all den kläglichen Einzelfällen sammelte, vollzog den radikalsten ethischen Bruch mit den Geltungen der Zeit, der sich ausdenken läßt. Sie trat mit einem entscheidenden Schritt aus dem ursächlichen Zusammenhang der Entwicklung. Sie wagte den kühnsten Sprung der Paradoxie und war auf dem Boden einer reinen philosophischen Einsicht angelangt, an der Grenze des Möglichen. Diese Kunst des Widerspruchs ward überhaupt zum äußersten Grenzfall unsres Lebens, als sie unsre phantasielosesten Fakten zum phantastischen Zeitgemälde aufbaute und mit der »chinesischen Mauer«, dieser modernen Apokalypse des Eros, diesem erotischen Weltuntergang der weißen Kultur, schlechterdings übereuropäisch wurde und die Schauder und die Seligkeiten einer prophetischen Vision erreichte, indem ein verzweifelter Humor die Antihymne vom Einbruch der chinesischen Erobererhorden, den satanisch perversen Schreckens wünsch einer »gelben Hoffnung«, welche die weiße Hoffnungslosigkeit erlöst, zum orgiastischen Rachejubel der beleidigten Natur verdichtete! Der Visionär stand genau dort, wo der tolle Größenwahn unsres verblendeten Weltfriedens an unsre abgründige Ohnmacht und die unaufhaltsame Katastrophe grenzte. Dort stand er, warnte und forderte, fragte und schrie, und tobte in heiligem Wahnsinn! Und sein Wort war – ein vorlautes Fernbeben unter unsrer europäischen Gottähnlichkeit.
Man erinnert sich: Als die Kunst der Gegenwart beikommen wollte, da mußte sie eine neue Art der Naturwahrheit anstreben und nannte sie Naturalismus. Das war damals, als die Kunst sich der Banalität zu erbarmen und dem modernen Menschen sogar eine soziale Frage – diese Kapitalsfrage im Doppelsinn des Wortes – zu lösen versuchte. Von dieser Wirklichkeit gewürgt, schrie die Kunst auf, mit einem entsetzlichen, unartikulierten Schrei, der in allen Tonarten von unsrer Bühne herab erklang, als der gellende Kampfruf des aufmarschierenden Vierten Standes und, intim gedämpft, als die zahmere Klage der Kultur besitzenden Stände, als Seufzer der schönen Seele, die nivelliert wurde; bis, zuletzt, heute, die Not der Kunst in den röchelnden Gurgellauten einer neusten Berliner Lyrik erstirbt, dem häßlichsten Gelalle, das je einer zerbrochenen und zerfetzten Leier entrungen wurde. Er ist zweifellos echt, dieser lyrische Krampf! Denn was hat die Kunst nicht alles getan, um das Material der Zeit zu nützen und sich dem heutigen Menschen anzupassen; war sie doch kaum mehr von der Statistik zu unterscheiden, als Zola seine Evangelien zu dekretieren sich erkühnte! Der Mensch, von der Wirtschaft konsumiert, von der Technik entseelt, an das Kapital verkauft, ein in den Betrieb gespanntes Nervensystem, erhob seinen schwachen Protest, den das Geräusch der Allerweltshöllenmaschine übertönte. Bis sich die Kunst, über so viel Vergeblichkeit erzürnt, von der Wirtschaft ab- und jener Leidenschaft wieder zuwandte, die durch Erreichbares nicht befriedigt und erschöpft werden kann.
Was aber erreicht worden war: der moderne Mensch – ihn stieß der wertende Geist mit einem Abscheu zurück, der in der Geschichte der Jahrtausende seinesgleichen nicht hat. Der moderne Mensch war eben jener »letzte Mensch«, den idealisch zu überwinden Nietzsche seinen »Übermenschen« halluzinierte; den praktisch zu überwinden, Nietzsche ein Jahrhundert der grauenhaftesten Kriege für nötig hielt – welches angesagte, glorreiche Jahrhundert denn auch recht pünktlich begonnen hat. Oder man überlasse sich den riesenhaften Pamphleten Dostojewskijs gegen diesen neuen Menschen, den wir, auch in der russischsten Verkleidung, wie uns selbst kennen, und dem keinen geheimsten Schlupfwinkel zu lassen, der unerbittlichste Psychologe aller Zeiten sich so furchtbar gerüstet hat. Die Gegenwehr der Restbestände an Kultur und Natur, welche Europa noch besaß, war also nicht gering, auch wenn ihr nichts sonst gedient hätte als nur die Seelen- und Geisteskraft dieser beiden Überzeitlichen: im Westen und im Osten, im Niedergang und im Aufgang der Sonne Europas, Nietzsche und Dostojewskij. Die einzige große schöpferische Gelegenheit, welche die Zeit bot, war das Nihil! Eine Kulturkrise brauchte keine Künstler, sondern Propheten.
Und die Frage der Zeit nahm eine allzumenschliche – vielleicht ihre eigenartigste – Wendung in der Frauenfrage. Nachgeborene mögen staunen, daß wir plötzlich mit solcher Dringlichkeit, so methodisch und so radikal, nach dem Weibe zu fragen, das Weib zu suchen und zu deuten begannen; als hätte erst heute Adam die Rippe verloren und seltsam verwandelt wiedergefunden! Erst ging es um Gleichberechtigung; die Epoche suchte in der Frau den Menschen, und zwar den modernen Menschen. Da fand sie die Hysterika. Aber bald wurde diese Oberflächenbewegung – die Oberfläche der Zeit bewegte sich! – durchkreuzt und durchbrochen von einem vulkanischen Stoß tieferer, heißerer Schichten. Den modernen Menschen hatte das Weib, das ihm glich, nicht genug gefreut. Ein Müssen riß ihn hin zum Gegensatz. Man suchte bald, mit tragischer Besessenheit, die elementare Frau, die absolute Frau, die Frau überhaupt. Und da kamen die Entdeckungen, fiebernd vor Neuheit, die Aufschlüsse: es war ein Ertappen, ein Erraten, ein Finder-Glück und -Leid ohnegleichen. Den Sehern dieses Unglaubhaftesten, des Weibes in seiner üppigen Eigenwilligkeit, gingen die Augen über, und sie warfen sich anbetend nieder vor der majestätischen Naturgewalt, die sie entschleiert hatten. Zum ersten Mal, so schien es, versuchte man die Frau nach ihrem unabänderlichen Gesetz zu begreifen. Nichts Neueres hatte man zu erfahren als dieses Urälteste, und niemand war sich der Paradoxie einer so verjährten Überraschung recht bewußt. Und diese Paradoxie zeichnete sich flammend an alle Wände der Zeit. Dieser Paradoxie verdankte unsre moderne Großstadt- und Zivilisations-Kunst ihre seltenen heroischen und paradiesischen Augenblicke. Oder ist, als der Kampf der Geschlechter zum Drama unsres Lebens geformt wurde, irgendwo auch die Verherrlichung des Mannes geglückt? Der Mann brachte es überall nur zur Tragikomödie, zum Pamphlet, zur Satire. Die Tragödie, im extremen Einzelfall Strindberg, entartete zum Verfolgungswahn, zur Tollwut, zur Selbstzerfleischung. Ibsen fand einen letzten Helden, seinen »Brand«, den unbedingten Mann; aber es war nur der moralische Schatten, den ein großer Unzeitgemäßer, Sören Kierkegaard, geworfen hatte. Auch dieses Höhenmaß, der Glaubensheld, das ungebrochene Entweder-Oder schien nur noch im Norden zu wachsen. In Skandinavien gab es noch ein Jenseits der Psychologie, einen Rest germanischer Rasse, einen Schlupfwinkel der Natur. Von dort entwich ein Knut Hamsun, ein mythologischer Flüchtling, in die Wälder und schüttelte den Kulturstaub, den Schutt Europas, von den Schuhen. Aber das blieb vereinzelte Notwehr; wie etwa die sakralen Formeln Stefan Georges, als Residua einer zermürbten Hoheit. Sie alle sind vom Westen angesteckt, haben den Bruch, die Problematik. Erst im russischen Christus schien sie sich auflösen zu können, fand sie in die Breite und Fülle der Allmenschlichkeit zurück und auf den echten Boden eines barbarischen Volkes, das die Zukunft tragen will. Indessen hatte die Gegenwart Recht, sich zu bezweifeln. So zieht sich die merkwürdige Reihe der verzerrten Porträts des Mannes von Jacobsen, Flaubert, Ibsen – über Wedekind, Heinrich Mann, Sternheim, Shaw – zu Karl Kraus.
Karl Kraus war in diese Konstellation hineingeboren und paßte hinein, ohne sich erst anpassen zu müssen. Dieser hartnäckige Antipode erlebte unsre Welt vom andern Pol her. Für ihn war die Frage nach der Frau – sofort – die Frage nach dem Mann. Der Mann fragte; der Satiriker wußte den Mann fragwürdig – und so verstand er die Frage. Die Frau suchen hieß: sich ermannen wollen. Weil dem Mann sein Absolutes geschwunden war, tastete er wankend nach der Absolutheit der Frau. Indem er das Elementare des Weibes erlebte, belebte er nur sein eignes ersterbendes Element. Man legte es durchaus auf das Elementare an, aber man erzielte meist nur das Extreme. Das bedeutete: daß, auch wer sich verzweifelt spannte, kaum noch den letzten äußersten Rand der Mannheit zu erreichen vermochte. Eine schauerliche Verarmung. Der Erbe aller Bildung, der Virtuose der Wissenschaften – da buchstabierte er nun das A-B-C! Der allmächtige Produzent hatte ein kleines Berufsgeheimnis zu verbergen: er war steril.
Als Simsons Haupthaar fiel und der geschorene Zivilisationsbürger zum Vorschein kam, da war nicht etwa der Gattungswille versiegt. Und sexuelle Routine würde das Übermaß der Natur, das Yiuyitsu die Athletik auch heute noch auskömmlich ersetzen; die Nerven könnten noch manches lohnende Stück spielen, wo die Muskeln erlahmen: wenn der moderne Berufsmensch, der Spezialist seiner Arbeitsteilungen, der Graduierte, der Isolierte, der endgültig Zivilisierte nicht ein Unendliches an innerer Wesenheit eingebüßt hätte. Nur der Schwund der Phantasie machte ihn zum Eintritt in eine entzauberte Welt, in die Welt des Reglements tauglich. Wie stolz war die Aufklärung, mit allem Glauben fertig geworden zu sein; aber, sonderbar, wenn man ihn erst los ist, glaubt man sich selbst nicht mehr. Und die totsichersten Wirklichkeiten ersetzen nicht den Verlust an Idee! So kam es denn, daß der Mann seine Herrschaft über das Weib offiziell wohl behielt, aber der uralte Seelenbaum sich bedenklich lockerte. Hatte der Mann auch stets der Gefährtin Wesen vergewaltigt – nun ging keine Illusion mehr von ihm aus, die seine notdürftigen Zwecke geadelt hätte. Wo ist denn seine Ehre, die sie wahren muß; wo lebt denn sein Ideal, das sie spiegeln soll? Wo gedeiht denn der Wuchs der Persönlichkeit, die, wenn sie liebt, enteignen darf? Dabei hat der Versuch des Mannes, der Frau gegenüber seine Gottähnlichkeit zu behaupten, sich in dieser Zeit als ebenso vergeblich erwiesen, wie sich jener andre Versuch, die Frau zu emanzipieren und mit ihr auf gleichem sozialen und ethischen Niveau zu paktieren, als höchst gefährlich offenbarte. In der Lügenpraxis war sie ihm schließlich ebenso über wie in der Geschlechtspraxis, in der Weitläufigkeit hatte sie ihm bald einen Vorsprung abgewonnen, den er auch mit unbedenklichster Aufopferung all seiner imaginären Werte nicht mehr einzuholen vermochte, und während die ethische Fessel, mit der er den Naturtrieb hatte bändigen wollen, ihn selbst schleifte und würgte, entsprang ihm gegenüber die befreite Megäre Strindbergs, die rächende Furie ihres Geschlechts. Da sie einander nicht mehr zu täuschen vermochten, wurde der Kampf schonungslos. Irrsinnige Tragödie, wenn der allmächtige Mann zuletzt auch nicht sein kläglichstes Lebensrecht, ja nicht einmal seine Vaterschaft gegen den tollgewordenen Egoismus der Gefährtin zu schützen vermag!
Nur aus der gewalttätigen Parteiung zwischen Mann und Weib, welche zu dieser Zeit den Gegensatz der Geschlechter ins Unversöhnliche trieb; nur aus der rasenden Entzweiung zwischen der einen Hälfte der Menschheit, welche an der Natur gesündigt hatte, und der andern Hälfte, welche die beleidigte Natur rächte, kann ich verstehen, daß ein wahrhaft heroischer und mit Geniekräften unternommener Versuch, die Idee des Mannes wieder zu ihrer vollen Höhe zu erheben, der vereinzelte Versuch eines Jünglings, Otto Weiningers, so furchtbar endete. Otto Weininger hat seine hellseherische Vision vom absoluten Weib nur verkünden können, indem er sich auch zum Sprecher für den Haß und die Furcht der Zeit machte; und er glaubte die Integrität des männlichen Charakters durch die Art zu retten, wie er seinen kategorischen Imperativ zwischen Mann und Weib setzte. Er hatte die beiden Pole der Welt willkürlich auseinandergerissen; und nun riß ihn der verstoßene Pol nach, mit einem Gegenruck, der an Urkraft die Entschiedenheit des philosophischen Gewalttäters noch übertraf. Wer den »Liebeshaß« ermißt, der in Weininger das Bild der Frau gestaltete; das erotisch Affektive, das dieses Denken überhitzte: der kann sich einer geschlechtlichen Deutung des Vorgangs nicht erwehren, als ob auf einen idealen Lustmord, Vernichtung des Wesens W, ein realer Opfertod, der Selbstmord des Denkers, gefolgt wäre. Aber wenn es auch unmöglich bleibt, den Entschluß eines Einsamen zu enträtseln; wenn auch der letzte Wille, der das Rätsel ungelöst mit sich hinübernahm, unbedingt durch Schweigen geehrt werden sollte: der charakterologische Denker, der die Welt von Grund auf bipolar konzipiert hatte, handelte bereits mit selbstmörderischer Gewalttätigkeit, als er das ewige Spiel der Gegensätze durch eine dogmatische Wertung sprengte. Ich kann mich des Glaubens nicht entschlagen, daß Otto Weininger an seinem Haß, an seiner Liebe herrlich gewachsen wäre, wenn nicht seine verzehrende Jünglingsseele zu rasch, zu unerbittlich eine materiell restlose Deckung des Lebens mit der ersehnten Idee gefordert hätte. Ihn zerriß der Krampf der Epoche, von der kranken Wurzel her; nicht das hohe Streben, sondern die ausfahrende Sucht nach unangemessenen Maßen.
Als Karl Kraus »Geschlecht und Charakter« gelesen hatte, schrieb er an Otto Weininger: »Ein Frauenverehrer stimmt den Argumenten Ihrer Frauenverachtung begeistert zu.« Der entscheidende Wert dieses Paradoxons besteht in der kritischen Unbefangenheit, mit der hier eine schnurgrade Logik die Grenze wahrt, wo organische Gestalt und willkürliche Meinung aufeinanderstoßen, wo reines Erkennen sich mit leidenschaftlichem Bekennen zu vermischen strebt. Es ist zugleich die Grenze, wo die Ethik von der Ästhetik, das Sehen vom Sein abzweigt, und wo niemand schwerer verzichtet als der Künstler, den ein sittliches Pathos erfüllt. Karl Kraus nahm nicht Partei wie Strindberg, der aus der infernalischen Ehe des Neurotikers mit der Hysterika den Dichter retten mußte: der Tragiker, der das Geschlecht pathetisch nimmt und die Ohnmacht der männlichen fixen Idee erleidet, welche das Weibliche zwingen will und ihm erliegt; dessen Bekenntnis des Geschlechtshasses deshalb so erschütternd wirkt, weil sich die praktische Schwäche der denkerischen Position vor den Augen der Zuschauer in sich selber rächt und verurteilt. Karl Kraus nahm auch nicht den idealen Ausweg Peter Altenbergs, des durch die Trivialität traumwandelnden Troubadours, der, die ästhetische Sendung der Frau verkündend, die Frau in die Ferne rückte, um sie betrachten zu können – ein Platoniker, der Welt ihren Willen verbietend, damit sie als Vorstellung zu genießen sei; und zuletzt ein Don Juan der Sekunde. Karl Kraus drohte auch nicht die Gefahr Frank Wedekinds, der wohl die Not der Zeit gestaltet hatte, als er die Komödie des männlichen Besitzwahnes zur Tragödie der Frauenanmut verdichtete; aber scheitern mußte, da er, den sexuellen Mann als seinen Helden krönend, das volle heroische Maß ertrotzen wollte – auch er ästhetische und ethische Werte, durch dogmatische Gleichsetzung, zu Unrecht verquickend.
Karl Kraus war von Natur aus gegen alle diese geistigen Versuchungen gefeit. Er war und blieb der Satiriker. Er war, von seiner satirischen Praxis her, der Sachverständige, was die heute gängigen männlichen Werte anlangt; und er schien durchaus nicht geneigt, was der Mann an Geist und Charakter schuldig blieb, von der Frau einzufordern. Während er selbst mit aller Schroffheit seiner männlichen Bestimmung folgte, gehörte sein inbrünstiger Dank den Frauen, die die ihrige erfüllten und in diesem kurzen Dasein die Wohltat der Natur spendeten; ästhetische Entschädigung für all den schweren ethischen Schaden ringsum. Auch noch die Befriedigung eines realen leiblichen Bedürfnisses war ein unschätzbarer positiver Gewinn neben der Hervorbringung falschen Geistes, als eines doppelt Negativen, und die Herren der Schöpfung in Amt und Würden, die mit ihrer Meinung und Gesinnung, mit Verstand und Vernunft, mit dem Charakter Handel trieben, durften nicht rechten, wenn auch das Weib seine Gaben der kapitalistischen Währung unterwarf. Es hieß wohl von der Phantasie des Mannes zuviel verlangen: daß sie das Weib über die Währung hinaus werten sollte. Hier trotzdem werten – den Zauber des Erlebens, eine Illusion –: das vermochte am Ende nur der Künstler. Der Dichter, für den die nach sozialer Geltung Verlorenen Unendliches gewonnen haben können! »Sie setzen sich allen Pfeilen aus, die die soziale Welt für ihre Leugner bereit hält, leisten der Natur Gefolgschaft und gehen in dem Vernichtungskriege unter, der das hehrste Schauspiel dieser subalternen Zeit vorstellt. Was weiß ein Staatsanwalt davon! Verstünde er es, wenn ihm ins Hirn gebrannt würde, daß das Hurentum das letzte Heroentum einer ausgelaugten Kultur bedeutet?« Wo das Gesellschaftsmännchen die Helferin seines tristen Bedürfnisses, die Wahrerin zugleich und Retterin seiner gesellschaftlichen Regel, mit Geld und Verachtung belohnt, hat der Künstler geliebt, ist der Pamphletist seiner Artverwandten, der großen Hetäre, begegnet, die, wie er, tabula rasa macht mit allen Halbheiten, mit allen Minderwertigkeiten, und den vollen Rausch der Sekunde nicht weniger unerbittlich emportreibt als er die geistige Erfüllung. Der Traum einer ästhetischen Vollendung, den sie in der Seele des Künstlers zeugt, auch wo sie leiden macht, verklärt noch die geringste, die unscheinbarste ihrer leidenden, rauschlosen, traumentblößten Schwestern.
Nichts tat so not, wie in diesen Bereichen unverlogen erleben zu können, unverlogen erleben zu müssen! Hier wird dem Menschen, als dem instinktgeschwächten Tier, die öffentliche Meinung, als der irregeführte Geist, zur Katastrophe der Vitalität. Welche teuflische Tücke, das Atmen verdächtig zu machen, sodaß die Ärmsten, mit schlechtem Gewissen atmend, eines Tages, da ihnen die Angst in die Luftwege gerät, zu ersticken drohen! Man weiß nicht: war es dringender für das Geschlecht, daß vom unwillkürlichsten Fühlen die Beleidigung, die Beschmutzung abgewehrt wurde; oder für die Seele, daß sie sich einer selbstmörderischen Problematik entzog; oder für den Geist, der über einer an heroischem Schaffenstrieb und natürlicher Sinnenfülle verarmten Welt versiechte; oder für die ethischen Kräfte, die, statt den Mann gegen das feindliche Leben auszurüsten, ihn gegen die Wurzel im eignen Blut bewaffnen und ihn zu einem verzweifelten Lügner machen, wo er liebt? Wehe, wenn die vorgebliche Absicht der Sitte geglückt, die Ethisierung der Sexualität restlos gelungen, die Verachtung der Sinne in die Nerven eingedrungen ist! Dem so gelähmten Menschen, dem Neurothiker, hilft kein Gott in den Himmeln aus dieser kläglichsten Misere, die das Leben an der Wurzel vergiftet, kein Planen und Gedeihen mehr zuläßt, den Willen bricht, den Geist entmündigt! Hier wächst nicht mehr Freiheit, Menschenwürde, hier bleibt nicht mehr das höchste Glück der Menschenkinder die Persönlichkeit: wenn der Mensch nicht mehr Mensch unter seinesgleichen zu sein vermag; wenn er sein Auge feig niederschlagen muß vor der rosigen Schönheit und zu den Lemuren fliehen, auf daß sie ihn atzen; wenn er sich schmachgekrümmt drücken muß, wo er liebt, damit er nicht in erbärmlichstes Unglück stürzt, was er liebt – dann ist dem Elenden kein Aufwand zu groß, um eine Sekunde tierischer Gewöhnlichkeit zu erjagen, und koste es das Leben! Dieser Desperado da, kaum noch menschenähnlich – und ein Kulturschöpfer? Wenn er schon ausgeschlossen ist vom Reigen der Lebendigen, wird er mit einem letzten Rest natürlichen Verstandes begreifen, daß sein Geist wenigstens sich einfügen muß in die Ordnung der Natur, und daß ein rettender Gemeinplatz, der sein Denken mit dem Trieb in Übereinstimmung bringt, ihm besser taugt als der leibhaftige babylonische Turm der Philosophien und Künste der Jahrtausende.
Erst wer diese unselige Problematik von allen Seiten her durchlebt hat, wird ermessen können, welch eine Befreiungstat ein Schriftsteller wie Karl Kraus plante, als er mit dem Wust der Zeit und all ihren nicht fundierten Geistigkeiten und im Innersten verlogenen Sublimierungen reinen Tisch machte und vom niedrigsten Grunde der Sozialität her das erotische Leben selbsttätig aufzubauen begann. Im »leichten Leben«, das oft genug ein besonders schweres Leben sein mag – als Kriegszustand der tückischsten Konkurrenz, in den Mißformen des Wuchers, der Erpressung, der Enteignung gesetzlos wüstend – erkennt der Denker das heroische Gesetz des Eros, dem jeder verfällt, dem keiner entgeht, als dem erhöhenden Auslese treibenden, immer aber den Sinn des Lebens erzwingenden Gesetz. Nicht wie der Asket, der den Kampf flieht, um ihn im eignen Innern wieder aufzunehmen: als ein Kämpfer der Liebe, der den Eros aufsucht, um aus Genuß und Leid, aus dem Erlebnis, die erotischen, die ästhetischen Werte, den durchglühten gereinigten Geist des Erlebnisses zu gewinnen, und, so bereichert, jenseits des Erlebnisses seine männliche Freiheit um so entscheidender zu wahren, umso stärker zu befestigen. Und welch ein großzügiger ethischer Aspekt eröffnet sich, wenn die Liebe eines Künstlers das Naturrecht der Frau mit anarchischer Rücksichtslosigkeit wahrt! Nicht nur daß heute das in eine teuflische Enge getriebene Geschlecht diesen kühnsten Durchbruch als einen verzweifelten Notausgang erstreben muß! Wenn der Künstler so die Naturwerte der Frau bejaht, vollzieht er eine ethische Rettung an der ganzen amoralisch blühenden Natur und rettet nicht zuletzt den verantwortlichen Charakter des Mannes als eines Liebenden, eines Führenden, eines Beschützenden des Lebens, das in seine Hand gegeben ist.
Karl Kraus hat hier von dem großen Mitleidigen, Friedrich Nietzsche, gelernt; dessen Zorn nur Mitleid war mit der Freude, mit dem Gedeihen der Art, mit der zauberhaften, von der pseudochristlichen Heuchelei schwer bedrängten Ja-Idealität des unmittelbaren Lebens. Nietzsche, dieser Zarteste, dieses Genie der Güte, rief den Haß zu Hilfe und die Härte, weil der Segen noch immer nicht kommen wollte. Nietzsche rüttelte den europäischen Menschen, um ihn wachzurütteln; er peitschte die europäische Seele, damit sie sich mit Blut fülle. Als ein Sturmwind sollte Zarathustra diese dürre, kärgliche Erde befruchten, indem sein dithyrambisches Lebensgefühl über die sozialen und geistigen Niederungen dahinbrauste und als ein Licht- und Feuerregen niederging. –
Während der Satiriker drunten im Pferch der Zeit den wahren Geist züchtet!
Für das Wienerische Auge hat Karl Kraus einen kleinen Gesichtswinkel; und der Kreis, den er satirisch spiegelt, wird ihm stets einen engen Horizont nachsagen. Die moderne Intelligenz kommt über ihre eigene Lappalie nicht hinweg; aber sie überspringt den geistigen Akt, den Karl Kraus an der modernen Lappalie betätigt. Deshalb blamieren sich die klügsten Köpfe, indem sie eine Entwicklung leugnen, die sich unter ihren Nasen, ja, über ihre Nasen hin vollzogen hat. Und ich erkenne die zeitbetäubten Zeitgenossen daran, daß sie sich immer noch an die Tatsachen klammern und die Reflexion nicht erfassen. Gar für den Aphorismus bringen sie nicht genug Geduld auf. »Wenn ein Denker mit der Aufstellung eines Ideals beginnt, dann fühlt sich jeder gern getroffen. Ich habe den Untermenschen beschrieben – wer sollte da mitgehen?« Und wer sollte einem Solchen verzeihen, daß unsre Schwäche seine Stärke ist? Ich wäre bereits zufrieden, begreiflich gemacht zu haben, daß es einem so Unzufriedenen nichts geholfen hätte, auszuwandern oder auch nur in einen andern Interessenkreis zu übersiedeln. Wohin man auch fährt, man fährt nicht aus der eigenen modernen Haut. Am besten noch blieb die Unrast zu Hause und grub in das eigene Selbst hinab. Wenn überhaupt irgendwo, war Erfüllung im eigenen Erlebnis, Gewißheit in der Gestaltung des Erlebnisses zu finden. Wir fliehen notgedrungen in das Ich, wir klammern uns an den Kern des Selbst; da es doch kein All mehr gibt, keine Gemeinschaft im Geiste, keine Menschheit in der Idee. Unser Selbsttrotz ist eine fuite en avant. Der isolierte Mensch unserer Weltverarmung hat den »Einzigen und sein Eigentum« erfunden. Geist existiert nur noch als Ausnahme, Wahrheit allein als Paradoxie. Und hätte der Einzige nichts, was er sein Eigen nennen könnte, als einen Haß, einen Widerwillen, einen Widerspruch! Und erschöpfte sich seine ganze Weisheit in einem Aphorismus, der, in dieser Weile der Ungewißheit, vom Ursprung kommt und kein Ziel sucht! Was blieb übrig von den Gedankenwelten der Vorzeiten, wenn nicht der Splitter eines Gedankens! »Eine Wahrheit ist nicht mehr wahr, wenn sie mehr als Einer glaubt«, behauptet Oskar Wilde, unser aller tragisches Paradigma. Ermessen wir, was die Wahrheit dem Einen zu bieten hat, der in ihr lebt.
Intensität und Konzentration! Mochte sich der Stoffkreis verengen – sollen wir es bedauern, da ein Zuviel an Stoff uns überwächst und erstickt! Mochte der Horizont schließlich zu einem Punkt in der Zeit zusammenschrumpfen, auf den das gebannte Auge unablässig starrt, bis er sich unheimlich belebt! Vielleicht gibt es unter den Zeitgenossen reichere Geister, weitere Köpfe, höhere Seelen. In zwei Haupttugenden erreicht diesen Einseitigen keiner; in zwei Tugenden, die ihn märchenhaft entwickelt haben: Intensität und Konzentration. Wer seine Anfänge betrachtet und zugleich sein heutiges Stadium, muß sich erschüttert fragen: Welche Notwendigkeit hat ihn getrieben und gedrängt, und welcher Zwang hielt ihn so dicht beisammen! Einer hat viel und Vieles mitbekommen und verzettelt es an Vielerlei. Ein Zweiter besitzt wenig, vertritt es restlos, gestaltet es rastlos und verwertet es unendlich. Dieser Zweite schreibt eine chronique scandaleuse von Krähwinkel; aber er steigert sie unaufhörlich und unermüdlich an der schlaflosen Frage seines Herzens, seiner Sinne, seines Geistes – und siehe da: Krähwinkel wird zur Welt! Er ist empfindlich gegen ein Unbeträchtliches; er faßt es stets aufs neue, schaut es von allen Seiten an, stellt es immer wieder vor sich hin: bis es maßlos, bis es absolut wird! So bewährt sich ein Sisyphus als Künstler! » Mein Respekt vor dem Unbeträchtlichen wächst ins Gigantische!« An diesem Respekt ist der Satiriker gewachsen. Es mag ein winziger Zug im Gesicht der Zeit sein, irgendeine böse Falte, eine unwillkürliche Grimasse: aber der Betrachter, der Darsteller ruht nicht, bis er dieses Nichts aus der Physiognomie, der es anhaftet, herausgerissen, es bleibend, zeitlos, es ewig gemacht hat. »Warum schreibt mancher? Weil er nicht genug Charakter hat, um nicht zu schreiben.« Aber auch an der jämmerlichsten Stofflichkeit vermag sich ein geistiger Charakter glorreich zu entfalten. Hätte dieser Eine uns sonst nichts erfahren lassen als Größe, an Kleinlichkeit bewährt: er hätte den Besten seiner Zeit genuggetan. »Man muß jedes Mal so schreiben, als ob man zum ersten und zum letzten Male schriebe. So viel sagen, als obs ein Abschied wäre, und so gut, als bestünde man ein Debüt.« Und deshalb: wenn Karl Kraus immer dasselbe sagt, ist es doch nie dasselbe. Ich gebe zu: heute, da jeder geistige Bettler ein Millionär an Meinung ist, mag es als ein Anachronismus anmuten, wenn ein Sonderling ein Leben lang Einem Gedanken nachhängt – und am Ende nur einer idée fixe! »Die Welt ist ein Gefängnis, in dem Einzelhaft vorzuziehen ist.« Es bleibt das Geheimnis seiner Ökonomie, daß der satirische Eremit mit der Luft seiner Zelle die weite Zeit da draußen einatmet und daß, wenn er ausatmet, in dem Hauch seines Mundes alles zittert, was sie bewegt. Und daß es uns tausendfach angeht, wenn er sich stets nur mit Wenigem, mit diesem Wenigen gründlich und am gründlichsten mit sich selbst beschäftigte.
In seiner Schrift »Nestroy und die Nachwelt« hat Karl Kraus dem »kosmischen Hanswurst« und seinem »weisen Wortschwall«, dem sprachsatirischen Meister und seinem »völlig sprachverbuhlten Humor, bei dem Sinn und Wort sich fangen, umfangen und bis zur Untrennbarkeit, ja bis zur Unkenntlichkeit umschlungen halten«, dem »höhern Nestroy, der nur Kopf hat und nicht Gestalt, dem die Rolle nur eine Ausrede ist, um sich auszureden, und dem jedes Wort zu einer Fülle erwächst, die die Gestalten schlägt« – dem hat er ein Denkmal gesetzt. Wie diese Ruhmrede den Schauspieler, den Possendichter, den Satiriker Nestroy ergründet und eine unerbittlich geistige Kunst- und Weltanschauung begründet, dafür gibt es einen Vergleich nur bei Karl Kraus – seine Streit- und Rettungs-Schrift über Lyrik: »Heine und die Folgen«. »Wenn Kunst nicht das ist, was sie glauben und erlauben, sondern die Wegweite ist zwischen einem Geschauten und Gedachten, von einem Rinnsal zur Milchstraße die kürzeste Verbindung, so hat es nie unter deutschem Himmel einen Läufer gegeben wie Nestroy. Versteht sich, nie unter Denen, die mit lachendem Gesicht zu melden hatten, daß es im Leben häßlich eingerichtet sei.« Die Schrift sagt ein Erstes und Letztes über die Satire überhaupt, ihre Mission und ihre Art Satire ist »die Kunst, die vor allen andern Künsten sich überlebt, aber auch die tote Zeit. Je härter der Stoff, desto größer der Angriff. Je verzweifelter der Kampf, desto stärker die Kunst. Der satirische Künstler steht am Ende einer Entwicklung, die sich der Kunst versagt. Er ist ihr Produkt und ihr hoffnungsloses Gegenteil. Er organisiert die Flucht des Geistes vor der Menschheit, er ist die Rückwärtskonzentrierung. Nach ihm die Sintflut.« Und die Schrift steht an jener Grenze, wo Nestroy endet und Karl Kraus beginnt. Sie ermißt, wie sich die Zeit seither, als Stoff für die Satire, entwickelt hat. Nestroy »kehrt um vor einer Nachwelt, die die geistigen Werte leugnet, er erlebt die respektlose Intelligenz nicht, die da weiß, daß die Technik wichtiger sei als die Schönheit, und die nicht weiß, daß die Technik höchstens ein Weg zur Schönheit ist, und daß es am Ziel keinen Dank geben darf, und daß der Zweck das Mittel ist, das Mittel zu vergessen. Er ahnt noch nicht, daß eine Zeit kommen wird, wo die Weiber ihren Mann stellen und das vertriebene Geschlecht in die Männer flüchtet, um Rache an der Natur zu nehmen. Wo das Talent dem Charakter Schmutzkonkurrenz macht und die Bildung die gute Erziehung vergißt. Wo überall das allgemeine Niveau gehoben wird und niemand draufsteht. Wo alle Individualität haben, und alle dieselbe, und die Hysterie der Klebstoff ist, der die Gesellschaftsordnung zusammenhält.« Aber man lese die Schrift. »Die Zeit, die das geistige Tempo der Masse verlangsamt, hetzt ihren satirischen Widerpart.« »Nestroys Eigentlichstes hätte eine zersplitterte Zeit zur stärkern Konzentrierung im Aphorismus und in der Glosse getrieben, und das vielfältige Gekreische der Welt hätte seiner ins Innerste des Apparates dringenden Dialektik neue Tonfülle zugeführt.« »In den fünfzig Jahren nach seinem Tod hat der Geist Nestroy Dinge erlebt, die ihn zum Weiterleben ermutigen. Er steht eingekeilt zwischen den Dickwänsten aller Berufe, hält Monologe und lacht metaphysisch.«
Damit ist nicht nur Entscheidendes über die satirische Reflexion ausgedrückt, sondern auch ein extremes Beispiel Krausscher Reflexion gegeben, als einer Manier, das Erlebnis zu erdenken und das Erdenknis zu verlebendigen. Sie brauchte von vornherein nur wenige und immer dieselben Anlässe, um daran organisch zu wachsen; und schließlich nur einen geringfügigen äußern Anstoß, um in eine unendliche innere Bewegung zu geraten. Diese Reflexion, als der gedankenhaft scharfe und immer schärfere Rand der innern Zustände, bleibt stets die genaue geistige Grenze der sachlichen Verhältnisse. Es bedeutet zuerst und zuletzt ein Sprachwunder, daß es Karl Kraus gelang, sein Ich, das augenblickliche, und jenes Ich, das bis in die Erbschaft der Vorzeit und bis in die Kindschaft der Nachwelt reicht, so tief in die Sprache zu drängen, daß die Beredsamkeit sein Fleisch und Blut und zum Spiel seiner Nerven wurde. Es erscheint mir eines Studiums wert, wie sich hier aus dem unermüdlichen Durchleben und Durchdenken der kleinen und kleinsten Fälle die Dialektik nach und nach aufbaute; wie sie den tausend Einzelzügen, Wendungen und Windungen der Tatsächlichkeit eine Bedeutung abgewann, die dann auch Tausendfaches bedeutete. Die Reflexion wurde immer allgemeiner, und die Aktualität schien immer nachlässiger bedient, zuletzt war sie nur mehr Vorwand für einen selbständigen Humor, ein selbständiges Pathos. Es genügte schließlich ein gespenstisch ferner Widerhall unsrer Gesprächigkeit, das verworrene Summen unsrer Alltagsstimmen, ein kaleidoskopischer Wirrwarr aus zitierten Bruchstücken und erbrochenen Zitaten. Die angeführten Stellen aus »Nestroy und die Nachwelt« mahnen, so aus dem lebendigen Zusammenhang gerissen, daß der Reflexion die Gefahr der Unfruchtbarkeit drohen könnte, wenn sie vor dem einzelnen Fall die Augen schlösse, weil sie die allgemeine These erblickt hat. Sie gäbe das Dichterische auf, den angeschauten Augenblick, ohne jedoch das Philosophische zu erreichen, das gedachte Gesetz. Unbesorgt darf sich der Dichter an die Fülle der Erscheinungen, der Denker an die Folge der Regeln hingeben. Der Satiriker muß jederzeit das Nicht-sein-Sollende, welches doch ist, und das Sein-Sollende, welches nicht ist, mit einem Blick und einem Gefühl umfassen; er muß, auf dem halben Wege von der Erscheinung zur Idee, im Zustand des Hohnes, des Zornes, des Wunsches bleiben, in einer unerlösten Spannung, die sein Witz stachelt und sein Pathos treibt. Er darf nie als seine Gewißheit verraten, daß er weiß, es sei die ewige Antinomie verhängt. Er darf sich nie vor der Tragik des Unabänderlichen beugen. Er muß an den Irrtum glauben, den er ausmerzen könnte; an den Mißbrauch, der ihn nicht schlafen läßt. Und deshalb bleibt die Banalität seinem Herzen nahe, deshalb verschlingt er sich immer dichter in den Knoten der Realität. Deshalb ist seine Reflexion der Dialektik einer Figur von Shakespeare vergleichbar, dem dramatischen Denken eines Gegenspielers, der leidenschaftlichen Seelenmimik eines Schauspielers auf dem Höhepunkte des Dramas.
Dem Satiriker liegt ob, seine Verletzlichkeit zu schärfen und allseitig auszubilden. Sie wächst und reift mit ihm, und er wird an ihr fruchtbar. Die Bedeutung der Satire steigert sich, je persönlicher sie gerichtet und je überpersönlicher sie orientiert ist. Es handelt sich darum, von einem Punkt der allernächsten Nähe auf verkürzten Wegen die weite Welt zu erreichen. Die Lust der Satire an allem, was sie reizt, schöpft aus der immer neuen Fülle des Mangels; und die Satire gedeiht, solange sie sich nicht von der Unlust anstecken läßt, die sie dem Unwesen zufügt. Sie wäre sofort zu Ende, wenn sich ihr gesunder Appetit auf das Ärgernis je erschöpfen könnte. Und sie wird unendlich, wenn sich das Drama nach innen schlägt. Durch diesen Akt der Verinnerlichung entsteht der Aphoristiker. Er findet den Anlaß, den Zwiespalt in sich selbst. Er löst in der eigenen Seele selbsttätig den Widerspruch aus. Der Gedankenblitz entlädt im Augenblick die heftigen Gegenpole: Geist und Natur, Mann und Weib, Ethik und Ästhetik, Geschlecht und Gedanke, Stoff und Künstler, Erlebnis und Sprache, Gattung und Ausnahme, Doxa und Paradox. »Qual des Lebens – Lust des Denkens.« »Es muß einmal in der Welt eine unbefleckte Empfängnis der Wollust gegeben haben!« »Nie ist größere Ruhe, als wenn ein schlechter Zeichner Bewegung darstellt. Ein guter kann einen Läufer ohne Beine zeichnen.« »Die Unsterblichkeit ist das Einzige, was keinen Aufschub verträgt.« »Man lebt nicht einmal einmal.« Wer hier nur die Laune merkt, die den Augenblick des Sinnes und des Wortes im Vorüberflug hascht, der verkennt die Gesetzmäßigkeit in der Gestaltung eines Innenlebens. Das Selbstporträt einer Physiognomie. Physiognomie: das ist ein Gesicht mit seinem Geist. Wer hier nur ein geistreiches Spiel schätzt, der ahnt nicht, wie sehr der Spieler es notwendig hatte, Geist zu haben. Ihm war versagt, sich bei den Gestaltungen der mittleren Gehirn- und Gemütszone zu beruhigen. Vor seinem Blick zerfiel alles, die Welt hatte den Schwund, von der lebendigen Gestalt blieb nur das Gerippe, vom Sinn nur die Antithese. So brachte ihn die zeitgenössische Aufklärung zum uralten Geheimnis; die moderne Technik ließ ihn die ewige Natur schätzen; alle Politik verging am anarchischen Sein; und seine Intellektualität grenzte dicht an das Unmittelbare. Ein gefährliches Entweder-Oder ging durch die ganze Anlage des Menschen; eine unvermittelte Polarität stellte das Individuum in Frage, machte es so entsetzlich kritisch und trieb auch sein Bedürfnis nach Behauptung, Bejahung, Begeisterung in unzulängliche Höhen; und ließ ihm da droben nur den Punkt, den Pol, um im Zenith zu stehen und ohne Übergang wieder abzustürzen. Tragisch, daß dem Aphoristiker ein abruptes Temperament verliehen ist und eine ätherisch durchdringende Sinnlichkeit, ein Höhegrad, der es als Wärme nur in der Hölle, als Licht nur im Paradiese aushält.
Nur eine sublime Rettung war hier denkbar, und sie vollzog sich in Humor, in der Vergeistigung, im Gedicht. So entstand, auf dem merkwürdigen Umwege des Pamphletes, höchst überraschend, ein Lyriker; und – nie so bedeutend wie im Kriege – ein prophetischer Redner, ein Rhapsode seines Geistes. Der Jurist konnte in Sophistik entgleisen, der Eigenbrödler zum Irrlehrer entarten; aber wo der Witz sich im Humor versöhnt, wo das Paradox sich in reine Betrachtung auflöst: da ist die Gefahr der bestrickenden Halb Wahrheit endgültig überwunden und die Welt zwischen den beiden Polen, der unerschöpflichen Natur und dem unvergänglichen Geist, ins lebendige Gleichgewicht gebracht.
Ich besinne mich einen Augenblick und lese, wieder und wieder, ein merkwürdiges Buch der deutschen Literatur, ein unbekanntes Buch: »Die chinesische Mauer«. Ich lese, aus Genußsucht, alte Bände der »Fackel«; veraltete, die erst heute aktuell geworden sind, deren Prophezeiungen die furchtbarste Gegenwart blutwahr gemacht hat. Und aus all diesen fanatischen Seiten strömt mir eine Besonnenheit zu, die das Herz stärkt und den Geist läutert. Und immer heißer, immer drängender fühle ich die Hoffnung in mir anwachsen, die absurdeste aller Hoffnungen: daß der Geist über diese Zeit Macht gewinnen könnte. Ihr, die am falschen Geiste, am Blendwerk der Intelligenz, leidet, ist durch einen warmen Zustrom von Güte nicht zu helfen; derlei verschwindet grausig in der gefräßigen Leere. Das echteste Menschenherz der Epoche, das unermeßliche Kinderherz Leo Tolstois, floh ja eher in die Winternacht hinaus, als daß es sich an unsrer Gemeinschaft wärmte; das Herz zog vor, sich vom Frost der Natur würgen zu lassen, ehe es an der Lüge unsrer Lieblosigkeit rettungslos dahinsiecht. Wem solche Erfahrung von der kläglichen Ohnmacht, von der erbärmlichen Heimlosigkeit des Geistes in der Welt der Intelligenz das tägliche Tränenbrot seines Berufes gewesen ist, nicht ohne daß oft und oft ein groteskes Gelächter den vergeblich Tätigen zu ersticken drohte: der wird wenig Vertrauen aufbringen für jenen berliner »Aktivismus«, der die Zeit mit ihren eigenen Mitteln zu bekämpfen und zu besiegen gedenkt. Die Herrschaft der »Geistigen?« Oh, ich könnte an den Fingern herzählen, wer da zur Herrschaft käme, und ich sage nur: Lieber die Soldateska über uns als solche Tyrannis! Denn eine Soldateska wird eher noch das lebendige Volk gegen sich versammeln als eine großstädtische Intellektokratie unter sich. Der mannhafte Wille zum Geist, die opferfreudige Tat des Geistes: sie seien, wo immer sie sich hervorwagen, geehrt und gesegnet! Aber wenn ich mir vorstelle, wie derart willkürliche Wege auf diesem gefährlichsten Boden nur umso tiefer in den allgemeinen Sumpf hineinführen müssen, statt daß auf neuem Fundamente wahre Gemeinschaft wüchse, (aber die wird kapitalistisch nimmermehr gedeihen und auch soziologisch nicht gezüchtet werden können, sondern sich im rechten Geiste konstituieren müssen): dann hallt der verzweifelte Aufschrei des Karl Kraus (aus »Grimassen über Kultur und Bühne«) in mir wieder: »Ich möchte mich aus solcher Gedankenwelt nach Hallstadt flüchten, um wieder Sprudelgeistern zu begegnen, und wenn ich dort einen Kretin fände, der Tag und Nacht seine Katze streichelt, ich fände den Glauben an die Menschheit wieder.«
Ich lese von ihm eine »Apokalypse« aus dem Jahre 1908, damals eine krankhafte Übertriebenheit ohnegleichen, heute eine sachliche Konstatierung. (Und sehr lesenswert für die Politiker des Weltfriedens und für gute Patrioten.) »Der wahre Weltuntergang ist die Vernichtung des Geistes, der andre hängt von dem gleichgültigen Versuch ab, ob nach Vernichtung des Geistes noch eine Welt bestehen kann.« »Die Natur mahnt zur Besinnung über ein Leben, das auf Äußerlichkeiten gestellt ist. Eine kosmische Unzufriedenheit gibt sich allenthalben kund, Sommerschnee und Winterhitze demonstrieren gegen den Materialismus, der das Dasein zum Prokrustesbett macht, Krankheiten der Seele als Bauchweh behandelt und das Antlitz der Natur entstellen möchte, wo immer er ihrer Züge gewahr wird: an der Natur, am Weibe und am Künstler.« »Es ist meine Religion, zu glauben, daß Manometer auf 99 steht. An allen Enden dringen die Gase aus der Welthirnjauche, kein Atemholen bleibt der Kultur, und am Ende liegt eine tote Menschheit neben ihren Werken, die zu erfinden ihr soviel Geist gekostet hat, daß ihr keiner mehr übrig bleibt, sie zu nützen.« Wer ist, von hier aus betrachtet, wie ihn Karl Kraus betrachtet, absolut der Dichter dieser Zeit, wenn nicht jener Peter Altenberg in Wien, dem die Narrheit, heute und hier noch ein Dichter zu sein, zur Groteske eines Lebens und zum Humor einer Selbstbetrachtung geworden ist? So nur, als ein Narr in Apoll, hat er sich, in der Verzerrung des Werkes, seine Lebenslinie zu wahren und reiner zu bewahren gewußt als, wie ich nur widerwillig zugebe, Gerhart Hauptmann, ein Schöpfer von Werken, der sich, in seinem heiligsten, unvergänglichsten Augenblick, als der »Narr in Christo« offenbarte. Nur ein Lebenswerk des Hasses war, so scheint es fast, dieser Welt ebenbürtig gewachsen. Nur wer die »Entstellungen« mitmachen konnte, ohne entstellt zu werden, konnte wiederherstellen. Dazu gehörte Härte. Und so kommt es denn, daß der Vorwurf, Karl Kraus sei böse, bei mir taube Ohren findet; ich beantworte ihn mit der Furcht, Karl Kraus sei vielleicht noch nicht böse genug. Wohl hat er sich nicht eher im Geiste versöhnt, als bis er ein radikales Außerhalb erreicht hatte, dahin seine rastlose Übertreibung der Zeit rastlos hinübertrieb; den geistigen Punkt, von wo aus die Idee sein Leben bewegt. Ein Ausruhen in der Zone des bürgerlichen oder selbst des menschlichen Gefühles gab es nicht. Die Menschen mögen zusehen, ob sie das Kraussche Paradox charakterbildend auf sich wirken zu lassen vermögen. Erst mußte der unerbittliche Vernichtungskampf des Satirikers mit ganzer Seele mitgemacht sein, bevor man erleben konnte, daß sich von dieser grausamen Reflexion eine Lyrik organisch ablöste. Nur wer die so strenge Zucht – und es ist nicht zuletzt eine qualvoll genaue Zucht der Sprache – Jahre lang erlitten hat, mit dem tätigen Leiden des idealen Studiums: dem fließt dann aus dieser sprödesten, unwilligsten Form der lebendige Quell, und die Meditationen des Ästhetikers, des Erotikers Karl Kraus leiten auf kürzestem Wege – mit dem Sprung des Aphorismus – zu Natur und Geist zurück; zur großen Unmittelbarkeit, die allein den menschenwürdigen Genuß des Daseins gewährt; zum elementaren Leben, das allein die Welt erlebenswert erscheinen läßt. Der leidenschaftlich geduldige Leser wird belohnt; wo die Reflexion zu blühen, zu spielen beginnt, in den phantastischen Satiren, den Humoresken, wird er auf eine »empfindsame Reise« des Satirikers durch Zeit und Tag und Ärgernis mitgenommen, die in der Freiheit der Seele, in der Reinheit des Gedankens, im Glück der Persönlichkeit endet. So gelingt dem Quälgeist, woran die Zärtlichkeit unsrer Bejaher scheitert: das reine Empfinden zu lösen. Und man empfängt die Weihen der sonderbarsten Frömmigkeit: wenn einer, den das Allzukleinliche fanatisiert, eines schönen Tages vor der Alltagsfratze, die er züchtigt, in die Knie bricht: »Kurzum, die vielen Bibliotheken und Museen, an denen ich im Leben vorbeigekommen bin, hatten sich über meine Aufdringlichkeit nicht zu beklagen. Dagegen zog mich von jeher das Leben der Straße an, und den Geräuschen des Tages zu lauschen, als wären es die Akkorde der Ewigkeit, das war eine Beschäftigung, bei der Genußsucht und Lernbegier auf ihre Kosten kamen. Und wahrlich, wem der dreimal gefährliche Idealismus eingeboren ist, die Schönheit an ihrem Widerspiel sich zu bestätigen, den kann ein Plakat zur Andacht stimmen.«
Aber freilich: dieser Sonderling hat ein Leben versäumt, eine Welt und ihren Erfolg verschmäht, eine Riesenkraft an das pure Nichts verschwendet, bis seine unablenkbare Einseitigkeit zur Abseitigkeit wurde; und siehe da: es war jene Seite, welche die starke Sonne des Geistes bestrahlt. Ich fürchte aber, die Zeit bringt die Zeit nicht auf, um bei Karl Kraus zu verweilen, und dem Lebensmut gebricht es an Mut, um sich zu vertiefen, wo ein Geist in so bösartig bewaffneter Versunkenheit sich gefunden hat. Und wer entzöge sich, so wie Karl Kraus, dem universalen Fortschritt, um, bei sich selbst, zurückzubleiben? Er freilich, in seiner innerlichen Vorwärtsbewegung – Bewegung nach innen – begriffen, fand: »Wir bleiben vorwärts und schreiten auf demselben Fleck. Der Fortschritt ist ein Standpunkt und sieht wie eine Bewegung aus.« Und: »Es war, als ob nicht ein Ziel die Eile der Welt geboten, sondern die Eile das Ziel der Welt bedeutet hätte. Die Füße waren weit voran, doch der Kopf blieb zurück, und das Herz ermattete.« Er leugnet nicht, daß wir heute schneller vorwärts kommen. »Aber wohin kommen wir? Ich selbst begnügte mich, es als das dringendste Bedürfnis zu empfinden, zu mir zu kommen.« Dahin wird der Fortschritt nicht nachkommen wollen. Das Selbst ist jedermann zu entlegen. Ich fürchte, daß ich, als ich mich zur Zeugenschaft für Karl Kraus entschloß, nach so langer Selbstbesinnung, dennoch voreilig gewesen bin. (»Und vorlaut,« wirft mir das Schweigen vor.) Da will ich einen merkwürdigen Zeugen anrufen, der mir vorausgeeilt ist. Vielleicht weiß er besser Bescheid, ob die Zeit nachkommen wird. Theodor Haecker, der Herold Kierkegaards, auf seines Meisters wahrhaft hoher Schule des seelenkritischen Geistes erzogen, sagt in »Sören Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit« (bei J. F. Schreiber in München, 1913) – einer kühnen und im edelsten Sinne am Meister reif und selbständig gewordenen Schrift, da er sich besinnt, ob lebendige Geister der Gegenwart vor dem Urgeiste Kierkegaards irgendwie bestehen könnten: »Ein Name fällt mir sofort ein, ohne daß ich mich zu besinnen brauche: Karl Kraus ... Unter allen Lebenden wurde ihm die stärkste vis comica geschenkt, doch steht sie bei ihm im Dienste der Idee. Er ist der einzige große, durch die Ethik gedeckte Polemiker und Satiriker der Zeit, er allein, sonst keiner, hätte das Recht, in seinem Werke des Hasses die furchtbaren Worte Kierkegaards über die Journalisten zu zitieren. Im Geiste gesehen ist Karl Kraus der mutigste Mann, der heute lebt, denn er steht mit seinem Wirken im grellen Lichte der Öffentlichkeit. Es ist doch immer noch weniger anstrengend, im Verborgenen oder unter Bienen und Blumen den Gott zu suchen, der Geist ist, als in den Straßen der Stadt zwischen Fratzen und Larven ihn nicht zu verlieren.«
Es hat an edlen Stimmen der Zustimmung und der Huldigung für Karl Kraus auch sonst nicht gefehlt. Ich nenne hier den würdigen Kreis des Brenner-Verlags in Innsbruck, der dem einmal erkannten geistigen Werte werbende Treue hielt, wie sich selbst. Aber das Wort Haeckers, eines Stillen im Land, hat besondern Klang. Wenn solcherart die gereinigte christliche Hoffnung, das strengste Bekenntnis der Innerlichkeit, für einen Mann, der in seiner Welt als der leibhaftige, wiedergeborene Judas Ischarioth mit Schrecken erlebt und mit Wut verabscheut wird, entschiedenes Zeugnis ablegt, dann beginnt mir um die Weltherrschaft der modernen Allerwelts-Intelligenz bang zu werden, und ich ahne hinter der politischen und wirtschaftlichen Krisis näherbebend die Geisteskrisis Europas als eine wunderbare Unabwendbarkeit.
»Wer wäre was er ist, wo Trug und Wesen
Die Welt vertauscht in jämmerlicher Wahl!«
Karl Kraus
Als es, in mythischer Zeit des Verfalles, die Große, die heilige Erneuerung galt, hat Jehova seine Boten ausgesandt und sie mit überwältigender Vollmacht ausgestattet: »Siehe, ich setze dich heute, dieses Tages, über Völker und Königreiche, daß du ausreißen, zerbrechen, zerstören und vernichten sollst und bauen und pflanzen.« »Denn Ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen im ganzen Land wider die Könige Judas, wider ihre Fürsten, wider ihre Priester, wider das Volk im Lande.« »Und er soll sie weiden mit einem eisernen Stabe, und wie eines Töpfers Gefäß soll er sie zerschmeißen.« Als ein Weltkreis sich öffnete, war wiederum zur Erneuerung des heiligen Geistes eine jüdische Zunge am Worte entflammt. Nur »des Menschen Sohn«, aber »aus seinem Munde ging ein scharf zweischneidig Schwert«. Solch ein Schwert schlug »die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden und sinds nicht, sondern sind des Satans Schule«. Bei den Juden hat der Gotteskämpfer mit dem Wort seine ganze Furchtbarkeit entfaltet und die äußerste Strenge der Entscheidung verwirklicht. Er wurde, an der Verlorenheit des Volkes, Täter und Gewalttäter des Geistes durchaus, füllte sich mit glühender Inbrunst und fieberte im »Pathos der Forderung« (Buber). Bei den Juden trug der strafende, der rächende Geist das höchste Amt auf Erden; er nahm den Religiösen, den Dichter in sich auf und überbot sie; heißere, blutigere Weihen empfangend und gebend als sein milder Bruder, der Psalmist, der Troubadour Gottes. Er ist der Absolute, der den Meißel der Rede schwingt gegen den trägen schweren Menschenstoff dieser formlosen Welt. Ich treibe nicht Geschichtsklitterung, wenn ich sage: wir können heute wieder ermessen, was der Prophet bedeutete, als der Tempel fiel. Wir ahnen wieder diese Reinheit, diese Macht, diese Tragik. Wir lechzen wieder nach dem zornigen Segen eines allerjüngsten, allerältesten Gerichts. Einer Schöpfermacht gegenüber, die sich in Weltuntergängen, in Apokalypsen offenbart, gibt es für den kleinen, vergänglichen Menschen nur eine Reue: wie häßlich im Geiste er die Gaben des Friedens, die Gaben des Lebens genossen hat! Gibt es nur ein Gebet: daß ein Gott komme, auf den Trümmern der Kultur nun endlich auch den Geist zu richten, ohne Erbarmen Unrein von Rein zu sondern! Einer Saat von Eisen, Feuer, Blut, Tränen entkeimt das messianische Ideal.
Ist dieses Ideal jüdisch? Ist es christlich? Mag diese Frage entscheiden, wer heute noch beten kann; aber nicht, wem mitten im Gebete ein Gähnkrampf den Schlund der innern Ohnmacht und Leere aufreißt! Die Welt ist voll von Solchen, die da sagen, sie seien Juden, sind aber nur des Satans Schule. Sie wissen längst nicht mehr, warum die Rotte Korah vom Schwerte fallen mußte, warum Mose über sein Volk vierzig Wüstenjahre, Jahre des Todes verhängte; und warum er selbst auf dem Berge Abschied nahm, von wo aus er das gelobte Land sah, das auch er um seiner Sünde willen nicht betreten durfte. Sie erraten nicht mehr, was der Zorn der Propheten wollte, ahnen nicht, daß nur Eines not tut: Erneuerung, Wiedergeburt im Geiste; und wie toll ihre Phantasie ausschweifen mag, sie reicht nicht bis zur Heiligung. Sie wähnen, die Flüche ihrer weiland Gottesmenschen seien aus dem Knechtessinn erflossen vor einem Götzen, so furchtbar, daß Keiner seinen Namen auszusprechen gewagt hätte. Jetzt buchstabieren sie munter den Namen, der ihnen nichts mehr bedeutet, und gemerkt haben sie sich nur den Fluch, in ihre Nerven eingegraben blieb allein die Rache. Wer ist nun der Heutige, der es wagt, die Donnerworte in seine zeitbestimmte Rede einzureihen und mit den Runen der strafenden Offenbarung zu spielen wie ein Kind mit dem Zepter des Todes? Der Ausgeborene ihrer Geistesunzucht: darf er seine Ausgeburt des Hasses dem hellen Tage zeigen? Der Artist der Schmähung: fürchtet er nicht, daß ihn mitten im Schnauben seiner Bosheit ein Erzväterblick treffe und ihn zur Sodomssäule erstarren mache, mitten in seiner verruchten Zeile? Mögen sie ihn – und verstünden sie noch ein andres Zeichen – daran als einen Juden erkennen, daß er die große Tradition des Fluches zu wahren und den Fluch zu vollziehen weiß bis ins Kleinste ihrer Kleinheit! Mehrt er nicht ihr Urerbe, und wenn nur um einen paradox geschliffenen Splitter im Auge seines Nächsten? Seine Übertriebenheit erweckt die übertriebensten Vorstellungen vom Jüdischen wieder; die Juden hatten längst nicht mehr die innere Macht, sich so zu übertreiben. Er macht die berüchtigten Qualitäten literaturfähig: die Unduldsamkeit, die Rachsucht; die Halsstarrigkeit; die immer tiefer fressende Entzweiung, die bloßlegend durch Form und Gehalt reißt; die Erbitterung, die schlaflos auf der Lauer unsrer Hinfälligkeiten und Sachfälligkeiten liegt; das Befremdende einer eigensüchtigen Intensität, die gewaltsam anzieht und abstößt; die dunkle Verbohrtheit einer Konzentration, welche wie eine chinesische Marter hernimmt. Karl Kraus war nicht der »Satiriker«, wie sie ihn meinten, der Spaßbold ihrer Zeitschriften, wenn er mit der verbissenen Kleinarbeit seines Mutterwitzes und Väterernstes den subtil und atomistisch gewordenen Juden- und Christengeist wie mit Nadeln aus jeder Pore der Zeit heraustrieb; wenn seine satirische Schärfe bis auf die nackte Menschlichkeit durchätzte; wenn seine Komik die Verlogenheit, die geheuchelte Idealität so stellte und einengte, daß es kein Entrinnen mehr gab. Peinlicher war kein Pathos je beglaubigt; aber sie spüren alle, alle die Beglaubigung im Blute, wenn sie es auch nicht zugeben wollen. Und wenn seine Anti-Reflexion mit infernalischer Wut die Allerweltsmeinung umschlang, um dem falschen Ton der Rotte Korah das Herz herauszupressen; dann bäumte sich ein Orgasmus des Zornes und des Fluches auf; ein Fieber der Rache und der Verkündigung raste, daß sich ein Steinchen vom alten Tempel loslösen mochte, um in die leere Tiefe der Zeit zu stürzen. Kein Zweifel: Karl Kraus ist ein Erzjude.
Wenn ich ihn so nenne, möchte ich damit das Literatur- und Kunst-Judentum der emanizipierten Gegenwart nicht verleumdet haben. Die alte Eigenart hat sich zwar allerorten erhalten, aber nobilitiert, vom jüdischen Dämon gereinigt. Aus dem Propheten war der Publizist geworden und zuletzt der Sonntagsplauderer, in dessen Damenschnaps man kaum noch ein Rüchlein der einstigen Essenz wird nachweisen können. Da war noch die Zweiheit von Rechtseifer und Gefühlsweichheit, von Witz und Schwärmerei; nur weitläufig abgeflaut. Statt des Rachegeistes eine Kastration, die Ironie; statt der fressenden Vernunft die zahnlose Klügelei; statt der verzückten Inbrunst die fettige Verlogenheit. Noch mit dem jüdisch Menschlichen, Allzumenschlichen, der Empfänglichkeit und Plastizität des seelischen Rohstoffes war derart Schindluder getrieben worden, daß der »Psychismus« heute als eine jüdische Unart gilt. Und so weit hat es die jüdische »Utiliteratur« gebracht, daß sie heute alle Spielarten aufweist, nur keine eigene. Wer erblickt nicht – mit Karl Kraus – auf dem Grunde dieser Entwicklung das gefährlich reizvolle Spiel Heinrich Heines? Auf keinen prominenten Juden paßt so wie auf Heine das Wort Weiningers: »Wenn also im Juden vielleicht noch immer die höchsten Möglichkeiten, so liegen doch in ihm die geringsten Wirklichkeiten; er ist wohl der zum Meisten veranlagte und doch zugleich der innerlich des Wenigsten mächtige Mensch.« Heine hat alles angeregt, Echtes und Falsches, was vom Judentum ausgehen kann. Daß zuletzt nur noch das Falsche von ihm kam, will die Schrift »Heine und die Folgen« erweisen durch eine verblüffende Luftlinie der geistigen Entwicklung, die von Heine zielsicher in die moderne Niederung führte. Heine selbst hat mit allen jüdischen Möglichkeiten gespielt, auch mit den heiligsten. Von Heine aus ließe sich sogar das biblische Heroentum wieder aufbauen, wenn gewisse eingesprengte Stellen als ein produktives Zentrum wirken könnten. Heine ist auch – wie Kraus sagen würde – der »Vorahmer« des erotisch-ästhetischen, des künstlerischen Durchbruchs durch den »Dekalog« und den cant des Rabbinismus; einer tiefen Rassenerschütterung, einer erneuernden Blutbewegung, deren paradoxe Zeichen ich im Werke des Karl Kraus nachgewiesen habe. Heine springt mit beiden Füßen ins Europäische; und dort steht er, dort schwankt er! Haltlosigkeit ist das Stigma seiner kosmopolitischen Haltung. Und wie soll einer Halt haben, der weder in einem Volke noch im Geiste eine Wurzel haben und halten will? Heine konnte alles Mögliche: das Sabbathlied und das katholische Wunder und die protestantische Vernunft; die Drolerie, die Gascognade und die schlichte Wucht des deutschen Michels; die Hybris des Ästheten und das demokratische Herz; die sexuelle Libertinage und die Schrift gegen Platen; die Beziehung zu Rothschild und die Barrikade. Das alles zusammen ergibt für das Liederbuch seiner Jugend dennoch kaum ein erfülltes Gedicht. Ein Schein von Liebe nur in diesem Mai, ein Schein, der das Gefühl narrt; Pfiffigkeit foppt die Leidenschaft und entwischt. Alles ist nur Spiel, aber ohne den kindlichen Ernst der menschenwürdigen, der göttlichen Spiele. Was übrig bleibt: Sentimentalität und Ironie, der Entscheidung ausweichend, in Schwebe, Tat vermeidend. Was die Ästheten an Heine entzückt, ist der Takt, mit dem er jeder Entscheidung entgeht. Diese Unverbindlichkeit halten sie für geistige Freiheit. Was da zuletzt übrig blieb: der revertierte Konvertit; der untragische, nur kranke Jongleur zwischen Empfindung und Spott, zwischen Jüdisch und Europäisch; der das Schicksal seines Volkes sah und beklagte und bewitzelte; der Zauberer seiner Geschicklichkeit ohne die letzte Kraft der Entscheidung. (Karl Kraus vergißt nicht, daß Heine als der arme Lazarus endete und als ein wahrer Dichter; da hatte das Leben, energisch genug, Ernst gemacht und an seiner Statt entschieden.) Mag ihm eine allgemeine Demokratie der Seele und des Standes eine gute Erinnerung bewahren; mögen zukünftige Revolutionen ihn als Ahnherrn preisen: der Stolz und die Demut des wahren Juden gedenken seines trügerischen Zaubers mit Schmerz und Scham. Eine nach seinem Beispiel, und ohne sein Talent, gebildete Generation ergab zunächst doch nur die gefährlichste Weltgeläufigkeit in Politik, Kunst, Wissenschaft und Journalistik. Da hätte nichts andres entstehen können, als eben entstand: die entsetzliche, alleskönnende, teuflisch betriebsame Geschicklichkeit assimilantischer, kapitalistischer, intellektualistischer Artung. Deshalb mußte sich ein Züchtiger und Selbstzüchtiger wie Karl Kraus mit Erbitterung gegen den »ungezogenen Liebling der Grazien« wenden, wenn er den zeit- und weltläufigen Intellekt im eigenen Ich satirisch untergraben und bis zur Wurzel durchstoßen wollte. Damit hatte er zugleich das pseudo-jüdische Wesen in einer ernsten Einsicht überwunden.
Karl Kraus, der Erzjude – dessen Geistesanlagen heute niemand besser deuten könnte als Martin Buber, der einzige bewußte Verkündiger jüdischer Geistes-Tiefe und -Hoheit, der einzige wahrhaft Wissende um den jüdischen Geist – darf ein Ketzer scheinen, ein Verräter am materiellen Interesse, am Welterfolg seines Mitjudentums: um den Preis, einen pseudojüdischen Ehrgeiz vor die Stirn zu schlagen, der weder echter Natur noch echtem Geiste entspricht; und der auf die tiefe Wurzel gern verzichtet, wenn er nur im allgemeinen Raubbau der Ära, im Spekulantentum einer entwurzelten Zivilisation die eigne Volkskraft, die Volksseele mit verbrauchen darf. Hier hat der Krieg sein Pamphlet mit Blut geschrieben. Heute müßten – so sollte man glauben – die jüdischen Opfer, die Gefallenen und Vertriebenen, die Enteigneten und die Drangsalierten (nächst den Bekennern der Pflicht) das Übergewicht erlangt haben über die skrupellosen Gewinner, denen kein Bankerott schadet, am allerwenigsten aber der Bankerott der Seele. Heute ist ja die jüdische Verlorenheit nur der geringe Bruchteil einer allgemeinsamen Rettungslosigkeit. Aber den Juden schmerzt immer die jüdische Schuld. »Im Kampf gegen sie entzündet sich allezeit die spezifische Genialität der Propheten und Lehrer Israels; sie ist eine kämpferische Genialität, und die jüdische Fruchtbarkeit ist eine kämpferische Fruchtbarkeit. Im Gegensatz zu der des Abendlandes, die auf das Werk geht und an ihm ihre Grenze hat, hat die jüdische Produktivität Form, aber keine Grenze; sie hat, darf man wohl sagen, die Form des Unendlichen, denn sie hat die Form des Geisteskampfes.« (Buber.) So entsteht immer wieder »die jüdische Lehre von der Entscheidung und der Umkehr«. Aber der Führende ist heute in der Regel ein Vereinzelter, wie Karl Kraus oder Otto Weininger, aus dem Zusammenhang des Weges gerissen, mit schrecklicher Unbedingtheit auf seinen Geist gestellt; vereinsamt bis zur Lebensgefahr. Was er gestaltet, ist das heutige Nonplusultra an Paradoxie einer solchen jüdischen Existenz; die gradezu selbstmörderische, jedenfalls selbsthassende, wenn nicht selbstverachtende Verzweiflung der messianischen Prophetie. Grade weil Geister dieser Art mit ganzer Inbrunst die schauerliche Tragik des jüdischen Zustandes in ihrem ehrlichsten Wollen erleben, versuchen sie jedes historische Band zu zerreißen und als nackte Einzelne, vom toten Ballast befreit, den Boden der Idealität jenseits aller Gegenwart zu erreichen – wenn sie nicht, wie die jüdischen Sozialisten, Anschluß gewinnen an eine allmenschlichere Zukunft. Jedenfalls: was sie dem Verfall, der Vernichtung des unmittelbaren, des heroischen Juden aus ihrer eigenen Brust entgegenzusetzen haben, ist wieder nur, in solcher Verkleidung oder in welcher Form auch immer, die urjüdische Idealität. Mag der Schüler Europas die Verwirrung der Seinigen, mit der rasenden Parteilichkeit gegen blutsverwandte Fehler, an fremden Werten messen: er sucht doch immer nur den eigenen Wert, erhärtet immer nur die eigene Art. Und wohl ihm, wenn er findet, wenn er hart wird in sich selbst! Dahin hat den Satiriker nicht sein Witz geführt, sondern die Sinnlichkeit, jene tiefere Schicht. Otto Weininger fehlte solche Hilfe im Blut. Er war der abstrakten Not ungeschützter preisgegeben, ihm mangelte das Künstlertum, das ihn hätte erhalten können. Er war schroffer noch, großartiger, unversöhnlicher veranlagt, ärmer an Gnade; die Natur hatte gegeizt. Wie verstand er, was dem Judentum fehlte: »das unmittelbare Sein, das Gottesgnadentum, der Eichbaum, die Trompete, das Siegfriedmotiv, die Schöpfung seiner selbst, das Wort: ich bin.« »Innerliche Vieldeutigkeit, ich möchte es wiederholen, ist das absolut Jüdische, Einfalt das absolut Unjüdische.« Wie tief erfaßt er, warum sich der Jude an die Realität mit wilder Gier klammert: »Weil er nichts glaubt, flüchtet er ins Materielle; nur daher stammt seine Geldgier: er sucht hier eine Realität und will durchs »Geschäft« von einem Seienden überzeugt werden – der einzige Wert, den er als tatsächlich anerkennt, wird so das »verdiente« Geld.« »Es ist wie ein Zustand vor dem Sein, ein ewiges Irren draußen vor dem Tore der Realität.« »Das frömmste Volk der Welt sind die Griechen gewesen« – welche verzweifelte Sehnsucht hat einen Juden zu dieser Erkenntnis gebracht! Und dann: »Der Jude singt nicht.« Dieser Schrei steigt mit Tränen herauf. Kein Zweifel, das Pamphlet Weiningers ist die tiefste Schilderung der Diaspora, die es gibt. Er nahm sie, in seinem Amoklaufen der Ideensucht, für das absolute Wesen des Judentums. Und mit einem gewissen metaphysischen Rechte; denn so betrachtet muß das jüdische Wesen an einem Volksschicksal, das unter den Völkern einzig ist, mitschuldig gewesen sein; wenn auch nur in dem Sinn, daß dieses Volk um jeden Preis dem Untergang entgehen wollte, sei es auch um den Preis der Diaspora. Die so vermiedene, die so hinausgeschobene Entscheidung zwischen Leben und Tod kann auf die Dauer nicht umgangen werden. Die rätselhafte, wunderhafte Zähigkeit der Selbsterhaltung läßt auch den Skeptiker vermuten, daß die historische Mission der Juden noch nicht beendet sei. Das immer neue Aufflammen der jüdischen Idealität und Prophetie bezeugt die nicht erloschene geistige Mission.
Martin Buber glaubt an eine religiöse Erneuerung des jüdischen Volkes, das sich allerdings nicht in irgend einem Auch-Staat, sondern gewiß nur in einer idealen Gemeinschaft, in einer Heiligen-Geist-Siedelung wiederfinden könnte. Weininger dagegen glaubt ausschließlich an die religiöse Möglichkeit des Einzelnen als eine große schöpferische Möglichkeit. Dieser tragische Jude, der am Judentum so furchtbar gezweifelt hat wie noch nie ein Mensch, schreibt den Satz: »Vielleicht ist er (Jesus) der einzige Jude und wird es bleiben, dem dieser Sieg über das Judentum gelungen: der erste Jude wäre der letzte, der ganz und gar Christ geworden ist; vielleicht aber liegt auch heute noch im Judentum die Möglichkeit, den Christ hervorzubringen, vielleicht sogar muß auch der nächste Religionsstifter abermals erst durch das Judentum hindurchgehen.« Weininger konnte dieses rettende Ereignis nicht abwarten. Er versuchte sich an dem strengsten kategorischen Imperativ der Individual-Ethik festzuhalten – und versank. – Karl Kraus, der Satiriker, war kräftiger für den Zustand vor der Erfüllung solcher Träume ausgerüstet. Er konnte sich den Selbsthaß erleichtern, indem er ihn gerechter Weise auf alle Kinder der Zeit, Juden und Nicht-Juden, verteilte. Die Entscheidung, an der er unmittelbar, an der er zum Künstler wird, ist das Nein, das er gestaltet. Was das Judentum anlangt, so lehnt er den äusserlichen Erfolg mit Erbitterung ab und wehrt sich gegen den Verlauf der Dinge. Er sieht auch seinerseits, wie Weininger, nur über- und unterjüdische Lösungen. Er dringt fanatisch auf das Fundamentale, er hungert und friert nach dem Absoluten; er fragt und fordert; und sieht die Werte des höhern Lebens, die er mit schrecklicher Unduldsamkeit erstrebt, grade durch seinen mißratenen Bruder, den erfolgreichen Verweltlicher, bedroht. Er verzehrt sich, mitten in der brutalsten Realität, nach idealer Reinheit, und endet damit, auch diese Sehnsucht künstlerisch zu gestalten. Der Fanatismus, mit dem die Rotte Korah aller Zeiten am absoluten Stoff hängt, ist nicht unerbittlicher und zäher als der Fanatismus, mit dem dieser Einzelne nach dem absoluten Geiste drängt. Ein Mann wie Karl Kraus ist noch nicht der unmittelbare, der gläubige, der metaphysische Jude, er ist aber auch rein menschlich noch nicht der große Gerechte, der Erfüllende. Satire: das ist noch nicht Wahrheit, noch nicht Menschlichkeit. Und Kunst, Geist: das ist noch nicht Religion. Aber wie die schöpferische Eigenart – wenn man genau zusieht, nicht weniger als bei Mahler und Schönberg, bei Altenberg und der Lasker-Schüler – von religiösen, von prophetischen Elementen stark durchdrungen ist; so reicht das, was er in der empfänglichen Seele, und so eines Tages auch in der allgemeinen Seele, bewirkt, weiter vielleicht als bei den andern allen über die Kategorien des Ästhetischen hinaus; und die unbedingte Geist-Wirkung fällt bereits in die religiöse Kategorie. Und weil Karl Kraus seine Intentionen immer nur am einzelnen Fall, am Detail, jedenfalls am Konkreten dartun kann: so hat er seine religiöse Innerlichkeit, das Tiefste seines Wesens, in die Gestaltung und Erkenntnis seines Sprachgefühls gepreßt. Seine Sprachphilosophie ist kein Theorem, sondern ein religiöser Kultus. Um zu zeigen, ein wie tiefer Wesenszug der urjüdischen Seele hier in einem vereinzelten guten, ja besten Europäer durchbricht, will ich aus Bubers Buch »Vom Geiste des Judentums« zitieren, was die Chassidim, also ostjüdische Volksmystiker, von der Sprache sagen: »Man soll die Worte sprechen, als seien die Himmel geöffnet in ihnen. Und als wäre es nicht so, daß du das Wort in deinen Mund nimmst, sondern als gingest du in das Wort ein.« »Denn in jedem Zeichen sind Welten und Seelen und Göttliches, und sie steigen auf und binden sich und vereinigen sich miteinander, und danach vereinigen sich die Zeichen, und es wird das Wort, und die Worte einen sich in Gott in wahrhafter Einung, da ein Mensch seine Seele in sie geworfen hat, und alle Welten einen sich und steigen auf, und die große Wonne wird geboren.« Karl Kraus gegen Heine: »Das Geheimnis der Geburt des alten Wortes war ihm fremd. Die Sprache war ihm zu Willen. Doch nie brachte sie ihn zu schweigender Ekstase. Nie zwang ihn ihre Gnade auf die Knie. Nie ging er ihr auf Pfaden nach, die des profanen Lesers Auge nicht errät, und dorthin, wo die Liebe erst beginnt. O markverzehrende Wonne der Spracherlebnisse!«
So (nur so) wird das »rassenfremde« Wort geboren, von dem ein Rassenphilosoph die Rettung des Ario-Germanentums und ein gläubiger Christ die Erneuerung der Innerlichkeit, des wahren Geistes erhofft. Denn die Befruchtung des Geistes geschieht durch die Art und Eigenart; der absolute Geist aber, die Frucht, kennt kein artliches Vorzeichen. Es ist die Frucht des allgemeinsamen Lebens.
»Fürchtet den Dichter nicht, wenn er edel zürnet: sein Buchstab
Tötet, aber es macht Geister lebendig der Geist.«
Hölderlin.
Otto Weininger – in seinem posthumen Buch »Von den letzten Dingen«, das zeigt, wie ein bis zur völligen Selbstaufgabe verzehrtes Gemüt gegen die Überfälle seiner eigenen metaphysischen Genialität immer wehrloser wird – erblickt die transzendente Seelennichtigkeit jenes Judentums, das er in sich selber fürchtet und in der Welt draußen verabscheut, als in dem Geschlecht der Fliegen verkörpert. Das Fliegenhafte, Fliegenartige und nichts andres, geistig genommen, international erfaßt, ist der Stoff der Satire eines Karl Kraus. Weininger, in derselben Epoche seines Denkens, knapp vor dem Selbstmord, drängt seine ganze Ethik in ein einziges metaphysisches »Sei!« zusammen. Um nichts andres als um dieses »Sei!« ringt heute in seinen Tiefen und Höhen, physisch und geistig, vom Wucher bis zum Messianismus, das entwurzelte, zerrissene jüdische Wesen, krankhaft und krampfhaft. Und ringt, nicht weniger gefährdet, die ganze europäische Menschheit. Wie gefährlich schwer besonders der Jude, der »nicht singt«, es hat, wo es um das Höchste geht: dafür ist Weininger ein Beispiel, in der Mitte zwischen dem Heiligen und dem Beklagenswerten.
So weit Karl Kraus reicht, in allen Stadien seiner Individualität, hat er das »Sei!« fanatisch verwirklicht. Er setzt – in der Glosse »Er ist doch ä Jud« – den Satz der »Rassen-Antisemiten«: »Aus der Rasse kann man nicht austreten«, fort: »Ich habe aber das unbestimmte Gefühl, daß man auch aus dem Leben nicht austreten kann, wenn man sich gleich umbringt, und daß man, ohne sich umzubringen, jenes höhere Leben des Geistes führen kann, dem man doch rettungslos verfallen wäre, wenn man sich umbrächte. So glaube ich wohl, daß man auch innerhalb der Rasse jenen höhern Zustand bewähren kann, der einmal keiner Rasse versagt war, oder der, ihr einmal erreichbar, sie nie unerträglich gemacht hätte. So ist es mir wohl auch möglich, Eigenschaften zu hassen, die ich auf jenem Stand der Judenheit, wo sie sich noch nicht von Gott selbständig gemacht hatte, vergebens suchen würde.« »Ich glaube von mir sagen zu dürfen, daß ich mit der Entwicklung des Judentums bis zum Exodus noch mitgehe, aber den Tanz um das goldene Kalb nicht mehr mitmache und von da an nur jener Eigenschaften mich teilhaftig weiß, die auch den Verteidigern Gottes und Rächern an einem verirrten Volke angehaftet haben. Ich weiß nicht, was heute jüdische Eigenschaften sind. Wenn es nur eine gibt, die alle andern, bessern verstellt, Machtgier und Habsucht, so sehe ich die auf alle Völker des Abendlandes gleichmäßig und nach dem Ratschluß teuflischer Gerechtigkeit verteilt, und wenn es dann nur noch eine gibt, den singenden Tonfall, in dem sie ihre Geschäfte besorgen und besprechen, so sage ich, daß ihn die andern auch treffen, denn es ist der Tonfall, der das Rollen des Geldes wohlgefällig begleitet.« »Wenn wir aber auch zugeben, daß hundert Jahrgänge sämtlicher antisemitischer Drucksorten ein feiges Stammeln sind neben der Sprache, die eine einzige Glosse der »Fackel« spricht, so wollen wir doch der Tendenz solchen Judenhasses die Ehre lassen, daß sie zu einem Ursprung strebt und nie zu einem Ziel.« »Solcher Judenhaß« dichtet beim Anblick eines Herrschaftsdieners die Strophe: »Der Diener ist schon alt, als hätt' er viele Jahre, Schon Gott gedient, so sieht er in die fremde Zeit. Zehntausend Juden sind nicht wert dies eine, wahre, Einfältige Gesicht voll Dienst und Dankbarkeit.« Und streift im »Gebet an die Sonne von Gibeon« das Sakrileg, einem biblischen Urtext die Lesart des Hasses unterschiebend, um sich darüber zur biblischen Gewalt einer religiösen Läuterung zu erheben. Am tiefsten aber hat Karl Kraus seine Anschauung von den beiden Gegenkräften, die im jüdischen Wesen wirken, ausgedrückt (seine unwillkürliche Anschauung unwillkürlich ausgedrückt), als er, das Judentum garnicht meinend, die beiden Arten des Geistes, den Geist, den er liebt, und den Geist, den er haßt, und deren Weg durch die weite Welt, durch die Menschheit in dem orphischen Epigramm »Zwei Läufer« schilderte:
»Zwei Läufer laufen zeitentlang,
der eine dreist, der andre bang:
Der von Nirgendher sein Ziel erwirbt;
der vom Ursprung kommt und am Wege stirbt.
Der von Nirgendher das Ziel erwarb,
macht Platz dem, der am Wege starb.
Und dieser, den es ewig bangt,
ist stets am Ursprung angelangt.«
So spricht bei Karl Kraus »Gott« zum »sterbenden Menschen«: »Sahst hinter dich und suchtest meinen Garten. Du bliebst am Ursprung. Ursprung ist das Ziel.« Die Welt – als ein Irrweg, Abweg, Umweg zum Paradiese zurück. Und so versuche ich denn auch die Entwicklung dieser merkwürdigen Begabung zu deuten: Intellektualität als ein Abweg, der zur Unmittelbarkeit, zum Geiste zurückführt. Publizität – ein Irrweg zur Sprache zurück. Die Satire – ein Umweg zum Gedicht.
Stofflich war der kühnste Vorstoß und Durchbruch gegen die Unmittelbarkeit, gegen den Ursprung hin geschehen, als es um den Eros ging. Hier fand sich der radikale Selbstbekenner so weit voran ins Urlebendige gestellt, wie in dieser Richtung kaum ein Andrer vor ihm gestanden hatte. Es gab kein Zurück auf diesem Wege, es gab nur ein Durch zu sich selbst. Ein Durch zum Geiste. Da der Eros, den er suchte, ein schaffender Eros war, befand sich der Denker auf einem schöpferischen Wege. Karl Kraus mußte nicht wissen, daß dieser Durchbruch – durch die Paradoxie zum Elementaren – von einer gewaltigen Krisis seiner Rasse angetrieben wurde. Ihm genügte zu wissen um die gewaltige Krisis Europas.
Karl Kraus mußte nichts ahnen von dem Problem, daß er, der Jude, in einer fremden Sprache zum Wort kam. Wie diese fremde Sprache ihm zur eigenen wurde, das war sein schöpferisches Erlebnis und sein tiefer, leidenschaftlicher, geduldiger Dienst um jeden Buchstaben, um jedes Satzzeichen. Er hat die deutsche Sprache nicht nur vorgefunden, als er in sie hineingeboren wurde, weil er in ihr Kind war: er hat sie auch erwählt mit der Liebe des Mannes. Er hat in ihrem Geiste sein Werk gezeugt. In jener Glosse »Er ist doch ä Jud«, wo Karl Kraus sein Nicht-Wissen um jüdische Eigenschaften trotz seinem bessern Wissen darum und darüber hinaus beteuert, weiß er alles, was er glauben will. »Und weiß dabei nicht, ob es eine jüdische Eigenschaft ist, an jeden Atemzug, den ein Gedanke braucht, um Wort zu werden, so viel Leidenschaft und Weltentbehrung zu wenden, daß man es einem Werk von fünfzehn Jahren nicht ansieht, und so die Zeit zu vergeuden, die sich die Händler und Genießer der Literatur nur vertreiben wollen.« »Ich weiß das alles nicht. Wie es mit mir beschaffen ist, kann ich nicht sagen, wenn es nicht aus meinem Lebenswandel ersichtlich ist. Ich glaube, daß hier, wie überhaupt bei der Erschaffung des Menschen und bei der Erschaffung der Werke durch den Menschen, höhere Einflüsse im Spiele sind, als sich bei gebildeter Betrachtung des Rassenproblems zeigen mag.« Eine Ahnung von seinem problematischen, aber lebendigen Verhältnis zur deutschen Sprache spricht aus dem epigrammatischen Gedicht »Bekenntnis«: »Ich bin nur einer von den Epigonen, Die in dem alten Haus der Sprache wohnen.« »Doch hab' ich drin mein eigenes Erleben, Ich breche aus, und ich zerstöre Theben.« Während das Ende dieses Gedichtes von der Sprache fort in den vererbten Seelengehalt weist, in den tiefern Ursprung des Sprechers einer wahlverwandten Sprache: »Bin Epigone, Ahnenwertes Ahner. Ihr aber seid die kundigen Thebaner.« So, zwischen Wissen und Ahnen, durchdrang er die Sprache mit seinem Wesen, sein Wesen mit der Sprache. Und indem er aneinander, ineinander beides unablässig reinigte und steigerte, den menschlichen Gehalt und die Sprache, wurde seine Glosse zur Kunstform, sein Fühlen, Meinen und inneres Tun zur eigenwüchsigen Reflexion, und aus der Reflexion schälte, löste sich der Kern, das Gedicht los. Das Gedicht, das jenen irrationalen Rest des Geistes verwertet, den man nur fühlen, ahnen, glauben kann.
»Es werde immer wieder Licht, Es war schon da und sammle sich wieder aus der Farbenreihe. Wissenschaft ist Spektralanalyse: Kunst ist Lichtsynthese. Der Gedanke ist in der Welt, aber man hat ihn nicht. Er ist durch das Prisma stofflichen Erlebens in Sprachelemente zerstreut, der Künstler schließt sie zum Gedanken. Der Gedanke ist ein Gefundenes, ein Wiedergefundenes.« Das Gedicht ist bei Karl Kraus ein Stadium dieses organisierenden Prozesses. Von Anfang an war seine Prosa durchsetzt mit lyrischen, dramatischen, bildhaften Elementen. Die Anteilnahme am Stoff war eine urpersönliche; der Satiriker war ein Verletzter, und die Intensität der Verletzung trieb die mit dem Stoffgewicht des Tages belasteten Streitschriften in die gehobene Sprache, in die Dialektik und Rhetorik des Kämpfers, in den Rhythmus der Leidenschaft. So wurde der Satiriker zum Dichter, indem er sich über die Aktualität erhob (während die Dichter heute nur allzuleicht der Überredung dringlicher Tatsachen erliegen). Die rhythmischen Satiren des Karl Kraus verdichten sich bis zum Monumentalen, sie deuten den einzelnen Fall zur Zeitlosigkeit empor, und die Haltung des Satirikers wird mythisch, wird zu der des alttestamentarischen Zürners. Die Kraft der Darstellung erweist sich als ungeheuer, zumindest aber als ungeheuerlich; der Haß, der Zorn, der strafende Eifer erreichen ein Maß und Unmaß des Überlebensgroßen. (Tod und Tango; Eine Prostituierte ist ermordet worden; Die Fundverheimlichung.) Hierher gehören die Kriegsgedichte (darunter: Eeextraausgabeee–!; Beim Anblick einer Schwangeren; Die Leidtragenden; Mit der Uhr in der Hand; Gebet), von denen Siegfried Jacobsohn mit Recht sagte, er sei »neugierig, wie unsre Kriegsgedichtsammler einmal verantworten werden, daß sie den Dichter übergehen, vor dem selbst ihre Parade-Autoren verblassen. Er ist das Schwert, er ist die Flamme, und seine Schläg' und Gluten sind von allen dadurch unterschieden, daß sie die Opfer anderswo als bei den Feinden suchen«. Nämlich bei den Eigenen. Die Höhe dieser Gedichte, die kein Vorbild haben, erschwingt das persönlichste Pathos, ihre Gefahr ist die Rhetorik. Eine Gefahr, der ein so verzehrender Fanatismus niemals allzunahe kommt.
Aber die Kunst des Karl Kraus gräbt tiefer noch ins Innerste hinein. Er konzentriert sich auf die Urform des satirischen Erlebnisses, sucht dessen Wurzel zu fassen oder das metaphysische Ziel der satirischen Intention zu deuten. So entsteht das angeschaute zufällige und persönliche Ereignis: die Lyrik. Solche jetzt in Versen selbständig werdende Gefühlszartheit verdeutlicht, ein wie zartes Gefühl hier von Anfang an verletzt wurde. Das Gewissen des Satirikers schlüpft in den innersten Empfindungsmittelpunkt der Erscheinung und bewaffnet sie nach außen hin mit Stacheln. So geharnischt und gefeit, steh auf, Leben, und wandle! Diese Gebilde (Elegie auf den Tod eines Lautes; Die Krankenschwestern; An einen alten Lehrer; Epigramm aufs Hochgebirge; An den Schnittlauch; Bekenntnis) sind auf entfernten Wegen zur Urform des Epigramms oder des Sinngedichts zurückzuführen, erheben sich aber über diese Formen durch den dichterischen Zauber, der sich offenbart, indem das Weben der Sprache sich mit dem Walten des Gefühls geheimnisvoll verquickt.
Es ist nicht leicht, sich in diese eigenwilligen Prägungen, in diese Bohrungen durch die Sprachlogik hineinzufinden, hineinzuleben; bis man erfährt, daß diese Schachte, diese Schrauben ins Edelmaterial der Sprache, dort, wo es hart und echt ist, führen – daß sie Goldadern des Sinnes unverhofft bloßlegen und auf liebliche Quellen treffen, Melodisches hervorsickern lassend. Diese Gedichte sind unbequem, sie beunruhigen durch ihre gedankliche Konzentration; und ihre sprachliche Konzentration zwingt das Ohr, sich gegen sie zu wehren. Diese Gedichte muten, in einer Literatur von Könnern, Technikern, Tausendsassas der Gelenkigkeit gradezu linkisch an und schwerfällig, als die Erzeugnisse eines strengen Ernstes, der nicht alles kann, sondern das Seinige muß. Das gequält Denkerische daran, das Aphoristische, wird belebt von jener Irrationalität, die einen Kämpfer wie Karl Kraus zum Dichter macht: vom Blitzartigen und Hauchartigen, vom Ungreifbaren, Imaginären des Daseins, das nur erhascht und wie flüchtig in das Spiel der Worte gebannt werden kann. Und dieser Zauber, diese Innerlichkeit geht über das geistige Glück des Aphorismus weit hinaus.
Und immer weiter hinaus. Welch eine Entwicklung des Dichters zwischen »Worten in Versen I« und »Worten in Versen II«, von denen Eins (im Verlag der Schriften von Karl Kraus, Leipzig, 1916) erschienen ist, Zwei sich aus den seither in der »Fackel« veröffentlichten Gedichten ergibt. Die Satiren, die Zeitgedichte treten zurück, die Kindheits- und Liebesgedichte treten vor, das Persönliche (Autobiographie des lyrischen Ichs) überwiegt immer mehr das Soziale, das Visionäre zehrt das Satirische auf. Ein verlorenes Paradies taucht wieder empor, das Paradies der Kindheit, des Eros, der Natur, der Sprache, des Traumes. Etwa in »Verwandlung«:
»Heute ist Frühling. Zitternder Bote des Glücks,
»kam durch den Winter der Welt der goldene Falter.
»Oh, kniet, segnet, hört, wie die Erde schweigt.
»Sie allein weiß um Opfer und Träne.«
»Siehe, so führt ein erstes Menschenpaar
»wieder ein Gott auf die heilige Insel!«
Oder »Wiese im Park«:
»Wie wird mir zeitlos. Rückwärts hingebannt
»weil ich und stehe fest im Wiesenplan,
»wie in dem grünen Spiegel hier der Schwan,
»Und dieses war mein Land.
»Die vielen Glockenblumen! Horch und schau!
»Wie lange steht er schon auf diesem Stein,
»der Admiral. Es muß ein Sonntag sein,
»und alles läutet blau.«
»Nicht weiter will ich. Eitler Fuß, mach halt!
»Vor diesem Wunder ende deinen Lauf.
»Ein toter Tag schlägt seine Augen auf.
»Und alles bleibt so alt.«
Was sich so im ersten Bande in einigen Gedichten eröffnet hat, durchströmt seither als Grundgefühl, als gewonnene lyrische Seele die ganze Produktion und greift auf die entferntesten Stofflichkeiten dieser innern Welt über. (Zuflucht; Abenteuer der Arbeit; Fahrt ins Fextal; An einen alten Lehrer; Alle Vögel sind schon da; Memoiren; Vor dem Einschlafen; Der Ratgeber; Der Reim; Landschaft; Gebet an die Sonne von Gibeon; Als Bobby starb.)
Diese Gedichte sind das zarteste, innerste, letzte Ja des Verneiners, seine eingestandene Menschlichkeit, sein einbekanntes Sehnen – ein letzthin Persönliches und zum ersten Mal restlos Überpersönliches; der »Garten«, den er, von der »Welt« sich abwendend, wiederfand (»Fern zeigt das Leben seine blutigen Scharten, An mir hat es sich selber wundgehetzt«. – »So zwischen Schmuck und Schönheit eingesetzt, Rückwärts die Welt und vorwärts einen Garten ersehend, bleibt die Seele unverletzt.«) Das Paradies! Ein vom Pöbel beschmutzter Adel des Fühlens hat sich gereinigt, geläutert. Das ist nicht mehr Reflexion, die ins Blühen geriet! Das ist Unmittelbarkeit. Freilich nicht die erste Unmittelbarkeit, angeschaute Natur, wie bei Goethe und Liliencron, oder romantische Natur, wie bei Hölderlin, oder der Mensch, der sein Inneres singt, wie bei Claudius, bei Mörike. Es ist die zweite Unmittelbarkeit auf der geistigen Ebene; metaphysische Unmittelbarkeit. Der Mensch singt nicht – er lauscht, er lauscht dem Echo vom Sange eines Traums. Das Glück des Elementaren, das vegetative Glück liegt ewig drüben, jenseits, unerreichbar. Ein Geisterbann hält sie zurück, eine unsichtbare, aber mächtige Grenze. Drüben liegt das gelobte Land; er darf es schauen, aber nicht betreten, der Kämpfer, – um der Sünden der »Welt« willen, in die er verstrickt war und verstrickt bleibt, weil es zutiefst, zuinnerst seine eigenen Sünden sind.
Wer ein lebendiges Ich, wie »groß« oder wie »klein« es sei, aber ein Ich, das ist und wirkt, ein Ich in seinem Widerspruch, der die Kräfte unendlich bewegt, in Worte zu fassen sich vermißt: der wird vielleicht die Merkmale ergriffen und darüber doch das Lebendige ausgelassen haben. Nachträglich mag er dann Schöpfeimer versenken und Netze auswerfen und auf alle Berge steigen, um es zu fangen! Das Lebendige ist beweglicher denn Quecksilber. Es brennt durch, taucht in die Tiefe, entspringt zur Höhe, entgleitet, verflüchtigt sich, wechselt Aggregatzustände und sitzt bald wieder an seinem alten Ort, als wäre nichts geschehen, lächelt listig und höhnt den Enttäuschten.
Karl Kraus, der Vorleser, wird jeden, der ihn vorher nur gelesen und nicht lesen gehört hatte, überraschen. Nicht daß er anders wäre, als man ihn sich vorstellen muß – als er ist! Aber die Energie, die Konsequenz der Durchführung überbietet auch den kühnsten Vorsatz, den der Leser im Geiste seines Autors gefaßt hatte. So wenig ist dieses Pathos gegen die Skepsis der Zeit gedeckt. Kein Burgtheater würde heute diese ungebrochene Tonfülle wagen, die ein Redner ohne Bühne und Kothurn erklingen läßt. Kaum ein Jüngling würde sich von der Unbesonnenheit seiner Jugend bis zu diesem Grade der hochtönenden Behauptung hinreißen lassen. Wir Gebildeten von heute sind aus tausend Verschämtheiten und Bedenklichkeiten gebildet. Unsre innere Unentschiedenheit nennen wir Geschmack. Unser geistiges Gewissen gibt vor, keine absolute Autorität dulden zu können – und auch nicht den Ton davon. Nur hie und da ein Dichter, der sich seinen Rhythmen anvertraute, als diese Rhythmen ihn eines Tages vor das Publikum trugen, fand den Mut, seiner herrischen innern Gewißheit nicht zu widerstehen und sie – fremdartig genug! – laut werden zu lassen. Richard Dehmel skandierte so und sang seine Ekstase eines dringenden Willens zur Kraft; oder Rainer Maria Rilke, tiefer als jeder Andre, vergab sich mit ganzer Seele und mit allen Sinnen an sein Wort! In Rilke war es – und beinahe blieb kein Rest! – Selbstaufgabe eines Vernunftwesens an die Inbrunst, Verschwingen und Verschweben eines Ichs in das Jenseits eines Zwischenzustandes, wo die Worte nicht mehr Worte, sondern musikalische Nervenfluida sind. Auf diesem Wege, nur nicht so wesentlich, strebten und streben ja auch die neu-romantischen Schauspieler von heute hinüber; hinüber zum Gesang, den sie nicht erreichen. Auf der Flucht vor unsrer Wirklichkeit, von Sucht und Sehnsucht gehetzt und dahingepeitscht, verstecken sie sich (und wäre es auch nur hinter der Hysterie) – vor dem Leben.
Während Karl Kraus, wenn er auch, von der Lyrik mitgenommen, auch er, in musikalische Tönungen und zuletzt in den Gesang abgleitet, doch immer wieder der exakte Sprecher ist und bleibt; die Energie des Inhalts nie verlierend; das Wesen und die Grenze der deutschen Sprache wahrend; die Konsonantenhärte, die Lautsprödigkeit, die Geistesstrenge jedes Wortes und des Satzes Sinn und Seele unverwischt behauptend – auf daß sich diese keusch geherzte Sprache nicht in romanische Vokal-Üppigkeit, in spielende Melodik, in sinnliche Klangschwelgerei verliere; nicht die Tonfarbe das Wort entkörpere und der Schwung die syntaktisch-logische Gedankenfolge zerreiße. Dieser Sprachrausch bleibt nüchtern, bleibt männlichen Geschlechts; diese Leidenschaft kennt kein andres Ziel als den sich frei quälenden Gedanken, den die Worte wirken und bauen. So gestaltet Kraus etwa, mit einer unvergleichlichen Kraft des Akzentes, die überreale Wucht einer Ballade von Liliencron. Oder er führt, den Regisseuren der Zeit entgegen, ein Drama von Shakespeare vielstimmig auf, indem er die eine führende Stimme in den Widerstreit der Gegensätze geraten läßt und das Steigen der blutbewegten Reflexion über die Klimax der Leidenschaft als eine urdramatische Tat der Sprache tut; und bedarf dabei der suggestiven Kulisse nicht, um die Phantasie mit einem Leser schwelgen zu machen, der zugleich ein Hörer und ein Sprecher und ein Täter ist. Und wenn er Hauptmann liest, wie Hauptmann geschrieben ist, dann wird es nebensächlich, wie nahe er den Äußerlichkeiten des schlesischen Dialektes kommt: er erreicht jedenfalls den treuherzigen Mystizismus, das innige Fabulieren dieser Mundart; und die Elendsmenschen sind nicht länger statistische Nachweise, sondern sie werden zu kindlichen Phantasten, den Herzenskindern eines Dichters. Oder Kraus schnellt die Tiraden des »kosmischen Hanswurstes« Nestroy los und entwirkt im Sprechgesang die natürliche Drastik einer satirischen Mundart. Oder er entfaltet die verschlungene und verwachsene Gefühlsallheit der Sprachschwärmerei und Gedankenlyrik Jean Pauls, dieser wahrhaft grenzenlosen All-Rede. Der Schauspieler in Karl Kraus darf nie die Diktion sprengen; er darf sie nur mimisch beleben und bereichern. Und alles Unmaß, alles Übermaß – denn Kraus hat, wenn seine Sprechgewalt entfesselt ist, nie genug; seine Steigerungen lassen die Fassungskraft des Hörers oft hinter sich, und seine Stimme kann immer noch, wenn das Ohr längst nicht mehr kann – findet stets zum Maß der kräftigen Sprache zurück. Ein durch berufsmäßige Theatergeherei innerlich abgetöteter Kritiker mag bei solchen Gelegenheiten nicht übel Lust verspüren, diesen Unband von einem Sprecher, dessen Wort unaufhaltsam durch und durch zu dringen entschlossen ist, vom Podium herunterzuschießen. Der echte Hörer gibt sich schließlich dem tyrannischen Sprachwillen hin und läßt sich gern besiegen, wo so entscheidend für den Geist und mit dem Geiste gerungen wird. Freilich muß ein so ungezähmter Wille immer wieder den veredelten Haustiergeschmack verletzen. Penetrant wie der Wille aber ist hier auch die Zucht, das Können; und die äußerste Exaktheit des Wortes, des Satzes, wenn sie erreicht ist, wie sie angestrebt wird, bewirkt am Ende die gereinigte Idealität der Sprache.
Wie Unvergleichliches nun auch der Einzelne solchem Kult der Rede verdanken mag: das Publikum würde dabei doch nicht auf die Kosten kommen. Karl Kraus kann das Publikum durch die Kunst des absoluten Wortes bezwingen, er kann es erziehen vielleicht und erbauen: aber er beglückt es nur, wenn er Karl Kraus liest. Und er macht es überglücklich, wenn er Karl Kraus den Satiriker liest. Da wird seine Sprache restlos Inkarnation, Geist und Handlung, Witz und Temperament; da wird sie Person durchaus und wirkende Persönlichkeit; da wird die Form unmittelbar, die Kunst Augenblick. Solches Ereignis, solches Erlebnis allein erregt den echten Enthusiasmus. Von solchen Abenden geht dann, ohne daß eine Zeitung sie ankündigte oder gar priese, die werbende Kraft aus, die dem Vorleser seine breite Hörerschaft und der Vorlesung ihre lebendige soziale Wirkung sichert. Was Karl Kraus erstreben muß und erstrebt, auch wenn er den Erfolg noch so hartnäckig ablehnt: die unbedingte Herrschaft des schöpferischen Menschen über die Seele, die sich hingibt und empfängt – hier erreicht er es mühelos, und die Natur selbst spielt mit bei solchem Spiele. Da zeigt sich, als ein wesentliches Merkmal des Anti-Journalisten, seine starke Polarität zum Publikum. Kraus darf dem Publikum alles ins Gesicht sagen. Er sagt es so, daß der überzeugte Anhänger für ihn zittert: das Publikum ist beseligt. Von seiner Stimme durchbohrt, von seiner Miene geformt, von seiner Geste gedeutet, von seiner Sprache gesprochen: legt das Publikum alle Hemmung ab. Würde und Ehrgefühl, Meinung und Gewohnheit, die Dummheit sogar– und wird ein glühendes, brünstiges Plastikum, ein echtes rechtes Publikum. Mit Wollust läßt es sich Unrecht tun. Mit jeder Übertreibung des Selbstdarstellers geht es mit, wenn sie nur genug entschieden ist. Das Publikum fühlt, daß der Zorn des Satirikers ihm eine Seele gibt, für einen Augenblick, da es seine Form annimmt. Bei dieser seltenen Gelegenheit wird sogar die gemeine Sensationslust, die den Pamphletisten um des Skandales willen umwirbt, den er verwertet: menschlich! Sie reagiert ab, sie tobt sich aus, sie sättigt sich, reinigt sich, läutert sich. Und weiß nicht, wie ihr geschah, wenn ihr Künstler sie gestaltet hat. Das edlere Empfinden des Einzelnen scheut hier zuerst zurück. Ihm widerstrebt es, die Stofflichkeit der Satire so vor den gierigen Augen der Menge ausgeweidet, ihr Persönliches ausgebreitet zu sehen, ihr Blamables pointiert zu hören. Das Pamphlet gewinnt zwar eine letzte grausame Dringlichkeit; aber zugleich droht die Kunst des Pamphletisten wieder zur Meinung zu werden, zur Aktualität, zur Beleidigung, zur Peinlichkeit. Zuletzt aber entscheidet hier doch nur die lebendige Individualität. Sie überzeugt, wenn sie, wie der Selbstdarsteller Kraus, mit jeder Pointe das Herz hergibt. Kraus überzeugt durch eine wunderbare Tugend, die kaum jemand bei ihm vermutet hätte: durch Naivität. Ob den Zuschauerraum nun die Fratzen seiner Satire in Fleisch und Blut oder edlere Gestalten bevölkern: wie Kraus grell beleuchtet dasitzt und unermüdlich in das Dunkel hinein um Menschen wirbt, ist er – derselbe Mann, der, wahrhaftigen Teufels, zum Sprung geduckt und mit der knöchernen, treffenden, fassenden, würgenden Hand ausfahrend, den unheimlichen Umriß eines verderbenden Dämons annimmt; der seinen Basiliskenblick auf lebendigem Fleische weiden läßt, sodaß es erschauert – ist er immer wieder kindlich, liebenswürdig, herzgewinnend, begeisternd. So eitel könnte er garnicht sein, daß ihm nicht sofort vergeben würde, wenn er lacht (mit der Verschmitztheit eines Knaben)! Er ist ja, seht nur, sanft vor Bosheit, er ist glücklich, offen – und verschönt von innen her, wie nur ein ganz guter Mensch. Diese Naivität, behaupte ich, ist das Verbindende zwischen der nie gelösten Reflektiertheit, die ihn zum unheilbaren Grübler, Zweifler und Rabulisten macht – und dem leidenden, drängenden Gefangenen hinter den tausend Gittern der Reflexion: dem Elementarmenschen in ihm, dem Schauspieler, dem Dichter, dem Liebenden, dem Religiösen. Jetzt fühlen wir seine menschliche Wärme, seine Scham und seinen Schmerz, seine Scheu und seine Ritterlichkeit. Jetzt geraten wir in die gedeihliche Zone des Gefühls, zwischen Witz und Sinnlichkeit, Scharfsinn und Schönsinn. Aus diesen Reserven also konnte er den verschwenderischen Verbrauch seines Temperaments an Verneinung, wie aus einem unerschöpflichen Born der Bejahung, immerzu ersetzen. Und ich habe wohl bemerkt, daß diese Augenblicke des Verschmolzenseins nicht nur das Publikum befruchtet haben, sondern auch den Rhapsoden seiner selbst. Er stieg aufs Podium, als er den entscheidenden Schritt vom Publizisten zum Künstler gemacht hatte. Und seine innere Gestalt wuchs an diesen Festen der Unmittelbarkeit. Von dem heißen Atem der Menge beschwingt, erstieg er das Pathos des rasenden Verkünders. Dieselbe Menge, die er mit Blitz und Donner züchtigte; die sich zitternd beugte, wenn seine Stimme rachetobend über sie hinfuhr – dieselbe Menge zu segnen, zu erquicken, löste sich immer quellender seine insgeheime Seele. Sie immer tiefer zu treffen, die indifferente Menge, sie immer reiner zu laben, hat er sich differenziert. Und wie in der »Fackel« schließlich, infolge dieser unvergleichlichen Inzucht eines Geistes mit seinem Stoff, mit seiner Welt, ein Zitat genügte, ein Titel, eine Interpunktion: so in der Vorlesung ein Anschlag der Stimme, ein Blick, eine Fingerbewegung. Und alles war gesagt, alles war verstanden. Und während sich das reife Werk loslöst, das Bleibende, die rein gewonnene Form: hört die immer neue Befruchtung nicht auf zwischen dem Tag und dem Gedanken, zwischen der Menge und dem Wort, wie sie in der »Fackel« und in der Vorlesung geschieht. Das intime Einverständnis, das sich so herausgebildet hat, stört kein Dritter: die Presse nicht und nicht der Staat. Zwischen den »Anwalt seiner satirischen Berechtigung«, den »Exekutor seiner Anschläge«, den »Wortführer seiner eigenen Beredsamkeit« und seine »geheimnisvolle Wirkung« (Kraus über den Schauspieler Nestroy) drängt sich kein Zensor. Auch nicht der Zensor im Kriege. So mußte das Hinterland horchen. So bekam der Krieg im Hinterland eine gellende Stimme, einen Mißton, der das Gewissen weckt und nicht mehr einschlafen läßt. Ein Pathos der Forderung, das nicht so bald, nicht so leicht ein Frieden beschwichtigen wird.
Ihr baut, Verbrechende an Maß und Grenze:
»Was hoch ist, kann auch höher!« Doch kein Fund,
Kein Stütz und Flick mehr dient ... es wankt der Bau.
Und an der Weisheit End ruft ihr zum Himmel:
»Was tun, eh wir im eignen Schutt ersticken,
Eh eignes Spukgebild das Hirn uns zehrt?
Der lacht: Zu spät für Stillstand und Arznei!
Zehntausend muß der heilige Wahnsinn schlagen,
Zehntausend muß die heilige Seuche raffen,
Zehntausende der heilige Krieg.
Stefan George.
»In dieser großen Zeit, die ich noch gekannt habe, wie sie so klein war–.« Mit diesen Worte beginnt Karl Kraus die Anrede, die er am neunzehnten November 1914 in Wien hielt, um anzukündigen, daß er vorerst schweigen werde, in »Subordination der Sprache vor dem Unglück«. »Die jetzt nichts zu sagen haben, weil die Tat das Wort hat, sprechen weiter. Wer etwas zu sagen hat, trete vor und schweige!« Damit ist jenes Schweigen ausgedrückt, das mit dem August 1914 begonnen hat; das öffentliche Schweigen des Geistes, das kein noch so lauter öffentlicher Lärm übertönt; das furchtbare Schweigen der Seele, in das Tausende von Toten ihr menschlichstes Geheimnis versenkten. Das Schweigen, welches Karl Kraus schon mit dieser einen denkwürdigen und im Februar 1915 mit einer zweiten Rede durchbrach und seither immer wieder durchbrechen mußte und sollte. Zwar, Lärm war übergenug, und die Menschen sind Kinder, die auch der Tod nicht vom Tand ablenkt. Und .. »das Ohr, das die Posaune des Weltgerichts vernimmt, verschließt sich noch lange nicht vor den Trompeten des Tages«. Es galt, hörbar zu machen, daß die Trompeten dieses Tages die Posaune des Weltgerichtes bedeuteten. Es galt, das Ohr der Welt zu öffnen für die Posaune des Gerichts. »Nicht erstarrte vor Schreck jetzt der Dreck des Lebens, nicht erbleichte Druckerschwärze vor so viel Blut. Sondern das Maul schluckte die vielen Schwerter, und wir sahen nur auf das Maul und maßen das Große nur an dem Maul.« Es galt, das Maul der Welt aufs Maul zu schlagen.
»... In dieser Zeit, in der eben das geschieht, was man sich nicht vorstellen konnte, und in der geschehen muß, was man sich nicht mehr vorstellen kann, und könnte man es, es geschähe nicht –; in dieser ernsten Zeit, die sich zu Tode gelacht hat vor der Möglichkeit, daß sie ernst werden könnte – « ... »In den Reichen der Phantasiearmut, wo der Mensch an seelischer Hungersnot stirbt, ohne den seelischen Hunger zu spüren, wo Federn in Blut tauchen und Schwerter in Tinte – – «. Welche Fragmentfetzen auch immer ich aus jener November-Rede reiße, mit der Kraus seinen »strategischen Rückzug aus der Position der öffentlichen Meinung« decken wollte, mit der er aber nur seine stärkste Offensive gegen den öffentlichen Geist einleitete: jedes Wort sagt, daß dieser Vereinzelte nüchtern blieb (und darin bewährte sich seine Phantasie), als uns alle der Taumel erfaßte, und daß er stehen blieb, als wir alle den Umschwung mitmachten. Sein Geburtsfehler: Unabhängigkeit. Zugleich seine Aufgabe. Im Frieden materielle Unabhängigkeit vom großen Umsatz des geistigen Marktes; im Kriege physische Unabhängigkeit vom großen Umsatz der Leiber. Ein Plus dort, ein Minus hier hatte ihn vor der gemeinsten, allgemeinsten Not der Tatsachen bewahrt.
Als uns die Stimmung erhitzte, war sein Teil Ernüchterung. Als uns die Hoffnung betäubte, war sein Erlebnis Erschütterung. Die Katastrophe, die er tausendmal vorausgesagt hatte, die er auf allen Straßen und Plätzen leibhaftig umgehen sah, als wir noch nichts ahnten; die er längst überall mit Händen griff, im Allernächsten, im Selbstverständlichen jedes Augenblicks, als wir noch in leichtsinniger Sicherheit uns brüsteten: da nun die Katastrophe wirklich eintrat, konnte er es nicht glauben, nicht fassen. Wie selbstverständlich fanden und schickten wir uns dagegen in das Unerhörte; wir gingen über ohne Übergang; wir brachen unser Leben auseinander, als hätten wir fünfzig Leben, es mit ihnen zu versuchen; überall standen zu Tausenden und Tausenden die beredten Apostel des Ungeheuerlichen auf: dem Redner stockte das Wort in der Brust wie ein Stein. Und nichts beglaubigt seine Rede, die dann losbrach, so stürmisch wie dieses Zögern! »Nun, glaubten manche, würde doch dem erdensichern Verstand, dem meertiefen Behagen und der himmelhohen Moral, denen kein Messina, keine Titanic und kein chinesischer Lustmord etwas anhaben konnten, der Verstand, der Humor und der Hochmut vergehen.« So erbebte die Hand, die das Menetekel eines Weltunterganges an die Außenwände der Kultur geschrieben hatte. Vorerst war nur ein Krieg daraus geworden! »Nun ist er da, und ich sage: Nie hätte ein Herz lauter im Gefühl seiner Entbehrlichkeit geschlagen! Was tun sie nun mit den sterbenden Soldaten? Sinken, die nicht fallen, auf die Knie? Laßt uns warten. Abwarten, was sie uns hinterlassen wird, die große Zeit, wenn sie eines Tages dahingeht, wie sie eines Tages gekommen ist. Warten wirs ab, ob die Schande, die ich in Form gebracht habe, versunken sein wird und mit ihr – wie gern! – ihr Künstler. Erledigt sein, ohne daß mir der Krieg meine Aufgabe erledigt – das möchte ich nicht. Dann möchte ich lieber, da er mir nicht geholfen hat, wieder ihm beispringen .... Wenn es jetzt auch den Anschein hat, ... daß der Krieg nicht so sehr den Kampf gegen das Übel fortsetze als das Übel selbst; daß das begeisterte Einstehen einer entgötterten Welt für den Besitzstand des Teufels nicht just ihre ideelle Bereicherung verbürge – warten wir zu. Es könnte am Ende das Wunder geschehen – Dichter und Denker rücken aus, es anzusagen – daß die im Dienst der Fertigware geopferte Seele durch das Opfer des Leibes neu ersteht. Bis dahin –«. Bis dahin will er schweigen, allen Mißbrauch, allen Unfug stumm erdulden. »Die Vorstellung, daß hinter der blutenden Quantität alles Leben unverändert sei und hinter der neuen Maschine ein altes Pathos noch den Tod zur Lebenslüge mache, sie hämmern in den Schläfen.« Und wie sich zu dem bis dahin bereits getanen Werke verhalten? »Da sich nichts um mich verändert hat, sollte ich nicht sagen dürfen, wie es war? Nein, angesichts der erschütternden Stabilität jener Erscheinungen, aus deren Gebiet meine Rohstoffe in den letzten fünfzehn Jahren bezogen waren, sehe ich mich nicht veranlaßt, nachträglich deren Verarbeitung zu bereuen, bin ich nicht gesonnen, das Erschienensein der »Fackel« einzustellen.« Die tiefe Identität der Anlässe zu seiner Satire mit den tiefern Anlässen zum Kriege scheint ihm auch jetzt noch unzweifelhaft. Kleine Wirkungen, große Ursachen: so hatte er es immer gesehen. Kleine Ursachen, große Wirkungen: so hatte es seine Kunst immer gehalten. Von den überraschenden Wechselwirkungen zwischen Klein und Groß hatte seine fixe Idee sich nie beirren lassen. Und » ...durch fixe Ideen wird ein schwankender Besitzstand gerettet, wie eines Staates, so einer Kulturwelt. Man glaubt einem Feldherrn die Wichtigkeit von Sümpfen so lange nicht, bis man eines Tages Europa nur noch als Umgebung der Sümpfe betrachtet. Ich sehe von einem Terrain nur die Sümpfe, von ihrer Tiefe nur die Oberfläche, von einem Zustand nur die Erscheinung, von der nur einen Schein und selbst davon bloß den Kontur. Und zuweilen genügt mir ein Tonfall oder gar nur die Wahnvorstellung.« Die Zeit war mit dem Kriege, mit dem immer größern und größern Kriege, groß geworden, sie war in die Satire hineingewachsen, und sie stand nicht still und wuchs und wuchs und sprengte das Schweigen des Satirikers! Die grauenvollste Identität brach überall hervor und wurde dräuend und schrie zum Himmel, daß eines Tages der stumme Redner nicht mehr aus noch ein wußte: hatten die Dinge ringsum sich seine Stimme ausgeborgt und rasten damit nun los, entfesselt? Wucherte aus diesem mit Blut und Tränen getränkten Boden das Pamphlet, das er gesäet hatte, mit einer unverhofft fürchterlichen Ernte empor, daß den Triumph des so bewiesenen Sehers das Entsetzen tobend überbot? Zwischen Front und Hinterland exponiert, nach welcher Seite er immer blicken mochte, blickte ihm die Fratze einer Gorgo entgegen, daß er aufschrie und seinen Schrei zu dem riesenhaften Mißton der Welt um ihn erstarren fühlte! Und da die Menschen weit ringsum, soweit sie Nutznießerin und Mißbraucherin des Opfers war, nicht Opfer selbst, zu allem Übermaß des Grauens und des Jammers beharrlich weiterlächelte, verhielt sich nicht länger das wahnsinnigste Gelächter des Zeugen der Zeit, die identisch geblieben war in all ihren Wandlungen und Handlungen. »Nicht jene erbärmliche Lache, deren Geschäft es ist, von Ernst und Erbarmen abzulenken, wagt sich hier hervor. Sondern eine, die ihre Opfer der Prüfung aussetzt, ob sie tragfähig waren für den Ernst, für die große Trauer und für die über Nacht erwachsene Größe. Hier ist Humor kein Gegensatz zum Krieg. Diesem können die Opfer entrinnen, jenem nicht. Er befreit keinen Schlechten, er befreit die Guten, die da leiden. Er kann sich neben dem Grauen sehen lassen. Er trifft sie alle, die vom Tode unberührt bleiben. Bei diesem Spaß gibts nichts zu lachen. Aber weiß man das, so darf man es, und das Lachen über die unveränderten Marionetten ihrer Eitelkeit, ihrer Habsucht und ihres niederträchtigen Behagens schlage auf wie eine Blutlache!«
Karl Kraus hat nie in der Linie gestanden, in der heute Tausende und Tausende von Menschen stehen und fallen, seit drei Jahren immerzu in jeder Stunde des Tages und der Nacht stehen und fallen. Das ist die schmale Linie, welche den schmerzenreichsten Tod von der erbarmungslosesten Not trennt, und die nun in jeder Sekunde von Menschenkindern überschritten, übersprungen wird! Das ist die äußerste Linie der Mannheit, wo Zwang und Pflicht in eins zusammenfallen, und wo, wer alles opfert und sich selbst dazu, sich nur im allerbescheidensten Sinne des Worts bewährt hat. Wer heute außerhalb dieser Linie steht, muß wissen, daß mit ihm, zum Schlechten oder zum Guten, eine Ausnahme gemacht wird. Und hat, im Vollgefühl seiner verschonten Nichtigkeit, wo die andern alle stumm sterben, seinerseits in Schweigen zu ersterben. Wenn er es nicht tut, wenn er das Schweigen bricht, so ist er doppelt Ausnahme, ist ein Frevler, den der Übermut seiner pardonnierten Feigheit juckt: er bewähre denn vor Aug und Ohr Himmels und der Erde sein Recht auf die Ausnahme! Daß Karl Kraus mit seinem Lebenswerk haftet, bedeutet nichts. Und bedeutet alles, wenn er es ohne schwindelnden Verlust, ohne daß es daran in Nichts und Ärgernis zerginge, gegen das Martyrium, das tausendfache Opfer, gegen den leibhaftigen Weltuntergang einzusetzen vermag. Nicht vor den Hinterlandshorden der Geldwucherer und der Wortwucherer, der Wortvampyre und der Geldvampyre, auch nicht vor den Höllen: Mächten des Staates und der Gesellschaft, sondern dem tausendfachen anonymen Tod gegenüber hat sich vor seinem Schöpfer zu verantworten ein Geschöpf, das heute aufsteht und mit dem Entsetzen Scherz und Kunst treibt! Und alles, hilft mit, um diese Verantwortung aufs äußerste zu verschärfen. Der Staat hat dem Schriftsteller, dem öffentlichen Redner Karl Kraus seine »Katakomben« des Widerspruchs freigegeben. Jene Gesellschaft, der er angesichts der »blutenden Quantität« ein ewiges Schandmal errichtet, schweigt wehrlos und läßt ihn gewähren. Und ich darf ihn hinaufdeuten zu sich selber, damit sein Beispiel auch noch das Beispiel seiner Wirkung gewinne. So kam es denn, daß eine einzige Stimme sich vom Unisono Europas loslösen und, wo alles sich verhalten muß, die Inbrunst ihres Widerspruches hinausbrüllen darf. Darf diese Stimme das auch wirklich, vor ihrer eigenen Verantwortung? In dieser ethisch verzweifelten Situation nun wagt es diese Stimme, statt sich zu verantworten, Verantwortung zu fordern! Indem sie alles, was sie je zu sagen hatte, angesichts der Sintflut noch einmal, nur noch rasender, wiederholt, verkündet sie den Weltuntergang einer Kulturwelt, und die Wandelbilder, die dazu erscheinen, machen furchtbar klar: es ist diesmal nicht bildlich gemeint! Wäre Krieg gewesen, nur ein Krieg unter Kriegen, die Stimme hätte nicht geschwiegen. Da aber das Weltgericht tagt, darf sie seine Posaune sein! Ein Ruf in das Gewissen, damit das Gericht fruchte! Die Schrecken deutend, auf daß ihr Sinn verstanden werde! Das Erlebnis verkündend, auf daß nicht Lüge, Beruhigung, Ausflucht ihm die Seele entziehe, die es, einen glühenden Gottesstempel, auf ihrem Grunde empfangen soll. Die Front des Gottesschwertes über alles Hinterland, über die Front selbst hinweg erstreckend und noch über den Krieg hinauserstreckend, damit nicht schnelles, billiges Vergessen des Friedens erste Leistung sei. »Vae victoribus!« ruft der Rufer. Wehe den Siegern, die nicht als Gottbesiegte aus dieser Prüfung hervorgehen. Wehe dem Frieden, der irdischen Grund erobert, ohne vom Grund der Seele aus Erneuerung zu sein. Ihm wäre besser, er verlöre alles, Grund und Seele, das Leben obendrein!