
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Folgen einer Erkältung auf der Reise warfen mich für einige Tage auf's Bett. Während dieser Zeit waren Herr Düpant, Herr Pastor Gerlach und einige andere Musikfreunde bemüht, uns ein Concert zu arrangiren. Es war aber schon vorauszusehn, daß dies nicht sehr brillant ausfallen würde, denn theils war die Noth und Theurung noch zu groß, theils hatten vor kurzem mehrere Concerte zum Besten der Armen stattgefunden, so wie auch die Jahreszeit schon zu weit vorgerückt und die meisten reichen Familien bereits auf's Land gezogen waren. In der That warf es nicht viel mehr als die Unkosten ab. Wir hatten uns überdies verleiten lassen, bei Herrn Pielet Rochemont und bei Herrn Düpant Privatmusik zu machen; die an beiden Orten sehr zahlreich versammelte Theegesellschaft fand es hierauf denn nicht mehr der Mühe werth, unser Concert zu besuchen. Den Gebrüdern Bohrer, die vier Wochen vor uns da waren, war es nicht besser ergangen. Im Ganzen genommen sollen die Genfer nicht viel Kunstsinn haben, sondern nur immer darauf spekuliren, wie sie die vielen Fremden, die sich im Sommer und Winter dort aufhalten, recht auspressen können. Wenigstens wissen sie von deutscher Kunst und deutschen Künstlern sehr wenig und kennen unsere klassischen Compositionen nicht einmal dem Namen nach. Die fremde Sprache und die lange französische Herrschaft machen das erklärlich.
Genf besitzt von allen Schweizerstädten die meisten ausgezeichneten Künstler, die aber auch hier, wie fast allenthalben, in zwei oder mehrere Parteien getheilt sind und wie Hunde und Katzen unter einander leben. Die Gebrüder Hensel und Wolf und Herr Berger (eigentlich Münzberger) sind die vorzüglichsten davon. Ich war so glücklich, diese Herren, die sonst nie zusammen spielen, in meinem Concerte zu vereinigen, und hatte so ein für eine Schweizerstadt recht vorzügliches Orchester beisammen. Herr Pastor Gerlach nahm uns auf's freundschaftlichste auf und erzeigte uns gar manche Gefälligkeit; ja er räumte uns sogar zu unserem Concerte die lutherische Kirche ein, in welcher die Musik einen sehr guten Effekt macht. Außerdem wären wir genöthigt gewesen, dasselbe in dem finsteren und unfreundlichen Theater zu geben, wo man überdies noch bedeutende Unkosten (300 Franken) hat.
Ich erlebte in Genf die unerwartete Freude, meinen alten Lehrer Kunisch aus Braunschweig wiederzufinden. Dieser brave Mann hatte alle Tücken des Schicksals empfunden. In seiner Jugend war er ein vorzüglicher Hornist, bekam dann Blutspeien und mußte, um sich zu retten, diesem Instrumente ganz entsagen. Durch eisernen Fleiß brachte er es in drei Jahren zu ziemlicher Virtuosität auf der Violine und fand später eine Anstellung als Vorgeiger beim Nationaltheater in Berlin. Als nach der Schlacht bei Jena der preußische Hof flüchten mußte und die Kapelle auseinander ging, wurde er von Herrn Schick, der gern seinen Platz gehabt hätte, von Berlin wegcabalirt, ging dann anfangs nach der Schweiz, wo er in seinen alten Tagen das Französische noch erlernte und später nach Lyon, wo er wieder als Vorgeiger eine Anstellung am Theater fand. Hier fing es ihm eben an zu gefallen, als er durch einen unglücklichen Sturz die linke Hand verstauchte, die bald ganz steif wurde, so daß er gar nicht mehr Violine spielen konnte und folglich seine Stelle aufgeben mußte. Er war daher gezwungen, zum drittenmal ein anderes Instrument zu erlernen und verdiente sich nun als Klavierlehrer sein kümmerliches Brod. Er hatte eine große Freude, mich wieder zu sehen und schien sehr stolz darauf, mich seinen Schüler nennen zu können.
*
Beim Durchlesen des hier eingeschalteten Tagebuches der Italienischen Reise vermisse ich einiges Erlebte, das mir noch jetzt (im Jahre 1847) so lebhaft in der Erinnerung schwebt, daß ich nicht umhin kann, es gleichsam als Nachlese hier folgen zu lassen.
Erwähnt ist schon, daß ich es nur den Bemühungen des österreichischen Gesandten, Grafen Apponyi, zu verdanken hatte, daß ich in Rom in der Advents-Zeit, wo alle öffentliche Musik verboten ist, ein Concert zu Stande bringen konnte. Graf Apponyi übernahm es, mein Gesuch um die Erlaubniß dazu dem Gouverneur von Rom zu übergeben, rieth mir jedoch, die Antwort darauf nicht abzuwarten, sondern das Concert so schnell wie möglich zu arrangiren, während dessen er mir dann die Subskribenten dazu sammeln werde. Ich ging sogleich an's Werk; allein die Sache hatte ihre großen Schwierigkeiten. Der Saal im Palast Ruspoli, den mir Graf Apponyi verschafft hatte, war wie das ganze unbewohnte Prachtgebäude sehr verfallen. Es mußten erst Glasscheiben in die Fenster eingesetzt, die Löcher in dem Marmor-Fußboden mit Backsteinen ausgefüllt und die nöthigen Möbel, z. B. Kronleuchter, Stühle, Pulte u. s. w. zusammengeborgt werden. Hauptsächlich aber war erst der Palast, vom Eingänge an bis zum Saale, von Unrath zu reinigen, wovon der Vorplatz und die prächtige, mit Statuen geschmückte Marmortreppe überfüllt waren, so daß ganze Karren voll weggeschafft werden mußten. Auch hatte ich erst Sänger und Musiker einzeln in der großen Stadt aufzusuchen und für mein Concert zu engagiren, was Alles viel Zeit wegnahm. Bis zum Tage des Concertes, und noch an diesem selbst bis zum Abend war ich nun in steter Angst, daß eine abschlägige Antwort auf mein Gesuch einlaufen und Alles über den Haufen werfen werde. Doch die Polizei war so human, mir diese erst am Tage nach dem Concerte zuzusenden, wo ich bereits eine ergiebige Einnahme in Händen hatte. Ich wurde durch diese von einer großen Sorge befreit, die mir den Aufenthalt in Rom bis dahin sehr verbitterte. Meine Reisekasse war nämlich bei den bisherigen schlechten Concert-Einnahmen in Italien so zusammengeschmolzen, daß ich mit Schrecken sah, sie werde zu einer Weiterreise nach Neapel gewiß nicht, kaum wohl zu einer direkten Rückkehr nach Deutschland, ausreichen. So nahe vor Neapel, dem ersehntesten Punkte der ganzen Reise, und nun umkehren – das war mir ein zu schrecklicher Gedanke, um mich an ihn gewöhnen zu können! Ich kam daher auf die Idee, die Familie Beer, die unterdessen von Venedig nachgekommen war, um ein Darlehn anzugehen. So sehr ich indessen auch mit dem Sohne Meyer Beer (später Meyerbeer) befreundet war, ich konnte es nicht über mich gewinnen, meinen Wunsch auszusprechen und zog es daher vor, mich deshalb an einen reichen Freund im Elsaß zu wenden, der mich jedoch, wie es bei solchen Gesuchen wohl öfters zu gehen pflegt, ohne Antwort ließ. Nun war nach der brillanten Concert-Einnahme alle Noth vorüber und ich durfte die Weiterreise nach Neapel ohne Bedenken wagen. Diese verzögerte sich aber wegen der Krankheit der Kinder noch bis in die zweite Hälfte des Januar, und da Dorette, die sie pflegte, mich nun nicht mehr auf meinen Excursionen begleiten konnte, so schloß ich mich häufig der Familie Beer an und konnte diesen später Angelangten nun schon als Cicerone dienen. Abends, wenn mit Anbruch der Nacht es nichts mehr zu sehen gab (denn die Theater waren wegen der Advents-Zeit noch immer geschlossen), begleiteten mich die drei Söhne zuweilen in meine Wohnung, und wir verkürzten uns dann die langen Abende durch eine Partie Whist. Da es aber zu jener Zeit in Rom sehr kalt
Buchseite 52 fehlt im Scan. Re
schlesischen Freunde gemacht hatten, und bei denen ich stets die Hälfte der Kosten tragen mußte, so zusammengeschmolzen war, daß sie kaum noch zur Rückreise in die Schweiz ausreichen würde.
Die Berechnung derselben war nur zu richtig gewesen; denn mit der Ankunft in Genf fand ich sie völlig leer. Da nun mein Concert dort auch nicht viel eintrug und ich im voraus wußte, daß bei der damals (im Frühjahr 1917) in der Schweiz herrschenden Hungersnoth auch in den übrigen Schweizerstädten nicht viel zu gewinnen sein würde, so lernte ich zum erstenmale in meinem Leben das Bittere der Nahrungssorgen kennen. Zwar besaßen wir einige Pretiosen, die wir an den Höfen geschenkt erhalten hatten; allein der Gedanke, diese verkaufen oder versetzen zu müssen, war uns doch gar zu widerwärtig. Die Noth zwang uns aber dazu. Schon war ich im Begriff, ein Leihhaus aufzusuchen, als Dorette den Vorschlag machte, sich lieber dem freundlichsten unserer dortigen Bekannten, dem Pastor Gerlach, anzuvertrauen und sich auch erbot, zu ihm zu gehen, wozu ich nicht den Muth gehabt hätte. Sie nahm ihren schönsten Schmuck, ein Diadem, das Geschenk der Königin von Bayern, und machte sich auf den Weg zum geistlichen Herrn. Nie im Leben habe ich so peinliche Minuten verlebt, als die während ihrer Abwesenheit. Nach einer ewiglangen halben Stunde kehrte sie endlich wieder und brachte das Pfand zurück – doch auch die zur Weiterreise erforderliche Summe. Sie war noch ganz in Aufregung von einem dort gehabten Schrecken. Als sie nämlich höchst verlegen und mit bebenden Lippen dem Herrn Pastor die augenblickliche Noth und die Bitte um einen Geldvorschuß gegen Unterpfand vorgetragen hatte, war er plötzlich in ein schallendes Gelächter ausgebrochen und in einem Nebenzimmer verschwunden. Doch bevor sie Zeit gewann, über die Bedeutung dieses, wie ihr schien, sehr unzeitigen Ausbruches von Heiterkeit nachzudenken, kehrte er zurück und brachte die verlangte Summe, indem er freundlich sagte: »Ich freue mich, dem braven Künstlerpaare, das uns so vielen Genuß bereitet hat, gefällig sein zu können; aber wie konnten Sie nur glauben, ein Pastor werde wie ein Jude auf Pfänder borgen?!«
So war also die augenblickliche Noth beseitigt, und die Reise konnte fortgesetzt werden. Wir gingen nun zuerst nach Thierachern, um unseren Wagen und die Harfe, die wir dort im vorigen Herbste zurückgelassen hatten, abzuholen. Da Dorette einiger Zeit bedurfte, um sich auf ihrem Instrumente wieder einzuspielen und wir überdies nicht zu eilen brauchten, indem die für's Concertgeben günstigste Zeit schon vorüber war, so blieben wir vierzehn Tage dort, übten des Vormittags unsere Duetten für Harfe und Violine von neuem ein und besuchten Nachmittags bei dem herrlichsten Frühlingswetter noch einmal alle früheren Lieblingsplätze. Endlich mußten wir uns jedoch entschließen, das paradiesische Thierachern zu verlassen, um unsere Kunstreise weiter fortzusetzen. Es ging uns aber in der Schweiz sehr übel; denn allenthalben wurde wegen der herrschenden Hungersnoth die Erlaubniß zu öffentlichen Concerten verweigert, und nur in Zürich wurde sie gestattet, weil wir uns erboten, einen Theil der Einnahme an die Armen abzugeben. Ich spielte dort zum erstenmale seit der Rückkehr nach Deutschland meine Gesangsscene und ein in Italien begonnenes und in Thierachern vollendetes Solo-Quartett ( Op. 43); beide Compositionen erhielten außerordentlichen Beifall. Damit mußte ich mich aber auch begnügen; denn die Einnahme dieses Concertes war bei weitem nicht so ergiebig, als die des vorjährigen. Ich konnte daher den Termin zur Rückzahlung der in Genf geborgten Summe nicht einhalten, was mich sehr beunruhigte. Herr Pastor Gerlach gab mir jedoch auf die deshalb gemachte Entschuldigung die beruhigendste Antwort, und so konnte ich mit erleichtertem Herzen die Reise fortsetzen.
Der Concert-Gewinn war aber auch in Deutschland, wo wir Freiburg, Carlsruhe, Wiesbaden, Ems und Aachen besuchten, wegen der allgemein herrschenden Noth nur mittelmäßig, so daß kaum die Kosten der Reise dabei herauskamen, und erst in letzterer Stadt, wo unser Spiel große Sensation erregte und uns zu drei sehr besuchten Concerten verhalf, erübrigten wir so viel, um die Schuld bei Gerlach tilgen zu können.
Wir waren nun seit vier Monaten von Neapel bis Aachen fortwährend in der Richtung von Süden nach Norden gereis't, ohne uns irgendwo sehr lange aufzuhalten. Wir hatten daher sowohl jenseits als diesseits der Alpen allenthalben die Baumblüthe getroffen und so das Frühjahr in einer Ausdehnung genossen, wie uns dies später nie wieder zu Theil geworden ist. Nach Aachen kamen wir aber im hohen Sommer, mitten in die Badesaison. Für die Weiterreise nach Holland war dies die ungünstigste Periode zum Concertgeben und ich beschloß daher, einige Wochen in Aachen zu verweilen. Wir hatten dort mehrere eifrige Musikfreunde kennen gelernt, bei denen häufig musicirt wurde. Auch hatte ich ein gutes Quartett-Accompagnement gefunden, mit dem ich meine Wiener Quartetten und Quintetten einübte und da sie bei den Zuhörern großen Anklang fanden, wiederholt zu hören gab.
So verlebten wir die Zeit unseres Aachener Aufenthaltes, zwischen Arbeit und Vergnügen getheilt, höchst angenehm. Der Unterricht der Kinder, der zwar auch auf der ganzen Reise nie ganz aufgehört hatte, indem wir selbst im Wagen während der Fahrt unterrichteten, wurde nun wieder mit mehr Ernst und Regelmäßigkeit betrieben. Auch begann ich wieder zu componiren und schrieb dort das erste Heft meiner vierstimmigen Männer-Gesänge ( Op. 44), von welchen das Göthe'sche: »Dem Schnee, dem Regen« später ein Lieblingslied der Liedertafeln geworden ist.
Gegen den Herbst hin wurde die Reise nach Holland fortgesetzt, und wir gaben zuerst in Cöln und Düsseldorf sehr besuchte Concerte. Dann gingen wir nach Cleve, wo wir in Herrn Notar Thomae einen eifrigen Kunstfreund und ausgezeichneten Dilettanten, der mehrere Instrumente spielte, kennen lernten. Wir musicirten häufig in dessen Hause, und die beiderseitigen Familien, die Kinder mitgerechnet, gewannen sich bald so lieb, daß sie ein Freundschaftsbündniß für das Leben schlossen. Dadurch wurde uns der Aufenthalt in Cleve so anziehend, daß wir das freundliche Städtchen mit seinen reizenden Umgebungen nur höchst ungern verließen.
Nach Holland aber war der Ruf des Spohr'schen Künstlerpaars noch nicht gedrungen, und wir mußten uns daher erst Bahn brechen. Dies gelang jedoch sehr bald. Wir machten in dem reichen und für deutsche Kunst und Künstler günstig gestimmten Lande große Sensation und in Folge davon auch brillante Geschäfte. Schon hatten wir in Rotterdam und im Haag gespielt und befanden uns eben in Amsterdam, wo wir auch bereits in Felix meritis aufgetreten waren und darauf ein eigenes Concert gegeben hatten, als ich einen Brief vom Theater-Direktor in Frankfurt a. M., Herrn Ihlée, erhielt, worin mir dieser im Namen der Actionäre jenes Theaters die Stelle des Opern- und Musik-Direktors antrug und im Fall der Annahme bat, dieselbe schleunigst anzutreten. Die Bedingungen waren zwar nicht so glänzend, als die bei meiner Wiener Anstellung, der Gehalt aber doch genügend, um eine Familie davon ernähren zu können. Freilich hätte ich meine Kunstreise, auf der ich mir gefiel, gern noch wenigstens bis zum Frühjahre fortgesetzt; doch in Frankfurt drängte man, und Dorette sehnte sich nach häuslicher Ruhe. So sagte ich denn ohne weiteres Bedenken zu und machte mich sogleich auf die Rückreise. In Cleve, wo wir im befreundeten Thomae'schen Hause abtraten, mußten wir, so sehr die Reise auch beeilt wurde, doch einige Tage verweilen. Obgleich es nun hoher Winter war, wurde doch wieder von neuem Alles aufgeboten, uns den Aufenthalt angenehm zu machen. Musikpartien, Schlittenfahrten und andere Vergnügungen wechselten mit einander ab. Am Abend vor der Abreise, als wir beim Nachtisch saßen, Nüsse knackten und der nahen Trennung wehmüthig gedachten, machte Freund Thomae den Vorschlag, die Familie Spohr solle, als Erinnerung an ihr Hiersein, eine der Nüsse im Hofe einpflanzen, was mit Akklamation angenommen wurde. Nachdem ein Grabscheit herbeigeholt war, zogen beide Familien, in warme Mäntel gehüllt, in Prozession in den Hof, wo ich im Mittelpunkte desselben, nachdem ich die Schneedecke weggeräumt hatte, ein Loch grub, in welches die Kinder die Nuß versenkten. Im folgenden Frühjahre wurde nach Frankfurt das Erscheinen des Keimes gemeldet. Dieser, durch eine Umfriedigung sorgfältig geschützt, wuchs nach und nach zu einem stattlichen Baume heran, und noch jetzt (1852) gedenkt die Familie Thomae, wie einer der Söhne mir unlängst erzählte, jenes Abends und der entfernten Freunde.
In Frankfurt wurde ich von den Aktionären des Theaters wie auch von sämmtlichem Theater- und Orchester-Personal auf das Freundlichste empfangen. Man gab mir zu Ehren ein Festessen im Saal des »Weidenbusch«, bei welchem die üblichen Toaste und Reden nicht fehlten. Das Orchester, welches sich unter der vorzüglichen Leitung seines bisherigen Direktors, des Herrn Schmitt, den Ruf eines der besten Deutschlands erworben hatte, fand ich durch die lange Krankheit desselben ein wenig verwildert. Da man mir aber in meinen Anordnungen willfährig entgegen kam und sich an meine Art zu dirigiren bald gewöhnte, so wurde das frühere gute Ensemble in kurzer Zeit wiedergewonnen. Mein Vorgänger hatte mit der Geige dirigirt, und auf den Wunsch der Sänger begann auch ich in derselben Weise, indem ich mit dem Bogen taktirte und die Geige zur Hand hatte, um denselben nöthigenfalls einhelfen zu können. Doch bald gewöhnte ich sie an solch' genaues Einüben ihrer Partien, daß eine derartige Hülfe nicht mehr nöthig war. Nun legte ich die Geige weg und taktirte auf französische Weise mit dem Stäbchen.
Der Geschäftsgang bei der Frankfurter Bühne war damals der, daß das von den Aktionären erwählte Direktorium wöchentlich einmal mit den technischen Direktoren (Herr Ihlée für das Schauspiel, ich für die Oper) zu einer Sitzung zusammenkam, in welcher das Repertoir entworfen und alle die Verwaltung betreffenden Gegenstände besprochen wurden. Der Präses oder Senior dieses Direktoriums war der Kaufmann Leers, der sich in dem Amte gefiel und daher Sorge trug, immer wieder gewählt zu werden. Er hatte sich durch die Länge der Zeit einige Routine in der Verwaltung des Theaters erworben und sprach daher gewöhnlich in sehr entscheidendem Tone. Sein ganzes Bestreben war auf Ersparnisse gerichtet, um das jährlich wiederkehrende Deficit von 14 bis 17,000 Gulden, das die Aktionäre decken mußten, zu beseitigen. Ihm waren daher die wohlfeilsten Sänger, Schauspieler und Musiker zum Engagement die liebsten, und bei der Wahl der aufzuführenden Opern und Schauspiele entschied er sich stets für die, für welche das geringste Honorar gefordert wurde. Auch Ihlée und ich hatten ein besonderes Interesse, das fatale Deficit wegzuschaffen, da uns ein Antheil am Ueberschuß kontraktlich zugesichert war; wir glaubten aber, daß dies weit sicherer erreicht werden würde, wenn man das Kunst-Institut durch Engagement ausgezeichneter Talente und durch die Aufführung klassischer Werke zu heben suche. Wir waren daher häufig in Opposition mit Herrn Leers und dessen Collegen, und nur einer derselben, Herr Clemens Brentano, trat unserer Ansicht bei. Doch wußte er ihr selten den Sieg zu verschaffen, da er sie in der Regel nur mit leicht hingeworfenen Witzen und Sarkasmen zu vertheidigen pflegte. Die Animosität, die sich durch diese Meinungsverschiedenheit zwischen Herrn Leers und mir erzeugte, wurde jedoch erst in späterer Zeit bemerklich; denn anfangs vertrugen wir uns ganz gut. Es wurde mir daher auch nicht schwer, die Zustimmung des Direktoriums zur Annahme und Aufführung meiner Oper »Faust« zu erlangen. Ich war sehr begierig, dieses Werk, das ich schon vor fünf Jahren in Wien geschrieben hatte, nun endlich einmal zu hören, und beeilte daher die Voranstalten nach Möglichkeit. Da unter dem Personale kein Baritonist war, der die Partie des Faust genügend geben konnte, so war ich genöthigt, sie dem ersten Tenor, Herrn Schelble, späterhin Gründer und Direktor des Cäcilien-Vereins, zuzutheilen, der in seinem Mezzo-Tenore den nöthigen Umfang, sowie auch die erforderliche Kehlfertigkeit besaß. Nachdem die Proben bereits begonnen hatten, sprach Schelble den Wunsch aus, daß ich ihm noch eine Arie, die dankbarer, als die in der Oper vorhandene, sei und ihm ganz in der Stimme liege, schreiben möchte. Da sich gleich nach dem Anfangs-Duett ein passender Platz dafür fand und Herr Georg Döring, (Oboist des Orchesters und später beliebter Romandichter), dazu einen mir zusagenden Text lieferte, so erfüllte ich Schelble's Wunsch sehr gern. Diese Arie »Liebe ist die zarte Blüthe«, welche später so oft in Concerten und von Pischek in London unzählige male gesungen wurde, ist daher das Erste, was ich in Frankfurt componirte. Unterdessen war das Einüben der Oper so weit gediehen, daß sie im März (1818) zum erstenmale gegeben werden konnte. Sie gefiel anfangs dem großen Haufen zwar weniger, als den Kennern, gewann aber mit jeder Aufführung mehr Publikum, so daß sie seit jener Zeit fast fortwährend auf dem Repertoir der Frankfurter Bühne geblieben ist und immer nach kurzen Zwischenräumen von neuem einstudirt wurde.
Dieser Erfolg ermunterte mich zu neuen dramatischen Compositionen. Ich sah mich daher nach einem Stoffe zu einer solchen Arbeit um und fand einen mir zusagenden im Gespensterbuche von Appel in der Erzählung: »Der schwarze Jäger.« Döring, mit dem ich mich deshalb besprach, erbot sich zu der Bearbeitung als Oper. Wir entwarfen gemeinschaftlich ein Scenarium, welches sich von dem Textbuche Kind's, das uns damals noch unbekannt war, hauptsächlich dadurch unterschied, daß der tragische Schluß der Erzählung beibehalten wurde. Sobald Döring die ersten Scenen bearbeitet hatte, machte ich mich auch sogleich an die Composition. Schon war die Introduction größtentheils in der Skizze vollendet, als die berühmte tragische Schauspielerin, Madame Schröder, und ihre Tochter, die später noch berühmter gewordene Schröder-Devrient, nach Frankfurt zu Gastspielen kamen, und bei ihrem Besuche diese angefangene Arbeit auf dem Claviere liegen sahen. Sie erzählten mir, daß C. M. von Weber denselben Stoff als Oper componire und bereits den ersten Akt vollendet hätte. Dies veranlaßte mich, meine Arbeit liegen zu lassen, da ich befürchten mußte, Weber würde weit früher als ich mit seiner Oper hervortreten. Es wäre das jedoch, wie sich später zeigte, nicht der Fall gewesen; denn »der Freischütz« wurde erst im Jahre 1820 bekannt, und meine fast ein Jahr später begonnene Oper, »Zemire und Azor«, bereits am 4. April 1819 zum ersten mal gegeben. Indessen hat es mich nie gereuet, den Appel'schen Stoff aufgegeben zu haben; denn mit meiner Musik, die nicht geeignet ist, in's Volk zu dringen und den großen Haufen zu enthusiasmiren, würde ich nie den beispiellosen Erfolg gehabt haben, den »der Freischütz« fand.
Da ich mich nun erst wieder von neuem nach einem Opernbuche umsehen mußte, so begann ich unterdessen Quartetten zu schreiben. Die nächste Veranlassung dazu war eine Aufforderung der Freunde dieser Musikgattung, öffentliche Quartett-Aufführungen zu veranstalten, die bis dahin in Frankfurt noch nicht existirt hatten. Ich wünschte, dabei neue Kompositionen vorführen zu können und schrieb deshalb im Laufe des Sommers die drei Quartetten Op. 45. Als ich das erste derselben in einer Musik- Soirée bei Schelble vortrug, war auch Jean Paul unter den Zuhörern. Er schien sich sehr für die neue Composition zu interessieren und legte ihr eine höchst poetische Deutung unter, an die ich bei der Arbeit zwar nicht gedacht hatte, welche mir aber als sehr treffend bei jeder späteren Vorführung des Quartettes wieder in Erinnerung gekommen ist.
Am 29. Juli 1818 vermehrte sich meine Familie wieder um ein Töchterchen, welches den Namen Therese von ihrer Pathe, der Frau Thomae in Cleve, erhielt und von meinem Freund Speyer über die Taufe gehalten wurde. Dorette fühlte sich nun sehr glücklich, einen festen Wohnsitz zu haben, um sich ganz der Pflege des neuen Ankömmlings widmen zu können.
Im Herbste begann der erste Cyclus der öffentlichen Quartetten im kleinen Saale des »Rothen Hauses« Die Mitwirkenden waren, bei der zweiten Violine Herr Concertmeister Hofmann, bei der Viola Herr Bayer, und beim Violoncell Herr Hasemann, damals Baß-Posaunist im Orchester, später erster Violoncellist der Casseler Kapelle. Ich trug Quartetten von Haydn, Mozart, Beethoven und eigne vor und übte sie sorgfältigst in zwei Proben ein. Sie machten daher durch die Genauigkeit ihrer Ausführung große Sensation und fanden so viel Beifall, daß im Laufe des Winters noch ein zweiter Cyclus veranstaltet werden konnte.
Im September 1818 begann ich auch die Composition der neuen Oper. Herr Ihlée hatte mir dazu den Text der ehemals sehr beliebten Oper »La belle et la bête« von Gretry vorgeschlagen. Da diese damals schon ganz vom deutschen Repertoir verschwunden und der jüngeren Generation unbekannt war, so ging ich gern auf den Vorschlag ein; denn ich hatte von frühester Jugend an eine Vorliebe für dieses Mährchen und erinnerte mich auch noch einer Arie aus der Gretry'schen Oper, nämlich die der Zemire mit dem Echo, die ich als Knabe oft von der Mutter gehört und auch selbst gesungen hatte. Herr Ihlée erbot sich, den Text in die Form der modernen Oper umzugestalten, was er auch, als sehr bühnenkundig, zu meiner vollen Zufriedenheit ausführte. – Damals wurde die Rossini'sche Musik zuerst in Deutschland bekannt, und besonders war es »Tancred«, der in Frankfurt einen wahren Beifallssturm erregte. Fast in jeder Theatersitzung mußte ich von Herrn Leers die Worte hören: »Das ist eine Oper, die das Publikum anzieht; solche müssen Sie uns mehr in Scene setzen!« – So wenig ich nun auch ein Verehrer der Rossini'schen Musik war, wie die scharfe Kritik derselben in dem Tagebuche der italienischen Reise zeigt, so blieb doch der Beifall, den »Tancred« in Frankfurt fand, nicht ganz ohne Einfluß auf den Styl meiner neuen Oper. Dazu kam, daß ich über vier Sänger (Demoiselle Friedel, die Schwestern Campagnoli und Herrn Schelble) zu disponiren hatte, die bedeutende Kehlfertigkeit besaßen. So erklärt es sich, daß die Musik zu »Zemire und Azor« so viele Coloraturen und Gesangs-Verzierungen in den Partieen der drei Schwestern und der des Azor enthält. Die Oper wurde von den Sängern wie vom Orchester mit vielem Eifer einstudirt und fand gleich bei der ersten Aufführung großen Beifall, ja sogar einen allgemeineren als der »Faust«, was sich jedoch später, sowohl in Frankfurt als im übrigen Deutschland, dem wahren Werth der Opern gemäß, wieder ausglich.
Im Laufe des Winters gab ich mit meiner Frau noch ein Concert, zu welchem ich eine neue Sonate für Harfe und Violine geschrieben hatte. Da sich auch, seit ich von neuem einen festen Wohnsitz hatte, wieder Schüler eingefunden, sowohl einheimische als fremde, so war ich während des ganzen Winters mit Arbeiten überhäuft. Ich sehnte mich daher, als endlich das Frühjahr herangekommen war, sehr nach einer Erholung, und es kam mir erwünscht, daß vier meiner früheren musikalischen Freunde aus Rudolstadt, die Herren von Holleben, Müller, Sommer und Methfessel nach Frankfurt kamen und mich zur Mitreise nach Mannheim, wo ein Musikfest stattfinden sollte, aufforderten. Ich erwirkte mir einen achttägigen Urlaub und schloß mich ihnen an. Von Darmstadt aus, wo die reizende Bergstraße beginnt, pilgerten wir bis Heidelberg zu Fuß und trugen unser Gepäck im Ranzen selbst auf dem Rücken. Drei der Rudolstädter, Müller, Sommer und von Holleben, die ausgezeichnet Horn bliesen, hatten ihre Hörner auf die Ranzen geschnallt, und Methfessel der unsere vierstimmigen Gesänge mit der Guitarre begleitete, trug sein Instrument, das an einem Bande hing, über die Schultern. So hatte unsere Reise-Gesellschaft, trotz ihres honneten Aeußeren, doch ganz das Ansehen einer reisenden Musikbande, und da wir in fröhlichem Uebermuthe durch alle Dörfer und Städtchen stets musicirend oder singend einherzogen, so fehlte es uns niemals an einem Schweife jubelnder Zuhörer, sowie an zahlreichen Anträgen, aufzuspielen, die natürlich, wiewohl zu großem Bedauern der Anfragenden, abgelehnt wurden. Wir machten kleine Tagereisen und erstiegen mehrere der an unserem Wege gelegenen Burgen. Dort wurde das aus dem Wirthshause hinaufgeschaffte Mahl eingenommen und durch Hornmusik, Gesang und fröhlichen Scherz gewürzt. Am dritten Tage kamen wir nach Heidelberg, wo wir die Schloßruine besuchten. Eine Horn-Fanfare zog bald einen Zuhörer-Kreis in unsere Nähe, der sich sehr an unseren vierstimmigen Gesängen und Methfessel's komischen Liedern ergötzte. Da wir unsere Namen in's Fremdenbuch eingetragen hatten, so wurde es bald in der Stadt bekannt, daß ich mit einer Gesellschaft Musiker zum Musikfest nach Mannheim ziehe. Es erschien daher am Abend eine Deputation des Heidelberger Gesang-Vereins bei uns mit der Einladung, die Fahrt nach Mannheim am anderen Morgen auf dem festlich geschmückten Schiffe des Vereins mitzumachen. Freudig wurde zugesagt.
Diese Fahrt war der Glanzpunkt der ganzen Reise. Als ich mit meinen Gefährten das bis in die Spitze des Mastes mit Blumenfestons geschmückte Schiff betrat, wurden wir von den bereits versammelten Sängern und Sängerinnen mit einem Chorgesang begrüßt und dann aufs Freundlichste bewillkommnet. Da das Schiff unterdeß zwischen hohe Felsenufer, die den Schall zurückwarfen, vorgedrungen war, so revanchirten sich die Rudolstädter zuerst mit ihrer Hornmusik, die sich da prächtig ausnahm. Dann folgten unsere Lieder, und besonders war es wieder Methfessel, der durch den Vortrag humoristischer Gesänge, die er meisterhaft mit der Guitarre begleitete, die ganze Gesellschaft in die fröhlichste Laune versetzte. Als wir uns dem Ziel der Reise näherten, wurden wir vom Mannheimer Verein auf mehreren mit Blumen und Flaggen geschmückten Schiffen eingeholt und bewillkommnet. Meine Anwesenheit auf dem Heidelberger Schiffe war bereits bekannt geworden; das Fest-Comité begrüßte daher auch mich und meine Gefährten und händigte uns Eintrittskarten für Proben und Aufführungen ein. Ja, sogar eine Wohnung in einem Privathause ward mir angetragen, die ich jedoch ablehnen mußte, da ich mich von meinen Begleitern nicht trennen wollte. Sobald daher die Landung bewerkstelligt war, suchten wir ein Gasthaus auf. Leider fanden wir es aber schon so von Fremden überfüllt, daß wir uns zu fünfen mit einem Zimmer behelfen mußten und am anderen Tage wurde der Zudrang so groß, daß wir Mühe hatten, unser Zimmer gegen das Eindringen noch weiterer Gäste zu schützen. Abends legten wir uns, da es, wie leicht begreiflich, an Betten fehlte, ganz friedlich neben einander auf eine Streu, und unsere gute Laune wurde dadurch nicht im geringsten gestört.
Was nun die Musik-Aufführungen betrifft, so erinnere ich mich derselben nicht mehr nur so viel weiß ich noch, daß ich und meine Gefährten, die sämmtlich den Frankenhäuser Festen beigewohnt hatten, hier von der Wirkung der Musik nicht so befriedigt wurden, wie dort, was sich aber schon durch den einzigen Umstand erklärt, daß die Aufführungen in Frankenhausen in dem sonoren Raume einer Kirche, dagegen in Mannheim im Theater stattfanden.
Am dritten Tage traten wir die Rückreise an. Da der Weg von Mannheim nach Mainz für eine Fußreise zu uninteressant gefunden wurde, so mietheten wir uns ein Boot mit zwei rüstigen Ruderern und machten ihn zu Wasser. Aber auch so war die Reise noch ziemlich langweilig. Wir hatten überdies die Nacht vorher auf einem Balle zugebracht und fühlten uns sehr ermüdet; es war daher kein Wunder, daß wir die versäumte Nachtruhe nachholten und die Fahrt zum großen Theile schlafend zurücklegten. Bei unserer Ankunft in Mainz erlebten wir jedoch noch ein kleines Abenteuer, das uns für die letzten Stunden unseres Zusammenseins die fröhlichste Laune zurückgab. Es dämmerte bereits, als wir nach unserer Landung das beste Gasthaus der Stadt aussuchten. Als wir es eben, in dem bereits beschriebenen Aufzuge reisender Musikanten, betreten wollten, schrie uns der Wirth, der aus dem Fenster sah, mit zorniger Stimme entgegen: »Packt Euch! Leute wie Ihr werden hier nicht aufgenommen!« Diese Anrede ergötzte mich sehr, weil ich meine Gefährten schon vielfach wegen ihres Aufzuges geneckt hatte, und lachend rief ich Herrn von Holleben zu: »Herr Oberforstmeister, man will uns hier nicht aufnehmen; suchen wir ein anderes Gasthaus aus!« Der Wirth aber, dem der vornehme Titel in die Glieder gefahren war, stürzte pfeilschnell auf die Straße und bat unter unzähligen Bücklingen: »Meine gnädigen Herren, geruhen Sie näher zu treten Und entschuldigen Sie huldreichst meine Bêtise!« Im höchsten Grade komisch war nun seine Verlegenheit, als wir ihm in's Innere des Hauses gefolgt waren und dort, im hellen Lichterschein, von ihm gemustert wurden. Unser elegantes Aeußere schien ihn nun zu beruhigen, doch die unglücklichen Hörner, die auf die Tornister geschnallt waren, und die an Methfessel's Halse hängende Guitarre erregten bei ihm immer von neuem Scrupel, ob er auch seines Hauses würdige Gäste aufgenommen habe. Als wir aber drei Zimmer mit Wachsbeleuchtung, wie ich absichtlich hinzusetzte, fünf Betten und ein gutes Abendessen bestellten, und zwar in dem kurz befehlenden Tone vornehmer Leute, da schwand bei ihm der letzte Zweifel, und sein Wesen wurde nun kriechende Unterwürfigkeit. Noch lange ergötzte uns diese gemeine Wirthsnatur und erheiterte unser letztes Zusammensein. Am anderen Morgen kehrte ich, da mein Urlaub abgelaufen war, nach Frankfurt zurück, und die Rudolstädter verfolgten weiter rheinabwärts ihren Reiseplan.
Als ich meine Wohnung betrat, sprangen mir die Kinder fröhlich entgegen, meine Frau aber, die schon bei der Trennung vor acht Tagen sehr betrübt gewesen, war in Folge eines heftigen Schreckens recht leidend. Damit der Leser die Veranlassung dazu verstehe, muß ich früher Erlebtes vorausschicken.
Im Spätherbst 1818 kam der Oboist Turner nach Frankfurt, den ich früher in Braunschweig gekannt hatte, wo wir Beide Mitglieder der Kapelle gewesen waren. Schon damals zeichnete sich Turner sehr durch Virtuosität sowie durch sein Compositions-Talent sehr aus. Auf späteren Reisen, besonders in Wien, wo er längere Zeit verweilte, hatte er sich den Ruf des ersten der damals lebenden Oboisten erworben. Zugleich erzählte man aber wunderliche Geschichten von seinem dortigen Aufenthalte; von einer Liaison mit einer vornehmen Dame, die er später anklagte, ihn durch eine Tasse Kaffee vergiftet zu haben; von einer deshalb entstandenen Criminal-Untersuchung, die ergeben, daß er periodisch in Irrsinn verfalle und dann an der fixen Idee leide, vergiftet zu sein. Diese Erzählungen, die von Mund zu Mund gingen, machten ihn interessant; sein Concert war daher überaus zahlreich besucht. Ich fand ihn, da er mich gleich nach seiner Ankunft besuchte, zwar ernster und zurückhaltender, als ich ihn früher in Braunschweig gekannt hatte, bemerkte aber im Uebrigen durchaus nichts Auffallendes an ihm. Da sein Spiel sehr gefiel und ich ihn auch als ausgezeichnet im Orchester kannte, da ferner durch Georg Döring's Abgang aus dem Orchester (er gedachte sich von nun an ganz der Schriftstellerei zu widmen) eine Vakanz bei der Oboe entstanden war, so trug ich in der nächsten Theater-Sitzung darauf an, daß Turner als erster Oboist angestellt werde. Seine Forderungen waren nicht übermäßig hoch gestellt und der Vorschlag fand deshalb wenig Opposition, ja selbst Herr Leers willigte bald ein. Turner trat daher in's Orchester und zeigte sich durch geschmackvollen Vortrag seiner Soli und schönen Ton als eine wahre Zierde desselben. Nach einiger Zeit bemerkte man jedoch eine auffallende Schwermuth an ihm, die sich nach und nach so steigerte, daß am Ende kein lautes Wort mehr aus ihm herauszubringen war. Seinen Orchesterdienst versah er dabei aber immer noch ganz pünktlich, so daß ich hoffte, es werde diese Periode des Trübsinnes ohne weitere Folgen vorübergehen. Bald ging sie aber in völliges Irrsein über, wo dann auch die fixe Idee von der Wiener Vergiftung wieder auftauchte. Nun war es die höchste Zeit, um allem möglichen Skandal vorzubeugen, ihn aus dem Orchester zu entfernen. Döring, ein naher Verwandter Turner's, übernahm es, für seine Kur und Pflege zu sorgen, und trat auch vorläufig in dessen Stelle wieder ein. Die Krankheit steigerte sich nun bald zu solcher Heftigkeit, daß er fortwährend bewacht werden mußte. Eines Abends war es ihm dessen ungeachtet gelungen, kaum halb angekleidet seinem Wächter zu entspringen. Er irrte bei starkem Schneegestöber die halbe Nacht hindurch im Freien umher und kehrte erst gegen Morgen, in eine dicke Kruste von Schnee und Eis gehüllt, in seine Wohnung zurück. Da er sich in diesem Zustande sogleich in sein Bett geworfen hatte, so fand ihn der Arzt am Morgen triefend und dampfend im heftigen Fieber. Vielleicht führte dies aber zu einer Krisis; denn von dem Tage an besserte es sich mit ihm, und bald konnte er, wieder bei völligem Verstande, seinen Dienst im Orchester von neuem beginnen. Doch bemerkte ich, daß er in jedem Monat, etwa acht Tage lang, und zwar immer bei zunehmendem Monde, von einem leichten Rückfalle seines melancholischen Irrseins heimgesucht wurde, der sich durch einen stieren Blick und eine gewisse fieberhafte Unruhe im voraus ankündigte. Dann trug ich mit Döring's Hülfe Sorge, daß er einige Tage vom Orchester fern gehalten wurde, bis mir sein heiterer Blick die Genesung wieder anzeigte. In solcher Weise versah Turner bis in den Sommer hinein seinen Dienst und man gab sich der Hoffnung hin, daß er nach und nach auch von diesen leichteren Anfällen geheilt werden würde. Er hatte mich in der letzten Zeit wieder wie früher dann und wann besucht, auch wohl den Abend bei mir zugebracht und sich freundlich und theilnehmend gegen meine Frau und die Kinder gezeigt. Als ich daher mit meinen Rudolstädter Freunden nach Mannheim abgereis't war, fiel es Doretten anfangs gar nicht auf, ihn eines Morgens in's Zimmer treten zu sehen; als er sich aber, ohne zu grüßen oder ein Wort zu sagen, ihr gegenüber setzte und mit stieren Blicken vor sich hinstarrte, wurde es ihr unheimlich zu Muthe, und sie fing an, sich zu fürchten. Da sie ganz allein mit ihm war (die Kinder waren in der Schule), so wollte sie eine im Nebenzimmer beschäftigte Näherin herbeirufen; doch kaum war sie aufgestanden, so sprang auch er auf und umfaßte sie. Mit einem Schrei des Entsetzens riß sie sich los, stürzte sich in die von der Näherin so eben geöffnete Thür des Nebenzimmers, und es gelang ihr, noch ehe Turner ihr folgen konnte, die Thür zuzuwerfen und den Riegel vorzuschieben. Das Zimmer hatte aber unglücklicherweise keinen weiteren Ausgang, und so sahen sich die erschrockenen Frauen von dem Rasenden belagert. Seinen Versuchen, das Schloß zu sprengen, begegneten sie dadurch, daß sie sich mit aller Kraft, die ihnen die Todesangst gab, gegen die Thür stemmten; es gelang ihnen, denn nach einigen vergeblichen Versuchen gab er es auf, rannte die Treppe hinab und zum Hause hinaus. Dorette fühlte sich nun einer Ohnmacht nahe, mußte zum Arzt schicken und einige Tage das Bett hüten. Nach meiner Rückkehr erholte sie sich in der Freude darüber und in der Beruhigung, nun unter meinem Schutze zu stehen, bald wieder, und so hatte der Vorfall zum Glück weiter keine übelen Folgen. Für den unglücklichen jungen Mann hatte dieser letzte heftige Ausbruch seiner Krankheit aber den Nachtheil, daß ihn die Theater-Direktion entließ. Er reis'te dann, nachdem er wiederhergestellt war, nach Holland, concertirte dort anfangs mit großem Beifall und Erfolg, wurde aber bei einem neuen Rückfall in's Irrenhaus gesperrt, wo er bald darauf starb. Die Welt verlor in ihm ein großes Musikgenie, das durch die unselige Krankheit nicht hatte zur vollen Entwickelung kommen können.
Unterdessen war die Gespanntheit zwischen Herrn Leers und mir immer greller hervorgetreten, und es verging selten eine Theater-Sitzung, ohne daß sie in förmlichen Streit ausbrach. Er machte mir zum Vorwurfe, daß ich zum Einüben neuer Werke zu viel Zeit verbrauche, weil ich es zu genau damit nähme. Er meinte, alle vierzehn Tage müsse sich eine neue Oper einstudiren oder wenigstens eine ältere in ihren unbesetzten Partien ergänzen lassen. Vergebens stellte ich ihm vor, daß eine Oper, die nachlässig eingeübt sei, unmöglich gut gehen, folglich auch keine Wirkung machen könne; daß sie dann, einmal in Mißkredit gebracht, auch keine Zuhörer anziehen werde, und so die darauf verwendete Zeit und Kosten unnütz vergeudet seien. Bei diesem eigensinnigen Menschen, der überdies vor meinem Eintritt in die Theater-Verwaltung nie Widerspruch erfahren hatte, waren vernünftige Vorstellungen ohne alle Wirkung. Da ich mich nun durchaus nicht bewegen ließ, eine Oper früher anzusetzen, als bis sie, den vorhandenen Kräften gemäß, auf's Genaueste eingeübt war, so brach der Streit nie ab. Dies, sowie eine Aeußerung des Herrn Leers bei einer General-Versammlung der Aktionäre, »daß sie für ihr Institut keines berühmten Künstlers, sondern nur eines tüchtigen Arbeiters bedürften, der alle seine Zeit und Kräfte dem Theater widme«, waren die Veranlassung, daß ich in der nächsten Theater-Sitzung meine Stelle für Ende September (1819) kündigte. Die Nachricht davon drang bald in die Stadt und erregte bei den Musikfreunden allgemeines Bedauern. Auch Börne äußerte sich in seiner Zeitschrift »Die Waage« darüber, und zwar nicht auf sehr schonende Weise gegen die Theater-Verwaltung. Ich schied mit leichtem Herzen von Frankfurt, denn meine Berufung dahin hatte mich nur in meiner Reiselust gestört; meine gute Frau aber, die einer Trennung von den Kindern entgegensah, weil diese, indem sie nun eines regelmäßigen Schulunterrichtes bedurften, nicht mehr auf Kunstreisen mitgenommen werden konnten, war sehr betrübt. Ich beruhigte sie jedoch durch das Versprechen, daß sie die Sommermonate stets bei ihren Kindern zubringen und nur vier bis fünf Wintermonate mit mir reisen solle.
Noch vor meinem Abgange von Frankfurt hatte ich ein Engagement bei der philharmonischen Gesellschaft in London für die nächste Parlaments-Saison angenommen, welches mir Ferdinand Ries, der berühmte Clavier-Virtuos und Componist, Namens der Gesellschaft angetragen hatte. Diese war wenige Jahre früher von zwölf bis sechszehn der berühmtesten Künstler Londons: Clementi, den beiden Cramer, Moscheles, Ries, Potter, Smart u. A. gestiftet worden und hatte zum Zweck, jedes Jahr während der Dauer der Parlaments-Sitzungen acht große Concerte zu geben. Der Zudrang zur Subscription für dieselben war trotz des sehr hohen Eintrittspreises so ungeheuer, daß mehrere hundert von Unterzeichnern für den Anfang keinen Platz fanden und erst im Laufe der Jahre nach und nach einrücken konnten. Die Mittel der Gesellschaft waren daher auch so bedeutend, daß sie nicht nur für die Solo-Vorträge in ihren Concerten die ersten Virtuosen und Sänger Londons engagiren, sondern auch namhafte Künstler des Auslandes herbeiziehen konnte. So war auch ich für die Saison von 1820 engagirt worden und hatte gegen ein bedeutendes Honorar, welches mir die Kosten der Hin- und Herreise und eines viermonatlichen Aufenthaltes sicherte, eine vierfache Verpflichtung übernommen. Ich mußte nämlich einige der acht Concerte dirigiren, in einigen Solo spielen, in sämmtlichen als Orchester-Violinist mitwirken und endlich der Gesellschaft eine meiner Orchester-Compositionen als Eigenthum überlassen. Doch war mir auch noch ein Benefiz-Concert im Lokale der Gesellschaft und unter Mitwirkung des Orchesters zugesichert worden. Obgleich meine Frau bei diesem Engagement nicht betheiligt war, so konnte ich mich doch nicht entschließen, sie vier Monate lang zu verlassen. Es wurde daher im Familienrath beschlossen, daß sie mich begleiten und auch als Künstlerin in London, wenigstens in meinem eigenen Concerte, auftreten solle. Da die Saison Mitte Februar begann, folglich die Ueberfahrt über's Meer in der rauhesten Jahreszeit zu machen war, beschlossen wir ferner, um diese möglichst abzukürzen, den Weg über Calais zu nehmen, und um in den belgischen und französischen Städten auf der Reise dahin Concerte geben zu können, dieselbe sechs bis acht Wochen früher anzutreten. Zunächst gingen wir nun nach Gandersheim zu meinen Eltern, welche die Pflege und Erziehung der Kinder während des Winters übernommen hatten und traten darauf eine Kunstreise nach Hamburg an, wo wir mit großem Erfolg zwei Concerte gaben. Auch meine neuen Quartetten, die man dort schon gestochen hatte, spielte ich, vortrefflich accompagnirt, vor gebildeten Zuhörern, wobei ich das meiste Glück als Geiger mit meinen beiden Solo-Quartetten machte. Die beiden Quintetten wurden ebenfalls einigemal gegeben, und ich fand den Enthusiasmus für diese Musikgattung hier größer, als irgend wo anders, Wien vielleicht ausgenommen. In dem Verzeichnisse meiner Compositionen findet sich auch das Goethe'sche Lied: »Wenn die Reben blühen«, als in Hamburg von mir componirt vor, doch erinnere ich mich nicht mehr der Veranlassung dazu.
Wir setzten dann unsere Kunstreise nach Berlin, Dresden, Leipzig, Cassel u. s. w. fort, wo wir überall Concerte gaben, wovon mir jedoch alles Nähere entfallen ist. Nur von Berlin findet sich folgender Zeitungsbericht:
Den 4. November 1819.
»Wenn Ref. sich auch nach einem Zwischenraum von zehn Jahren noch sehr lebhaft der gediegenen, ernsten Ton-Schöpfungen – voller harmonischen Tiefe und Reichthum der Modulation – wie des, in seiner Art einzig fertigen Violin-Spieles des Herrn Spohr erinnert, so scheint ihm dennoch die Fülle und Zartheit des Tones, welchen der fühlende Künstler aus seinem klangreichen Instrument zieht, und dessen trefflicher Vortrag des Cantabile noch gewonnen zu haben. Auch die bewundernswerthe Fertigkeit in Octaven-, Decimen-Fortschreitungen, Doppel-, ja drei-, vierfachen Griffen, die Leichtigkeit und Sicherheit der gewagtesten Sprünge, der freie Bogenstrich, bei der ruhigsten körperlichen Haltung voll edlem Anstand – alle diese noch in höherem Grade vervollkommneten und selten vereint angetroffenen Vorzüge eines ausübenden und schaffenden Künstlers, sie bekunden deutschen Fleiß, Genie und ernsten Willen eines für die höhere Bestimmung der so oft gemißbrauchten Tonkunst empfänglichen Gemüthes. – Deshalb werde auch vaterländisches Talent nach Verdienst geehrt.
Die Form des von Herrn Spohr componirten Violin-Concertes »in Form einer Gesangsscene« ist neu und verbindet, dem Gesange nachahmend, Recitativ, Arioso und Bravour-Allegro sehr geschickt mit einander, ohne durch Länge und verbrauchte Tutti's zu ermüden. Hier bildet Alles ein harmonisches Ganze, voll Kunst und Ebenmaß.
Wenn der gewandte, ideenreiche Tonsetzer indeß im vollen Orchester – wie auch in der viel modulirenden, gehaltreichen Ouvertüre – seine Instrumental-Kenntniß im Großen zeigte, so fand doch im Duett für Harfe und Violine der denkende Virtuose noch mehr Gelegenheit, ganz die Kenntniß des Satzes mit gleichem Vortheil für beide Instrumente (ohne Begleitung) anzuwenden.
Mad. Spohr entwickelt in ihrem zarten und alle Schwierigkeiten der Modulation in die fremdesten Ton-Arten besiegenden Spiel, eine höchst befriedigende Verbindung von Kunstfertigkeit und Geschmack. – Die Composition ihres Gatten sprach ungemein an und es machte eine freundliche Wirkung, wie das anspruchslose Künstlerpaar sich im Einklang zarter Töne sanft vereinte und dann wieder im stürmischen Wechsel-Fluge kühner Phantasie überbot.«
In Brüssel fanden wir ein anderes reisendes Künstler-Ehepaar, das sich, wie wir, auf Harfe und Violine hören ließ. Es war Herr Alexander Boucher und Frau aus Paris. Ich hatte schon viel von ihm erzählen hören und war deshalb begierig, seine persönliche Bekanntschaft zu machen. Boucher hatte den Ruf eines ausgezeichneten Geigers, aber auch den eines großen Charlatan. Er glich auffallend dem Kaiser Napoleon, sowohl in den Gesichtszügen, als in der Figur, und suchte nun diese Aehnlichkeit nach Kräften auszubeuten. Er hatte sich die Haltung des verbannten Kaisers, seine Art, den Hut aufzusetzen, eine Prise zu nehmen, möglichst getreu eingeübt. Kam er nun auf seinen Kunstreisen in eine Stadt, wo er noch unbekannt war, so präsentirte er sich sogleich mit diesen Künsten auf der Promenade oder im Theater, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen und von sich reden zu machen; ja, er suchte sogar das Gerücht zu verbreiten, als werde er von den jetzigen Machthabern wegen seiner Aehnlichkeit mit Napoleon, weil sie das Volk an den geliebten Verbannten erinnere, angefeindet und aus dem Lande vertrieben. Wenigstens hatte er in Lille, wie ich dort später erfuhr, sein letztes Concert in folgender Weise angekündigt: » Une malheureuse ressemblance me force de m'expatrier; je donnerai donc, avant de quitter ma belle patrie, un concert d'adieux etc.« Auch noch andere ähnliche Charlatanerien hatte jene Ankündigung enthalten, wie folgende: » Je jouerai ce fameux concerto de Viotti, en mi-mineur, dont l'éxécution à Paris m'a gagné le surnom: l'Alexandre des violons.«
Ich war eben im Begriff, Herrn Boucher aufzusuchen, als dieser mir durch seinen Besuch zuvorkam. Er erbot sich sehr freundlich, mir bei dem Arrangement meines Concertes behülflich zu sein und zeigte sich überhaupt, seine Ruhmredigkeit abgerechnet, recht liebenswürdig. Er führte uns bei einigen musikliebenden Familien ein, die uns dann auch durch Einladungen zu ihren Musikpartien Gelegenheit verschafften, das Boucher'sche Ehepaar zu hören. Beide entwickelten in ihren gemeinschaftlichen Vorträgen viel Virtuosität; es war aber Alles, was sie spielten, von dürftiger, gehaltloser Composition, ob von der des Herrn Boucher selbst, erinnere ich mir nicht mehr. Vorher spielte Herr Boucher auch ein Quartett von Haydn, mischte aber so viel ungehörige und geschmacklose Verzierungen ein, daß ich unmöglich Freude daran haben konnte. Auffallend war, wie Boucher sich dabei von seiner Frau bedienen ließ. Nachdem er sich vor dem Quartettpulte niedergelassen hatte, bat sie sich von ihm den Schlüssel zum Violinkasten aus, schloß auf, brachte ihm die Violine, dann den Bogen, den sie vorher mit Kolophonium bestrich, legte dann die Noten auf und setzte sich zuletzt neben ihn, um die Blätter umzuwenden. Als wir nun aufgefordert wurden, zu spielen, begann die umgekehrte Procedur, indem ich nicht nur mein eigenes Instrument herbeiholte, sondern auch die Harfe meiner Frau aus dem Kasten nahm, sie auf den Platz trug, wo musicirt werden sollte, und dann einstimmte, was bei der vorhergehenden Production Alles von Madame Boucher besorgt worden war. Ich übernahm jedoch das Stimmen der Harfe bei jedem öffentlichen Auftreten nicht nur, um meiner Frau die Mühe zu ersparen, sondern auch um das Instrument völlig rein zu temperiren, was bekanntlich nicht so leicht ist. Wir spielten eins unserer brillanten Duetten und ernteten großen Beifall ein. Besonders schien Boucher sehr entzückt von meinem Spiel, und er mochte es wohl ziemlich aufrichtig damit gemeint haben; denn in einem Empfehlungsbriefe, den er mir an den Baron d'Assignies in Lille mitgab und den dieser mir als ein Curiosum zeigte, hieß es nach einer Charakteristik meines Spieles: » ... enfin, si je suis, comme on le prétend, le Napoléon des violons, Mr. Spohr est bien le Moreau!«
Mein Concert fand im neuen großen Theater unter vielem Beifall statt; die Einnahme war aber nach Abzug der sehr bedeutenden Kosten nur eine geringe, weil unser Ruf noch nicht bis Brüssel vorgedrungen war. Zwar wurden wir von den Musikfreunden und in den öffentlichen Blättern aufgefordert, ein zweites Concert zu geben; da sich aber nicht gleich ein passender Tag dazu finden wollte und der Aufenthalt in dem großen Gasthause, wo wir abgetreten waren, ein sehr kostspieliger war, so zogen wir es vor, unsere Reise nach Lille sogleich fortzusetzen.
Dort angekommen, war mein erster Gang zu Herrn Vogel, der mir als der beste Geiger der Stadt und als Dirigent der Dilettanten-Concerte bezeichnet war. Ich fand ihn nicht zu Hause, wohl aber Madame Vogel, die mich artig empfing. Als ich meinen Namen nannte, verklärte sich ihr Gesicht und sie fragte mit Spannung, ob ich der Componist des Nonetto sei, dessen Thema sie mir vorsang. Als ich lächelnd bejahete, fiel sie mir in einem Ausbruche französischer Lebhaftigkeit um den Hals und rief: »O wie wird mein Mann entzückt sein, car il est fou de votre Nonetto!« Auch war ich kaum in's Wirthshaus zurückgekehrt, als Herr Vogel schon mit freudestrahlendem Gesicht erschien und mich wie einen alten Freund willkommen hieß. In dem Hause dieses liebenswürdigen Ehepaares verlebten wir sehr frohe Stunden und gaben ein von Herrn Vogel arrangirtes Concert im Saale der Dilettanten-Gesellschaft, da sämmtliche Mitglieder den Componisten des wiederholt aufgeführten Nonetts nun auch spielen hören wollten. Besonders bei unserem Zusammenspiele fanden wir einen so enthusiastischen Beifall, daß sogleich der Tag zu einem zweiten Concert angesetzt wurde. Einige Musikfreunde aus dem benachbarten Douay, die zu dem Concerte herübergekommen waren, luden uns Namens der dortigen Musik-Gesellschaft ein, auch in Douay zu spielen, und garantirten uns den Absatz von 400 Billets zu fünf Franken. Ich hatte daher die schönste Aussicht, recht viel Geld aus Lille mit fortzunehmen, als ein unerwartetes Ereigniß meine Hoffnungen zertrümmerte. Schon war der Wagen gepackt und wir standen im Begriff, nach Douay abzureisen, als sich das Gerücht in der Stadt verbreitete, der Telegraph habe soeben aus Paris die Nachricht von der Ermordung des Herzogs von Berry gebracht. Es dauerte nicht lange, so wurden obrigkeitliche Plakate an die Straßenecken geheftet, die diese Trauerbotschaft den Bewohnern Lilles amtlich verkündeten. Da nun alles Concertgeben innerhalb Frankreichs aufhören mußte, der Zeitpunkt, wo mein Engagement in London begann, aber noch nicht herangekommen war, so ließ ich mich von den Herren Vogel, d'Assignies und anderen Musikfreunden leicht bereden, noch länger in Lille zu verweilen. Es wurde nun fast täglich in Privat-Gesellschaften musicirt, und ich fand dadurch Gelegenheit, diesem Zirkel enthusiastischer Musikfreunde meine sämmtlichen Quartetten, Quintetten und Harfen-Compositionen vorzuführen. Ich hatte dabei ein sehr empfängliches und dankbares Publikum und erinnere mich daher dieser Musikpartien noch immer mit großem Vergnügen. Es wurde bei diesen Soiréen auch noch allerlei Interessantes von Boucher erzählt. So hatte er einst mitten im Spiele, als ihm, seiner Meinung nach, etwas nicht recht geglückt war, plötzlich aufgehört, und ohne auf die Begleitenden Rücksicht zu nehmen, die verunglückte Stelle nochmals wiederholt, indem er sich laut zurief: » Cela n'a pas réussi, allons, Boucher, encore une fois!« Höchst komisch war auch der Schluß seines zweiten und letzten Concertes gewesen. Er spielte als letzte Nummer ein Rondo seiner Composition, welches am Ende eine improvisirte Cadenz hatte. Bei der Probe bat er die Herren Dilettanten, die ihn accompagnirten, nach dem Triller seiner Cadenz mit ihrem Schlußtutti ja recht kräftig einzusetzen und fügte hinzu, daß er ihnen das Zeichen dazu durch Niedertreten geben werde. Am Abend, als diese Schlußnummer begann, war es aber schon sehr spät, und die Herren Dilettanten mochten sich nach ihrem Souper sehnen. Als daher die Cadenz, in der Boucher noch einmal alle seine Kunststücke vorführte, gar nicht enden wollte, so legten einige der Herren ihre Instrumente in die Kasten und schlichen sich davon. Dies war so ansteckend, daß binnen wenig Minuten das ganze Orchester verschwunden war. Boucher, der in der Begeisterung seines Spieles davon nichts gemerkt hatte, hob schon beim Beginn seines Schlußtrillers den Fuß auf, um auf das verabredete Zeichen im voraus aufmerksam zu machen. Als er es nun am Ende des Trillers gab, war er des Erfolges, nämlich des kräftigsten Eintrittes des Orchesters und des dadurch hervorgerufenen Applaudissements der entzückten Zuhörer, ganz gewiß. Man denke sich also sein Erstaunen, als er außer seinem eigenen, derben Fußtritt weiter nichts hörte. Erschreckt sah er sich um und entdeckte nun die verlassenen Pulte. Das Publikum aber, das diesen Moment sich hatte vorbereiten sehen, brach in ein schallendes Gelächter aus, in welches Boucher, wohl oder übel, mit einstimmen mußte.
Es war nun die Zeit zur Reise nach London herangekommen. Da ich willens war, meiner Frau in London eine neue Erard'sche Harfe mit dem verbesserten Mechanismus à double mouvement zu kaufen, so ließen wir das alte Instrument in der Verwahrung des Herrn Vogel zurück. Der Familie Vogel war dies sehr lieb, da sie nun sicher darauf rechnen konnte, uns auf der Rückreise wiederzusehen.
In Calais angekommen, begab ich mich sogleich auf das Büreau der Packetboote, um die Plätze zur Ueberfahrt zu belegen. Von da machte ich einen Spaziergang nach dem Hafen, um das Schiff, mit welchem wir Nachmittags abfahren wollten, in Augenschein zu nehmen. Als ich nun aber bemerkte, daß das Meer schon innerhalb des Hafens in großer Bewegung war, draußen aber so tobte, daß die Wellen hoch über den Hafendamm spritzten, so verlor ich die Lust zur Ueberfahrt bei so stürmischer See und eilte auf das Büreau zurück, um die genommenen Plätze für den folgenden Tag umschreiben zu lassen. Bei einer Tour, die ich Nachmittags mit meiner Frau in der Stadt machte, hütete ich mich wohl, sie in die Nähe des Meeres zu führen, damit sie, die sich ohnehin vor der Ueberfahrt fürchtete, das Toben desselben nicht etwa bemerke. Der Gedanke, in so stürmischer Jahreszeit mit meiner zarten, reizbaren Frau überfahren zu müssen, beunruhigte mich die ganze Nacht; ich eilte daher, sobald der Tag angebrochen war, wieder zum Hafen, um zu sehen, ob der Sturm nicht nachgelassen habe. Es schien mir so, und ich holte deshalb Dorette auf's Schiff und beredete sie, sich sogleich in der Kajüte niederzulegen. Ein gutmüthiger Deutscher, der als Matrose auf diesem englischen Packetboot diente, versprach mir, sich ihrer anzunehmen und für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Ich konnte daher auf das Verdeck zurückkehren, wo ich in freier Luft hoffen durfte, der Seekrankheit einigermaßen zu widerstehen. Unterdessen waren die Vorbereitungen zur Abfahrt getroffen, und das Schiff wurde nun dicht am linken Hafendamm von sechzig bis achtzig Menschen an langen Seilen bis zur äußersten Spitze desselben fortgezogen. Kaum hatte es aber diese überschritten, so wurde es auch sogleich von einer kolossalen Welle gepackt und in einem Nu zur entgegengesetzten Seite des Hafens geschleudert, so daß es beinahe an der Spitze des rechten Hafendammes gescheitert wäre. Darauf stürzten auch die Wellen sogleich über das Verdeck, und die Luken sowie die Kajütenthür mußten geschlossen werden. Ich war allein von allen Passagieren auf dem Verdeck zurückgeblieben und hatte mich in der Nähe des großen Mastes auf eine Bank gesetzt, die innerhalb eines ziemlich hohen Kreises von aufgethürmten Ankertauen stand. Hier hoffte ich, vor dem das Verdeck überströmenden Wasser gesichert zu sein. Doch bald drangen die Wellen so hoch heran, daß ich, um von ihnen nicht durchnäßt zu werden, auf die Bank steigen mußte. Dies war kaum einigemale geschehen, als mich die Seekrankheit so heftig überfiel, daß ich die Kraft dazu nicht mehr hatte. Es dauerte daher auch nicht lange, so war ich trotz meines dichten Mantels bis auf die Haut durchnäßt, was meinen ohnehin trostlosen Zustand noch unerträglicher machte. Dazu packte mich der Brechkrampf, besonders als der Magen nichts mehr herzugeben hatte, so heftig, daß ich es kaum zu überleben hoffte. Glücklicherweise war die Fahrt, durch den Sturm begünstigt, eine ungewöhnlich schnelle. Die drei Stunden, in denen sie zurückgelegt wurde, schienen mir nichtsdestoweniger eine Ewigkeit. – Endlich war man vor Dover angelangt, aber ein neues Mißgeschick erwartete uns hier; denn man konnte wegen der Ebbe nicht in den Hafen einfahren und war genöthigt, die Passagiere auf offenem Meere auszuschiffen. Man ließ deshalb, sobald die Anker ausgeworfen waren, die Boote hinab und rief uns zum Ueberfahren in den Hafen heran. Nun sah ich meine Leidensgefährten blaß und schwankend, wie Geister aus dem Grabe, emporsteigen und merkte wohl, daß sie unten auch nicht besser daran gewesen waren, als ich oben. Endlich erschien auch meine arme Frau, von dem freundlichen Matrosen unterstützt, in sehr leidendem Zustande. Eben wollte ich zu ihr eilen, als sich ein junges, schönes Mädchen, das ich zwar schon beim Einschiffen bemerkt hatte, von ihm aber damals keines Blickes gewürdigt wurde, plötzlich an meinen Hals warf und ohne ein Wort zu sprechen, daran festklammerte. Ich errieth leicht den Beweggrund zu so auffallendem Benehmen. Das arme, geängstete Wesen hatte nämlich mitangesehen, wie die ersten Reisenden in's Boot expedirt wurden, das von den noch immer tobenden Wellen bald bis zur Höhe des Verdeckes emporgeschleudert, bald in einen Abgrund versenkt und wieder von neuem emporgehoben wurde, welches dann der Moment war, wo die Matrosen wieder einen Passagier oder ein Stück vom Gepäck hineinwarfen. Diese Procedur hatte sie so erschreckt, daß sie den Arm ihrer Begleiterin verließ und sich an mich anklammerte, da ich ihr wohl als der kräftigste von der Reisegesellschaft erscheinen mochte. Zu einer Explication war keine Zeit; ich trug sie daher in's Boot und eilte dann zu meiner Frau, um auch diese zu geleiten. Kaum war ich mit ihr glücklich in demselben angelangt, als sich die geängstigte Schöne abermals fest an mich hing, und zwar zu Doretten's größtem Befremden. Doch die gefahrvolle Fahrt ließ keine Bemerkung aufkommen, und das junge Mädchen fühlte bei der Landung kaum festen Boden unter seinen Füßen, als es mich ohne ein Wort des Dankes losließ und mit ihrer Begleiterin davon eilte. Daß es eine vornehme Lady mit ihrer Gouvernante war, hat dies ächt-englische Benehmen wohl schon verrathen.
Nachdem ich im Gasthause meine ganz durchnäßten Kleider mit trockenen vertauscht und wir den wiedererwachten Appetit an der table d'hôte gestillt und uns zur Weiterreise gestärkt hatten, nahmen wir sogleich Plätze in der Nachmittags nach London abgehenden Postkutsche. Diese Reise wurde fast ganz bei Nacht gemacht, und als wir am anderen Morgen auf dem Posthofe zu London nebst unserem Gepäck abgesetzt wurden, fand ich mich in sehr großer Verlegenheit. Es wollte mir nämlich trotz aller Mühe nicht gelingen, weder dort, noch im Büreau Jemanden zu finden, mit dem ich mich hätte verständigen können; denn ich wußte kein Wort Englisch, und Alle, die ich anredete, verstanden weder deutsch, noch französisch. Es blieb mir daher nichts übrig, als auf die Straße zu laufen und, während meine Frau das Gepäck bewachte, dort nach einem Dolmetscher zu suchen. Es war aber noch früh am Tage, und ich sah daher nur Leute niederen Standes, von welchen ich nicht erwarten konnte, daß sie eine fremde Sprache verstehen würden. Endlich kam ein Wohlgekleideter, dem ich erst deutsch, dann, als er den Kopf schüttelte, französisch meine Noth klagte. Der Mann zuckte aber die Achseln und ging weiter. Ein anderer jedoch, der diese Scene mit angesehen hatte, näherte sich mir und fragte in gutem Französisch, was ich wünsche? Es war ein Lohnbedienter, der auf mein Verlangen sogleich einen Fiaker herbeiholte, um uns zu Herrn Ries, dessen Wohnung ich glücklicherweise wußte, zu fahren. Wir wurden nun alsbald in die für uns gemiethete Wohnung gebracht, wo wir uns endlich von den Anstrengungen der See- und Nachtreise erholen konnten.
Am anderen Morgen, wo eine Sitzung der Direktoren der philharmonischen Gesellschaft anberaumt war, sollte ich denselben durch Herrn Ries vorgestellt werden. Ich machte daher sorgfältige Toilette und legte absichtlich ein Prachtstück meiner Garderobe, eine rothbunte, türkische Shawl-Weste an, die auf dem Continent für das Eleganteste der neuesten Mode galt. Kaum war ich damit auf der Straße erschienen, als ich die allgemeine Aufmerksamkeit der Vorübergehenden erregte. Die Erwachsenen begnügten sich, mich mit erstaunten Blicken zu betrachten und gingen dann ruhig ihres Weges, die liebe Straßenjugend aber ergoß sich in Bemerkungen, die ich leider nicht verstand, deshalb auch nicht errathen konnte, was ihr an mir mißfiel. Sie bildete nach und nach einen Schweif hinter meinem Rücken, der immer lauter und unruhiger wurde. Ein Vorübergehender redete mich an und gab mir wahrscheinlich eine Erklärung darüber; da es auf englisch geschah, so konnte ich keinen Nutzen daraus ziehen. Glücklicherweise war die Ries'sche Wohnung nicht sehr entfernt und wurde so eben von mir erreicht. Die Frau, eine junge liebenswürdige Engländerin, die aber geläufig französisch sprach, gab mir nun Aufschluß über mein Abenteuer. Es war unlängst nach dem Tode Georgs III. allgemeine Landestrauer ausgeschrieben, und nach englischer Sitte durfte öffentlich Niemand anders als in Schwarz erscheinen. Mein übriger Anzug war zwar schwarz und so der Vorschrift gemäß, die unglückliche rothe Weste contrastirte damit aber um so auffallender. Madame Ries äußerte, ich hätte es sicher nur meiner imposanten Gestalt und meinem ernsten Wesen zu verdanken, daß die Ungezogenheit der Straßenjugend sich nicht bis zu Thätlichkeiten, d. h. bis zum Werfen mit Koth, gesteigert hätte. Um allen weiteren Anstoß zu vermeiden, fuhr nun Ries erst mit mir zu meiner Wohnung, um die rothe mit einer schwarzen Weste zu vertauschen.
Nachdem ich von den Direktoren der philharmonischen Gesellschaft, deren einige deutsch, andere französisch sprachen, freundlich bewillkommnet war, begann die Berathung über das Programm für das erste Concert. Ich wurde aufgefordert, in demselben zweimal Solo zu spielen und die Direktion an der ersten Violine zu übernehmen. Ich erwiderte, daß ich zu dem ersteren zwar bereit sei, aber bitten müsse, mich in einem der späteren Concerte dirigiren zu lassen, da mein Solospiel zu sehr darunter leiden würde, wenn man mir beides am selben Abend zumuthe. So klar dies von einigen der Herren, die selber Solospieler waren, erkannt wurde, so veranlaßte es doch erst eine lange und lebhafte Diskussion, bis es zugestanden wurde, weil es von dem dort Herkömmlichen abwich. Größeren Anstoß erregte noch mein Verlangen, bei diesem ersten Auftreten nur eigene Compositionen vortragen zu wollen. Die philharmonische Gesellschaft hatte nämlich, um die seichten und gehaltlosen Virtuosen-Concerte von ihren Programmen entfernt zu halten, das Gesetz gemacht, daß mit Ausnahme der Mozart'schen und Beethoven'schen Clavier-Concerte keine ähnliche Musikstücke gespielt werden dürften, sondern der Solospieler nur Das vorzutragen habe, was sie wählen würde. Nachdem jedoch Ries die Diskussion englisch, also mir unverständlich, fortgesetzt und den Herren versichert hatte, daß meine Violin-Concerte in Deutschland den von ihnen von dem Verbot ausgenommenen an die Seite gesetzt würden, gab man endlich auch dieses nach. Ich trat daher im ersten philharmonischen Concerte zunächst mit meiner Gesangsscene, und im zweiten Theile desselben mit einem Solo-Quartett in E-dur auf und fand den allgemeinsten Beifall. Als Componisten gewährte es mir besondere Genugthuung, daß nun die Direktoren sämmtlich dem Ausspruche des Herrn Ries beitraten, und als Geiger machte es mir große Freude, daß der alte Viotti, der von jeher mein Vorbild war und in der Jugend mein Lehrer werden sollte, sich unter den Zuhörern befand und mir auch viel Lobendes über mein Spiel sagte. Als ich so mein erstes Auftreten in London glücklich überstanden hatte, verwandte ich die nächsten Tage dazu, meine Empfehlungsbriefe abzugeben. Dies war für mich, der ich kein Englisch verstand, eine sauere Arbeit und brachte mich oft in Verlegenheit. Auch hatte mir Niemand gesagt, daß man sich dort an den verschlossenen Hausthüren durch Klopfen, und als Gentleman durch starkes, schnell wiederholtes Klopfen anmelden müsse; ich zog daher nach deutscher Weise ganz bescheiden die Schelle, welche dort nur von Leuten, die Aufträge in der Küche haben, benutzt wird, und wußte es mir daher auch nicht zu erklären, daß mich die Oeffnenden stets mit Erstaunen betrachteten und nicht begreifen konnten, daß ich bei der Herrschaft angemeldet sein wollte. Da nun Die, welchen mein Besuch galt, oft eben so wenig als ihre Diener deutsch oder französisch verstanden, so gab es verlegene Scenen. Eine erheiternde, für mich recht ergötzliche hatte ich dagegen bei Rothschild, dem ich einen Empfehlungsbrief von dessen Bruder in Frankfurt und einen Creditbrief von Speyer überbringen mußte. Nachdem Rothschild mir beide Briefe abgenommen und flüchtig überblickt hatte, sagte er zu mir in herablassendem Tone: »Ich lese eben (auf die »Times« deutend), daß Sie Ihre Sachen ganz gut gemacht haben. Ich verstehe aber nichts von Musik; meine Musik ist dies (auf die Geldtasche schlagend), die versteht man an der Börse!« worauf er seinen Witz laut belachte. Dann rief er, ohne mich zum Sitzen zu nöthigen, einen Commis herbei, gab ihm den Creditbrief und sagte: »Zahlen Sie dem Herrn sein Geld aus.« Hierauf winkte er mit dem Kopfe, und die Audienz war zu Ende. – Doch als ich bereits in der Thüre war, rief er mir noch nach: »Sie können auch einmal zum Essen zu mir kommen, draußen auf mein Landgut!« Einige Tage nachher schickte auch wirklich Madame Rothschild und ließ zur Tafel einladen. Ich ging aber nicht hin, obgleich sie die Aufforderung noch einmal wiederholte. Ohne Nutzen war jedoch die Empfehlung an das Rothschild'sche Haus nicht; denn zu meinem Benefiz-Concerte wurde von ihm eine ganze Loge genommen.
Da ich mich sogleich nach unserer Ankunft in London zu meinem öffentlichen Auftreten vorbereiten mußte und meine Frau mit der häuslichen Einrichtung beschäftigt war, so hatten wir es leider versäumt, den Eltern in Gandersheim alsbald Nachricht von unserem Eintreffen zu geben, wodurch den alten Leuten ein Schrecken bereitet wurde, von dem sie sich lange nicht erholen konnten. Das Schiff, mit dem wir am Tage unserer Ankunft in Calais überzufahren willens waren, und für welches ich bereits Billets gelös't hatte, die ich dann, weil die See gar zu stürmisch war, für den folgenden Tag umschreiben ließ, war nämlich ganz aus dem Canale verschlagen worden und wurde für verloren gehalten, bis es sich endlich, und zwar an der spanischen Küste, wiederfand. Ein französisches Blatt hatte unter seinen Passagieren auch uns aufgeführt. Was war daher natürlicher, als daß die französischen Blätter bald sämmtlich meldeten: »Das Spohr'sche Künstlerpaar ist bei der Ueberfahrt nach England verunglückt.« Bald war dies auch in deutschen Zeitungen, z. B. in der Dorfzeitung, die im elterlichen Hause gehalten wurde, zu lesen. Unglücklicherweise kam der Mutter, die sich bereits wegen des langen Ausbleibens von Nachrichten aus England beunruhigt hatte, das verhängnißvolle Blatt zuerst zu Gesicht. Ein Aufschrei des Entsetzens und eine augenblickliche Ohnmacht waren die Folge davon. Das ganze Haus lief zusammen, und nachdem die Mutter endlich wieder zur Besinnung gekommen war, begann erst recht ein allgemeines Jammern und Klagen. Meine Schwester faßte sich zuerst wieder und gab zu bedenken, wie oft Zeitungsnachrichten falsch wären. Auch bat sie, meinen Kindern, die eben aus der Schule kamen, nichts davon merken zu lassen, was allgemein versprochen wurde. Doch konnte sich die Mutter nicht enthalten, die vermeintlichen Waisen mit außergewöhnlicher Zärtlichkeit zu umarmen. Dieses, sowie die verweinten Augen, setzten die Kinder nicht wenig in Erstaunen, und als sie auf ihre deshalbigen Fragen keine Antwort erhielten und Niemand sich zum Mittagsessen niedersetzen wollte, fingen auch sie an zu weinen, ohne zu wissen, warum. Der eintretende Briefträger machte endlich der peinlichen Scene ein Ende. Alle sprangen freudig auf und hofften einen Brief aus England zu sehen. Doch war die Freude nur kurz; denn als sie das Postzeichen »Frankfurt« und die Hand Speyer's auf der Adresse erkannten, glaubten sie nun nicht anders, als die Bestätigung der unglücklichen Zeitungsnachricht zu lesen. Niemand hatte daher den Muth, den Brief zu öffnen, bis endlich meine Schwester sich dazu ermannte. Kaum hatte sie einen Blick hineingeworfen, als sie freudig ausrief: »Sie sind glücklich angekommen!« und dann den Brief dem Vater reichte, der ihn unter großer Aufregung vorlas. Speyer schrieb, daß ihm so eben vom Rothschild'schen Hause in London die Anzeige gemacht, daß ich mir dort habe Geld auszahlen lassen, daß folglich die Zeitungsnachricht vom Untergange des Spohr'schen Ehepaares eine falsche sei, was er sogleich zur Beruhigung der Eltern hiermit anzeige. Jetzt brach allgemeiner Jubel aus und das bisher verschmähte Essen wurde zum wahren Festmahle. Nach demselben setzte sich der Vater aber sogleich an den Schreibtisch, um Herrn Speyer für seine Fürsorge zu danken und dem Redakteur der Dorfzeitung den Kopf zu waschen, daß er durch leichtsinnige Aufnahme einer unverbürgten Nachricht den Betheiligten so großen Kummer verursacht habe. Einen Tag nachher traf denn auch mein Brief von London ein und vermehrte durch seine guten Nachrichten die Freude der Familie.
Im Hause des Herrn Ries hatte ich auch die Bekanntschaft von Herrn Erard, dem Chef des Londoner Hauses frères Erard, gemacht und in Begleitung meiner Frau bereits das Magazin von fertigen Harfen besucht. Wir konnten uns jedoch nicht entschließen, sogleich eine derselben auszuwählen, da Dorette erst erproben mußte, welche Größe ihr am meisten zusagen würde, und ob sie sich überhaupt an den neuen Mechanismus werde gewöhnen können. Dieser Verlegenheit machte Herr Erard dadurch ein Ende, daß er sich freundlichst erbot, ihr eine Harfe nach ihrer Auswahl für die Dauer des Londoner Aufenthaltes zu leihen, die sie dann, wenn sie ihr nicht zusage, gegen eine andere vertauschen oder auch ganz zurückgeben könne. Dies nahm sie mit Dank an und begann nun sogleich, sich auf dem neuen Instrumente einzuüben; doch wollte es ihr anfangs gar nicht recht gelingen. Die neue Harfe, obgleich vom kleinsten Format, war nämlich doch noch um ein bedeutendes größer, so wie auch stärker bezogen, als ihre eigene und verlangte daher viel mehr Kraftanstrengung, und sodann wurde es ihr sehr schwer, sich an den neuen Mechanismus à double mouvement zu gewöhnen, da sie den einfachen von Kindheit an geübt hatte. Sie sah daher bald ein, daß sie auf dieser Harfe erst nach Monaten werde öffentlich spielen können, und ich beschloß deßhalb, sie nur einmal in meinem Benefiz-Concert auftreten zu lassen, um diesem dadurch einen besonderen Reiz zu geben. Unterdessen war nun auch die Reihe an mich gekommen, eins der philharmonischen Concerte zu dirigiren, und ich hatte damit nicht weniger Aufsehen erregt, als mit meinem Solospiel. Es war damals dort noch gebräuchlich, daß bei Symphonien und Ouvertüren der Pianist die Partitur vor sich hatte, aber nicht etwa daraus dirigirte, sondern nur nachlas und nach Belieben mitspielte, was, wenn es gehört wurde, einen sehr schlechten Effekt machte. Der eigentliche Direktor war der Vorgeiger, der die Tempi angab und dann und wann, wenn das Orchester zu wanken begann, den Takt mit dem Violinbogen gab. Ein so zahlreiches und weit von einander stehendes Orchester, wie das philharmonische, konnte aber bei solcher Direktion unmöglich genau zusammengehen, und trotz der Trefflichkeit der einzelnen Mitglieder war das Ensemble doch viel schlechter, als man es in Deutschland gewohnt war. Ich hatte mir daher vorgenommen, wenn die Reihe zu dirigiren an mich käme, einen Versuch zu machen, diesem Uebelstande abzuhelfen. Zum Glück war an dem Tage, wo ich dirigirte, Herr Ries am Piano, und dieser verstand sich gern dazu, mir die Partitur zu überlassen und ganz davon zu bleiben. Ich stellte mich nun mit derselben an ein besonderes Pult vor das Orchester, zog mein Taktirstäbchen aus der Tasche und gab das Zeichen zum Anfangen. Ganz erschrocken über eine solche Neuerung, wollte ein Theil der Direktoren dagegen protestiren; doch als ich sie bat, wenigstens einen Versuch zu gestatten, beruhigten sie sich. Die Symphonien und Ouvertüren, welche probirt werden sollten, waren mir sehr bekannt und in Deutschland bereits von mir öfters dirigirt worden. Ich konnte daher nicht nur die Tempi sehr entschieden angeben, sondern auch den Blas- und Blech-Instrumenten alle Eintritte andeuten, was ihnen eine dort nicht gekannte Sicherheit gewährte. Auch nahm ich mir die Freiheit, wenn mir die Ausführung nicht genügte, aufzuhören und den Herren sehr höflich, aber ernst Bemerkungen über die Vortragsweise zu machen, die Ries auf meine Bitte dem Orchester verdolmetschte. Hierdurch zu außergewöhnlicher Aufmerksamkeit veranlaßt, und durch das sichtbare Taktgeben mit Sicherheit geleitet, spielten Alle mit einem Feuer und einer Genauigkeit, wie man es bis dahin von ihnen noch nicht gehört hatte. Durch diesen Erfolg überrascht und begeistert, gab das Orchester auch sogleich nach dem ersten Satze der Symphonie seine allgemeine Billigung der neuen Direktionsweise laut zu erkennen und beseitigte dadurch alle weitere Opposition von Seiten der Direktoren. Auch bei den Gesangsachen, deren Direktion ich auf Bitte des Herrn Ries übernahm, insbesondere beim Recitativ, bewährte sich das Taktiren mit dem Stäbchen, nachdem ich die Erklärung meiner Taktzeichen vorausgeschickt hatte, vollkommen, und die Sänger gaben mir über die Genauigkeit, mit der ihnen nun das Orchester folgte, wiederholt ihre Freude zu erkennen.
Der Erfolg am Abend war noch glänzender, als ich ihn gehofft hatte. Zwar stutzten anfangs die Zuhörer über die Neuerung und steckten die Köpfe zusammen; als aber die Musik begann, und das Orchester die wohlbekannte Symphonie mit ungewöhnlicher Kraft und Präcision ausführte, gab sich schon nach dem ersten Satz die allgemeine Zustimmung durch ein lang anhaltendes Beifallklatschen zu erkennen. Der Sieg des Taktirstäbchens war entschieden, und man sah bei Symphonien und Ouvertüren von da an Niemand mehr am Piano sitzen. An diesem Abende wurde auch die Concert-Ouvertüre, die ich vor meinem Abgange von Frankfurt componirt hatte, zum erstenmal aufgeführt. Da sie sehr gefiel, so nahm sie die philharmonische Gesellschaft als die Composition an, die ich ihr, meinem Contrakte gemäß, zu überlassen hatte. Ich behielt keine Abschrift davon und vergaß sie bald gänzlich, so daß ich einige Jahre später bei der Verfertigung eines thematischen Verzeichnisses meiner Compositionen mich nicht mehr auf den Anfang besinnen konnte, weshalb das Thema derselben im Verzeichnisse fehlt.
Bei der Abgabe meiner Briefe in London, so wie auch bei anderen Gelegenheiten hatte ich so sehr das Bedürfniß gefühlt, Jemanden zu haben, der mir als Dolmetscher dienen könnte, daß ich mich fortwährend nach einem Begleiter umsah, der deutsch und englisch verstehe, bis Herr Ries sich endlich besann, daß ein alter Diener des verstorbenen Salomon Derselbe, der als Concert-Unternehmer seinen alten Freund Haydn bewog, nach London zu kommen und ihm Symphonien für seine Concerte zu schreiben, und dem daher die musikalische Welt die Entstehung der zwölf schönsten Symphonien Haydn's zu verdanken hat., Namens Johanning, diesen Platz wohl auszufüllen im Stande sein werde. Zwar hatte er sich bereits zur Ruhe gesetzt und als Erbe seines verstorbenen Herrn eine kleine ländliche Besitzung in der Nähe von London angekauft. Ries hoffte indessen, daß der noch ganz rüstige Alte trotzdem die Stelle annehmen werde, weshalb er zur Stadt citirt und ihm von mir der Antrag gestellt wurde. Als er erfuhr, daß er einem Deutschen, zumal einem Musiker und noch dazu einem Geiger, wie sein verstorbener Herr gewesen war, dienen solle, war er dazu sogleich bereit und überließ es sogar meiner Bestimmung, was ich ihm nach Ablauf der Saison als Honorar bewilligen würde. Er kam von nun an jeden Morgen zur Stadt, verdolmetschte zuerst die Aufträge meiner Frau an die Hauswirthin in Bezug auf die Küche und begleitete mich dann auf meinen Wegen. Sein Deutsch hatte er aber bei dem langen Aufenthalte in London zum Theil vergessen und sein Englisch mochte wohl auch nicht klassisch sein; denn es gab bei seinen Verdolmetschungen häufige Mißverständnisse. Im Uebrigen war er eine gute, treue Seele und zeigte bald für mich und meine Frau eine große Anhänglichkeit. Nachdem ich nun mit weniger Beschwerde, als früher den Rest meiner zahlreichen Empfehlungsschreiben noch abgegeben hatte, fand ich auch wieder Zeit und Ruhe zu neuen Compositionen. Zuerst schrieb ich eine Symphonie (die zweite D-moll, Op. 49) und führte sie in einem der philharmonischen Concerte, welches ich zu dirigiren hatte, den 10. April 1820 zum erstenmal auf. Sie fand schon in der Probe, sowohl beim Orchester, wie auch bei den zahlreich anwesenden Zuhörern großen Beifall, erregte aber am Abende bei der Aufführung wahren Enthusiasmus. Einen Theil des glänzenden Erfolges verdankte ich den zahlreichen und überaus trefflichen Saiten-Instrumenten des Orchesters, denen ich in dieser Composition besonders Gelegenheit gegeben hatte, ihre Virtuosität in reinem und präcisem Zusammenspiele zu zeigen. In der That habe ich in Bezug auf die Streich-Instrumente diese Symphonie nie wieder so gut wie an jenem Abende gehört. Alle Blätter Londons brachten am anderen Morgen Berichte über die neue, in ihrer Stadt componirte Symphonie und überboten sich in Lobeserhebungen über dieselbe. Gleich günstige Berichte über mein Spiel bei jedesmaligem Auftreten verbreiteten meinen Ruf bald über die ganze Stadt, und es fanden sich daher leicht Schüler, die von mir im Violinspiel unterrichtet, und Damen, die am Piano begleitet sein wollten. Da Alle sich bereit erklärten, ein Honorar von einer Guinee für die Stunde zu entrichten, so nahm ich sie ohne weiteres an, weil ich es meiner Familie schuldig zu sein glaubte, das Glück, das ich als Künstler in London machte, nun auch zu meinem pekuniären Vortheile zu benutzen. So lief und fuhr ich dann, nachdem ich vorher einige Stunden zu Hause componirt oder mit meiner Frau musicirt hatte, den ganzen Tag im großen London umher und ließ es mir in der That recht sauer werden; denn die meisten meiner Schüler waren ohne Talent und Fleiß und ließen sich nur von mir unterrichten, um sagen zu können, sie seien Schüler von Spohr. Ich erinnere mich jedoch mit Vergnügen an verschiedene Originale, die mich durch ihre Sonderbarkeiten erheiterten und mir dadurch die saure Arbeit erleichterten. Das eine war ein alter, pensionirter General, der sich aber stets in Uniform, mit allen Orden und in höchst militärischer Haltung präsentirte. Er kam ausnahmsweise zu mir ins Haus, verlangte aber demungeachtet nicht länger als drei Viertel-Stunden zu spielen, da nach dortiger Sitte eine Viertel-Stunde für den Weg abgerechnet wird. Er kam jeden Morgen, die Sonntage ausgenommen, präcis zwölf Uhr in seiner alten Staatskarosse angefahren, ließ durch einen der galonirten und bepuderten Bedienten den Geigenkasten hinaufbringen, und setzte sich dann nach einem stummen Gruße sogleich an sein Pult. Vorher zog er aber seine Uhr heraus, um nachzusehen, wann angefangen wurde, und legte diese dann neben sich hin. Er brachte leichte Duetten mit, größtentheils von Pleyel, wozu ich die zweite Violine spielte. Obgleich nun mancherlei am Spiel des Schülers zu erinnern war, so sah ich doch bald, daß es diesem darum nicht zu thun war. Ich begnügte mich daher, meine Stimme der des alten Herrn möglichst genau anzupassen, und so spielten wir in bester Eintracht ein Duett nach dem anderen. Sobald wir aber drei Viertel-Stunden musicirt hatten, hörte der General mitten im Musikstück auf, zog aus seiner Westentasche eine Pfundnote, in die ein Schilling gewickelt war und legte diese auf den Tisch. Dann nahm er seine Uhr und empfahl sich eben so stumm, wie er gekommen war.
Das andere Original war eine alte Dame, der ich am Piano accompagnirte. Sie war eine leidenschaftliche Verehrerin von Beethoven, wogegen ich nichts einzuwenden fand, hatte aber auch die Grille, durchaus keine andere Musik, als die ihres Lieblings spielen zu wollen. Sie besaß sämmtliche Klavier-Compositionen Beethoven's, so wie dessen Orchester-Werke in Clavier-Arrangements. Auch war ihr Zimmer mit allen Porträts von ihm, die sie hatte auftreiben können, geschmückt. Da diese sich nun unter einander sehr unähnlich sahen, so verlangte sie von mir zu wissen, welches ihm am meisten gliche. In ihrem Besitze waren auch einige Reliquien von ihm, die ihr reisende Engländer aus Wien mitgebracht hatten, unter anderen ein Knopf von seinem Schlafrock und ein Stückchen Notenpapier mit einigen Federproben und Dintenklecksen von seiner Hand. Als sie erfuhr, daß ich längere Zeit in vertrautem Umgange mit ihm gelebt hatte, stieg ich sichtlich in ihrer Achtung, und sie hatte mich nun über so vieles zu befragen, daß es an manchen Tagen kaum zum Spielen kam. Sie sprach ziemlich geläufig französisch und radebrechte sogar einige Worte deutsch. Ihr Clavierspiel war auch gar nicht übel, so daß es mir Vergnügen machte, die Sonaten für Piano und Violine mit ihr zu üben. Als sie später aber auch die Trios auflegte und ohne Violoncell mit mir spielte, dann sogar die Clavier-Concerte, wobei außer der ersten Orchester-Violine, die ich übernahm, alles Andere wegblieb, so wurde es mir doch klar, daß ihr Enthusiasmus für Beethoven nur ein gemachter war, und ihr die Einsicht von der Vorzüglichkeit seiner Compositionen völlig abging.
Einen dritten Sonderling lernte ich auf folgende Weise kennen. Eines Morgens brachte ein Diener in Livrée einen Brief, den mir mein alter Johanning etwa folgendermaßen übersetzte: »Mr. Spohr wird eingeladen, sich präcis 4 Uhr im Hause des Unterzeichneten einzufinden.« Da ich die Unterschrift nicht kannte, von dem Diener auch nicht erfahren konnte, wozu ich citirt wurde, so gab ich eben so lakonisch, wie der Brief abgefaßt war, die Antwort: »Ich habe um die genannte Zeit Geschäfte und kann nicht kommen.« Am anderen Morgen erschien der Diener mit einem zweiten, viel höflicheren Schreiben: »Mr. Spohr wird gebeten, dem Unterzeichneten die Ehre seines Besuches zu gönnen, und die Zeit dazu selbst zu bestimmen.« Zugleich hatte der Diener Auftrag, den Wagen seines Herrn anzutragen, und da ich unterdessen in Erfahrung gebracht, dass der Briefsteller ein berühmter Arzt sei, der häufig in Concerten gesehen werde und sich besonders für Violin-Vorträge interessire, so trug ich kein Bedenken mehr, zu ihm zu gehen, bestimmte dem Diener die Zeit und wurde dann in der Equipage des Doktors abgeholt. Ein alter, freundlicher Herr mit weißem Haare empfing mich schon auf der Treppe; aber nun entdeckte es sich leider, daß wir uns nicht verständigen konnten, denn er sprach weder deutsch, noch französisch. Wir standen verlegen einander gegenüber, bis er mich am Arm nahm und in ein großes Zimmer führte, an dessen Wänden ich eine Menge Geigen aufgehängt fand. Andere waren aus den Kasten genommen und auf den Tischen ausgebreitet. Der Doktor überreichte mir einen Violinbogen und deutete auf die Instrumente. Ich sah nun, daß ich ein Urtheil über den Werth der Geigen abgeben sollte und begann daher sogleich eine nach der anderen zu probiren und sie ihrer Güte nach zu ordnen. Es war dies keine kleine Arbeit; denn es waren ihrer viele, und der alte Herr holte sie sämmtlich herbei, ohne auch nur eine zu vergessen. Als ich nun, nach Verlauf von etwa einer Stunde, die sechs besten herausgefunden hatte und diese noch abwechselnd spielte, um die allerbeste zu ermitteln, bemerkte ich, daß der Doktor auf eine derselben besonders zärtliche Blicke warf, und sein Gesicht sich ganz verklärte, so oft ich diese anstrich. Ich machte daher dem guten, alten Manne gern die Freude, dieses Instrument als den Matador der ganzen Sammlung zu bezeichnen. Ganz entzückt über diesen Ausspruch holte er nun auch noch eine viola d'amour herbei und begann auf diesem längst außer Gebrauch gekommenen Instrumente zu phantasiren. Ich hörte mit Vergnügen zu, weil das Instrument mir noch völlig unbekannt war und der Doktor gar nicht schlecht spielte. So endete der Besuch zu beiderseitiger Zufriedenheit, und schon hatte ich meinen Hut ergriffen, um mich zu empfehlen, als mir der Alte mit freundlichem Gesicht und tiefem Bücklinge noch eine Fünfpfundnote überreichte. Erstaunt betrachtete ich das Geld und den Geber und wußte anfangs nicht, was es zu bedeuten habe; als mir aber plötzlich einfiel, daß es die Bezahlung für das Geigenprobiren sein solle, schüttelte ich lächelnd mit dem Kopfe, legte das Papier auf den Tisch, drückte dem Doktor die Hand und eilte die Treppe hinab. Er folgte mir bis auf die Straße, half mir in den Wagen hinein und sprach dann in sichtlicher Erregung einige Worte zum Kutscher. Diesem war das so aufgefallen, daß er es dem alten Johanning, der an den Wagen kam, um den Schlag zu öffnen, sogleich wieder erzählt hatte. Er hatte nämlich gesagt: »Da fährst Du einen Deutschen, der ein ächter Gentleman ist; bring' ihn mir unversehrt in seine Wohnung, das rathe ich Dir!« – Als ich einige Monate später mein Benefiz-Concert gab, ließ der Doktor ein Billet holen und schickte dafür eine Zehnpfundnote.
Meine Frau hatte sich unterdessen mit ausdauerndem Fleiße auf der neuen Harfe eingespielt, sich dabei aber wegen des größeren Umfangs und stärkeren Saitenbezugs derselben, übermäßig angestrengt, so daß sie sich recht erschöpft und leidend fühlte. Ich wußte aus früheren Erfahrungen, daß nichts ihre Nerven so schnell wieder zu stärken vermöge, als häufiger Genuß der freien Luft. Ich benutzte daher jeden Sonnenblick der ersten Frühlingstage zu kleinen Spaziergängen mit ihr in den Regents-Park, der unserer Wohnung (Charlotte-Street) sehr nahe lag. An Sonntagen, wo die Musik in London verstummen muß, und wir daher, ohne Aergerniß zu geben, nicht einmal zu Hause musiciren konnten, wurden größere Ausflüge nach Hampstead oder in die entfernteren Parks gemacht. Unsere Begleiter und Führer dabei waren abwechselnd der jüngere Ries und ein alter freundlicher Herr, der Instrumentenmacher Stumpf. Ich hatte bald die Freude zu sehen, daß meine Frau, durch die Einwirkung des englischen, milden Frühjahrs wieder neuen Lebensmuth gewann; doch blieb ich meinem früheren Vorsatze, sie nur einmal in meinem eigenen Concerte auftreten zu lassen, getreu, und lehnte mehrere Anträge, die ihr gemacht wurden, standhaft ab. Ich selbst spielte aber in allen Concerten, wo man das von mir angesetzte Honorar auszahlte, und da dieses, nach englischen Begriffen, nicht übermäßig hoch war, so wurde ich sehr oft aufgefordert und sah meinen Namen fast auf allen Concert-Programmen der Saison figuriren. Doch konnte ich mich nie entschließen, auch in Privat-Gesellschaften für Geld zu spielen, da mir die Art und Weise, wie man in solchen die Künstler damals behandelte, gar zu unwürdig vorkam. Sie wurden nämlich nicht zur Gesellschaft gezogen, sondern mußten in einem abgesonderten Zimmer des Moments harren, wo sie zu ihren Musikvorträgen in das Gesellschaftszimmer citirt wurden, und hatten dieses nach beendigtem Vortrag sogleich wieder zu verlassen. Meine Frau und ich waren selbst einmal Zeugen solch' einer geringschätzigen Behandlung der ersten und berühmtesten Künstler Londons. Wir waren nämlich an die Brüder des Königs, die Herzöge von Sussex und Clarence, empfohlen und da Letzterer mit einer Deutschen, einer Prinzessin von Meiningen, vermählt war, so machten wir bei dieser eine gemeinschaftliche Visite. Das herzogliche Paar empfing uns sehr freundlich und lud uns zu einer Musikpartie, die in einigen Tagen sein sollte und zur Mitwirkung bei derselben ein. Ich sann nun darüber nach, wie ich uns der mir verhaßten Absonderung von der Gesellschaft entziehen könne, und beschloß, wenn mir dies nicht gelänge, sogleich wieder nach Haus zurückzukehren. Als wir daher das herzogliche Schloß betraten und ein Diener uns das Zimmer öffnen wollte, wo die übrigen Musiker versammelt waren, ließ ich diesem durch Johanning meinen Violinkasten übergeben, und schritt, meine Frau am Arme, sogleich die Treppe hinauf, ehe der Diener Zeit gewann, sich von seinem Erstaunen zu erholen. Vor dem Gesellschaftszimmer angelangt, nannte ich dem dort postirten Diener meinen Namen, und als dieser zögerte, zu öffnen, machte ich Miene, es selbst zu thun. Darauf riß der Diener jedoch sogleich die Thür auf und rief die Namen der Ankommenden hinein. Die Herzogin, eingedenk der deutschen Sitte, erhob sich sogleich von ihrem Platze, kam meiner Frau einige Schritte entgegen und führte sie zum Damenkreise. Auch der Herzog bewillkommnete mich mit einigen freundlichen Worten und stellte mich den umstehenden Herren vor. So glaubte ich nun Alles glücklich überwunden zu haben; doch bald bemerkte ich, daß die Dienerschaft mich noch immer nicht als zur Gesellschaft gehörig betrachten müsse; denn sie ging mit dem Theebrett und anderen Erfrischungen stets an mir vorüber, ohne mir etwas anzubieten. Endlich mochte der Herzog dies wohl bemerkt haben; denn ich sah, wie er dem Haushofmeister winkte und ihm einige Worte in's Ohr flüsterte. In Folge dessen wurden mir nun ebenfalls die Erfrischungen präsentirt. Als das Concert beginnen sollte, ließ der Haushofmeister die eingeladenen Künstler nach der Reihe, wie das Programm sie nannte, heraufholen. Sie erschienen mit dem Notenblatt oder dem Instrument in der Hand, begrüßten die Gesellschaft mit einer tiefen Verbeugung, die, so viel ich bemerkte, von Niemandem als von der Herzogin erwiedert wurde, und begannen ihre Vorträge. Es war die Elite der ausgezeichnetsten Sänger und Virtuosen Londons und ihre Leistungen waren fast alle entzückend schön. Dies schien das vornehme Auditorium aber nicht zu fühlen; denn die Conversation riß keinen Augenblick ab. Nur als eine sehr beliebte Sängerin auftrat, wurde es etwas ruhiger und man hörte einige leise Bravo, für die sie sich sogleich durch tiefe Verbeugungen bedankte. Ich ärgerte mich sehr über die Entwürdigung der Kunst und noch mehr über die Künstler, die sich solche Behandlung gefallen ließen, und hatte die größte Lust, gar nicht zu spielen. Ich zögerte daher, als die Reihe an mich kam, absichtlich so lange, bis der Herzog, wahrscheinlich auf einen Wink seiner Gemahlin, mich selbst zum Spielen aufforderte. Nun erst ließ ich durch einen Diener mein Violinkästchen heraufholen und begann dann meinen Vortrag, ohne vorher die übliche Verbeugung zu machen. Alle diese Umstände mochten die Aufmerksamkeit der Gesellschaft erregt haben; denn es herrschte während meines Spiels eine große Stille im Saal. Als ich geendet hatte, applaudirte das herzogliche Paar und die Gäste stimmten mit ein. Nun erst dankte ich durch eine Verbeugung. Bald darauf schloß das Concert und die Musiker zogen sich zurück. Hatte es nun schon Sensation erregt, daß wir uns der Gesellschaft angeschlossen, so steigerte sich diese doch noch um Vieles, als man sah, daß wir auch zum Souper da blieben und bei demselben von den herzoglichen Wirthen mit großer Aufmerksamkeit behandelt wurden. Wir hatten dieses, nach damaligen englischen Begriffen Unerhörte wohl hauptsächlich dem Umstande zu danken, daß uns die Herzogin schon im elterlichen Hause gekannt und Zeuge der guten Aufnahme gewesen war, die wir zu der Zeit, wo wir noch in Gotha wohnten, wiederholt am Meininger Hofe genossen. Auch der Herzog von Sussex, dem ich eine Empfehlung vom Herzog von Cambridge, dem damaligen Regenten von Hannover, überbracht hatte, zeichnete mich sehr aus und unterhielt sich viel mit mir. In Folge eines Gespräches über englischen Volksgesang ließ der Herzog sogar seine Guitarre holen und sang mir einige englische und irländische Volkslieder vor, was mich später auf den Gedanken brachte, einige der beliebtesten derselben als Potpourri für mein Instrument zu bearbeiten und in meinem Concerte vorzutragen Es ist dies Op. 59, das zweite meiner in London geschriebenen Werke.. Als sich dann lange nach Mitternacht die Gesellschaft trennte, kehrten wir sehr befriedigt über den Erfolg unseres Wagnisses und den Sieg, den wir über das Vorurtheil davon getragen hatten, in unsere Wohnung zurück.
Unter denen, die mich aufforderten, in ihren Concerten Solo zu spielen, war auch Sir Georg Smart, einer der Direktoren der philharmonischen Gesellschaft. Er gab während der Saison eine Reihe von Subscriptions-Concerten, die er geistliche nannte, in denen aber auch viel weltliche Musik gemacht wurde. Ich spielte in zweien derselben, wofür Sir Smart das Arrangement von meinem Benefiz-Concerte übernahm, eine Arbeit, die schon für einen Einheimischen, damit Vertrauten sehr umfangreich war, die mir aber, hätte ich sie selbst übernehmen wollen, vielleicht sechs Wochen meiner Zeit, die ich doch vortheilhafter zu benutzen wußte, gekostet haben würde. Mein Concert fand am 18. Juni statt und war eins der glänzendsten und besuchtesten der ganzen Saison. Fast alle Personen, an die wir adressirt waren, unter ihnen auch die Herzöge von Sussex und Clarence, hatten Logen oder Sperrsitze dazu genommen, und mehrere dieser reichen und vornehmen Herren schickten ansehnliche Honorare dafür ein. Auch ein großer Theil der Abonnenten der philharmonischen Gesellschaft behielt seine Plätze, und da der niedrigste Preis eines Billets eine halbe Guinee betrug und der Saal wohl an tausend Menschen fassen konnte, so war die Einnahme eine sehr bedeutende. Dazu kam noch, daß die Unkosten, die in London enorm hoch sind, bei diesem Concerte dadurch sehr ermäßigt wurden, daß ein Theil der Orchestermitglieder, aus Anhänglichkeit an mich, auf Bezahlung verzichtete, und, vermöge meines Vertrags mit der philharmonischen Gesellschaft, das Lokal mir nichts kostete. Dagegen mußten sämmtliche Sänger bezahlt werden, und ich erinnere mich noch genau, daß ich der Mrs. Salmon, der beliebtesten der damaligen Londoner Sängerinnen, ohne deren Mitwirkung mein Concert kein rechtes Ansehen gehabt haben würde, für eine einzige Arie ein Honorar von dreißig Pfund Sterling entrichten mußte, wobei sie noch die Bedingung stellte, daß sie erst im zweiten Theile gegen das Ende des Concertes singe, weil sie vorher in einem Concerte der City, sechs englische Meilen entfernt, aufzutreten habe. Es sei hier auch einer sonderbaren Ausgabe bei den damaligen Concerten in London erwähnt, weil sie jetzt, wie so manches Absonderliche jener Zeit nicht mehr existirt. Es war nämlich Sitte, daß der Concertgeber seine Zuhörer in der Pause zwischen dem ersten und zweiten Theile des Concertes mit Erfrischungen bewirthete. Diese wurden in einem Nebensaal am Büffet unentgeltlich verabreicht, und man hatte deshalb sich mit dem Conditor im voraus über eine feste Summe zu verständigen, die bei meinem Concert auf zehn Pfund Sterling accordirt war. Bestand nun die Gesellschaft größtentheils aus der vornehmen Welt, bei der es Sitte war, nichts zu nehmen, so machte der Conditor gute Geschäfte, war sie aber sehr gemischt und zahlreich und die Hitze groß, so kam er auch wohl bedeutend zu Schaden. Nie hat er sich aber wohl besser gestanden, als bei meinem Concert. Es fand dieses nämlich an dem Tage statt, an welchem die Königin Charlotte von England aus Italien zurückkehrte und in London einzog, um sich vor dem Parlament, bei welchem sie ihr Gemahl der Untreue angeklagt hatte, zu vertheidigen. Ganz London war in zwei Parteien getheilt, deren bei weitem größere, vom Mittelstande bis zum niedrigsten Volke herab, auf Seiten der Königin stand. Die Stadt war in ungeheurer Aufregung, und es war ein Glück für mich, daß ich die Billets zu meinem Concerte bereits sämmtlich abgesetzt hatte, weil ich sonst durch die Ungunst des Zufalls leicht in großen Schaden hätte kommen können. Meine Concert-Anzeigen an den Straßenecken waren nämlich bald von großen Plakaten überklebt, auf welchen im Namen des Volkes zur Feier des Tages eine allgemeine Illumination der Stadt angesagt wurde; auch brachte Johanning die Nachricht mit, daß das Volk drohe, in allen Häusern, wo diesem Aufrufe nicht Folge geleistet werde, die Fenster einzuwerfen. Da nun die vorhandene Polizeimannschaft, sowie das wenige Militär nicht hinreichten, um die königlichen Gebäude gegen die angedrohten Excesse des Volkes zu schützen, so mußten die Anhänger des Königs, die doch unmöglich dem Aufrufe folgen konnten, ruhig Alles über sich ergehen lassen, und suchten nur dadurch, daß sie ihre Fenster mit Brettern zunageln ließen, so viele von den theuern Spiegelscheiben zu retten, als es die Kürze der Zeit erlauben wollte. So wurde allenthalben und besonders in dem nahegelegenen Portland-Place, wo der vornehme Adel wohnte, den ganzen Tag gehämmert, zum großen Ergötzen der Straßenjugend, die ihren Witz und Spott nicht zurückhielt. Während wir uns zu Hause auf die Concertvorträge vorbereiteten, wogte das Volk in großen Massen durch die Straßen und zog der Königin entgegen. Da dies nach der Richtung der City geschah, so wurde es gegen Abend in Westend ganz ruhig. Wir fanden daher, als wir um halb acht Uhr zum Concertlokale fuhren, die Straßen fast leerer, als gewöhnlich und nirgends ein Hinderniß auf unserem Wege. Doch bemerkten wir allenthalben eifrige Vorbereitungen zur Illumination, damit beim Anbruch der Nacht dem Gebot des souveränen Volkes sogleich Folge geleistet werden könne. Meine Frau, die sich ohnehin vor dem ersten öffentlichen Auftreten mit der neuen Harfe fürchtete, war in großer Angst vor dem, was da kommen würde, und ich hatte ernstliche Besorgniß, daß die Aufregung, in der ich sie sah, sowohl ihrem Spiele als ihrer Gesundheit nachtheilig sein werde. Ich suchte sie daher durch Zureden zu beruhigen, was mir auch ziemlich glückte. Der Saal füllte sich nach und nach mit Zuhörern, und das Concert begann. Das Programm desselben kann ich hier vollständig mittheilen, da mir Sir G. Smart bei meinem letzten Besuche zu London (im Jahr 1852) ein Exemplar, wie es damals den Zuhörern bei ihrem Eintritt in den Saal überreicht wurde, geschenkt hat. Es lautet:
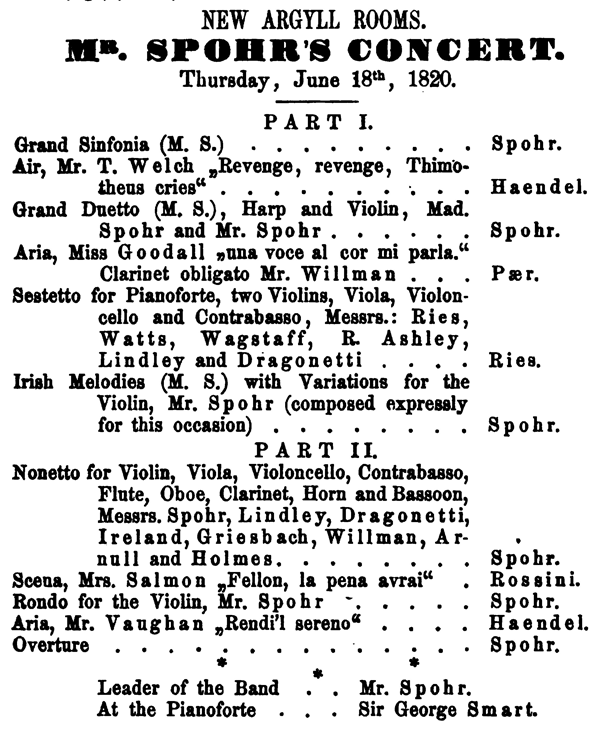
Die neue, vom Orchester nun schon gekannte, aber doch nochmals sorgfältig durchprobirte Symphonie wurde meisterhaft executirt und fand wo möglich noch lebhafteren Beifall, als bei der ersten Aufführung. Während der folgenden Arie stimmte ich im Nebensaale meiner Frau die Harfe und sprach ihr Muth zu. Dann führte ich sie in den Saal und wir nahmen unsere Plätze ein, um das Duett zu beginnen. Schon verbreitete sich die Stille der Erwartung, und man lauschte unseren ersten Tönen, als sich plötzlich von der Straße her ein fürchterliches Geschrei erhob, dem auch sogleich eine Kanonade von Pflastersteinen gegen die unerleuchteten Fenster des Nebensaales nachfolgte. Bei dem Klirren der Scheiben und Kronleuchter sprangen die Damen entsetzt von ihren Plätzen auf, und es entstand eine unbeschreibliche Scene der Verwirrung und Aufregung. Man beeilte sich, die Gasbeleuchtung des Nebensaales anzuzünden, um einer zweiten Salve zuvorzukommen und hatte auch wirklich die Genugthuung, zu sehen, daß nun das Volk, nachdem es über den Erfolg seiner Demonstration noch ein Jubelgeschrei angestimmt hatte, weiterzog und so nach und nach die frühere Ruhe wiederkehrte. Doch dauerte es lange, bis das Publikum seine Plätze im Saale wieder einnahm und sich so weit beruhigte, daß wir endlich beginnen konnten. Ich war dabei nicht ohne Besorgniß, daß der Schrecken und die lange Pause meine Frau noch mehr aufgeregt haben würde und horchte daher in großer Spannung auf ihre ersten Accorde; als diese aber in gewohnter Kraft ertönten, beruhigte ich mich sogleich und überließ mich nun ganz der Aufmerksamkeit auf unser Zusammenspiel. Dieses, welches in Deutschland immer so sehr gefallen hatte, verfehlte auch auf das englische Publikum seine Wirkung nicht; es steigerte sich daher der Beifall bei jedem Satze des Duettes und wollte am Schlusse desselben gar nicht enden. Als wir höchst erfreut über diesen Erfolg abtraten, dachten wir Beide nicht, daß es das letztemal gewesen war, daß Dorette Harfe gespielt hatte. Doch davon später! Von den übrigen Nummern des Programmes, bei denen ich selbst betheiligt war, freute mich besonders die gute Aufnahme, welche das Nonett fand. Ich hatte es mit denselben Künstlern bereits in einem der philharmonischen Concerte gegeben und war damals von vielen Seiten aufgefordert worden, es in meinem eigenen Concerte zu wiederholen. Die Genauigkeit unseres Zusammenspieles war diesesmal noch vollendeter und so konnte es seine Wirkung nicht verfehlen. Auch die Irländischen Lieder wurden allgemein beifällig aufgenommen. So ging denn das Concert, trotz des störenden Intermezzos zu allgemeiner Zufriedenheit zu Ende. Die Pause nach dem ersten Theil und die Promenade in den Nebensaal waren wegen der Verwüstung desselben für diesmal ganz unterblieben; der Conditor hatte für seine zehn Pfund Sterling gar nichts zu leisten gehabt. Doch war ihm durch den Steinhagel auch Einiges auf dem Büffet zertrümmert worden. – Als wir nun endlich in höchster Erschöpfung unseren Wagen erreichten, konnten wir nicht in gerader Richtung nach Haus zurückkehren, weil in der Gegend von Portland-Place der Pöbel noch sein Wesen trieb. Der Kutscher mußte daher allerlei Umwege machen und es war ein Uhr vorüber, als wir endlich vor unserer Wohnung ankamen. Wir fanden bereits das ganze Haus mit Ausnahme unserer Etage erleuchtet, und die Wirthin erwartete uns in großer Unruhe, um auch unsere Fenster mit Lichtern versehen zu können. Es war die höchste Zeit; denn schon hörte man die Volksmasse heranziehen. Da sie jedoch die ganze Charlotte-Street, ihrem souveränen Willen gemäß, hell erleuchtet fand, so zog sie, ohne irgend einen Exceß zu begehen, vorüber. Die Lichter durften aber demungeachtet noch nicht ausgelöscht werden, und erst nach Verlauf von einigen Stunden, als die Stadt ganz still geworden war, fanden wir endlich die nöthige Ruhe.
* * *