
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Waschbär von Kildercreek
Mutter Natur, die du den Wald erschufst, viele Wesen hast du hervorgebracht und wieder verworfen: den Bären, weil er zu groß, den Hirsch, weil er im Schnee zu leicht sichtbar und hilflos, den Wolf, weil er zu wild und ein zu arger Fleischfresser ist; sie alle schienen dir nicht dem Geist des Baumlandes zu entsprechen. Und du hast dich weiter versucht, bis der Waschbär deiner Hand entsprang, der mit seiner schwarzen Maske nächtens durch den Hochwald wandert. Ihn hast du mit den Gaben der Dryade, der Baumnymphe, ausgestattet, ihn, den harmlosen Bewohner der hohlen Eiche, das Wahrzeichen der vom Pflugland am weitesten abgelegenen Sümpfe, die hallende Stimme, die der Rothaut vertraut ist.
Oh, steh dem Besinger des Waldes bei, wenn er vom Waschbären kündet; von seiner Güte, seiner Stärke, seiner Lebensfreude im hohlen Baum, den der Farmer verschmähte, weil er so hohl war! Und wenn er von seinem Liede kündet, das er auf der nächtlichen Wanderung singt, und weshalb er singt, und warum der Wäldler sein wildes, schreiendes »Jaup« liebt, ganz, wie er den Gesang des Indianers liebt, in dem der Geist des brennenden Waldes lodert!
Hilfst du ihm diese Dinge künden, daß sie die Welt rühren, wie sie ihn selbst gerührt haben, so soll der unerbittliche Forstmann nicht bis ans bittere Ende gehen. Er soll den hohlen Baum stehenlassen und den ringelschwänzigen Einsiedler des Waldes nicht vertreiben, noch seinen Windgesang im Tollen Mond verstummen lassen!
Was der Waschbär für uns bedeutet, läßt sich nicht in dürren Worten ausdrücken, aber soviel sei gesagt: Er ist ein Sinnbild für vieles, was gemütvolle Naturen lieben; und setzen die stockblinden Ratgeber der Nation ihren üblen Willen durch und fällt der hohle Baum samt ihm zum Opfer, dann bedeutet das, daß der letzte Winkel dieses Landes dem Dollar und seinen Anbetern Untertan wird. Möge ich lange dahingefahren sein, wenn dies eintritt!
Der März mit seinem Krähengeschrei und seinem Spechtgehämmer nahm vom Walde Besitz. Die Sonne war untergegangen, und ein sanftes Sternenlicht auf dem schmelzenden Schnee genügte den scharfen Augen der nächtlichen Wanderer. Zwei von ihnen kamen daher; schnell liefen sie durch den Wipfel eines gefallenen Baumes am liegenden Stamm entlang durch den Schnee und benutzten dann jeden passenden Baumstamm als eine Art Bürgersteig. Es waren große Tiere, das heißt größer als Füchse, von gedrungener Gestalt, mit buschigem Schwanz, ihrem Artmerkmal, an dem die scharfen Nachtaugen einer vorbeistreichenden Eule die dunklen Streifen sehen konnten.
Voran ging das kleinere der beiden Tiere, das sich von Zeit zu Zeit gereizt und ungeduldig umdrehte, als wollte es das größere hinter ihm beißen; vor ihm zu fliehen schien es aber nicht. Der größere Waschbär folgte mit geduldiger Gelassenheit. Ein Waldkundiger hätte sofort gewußt, daß es sich um ein Pärchen handelte. Wie es bei den Tieren Regel ist, hat die Mutter alle Vorbereitungen für die kommende Brut zu treffen. Sie muß die Kinderhöhle aussuchen, sie muß die rechte Zeit wissen, sie allein ist die Führerin auf diesem Streifzuge. Er ist nur zum Schutze dabei für den Fall, daß sie einem Feind begegneten.
Hinab durch das Erlendickicht am Fluß ging es und durch das niedere Strauchwerk und weiter, bis sie den ausgedehnten Waldstrich erreichten, den man hatte stehen lassen, weil das Land tief lag und dürftig war. Es war viel alter Bestand darunter, und die Waschbärin, die künftige Mutter, ging schnell von einem Stamm zum andern und suchte – was?
Der Wäldler weiß, daß eine hohle Fichte selten, ein hohler Ahorn häufig vorkommt und eine hohle Linde die Regel ist. Er hätte den gesuchten Stamm bei Tage wohl erkannt, denn ein hohler Baum hat einen toten Wipfel, aber die Waschbärin schien in der Dunkelheit mit voller Gewißheit von einer großen Säule zur nächsten zu gehen und, ohne hinaufzuklettern, zu wissen, daß sie nicht für sie geeignet seien. An der Biegung schließlich, wo Bach und Fluß sich vereinen, kletterte die Waschbärin auf einen großen abgestorbenen Ahornbaum wie eine, die Bescheid weiß.
Das ist die beste Wohnung für einen Waschbären. Hoch oben auf einem großen, weitragenden Baum, in einem tiefen, gefährlichen Sumpf, unweit fließenden Wassers mit seinem Zauber und seinem Reichtum an Nahrung, eine geräumige bequeme Kammer, trocken und mit dem weichsten Mulm gepolstert, ein enger, eben noch das Hineinschlüpfen gestattender Eingang und in der Nähe ein großer Ast, den am Tage der volle Sonnenschein trifft. Das ist die beste Wohnung, und das hatte die Mutter Waschbärin gefunden.
Im April waren die Jungen angekommen, fünf Stück mit Ringelschwänzen und schwarzen Masken wie ihre Eltern und hatten viel Arbeit gemacht.
Ihre Säuglingszeit war vorüber, und nun im Juni waren sie alt genug, an hellen Tagen herauszukommen und in einer Reihe auf dem dicken Ast zu sitzen, um ein Sonnenbad zu nehmen. Sehr früh im Leben traten ihre persönlichen Eigenheiten hervor. Da war das Furchtsame, dessen Schwanz um einen Ring zu kurz war; das fette Graue, das immer zuletzt aus dem Neste kroch; und das mit der schwärzesten Maske, groß, lebhaft und immer zu allem bereit: das Junge, das später den Namen Weh-Atscha erhielt. In der molligen Kinderstubenzeit sind die Gebote des Waschbärenlebens einfach: Iß, wachse und verhalte dich ruhig – für alles andere sorgt Mutter! Sind sie aber erst einmal so alt, daß sie das Nest verlassen können, dann fangen sie an, selbst Erfahrungen zu sammeln und die anderen Gebote zu lernen. Der Sonnensitz stand allen frei, und auch höher hinauf am Baum, zwischen den kleineren Zweigen durften die Jungen kriechen, nicht aber unter das Nest, wo der Stamm eine ganze Strecke weit völlig ohne Rinde und sehr glatt war, also eine schwierige und gefährliche Stelle für den Kletterer. Sobald daher eines der Kleinen Miene machte, sich hinunterzuwagen, rief die Mutter es mit scharfen, zornigen Tönen zurück.
Weh-Atscha (Mutter nannte ihn wie die andern »Wirr«, nur noch mit etwas kräftigerem Schnurren) war schon ein paarmal nachdrücklich zurückgeholt worden, aber das machte ihn nur noch erpichter auf die verbotenen Kletterpartien. Mutter war drinnen, als er wieder einmal von dem sonnigen Ast auf der rauhen Rinde hinabglitt und weiter zu der glatten Stelle. Hier war der Stamm zwanzigmal zu dick, als daß Weh-Atschas Ärmchen ihn hätten umfassen können. Natürlich fiel er hinunter, obwohl er sich an allem hielt, was er erlangen konnte; alles krachte und riß, und die Blitzfahrt endete mit einem Platsch im tiefen Wasser unten.
Durch das plötzliche Keuchen der andern beunruhigt, kam die Mutter eilends heraus und sah ihren Ältesten im Bache zappeln. Schleunigst glitt sie zu seiner Rettung hinunter, aber die Strömung hatte ihn gegen eine Sandbarre getrieben; er strampelte heraus, ohne großen Schaden genommen zu haben, und wandte sich dem Heimatbaum zu. Mutter war halbwegs unten; da sie ihn aber schon wieder heraufklettern sah, kehrte sie zu der Reihe gespannter Gesichter auf dem Ast oben zurück.
Weh-Atscha klomm tapfer hinauf, bis er die lange, rindenlose Stelle erreichte. Hier versagte seine Kletterkunst, und in seiner Verzweiflung brach er in ein langes, winselndes Gewimmer aus. Mutter war wieder an der Höhle, aber sie wandte sich nun, stieg hinunter, packte den Gescheiterten ziemlich unsanft im Genick, nahm ihn zwischen ihre Vorderpfoten, trug ihn um den glatten Stamm herum, auf die Seite, wo zwei Risse den Krallen einigen Halt boten, schob ihn hinauf und hielt ihn dabei, daß er nicht fallen konnte, puffte ihn aber auf dem ganzen Weg bis zum sicheren Heim.
Etwa zwei Wochen später hielt die Mutter die Zeit für gekommen, die Jungen in die große Welt hinunterzuführen, und dazu wartete sie einen Vollmond ab. Alte Waschbären können sich sehr gut in dunkler Nacht behelfen, aber wenn sie an die Ausbildung der Jungen gehen, brauchen sie etwas Licht.
Vater ging zuerst hinunter, um bereit zu sein, falls sich ein Feind zeigte, und nun lernten die Jungen erst, mit dem kahlen Stamm fertigzuwerden. Nur an einer Stelle bot sich eine sichere Gelegenheit: da, wo die beiden Risse ein festes Einkrallen möglich machten. Mutter machte es ihnen vor, und die Jungen taten ihr nach.
Für die war alles neu und überraschend; jeder Gegenstand mußte berochen und angefaßt werden: Steine, Baumstämme, Gras, Erde, Schlamm und vor allem das Wasser. Das glänzende Wasser, das sich nicht fassen ließ, war für sie alle ein Rätsel, nur nicht für Weh-Atscha, der es schon kannte oder sich doch einbildete, es zu kennen.
Die Jungen trieben es lustig; sie jagten auf den Stämmen umher und suchten einander in kleine Löcher zu stoßen, aber Mutter hatte Ernsteres mit ihnen vor; sie sollten den ersten Unterricht darin erhalten, wie sie ihren Lebensunterhalt zu erwerben hätten, und das geschah in der Hauptsache durch ihr Beispiel.
Wenn ein Waschbär auf der Nahrungssuche ist, so pflegt er am Wasser zu stehen, beide Vorderpfoten hineinzustecken, den Schlamm mit flinken und feinfühligen Fingern abzutasten und dabei Frösche, Fische, Krebse und dergleichen zu ergattern; zugleich läßt er seine Blicke über das Gehölz fern und nah, rechts und links schweifen, um auch sonstige gute Fanggelegenheiten wahrzunehmen und sich vor Feinden zu wahren. So machte es Mutter vor, und die Jungen sahen zu, fragten aber mehr nach der Beute als nach der Fangart.
Dann drängten sie sich aneinander, um besser zu sehen, das heißt, sie standen in einer Reihe am Ufer. Unwillkürlich steckten sie die »Hände« ins Wasser und taten es sofort der Mutter nach. Was für eine sonderbare Empfindung, wenn man den Schlamm so durch die Finger gleiten fühlte, dann vielleicht eine Wurzel wie eine Schnur oder eine runde weiche, die sich schlängelt! Was das für einen Schauer gibt! Denn der Instinkt sagte ihnen, das sei eine Beute, das sei ihr Ziel.
Unser Weh-Atscha, der den Fund machte, hielt die Kaulquappe fest, ohne daß man es ihn geheißen hatte, und nahm sie zwischen die Zähne, bekam aber den Mund voll Schlamm und Sand. Er spuckte aus, Schlamm, Kaulquappe und alles. Mutter nahm das Zappelige mit dem silberigen Bauch, wusch es in dem klaren Wasser und gab es Weh-Atscha zum Verschlingen. Nun wußte er Bescheid und hielt sich hinfort an den Brauch seiner Artgenossen, jeden Bissen gewissenhaft zu spülen und zu säubern, ehe er ihn verzehrte. Der scheue Bruder mit dem kurzen Schwanz war zu furchtsam, von der Mutter weit wegzugehen, und lernte daher nur wenig. Die andern beiden zankten sich um einen vollkommen wertlosen alten Knochen. Jeder hatte »ihn zuerst gefunden«, und der Sieger hatte nichts davon, Graurück war weit draußen auf einem Holzstamm über dem Wasser und wollte darin den widerspiegelnden Mond fangen, aber der vom Erfolg berauschte Weh-Atscha war nur aufs Jagen versessen. Am schlammigen Rande watschelte er entlang und spähte eifrig hierhin und dorthin, ganz wie Mutter, und stocherte überall im Schlamm und ließ ihn durch die Finger gleiten, ganz wie Mutter, hielt zwei Hände voll empor, um daran zu riechen, ganz wie Mutter, umspannte eine unbrauchbare Wurzel, die sich zu winden schien, und spuckte sie knurrend aus, ganz wie Vater. Das war ein Spaß! Und als seine ruhelosen kleinen Finger schließlich den glatten, zappelnden Körper eines im Schlamm versteckten Frosches faßten, durchzuckte Weh-Atscha solch ein Freudenschauer, daß sich ihm alle Haare auf dem Rücken sträubten, und er stieß das Feldgeschrei der Waschbären aus, das nichts weiter ist als ein wunderlicher Mischlaut, halb Brummen, halb Knurren. Das war ein Augenblick des Triumphs, aber Weh-Atscha vergaß nicht, was er vorher gelernt hatte, und spülte den Frosch so sauber, wie Wasser ihn machen konnte, ehe er ihn verschmauste.
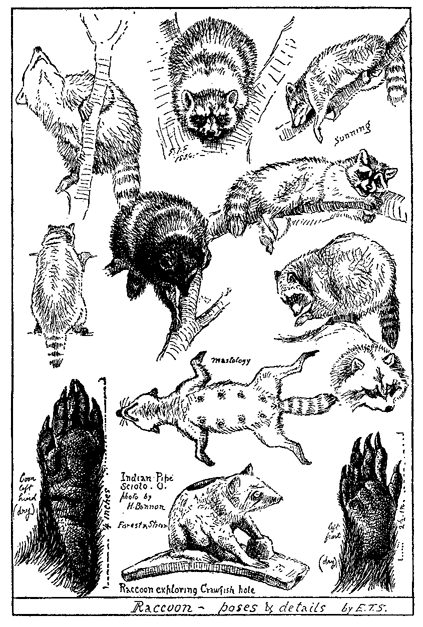
Der Waschbär – Bewegungsstudien und Einzelheiten aus Ernest Thompson Setons Skizzenbuch.
War das aufregend! Und er hoffte auf endloses weiteres Vergnügen, als plötzlich ein Zeichen vom Vater alle seine Absichten über den Haufen warf. Vater hatte weit unten am Flußufer Wache gehalten, während die Mutter mit den Jungen am Bache weilte. Jetzt ließ er einen Warnruf hören, den Mutter nur allzu gut kannte; es war ein leiser Ton, etwa wie »Fuuf« klingend, dem ein tiefes Brummen folgte. Mutter lockte die Jungen mit leichtem Gebrumm. Sie ahnten die Bedeutung nicht, aber ein Gefühl der Unruhe hatte sie ergriffen, und eine Minute später krochen in regelrechtem Zuge sechs Pelzkugeln den gewaltigen Ahornbaum hinauf, genau in den beiden Ritzen und dann sofort in ihr bequemes Schlafzimmer.
Fernher vom Fluß unten kam ein tiefer, hallender Klang, zweifellos das Gebrüll eines schrecklichen Tieres. Mutter horchte vom Eingang aus. Jetzt kam Vater den Stamm heraufgeklettert, naß, weil er durch den Fluß geschwommen war, nachdem er, um den Feind wegzulocken, eine Fährte gelegt hatte; und er war auf einem neuen Wege, am oberen Rand eines Zaunes entlang, heimgekehrt, so daß keine Spur geblieben war, und das Gebell des Hundes verklang.
In dieser Nacht hatte Weh-Atscha einige der großen Ereignisse, die für das Leben eines Waschbären von Bedeutung sind, kennengelernt und mitempfunden: die Mondscheinjagd, die wachsame Mutter, den wehrhaften Vater, den schrecklichen Hund, die sichere Heimkehr mit Hilfe der Spurunterbrechung. Aber Gedanken darüber hatte er nicht. Ihn bewegte nur die Erinnerung an die freudige Erregung, als er den fetten, zappligen, saftigen Frosch in den Fingern quetschte, und in der nächsten Nacht sehnte er sich nach einer neuen Jagd.
Viele Wesen haben einen sechsten Sinn, ein Etwas, das sie vor drohender Gefahr warnt, ein Etwas, das früher auch die Menschen besaßen, und das sie einen »Fernsinn kommender Dinge« oder einen »Glückssinn« nannten. Am stärksten scheint diese Fähigkeit bei Müttern entwickelt zu sein, die Junge haben. Und als die nächste Nacht heraufzog, fühlte sich Weh-Atschas Mutter unruhig. Etwas war nicht in Ordnung. Sie zögerte, die runde Treppe hinabzusteigen und lag, gespannt spähend und lauschend, auf dem sonnigen Ast, bis alle mißmutig und hungrig waren. Weh-Atscha konnte es vor Ungeduld einfach nicht mehr aushalten. Vater lief den Stamm hinunter, kam aber bald wieder herauf. Die Kinder winselten; doch Mutter gab nicht nach. Ihre Ohren wandten sich mehrmals dem Flusse zu, aber nichts Besonderes ließ sich vernehmen. Der Mond war untergegangen, und jetzt, in der größten Dunkelheit, führte die Mutter endlich ihre Sprößlinge hinunter. Alle hatten großen Hunger und liefen plätschernd und spritzend am Ufer dahin. Weh-Atscha fing einen Frosch und Klein Kurzschwanz eine Kaulquappe. Dann fingen sie alle miteinander Frösche, und die ganze Welt war wie eine einzige große, lustige Jagd ohne Sorgen, ohne Schmerz.
Jetzt fand Weh-Atscha auf einer Sandbarre eine neue Art von Frosch. Er glich zwei nebeneinanderliegenden flachen Knochen und roch angenehm. Weh-Atscha langte danach, aber sofort schlossen sich die beiden Knochen über seinen Zehen und quetschten sie so, daß er flehend um Hilfe schrie. Natürlich eilte die Mutter sofort herbei, während Weh-Atscha vor Schmerz und Furcht auf und nieder hopste. Die Alte kannte die Muscheln zur Genüge. Sie nahm das harte Ding zwischen die Zähne, zerdrückte das Schloß und machte so der Not ein Ende. Jetzt hatte der Gekniffene das Vergnügen, das Fleisch von den Schalen zu lösen, im Fluß zu spülen und als eine neue Art Frosch zu verschlingen, und alles erschien ihm wieder rosenrot.
Aber Vater erklomm eine Wurzel, schnaufte, witterte und horchte, und Mutter prüfte alle Gerüche und Spuren, die am Wege weiter ab vom Ufer waren. Zum Jagen war sie heute kaum gekommen. Ihr geheimer Sinn war stark in ihr, und sie gab das Zeichen zur Rückkehr.
Die Jungen folgten sehr widerwillig, und Weh-Atscha wurde fast aufrührerisch. Nach seinem Urteil hatten sie allen Grund zu bleiben, und keinen, sobald nach Hause zu gehen. Aber das beste Urteil vermag nichts gegen höhere Gewalt. Mutters Pfoten waren stark, und Vater konnte sehr grob werden. So stiegen die sieben Haarbälle wie zuvor die steile Ahorntreppe hinauf.
Der Rotfuchs vom Berghang jappte dreimal, ein kleiner Singvogel sang unweit des Ahornbaums dreimal laut im Traum, und Mutter Waschbär hörte es, ohne darauf zu achten. Später kam dann ein anderer Laut, ganz leise und fern, ganz schwach. Die Jungen vernahmen ihn nicht, aber der Alten sträubten sich die Haare. Es war ein ganz anderer Ton und kam von irgendwoher im Norden, der harmlose Wind machte manchmal solche Geräusche, aber hier war noch ein starkes Krachen dabei und ein paarmal Gebell, das von Hunden stammen mußte.
Die Geräusche kamen näher und wurden lauter, rote Sterne erschienen zwischen den Bäumen, und bald zeigte sich eine Schar von Männern mit Hunden, eine schwere Bedrohung für jedes lebende Wesen im Walde. Die frische Fuchsfährte da unten zog die Aufmerksamkeit der Hunde auf sich; so kamen sie dem Waschbärenbaum nicht nahe, und Mutter wußte, daß sie alle in dieser Nacht einer großen Gefahr entgangen waren.
Am folgenden Abend hatte Mutter Waschbär Augen und Ohren auf allen Seiten und prüfte jeden Windhauch, während der Mond bei vier Bäumen vorüberging und ganz nahe bis zum Höhleneingang schien, ehe sie die Kinder zur gewöhnlichen Jagd hinunterließ. Die glaubten natürlich, sie würde sie wie sonst am Fluß hinabführen, aber sie tat es nicht. Flußaufwärts ging es; auch machte sie nicht halt zum Jagen, sondern wanderte weiter. Sie gelangten zu einem Strich am Ufer, wo überall aus dem Schilfgras Frösche ins Wasser sprangen. Das schien verheißungsvoll, aber Mutter ging noch weiter. Dann ward ein lautes Geräusch vernehmbar, als erhöbe sich ein Wind, nur manchmal plätscherte es wie ein Frosch oder gar eine Bisamratte. Dann kamen sie zur Quelle des Geräusches; es war der Bach selbst, der über eine Felsleiste in einen Teich hüpfte, glitzernd im Mondlicht, geräuschvoll in der Stille der Nacht. Mutter hielt die Jungen ein Weilchen zurück, während sie scharf nach vorn und ringsumher spähte. Dann duckte sie sich; ihr Haar sträubte sich, sie grollte. Vater trat neben sie. Die Jungen hatten jetzt kein Verlangen mehr, vorwärtszueilen. Denn dort, am wildreichen Wasser, waren andere Jäger, die plätscherten, Frösche fingen und schmausten. Sie sahen aus wie sie selbst, und drehte einer von ihnen seinen Schweif herum, so sah man daran unfehlbar die sieben Ringel, das Wahrzeichen der Waschbärensippe.
Aber die eine der beiden Parteien war widerrechtlich hier. Welcher Familie gehörte dieser Jagdgrund? Das ist im Wald immer eine ernste Frage. Vater Waschbär reckte sich hoch auf, plusterte den Pelz auf und stelzte aus der Deckung vorwärts, am offenen Rand entlang. Die andere Familie geriet in lärmende Aufregung; dann liefen drei der Jungen winselnd zur Mutter, und ihr Vater reckte sich hoch auf den Beinen, plusterte seinen Pelz auf und stelzte steif und offen auf Weh-Atschas Vater los. Jeder brummte leise, als wollte er sagen: »Du da, verschwinde, oder ich geb' dir's.« Da aber keiner wegging, standen sie einander gegenüber. Jeder meinte, er sei im Recht und der andere im Unrecht. Jeder fühlte, er müßte seine Familie beschützen und die Eindringlinge vertreiben, und so standen sie und maßen einander mit den Blicken, während sich die Jungen auf jeder Seite hinter der Mutter zusammendrängten.
Die Revierordnung ist bei den Tieren so: Wer sich zuerst einen Jagdbezirk wählt, hat das Besitzrecht. Er muß ihn aber an den Hauptpunkten zeichnen, wozu er sich der Duftdrüsen nahe am Schwanz bedient, die ihm von der Natur für solche Zwecke gegeben sind. Haben zwei Jäger gleichberechtigte Ansprüche, so kämpfen sie, und der Stärkere behält das Revier. Weh-Atschas Eltern hatten den Jagdgrund seit Wochen nicht gezeichnet, und ihr Duftstempel war fast ganz weggewaschen. Die andere Familie war zwar später gekommen, hatte aber das Revier viel benutzt und auch markiert. Also hatten beide gleichviel Recht, und nur der Kampf konnte den Streit entscheiden.
Die Hauptregeln im Waschbärenkampf sind: Geh los auf den Feind, wobei du ihm den geschützten Rücken und die Schultern darbietest, packe ihn um die Hüften und wirf ihn so, daß er auf dich fällt! Denn der untenliegende Waschbär hat die beste Gelegenheit, dem andern mit den Hinterbeinen, die frei sind, den Bauch aufzuschlitzen; und während er ihn mit den Vorderbeinen, die ebenfalls frei sind, hält, kann er ihm mit den Zähnen die Kehle bearbeiten.
So lief Weh-Atschas Vater den Gegner, ein wenig seitwärts geneigt, an, und der andere, der ihn als an Größe überlegen erkannte, hielt sich besorgt etwas zurück.

Der Größere machte einen Ausfall, der Kleinere parierte. Sie drehten sich im Kreise, ohne daß einer von ihnen Boden gewann oder verlor. Ein zweiter Ausfall, da glitt der Größere ein wenig aus, der neue Waschbär warf sich auf ihn, und der Kampf begann. Aber keiner konnte den Griff machen, den er wollte. Die Kräfte waren fast gleich. Sie wälzten und zerrten sich, während ihre Angehörigen laut schrien, und in einem Augenblick gingen sie beide taumelnd hinunter – plantsch – in den tiefen Teich. Nichts kühlt mehr ab als kaltes Wasser. Die Kämpfer ließen voneinander, und als sie herauskrabbelten, war bei beiden eine merkwürdige Veränderung vor sich gegangen. Keiner hatte mehr Lust zu kämpfen, und die Tatsache, daß der andere auf seinem Grunde jagte, ließ ihn ganz gleichmütig.
Ein paar wütende Blicke gab es wohl noch und hin und wieder leises Knurren, aber beide Familien gingen am Teich auf Nahrung aus, die eine mehr auf der offenen Seite, die andere, wo das Dickicht stand.
Das war der Anfang, und nach und nach wurden sie allesamt gute Freunde, denn für beide gab es hier reiche Beute. Die Kleinen schmausten, bis ihre Bäuche kugelrund waren, und wohlgemut kletterten sie endlich wieder auf ihren großen, glatten Baum.

Weh-Atscha war mit vielem, was seine Mutter tat, sehr unzufrieden. Wollte sie bachabwärts, zog es ihn bachaufwärts. Ließ sie sich durch irgendein nichtssagendes Geräusch zur Zeit der Abendmahlzeit abhalten, auf die Abendjagd zu gehen, so war das überaus ärgerlich. Ließ sie sich von dem sonderbaren Geruch an einem Steine beim Ufer erschrecken, nun, ihn erschreckte er eben nicht, und dabei blieb es.
Als sie wieder einmal eines Nachts auf die Nahrungssuche gingen, hatte sich Mutter, nachdem sie den Wind geprüft, für den Weg bachabwärts entschieden. Weh-Atscha dagegen träumte vom Teich mit seinem mannigfaltigen Getier.
Er hielt sich zurück, und als die Mutter rief, war er weit hinten. Dann erspähten seine scharfen Augen eine Bewegung am Rande des nahen Wassers. Mit der Leidenschaft des angehenden Jägers sprang er darauf und zog einen schönen großen Krebs heraus. Den spülte er sorglich ab und verzehrte ihn mit Haut und Haar, ohne der Rufe der Mutter zu achten, als sie die andern wegführte. Eingebildet auf seine Errungenschaft, fühlte er sich so siegesbewußt und selbständig, daß er der Mutter den Rücken kehrte und sich, wie es von vornherein seine Absicht gewesen war, dem oberen Teich zuwandte.
Nachdem ihm noch ein paar kleine Fänge geglückt waren, erreichte er das hüpfende Wasser. Dort war an demselben Tage auch ein anderer Besucher gewesen. Der Indianer-Peter, ein Fallensteller, hatte den Teich und um ihn herum Fährten von Bisamratte und Waschbär entdeckt. Zu dieser Jahreszeit hat das Pelzwerk keinen Wert, aber Peter brauchte die Tiere zur Nahrung; so verbarg er im Schlamm eine große Stahlfalle, und an einem kleinen Stecken weiter draußen im Wasser rieb er einen Lappen mit einer Mischung von tierischen Ölen und Moschus.
Aha, hier war er wieder, der Geruch, vor dem die ängstliche Mutter solche Furcht hatte! Den wollte er jetzt untersuchen. Er kam hinunter zu der Stelle, schnüffelte herum und griff dann nach seiner Gewohnheit in den Schlamm, während er seine Blicke umherwandern ließ; da ging es plötzlich schnapp-klatsch, und der arme Weh-Atscha war mit einer Pfote in einer Stahlfalle gefangen.
Jetzt dachte er an die Mutter und ließ ein langes, leises Wimmern hören, wie es seiner Art eigen ist, aber Mutter war weit fort; davon hatte er sich ja selbst überzeugt. Und er erinnerte sich an die kneifende Muschel, aber alle seine Versuche, die Pfote herauszuziehen oder das scheußliche harte Ding abzubeißen, waren vergebens; es saß fest an der Pfote, und eine Art starke, gedrehte Wurzel hing auch daran. Die ganze Nacht hindurch schrillte, wimmerte und wand er sich vergeblich, der Ungehorsame, und als die Sonne aufging, war er zu Tode erschöpft und stockheiser. Mit Verwunderung fand der Indianer am nächsten Morgen in seiner Falle statt einer Bisamratte einen jungen Waschbären, halbtot vor Kälte und Angst und so schwach, daß er nicht einmal beißen konnte.
Der Trapper nahm das kleine Geschöpf aus der Falle und steckte es lebend in seine Tasche, ohne recht zu wissen, was er damit anfangen sollte.
Auf dem Heimwege kam er bei Pigotts Gehöft vorüber und zeigte den Kindern seinen Gefangenen.
Der kleine Waschbär war noch ganz kalt und elend, und als die älteste Tochter ihn in ihre Arme nahm, schmiegte er sich so innig an, daß er ihr das Herz bewegte und sie dem Vater so lange mit Bitten zusetzte, bis er Weh-Atscha, wie der Indianer den Gefangenen in seiner Sprache nannte, kaufte.
So fand der kleine Eigensinn ein neues, ganz anderes Heim. Hier wurde er so gut versorgt, daß er sich in wenigen Tagen recht wohl fühlte. Statt seiner Geschwister hatte er jetzt Kinder zu Spielgenossen, und an Stelle der Frösche bekam er viele sonderbare Dinge vorgesetzt, aber noch immer steckte er seine braunen Pfoten gern in Schlamm oder irgend etwas Feuchtes. Milch und Brot verzehrte er nicht wie eine Katze oder sonst ein wohlerzogenes Geschöpf; regelmäßig steckte er seine Pfötchen hinein, das Brot, Stückchen für Stückchen, herauszufischen, und meistens war das Ende vom Liede, daß er die Milch verschüttete.
Ein Mitglied des Haushaltes versetzte Weh-Atscha in große Furcht; es war Roy, der Schäfer-, Haus- und allgemeine Hofhund. Als sie sich zum ersten Mal sahen, knurrte Roy, und Weh-Atscha schrillte. Bei beiden verrieten die gesträubten Schulterhaare die tiefe Erregung, und in jedem von beiden rief der Geruch des andern eine jahrhundertealte Feindschaft wach. Die Pigottschen Kinder konnten nur durch Ausübung ihres Gebieterrechts den Frieden wahren. Roy lernte mit der Zeit den Waschbären dulden, der kleine Bär wurde ein ergebener Freund von Roy, und es waren noch keine zwei Wochen vergangen, als Weh-Atscha auf Roys haariger Brust sein Schläfchen zu halten pflegte, tief in die Wolle gedrückt, und von den vier Hundebeinen eng umschlossen.
Als er größer wurde, machte er sich recht unnütz. Halb wie ein Affe, halb wie ein Kätzchen, war er immer zu Posen aufgelegt und für Liebkosungen empfänglich – und immer hungrig. Bald wußte er auch, wo er sich Leckerbissen holen konnte. Die Kinder pflegten eine Näscherei für ihn in der Tasche zu haben, und das war Weh-Atscha so gut bekannt, daß er, wenn ein Fremder ins Haus kam, ihm an den Beinen hinaufkletterte und die Taschen nach etwas Eßbarem durchsuchte.
Einmal war er ein paar Stunden lang nicht sichtbar, stets ein verdächtiger Umstand. Als Frau Pigott in die von Sommervorräten strotzende Vorratskammer kam, wurde sie von einem winselnden Weh-Atscha begrüßt, der geschäftiger war, als Worte beschreiben können. Bis zu den Augen mit Pflaumenmus beschmiert, wirkte er an einem damit angefüllten großen Steinguttopf wie eine Waschfrau vor ihrem Zuber. Er hatte sich vollgestopft, bis er nichts mehr hinunterbrachte, und nun fingerte er, von seinen alten Walderinnerungen getrieben, in Mus und Tunke herum, um alle Pflaumensteine auszulesen, die einer nach dem andern untersucht und beiseite geworfen wurden. Der Boden war voll von Steinen, die Bretter starrten von dem Mus aus den zahlreichen untersuchten Töpfen. Das Bärchen war bis auf seine glänzenden Äuglein unkenntlich; aber es kam watschelnd, triefend, glucksend vom Gestell herunter auf Frau Pigott zu und wollte an ihr emporklettern und liebreich getätschelt werden. Er wurde grausam enttäuscht.
Eines Tages setzte Frau Pigott eine Henne zum Brüten auf dreizehn Eier. Am nächsten Tag war Weh-Atscha nicht zu sehen. Als man herumging und nach ihm rief, vernahm man eine schwache Erwiderung aus dem Hühnerhause: das freundliche Schrillen, mit dem er gewöhnlich zu antworten pflegte. Als sie die Tür öffneten, sahen sie Weh-Atscha auf dem Hühnernest mit vollem Bauch lang ausgestreckt liegen, und die verstreuten Schalen der dreizehn Eier verrieten, was er angestellt hatte. Roy war der berufene Hüter des Hühnerhauses, und kein Strolch, kein Fuchs, kein wilder Waschbär konnte hinein, solange er Wache stand. Aber ach, Liebe und Pflicht wiesen verschiedene Wege, und in seiner Verlegenheit war der Hund unwissentlich der Vorschrift eines gewissen großen Mannes gefolgt, der da sagt: »Im Falle des Zweifels handle wie ein Freund.«
Farmer Pigott ertrug Weh-Atschas Streiche mit Geduld, weil die Kinder den kleinen Übeltäter so gern hatten. Aber eines Tages wurde der Höhepunkt erreicht, als der Waschbär, der sich allein im Hause befand, hinter die Tintenflasche kam. Zuerst zog er den Korken heraus und verschüttete die Tinte, dann plantschte er in seiner gewöhnlichen Art mit den Fingern darin, und es bereitete ihm ein neues Vergnügen, seine tintigen Pfoten auf alles zu legen, was einen guten Abdruck annahm. Zuerst bemalte er den Tisch, dann fand er, daß die Schulhefte der Kinder viel geeigneter waren und die besten Erfolge ergaben. Er stempelte sie mit seinen Pfoten inwendig und auswendig, und dann veranlaßte ihn wieder der angenehme Kitzel des Plantschens, seine Pfoten recht oft zu schwärzen. Sodann schien die Tapete dringend einer Zier zu bedürfen. Von den Tapeten ging es zu den Fenstervorhängen und den Kleidern der Mädchen, worauf Weh-Atscha, da das Schlafzimmer offenstand, aufs Bett kroch. Es war wirklich hübsch anzusehen, wie der schneeweiße Überzug die süßen kleinen Pfotendrucke annahm, wenn er mit großem Wohlgefallen darüber hingaloppierte. Er war ein paar Stunden allein und brauchte die ganze Tinte auf, so daß es, als die Kinder von der Schule heimkamen, aussah, als wären hundert kleine Waschbären dagewesen und hätten schwarze Fährten hinterlassen. Die arme Frau Pigott brach tatsächlich in Tränen aus, als sie ihre schönen Betten, den Stolz ihres Herzens, erblickte. Aber sie hörten auf zu fließen, als Bärchen ganz wie sonst auf sie zulief, seine tintigen Ärmchen ausstreckte und »errr err« machte, um aufgenommen und gestreichelt zu werden, als wäre er der beste Waschbär der Welt.
Aber was zuviel war, war zuviel! Auch die Kinder hatten nichts zur Entschuldigung vorzubringen; ihre Kleider waren ruiniert. Weh-Atscha mußte fort, und so kam es, daß nach dem Indianer-Peter geschickt wurde. Weh-Atscha gefiel der Mann nicht, aber er hatte keine Wahl. Er wurde in einen Sack gesteckt und von dem Halbblut mitgenommen, sehr zu Roys Verwunderung, denn er verabscheute das Halbblut und verachtete dessen Hund. Warum man den Fremden ein Mitglied seiner Familie mitnehmen ließ, war ihm ein Rätsel. Roy knurrte ein wenig, schnüffelte stark an den Beinen des Jägers und wedelte nicht ein einziges Mal mit dem Schwanz, als Indianer-Peter mit dem zappelnden Sack davonging.
Der Sommer ging zu Ende, der Jagdmond stand bevor. Der Jäger hatte einen neuen Hund abzurichten, und jetzt bot sich die erwünschte Gelegenheit, sich dabei eines Waschbären zu bedienen. Peter hatte keinen Grund, Weh-Atscha zu schonen, und nichts macht einen Hund geschickter zur Waschbärenjagd, als wenn er sich am lebenden Tier üben kann.
Es sollte also Weh-Atschah Los sein, bei der Abrichtung eines Hundes geopfert zu werden. Als Peter sich seiner Hütte näherte, kam dieser Hund, ein schwerfälliger Bastard, angesprungen, dessen lärmendes Jappen sich noch verdreifachte, als er den Sack beschnüffelte, in dem Weh-Atscha steckte.
Das Abrichtungsverfahren Indianer-Peters war folgendes: Im Stalle erhielt der Waschbär einen Stand oder kleinen Verschlag, wohin er wenigstens sein Leben vor dem Hunde retten konnte. Der Heuler wurde an einer Kette hereingebracht und mit lautem »Faß ihn!« zum Angriff auf den Waschbären gereizt. Beim Anblick eines so kleinen Feindes tapfer wie ein Löwe, sprang er darauf los, wurde jedoch von der Kette zurückgehalten, denn es war noch zu früh zum »Ausmachen«.
Weh-Atscha war ganz verdutzt. Die anderen zweibeinigen Wesen hatten sich doch so freundlich gezeigt, warum war dieses so feindlich, und warum war Roy ein so guter Kamerad gewesen und dieser gelbe Rohling so böse und grausam? Jedesmal, wenn der Hund anrannte, fühlte der kleine Weh-Atscha das kriegerische Blut seines tapferen Geschlechts aufwallen und trat dem Angreifer knurrend und zähnefletschend entgegen.
Aber es wäre wohl sehr bald um ihn geschehen gewesen, hätte Indianer-Peter die Kette nicht festgehalten. Nur einmal ließ er dem Hund freies Spiel. Er packte das junge Tier im Genick, um es zu Tode zu schütteln, aber die Natur hat dem Waschbären ein starkes, loses Fell gegeben. Weh-Atscha fühlte das Schütteln kaum und setzte seine Zähne so kräftig am Bein des Heulers an, daß dieser laut aufgellte und das Halbblut den Hund wegzog. Das war die erste Lektion. Von nun an haßten sie einander.
Am nächsten Tage lernten beide wieder etwas Neues: Weh-Atscha, daß das Loch, der ihm zugewiesene Verschlag, eine sichere Zufluchtsstätte war, und der Köter, daß der Waschbär nicht nur beißen, sondern auch kratzen konnte.
Es kam der dritte Tag und brachte die dritte Lektion. Am kühlen Abend packte der Jäger den Waschbären, steckte ihn in einen Sack, nahm sein Gewehr von der Wand und machte sich auf zum nächsten Waldstück; denn die Fahne des Waschbären zu verfolgen und ihn auf einen Baum zu treiben, war die höchste Stufe im Abrichtungskurs.
Im Holz angekommen, war das erste, was Peter tat, daß er den Hund an einen Baum band. Warum? Sicher nicht aus Rücksicht für den Waschbären, sondern weil dieser Gelegenheit haben mußte, fortzulaufen und aus der Sicht zu kommen, damit der Hund sich veranlaßt sähe, der ersehnten Beute auf deren Fährte zu folgen. Muß er dies erst einmal tun, um sein Ziel zu erreichen, so macht ihn sein eigener Instinkt zum Spürhund, und er folgt der Spur, bis er das Beutetier erblickt. Dann greift er es an oder springt den Baum an, auf das sich es geflüchtet hat, und läßt so den Jäger wissen, daß sich da oben der Waschbär befindet. So pflegt man einen Hund auf den Waschbären abzurichten, und das war auch der Plan Indianer-Peters.
Der Hund wurde also an ein Stämmchen gekettet und der Waschbär aus seinem Bereich getragen und aus dem Sack geschüttet. Verdutzt zunächst, doch unerschrocken schaute er sich um, und als er seinen großen Feind ganz nahe sah, stürzte er mit offenem Maule auf ihn zu. Indianer-Peter rannte etwas erstaunt, aber lachend, weg. Der Hund fuhr auf den Waschbären los, bis die Kette ihn mit einem Ruck zum Halten zwang, und nun war der Waschbär vor jedem Angriff sicher und konnte laufen. Und wie er lief! Mit dem Instinkt des gejagten Wildes stürzte er hinter einen Baum, um außer Sicht zu kommen, und setzte im Zickzack davon, der dichtesten Deckung zu; er rannte wie nie zuvor.
Nun kam das Halbblut zurück, den Hund freizumachen. Straff wie ein Segeltau war die Kette, die den blindwütenden Köter festhielt, so straff, daß Peter nicht das Stückchen lose Kette in die Hände bekommen konnte, das er brauchte, um den Karabinerhaken aufzudrücken. Er fluchte auf den Hund, riß ihn immer wieder zurück und bemühte sich, den Kettenverschluß zu öffnen, aber je mehr er riß und schrie, um so stärker riß und bellte auch der Hund und machte es seinem Herrn noch schwerer. Zwei, drei Minuten hatte dieser zu tun, bis die Kette glücklich los war, und dann mußte er noch den Hund fangen und halten, um ihm sein Halsband abzustreifen. Dann erst sprang der Hund dahin, wo er den Waschbären zuletzt gesehen hatte.
Aber das Opfer war nicht mehr da; die drei kostbaren Minuten bedeuteten so viel, und auf des Jägers »Faß ihn! Faß ihn!« raste der Hund herum. Seine Nase fand die Fährte, instinktmäßig bellte er, dann folgte er ihr und bellte wieder bei jedem Satz. Zuweilen verlor er sie, fand sie wieder, bellte und folgte ihr nun langsamer, denn wenn er zu schnell lief, verlor er sie immer wieder. Peter rannte mit und feuerte ihn durch Zurufe an, denn das alles lag in seinem Plan. Zweifellos rannte der Waschbär davon, aber der Hund würde ihn bald finden, und dann – oh, das bleibt nicht aus – klettert der Waschbär auf den am leichtesten zu erklimmenden Baum, und das ist immer ein kleiner, der darunter bellende Hund leitet dann den Schützen hin, der kommt herbei und schießt den Waschbären an, so daß er herunterfällt und vom Hunde abgewürgt wird. Dieser hat so seinen Anteil an späteren Waschbärjagden kennengelernt und ist hinfort, vom Sieg berauscht, noch mehr auf die Jagd versessen als sein Herr.
Ja, so war Peters Plan. Er war vorher oft erfolgreich gewesen und würde es auch diesmal sein, ganz sicher. Nur eins stimmte nicht: Weh-Atscha kletterte nicht auf einen schlanken Baum! Sobald er weit genug entfernt war und die beiden hinter sich herlärmen hörte, kletterte er auf einen Baum der Art, der seiner Erinnerung nach die sicherste Zufluchtsstätte bot. Der dicke, hohle Ahorn war der schützende Hafen seiner Jugend gewesen, und auf den allerdicksten Baum, den er fand, stieg er nun.
Sein Feind kam heran, der Hund lernte schnell und hielt sich fest an die Fährte. Sein Herr folgte, bis sie die mächtige Sykomore erreichten und Heuler sagte: »Hier, hier haben wir ihn auf dem Baum!« Was das Halbblut sagte, können wir uns denken. Sein Gewehr hatte er mitgenommen, aber keine Axt. Der Waschbär hatte sich in irgendeine große Asthöhle gerettet; denn zu sehen war er nirgends, und ein Mensch konnte den Baum nicht erklettern. Es wurde Nacht, und Peter ging mit seinem keuchenden Hunde als Besiegter heim.
So war das Glück mit Weh-Atscha, das Glück und die Erinnerung an seine Kindheitstage, die, vom Instinkt verstärkt, ihm das Geheimnis seines Geschlechts erschloß: Das ist eure wahre Wohnstätte – der große hohle Baum. Der schlanke Nachwuchs ist eine Versuchung und eine Falle, aber der mächtige hohle Baum ist eine starke Festung und sichere Rettung.
Ausgeruht und unternehmungslustig war er, als die dunkelsten Stunden mit ihrer begnadeten Stille kamen; und nach manchem Ohrenspitzen und Äugen schwang er sich im tiefen Walde auf den Boden und trabte fort, immer weiter und machte nicht einmal halt, um seinen Hunger zu stillen, bis er fern war im weiten Sumpfland am Kilderbach, in der Heimat seiner ersten Lebenstage, im Land seiner Sippe.
Ein Waschbär, der nach Monaten zurückkehrt, ist für sein Volk ein Fremdling; seine Gestalt ist vergessen oder eine andere geworden; sein Platz ist ausgefüllt. Nur eins bleibt dauernd in diesem Geschlecht von Nasentieren, das ist sein Geruch. Und das war auch Weh-Atschas Paß, ein Beweis, daß er zu den Seinigen gehöre. Langsam lebte er sich bei ihnen ein, nicht als ein Junges, sondern als ein vollzähliges Mitglied, und er blieb bei ihnen, lernend und lehrend. Aber auch bei ihm wird, wie bei allen seinen Altersgenossen, der Tag kommen, wo der innere Drang sich geltend macht und die bisherigen Bande gebrochen werden, um einer Lebensgefährtin willen. Dann verlassen sie ihr Heim und suchen, wie es ihre Eltern taten, eine ruhige Stelle auf, wo riesige, mächtige Stämme noch den Platz behaupten, wo wertloses Land noch schön ist. Und hier, von der Allmutter geleitet, ziehen sie ihre Brut auf und lehren sie noch etwas mehr, als sie selbst gelernt haben, denn die Zeiten sind andere geworden. Die Reihen dicker hoher Bäume gibt es nicht mehr, nur kümmerliche Reste stehen noch am Wasser, nur noch unnütze Stämme auf unnützem Land, wie die Ackerbauer meinen. Sie sind nicht mehr die sicheren Häfen der ehemaligen Könige des Waldes, sondern locken nur den schwarzgelarvten Bewohner der hohlen Stämme an. Er ist ein kluges Tier und bedarf der Klugheit immer mehr. Am Tag kommt er nicht mehr zum Vorschein, und nachts geht er nicht weit weg. Jeden Zaun benutzt er, um darauf zu laufen, und unterbricht dadurch seine Fährte. Seine Nahrung holt er sich im Walde am Bachufer. Jedes Zusammentreffen mit Menschen vermeidet er. Er zeigt sich ihnen nie, wenn sie nicht zufällig seine Wege kennen. Manchmal liegt er mittags hoch oben, vom Tagesgestirn bestrahlt, dessen Einfluß manches Siechtum heilt, und nachts, bei untergehendem Monde, geht er am sumpfigen Ufer plantschen und fangen. Spuren verschiedener Größe geben am nächsten Tag Kunde von der nächtlichen Streife. Aber zu sehen bekommt man ihn im seltensten Fall; denn seine Sinne sind schärfer als die des Menschen, und er ist stets bereit, in seinem hohlen Baum zu verschwinden. Die Welt hat viele jagende Hunde, aber nur einen Roy. Der Waschbär kennt dich nicht, aber er weiß, daß es viele Indianer-Peter gibt.
Ihr möchtet ihn finden und kennenlernen, ihr Waldfreunde! Ihr versprecht Rücksicht, ja Hochachtung vor der Dryade der hohlen Bäume.
Oft habe ich nach ihm gesucht und mit Liebe gesucht in den tiefen, feuchten Wäldern des Kilderbaches. Oftmals habe ich auf Astgabeln und anderen Altären lockeres Welschkorn als mein Opfer für den Ringelschwänzigen gelegt. Und das Korn ist immer verschwunden, nie weiß ich recht, wie – aber von Zeit zu Zeit sehe ich Spuren und Abdrücke der geschickten, handähnlichen Pfote oder die Muschelschalen mit zerbissenem Schloß oder die Flossen des Katzenfisches, und ich weiß, daß er noch in der Nähe haust, daß er noch mit Verachtung die Hunde bellen hört und nur eine große Furcht kennt, die vor der Axt, die ihm seinen geweihten Baum rauben will. Was gäbe ich darum, könnte ich ihn dahin bringen, daß ich ihn sehen darf wie ein naher Freund, aber das will er eben nicht. Mein ganzes Vorrecht besteht darin, daß ich die kleinen, menschlich anmutenden Spuren sehe, wenn ich in den Morgenstunden am Seeufer suchend dahinwandere; oder manchmal, in dunkler Herbstnacht, schlägt an mein Ohr der langgezogene, wiegende, rollende Singsang: »Whill – ill – ill – a – lu, whill – ill – ill – a – lu, whill – a – lu«, das Liebeslied Weh-Atschas, des ringelschwänzigen Waschbären, der noch wandert, liebt und lebt, wie der übriggebliebene Prophet eines vergangenen einfachen Glaubens, der gewißlich zu seiner Zeit wiederkommen und herrschen wird. Jetzt aber wartet er in der Verborgenheit, wartet, bis das Feuer vorüber ist.