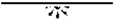|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
| Schnurrbartsbewußtsein trug und hob den ganzen Mann, Und glattgespannter Hosen Sicherheitsgefühl. |
| Mörike. |
Wolfgang stand am Morgen des anderen Tages in seinem Atelier und rückte das seiner Vollendung nahende Porträt ins rechte Licht. Er hatte gestern den Kampf mit Frau Springer noch einmal wieder aufgenommen, allein es wäre ihm wohl eher gelungen, den Nordpol mit einem Wachslicht aufzutauen, als das gepanzerte Herz dieser Frau zu erweichen. Sie war arm und hatte nichts als ihre Tochter und ihre Ehre. Das Gift, das Iduna Schlunk in ihr Ohr geträufelt hatte, zehrte und fraß, denn sie wußte, daß der Makel der Verleumdung haftet wie ein Brandfleck auf weißer Leinwand. In ihr ängstlich sauber und rein gehaltenes Leben hatte man mit schmutzigen Fingern hineingetastet, und obgleich sie keinen Groll auf Wolfgang hegte, der ja nur die unschuldige Ursache dieses Jammers war, so mußte er doch fort, damit der Verleumdung ihre Grundlage genommen würde. Am liebsten hätte sie ihn angefleht, daß er schon morgen ginge. Das Einzige, was dieser noch hatte von ihr erreichen können, war, daß sie die Vollendung des Porträts, wozu nur noch eine Sitzung erforderlich war, gestattete, auch hatte sie sich über das Gretchenbild beruhigt, nachdem Wolfgang ihr versprochen hatte, es in der Stadt nicht ausstellen zu wollen, und nachdem er ihr eine wunderliche Schilderung von der abgelegenen, moosbewachsenen Provinzialstadt, die dem Besteller zum Wohnsitz diente, entworfen hatte, wo das Bild aus der Welt sei und vor den Blicken unziemlicher Neugier verborgen.
Er stand jetzt und bereitete sich für die Sitzung vor, und die Gedanken, die sein Gemüt in den letzten Stunden bewegt hatten, durchgaukelten in unruhigem Tanze sein Gehirn. Das Ereignis des vorhergehenden Tages berührte ihn tiefer, als er es für möglich gehalten haben würde. Aus aller Ruhe und Behaglichkeit war er plötzlich herausgeschreckt, er hatte eine ähnliche Empfindung, wie sie das erste Erdbeben im Menschen erzeugt, wenn das, was man vor allen Dingen als fest und beständig anzusehen gewohnt war, die sichere wohlgegründete Erde, plötzlich in erschrecklicher Leichtfertigkeit anfängt zu tanzen. Ja, es schmerzt oft mehr, wenn die vielen kleinen Würzelchen, die aus dem Alltäglichen ihre Nahrung saugen, losgerissen werden, als wenn eine der großen Pfahlwurzeln unserer Existenz durchschnitten wird.
Es gibt wohl nichts Unbequemeres, als wenn zu so unbehaglicher Stimmung noch Besuch von fatalen Menschen tritt. Auch diese Zuthat blieb Wolfgang nicht erspart, denn es klopfte, und herein trat jemand, den er unter allen Umständen lieber im Pfefferlande sah und für den, um ihn im gegenwärtigen Augenblick fortzuwünschen, die Geographie mit vollständig ungenügenden Entfernungen ausgerüstet war. Herr Benno Bach trat ein, ein junger Mann im Anfang der dreißiger Jahre, wohlgenährt und von rosiger Gesichtsfarbe mit einer weißen Stirn, die sich glänzend bereits bis zum Zenith erstreckte. Den übrigen Teil des Hauptes bedeckten kurze, sehr blonde wohlgekräuselte Löckchen, in denen kein Härchen ungezählt war. Diese appetitliche Sorgfalt erstreckte sich auf den ganzen Anzug, der, von feinen Stoffen hergestellt, in sorglicher Farbenzusammenstellung und harmonischer Zierlichkeit den Körper umschloß. Trotz des winterlichen Schlackerwetters war kein irdisches Tröpfchen auf den glänzenden Stiefeln zu spüren. Er begrüßte Wolfgang in einer gewissen zerstreuten, abwesenden Art, gleichsam als zähle er im Geiste wichtige Dinge ab, und fürchte sich, einen Irrtum zu begehen.
»Ach, ich störe Sie wohl,« sagte er nach der ersten Begrüßung. »Sie sind bei der Arbeit . . . Ich will Sie nicht lange aufhalten, ich bitte nur um eine Feder und etwas Papier, um eine Idee niederzuschreiben, einen Gedankenzug, der sich mir aufdrängte, als ich durch das Geräusch der Nebenstraße fuhr . . . Ich war unglücklich, ich hatte mein Notizbuch vergessen, da fielen Sie mir ein.. – Schreibe ich dergleichen nicht sofort auf, so ist es mir entschwunden . . . mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, nur die großen Züge bewahrt es, nicht die kleinen Feinheiten . . .« Dabei suchte er unruhig nach dem Gewünschten, ohne es zu finden.
»Wie ein Huhn, wenn es legen will,« dachte Wolfgang heimlich.
»Dort, dort,« sagte er dann, indem er ihm den Ort bezeichnete. Mit Befriedigung setzte sich Bach, jedoch fing er gleich an, hastig zwischen den Schreibgegenständen zu suchen und zu wählen.
»Lauter Bleifedern,« sagte er, »Faber Nummer zwei, Faber Nummer drei . . . Gutknecht . . . Hardtmuth . . . ach, haben Sie keine Feder?« fügte er fast kläglich hinzu, »eine Stahlfeder und Tinte?«
Wolfgang brachte beides herbei. »Genügt eine Bleifeder nicht für diesen Zweck?« fragte er.
»Ich schreibe sehr ungern mit Bleifedern, nur im alleräußersten Notfall,« sagte Bach, »es sagt mir nicht zu, es ist mir« . . . – er suchte eine Weile in allen Gehirnschiebladen nach einem Ausdruck und krähte schließlich sichtlich erfreut – »es ist mir nicht monumental genug!« Dann ward er eine Zeit lang unschädlich und schrieb eifrig. Wolfgang kehrte an seine Staffelei zurück und wappnete sich im stillen mit Duldung. Er haßte diesen Menschen. Benno Bach hatte davon keine Ahnung, er lebte sogar in dem Aberglauben, daß das Gegenteil der Fall sei. Er besuchte den Maler zuweilen und lobte seine Bilder, und wenn er ihm zu Wagen auf der Straße begegnete, ließ er den Kutscher halten, sprang auf die Straße, zog Wolfgang in die nächste Restauration, alle Ausflüchte nicht beachtend, und zwang ihn unter Freudenausbrüchen über das glückliche Zusammentreffen, ein Glas mit ihm zu trinken. Bei einer solchen Gelegenheit hatte er einst erklärt, er halte sehr viel von Turnau und er wisse, daß diese Neigung erwidert werde. Dieser, der mit Anstrengung aller seiner Geistesgaben eben an der Arbeit war, eine Ausflucht zu erfinden, um dem Verhaßten zu entrinnen, besaß in seiner Gutmütigkeit den Mut nicht, eine Aufklärung herbeizuführen, denn er mußte es sich doch sagen, daß der Edle ihm in Wirklichkeit niemals etwas gethan, sich sogar im höchsten Maße freundlich gegen ihn erwiesen hatte. Mittlerweile hatte er sich daran gewöhnt, diese einseitige Freundschaft wie ein unvermeidliches Schicksal zu tragen.
Bach hatte seine Niederschrift beendet und erhob sich: »Was ich hier eben aufschrieb,« sagte er, »ist mir viel wert, es sind die Samenkörner zu einem ganzen Zyklus von Gedichten; ich fühle schon, wie sie keimen!« Dabei ließ er seine Züge einen sinnenden Ausdruck annehmen und starrte eine kleine Weile in sich hinein, gleichsam als belausche er diesen geheimnisvollen Werdeprozeß. Danach fielen seine Augen auf das Bild. »Ein Porträt,« sagte er gleichmütig, »scheint ja ein hübsches . . . aber wie ist das möglich,« rief er dann, »das ist ja Fräulein Springer! Und zwar durchaus vorzüglich gemalt, und von der größten Ähnlichkeit! Ist sie jetzt in der Stadt? Wie kommen Sie dazu?«
Wolfgang war verwundert und unangenehm berührt. »Durch ein zufälliges Zusammentreffen,« sagte er, »ich kenne das Mädchen kaum.«
»Sie wohnt jetzt hier?« forschte Bach.
»Ich glaube wohl,« antwortete Wolfgang; dabei fiel ihm mit Entsetzen ein, daß Helene mit ihrer Mutter jeden Augenblick zur Sitzung kommen konnte; er machte sich im Zimmer etwas zu thun und verriegelte heimlich die Thür, die zu Frau Springers Räumen führte. Er hatte das dunkle Bewußtsein, daß er von jetzt ab ungeheuer lügen werde.
Bach war ganz in den Anblick des Bildes versunken: »Vergangene Zeiten steigen herauf,« sagte er dann, »in Ostpreußen habe ich sie kennen gelernt vor anderthalb Jahren, sie war noch sehr jung, allein ihr ganzes Wesen, gemischt aus kindlichem Frohsinn und jungfräulichem Ernst, hatte etwas sehr Anziehendes für mich. Es berührte mich eigentümlich neu. Die geistreichen Weiber bekommt man auch satt. Ich sah schon eine Idylle gleich der Sesenheimer herannahen. Lyrische Stimmungen verließen mich nicht mehr. Ich war im Begriff, eine ganz neue Sorte von Liebe kennen zu lernen, und Sie glauben gar nicht, wie das zum poetischen Schaffen anregt.«
Turnau ballten sich die Fäuste bei diesen Worten und sein Herz schwoll plötzlich bei dem Gedanken an den unsäglichen Hochgenuß, den es ihm bereiten würde, den trefflichen Poeten in diesem Augenblick mit einem Stuhlbein zu Boden zu schlagen, oder ihn beim Kragen zu nehmen und durch die klirrende Glasthür die Treppe hinab zu werfen.
Bach fuhr nach einer Pause, da Wolfgang nichts erwiderte, unbeirrt fort: »Eines Sommerabends erinnere ich mich noch. Ich ging spazieren mit den beiden Töchtern des Pfarrers und Fräulein Springer. Als die Sonne unterging, standen wir auf einem Hügel unter einer großen Eiche. Vor uns senkte sich ein Kornfeld, dann kam eine schmale Wiese und dahinter ein See, der in der Ferne wiederum durch Wald begrenzt wurde. Hinter den Wipfeln dieses Waldes war die Sonne versunken und brannte nur noch mit einer großen goldenen Glut hervor. Ringsum war alles feierlich und still, wie in Andacht versunken. Eines meiner besten Gedichte betitelt sich: ›Sonnenuntergang‹. Sie werden sich erinnern; es beginnt:
›Du einsames Grab
Der versunkenen Sonne . . .‹
»Ich zitierte dies Gedicht mit bewegter Stimme, und als es zu Ende war, schaute ich auf Fräulein Springer, die etwas abseits stand. Sie trug einen Kornblumenkranz im Haar und schaute mit großen Augen in die Abendglut, die einen warmen leuchtenden Schein auf ihr schönes, seltsam ernstes Antlitz warf; ich glaubte eine Thräne in ihrem Auge schimmern zu sehen. Sehen Sie, lieber Turnau, das sind die Erfolge, die dem Herzen des Poeten wahrhaft wohlthun.«
Turnau war von diesem selbstgefälligen Geschwätz fast zur Verzweiflung gebracht. Als er über Helene so reden hörte, hatte er eine Empfindung, wie jemand, der eine schöne, scheinbar unberührte Frucht bewundert, aus welcher plötzlich bei näherer Betrachtung ein gefräßiger Ohrwurm davoneilt, der sie heimlich benagte. Er brummte etwas Unverständliches; Benno Bach seufzte ein wenig, strich sich sorgfältig die Stellen seiner hohen Stirn, wo früher Haare wuchsen, prüfte mit vorsichtigen Fingern den künstlich gelockten Rest, der ihm noch geblieben, und fuhr fort: »Ich denke zuweilen jetzt auf Heiraten, ganz ernsthaft sogar. Dies Bild bringt mich wieder darauf, weil es mir zeigt, wie die Zeit vergeht. Seit jenem Abend habe ich sie nicht wieder gesehen, damals war sie noch ein halbes Kind, jetzt ist die Knospe voll erschlossen. Ich möchte sie wiedersehen. Sie haben wohl die Freundlichkeit, mir die Adresse mitzuteilen!«
Es stellte sich aber heraus, daß Herr Benno Bach sich in einem der größten Irrtümer befand, als er dies annahm. Wolfgang geriet in eine sehr täuschende Verwunderung darüber, daß ihm noch nie eingefallen sei, danach zu fragen. Die junge Dame käme mit einer älteren zu ihm, und so viel er sich entsinne, habe er aus einigen Andeutungen geschlossen, daß sie sehr weit entfernt wohnen müßten, vielleicht eine Stunde weit oder noch weiter. Ein Bahnhof sei in der Nähe ihrer Wohnung, ob der Stettiner oder der Ostbahnhof, sei ihm wieder entfallen. Es habe ihn bis jetzt auch gar nicht interessiert, aber wenn Bach es wünsche, so könne er ja auch einmal nach der Wohnung der Dame fragen, er hoffe, daß er es nicht vergessen werde. Bach ersuchte ihn noch besonders, dies ja nicht zu unterlassen. Das Bild habe sein Herz seltsam bewegt und er vermöge sich kaum von ihm zu trennen. Wolfgang meinte dann, dies fände er nicht recht begreiflich, aber in solchen Dingen seien die Ansichten der Menschen verschieden. Dabei horchte er fortwährend nach der Thür und seufzte hoch auf, als Benno Bach sich endlich empfahl und die Thüre hinter sich geschlossen hatte. Zu weiteren Gedanken blieb ihm keine Zeit, denn kaum hatte der Poet das Atelier verlassen, als von der anderen Seite Helene und Frau Springer eintraten und die Sitzung ihren Anfang nahm.
Heute kam mit Helene kein Sonnenschein in das Atelier; sie erschien mit verweinten Augen wie der blasse Mond, während Frau Springer sie begleitete und einer drohenden Wolke vergleichbar war.
»Es ist gut, daß ich heute nur noch am Haar zu thun habe,« sagte Wolfgang, indem er sie prüfend betrachtete. Helene seufzte, ihre Mutter sah unergründlich ernsthaft auf und strickte wie eine Maschine.
»Erlauben Sie,« sagte Wolfgang dann, »daß ich das Haar ein wenig ordne.« Helene neigte schweigend das Haupt, und der Maler gab mit leichten Fingern dem welligen, seidenweichen Gelock eine gefälligere und freiere Lage. Seine Hand zitterte hierbei; er hatte Helene gegenüber noch nie diese Verlegenheit empfunden. Es war, als ob von dieser Berührung eine warme elektrische Strömung ausginge, die sein Herz rascher schlagen machte und in seinem Haupte die Gedanken seltsam und lieblich durcheinander wirrte. Er konnte kaum der Versuchung widerstehen, dies schöne Köpfchen zwischen seine Hände zu nehmen und es aufzurichten, um einmal recht tief in die dunklen Augen zu sehen. Und seltsam – als er sein Werk vollendet hatte und Helene wieder aufschaute, war die Blässe ihres Gesichts verschwunden und hatte einer sanften Röte Platz gemacht.
Die Sitzung begann. Es war heute recht still in dem behaglichen Raume, man vernahm nichts als das eifrige Klirren der Stricknadeln und von draußen das Schwatzen der Sperlinge, die in der hohen Schwarzpappel Distriktsversammlung abhielten.
Wolfgang malte, als hinge das Wohl der Welt davon ab, er wunderte sich selbst, wie ihm heute alles gelang; der alte Künstlerspruch:
Hände, Füß' und Haar
Sind des Teufels War' –
schien heute bei ihm seine Wahrheit verloren zu haben.
Nach einer halben Stunde klingelte es draußen und Frau Springer ward dadurch abgerufen. An ihrer Stelle blieb nur ein eilig zusammengeballtes Strickzeug, das mit seinen Nadeln wie ein spärlich bewaldetes Stachelschwein in die Welt starrte und ein seltsam beobachtendes Ansehen hatte, gleich als sei es sich seiner Stellvertretung wohl bewußt. Außerdem blieb auch die große Stille, nur die Sperlinge schienen bei Beratung ihrer kommunalen Angelegenheiten auf einen Streitpunkt gestoßen zu sein und erhoben einen gewaltigen Lärm, bis sie plötzlich mit Gebrause alle auf einmal davonflogen. Nun war die Stille noch auffallender, und Wolfgang, um nur etwas zu reden, erinnerte sich an den Besuch von vorhin und sprach: »Es war soeben ein alter Bekannter von Ihnen hier.« Helene sah ihn fragend an.
»Erinnern Sie sich nicht mehr an den Abend in Ostpreußen, als Sie, einen Kornblumenkranz im Haar, in die untergehende Sonne sahen und jemand dazu lyrisch wurde:
›Du einsames Grab
Der versunkenen Sonne . . .‹«
Helene sah ihn mit großen Augen an: »Das war Herr Bach – Sie kennen ihn?« Dann sah sie eine Weile nachdenklich vor sich hin und fuhr fort: »Von dem Gedicht habe ich nicht viel gehört, es mag wohl sehr schön gewesen sein, aber ich dachte an andere Dinge. Man hatte vorher gesagt, daß dort Berlin läge, wo die Sonne versank. Ich dachte an meine Mutter und an unser kleines Eckzimmer, wo auch die untergehende Sonne hineinscheint, und an unseren Kanarienvogel, der dann noch zum letztenmal so schön singt, und an . . .« Hier stockte sie eine Weile, so daß Wolfgang weiter forschte: »Und an . . .?« – »Und an mancherlei,« fuhr sie fort. »Ich weiß das noch sehr genau, denn ich habe oft an diesen Abend gedacht. Ich hatte Heimweh. Herrn Bach habe ich seitdem nicht wieder gesehen, er besuchte damals seinen Onkel, dem das Gut gehört.«
»Wie gefiel er Ihnen?« fragte Wolfgang.
»Er war stets sehr zuvorkommend gegen mich,« sagte Helene, »ich lachte niemals über seine Gedichte, wie die anderen Mädchen, die sich zuweilen die Taschentücher in den Mund stopfen mußten, wenn er vorlas. Ich kann sehr ernsthaft sein, wenn es darauf ankommt.«
»Hm,« meinte Wolfgang, »Sie hätten nur lachen sollen.«
»Herr Bach ist doch Ihr Freund?« fragte Helene fast verwundert.
»Ja, er ist mein Freund,« rief Turnau heftig, »aber ich bin geneigt, diese Freundschaft, die der unerforschliche Ratschluß der Götter über mich verhängt hat, als ein ›Schicksal‹ zu betrachten. Ich bin mit diesem Menschen behaftet, ich habe ihn wie eine Krankheit. Er ist mir zuerteilt worden als eine grausame Strafe für meine Sünden!«
Er bemerkte, daß ihn Helene wegen dieser plötzlichen Festigkeit ganz erstaunt ansah, und fuhr fort: »Ich hätte mich seiner längst entledigt, aber leider bin ich ihm Dank schuldig, und das bindet mir die Hände und kränkt mich zugleich. Er lernte mich kennen, als ich in friedlicher Dunkelheit und ziemlich unbeachtet ein Bildchen nach den anderen strich, und hat dann zuerst auf mich aufmerksam gemacht und die Presse in Bewegung gesetzt, daß ich mit einemmal bekannt wurde. Aber dies ist mehr als ausgeglichen dadurch, daß er nun überall, wo es sich machen läßt, als mein Entdecker figuriert und mich vorführt wie ein Zirkuspferd, das er persönlich dressiert hat, daß er überall meinen Namen als eine Rose im Knopfloch trägt, um den seinigen damit zu schmücken!«
Helene nahm wie alle Frauen die Partei des Angegriffenen.
»Das hat er doch am Ende nicht nötig,« sagte sie, »er gilt doch für einen berühmten Dichter!«
»Machwerk! Machwerk!« rief Turnau, »ein künstlich aufgeblasener Name, der über Nacht platzen wird wie eine Seifenblase, und es wird nichts übrig bleiben als ein wenig unreines Wasser. Sie wissen nicht, wie das gemacht wird, wie sie zusammenhalten die Mittelmäßigen und in Blättern und Blättchen einander emporloben und gegenseitig ihre Namen und Nämchen ausschreien, bis das arme dumme Publikum endlich glaubt, von dem vielen Geschrei müsse doch etwas wahr sein. Sie wissen nichts von den Kunstparasiten, denen es nur zu thun ist um Geld oder Ruhm und die den wahren Künstlern wie Unkraut im Wege stehen. Die langen Ohren haben sie ins Publikum gestreckt und lauschen und horchen nach dem, was die große Menge haben will, und schneidern dann nach der Mode des Tages zusammen, was heute gefällt und übermorgen schon vergessen ist.«
»Aber Herr Bach gehört doch nicht zu denen?« fragte Helene, ganz ängstlich gemacht durch eine Heftigkeit, die ihr kaum verständlich war.
»Herr Bach gehört zu denen,« sagte Wolfgang, »die ich Kunstschwindler nenne, und das ist es, was ewig eine Kluft zwischen uns befestigt. Es ist ihm nicht um die Sache selbst zu thun, sondern vor allen Dingen um den Erfolg der Sache. Er sucht nicht mit unablässigem Streben nach Vervollkommnung aus sich heranzubilden, was die Natur etwa in ihn gelegt hat, nein, es ist ihm nur daran gelegen, einen Glanz und Schimmer um sich zu verbreiten, und in eitler Selbstgefälligkeit wird er nicht müde, fortwährend den Leuten sein liebes Ich wie auf dem Teller entgegen zu tragen.«
Helene hörte ihm mit steigender Erregung zu; ihr erschienen diese Worte sehr übertrieben und grausam, und es widerstand ihr, diese Ergüsse anhören zu müssen.
»Sie urteilen gewiß zu hart,« meinte sie, »Sie sind eingenommen gegen Herrn Bach und thun ihm gewiß unrecht . . .«
Wolfgang ließ sie kaum ausreden, er hatte sich in Feuer gesprochen und redete sich immer tiefer in seinen Groll hinein: »Ich bin zu milde,« sagte er, »viel zu milde! Haben Sie einmal seine Gedichte gelesen? Das Buch erinnert mich immer an eine Eiersammlung. Nichts wie ausgepustete Eier. Lauter glänzende Schalen ohne Inhalt! Vorhin sprach er davon, daß er sich verheiraten möchte. Ich weiß ein Wesen, das seiner würdig ist. Er sollte Fräulein Iduna Schlunk heiraten; diese Künstlerin hat viel Verwandtes mit ihm, und vielleicht vereinigen sich einmal beider Talente in einem gemeinschaftlichen Sohn, der dann später seinen menschenfeindlichen Beruf darin finden wird, Arabesken von Kamillenblümlein und Vergißmeinnicht um seine eigenen mauserigen Gedichte zu malen!«
Helene kamen fast die Thränen in die Augen. Es mißfiel ihr über die Maßen, Wolfgang so sprechen zu hören, und sie konnte sich nicht enthalten, ihm dies zu sagen. »Ich hätte Sie nicht für so lieblos gehalten!« sprach sie, indem ihr das Rot in die Wangen stieg, mit zitternder Stimme.
Wolfgang sah sie groß an, er hatte offenbar diesen Ton nicht erwartet und ward plötzlich stumm und nachdenklich. Da auch in diesem Augenblick Frau Springer zurückkam, so trat das alte Schweigen wieder ein und die Sitzung ging stumm und verdrossen zu Ende.
Als Wolfgang wieder allein war, ging er eine Weile in seinem Atelier ziellos umher und stand zuweilen und starrte auf alle möglichen Dinge, ohne irgend etwas zu sehen. Ein Verdacht war in ihm aufgestiegen, den er nicht abzuweisen vermochte, und der ihm das Herz einschnürte, je mehr er seine Berechtigung einzusehen glaubte. Es schien ihm klar zu sein, daß Helene eine Zuneigung für Benno Bach hege, ja ihn vielleicht heimlich liebe. Es gibt viele unbegreifliche Dinge in der Welt, sagte er sich, und dies ist am Ende noch nicht so unerklärlich. Benno Bach war sehr reich, er hatte kein unschönes Aeußere, und vielleicht mochte ja gerade das selbstgefällige Wesen, das den Maler zurückstieß, auf Helenens Unerfahrenheit bestechend eingewirkt haben. Die harmlose Jugend verwechselt ja so leicht und gerne ein Laster mit der verwandten Tugend und umgekehrt, und nichts ist leichter, als einem so jungen Mädchen, dessen Köpfchen noch mit schönen Einbildungen erfüllt ist, Schein für Wahrheit zu verkaufen. Sollte dies Benno Bach so schwer gefallen sein, dessen ganzes Sein und Wesen Schauspielerei war, und der nichts versäumte, sein liebes Ich auf alle Weise zu illuminieren und jeden Schein eines Verdienstes als eine leuchtende Wahrheit hinzustellen? Wolfgangs grübelnde Gedanken bohrten sich in diesen Vorstellungen fest, und an der unangenehmen Wirkung, die er hiervon erfuhr, ward ihm mit einemmal sonnenklar, wie es mit ihm selber in dieser Angelegenheit stand. Er ward plötzlich rot und dann wieder blaß, fuhr sich mit der Hand mehreremal durch das dichte Haar und blieb dann vor Helenens Porträt nachdenklich stehen. Dann rückte er einen Lehnsessel davor und saß eine lange Weile, bald das Bild betrachtend, bald in die grauen Wolken starrend, die sich verdrossen und unablässig an dem winterlichen Himmel durcheinanderschoben. Es wurde dämmerig und fing an wieder zu regnen; der Wind warf die Tropfen prickelnd gegen die Scheiben; in den Ecken und Winkeln des Ateliers lagerten sich finstere Schatten; nur das Porträt leuchtete noch mit sanftem Schimmer hervor. Aber es dunkelte immer stärker, bis allmählich Helenens Bild ebenfalls in die Finsternis versank. Draußen ward die Straßenlaterne angezündet und warf einen stillen Schein an die Decke des dunklen Raumes. Wolfgang erhob sich und sah auf die Straße. Diese Laterne brachte ihn auf einen Gedanken, sie erinnerte ihn daran, daß an demselben Abend das allerdings etwas verspätete Weihnachtsfest der »Klapprigen Laterne« gefeiert werden sollte. »Morbrand wird dort sein,« dachte Wolfgang, »er muß mir einen Rat in dieser Angelegenheit geben. Ich muß über diese seltsamen Erscheinungen, die sich in mir heute abend hervorgethan haben, ins klare kommen. Es wird sich wohl ein Augenblick finden, wo ich ihn allein habe.
Es ging eine Sage über die Entstehung des Namens »Klapprige Laterne«. In der grauen Vorzeit des Vereins, da er noch namenlos war und nur aus fünf Mitgliedern bestand, die allwöchentlich abwechselnd in ihren Wohnungen zusammenkamen, hatte es bei einer dieser Versammlungen plötzlich an die Thüre geklopft und herein war getreten der alte Diogenes, der verdammt war, noch immer ruhelos mit seiner Laterne nach Menschen zu suchen. Sie hatten ihn freundlich aufgenommen, und Morbrand, der Aelteste des Vereins, hatte gesagt: »Setzen Sie sich, Professorchen, Sie werden müde sein, denn Griechenland ist weit, und der Jüngste sind Sie auch nicht mehr.« Der alte Diogenes hatte seine Laterne auf den Tisch gestellt und sich in den großen braunen Lehnstuhl mit Ohrenklappen gesetzt und recht kümmerlich geseufzt, daß es ganz herzzerbrechend anzuhören gewesen ist. Sie haben ihm aber viel Punsch zu trinken gegeben und allerlei anmutige Gespräche mit ihm geführt, dergleichen er sich gar nicht vermutet gewesen, so daß der alte Herr immer fröhlicher geworden ist und bald den einen, bald den anderen fast verwundert angesehen und sich immer häufiger und eifriger die Hände gerieben hat vor lauter Behagen. Und als die Stunde später geworden ist und die Geister lebendiger, so daß in bewegtem Hin und Wieder des Gespräches Scherz und Ernst durcheinandergeschwirrt sind wie die Bienen und Schmetterlinge zur Sommerzeit am blumigen Feldrain, da ist der Alte immer helläugiger geworden und immer aufgeregter, und zuletzt ist er plötzlich aufgesprungen und hat seine Laterne genommen und sie mit einem großen Jauchzer gegen den Ofen geschmettert und hat gerufen: »Hier sind ja Menschen! Hurra! Hier sind ja Menschen! Ich brauche dich nicht mehr, ich bin erlöst!« Danach hat er alle der Reihe nach umarmt und ihnen mit großer Rührung die Hände gedrückt, ist mit etwas schiefem Gange aus der Thür geschossen, mit ziemlichem Lärm die Treppe hinabgepoltert und niemals wiedergekommen.
Die Laterne hat man aber in ihrem dermaligen Zustande sorgfältig aufbewahrt und sie mit einem brennenden Lichte darin als ein heiliges Symbol bei jeglicher Sitzung auf den Tisch gestellt, auch gebührendermaßen den Verein feierlich nach ihr benannt. Etwa ein Dutzend Menschen hatten sich gesellig um sie geschart und versuchten das Lob zu verdienen, das einst der alte Diogenes den Stiftern gespendet hatte. Ernst und Scherz in zwangloser Abwechslung herrschten an diesen Abenden. Manche Dichtung, bevor sie in die Welt hinausging, empfing hier ihre erste Beleuchtung – die alte Laterne konnte gar scharfe Lichter werfen –, manch künstlerischer Plan kam hier in kritischem Wechselgespräche zur Reife und Vollendung, doch auch der tollste Humor trieb hier seine schillernden Blüten, und nichts war so burlesk und paradox, daß es hier nicht begeistertes Verständnis gefunden hätte. Der Art war der Verein, den Wolfgang Turnau an diesem Abend besuchen wollte.
Um die Weihnachtszeit herum schimmern gar viele freundliche Lichtpunkte, wie heitere Sterne sich um den leuchtenden Mond scharen, unzählige Vereine feiern dann ihr Winterfest und wochenlang strahlen allabendlich die Tannenbäume bis tief in den Januar hinein. Eine freundliche Sitte, die auch den Familienlosen eine fröhliche Weihnachtsfeier ermöglicht.
Der größte Raum stand unter den Mitgliedern des Vereins dem Bildhauer Daniel in seinem geräumigen Atelier zur Verfügung, weshalb auch dort das Fest stattfand. Als Wolfgang eintrat, fand er bereits die meisten seiner Freunde in dem behaglich und anmutig mit Tannengrün und lebenden Pflanzen ausgeschmückten Raume anwesend.
Die Bildwerke, die das Atelier enthielt, waren alle an die Wände gerückt und schimmerten hell und freundlich aus dem grünen Blattwerk hervor, in der Mitte des Raumes leuchtete ein gedeckter Tisch, und den Ehrenplatz am oberen Ende desselben nahm ein mächtiger Tannenbaum ein, der, von Künstlerhand verziert, in Gold und Farben stand und mit mancherlei drolligem Spielwerk behängt war. Es herrschte, wie es bei derartigen Anlässen zu sein pflegt, eine gedämpfte Anfangsstimmung, die Freunde saßen behaglich schwatzend in kleinen Gruppen zusammen oder es standen einige vor diesem oder jenem Bildwerk in kritischer Beschauung.
Plötzlich klappte im Hintergrunde eine spanische Wand auseinander und ein alter Zaubergreis mit langem weißen Bart und spitzer Hieroglyphenmütze ward sichtbar. Er trug eine Kelle in der Hand und war bekleidet mit einem bunten Talar, der über und über mit blitzenden Zauberzeichen bedeckt war. Neben ihm befand sich ein dampfender Kessel auf einem Dreifuß, darunter stand eine Schale. Der Zauberer kreuzte die Arme, verbeugte sich würdevoll und sprach dann:
»Des Nordens lange Winternacht zu kürzen,
Ward einst in alter, längst vergeßner Zeit
Von einem Mann, verloren ist sein Name,
Ein wunderbarer Zaubertrank erdacht.
Gar manche Nacht, die ruhmlos der Philister
Und thatenlos im warmen Bett verschnarcht,
Saß er an seinem Werk und mischt' und trank
Und trank und mischte, bis er hingesunken
Im Schlafe noch von der Vollendung träumte. –
Es kam die Zeit, die brünstiglich ersehnte,
Es kam die Zeit, wo ihm das Werk gelang,
Wo Kraft und Milde, Süßigkeit und Feuer,
Zusammenfloß in holder Einigkeit,
Und im Verein der widerspenst'gen Kräfte
Geboren ward der wunderbare Trank!
Heil sei dem Mann! Ihm ward kein Monument
Von Stein und Erz, jedoch im Widerschein
Viel seligroter Nasen glüht und leuchtet
Ein beßres Denkmal ihm vieltausendfach! –
Sein Name schwand, sein Werk wird ewig bleiben.
Wir wollen dessen heut uns heiter freuen!
Den alten Zauber wieder froh erneuen!«
Damit wandte sich der Zauberer und schwang unter unverständlichen Sprüchen seine Kelle beschwörend in der Luft. Aus der Schale schlug eine riesige blaue Flamme auf und leckte an den Wänden des Kessels hoch empor. Dann beugte er sich nieder und goß aus mächtigen Krügen, die neben ihm standen, unendlichen Wein in das Gefäß und sprach, indem er von Zeit zu Zeit mächtig mit der Kelle in der Flüssigkeit rührte:
»Es rankt die Rebe am rauschenden Rheine,
Die Kräfte der Erde saugt sie empor!
Sie bindet den Sommer und bannt ihn in Beeren,
Sie wendet und wandelt im Wechsel der Wochen
Der Sonne Gefunkel zu flüssigem Feuer,
Der Sonne Gleißen in glänzendes Gold!
Feuer zu Feuer und Flammen zu Flammen!
Heia, nun glänze, du goldige Glut,
Fließe im Feuer, du flammende Flut!«
Danach geschahen neue Beschwörungen. Im Hintergrunde erhob sich ein diabolisches Geheul und plötzlich stand wie aus der Erde gewachsen ein schwarzer Nigger da, der in den Händen eine mächtige Schale mit Zucker trug, der unter feierlichen Zeremonien dem Tranke beigemischt wurde. Auf ähnliche Weise erschienen die Zitronen von einem Italiener dargebracht, und als im Laufe der Zeit der Wein anfing zu sieden, tauchte ein vortrefflicher Chinese mit dem nötigen Arak auf, nach dessen Beimischung ein angenehmer Punschgeruch sich in dem ganzen Raume verbreitete und die Gemüter mit süßer Ahnung kommenden Genusses füllte. Nachdem somit die Grundbedingung eines behaglichen Abends geschaffen war, verschwanden der Zauberer und seine Gehilfen unter allgemeinem Beifall wieder im Hintergrunde, um nach einiger Zeit als gewöhnliche Menschen sich an ihren Plätzen wieder einzufinden.
Als danach die Begierde der Speise – aber noch lange nicht des Trankes – gestillt war, strahlten am Tannenbaum die Lichter auf und eine lustige Verlosung der scherzhaften Dinge, die er an seinen Zweigen trug, ward ins Werk gesetzt. Dadurch geriet allmählich die Stimmung in jene heitere Strömung, die in lebhaft rauschendem Allgemeingespräch sich kund thut, und nur zuweilen bildeten scherzhafte Vorführungen einzelner eine Insel in diesem Strome.
Der einzige, der an diesem Abend die richtige Stimmung nicht zu finden vermochte, war Wolfgang, wie wohl leicht erklärlich ist. Er hatte sich seines Beitrages in der Rolle des Chinesen erledigt und saß nun da, schweigend ein Glas Punsch über das andere schlürfend, und wälzte Gedanken. Zuweilen stimmte er mechanisch in ein besonders lautes Gelächter mit ein, um nicht aufzufallen, obgleich er selten genau wußte, um was es sich handelte. Er war fest entschlossen, sich Morbrand anzuvertrauen, allein, so lange er diesen auch beobachtete, immer wollte der geeignete Zeitpunkt nicht kommen, wo dieser allein war.
Scherzhafte Reden und burleske Aufführungen lösten einander ab. Die Stimmung ward brausender und die feurigen Geister des starken Getränkes entflammten die Köpfe. Zu dem Duft des Punsches, der ausgeblasenen Wachslichter und verbrannten Tannenzweige mischte sich der bläuliche Nebel der Zigarren, und die Gesellschaft sonderte sich, wie es in späteren Stadien solcher Zusammenkünfte zu geschehen pflegt, in einzelne lebhaft disputierende Gruppen, in buntem Gespräch das Höchste wie das Tiefste durcheinander wirbelnd. Am Klavier tauchte ein Punschenthusiast auf und gab seiner Begeisterung singend Ausdruck:
»Und würden zu Rum die Ströme,
Und würden die Meere zu Wein,
Und schmölzen dann alle Berge
Als Zuckerhüte hinein,
Und drückt' man den Mond als Zitrone
Hinein in die köstliche Flut,
Und heizte die riesige Bowle
Mit der Erde vulkanischer Glut,
Und könnt' ich dann liegen und schlürfen
Und trinken ohn' Aufenthalt:
Es würde doch nimmer bestehen
Vor meines Durstes Gewalt.«
Der Zeitpunkt war eingetreten, wo die Menschen je nach ihrer Begabung sentimental oder streitsüchtig werden, und wo man jene Offenherzigkeiten zu begehen pflegt, die am anderen Tage so unverdaulich auf der Seele liegen.
Morbrand hatte sich zurückgezogen, saß allein hinter dem Tannenbaum versteckt und knackte Nüsse, indem er behaglich in das bunte Treiben vor sich schaute. Diesen Augenblick ließ Turnau nicht ungenützt vorübergehen, und es gelang ihm, Morbrand so künstlich in seiner Ecke einzuzäunen, daß der Zutritt eines dritten unmöglich gemacht wurde. Es ist nicht mehr als natürlich, daß er sodann ein Gespräch anfing, das mit der Sache, die ihm am Herzen lag, einen möglichst geringen Zusammenhang darbot. Nachdem er über die Vorzüge der Haselnüsse einige begeisterte Worte geäußert und über Nüsse im allgemeinen vortreffliche Anschauungen dargelegt hatte, spann sich das Gespräch mühsam dahin, bis endlich eine kleine Pause eintrat. Wolfgang sah eine Weile auf seine rechte Fußspitze, mit welcher er ein weniges auf und nieder wippte, und sprach ohne besondere Betonung vor sich hin: »Es ist mir sonderbar ergangen, Morbrand.«
»Hm,« sagte dieser, seine Bereitschaft zum Hören ausdrückend, ohne sich jedoch in seiner Beschäftigung zu unterbrechen. Wolfgang fuhr einigemal mit der Hand durch sein dichtes Haar, rückte dann näher und sprach: »Ich möchte dir etwas anvertrauen, wofür ich deinen Rat und deine Verschwiegenheit erbitte.« Morbrand legte den Nußknacker auf den Tisch und die eben ausgelöste Nuß säuberlich daneben. Dann nahm er seine Brille ab und putzte sie mit dem Taschentuch: »Dies wird feierlich,« sprach er. Nachdem er dann, wie es der Brauch ist, die Brille gegen das Licht gehalten und säuberlich wieder auf seine Nase gerückt hatte, that er einen tiefen Zug aus seinem Glase, lehnte sich in den Stuhl zurück und sagte: »Ich bin bereit.«
Wolfgang stärkte seine Seele ebenfalls mit Punsch und fuhr dann fort: »Ich habe vorher noch eine Bitte: Wenn es dir irgend möglich ist, lieber Freund, so bleibe ernsthaft bei dem, was ich dir sage. Es sind manchmal Dinge für andere sehr komisch, die dem Beteiligten bittere Bedrängnis schaffen. Wenn du durchaus lachen mußt, dann laß es mich wenigstens nicht sehen, mach' s innerlich ab. Und ehe ich anfange, gib mir die Hand, alter Freund.«
Morbrand blickte auf die Gesellschaft. Man achtete nicht auf die beiden Abgesonderten; in solcher Zeit und Stimmung hat jeder genug mit sich selber zu thun. Er griff unter dem Tisch nach Wolfgangs Hand und drückte sie kräftig.
»Es hat mich,« sagte dieser dann.
»Was, wie, wo?« fragte Morbrand.
»Hier,« antwortete Wolfgang, indem er die Hand aufs Herz legte und wie ein ertappter armer Sünder aussah. Es zuckte über des Freundes Gesicht, allein er bezwang sich: »Weiter!« sagte er.
Und Wolfgang beichtete alles herunter, was ihm auf der Seele lag. Am meisten bedrückte ihn natürlich die Befürchtung, die heute in ihm aufgestiegen war. »Wenn es sich bewahrheitet,« rief er aus, »daß sie diesen Kerl liebt, dann ist es zu Ende mit meiner Geduld, dann ist es hohe Zeit, daß er ausgerottet wird, damit er nicht noch mehr Unheil stiftet. Ich fordere ihn zum Zweikampf heraus und die Waffe soll mir ganz gleichgültig sein, wenn sie nur geeignet ist, ihn umzubringen.«
Morbrand lächelte doch ein wenig. »Diese Absicht ist ja lobenswert,« sagte er, »allein ich gebe dir zu bedenken, ob du dein Herz in Bezug auf das Mädchen auch genügend geprüft hast, ob dieses plötzliche Auflodern auch wirklich Liebe bedeutet, und ob dieses junge Fräulein auch die Eigenschaften und die Bildung besitzt, die einen Mann von deinen Eigenschaften dauernd glücklich machen können.«
»Es ist kein plötzliches Auflodern, »sagte Wolfgang, »es ist mir nur blitzartig zum Bewußtsein gekommen, was längst in mir verborgen war. Denke dir, man hat ein altes Bild lange besessen und niemals beachtet – man betrachtet es einmal genauer und siehe da, es ist ein Rembrandt. Du kennst das Mädchen nicht: sie ist nicht geradezu schön, aber sie hat jenen milden Liebreiz, der das Herz jedes Mannes mit Wärme füllt, jenen Zauber von Gesundheit und Frische, der in heutiger Zeit so außergewöhnlich selten ist, und dazu ein heiteres, sonniges und dennoch tiefer Empfindung fähiges Gemüt. Was ihre Bildung anbetrifft, so spielt sie nicht Klavier, sie malt nicht und macht keine Verse – das ist schon bedeutend mehr, als man heutzutage billigerweise verlangen kann.«
Morbrand lächelte wieder. »Nun gut, ich werde dir meinen Rat in dieser Angelegenheit erteilen. Ich fürchte nur, du wirst mit ihm nicht zufrieden sein, obgleich er der einzige und beste ist, der sich denken läßt: Wenn du sie liebst, da geh doch hin und sag's ihr!«
Wolfgang sah ihn fast verblüfft an und trommelte mit den Fingern. Er schwieg.
»Nun, warum nicht?« fragte Morbrand, »es ist das Sicherste. Die frische That erlöst.«
Der Maler versank in Gedanken. So selbstverständlich der Rat seines Freundes war, es lag doch für ihn etwas Ueberraschendes darin, denn trotz alledem war er der Sache noch nicht so nahe getreten. »Wenn ich einer günstigen Antwort gewiß wäre,« meinte er dann, »das Gegenteil wäre unerträglich.«
»Ungewißheit ist das Unerträglichste,« sagte Morbrand.
»Du hast recht,« entgegnete Wolfgang, »ich will es thun, ich will mit ihr sprechen.«
»Das genügt mir noch nicht,« meinte der Freund, »wann willst du mit ihr sprechen?«
»In den nächsten Tagen, sobald sich eine passende Stunde findet.«
»Dieser Plan ist schlecht,« sagte Morbrand, »binde dich an eine bestimmte Zeit, zum Beispiel morgen nachmittag Punkt vier Uhr. Erhebe dies zum festen Vorsatz.«
»Warum das?« fragte Wolfgang verwundert.
»Du weißt,« antwortete der Freund, »ich gehöre selber ein wenig zu den Leuten, die ihr ganzes Leben lang ›nächste Woche anfangen wollen‹. Wie manches habe ich nicht im Leben versäumt, weil ich heute nicht that, was ich morgen oder übermorgen thun wollte, wenn die passende Stunde sich fände. Darum, wenn dir die Zeit genehm ist, so schlage ein.«
»Ich verspreche auch dies,« sagte nach einer Weile der Maler und drückte dem Freunde kräftig die Hand. Danach mischten sich beide wieder unter die übrige Gesellschaft. Eine innere Heiterkeit war nach diesem Entschluß über Wolfgang gekommen und fröhlich nahm er von jetzt ab an allem teil, bis auch dieser Abend verbrauste und verschwamm, wie jede heitere Stunde dahingeht – Schaum, der eine Welle der Ewigkeit krönt.
Am anderen Morgen, als Wolfgang trotz der durchschwärmten Nacht zur gewöhnlichen Zeit erwachte, lobte er den Rat Morbrands, denn frei von allem Zweifel stand vor ihm, was er zu erfüllen hatte, und jene geistige Anspannung, mit der man Dingen entgegen geht, die auf keine Weise mehr zu ändern sind, verließ ihn nicht mehr. Am Nachmittage, kurz vor der bestimmten Zeit, als er von seinem Mittagsessen zurückkehrte, begegnete ihm, was sonst allerdings nicht als ein gutes Omen betrachtet wird, Frau Springer vor der Hausthür, im Begriff auszugehen, allein ihm erschien es wie ein günstiges Vorzeichen, da er kaum zu hoffen gewagt hatte, Helene allein zu treffen.
Er stand in seinem Atelier vor seiner großen braunen Wanduhr, die ein Erbstück war, bis der Zeiger auf die volle Stunde deutete, und als das alte Mirakel mit großem Aufwand von innerem Schnurrwerk anhob, vier zu schlagen, marschierte er geradeswegs in sein Schicksal hinein. Auf dem Korridor lauschte er eine Weile, ehe er an die verhängnisvolle Thür klopfte. Er hörte nichts als den schmetternden Gesang eines Kanarienvogels. Als er hineintrat, wurde er fast geblendet, denn Helene befand sich in dem bereits erwähnten Eckzimmer und die untergehende Sonne sandte einen vollen Strom rotgoldenen Lichtes hinein. Das Mädchen erhob sich und stand mitten in dem Glanze da.
Turnau trat ein wenig zur Seite, um dem blendenden Lichte zu entgehen: »Ich wünsche Ihre Frau Mutter zu sprechen,« sagte dieser heuchlerische Sünder.
»Sie ist ausgegangen, aber sie wird bald zurückkehren,« war die Antwort.
»Darf ich sie hier erwarten?« fragte der Maler.
Helene schwieg verlegen, es war offenbar gegen ihre Instruktion, ja zu sagen. Aber Wolfgang nahm die Gelegenheit wahr und blieb.
»Sie zürnen mir doch nicht mehr wegen des Gespräches von gestern,« sagte er, »mir fällt es wieder ein, weil der Ort mich daran erinnert. Hier ist die untergehende Sonne, die in das kleine Eckzimmer noch einmal so schön hereinscheint, hier ist der schmetternde Kanarienvogel, an alles dies haben Sie gedacht an jenem Abend, aber hier ist heute noch jemand, der bis jetzt sozusagen zum Hause gehörte – haben Sie sich damals auch an diesen erinnert, Helene?«
»Herr Turnau, Sie fragen seltsam,« sagte Helene verwirrt, und zu dem Rot der Sonne, das auf ihren Wangen lag, trat eine tiefere Glut.
»O die Frage ist nicht seltsam,« rief Turnau, »ein freundliches Gedenken thut dem Menschenherzen wohl. Ich soll in kurzer Zeit aus diesem Hause gehen, wo ich die glücklichste Zeit meines Lebens verbrachte, da wäre es mir liebes Bewußtsein, wenn ich die Gewißheit hätte, daß meiner zuweilen gedacht wird.«
Helene schwieg und sah ihn an. In der Tiefe ihrer Augen lag ein warmer Schein, ein stilles Leuchten ging von ihnen aus, das Wolfgangs Herz pochen machte und sein Blut rascher strömen ließ.
»Ich gehe sehr ungern aus diesem Hause,« rief er, »und doch würde ich es mit Freuden verlassen, wenn ich eine Gewißheit hätte; darf ich sagen welche?«
Die Sonne war unterdes in schweren Wolken verschwunden, aber es war dies nicht allein, was das Antlitz Helenens tödlich erblassen machte.
Der kleine Kanarienvogel hatte aufgehört zu singen und es war so still im Zimmer, daß man das leise Knistern des Mieders hörte, das vom Sturm des jungen Busens bewegt wurde.
». . . Daß Sie mit mir gehen!« sagte Wolfgang. Er flüsterte es fast, und doch war beiden die ganze Welt in diesem Augenblicke mit dem Klange dieser Worte erfüllt. Helene sah ihn an starr wie im Traume, dann irrten ihre Augen wie Hilfe suchend umher – sie wollte entfliehen, allein Turnau trat ihr entgegen und sie sank ihm in die Arme und an die Brust, wo schon seit lange ihre Heimat war. Seine Lippen suchten die ihren und fanden sie, und die langgehegte stille Glut strömte nun süßberauschend ihm entgegen. Dann flüsterte sie an seiner Brust: »An jenem Abend dacht' ich auch an Sie. Und immer, jeden Tag, seit ich fort war, je länger es dauerte, je mehr.«
»Und niemals hast du diesen vergoldeten Poeten lieb gehabt, auch nicht ein kleines bißchen?« rief er jauchzend.
Sie hob den Kopf und schüttelte ihn verwundert: »Hast du das jemals gedacht?«
»Hurra,« jubelte Wolfgang, »ich war ein Thor, ein Narr, ein vollkommener Narr. Wo ist die Sonne, die Sonne soll noch einmal kommen, sie hat noch niemals einen so glücklichen Esel gesehen!« Und die Sonne erfüllte sein Verlangen. Groß und rot sank sie hinter der Wolke hervor und warf noch einmal, bevor sie schied, ihr verklärendes Licht auf die zwei Glücklichen. Wolfgang hielt Helene umschlungen und sah mit ihr hinaus in die Glut.
»Nun fehlt nur noch die Mutter,« sagte Helene.
»Ja, die Mutter,« sagte Turnau, »horch, da kommt sie schon.« Und als Frau Springer noch außer Atem von den vier Treppen über den Korridor kam und die Thür zu ihrem kleinen Eckzimmer öffnete, da, im letzten Schein des Abendrotes – ja, da stand die Bescherung!