
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
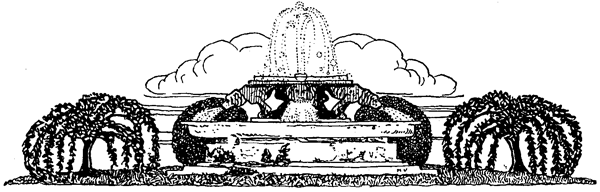
Das Wort wird Tat,
Das Kind wird Mann,
Der Wind wird Sturm,
Wer zweifelt daran?
Chamisso.
 In einem der schönsten jener alten Gärten Hamburgs, die sich bis zur Elbe hinunterziehen, spielten ein Paar Kinder, ein Knabe von etwa vierzehn Jahren und ein kleines Mädchen, das halb so alt sein mochte. Zwischen den Tuffsteinen, die das Becken eines kleinen Wasserfalles umgaben, holte der Knabe einige geschnitzte und sorgfältig aufgetakelte Schiffchen hervor.
In einem der schönsten jener alten Gärten Hamburgs, die sich bis zur Elbe hinunterziehen, spielten ein Paar Kinder, ein Knabe von etwa vierzehn Jahren und ein kleines Mädchen, das halb so alt sein mochte. Zwischen den Tuffsteinen, die das Becken eines kleinen Wasserfalles umgaben, holte der Knabe einige geschnitzte und sorgfältig aufgetakelte Schiffchen hervor.
»Nun haben wir sieben,« sagte er, »ebensoviel wie Dein Onkel. Er hat immer sieben; wenn eins verkauft wird oder untergeht, läßt er ein neues bauen. Und jedes heißt nach einem Stern.« Er setzte die Schiffchen ins Wasser und nannte dabei ihre Namen: »Venus, Anthares, Spica.« – »Regulus!« fiel das Kind ein. – »Arkturus, Aldebaran,« fuhr der Knabe fort. »Und dieses neue ist der Rigel.«
»Der Stern hat einen häßlichen Namen,« sagte das Kind. »Warum wohl?« »Du solltest Deinen Onkel fragen.«
»Onkel weiß auch nicht immer alles,« meinte die Kleine. »Manchmal antwortet er: ›Kinder fragen mit Zucker bestreut‹, das mag ich gar nicht.«
»Das würde ich auch nicht mögen. Aber ich will unseren Ordinarius fragen; der weiß alles.«
Das kleine Mädchen war die Pflegetochter des Kaufherrn Nippold, eine Nichte seiner Frau. Ihr Vater, Herr Moritz Tschuschner, führte nach dem Tode seiner Gattin, die bei der Geburt der kleinen Melitta gestorben war, ein Wanderleben, wie er es schon vor seiner Heirat getan hatte. Er war ein gewandter, überaus glücklicher Geschäftsmann; es galt ihm gleich, ob er im fernen Westen eine Post einrichtete, in Australien eine Stadt gründen half oder in Argentinien eine Fabrik für Fleischextrakt ins Leben rief – er fiel, wie er zu sagen liebte, jederzeit auf seine vier Füße.
Der Spielgefährte der kleinen Melitta war Volckardt, der Sohn des Gärtners. Seit den vier Generationen Nippold, die das vornehme alte Haus und das herrliche Grundstück besessen hatten, waren auch die Werningen dort Gärtner gewesen. Der jetzige Hausherr und der jetzige Inhaber der Stelle waren miteinander zur Schule gegangen, bis der erstere das Johanneum bezog, während der andere unter dem Druck des strengen Vaters die Gärtnerei erlernen mußte, es aber nie verschmerzen konnte, daß er nicht hatte Pastor werden dürfen. Er heiratete später eine Kantorstochter von einem benachbarten Gute, und der junge Herr Nippold, seit des Vaters frühem Tode Chef der Firma, stand bei seinem ersten Kinde Gevatter.
Als nach der Taufhandlung der Pastor einen Trinkspruch auf den neuen kleinen Gärtner ausbrachte, ergriff Herr Nippold das Wort. Der kleine Gärtner, hoffte er, würde nicht ausbleiben, für diesen seinen kleinen Paten hätte er aber einen anderen Wunsch. Er könnte ihm freilich nicht wie regierende Herren ein Offizierspatent in die Wiege legen, womit einem Hamburger Bürgerssohn wohl auch schwerlich gedient wäre, aber einen Platz in seinem Kontor wolle er ihm hiermit zusichern. Es wäre schon mancher aus bescheidenen Verhältnissen zu den höchsten Ehrenstellen seiner Vaterstadt aufgestiegen; ob das auch diesem Knaben gelänge, würde von seinem Charakter und seinen Gaben abhängen; etwas Glück müsse freilich auch dabei sein. Das wünsche er ihm, und in diesem Sinne wolle er das Glas leeren auf das Wohl des kleinen künftigen Senators.
Wie sehr der Kaufherr den jungen Eltern ins Herz gesehen hatte, zeigten das jähe Rot, das in dem Gesicht der Wöchnerin aufstieg und die Ergriffenheit, mit der der Gärtner ihm die Hand schüttelte. »Das ist ein Wort, Herr Nippold! Das ist ein Wort!« wiederholte er mehrfach.
Der kleine Volckardt blieb das einzige Kind, und Frau Werningen brachte den Ehrgeiz, den sie im stillen für ihren Knaben hegte, dadurch zum Ausdruck, daß sie ihn auf das sorgfältigste hielt und kleidete, durchaus über seinen Stand, wie öfter mißfällig bemerkt wurde. Da sie jedoch alles für ihr Kind selbst anfertigte, so konnte man ihr kaum einen Vorwurf daraus machen, wenn sie bei dieser Gelegenheit den Geschmack an den Tag legte, den sie sich als Jungfer in einem feinen Hause angeeignet hatte.
Als nach dem Tode ihrer Mutter die kleine Melitta zu Nippolds gebracht wurde, war Volckardt außer sich vor Freude und behauptete steif und fest, er habe ein Schwesterchen bekommen. Ganz behutsam faßte er sie an und wurde nicht müde, vor ihr zu tanzen und zu springen und sie auf alle Art zu unterhalten. Er hatte eine ausgesprochene mechanische Begabung und machte der Kleinen allerhand Spielzeug, das sich drehte, rollte und klapperte. Niemand hatte soviel Einfluß auf sie, wie er. Eines Tages hatte Frau Nippold Besuch und schickte nach der Kleinen; anstatt der Wärterin erschien Volckardt mit dem Kinde an der Hand und sagte treuherzig, während er mit einer ihm eigenen Bewegung die Locken zurückwarf: »Sie schrie und wollte nicht kommen, da mußte ich sie wohl bringen.« Der fremden Dame machte er eine sehr sorgfältige kleine Verbeugung, ehe er wieder hinausging.
»Das war wohl der Kleine von Bürgermeisters nebenan?« fragte die Dame.
»Nein, ein Pate meines Mannes, der Sohn des Gärtners,« war die Antwort.
»Er sieht aus, wie ein kleiner Prinz,« sagte die Fremde.
Leider war Volckardt nicht immer so wohl erzogen, und Frau Werningen vergaß es nie, daß er, als Frau Nippolds Mutter, die alte Frau Keller, ihm einmal Milch in ihre eigene Tasse eingoß, ungezogen äußerte: »Wo Du din oll Snabel intunkt hast, mag ik nich trinken.«
Melitta war ein leidenschaftliches Kind. Sie konnte sich bei Ausbrüchen von Heftigkeit und Eigensinn auf den Boden werfen, wobei dann Tante und Bonne hilflos daneben standen. Sogleich aber erhob sie sich, wenn Volckardt bei einem solchen Auftritt ins Zimmer kam, und sie sparte nicht an Tränen und Bitten, bis er »wieder gut« war.
In der Schule und später im Gymnasium war Volckardt mehr gefürchtet als geliebt, und es bildete sich mit der Zeit eine Schroffheit in seinem Charakter aus, die nicht jedem gefiel. Er hatte wenig Freunde und wählte sie sorgfältig. Seine Mutter war besonders stolz auf seinen Umgang mit dem Sohne des Senators Dietert, einem aufgeweckten, talentvollen Jungen.
Sobald die Knaben die Sekunda durchgemacht hatten, bemühte sich der Senator um einen Platz im Nippoldschen Kontor für seinen Sohn; Herr Nippold aber erinnerte sich seines Versprechens und lehnte den jungen Dietert zu Gunsten seines Paten ab.
So hatten denn Werningens das Ziel ihrer Wünsche erreicht, und vielleicht war es einer der glücklichsten Augenblicke ihres Lebens, als sie eines Tages Volckardt nachsahen, wie er zum erstenmal mit anderen jungen Leuten des Kontors zu Nippolds gebeten, in tadellosem Anzug, mit hellen Handschuhen und weißer Binde den Weg von der Gärtnerwohnung zum Herrenhause zurücklegte.
Leider blieb ihre Freude nicht lange ungetrübt, denn schon nach wenigen Monaten liefen Klagen über Volckardt ein. Der alte Kassierer, Herr Dammann, beschwerte sich über seine Zerstreutheit und Lässigkeit. »Und er kann doch alles sehr gut machen, wenn er nur will,« fügte er hinzu. Melitta fing eine ärgerliche Äußerung des Onkels darüber auf, und obwohl sie und Volckardt je länger je seltener zusammen waren, wußten sie sich doch zu finden, wenn es darauf ankam, und Melitta wiederholte ihm an einer abgelegenen Stelle des Gartens, was sie den Onkel hatte sagen hören, und fragte, ob der alte Dammann ihm vielleicht übel wolle?
»Nein, er hat ganz recht,« sagte Volckardt.
»Aber warum tust Du nicht Deine Pflicht?« fragte Melitta.
»Ich kann es nicht. Wohl ein paar Stunden lang, dann aber kann ich in der Tretmühle nicht weiter. Im Gymnasium war das Arbeiten leicht, da hatte ich Interesse an den Sachen. Hier aber fehlt es mir; denn ich bin kein Kaufmann, ich bin ein Mechaniker. Als solcher könnte ich etwas leisten; als Kaufmann wird aus mir im Leben nichts.«
»Warum sagst Du das nicht, Volckardt?«
»Ich habe es der Mutter gesagt, aber da hättest Du sie sehen sollen. Sie schrie fast vor Angst, weinte und bat, ich solle um Gottes willen den Vater nichts merken lassen. Ich mußte ihr versprechen, noch zu warten und wenigstens zu versuchen, mich in die kaufmännische Arbeit hineinzufinden. Das will ich auch, denn wechseln ist sonst meine Sache nicht.«
»Soll ich nicht mit Tante Lydia sprechen, damit sie es dem Onkel zu guter Stunde beibrächte?«
»Wenn Du jemals wiederholst, was ich Dir im Vertrauen sage, sind wir geschiedene Leute. Auf Dich wenigstens muß ich mich verlassen können; ich habe ja sonst niemand.«
»Das kannst Du auch. Gegen Deinen Willen und ohne Dein Wissen sage ich nichts.«
Melitta schied bedrückt von dem Jugendfreunde und konnte den Eindruck tagelang nicht verwinden; bald aber vergaß sie alles über der Nachricht, daß ihr Vater auf einige Zeit zum Besuch käme. Ihr Jubel füllte das Haus. Es war unmöglich, sich nicht an ihr, wenn auch nicht mit ihr zu freuen, und das sonst so scharf beobachtende Kind merkte in diesem Falle nicht, daß es mit seiner Freude ziemlich allein stand. Das Verhältnis zwischen den Schwägern war mit jedem Zusammensein kühler geworden. Herrn Nippold war die etwas laute, joviale Art seines Schwagers ebenso unangenehm, wie Herrn Tschuschner dessen gemessenes, allezeit korrektes Wesen. Nippold konnte nicht begreifen, wie man sein Leben in den verschiedensten Weltgegenden mit immer anderen Projekten ausfüllen und darüber zu keiner Seßhaftigkeit gelangen könne, und Tschuschner fand, daß es für den guten Franz ein Segen gewesen war, als Chef eines großen Handelshauses geboren zu werden, denn auf andere Weise wäre er nie einer geworden.
Frau Nippold stand, wie mit allen Leuten, so auch mit dem Schwager gut, in Gegenwart ihres Mannes aber wurde sie die Mitempfindung seines Unbehagens nicht los. Dazu kam bei ihr die Sorge, Tschuschner möchte ihnen Melitta nehmen, obwohl ihm Nippold die Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß er das dem Kinde nicht antun würde. Der kleine Mittelpunkt dieser verschiedenen Interessen stand mit vollster Unbefangenheit zwischen ihnen. Für Melitta war seit der Ankunft des Vaters jeder Tag ein Fest und der Unterricht nur ein Hindernis, ihn überall hin zu begleiten. Als er sie eines Tages mit an den Hafen hinunternehmen wollte und die Erzieherin an die Klavierstunde erinnerte, traten Melitta Tränen in die Augen.
»Ich dächte,« meinte Herr Nippold und sah die Erzieherin fragend an, »man könnte doch, während der Papa hier ist, die Zügel ein wenig locker lassen.«
»Das ist auch meine Meinung,« sagte Fräulein Ritter gefällig. Sie war Herrn Tschuschner sehr gewogen, denn als er das vorige Mal Abschied nahm, hatte er ihr ein Etui mit einem kostbaren Armband überreicht, in dessen Rund sich ein feingefalteter Tausendmarkschein anmutig schmiegte; das mußte ihr denn wohl gefallen.
»Wen hast Du heute zu Tisch, Lydia?« fragte am nächsten Sonntagmorgen Herr Nippold seine Frau.
»Volckardt und Brand sind an der Reihe, und da Brand noch krank ist, habe ich den jungen Dietert dazu gebeten. – Ist Dir's nicht recht?« fragte sie, als sie eine Wolke auf ihres Mannes Stirn aufsteigen sah.
»Heute läßt es sich nicht mehr ändern,« erwiderte er, »aber für's erste möchte ich Volckardt nicht wieder gebeten haben. Dammann klagt fortwährend über ihn, und ich fürchte, die Sache wird nicht gehen, falls er sich nicht bald zusammennimmt.« –
Frau Nippold sah sehr betroffen aus; Melitta, die mit einem Buch am Fenster saß, stand auf und verließ das Zimmer.
»Du gibst doch acht, Lydia,« sagte der Kaufherr beunruhigt, »daß das nicht etwa weiter geht? Die Intimität zwischen den beiden gefällt mir gar nicht mehr.«
»Sie ist schon viel geringer geworden,« erwiderte Frau Nippold, »und wir tun wohl am besten, nicht an das Verhältnis zu rühren. Ich glaube, daß wir uns auf den Takt der Eltern verlassen können und auf den von Volckardt auch; er hält sich seit einem Jahre sichtlich zurück.«
»Behalte jedenfalls die Augen offen. Sobald es tunlich ist, schicke ich ihn außer Landes.«
Der junge Dietert war aus einem feinen lebhaften Knaben ein sehr hübscher, gewandter junger Mann geworden. Volckardt sah älter aus und war begreiflicherweise heute still und bedrückt.
»Ist es wahr, Herr Tschuschner, daß Sie eine Weile unter den Indianern gelebt haben?« fragte Dietert. Damit war nun gerade die Art der Unterhaltung eingeleitet, die Nippold besonders zuwider war. Tschuschner aber war bald im besten Fahrwasser, beschrieb die Indianer und sein Leben mit ihnen am Colorado, und erzählte, wie er einst in einem Streite, der zwischen ihnen und den weißen Ansiedlern ausgebrochen war, vor ihren Augen die Waffen ablegte und allein zu ihnen ging; seitdem war er bei allen solchen Zwistigkeiten zum Schiedsrichter und Obmann gewählt worden.
»Wie kamst Du denn aber dorthin, Papa?«
»Mit einem englischen Schiffe, Puß, von dem ich ablief. Es war in 'Frisco. Ich traf dort Pelzhändler, die nach dem Colorado gingen, und schloß mich ihnen an.«
»Wie kam es eigentlich, daß Du überhaupt Seemann wurdest? Du bist doch aus Schellstadt.«
»Ja, das hatte seine Gründe, Pussy. Ich war nicht sehr glücklich zu Hause und hatte schon öfter daran gedacht, fortzulaufen. Meine Mutter war gestorben, und mein Vater hatte eine Schwester von ihr geheiratet, die ich schon als Tante nie hatte leiden können. Der Vater war sehr heftig und sehr streng, und dazu hatten wir am Gymnasium – ich war damals in der Sekunda – einen Direktor, der auch ein sehr strenger Herr war. Wir nannten ihn Jämmerlich, weil er seine Pauken immer mit den Worten anhob: ›Es ist doch jämmerlich.‹ Besonders auf das Rauchen hatte er es abgesehen, und gerade deshalb waren wir darauf versessen und hatten eine Verbindung gestiftet; es war die reinste Dummejungenspielerei. Wir tranken schlechtes Bier, rauchten ein schauderhaftes Kraut und trugen dazu weiß und grüne Bänder; das war alles. Der Ort, wo wir unsere Zusammenkünfte hielten –«
»Kommt noch etwas?« fragte der Hausherr ungeduldig. Frau Nippold murmelte mit niedergeschlagenen Augen etwas von Nachtisch, und Herr Tschuschner fuhr unbekümmert fort:
»Also das Lokal hatte uns viel Kopfzerbrechen gemacht, aber schließlich kam uns ein genialer Einfall. Wir versammelten uns nämlich im Oberzimmer eines uralten Turmes, der noch aus der Zeit der Befestigung der Stadt herstammte. Er war früher in die Stadtmauer eingefügt gewesen, von der noch ein Stück stehen geblieben war, und zwar so, daß es den Eingang fast verdeckte. Unten war die sogenannte Wachtstube für die Nachtwächter; sie wurde bei Tage selten benutzt; oben enthielt der Turm aber noch ein Stübchen mit vergittertem Fenster, wo ab und zu ein aufgegriffener Strolch für die Nacht eingesteckt wurde, weshalb dort eine Pritsche mit einer Decke vorhanden war; sonst war außer einem Tisch und ein paar Stühlen nichts darin. Dort also saßen wir an einem schönen Herbstnachmittag in guter Ruh, ohne zu bemerken, daß der Tabakrauch in dicken Wolken durch das geöffnete Fenster zog. Einer von uns sagte noch ganz harmlos: ›Da kommt der Jämmerlich.‹ sprang aber plötzlich in die Höhe: ›Um Gottes willen, was fangen wir an? Er fixiert das Fenster! er kommt!‹ – Nun war guter Rat teuer, denn einen zweiten Ausgang gab es nicht. Wir hatten zwar die Tür von innen abgeschlossen, aber das war doch nur ein Aufschub; wir saßen wie die Mäuse in der Falle. Da fiel mir die wollene Decke in die Augen. ›Hört,‹ sagte ich, ›Ihr stellt Euch hinter die Tür und nehmt Eure Mützen, damit nichts zurückbleibt, das uns verraten kann. Einer schließt auf, und sobald Jämmerlich eintritt, werfe ich ihm die Decke über den Kopf, und ehe er sich besinnt, sind wir unten.‹ Währenddessen hörte man schon den Herrn Direktor die Stufen heraufkeuchen und sein ›es ist doch jämmerlich‹. Nun rüttelte er an der Klinke und schlug mit der Faust an die Tür. ›Aufgemacht!‹ schrie er, ›ich bin der Rektor!‹ Ich hielt die Decke ausgebreitet vor mich, die anderen drückten sich gegen die Wand. ›Fertig!‹ sagte ich. Einer schloß auf, und der Rektor trat ein. ›Es ist doch jämmerlich‹ – da stülpte ich ihm das Tuch über und wand es ihm um Kopf und Hals und Schultern. Die Jungen stürmten die Treppe hinunter; ich stellte dem Rektor noch ein Bein, daß er hinfiel, und ehe er sich aufrappeln konnte, war ich draußen, schloß ab und nun hinunter wie der Blitz. Aber, wie es das Unglück will, eben, da ich aus der Tür trete, geht der Klassenlehrer vorbei und sieht mich. ›Wo kommen Sie denn her?‹ fragte er. Ich antwortete: ›Aus der Wachtstube.‹ ›Sie haben da wohl einen eingesperrt?‹ – Man hörte oben jemanden toben und gegen die Tür donnern und dazu die wohlbekannte Stimme: ›Hilfe! Aufmachen! jämmerlich! jämmerlich!‹ – ›Das klingt ja fast wie der Rektor?‹ sagte der Lehrer. ›Mir scheint es auch so; wollen wir nicht hinauf und nachsehen, Herr Doktor?‹ Er warf mir einen sonderbaren Blick zu, und wir wandten uns beide nach der Treppe. Sobald aber der Doktor hinaufstieg, sprang ich zurück, war mit einem Satz um die Mauer und lief wie gehetzt durch das Stadthölzchen, dann weiter in die Niederung, als wäre man hinter mir her. Ich wußte augenblicklich, daß ich nicht nach Hause zurückkonnte, denn von der Schule wäre ich mit Schimpf und Schande gejagt worden, und meinem Vater hätte ich nicht unter die Augen treten dürfen. Die Dämmerung brach herein, und ich irrte noch immer an der Oder entlang, ohne zu wissen, wohin. Da stieß ich auf einen alten Kahn, der halb im Schlamm lag; ein Paar Ruder lagen darin. ›Wenn ich nur über den Fluß könnte,‹ dachte ich und schob den Kahn hinunter; aber es war ein morsches Ding und zog gefährlich Wasser. Indem ich noch unschlüssig dastand, sah ich einen der großen Oderkähne herankommen, und nun war mein Entschluß gefaßt. Ich stieg in das lecke Ding und gedachte das Fahrzeug zu erreichen; aber das flache Boot lief im Umsehen voll. Ich suchte erst das Wasser mit meiner Mütze auszuschöpfen, dann ruderte ich wieder aus Leibeskräften und schrie so laut ich konnte. Ein alter Mann aus dem Kahn hatte mich bemerkt, hielt auf mich zu und warf mir, sobald ich in erreichbare Nähe kam, ein Tau zu. Es war die höchste Zeit, der Kahn sackte unter mir fort, und ich kletterte naß wie ein Pudel an Bord. ›Zum Teufel, junger Herr,‹ sagte der Alte, ›was fällt denn Ihnen ein? Ihrethalben kann ich nicht anlegen, nun müssen Sie hier bleiben, bis morgen Mittag.‹ Mir war das nur zu recht. Der alte Mann war allein an Bord mit seinem Sohne, einem stillen, ordentlichen Menschen, der mir trockenes Zeug brachte, mir etwas zu essen gab und mich in seiner Koje schlafen ließ. Am nächsten Morgen erzählte ich den beiden, wie es mit mir stand. Der Alte lachte: ›Wenn Sie einen schlechten Streich gemacht hätten, setzte ich Sie ohne weiteres ab, da es aber nur ein dummer war, will ich Ihnen helfen.‹ Sie hatten den Tag zuvor zwei Leute fortgeschickt, die sich an Land betrunken hatten; so kam ich ihnen ganz gelegen. Als ich dachte, daß Gras genug über die Geschichte gewachsen wäre, nahm ich in Stettin eine Heuer auf einem Schiffe, das nach England ging und einem Vetter von meinem Schiffer gehörte. Der gab mir ein gutes Zeugnis. So kam ich nach London. Natürlich wollte ich aber nicht nach Deutschland zurück. Sobald das Schiff wieder segelfertig war und der Schlepper bestellt, sagte ich, ich wolle mir noch etwas Tabak aus einem kleinen Laden in der Nähe holen, ging aber nicht hinein, sondern sprang auf den ersten besten Omnibus und fuhr mit, so weit er ging. Dann, als ich sicher war, daß das Schiff fort war, fragte ich mich nach der Themse durch und wanderte die ganze Nacht am Strande entlang bis nach den Docks. Da stand ich nun –«
»Konnten Sie damals schon Englisch?« fragte Volckardt – es war fast das einzige, das er an diesem Mittag sprach.
»Nein, mein Sohn. Mit Griechisch und Latein hatte ich mich jahrelang herumgeplagt, aber etwas Nützliches, das einem hätte im Leben vorwärts helfen können, lernte man zu meiner Zeit auf einem preußischen Gymnasium nicht.«
»Ich denke, wir heben die Tafel auf,« sagte Herr Nippold zu seiner Frau. Sie erhob sich, und man verfügte sich zum Kaffee auf die Veranda. Die jungen Leute umgaben Herrn Tschuschner, wie Bienen einen Honigtopf, aber der Hausherr zog sich zu seinem Mittagsschlaf zurück.
»Was machtest Du denn nun, Papa?« fragte Melitta.
»Ich sah Arbeiter Bohlen aus einem Schiff laden, stellte mich dazu und trug mit. Zur Essenszeit ging ich mit ihnen in eine Wirtschaft, und weil mich der Omnibus mein letztes Geld gekostet hatte, so nahm ich meine Jacke ab und gab sie der Frau an der Bar zum Pfand; aber sie lachte und gab sie mir wieder. Abends wurde ich mit ausbezahlt und schlief dann auch dort; es war billig und reinlich. Während ich dort arbeitete, redete mich der Steuermann, der deutsch konnte, an, und riet mir, mich auf sein Schiff zu verheuern, das noch Leute brauchte, und mit nach Kapstadt zu gehen. Das tat ich, und nach ein paar Jahren kam ich nach 'Frisco, wo ich wieder ablief, wie ich schon sagte.«
Nur zu schnell verging Melitta die Zeit, die ihr Vater für seinen Aufenthalt in Hamburg festgesetzt hatte; er sprach zwar mehrmals davon, ganz dazubleiben, teilte ihr dann aber ziemlich plötzlich seinen Entschluß mit, nach Australien zu gehen, wo er verschiedene Eisen im Feuer hätte, und eines Abends stand sie oben im Garten im Aussichtspavillon und sah in heißen Tränen dem Dampfer nach, der ihr den Vater entführte.
Kurze Zeit danach trat die erwartete Katastrophe für Volckardt ein. Herr Dammann erklärte ihm eines Morgens, daß er genötigt wäre, seinethalben nochmals ernstlich mit Herrn Nippold zu sprechen. Das wartete Volckardt nicht ab, sondern ging selbst in das Sanktum des Chefs. Er sah sehr bleich aus, als er an Herrn Nippolds Pult trat.
»Du kommst, um Deine Entlassung zu nehmen. Du kannst gehen,« sagte Herr Nippold hart. »Was willst Du noch?« fragte er dann.
»Ich – ich wollte Ihnen danken –« stotterte der arme Junge.
»Tut nicht nötig.« Der Kaufherr zeigte mit der Feder nach der Tür und sah in einen Brief, den er in der Hand hielt. Gesenkten Hauptes ging Volckardt hinaus. War die Entlassung aus dem Geschäft bitter und demütigend gewesen, so war der Empfang, als er zu ungewohnter Stunde nach Hause kam, geradezu schrecklich. Die Mutter jammerte und rang die Hände; hätte man ihr den einzigen Sohn tot ins Haus getragen, sie hätte sich nicht verzweifelter anstellen können. Noch schlimmer war der Vater. Wiederholt ging er mit geballten Fäusten und verzerrtem Gesicht auf den Sohn los, und man sah, wie er gewaltsam an sich hielt, um sich an dem fast Erwachsenen nicht tätlich zu vergreifen, während er mit heiserer Stimme schrie: »Zum Schuster tu ich Dich! Zum Schuster auf die Flickbank gehörst Du! Dafür haben wir Dich aufgezogen wie einen Prinzen und kein Opfer gescheut, daß Du nun Schande über uns bringst! Feines Zeug tragen und hochdeutsch reden, das kannst Du, aber zum Arbeiten ist der junge Herr zu gut! Aber komm Du mir nur! Du hast's nicht gut haben wollen, nun magst Du's fühlen, wenn Dir der Meister den Buckel zerdrischt! Wie lange willst Du Dich noch von uns füttern lassen, Du unnützer Sack Du?«
»Ich will zum Schlosser in die Lehre,« antwortete Volckardt, »ich habe mit Petersen schon gesprochen.«
»Meinethalben geh zum Hundefänger! Ich scher mich nicht länger um das, was du tust oder läßt.«
In der Tat mußte die Mutter die nötigen Abmachungen vermitteln, denn wochenlang sprach der Vater kein unnützes Wort und ging jedem Mitglied der Familie Nippold scheu aus dem Wege. Auch der Mutter schnitt es ins Herz, wenn sie Volckardt mit berußtem Gesicht und schwarzen Händen nach Hause kommen sah.
Monate waren so vergangen, als Herr Nippold einmal den Gärtner bei einer Arbeit traf, stehen blieb und fragte: »Wie geht es denn jetzt mit Volckardt? Ich höre, Petersen soll sehr zufrieden mit ihm sein.«
Da aber verwandelte sich Werningens ganzes Gesicht; er richtete sich straff auf und sagte: »Herr Nippold, davon kann ich nicht sprechen. Sie haben es gut mit uns gemeint, und wir haben Ihnen mit Undank gelohnt.«
»Nimm Dir das doch nicht so zu Herzen, Jan!« sagte Herr Nippold gutmütig; aber die Erschütterung des Mannes war so sichtlich und so tief, daß er das Gespräch abbrach.
Der Sturm erneuerte sich, als Volckardt nach einem Jahre das Polytechnikum besuchen wollte. Er bat seinen Meister, darüber mit dem Vater zu sprechen, allein auch dieser richtete bei dem störrischen Manne nichts aus. Er erklärte hartnäckig, mit seinem Willen würde nicht wieder umgesattelt; jetzt wäre der Junge Schlosser, und Schlosser solle er bleiben.
Eines Abends saß Melitta lesend im Zimmer ihrer Tante, ganz vertieft in the Heart of Midlothian. Es war Spätherbst, und das Feuer im Kamin flackerte behaglich. Da klirrte es leise, als ob von außen Sand gegen die Scheiben geworfen würde, das Zeichen, durch das sie Volckardt sonst in den Garten zu rufen pflegte. Seit Jahren war es nicht mehr gegeben worden, und Melitta begriff sogleich, daß es sich um etwas Wichtiges handeln müsse. Sie stand auf, verließ das Zimmer und eilte den Laubengang aufwärts nach dem Pavillon, den sie einst scherzweise ihr geheimes Fleck genannt hatten. Ein dichter Tannengang senkte sich von dort in den unteren Teil des Gartens, und es hatte zu ihren Kinderspielen gehört, sich bei den Händen haltend, mit geschlossenen Augen hinunter zu springen, »ins Nichts zu laufen«, wie sie es nannten.
Wie Melitta erwartet hatte, stand Volckardt im Schatten des Pavillons, als sie mit ängstlichem: »was gibt es denn?« oben ankam. Er faßte ihre Hände.
»Ich will Dir Lebewohl sagen,« rief er leise; »ich muß fort.«
»Um Gottes willen! Du hast doch nichts Unrechtes getan?« fragte Melitta erschrocken.
»Nein,« erwiderte er, »wie kannst Du nur so etwas denken?« Er setzte ihr nun auseinander, wie er seinen ganzen Lebensgang ändern müßte, wenn er jetzt noch ein paar Jahre verlöre. »Ich habe entschieden mechanisches Talent,« sagte er, »aber es muß ausgebildet werden, wenn ich vorwärts kommen soll. Hier in Deutschland geht alles so langsam nach der Schablone, und ich muß schneller weiter; ich muß selbständig werden. Bei der Mutter finde ich kein Verständnis, und der Vater behandelt mich wie einen Schuft. Ich muß aus diesen Verhältnissen hinaus. Ich will es machen, wie Dein Vater, und mir das Glück auswärts suchen, das sie mir in ihrem Unverstande hier aus der Hand winden.«
»Aber warum hat es denn mit Dir solche Eile?« fragte Melitta.
»Ich will offen mit Dir sprechen, Melitta. Du weißt, daß ich auf der Welt keinen anderen Freund habe als Dich. Du bist mein einziges Glück und mein einziger Trost, und« seine Stimme sank – »meine einzige Hoffnung. Und leider bist Du reich und hübsch, und es wird nicht lange dauern, so werden das andere auch sehen. Da will ich denn, so aussichtslos es auch ist, versuchen, mir eine Stellung zu erwerben, die es mir ermöglicht, Dich zu erringen.«
»O,« rief Melitta lebhaft, »auf mich kannst Du Dich verlassen! Ich warte schon« –
»Nein,« erwiderte Volckardt, »das darf nicht sein, das darfst Du nicht aussprechen. Du bist noch ein Kind und würdest vielleicht in ein paar Jahren über das kindische Versprechen lächeln. Es könnte auch sein, daß es Dich dann beunruhigte. Nein, Du sollst frei bleiben, ganz frei! Ich wollte Dir nur sagen, wie ich denke, damit Du weißt, was mich von hier forttreibt, wenn sie nachher alle über mich herfallen.«
»Und wohin gehst Du?« fragte Melitta.
»Zunächst nach England. Kraft Heinz geht heute nacht in See und nimmt mich mit hinüber.«
»Hast Du denn Geld?«
»Nein, ich hatte eine kleine Summe für alle Fälle zurückgelegt, aber die Mutter hatte ein Paar größere Rechnungen, die sie drückten, und bat mich, sie ihr zu leihen. Du weißt ja, wie Vater immer schilt, wenn Mutter Geld von ihm verlangt. Es muß auch so gehen.«
»Warte,« sagte Melitta, »ich hole Dir, was ich habe.« Sie sprang davon, und es dauerte kaum zehn Minuten, bis er ihr helles Kleid wieder durch die Büsche schimmern sah und sie ihm atemlos ein Päckchen in die Hand drückte.
»Ich danke Dir,« sagte Volckardt bewegt, »von Dir nehme ich es gern.« Da warf sie ihre Arme um seinen Hals, und er fühlte ihre Tränen auf seinen Wangen und ihre weichen Lippen an seinem Munde.
»Melitta! Melitta! wo bist Du?« hörten sie in diesem Augenblicke die Stimme der Erzieherin vom Hause her.
»Geh nur, geh!« flüsterte Melitta.
»Sei ruhig; ich verschwinde ins Nichts,« erwiderte Volckardt und drückte sie noch einmal an sich, ehe er mit leichtem Sprung in dem Tannengange verschwand.
»Hier bin ich! Ich komme ja schon!« rief Melitta hastig, indem sie der Erzieherin entgegeneilte, um das Geräusch von Volckardts Schritten zu verdecken.
»Du hast geweint, Kind? Was hast Du?« fragte die Tante, als Melitta ins Zimmer zurückkehrte.
»Fräulein Ritter ist gleich so böse!« sagte Melitta und brach in heftige Tränen aus.
»Aber liebes Kind, nimm Dir das doch nicht so zu Herzen. Ich mag ja etwas ungeduldig nach Dir gefragt haben. Du weißt, ich bin manchmal etwas nervös, seit Onkel krank ist.«
Als Volckardt am nächsten Morgen nicht zum Frühstück erschien und die Mutter sein Bett unberührt fand, war der Verdruß groß.
»Nun wirft sich der Bengel noch auf die liederliche Seite,« schalt der Vater. »Das fehlte gerade noch. Nichts als Schimpf und Schande erlebt man an dem Jungen.«
Als Volckardt auch zu Mittag fehlte und die Mutter unvorsichtig bemerkte, er hätte wohl Angst sich zu zeigen, entlud sich der Zorn des Vaters über sie. Es kam aber noch schlimmer. Als die arme Frau am Nachmittag einige ausgebesserte Wäschestücke in ihres Sohnes Kommode legen wollte und das Schubfach aufzog, war es leer. Mit zitternden Händen öffnete sie den Kleiderschrank; auch der gute Anzug und die besseren Arbeitskleider des Sohnes fehlten. Nun lief sie laut schreiend in den Garten.
»Um Gottes willen, Mann! Volckardt ist fort! Er ist fort! Mein Junge ist fort! Mein armer Junge!«
»Meinethalben mag er sein, wo er will,« erwiderte ihr Mann mürrisch, ging aber doch in das Haus und untersuchte sorgfältig des Sohnes Kammer. Im Pult lagen aber nur Zeichnungen von Maschinen und eine Abhandlung über den »Vulkan« in Stettin.
»Ja,« sagte die Mutter, schon halb getröstet, »nach Stettin wird er gegangen sein; davon hat er schon oft gesprochen.«
Als dieses Zwiegespräch stattfand, lag Volckardt an Bord des Kohlendampfers »Gesch-Margret« in seiner Koje. Er hatte die Vorhänge zugezogen und fand jetzt die Muße, im Lichte der runden Luke Melittas Päckchen zu öffnen. In eines ihrer kleinen Taschentücher fest eingeknotet fand er ihr Portemonnaie mit all ihrem Reichtum, 52 Mark 65. Pfg., daneben in einem Briefumschlag ein handlanges Stück ihres dicken braunen Zopfes, noch mit der blauen Schleife daran, offenbar in höchster Eile mit einem Messer schräg abgeschnitten. Voll Rührung betrachtete er das kindliche Liebespfand, das ihm später in mancher Versuchung zum rettenden Talisman werden sollte.
Zwei Jahre vergingen, ehe Volckardt wieder von sich hören ließ. Dann schrieb er endlich aus Johannisburg, wo er in der Nähe der Goldfelder eine Werkstatt zur Reparatur von Maschinen und einen kleinen Handel mit Werkzeug eingerichtet hatte. Es ginge ihm gut, berichtete er. Sobald er die nötigen Mittel beisammen hätte, gedächte er nach Chicago zu gehen, wo ein in der Eisenindustrie etablierter Freund lebte, und wo er auch seine wissenschaftlichen Kenntnisse vervollkommnen könne. Er ließ den Vater und Melitta grüßen. Die Mutter zögerte lange mit der Antwort, denn Schreiben war ihre Sache nicht. Der Vater nahm überhaupt keine Notiz von dem Brief, aber Frau Nippold und Melitta schickten freundliche Grüße, und Nippold sagte zu seiner Frau: »Den Jungen haben sie auf dem Gewissen. Der würde seinen Weg gemacht haben, hätten sie ihn verständig genommen und gewähren lassen.«
»Sie sind vorbei, die Tage solcher Tränen.«
Pestalozzi.
Während Volckardt schon im Kampfe des Lebens stand, durchlebte Melitta noch das Freundschaftsstadium der Backfischzeit. Solange sie Volckardts kameradschaftlichen Umgang gehabt hatte, war sie in kein näheres Verhältnis zu einem anderen kleinen Mädchen getreten. Jetzt aber erblühte eine warme Freundschaft zwischen ihr und Fanny Kämpf, aus der sie sich sonst nicht viel gemacht hatte. Es war eigentlich eine Kontrastfreundschaft; sie hatten nicht viel gemeinsame Interessen, ergänzten sich aber in gewisser Weise vortrefflich. Beide waren einzige Kinder und gestanden sich einmal in vertraulicher Stunde, daß es das größte Glück sein müßte, eine Schwester zu haben. Da das nun nicht zu erreichen war, stifteten sie, wie Jonathan und David, einen Bund miteinander, tauschten ihre Broschen aus und erklärten sich für Schwestern. Die beiderseitigen Mütter, denen der nähere Umgang der Kinder sehr erwünscht war, gingen bereitwillig darauf ein, und die neuen Schwestern genossen das Glück, sich gleich kleiden und die meisten ihrer Unterrichtsstunden teilen zu dürfen. Fanny war zwar ein Jahr älter, aber noch besonders kindlich und eine wahre Meisterin im Puppenspielen, woraus sich Melitta nie viel gemacht hatte; jetzt aber holte auch sie, von Fanny angeregt, die längst fortgelegten Puppen nochmals hervor, und der gütige Onkel, der davon hörte, brachte ihr selbst eines Tages noch eine herrliche Wachspuppe, als Braut gekleidet, mit einem feinen Schleier und einem Kranz aus winzigen Orangenblüten. Durch eine jener wunderbaren Fügungen, wie sie auch im Puppenleben vorkommen, paßte sie in der Größe genau zu Fannys geliebtem Matrosenjungen James, und der Gedanke, die beiden zu vermählen, war daher sozusagen von selbst gegeben. Frau Kämpf war etwas betreten, als sie eines Tages in die sogenannte Kinderstube kam und die Vorbereitungen zu einer glänzenden Hochzeitsfeier in vollem Gange fand. »Kinder!« sagte sie, »Das ist kein hübsches Spiel! Das möchte ich lieber nicht!«
»O Mamachen!« rief Fanny, der schon die Tränen in die Augen schossen, »seit zwei Tagen arbeiten wir daran, und eben ist alles fertig! Melitta zieht nur noch Betty und Susanne als Brautjungfern an, beide weiß und rosa, und wir haben so furchtbare Mühe gehabt, genug rote Gänseblumen zu den Kränzen zu finden. Und wir haben einen Toast in Versen, der beim Braten kommen soll, und wir haben einen wirklichen Braten!«
»Einen wirklichen Braten? – Was denn?« fragte die Mutter.
»Trina hat uns eine Leipziger Lerche von Jenckel mitgebracht, die kleinste, die da war, und wir haben sie mit Speckscheiben umwickelt, und sie brät in der kleinen Bratröhre. Wir haben schon dreimal Spiritus aufgegossen. Riechst Du es nicht?«
Die Mutter war zwar so gefällig, die Lerche zu riechen, sagte indessen: »Mit ernsten Dingen, wie kirchliche Handlungen sind, treibt man kein Spiel.«
»Das wollen wir ja auch gar nicht!« rief Fanny kläglich. »Es ist ja nur Zivilehe! Da in der Ecke ist das Standesamt!«
»Nun, dann –« sagte Frau Kämpf.
»Wir wissen nur nicht,« fuhr Melitta fort, die eben der einen Brautjungfer eine Stecknadel in den Kopf drückte, »wir wissen nur nicht, ob man seinen eigenen Namen in das Buch schreibt, oder den neuen.«
»Den neuen,« sagte Frau Kämpf lachend.
Und so kam es, daß die Puppe Leokadie sich gleich als Baronin James von Adlerhorst-Brandenfels auf der letzten Seite einer alten französischen Grammatik eintragen durfte.
Diese harmlos glückliche Zeit verging schnell, und aus den beiden Kindern entwickelten sich zwei anmutige junge Mädchen, die man überall zusammen sah und von denen es hieß, daß sie sich gegenseitig gut stünden, da Fanny eben so rosig und blond, wie Melitta dunkel und farblos war.
Für diese hatte sich währenddessen das Leben im Hause durch die zunehmende Krankheit des Onkels traurig geändert. Jahrelang hatte sich Frau Nippold darauf gefreut, die Pflegetochter in Gesellschaft zu führen; nun beanspruchte die Pflege des Mannes all ihre Zeit und ihre Kräfte. Auch ihre eigene Kränklichkeit nahm zu, und so mußte sie sich begnügen, Melitta unter Frau Kämpfs Obhut die Vergnügungen mitmachen zu lassen, zu denen sie selbst sie nicht begleiten konnte.
So standen die Sachen, als Herr Tschuschner nach Jahren wieder zu längerem Besuche eintraf. Er hatte sich im allgemeinen angemeldet, das Schiff, mit dem er kommen würde, indessen nicht bestimmen können; so kam er denn eines Abends im Februar bei eisigem Sturm und dem bekannten Hamburger Wetter, von dem man nicht weiß, ob es Regen, Nebel oder Schnee vorstellen soll, vor dem Nippoldschen Hause an, das anstatt wie sonst eine Reihe heller Fenster zu zeigen, jetzt wie ausgestorben, dunkel und trübe dalag. Niemand empfing ihn als der alte Diener Gustav.
»Ist es möglich! Herr Tschuschner! Und bei diesem Wetter! Aber Herrn Tschuschners Zimmer sind bereit; alles warm und frische Blumen; da hat Fräulein Melitta alle Tage danach gesehen! – Ach, wie finden es Herr Tschuschner bei uns verändert; unser armer Herr!« sagte der treue Mensch mit Tränen in den Augen, während er den Gast die Treppe hinaufgeleitete.
»Geht es meinem Schwager so schlecht?«
»O nein, eben geht es eher etwas besser, aber da ist wohl wenig Hoffnung. Die Ärzte sprechen von Rückenmark, aber der Herr weiß es nicht. Ihm sagt man, es wären die Nerven, und es würde sich geben.«
»Und meine Schwägerin?«
»Die können Herr Tschuschner heute nicht mehr sehen; Frau Nippold geht immer ebenso früh zur Ruhe, wie der Herr, weil er so schwer einschläft und leicht aufwacht.«
»Und meine Tochter?«
»Ach, das wissen wohl Herr Tschuschner nicht? Es ist ja heute Fräulein Fannys Polterabend! Fräulein Fanny Kämpf heiratet ja Herrn Albert Hahn, den ältesten Sohn von Hahn & Froissard; sie kommt nach Singapore. Das ist auch ein rechter Verlust für unser Fräulein. Aber es ist erst acht, da sollten doch Herr Tschuschner noch hingehen. Herr und Frau Kämpf würden sich so freuen und Fräulein Fanny und alle. Um neun fangen erst die Aufführungen an; lebende Bilder und ein kleines Stück; ein Freund vom Bräutigam, der junge Herr Dietert, hat es gemacht. Aber das Schönste kommt zuletzt. Da sind alle jungen Damen Blumen, und unser Fräulein ist die allerschönste. Wirklich, Herr Tschuschner müßten sich das ansehen. Vorgestern war Kostümprobe; da hatten sich's Fräulein Melitta und Fräulein Fanny ausgedacht und die ganze Dienerschaft von den drei Häusern dazu gebeten, weil wir doch sonst nichts davon gesehen hätten. Fräulein Fanny war natürlich nicht dabei, aber als es aus war, bekamen wir Torte und Wein, und die jungen Herrschaften kamen und stießen mit uns an. Die alte Trina, die schon da war, als Fräulein Fanny geboren wurde, weinte die ganze Zeit, und es tut uns auch allen leid, und lange werden wir wohl unser Fräulein auch nicht mehr haben.«
»Wieso? – Ist etwas im Werk?« fragte Herr Tschuschner unbedenklich.
»Wir meinen nur so – ein so schönes Fräulein!« erwiderte der alte Diener ausweichend.
»Ach was, sagen Sie es nur gerade heraus,« sagte Herr Tschuschner.
»Man sagt nur so,« wiederholte Gustav, »es heißt, die Hahns hätten unser Fräulein gern für den zweiten Sohn, Herrn Viktor, und es wäre ja auch hübsch, wenn Fräulein Melitta und Fräulein Fanny Schwägerinnen würden.«
»Ist das alles oder kommt noch ein anderer in Frage?«
»Ja,« sagte Gustav, »es scheint fast so. Da ist eben noch der Herr Dietert, von Wechsler & Co.«
»Der Sohn vom Senator?«
»Ach, Herr Tschuschner erinnern ihn wohl noch? – Er war einmal zu Tisch hier mit dem jungen Werningen.«
»Ganz recht – und wo ist der junge Werningen?«
»Verschollen, Herr Tschuschner. Er lief fort – man fragt da nicht gerne. Es ist hart für die Eltern, sie hatten nur den einen. Herr Dietert ist jetzt auf Urlaub hier; er ist sonst in Rangoon. Das ist ein Staatsmensch geworden; Herr Tschuschner wird auch seine Freude an ihm haben.«
»Und der, heißt es, bemüht sich um meine Tochter?«
»Das kann ich nicht sagen, aber sie sind viel zusammen gewesen in dieser Zeit. Den ganzen Polterabend haben die beiden fast ganz allein eingerichtet.«
Anderthalb Stunden später betrat Tschuschner das helle, blumengeschmückte Treppenhaus bei Kämpfs. Ein Diener eilte dem späten Gast entgegen.
»Die Aufführungen sind schon im Gange, und hinten steht alles dicht gedrängt,« sagte er, »aber ich werde die Seitentür öffnen; der Herr Senator wird zwar hinter Topfgewächsen sitzen, kann jedoch von da aus alles übersehen.«
Tschuschner ließ sich nieder und betrachtete, wohl verborgen, die glänzende Gesellschaft und das der Bühne gegenübersitzende Brautpaar.
Von dem kleinen Stücke verstand er nicht viel. In dem Hauptspieler erkannte er nach der Beschreibung des alten Gustav unschwer den jungen Dietert, der einen Krämer vorstellte, bei dem die Einkäufe zum Hochzeitsmahl gemacht wurden. Was er sagte, schien witzige Anspielungen zu enthalten, denn im Saal folgte ein Heiterkeitsausbruch dem anderen.
Als nach dem Schlusse des Stückes der Vorhang sich wieder hob, hing an der Seite der kleinen Bühne eine Tafel mit der Aufschrift: »Ort der Handlung: Fannys Gärtchen.« Die Musik spielte das Kinderlied: »Kuckuck! Kuckuck ruft aus dem Wald.« Währenddessen kam mit kleinen Schritten und gesenktem Köpfchen ein Veilchen aus der Kulisse, sah sich scheu um und duckte sich unter seine Blätter; gleich darauf noch eins; dann folgten, mit feinen silbernen Glocken läutend, ein Paar Schneeglöckchen, hierauf Flieder und Goldregen Hand in Hand und andere mehr. Kinder kamen als Maßliebchen gesprungen und drehten sich im Ringelreihen. Dann schwieg die Musik, und die Blumen begannen zu klagen, daß sie nun umsonst hier blühen müßten, denn die schönste und liebste der Schwestern zöge fort in ein fremdes Land, und jede Strophe schloß mit dem von allen halb gesungenen, halb gesprochenen Kehrreim:
»Fehlest beim Tanze,
Fehlst beim Gekose,
Ach! aus dem Kranze
Fehlet die Rose!«
und die Augen der jungen Braut standen schon voll Tränen. Da ließ sich von weitem ein fremdartiger Klang hören, und Dietert trat auf als indischer Gaukler, im bunten Sarong, der weißen burmesischen Jacke und dem rosa Kopftuch, auf einer indischen Pfeife spielend. Halb in gebrochenem Deutsch, halb in dem in Indien üblichen Pigeon-Englisch erklärte er, ein Zauberer zu sein, ließ eine unsichtbare Schlange tanzen, von der er versicherte, daß ihr die Giftzähne ausgebrochen seien, machte Münzen unter Tonnäpfchen verschwinden und beteuerte, noch ganz andere Dinge zu können. Die Blumen alle, die hier stünden, so reizend sie auch schienen, wären bleich und matt gegen ihre Schwestern im fernen Osten, und wenn die Herrin erlaubte, so würde er die schönste der dortigen Blumen herzaubern, die heilige Tempelblume, die Pagodaflower. Fanny nickte. Der Gaukler blies nun auf seiner Schalmei und beschrieb beschwörende Kreise in der Luft. – »Jetzt«! sagte er, »jetzt! – Still, sie kommt! – Da ist sie« und aus dem Hintergrund kam langsamen Schrittes, in halbdurchsichtigen gelblichen Gewändern, mit nachschleppendem Schleier, das dunkle Haar gelöst, die fünf zurückgebogenen Zacken einer großen gelbrötlichen Blüte auf dem Haupte, mit geschlossenen Augen wie im Traume, Melitta.
»Wir müssen sie wecken,« sagte der Gaukler, zog aus seinem Sack ein glänzendes Banjo und schlug ein paar Töne an. Die Pagodablume öffnete die Augen, die infolge von braunen Strichen unter den Lidern noch größer und dunkler erschienen, und sah sich verständnislos um. Nun pfiff der Gaukler eine spanische Melodie und begleitete sich dazu auf dem Banjo. Die Pagodablume bewegte sich jetzt in der Art, wie Indierinnen tanzen, nur mit dem Oberkörper und den Armen, die Hände auswärts haltend. Der Zauberer berührte sie schließlich mit dem Stabe. »Sprich,« sagte er, »begrüße die Memsab!« Da trat sie mit gekreuzten Armen vor und flüsterte einige Worte auf Hindostanisch. »Deutsch!« gebot der Gaukler, und mit ruhiger, klangvoller Stimme brachte sie die Grüße der fernen Heimat unter den Palmen und den Blumen, die der Herrin harrten; glänzend wären sie und glühend und leuchtend, aber reizender als alle würde zwischen ihnen die deutsche Rose sein, an Zartheit, Frische und an süßem Duft.
»Herrlich!« rief der Gaukler, »du hast wahr gesprochen!«
Dabei stemmte er eine lustige Melodie an, die Musik fiel ein, die Blumen tanzten in allerlei Verschlingungen durcheinander, in der Mitte allein die Pagodablume. Tanzend löste sie einen feinen indischen Schleier von der Schulter und warf ihn Fanny zu. Der Gaukler schloß mit einem vollen Akkord, und die Blumen sprangen von der Bühne in den Saal hinab, von allen Seiten umringt und bewundert.
Tschuschner war in einem seltsamen inneren Widerstreit dem Spiele gefolgt. Er hatte Melitta als Kind verlassen und natürlich erwartet, sie erwachsen wieder zu finden, aber er hatte geglaubt, sie würde nun ganz ihrer Mutter gleichen, deren Reiz für ihn in einer eigentümlichen Herbheit, einer Art schüchternen Zartheit bestanden hatte; und nun hatte sie vor ihm gestanden, anmutig zwar in jeder Bewegung, aber so fremdartig, und mit einer solchen Ruhe und Sicherheit, daß ihm war, als befände er sich nicht seinem Kinde, sondern einer jungen Fürstin gegenüber. Und es überkam ihn eine große Enttäuschung, eine heiße Sehnsucht nach dem warmherzigen Backfisch, der beim Abschied in so heißen Tränen an seinem Halse hing; und er wollte sich unbeachtet, wie er gekommen war, wieder entfernen, aber der Saal begann sich zu entleeren und zu den letzten Paaren, die an ihm vorübergingen, gehörten Melitta und Dietert. Beide plauderten angeregt, als Dietert zufällig zur Seite blickte, Herrn Tschuschner voll ins Gesicht sah, stutzte und ausrief: »Fräulein Melitta! Da ist ja Ihr Vater!«
Melitta sah auf und flog mit einem leisen Schrei des Entzückens auf Tschuschner zu. Und als sie nun neben ihm saß und seine Hand streichelte, während ein glückliches Lächeln um ihre Lippen spielte und ihre Augen feucht waren und sie nach den ersten Fragen von des Onkels traurigem Zustand sprach, als von dem, was ihrem Herzen zunächst lag, erfaßte ihn eine große Freude und Rührung.
»Ja, Du bist es! Du bist es noch!« wiederholte er mehrfach.
»Ich habe mich wohl sehr verändert, Papa? – In dem Alter, weißt Du! – Aber Du wirst mich schon wiederfinden, vielleicht mehr als Dir lieb sein wird.«
Nun aber kamen, von Dietert benachrichtigt, alle in den Saal zurückgeeilt, Herr und Frau Kämpf, Herrn Nippolds Neffe Robert und seine Frau Konstanze, die Hahns, alle die nächsten Freunde, das Brautpaar; man umgab den Heimgekehrten in froher Begrüßung. Fanny hob sich auf die Fußspitzen, bot ihm den Mund und nannte ihn Onkel und Du, als wäre er gestern fortgegangen.
»Das setzt dem ganzen Fest noch die Krone auf! Das ist zu herrlich!« jubelte sie. »Nicht wahr, Albert?«
»Jawohl,« sagte Albert gehorsam. »Jawohl,« klang ein dünnes Echo nach.
»Mein Sohn Viktor,« beeilte sich Frau Hahn vorzustellen. Herr Tschuschner warf einen prüfenden Blick auf den semmelblonden Menschen mit den zwinkernden Augen und schüttelte ihm kordial die Hand. »Der kommt nicht in Betracht,« dachte er beruhigt.
Noch saß man beim Abendbrot, als Trompetensignale die Jugend in den zum Tanzen umgewandelten Saal zurückriefen. Dietert eilte auf Melitta zu: »Darf ich bitten!«
»Wäre es Dir nicht lieber, jetzt nach Hause zu fahren, Papa?« fragte Melitta.
»Im Gegenteil, es gefällt mir hier sehr gut. Weshalb wolltest Du mich um das Vergnügen bringen, Euch tanzen zu sehen?«
»Wir werden uns die größte Mühe geben. Sie zufrieden zu stellen, Herr Tschuschner,« versicherte Dietert.
Der Vater suchte sich nun einen erhöhten Platz in einer Sofaecke aus und sah befriedigt in das bunte Gewühl. Da kamen sie; keine Frage, weitaus das schönste Paar; die verkörperte Anmut und Lebenslust, schwebten sie an ihm vorüber und ihnen folgte das Brautpaar; blond und zufrieden in der Sicherheit erhofften Glückes, tanzten sie dahin.
»Unsere lieben Kinder sehen doch vortrefflich miteinander aus, finden Sie nicht auch, mein lieber Herr Tschuschner?« flötete eine Dame, die an seiner Seite Platz genommen hatte, lang und schmal, mit scharfen Zügen und etwas gelblicher Farbe. Tschuschner besann sich. Frau Senator Dietert, natürlich.
»Jawohl, gnädige Frau, Ihr Herr Sohn tanzt vorzüglich.«
»Und die liebe Melitta! Sie ist doch eigentlich die Königin des Festes, obwohl man das freilich an einem Polterabend, an dem der Braut die erste Stelle zukommt, nicht sagen darf. Ja, um so ein Töchterchen kann man Sie beneiden.«
»Na, sie ist ja so ziemlich geraten.«
»Und die Pagode, die sie auf dem Kopfe hat, steht ihr bezaubernd. Ich habe ja leider nur die zwei großen Jungen. Der Älteste ist schon seit zwei Jahren bei Reese & Mann in Rio. Sie kennen die Firma jedenfalls, Herr Tschuschner?«
»Gewiß, gewiß, dem Namen nach wenigstens,« sagte Tschuschner, der ihn nie gehört hatte.
»Mein Ludwig ist der zweite. Es wurde mir schwer, zu ertragen, daß er nach Rangoon ging, aber es ist doch eine Auszeichnung, wie sie nicht vielen in seinem Alter zuteil wird. Und wer einmal bei Wechsler & Co. festen Fuß gefaßt hat, ist ein gemachter Mann, heißt es immer. Natürlich, er muß das Seine tun, das versteht sich, und das wird ja auch mein Ludwig, mit Gottes gnädiger Hilfe.«
Hier gelang es Tschuschner, nicht weit von sich einen alten Bekannten zu erblicken.
»Ja! Da ist ja auch der alte Hagenest!« rief er, »Donnerwetter, wie der sich hält! Sie entschuldigen, Frau Senator« – und fort war er.
Das Wiedersehen zwischen Tschuschner und seinem Schwager Nippold am nächsten Morgen war für beide Teile ergreifend. Es war Herrn Tschuschner beweglich, den Schwager, den er immer aufrecht und selbstbewußt gekannt hatte, nun kraftlos im Lehnstuhl zu sehen und das freundliche, behagliche Gesicht der Schwägerin von Sorge gefurcht und gealtert wiederzufinden.
»Ich bin ein gebrochener Mann, Moritz!« sagte Nippold und streckte ihm seine abgemagerte Hand entgegen.
»Sage das nicht, Franz! Ich habe manchen von weiter her zurückkommen sehen, als Du jetzt bist!«
Das alte brüderliche Verhältnis des ersten Jahres trat wieder zwischen ihnen ein. Tschuschner fuhr den Kranken im Rollstuhl durch den Garten, und es war rührend, wie er die Stimme dämpfte und ihm allerhand von der äußeren Welt zuzutragen und zu erzählen wußte.
Inzwischen gingen die Festlichkeiten der Hochzeit ihren Gang; es waren Gäste von auswärts gekommen, denen Hamburg gezeigt werden mußte, und die befreundeten und nun verschwägerten Familien versammelten abwechselnd den Freundeskreis bei sich. Tschuschner begleitete seine Tochter überall hin, und überall trafen sie Dietert, der bei diesen Gelegenheiten die Seele der Gesellschaft war. Sprudelnd von Lebendigkeit und Lebenslust, machte er aus seiner Bewunderung für Melitta kein Hehl, und daß er auch ihr gefiel, schien zweifellos. Sein Urlaub näherte sich dem Ende, und es war vorauszusehen, daß er nicht abreisen würde, ohne sein Heil bei Melitta versucht zu haben. Sie sah es kommen, so gut wie die anderen, aber so sicher sie sonst in ihren Entschlüssen war, so unsicher fühlte sie sich in diesem Fall.
»Er gefällt mir, ich mag ihn lieber, als die anderen,« sagte sie zu sich selbst, »aber es ist zu früh, es ist zu rasch, wenn er nur jetzt noch nicht käme!«
Aber er kam. Eines Morgens, als sie nicht weit von Hause in einer kleinen Laube saß, um einen Brief von Fanny zu lesen, die sich noch auf der Hochzeitsreise an der Riviera befand, öffnete sich die Gartenpforte, und Dietert trat ein in einem neuen Hut und lavendelfarbenen Handschuhen. Er sah Melitta und eilte auf sie zu.
»Sie haben sich ja heute wunderschön gemacht« – konnte sie sich nicht enthalten etwas malitiös zu sagen.
»Ich – ich wollte – zu Ihrem Herrn Vater,« stotterte der sonst so selbstbewußte Dietert verlegen.
»Papa ist oben,« sagte Melitta und wurde rot.
Nun fand Dietert seine Sicherheit wieder; er hielt die Hand, die sie ihm gereicht hatte, fest und fragte, ob er sie behalten dürfe, und dann strömte Lebensglück und einzige Hoffnung und was sonst in solchen Augenblicken gesagt wird, ihm in Fülle und in ehrlicher Bewegung über die Lippen. Melitta sah mehr beängstigt als beglückt aus.
»Es kommt mir zu schnell,« stammelte sie, »ich muß es mir überlegen. Sprechen Sie mit Papa – das wird das beste sein.« Sie suchte Zeit zu gewinnen, er aber, froh des errungenen Vorteils, eilte ins Haus und klopfte an Herrn Tschuschners Tür.
»Herein!« Tschuschner musterte den jungen Mann, seinen Hut und seine Handschuhe mit sarkastischen Blicken. »Das sind ja große Vorbereitungen, Herr Dietert! Was bringen Sie denn Gutes?«
»Ich bringe nichts, Herr Tschuschner«, sagte Dietert, dem plötzlich der Atem etwas schwer ging.
»Dann wollen Sie wohl etwas?« fragte Tschuschner unbarmherzig.
»Ihr Fräulein Tochter – ich traf sie – zufällig – in der Laube« –
»Beruhigen Sie sich erst ein wenig; streifen Sie die Dinger da ab, lieber Dietert, und dann wollen wir die Sache bei einer Zigarre freundschaftlich besprechen.«
Tschuschner öffnete seinen Schrank, wählte bedächtig eine Zigarre und setzte sie gelassen in Brand. »So,« sagte er, »nun wollen wir uns miteinander verständigen.«
Dietert hatte sich inzwischen gefaßt; er sah recht gut, daß ihm seine Verlegenheit eher genützt als geschadet hatte, und brachte nun sein Anliegen männlich und bescheiden vor.
»Ich habe das erwartet,« sagte Tschuschner. »Sie haben meine Tochter zuerst gesprochen. Wie steht sie zu der Sache?«
»Fräulein Melitta sagte, sie wollte es sich überlegen, und ich sollte vorerst mit Ihnen sprechen.«
»Außerordentlich korrekt. Das erleichtert mir die Sache ungemein. Also kurz und gut, ich habe an und für sich nichts dagegen. Sie gefallen mir, Sie gefallen – worauf es noch mehr ankommt – auch meiner Tochter. Sie sind aus gutem Hause; das ist erfreulich, wenn auch nicht unbedingt notwendig. Sie haben für Ihre Jahre eine gute Stellung in einer guten Firma. Das ist für den Augenblick genügend. Ich habe, wie gesagt, prinzipiell nichts dagegen. Aber meine Tochter ist erst siebzehn Jahre alt; das ist mir zu jung zum Heiraten, und lange Verlobungen sind mir ein Greuel. Also für den Augenblick kann noch von nichts die Rede sein. Dazu kommt, daß ich eine Bedingung an meinen Schwiegersohn stelle, die Sie wohl billig finden werden. Meiner Ansicht nach muß der Mann so viel haben, daß er die Frau erhalten kann; nachher kann die Frau dazu bringen, soviel sie mag, je mehr, je besser. Das verlange ich also auch von Ihnen. Sehen Sie zu, daß Sie eine auskömmliche Stellung bekommen, dann kommen Sie wieder. Ist auch Melitta dann desselben Sinnes, dann sollen Sie sie haben.«
Dietert konnte seinen Schrecken nicht verbergen. »Sie haben gewiß alles Recht, Ihre Bedingungen zu stellen, Herr Tschuschner – aber in meinem Falle – bedenken Sie, ich muß fort.«
»Das ist mir gerade sehr angenehm. Solch ein Hin- und Herziehen ist nichts für die Dauer. Ich hätte sonst mit meiner Tochter fortgehen müssen, und das wäre mir wegen der Verhältnisse hier im Hause sehr schwer geworden.«
»Sie werden uns doch wenigstens gestatten, zu korrespondieren?«
»Schreiben Sie an mich, soviel Sie wollen, lieber Dietert,« sagte Tschuschner artig, »auch an die Tante unten, wenn Sie das erleichtern kann, an meine Tochter aber schreiben Sie nicht. Meine Tochter soll frei sein, ganz frei.«
»Das ist hart, Herr Tschuschner. Sie kennen doch die Verhältnisse. Ich kann nichts tun, um mich vorwärts zu bringen; ich muß warten, bis ich befördert werde; währenddessen können andere kommen und mich aus dem Felde schlagen.«
»Ich denke, darüber können Sie ruhig sein. Meine Tochter ist in ihren Neigungen beständig. – Sehen Sie, junger Mann, ich habe das Leben mit Nichts angefangen und bin jetzt, selbst für Hamburger Verhältnisse, ein wohlarrangierter Mann. Ich will nicht, daß es von meinem Schwiegersohne heißt, wie von den Männern im Stedinger Land, die die Goldfischchen dort angeln: »Die Fru hat ihn tom Manne makt.« Wer steht mir dafür, daß solch einem Glücksfischer nicht mein Geld in den Kopf steigt, und er es in dem Zehntel der Zeit wieder los wird, die ich gebraucht habe, um es zusammenzubringen? – Darum will ich für meine Tochter einen Mann, der seine Lehrzeit hinter sich hat; es gewährt auch das keine Sicherheit, ich weiß es wohl, aber eine gewisse Gewähr liegt doch darin. Was sonst an Charakter, Geist und Tüchtigkeit nötig ist, das ist Voraussetzung – ich denke, darin wird meine Tochter nicht fehlgreifen.«
»Aber, Herr Tschuschner, gesetzt auch, ich käme in den nächsten Jahren so weit, so bekomme ich vor vier Jahren keinen neuen Urlaub.«
»Darüber seien Sie ruhig. Wenn es so weit ist und Sie sind beide noch desselben Sinnes, so bringe ich Ihnen Melitta; darauf können Sie sich verlassen. – So, und nun überlegen Sie sich das. Guten Morgen.«
Dietert ging. Melitta saß noch in der Laube, und sie sprachen eine Weile miteinander, als Tschuschner zu ihnen trat.
»Was machen Sie denn hier?« fragte er.
»Ich teilte Fräulein Melitta Ihre Antwort mit.«
»Das kann ich selbst am besten,« sagte Tschuschner ganz freundlich.
Dietert küßte Melitta die Hand und schlug etwas zögernd in Herrn Tschuschners dargebotene Rechte.
»Mut, junger Mann! Noch ist Polen nicht verloren,« sagte Tschuschner und entließ ihn mit einem freundschaftlichen Schlag auf die Schulter. Dann zog er Melittas Hand durch seinen Arm und führte sie in den Garten. »Nun sind wir wohl böse auf den alten Papa?« fragte er und sah sie prüfend an.
»O nein, Papa! Es ist mir ganz recht –«
Tschuschner sprach nun eingehend mit der Tochter, und als das Resultat dann Nippolds mitgeteilt wurde, hielten beide mit ihrem Beifall nicht zurück.
»Sehr verständig, sehr verständig! Ich hätte Moritz diese Lösung kaum zugetraut,« sagte Nippold später zu seiner Frau.
Weniger erbaut war man bei Dieterts, als der Sohn mit finsterem Gesicht nach Hause kam und seinen neuen Hut rücksichtslos auf den Tisch schleuderte.
»Um Gotteswillen! Du hast doch keinen Korb bekommen?« rief die Mutter.
Dietert erzählte, wie es ihm ergangen war, und nachdem man die Sache reiflich besprochen hatte, kam man zu dem Trost, daß sie nicht gar so schlimm stünde. »Nur behutsam muß man sein,« hieß es. »Wir müssen verlauten lassen, daß Du die Einwilligung von Vater und Tochter hast und nur Melittas große Jugend das Hindernis ist. Ist das erst bekannt, so ist es fast besser als eine Verlobung, die sie jetzt nicht würden anzeigen wollen. Nun, der Herr, dem wir auch dieses anheim stellen wollen, mag das Beste geben. Es ist weitaus die beste Partie, die Du machen könntest, da können wir es uns schon etwas sauer werden lassen. Und ich werde schon mein Auge auf Melitta haben, während Du fort bist.«
Sehr unglücklich über diesen Ausgang der Sache war auch Fanny, als sie und Albert zurückkehrten, um sich zur Abfahrt nach Singapore zu rüsten.
»Ich dachte so bestimmt, daß Du gleich nachkommen würdest,« klagte Fanny, »und nun dauert es noch wer weiß wie lange.«
»Mir ist es so ganz recht; ich war noch gar nicht so weit,« erwiderte Melitta.
»Ach, Unsinn! Das hätte sich schnell genug gefunden!« sagte die junge Frau von der Höhe ihrer Erfahrungen herab. »Drücke nur den Korb da nicht zusammen! Gib ihn her, er kann mit in den Kleiderkoffer.«
»Was ist denn so Kostbares darin?« fragte Melitta.
»Nun, James und Leokadie«, erwiderte Fanny.
» Die nimmst Du mit?!«
»Natürlich! Wenn ich sie zurücklasse, schenkt sie Mama doch nur armen Kindern zu Weihnachten. Für die sind neue Puppen gut genug; dazu ist mir mein James denn doch zu lieb.«
Die arme Melitta empfand die Leere nach Fannys und Dieterts Fortgang bitter und ihre Tante und ihr Vater mit ihr. Er suchte sie in dieser Zeit durch Reisen zu zerstreuen; sie gingen bald nach England, bald nach Frankreich, blieben aber, des Onkels und der Tante wegen, selten länger als drei Wochen fort.
Als Melitta eines Tages nach der Rückkehr von einem solchen Ausflug durch den Garten ging, trat Frau Werningen in großer Erregung auf sie zu.
»Ach, Fräulein Melitta!« rief sie, »ich habe etwas getan! Ach, wenn nur mein Mann das nicht erfährt! Nicht wahr, Sie sagen es nicht?«
»Nein, nein, Frau Werningen! Beruhigen Sie sich doch!«
»Ach, Fräulein Melitta, mein Volckardt –«
»Haben Sie schlechte Nachricht von Volckardt?« fragte Melitta erschrocken.
»Nein, Fräulein, schlimm ist es gerade nicht. – Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es herausbringen soll – erinnern sich Fräulein Melitta wohl noch an den Tag, wo Herr Dietert Abschied nahm?«
»Ja,« sagte Melitta errötend.
»Ja, sehen Sie,« fuhr Frau Werningen fort, »gerade an dem Tage saß ich oben in Volckardts Stübchen und wollte ihm antworten, denn er hatte geschrieben, er wolle fort, und wenn ich den Brief gleich abschickte, erreichte er ihn noch. Und da sah ich Herrn Dietert kommen, und er sah so fein aus, da dachte ich es mir gleich, und er ging hinauf zu Herrn Tschuschner und dann ging er wieder in die Laube und dann kam Herr Tschuschner, und er küßte Fräulein Melitta so die Hand und Herr Tschuschner klopfte ihm noch auf die Schulter. Da dachte ich, nun ist es in Ordnung und schrieb es gleich an Volckardt. Aber weil ich nachher gar nichts hörte, fragte ich Gustav, und der sagte, es wäre jetzt noch nichts, Fräulein Melitta wäre noch zu jung.«
Melitta konnte sich eines unbehaglichen Gefühls nicht erwehren, sagte aber so freundlich sie konnte: »Das ist doch nicht so schlimm, Sie können ja an Volckardt schreiben und es berichtigen.«
»Das ist es ja eben! Wir wissen jetzt gar nicht, wo er ist. Und wenn mein Mann das erfährt, der schon immer sagt, ich soll nicht blasen, was mich nicht brennt –«
»Aber das braucht er ja auch nicht zu erfahren,« sagte Melitta.
»Ja, da ist doch aber das Päckchen!«
»Was denn für ein Päckchen?«
»Ja, ein Päckchen von Volckardt. Er muß es einem Bekannten oder einem Schiff mitgegeben haben, denn es kam mit der Hamburger Post, wie ein gewöhnlicher Doppelbrief. Hier ist es« – und Frau Werningen zog aus ihrer Tasche ein dünnes Kästchen, in dem auf weichem Leder ein schmaler offener Goldreif lag. »Er schreibt,« sagte Frau Werningen, »er hätte es selbst aus dem ersten Golde, das er gefunden hätte, gehämmert, und er bäte Fräulein Melitta, es zum Andenken anzunehmen, mit seinen besten Wünschen für sie und seinen alten Kameraden.«
In Melittas Gesicht stieg eine warme Welle; sie streifte den goldenen Reif über die Hand und drückte ihn um ihren Arm zusammen.
»Solange ich lebe, will ich ihn tragen,« sagte sie bewegt.
»Wenn nun aber jemand danach fragt?«
»Wer soll danach fragen? Papa kümmert sich nicht um solche Dinge, und wenn Tante Lydia fragen sollte, so erkläre ich ihr, wie ich zu dem Armband kam, und sie wird nichts sagen.«
»Tausend Dank! Ich dachte gleich, daß Fräulein Melittchen mir helfen würde!« Erleichtert ging Frau Werningen davon.
Melitta betrachtete den Armreif mit Rührung. ›Das ist ein treues Herz,‹ dachte sie. Er hatte sich schwer durchschlagen müssen und war wohl mehr als einmal in Not gewesen, aber dieses erste Gold hatte er nicht angerührt, das war ihr Eigentum gewesen von Anfang an, und in seinen freien Stunden nach der Tagesarbeit hatte er es gehämmert zu einem einfachen kleinen Schmuckstück für sie. Oft hatte sie an ihn gedacht und über den kleinen Roman, der zwischen ihnen gespielt hatte, als über eine kindische Torheit gelächelt, ihm aber war es Ernst geblieben.
In ihrer Annahme, ihr Vater werde den Reif nicht bemerken, hatte sie sich indessen getäuscht. Der scharfe Blick des alten Goldgräbers entdeckte ihn auf der Stelle.
»Laß einmal sehen,« sagte er, ihren Arm an sich ziehend, »das ist ja ein specimen! – Gold. – Rein. › So pliable from the pure gold! – the lovely arm its only mould‹, sagt Byron irgendwo. Woher hast Du ihn?«
Melitta erzählte. Tschuschner betrachtete den Ring nachdenklich. »Überaus sorgfältig und gut gehämmert. Schade um den Menschen. Damals, als die beiden Jungen hier waren, er und Dietert, weißt Du noch? – gefiel er mir gut, obgleich er fast nichts sagte.«
Die Zeit verging. Andere Bewerber zeigten sich nicht; denn dafür, daß das Goldhändchen allgemein für versagt galt, sorgte Frau Senator Dietert. Sie wurde auch nicht müde, Melitta Aufmerksamkeiten zu erweisen, und erbot sich unablässig, sie in Konzerte, Ausstellungen und dergl. zu führen, so oft auch die Antwort lautete, daß Herr Tschuschner seine Tochter selbst zu begleiten gedächte.
›Meine liebe, meine liebe, liebe Melitta,‹ hieß es, so oft sie sich trafen, immer mit dem Zusatz: ›Ich darf doch das Fräulein weglassen – stehen wir uns doch innerlich so nah!‹ Wenn es sich irgend tun ließ, sah sie Melitta so lange und tief in die Augen, daß diese nicht wußte, wo sie mit den ihren bleiben sollte. Melitta war eine zurückhaltende Natur; schon Fanny pflegte ihr vorzuwerfen: ›Wenn man Dich küssen will, machst Du dich steif,‹ und dieses Gefühl des Steifmachens überkam sie jedesmal der Senatorin Dietert gegenüber. Es war ihr unbehaglich, wenn die Dame ihr zuflüsterte: ›Ich habe wieder Nachricht von meinem süßen Ludwig!‹ und ihr Stellen aus seinen Briefen vortrug. Sie hätte sie lieber selbst gelesen und auf die Zwischenbemerkungen der Mutter verzichtet.
›Die Schwiegermama ist keine angenehme Zugabe,‹ dachte Tschuschner, und er sowohl wie Melitta hofften, die Überschwenglichkeit der Mutter würde sich geben, wenn sie die erwünschte Schwiegertochter erst wirklich sicher hätte.
Der Tod des Onkels Nippold gestaltete das Leben im Hause noch trüber; Tante Lydia schien sich nur aufrecht erhalten zu haben, solange der Kranke ihrer bedurfte; jetzt versagten ihr wie mit einem Schlage die Kräfte, und sie verließ nur selten ihre Zimmer. So kam Melittas neunzehnter Geburtstag heran.
Am Tage vorher klopfte ihr Vater an ihre Tür und reichte ihr einen Brief. »So,« sagte er, »die Sache ist ja nun von seiner Seite in Ordnung. Es ist schnell gegangen; die Firma wird wohl gewußt haben, worum es sich handelte. Gleichviel, er hat es erreicht, und ich bin der letzte, ihm einen Vorwurf daraus zu machen, daß er alle Minen springen ließ. – Ich bin in meinem Zimmer, wenn Du mich sprechen willst.«
Mit klopfendem Herzen und geröteten Wangen las Melitta den ersehnten Brief. Zum Überlegen hatte sie Zeit genug gehabt; die Lücke, die damals durch Dieterts Fortgehen in ihrem Leben entstanden war, hatte kein anderer ausgefüllt, und das Bild des begabten hübschen Mannes war nicht aus ihrer Phantasie verdrängt worden. Die Besprechung zwischen ihr und dem Vater war kurz.
»Wenn wir gleich schreiben, gehen die Briefe noch mit dem morgenden Dampfer. – Ich werde ihm sagen, daß ich mein Wort halten und dich ihm bringen würde. Es paßt mir sehr gut. Sobald ihr getraut seid, gehe ich weiter nach Shanghai und hinauf zu Mac Hallan. Ich übergebe ihm selbst meinen Anteil des nötigen Kapitals zu seiner elektrischen Bahn und helfe ihm bei der ersten Anlage. Mir wird es auch gut tun, wieder einmal in einer praktischen Arbeit zu stehen. – Gleich morgen früh will ich mit Tante Lydia sprechen.«
»Ach nein, Papa! Nur nicht morgen! Da ist mein Geburtstag, da kann ich ihr das nicht antun! Es ist schon so schlimm, daß sie mich hergeben muß.«
Die Briefe wurden geschrieben. Tschuschner brachte sie selbst zur Post.
Am nächsten Morgen erwachte Melitta mit der Empfindung, eine große Schicksalswendung erlebt zu haben, zu dem Bewußtsein, Braut zu sein. Langsam in einem traumartigen seligen Gefühl ging sie durch den taufrischen Garten, die ferne künftige Heimat in Gedanken. Wie alljährlich nahm sie Werningens Strauß und Glückwunsch entgegen. Der Geburtstagstisch erwartete sie im Zimmer ihrer Tante, und als es Zeit war, kehrte sie ins Haus zurück. Die Jungfer kam ihr mit ängstlichem Gesicht entgegen, die gnädige Frau hätte noch nicht nach dem heißen Wasser geklingelt, und es wäre so still. Melitta ging in das Schlafzimmer. Die Sonne schien durch die roten Vorhänge und füllte es mit warmem Licht, und dort, auf dem breiten Bette ruhte friedlich Tante Lydia, den Kopf mit dem feinen Nachthäubchen ein wenig nach der Seite geneigt, wo sonst ihr Mann zu ruhen pflegte. Aber so tief, so vollkommen wie dieser war, ist kein irdischer Schlaf.
Melitta hatte die Hände auf dem Bettrand gefaltet, und Träne auf Träne rann über ihre Wangen. Tschuschner, den die erschreckte Jungfer sogleich gerufen hatte, war tief ergriffen; der alte Gustav stand in der Tür mit gefalteten Händen.
»Gönne es ihr,« sagte der Vater, »gönne es ihr!«
»Ach, Papa,« schluchzte Melitta, »ich weine ja vor Freude und vor Dank!« –
Alle Schwierigkeiten waren nun gelöst, und die Abreise nach Indien sollte so bald als möglich erfolgen. Unter diesen Umständen wurde die Verlobung nicht angezeigt, sondern nur im Freundeskreise mitgeteilt, und mit Triumph tat Frau Senator Dietert das Ihrige, sie nach Möglichkeit zu verbreiten.
Die letzte Zeit im alten Hause wurde Melitta so schwer gemacht, daß sie sich nach dem Abschluß sehnte. Robert Nippold hatte als Chef der Firma und Haupterbe sofort alles in die Hand genommen, und es verging kaum ein Tag, an dem nicht Konstanze erschien und ihre Befehle gab, ohne im geringsten auf Herrn Tschuschner oder Melitta Rücksicht zu nehmen. Eine von Konstanzens ersten Äußerungen nach dem Tode der Tante war bezeichnenderweise gewesen: »Es versteht sich von selbst, Melitta, daß Ihr bis zu Eurer Abreise ruhig hier bleibt. Es wird ohnehin mit unserer Übersiedelung vor nächstem Herbste nichts werden, denn es wird monatelanger Überlegung und Arbeit bedürfen, bis man Haus und Garten einigermaßen habitabel machen kann. Ich fände es verständiger, ganz neu zu bauen, aber Robert, mit seiner Sentimentalität, will ja durchaus nicht.«
Der neue Hafen war noch nicht fertig, und so fuhren Tschuschner und Melitta auf dem Dampfer, der sie hinausbrachte, an dem Platze vorüber, der so lange ihre Heimat gewesen war. Melitta sah das steile, altertümliche Dach zwischen den Bäumen, weiterhin die Spitze des Pavillons, der einst ihr geheimes Fleck gewesen war; jeden Laubengang, jede Baumgruppe suchte sie mit dem Auge. Am Stege unten stand ein dunkles Häufchen: der alte Gustav, Werningens beide, die Dienerschaft war dort vereint und winkte dem Kinde des Hauses den letzten Gruß zu, und Melitta breitete die Arme aus – sie sahen es alle.
Die stille Übergangszeit der Fahrt war eine Wohltat nach der Unruhe der letzten Wochen. Verlobung, Begräbnis, Beileidsbesuche, Trauerkleider, Glückwünsche, Aussteuer und Hochzeitsgeschenke hatten sich in aufreibendem Wirbel abgelöst. Jetzt endlich konnte Melitta zur Ruhe kommen. Sie war sehr ernst und zurückhaltend, während Tschuschner leicht Bekanntschaft machte und sich an Bord eines jeden Fahrzeuges sofort heimisch fühlte. In Malta kaufte er seiner Tochter Spitzen, und Teppiche in Suez. Das Rote Meer zeigte sich ihnen gegenüber besser als sein Ruf, und dann stürmte der Dampfer durch die endlose Bläue des Indischen Ozeans seinem Ziele entgegen. Eines Morgens stand die ganze Schiffsgesellschaft an der Reeling, um die erste Küstenlinie in leichtem Umriß aus den Wellen steigen zu sehen, das steil abfallende Kap von Atchinhead. Dann glitt man zwischen den grünen Ufern der Straße von Malacca entlang, und eines Nachmittags sichtete man Singapore.
Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Wundervolle Märchenwelt,
Steig auf in der alten Pracht!
Tieck.
Und so war denn Indien, das Land der Wunder und der Verheißung, das neue Heimatland, glücklich erreicht.
Melitta ließ den Blick über die Palmenufer zur Rechten, über die felsigen Inseln zur Linken schweifen; drüben lag die Stadt am Fuße ihrer grünen Hügel, und in der Bai, die der Dampfer langsamer durchschnitt, wiegte sich eine Unzahl von Schiffen, die löschten oder ladeten. Schwarze, braune und gelbe Mannschaft hantierte auf ihnen, und kleine Sampans schossen zwischen ihnen hin und her. Nun lag das Schiff an der Pier, und eine bunte Menge ergoß sich auf das Deck; Bewillkommnen, Fragen, Suchen überall. Dazwischen drängten sich Chinesen, Malayen und Inder und boten ihre Dienste an. » Me Sneider! me very good Sneider!« rief es von einer Seite. » Lookee, Mama!« von der anderen, und ein Händler begann zu Melittas Füßen zwischen Drängen und Stoßen seinen Pack aufzumachen. »Melitta! Melitta! Da bist Du ja! – Na, endlich, endlich!«
Es war Fanny, etwas schmäler, etwas weniger rosig, aber sonst ganz die alte. Da war auch Albert; Händeschütteln, die üblichen Fragen, und bald saßen sie alle vier in einem eleganten Wagen und fuhren die Esplanade entlang. Dann bog der Weg ab, und es ging durch die Stadt. Weich und warm war die Luft. Ein Sprengwagen zwang sie, einen Augenblick zu halten, und Melitta fing mit geübten Augen ein reizvolles Bild auf: hinter der Wassertonne, die Vorrichtung regulierend, schritt eine Idealfigur, schlank, ebenmäßig, wie in Bronze gegossen, nackt bis auf den aufgerollten Sarong, mit reinem ägyptischem Profil; der Eindruck wurde noch verstärkt durch einen viereckig auf den Kopf gelegten Sack, der hinten geradlinig über den Nacken fiel.
Fanny lachte. »Ja,« rief sie, »gerade so ging es mir anfangs auch! Ich starrte jeden braunen Kerl an; während ich jetzt kaum noch sehe, von welcher Farbe die Leute sind.«
»Den würde ich immer und überall bemerkt haben,« meinte Melitta.
»An dem ist doch nichts Besonderes,« sagte Fanny und streifte den Mann mit gleichgültigem Blick.
Wundervoll waren die Bäume an den Straßen, mit glattem, grauem Stamm, hellgefiederten Blättern und flammend roten Blumen.
» The flame of the forest,« »Die Flamme des Waldes. erklärte Fanny.
Nun ging es in die Villenstadt. Hohe Bambushecken umgaben herrliche Gärten, in denen Bungalows standen, hölzerne Wohnhäuser, die mit ihren vorspringenden Dächern und Galerien an Schweizer Bauart erinnern. Auf einem sorgsam gepflegten Rasenplatz lag ein Kinderspielzeug. Der Wagen hielt.
»Hier sind wir!« Fanny eilte mit dem Rufe: »Ayah! Ayah!« dem Hause zu. Aus dem Schatten eines Gebüsches trat eine braune Malaiin, weiß angetan, in der Nase eine goldene Rosette, grüne Steine in der Ohrmuschel, ein dickes blondes Baby im Arm. »Das ist Bertie!« sagte Fanny und stellte mit mütterlichem Stolz den Sohn und Erben vor. Der Kleine wendete sich ab.
»Das ist ja Tante Melitta, Du Dummerchen!«
»Laß nur, wir lernen uns schon noch kennen,« rief Melitta. »Es fehlt ihm doch nichts? Er sieht etwas bläßlich aus.«
»Bewahre! die europäischen Kinder haben hier alle keine Farbe, die einheimischen haben zu viel davon,« lachte Fanny.
»Ich finde die braunen Leute schön,« meinte Melitta.
»Warte nur, bis Du ein Jahr im Lande bist, dann ist der Charme vorüber!«
Das Hahnsche Wohnhaus stand, wie alle Bungalows, auf Pfählen, und eine Holztreppe führte von außen auf die Veranda, durch die man den Mittelraum des Hauses, den Salon, betrat. Von dort öffneten sich die Türen in die verschiedenen Zimmer. Sie waren alle offen, aber japanische Schirme wehrten den Einblick.
Fanny geleitete ihre Gäste in die beiden für sie bestimmten Gemächer, von dem jedes ein Bett von sechs Fuß im Geviert enthielt, das mit dem üblichen Moskitonetz bezogen war. »Wie herrlich, so viel Raum zu haben, nach der Enge der Kabine!« rief Melitta.
»Ihr habt Euren eigenen Ausgang.« Fanny öffnete die Tür auf eine Treppe, die in den Garten führte. »Auf der anderen Seite liegt das Badezimmer.«
Hier war der Boden durchlöchert; in der Ecke stand ein riesiges Tongefäß, das bis an den Rand mit Wasser gefüllt war, und daneben hing eine kupferne Kalebasse, die dazu diente sich zu übergießen. In dieser Form nimmt man in Indien das Morgenbad oder erfrischt sich nach der Hitze des Tages.
»Und nun, darf ich bitten?« sagte Fanny.
Albert reichte Melitta den Arm, Tschuschner folgte ihnen mit Fanny. Der Eßtisch war mit einem Muster aus flachen, rötlichen Blättern zierlich ausgelegt; der chinesische Butler stand, ganz in Weiß gekleidet, mit dem Zeichen seiner Würde, der himmelblauen Knieschleife, am Seitentisch; der aufwartende schwarze Diener ging, ebenfalls blütenweiß gekleidet, mit einem mächtigen Turban, auf nackten Sohlen lautlos hin und her. Fanny strahlte vor Freude, den Freunden ihr behagliches, wohleingerichtetes Hauswesen zeigen zu können.
Nach Tisch begab man sich wieder auf die Veranda. Die Herren setzten sich mit Zeitung und Zigarre an den niedrigen Mitteltisch, Fanny legte sich auf einen der langen Bambusstühle, Melitta lehnte an einem der Pfosten und sah in die Nacht hinaus. Der junge Mond goß sein mildes Licht über den stillen Garten; in der Ferne glänzte die Bucht in zahlreichen Lichtern, ein kühles Lüftchen wehte vom Meer herüber. Aus dem Garten erklang das scharfe Zirpen der Grille, und aus weiter Ferne vernahm man den tiefen Ton der Bullfrösche. Leise schlug daneben das trockene Rauschen der Palmen an Melittas Ohr.
»So,« sagt Fanny behaglich, »und nun hört meinen Plan. Ihr seid jetzt bei mir, und ich sehe nicht ein, weshalb ich Euch eher hergeben soll, als unbedingt nötig ist. Ich halte es daher für das einzig Vernünftige, daß die Hochzeit hier gefeiert wird. Ihr reist dann von hier ab, wie andere Neuvermählte auch.«
»Ich habe auch schon daran gedacht,« erwiderte Melitta, »aber Dietert kann jetzt nicht abkommen.«
»Ach, Unsinn, warum soll er nicht kommen können. Du sollst sehen, wie schnell er da ist, wenn Du ihm sagst, die Hochzeit wäre hier. Nicht wahr, Onkel?«
»Ich täte es gerne, Fanny, schon um Dir zu gehorchen,« erwiderte Tschuschner, »aber ich habe Dietert versprochen, ihm Melitta zu bringen, und muß mein Wort halten.«
»Du hast sie ihm bis hierher gebracht, damit kann er zufrieden sein. Meinst Du nicht auch, Albert?«
»Ich meine, Fanny, Du solltest anderen Menschen ab und zu ihren Willen lassen, wenigstens in ihren eigenen Angelegenheiten. Dietert hat, sollte ich meinen, lange genug gewartet.«
So schnell ließ Fanny indessen ihren Plan nicht fahren und kam immer von neuem, wenn auch erfolglos, auf ihn zurück. Melitta mußte die Kiste aufschließen, in der ihr Brautauzug bis auf die kleinste Kleinigkeit fix und fertig lag, und Fanny war den Tränen nahe, daß diese Herrlichkeit nicht zur Geltung kommen sollte.
»Dort sieht es ja niemand!« klagte sie.
»Dietert sieht es doch,« meinte Melitta lächelnd.
»Ach, Dietert!« rief Fanny geringschätzig. »Der ist ja doch nur ein Mann! Was versteht er davon! Der sieht höchstens etwas Weißes und sonst doch nur Dich, und ob Du ein gewöhnliches Kleid anhast oder dieses, ist ihm völlig gleichgültig.«
Als die beiden Freundinnen am nächsten Morgen durch die weiten Anlagen auf der Höhe des Berges fuhren, und Melitta die entzückten Blicke über das Blau der See und über die üppige Landschaft gleiten ließ und dann wieder den kleinen Affen nachsah, die sich von einem Baumwipfel zum anderen schwangen, wies Fanny auf einige kleine Bungalows, die zwischen dichtem Gebüsch hervorsahen.
»Siehst Du, hier verleben bei uns die jungen Paare ihre Flitterwochen. Die Einrichtung ist entzückend und die Bedienung vorzüglich. Das könntet Ihr auch haben, wenn Du verständig wärest und hier Hochzeit machtest.«
Gegen Abend, nachdem die Hitze des Tages verplaudert, verträumt und verlesen war, fuhr man bis zur einbrechenden Dunkelheit in den botanischen Garten, wo sich die schöne Welt zusammenfindet, und wo Fanny eine Menge Bekannte traf, Herren in Weiß und Damen in so eleganten Toiletten, daß sie trotz der Hitze sogar die Federboas trugen, die in Europa eben Mode geworden waren. Melitta konnte sich währenddessen an den wundervollen Pflanzen nicht satt sehen und wünschte sich nur Dietert herbei, um ihr Entzücken zu teilen.
»Habt Ihr denn auch den Orang-Utan gesehen?« fragte Albert, als sie sich zur Tafel setzten.
»Einen Orang-Utan? Ist einer da? Und das sagst Du erst jetzt?« rief Fanny.
»Ja, es soll einer da sein; es wurde im Klub erzählt.«
»O, dann müssen wir nochmals hin, ich habe noch nie einen gesehen,« rief Melitta lebhaft.
»Ich auch nicht,« sagte Albert, »und da die Post heute erledigt ist, kann ich Euch morgen begleiten. – Fanny muß ohnehin jeden Tag in den botanischen Garten; sie interessiert sich so sehr für die Blumen, die auf den Hüten der Damen wachsen.«
Der Orang-Utan wurde denn auch am nächsten Tage aufgesucht, und Melitta und Fanny betrachteten das furchtbare Gebiß und die gewaltigen Arme des mächtigen Tieres mit Grauen.
»Und dabei soll er gutartig sein,« sagte Tschuschner, »und den Menschen nicht anfallen.«
»Ich möchte doch nicht, daß er hier ausbräche,« meinte Albert.
»Haben Sie nun den Herrn Vetter genug bewundert, so könnten wir weiter zu den Orchideen gehen,« fuhr er fort.
»Und davon soll man nun abstammen! Das kann mir wirklich niemand zumuten!« sagte Fanny, die noch in den Orang-Utan vertieft war.
»Sieh doch nur den Hut!« flüsterte ihr Melitta zu. Fanny sah auf und begann lebhaft zu winken und zu nicken. »Das ist Miß Miller, die Amerikanerin, von der ich Dir schrieb. Sie läßt sich alle ihre Sachen aus Paris kommen und gilt für sehr » chic«; sie macht hier die Mode, sozusagen.«
Miß Miller, eine ältere junge Dame, eilte auf Fanny zu.
» My dear Mrs. Hahn! Sieht man Sie endlich einmal wieder! Ich glaube, ich habe Sie zwei Tage nicht gesehen, es können sogar drei sein!«
»Ich habe lieben Besuch, die Freundin, von der ich Ihnen erzählte. Miß Tschuschner.«
»O gewiß, ich weiß! Es ist mir sehr angenehm, Miß Tusch –«, sagte Miß Miller und blieb hilflos stecken.
»Tschuschner,« half ihr Melitta ein.
»Jawohl, freilich, Miß Zusch – Zuscher –«
»Geben Sie sich keine Mühe, Miß Miller, es lohnt sich nicht mehr! Sie werden meine Freundin häufig genug in Rangoon als Mrs. Dietert wiedersehen und dann ihren Namen leicht aussprechen können.«
»Sie sind ein sehr glückliches Mädchen,« erwiderte Miß Miller, »Mr. Dietert hat hier eine Unzahl Herzen gebrochen. Das kann ich Ihnen versichern.«
»Hoffentlich ist Ihres nicht darunter,« scherzte Fanny.
»O nein! Das war schon unter sicherem Verschluß!«
»Leben Sie in Rangoon?« fragte Melitta, unangenehm berührt.
»Ab und zu. Ich bin öfter zum Besuch bei meiner Freundin Miß Bell und ihrer Schwester, Baroneß Kamp. Sie wissen, Baron Kamp ist der Chef der Firma und deutscher Konsul in Rangoon. Sie sehen, wir verkehren in demselben kleinen Kreis« – In diesem Augenblicke fuhren Melitta und Fanny mit entsetztem Schrei zurück und gleichzeitig riß Tschuschner Miß Miller an sich. Sie hatte sich unüberlegt auf die Stange gestützt, die das Publikum von dem Käfig des Orang-Utans trennt, und der furchtbare Affe hatte unbemerkt seinen Arm durch die Stäbe gezwängt und mit seiner haarigen Pfote blitzschnell nach ihr gefaßt. Durch Tschuschners schnellen Griff war sie noch eben aus der unmittelbarsten Gefahr gerettet worden, und nur das leichte Gebilde aus abschattiertem lila Mohn blieb zusammengeballt in der Faust des Ungetüms zurück. Albert war kreidebleich geworden, Melitta und Fanny zitterten vor Schreck. »Mein Hut! Mein neuer Hut!« schrie Miß Miller. »O, das abscheuliche Tier!«
»Danken Sie Gott, daß es so abgelaufen ist, Miß Miller,« sagte Albert. »Eine Sekunde noch, und er hätte Ihre Flechten gefaßt und Ihnen Haut und Haar vom Kopfe gerissen.«
Miß Miller schien jedoch unfähig, den Ernst des Vorganges zu begreifen. »Warte, du schändliches Geschöpf,« rief sie und drohte dem Affen mit ihrem Spazierstöckchen. Der Orang-Utan stieß ein zorniges Gebrüll aus und rüttelte die Stäbe, daß der ganze Käfig klirrte.
»Komm, Fanny,« sagte Albert, »kommen Sie, Melitta.« Er nahm den Arm seiner Frau und eilte mit den beiden davon. Tschuschner ergriff ohne Umstände das Handgelenk der nun doch erschrockenen Dame und zog sie ebenfalls mit sich fort.
»Wie konnte sie nur so kindisch und albern sein?« sagte Melitta aufatmend, als sie glücklich wieder im Wagen saßen.
»Das machte der neue Hut,« meinte Fanny. »Sie ist sonst nett und verständig, aber wenn sie einen neuen Hut hat, kann sie keinen anderen Gedanken fassen.«
Am nächsten Morgen kam das Boot von Java an, das Singapore aus diesem Paradies der Früchte versorgt, und der Butler erschien, als die Familie beim Tiffin (Frühstück) saß, und fragte Fanny, ob das genügen würde; dabei hielt er ihr einen flachen Korb mit den verschiedensten Früchten hin. »Was ist denn das für eine Bescherung?« fragte Albert. »Erwartest Du Gäste?«
»Nein,« erwiderte Fanny, »ich habe ihm nur aufgetragen, das beste und das verschiedenste Obst zu bringen, das er bekommen kann, damit Melitta einmal sieht, was es hier alles gibt.«
»Da scheint er auch einen alten Käse mit eingehandelt zu haben,« bemerkte Melitta.
»Wie kann der Kerl sich unterstehen, die Durian mit in das Zimmer zu bringen!« rief Albert und wandte sich auf Hindostanisch scheltend an den Boy, der den Korb fortstellte und eilig mit einer großen, stachligen Frucht hinauslief.
»Ja, diese Mangos sehen gut aus,« sagte Fanny, »und er hat auch ein paar Stränge Mangosteen mitgebracht, aber lange nicht genug.«
»Nein,« sagte Albert, »genug bekommt man von denen überhaupt nicht; wenn man die Zeit hätte, könnte man den ganzen Tag sitzen und sie trinken; es ist ja nichts daran, als etwas weinartiger Saft.«
»Nachher baden wir den Jungen, und dann wollen wir uns eine Güte tun,« sagte Fanny zu Melitta.
»Nur eßt, bitte, die Durian nicht im Schlafzimmer,« mahnte Albert.
»O, bis Du wiederkommst, ist der Geruch längst verflogen,« versetzte Fanny gelassen.
Als sie dann beide den Kleinen badeten, steckte Albert noch einmal den Kopf ins Zimmer: »Die Freuden, die man übertreibt, verwandeln sich in Schmerzen; das wollte ich mir nur erlauben, den Damen zu der bevorstehenden Orgie ins Gedächtnis zurückzurufen.«
»Das solltet Ihr in goldenen Lettern über Euren Klub setzen!« rief Fanny zurück.
»Werde es den Herren mit Deinen Komplimenten bestellen!« –
»So,« sagte Fanny vergnügt, »nun ist er fort! Nun machen wir es uns bequem. Zieh Dein Kleid aus, Melitta. Diese Früchte machen abscheuliche Flecke, die Mango gelbe und die Mangosteen braune, und sie gehen nie aus. Anfangs haben wir sie immer gerieben, bis wir anstatt der Flecke Löcher hatten; jetzt, wenn ein Kleid zu arg zugerichtet ist, gebe ich es der Ayah oder Christine. Je nachdem ich mit der Einen unzufrieden bin, bekommt es die Andere.«
Fanny rückte nun zwei lange Stühle nebeneinander, setzte zwischen sie auf einen niedrigen Tisch eine Waschschüssel mit Wasser und legte ein paar Handtücher daneben. Dann ergriff sie den Korb mit den Früchten.
»Ich habe immer gehört, Mangos würden auseinandergeschnitten und mit dem Löffel gegessen,« meinte Melitta.
»So behandelt man die veredelten, die aus Indien herüberkommen; die hiesigen und die aus Java sind dazu zu faserig, und das Beste sitzt bei ihnen am Kern. Man muß sie in die Hand nehmen und ordentlich absaugen, was in anständiger Gesellschaft doch nicht wohl angeht. – So«, fuhr sie nach einer Weile mit einem befriedigten kleinen Seufzer und ausgespreizten klebrigen Fingern fort, »das war hübsch. Wenn nun die Hochzeit hier wäre, hätten wir noch acht Tage! Es ist schrecklich, daß Du übermorgen schon nicht mehr da sein wirst!«
»Nun, wir bleiben doch in erreichbarer Nähe.«
»Ich dachte ernstlich daran, Dich zu begleiten; ich könnte ja, nachdem ich Dich dem Gatten gefreit, mit Onkel Tschuschner zurückkommen.«
»Das wäre herrlich!« rief Melitta erfreut. »Was sagt denn Albert dazu?«
»Ach, Albert meint, wenn es durchaus sein müsse, so könnte ich seinethalben gehen.«
»Und da kannst Du natürlich nicht?«
»Nein, ich hätte es natürlich getan, aber Bertie steckte gestern zweimal die ganze kleine Faust in den Mund und hatte ein heißes Bäckchen. Ich fürchte, er zahnt, und da kann ich nicht fort.«
Der kleine Bertie ahnte nicht, welche Folgen es haben sollte, daß er die Faust in das Mündchen steckte und ein heißes Bäckchen bekam.
*
Schnell und stetig durchschnitt der Dampfer den Meerbusen von Martaban, ließ den China-bakir zur Linken und ging dann hinein in den mächtigen Strom. Seine Ufer sind flach; dichte Wälder wechseln auf ihnen mit niedrigem Buschwerk; nur hier und da sieht die Spitze einer kleinen Pagode aus dem Grün hervor. Es war gegen Abend, als die Reisenden Rangoon erreichten. Wie flüssiges Gold wogte der weite Strom in der sinkenden Sonne, große Segelschiffe wiegten sich in der einkommenden Flut, und ihr Takelwerk zeichnete sich scharf und fein gegen den flammenden Himmel. Die Gelände strahlten in rötlichem Schein, und hoch über ihrem grünen Hügel funkelte die Krone der höchsten Pagode der Welt. Wie in ein goldenes Märchen glitt Melitta in ihr neues Leben und die neue Heimat hinein. Einen Augenblick überkam sie eine seltsame Angst, sie möchte Dietert nicht wiedererkennen; sie versuchte umsonst, sich seine Züge ins Gedächtnis zurückzurufen. Keine Sorge! Dort, die schlanke Gestalt in Weiß, die mit der Hand winkte, das war er! Nun lag das Schiff an dem Pier und erzitterte unter dem Niederrasseln des Ankers. Allen zuvor schwang sich Dietert über die Reeling, stattlicher, brauner, männlicher als Melitta ihn im Gedächtnis hatte. Da war sein feines, kluges Gesicht, seine dunkeln Augen. Ihre Blicke begegneten sich in glücklichstem Verständnis, ihre Hände hatten sich gefaßt, und sie fühlte wieder das nervöse Zucken der heißen trockenen Hand, die die ihrige umschloß. Dann kam Tschuschner und umarmte den Sohn mit Herzlichkeit. »Siehst Du, min Jung,« rief er, »ich habe Wort gehalten und sie Dir gebracht; da hast Du sie.«
Die Bewegung der beiden Männer machte sich in wiederholtem Händeschütteln Luft. Dietert hatte ein braunes Faktotum mit, dem die Besorgung des Gepäcks übergeben wurde; er selbst führte seinen Schwiegervater und seine Braut sogleich zu einem offenen Wagen und nahm Melitta gegenüber Platz.
»Ist das Dein Gefährt?« fragte Tschuschner.
»O nein, Papa,« erwiderte Dietert, einen vergnügten Blick mit Melitta tauschend, »Wagen und Pferde sind hier großer Luxus; dazu reicht es noch nicht.«
»Nun,« meinte Tschuschner, »schaffe Dir nur einen netten Wagen an und ein Paar flinke Pferdchen; ich bin Dir doch auch ein Hochzeitsgeschenk schuldig.«
»O danke, Papa! Das ist eine große Freude.«
»Wie wundervoll!« rief Melitta. Sie fuhren an einer breiten Allee mächtiger Bäume vorüber, die von einer Menge braunen Volks, das Blumensträuße trug, belebt war. »Dies ist der Weg zur großen Pagode,« erklärte Dietert. »Es ist morgen das Fest des Vollmonds; da kommen die Burmesen in Scharen aus der Umgegend zum Tempel.«
»O, können wir hinauf und das sehen?« fragte Melitta.
»Gewiß; ich habe schon angenommen, daß es Dich interessieren würde,« sagte Dietert, und Tschuschner wunderte sich im stillen, wie flink das Du zwischen den jungen Leuten hin und her ging; er bedachte nicht, daß sie sich als Kinder gekannt hatten und das »Sie« ihnen schwerer gefallen war, als jetzt das »Du«.
»Das ist doch nicht der Weg zu Eversheds?« fragte er nach einer Weile.
»Nein,« erwiderte Dietert. »Das Hotel schien mir gleich etwas fraglich. Als ich dort war, um mir die Sache anzusehen, ging gerade einer der Gäste mit einem zahmen Tiger durch den Eßsaal, und das schien mir denn doch kein geeigneter Aufenthalt für Melitta. Ich habe Euch in Kantonnements untergebracht.«
»Wo?« fragte Melitta.
»In einer Art Pension. Die Mahlzeiten werden zwar gemeinsam eingenommen, aber jede Familie hat ihren Tisch und läßt sich von ihrem eigenen Boy bedienen; man hat auch seine abgeschlossene Wohnung mit besonderem Aufgang. Ich gebe Euch einen meiner Boys. Ihr werdet gut aufgehoben sein.«
Das Bungalow lag hübsch, die Wohnung gefiel Melitta und ihrem Vater. Tschuschner machte sich gleich mit den Koffern zu schaffen und ließ das Brautpaar rücksichtsvoll allein. Als Dietert sich später verabschiedete, nachdem noch das Nötigste über die Hochzeit besprochen war, sagte sich Tschuschner befriedigt beim Anblick der beiden erregten jungen Gesichter: »Er ist ein tüchtiger, frischer, junger Kerl, und ehrlich verliebt sind sie beide; da ist ja nun wohl alles in Ordnung.«
Am nächsten Morgen kam Dietert früh und holte sie noch vor seinen Geschäftsstunden zu einer Fahrt nach den lakes ab, künstlichen Teichen zwischen parkähnlichen Anlagen. Melitta belustigte sich sehr an einer chinesischen Familie, die sich neben ihnen niederließ.
»Das sind vornehme Leute,« sagte Dietert auf deutsch.
»Ich dachte, vornehme Chinesinnen hätten verkrüppelte Füße,« meinte Melitta.
»Das soll sehr abkommen,« warf Tschuschner ein.
»Wie gut!« rief Melitta.
»Ja,« sagte Dietert, »es ist eine grausame Sitte. Dem Konsulat gegenüber wohnt ein sehr reicher Chinese; als dessen Töchterchen zwei Jahre alt war, wurden ihm die Füße gewickelt, und wir hörten tagelang das Jammergeschrei.«
»Nein, sieh nur den dicken Diamant, den die alte Chinesin am Finger trägt,« rief Melitta.
»Das ist noch gar nichts,« sagte Dietert, »Du wirst heute abend beim Feste des Vollmonds noch ganz andere Geschmeide sehen.«
Auf dem Rückweg begegneten sie einem glattrasierten, englisch aussehenden Herrn mit zwei Damen in weißen Topis, dicken Sommerhüten aus Kork. Es waren Herr von Kamp, der hiesige Chef von Wechsler & Co. und zugleich deutscher Konsul, seine junge Frau und eine ältere Schwägerin, Miß Bell. Dietert machte sie mit Braut und Schwiegervater bekannt. Sie begrüßten Melitta mit großer Zuvorkommenheit.
»Wir können uns künftig ganz ungezwungen sehen,« bemerkte Frau von Kamp, »unsere Gärten stoßen an einer Stelle aneinander.«
»Ist es hier nicht reizend?« fragte Miß Bell. »Sie müssen den Rasen bewundern, das ist unser Stolz und eine große Seltenheit hierzulande.«
»Und entzückend ist es, wenn hier Feste arrangiert werden,« sagte Frau von Kamp. »Alles wird mit Lampions dekoriert; in dem Pavillon dort sind die Erfrischungen, in dem kleinen sitzt die Musik, und hier oben wird getanzt.«
»Getanzt?« sagte Melitta. »In dieser Hitze?«
»Sollen wir etwa nicht tanzen, weil es hier zufällig heiß ist?« fragte Miß Bell, die eigentlich aussah, als sei sie über das tanzpflichtige Alter längst hinaus. »O, wir wissen uns hier zu amüsieren, das können Sie glauben,« fuhr sie fort. »Mögen Sie gerne mit dem Bogen schießen?«
»Ich habe es noch nie versucht.«
»Darin müssen Sie sich üben,« meinte Miß Bell, »ich freue mich darauf, es Ihnen beizubringen. Meine Brosche hier habe ich bei dem letzten Scheibenschießen als Preis bekommen.«
»Treffen wir uns nicht heute abend wieder hier?« fragte der Konsul. »Es ist wunderschön an den lakes, wenn der Vollmond scheint.«
»Dann wollen wir auf die Pagode,« sagte Dietert. »Meine Braut freut sich auf das burmesische Volksfest.«
»Im Dunkeln auf die Pagode! Nehmen Sie sich nur in acht vor den ausgetretenen Stufen.«
»Mir ist solch ein Gewühl nicht angenehm.« Der Konsul räusperte sich. »Man weiß nie, was für Krankheiten herumgehen.«
»Die Leute sind dann alle frisch gewaschen und in ihrem besten Putz,« meinte Dietert, »und man kann ja die Kleider wechseln, wenn man zurückkommt.«
Gegen Abend fuhren Tschuschner und Melitta in einem Gherry, einer kleinen geschlossenen Droschke, zu Dietert, wo sie speisen und Melitta ihr künftiges Haus kennen lernen sollte. Er empfing sie an der Gartenpforte.
»Willkommen daheim!« sagte er mit beglücktem Blick, als er Melittas Hand in seinen Arm legte, um sie den Gartenweg entlang nach dem Bungalow zu führen.
Was war das für ein Garten! Große Bäume, aus deren Stämmen und Ästen Büschel roter Blumen hervorbrachen, ein Brotfruchtbaum übervoll von kürbisgroßen Früchten, seltsame Koniferen, riesigen Armleuchtern vergleichbar, starkduftende Blumen. Seitlich vom Hause zog sich ein blauüberblühter Bogengang hin. Melitta pflückte im Vorübergehen eine Ranke; es war eine von Grün zu mattem Blau abschattierte Rispe kleiner Blumen. »Was ist denn das?« fragte sie.
»Ja, botanische Kenntnisse darfst Du von mir nicht erwarten,« erwiderte Dietert. »Ich fand das alles vor und habe mich nicht sehr darum gekümmert.«
Einige Stufen führten auf die Veranda, die die Vorderseite des Hauses umgab. Sie betraten ein Wohnzimmer, dem allerhand japanisches und indisches Gerät etwas Charakter gab; dahinter lag Dieterts kleines Arbeitszimmer, an der anderen Seite der Speisesaal mit Möbeln, deren Schnitzwerk Arabesken und Elefanten zeigte. »Das alles ist leicht erschwinglich,« erklärte Dietert, als Melitta ihrer Bewunderung Ausdruck gab, »es ist Gefängnisarbeit.«
Die Mahlzeit verlief sehr heiter; die Bedienung war tadellos, der Tisch mit blaßroten Rosen und Farnkräutern geziert.
Das Fest des Vollmonds auf der größten Pagode der Welt! Das klang wie ein Märchen, und es war auch eins. Schön war schon die Fahrt durch die Abendkühle unter dem schwarzen Schatten der Alleen, durch das bunte Gewimmel mit den zahllosen Lichtchen und Papierlaternen.
Nun hielten sie am Aufstieg der Pagode; die beiden steinernen Ungeheuer an ihrem Fuße waren zwar nur undeutlich sichtbar, aber die Treppen waren bestrahlt von Lichtern und belebt von auf- und absteigenden Gästen in hellen farbigen Gewändern aus reichen Stoffen. Alle trugen den bunten Sarong, die weiße burmesische Jacke und das rosa oder gelbe Kopftuch; die Frauen trugen das Haar unbedeckt und mit Blumen geschmückt. An den Seiten der Treppe kauerten Bettler, streckten flehend die mageren Arme aus, und nur wenige gingen vorüber, ohne ihren Anna in die hingehaltene Bettlerschale geworfen zu haben. Ein kleiner brauner Junge sprang auf Melitta zu, reichte ihr eine Rose und lief davon, ohne auf den Dank zu warten.
Die Stufen der Treppe waren in der Tat halsbrechend ausgetreten, denn in Jahrtausenden nützen selbst nackte Sohlen den Marmor ab. Aber jetzt war Melitta mit beiden Herren oben, und sie ergingen sich in der bewegten Menge zwischen offenen Hallen und glänzenden Schreinen, in denen weiße Buddhas in ewiger Beschaulichkeit ihr unverändertes Lächeln zeigten, zwischen Tempeln, deren Altäre im Glanze zahlloser Kerzen strahlten, und vor deren jedem eine dichte Menge auf den Knien lag und ihre Lichtchen darbrachte. Sie traten auf den Mittelplatz, der tageshell im Mondenlicht dalag. Die große Pagode stand im magischen Schein des Mondlichtes vor ihnen, rings um den Sockel hatten Beter ihre Blumen niedergelegt, und ganz oben blitzte die feine Krone, die in der Höhe der Paulskirche die Spitze ziert; der reiche Schmuck von Diamanten und Edelsteinen, deren Glanz die Erde nicht erreicht, funkelte ungesehen zu den Sternen hinauf. Rings umher spielten die Wipfel der Tamarinden weißlich im Mondlicht und bedeckten den Grund mit schwarzen Schatten; darunter wogte das festliche Getümmel. Hier hatten sich mehrere Familien zu fröhlichem Mahl vereint, dort kauerte ein Bonze am Boden und schlug seinen Gong zum Gebet an; da sang und spielte ein Blinder, und eine lauschende Korona stand um ihn her. Dazwischen spielten Kinder, trugen Mütter ihre braunen Babys rittlings auf der Hüfte oder gaben, vor den Altären kniend, ihren Säuglingen unbefangen die Brust. Und diese ganze große Schar, die nach Tausenden zählte, feierte in harmloser Freude ihr Fest; nirgends ein Mißton, nirgends ein Streit oder auch nur ein lautes Wort. Hier konnte jeder Fremde, jede Dame sich unter die Menge mischen, konnte durch einen Schlag an die große silberne Glocke die Götter des Landes anrufen, und die Umstehenden nahmen es, als eine ihnen erzeigte Ehre, mit Wohlgefallen auf.
Nach einer Weile führte Dietert seine Gäste aus dem Gewühl durch ein Gehölz bis an die Mauer, die oben den Tempelhügel umschließt. Hier war es still, nur von weitem hörte man das Summen der Stimmen und den Klang der Gongs. Im Schatten breiter Tamarinden standen sie, in deren Kronen der Abendwind rauschte, und tief unter ihnen lag in der Helle des Vollmonds die Landschaft.
Da fiel ein Strahl auf eine Steinplatte zu ihren Füßen, und sie sahen, daß sie eine Inschrift trug:
»To the memory of
James Lytton Gordon,
lieutenant,
buried where he fell.«
»Dem Andenken von James Lytton Gordon, Leutnant, begraben wo er fiel.«
»Sind hier Gräber?« fragte Melitta.
»Ja,« sagte Dietert, »hier liegen die Engländer, die einst bei der Erstürmung der Pagode fielen. Als unten die Stadt eingenommen war, warfen sich die Burmesen in die Pagode, und es gab noch einen wütenden Kampf und ein entsetzliches Gemetzel, denn die Leute verteidigten ihr Nationalheiligtum mit wildem Fanatismus. Es wurde ihnen bald wieder freigegeben, aber auf dem Hügel nebenan hinter dem Buschwerk stehen ein paar geladene Kanonen, die den Pagodaplatz jederzeit bestreichen können, und ein englischer Posten steht immer daneben, hier rechts, hinter der Mauer.«
Er hatte mit ungewöhnlicher Lebhaftigkeit gesprochen.
»Du wärst wohl gern mit dabei gewesen?« fragte Tschuschner lächelnd.
»So etwas ist meine Sache nicht.« Dietert stieß mit der Fußspitze gegen den Stein. »Es ist am besten wie es ist. Lassen wir nur die Engländer die Kastanien aus dem Feuer holen, Bahn für uns brechen, Wege bauen, Häfen anlegen, Ordnung schaffen, die Farbigen niederhalten. Dann kommt der deutsche Kaufmann und schert sein Schäfchen in Ruhe. – Weshalb sollen wir unsere Haut zu Markte tragen? – Du glaubst doch nicht an all den Kolonialschwindel? Hand aufs Herz, wäre die Welt so schlimm daran, wenn sie schließlich englisch würde?«
Melitta stieg das Blut ins Gesicht. Sie sagte scharf: »Ich finde es nicht eben schön, andere die Arbeit tun zu lassen und zu ernten, wo man nicht hat säen mögen!«
»Tun wir das nicht alle, Tag für Tag?« erwiderte Dietert. »Seien wir doch wenigstens ehrlich und gestehen es uns ein.« Melitta schwieg.
»Nach meiner Erfahrung sind es meistens die Deutschen, die die Kastanien aus dem Feuer holen,« sagte Tschuschner. »Ich habe das Land noch nicht gefunden, noch das Unternehmen gesehen, an dem nicht ein Tropfen deutschen Schweißes geklebt hätte. Der Gewinn freilich fließt selten in die richtige Hand, darin hast Du recht. Aber das sind nicht Dinge, die man so zwischen Tür und Angel abtun kann.«
›James Lytton Gordon – buried where he fell,‹ wiederholte Melitta für sich.
Es war lange her. Der hier Begrabene wäre jetzt ein uralter Mann, wenn er überhaupt noch lebte; die ihn damals mit so heißen Tränen beweinten, schlafen selbst wohl lange den letzten Schlaf, – damals aber war er jung, frisch und kräftig und tat sein Bestes, das wehrlose Volk niederzuschlagen, das den Feinden im heiligsten Kampfe die nackten Leiber entgegenwarf. Sie sah es alles vor sich, und ernster als sie gekommen, schritt sie die Treppe zwischen den Drachen hinab.
Auch das Streiflicht, das durch das angeregte Gespräch auf Dieterts Anschauungsweise gefallen war, gab ihr zu denken. Sie war zu wahrhaftig und zu sehr an folgerichtiges Denken gewöhnt, um sich zu verschleiern, daß es sich hier um einen fundamentalen Gegensatz ihrer Naturen handelte, und zugleich zu jung und zu verliebt, um nicht zu versuchen, diesen Gegensatz in sich auszugleichen und zu überbrücken. In einer ruhigen Stunde gedachte sie nochmals mit Dietert auf die springenden Punkte zurückzukommen; bei ernsterem Eingehen, meinte sie, müßte sich die Verständigung von selbst ergeben.
Allein diese ruhige Stunde fand sich nicht in dieser kurzen unruhigen Brautzeit. Sie waren noch mehrmals auf dem Pagodahügel; Dietert neckte Melitta damit, daß der Buddha sie bezaubert hätte, doch blieb der erste Eindruck der stärkste und wurde durch kein späteres Bild verwischt.
Der Konsul, seine Frau und seine Schwägerin machten Melitta nach englischer Sitte den ersten Besuch und belustigten sich sehr über ihre Begeisterung.
»Alle diese Dinge verlieren ihren Reiz nur zu bald,« sagte Frau von Kamp. »Nach einem Jahr sieht man nicht mehr, ob die Leute braun oder schwarz sind, und man hat so viel Ärger mit der Dienerschaft, daß man Gott dankt, wenn man sie nicht um sich zu haben braucht.«
»Ich glaube nicht, daß ich das Interesse für Volkstypen je verlieren könnte,« erwiderte Melitta, »jedenfalls behält doch das Landschaftliche immer seinen Reiz.«
»O nein,« hieß es nun, »keineswegs; der Winter fehlt hier, und das ewige Grün wird einem zuletzt gleichgültig; Sie werden es bald erfahren.«
»Gegen die Baumformen wenigstens kann man doch unmöglich gleichgültig werden. Sehen Sie doch hier aus dem Fenster diesen Baum mit dem seltsam geteilten, gewundenen Stamm und der breiten Krone. Oben trägt er eine Palme. Wie dieser Palmenkern dort hingekommen sein kann, das beschäftigt mich, seit ich hier bin.«
»O, das ist ein Bannianbaum,« sagte Frau von Kamp. »Es ist eigentlich gar kein Baum, sondern eine Schlingpflanze, die den Stamm eines anderen Baumes umzieht und dann eine so starke Krone entwickelt, daß man des eigentlichen Baumes kaum noch gewahr wird. Hier ist die Palme das Mittelstück.«
»Solch ein enormer Stamm und solch eine Krone eine Schlingpflanze!«
»Dieser ist noch gar nicht so sehr imposant!« behauptete der Konsul. »Der größte Bannianbaum der Gegend, wenigstens soviel ich weiß, steht im Dschungel, ein paar Meilen den Fluß hinauf.«
»In den Dschungel möchte ich auch so gern. Schade, daß man da nicht hin kann.«
»Aber nichts ist leichter als das,« sagte Frau von Kamp. »Lassen Sie uns doch zusammen hinfahren. Wir nehmen unser kleines Dampfboot. – Wird es morgen gebraucht, Freddy?«
»Ich glaube, ich kann es Euch morgen zur Verfügung stellen und mich dazu.«
»Reizend,« rief Miß Bell, »wir machen ein Picknick! Wir brechen früh auf, und ehe die Hitze zu arg wird, sind wir wieder zurück!«
Am nächsten Morgen traf sich die Gesellschaft wie verabredet um sechs Uhr an dem Pier; man bestieg den kleinen Dampfer; ein Boy des Konsuls und einer von Dietert hatten allerhand gute Dinge in Körbe gepackt und auf Eis gelegt. Die Fahrt ging an den waldigen Ufern entlang; geschnitzte Reisboote mit hohen, geschwungenen Enden glitten ihnen entgegen; sie dampften an Holzplätzen vorüber, auf denen Elefanten arbeiteten, und legten endlich in einer kleinen Bucht im Schatten wahrer Riesenstämme an, deren einer der berühmte Bannianbaum war. An seinem Fuße wurde ein Tischtuch ausgebreitet und Teller, Gläser und Schüsseln darauf gestellt, während die Gesellschaft sich auf den Baumwurzeln oder auf mitgebrachten Matten niederließ. Dietert führte Melitta etwas weiter in den Dschungel hinein, der hier nicht besonders dicht war. Mit besonderem Interesse betrachtete Melitta einen Baum, der im Umkreis seiner Krone Hunderte von Wurzelstöcken ans der Erde trieb. Eben hatte sie bemerkt, es müsse schrecklich sein, hier laufen, vor etwas fliehen zu müssen und zu fallen, als Dietert ihre Hand fest faßte und in ganz verändertem Tone sagte: »Sieh Dich nicht um! Komm! Geh ruhig!«
Sie begriff, daß eine Gefahr ihnen drohte; sie dachte an Schlangen und schritt, so eilig und so vorsichtig sie konnte, zwischen den Pflöcken fort. »Komm! Komm!« drängte Dietert, sobald sie aus dem Bereich des Baumes waren. In diesem Augenblick sah Frau von Kamp zufällig nach ihnen hin und stieß einen Schrei aus; zugleich sprangen auch die anderen auf und eilten auf das Dampfboot zu; nur Tschuschner stürzte ihnen entgegen. Jetzt blickte auch Melitta hinter sich und sah sechs bis acht blaue Büffel langsam und stetig herantrotten. Die mächtigen Tiere waren kaum zwanzig bis dreißig Schritt von ihnen entfernt. Tschuschner riß seiner Tochter den roten Sonnenschirm aus der Hand und schleuderte ihn auf die Büffel zu; dann umfaßte er Melitta, die sich seiner Führung überließ, während Dietert in großen Sätzen voranflog. An der Treppe der Steamlaunch besann er sich, blieb stehen und half Melitta in das Boot. Frau von Kamp war ganz blaß, Miß Bell weinte, Dieterts Hände zitterten, und alle sahen nun aus sicherer Entfernung zu, wie die Büffel geradeswegs über das ausgebreitete Frühstück hintrabten. Einige prüften mit den Nüstern die ausgestellten Schüsseln; man hörte das Prasseln der Gläser und Teller. Nachdem die Tiere einen Augenblick am Ufer gestanden und den kleinen Dampfer unschlüssig und mißtrauisch betrachtet hatten, zogen sie langsam und schwerfällig ihres Weges. Man hörte dann einen Pfiff und sah sie weiterhin im Walde verschwinden.
»Schade um all die guten Dinge,« sagte der Konsul.
»Sind denn die Büffel so gefährlich?« fragte Melitta.
»O meine Liebe! Es war schrecklich, wie sie auf Sie zukamen,« sagte Frau von Kamp. »Hätte sie der Schirm nicht einen Augenblick beschäftigt, wer weiß, ob Sie das Boot erreicht hätten.«
»Ob sie das Tischtuch ganz zerrissen haben?« fragte Miß Bell.
»Ich will doch nachsehen, ob noch etwas zu retten ist,« meinte Dietert.
»Nein! nein! Um Gottes willen nicht!« rief Miß Bell.
Dietert lachte und schwang sich über die Reeling.
»O Miß Tusch! lassen Sie ihn nicht gehen!« Miß Bell rang die Hände.
»Warum denn nicht? Die Büffel sind doch fort!«
»Aber sie können kommen wieder! Ihr müßt nicht lassen sein Gelobtes rennen in Gefahr!« Miß Bell preßte die Angst deutsche Laute aus.
Melitta lachte. »Ich sehe keine Gefahr, Miß Bell, und er kann ja gut laufen.«
Diese Bemerkung verletzte Dietert, aber er kehrte das Gesicht ab, um seinen Unmut zu verbergen, und schritt dem Platze der Verwüstung zu, wo die Boys bereits von dem Gerät aufnahmen, was noch heil geblieben war. Bald entdeckte er, daß die Eiskiste mit den Reserven unversehrt war. Sie wurde an Bord geschafft, mit Jubel begrüßt und geleert, worüber sich die verlorene Stimmung wiederfand. Zur festgesetzten Zeit erreichte man den Pier, eben als der fällige Dampfer von Shanghai ankam. »Nun müssen wir uns tummeln, um im Kontor zu sein, wenn die Post abgegeben wird,« sagte der Konsul zu Dietert.
»Ich komme erst nach Tisch!« rief Dietert seiner Braut zu. »Dann machen wir noch eine Fahrt um die lakes!«
Dasselbe, das wir säen,
Müssen wir schneiden und mähen.
Gottfried v. Straßburg.
Früher als sonst ertönten heute die beiden Schüsse, die den Schluß der Post und die Abfahrt des Dampfers verkündeten.
»Ich dächte,« sagte Tschuschner zu seiner Tochter, »wir führen noch zu Dietert. Es liegt mir daran, das Geschäftliche abzumachen und ihm die Mitgift einzuhändigen. Wer weiß, was morgen dazwischen kommt, und es bis zum Hochzeitstag aufzuschieben, scheint mir nicht passend.«
Nun gehörte es, wie Melitta wußte, zu Dieterts Eigenheiten, von einer einmal gegebenen Bestimmung ungern abzuweichen, zumal, wenn sie von ihm selber getroffen war. Indessen, wenn der Vater seiner Braut ihm ein Vermögen ins Haus brachte, konnte er sich eine solche Abweichung wohl gefallen lassen. Sie fuhren also hin. Der Butler eilte ihnen entgegen. Der Barra-Sab Der große Herr, von Sahib, Herr. wäre eben erst aus dem Kontor zurück, sagte er, und noch in seinem Badezimmer. Der Sab und die Memsab möchten Platz nehmen. Was er ihnen bringen dürfte? Sie nahmen etwas Limonade an und setzten sich. Bald darauf erschien Dietert im häuslichen weißen Flanellanzug. Melitta bemerkte sehr wohl den Schatten, der über sein Gesicht flog, als ihm der Butler die Gäste meldete; doch begrüßte er sie gleich darauf mit froher Herzlichkeit. Tschuschner erklärte ihm den Grund seines Kommens. »Es wird kaum zehn Minuten erfordern,« sagte er.
»Wir haben noch eine Viertelstunde bis zum Essen,« erwiderte Dietert, »wenn es Dir jetzt paßt. Kommst Du nicht mit, Melitta?«
»Wenn ich bei Eurer Unterhaltung nicht nötig bin, bleibe ich lieber hier; mir ist heute den ganzen Tag über der Kopf etwas schwer.«
Die Herren gingen in Dieterts kleines Arbeitszimmer; man hörte die Stühle rücken und das Knittern von ausgebreitetem Papier. Melitta schien es unter der Veranda schwüler zu sein als draußen. Sie stand auf, ging die Stufen hinunter und trat in den blaubewachsenen Laubengang. Eine Gattertür führte von ihm aus in den Hofraum. Sie war nur angelehnt, und Melitta schritt hindurch und lächelte darüber, daß sie sich schon so als Herrin fühlte, denn sie befand sich hier zwischen den Wirtschaftsräumen des Bungalows. Der alte Gärtner, der vor der Stalltür Holz spaltete, hielt mit seiner Arbeit inne und machte ehrerbietig Salaam. Gleich linker Hand stand ein Häuschen, das etwas besser war, als es dem Gesinde gewöhnlich angewiesen wurde. Als sie daran vorüberschritt, sah sie auf der unteren Hausstufe eine kleine Ayah stehen, die ein Kind im Arm hielt. Es mochte ein halbes Jahr alt sein und schien krank, denn es hatte den Kopf an die Schulter der Wärterin gelehnt, und der eine Arm hing schlaff herunter. Bei Melittas Nahen drehte es das Köpfchen und sah sie mit den unnatürlich großen, ernsten Augen kranker Kinder an. Melitta war wie vom Blitz getroffen. Das Kind war weiß, und sie kannte den hochmütigen, abweisenden Blick, den es ihr unbewußt zuwarf. Bei einem dicken, gesunden Kinde wäre die Ähnlichkeit vielleicht weniger auffällig gewesen, so aber war das Gesichtchen Dieterts verkleinertes Abbild Zug um Zug; die zu nahstehenden Augen, die feine Nase, die dunklen, ungleichen Augenbrauen, die unregelmäßige Zeichnung des Mundes, die Kopfform, der Haaransatz, sogar die lange schmale Hand war Dieterts. Es war so augenfällig und kam so plötzlich, daß Melitta unwillkürlich stehen blieb und sich nach dem Hause zurückwandte. Dabei traf ihr Blick den Gärtner, der die unausgesprochene Frage sogleich verstand und ihr mit grinsendem Gesicht zurief: Yessee! yessee! littee barra-sab! Pour! ( four – vier). Dabei zeigte er die Größen von vier kleinen Orgelpfeifen und wiederholte: » Pour! – littee barra-sab! – littee memsab!« Und die kleine braune Wärterin zeigte auch ihre weißen Zähne und lachte: » Littee barra-sab! yessee! pour!«
Instinktmäßig nahm sich Melitta vor den Augen des Gesindes zusammen und schritt anscheinend ruhig weiter. – War denn das möglich? Es konnte doch nicht sein! Sie hielt an und sah zurück; die kleine Wärterin stand noch da, und die Blicke des Kindes folgten ihr nach. Aber im Schatten hinter der halbgeöffneten Tür sah sie ein dunkles junges Gesicht, verzerrt von Haß, die Lippen von den blanken Zähnen zurückgezogen, die Augen glühend, in wilder Leidenschaft auf sich gerichtet. Sie wußte genug. Ruhig schritt sie weiter bis zu der nächsten Pforte. Sie vermochte sie nicht zu öffnen und winkte einem Arbeiter, der ihr staunend zugesehen hatte und die Tür mit einer Handbewegung aufstieß. Melitta hatte in ihrer Verwirrung nicht bemerkt, daß sie offen war und daß sie sie andrückte, anstatt sie aufzuziehen. Sie befand sich dann wieder in dem blauen Laubengang und ging ins Haus zurück. Nicht zwei Minuten konnte sie fortgewesen sein. Alles schien sich um sie zu drehen, als sie die Stufen hinaufstieg und in das Zimmer trat.
»Ich würde Dir nicht raten, alles ins Geschäft zu geben,« sagte eben Tschuschner, »es ist immer gut, eine Summe disponibel ... Mein Gott, Melitta, was ist Dir?«
»Bist Du krank?« rief Dietert zu gleicher Zeit. »Ist Dein Kopf schlimmer?«
»Mir ist sehr schlecht, Papa,« sagte Melitta schwer. »Ich will nach Hause.«
»Lege Dich erst ein Weilchen hin, hierher,« bat Dietert ängstlich.
»Ich brauche nur Ruhe, Papa. Bringe mich nach Hause.«
Eilfertig raffte Tschuschner die Papiere zusammen, schob sie in seine Brusttasche und sagte hastig: »Laß das Gherry rufen, Dietert.« Langsam führte er seine Tochter den Gartenweg hinunter, der Pforte zu. Dietert war vorangeeilt und rief den syce, der neben seinem Pferde kauerte und ihm Grasbüschel hinhielt. Melitta stieg ein, der Vater folgte.
»Ich darf Euch doch begleiten?« fragte Dietert. »Boy! Meinen Hut!«
»Nein,« sagte Melitta kurz.
»Soll ich nicht Doktor Cherry holen?«
»Nein,« wiederholte Melitta scharf, »ich will den Doktor nicht, nur Ruhe.«
Das Pferd zog an. Melitta sah an Dietert vorbei noch einmal nach dem Hause zurück, das so friedlich und freundlich inmitten seines schattigen Gartens dalag. Ihr Kopf schmerzte; sie lehnte sich an die Rückwand des Wagens und schloß die Augen. Zu Hause legte sie sich sogleich nieder. Als ihr Vater später leise in ihre Tür trat, rief sie ihn zu sich und erzählte ihm, was ihr begegnet war. Tschuschner war sehr betroffen. »Das ist ja eine fatale Geschichte. Wie – unvorsichtig!« wollte er hinzufügen, verbesserte sich aber in »unbegreiflich«.
Weder Vater noch Tochter schliefen in dieser Nacht; erst gegen Morgen sank Melitta in einen schweren Schlaf. Als sie erwachte, hörte sie in ihres Vaters Stube seine und Dieterts Stimmen in ernstem Gespräch. Tschuschner hatte das Frühstück auf sein Zimmer bestellt.
»Dietert war hier,« sagte er, als Melitta eintrat.
»Leugnet er es etwa noch?« fragte sie bitter.
»Nein, er suchte mir nur zu erklären, wie alles gekommen wäre.«
»Was ist da zu erklären?«
»Es ist ihm natürlich schrecklich, daß es so gekommen ist. – Daß er gelebt hat, wie die jungen Leute hier eben leben, das – das ist ja nun einmal so – aber er hätte das natürlich ordnen müssen, ehe Du kamst. Er wollte das auch und hat die anderen Kinder zu den Eltern des Mädchens in den Dschungel geschick.t, Das Kleinste aber war krank, es hatte Fieber, und der Doktor hatte gesagt, es müsse ruhig gehalten werden und dürfe jetzt die Milch nicht wechseln; das Frauenzimmer aber weigerte sich unter diesen Umständen zu gehen. – Dietert meint, Du vor allen würdest begreifen, daß er das Herz nicht hatte, sie zu zwingen. Gerade heute hatte sie fort sollen.«
»Gut, daß ich noch zur Zeit kam.«
»Er hätte sie reichlich abgefunden, versichert er; Du würdest keine Belästigung von der Sache haben. Er hofft, Du wirst deshalb nicht schlechter von ihm denken.«
»O bewahre – hofft er nicht auch, daß das meine Liebe und Achtung wesentlich erhöht hat? – Bitte, Papa, wir wollen das Thema fallen lassen; nur laß mich ihn nicht wiedersehen.«
Tschuschner schwieg in der Hoffnung, daß sie sich dann am ehesten beruhigen würde. Gegen Abend kam Dietert wieder. Sobald Melitta seinen Schritt hörte, zog sie sich in ihr Zimmer zurück. Nach einer Weile trat ihr Vater bei ihr ein. »Dietert,« sagte er, »läßt auf das dringendste bitten, Dich sprechen zu dürfen.«
»Ich habe ihm nichts mehr zu sagen und nichts mehr von ihm zu hören,« erwiderte Melitta hart. »Bitte, Papa, erkläre ihm das ein für allemal.«
»Laß mich Dir nur ein Wort sagen, Melitta!« rief Dieterts Stimme an der Tür. Melitta ging sofort in ihr Schlafzimmer und schloß hinter sich ab. Sie hörte draußen Dietert heftig sprechen und dazwischen ihres Vaters ruhige Stimme: »Geduld haben – Zeit lassen – tiefverletzt – unschuldiges junges Mädchen –«
In dieser Nacht hörte Tschuschner seine Tochter weinen. Er regte sich nicht, in der Hoffnung, daß Tränen sie erleichtern und vielleicht milder stimmen würden. Doch als sie am Morgen aus ihrem Zimmer kam, sah er keine Weichheit in ihrem Gesicht, und fragte sich unruhig, wie denn das alles enden solle.
Wieder erschien Dietert, und wieder zog sich Melitta zurück.
»Keinen Verbrecher verurteilt man ungehört!« hörte sie ihn rufen. »Ich bestehe darauf, sie zu sprechen!« Und Tschuschner redete ihr sehr ernst zu.
»Ich halte es für unumgänglich und notwendig, daß Du ihn selbst sprichst.«
»Dann kann ich es ja tun,« sagte Melitta. Ihr Vater ging hinaus, und Dietert trat ein. Melitta bemerkte sehr wohl die Veränderung, die Sorge und Angst in seinem Gesicht hervorgebracht hatten; er sah bleich und übernächtig aus. Mit ausgestreckter Hand kam er auf sie zu. »Melitta,« sagte er weich, nur schwer seiner Erregung Herr werdend, »Du ahnst nicht, wie mir zumute ist. Ich bin hart gestraft, viel härter, als Du denken kannst. Komm nun, laß dies das erste sein, das wir miteinander tragen. For better for worse, you know. – Sieh, nie wieder sollst Du ein Wort von dieser unglücklichen Geschichte hören –«
»Damit ist sie nicht abgetan.«
»Sie ist abgetan. Das Frauenzimmer ist abgefunden und fort, die Kinder auch.«
»Die Kinder wußten doch, daß sie Dein waren? Sie sind doch so gehalten worden, nicht?« Er schwieg. »Das Kleine, das ich sah, hatte ein gesticktes Kleidchen und sah aus wie ein Herrenkind, und nun schickt man sie mir nichts, dir nichts in den Dschungel – entsetzlich!«
»Melitta!« rief Dietert, dem ein Licht aufzugehen schien. »Sollen wir sie behalten? Willst Du für sie sorgen?«
»Der Mutter auch noch die Kinder nehmen? Nein.«
»Dann wollen wir sie hier anständig unterbringen.«
»Damit Du zwei Wirtschaften hast? – Nein.«
»Melitta!« rief Dietert empört. Er nahm sich mit Anstrengung zusammen. »Wie kannst Du so etwas sagen? – Traust Du mir das wirklich zu – kannst Du an meiner Ehrenhaftigkeit so zweifeln? Du weißt doch, wie lieb Du mir bist!« – Er konnte nicht weiter sprechen und ging in heftiger Bewegung auf und nieder. »Hast Du denn gar kein Vertrauen mehr zu mir?«
»Nein,« sagte Melitta, »gar keins. Wer mich so hintergeht, wie soll ich dem vertrauen?«
»Hintergeht!« brauste er auf. »Glaubst Du, ich würde Dir's nicht gesagt haben, wenn die Gelegenheit gekommen wäre?«
»Ja, wenn es zu spät war,« sagte Melitta bitter.
»Und wann hätte ich es tun sollen? – Ich habe gelebt, wie alle jungen Leute hier leben; das wird nicht als etwas Schlimmes angesehen. Sollte ich etwa, als ich um Dich anhielt, als Du kaum erwachsen warst, davon sprechen? Damals habe ich wahrhaftig mit keinem Gedanken daran gedacht. – Wären wir verlobt gewesen, hätten wir wie andere Brautleute korrespondieren dürfen, dann hätten wir uns näher treten können. So war ich von Dir abgeschnitten – und hier – wann und wie und wozu hätte ich davon sprechen sollen? – Solche Dinge sagt man seiner Frau, aber nicht seiner Braut. Komm doch zu Dir, – Du bist wie in einem bösen Traum befangen. – Überlaß die Sache mit Vertrauen mir – oder wenn Du Wünsche hast, sage sie. Ich will tun, was ich irgend kann, um Dich zu beruhigen und zufriedenzustellen. – Gott weiß, Du sollst keinen Anlaß zur Klage wieder über mich haben; was ich Dir an den Augen absehen kann, will ich tun, um Dich das Leid dieser Tage vergessen zu machen! – Was meinst Du, was wünschest Du, liebes Herz?«
»Ich habe keine Wünsche,« erwiderte Melitta; »die Sache geht mich nichts mehr an.«
»Nichts mehr an? Was soll das heißen?!«
»Du kannst doch unmöglich glauben, daß ich jetzt noch Neigung habe, Deine Frau zu werden?«
Dietert stand wie vom Donner gerührt. »Melitta,« sagte er dann drohend, »ich kann Dir vieles zugut halten, aber so lasse ich nicht mit mir spielen. Besinne Dich. Übermorgen ist unsere Hochzeit; wir sind so gut wie verheiratet. – Nimm Dich in acht, zum Narren lasse ich mich nicht halten.«
Seine Augen funkelten.
In Melittas Gesicht trat der steinerne Ausdruck, dessen er sich aus ihrer Kindheit erinnerte, der harte Eigensinn, gegen den die Tante und die Erzieherin nichts ausrichten konnten und dem gegenüber auch er sich mit Erbitterung machtlos fühlte. Er hatte ihr Handgelenk gefaßt und drückte ihr achtlos Volckardts Goldreif in den Arm, während er sprach.
»Papa!« rief Melitta. Tschuschner, der an der Türe stand, unschlüssig, ob er dem Gespräch ein Ende machen solle oder nicht, trat ein. »Bleibe hier, Papa, und bitte Herrn Dietert, meinen Arm loszulassen. Er vergißt sich.«
»Pardon,« sagte Dietert und trat zurück.
»Geh jetzt, Dietert!« Tschuschner führte ihn in das Nebenzimmer. Hier brach der junge Mann los; er zitterte vor Erregung. Tschuschner konnte lange nicht verstehen, was er mit solcher Leidenschaft verlangte; als er es endlich begriff, sagte er mit großem Ernst: »Davon kann keine Rede sein. Ich habe Dir von vornherein gesagt, daß meine Tochter in ihrer Wahl frei sein solle; sie zu einer Heirat zu zwingen, gegen ihren Willen, das fällt mir nicht ein. Du hast Dir durch Deine Unvorsichtigkeit und Schwäche die Sache selbst verpfuscht, nun trage die Folgen in Geduld. Vielleicht besinnt sich Melitta; das sollte mir lieb sein. Aber von Beeinflussen, geschweige denn von Zwingen ist keine Rede.«
Melitta sah das von Wut und Haß entstellte Gesicht des in seiner Liebe, in seinem Ehrgeiz, in allen seinen Hoffnungen gekränkten Mannes nicht, aber sie wußte ohnehin, daß er so wenig vergab wie vergaß.
Als Tschuschner zu seiner Tochter zurückkam, fand er sie ganz außer sich; laut schluchzend und händeringend ging sie auf und nieder. »Papa! Papa! Laß uns fortgehen! Nimm mich fort! Nur fort von hier! – Nur fort!«
So hatte er sie noch nie gesehen.
»Sei ruhig,« sagte er, »mit dem nächsten Dampfer – übermorgen – gehen wir nach Singapore zurück. Auf der Stelle schicke ich nach Ten Tschaik.«
Melitta machte sich sogleich mit fieberhafter Hast daran, die Koffer zu packen, während Tschuschner ein Billett an den Pastor und eins an den Konsul schrieb, um ihnen anzuzeigen, daß die Trauung wegen Erkrankung seiner Tochter hinausgeschoben wäre. Durch ein anderes entbot er den Chinesen zu sich, den er beauftragt hatte, das Gepäck aus den Lagerräumen der Dampfergesellschaft, sowie Melittas Koffer in Dieterts Haus zu schaffen. Ten Tschaik erschien denn auch alsbald mit einem großen Diamanten am kleinen Finger und einem papiernen Sonnenschirm unter dem Arm und versicherte, er habe den Auftrag nicht vergessen und würde pünktlich mit seinen Leuten erscheinen, um die Sachen zu Dietert-Sab zu bringen. Es kostete Mühe, ihm begreiflich zu machen, daß alles bis zum Abgang des Dampfers im Güterschuppen bleiben sollte.
»Haben Sie jemand von Ihrer Familie verloren, Mr. Ten Tschaik?« fragte Tschuschner, um die Aufmerksamkeit des schlauen Chinesen von Melittas verstörtem Gesicht abzulenken. »Ich sehe mit Bedauern ein weißes Band in Ihrem Zopf.«
» Son. Makee die. Bought him, pipe years ago in Hongkong, quite littee, littee.«
»Woran starb er denn?«
» Belong sick. Takee too muchee medicine; no good. Me buy other one, next year, all the same Hongkong,« war die philosophische Antwort.
Pünktlich kam er dann mit seinen Satelliten wieder. Es fiel Melitta ein Stein von der Seele, als sie die Gepäckstücke fortschaffen sah.
»Nicht dieses hier,« sagte sie, als die Chinesen sich anschickten, einen flachen Mahagonikasten aufzunehmen. »Dieses bleibt hier.«
» To Diet-Sab?« fragte einer der Leute.
»Nein!« Melitta besann sich einen Augenblick, strich dann die Adresse aus und setzte darunter: » To the Misses Cherry«. Die Überraschung und Freude der fünf erwachsenen Töchter des Doktor Cherry, als sie die Kiste öffneten und darin einen Brautanzug fanden, so wundervoll, wie sie noch keinen gesehen hatten!
»Noch diesen einen Tag!« dachte Melitta, als sie am Morgen des Tages erwachte, der ihr Hochzeitstag hatte sein sollen. Beim Frühstück suchten sie sich durch gleichgültiges Gespräch über die Zeit hinwegzutäuschen, als der Boy grinsend den Diener eines mit Dietert befreundeten Herrn einließ, der ein feines Körbchen mit weißen Blumen und die Glückwunschkarten von Colonel, Mrs. und Miß Green überbrachte.
»Wirf dies fort,« sagte Tschuschner und hielt dem erstaunt zögernden Boy das Körbchen hin, indem er zugleich dem fremden Diener nach der Tür winkte.
Der Mann regte sich nicht.
»Gib ihm ein Trinkgeld, Papa, daß er geht,« sagte Melitta ungeduldig.
Tschuschner reichte ihm einige Münzen, worauf der Diener umständlich Salaam machte und eine nach der anderen klingend in eine Falte seines Sarongs gleiten ließ; dann blieb er stehen. »Was geht denn der Kerl nicht?« fragte Tschuschner.
» Him belong card,« erwiderte der Boy.
Melitta stand auf, holte aus ihres Vaters Rock sein Taschenbuch und entnahm daraus eine Karte. »So, nun schreib ums Himmels willen ein paar Worte, damit man ihn nur los wird.«
Tschuschner schrieb ein paar Dankesworte und reichte die Karte dem fremden Boy – der regte sich immer noch nicht und machte wieder ein Zeichen.
»Was will der Mensch denn noch?« fragte Tschuschner, worauf der Boy erklärte, es müsse noch in einen Umschlag. Da diese Dinge alle eingepackt waren, so fand sich erst nach längerem Suchen ein viel zu großes Kuvert. Die Karte wurde hineingesteckt und dem Boten zugeworfen, der sie um und um drehte und die Bewegung des Schreibens machte. »Um Gottes willen,« sagte Melitta halb weinend, »was kann er noch wollen!«
» Write: Colonel-Sab, – Memsab, – here« – zeigte der Boy. Melitta nahm dem Manne das Kuvert unsanft aus der Hand und schrieb die Adresse – da endlich ging er. Gleich darauf erschien Dieterts Butler und überreichte mit tiefem Salaam einen weißen Brautstrauß.
» Clear out!« donnerte Tschuschner den Unglücklichen an, der vor Schrecken mit offenem Munde und aufgerissenen Augen stehen blieb, aber hastig verschwand, als Tschuschner zornig aufsprang. Draußen hörte man ein langes Geflüster. »Was ist?« fragte Tschuschner, auf den Treppenabsatz hinaustretend, von dem der Butler sich eiligst davon machte. Der Boy erklärte, der Barra-Sab habe den Strauß für heute bestellt gehabt, aber als man ihn gebracht habe, hätte er den Butler angefahren: » Go debil«, – woraus der Butler geschlossen hätte, der Strauß sollte anstatt dem Barra-Sab der Memsab gebracht werden, und nun wüßte er gar nicht wohin damit.
Das Körbchen aber fand der Boy mit Recht zu gut, um fortgeworfen zu werden; er schenkte es einer farbigen Zofe. Die stellte es in ihr Fenster, wo Melittas Auge darauf fiel, so oft sie die Veranda betrat.
Indessen die Stunde schleicht auch durch den längsten Tag. Endlich kam der Augenblick, wo Melitta und ihr Vater wieder auf dem Dampfer standen, der mit langsamen Stößen seine Fahrt stromabwärts antrat. Die Sonne goß eine Flut von goldenem Licht über die Landschaft, in den Leichtern sangen die Kulis bei der Arbeit ihr eintöniges: » A-la-eia-mari!« Am Ufer badeten die Elefanten, die Spitze der Pagode blitzte – es war alles so schön, wie am ersten Tag. Aber Melitta sah es nicht mehr. Sie kehrte der leuchtenden Herrlichkeit den Rücken und heftete ihre Blicke auf die flache Dallaseite, wo in dem öden Felde hinter dem Ufersaum schwerfällig ein mit Zebus bespannter Karren fuhr. Bis an ihr Lebensende blieb jede Einzelheit des reizlosen Bildes in ihrer Seele haften, – die aus einem Stück geschnittenen ungefügen Räder, die Form des primitiven Fuhrwerks, der Lenker, auf der Deichsel stehend, die kleine Staubwolke, die bei jedem Ruck des schwerfälligen Gespanns aufwirbelte. Tschuschner lehnte, eine Zigarre rauchend, an der Reeling und starrte trübe vor sich hin. Er rief sich Melittas glückstrahlendes Gesicht bei der Ankunft ins Gedächtnis und wollte Dietert zürnen, aber der arme Junge tat ihm doch auch so unsäglich leid. Unter der Menge an dem Pier glaubte er seine weiße Gestalt zu erkennen, doch war er dessen nicht gewiß.
Fanny stieß einen Freudenschrei aus, als Melitta und ihr Vater die Verandatreppe hinaufstiegen. »O, Ihr goldenen Leute!« rief sie. »Habe ich es nicht gesagt, daß man Urlaub bekommt, wenn man ihn nur ernstlich genug verlangt! Und nun macht Ihr gar eine ordentliche Hochzeitsreise. Um Gott, Melitta! was ist Dir? Bist Du krank! Wo ist Dietert?«
»Frage jetzt nicht, Fanny,« sagte Tschuschner, »warte, bis Ihr allein seid.«
Bald gingen Tschuschner und Albert in einem abgelegenen Teil des Gartens auf und nieder. Man hörte abgerissene Worte wie: »unfaßbaren Leichtsinn« – »geradezu unverständlich«. Die beiden Freundinnen besprachen sich in Fannys Ankleidezimmer.
»Du bist so still, Fanny,« sagte Melitta endlich.
»Ja, weißt Du, es ist schwer, etwas darüber zu sagen. Du hast keine Idee, wie sie hier auf die Farbigen heruntersehen; sie zählen eigentlich überhaupt nicht mit. Und weißt Du, Männer denken über solche Sachen ganz anders als wir; ich glaube, daß viele das gar nicht als genügenden Grund zum Bruche ansehen würden. Und ich meine, Du könntest Dich von jetzt an auf Dietert verlassen. Wenn alle Frauen das Vorleben ihrer Männer kennten –«
»Fanny,« unterbrach Melitta, »darum handelt es sich nicht. Was früher war, danach zu fragen hat man vielleicht kein Recht – aber er ging fort als mein Verlobter, er betrachtete sich so, und wenn ich auch frei sein sollte, so wußte er doch sicher, daß ich ihm gut war; jedenfalls war er gebunden und – und« – hier wurde sie purpurrot – »das kleine Kind war etwa dreiviertel Jahr – und er ließ mich unter sein Dach kommen und hatte das Frauenzimmer im Hause.«
Fanny schwieg.
»Sage mir eins,« fragte Melitta, »hättest Du Albert das verzeihen können?«
Auch über Fannys Gesicht zog eine helle Röte, als sie zur Antwort gab: »Ich glaube – ja. Natürlich wäre ich erst furchtbar böse gewesen und hätte ihm auch gesagt, daß nun alles aus wäre, aber wenn er nun recht gebeten hätte und versprochen, es solle nie wieder vorkommen – ich hätte da doch nicht widerstehen können und hätte es verziehen.«
»Und vergessen auch? Fanny, kann man so etwas vergessen?«
»Ja,« sagte Fanny, »vergeben ist vergessen. Man denkt dann eben nicht mehr daran. Und wir wären dann doch noch glücklich geworden. Aber Ihr – was habt Ihr nun?« Sie weinte bitterlich. Melitta stand unruhig auf und ging auf die Veranda. Es war noch derselbe Mond, der in den Wipfeln der Palmen spielte, als sie zuletzt hier stand; die Pagodablume duftete wie damals, die Linie der Bucht hob sich weiß-glänzend gegen den dunklen Himmel. Aber sie sah es nicht. Träne auf Träne rann über ihre Wangen; doch weinte sie nicht um Dietert, um ihre verlorene Liebe und ihr verstörtes Glück, – es war Heimweh, das sie überkam, heiße, schmerzliche Sehnsucht nach der guten alten Heimat im fernen Deutschland, nach der, trotz manchem Schweren, doch so glücklichen, wohlbehüteten Jugend, nach der Mutterliebe, die ihr entrissen war. Tante Lydia hätte ganz anders die schwere Zeit mit ihr getragen; sie hätte ihr nicht zugemutet, einen Mann zu heiraten, dem sie nicht länger vertrauen konnte, der sich um ihre Achtung gebracht hatte. Und noch einer – Volckardt hätte sie verstanden. Sie erinnerte sich, wie er ihr einstmals, nach einem Zerwürfnis mit Dietert, gesagt hatte: »Ich kann es aus der Schwäche und Eigenart seines Charakters verstehen, aber vertrauen wie vordem kann ich ihm nie wieder.« Wo war Volckardt? In welchem Winkel der Welt schmiedete er sein Leben zurecht?! –
Fanny trat zu Melitta und küßte sie. » Don't lose heart,« sagte sie leise, »vielleicht wird noch alles gut.«
Indessen empfand Fanny bald, daß Melitta als sorgloses Mädchen und glückliche Braut eine andere gewesen war, als jetzt, wo die erlittene Enttäuschung und die jähe Schicksalswendung sie bedrückten. Es war ihr eine Überwindung mit Menschen zusammenzukommen; um Fanny nicht von dem gewohnten Verkehr zurückzuhalten, unternahm Tschuschner selbst täglich weitere Fahrten mit seiner Tochter. Meistens ging es hinauf an die Wasserwerke, oder sie rollten auf der breiten, glatten Chaussee unter schattenden Bäumen quer über die Insel, bis der Weg sich senkte und sie den Meeresarm vor sich hatten, der die Insel vom Festlande trennt. Zur Zeit beachtete es Melitta nicht, aber wenn sie später an diese Tage zurückdachte, fühlte sie die Sorge und Zartheit, mit der ihr Vater sie damals hegte und pflegte wie ein krankes Kind. Meistens saß er schweigend neben ihr und ließ ihr vollkommene Ruhe, dann wieder, wenn der finstere Ausdruck ihres Gesichts nicht weichen wollte, erzählte er ihr allerhand von seinen früheren Erlebnissen; von ihrer jungen Mutter sprach er, die er sonst nicht zu erwähnen pflegte. Er sagte ihr nicht, wie sehr er sich Jahre hindurch gesehnt hatte, in ihrem Gesicht jenen stillen Ausdruck vollkommenen Glückes wiederzusehen, der ihn noch in der Erinnerung bewegte, – doch teilte er ihr kleine Züge und Eigenheiten seiner Melitta mit, die sonst nie über seine Lippen gekommen wären. So erschloß er ihr in dieser Zeit das Heiligtum seiner Seele, und sie lernte ihn besser kennen und verstehen, als in all den vergangenen Jahren. Sie erinnerte sich später mit Rührung daran, wie er manchmal seine Hand beruhigend und schützend auf die ihre legte, als wollte er sagen: »Laß Dir an meiner Liebe genügen.«
Indessen, solange der Kranke fiebert, hilft kein Zureden und verfängt kein Trost. Erst viel später, vielleicht erst nachdem wir sie längst verloren haben, kommen uns der Reichtum und die Tiefe einer solchen Liebe zum Bewußtsein.
»Eure Wege hier sind vortrefflich,« sagte Tschuschner eines Abends bei Tisch, »aber Ihr habt doch eigentlich recht wenig Abwechselung.«
»Sie kennen ja den Strand mit dem Kokoswäldchen noch gar nicht, wo die schöne Welt hier in die Sommerfrische geht und in der See badet,« meinte Albert, »und im Westen liegt ein ganzes Labyrinth von kleinen bewaldeten Inseln und Buchten, zwischen denen man fährt, wie aus einem Landsee in den anderen.«
»Dahin möchte ich,« sagte Melitta.
»Das läßt sich leicht machen. Sie gehen morgen früh mit unserer Steamlaunch hinaus, – ich werde mit Harries sprechen; er muß Sie bei Pulo Barri absetzen. Dort finden Sie jederzeit einen Sampan, der Sie umherrudern kann. – Du mußt etwas Frühstück zurechtmachen, Fanny. Sie treiben sich dort umher, wie es Ihnen gefällt, und um 10 Uhr etwa holt Sie die Steamlaunch wieder ab.«
Der Vorschlag wurde angenommen. Es war ein etwas bedeckter Tag; die Glut eines solchen gilt in Indien für gefährlicher als die Helle Sonne, aber Melitta empfand das etwas verschleierte Licht wohltuend. Nach dem Geklapper des unruhigen kleinen Dampfers und dem Geruch von Öl und heißem Eisen war ihr die rhythmische Bewegung des Ruderns angenehm. Sie hatten im Schatten eines weitüberhängenden Baumes etwas gefrühstückt und fuhren eben aus einer schmalen Wasserstraße in eine breitere, als der Sampanboy bemerkte: » Memsab belong sick,« ›Herrin Sahib krank.‹ Tschuschner, der in Gedanken versunken gesessen hatte, sah auf und ließ die Zigarre ins Wasser fallen. Melitta lehnte weiß und regungslos gegen die Rückwand ihres Sitzes. Er rief sie an, und sie sah auf, aber offenbar ohne Verständnis. Hastig tauchte er ihr Taschentuch ins Wasser und legte es auf ihre Stirn. Dann blickte er rings an den Ufern entlang; nirgends war eine Ansiedlung zu sehen; endlich erspähte er auf einer Anhöhe zwischen Baumwipfeln ein Dach. »Was ist das dort oben?« fragte er.
» Vernon Sab's place,« sagte der Sampanmann. Tschuschner zeigte dem Malayen ein Goldstück. »Das bekommst Du, wenn Du in fünf Minuten dort drüben bist und mir hilfst, die Memsab hinauf zu bringen.«
» Yessee! yessee!« grinste der Mann und holte in langen Stößen aus, so daß sich die Ruder bogen. »Dorthin!« Tschuschner zeigte auf einen Steg, der von der Spitze einer kleinen Landzunge ins Wasser führte. Der Malaye schüttelte den Kopf, gab noch einen kräftigen Stoß, zog die Ruder ein, und das leichte Boot glitt im Schwunge vorwärts durch das rauschende Schilf und fuhr hoch in den Schlick des Ufers hinein. Auf einen Pfiff des Sampanboys kamen zwei Fischer gelaufen; der eine hatte noch ein rundes Netz und eine dreizackige Gabel in der Hand. Sie zogen das Boot vollends an Land und halfen Melitta aus dem Sampan heben. Tschuschner und der Malaye nahmen sie auf; unwillkürlich legte sie den Arm um ihres Vaters Nacken. Die Fischer schritten voran und bogen Schilf und Zweige auseinander. So stiegen sie aufwärts, bis sie sich zwischen den Wirtschaftsgebäuden eines Bungalows befanden, und gingen dann ohne weiteres die Hintertreppe des Wohnhauses hinauf. Sie betraten das Speisezimmer, in dem ihnen mit verwundertem Gesicht eine brünette junge Dame in Weiß entgegenkam. Einige Worte genügten, sie aufzuklären.
»Bringen Sie die Kranke hier herein, es ist das luftigste Zimmer.« Sie schritt voran in eine große, einfache, aber sehr behagliche Schlafstube.
»Hier, gleich auf das Bett,« befahl sie, winkte den Leuten, sich zu entfernen, und gab einer erstaunt eintretenden Ayah den Auftrag, sofort Eis zu bringen. Sie selbst half Melitta Kleid, Schuhe und Strümpfe ausziehen, löste das schwere Haar und legte es über die Kopfrolle zurück, dämpfte durch die Stäbe der Rollfenster das zu grelle Licht, ohne die durchstreichende erfrischende Seebrise auszuschließen, und erneuerte selbst von Zeit zu Zeit den Eisumschlag auf Melittas Stirn und Kopf. Bald schlief diese fest in der erquickenden Kühle und Dämmerung.
Tschuschner erklärte der jungen Dame nun mit leiser Stimme, wie seine Tochter zu dem Sonnenstich gekommen war. Sobald Mrs. Vernon hörte, daß die Steamlaunch bei Pulo Barri warte, beauftragte sie einen Boy, sie fortzuschicken. »Alles hängt davon ab, daß die Dame ruhig gehalten wird und womöglich schläft. So kommt sie wohl mit dem Schrecken und ohne weitere schlimme Folgen davon.«
Tschuschner dankte ihr mit Wärme.
»Ich bedaure nur, daß Mr. Vernon abwesend ist,« sagte sie, »und Sie also keine andere Gesellschaft außer der meinen haben werden.«
Das konnte er sich jedoch gefallen lassen; sie war eine elegante Erscheinung, hatte feine Züge und dunkle Augen. Etwas Kindliches und Gewinnendes lag in ihrem Ausdruck, obwohl man ihr das Mischblut ansah. Sie aßen allein, und abends geleitete sie den Gast in das Fremdenzimmer gegenüber.
»Ich schlafe neben Ihrer Tochter,« sagte sie; »ich denke, sie wird die Nacht durchschlafen. Jedenfalls bin ich zur Hand, wenn sie etwas brauchen sollte.«
In der Tat erwachte Melitta am Morgen neugestärkt, nur in den Knien empfand sie noch etwas Schwäche. Sie fand ihren Vater und Mrs. Vernon im Eßzimmer, das der frische Morgenwind durchwehte. Draußen hörte man eine Kinderstimme. »Die Ayah soll ihn hereinbringen,« sagte Mrs. Vernon. Gleich darauf erschien die Wärterin mit einem wohlgerundeten Baby, das, nur mit dem Hemdchen bekleidet, jauchzend auf seine Mutter zustrebte, die den Kleinen auf den Arm nahm und mit berechtigtem Stolz zeigte. Wie der Knabe so auf ihrem Arm saß wie auf einem Thron und die Fremden mit ernsten, dunkeln Augen ansah, den Kopf voll brauner Locken, konnte er wohl an den der Sixtina erinnern. Melitta streckte dem Kinde die Arme hin, es langte nach ihr, und Mrs. Vernon gab ihr den Kleinen auf den Schoß. Während sie mit ihm spielten, erklärte Mrs. Vernon, sie habe sie noch in der Morgenkühle in die Stadt bringen lassen wollen, aber der Chemiker des Geschäfts sei ausgefahren und der Wagen könne vor einer Stunde nicht zurück sein. Sie möchten sich so lange an der Nordseite der Veranda aufhalten, wo es jetzt am kühlsten wäre; sie würde ihnen folgen, sobald sie Johnny hingelegt hätte. Tschuschner begab sich auf die Veranda, Melitta verweilte noch etwas im Zimmer des abwesenden Hausherrn, durch das sie zu gehen hatten. Es war einfach und behaglich, und sie musterte eine Weile die Büchergestelle, auf denen neben den einschlägigen Fachwissenschaften und englischen Klassikern eine Anzahl Reisebeschreibungen und andere Werke von allgemeinem Interesse standen. Einige Bände von Goethe und Rückert, Homer und Herodot in deutscher Übersetzung neben Dante zeigten, daß der Besitzer verschiedener Kultursprachen mächtig war, die » Nature« lag auf dem Schreibtisch, – freilich eine andere Bücherei als die von Dietert, vor dessen Schrank sie einmal gestanden und nicht gewagt hatte, unter den Zolas, Gyps, Kocks u. dergl. eine Wahl zu treffen.
»Stehe nicht so lange, Melitta! Komm hierher, es lohnt sich!« rief ihr der Vater zu. Mit einem Laut des Entzückens trat Melitta aus der Tür. Die Bucht breitete sich vor ihnen aus wie ein einsamer Landsee, umsäumt von waldigen Inseln, deren Spitzen in der Morgensonne glänzten. In der Ferne leuchtete das Meer, und am Horizont zog ein Schiff mit rötlich angestrahlten Segeln seine stille Bahn. »Hier möchte ich bleiben, Papa, hier ist es friedlich,« sagte Melitta.
»Ganz kann man die Menschen auf die Dauer doch nicht entbehren,« meinte Tschuschner.
Nach einer Weile trat Mrs. Vernon zu ihnen mit der Meldung, der Sampan wäre bereit, sie nach dem Festland überzusetzen; man sähe den Wagen kommen. Sie geleitete sie selbst einen schattigen Pfad hinab, an geschwärzten Gebäuden und hohen Schornsteinen vorüber, bis an den Kai, wo, wie sie erläuterte, die Schiffe das Zinn und den Anthrazit für die Zinnschmelze löschten, die ihr Mann leite. »Hier,« wandte sie sich dann etwas verlegen zu Melitta, »nehmen Sie diesen blauen Schleier – er ist leider etwas verbraucht; ich habe ihn öfter über Johnnys Korb gedeckt, aber ich habe keinen anderen, nicht einmal eine dunkle Brille, die ich Ihnen anbieten könnte, und Sie müssen sich durchaus vor grellem Sonnenlicht hüten.«
»Wenn ich je ein Vorurteil gegen Farbige gehabt hätte, so wäre ich jetzt davon geheilt,« meinte Melitta, als sie den Weg von Tanjong Paga nach Singapore zurücklegten und sie die Wohltat des blauen Schleiers empfand.
»Ich denke, in dieser Beziehung hast Du Dir wenig Vorwürfe zu machen.«
»Du vielleicht, Papa?«
»Ich schon eher. Ich habe zu lange unter farbigem Volk jeder Schattierung gelebt, um das Vorurteil ganz abzustreifen.«
»Nun, wenn Du selbst zugibst, daß es ein Vorurteil ist, mag es hingehen,« sagte Melitta.
Wer ist's, der dort vom Licht der Sonne
Den unfreiwillig schweren Abschied nimmt?
Shakespeare.
Es verstand sich von selbst, daß Melitta ihren Vater nach Shanghai begleitete. Zwei Wochen später gingen sie an Bord des Star of Birma. Albert hatte ihnen Plätze besorgt. »Sie werden fahren wie in Abrahams Schoß,« hatte er gesagt. »Es ist vornehme Gesellschaft an Bord. Es wurde mir erzählt: ein früherer Vizekönig, der in Australien Minen besitzt, begibt sich mit seiner Familie dorthin, läuft aber erst in Geschäften Shanghai an.«
Tschuschner war aufmerksam geworden. »Wer ist es denn?«
»Lord Fanshaw.«
»Den habe ich als jungen Mann in Adelaide gekannt,« sagte Tschuschner. »Damals war er Mr. Neville, Gerard Neville, ein allerliebster Mensch. Ich hörte schon, daß er später Lord Fanshaw geworden wäre und eine große Karriere gemacht hätte. Ein sehr angenehmer Gesellschafter, Du wirst Dich freuen, ihn kennen zu lernen, Melitta.«
»Mich verlangt wenig nach neuen Bekanntschaften,« antwortete Melitta abweisend. Die Schwäche ihres Vaters für hochgestellte Persönlichkeiten war der stolzen kleinen Hamburgerin von jeher peinlich gewesen. Daß die Sache in diesem Falle etwas anders lag, daß ihr Vater diesem Mr. Neville seinerzeit einen zu bedeutenden Dienst geleistet hatte, als daß es der eine oder der andere hätte vergessen können, ahnte sie nicht. Es berührte sie daher unangenehm, als sie am Morgen nach ihrer Abreise an Deck kam und ihren Vater schon in voller Fahrt mit dem früheren Würdenträger begriffen fand. Sein » your Excellency« und » your Lordship« schallte über das Deck.
Auf der anderen Seite unterhielt sich sehr laut und frei eine englischamerikanische Gesellschaft, von der sich plötzlich ein blau- und weißgestreiftes Zebra mit großgewürfeltem Sonnenschirm und blauer Schirmmütze loslöste und auf Melitta zueilte – Miß Miller.
»Ist es möglich, my dear Mrs. Dietert! Sie hier?«
»Ich bin Miß Tschuschner; ich reise mit meinem Vater,« sagte Melitta mit Eiseskälte. Sie ging an der völlig außer Fassung gebrachten Dame vorüber, hinter das Kartenhäuschen, wo sie auf einen leerstehenden Stuhl niedersank und den Schrecken zu überwinden suchte. In ihrer Nähe lag nur eine sehr einfach gekleidete, blonde Dame lesend auf einem Deckstuhl; weiterhin spielten ein paar niedliche Kinder. Ein kleines Mädchen fiel dicht neben Melitta über seinen Reifen. Melitta nahm das Kind auf und redete ihm zu.
»O danke,« sagte die junge Dame, »komm zu mir, Annie, komm zu Mama.«
»Ich wußte nicht, daß es Ihre Kinder sind,« erklärte Melitta mit halber Entschuldigung. Die Dame dankte nochmals und legte ihr Buch nieder. Melitta, der in diesem Augenblick jede Ablenkung willkommen war, ließ sich willig in ein Gespräch ziehen. Sie sah sich nicht nach ihrem Vater um, von dem sie wußte, daß er darauf brannte, ihr seinen Lord zuzuführen. In der Tat sah er so unverwandt nach ihr hin, daß die Frage nach dem schönen Mädchen nicht ausbleiben konnte, ebensowenig nach erhaltener Auskunft die Bitte, ihr vorgestellt zu werden. Mit Verdruß sah Melitta die beiden Herren auf sich zukommen. In der strahlenden Miene des Vaters und der abweisenden der Tochter war unschwer zu lesen. Der alte Diplomat mit dem feinen Gesicht und den klugen Augen lächelte ein wenig über die herbe kleine Schönheit.
»Es ist wunderbar, wie man sich im Leben wiederfindet,« sagte er. »Ich habe Ihren Vater gekannt, als wir beide noch keine solchen Grauköpfe waren, wie jetzt. Man würde noch ganz anders um seine guten Jahre trauern, wenn man sich nicht an seinen reizenden Töchtern trösten könnte. Sie erlauben mir, Ihnen meine Tochter vorzustellen, Lady Frances Hammond.«
Die blonde junge Frau hatte sich erhoben und reichte Melitta die Hand.
»Wir haben bereits Bekanntschaft gemacht,« sagte sie artig. Während sich nun die beiden jungen Damen miteinander unterhielten, gingen die Herren rauchend und plaudernd auf und nieder.
»Ja, das Leben spielt seltsam.« Nachdenklich wiederholte es Lord Fanshaw. »Wer hätte gedacht, daß wir uns je wieder auf einem Schiffe begegnen würden, unterwegs nach dem alten Ziel?«
Ihre Augen trafen sich; dieser Blick überbrückte die Kluft der dazwischen liegenden Jahre und trug sie zurück in die Zeit, wo sie in heißer Arbeit Schulter an Schulter gestanden hatten.
»Dort unten steht nicht alles, wie es sollte,« sagte Tschuschner. »Mich hielten Familienrücksichten, sonst wäre ich schon vor einem Jahre hingegangen.«
»Ich habe meinen Sohn hingeschickt; er schreibt besorgt. Sie haben wieder dreißig Arbeiter entlassen; es scheint, daß das Kupfer wirklich versagt. Nun, wir haben unser Gutes gehabt. – Es war ein Beweis mehr für Ihr sprichwörtliches Glück, daß sich wenigstens Kupfer fand, wo Sie nach Gold suchten.«
»Es war besser als Gold,« sagte Tschuschner. »Gold ist und bleibt eine Lotterie.«
»Überraschend bleibt es immer. Niemand hätte so etwas erwarten können, und wenn Sie damals nicht noch in der Nacht die fünf Stunden geritten wären, um mir die Nachricht zu bringen, so hätte ich am Morgen meinen Anteil um einen Pappenstiel losgeschlagen. Mein ganzes Leben wäre dann anders geworden. Jedenfalls hätte ich nicht zur gegebenen Zeit nach England zurückkehren können, um meinen Onkel nach Indien zu begleiten; diesen Weg wenigstens hätte ich dann nicht gemacht.«
»Es ist bei alledem ein seltenes Mißgeschick, daß ein Kupferbergwerk so plötzlich und so gänzlich versagt,« bemerkte Tschuschner. »Indessen – solange die Bank sicher ist –«
Er fing einen schnellen Blick auf, den ihm Lord Fanshaw von der Seite zuwarf. »Haben Sie etwas Beunruhigendes gehört?« unterbrach er sich.
»Ich habe allerdings mancherlei gehört, das mir nicht gefällt. Mein Sohn schreibt, man befürchte allgemein, daß die Bank sich nicht würde halten können, wenn das Bergwerk einginge.«
»Dagegen war Vorsorge getroffen,« sagte Tschuschner. »Die Statuten bestimmen ausdrücklich, wie weit die Bank gehen darf –«
»Die Statuten, mein lieber Freund! Wenn sie sich nun nicht an die Statuten gekehrt haben, was wollen Sie machen? Ich wurde gleich stutzig, als sie Bowring zum Direktor machten und zugleich Simmermann in den Aufsichtsrat kam; das hieß den Bock zum Gärtner setzen. Wir Aktionäre werden tüchtig zuzahlen müssen, fürchte ich; aber ich hoffe doch, wir werden mit einem blauen Auge davon kommen. Jedenfalls ist es gut, daß wir nach dem Rechten sehen.«
Melitta war zu ihnen getreten, und Lord Fanshaw verabschiedete sich. Tschuschner drehte seine Zigarre zwischen den Fingern und blickte nachdenklich über das Wasser. – »Papa,« sagte Melitta beunruhigt, »was machen wir, wenn die Kupferminen versagen und die Bank verkracht?«
»Dann machen wir eben etwas anderes, Pussy.« Tschuschner sah sie halb belustigt und halb bekümmert an. »Ängstige Dich nicht, es wird schon genug da sein, um Dir Handschuhe und Schokolade zu kaufen. Du wirst das Leben vielleicht von einer etwas rauheren Seite zu sehen bekommen als bisher; aber wie ich Dich kenne, wird Dich das nicht schrecken. – › Never despair‹ ist mein Wahlspruch, den mache auch zu deinem.«
Lord Fanshaw und seine Tochter waren sehr zuvorkommend gegen Melitta; sie gefiel ihnen, und ihre Bekanntschaft war für späteren Verkehr belanglos. Die Versuche ihrer Landsleute, sich ihnen zu nähern, ließen sie gelassen von sich abgleiten. Das trug den beiden Deutschen manchen scheelen Blick von der übrigen Gesellschaft ein. Als Melitta vor dem Tiffin ihre Kabine aufsuchen wollte und in den Salon hinunterkam, standen einige Damen, darunter eine dicke alte Engländerin, so gedrängt in dem Gange vor ihr, daß sie genötigt war, stehen zu bleiben und das Ende einer rücksichtslosen Unterhaltung anzuhören, deren Gegenstand, eine brünette Dame in Trauer, soeben in der Tür ihrer Kabine verschwand. Der farbige Steward stand mit seiner Serviette unter dem Arm vor den erregten Damen.
»Auch neben mich setzen Sie sie auf keinen Fall,« sagte eine junge Frau.
» Very well, M'm,« sagte der Steward.
»Ebensowenig neben mich,« rief eine andere Stimme.
» Very well, M'm.«
»Ich habe nichts gegen diese half-castes, sie können nichts dafür,« sagte die dicke Dame, »aber warum kann die Dampferlinie nicht dafür sorgen, daß sie an einen besonderen Tisch gesetzt werden. Es ist zu viel verlangt, daß man mit ihnen, essen soll, mir nimmt es den Appetit.«
»Steward!« Melitta machte ihr ›Prinzessinnengesicht‹. »Sie können die Dame neben mich setzen. – Darf ich bitten?« wandte sie sich an die vor ihr Stehenden. Man machte ihr Platz, und sie hörte noch, indem sie ihre Tür hinter sich schloß: »Deutsche Sentimentalität!« – »Unverschämtes Gänschen!« – »Ein paar Monate in Indien schleifen das schon herunter!«
Der Platz neben ihr blieb übrigens leer, beim Tiffin und auch beim Diner.
Sie hatten bereits die Bankastraße hinter sich und bogen in die Sundastraße ein. Tschuschner und Lord Fanshaw standen mit ihren Töchtern und dem Kapitän zusammen auf Deck und sprachen über den Ausbruch des Krakatoa, dessen Riesenhaupt sich schon voraus zu heben begann. Der Kapitän erzählte, er wäre damals hier als Steuermann gefahren. Es wäre schrecklich gewesen, als sie nach dem Erdbeben ihre regelmäßige Fahrt durch die Sundastraße wieder aufnahmen und alles verändert fanden; das Wasser bedeckt mit Bimsstein und Trümmern, zwischen denen Leichen trieben, der Feuerturm auf »vierte Punt« verschwunden, die Ufer verschlammt, kahle Flecke auf den Bergen; altbekannte Landmarken, wie hohe Bäume und Felszacken, suchten sie vergebens; und als sie in Anjer die Post abgeben wollten, fanden sie die Stadt nicht wieder, denn sie war gänzlich zerstört, und am Hügel sah man, wie unglaublich hoch das Wasser gestanden hatte. Unterwegs wäre ein Boot herangekommen, in dem ein paar halbverhungerte Malaien saßen. Sie erzählten, wie sie eine riesige Welle hätten heranrollen sehen und wie sie den Berg hinaufflüchteten, und wie das Wasser hereinbrach und alles fortwusch und manchen, der sich schon in Sicherheit glaubte, noch erhaschte und hinunterriß. Einer der Männer aß und trank mit tierischer Gier und starrte dann vor sich hin; es war kein Wort aus ihm herauszubringen; die anderen erzählten, er hätte seine Eltern, alle seine Geschwister, seine Frau und sieben Kinder bei der Katastrophe verloren; nun suchte er sie immer und wüßte nichts mehr von sich.
»Schrecklich!« sagte Lady Frances.
»Erdbeben sind schrecklich,« meinte auch Lord Fanshaw, »ich war in Nizza zur Zeit des Erdbebens an der Riviera. Ein Freund von mir, ein Arzt, wollte seine Schwester wecken, als die ersten Stöße erfolgten, und als er die Tür zum Korridor aufmachte, wäre er fast in die Tiefe gestürzt, denn der Korridor und der ganze Seitenflügel des Hauses waren fort. Er knüpfte sein Plaid und sein Bettuch zusammen und ließ sich so hinunter. Noch nach Wochen zitterten ihm die Hände, wenn die Rede auf diese Erlebnisse kam.«
»Ich war fünf Jahre nach dem Erdbeben in Mendoza,« sagte Tschuschner, »es war noch gänzlich zerstört, – der zusammengeschossene Stadtteil in Straßburg, im Jahre 1870, erinnerte mich daran.«
Lady Frances lenkte ab: »Schade, daß man an all diesen reizenden kleinen Inseln so schnell vorüberfahren muß. Man möchte an einer oder der anderen gerne anhalten und ein wenig auf ihr umherklettern.«
»Das geht freilich nicht an,« sagte Tschuschner, »aber etwas näher an sie heranzukommen, das müßte sich doch machen lassen. Das Schiff läuft längst nicht volle Fahrt und solch ein kleiner Umweg wäre bald wieder eingebracht. Was sagen Sie, Kapitän? Für einen jungen flinken Seemann wie Sie, müßten die Wünsche schöner Frauen Befehl sein.«
»Sind sie auch – sind sie auch!« Der Kapitän schmunzelte. »Von Anlegen ist natürlich keine Rede, aber etwas darauf zuhalten und langsamer vorübergehen, das will ich wohl riskieren.«
Sie hatten die Insel Dwars-in-den-Weg passiert, und der Kapitän sah spähend vorauf, wo am Horizont wieder ein Inselchen auftauchte. Die Sonne war mittlerweile gestiegen, und Melitta begab sich in die Kajüte hinunter. Eben trat die farbige Dame in Trauer aus ihrer Kabine. Beide faßten sich ins Auge, stutzten und eilten dann mit einem Ruf der Überraschung aufeinander zu.
»Sie, Mrs. Vernon!« rief Melitta. »Und in Trauer –?«
Die Lippen der jungen Frau zitterten. »Johnny,« sagte sie tonlos.
»Johnny! Dieses schöne kräftige Kind, dieser reizende kleine Kerl!«
Die junge Mutter weinte still.
»Sonnenstich,« sagte sie. »Die Ayah holte seine Milch, und währenddem war er aus dem Schatten gekrochen. Der helle Sonnenfleck neben seiner Matte hatte ihn angelockt. Ich sah es von der Veranda aus und lief hinunter, aber es war zu spät.«
»Und Sie haben sich jetzt von Ihrem Mann trennen können?«
»Er hat mir selbst zugeredet,« erwiderte Mrs. Vernon. »Mein Vater hatte uns geschrieben, meine Mutter sehne sich so sehr nach mir; sie hat ein qualvolles, unheilbares Leiden, den Krebs, scheint es. Mein Mann meinte, wenn Mama stürbe, ohne daß ich ihr den letzten Wunsch erfüllt hätte, so würde ich es nie verwinden.«
»Wie kommt es, daß ich Sie noch gar nicht gesehen habe? Waren Sie krank?«
»Ich aß in meiner Kabine, – ich war nicht wohl, und dann – ich bin so wenig gewöhnt, unter Fremden zu sein. Jetzt, da Sie da sind, ist das anders.«
Tschuschner war nicht erbaut, als er beim Tiffin Mrs. Vernon neben seiner Tochter sah, war aber doch zu sehr Gentleman, um sie nicht mit Herzlichkeit zu begrüßen und ihr mit Wärme seine Teilnahme auszusprechen. Mrs. Vernon, die noch bei jeder Anspielung auf ihren Verlust nur mit Mühe ihre Fassung bewahrte, saß sehr still und blaß bei Tisch. Der Steward kam und fragte, ob sie Wein wünsche. Sie warf einen Blick auf die Karte und füllte dann die Anweisung aus, die ihr der Mann hinschob. Melittas Blick folgte mechanisch der schreibenden Hand. Plötzlich stieg ihr eine Blutwelle vom Herzen bis in die Stirn.
»Ist das Ihr Name?« fragte sie. »Ich glaubte, Sie hießen Vernon!«
»Wir werden immer so ausgesprochen, und ich nenne meinen Mann auch, wie man ihn nannte, als ich ihn kennen lernte. Dieser lange deutsche Name ist so unbequem, Wer-nin-gen.«
»Und Ihr Mann ist aus Hamburg, und heißt Volckardt?«
»Ja,« erwiderte Mrs. Vernon erstaunt, »kennen Sie ihn?«
»Sehr, sehr gut,« sagte Melitta, brach aber rasch ab, von den auf sie einstürmenden Gedanken überwältigt. So nahe war sie ihm gewesen! Unter seinem Dach, auf seinem Bett hatte sie geruht, an seinem Tisch gegessen! Es war seine Frau, die sie aufgenommen und wie eine Schwester gepflegt hatte, sein Kindchen hatte sie in den Armen gehabt! An seinem Schreibtisch hatte sie gestanden, seine Bücher betrachtet!
»Was hast Du?« fragte sie der Vater, der ihren bewegten Ausdruck und die erhöhte Gesichtsfarbe gewahrte.
»O Papa!« Ihre Augen leuchteten, wie seit Wochen nicht mehr. »Denke Dir, Mrs. Vernon ist Volckardts Frau!«
»Mrs. Vernon Volckardts Frau – wie ist das möglich?« fragte Tschuschner erstaunt.
»Sie englisieren hier die Namen; Werningen ist ihnen zu unbequem.«
»Und Volckardt hat eine – Farbige« wäre ihm beinah entschlüpft, doch hielt er es noch zurück und sagte: »Frau!«
»Und wo haben Sie denn Ihren Mann kennen gelernt?« wandte sich Melitta wieder an Mrs. Vernon. »Sie sagten mir doch, Sie seien aus der Nähe von Melbourne?«
»Mein Vater ist dort Vormann in einer Maschinenfabrik, und mein Mann kam dahin als Manager. Er gefiel mir gleich, aber ich dachte nicht, daß er sich etwas aus mir machte. Als er dann an die Zinnschmelze nach Pulo Barri gerufen wurde und meinen Eltern seine bevorstehende Abreise mitteilte, da – konnte ich die Tränen nicht zurückhalten und eilte aus dem Zimmer. Das rührte ihn, denke ich, und so kam es. Das war vor anderthalb Jahren.«
›Ja, das war vor anderthalb Jahren,‹ dachte Melitta. »Wie viel haben wir uns zu erzählen! Wir müssen noch einmal ganz von vorn Bekanntschaft machen,« sagte sie, als man sich von der Tafel erhob.
Es waren die heißesten Stunden des Tages, die Melitta mit einem Buche oder Fächer auf dem Bette liegend zu verbringen pflegte. Sie legte auch heute die Oberkleider ab und war im Begriff sich auszustrecken, als sie, wie schon öfter, eine Unebenheit der Matratze störend empfand. Sie hob das Kissen auf und sah darunter den Rettungsgürtel aus Kork, der für den Notfall in jeder Kabine eines Dampfers vorhanden sein muß. Melitta lächelte, als sie ihn vorzog, und begann ihn versuchsweise umzulegen. Eben hatte sie die Bänder befestigt, als ein furchtbarer Ruck sie über das Bett schleuderte. Zugleich flog die Tür der Kabine auf, und unter krachendem Schüttern des ganzen Schiffs und dem Getöse stürzenden Gebälks brach schreiend eine von Entsetzen gepeitschte Menge aus den vorderen und unteren Schiffsräumen, jagte in wilder Flucht durch den Speisesaal und drängte die Treppe hinauf. Melitta, die, von derselben Panik erfaßt, zitternd und bebend aus der Tür eilte, wurde mitgezogen und wäre zu Boden gerissen worden, wäre es ihr nicht gelungen, das Geländer der Treppe zu erfassen. »Kollision! – Kollision! Das Schiff sinkt!« gellte es von allen Seiten. Mit größter Anstrengung rettete sich Melitta aus dem furchtbaren Druck, der ihr den Atem benahm, auf einen Poller. Ein anderes Fahrzeug war nicht zu sehen; das Schüttern und Krachen und ein zitterndes Schurren dauerte fort. Das Schiff sackte nach hinten, eine Schaumwelle brach über das Vorderteil. Auf der Brücke liefen die Offiziere hin und her; man hörte Kommandorufe. Die Maschine stoppte. » Man the boats!« – und die entsetzten, heulenden Menschen drängten nach der Seite, wo das erste Boot niedergelassen wurde. Das Schiff begann zu rollen. Die Maschine nahm in einzelnen Stößen ihre Arbeit in entgegengesetzter Richtung auf – ein gurgelndes Zischen, und das Schiff schrapte zitternd zurück und senkte sich nach vorn.
Jetzt wurde die Menge von Wut und Wahnsinn erfaßt; sie stürzte sich auf das niederschwingende Boot. Ein alter gelber Kerl mit nur einem Auge zog den vor ihm Stehenden die Beine fort, während ein brauner Matrose mit verzerrten Zügen und blutendem Kopf mit einer eisernen Stange auf die Andrängenden einhieb, die blutend und heulend sich gegenseitig über Bord stießen. Das überfüllte Boot kenterte, ehe es zu Wasser kam. Wie rasend schlugen die Verzweifelnden um sich. Melitta mußte ihren Schwimmgürtel gegen eine Faust verteidigen, die daran riß.
»Die See kommt! – Die See kommt!« – Wie ein sterbendes Ungetüm schlug das Schiff mit dem Vorderteil; einen Augenblick schien das Wasser höher zu stehen als der Schiffsrand; es brach vornüber; ein langer, grauenhafter Schrei –
Melitta wartete nicht ab, daß die überstürzende Welle diese ganze kämpfende Menschheit über Bord fegte, sie sprang von der Reeling und schwamm, von der nachbrechenden Welle getragen, mit Aufbietung all ihrer Kräfte, um aus der todbringenden Nähe des sinkenden Schiffes zu kommen. So war sie in der Hamburger Schwimmanstalt nie geschwommen, wie jetzt, wo es das Leben galt. – War das Wimmern und Stöhnen, das dumpfe gurgelnde Zischen und Ziehen in ihrem Ohr, vor oder hinter ihr?! In Todesangst schüttelte sie eine Hand ab, die sich an sie klammerte; sie trat einen Kopf zurück, den sie an sich fühlte. Gurgelnd kreiste es plötzlich um sie her und zog und saugte nach unten. Mit aller Kraft strebte sie fort. Da schwoll das Wasser unter ihr und hob und trug sie weiter. Nun war alles still; noch ein gellender Schrei hallte über das Wasser; noch einer und noch einer. Erschöpft und von Grauen gepackt hielt sie an und blickte zurück – schrecklicher als alles, das sie hätte sehen können, war die weite ruhige Öde; von dem stattlichen Schiff war nichts mehr zu erblicken; die See lag in ruhiger Bläue, nur hier und da schwammen losgerissene Trümmer, Tonnen und Balken, an denen dunkle Gestalten klebten, weiterhin ein dunkler, wechselnder Fleck, ein unentwirrbarer Knäuel menschlicher Leiber, die sich im Todeskampf ineinander verschränkten und aus dem halbersticktes Schreien und das Angstgebrüll der Verzweifelnden über das Wasser erscholl; es war indessen zu weit und Melitta lag zu tief, als daß sie irgend etwas hätte erkennen können. Sie war allein, ganz allein in dem weiten Blau, unter der niederprallenden Sonne; unerreichbar fern das rettende Ufer. Sie fühlte die Kräfte schwinden und trieb auf dem Rettungsgürtel. Da bemerkte sie nicht weit von sich einen Gegenstand, ein Stück Lattenverschlag, eine Tür vielleicht; sie schwamm darauf zu, und es gelang ihr, sich hinauf zu ziehen. Sie hatte noch die Geistesgegenwart, ihr dichtes Haar gegen den Sonnenbrand um Kopf und Nacken zu winden, dann vergingen ihr die Sinne.
Das erste, das ihr wieder zum Bewußtsein kam, war das Geschnatter von Malaien; gleich darauf fühlte sie sich am Handgelenk gefaßt, und jemand suchte ihr den Goldreif abzustreifen. Unwillkürlich zog sie den Arm zurück; zugleich ließ sich die scheltende Stimme eines alten Mannes vernehmen, und die fremde Hand gab die ihrige frei. Ihr kleines Floß mußte nun an einem Boote befestigt worden sein, denn es ging schnell durch das Wasser, das bei jedem Ruck der Ruder durch die Latten schäumte und über sie fortspülte. Wieder hörte sie dieselbe befehlende Stimme, und die Fahrt wurde verlangsamt. Melitta wurde dann an das Land getragen, hörte wieder ein Gewirr von Stimmen um sich und wurde wiederholt mit kaltem Wasser begossen. Jemand hob ihren Kopf und hielt eine Schale mit Milch an ihre ausgedörrten Lippen, ein unvergleichliches Labsal. Sie empfand noch, wie sie eine plötzliche Dunkelheit wohltuend umfing, wie sie auf eine Matte niedergelegt wurde, weiter nichts. Von da an erinnerte sie sich nur dumpf, daß ab und zu jemand neben ihr saß und ihr Luft zufächelte, daß man ihr von Zeit zu Zeit zu trinken gab, daß alle Glieder sie schmerzten und die Brandwunden der Sonne an Gesicht und Körper sie quälten, daß das Hämmern und Dröhnen in ihrem Kopfe gar nicht aufhören wollte. Wie im Traume sah sie braune Frauen hin und her gehen und hantieren. Sie wußte nicht, wie lange sie so gelegen hatte, als lebhaftes Sprechen und Laufen und ein schriller Pfiff ihre Aufmerksamkeit erregten. In dem hellen, blau und grünen Ausschnitt der Tür sah sie ein Boot mit weißen Männern vorübergleiten und gewahrte über dem Palmengrund am Ufer den Schornstein eines kleinen Dampfers. Dann knirschte der Sand unter festeren Tritten, als dem geräuschlosen Schreiten nackter Füße, und, von dem alten Malaien geführt, trat ein Europäer in die Tür, nahm seinen Tropenhelm ab und bückte sich, um einzutreten, kam näher und beugte sich über ihr Lager.
Sie hatte ihn beim ersten Blick erkannt. Im Dämmerlicht der Hütte unterschied sie kaum die Züge, aber die Haltung, das hochstehende Haar über der Stirn, die Kopfform, die Stimme ließen bei der Erinnerung, die so kürzlich erst in ihr geweckt worden war, keinen Zweifel. »Volckardt,« sagte sie.
Er stutzte, aber das gedämpfte Licht kam auch ihm zustatten. Die eingefallenen Züge, die rotgebrannte, abblätternde Haut sah er nicht, wohl aber erkannte auch er die Stimme und die dunkeln Augen. »Melitta!« rief er erschrocken, »bist Du es? – Weißt Du, was aus meiner Frau geworden ist? Sie war mit auf dem Star of Birma. Hast Du sie gesehen?«
»Ja,« sagte Melitta, »aber nicht bei – bei dem – Untergang.«
Erschöpft schloß sie die Augen, zu matt, um sich zu wundern, wie er hierherkam und daß sie ihn so wiederfand; doch fühlte sie die Beruhigung durch ihre ganze Seele strömen, in seinem Schutz nun erst wirklich gerettet zu sein.
Volckardt und ein anderer Herr nahmen sie mit Hilfe der Malaien auf und legten sie auf eine mitgebrachte Tragbahre, über der sie ein Dach aus Segeltuch gegen die Sonne befestigten. Währenddessen händigte Volckardt dem alten Malaien einige Goldstücke ein und erklärte ihm, soviel bekäme jeder, der einen der Verunglückten aufgenommen hätte und die Hälfte für Bergung einer Leiche. Im Hintergrunde standen die malaiischen Frauen und beobachteten den Vorgang. Ihrer Pflege verdankte Melitta ihr Leben, und sie besaß nichts, gar nichts, das sie ihnen hätte geben können. Doch – sie hatte den Goldreifen am Arm. Sie winkte ihnen; die eine kam zögernd heran, und Melitta streifte den Ring ab und reichte ihn ihr hin. Man zog nun die Leinewand über ihr zu, hob die Trage auf, und so wurde sie an Bord des kleinen Dampfers gebracht, wo eine Stewardeß sie in Empfang nahm und sie, so gut es bei den offenen Wunden und der großen Schwäche gehen wollte, wusch und bettete. Von dieser Frau erfuhr sie auch, daß die Gesellschaft der Dampferlinie, als die Kunde von dem Unglück Singapore erreichte, einen kleinen Dampfer zur Rettung der etwa noch lebenden Schiffbrüchigen ausgesandt hatte und die Kaufleute der Stadt auf eigene Hand einen anderen. Beide Ufer und die der Unglücksstelle zunächst liegenden Inseln wurden abgesucht, aber von den siebenhundertundzwanzig Seelen des verunglückten Schiffes waren nur siebzehn gerettet, und auch von Leichen wurden nur wenige gefunden. Die meisten mochten mit der Ebbe hinaus ins Meer geführt worden sein.
Der Zustand geistiger und körperlicher Erschöpfung, in dem Melitta sich befand, schloß jedes eingehende Gespräch aus, doch kam Volckardt täglich und teilte ihr in wenigen Worten die Erfolglosigkeit der Nachforschungen mit. Er mußte annehmen, daß Melitta, gleich ihm, den schwersten aller Verluste erlitten habe, und hatte keine Ahnung davon, daß auch ihr Vater an Bord gewesen war, bis Melitta fragte, ob er sich nicht wenigstens unter den geborgenen Toten befände? Da schüttelte er stumm den Kopf. Ein einziges Mal brach ein Strahl der alten Zugehörigkeit bei ihm durch; er hatte sich nach ihrem Befinden erkundigt und ihr Mut zugesprochen und war schon an der Tür, als er sich nochmals zu ihr wandte und schnell und bewegt sagte: »Ich dachte nicht, daß ich Deine Stimme je wieder hören würde!«
Als nach vier Tagen angstvollen Harrens die beiden Dampfer in Singapore binnen kamen, stand auf dem Pier eine dichtgedrängte, beklommen schweigende Menge. Der erste, der an Land gebracht wurde, war der unglückliche Kapitän. Er wäre seines Lebens nicht sicher gewesen, hätte man gewußt, daß er es war, doch niemand erkannte ihn. Er war ein stattlicher Mann mit braunem Haar und Bart, als er hinausging, und er kam zurück mit ergrautem Haupt, ein blutiges Tuch über Stirn und Augen. Dann wurde die dicke Engländerin an Land gebracht, freudeweinend umringt von ihren Kindern und Enkeln. Albert stand mit Fanny in der vordersten Reihe; sie hatte sich nicht zurückhalten lassen selbst zu kommen; indessen ein Tragbett nach dem anderen wurde mit seiner traurigen Last vorübergebracht, ohne daß sie gefunden hätte, was sie suchte. Einer der letzten Krankenkörbe wurde nicht weit von ihr niedergesetzt. Sie streifte mit enttäuschtem Blick das noch junge Frauenzimmer darin und wandte sich an einen der begleitenden Herren, der ihr bekannt schien: »Können Sie mir nicht vielleicht sagen, ob sich eine Miß Tschuschner unter den Geretteten befindet?«
» Dies ist Mrs. Dietert,« antwortete er.
»Das ist ein Irrtum,« sagte Fanny, ohne auf die Bezeichnung zu achten. Sie ließ mit innerem Schauder ihr Auge über die Unglückliche gleiten, die regungslos, in einen alten Sarong gehüllt, vor ihr lag, die scharfen Züge und mageren Arme braunrot mit losen Hautfetzen; das lange Haar, grau und starr von Seewasser, hing in zottigen Strähnen um das bleiche Gesicht. Bei dem Klange von Fannys Stimme jedoch schlug Melitta die Augen auf und sah sie mit einem Blick vollen Bewußtseins an. Fanny stieß einen durchdringenden Schrei aus und rang unter krampfhaftem Schluchzen die Hände; auch Albert fuhr in heftigem Schrecken zusammen. »Wir haben den Wagen mit; wollen Sie uns helfen, die Dame dorthin zu bringen,« sagte er mit unsicherer Stimme.
»Wohnen Sie sehr weit von hier?« war die Gegenfrage. »Sonst wäre es besser, die Kranke in Ihre Wohnung zu tragen. Jede Erschütterung muß vermieden werden, und es wäre gut, so schnell wie möglich den Arzt kommen zu lassen.«
»Nimm den Wagen, Fanny, und suche Dr. Bauer gleich mitzubringen. Ich werde Melitta begleiten,« bestimmte Albert, und noch vor ihnen war Fanny mit dem Doktor zur Stelle. Ehe eine Stunde verging, lag Melitta wieder in ihrem gewohnten Bett im verdunkelten Zimmer, in einem von Fannys feinen Nachthemden, und ein laues Bad hatte die letzten salzigen Spuren des Seewassers fortgespült. Während sie in tiefem, erquickendem Schlummer lag, weinte Fanny im Nebenzimmer heiße Tränen auf Melittas vormals so prachtvolles Haar, das in glanzlosen, zusammengefilzten Massen vor ihr lag; der Arzt hatte es sogleich abgeschnitten, trotz ihrer flehentlichen Bitte, ihr erst einen Versuch zu gestatten, es zu entwirren. Der Doktor hatte dann eindringlich mit ihr gesprochen und ihr vollständige Ruhe für die Kranke zur Pflicht gemacht; sie dürfe durchaus nicht gefragt, es dürfe überhaupt nicht mit ihr gesprochen, jedes Geräusch müsse sorgfältig vermieden werden, denn ihr Nervensystem habe eine schwere Erschütterung erlitten und Schreck oder Erregung könne ein Gehirnleiden zum Ausbruch bringen, dessen Folgen nicht abzusehen wären.
Fanny war für Ruhe und Pflege nicht geschaffen, aber wie viele hatte sie ein Grauen vor Geisteskrankheit, und so wurde die ärztliche Vorschrift auf das peinlichste befolgt. Der kleine Bertie wurde in den entferntesten Teil des Hauses verbannt und kein lautes oder unnötiges Wort in dem Krankenzimmer gesprochen, in dem eine stille katholische Schwester ihres Amtes waltete. Fanny schwebte in beständiger Angst, Melitta möchte nach ihrem Vater fragen, während diese die Wahrheit längst durch Volckardt erfahren hatte, ebenso wie das nähere über die Katastrophe. Als Ursache gab der Kapitän bei der Verklarung an, daß er von seinem Kurs abgewichen und auf einen unter Wasser verborgenen und in den Karten nicht bezeichneten Felsen aufgefahren sei.
Eines Tages überraschte Melitta Fanny durch die Frage, ob Volckardt nicht dagewesen wäre.
»Volckardt?« fragte Fanny bestürzt. »Wie kommst Du auf Volckardt?«
»Er war ja auf dem Dampfer, er hat mich ja gefunden,« erwiderte Melitta.
»War das Volckardt? Ja, der Herr, der Dich an Land tragen half, hat sich einige Male nach Dir erkundigt, – er hätte doch auch zu mir kommen können,« meinte sie gekränkt.
»Er ist wohl nicht in der Stimmung, Besuche zu machen, er hat ja eben seine Frau verloren,« sagte Melitta. »Mrs. Vernon war seine Frau,« fügte sie erklärend hinzu.
Fanny erinnerte sich plötzlich, daß Melitta nicht sprechen und sich nicht aufregen sollte und hielt einen Ausruf des Staunens zurück.
Dank der guten Pflege war Melitta nach einiger Zeit imstande, aufzustehen und auf der Veranda zu liegen, und eines Tages erschien sie auch zu den Mahlzeiten. Sie war bleich und stiller, auch das kurze Haar trug zu der Veränderung bei. Da sie von ihren eigenen Sachen nichts mehr besaß, brachte ihr Albert ab und zu etwas mit, ein Nähkästchen, eine Schreibmappe. Fanny besah jedes Stück mit kindlicher Freude und war stolz auf seinen guten Geschmack.
»Hast Du Melitta heute nichts mitgebracht?« fragte sie ihn eines Tages.
»Doch! Doch!« erwiderte Albert, an sich herumtastend, und holte dann ein allerliebstes Geldtäschchen aus Schlangenhaut hervor. Melitta öffnete es mit Vergnügen und fand einige Goldstücke darin.
»Sie müssen nun auch wieder Geld haben,« bemerkte Albert. »Nun, fürs erste müssen Sie mich als Ihren Bankier betrachten.«
Plötzlich stand Melitta auf, legte das Geldtäschchen auf den Tisch und ging mit verstörtem Gesicht und ungleichen Schritten auf und nieder, offenbar ohne zu wissen, was sie tat. Fanny starrte sie mit erschrockenen Augen an. ›Sie hat den Verstand verloren,‹ dachte sie entsetzt, ›gottlob, daß Albert da ist!‹
Inzwischen hatte sich Melitta gewaltsam gefaßt und blieb stehen.
»Was ist denn – was hast Du?« fragte Fanny ängstlich.
»Es ist nur –,« sagte Melitta, »ich hatte bisher nicht daran gedacht, und es fiel mir plötzlich auf die Seele – Fanny, ich habe ja gar nichts mehr, – gar nichts!«
Fanny sah sie verständnislos an, und Albert fragte: »Was meinen Sie, Melitta?«
»Ich hätte Sie nicht erschrecken sollen –« Melitta sprach es langsam und schwer – »es überkam mich nur selbst so plötzlich. Papas ganzes Vermögen ist mit ihm untergegangen. Alles, alles was er noch hatte.«
»Melitta!« rief Albert, hastig aufstehend. »Das Unglück ist groß genug, wie es ist. Erschweren Sie es sich nicht noch durch solche Vorstellungen. Daß Sie einen Teil Ihres Vermögens verloren haben, unterliegt keinem Zweifel; jedenfalls das, was Ihr Vater für Mac Hallans Unternehmen flüssig gemacht hatte, und wahrscheinlich auch das, was er Ihnen zur Aussteuer hat mitgeben wollen, aber das Übrige muß da sein. Weitläufigkeiten werden wir haben, gewiß, aber bekommen werden Sie es sicher. Ich schreibe mit nächster Post an Robert Nippold; er weiß vielleicht etwas darüber oder kann in Hamburg etwas erfahren.«
»Nein,« sagte Melitta ruhiger; »es ist alles wertlos, alles hin. Sagten Sie nicht neulich, Wechsler & Co. hätten bei dem Zusammenbruch der Colville-Bank ebenfalls Verluste gehabt? – Ich achtete seinerzeit nicht darauf, aber an der Colville-Bank war Papa beteiligt. Die Kupferminen versagten, und nun hat sich auch die Bank nicht halten können. Es bleibt mir nichts mehr.«
»Die Bank ist nicht bankerott; sie hat nur vorläufig ihre Zahlungen eingestellt,« erklärte Albert, »sie kann sich sanieren. Die Minen allerdings sind jetzt nicht einmal als Grund und Boden verkäuflich. – Indessen, man muß die Flinte nicht vor der Zeit ins Korn werfen. Ich werde in Colville Erkundigungen einziehen. Und schreiben Sie an Mr. Mac Hallan; er ist Ihres Vaters alter Freund und weiß vielleicht Genaueres über seine Vermögensanlagen. Ein Teil wird sich jedenfalls retten lassen, dessen bin ich sicher.«
Albert schrieb an einen ihm bekannten Herrn vom Aufsichtsrat der Bank von Colville, und Melitta an Mr. Mac Hallan; die Antworten bestätigten Melittas schlimmste Befürchtungen. Die Bank hatte ihre Zahlungen eingestellt und die Aktionäre aufgefordert, ihrer statutenmäßigen Verpflichtung nachzukommen und auf ihre Anteile, auf die sie seinerzeit 65 % hatten hinterlegen müssen, die fehlenden 35 % nachzuzahlen, um womöglich den völligen Zusammenbruch zu verhüten. – Wie sich von selbst verstanden habe, hätten sie Herrn Tschuschners persönliche Einlage von 500 000 M. zur Resteinzahlung auf seine Aktien verwendet, eine Summe, die kaum zur Deckung gereicht habe. Den Anspruch seiner Tochter und einzigen Erbin erkannten sie bereitwilligst an und sie hofften, daß die Bank sich in einigen Jahren erholen werde, usw.
»Die Halunken!« rief Albert, nachdem er den Damen das Schreiben vorgelesen hatte. »Sie durften gar nicht ohne Ermächtigung an die Depots gehen!«
»Aber das kann doch nicht alles sein! Onkel Tschuschner hatte gewiß noch irgendwo etwas,« sagte Fanny. Indessen waren alle Erkundigungen, die Albert anstellte, erfolglos. Nippolds schrieben beide, und Robert sprach sich gegen Albert vertraulich darüber aus, daß der alte Tschuschner doch nur ein self-made man, nie ein regelrechter Kaufmann gewesen und stets ein Sonderling geblieben wäre. Konstanze bot Melitta ihr Haus an; ihnen, die jetzt die Firma und die Familie repräsentierten, käme es zu, sie bei sich aufzunehmen; sie wünschten durchaus nicht, diese Pflicht auf andere zu übertragen, und wenn es noch so gute Freunde wären; im Gegenteil, Melitta würde ihr im Hause sehr erwünscht sein.
»Das ist ganz Konstanze!« sagte Fanny entrüstet. »Sie möchte Dich haben; natürlich, es wäre ihr recht bequem, eine Gesellschafterin zu haben, die nach ihrer Pfeife tanzen müßte, und sich dabei noch auf die Großmut und Vortrefflichkeit aufzuspielen. – Nein, Du bleibst bei mir,« fügte sie hinzu.
Auch Mr. Mac Hallans Brief ließ nicht auf sich warten; er lautete nicht tröstlicher. Über die leichtsinnige Art, wie die Bank verwaltet worden, seien schon seit Jahren unbestimmte Gerüchte im Umlauf gewesen, die jedoch wieder verstummt wären, bis neuerdings die Wahl von Bowring und Simmermann, zwei Leuten, die für ebenso gewandt wie gewissenlos gälten, die Beteiligten beunruhigt habe. Trotzdem sei die Katastrophe allen überraschend gekommen, und er für seine Person glaube nicht, daß irgend jemand einen Cent von seinem Gelde wiedersehen würde, auch wenn es gelänge, die beiden Gauner loszuwerden. Er könne Melitta nur raten, sich auch mit dieser Wendung ihres Geschickes abzufinden. Was ihn selbst beträfe, so gestatteten ihm die veränderten Verhältnisse vorderhand nicht, sie zu sich zu bitten oder so für sie zu sorgen, wie er möchte. Er wäre durch den Tod des Freundes und Partners, der ihm das Betriebskapital für die gemeinsame Unternehmung hätte bringen wollen, selbst in Verlegenheit und müsse neuen Anschluß suchen, doch sähe er sie als ein teures Vermächtnis des Verstorbenen an, und da sie wohl eine ihren Fähigkeiten angemessene Tätigkeit im alten Vaterlande leichter finden würde, als in den Kolonien, so legte er ihr das Reisegeld vorläufig bei.
Diese Bemerkung brachte den Entschluß, mit dem Melitta sich trug, zur Reife.
»Eine meinen Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit,« wiederholte sie halblaut.
»Du – in Stellung!« Fanny sah Melitta so erschrocken an, als hätte ein kleiner Hase davon gesprochen, Kriegsdienste zu nehmen.
»Es wäre doch eine Schande,« sagte Melitta, »wenn ich mit der Erziehung, die ich gehabt habe, mir nicht ebensogut mein Brot erwerben könnte, wie tausend andere.«
»Aber tausend andere sind dazu erzogen und Du nicht,« wandte Fanny ein. »Nein, zurück darfst Du auf keinen Fall! Nicht wahr, Albert?«
»Liebes Kind,« sagte Albert, »Hamburg ist nicht aus der Welt, und Melitta kann wiederkommen. Aber nach Deutschland zurück muß sie, das hat mir der Arzt gleich gesagt. Ihre Gesundheit wäre erschüttert, in den Tropen würde sie sich nie ganz erholen; in dem heimatlichen Klima wäre das aber bei ihrer Jugend und guten Konstitution mit Sicherheit zu erwarten.«
Da wagte Fanny keine Einwendung mehr. Albert hatte ohne Melittas Wissen wegen des Vermögens an Dietert geschrieben; auch er konnte keine weitere Auskunft geben. In seiner Antwort war jedoch ein Brief an Melitta eingeschlossen, in dem er sie nochmals aufforderte, das Vergangene vergangen sein zu lassen und noch jetzt das einmal gegebene Wort einzulösen.
»Das ist doch eigentlich furchtbar nett von ihm,« meinte Fanny.
Melitta schwieg. Sie kannte ihn zu gut, um nicht zu wissen, daß gekränkte Eitelkeit und nicht Neigung ihn zu diesem Schritt veranlaßt hatte. Sie war fertig mit dieser Episode ihres Lebens und hätte sie aus ihrem Gedächtnis löschen mögen; sie schämte sich jetzt ihrer Wahl. Der Zauber, mit dem Idealismus der Jugend, äußere Verhältnisse, seine hübsche Persönlichkeit und glänzenden Eigenschaften ihn umgeben hatten, war gebrochen. Ihr Urteil über ihn war hart bis zur Ungerechtigkeit; es lag noch weniger in seinem Charakter, zu vergeben und zu vergessen, als in dem ihren, sagte sie sich, und der Gedanke, ihm anzugehören, erfüllte sie mit Grauen. Sie antwortete entschieden ablehnend. Kurze Zeit darauf war sie unterwegs nach Deutschland.
*