
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
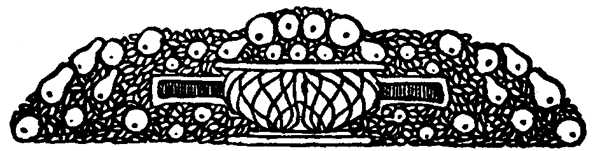
Marie von Ebner-Eschenbach geborne Gräfin Dubsky beging am 13. Sept. 1900 die Feier ihres siebzigsten Geburtstages. Sie durfte es erleben, dass Deutschland und Österreich sich vereinten, ihr die gemeinsame Freude an ihrem Lebenswerk, ihrer Dichtung in zahllosen Zeichen der Liebe und Verehrung zu beweisen. Ihr Name, die Daten ihres Lebens, eingehende Besprechungen ihrer Novellen, ihrer Gedichte und Aphorismen, ihrer Lebensanschauung, ihrer Ethik, ihrer Religion wurden durch die Presse in die fernsten Gauen, in alle verborgensten und literaturfremdesten Ecken und Winkel getragen, da man noch in deutscher Zunge redet. Die Wiener Universität verlieh der Gefeierten die Würde eines Doktors der Philosophie honoris causa. In dem Referat, welches dem Professoren-Kollegium den Vorschlag dazu unterbreitet, und das in der Ebner-Biographie von Anton Bettelheim (Berlin 1900, Verl. v. Gebr. Paetel) abgedruckt ist, wird gesagt:
»Marie von Ebner-Eschenbach ist unstreitig heute die erste deutsche Schriftstellerin, nicht bloss in Österreich, sondern auch in Deutschland; und selbst unter den Dichterinnen der Vergangenheit könnte ihr allein von der Droste der Rang streitig gemacht werden . . .
»An weitem geistigen Horizont, an umfassender und tiefer Welt- und Menschenkenntnis sind ihr in der zeitgenössischen Literatur wenige gleich, keiner überlegen . . .
»Auch künstlerisch steht sie recht in der Mitte zwischen der alten und neuen Schule; der Gegensatz zwischen dem Idealismus und dem Realismus, zwischen den Alten und den Jungen hat ihr, wie allen tiefern Geistern, die nicht leeren Schlagwörtern nachlaufen und ihre Farbe mit der Mode wechseln, früh schon zu schaffen gemacht.
»Keine Partei darf sie zu der ihrigen zählen; aber sie kann den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, nach dem Tode Fontanes der einzige Schriftsteller der ältern Generation zu sein, der sich bei alt und jung der gleichen Anerkennung erfreut. Die Klugheit der Künstlerin aber erhebt sich zur Höhe ethischer Weisheit in den Aphorismen, in denen sie ihre ganze Weltanschauung niedergelegt hat und die nicht blendende Paradoxien, sondern der Ausdruck einer reichen, durchgebildeten Persönlichkeit sind.«
Das Dokument spricht in den wiedergegebenen Sätzen offiziell die Ansicht der wissenschaftlichen und gebildeten Welt von dem Schaffen der Ebner aus. Und darin liegt seine Bedeutung. Durch die Verleihung der Ehrendoktorwürde an eine alte Frau wird es auch dem den Literaturbewegungen Fernstehenden, dem Stumpfen und dem Banausen klar, dass hier wohl ein besonderer Fall vorliegt und dass die Redensart von dem dilettierenden Blaustrumpf einmal vor einer ehrfurchtgebietenden Macht zu verstummen hat.
Die Aufzählung der dem Schaffen der Marie Ebner gewidmeten Arbeiten vom ernsten Wissenschaftler bis zum geistreichen Feuilletonplauderer würde Seiten füllen. Dabei birgt doch das Dasein, wie die geistige Physiognomie der zugleich einfachen und ausserordentlichen Frau keinerlei Geheimnisse, an denen der Spürsinn sich üben, ihre Werke keinerlei Dunkelheiten, bei denen eine spitzfindige Auslegung Überraschungen zutage fördern könnte.
Die Intimitäten ihres persönlichen Lebens, die für den Psychologen von Wert, für den Menschenfreund voller Reiz sein dürften, könnte nur sie allein geben, und dazu wird eine so diskrete Natur sich auch in einer Selbstbiographie schwerlich entschliessen.
Wer aber im eigenen Innern das Werden und die verborgene Struktur eines Dichtwerkes hat entstehen fühlen, wird den Schlüssen, die man daraus auf persönliche Erlebnisse und Erfahrungen des Dichters ziehen wollte, immer misstrauen. Zu seltsam, zu untrennbar mischt sich hier Schauen, Erleben, Phantasieren zu neuem einzigartigem Erleben, das so wirklich ist und doch mit der Wirklichkeit so wenig zu tun hat.
Gleicherweise wächst uns aus dem Lebenswerke eines Künstlers, wenn es, in den Hauptsachen vollendet, reich gegliedert, und doch von einem leitenden Geiste durchdrungen, geordnet und beseelt, von uns genossen und erforscht wird, allmählich ein Bild des Schaffenden empor. Dieses Bild braucht kein objektiv, in allen Zügen wahres Porträt zu sein. Es kann es gar nicht sein, denn wir werden stets vom eignen Wesen einen Teil dazu tun. Auch hier schaffen wir uns selbst eine Dichtung vom Dichter – ein Phantasiebild, aus Schauen, Erleben und Träumen zusammengefügt. Lieben wir doch auch in unsern Nächsten hauptsächlich die Phantasiebilder, die wir uns fortwährend von ihnen entwerfen, und zu denen die Wirklichkeit uns gleichsam nur den Rohstoff bietet. Spiegelungen unseres Geistes und Gemütes sind sie uns, denn in Wahrheit kennt keiner den andern. Jeder kennt nur sich selbst – noch besser kennt er die Gestalt, die er sein möchte – das Ideal, das er sich täglich neu aus der eignen Persönlichkeit bildet. Darum – seien wir doch ehrlich – ist es uns auch viel wichtiger, was der Meister, zu dem wir aufschauen, uns gibt, in uns wirkt und aus uns weckt, als was er in der Wirklichkeit, oder in den Augen der andern Menschen – oder was er sich selbst bedeutet.
— — — — —
Eine kleine Komtesse wuchs fröhlich auf in ihres Vaters Schlosse Zdislavic in Mähren. Die üppigen Früchte der Obst- und Gemüsegärten, die frische schäumende Milch der glänzenden Kühe gaben der jungen Marie kräftiges Blut und reine Säfte. Die klare Luft der weiten Felder umwehte sie. Grüne Parks mit schönen fremden Gewächsen, mit dunkeln Fichtenhainen und breitästigen Lindenalleen, mit grünen Rasenflächen und lustigen bunten Blumen wurden ihre und der Geschwister Spielplätze; Pferde, Hunde und Vögel ihre vertrauten Kameraden. Am grossen freien Himmel über sich sah sie die Sonne auf- und niedergehen, verfolgte sie das Weben und Wandern der Wolken, ihr köstliches Erglühen, ehe die Nacht kam und den Mond und die Sterne brachte. Die Welt war ihr voll ruhiger gesunder Kinderfreuden. Unter all dem Guten, das sie sorglos genoss, mochte sie es im leichten jungen Herzen wohl manchmal vergessen, dass ihr ein Köstliches auf immer verloren blieb. Die Mutter, eine bedeutende, geliebte Frau, war bald nach Mariens Geburt gestorben. Aber die Kleine umfasste auch die zweite und später eine dritte Gattin des Vaters mit aller Wärme ihres Gemütes. Ja, voll Schwärmerei und Bewunderung blickte das heranwachsende Mädchen zu den künstlerischen Erzeugnissen der mannigfach begabten Stiefmutter auf und mochte wohl an ihnen gar die erste künstlerische Sehnsucht entzündet haben.
Die kleine Komtesse wurde erzogen, wie kleine Komtessen erzogen zu werden pflegen: ein wenig Lernen, zuerst bei einer schlechten, dann bei einer guten Erzieherin, Englisch und Französisch parlieren, ein wenig Handarbeiten. Reiten, Tanzen, Schiessen und Jagen gehörten als ritterliche Künste, im Wetteifer mit den Brüdern getrieben, notwendig zur Ausbildung des adeligen Landkindes. Und dann kam der Vetter, der schon als grüner Bub voll scheuer Zärtlichkeit zu der winzigen mutterlosen Base im Wickel niedergeschaut hatte, und begehrte das kaum erwachsene Mädchen zum Weibe. In herzlicher Zuneigung reichte Marie ihm ihre Hand und führte mit dem ernsten und gebildeten Offizier eine lange, friedevoll glückliche Ehe. Ruhige Jahre in der kleinen Garnison Klosterbruck wurden ihr zu ernsten Studienzeiten, doch entfremdeten diese Studien sie niemals dem heitergeselligen Leben ihrer Kreise und ihrer Familie. Die Kinderlose schloss eine lustig emporblühende Schar von Neffen und Nichten ins Herz, wurde ihnen die beste, zärtlichste Tante. Die Armen auf dem väterlichen Gute fanden in ihr eine weise sorgende Mutter, gescheiten Männern und Frauen in Wien stand sie als kluge teilnehmende Freundin zur Seite. Sie musste im Laufe ihres langen gesegneten Lebens den Tod manches teuern Menschen erleiden, sie musste ihre Geduld im Ertragen von Schmerzen auch in eigenen Krankheitstagen reichlich erproben. Aber nicht die nervenzerrüttende Leidenschaft der Sinne, nicht die armselige Sorge um das tägliche Brot durfte die heitere Höhe erreichen, auf die ein mildes Geschick sie gestellt hatte. So reifte sie an Frieden und Harmonie mit sich und der Welt. Und jetzt kommt das merkwürdige an der einfachen Geschichte: die alte Frau war in aller Stille die erste lebende Dichterin in deutscher Zunge geworden.
Dieses scheinbar so ruhige, in beinahe konventionell-alltäglicher Form sich darstellende Leben war ausgefüllt mit einem Inhalt, wie er nur ganz wenige, ganz auserlesene Frauenleben in dieser Stärke anfüllt und durchdringt. Im Geiste der gütigen, heiteren und hilfreichen, aber in keiner Weise aus ihren Kreisen aufrührerisch herausstrebenden Frau brannte seit frühester Jugend ein Feuer, das sie unablässig mit ihren besten Kräften und Säften nährte, bis alles, was das Dasein ihr an Eindrücken, Erfahrungen und Empfindungen schenkte, in seiner Weissglut zu den lieblichsten, köstlichsten Kunstwerken umgeschmolzen wurde. Und in einer geduldigen, fleissigen, unendlich gewissenhaften Arbeit erhielten diese Kunstwerke die letzte ihnen mögliche Vollendung der Form.
Im Kopfe der jungen vierzehnjährigen Komtesse war, während sie unter der Obhut der geistig regsamen Stiefmutter in Wien das Theater besuchte, der reinste, klarste Begriff von dem schwer definierbaren Wesen der Kunst entstanden. Zwar wird sie ihn im Laufe ihres Lebens erweitert und tiefer durchdrungen haben, aber in der Grundform, wie sie ihn damals erfasst hat, blieb er ihr unzerstörbarer Besitz.
Sie hatte ihren Begriff vom Wesen der Kunst ganz gewiss nicht durch die logischen Gedankenreihen einer feinen Verstandesarbeit erworben. So kommen Männer zur Kunst. Nicht die Grössten und nicht die Tiefsten. Aber einige tüchtige und einige ganz feine, zarte und formvollendete Schriftsteller haben auf solchem Wege ihr Ziel umstrichen, und es gleichsam prüfend und vorsichtig allmählich umzingelnd endlich erfasst.
Nein – Marie Dubsky wird die Kunst ihrer Begabung in einem grossen, richtunggebenden Augenblick erschaut haben, geschaut, wie ein junges Weib den Geliebten ihres Lebens erblickt: mit dem Geiste, mit dem Gemüte und mit allen Sinnen. Auf eine unerklärliche, aber sehr deutliche Weise fühlt, ja weiss sie: dies ist jetzt mein Schicksal, und nichts auf der Welt, noch so grosse, noch so liebe und verlockende Gewalten können mich hindern, mein Schicksal zu erfüllen.
Ich will nicht sagen, dass alle Liebe so beginnt. Und es ist selten, dass, auch wenn die Offenbarung so stark war, die Persönlichkeit, welche diese Offenbarung empfängt, gleich stark, energisch und treu genug ist, um ihr ohne Wanken, ohne Felonie zu folgen. Es ist selten bei einer Frau in der Liebe zum Manne, es ist noch seltener bei einer Frau in der Liebe zur Kunst. In dem Leben so mancher begabten Frau verzehrt die Liebe zum Manne die besten Kräfte für die Kunst. Freilich auch weckt in andern erst die enttäuschte oder nie erfüllte Sehnsucht nach der grossen Leidenschaft des Geschlechtes die Begierde und den Drang und die Fähigkeiten zur Kunst.

Schloss Zdislavic
das Geburtshaus von Marie Ebner-Eschenbach
Dies alles trifft nicht zu bei Marie Dubsky, die später Marie von Ebner-Eschenbach wurde, ohne dass ihre Heirat die Richtung ihres innern Seins und Strebens nur im mindesten berührt zu haben scheint. Sicher nicht ohne harten Kampf hat sie sich dieses ihr eigenstes Gebiet so rein von äussern Einflüssen und Störungen zu erhalten gewusst. Denn in ihr ist keine Spur von jener Kälte des hochmütigen Kunstfanatikers, der da l'art pour l'art auf seine Fahne schreibt. Ihre Brust ist erfüllt von Menschenliebe, von freudig überströmender Herzlichkeit. Und wo sie in ihren Werken jemals hart verurteilt, da trifft sie mit der Geissel jene egoistische Kälte, die sie das Schädliche nennt, welches vertilgt werden muss um jeden Preis.
Und doch vermag das junge, weiche, liebende Mädchen, die heimliche Braut, in der Zeit ersten glühenden Ringens um den Dichterberuf gegen ihre alte Erzieherin in das Geständnis auszubrechen: »Ich kann das Dichten nicht aufgeben, und wenn ich seine Liebe verlöre!«
Welch unbeugsamer Wille in dem warmen, begeisterten Geschöpf, das in seiner temperamentvollen Jugendfrische aller Herzen gewinnt und die gewonnene Liebe auch durch ein langes Menschenleben festzuhalten versteht!
In Marie von Ebners wenigen Gedichten, deren jedes ihre Stellung zu einer der Hauptfragen ihres Lebens enthält und die in scheinbar absichtsloser, unübertrefflich künstlerischer Zusammenfügung ein vollständiges Bild ihres geistigen Wesens geben, finden sich ein paar Verse, die ihr späteres Verhältnis zu ihrem Dichterberuf charakterisieren. Ihre Freunde bestürmen die durch Leiden und Schmerzen geplagte Frau, zu ihrer eigenen Schonung das Dichten sein zu lassen. Ihre machtvolle Antwort, indem sie auf die Tätigkeit des Dämons in sich weist, lautet:
Er füllt allein Dein ganzes Denken aus,
Du hast nur ihn: ja Dein ureignes Leben,
Dein menschlich Irren, jegliches Empfinden,
Dein glühend Mitleid, Hass und Zorn und Schmerz,
Dein stillstes Sehnen, Dein geheimstes Träumen,
In seinem Dienst wird alles ausgenützt . . .
Dünkt Euch dies Schicksal so beneidenswert?
Ertrüg' es Einer, der es wenden könnte? . . .
Heutzutage ist der Begriff des Dämonischen etwas in Misskredit gekommen. Es sind gar zu viele von Dämonen und Dämönchen heimgesucht, und wenn man die Werke dieser Besessenen näher beschaut, kommt einem zuweilen der ketzerische Gedanke: es hätte nicht gerade eines Dämons zur Mitwirkung bedurft, das hätte ein braver Handwerker auch fertig gebracht . . . Andere Dämonen scheinen gar zu der Gattung der Spiritistengeister zu gehören, die mit Erdäpfeln und hölzernen Tischbeinen das unheimlichste Getöse vollführen. Man kann wohl auch hier die Weisung der Bibel befolgen: »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!«
Wenn eine der Phrase, jedem Pathos so abgeneigte Natur, wie Marie Ebner, vom Dämon in sich spricht, dann will das doch etwas Besonderes und sehr Ernsthaftes bedeuten.
Es ist etwas Eigenes um den Dämon im Künstler. Er ist eine Macht, die ausserhalb und über dem Willen steht, so dass er oftmals den gemeinen Willen zum Leben besiegt und vernichtet. Und dann ist er zugleich auch wieder der Wille selbst in seiner höchsten und stärksten Form und treibt ein armes, schwaches, gebrechliches Erdengeschöpf zu Anstrengungen und Taten, die mit seinen sonstigen Kräften gar nicht mehr im Verhältnis stehen. Wer nicht dieses unheimliche, selbständig Wirkende, diese fremde und unbegreifliche Macht schon in sich gespürt hat, der ist gewiss kein Künstler.
In Marie Ebner scheint nun neben dem Willen des Dämons auch der Wille des Charakters sehr stark entwickelt zu sein. Man kann in ihren Werken wohl verfolgen, wie der eine mit dem andern ringt, ihn gar bezwingt und in Fesseln hält. Daraus ergibt sich dann die kühle Ruhe, die uns in ihren besten Erzählungen so eigentümlich ergreift, weil wir fühlen, dass sie nicht aus dem Herzen der Dichterin strömt, sondern vom Willen ihm abgerungen worden ist. Solcher Wille im Verein mit einem so seltenen Reichtum von Gefühlswärme bildet in einem Charakter das Element der Treue. Marie Ebner ist in hervorragendem Masse eine treue Natur. Ihr mehr als siebzigjähriges Leben hat es bewiesen. In ihrer Treue liegt der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Eigenart ihrer Dichtung. In der Treue wurzelt sie, an ihrer Kraft hält und entwickelt sie sich, aus ihrem Schatze schöpft sie ihre feinsten Schönheiten, in ihren Verboten findet sie ihre festen Grenzen. Ja, diese Grenzen: sie machen uns zuweilen ungeduldig, wir wünschen sie fort, und doch wissen wir recht gut, dass ohne sie die Ebner nicht mehr die Ebner wäre. Denn unsere Grenzen gehören so gewiss zu unserer Notwendigkeit, zu unserer Vollendung, wie unsere Freiheiten.
Den Priesterinnen der Vesta gleich, die da gelobten, das heilige Feuer niemals verlöschen zu lassen, hat Marie Ebner die Kunst stets als das heilige Feuer aufgefasst, dem sie in reinem Tempeldienst geweiht war. Durch die zuweilen an Askese streifende Strenge gegen sich selbst behielt ihr geistiges und künstlerisches Sein, trotzdem sie Ehefrau wurde und mitten im bewegten Treiben der grossen Stadt und der vornehmen Welt stand, etwas eigen Jungfräuliches. Und weil es doch so ganz ohne Herbheit war, wandelte es sich im Alter, ohne den Duft der Keuschheit zu verlieren, sanft und schön zum Mütterlichen.
Grad', grade geht der Pfad, wie Strahl der Sonnen,
Grad, wie die Flamme lodert vom Altare,
Grad, wie Natur das Berberross zum Bronnen
Treibt mitten durch die Wirbel der Sahare . . .
Dieses Wort, das eine Dunklere und Härtere, Annette von Droste-Hülshoff, sich selbst und ihren dichtenden Schwestern als Wegweiser aufgerichtet hat, ist wie vorahnend gesprochen vom Schaffen der Marie Ebner.
Grad' wie die Flamme vom Altare steigt ihre Kunst zur Vollendung auf. Es ist kein Bruch, keine Abirrung, keine Unberechenbarkeit in dieser Dichterentwicklung nachweisbar. Vom Genie lässt sich das wohl niemals behaupten. Das Genie ist in sich das Unberechenbare, das Unbegreifliche.
Aber hier wurde ein grosses Talent durch glückliche Naturanlage, durch günstige Verhältnisse und durch eine seltene Treue gegen sich selbst in ruhigem organischen Wachstum zu erfreulichster Entfaltung, zu schönster Reife gefördert. In dieser Zeit des Tastens, des Überwindens, des Ringens um neue, noch unerprobte Formen und Inhaltswerte, umringt von den gärenden Strudeln moderner Dichtung, für deren Erscheinungen uns noch ganz das klare Erkennen, der sichere Massstab fehlt, liegt das Lebenswerk der Ebner wie eine in sich vollendete, heiter-sonnige Friedensinsel. Und auch die im wildesten Wirbel Kämpfenden machen gerne an dem lieben Eilande Rast, um sich an seinen freundlichen Blumen, seinen klaren Quellen und milden Lüften zu erquicken.
— — — — —
Zunächst scheint es ja freilich, als ob die junge Baronin Ebner einen falschen Weg einschlägt, um zum ersehnten Ziele zu gelangen. Den Weg über die Bühne! Er dünkt wohl jedem aufblühenden Talent der erstrebenswerteste. Wachsen doch auf ihm die Rosen und Dornen gleich üppig, ist doch Sieg und Niederlage von gleicher dramatischer Spannung begleitet. Von der Bühne zu seinem Volke sprechen, den Pulsschlag der Menge klopfen zu hören zur Begleitung der eignen Gedanken, dem Jauchzen, dem Zorn gebieten zu dürfen, alle bösen und alle guten Instinkte der Massen aufpeitschen zu können zu kraftvollster Entladung – das ist etwas! Wurde man nicht auf Thronen geboren – ist man nicht ein Führer von Aufruhr und Revolution – wo ist das Feld für diese Betätigung herrlichster Herrscherkraft in gleicher Weise möglich, als von der Bühne? – Kein Wunder, dass von ihr eine gewaltige zaubervolle Anziehungskraft auf alle schaffenden Geister ausströmt. Kein Wunder, dass so viel im erfolglosen Streben hier ihr bestes Herzblut, ihre schönsten Kräfte nutzlos verströmen, und dass andere im wilden Kampfe ihre heiligsten Ideale verleugnen, um zu einem Scheinsiege zu gelangen. Dies letzte war ausgeschlossen bei Marie von Ebner. Auf ehrlichem Wege ging sie, in ehrlicher Arbeit nach ihrer Überzeugung rang sie um die Palme. Dieses Ringen und Arbeiten zu verfolgen, ist ergreifend und erhebend zugleich. Einige kleine Siege wie die Karlsruher Aufführung ihres Dramas »Marie Stuart in Schottland« unter Devrients Leitung konnten einen so von innen heraus aufbauenden Geist wie den der Ebner natürlich nicht befriedigen. Und zu einem vollen Erfolg kam es nicht. In der Vaterstadt der Dichterin in Wien wurde ihr sogar 1883 bei der Aufführung des »Waldfräuleins« eine erschütternde Niederlage bereitet.

Marie Ebner-Eschenbach im Jahre 1849
Dies war das Ende. Frau von Ebner begrub ihre unglückliche Liebe von da an still in ihrem Herzen, entsagte ein für alle mal dem Kampf um diese Form der Kunst, die ihr doch die höchste dünkte und wahrscheinlich noch heute dünkt.
Sie war darüber dreiundvierzig Jahre alt geworden. Die Hälfte eines normalen Menschenlebens war an diesen Kampf gesetzt. Die Jahre, die man im allgemeinen für die schaffenskräftigsten hält. Dennoch begann sie mutig und ohne Erbitterung einen neuen Weg zu ihrem Ziele zu suchen. Mit welcher tiefen, leidvollen Resignation mag sie den ersten Erfolg ihrer einfachen kleinen Erzählungen begrüsst haben! O – das Kapitel von der unglücklichen Liebe in der Kunst ist lang und voll heimlicher Tragik. Vielleicht werden die besten und stärksten Gefühle in diesem unglücklichen Lieben verbraucht. Ich will absichtlich nicht sagen »verschwendet«. Ein starkes Gefühl ist, wenngleich in hoffnungslosem Kampfe ausgegeben, nie verschwendet, sondern ein Quell heimlichster Erkenntnisse für den, der es durchlebt hat.
Und das Ringen um den Sieg in der dramatischen Kunst wird für Marie Ebner nicht nur nach der Seite des Technischen hin fruchtbringend geworden sein.
Warum konnte sie nicht siegen? War nur die Ungunst der Zeiten, die Verständnislosigkeit und Oberflächlichkeit des Publikums, waren nur jene tausend heimtückischen Zufälle, die den Erfolg der besten Theaterdichtung vernichten können, daran Schuld?
Die Zeiten sind günstiger geworden, das Verständnis für das reine Wollen, das starke Können von Marie Ebner ist gereift und vertieft, der Glanz des Ruhms umleuchtet ihre Stirn und wirft ein helleres Licht auch auf die Werke ihrer Jugend. Die Feier ihres siebzigsten Geburtstages würde ihr ohne weiteres die Pforten sämtlicher Bühnen erschlossen haben. Man brachte auch hier und da, vor allem in Wien einige kleine Lustspiele von ihr. Doch gaben sie keine Offenbarung von neuen, bisher unbekannten Seiten ihres Talentes. Was aber wohl das Entscheidende sein dürfte: die Dichterin selbst hat keinen Wert darauf gelegt, sich noch jetzt die Bühne zu erobern. Sie hat mit ihrem nun so reifen und vollen Können und bei günstigster Chance keinen Versuch zu neuem dramatischen Schaffen gewagt. Sie hat ihre früheren dramatischen Arbeiten nicht in die Zahl der gesammelten Werke aufgenommen.
Sie hat weise gehandelt – viel überlegener und weiser als mancher ihrer männlichen Kollegen. Ich möchte hier die Bemerkung einschalten, dass ich die Gabe der Selbstbescheidung und Selbstkritik, der richtigen Einschätzung der eigenen Stellung zum Ganzen, bei hervorragenden weiblichen Schriftstellerinnen überhaupt mehr entwickelt gefunden habe, als bei den männlichen Geistern. Es scheint, dass diese einen gewissen Rausch des Gottbewusstseins, die Illusion, sich als Mittelpunkt des Alls zu fühlen, als Ingredienz des Schaffensdranges notwendiger gebrauchen als die Frauen.
Marie Ebners Gaben sind hervorragend episch. Die liebevolle Lust am Ausmalen des Details, der Umgebung, der Nebenfiguren, der ruhige gleichmässige Klang ihrer Sprache, die Diskretion in der Anwendung von Steigerungen und Pointen, die Zartheit und die Delikatesse ihres Humors, alles weist sie auf die Kunstform des Romans und der Novelle. Ja, ihre ganze Weltanschauung mit ihrer Neigung zur Versöhnung der Gegensätze kann eher episch als dramatisch genannt werden. Und viele ihrer Erzählungen sind denn auch klassische Kunstwerke in ihrer vollendeten ruhevollen Form, die die Höhepunkte dramatischer Steigerung so wenig entbehren, wie die unsterblichen Epen der Griechen sie entbehrten. Nur ist eben eine dramatische Steigerung im Epos, im Roman, in der Novelle etwas grundverschiedenes von den Steigerungen und Konzentrationen, die die Bühne verlangt.
Es fehlte Marie Ebner für das Drama die stürmende, rücksichtslose Leidenschaft – es fehlte ihr auch die Erkenntnis für die düstere und wilde Schönheit der Schuld. Sie besass nicht die wollüstige und waghalsige Freude an den finstern Abgründen, den verheerenden Gewittern des Schicksals.
Es ist charakteristisch, wie sie sich zu den Stoffen stellt, die sie zum Inhalt zweier Jambendramen wählte: Maria von Schottland und Marie Roland. Im ersten Falle raubt sie der Heldin, indem sie sie als eine völlig unschuldige Märtyrerin und Dulderin darstellt, die Notwendigkeit zum bühnenwirksamen Erfolg: jene Leidenschaft, aus der die Schuld, jene Schuld, aus der das tragische Schicksal sich in dramatischer Steigerung entwickeln muss. Das zweitemal greift sie zu einem Stoffe, der in sich undramatisch ist, obwohl er, mitten in hoch dramatischen Stürmen und Szenen sich abspielend, sehr leicht dazu verführt, ihn dafür zu nehmen: das Leben und der Tod von Marie Roland, der begeisterten Girondistin. Marie Roland ist keine dramatische Heldin, weil sie viel zu wenig ursprüngliche Natur ist, weil viel zu wenig Dämon in ihr steckt. Sie ist ein Produkt hochgesteigerter Zivilisation, ein Gemisch aus Bildung, Verstand und überlegter Tugend. Selbst ihre Begeisterung für die Freiheit hat etwas Philosophisch-Akademisches. Sie ist verehrungswürdig, aber unpoetisch. Es haftet ihr etwas Starres, Unkünstlerisches an, das keine dichterische Macht gefügig machen wird.
Wohl hat auch Shakespeare die schöne duldende Unschuld, die reine kühle Tugend oft und gerne in seinen Dramen verherrlicht. Aber die rührenden Gestalten einer Cordelia, Ophelia, Desdemona sind niemals die Träger der dramatischen Handlung, sind immer nur Nebenfiguren, Gegensätze zu dem im Wirrsal von Schuld und Schicksal ringenden Helden. In gleichem Sinne gruppieren Schiller und Goethe ihre Gestalten. Und Iphigenie ist kein Beweis dagegen. Über ihr liegt die Schuld eines ganzen Geschlechtes. Es gibt keine tugendhaften und schuldlosen Helden. Die Unschuld kann im Drama nur eine lyrische Episode bleiben, die Tugend ist im besten Falle episch.
Marie Ebner verstand in ihrer Jugend noch nicht, dass ihre künstlerische und sittliche Persönlichkeit und die Bühne mit ihren notwendigsten Anforderungen unvereinbare Gegensätze darstellen. Ihre sittlichen und künstlerischen Ideale überwucherten noch die reinen künstlerischen Instinkte. Erst später gelang es ihr, den harmonischen Dreiklang zu finden, als sie sich auf ihr eigenstes Gebiet, die epische Erzählung, beschränkte.
— — — — —
Einst schrieb Marie Ebner ein symbolisches Märchen: Die Prinzessin von Banalien. Eines reichen Landes Herrscherin entbrennt in Liebe zu einem wilden Mann des Waldes. Sie lässt ihn an den Hof kommen, wo seine rauhen Sitten, seine Ausbrüche unkonventioneller Gerechtigkeitsliebe alle Schranzen in Aufruhr bringen. Aber Glück und Glanz können den wilden Gesellen nicht fesseln, er schenkt sein Herz nicht der schönen, liebevollen Prinzessin, sondern einer zerlumpten Zigeunerin. Die Prinzessin heiratet einen edlen König, ein Sohn wird ihr geschenkt. Scheinbar hat sie den törichten romantischen Wallungen entsagt. Da tragen die Fluten des Stromes unter dem Altan des Schlosses die Leiche des wilden Jugendgeliebten vorüber, alle Tiere des Waldes geleiten sie mit Klagegeschrei, dem Zuge voran schwebt ein mächtiger Adler. Als die Königin die herrliche Leiche des teuern Mannes erblickt, ruft sie in Schmerz und wahnsinniges Entzücken ausbrechend: »Abdul! – Abdul! – kommst Du? kommst Du zu mir?« Und sie stürzt sich von der Seite ihres Knaben hinunter zu dem Geliebten in die todbringenden Fluten.
Das Märchen ist das einzige Werk der Ebner, welches die rücksichtslose Leidenschaft verherrlicht. Und ich meine, sie hat darin wohl der einzigen Leidenschaft ihres Lebens symbolischen Ausdruck verliehen: der Liebe des begeisterten hellen gütigen Mädchens zu der finstern, fremden, unbegreiflichen Macht der Kunst.
Auch Marie Ebner hat es erfahren müssen, dass die Kunst nicht den redlich Liebenden ihr Köstlichstes schenkt, sondern ihre Gaben aufhebt für irgendein sorglos des Weges daher kommendes zigeunerisches Wesen. Und dennoch: nicht reiches schönes Wirken und nicht alle höchsten Güter der Erde befriedigen ihre Sehnsucht. Rücksichtslos stürzt sie sich dem Dämon nach in den Strom, der ihn für immer zu entführen scheint. Eher untergehen, als dem Mysterium der Liebesvereinigung mit ihm entsagen!

Marie Ebner-Eschenbach im Jahre 1867
Viel tapferes Ringen galt es noch, ehe der Erfolg ihr zu teil wurde.
Das Erscheinen ihrer auserlesen wertvollen Aphorismen und der ersten prächtigen Erzählung »Božena« ging auf dem Büchermarkt fast spurlos vorüber.
Inzwischen hatte das Leben ihr zum Ersatz etwas Schönes zugedacht, das als Anregung zu neuer Arbeit reichlich soviel bedeutete, als der breitere Erfolg bei der Menge: die Freundschaft und die aufrichtige Bewunderung zweier bedeutender Frauen, der Wienerin Ida von Fleischel-Marxow und der Norddeutschen Luise von François. Diese Freundschaft, diese Bewunderung galt nun doch nicht mehr allein der liebenswürdigen vornehmen Frau, oder der gütigen Verwandten, sie galt der künstlerischen Persönlichkeit in Marie Ebner.
Es ist ganz unberechenbar, wie fruchtbar Anfeuerung, Kritik, Teilnahme am geistigen Schaffen werden können, wenn dies alles, mit dem Zauber frischer Sympathie umstrahlt, von hervorragenden Menschen dargebracht, neu in das Leben eines Strebenden eintritt. Luise von François, die herbe, starke Dichterin der letzten Reckenburgerin, des unvergleichlichen Kulturbildes aus der Zeit der Freiheitskriege, widmete der weichern österreichischen Schwester, als diese sich ihr bescheiden näherte, sogleich eine warme mütterliche Liebe. Sie hielt mit ihrem Tadel so wenig wie mit ihrem Lob zurück. Obschon Alter, Kränklichkeit und die beschränkten Verhältnisse der François ein öfteres persönliches Zusammensein unmöglich machten, erhielt sich ein reger Briefwechsel. Die innige Freundschaft der beiden so verschiedenen, auf gleicher geistiger Höhe stehenden Frauen ist ein köstliches und seltenes Bild in der Literaturgeschichte, ein Zeugnis für die warme und loyale Menschlichkeit, die den gemeinsamen Besitz beider Frauen bildete.
Marie Ebner mag wohl in mancher schönen Stunde gefühlt haben, welch seltenes Glück ihr zuteil wurde, indem es ihr vergönnt war, den einsamen Lebensabend einer der Grössten unter uns mit den warmen Sonnenstrahlen ihrer Liebe schmücken zu dürfen. Und was heisst Erfolg im Grunde anders, als ein oder zwei solche Herzen und Geister sich gewinnen zu können? Die Möglichkeit dazu bildet die feinste Essenz des Ruhmes. Alles andere ist nur Beigabe. Oft lästige, oft amüsante, zuweilen erfreuliche Beigabe. Dieses eine ist sein wahres und echtes Geschenk.
Wohin wir blicken in der Geschichte der Schaffenden, haben sie es auch so empfunden. Wohin wir blicken, hat solcher Gewinn die schönsten Früchte getragen.
Es scheint oft fast, als ob die vorhergehenden Jahre nur die notwendige Vorbereitung bilden für die fruchtbare Erntezeit, die dann plötzlich eintritt.
So folgen nun bei Marie Ebner Schlag auf Schlag die besten Treffer ihres Wirkens. In den Jahren, da gelehrte Wissenschaftler die Möglichkeit schöpferischer Arbeit bei der Frau überhaupt stark in Zweifel ziehen, erklimmt Marie Ebner rüstig und sicher die Höhen der Vollendung ihrer Kunst. Da schafft sie die Meisterstücke: Die Freiherrn von Gemperlein, das Gemeindekind, Krambambuli, und zahllose andere mehr oder minder kräftig geschaute, aber immer fein und vornehm geformte Lebensbilder.
— — — — —
Man sagt im allgemeinen: die Ebner sei eine durchaus objektive Erzählerin. Das ist doch nur bis zu einem gewissen Grade zutreffend. Sie ist nicht subjektiv, weil sie nicht ichsüchtig ist, sie ist eine selbstlose und insofern auch eine objektive Natur, als nicht nur ihre Person und deren Gefühle, Stimmungen, Freuden und Enttäuschungen das Leben ihres Gemütes ausmachen. Sondern ihr Herz umfasst stärker und wärmer als das eigne Ich die jungen Menschenkinder, die sie lieb gewonnen hat, die Armen und Elenden, um die sie sorgt, die Sonderlinge im Volk und unter ihren Standesgenossen, die sie mit ihrem freundlichen Humor umspinnt, die Tiere, die sie versteht, wie wenige Frauen sie verstehen, ihre Sammlungen, als da sind ihre merkwürdigen alten Uhren, und die Natur ihrer Heimat, die von ihr so intim gekannte und geliebte Landschaft Mährens. Dies alles bedeutet ihr Leben, gehört aufs engste zu ihrem Dasein. Und für ihre Dichtungen schöpft sie den Stoff am wertvollsten, am kräftigsten aus dem eignen reichen Leben.
Lasst es uns offen aussprechen: wenn diese als so objektiv gepriesene Dichterin aus der Atmosphäre gerät, die ihr Herz umspannt, wird sie schwach und blass, da kann sie falsche Töne greifen, kann sogar ungerecht werden. Aber sie tut es selten. Es ist ihr nicht wohl in der fremden Welt da draussen. Und mit frisch erneuter Lust kehrt sie dann immer wieder zu ihrem Eigensten zurück.
Unter die Glücksgeschenke, die Marie Ebner mitgegeben wurden, gehört vor allem eins: das Schicksal hat ihr eine Heimat gegönnt, eine wirkliche und wahrhaftige Heimat. Ein Stück Erde, wo das Kind gespielt, die Jungfrau geschwärmt, geliebt und sich begeistert hat, wo die junge Frau sich mit dem Leben abgefunden, sich zu manchem Entsagen ernsthaft durchgerungen hat, wo der reifende Mensch sich zur Welt und ihren Erscheinungen in ein Verhältnis gesetzt und die Frage nach dem Unsichtbaren und Ewigen in schauender Seele empfunden hat.
Zdislavic – was mag dieser eine Name für Marie Ebner bedeuten! Das Vaterhaus, dem sie jedes Frühjahr mit neu aufblühendem Entzücken entgegenfuhr – und sie hat dieses Wiederfinden mehr als einmal reizend beschrieben – das Vaterhaus durfte ihr durch ihr langes gesegnetes Leben hindurch eine Heimstätte, ein Erholungshort für Leib und Seele bleiben.
Dadurch, dass der Gatte der eignen Familie blutsverwandt war, brauchte sie sich keiner neuen, fremden Familie anzuschliessen, und, was viele Frauen mit schwerem Herzen tun, in ein fremdes Land, unter ein fremdes Volk zu gehen. Nicht musste sie sich um der Liebe willen von den Lieben lösen. Ihr blieb der Kampf erspart, zwischen der Anhänglichkeit an die Mächte, die die Kindheit schirmten und bildeten, und der Hingabe an jene, denen die Zukunft und die Gegenwart gehören sollen und die oft genug den erstem feindlich gegenüberstehen – ein Kampf, der tiefe Wunden schlägt, manche empfindliche Frauenseele niemals wieder zu froher Harmonie gesunden lässt.
Von Klosterbruck, wohin Baron von Ebner-Eschenbach samt der ganzen Ingenieur-Akademie aus Wien versetzt wurde, konnte Zdislavic leicht erreicht werden und blieb so der natürliche und gewiesene Sommeraufenthalt der jungen Offiziersgattin. Sie lernte nun zu dem deutsch-österreichischen Landleben auch das der kleinen Garnison, der kleinen Provinzstadt mit ihren humoristischen Typen engbeschränkter guter und wunderlicher Menschen kennen. Wie köstlich lebt das alles in ihrer ersten Erzählung »Božena« auf.
Vergißt man je das Bild des jungen glänzenden Offiziers, der auf dem Marktplatz des Städtchens sein Pferd die herrlichsten Kunststücke vollführen lässt, um die Aufmerksamkeit der schönen Kaufmannstochter Röschen zu erregen? Und der Buchhalter Mansuetus mit der heimlichen Schwärmerei für den ritterlichen Helden, die verkniffene, gezierte Gouvernante, die spät sich noch ins warme Nest des alten Kaufhauses gesetzt hat und darin nach aussen honigsüss, nach innen gallenbitter und herzenshart schaltet. Vor allem aber die grösste Gestalt des Buches: die getreue Magd Božena, welche die François eine Kentgestalt aus dem Volke nennt.
Es sind viele – allzuviele Geschichten von Leutnants und Bürgerstöchtern geschrieben worden, aber ein solches in sich geschlossenes Kulturbildchen gibt kaum eine andere. Diese Gestalten sind so ganz verschieden von allen sonstigen harten alten Kaufleuten, gezierten Gouvernanten, wunderlichen Buchhaltern, flotten Offizieren und getreuen Mägden, so ganz österreichisch, obschon so ganz menschlich.
Es ist die grosse Kunst der Ebner: das rein und ewig Menschliche in ihren Gestalten unlöslich mit dem Stammesbesonderen zu verbinden und zu verschmelzen. Weil sie selbst so rein menschlich empfindet und sieht und doch so fest in der Besonderheit ihres Stammes, ja selbst ihrer Kaste wurzelt, greift sie ganz unwillkürlich schon zu den richtigen Farben und Tönen. Auf diese Weise erklärt sich das Unabsichtliche in ihren Schilderungen, das zum Beispiel ihren Darstellungen aus der vornehmen Gesellschaft einen so hohen Reiz und eine so grosse Bedeutung verleiht. Es haftet ihnen nichts mehr von »Literatur« an. – Sie sind nicht nur fein beobachtet und gut gemacht, sondern sie sind organisch erwachsen, sie haben ihr eigenes Leben für sich: die alten Gräfinnen und Baroninnen, diese jungen Komtessen, die Grafen Wolfsburg und Dornach, die Freiherrn von Gemperlein. Sie strotzen von Natur und sind doch so diskret in der Farbe und in den Umrisslinien, wie wir nur die zeichnen können, die wir am allerintimsten kennen – die wir nicht mehr von aussen sehen, sondern durch Jahre und Jahre hindurch miterlebt haben. Die meisten Schriftsteller, welche den Adel schildern, gehören nicht durch die Geburt zu dieser exklusiven Gesellschaft. Manche Schattierungen im Bilde werden sie stets, falls sie nicht den seherischen Blick des Genies besitzen, falsch auffassen oder nicht bemerken. Sie werden geneigt sein, zu stark zu bewundern oder verständnislos zu verdammen.
Einige andere haben den Adel geschildert, die wohl zu ihm gehören, sich aber durch Weltanschauung oder Lebensverhältnisse in Gegensatz zu ihm gebracht haben, die aufrührerisch feindlich gegen ihn empfinden und zwar meistens feindlich mit dem Hass heimlicher Liebe und Sehnsucht, der bekanntlich ein besonders verbitterter Hass bleibt.
Und zuletzt gibt es noch eine Sorte von Schriftstellern aus der grossen Welt, die adligen Snobs, die gar nicht für sich oder ihre Kaste, sondern recht eigentlich für die Bürgerlichen schreiben, um diesen zu imponieren, sie zu blenden. Etwas von solcher theatralischen oder dekorativen Ritterlichkeit besass selbst ein so bedeutender Dichter, wie der Graf von Strachwitz.
Sie sehen sich immer auf einer Bühne, vor einem Parterre von Minderwertigen ihre Tragödien oder Komödien abspielen.
Um noch einen kraftvollen Schriftsteller dieser Art zu nennen, sei der Franzose Barbey d'Aurévilly erwähnt, der das aristokratische Dandytum mit Bewusstsein als Kulturfaktor pflegte. Auch die so gerichteten Poeten werden immer gern zu glänzende oder zu düstere Farben wählen, werden in überheroisches opernhaftes Pathos verfallen.
Marie Ebner ist auf diesem Gebiet unübertroffen. Nichts von den Fehlern, die angedeutet wurden, haftet ihren Schilderungen österreichischen Hochadels, Wiener Komtessen und mährischer Landjunkerfamilien an. Sie zeichnet sie mit der Liebe ihres Herzens, die aus teuersten Lebenserinnerungen schöpft. Sie betrachtet sie mit der Klarheit ihres feinen Verstandes, der die Schwächen, das Unrecht und die Lächerlichkeiten ihrer Kaste nicht verborgen bleiben können. Sie wägt sie mit dem Gerechtigkeits- und Wahrheitsmut ihrer reichen Seele, die weit hinausstrebt über die Standesschranken und alles edle Menschentum in sich aufzunehmen trachtet.
Aus Liebe, klarem Verstande und Wahrheitsmut bildet sich der Humor, der lächelnd und gütig zu richten versteht.
Marie Ebner ist fast niemals ironisch. Zur Ironie wird der Humor derer, die nicht genügend lieben. Es ist selten in Marie Ebners Lebenswerk, dass die Menschenfreundlichkeit nicht auch das verurteilende Wort sanft begleitete. Es gibt nur eine Stelle, eine Erzählung, in der das Thema ihrer Darstellung ihr Inneres so empört, dass die Liebe sich verhüllt und der Humor sich zu bitterer Ironie verwandelt. Es ist das feine und doch so furchtbare Kulturbild aus der Zeit der Leibeigenschaft: »Er lässt die Hand küssen.« Schärfer und unerbittlicher kann man ein verderbliches Regime kaum verurteilen, als es in dieser graziösen kleinen Erzählung geschieht. Ein alter Herr schildert seiner bejahrten Freundin die Tage der Vergangenheit, da ihre Grossväter und Grossmütter noch »grosse Herrn« waren, und wie eben diese gräfliche Grossmutter sich des Schicksals eines armen Leibeignen, des jungen Mischka annimmt, wie sie Stück für Stück das zufriedene harmlose Leben zerbricht, wie sie grausame Qualen verhängt, wo sie Wohltaten zu erweisen glaubt, bis zuletzt ein leichtsinnig gegebener Befehl zum Todesurteil wird. In die Geburtstagsfeier der gräflichen Poetin, die mit ihrem Schäferspielchen »les adieux de Cloë,« mit ihren Mooshüttchen und Tragantaltärchen ihre hochgeborenen Gäste unterhält, gellt der letzte Verzweiflungsschrei des zu Tode geprügelten Mischka.
Ja, auch hier, nach diesem krassen Sittenbilde, das durch die gedämpfte und sanfte Art des Erzählens nur noch stärker wirkt, fügt Marie Ebner eine kleine Nachschrift hinzu, die unendlich charakteristisch für sie ist. Der Enkel der grausamen Herrin des vergangenen Jahrhunderts behält den Enkel des getöteten Mischka in seinem Dienst – trotzdem dieser seine Interessen gröblich vernachlässigt. Er sucht in seiner Weise gut zu machen, was seine Vorfahren gesündigt haben. In dem Zuge offenbart sich die ganze Marie Ebner.
So ist diese Poetin der Gegenwart: mit klaren Augen sieht sie den Schaden, den die grossen Herren der vergangenen Jahrhunderte an ihren Untergebenen, an der Seele des armen Volkes begangen haben. Immer wieder in furchtbar ernsten, wie in gütig humorvollen Worten weist sie darauf hin: das Volk ist so armselig, so dumm und vertiert, weil ihr Eure Erzieherpflichten, Eure einfachsten Menschenpflichten an ihm versäumt habt. Wenn Euch jetzt vom Volke, von den Arbeitern und Taglöhnern Schaden zugefügt und für Euer gutes Meinen Unverständnis, Roheit zum Lohne wird, so erntet Ihr nur, was Eure Vorfahren einst säten. Jahrhunderte müssen vergehen in geduldiger Arbeit, ehe eine kommende Generation wieder die Früchte Eures bessern Wollens und Tuns ernten kann. Marie Ebner sucht als Mensch wie als Künstlerin ehrlich und gewissenhaft die Seele des so schwer zugänglichen, den höheren Ständen so feindlich verschlossenen, sich selbst so unbewussten Landvolkes ihrer Heimat zu verstehen. Und der Lohn ist ihr zuteil geworden: einige Offenbarungen von höchster dichterischer und sittlicher Schönheit, von ergreifender Wahrheit verdankt sie und verdanken wir diesem Suchen, diesem Finden. Immer aufs neue interessiert sie, das Kind vom Schlosse, die Wechselwirkung zwischen Schloss und Dorf, zwischen Herrschenden und Dienenden, zwischen Oben und Unten. Sie sucht alles aufs Menschliche zu stellen – auszugleichen, zu versöhnen, wie es ihre Art nun einmal ist, die Art der milden und feinen Frau, die nicht gerne hoffnungslos verzagen möchte an den Unmöglichkeiten des Lebens. Ein Zweifel, ob auf dem Wege, den sie angibt, noch zum Ziele zu kommen ist, taucht schon hin und wieder auf, aber er wird mutig bekämpft. Wenn jeder seine Pflicht täte – von oben und unten, so müsste es ja besser werden . . . Wenn sie nur jeder täte . . . Und sie wird nicht müde ihren Standesgenossen die Wahrheit zu sagen: herzlich, freundlich, scherzhaft. Sie ist eine weise und kluge Erzieherin, die gar keine neuen Ideale und Normen und Gesetze aufstellen will, als die, welche von jeher für die Ritterbürtigen, die Freien bestanden haben – die »Freien« freilich genommen als Gegensatz zu den »Unfreien«, den Hörigen und Knechten. Jene Freiheit, von der wir Spätergeborenen in schönen Stunden träumen, als von einem letzten Gut, das der ganzen Menschheit auf den Höhen sittlicher Vollendung gleich einer göttlichen Krone winkt, sie meint Marie Ebner nicht. Der Traum einer stolzen innern Freiheit aller Menschen, aus dem einige von uns ein starkes Ideal gewannen, das auch Kräfte für die geduldige und scheinbar aussichtslose Arbeit des Tages zu geben vermag, ist ihr nur eine wüste, wirre Phantasie geblieben, weil die Geburtsstunden solcher Träume, solcher Ideale blutig waren und schrecklich, wie Geburtsstunden neuen Lebens zu sein pflegen. Sie strebt nicht ins Grenzenlose, ins Zukünftige. Das Gegenwärtige, Massvolle ist ihr genug, im Leben wie in der Kunst. Innerhalb gesetzlicher Grenzen Tiefe und Wahrheit; in den Schranken der Sitte belebt und frei. Nicht die ganze Wahrheit – aber niemals etwas anderes als die Wahrheit. Ein wenig Nüchternheit wird solcher Denkweise immer anhaften. Der eine nimmt's als einen Vorzug, der andere als einen Mangel. Das ist Geschmackssache. Mit dem Gegebenen haushalten, das Gegenwärtige ausgestalten – to make the best of it, wie der Engländer sagt – so könnte auch der Wahlspruch der Ebner lauten. Menschen, die sich fügen und in das gewiesene Schicksal mutig oder entsagend schicken, sind ihr immer sympathisch. Wie viele feine und verklärende Worte findet sie für solche stillen Seelen. Das Aufrührerische, Draufgängerische, Rücksichtslose ist ihr in jedem Sinne verdächtig. Es endet immer schlecht in ihren Lebensbildern, und sie hat auch für die Tragik solchen Unterliegens nicht viel Sinn. Ebensowenig wie für die heroische Grösse der Schuld, die stets im Suchen neuer Formen, neuer Lebenswerte gegen das Alte begangen wird.
Ich zweifle, ob Marie Ebner es zugeben würde, dass ohne solche Schuldigen und Sünder die Menschheit heute nicht die Stufen der Entwicklung erklommen haben würde, die sie in der Tat erklommen hat. Wenngleich der starre und törichte Feudalismus ihrer Standesgenossen ihr fremd ist, gehört Marie Ebner doch ihrer ganzen Wesensart nach zu den konservativen Elementen.

Marie Ebner-Eschenbach in mittleren Lebensjahren
Sie ist auch im Konservatismus Idealistin. Wohl behält sie die alte Form, aber sie schaut tapfer hinein, sieht, dass die Form in zahllosen Fällen leer und hohl geworden ist, oder mit falschem Inhalt gefüllt wurde. Dann schüttelt sie sie mit kräftiger Hand und gibt ihr den echten edlen Inhalt wieder, der ursprünglich dafür bestimmt war. So hofft sie, aus einer wesenlosen Maskerade vergangener Tage einen neuen segensreichen Kulturfaktor der Gegenwart machen zu können. Indem Marie Ebner überall auf das Wesentliche zurückgeht, geschieht es ihr, dass unvermerkt in ihren Händen das adlige Ideal sich zu einem allgemein menschlichen, besser gesagt, zu einem Ideal germanischer Rasse erweitert – oder vereinfacht. Denn es kommt schliesslich auf ein paar Grundbegriffe heraus, die urecht germanisch sind, und die wir aus dunklen Vergangenheiten, mehr als wir es selbst wissen, im Blute tragen: Sei mutig und gerecht, sei treu und wahr. In diesen vier Begriffen liegt die ganze Moral von Marie Ebner. Sie predigt sie durch ihre künstlerischen Gestalten unaufhörlich ihren Standesgenossen – ihr Herz schwillt über von Freude, wenn sie sie auch im Volke triumphieren sieht. Fürchtet sie noch die Freiheit, welche im innersten Sinne Herrn und Knechte gleich macht, welche, wenn errungen, auch die äussern Verhältnisse zwischen beiden unfehlbar ändern muss, so weist sie doch, halb bewusst, halb unbewusst, den rechten Weg zu diesem Ziel. Denn wer mutig und gerecht, treu und wahr ist, der ist ein innerlich freier Mensch. Ein Verhältnis zwischen zwei Menschen, die beide mutig, treu und wahr sind von Herzensgrunde, kann niemals das von Herrn und Knecht im hergebrachten Sinne sein – selbst wenn zufällig der eine die Arbeit anzugeben, der andere sie auszuführen hat, selbst wenn der eine mit Glücksgütern gesegnet, der andere von ihnen entblösst ist. Die innern Beziehungen zwischen beiden werden nicht auf Herrentum und Knechtschaft beruhen, sondern auf gegenseitiger Hochachtung und Sympathie. Und auf die innern Beziehungen kommt es an. Nur solche innern Kräfte führen auf die Höhen, wo die göttliche Krone winkt.
— — — — —
Der Roman »Unsühnbar«, ein breit und kräftig ausgeführtes Gemälde österreichischen Hochadels, lässt uns, wie kaum ein zweites Buch, Marie Ebners inneres Verhältnis zu ihren Standesgenossen beobachten. Es beweist alle glänzenden Vorzüge ihrer hohen Kunst, die Lauterkeit ihrer Weltanschauung und zeigt zu gleicher Zeit die Grenzen ihres Erkennens, ihres Wollens.
Aufs feinste berechnet, aufs glücklichste getroffen ist die Komposition aus den charakteristischen Typen österreichischer Aristokratie. Wie diese Gesellschaft miteinander verkehrt, wie sich die Menschen bewegen, sich kleiden, wie sie reiten und jagen, ihre Feste und Familienzusammenkünfte, der Ton ihrer Unterhaltungen, die Art wie sie sich freuen und wie sie leiden – alles ist von so absoluter Glaubwürdigkeit und zugleich von so hoher künstlerischer Vollendung, dass das Buch schon aus diesem Grunde immer ein höchst wertvolles historisches Kulturdokument bleiben wird.
Und doch gehört es als Ganzes nicht zu den grossen Büchern, die ewig Menschliches uns in unvergesslicher Offenbarung enthüllen.
Der Teil, der seine Tiefe und seine Stärke bedeuten müsste, fasst nicht ins Innerste und ist aus Stärke und Schwäche seltsam gemischt.
Eine grosse, edle Frauennatur, Marie Gräfin Dornach, wird durch ein Zusammentreffen verhängnisvoller Umstände mehr als durch eignen Willen zum Ehebruch getrieben. Jene wenigen Minuten eines Unterliegens unter der Gewalt verwirrter Leidenschaften haben für sie, die Stolze und Wahre, ein Leben der Lüge und Verstellung zur Folge. Sie nimmt die für sie schwerste Busse nicht aus Schwäche auf sich, sondern in bewusster Überlegenheit, um das Glück ihres edlen und von ihr mehr und mehr geliebten Gatten nicht zu zerstören. Als ein schrecklicher Zufall ihn und seinen Sohn tötet, sie allein mit dem in jener bösen Stunde erzeugten Kinde zurückbleibt, schüttelt sie auch sofort die Lüge von sich ab und nimmt vor ihrer Familie und der Gesellschaft alle Konsequenzen ihrer Schuld auf sich. Dennoch fühlt sie sich nicht entsühnt und stirbt in tiefer, ungestillter Reue.
Der Stoff ist stark und erschütternd, alles Beiwerk meisterhaft gezeichnet – woran liegt es, dass diese Maria Dornach und ihr Fehlen, ihr Leiden, ihr Büssen uns doch immer wieder wie ein künstlich konstruiertes Romanschicksal erscheinen will und nicht mit der Wucht dichterischer Kraft unser Fühlen ergreift? Man sagt, Marie Ebner habe, angeregt von einer wahren Begebenheit, die sich innerhalb der österreichischen Aristokratie abspielte, die Idee zu diesem Buche gefasst. Dies scheint sehr glaubhaft, und es erklärt schon die plastische Kraft, die der Enthüllungsszene innewohnt, im Gegensatz zur Schwäche in der Motivierung der vorhergegangenen Schuld. Die Tatsache, dass eine Frau, nicht gezwungen durch äussere Umstände, sondern getrieben von leidenschaftlichem innern Wahrheitsdrange, vor der ganzen Welt eine längst verjährte Schuld bekennt, fällt ganz in das Gebiet der Lieblingsmotive unserer Dichterin. Bereits ihre erste Erzählung: »Božena« wurzelt in ähnlicher Grundidee. Das Weib aus dem Volke, die derbe Božena, kann so wenig wie die vornehme Gräfin Dornach ertragen, dass man sie mit Ehren überhäuft, die sie nicht zu verdienen meint. Und weiter: wie die Gräfin Dornach den Verführer, weist die Bäuerin in »Eine Totenwacht« den Vater ihres Kindes zurück, als er verspätet sie zur Ehe begehrt, weil ihnen beiden eine Vereinigung mit dem Manne, der einst feige und schlecht gehandelt hat, unmöglich ist – obschon eine Heirat für sie beide mit mancherlei weltlichen Vorteilen verknüpft sein würde.
Durch solche Auffassung erhebt sich Marie von Ebner hoch über ihre englische Kollegin George Elliot, mit der sie sonst in ihren Anschauungen über Ethik und Moral und die Behandlung beider in ihren Dichtungen viel Ähnlichkeit aufweist. Aber die Elliot macht entweder dem englischen Publikum oder einer Feigheit des eignen Herzens peinliche Konzessionen. Sie kann die Frauen, die ihrer Anschauung nach gefehlt haben, gar nicht genug und förmlich mit grausamer Lust von des Geschickes Geisselhieben peitschen lassen, bis sie in Jammer und Verzweiflung enden. Sie verdammt sie schonungslos, obschon sie doch gut genug, aus der Erfahrung an sich selbst, wissen müsste, dass ein Abweichen der Frau von dem vorgeschriebenen Wege bürgerlicher Sitte und sogenannter Ehrbarkeit keinerlei Rückwirkung auf ihren Charakter zu haben braucht, dass solches Abweichen ebensowohl durch ungewöhnliche persönliche Kraft, als durch ungewöhnliche weibliche Schwäche verursacht sein kann.
Aber diese geistig bedeutende Frau hat nie den Stolz besessen, sich selbst zu ihrem Handeln zu bekennen. Diese Zwiespältigkeit zwischen Leben und Überzeugung muss bei einer Erscheinung, wie die der Elliot, verletzend auf jedes natürliche moralische Gefühl wirken.
Die Marie Ebner steht den heiklen und schwierigen Fragen weiblicher Sittlichkeit gerader und einfacher gegenüber. Sie bleibt auf dem Boden hergebrachter Anschauung über Frauenehre und Frauenmoral, aber sie bleibt nicht aus Feigheit oder Denkträgheit oder Temperamentlosigkeit darauf, sondern weil dieser Boden ihrer Natur die richtige und beste Nahrung bietet, weil sie sich wohl darauf fühlt und er gerade ihrer Wesensart keine hemmenden Schranken auferlegt.
Aus ihrer glücklich balanzierten Natur heraus kann sie mancher Erscheinung komplizierterer Art unter den Frauen kein volles Verständnis entgegenbringen. Irgendwie fühlen wir in der Zeichnung von Maria Dornach einen Mangel, wie wir ihn sonst bei Marie Ebners Phantasiekindern nicht fühlen. Sie ist doch gar zu sehr Heilige. Den Sturz stellt auch die Verfasserin zu sehr als ein an ihrer Heldin begangenes Verbrechen dar. Fühlt Maria den Ehebruch als unsühnbares Unrecht – und er wird es natürlich in ihren Augen mehr und mehr, je stärker und inniger die Liebe zu ihrem Gatten aufblüht – so ist die Verdammung ihrer selbst doch nur möglich, wenn sie selbst ihn mit heissem Blut in verschwiegener Seele ersehnt hat. Und so heisses Blut regt sich im Leben eines Menschen nicht nur einmal. Es wallt bei tausend Gelegenheiten, nicht nur erotischen, auf. Es treibt zu ungewöhnlichen wie zu gefährlichen Taten. Es ist Ansporn und Pfahl im Fleisch einer ethisch fein und rein fühlenden Frau. Und diese geheime Tragik in der zwiespältigen Natur ihrer Heldin, den nie endenden Kampf mit dem eignen Ich, den bleibt uns Marie Ebner schuldig, so prachtvolle und kernige Szenen das Buch sonst auch bietet. Besonders sei der Szene gedacht, in der die Gräfin Dornach auf dem Rücken ihres Pferdes vom wilden Rausch des animalen Leben so stark [Eine Seite fehlt im Buch] Minierarbeit den Fuss und das Gewand beflecken könnte, hält sie zurück, vielleicht gesellt sich zu diesem Bangen auch wieder jene richtige Schätzung von der Art ihres Talentes, jene schon mehrfach erwähnte Selbstbescheidung, und ein sehr ausgeprägter Geschmack für eine vornehme Glätte und Abrundung der Form, in welche die dämonischen und schrecklichen Erscheinungen des Menschenlebens nicht zu zwingen sind.

Marie Ebner-Eschenbach in ihrem Arbeitszimmer
Kurz: Marie Ebner hat sich mit Bewusstsein und aus Überzeugung das Bereich ihrer Motive ziemlich eng gesteckt. Sie hat jahrelang in Wien gelebt, es ist ihre zweite Heimat geworden. Sie hat mit ihren hellen Augen gewiss auch in manchen gefährlichen Strudel geblickt, der in der alten Kaiserstadt quirlt und brodelt. Und was gab sie uns aus dieser weitverzweigten vielgestaltigen Welt? Ein paar kleine Komtessen, ein paar Grafen und Barone, ein paar freundliche Sonderlinge, liebenswürdige Mädchen, gütige alte Damen, rührende Kindergestalten. Das ist alles. Vorüber ging sie an der gierigen Jagd nach Besitz und Ruhm, Einfluss und Macht, vorüber auch an den rasenden, unerbittlich hartnäckigen Kämpfen von Rasse gegen Rasse, wie sie gerade in Wien ausgefochten werden, in denen sich die dunkeln Untergründe der Menschennatur bestialisch offenbaren, vorüber an den Erscheinungen wilder Sinnenlust und wunderlich verschnörkelter Dekadenz einer müden kranken Jugend. Und hat sie für die Not auf dem Lande ergreifenden Ausdruck gefunden – das Proletariat der grossen Stadt und sein Ringen um Befreiung und Erhebung bleibt dieser Menschenfreundin fremd, unheimlich.
Das ist die Art aller echten Kunst: sie greift aus dem Wirrwarr buntfarbiger Erscheinungen, davor der laienhafte Beobachter überwältigt steht, ein Kleines, Unscheinbares heraus, vergnügt sich mit der liebevollsten Sorgfalt an seiner Bildung und offenbart an ihm die tiefsten Wahrheiten und die mannigfachsten Beziehungen zwischen allem Menschlichen.
Marie Ebner ist die Dichterin der Idylle. Ihre Lieblingsgestalten sind alle im Grunde gute Seelen, die keiner Fliege ein Leid tun möchten, und die sich nur zuweilen anfangs ein wenig rauh gebärden, wie jener jüdische Kreisarzt, der so schrecklich aufs Geld erpicht ist und doch so prächtig von seiner Habsucht geheilt wird durch das Zusammentreffen mit einem selbstlosen Menschen.
Marie Ebner hat es wohl auch einmal versucht, das Satanische zu schildern, das Weib als Verderberin, in der merkwürdigen Erzählung: »Das Schädliche«. Aber die schöne kalte Teufelin bleibt ein aus lauter feinen Psychologiepünktchen zusammengesetztes Mosaikbild. Die Erzählung gibt mehr Marie Ebners innere Stellungnahme zu so rätselvollen, glänzenden und zerstörenden Phänomenen, als dass uns die Macht dieses Glänzenden, Verführerischen und Zerstörenden innerlich ergriffe. Ihr Standpunkt ist hier doch zu sehr der sittlich-verurteilende. Sie hat keine ästhetische Freude an dem schönen herzlosen Geschöpf, deshalb verfallen wir seinem Zauber zu wenig.
Es ist wohl auch hier der Grund zu suchen, weshalb das vorletzte Buch der Ebner, die »Agave«, nicht ganz die Höhe der übrigen Werke erreicht. Durch einen Aufenthalt in Rom angeregt, wollte die jugendlich begeisterte Siebenzigjährige ein Gemälde jener grossen und geheimnisvollen Renaissancezeit geben, da Weltsinn und Frömmigkeit, heilige Kunstbegeisterung, wilde Blutgier und Kriegslust sich seltsam einten, um die Wunderblüten zu zeugen, deren Farbe, deren Duft uns noch heute aus den Kunstwerken und Dichtungen jener Zeiten wundervoll berauschen. Wenn man neben die »Agave« Stendhals unvergleichliche Renaissance-Novellen hält, in denen wie in keinem andern Buch der Neuzeit der Geist jener glühenden und furchtbaren Tage eingefangen wurde, so scheint doch die »Agave« von Marie Ebner ein allzu friedfertiges, harmloses Büchlein.
Man kehrt von der Künstlergeschichte des armen Jungen, der eigentlich kein Talent hat und doch in der Leidenschaft ein wundervolles Meisterwerk malt, das er später, da ihm kein gleiches wieder gelingt, verzweifelt vernichtet, gerne zu den unübertrefflichen Erzählungen aus der mährischen Heimat der Ebner zurück. Hier offenbart sich der reiche schöne Geist, das tiefe Gemüt der herrlichen Frau auf jeder Zeile. Hier gibt's unübertrefflichen Genuss. Hier ist die lindeste, einfachste Vollkommenheit.
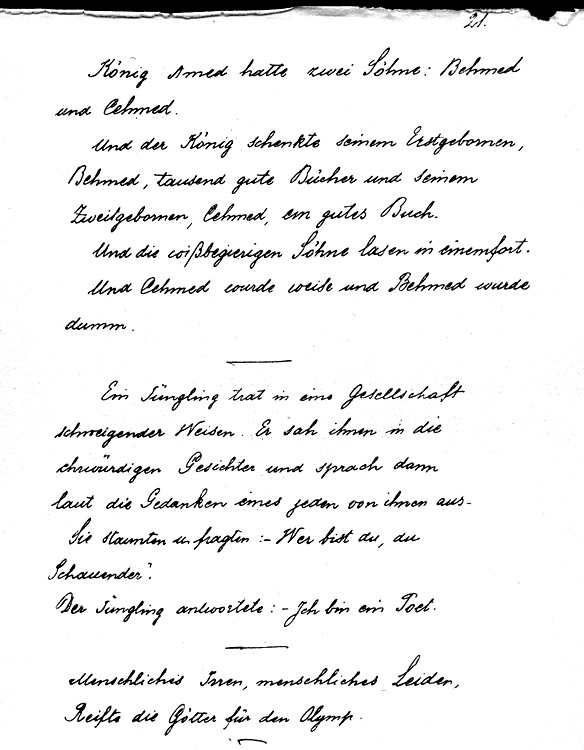
Der Stil von Marie Ebner, sie mag Glanz, Feinheit und Schöne, sie mag Elend und verschwiegenen Jammer schreiben, gleicht immer der Toilette einer vornehmen Frau. Balzac zieht einmal Vergleiche zwischen der Art, wie eine grande dame sich kleidet, und wie die bourgeoise sich anzieht. Die grande dame nimmt vielleicht nur ein Band als Garnierung ihres Hutes, aber sie wird niemals ein gewaschenes oder gefärbtes tragen. Die bourgeoise greift ruhig zu dem aufgefärbten und tut dann noch eine billige Blume oder Feder hinzu. Die grande dame wird nur wenig Schmuck anlegen, aber er wird unfehlbar in echten Steinen und guter Arbeit ausgeführt sein, die bourgeoise wird ein Medaillon noch über der Broche klirren lassen. Denn: la bourgoise aime le pléonasme dans la toilette.
In ihrer künstlerischen Toilette ist nun Marie Ebner völlig la grande dame. Ruhige Schlichtheit ist ihr erstes Bedürfnis. Aber die Schlichtheit ist das Gegenteil von Dürftigkeit. Sie ist, wenn man näher zusieht, aus den kostbarsten Stoffen mit wählerischem Geschmack hergestellt. Ich glaube, man könnte ruhig Marie Ebners sämtliche Werke durchblättern, ohne je einem Pleonasmus oder einem unechten Redeschmuck zu begegnen. Jede Übertreibung des Ausdruckes ist ihr verhasst, sie verschmäht den farbigen Ausputz glänzender malender Beiwörter. Fest und logisch sind ihre Sätze geformt, ruhig dahinströmender Wohllaut klingt in ihren Perioden. Malt sie einmal ein Bild, so steht es, trotz der diskreten und einfachen Mittel plastisch rund und kräftig vollendet da, wie z. B. der herrliche Aufbruch zur Jagd in »Unsühnbar« oder die grandiose Rauferei zwischen den Bauern und Pavel im »Gemeindekind«.
Ihre Art zu erzählen muss eher behaglich als spannend genannt werden, aber wo sie dramatische Steigerung anwenden will, bewährt sie sich als Meisterin im Aufbau solcher Szenen, die um so stärker wirken, je sparsamer sie im Gefüge des Ganzen verwendet werden. Delikat und zierlich sind die Pointen aufgesetzt, reizvoll bewegt wird der Ernst der friedlich dahingleitenden Sprache durch die schelmischen Munterkeiten eines freundlichen Humors.
Marie Ebners Humor ist etwas ganz Einzigartiges. Er hat keine Ähnlichkeit mit den grotesk-unheimlichen Übertreibungen des an Menschenliebe und Erbarmen ihr gleichenden Dickens. Auch nicht mit dem gemütlichen Ausmalen guter menschlicher Drolligkeit, oder der derben niederdeutschen Schwankhaftigkeit, wie sie Fritz Reuter liebt. Er ist von ganz anderer Art als der skurrile, wuchtige und so tiefgründig wie prachtvoll farbige Humor des Schweizers Gottfried Keller.
Er ist das Lächeln einer feinen, klugen vornehmen Frau über das wunderliche Leben und die wunderlichen Menschen. Ein Lächeln, das niemals zum lauten Lachen wird, das auch selten nach dem alltäglichen Rezept für Humor von sentimentalen Tränen begleitet ist – das eben nur wie ein flüchtiges Leuchten in den Augen aufblinkt, um die Mundwinkel huscht, gleich wieder verschwindet und doch einen weichen und heitern Zug auf dem ernsten Gesicht zurücklässt.
Oder ihr Humor ist wie ein zartes goldenes Netz, das ihre geschickten Finger knüpften, um aus Bächen und Seen, angefüllt mit Schlamm und Getier von mancherlei Art, die seltsamsten Fischlein zu fangen und ihr fröhliches oder wichtiges und eifriges Gebaren zu beobachten, ohne ihnen doch wehe zu tun. Nein – Marie Ebners Humor kann niemand wehe tun. Sie umspinnt mit ihm nur das, was sie liebt, den, der sie erfreut, wenn auch nicht immer durch seine Vortrefflichkeit, so doch gewiss durch seine Absonderlichkeit, die ja auch zu einer andern Art von Schönheit werden kann.
Die Zartheit und die sonnige Heiterkeit von Marie Ebners Humor wird geschaffen und durchleuchtet von der Güte ihres Herzens.
Seltsamerweise misstraut man heute der Güte fast so sehr wie dem Dämonischen. Sollte ein tiefer Sinn sich aus dem Zusammenwerfen dieser scheinbar so himmelweit voneinander wohnenden Begriffe offenbaren? Insofern schon, als die wahre Güte – wie Marie Ebner sie begreift – beinahe etwas Dämonisches zu nennen ist: eine Anschauung aller Dinge, ein Verhalten zum Weltganzen, das aus einer innersten Gewalt, aus den vom nüchternen Verstande nicht mehr beherrschten Urgründen einer Natur als milde, aber unwiderstehliche Macht hervorbricht und seinen Weg sucht, seine Taten tut – allen Hindernissen zum Trotz.
In Zeiten verfeinerter Kultur wendet man sich stets mit ängstlicher Sehnsucht nach den Idealen der Kraft und der Stärke, als nach Stützen und Gegengewichten für das allzu Schmiegsame, Zarte, das die Oberhand zu gewinnen droht. Und da begeht man zuweilen das Missverständnis, auch die Güte unter die weichlichen Tugenden, die überwunden werden müssen, zu rechnen, während sie doch gerade recht eine Tugend der stillen Kraft genannt werden kann. Man hat die Güte mit ihrer minderwertigen, ihr freilich in manchen Augenblicken zum Verwechseln ähnlichen Schwester, der nachgiebigen haltlosen Gutmütigkeit, verwechselt.
Wahrhafte Güte – nicht als spontane Wallung, sondern als stetige ausschlaggebende Richtung eines menschlichen Lebens – findet sich nur bei harmonisch vollendeten Persönlichkeiten – und wo wäre eine harmonische Vollendung ohne unaufhörliche stille Kraftbetätigung möglich?
Es gibt aber kaum einen produzierenden Künstler, dessen geistiges Wesen so durchaus geleitet würde von der Güte, wie das der Marie Ebner. Und wir sehen hier einmal, wie ein Ideal gebildet wurde aus der reichen Fülle des vorhandenen Stoffes, statt aus der Sehnsucht nach einer nicht vorhandenen Essenz zur Ergänzung eines stark und schmerzhaft empfundenen Mangels – wie es ja bei manchen Philosophen geschehen sein soll.
Geben die Aphorismen der Ebner den Niederschlag ihrer Lebensbetrachtung – und sie schenken uns einen reichen goldenen Niederschlag – so müssen wir darin auch ihre Gedanken über die Natur der Güte, ihres Lebensideales finden.
Sie spricht also:
Fähigkeit ruhiger Erwägung: Anfang aller Weisheit, Quell aller Güte!
*
Der Geist ist ein intermittierender, die Güte ein permanenter Quell.
*
Gutmütigkeit ist eine alltägliche Eigenschaft, Güte die höchste Tugend.
*
Erinnere Dich der Vergessenen – eine Welt geht Dir auf.
*
Nächstenliebe lebt mit tausend Seelen, Egoismus mit einer einzigen, und die ist erbärmlich.
*
Aus dem Mitleid mit anderen erwächst die feurige, die mutige Barmherzigkeit, aus dem Mitleid mit uns selbst die weichliche Sentimentalität.
*
Er ist ein guter Mensch! sagen die Leute gedankenlos. Sie wären sparsamer mit dem Lobe, wenn sie wüssten, dass sie kein höheres zu erteilen haben.
*
So mancher meint ein gutes Herz zu haben und hat nur schwache Nerven,
*
Die Güte, die nicht grenzenlos ist, verdient den Namen nicht.
*
Wie weise muss man sein, um immer gut zu sein.
Nicht nur die höchste Weisheit zeigt sich für Marie Ebner in der Güte, auch die rechte Religion offenbart sich durch sie der Dichterin. Als der Priester in »Glaubenslos« an den Dogmen seiner Kirche zu zweifeln beginnt, findet er seinen Frieden in der Liebe zu seinen Gemeindegliedern. Und in dem reizenden Gedichtlein: »St. Peter und der Blaustrumpf« denkt sich Marie Ebner selbst vor der Himmelspforte. Als der Heilige die Echtheit ihrer Religion nicht gelten lassen will, antwortet sie ihm:
»Wär Dir bekannt mein Lebenslauf,
Du wüsstest, dass in selgen Stunden
Ich meinen Herrn und Gott gefunden.«
Der Pförtner stutzt: »Allwo? – Sprich klar!«
– »Daselbst, wo ich zu Hause war,
Mein Handwerk brachte das mit sich,
Im Menschenherzen. Wunderlich
War dort der Höchste wohl umgeben;
Oft blieb von seines Lichtes Weben
Ein glimmend Fünklein übrig nur,
Und führte doch auf Gottes Spur.
Ob er sich nun auf dem Altare
Den Frommen reicher offenbare –
Das zu entscheiden ist Dein Amt.
Bin ich erlöst? bin ich verdammt?«
– St. Peter lässt nach einigem Besinnen den Blaustrumpf ein, damit er die fragliche Angelegenheit mit Gott Vater selber besprechen möge.
Das Suchen des göttlichen Funkens der Liebe, der Güte im Menschenherzen erscheint Marie Ebner als die köstlichste und notwendigste Aufgabe des Poeten. Und welche Freude, wenn er ihn gefunden!
Unzählige Varianten ersinnt die Dichterin, um das Lob der Güte stets neu und anziehend zu gestalten. Die mannigfachsten Menschentypen sucht sie zu formen, die ganze, fein ausgebildete Kunst ihrer Psychologie wendet sie an, ihre Lieblinge mit einem reichen, vielseitigen Seelenleben, mit zahllosen überraschenden Zügen voller Lebenswahrheit auszugestalten.
Die Jünger der Güte bilden weitaus den grössten Teil in Marie Ebners Sammlung von Charakterköpfen.
Da ist gleich zuerst Božena, die robuste Magd aus dem Volke, deren durch aufopfernde Hingabe ihres ganzen Lebens gesühnte Schuld darin besteht, dass sie in einer einzigen Nacht über dem eignen Glück die Sorge um das Kind ihrer Herrschaft vergessen hat.
Ihr folgt in dem langen Zuge liebenswürdiger Gestalten: Lotti, die sanfte Uhrmacherin. In der Werkstatt ihres Vaters, unter all den seltenen Kunstwerken der Uhrmacherkunst, führt sie ein von Entsagungsfreuden und Aufopferungsglück still bewegtes Dasein. In dessen Schilderung hat die Verfasserin höchst reizvoll ihre eigne Liebhaberei für seltene alte Uhren, ihre genaue Kenntnis dieses eigenartigen Sammelobjektes verwebt. Und gewiss hat diese aparte Umrahmung beigetragen, ihr gerade für diese Erzählung, welche zuerst in der »Deutschen Rundschau« erschien, den norddeutschen Leserkreis zu erobern. Der Uhrmacherin folgt in demselben Bande der gesammelten Werke der zarte Schemen jener Verstorbenen, der mit blasser Geisterhand einen starren Egoisten auf den rechten Weg zu führen, noch nach dem Tode die Macht erhält. Und wieder gleich einem künstlichen Uhrwerk aus den feinsten Rädchen und Spindeln, gefasst in ein zierlich ausziseliertes goldenes Gehäuse, wirkt das Idyll: Die Freiherrn von Gemperlein. Hier ist ein schier unerschöpflicher Reichtum an kleinen humorvollen Zügen unendlicher Herzensgüte der so komischen wie rührenden Brüder des konservativen Friedrich, des radikalen Ludwig – der zwei unsterblichen alten Junggesellen auf Wlastowitz.
Eine hervorragend bedeutende Gestalt ist der merkwürdige loyale Aufrührer Jakob Scelas. Dann der jüdische Kreisphysikus, die kleine Sportskomtesse Muschi, die Unverstandene auf dem Dorfe, die Generalin, die auf der Strasse ihren Muff verschenkt, die Jungfer Pulcheria in der »Agave«, die beiden Tanten in der »Armen Kleinen«. Mit ihnen allen ist die Reihe köstlicher Gestalten, die zum Preise des göttlichen Funkens über die Bühne von Marie Ebners Schaffen wandeln, noch lange nicht erschöpft.

Marie Ebner-Eschenbach im Greisenalter
(Nach einem Gemälde von Marie Müller)
Am feinsten und tiefsten ist es ihr gelungen, den Sieg des Guten gegen die Gewalten des Hasses und der wilden Menschenverachtung zu feiern in der seelischen Entwicklung des armen Gemeindekindes, in Pavel, dem Sohn des Zuchthäuslers. Die gefährlichsten Umstände vereinen sich, um in das Herz dieses armen Kindes Gedanken der Rache, der Verbitterung, des Aufruhrs – die Saat des Verbrechens zu streuen. Pavel ist durch seine Abkunft, durch die Vernachlässigung und alle die Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten, die er in seiner Kindheit erfährt, eigentlich prädestiniert, ein Lump, ein Dieb, ein Totschläger zu werden und im Zuchthaus zu enden, wie sein Vater. Aber mit aller Wildheit und Unlenksamkeit verbindet sich in ihm als Erbteil seiner unglücklichen Mutter, die schweigend im Gefängnis eine nie begangene Freveltat abbüsst, ein Keim starrer Pflichttreue und weicher Güte. Beides wandelt ihn endlich aus einem kleinen Halbtier, einem finstern Kaliban zu einem braven trefflichen Menschen. Freilich geschieht dies nicht, ohne dass zuerst die notwendige Entladung eintritt. Er wirft seinen Peinigern, den reichen Bauern und Gemeindevorstehern, die die Quäler seiner Jugend waren, das Wort »Lumpenbagage« an den Kopf, und als sie, viele gegen einen, über ihn herfallen, prügelt er sie mit wilder Wollust, einem rasenden Ajax gleich, einen nach dem andern fürchterlich durch. Der Szene wurde schon erwähnt. Sie ist eine der gewaltigsten, die Marie Ebner geschrieben hat. Man fühlt ordentlich, wie auch ihre feine Hand sich zur Faust ballt, um all der trägen dumpfen Schlechtigkeit, die sie mit ihrem Pavel durchlebt hat, unerwartet wuchtige Strafe zu versetzen. Als ein blasses Heiligenbildchen auf Goldgrund hebt sich von dem dunklen Hintergrund der Erzählung die Gestalt der Schwester Pavels ab. Von ihrer Gönnerin, der alten Baronin, auch eine der besten von Marie Ebners vielen guten Sonderlingen, ins Kloster geschickt, büsst sie dort für die Sünden ihrer Eltern so heftig, dass sie, eine kleine Märtyrerin ihres ehrgeizigen Heiligkeitsdurstes, einen frühen Tod findet. Bewundernswert ist es, wie Marie Ebner bei der Zeichnung der kleinen Frommen und der anbetenden Liebe des Bruders zu der ihm so fremden Schwester jeder Spur von Sentimentalität aus dem Wege gegangen ist, wie herbe überhaupt das ganze Gemälde mit seiner Fülle lebensstrotzender Gestalten in Umriss, Farbe und Linienführung wirkt.
— — — — —
Marie Ebner als Psychologin der Kinderseelen, das ist ein ganz eignes Kapitel. Der scheue Trotz, die zarte, unbewusste Sehnsucht nach Liebe und Verständnis, die oft im Kinde hinter fester Verschlossenheit verborgen wird, das Sprunghafte seiner Wünsche und Bestrebungen, seine Eigenwilligkeit und zugleich seine Nachgiebigkeit, seine quälenden Gewissensnöte – die Phantasie in des Kindes Lüge – die Phantasie in der kindlichen Wahrhaftigkeit – alles liebt und begreift sie als wichtige Teile von Werdeerscheinungen des heranreifenden Menschen. Und sie zeigt uns, wie oft aus scheinbar leichten Verletzungen die erschütternde Tragik eines Kinderschicksals sich entwickeln kann, wenn die, welche die Meister und Leiter dieses zerbrechlichen Geschickes sein sollen, töricht oder brutal oder gedankenlos, kein Verständnis für seine Zartheit besitzen.
Tiefbewegend in ihrer schlichten Alltäglichkeit ist die Geschichte des wenig begabten Schülers, der von dem eigensinnigen Vater dem Phantome seines Ehrgeizes und seiner Eitelkeit geopfert wird.
Oder die Charakteristik der beiden Kinder aus dem Armenhaus in »Ein Verbot«, dieser typische Gegensatz zwischen dem praktischen lebenstüchtigen, skrupellosen Mädchen, der Milenka, und dem verträumten, kränklichen Franzko, den Furcht und Grauen vor der vermeintlichen Hexe in den Tod hetzen. Verständnisvolle Menschenliebe hat auch in diesem Kulturbild der Dichterin die Hand geführt. Mit wie wenigen Strichen ist das alles hingesetzt – und der Humor, der diesen Auswurf menschlichen Elends schildert, wird düster und schmerzlich, bekommt Töne anklägerischer Schärfe, die Marie Ebner nur selten anwendet. Denn im allgemeinen ist es gerade der Mangel an Bitterkeit und Galle, wodurch ihrem Humor die helle und doch feine Heiterkeit bewahrt bleibt. Besonders innig wird diese Heiterkeit, wo Marie Ebner aus den Erinnerungen an die eigne Kindheit schöpft, oder wo die jungen Nichten ihr Modell standen, die Bruderkinder, welche sie mit Mutterzärtlichkeit in ihr Herz geschlossen hat. Sie alle gehören derselben Familie an, die blonden, frischen, mutigen, wahrheitsfreudigen Schlosskinder, ob sie nun Muschi oder Paula, Pia oder Elika heissen. Ihnen allen, den ernsten und den lustigen, den weisen und den törichten haucht Marie Ebner den eignen Geistesodem ein und gibt ihnen die eigne unerschütterlich anständige Gesinnung mit. Manche der kindlichen Mädchengestalten gemahnen in der Technik an jene unglaublich sauber ausgeführten Bleistiftzeichnungen des Pariser Meisters Ingres, andre wieder erinnern in der delikaten Tönung an die zart-pikanten Pastellbildchen, wie sie die Wände der alten englischen Landsitze zieren. Exquisite Noblesse, rosenrote Jugend, ein Hauch gesunder Landluft und eine herzliche Schelmerei oder eine liebe wehmütige Sehnsucht geben die charakteristischen Elemente der reizvollen Genrebilder. Die Farben sind so leicht und duftig aufgetragen, wie mit dem zugespitzten Papierröllchen des alten Pastellzeichners, an dem nur der feinste Hauch des flüchtigen bunten Farbenstaubes haften durfte.
So steht die schlanke Pia mit dem blonden, knabenhaft kurz geschnittenen Haar oben im Fenster des alten Turmes, das rosige Fäustchen umschliesst ein ängstlich zuckendes Vögelchen, das sie dem bösen Hund entrissen hat, auch die räuberische Katze mit den gelben Opalaugen an ihrer Seite lauert auf die köstliche Beute, und das Kind wirft das Vögelchen hinaus in die Luft zu romantischerem Tode – doch siehe, das Sterbende flattert – fliegt . . . wird mit Jubelgezirp von der klagenden Vogelmutter im Lindenbaum begrüsst, und die Kleine jauchzt: »Spring nach! Hol Dir's alter Kater! Es ist gerettet vor Dir, vor allen seinen Feinden, es ist bei seiner Mutter.«
Und dann wiederholt sie nachdenklich: »Bei seiner Mutter.«
»Wie einem da ist wusste sie schon lange nicht mehr . . . Sie war damals so gar klein gewesen . . . Aber herrlich musste es sein für einen Vogel und für ein Kind.«
Hier klingt ein Ton des Sehnens und Entbehrens, der durch Marie Ebners eigne Kindheit zittert. Und aus der Sehnsucht nach dem Köstlichsten, was dem Weibe geschenkt werden kann, und das sie nie besass, entstanden jene Einsichten und Erkenntnisse, die der Besitz selbst so selten erzeugt. Doch sie hat Schmerz und Begehren längst überwunden. Das Licht eines klaren Herbstabends liegt über Marie Ebners letztem Buche, welches sie der Nichte widmet, das aller mädchenhaften Jugend geschenkt wurde.
Ja – Herbst mag es wohl geworden sein für die alternde Frau, die den Gatten, die liebsten Freundinnen hat dem Tode hingeben müssen. Herbst – in dessen Licht die Fernen klar und nahe scheinen, in dessen Farben dem erfahrenen Auge das Welken und Vergehen sich offenbart – Herbstabend – unter dessen blassem Himmel die Gedanken wie Wandervögel in unbekannte, nur geahnte Weiten ziehen . . . Aber Winter, kalter Winter – nein, der kann Marie Ebners grosses warmes Herz, solange es schlägt, nicht in seinen kalten Bann zwingen!
Ein schwer zu erklärender Zauber von lebensvoller Frische, von Munterkeit und zugleich von ernster Wehmut liegt über der einfachen Erzählung von dem mutterlosen Kinde, das unirdisch zart, einem frühen Hinscheiden geweiht scheint und allmählich dem Leben, seinen Freuden und Leiden gewonnen wird, rotbäckig aufblüht, während der prächtige kraftstrotzende Bruder den schweren Weg ins Grab gehen muss. Aufs zierlichste und heiterste ist hier mit dem Tode getändelt, graziös und ohne Zynismus. So wagt nur der mit dem dunklen Gast zu scherzen, der auch seine Grösse und seinen Ernst gespürt hat, wenn er nach manchem verschwiegenen Kampfe dem Herzen zum vertrauten Freunde geworden ist.
Es wurde Marie Ebner gegeben, aus den Dornen auf ihrem Wege Rosen zu ziehen und aus ihnen köstliches Öl mit unvergleichlichem Dufte zu pressen.
Das Kind mit dem zärtlichen Gemüt, das nie eine Mutter küssen durfte – die Frau mit dem mütterlichen Herzen, der Kindesliebe versagt blieb – das ist wohl eine tragische Grausamkeit der Natur. Durch die Selbstüberwindungskraft eines starken Charakters, durch die Liebesfülle eines edlen Geistes, keimte aus solcher harten Naturgrausamkeit reiches Glück und befruchtender Segen für viele.
Ich dank ihn Euch, so seid mir denn bedankt,
Ihr Grossen und ihr Kleinen, Fernen, Nahen,
Durch meiner Liebe, Eurer Liebe Kraft
Begibt an mir ein schönes Wunder sich:
Die Kinderlose hat die meisten Kinder.
Das klingt, als sei es aus einer Geschichte von Marie Ebner. Es ist nicht eine Geschichte von ihr – es ist die Geschichte ihrer selbst.
Tief verwebt sich auch in ihr Kunst und Leben zu einem unlöslichen Ganzen.
