
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es gibt Entwicklungen, die sich derart unheimlich schnell vollziehen, daß man um eine Antwort auf die Frage nach den Gründen eines so verblüffenden Aufstieges, einer so siegessicheren Verbreitung fast verlegen sein könnte. Beinahe wäre man zu der poetischen Deutung verführt, daß solche Entwicklungen eigentlich längst fällig gewesen wären, daß hier Ideen als späte Kinder einer rastlosen Zivilisation, die sie nicht früher das Licht der Kulturwelt erblicken ließ, mit einer riesigen und oft ungesunden Schnelligkeit zur Vollendung aufschießen und verlorene Jahrhunderte in kaum ebensovielen Jahrzehnten nachholen. Nicht immer handelt es sich dabei um eine unwidersprechliche Bereicherung des menschlichen Kulturschatzes, und umgekehrt haben wirkliche Werte oft ein verhältnismäßig klägliches Tempo eingeschlagen, ehe sie Allgemeingut der Menschheit wurden. Die Eisenbahn brauchte nicht viel weniger als ein Jahrhundert, um jene weltumspannende, in den Rhythmus der neuzeitlichen Menschheit verwachsene Gewalt zu werden, die sie heute ist. Die Flugkunst aber hat in ganz wenigen Jahren, nach sehr kurzem Tasten den uralten, aus märchenfernen Urzeiten herüberwehenden ikarischen Traum erfüllt. Von der bescheidenen Shakespeare-Bühne zur Drehbühne der Gegenwart sind über unendlich viele Wandlungen und Zwischenstufen, über Aufstiege, Abstiege und Stillstand Jahrhunderte verstrichen. Der Film aber hat in der beängstigend kurzen Zeit von kaum zwei Jahrzehnten die Brücke von der unruhig zitternden Leinwand, auf der man zuerst die verschwommenen Linien und die bildmäßig lebendig gewordenen Gebärden von Menschen flimmern sah, zur technischen Vollendung des Heute geschlagen.

Die Abgrenzung des Bildfeldes bei einer Atelieraufnahme (Zu S. 13) Die Abbildungen auf Seite 4, 8, 13, 48, 52, 57 und 59 sind mit Genehmigung des Verlages von Dr. Eysler & Co. in Berlin dem Filmbuch »Die zappelnde Leinwand« von Max Mack entnommen.

Der Regisseur erklärt Damen der Komparserie ihre Rolle: »Da hinten durch jene Tür, meine Damen, stürzen Sie nachher leidenschaftlich herein! Hören Sie? Ich sage leidenschaftlich …!« (Zu S. 18)
Wir sahen alle vor zehn, zwölf Jahren das Wunder der belebten Leinwand, allein uns fehlte der Glaube. Nun haben wir den Glauben gefunden, haben uns einer fast schon zu innigen Kino-Gläubigkeit verschrieben, nur – das Wunder ist kein Wunder mehr; die Geheimnisse der Kinematographie sind von der großen Menge durchschaut; die Menge ist aufmerksamer Beobachter auf dem Siegeswege der filmtechnischen Entwicklung geworden, Beobachter des raschen Einstellens dieser jungen Zauberei auf die blitzartigen Veränderungen der kinematographischen Ausdrucksmöglichkeiten, der von Jahr zu Jahr sich wandelnden Ausdrucks-Notwendigkeiten des Films. Nicht mehr das lebende Bild an sich ist das Wunderbare; wunderbar ist nur die Wirkung auf die Masse, die in allen Volksschichten festgewurzelte Liebe, das unverrückbare Interesse für alles, was auf der weißen Wand in bewegten Flächen und Linien das Leben nachahmt und unbekümmert um alle Gesetze der Körperlichkeit mit zwei Dimensionen sein Auslangen findet.
Der atemlose Siegeszug des Films und das beispiellose Interesse aller Volkskreise fallen wohl am unmittelbarsten in der ganzen hastenden Entwicklungsgeschichte der Kinematographie auf. Sie finden ihre Erklärung am ehesten in der Tatsache, daß ein ganz technischen Bestrebungen hingegebenes Jahrhundert, wie es das neunzehnte war, und ein der industriellen Ausbreitung verschriebenes, wie es das zwanzigste ist, den Boden vorbereiten und bereiten konnten, um einer Erfindung das feste, von einem großen industriellen Zug und einer kaufmännischen Sammlung gestützte Rückgrat zu verleihen; sie finden aber auch in rein seelischen Voraussetzungen ihre Begründung, die im Verlaufe der weiteren Ausführungen noch näher zu untersuchen sein werden.
Noch vor dem großen Krieg war die Herstellung des Films immerhin eine Geheimkunst, beschränkt auf einen Kreis von Menschen, die ihr zünftig dienten und im übrigen mehr von dem Handwerk als von der künstlerischen, schönheitdienlichen, erzieherischen Ausbreitung des Films hielten. Die große Menge war entzückter Zuschauer, vorurteilsloser Genießer oder streitbarer Kritiker. Doch mitten in dem großen Weltringen erwachte allseits das Bestreben, dem Film nicht nur genießend gegenüberzustehen, sondern – freilich meist ohne Prüfung einer Berechtigung hierfür – selbst in der ewigen Regsamkeit dieses Gebietes mitzuwirken. Maler, Schriftsteller, Sprechschauspieler, Sängerinnen, der Buchdruck, die Reklame, die Mode, das Bekleidungsgewerbe, der Innenarchitekt wie der Baumeister, das Zeitungswesen, ein nicht zu unterschätzender Teil des gesamten Volkes dreht sich in schöpferischem Betätigungswillen um die glühende Achse des Films. Und in weitem Abstand stehen die Sehnsüchtigen, die nicht mehr Zuschauer, die wenigstens, wenn auch noch so bescheidene, Mitläufer sein möchten; sie regen die Hände wie nach einer ungreifbaren Fata morgana und haben irgendwo in ihrem verborgensten Winkel heimlicher Träume die schüchterne Hoffnung auf Erfüllung.

Wie die elegante Hoteltreppe hinter den Kulissen aussieht
Ein Filmfieber hat Tausende ergriffen. Keine Enttäuschung kann sie – vorläufig wenigstens – heilen. Keine Entgleisung, und deren sind wahrhaft genug gewesen, bringt sie zur Einsicht, jede neue Vervollkommnung entzündet sie aufs neue. Der Film ist die größte Massensuggestion der letzten Zeit. Er umarmt mit den Polypenarmen seiner unabsehbar langen Zelluloidstreifen die Menge, er ist Phantasie von ihrer Phantasie, er zielt ins Volk. Aber in neunundneunzig von hundert Fällen schießt er an diesem Ziel vorbei: er gibt sich volks tümlich und ist – volks fremd. Niemand kann das Wesen des Kinos richtig erfassen, der an dem seelischen Gehalt dieses Widerspruchs vorbeisieht. Der Film aber ist eine volkspsychologische Frage ersten Ranges. Er gibt Rätsel auf, die nur dann zu lösen sind, wenn sich einer bemüht, in die Wechselbeziehungen zwischen Kinematographie und Volksseele liebevoll, ohne überlegenes Lächeln, ohne bedingungslose Bewunderung, ohne gewinnsüchtige Absicht hineinzuleuchten.
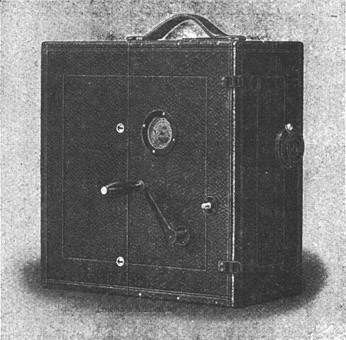
Ernemanns Normal-Aufnahme-Kino Modell A. Von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 12)
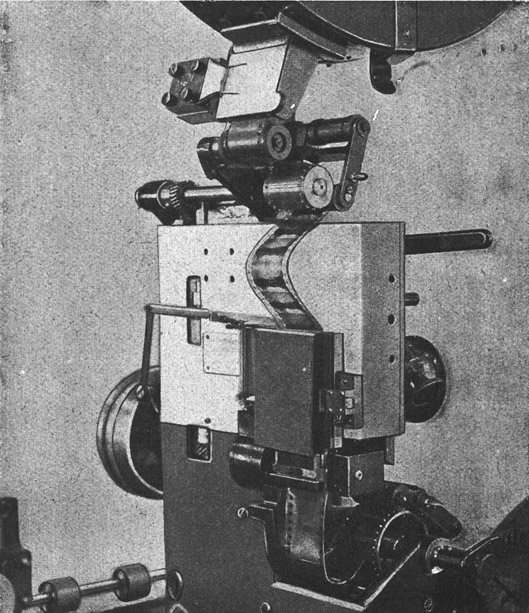
Kinematograph
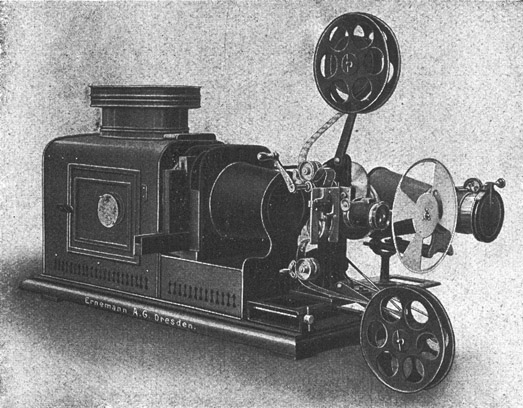
Ernemanns Kino-Bob Modell X für Einloch-Films mit Vor- und Nachwickler und selbsttätigem Filmaufwickler. Von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 12)
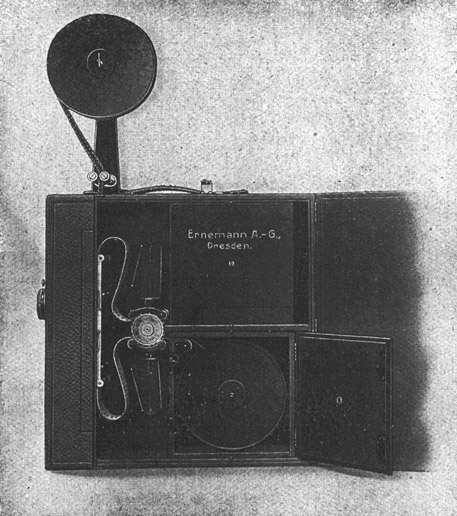
Ernemanns Normal-Aufnahme-Kino Modell A geöffnet während der Herstellung eines Positiv-Films vom Negativ-Film. Von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 12)

Der Regisseur als Bademeister: Das Damenbad im Filmatelier (Zu S. 18)
Da unterbricht ein Leser mit dem sehr beherzigenswerten Zwischenruf: »Film! Film! Erzählt uns noch nichts über ihn, erzählt uns von ihm!« Der Zwischenruf kommt sehr zur Zeit. Das Buch werde zur Lichtbildbühne, und auf dem weißen Grund des Papiers erscheine in buntem Wechsel des lebenden Bildes Werdegang!
*
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts erschien ein Spielzeug im Handel, an dem sich alt und jung vergnügte, die Wunderscheibe, die aus einem Stück Pappe bestand, auf dessen einer Seite ein leerer Käfig abgebildet war, indessen die andere Seite einen Vogel zeigte. Drehte man die Scheibe an zwei Fäden rasch um sich selbst, so verschmolzen Käfig und Vogel zu einem einzigen Eindruck: der Vogel saß im Käfig. Der täuschende Vorgang bei dieser Verschmelzung entsteht dadurch, daß die beiden Bilder durch das positive Nachbild der Netzhaut des Auges zu einem werden. Diese belustigende Sinnestäuschung ist eine Hauptbedingung für die Kinematographie, und die Wunderscheibe eine rührend einfache Vorläuferin des Films von heute. Freilich, die Wunderscheibe zeigt bloß ein stehendes Bild und noch nicht das Merkmal der Bewegung. Aber schon das Lebensrad, das etwas später von Stampfer in Wien als Stroboskop und von Plateau in Genf als Phenekistoskop gleichzeitig erfunden wurde, täuscht Bewegung vor. Es besteht aus einer Scheibe, auf welcher eine Figur in Bewegungsabschnitten, die einander sinngemäß folgen, abgebildet ist. In der Scheibe sind in gleichen Abständen Schlitze angebracht, durch die man von der Scheibe her, von der Rückseite, in Spiegel schaut. Wird die Scheibe gedreht, so sieht man in jedem neuen Schlitz die Figur in dem nächstfolgenden Bewegungsabschnitt. Durch Sinnestäuschung kommt auch hier der Eindruck eines Bewegungsvorganges zustande. Auf dem gleichen Grundsatz beruht die Wundertrommel und das viel später gefertigte Wunderbüchlein, bei dem man durch rasches Blättern zahllose in verschiedene Bewegungsphasen zerlegte Lichtbilder zu einer tatsächlichen Bewegung verschmelzen sieht. Da die Täuschung bei all diesen Spielereien zwar nicht das erste, aber doch das ausschlaggebende Merkmal ist, so darf man behaupten, daß es sich dabei vornehmlich um einen seelischen Vorgang handelt.
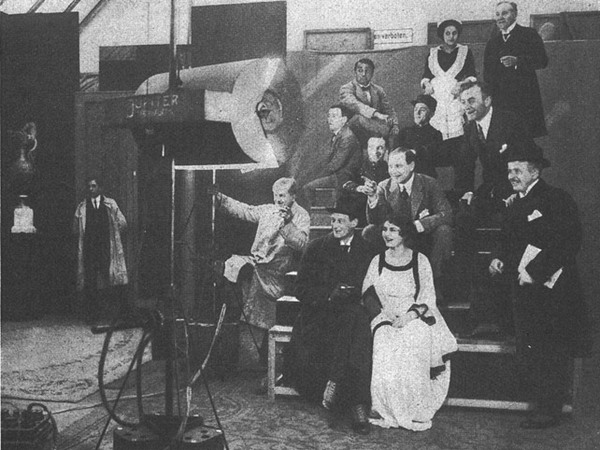
Das »Drehen« einer lustigen Szene: Filmleute als dankbare Zuschauer, im Vordergrund Hanni Weiße (Zu S. 67)
Von diesen Zauberkünsten zur Kinematographie ist nur ein, wenn auch gewaltiger Schritt gewesen; er wurde gewagt und ist überraschend gelungen.
Die Reihenbilder, die nach der Phantasie gezeichnet worden waren, wurden durch photographische Reihenaufnahmen ersetzt; die Kinematographie war geboren. Die ersten photographischen Reihenaufnahmen wurden von dem Amerikaner Muybridge in San Francisco gemacht, und zwar in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. In den Kreisen amerikanischer Pferdeliebhaber war nämlich zu jener Zeit die Frage aufgeworfen worden, ob ein Pferd im Galopp einen Augenblick frei über dem Boden schwebe oder nicht. Muybridge löste mit Hilfe der Momentphotographie die Frage in bejahendem Sinne. Er stellte an verschiedenen Stellen photographische Apparate auf und fertigte Momentaufnahmen an, die z. B. ein Pferd in genau derselben Bewegungsphase von verschiedenen Seiten gesehen zeigten. Dann nahm er das Pferd seitlich gesehen in den aufeinanderfolgenden Bewegungsphasen auf und errichtete zu diesem Zwecke gleichlaufend zur Reitbahn eine große, weite Hintergrundwand und einen Holzbau, in dem 24 Momentapparate nebeneinander aufgestellt waren. Quer über die Bahn waren 24 dünne Fäden gespannt, welche zu elektrischen Kontakten führten. Das galoppierende Pferd zerriß die Fäden und löste damit jeweils eine Kamera aus. So wurden in Zwischenräumen von ? Sekunde Reihen von Momentaufnahmen gewonnen, womit die Streitfrage gelöst werden konnte. Die nächste Stufe in der weiteren Entwicklung war der im Jahre 1885 von dem Deutschen Anschütz erfundene elektrische Schnellseher; dieser bestand aus einem etwa 1½ Meter im Durchmesser breiten Rad, auf dessen Umkreis die Diapositive der Reihenbilder aufmontiert waren. Durch Drehung des Rades wurden sie in rascher Aufeinanderfolge hinter einem Fensterchen gezeigt; so oft ein Diapositiv für den Bruchteil einer Sekunde auftauchte, wurde es von hinten durch Geißlersche Röhren erleuchtet.
Als der eigentliche Begründer der Kinematographie muß der französische Physiologe Marey angesprochen werden. Er beschäftigte sich mit photographischen Messungen der Bewegungen von Körperteilen, verfertigte zur Festhaltung der Phasen des Vogelfluges die sogenannte photographische Flinte und ersann im Jahre 1888 eine neue Einrichtung, die für die Kinematographie grundlegend war. Statt der photographischen Platte verwendete er nämlich eine Kamera, in der ein langes, lichtempfindlich gemachtes Papierband auf einer Rolle aufgewickelt war und durch einen besonderen Mechanismus ruckweise abgewickelt wurde. Solange das lichtempfindliche Band stillstand, erfolgte durch einen Schlitz in der sich drehenden Blende die Belichtung, sobald aber die Blende das Objektiv wieder verdeckte, wurde der Film ruckweise weiter bewegt. Die belichteten Teile des Bandes wurden auf eine zweite Rolle wieder aufgewickelt, das Ganze durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt – die erste kinematographische Aufnahmekamera war erfunden. Um das Jahr 1898 wurde an Stelle des Papierstreifens das Zelluloidband eingeführt; das Zelluloidband wurde später gezähnt, damit es bei dem Transportmechanismus besser eingreifen konnte, eine Verbesserung, die man Edison verdankt. Endlich sei erwähnt, daß die allgemein gültig gewordene Bezeichnung Kinematographie – Bewegungsbild – von den Gebrüdern Lumière gewählt wurde. Die Reihenbilder müssen, wenn sie auf die weiße Fläche geworfen werden, schneller durch den Apparat geführt werden, als ursprünglich die Aufnahmen erfolgten. Etwa 35 Bilder folgen in der Sekunde aufeinander, damit die zwischen den einzelnen Bildern liegenden Verdunkelungen nicht das lästige Flimmern hervorrufen. Gute Aufnahmeapparat vermögen bereits 6000 Aufnahmen in der Minute zustande zu bringen.

Eine »Trick«-Aufnahme. Der Hut schwebt frei in der Luft. Ein weißer Faden auf weißem Hintergrund löst das Geheimnis (Zu S. 49)

Im Glashaus. Es wird auf verschiedenen Bühnen gleichzeitig gefilmt (Zu S. 13)
Auch die deutsche Wissenschaft hat an der Konstruktion der Apparate hervorragenden Anteil. So hat Meßter, unabhängig von den Franzosen, im Jahre 1896 den ersten deutschen Kinematographen erfunden.
Die gebräuchlichsten und bewährtesten Apparate, auf deren sehr verwickelte Einzelheiten hier einzugehen zu weit führen würde, sind die Modelle aus der Dresdener Aktiengesellschaft Ernemann, die wir im Bilde (Abb. S. 6 u. 7) zeigen. Soweit technische Vorgänge zu berücksichtigen sind, wird dies an den entsprechenden Stellen dieses Buches geschehen.
Mit ungeheuerlicher Schnelligkeit ist dann die Entwicklung von den harmlosen kleinen Bilderscherzen zur Vollendung der heutigen Filmindustrie weitergeschritten. Der zeitgemäße Film wird vornehmlich im Atelier im »Glashaus« (Abb. S. 8 ff.) aufgenommen, »gedreht«, wie es in der Kinosprache heißt. Hier ist der Schauplatz seines Werdens, in dem hohen, hellen Raum, der von allen Seiten Licht zu empfangen vermag, in dem das Sonnenlicht ganz nach Wunsch gedrosselt oder verstärkt werden kann. Hochkerzige Bogenlampen, von Milchgläsern bauchig umhüllt, stehen mit starrer, riesenhafter Gebärde im Atelier herum. Sie schaffen auch bei geizigem Sonnenschein die Möglichkeit, kurze Momentaufnahmen so kraß zu belichten, daß das natürliche Sonnenlicht vollwertig ersetzt erscheint. Ein Besuch im Glashaus zur Sommerzeit gehört so ziemlich zu den qualvollsten Begebenheiten. Ungehemmt prallt die Sonne von allen Seiten auf das Atelier, die Jupiterlampen verströmen eine höllische Glut, und die Berieselungsanlagen versagen ohnmächtig in diesem tropischen Feuerhauch. Wer zum erstenmal Gast im Glashaus ist, kommt sich unfehlbar wie verhext vor. Kulissen und »Praktikabel« drohen wie Gespenster aus allen Ecken, eine unerklärliche, auf den ersten Blick nicht zu erfassende Fülle von Geräten verwirrt und verblüfft. Trinkgläser und Schreibzeuge, kleine Pappmodelle von Häusern, Eisenbahnzüge, die aus der Spielzeugschachtel des Kindes stammen könnten, aber so täuschend aus Blech gefertigt sind, daß sie sehr gut folgenschwere Zusammenstöße und Entgleisungen vortäuschen können, Tafelgeschirr, Blumenvasen, alles, alles, was irgendwie gebraucht werden kann, steht in einem scheinbaren Durcheinander da, und doch zaubert der Requisiteur auf einen Wink das Gewünschte herbei, ob es ein Revolver, ein Spazierstock, ein Rosenstrauß, eine auf die winzigsten Maße gebrachte papierne Stadt, ob es ein weißer Pfau oder eine großartige Felslandschaft ist. Vorhanden muß es sein, – Regisseur und Operateur besorgen dann sicher den holden Schwindel, all diese toten Dinge mit wahrhaftigem Leben zu übergießen. Überall stehen Möbel herum, Kabelstränge graben dicke Furchen in den Boden, von der Decke baumeln Bogenlampen, Scheinwerfer gähnen einen mit glänzenden Mäulern an, und hoch oben rasseln eiserne Krane, die schwere Lasten heben, die mit Gigantenhänden Kulissen von da nach dort verpflanzen und, wenn eine Aufnahme von oben nötig ist, auch dem Operateur eine Brücke bauen, von der aus er seinen Kurbelkasten drehen kann.

Die Diva im Zorn: »Ich spiele diesen Schmarrn nicht weiter –!
Mit echt filmmäßiger Geringschätzung aller Hindernisse baut der Innenarchitekt die vornehmsten und von erlesenem Geschmack beherrschten Räume auf; es fehlt ja an nichts, nichts ist zu teuer, nichts unerreichbar. Das ganze Atelier wird in Felder und Ecken geteilt, jedes Feld, jeder Winkel ist eine Bühne für sich, und in jedem dieser Atelierabschnitte können zu gleicher Zeit Szenen aufgenommen werden. (Abb. S. 11.)
Soll die Aufnahme beginnen, so stellt zunächst der Operateur oder Photograph den Raum ein, d. h. er grenzt ab, was sein Bildfeld faßt. (Abb. S. 3.) Dieses Bildfeld wird durch eine Stange, eine Schnur oder ähnliches umrahmt, und die Mitwirkenden dürfen diese Linie nichtüberschreiten, denn was jenseits der Bildsperre liegt, würde außerhalb des Bildfeldes fallen. So hat der Operateur, eine der bezeichnendsten Erscheinungen in dem an sonderlichen Gestalten wahrhaftig nicht armen, ewig unruhigen, ewig schwirrenden Bienenhaus der Kinowelt, gleichsam das Spielland aus dem Ozean des Glashauses auftauchen lassen. Auf diese abgesteckte Insel verdichtet sich für Minuten das ganze Leben, alles Interesse der Unzähligen, die, zweckmäßig in streng geschiedene Gruppen gegliedert, das Atelier bevölkern. Der Operateur ist der Tyrann dieser Welt. Eigentlich ein untergeordnetes Organ, beherrscht er, der allein über das Gelingen oder Mißlingen der Photographie entscheidet, der es in der Hand hat, unsägliche Mühe mit dem Erfolg zu krönen, den Höchstkommandierenden der Filmtruppen, den Spielleiter, und dessen Mithelfer, die Schauspieler und die Komparserie. Der Operateur darf grundsätzlich nur mit Handschuhen angefaßt werden; jede seiner Launen – und er besteht nur aus Launen – wird mit engelhafter Geduld und mit einer Sanftmut hingenommen, die halb nach Galgenhumor, halb nach Verzweiflung schmeckt. Er ist der verwöhnteste Mensch im ganzen Filmbetrieb und hat sich das Gehaben eines Unnahbaren angeeignet. Sein Hochmut und sein Selbstbewußtsein sind aber gutmütiger Art und finden in der großen Verantwortung, die auf ihm lastet, und in der nervösen Erregung, die seine besondere Tätigkeit mit sich bringt, eine entschuldigende Erklärung.
Sein gerades Gegenteil ist der Hilfsregisseur. Er ist der Sündenbock für alle. Nach außen hin Generalstabschef des Regisseurs, ist er in Wahrheit nicht viel mehr als die herumgehetzte und halb tot gejagte Ordonnanz des Allerherrlichsten, des Spielleiters. Ihm blüht die Aufgabe, Kraftwagen zu besorgen, auf den Markt, d. h. in die Filmkaffees oder nach der Filmbörse zu gehen und dort die für die einzelnen Szenen notwendigen Gestalten anzuwerben. Den analphabetischen Herrn aus der Vorstadt, dessen Eigenart es ist, so wie ein feudaler Graf auszusehen, oder den Mann mit dem wüsten Trinkergesicht, das liebliche Mädchen mit dem unschuldigen Kinderlächeln, die Weltdame, die in Gesellschaftsszenen so tun kann, als wäre sie bei Vanderbilt aufgewachsen (sie wohnt in Wahrheit, wo die Füchse sich Gute Nacht sagen, Hinterhaus, vier Treppen), oder die Halbweltlerin mit dem verrucht frechen Blick (sie kann im Privatleben einem frommen Jungfrauenverein angehören). Der Hilfsregisseur hat nicht Menschen zu bringen, er schleppt Typen, Linien, geborene Masken, photographische Ware heran. Er übernimmt in den meisten Fällen auch das ein beispiellos geübtes Gedächtnis erfordernde Amt eines Requisiteurs, er denkt an alles, weiß von allem und hat letzten Endes in die Bresche zu treten, wenn auf irgend jemand ein Ungewitter niedergeht.

Der Kinoapparat auf der Klettertour. Aufnahme von A. Groß, Berlin (Zu S. 19)

Ruhepause bei einer Kinoaufnahme im Gebirge (Zu S. 19)

Der Berliner Filmregisseur Max Mack (links) sucht ein dankbares Motiv (Zu S. 20)
Wie ein wandelndes Fragezeichen schleicht der Dramaturg herum. Er hat Zeit, über seine Überflüssigkeit nachzudenken, die bei den Aufführungen so recht in die Erscheinung tritt, während sie sich im Bureau doch noch hinter der Aufgabe, den Text des Manuskriptes filmgerecht zu bearbeiten, oder dem Direktor und dem Regisseur geeignete Manuskripte aus der Hochflut der Einsendungen zu empfehlen, mit Anstand verbirgt. Die Solisten, die an diesem Tage beschäftigt sind und unter der Berufskrankheit des Films, dem Warten, diesem erschöpfenden, halbe Tage langen Warten, das Kräfte frißt und alle Frische verbraucht, ebenso zu leiden haben wie die Komparserie oder die technischen Helfer, denken noch einmal über die Stellung nach, die sie nach den ersten flüchtigen Andeutungen des Regisseurs einnehmen sollen. Die Filmdiva lächelt gnädig großartig, streichelt ihr Lieblingstier (jede Diva hat ein Lieblingstier), läßt sich verwöhnen wie ein Operateur, wird mit Schokolade gefüttert, trinkt einen Schluck Kognak, verschmäht je nach Veranlagung auch eine Flasche Sekt nicht, tut gelangweilt, ist vielleicht auch sehr liebenswürdig, macht ihrem Direktor ein schönes Gesicht und versucht, noch irgend finanzielle Vergünstigung herauszuschlagen. Manchmal markiert sie auch mit Erfolg hochgradige Nervosität, manchmal läßt sie sich noch rasch von ihrer Masseurin kneten, wenn das die Toilette, die sie trägt, irgendwie erlaubt, häufig schimpft sie auf ihre Schneiderin, noch häufiger freut sie sich, daß andere über ihre Toiletten zerspringen, und am häufigsten bekommt sie einen Tobsuchtsanfall, der sehr rasch vorübergeht. Der männliche Filmstern fühlt seinen ganzen unwiderstehlichen Zauber. Handelt es sich um ein Detektivstück, macht er ein vielsagendes, alles durchdringendes Gesicht. Spielt er in einem Sensationsfilm mit verwickelten dramatischen Fügungen, dann setzt er eine theatralische Miene auf, und soll er einem Lustspiel seine Eigenart aufprägen, so schneidet er – um nicht aus der Übung zu kommen – eine Grimasse. Die Komparserie wartet, wartet, wartet, träumt von den Riesenbezügen der Stars, träumt von Erfolgen und findet, daß 30 Mark Tagegeld schließlich auch nicht zu verachten sind.
Der Regisseur, der den ganzen Schwindel kennt, spielt alle seine Register durch. Er ist nett, grob, er droht, er scherzt, er flüstert, er schreit, kurz, er tut nervös zerfahren und ist doch der Gesammeltste von allen; er gibt jedem das Seine. Mit möglichster Deutlichkeit erklärt er in kurzen, klaren Worten die Aufnahme. (Abb. S. 4.) Dann wird geprobt. Unter hundert Mißverständnissen, mit unsäglicher Geduld, mit der immer wiederkehrenden Mahnung an die Neulinge, ja keine allzu raschen Bewegungen auszuführen, da sonst die Bilder verschwimmen. Der Direktor sitzt manchmal dabei, läßt ein paar Brillanten über seinem wohlgenährten Leichnam blitzen und überschlägt im Geiste, wie teuer er den Meter wird verkaufen können.

Iwa Raffay, die erste deutsche Filmregisseurin (Zu S. 58)

Karikatur auf Asta Nielsen (Zu S. 63)
Die Probe ist zu Ende. Ein kurzer Befehl: Licht! Und es ward Licht! Die Jupiterlampen knistern, violettes Licht schießt auf die Szene, die Aufnahme beginnt, und unter den anfeuernden Zurufen des Regisseurs wird die Szene »gedreht«. (Abb. S. 8 ff.)
Die Aufnahmen geschehen durchaus nicht in zeitlicher Reihenfolge; es werden vielmehr »Dekorationen abgespielt«. Das heißt, alle Szenen, die das Manuskript in einer bestimmten Dekoration vorsieht, werden, unbekümmert um ihren natürlich ganz verschiedenen Inhalt und Charakter, hintereinander gestellt, gespielt und gekurbelt. An diesem einen bezeichnenden Vorgang sieht man klarer und beweiskräftiger als an manchen anderen, wie unkünstlerisch alles, was mit dem Kino zusammenhängt, im Grunde genommen ist. Der Darsteller hat ganz ohne die Erregung des fortschreitenden Spiels, ganz ohne die Ehrlichkeit des Schauspielers, der die holde Täuschung der Bühne fühlt und gefühlsmäßig zum Erlebnis erhöht, immer wieder aus Zusammenhängen und gesammelter Kraft gerissen, einfach auf Befehl ein paar Sekunden lang wahllos alle Gefühle, alle Erregungen durcheinander auszudrücken. Damit ist die Unehrlichkeit des Kinospiels zur Genüge erwiesen; was aber unehrlich ist, kann nicht künstlerisch sein.
Besonders bezeichnende Augenblicke werden aus geringer Entfernung aufgenommen, um recht groß, scharf und mit allen Einzelheiten zu wirken. Diese »Großaufnahmen« zeigen zumeist irgend einen entscheidenden Gesichtsausdruck eines der Hauptdarsteller oder einen Vorgang, bei dem es auf eine Handbewegung ankommt, die, um einen Zustand verständlich zu machen, sehr deutlich gezeigt werden soll; auch Gegenstände, die eine Rolle spielen, die auf eine bestimmte Stunde eingestellte Uhr, das blutbefleckte Taschentuch im Detektivfilm u. dgl. werden groß aufgenommen.

Asta Nielsen. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S. 63)
Wird ein Film nicht im Glashaus sondern im Freien gedreht, dann begibt sich das ganze mehr oder minder lustige Flimmervölkchen nach dem vom Regisseur und vom Hilfsregisseur mit feinstem Blicke für die malerische Schönheit oder die geeignete Örtlichkeit mühsam gesuchten Schauplatz. Automobil und Eisenbahn tragen die Gesellschaft – meist ohne die Komparserie, denn die findet sich schließlich leicht auch an Ort und Stelle – nach der Stätte der Freilichtaufnahme. Sie kann in den Straßen der Stadt, sie kann in einem Park, in einem Privatgarten stattfinden, an der See, im Gebirge (Abb. S. 15), im Fels und Eis der Alpen. Kein Ort der Welt ist dem Kurbelkasten zu hoch, zu weit; wenn es sein muß, spreizt er sich in jede Landschaft und fängt getreu das Bild ein, das der Regisseur gestellt hat. (Abb. 14.) Was im Glashaus die verläßliche Jupiterlampe ersetzen kann, die sparsame Sonne, das macht die Freilichtaufnahme abhängig von der Wetterlaune. Wenn die Sonne streikt, werden die besten Absichten zunichte. Wolkengespenster steigen auf, und jeder verzweifelte Regisseur wird zu einem Ibsenschen Oswald, der nach der Sonne lallt. Die andern dürfen zwar ebenfalls verzweifelt sein, und sie sind es begreiflicherweise auch, aber ihre vornehmlichste Aufgabe ist das Warten. Warten und immer wieder warten ist das höchste Gebot des Filmdarstellers überhaupt. Er wartet, bis seine Nerven absterben, bis ihm die Zunge vor Durst beim Halse heraushängt, er wartet sich, wenn's gilt, siech und tot, denn es gibt unausgesetzt heimtückische Zwischenfälle, die eine für 7 Uhr früh angesetzte Aufnahme bis 5 Uhr nachmittags hinauszögern; Sommers und Winters, im Waldesgrün und auf der gefilmten Rodelbahn, – es wird gewartet. Wie ein Fluch liegt dieses Warten auf der ganzen Tätigkeit der darstellenden Menschen vor der »zappelnden Leinwand«, wie sie der immer rege, witzige und auf alle erreichbare künstlerische Wirksamkeit bedachte Berliner Filmregisseur Max Mack (Abb. S. 16) außerordentlich treffend benannt hat.
Die Kinoleute im Dorf! Das ist ein Kapitel köstlicher Erregtheit, ein Kapitel vom Staunen und Gaffen für sich. (Abb. S. 25.) Alles drängt an die Flimmermenschen heran, die sich im Auto steile Straßen herauf gewunden haben oder mit dem schmalspurigen Bähnchen in die entlegensten Gebirgseinöden vorgedrungen sind. Im weltmäßigen Alpenhotel, im vornehmen Seebad ist die Aufregung nicht minder: Thespis von heute, Thespis mit dem Kurbelkasten ist da! Übrigens ist das Interesse für Aufnahmen im Freien bei der »abgebrühten«, an alles gewöhnten großstädtischen Bevölkerung nicht geringer als bei den ursprünglichen Leuten weltabgerückter Gegenden. Alles will Helferdienste leisten, und der Hilfsregisseur flötet sich in allen Tonstärken und allen schüchtern nachgeahmten Dialekten heiser, um die lieben Gaffer aus der Bildfläche zu drängen. Außer den für die Handlung wichtigen Szenen werden auch sogenannte »Passagen« gedreht. Augenblicksbilder, die, ohne eigentlich zum Gang der Ereignisse zu gehören, zur Verdeutlichung einer Situation oder zur Erhöhung beziehungsweise Erstreckung der Spannung, oft auch nur zur Einschaltung eines an sich schönen Bildes gemacht werden, das einen Ruhepunkt in die Hast der Vorgänge streuen soll. Hübsche Waldstellen, Ausschnitte aus einer Straße, von Blüten umrankte Bänke, meist Freilichtbilder, oft aber auch architektonisch feine Einzelheiten, oder im Glashaus gebaute Treppenstücke, Nischen u. dgl. werden als Passagen gezeigt.
Rings um das Atelier hat der praktische und alle Möglichkeiten voraussehende Geist der Filmindustriellen meist großzügige bauliche und gärtnerische Anlagen erstehen lassen. Dadurch ist es ermöglicht, häufig wiederkehrende, wenn man so sagen darf »Schema F«-Außenaufnahmen, ohne erst einen großen Apparat in Szene setzen zu müssen, im engsten Anschluß an die Fabrik herzustellen. Park-Passagen, hübsche Toreingänge, Partien an Bächen und ähnliches kann also gleichsam zu Hause aufgenommen werden. Diese Reserven an natürlichen Kulissen erleichtern den ganzen Betrieb außerordentlich, und sicher werden die Kulissengelände rings um das Glashaus mit dem bevorstehenden weiteren Aufschwung der Filmindustrie nach dem Kriege nach allen Richtungen hin erweitert werden.
Die großen Gesellschaften haben übrigens bereits ganze Filmstädte gegründet. Sie lassen Dekorationen bauen, die viel zu wertvoll und stilsicher aufgestellt sind, als daß sie nach einmaliger Ausnützung wieder abgetragen werden dürften. So ist in Neubabelsberg bei Berlin ein
kleines völkerkundliches Museum aus der Erde gewachsen. Buddhatempel und Dschungeln schmiegen sich mit seltsamem und märchenhaftem Ernst in die grüne Lieblichkeit der Mark; denn dort draußen, im preußischen Schatten von Potsdam, sind all die indischen Films entstanden, die eine Zeitlang bei der Industrie und beim Publikum gleich beliebt waren. An anderen Orten wurden wieder, um mühsame Reisen zu ersparen, kühne Dolomitformen aufgetürmt, und die Alpen klettern mit Blöcken, und Zinken und Zacken sehr wunderbar aus dem sanften Boden der Ebene zu jener Höhe, die alpine Maße vorgaukelt und doch nur dem Täuschungszweck des Kinos genügt. In Stellingen bei Hamburg ist Klein-Japan aufgebaut. Zierliche Teehäuser, verschlungene Wasserläufe, in deren Spiegel sich japanische Zwerggewächse schaukeln – kurz ein wundervolles, von dem Hauch der Echtheit angewehtes Kino-Japan ist der alten Hanseatenstadt vorgelagert. (Abb. S. 27.)

Henny Porten in der Titelrolle des oberbayerischen Volksstücks »Die Claudi vom Geiserhof« (Zu S. 64)
Auf diesem Gebiete sind uns freilich die Amerikaner weit überlegen. Alles, was wir hier unternehmen, ist noch ziemlich schwächliche Nachahmung des amerikanischen Vorbildes. So ist in Los Angeles eine richtige Filmstadt entstanden. Alles im Gebiete der großen Stadt ist dem Kino dienstbar; die Bevölkerung lebt von der Filmindustrie, sie hat sozusagen Tag und Nacht kinematographische Bereitschaft. Jede Anlage, mag sie auch ein noch so nüchterner Zweckbau sein, ist aus dem Gesichtswinkel der filmtechnischen Wirksamkeit ersonnen, alles für den Film geschaffen, alles steht zu seiner ausschließlichen Verfügung. In Südafrika hat ein großer Konzern in der Nähe von Kapstadt eine weite Strecke Landes angekauft und erweitert dort die in Los Angeles gewonnenen Erfahrungen ins Riesenhafte. Diese neue Filmstadt mit dem umgebenden Gelände ist ganz und gar aus filmtechnischen Bedürfnissen heraus entworfen. Die Kinematographie ist unter die Stadtgründer gegangen. Jeder noch so verstiegene Wunsch des Regisseurs, jeder noch so romantische Einfall des Filmdichters kann hier verwirklicht werden. Alle Stile sind vertreten: das Pfahlbaudorf der Urzeit, das römische Forum, das winkelige Ghetto, traum-trauliche Lieblichkeit des Mittelalters, gotische Würde, barocke Schwelgerei und nüchterne Eisenkonstruktion der Neuzeit harrt des Kurbelkastens; alle landschaftlichen Szenerien blühen der Verewigung in Zelluloid entgegen. Berg und Wasser, Wald und Wiese unterjochen die Natur der Phantasie des Kinoregisseurs. Die ganze Stadt ist ein einziges großes Filmatelier. Die überaus günstigen Lichtverhältnisse, die Durchsichtigkeit der südafrikanischen Sonne ermöglichen es ja, alle Aufnahmen im Freien zu machen. Übrigens ist vor ganz kurzer Zeit auch eine italienische Insel, die volle Ausnützung märchenhafter Naturschönheiten verspricht, von einer Vereinigung von Filmgesellschaften angekauft worden.

Fern Andra (Zu S. 64)

Hella Moja. Aufnahme von Karl Schenker, Berlin (Zu S. 64)
Ist der Film so weit gedreht, dann ist er beileibe noch nicht fertig. Jedes Filmwerk steht auf einem Sockel von hundert sauren Stunden, von maßloser Mühe, Geduld, bestem Willen und – erbärmlich störenden Zwischenfällen. Eine Unzahl von Händen und Köpfen war in Bewegung gesetzt, eine Fülle von Kraft verbraucht; und die große Arbeit im kleinen, die weniger Hände, weniger Köpfe in Bewegung setzt, beginnt erst; eine Arbeit, die für das Gelingen des Films von nicht minderer Wichtigkeit ist als die Aufnahmen vor dem Kurbelkasten. Nach der Aufnahme besteht das Filmband erst aus einer Unzahl von Mosaikstückchen, die nach dem Inhalt gesichtet, geordnet und zur Gesamtwirkung verwertet werden müssen.
Ist die Aufnahme vollendet, so wird das Filmband in der Dunkelkammer aus der Kassette genommen; bekanntlich läuft ja beim Kurbeln aus einer Kassette ein fortlaufendes Filmband in eine andere. In der Dunkelkammer wird dann entwickelt. Aber so einfach wie beim gewöhnlichen Lichtbild ist dieser Vorgang keinesfalls; es gibt dafür sehr umständliche Vorrichtungen, da das Negativ nach seiner Dichte, nach der Lichtkraft, in einem besonderen Entwickler bearbeitet werden muß. Nach der Fixierung ist das Negativ fertig. Die einzelnen Negativrollen werden dann nach ihrer Lichtdurchlässigkeit geordnet, das heißt, jene Rollen, welche ungefähr gleiche Kopierzeiten benötigen, kommen zusammen. Mit der Kopiermaschine wird nun die erste Kopie auf dem sogenannten Positivfilm hergestellt. In diesem Augenblick ist es bereits möglich, die Aufnahmen im Vorführungsraum der Fabrik auf der weißen Fläche, fälschlich immer Leinwand genannt, obwohl sie nur ein glatter Ausschnitt der Wand ist, zu sehen. Es beginnt eine mühselige Arbeit: die Negativrollen werden getrennt, jede Szene wird eine Rolle für sich und erhält eine Nummer. Nach dem Manuskript werden jetzt die Szenen in sinngemäßer Reihenfolge zusammengeklebt. Vorher wird natürlich darüber entschieden, ob die Aufnahme auch genügt oder ob etwa eine Nachaufnahme nötig ist. Die Szenen werden nicht in ihrer ursprünglichen Länge zusammengestellt, nur die wichtigsten, die schönsten, die bezeichnendsten Stellen eines Bildes kommen in den Film. Alles Entbehrliche wird vorsichtig weggeschnitten. Dieses Schneiden ist eine der heikelsten Fertigkeiten in der ganzen Herstellung. Es gehört ein geübter Blick, eine sichere Hand dazu, das Bezeichnende zu wählen, das Nebensächliche der Schere verfallen zu lassen. Großaufnahmen etwa sind mit besonderer Feinschmeckerei in die entsprechend geschnittene Szene hineinzukleben und dabei ganz besonders auf die richtigen Übergänge von der Fernaufnahme zur Großaufnahme Bedacht zu nehmen. Sind die Szenen endlich geklebt – dieser Vorgang wird meist von der bereits sehr spezialisierten Gilde der Filmkleberinnen vorgenommen –, dann beginnt die »Virage«, das Färben des Filmbandes. Der farblosen Photographie wird durch entsprechende Tönung lebendigeres Kolorit, Stärkung des grauen stumpfen Tones und damit Erhöhung der Täuschung verliehen. Naturaufnahmen werden grün viragiert, erleuchtete Zimmer erhalten einen orangefarbenen Ton, Nachtbilder einen blauen, Feuer einen roten Ton. Natürlich handelt es sich beim Viragieren nur um naturnahe Tönung, nicht um photographierte Farbe; das Ideal des Lichtbildes, die Farbenphotographie ist auch für die verwöhnte Kinematographie, der scheinbar nichts unmöglich ist, noch nicht erfunden; allem Anscheine nach steht aber auch hier eine bahnbrechende Erfindung unmittelbar vor ihrem Abschluß.
*
Der Film ist nun, bildmäßig, vollendet. Er könnte auf die weiße Fläche geworfen werden, könnte einem fast immer begeisterten und oft, leider, viel zu sehr begeisterten Publikum die höchste erreichbare Vorspiegelung von Wirklichkeit und Echtheit schenken, wenn ihm nicht der Erbfluch der Kinematographie anhaftete: die Stummheit. Die Menschen im Film können alles: sie brechen, wenn es sein muß, mit den Gesetzen der Schwerkraft, sie verzaubern sich in sekundenjähem Wechsel von einem Erdteil in den anderen, nur eines vermögen sie nicht: zu sprechen. Sie haben jede Gebärde, aber kein einziges Wort. Wir sehen sie sprechen, aber wir hören sie nicht; sie wirken nur auf unseren Gesichtssinn, für unser Ohr sind sie ohnmächtig. So mußte auch die Ersatzsprache der Menschen von der Flimmerwand dem Werkzeuge des Gesichtssinnes angepaßt werden, mit dem allein wir das wunderliche Geschehen der bewegten Fläche aufzunehmen vermögen. Wir hören nicht, was der Filmdarsteller zu sagen hat, wir lesen es. Das stumme Spiel macht uns taub, es schreibt uns die Zwiesprache der Stummen in Buchstaben vor die Augen. Die Schrift im Film, fachtechnisch der »Titel« genannt, begleitet erzählend und erklärend die Geschehnisse vom ersten Lichtschein bis zum letzten Abblenden. Der Titel ist das gedankliche Rückgrat des Films. Er vermittelt die Zusammenhänge, die das Bild allein nicht bieten kann. Er ersetzt Dialoge; er unterstreicht durch ein paar scharfgeprägte Worte die Situationen; er zeigt den Liebesbrief, das Testament, die Schicksalsurkunde, die im Rahmen der Vorgänge niedergeschrieben wurde, in hinreichender Größe, so daß jedermann den Inhalt dieser Niederschriften erfassen kann – er sorgt also für die Vollendung der Täuschung.

Kinoaufnahme in einem kleinen Städtchen (Zu S. 20)

Szenenbild aus dem Film »Die Lieblingsfrau des Maharadscha« mit Gannor Tolnaes (Zu S. 58)
Mag ein Film photographisch noch so vollendet sein, die Titel sind immer irgendwie unbeholfen, sprachlich unkultiviert, aufgeblasen oder hanebüchen kindisch. Es gibt, selbst im Film, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, keinen Menschen, der so spräche wie die Titel. Die Notwendigkeit, sich knapp auszudrücken, verführt zu einer manchmal geradezu lächerlichen Vergewaltigung der Sprache, anderseits hat der kolportagemäßige Grundzug des Films gerade im Titel ein Werkzeug gefunden, in Hintertreppenstilen zu schwelgen, oft auf die Gefahr hin, die bildmäßigen Vorgänge durch atemlos lange Beredsamkeit, allen Gesetzen der Kinematographie entgegen, zu unterbrechen. Die Titelgebung ist gewiß eine der schwierigsten Aufgaben. Der Titel soll ausdruckskräftig, kurz, er soll stilistisch geschliffen, er soll leicht faßlich sein, er muß auf jede sprachliche Verzierung verzichten, er soll folgerecht und ungezwungen wirken. Das ist ein wenig viel verlangt, und nur ganz erstklassige Fabrikate zeigen denn auch das nötige Verantwortlichkeitsgefühl für eine richtige, saubere, lebendige Titelgebung. Übrigens nimmt das kritikloseste Publikum der Welt, das Kinopublikum, auch die dümmsten Titel widerspruchslos entgegen. Gewöhnlich werden die Titel, wenn sie nicht schon im Manuskript vorgesehen sind, aus dem fertigen Bilde heraus geschöpft. Mau drückt die Filmtitel auf eigene Streifen und fügt sie den Bilderfolgen an den entsprechenden Stellen ein.

Japan im Film: Die in Berlin lebende Halbjapanerin Takka-Takka in den »Augen von Yade« Bei Hamburg aufgenommen unter Leitung von Iwa Raffay (Zu S. 22)
Der Film hat auch ein neues Geschlecht von Dichtern geschaffen: die Filmautoren. Sie sind stets auf der Jagd nach noch nicht dagewesenen Einfällen, nach Ungeheuerlichkeiten und sensationellen Verwirrungen und Situationen. Sie schrecken vor keiner Plattheit zurück, sie verzichten von Anfang an, Psychologie zu treiben, Gestalten seelisch zu vertiefen, sie geben Gegenständlichkeit, äußere Welt, sie kuppeln Bildgedanken zu einer kilometerlangen Schlange. Erst den letzten Jahren war auch hier eine Verfeinerung der Art, ein Vergleich zwischen krasser Äußerlichkeit und andeutungsweiser Innerlichkeit vorbehalten; der Filmautor suchte und versuchte, dramatische Kultur mit den Bedingungen der Kinematographie in Einklang zu bringen. Im allgemeinen darf man füglich behaupten: je edler das Manuskript, desto weniger filmwirksam ist es. Nur ganz wenige Schriftsteller haben wahrhaftes Talent für ein Film-Manuskript, meist wird aus dem Manuskript erst unter den Händen des Regisseurs eine brauchbare Grundlage für die Photographie.

Szenenbild mit Bruno Kastner (rechts) (Zu S. 68)
Immer mehr suchen Fabrikanten und Regisseure Schriftsteller von Rang und Namen zur Abfassung selbständiger Filmwerke heranzuziehen. Der Versuch hat nur in seltenen Fällen ein befriedigendes Ergebnis gehabt. Die Technik des Filmmanuskripts ist durchaus nicht so, daß sie den Autor beglücken könnte; der karge, in Schlagworten sich erschöpfende Text, der eine Situation feststellt, ohne sie sprachlich oder stilistisch ausmalen zu sollen, die nüchterne, skizzenhafte Art, die im Telegrammstil dahinjagt, ist für einen halbwegs ernsthaften Schriftsteller nichts weniger als verlockend; dazu sind die Manuskripthonorare, handelt es sich nicht um sehr gut eingeführte oder literarisch bedeutsame Namen, verhältnismäßig gering. Das Durchschnittshonorar für ein Manuskript, mit dem der Fabrikant Millionen verdienen kann, übersteigt heute kaum 1000 Mk.

Harry Liedtke. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S, 69)
Das Gebiet, dessen sich der Filmschriftsteller bemächtigt, ist freilich schier unerschöpflich. Die lustigen Tölpeleien, die am Anfang der Geschichte des Films stehen, sind heute längst überholt. Man hat sich an diesen akrobatischen Possen, in denen ein sehr kleiner Gedanke in unendlich viele Bilder zerdehnt wurde, satt gesehen. Man will nichts mehr wissen von dem unsäglich komischen Manne, der sich aus irgend einem Grunde versteckt, der immerzu verfolgt wird, in den Kamin flüchtet, dort, pechschwarz angerußt, in die Mehlkiste stürzt und wie ein weißes Gespenst die Hetzjagd über Treppen und Dächer fortsetzt, in eine ahnungslose Tischgesellschaft hineinplatzt und mitten in der Suppenschüssel Platz nimmt. Einmal hat man über diese Zirkusspäße Tränen gelacht, heute sind all diese Schwänke und Scherze tot. Und doch bargen gerade sie das Kinomäßige: Die zur Wirklichkeitsvortäuschung gewordene Unmöglichkeit. Man kann in gewissem Sinne sagen, das Kinostück war am echtesten, solange es sich in jeder Szene geflissentlich unecht gab. Der zappelnden Posse folgte bald das Flimmerlustspiel. Es verbreitete Wald- und Wiesenheiterkeit, war von einem sittsamen, sanften, geräuschlosen Humor, bescheiden und recht unkinomäßig. Es liebäugelte mit dem Schwank und mit der Posse, aber die Zuseher fanden schließlich bald heraus, daß der gesprochene Witz doch noch belustigender ist als der in Bildern gestellte und in limonadenlangweilige Titel aufgelöste. Vielleicht stand damals, als das Lustspiel – das natürlich inzwischen auch schon längst kinomäßig erneuert ist – auf die weiße Fläche zog, die ganze Entwicklung des Films auf der Kippe, denn zum ersten- und letztenmal war das Kinopublikum wirklich kritisch. In diesem nicht ungefährlichen Augenblick machte die Kinematographie eine Schwenkung: sie knüpfte an die ersten Filmpossen an, verdichtete die grotesken Möglichkeiten der Situationen, schlug einen Saltomortale über die Logik und erregte eitel Entzücken und Verblüffung mit der bewußten Kinogroteske.
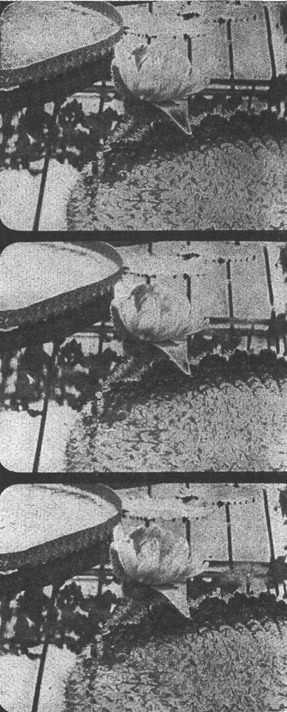
Das Aufblühen der Victoria Regia Teil eines Normalfilms von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 32)

Das Leben der Qualle im Meer Teil eines Normalfilms von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden-A. (Zu S. 32)
Der Groteskfilm war durchaus kinogemäß. Alle seine Absichten, seine Ausdrucksmittel entsprachen der Kinowirksamkeit. Die Täuschung rankte sich ins Witzige, ins Verstiegene hinüber, Situationen und Dinge, die der Sprechbühne und der mimischen Darstellung immer versagt bleiben, fanden hier Möglichkeiten, die Verzerrungen des Lebens in der Verzerrung durch den Film erst die geschaffene Tribüne. Wie sehr verzerrt, wie sehr unecht das Kinostück im Grunde ist, obwohl es doch von der Vortäuschung des Echten lebt, das beweist gerade die Eignung des Lichtspiels für die Groteskwirkung. Der Groteskfilm lebte vom »Trick«, von der Überrumpelung, von der Fähigkeit, Zaubereien und Taschenspielerkunststücke zu vollbringen. Er gab auch dem Darsteller immerhin dankbare Aufgaben, denn er berechtigte ihn geradezu zu Übertreibungen, die jedenfalls ehrlicher und erquickender waren als die großartigen Gebärden, auf die er sich in den nachfolgenden Gesellschaftsdramen und Detektivfilms einstellen mußte, Gebärden, die für ein paar Kurbelsekunden gesammelten Ausdruck verlangen. Die Groteske kann sich in Sekunden erschöpfen, das Empfindungsleben fordert Aufbau, Breite, Dauer im Ausdruck. Aber der Groteskfilm war auch nur ein Übergang, eine Anfangsstation in der Entwicklungsstraße des Films. Heute herrscht neben den Detektivabenteuern das großkalibrige Sensationsdrama, das zum Teil wuchtige, zum Teil sentimentale, meist aber ärgerlich verlogene Gesellschaftsstück.
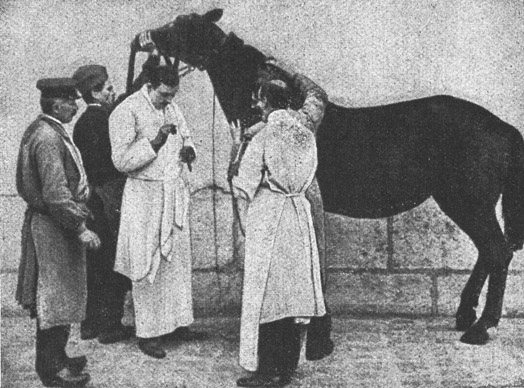
Mediziner bei der Herstellung von Pestserum anläßlich der Epidemie in China 1911. Ausschnitt aus einem Film (Zu S. 36)

Filmausschnitt aus einer Walfischjagd
Ehe auf diese Gattung näher eingegangen werden soll, mag einer aufrichtigen und wertvollen Bestrebung gedacht werden, die ziemlich früh einsetzte und dahin abzielte, die Kinematographie in den Dienst der Wissenschaft, in den Dienst einer ernsthaften Aufklärungsarbeit zu stellen. Der Kulturfilm, richtiger vielleicht Lehrfilm genannt, gehört zu den frühen Errungenschaften. Er gehört aber auch der Zukunft, und um seinetwillen mag manche Sünde, die auf der belichteten Fläche begangen wurde, verziehen und vergessen sein. Die Verwendung des Films als Hilfsmittel des Unterrichts oder einer volkstümlichen Kenntnisbereicherung umfaßt alle Gebiete der anorganischen Natur, der Pflanzenwelt und des Tierreiches, das weite Feld der Medizin, zahlloser menschlicher Zivilisationsbestrebungen und Kulturerrungenschaften. Der Beginn wurde mit der Technik gemacht. Man zeigte z. B. die Bereitung des Käses; vom Melken der Kuh rollte jede Zwischenstufe bis zum fertigen Käselaib vor den Augen des Zuschauers vorüber. An wichtigen Stellen kann ein solcher Film durch eine sinnreiche Vorrichtung durch den Stillstandsapparat auf beliebige Zeit festgehalten werden. Durch diese Einrichtung vermag der Vortragende – solche Lehrfilms werden ja immer von erläuternden Vorträgen begleitet – das Tempo der Vorführung zu hemmen und selbst zu bestimmen. In das Reich der Pflanzen wurde der nächste Ausflug unternommen; aberhundert rasch hintereinander auf die Fläche geworfene Bilder hielten die winzigsten Teilstufen aus der Entwicklung einer Pflanze fest, so daß der Beschauer wahrhaftig den Eindruck hatte, dem Werden einer Pflanze zuzusehen; er ist Zeuge des Aufblühens der Victoria Regia (Abb. S. 30), oder sieht, ins Tierreich entführt, das Leben der Qualle im Meer (Abb. S. 30) so genau und lebensecht, als schwämme der Zuschauer selbst neben diesen zarten Ballons der Tiefsee umher. Der Lehrfilm geht an keinem wissenschaftlichen Zweige vorbei; er weiß auch der trockenen Geographie Leben abzuringen, zeigt die Entstehung eines Flußlaufes, zeigt, in die geschichtliche Geographie abbiegend, in rasch durcheinandergewürfelten Landkarten das Werden eines Staates, seine Vergrößerung, seinen Zerfall, sein Wiedererstarken, besser, eindringlicher als es die tote, starre Karte je vermöchte; er wirbt um Liebe und Verständnis für den Zauber von Landschaften, deren windbewegte Bäume winken, deren Einwohner in malerischer Volkstracht bunt und frisch vorüberziehen, zur Kirche gehen, Volksfeste feiern, Hausindustrie betreiben, alte Sitten und Gebräuche üben. Wieder andere Lehrfilms eröffnen Rückblicke in verklungene Zeiten; sie geben Einsicht in die Kulturgeschichte, entwerfen Bilder gut gestellter, archäologisch beratener Szenen des klassischen Altertums, der mittelalterlichen Romantik, des zierlichen und zärtlichen Rokokos. Die Schönheiten geschichtlicher Trachten werden im lebendigen Flusse am lebenden Körper gezeigt, aus dem Faltenwurf ahnt die von einer plumpen Mode geknechtete Nachwelt die Freiheit und Zweckmäßigkeit ausgestorbener Kleidschönheit oder auch die Verstiegenheit verirrter Moden von einst. Die Bühne kann nie so eindringlich das Trachtenbild zeigen, denn dort ist es nur Beiwerk, nur Mittel zum Zweck; im Lehrfilm aber verweilt es, wird es deutlich und unterstreicht die bezeichnenden Einzelheiten. Der landwirtschaftliche Film zeigt das Leben der Bauern in allen Stunden harten Tagewerkes und gleicht, Verständnis erweckend, die Unterschiede zwischen Stadt und Land aus. Der Industriefilm, groß und wuchtig, führt in Fabriken und Werke, er läßt Hämmer niedersausen, flüssiges Eisen quellen, läßt ungeheure Werke in einer Viertelstunde gesammelter Stimmung vor dem Auge des entrückten und beglückten Zuschauers erstehen und greift unaufdringlich und doch zwingend hinein in die ungeheure, noch immer ungelöste soziale Frage. Sehr interessant ist auch der Sportfilm. Da es möglich ist, jetzt an 400 Aufnahmen in der Sekunde zu machen – bisher brachte man es nur auf etwa 14 – so läßt eine so beispiellos ins einzelne gehende Zerlegung eines sportlichen Vorganges – jede Teilerscheinung, etwa des Sprunges über eine Hürde mit wahrhaft märchenhaft wirkender Deutlichkeit verfolgen. Man sieht die galoppierenden Pferde verhältnismäßig noch langsam daherkommen, sieht jede angespannte Muskel des Tieres, jede Regung im Gesichte des Reiters, man kann den Absprung messen, die Tätigkeit des Reiters in jedem Bruchteil einer Sekunde verfolgen. Die Bewegung von Pferd und Mensch kann aus diesen Bildern neue sportlich sehr wichtige Aufklärungen entnehmen.

Guffy Holl in dem Aufklärungsfilm »Die Prostitution« (Zu S. 41)

Szenenbild aus dem orientalischen Film »Die Tochter des Mehemed«

Szenenbild aus dem Riesenfilm »Veritas vincit« (zu S. 66)

Viggo Larsen in dem Film »Der Mann mit den sieben Masken« (Zu S. 69)
Das wichtigste und edelste und am tiefsten in Volksnotwendigkeiten und wissenschaftlichen Ernst eingreifende Betätigungsfeld des Lehrfilms ist Wohl der medizinische Film. (Abb. S. 31.) Die Universitäten sind überfüllt; von mancher wichtigen Operation kann der Student keinen klaren, bildenden Eindruck erfassen. Der Film aber vermag die Tätigkeit des Chirurgen in jedem Augenblick der Operation festzuhalten. Der Operationsfilm kann tatsächlich Gegenstand des medizinischen Unterrichts werden, denn er zeigt alles Sehenswerte deutlich, und so oft man nur will, im klarsten und eindrucksvollsten Bilde.
Das Gebiet des medizinisch-wissenschaftlichen Films, dem noch eine gewaltige Zukunft offen steht, ist schon heute ein überaus weites. Selbst einen medizinisch-historischen Film gibt es; die Aufnahme zeigt eine von dem berühmten Chirurgen Bergmann ausgeführte Unterschenkelamputation. Ein Positiv davon befindet sich im Besitze des Berliner Kaiserin Friedrich-Hauses für das ärztliche Fortbildungswesen. Was der medizinische Lehrfilm in kleinen Ärztevereinen mittlerer Städte zu leisten vermag, wo die großen Apparate der Universitäten nicht zur Verfügung stehen, das liegt auf der Hand. Über den Wert, den die Kinematographie für Forschungs- und Sammlungszwecke hat, nur einige Worte. Unser Auge und unser Gehirn sind bloß auf das Erfassen von Bewegungen eingestellt, die eine gewisse Geschwindigkeitsgrenze nicht übersteigen. Die Kinematographie aber gewährt eine wesentliche Erweiterung unseres Auffassungsvermögens. Wir sind z. B. nicht in der Lage, den Gang des Menschen bei normaler Geschwindigkeit in seinen einzelnen Abschnitten zu verfolgen. Mit einem kinematographischen Apparat aber ist es möglich, mittelschnelle Bewegungen mit erhöhter Bildwechselzahl aufzunehmen, jedoch mit normaler Bildwechselzahl wiederzugeben, so daß eine künstliche Verlangsamung der Bewegung um ein Drittel erzielt wird. Man hat im Kinematogramm die Hebel- und Rotationsbewegungen des Herzens gezeigt, die Wirkung von Herzgiften im Tierexperiment, so die augenblickliche Einwirkung des Chinins, des Nikotins, des Chloroforms; sehr interessant sind die Aufnahmen der Magen- und Darmbewegung; Filme, die Vorgänge im Geburtskanal und geburtshilfliche Operationen verdeutlichen, sind nicht minder lehrreich. Die wissenschaftlichen Tatsachen, die unabweislichen Forderungen der modernen Hygiene, die Gymnastik, die Diätetik, die Samariterkunst, Ursachen und Entstehungsweise von Krankheiten und gesundheitlichen Schädigungen, all das wird ebenso wie die Mittel zur Krankheitsverhütung im Film vorgeführt. Wollte man auf das Anwendungsgebiet des medizinischen Lehrfilms auch nur annähernd eingehen, müßte man, um gewissenhaft zu sein, schon ein ganzes Buch schreiben. Mit diesen ausgesprochen medizinischen Weiterbildungszwecken gehen die auf breite erzieherische Volkswirkung bedachten medizinischen Aufklärungsfilms ziemlich Hand in Hand. Bei einer Vorführung der Kulturabteilung der Ufa, der Universal Film Aktiengesellschaft in Berlin, wurden solche unter ärztlicher Anleitung aufgenommene Aufklärungsbilder gezeigt. Die volksvergiftenden Folgen der Geschlechtskrankheiten fanden im Bilde eine abschreckende, eindringlich mahnende Deutlichkeit. Man sah, tief erschüttert, Rückenmarksleidende, die die Herrschaft über ihre Gliedmaßen verloren hatten, sah die quälerischen Bemühungen eines Paralytikers seinen Rock anzuziehen: sah die Spirochäten, die Erreger der Syphilis, in riesenhafter Vergrößerung ihr zerstörendes Wesen in der Blutbahn treiben. Mehr als das abmahnende Wort des Arztes, mehr als die beschwörende Gebärde des Soziologen kann dieses flimmernde Bild auf der weißen Fläche wirken.

Max Landa (rechts) in dem Detektivfilm »Europa postlagernd« (Zu S. 68)
Fast unbegrenzt ist das Gebiet des Kulturfilms; freilich, nicht alle Hoffnungen, die sich daran knüpfen, werden erfüllt werden können, denn die Herstellung kostet Geld, und es wird, wenigstens bei uns, noch recht lange dauern, bis das Wort eines amerikanischen Filmorganisators: daß jede Schule der Welt ihren Vorführungsraum für Filme haben müßte, zur Wahrheit geworden sein wird. Fast alle Gebiete des menschlichen Lebens und der Geistesarbeit harren der Verwertung im Film. Der Staatsmann, der Politiker, der Finanztechniker, alle, alle nützen den Film zu Propagandazwecken aus. Die Eindruckskraft des Films hat sich so recht deutlich im Kriege gezeigt. Deutschlands Feinde betrieben, in richtiger Erkenntnis der Massenwirkung des Kinos, ihre Hauptpropaganda durch den Film. Sie überboten einander an Unwahrheiten und Geschmacklosigkeiten in Propaganda- und Hetzfilms und schürten in den »Cinémas« stets aufs neue die erschlaffende Volkswut gegen alles Deutsche. Deutschland konnte gegen diesen »gestellten« Lügenfeldzug nichts unternehmen, ihm fehlte ja durch die Blockade jede Wirkungsmöglichkeit auf das Ausland. Für nationale Propaganda im edelsten Sinne werden wir uns künftig mit allen Kräften einsetzen müssen. Während der fünf schweren Kriegsjahre war der deutsche Propagandafilm darauf beschränkt, im Inlande zu wirken und zu werben. Er hat es redlich getan, mochte er in hübsch ersonnenen Bildern, in geschickt gebauten Stücken Stimmung für die Kriegsanleihen machen oder in würdigen, ehrlichen Ausschnitten aus dem Kriegswelttheater deutsches Heldentum in unvergleichlicher Anspannung, oder deutsche Tüchtigkeit, deutsche Anpassungsfähigkeit und deutsche Zivilisation in eindringlichen Szenen zeigen. Der Propagandafilm wirbt wie nicht bald ein Mittel für Zeitgedanken, er kann der lautlose und doch der beredteste Demagoge sein; ein Volksprediger, ein Volkslehrer, ein Volkserzieher. Er kann die tiefere Volksfremdheit des Lichtspieldramas wett machen durch die wahre, innere Volkstümlichkeit des aufklärenden, kulturtragenden, Gedanken vermittelnden propagandistischen Reichtums.

Mia May in » Veritas vinci!« (Zu S. 66)

Pola Negri in »Carmen« (Zu S. 66)
Üble Berechnung hat, zumal in allerjüngster Zeit, mit dem Schlagwort vom Kulturfilm oder Aufklärungsfilm bösen Mißbrauch getrieben. Es ist geradezu empörend, was, insbesondere seit Aufhebung der Zensur, unter der Maske des Aufklärungsfilms in die breiteste Öffentlichkeit zieht. Zunächst beschränkte sich eine halb ehrliche, immer aber auch halb geschäftstüchtige Aufklärungsarbeit darauf, in dramatisch bewegten, auf die Grundidee gestimmten Stücken das Verheerende der Geschlechtskrankheiten zu zeigen. Man durfte dieser Tätigkeit, die, wenn auch nur geringen praktischen, so doch immerhin grundsätzlichen erzieherischen Wert hatte, nicht in den Arm fallen, ja, es muß mit einer gewissen Anerkennung des Regisseurs und Filmschriftstellers Richard Oswald gedacht werden, der dieses Gebiet mit Ernst und Geschick beging und sich von jeder Ausschreitung frei hielt, durchaus mit sauberen Händen arbeitete. Auch vom rein wissenschaftlichen Standpunkt ist gegen diese in Handlungen eingekleideten medizinisch aufklärenden Films nichts einzuwenden gewesen; gerade bei Kinematogrammen über Geschlechtskrankheiten ist die dramatische Handlung das Betonte, denn nur sie kann die ganze Tragödie des geschlechtlichen Elends so hinreißend darstellen, daß die aufklärende und abschreckende Wirkung erzielt wird. Ein anderer ähnlicher Film »Die siegende Sonne« wirkte im Sinne der Volksaufklärung gegen die Volksseuche Tuberkulose. Seitdem nun in Deutschland die Zensur von dem Sturmwind der Revolution weggefegt ist, schießt eine neue Sorte von Aufklärungsfilms aus dem betriebsam gedüngten Boden der gewinnsüchtigen Fabrikation. Auch jetzt noch hält sich Richard Oswald, wenn er auch an die gewagtesten Aufgaben herangeht, von Übertreibungen frei; in dem großen Filmwerk »Die Prostitution« (Abb. S. 33) ist mehr menschlicher Gehalt, mehr gute Absicht als rechnerisches Ausspähen auf die Stimmung der Masse, die gerade solche Schaustellungen stürmt, die um das sexualerotische Gebiet herum angelegt sind. Es ist eine gewisse Zurückhaltung, ein behutsames Schamgefühl, sicherer Geschmack in Bild und Absicht zu merken, ein an sich dramatischer Aufbau, der die Tendenz nicht aufdringlich in den Vordergrund schiebt; und auch die Moral der Geschichte riecht nicht nach Sonntagspredigt; sie zieht nur aus geschickt vor Augen gestellten Tatsachen Folgerungen, die jeder beherzigen kann, der Lust hat. Es ist freilich zu befürchten, daß nicht allzuviele dazu Lust verspüren werden, und die Prostitution, »die Pestbeule am Leibe der Kultur«, wird wegen dieses Films nicht kleiner, nicht weniger drohend werden. Schon bei diesem Film machte sich eine Erscheinung bemerkbar, die dann in rascher Folge zu einem gefälschten Reklameschild für all die vielen falschen Kulturfilms wurde: die in solchen Fällen völlig überflüssige Mitarbeit ärztlicher Berater. Ein wissenschaftliches Gutachten medizinischer Fachleute zu einem Film über d. h. gegen die Prostitution ist ein unsinniger Rahmen. Gibt sich eine ärztliche Autorität dazu her, gegen gute Bezahlung – Honorar scheint mir hier nicht mehr das richtige Wort – den Text für ein paar nebensächliche Filmtitel zu schreiben, dann mag das dieser Arzt mit seiner wissenschaftlichen Würde ausmachen. Aber ein Plakat, die Stimme des Anlockers, des »Rekommandeurs« wie am Rummelplatz soll die »fachliche« Mitarbeit nicht werden. Unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Vorworte segelten bald weitere Aufklärungsfilms in die Masse. Sie besorgten ihren Zweck schon besser; sie klärten wirklich auf und ließen, von schmutzigen und eindeutigen Situationen überschwemmt, keine Lücken mehr in der Allgemeinbildung über menschliche Laster und Entartungen. Wenn dieser Wahnsinn weitergeht, wird es bald keine erotische Verirrung mehr geben, die nicht durch einen wissenschaftlich belegten Kulturfilm Aufklärungsarbeit und den Fabrikanten und Direktoren volle Häuser macht. Es wäre müßig, darum gleich nach der Zensur zu schreien; der gute Geschmack des Publikums allein wäre der berufene Zensor; er muß solche Machwerke, die sich oft nicht scheuen, einen Paragraphen des Strafgesetzbuches verführerisch an der Stirne zu tragen, verwerfen.

Pola Negri in ›Vendetta‹ (Zu S. 66)
Nach diesem wissenschaftlichen Abstecher, der auch in den Bereich des Mißbrauchs wissenschaftlicher Schlagworte führte, zurück zur Entwicklung des Spielfilms. Dem grotesken Lichtspiel folgte bald als richtiges Futter für die große Masse das Gesellschaftsdrama. Verwicklungen unmöglichster Art, viel zu unwahrscheinlich, als daß sie in einem Hintertreppenroman billigsten Zuschnitts hätten Raum finden können, bevölkerten die Salons, die vor das Auge hinflimmerten. Es konnte gar nicht feudal genug hergehen in solchen Films. Unter Grafen tat man es überhaupt nicht, und eigentlich fing der Filmheld erst beim Fürsten an. Testamente und Liebesirrungen, unterschobene Kinder, gestohlene Patente spielten eine Hauptrolle. Es gab immerzu großartige Festlichkeiten, lauschende Dämonen an verschlossenen Türen, Entführungen über Stock und Stein, Mondscheinszenen und zuckersüße Lieblichkeiten. »Visionen« stiegen aus sinnig gestellten Bildern auf und zeigten, wenn die Geschichte so langweilig und verworren geworden war. daß sich kein Mensch mehr in ihr zurecht fand, was vor 20 Jahren geschehen war. Das Gegenwartsbild blendete ab, und aus der Versenkung eines Überganges dämmerte die Vorgeschichte. Sie spielte mit Vorliebe in amerikanischen Urwäldern (in denen natürlich kein einziger Baumstamm amerikanisch war), auf Goldfeldern, in Steinbrüchen; diese Vorgeschichte liebte es auch, Gewalttaten und Verbrechen einer Gesellschaft, die sich in Frack und Seide gab, anzudichten. Mit dem technischen Verblüffungsmittel der Vision wurde nicht gegeizt; bald stand die wegen einer Eheirrung vertriebene Mutter geisterhaft und sehr plötzlich am Bett ihres Kindes, bald schattete die Hand eines Toten spukhaft über die Szene. Die schattenhaften, romantischen Einstreuungen fanden Beifall; diese Anerkennung des Publikums verlockte die Erzeuger von Filmen, das phantastische Element mehr zu betonen. Unter gründlicher Ausnützung der vielen Möglichkeiten zu Trickaufnahmen, von denen noch die Rede sein soll, wurden, rein bildmäßig bewertet, phantastische Films gedreht, die mancherlei Schönheit brachten und sich turmhoch über die öden Spielfilms erhoben. Das Motiv des Doppelgängertums z. B. wurde mit Erfolg angeschlagen, die Tatsache, daß im Film ein und derselbe Darsteller mit sich selbst Würfel spielen, mit sich selbst einen Zweikampf auf Rapiere ausführen konnte, war natürlich überaus reizvoll. (Abb. S. 51.) Die Phantasie des Zuschauers wurde, wenn nicht befruchtet, so doch scharf angeregt, seine Neigung für Übersinnliches, Mystisches, Traumhaftes mächtig gepackt. Wieder zeigte es sich, daß der Film, berechnet auf die Vortäuschung der stärksten Wirklichkeit, eigentlich erst dort am eindrucksvollsten wirkt, wo er sich von der Wirklichkeit am meisten entfernt. In der Reihe der phantastischen Filmwerke steht so ziemlich als erstes und bestes der »Student von Prag« an der Spitze. Einen vorläufigen Gipfel hat diese Art in der Verfilmung des Romans »Alraune« von Hans Heinz Evers gefunden. Freilich ist hier die Vergröberung der Wirkungen schon eine recht merkbare. Von den zwischen diesen Endpunkten liegenden phantastischen Films wäre noch das allerdings unerträglich breit angelegte Werk »Homunculus« als eines der erfolgreichsten zu nennen. Es sucht die Idee des künstlichen Menschen zu vertiefen, ja, es hat geradezu den Ehrgeiz, faustische Maßstäbe anzulegen. Die Gier, einen Gedanken ins Endlose zu zerdehnen, hat den Fortsetzungen des guten, ersten Teils sehr geschadet, wie überhaupt das Bestreben, »Serienfilms« zu »drehen«, in so und sovielmal fünf oder sechs Akten einen Grundgedanken fortzuspinnen, sich als eine recht wenig glückliche erwiesen hat. Es scheint, daß der phantastische Film in der Heranziehung geheimnisvoller Vorgänge seine Fortsetzung finden wird. Nachdem die Amerikaner in der kitschigen Geschichte von Trilby und Svengali die Hypnose filmgerecht gemacht haben (übrigens in guten Bildern, in denen die schöne Amerikanerin Kimhall Young die Hauptrolle spielt), versprechen jetzt deutsche Filmgesellschaften Lichtspiele aus dem Bereich der Fernahnung und des Schlafwandels.

Käthe Haack. Aufnahme von Becker & Maaß, Berlin (Zu S. 66)
Wo der alte Spielfilm nicht die Vision als Unterbrechung der Handlung heranziehen mochte, dort unterschob er, wie schon erwähnt, gerne irgend ein Verbrechen. Es ist selbstverständlich Spannung erzeugend, wenn das Verbrechen nicht gleich entdeckt wird. Der unbeherrschte Sinn der Masse findet an solchen Dingen Geschmack. Die gehorsame Filmindustrie tat das Gleiche. Sie lieferte Massenverbrechen, Totschlag, Mord und Diebstahl. Um die Spannung weiter zu erhöhen, mußte irgend jemand den dunklen Taten nachgehen, sie mit fabelhaftem Spürsinn aufzuklären versuchen und schließlich überraschende Lösungen finden: Der Detektivfilm war geboren. Mit dem Detektivfilm aber hatte die Kinematographie den denkbar äußersten Tiefstand erreicht. Kein Detektivroman, von all den tausenden, die den Spuren Sherlock Holmes folgten, hat eine solche Verirrung der Logik, eine solche Vergewaltigung des gesunden Menschenverstandes, soviel erschütternde Geistesarmut zutage gefördert wie die Detektivfilms. Was all diese zur Berühmtheit gewordenen Detektivgestalten an Unsinn und Witzblatt-Heldentum geleistet haben, ist wahrhaft monumental. Man hat den Filmdetektivs zugejubelt und, kritiklos, niemals erkannt, daß sie selbst vom bildhaft-darstellerischen Standpunkt aus fast ausnahmslos nichts zu spielen, nichts darzustellen hatten. Ihre Rollen waren die undankbarsten; sie hatten zu kommen, zu sehen, zu siegen; sie hatten stets die gleiche undurchdringliche Maske aufzusetzen, dasselbe pfiffig überlegene Lächeln zu lachen, wenn ihnen die Überlistung eines Verbrechers gelungen war; hatten bescheiden stolz zu tun, wenn sie sich als klüger als die Polizei erwiesen hatten; und sie sind immer klüger als der Kriminalist; das gehört schon zum Handwerk der Film-Manuskriptfabrikation; sie rauchen unentwegt Zigaretten, und es sieht so aus, als ob sie aus dem kräuselnden Rauch Offenbarungen gewännen. So oft ein Revolver gegen sie in Anschlag gebracht wird, versagt er, oder sie parieren die zum Schuß erhobene Hand; oder sie wissen es schon im voraus, daß ihnen Gefahr droht, und haben ihre Vorkehrungen getroffen; sie führen alle Gegengifte bei sich, sie entfliehen aus dem tiefsten Keller, aus nachtdunklen Brunnen und unzugänglichen Verließen. Sie wittern aus Spuren, die kein Polizeihund nehmen könnte, mit märchenhaftem Instinkt Zusammenhänge, die es gar nicht geben kann. Sie sind wahre Hexenmeister des Scharfsinns, der Berechnung;. ihre Rollen geben ihnen zwar nichts zu spielen, aber diese Rollen sind doch ausgefüllt von soviel wohl unmöglichem, dafür aber inhaltreichem Geschehen, daß die Menge in dem Filmdetektiv, in dem Sherlock Holmes-Ersatz der zappelnden Leinwand, schließlich den unbesiegbaren Helden erblickt. Wenn irgendwo, hier darf man sagen: Vernunft wird Unsinn!

Panik auf einem Ozeandampfer auf hoher See. Packende Szene aus dem Film Atlantis nach Gerhart Hauptmann (Zu S. 47)
Auch das Detektivstück, das wie kaum ein anderes volksbeliebt wurde, hat seine »Serien«. Die Serien heißen hier Abenteuer, und es gibt Detektivgestalten des Films, die zum »geistigen« Besitzstand jedes Deutschen gehören. Sie aufzuzählen, verlohnte nicht, selbst wenn es der Raum gestattete. Nur die immer wiederkehrenden: die Stuart Webbs, Harry Higgs, Joe Jenkins, und Rat Anheim mögen beispielsweise genannt sein. Einige Stücke, wie die des sehr begabten Paul Rosenhayn oder des einfallreichen E. A. Dupont, ersetzen den Kitsch durch wirklichen Scharfsinn. In letzter Zeit ist übrigens ein sehr angenehmes Abflauen sowohl des Interesses, wie, damit übereinstimmend, auch der Herstellung von Detektivfilms zu bemerken. Die ganze Art, deren unerfreulichster Zug der war, daß sie sich selber ernst nahm, stirbt allmählich aus. Parodistische Detektivfilms treiben Selbstverspottung, der Kitsch verulkt sich, und die Helden von Spürsinns Gnaden lassen eine Perle um die andere aus ihrer Talmikrone fallen. Im Film ist es aber stets so, daß, wenn eine Gefahr schwindet, die andere um so mächtiger ihr Haupt erhebt. Und so vergreift sich in letzter Zeit der Film immer häufiger an Werken der dramatischen Kunst, an ernsthaften Romanen der Weltliteratur, ja selbst an den Klassikern. Manchmal gelingt der Versuch insofern, als ein kultivierter Regisseur mit voller Hingabe an die große Aufgabe alles, was der Film aus einem Kunstwerk herauszuholen vermag, in das Bild bringt, ohne dem Wert der Dichtung Gewalt anzutun, so in der Verfilmung des Bierbaumschen Romans »Prinz Kuckuck« (Regie Paul Leni). Oft aber, nur zu oft, läßt sich eine Verflachung und Veräußerlichung nicht umgehen, und dann muß jeder künstlerisch empfindende Mensch die Heranziehung des Sprechdramas oder des gehaltvollen Romans für Filmzwecke als einen Mißbrauch bösester Art ansehen. Ibsen und Hauptmann (Abb. S. 45), der sehr lange zögerte, ehe er ein Kompromiß mit der zappelnden Leinwand schloß, sind im Film zu sehen, Strindberg wird verfilmt, Wedekinds Witwe hat die Werke des toten Gatten dem Kurbelkasten ausgeliefert. Manche Regisseure wissen, was sie im Rahmen der Grenzen ihres Reiches der großen Kunst schulden, viele übersehen es geflissentlich, manche aus Mangel an Einstellung zu dem literarischen Wert der Werke. Daß der Film auch vor den – wehrlosen – Klassikern nicht Halt macht, versteht sich eigentlich von selbst. Nicht grundsätzlich ist gegen die Verfilmung von Werken der Weltliteratur oder von Kunstwerken der letzten Zeit Stellung zu nehmen, aber Fabrikant und Regisseur sind eindringlich an die Pflichten zu erinnern, die eine solche Aufgabe mit sich bringt.

Der zappelnde Mann. Trickaufnahme des Komikers Henry Bender. Aufnahme von A. Groß, Berlin (Zu S. 49)

Ein »Turm« fliegt in die Luft. Durch Sprengung eines Modells wird der Eindruck der Echtheit vorgetäuscht. Aufnahme von A. Groß, Berlin (Zu S.50)

Der Schloßbrand oder »Wie's gemacht wird«. Das Modell der kleinen Villa wird abgebrannt und der danach aufgenommene Film rot gefärbt, wodurch der Eindruck eines wirklichen Brandes entsteht (Zu S. 50)
Wohin die Filmmode gegenwärtig steuert, läßt sich nicht mit einem Worte beantworten. Es scheint, daß sich die Filmindustrie ihres nächsten Weges selber kaum recht bewußt ist. Der ganz große Spielfilm, der nach amerikanischem Vorbilde mit einem Riesenaufgebot von Menschen arbeitet und den Namen Kolossalfilm, Monumentalfilm, Weltfilm, Rekordfilm und andere tönende Bezeichnungen nicht zu Unrecht verdient, ist augenblicklich der begehrteste. Schlagworte der Zeit werden, von begleitenden Begebenheiten umrankt, in einen ungeheuren Rahmen gespannt und rollen Bilder auf, denen die Sprechbühne auch nicht annähernd standhalten kann. Alles ist auf Ungeheuerlichkeit eingestellt, und es läßt sich nicht leugnen, daß all dieses Riesenhafte – amerikanische Films arbeiten mit einem Aufwand bis zu 75 000 Personen – etwas Hinreißendes, wahrhaft Zwingendes hat.
Der historische Film zaubert kühn bewegte und verlebendigte Vergangenheit, erhöht durch den Reiz der Zeitstimmung, die durch verschwenderische Anwendung von Kostümen und Einpassung in historische Örtlichkeit besticht, auf die »Leinwand«; die landschaftliche Schönheit wird mit einem gepflegten Blick für köstliche Einzelwirkung immer reichhaltiger herangezogen; nur das Lustspiel krankt noch an verbrauchten, von einer possenhaften Komik mühsam durchleuchteten Situationen.
Der kurze Streifzug in die Vielfältigkeit der Kinoproduktion läßt sich nicht abschließen, ohne auf die vielen kleinen und großen Überraschungen einzugeben, die den Film für den Laien oft ins Reich des Wunderbaren erheben. Der Trick im Film, all dieser flimmernde Hokuspokus, ist ein Kapitel für sich. (Abb. S. 11 u. 46 ff.)
Die Eigenart der photographischen Linse gestattet eine der Einbildungskraft förderliche besondere Kinotechnik, die sogenannten Trickaufnahmen, die allerlei Hexereien ermöglichen, oft auch das Verfahren vereinfachen. Pappfelsen werden vom Steinmassiv im Lichtbild kaum mehr unterschieden. Also kann man auf einem Tisch eine Gebirgslandschaft aufbauen, nicht viel größer als ein Kinderspielzeug. Der Apparat wird an diesen Gebirgsersatz sehr nahe herangeschoben, und der Film gibt die fromme Täuschung echtesten Dolomitgepräges wieder. Um die Gesetze der Schwerkraft braucht sich der Regisseur kein graues Haar wachsen lassen. Die Hilfskonstruktionen verschwinden ja in der Aufnahme; vor einem weißen Hintergrunde hängt an einem ebenso weißen, also unsichtbaren Faden ein Hut. (Abb. S. 11.) Hintergrund und Faden verschwimmen bei der Aufnahme zu einem Ton, das Wunder ist geschehen: der baumelnde Hut dreht sich lustig frei in der Luft. So lernen auch Menschen im Trickfilm das Fliegen. (Abb. S. 46.) Brücken werden gesprengt. (Abb. S. 49.) Es sieht sehr dramatisch aus; in Wahrheit stand die Brücke im Glashaus und wurde höchst gefahrlos vor dem nahegerückten Objektiv in die Luft geschmissen. Das will nicht sagen, daß nicht auch tatsächlich naturgetreu hergestellte Schablonen von Türmen (Abb. S. 47) oder Schlössern gebaut und gesprengt werden. Die prächtige Villa, die eben noch von Menschen bevölkert war, wird fünf Minuten später ein Raub der Flammen. Ihr getreues Modell steckt nämlich ein Streichholz auf dem Tisch vor dem Operateur in Brand. (Abb. S. 48.) Wieviel Lichtwirkungen lassen sich mit einfachen Tricks erzielen! Man drosselt etwa in einem Zimmer die Beleuchtung auf ein Mindestmaß, nur im Kamin ist eine hochkerzige Lampe untergebracht: das Bild zeigt dann ein in Dämmer verschwebendes Zimmer, mit voll leuchtendem Kaminfeuer, das seinen Glutschein auf alle Mitspielenden verströmen läßt. Schauspieler können in ein und derselben Szene ihre eigenen Doppelgänger sein, man braucht sie dazu nur getrennt aufzunehmen und ihre Bilder geschickt einzukopieren. (Abb. S. 51.) Dieselbe Lösung findet das Rätsel der Visionen, die über eine sehr wirkliche Szene hingeistern. Leute, die auf Dächern herumklettern, müssen einem darum noch keine Angst einjagen; die Dächer sind nur zwei Meter hoch. (Abb. S. 53.) Abstürzende verletzen sich nie, denn: es sind bloß Puppen, die in die Tiefe sausen. Der Sprung von dahinbrausenden Eisenbahnzügen ist höchst ungefährlich, denn die Züge, die zum Zwecke der Aufnahme gemietet waren, fahren in Wirklichkeit sehr langsam, nur ein rasches Vorführen läßt die Bewegung im D-Zugtempo erscheinen. (Abb. S. 55.) Raubtiere, die sich um eine heldenhafte Darstellerin gruppieren, sind keine Bestien mehr, sie sind nur einkopiert. Ehrgeizige Filmleute suchen freilich tatsächlich die äußersten Gefahren und lassen sich (in diesen Gefahren) von dem nicht minder Gefahren ausgesetzten Operateur kurbeln. Der Schauspieler Harry Piel läßt sich samt einem Pferde, an das er gegürtet ist, 200 Meter tief im Fallschirm vom Fesselballon niedergleiten; manche allzu Verwegene haben ihren Kinomut mit dem Leben gebüßt. Aber im allgemeinen lebt das Lichtspiel, die Tochter der Lüge, im Reich des Tricks, im Land der Täuschung.
*

Die Sprengung einer Brücke im Atelier (Zu S. 49)

Filmaufnahme im Löwenkäfig
Die heimliche Sehnsucht des Films ist das Wort, das Geräusch, der Laut, der mit dem Bild gleichlaufende Gehörreiz. Der Film ist stumm. Alle Bestrebungen, ihn mit Sprache zu begaben, sind bisher gescheitert. Man hat Grammophone und Phonographen herangezogen und sich bemüht, ein möglichstes Zusammentreffen von Bild und Ton zu erzielen; es blieb immer eine halbe Sache. Bald hinkte die Bewegung dem Ton, bald der Ton dem Bilde nach. Etwas Ganzes läßt sich nur bei sogenannten synchronischen Aufnahmen erzielen, d. h. bei Aufnahmen, die jedes Geräusch gleichzeitig mit der entsprechenden Bewegung sowohl im photographischen Apparat wie im Phonographen festhalten. Auf diesem synchronischen Grundsatz beruht die Erfindung Edisons, das Kinetophon, das vor dem Kriege von einer eigenen Edison Kinetophon-Gesellschaft auch in Deutschland eingeführt werden sollte. Die Geschichte führte zu einem ziemlich kläglichen Zusammenbruch. Ton und Bild waren zu sehr voneinander abhängig, um eine fließende Wirkung erzielen zu können, die Geräusche kreischten, das gesprochene Work wurde unklar, und die Frage des Kinetophons, des Sprechbildes, blieb vorläufig ungelöst.

»Sind wir nicht beide Paul Heidemann?« (Der Doppelgänger im Film) (Zu S. 43 u. 50

Eine Aufnahme, die wirklich »auf der Höhe« ist
Man versuchte dem Film auf einem anderen Wege die Zunge zu lösen. Die Lichtspieloper und die Lichtspieloperette sollten die Illusion der sprechenden und singenden Leinwand herstellen. Ein geschickter Kapellmeister, der scheinbar den Sängern im Film die Einsätze gab, sollte eine Übereinstimmung zwischen Bild und Sängern, die irgendwo hinter der Szene aufgestellt waren, herstellen; es blieb beim Schein. Bald schmiß das Orchester um, bald der Ersatzsänger, und alles war oft nur ein mühseliges Nachhinken, ein Wettrennen mit dem Gebärdenspiel der Bilder. Die ganze Geschichte steckt noch sehr in den Kinderschuhen; die glücklichste Lösung wäre gewiß die synchronische Aufnahme wie beim Kinetophon gewesen, aber gerade diese gleichzeitigen Aufnahmen versagten. Ein Versuch, den Bildern Plastik zu geben, für den eine Zeitlang unter dem Titel Kinoplastikon Stimmung gemacht wurde, kam gleichfalls über durchaus nicht hinlängliche Anfänge nicht hinaus. Vielfach wurde auf anderem Wege eine Belebung des geisterhaften Flächenspiels angestrebt. Man verband Bild und Wort in der Form des Filmsketch, so, daß in eine filmgerechte Handlung, in einen leichten, ansprechenden (natürlich auch seichten) Dialog einfach Bilder eingelegt wurden. Dinge, die sich auf der Sprechbühne nicht zeigen lassen, Aufstiege in Flugzeugen, Jagden über Dächer usw., erschienen im Film. Anstatt des Vorhanges geht über der Szene die weiße Leinwand (diesmal ist's wirklich Leinwand) nieder, und die Projektion beginnt, um im geeigneten Augenblicke wieder von der Szene der Sprechbühne abgelöst zu werden. Man sieht also, der Herzenswunsch der Kinematographie, andere Gebiete von Sinneseindrücken zu erobern, ist noch im Suchen und Tasten. Schließlich, wenn das Kinematogramm sprechen könnte, wenn es plastisch wäre und sich in natürlichen Farben zeigte, wäre es ja kein Film mehr. Bis zu dieser Vollendung ist aber noch ein weiter Weg.
*
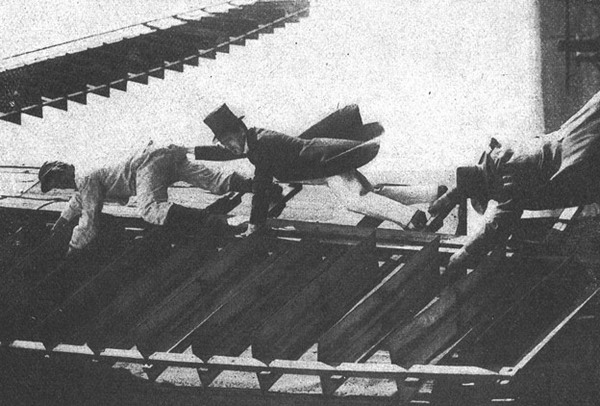
Was alles gemacht wird: Diebsjagd über Windmühlenflügel (Zu S. 50) Die Windmühlenflügel liegen, höchst ungefährlich, auf dem Boden des Glashauses, und die Szene wird von oben gekurbelt
Alle Welt drängt zum Film. Die Dame der Gesellschaft spielt mit der Versuchung, ach, nur ein einzigesmal vor dem Kurbelkasten zu stehen! Die kleine Verkäuferin träumt Tag und Nacht davon, einmal ihrem Bilde auf der weißen Fläche zu begegnen; da ist auch kein Wesen weiblichen und bald wohl auch keines mehr männlichen Geschlechts, das nicht von dem einen, heißhungrigen Bestreben restlos erfüllt wäre, zu filmen. Eine Filmleidenschaft, die fast schon ans Krankhafte grenzt, beherrscht alt und jung. Die Regisseure können sich des Angebotes, das in allen Abschattungen an sie heranflutet, von der bescheiden zugeflüsterten Bitte bis zur stürmischen Liebesverheißung, vom selbstbewußten Ton des überzeugten Dilettanten bis zur entsagungsvollen Träne des verkannten Genies, nicht erwehren. Die Massenhypnose Kino hält diese Begehrlichen in ihrem Bann. Dazu kommt, daß ein hartnäckiges Gerücht dem Uneingeweihten goldene Berge beim Film verspricht; jeder hofft, bei angenehmer, anregender Arbeit, in einem zigeunerhaft seligen Leben Geld zu erraffen. Nichts ist törichter als dieser Irrwahn! Der Filmsüchtige wird es in 990 von 1000 Fällen nicht über Komparsendienste bringen. Der Statist erhält aber heute für die anstrengende, durch Geduldproben entnervende, oft bis zur Grenze der körperlichen Leistungsfähigkeit gesteigerte Tätigkeit ein Taggeld von 25 bis 30 Mark. Dafür haben, zumal die weiblichen Komparsen, Toiletten zu stellen (meist werden Gesellschaftstoiletten verlangt, die durchaus nicht armselig sein dürfen); sie haben sich davon einen ganzen Tag zu verpflegen und Fahrgeld auszulegen, denn Reisevergütungen werden nur bei Aufnahmen außerhalb bezahlt. Ein wirtschaftliches Genie bringt von dem Taggeld vielleicht noch traurige 5 Mark Überschuß heim; ein schwächerer Rechner zahlt glatt darauf. Die Filmlaufbahn ist mit Enttäuschungen, mit Mutlosigkeit und Opfern, mit dem Aufwand von Nerven und Gesundheit zu erkaufen. Und der Enderfolg ist nur zu oft ein so geringer, daß das Mißverhältnis von Einsatz und Preis allzu kraß wird. Es gibt eine besondere Filmbegabung, die aus einer gewissen Ruhe und einer starken Eindruckskraft der Bewegungen erzielt wird. Doch das Talent allein ist noch nicht alles. Die entsprechende Frage beim Film bleibt stets: wie wirke ich im Bilde? Der Begabteste kann photographisch versagen. Wo alle Welt zum Film drängt, gibt es nur einen wohlgemeinten Rat: Hände weg vom Kino! Das Mahnwort ist in den Wind geredet, aber ausgesprochen mußte es werden. Wenn Filmschulen Dilettanten Ausbildung und fachgemäßen Unterricht versprechen, so ist das eine rücksichtslose Spekulation auf den Massentrieb der kinosüchtigen Menge. Das Filmen läßt sich nicht lernen. Man wird als Kinodarsteller geboren und tritt gleich das erstemal als ein Fertiger oder Unverbesserlicher vor das Objektiv. Regie und Übung, aber praktische, berufliche, nicht schulhafte Übung erst können also dem Fertigen die Vollendung holen. Wer immer den Zug zum Kino fördert, stärkt nur das ohnehin allzu zahlreiche Filmproletariat, das oft und oft, beschäftigungslos, undiszipliniert, und ohne Halt der moralischen Entartung in die Arme treibt.

Ein Automobilabsturz wird gefilmt
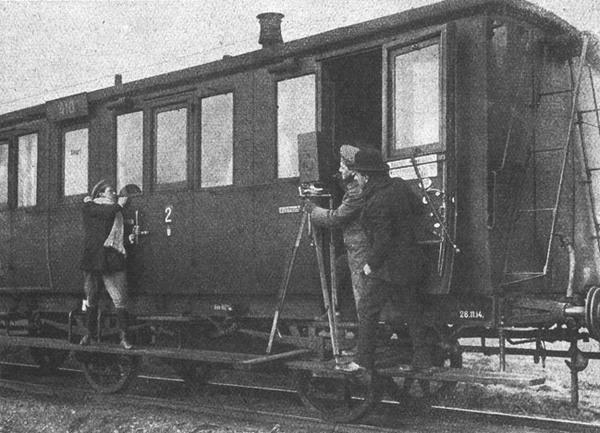
Ein Eisenbahnmarder springt während der Fährt auf einen Zug (Zu S. 50)
In sehr schätzenswerter und sehr straffer Weise hat eine Organisation all die vielen kleinen Leutchen vom Film erfaßt, nur ihnen die Möglichkeit zu einer geordneten Tätigkeit zu eröffnen. In Berlin dient diesem Zwecke die Filmbörse, die in einem Kaffee der mit dem Filmgetriebe innig verknüpften Friedrichstadt untergebracht ist. Das Börsenleben, das sich sonst »wild« in verschiedenen Kaffees abspielte, ist jetzt in einen Mittelpunkt gedrängt, wenigstens was die kleine Filmwelt anbelangt. In den übrigen Kaffees ist große Börse. Dichter, Regisseur, die Rollenträger und -trägerinnen, manchmal auch die »Diva« und sehr oft der männliche Star sind dort zu treffen. Sie lassen sich sehen, besprechen das Geschäft, zeigen Toiletten, reden eine Sprache, die ein gewöhnlicher Sterblicher kaum versteht, vergessen plötzlich die Wirklichkeit und fallen in den Stil einer Rolle; sie kokettieren, intrigieren, surren, girren, haben großartige Gebärden oder die kleine, nüchterne Geste des Alltags. Dichter Zigarettendampf stockt wie ein riesiger Luftballon über dieser kribbelnden Welt, aus der alle Gesichter, alle Besonderheiten, alle Linien, die vor dem Kurbelkasten zum Bilde werden, in einem bunten Hexentanz aufleuchten. Ein klein wenig Romantik geistert am hellen Tage in nüchterner Zeit durch ein verräuchertes Kaffeehaus. (Abb. S. 59.)
Die kleinen Leute vom Film sind auf die Börse angewiesen. Hier, an den vielen Tischchen zu ebener Erde und im ersten Stocke sitzen sie, warten auf die Hilfsregisseure, die ab und zu mit cäsarischer Miene die Räume durchschreiten und passende Gestalten suchen. Der Blick des Hilfsregisseurs bohrt sich in diese angestaute Menschheit, in dieses lebende Warenlager von Spezialitäten, prüft blitzschnell, wählt, winkt, engagiert. Es ist streng verboten, den Hilfsregisseur anzusprechen, sich ihm aufdringlich in den Weg zu werfen; aber die Sprache der Augen läßt sich nicht mundtot machen. Diese Augen springen den Suchenden an, sie betteln und schmeicheln und bieten an, sie verkrampfen sich in den Blick des Wählenden, sie hoffen und bangen. Hier sitzt der »Bonvivant« neben dem Greis mit den: verwüsteten Gesicht, der sanfte Christustyp neben dem Dämonischen, das gleichgültige Filmkind, das sich nach Spiel und Wiese sehnt, neben der rundlichen komischen Alten, die ehrwürdige Hausfrau neben dem frühreifen Großstadtpflänzchen, dem halbwüchsigen, englisch aufgemachten Mädelchen aus dem Norden, der kleine, saubere junge Mann neben der in gepumpter Seide wogenden Talmidiva, die niemals in ihrem schon heftig betagten Leben über die Lorbeeren der Statisterie hinauskommen wird; die sentimentale Langweile stochert bedächtig in himbeerfarbenem Eis herum, die Frau mit den verruchten Augen dampft wie ein Schlot Zigaretten und trinkt einen Mokka nach dem andern. In dieses menschliche Warenlager bringt das Erscheinen des Hilfsregisseurs Bewegung und Gliederung. Viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Freilich ist die Organisation des Börsenbetriebes eine so glückliche und günstige, daß, wer an einem Tage keine Gnade vor den Augen des Gebieters über das wirtschaftliche Sein oder Nichtsein gefunden hat, in den nächsten Tagen sichere Aussicht auf Beschäftigung hat. Es entwickelt sich auf der Grundlage des Rechtes auf Arbeit ein gewisser Turnus, der jeden an die stets gefüllte Krippe herankommen läßt. Eintritt zur Filmbörse hat jeder, der mindestens dreimal gefilmt hat und darüber eine Bescheinigung und damit eine Legitimation zum Besuch der Börse hat.

Der gefilmte Todessprung
Das sind die Menschen, die in buntem Wechsel die »Leinwand bevölkern«, sie sind nicht wichtiger als die Leute hinter den Kulissen, die p.p. Operateure, die Dichter, die Dramaturgen, die sich wichtiger nehmen, als sie es sind, die Requisiteure, die Innenarchitekten, die Baumeister der lustigen Potemkinschen Dörfer, die Kunstmaler, die großartige Plakate entwerfen. Auch die ganz kleinen Leute stehen auf bedeutsamen, für den Gesamtbetrieb wesentlichen Posten. Da ist einmal der Entwickler, dessen geschultes Auge entscheiden kann, ob das Negativ gelungen ist, und der Irrtümer der Belichtung ausmerzt. Dann die Filmkleberin, die ein Stückchen Film an den anderen reiht, die Filmenden in die Maschine klemmt und als bescheidenstes, aber durchaus nicht unwichtigstes Glied in der Kette der vielen im weißen Kittel alle Großartigkeiten des Films, alle Divaträume bereits zu Zelluloid erstarrt empfängt. Dann der Vorführer, der das Filmband durch den Projektionsapparat laufen läßt und für das richtige Zeitmaß der Vorführung verantwortlich zeichnet. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, ist sein oberstes Gesetz. Er muß Gefühl für das Tempo einzelner Szenen haben, er ist gewissermaßen das musikalische Element im technischen Filmbetrieb. Mag die Kleberin noch so sorgfältig geklebt, der Vorführer noch so geschickt das Band haben laufen lassen, plötzlich reißt der Film an einer hochdramatischen oder lyrischen Stelle. Das sind Zwischenfälle, die, so peinlich sie wirken, sich nicht vermeiden lassen. Sie zeigen, wie sehr beim Film keine Fähigkeit, keine der verschiedenen Arbeiten unterschätzt werden darf. Denn hier wirkt eine Hand in die andere.

Die Manege im Glashaus
Die Flut voll Filmbeflissenen, von Sternen ersten Ranges und Pünktchen letzter Größe hält der Wille, die Energie, die, man darf das Wort mit einiger Einschränkung gebrauchen, künstlerische Einsicht des Regisseurs. Er bringt Stimmung in die Szene, er gibt den Vorgängen das Zeitmaß, er dämpft, er befeuert, er gliedert die tote, träge Masse der Komparserie, er ist es, der unkörperlich und unsichtbar im Objektiv des Anfnahmeapparats drinnen steckt und gleichsam mit der Feinnervigkeit der photographischen Linse sieht, er trichtert dem Schauspieler, der nur allzu gerne gegen die Gesetze des Films eine eigene Auffassung haben möchte, diejenige Auffassung ein, die einer geschlossenen Gesamtwirkung am förderlichsten ist: er weiß, aus der schönsten Landschaft erst etwas herauszuholen, er beseelt die Szene durch feine Effekte und Abschattungen der Beleuchtung; so hat Max Mack mit der Freilichtaufnahme von Gestalten, die gegen den Horizont gestellt sind, sehr hübsche Schattenrißwirkungen erzielt. Eine Zeitlang war die Einfuhr von nordischen Filmregisseuren eine außerordentliche; sie waren und sind teils noch die geborenen Herrscher im Reich des Objektivs, so der allseits beliebte Gunnar Tolnaes. Von den gedankenlosen Huldigungen, die von der Menge den Stars entgegengebracht wird, fällt noch reichlich viel auf den Tisch der Regisseure. Die deutschen Kinoregisseure haben es längst mit der nordischen Konkurrenz aufgenommen und Erstklassiges geleistet. Sie haben sich übrigens fast alle von einem gewissen selbstbewußten Dandytum befreit. Es geht nicht an, jedem hier einen eigenen Spruch zu widmen, einige von den Tüchtigsten aber müssen, da sie vielfach volkstümlich wurden, in einem Volksbuch über Kino genannt werden. So: Eugen Burg, Ernst Lubitsch, Alwin Neuß, Ernst Reicher, Friedrich Zelnik, William Kahn, Joe May, Richard Oswald, Max Mack, Rudolf Meinert, E. A. Dupont, Otto Rippert. In den letzten beiden Jahren hat auch eine Frau das männliche Vorrecht der Filmregie durchbrochen: die rassige, von künstlerischen Gesichtspunkten beherrschte, von Geschmack und Kultur und einen: filmtechnisch wie bühnensicher ausgeprägten Willen erfüllte Iwa Raffay (Abb. S. 17), die u. a. in Stellingen bei Hamburg die sehr reizvollen japanischen Dekorationen mit unfehlbarem Stilgefühl bauen ließ. Ihr Grundsatz ist: die Harmonie von Linie und Bewegung in die auf das Zweidimensionale beschränkte Fläche zu bringen, den Film geistig, literarisch, gedanklich zu erhöhen.
Diese Flimmerwelt, an die von allen Seiten das Interesse der Menge heranflutet, hat ihre Pole: die Filmsterne, die auf dem ohnedies so bunten und belebten Himmel über alles andere hinausleuchten. Männliche und weibliche Stars sind die Götzen des Publikums geworden; und vor den weiblichen Sternen liegen nicht nur die galanten, schwärmerischen Männer auf den Knien, sie werden mit derselben Inbrunst auch von den Frauen und Mädchen angebetet. Der Verfasser dieser Schrift war selbst Zeuge, wie bei der Vorführung eines Henny Portenfilms, der die Künstlerin persönlich anwohnte, eine einfache Frau aus dem Publikum sich vor der Loge der göttlichen Henny aufstellte und versicherte: der größte Augenblick ihres Lebens sei gekommen, sie warte, bis die Diva ihre Loge verlasse, und dann, ja dann werde sie die Hand dieser Begnadeten drücken dürfen. Kein Wunder, daß bei derselben Gelegenheit ein ziemlich hysterisches Mädchen »richtiggehend« ohnmächtig wurde aus Aufregung darüber, daß sie von Henny Porten angesprochen worden war. Woher rührt die maßlose Popularität der Filmsterne? Das Publikum vermengt unbewußt die Erlebnisse der Künstler auf der Leinwand mit ihrem Privatleben. Es will zwischen Mensch und Rolle keine Grenzen ziehen. Immer wieder zeigt sich die geliebte Künstlerin, der gefeierte Stern in neuen Bildern, an jeder Straßenecke begegnet man seinem Bild, seinem Namen, ganze Serien von Stücken sind nach ihnen genannt, Schicksale, die ohne große Anstrengung des Denkvermögens begriffen werden können, Empfindsamkeiten, die sich mit jener der Menge decken, werden unlöslich mit der Vorstellung von einer bestimmten Künstlerin, eines bestimmten Darstellers immer wieder verknüpft; schließlich sieht das Volk in ihnen eine leuchtende Verkörperung seines Gefühlslebens. Es kommt dazu, daß es sich immer mehr einbürgerte, der Erstaufführung eines Filmwerkes die Hauptdarstellerin in einer Loge beiwohnen zu lassen; irgend jemand im Zuschauerraum erkennt sie, im Zwischenakt, am Schluß wird mit Beifall, Tücherschwenken und Blumen gehuldigt, und die Diva dankt gerührt. Die letzte Schranke zwischen Sprechbühne und Lichtspielbühne ist gefallen, die persönliche Berührung zwischen Darsteller und Publikum hergestellt. Es ist nicht leicht, Kinostar zu werden, nur schwer kommt eine neue Größe auf, die glücklich im Hafen Gelandeten möchten am liebsten einen numerus clausus einführen, um keine neue Konkurrenz in den heilig geschlossenen Ring eindringen zu lassen. Und doch fällt es einer schönen Frau, die über bildhaften Reiz verfügt, leichter, sich beim Film durchzusetzen als bei der Sprechbühne. Der Starhunger der einzelnen Gesellschaften züchtete jede, man könnte sagen körperliche Begabung zum Stern hinan. Freilich, eines gehört auch hierzu: Glück. Sonst gäbe es ja lauter Sterne. Bei der Kinodarstellung ist weniger das Talent das Entscheidende als das Aussehen, die Grazie, die Unmittelbarkeit und Eindringlichkeit des Ausdrucks, die photographische Gewalt des Gesichtes. Dinge, die mehr einen Besitz als ein Talent bedeuten. Wer sich zu kleiden und auch ein wenig zu entkleiden versteht, wer Sinn für Einfühlung nicht nur in Situationen, sondern auch in Kostüme besitzt, hat ein Stück des Weges zum Erfolge zurückgelegt. Wehe aber derjenigen, die diese Worte verallgemeinern wollte! Übrigens ist das Starsystem der einzelnen Firmen in deutlich merkbarem Abbau begriffen; es herrscht bereits bei vielen Filmfabriken der Grundsatz gleichmäßiger Qualität, ohne daß der eine oder der andere Darsteller den übrigen vorangestellt würde.

Gelbsterne des Films in der Filmbörse. Zeichnung von Lutz Ehrenberger (Zu S. 55)

Alexander Moissi und Ria Jende im »Ring der drei Wünsche« (Zu S. 66 u. 69)

Ria Jende. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S. 66)

Albert Bassermann in der Hauptrolle des Filmdramas »Der Andere« von Paul Lindau (Zu S. 69)
All die weiblichen und männlichen Stars, die in deutschen Landen die Leinwand beleben, auch nur annähernd aufzuzählen und auf ihre Eigenart einzugehen, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Es mag genügen, auf einige auffällige Erscheinungen hinzuweisen. An der Spitze der deutschen Filmkunst steht unbestritten die Dänin Asta Nielsen. (Abb. S. 18 u. 19.) Sie hat den Massenerfolg des Kinos in Deutschland begründet; und jetzt, da sie wieder nach Berlin zurückkehrte, wird sie mit offenen Armen empfangen, steht sie, ungeachtet der großen glanzvollen Nummern, die inzwischen Klang und Geltung fanden, nach wie vor an erster Stelle. Ihre künstlerische Heimat ist Berlin. Nach ihrer mehrjährigen Abwesenheit, während der sie sich von ihrem Gatten, dem berühmten Regisseur Urban Gad trennte, hat sie der größte deutsche Filmkonzern, die Ufa, unter der Regie des zu großen Aufgaben wahrhaftig berufenen Ernst Lubitsch in Strindbergs »Rausch« gezeigt. Es ward Asta Nielsens persönlichster Triumph. Sie hat einen harten Weg hinter sich. Als Mädchen aus dem Volke, als unverbildetes Naturkind kam sie, die Tochter einer Waschfrau, von Not und Elend her aus der Kopenhagener Vorstadtgasse zum Theater. Denn als Verkäuferin im Bäckerladen behagte es ihrem brausenden Temperament durchaus nicht. Schon beim Theater war ihr das Wort Schall und Rauch, und die Geste alles. In einem Film »Abgründe« tauchte sie auf. Ihr Name war verschwiegen. Aber das Publikum entdeckte sie aus der Leinwand heraus, wollte wissen, wer die namenlose, schlanke, schwarze Gestalt mit dem kurzgeschnittenen Haar ist, die eine Welt in ihre Augen zu legen versteht. Ohne Reklame, entdeckt von den Leuten, die sie hinriß, so wurde Asta Nielsen. Die Duse des Kinos war geboren, die ausdrucksfähigste, beredteste Künstlerin des Lichtspiels; sie, die ganz Deutschland schlechtweg die »Asta« nennt, denn es gibt nur eine Asta und das ist sie, hat den höchsten Gipfel der Volkstümlichkeit, die äußerste Grenze dessen, was die Kunst im Film vermag, erreicht, und restlos behauptet.

Paul Wegener in »Der fremde Fürst« (Zu S. 69)
Die ganz deutsche, blonde, empfindsame Henny Porten (Abb. S. 21 u. 72), die Künstlerin mit den großen, gütig weichen Augen, die sehr viel Lauterkeit des Charakters spiegeln, die Frau mit dem ruhigen, edlen Profil, ist der vergötterte Liebling aller Schichten des Volkes, die am Kino und seinen Menschen Anteil nehmen. Daß sie zum Film kam, verdankt sie einem Zufall: Ihr Vater, der Bariton Franz Porten, hatte als Theaterdirektor die Leitung mehrerer Bühnen. In der Nähe der elterlichen Wohnung lag die Blindenanstalt. Das Leben der Blinden bot den Schwestern Henny und Rosa mancherlei Anregungen zu einem Filmroman, in dessen Mittelpunkt eine blinde Frau steht. Rosa, die Energischere, schrieb das Manuskript und bot es der Meßter-Filmgesellschaft an. Die Arbeit gefiel, aber es war niemand da, der die Rolle hätte spielen können. Rosa Porten holte rasch entschlossen ihre Schwester Henny. Die schüchterne Anfängerin gefiel, ihr Glück war gemacht. Von dem Tage an, da sie mit hinreißender Ausdruckswucht sich in dem Film »Das Liebesglück der Blinden« zum ersten Male zeigte, war ihr Erfolg, ihr Aufstieg begründet. Sie gehört noch heute der Meßter-Filmgesellschaft an, ihr Name aber gehört der Welt, denn die Porten-Films, Schauspiele und Lustspiele, zeigen einen hohen Grad künstlerischer Abgeschlossenheit. Ihre Schwester Rosa hat sich übrigens auch erfolgreich beim Film durchgesetzt.
Fern Andra (Abb. S. 22), die Weltdame, die schöne, reife, in großen Posen schwelgende Künstlerin, Sportlerin, Musikerin, ist Deutsch-Amerikanerin; sie hat auch den Blick und das Verständnis für amerikanische Reklame, der sie, auch jetzt, wo ihr Name nicht mehr geschmälert werden kann, durchaus zuneigt. Ihre Kinolaufbahn verdankt auch sie einem Zufall: Als sie in den Straßen Neuyorks als kleines Schulmädel auf Grund einer Wette sich übermütig in einem Mörteleimer an einem Wolkenkratzer hochziehen ließ, kurbelte ein Kinooperateur zufällig die Szene. Dieser Zufall hat Fern Andra, die Frau mit der Vorliebe für alle Dinge der Kultur und Kunst – neuestens betätigt sie sich auch literarisch – gemacht. – Die schöne und stets von einem mädchenhaften Liebreiz umflossene Polin Hella Moja (Abb. S. 23), in Deutschland heimisch und beliebt, wie wenige berufen, die deutsche Marke nach dem Krieg auf den Weltmarkt zu tragen, versteht es, sich im Bilde mit stilsicherer Anpassungsfähigkeit in fremde Volkscharaktere einzuleben. Die Vielseitigkeit ihres Ausdrucksvermögens, die graziöse Linie ihrer Erscheinung, das Vermögen, bestimmte Volkseigenarten abzuschatten, lassen sie für die »völkerverbindende Wirkung« des Films vorbestimmt erscheinen. Sie ist im Bilde Lyrikerin und Tragödin in einem und hat es sicher längst vergessen, daß sie mit ihrem ersten Film »Streichhölzer« abfiel. Ihr war also der Weg zum Erfolg nicht ganz so leicht wie anderen. – Dann Mia May! (Abb. S. 39.) Puppengesicht, Lockenkopf, außerordentliche Wandlungsfähigkeit des Ausdrucks: geschaffen für das große, wuchtige Filmdrama, das Probleme aufrollen will; von einem bei aller Weiblichkeit der Erscheinung fast männlichen Zuschnitt des Willens; immer an der Arbeit, Ergänzung ihres Gatten, des Regisseurs May, von Erfolg zu Erfolg steigend, der zuletzt in dem Riesenfilmwerk »Veritas vincit« (Abb. S. 35 u. 39) einen kaum zu überbietenden Höhepunkt fand. Ihre Phantasie rast durch alle Erdteile; echtes Kinotemperament mit weitem, auf Größe und künstlerisch gerundete Wirkung eingestelltem Blick. Weiter in bunter Reihe: Pola Negri (Abb. S. 40 u. 41), südliche Schönheit, Rasse, dramatischer Schmiß in jeder Geste, hatte ihren letzten großen Erfolg in dem italienischen Volksfilm »Vendetta«. (Abb. S. 41.) Käthe Haack (Abb. S. 43), auf der Bühne wie auf der Leinwand gleich zu Hause, freundlich heiter, sonnig, eine der erfreulichsten Erscheinungen in der Filmwelt; dort, wo ernste Aufgaben an sie herantreten, weiß sie sie mit starker Persönlichkeit zu zwingen, Eigenartigstes zu schaffen. Eine der Gewordenen, die doch noch einen Weg des Aufstiegs vor sich sieht.

Pariser Guillotinenszene aus der Zeit der französischen Revolution (1789) in dem künstlerisch und theatralisch vollendeten »Ufa«-Film »Madame Dubarry«. (Die Aufnahme ist bezeichnend für den großen Aufwand und die ungeheuren Menschenmassen, die für Riesendfilms in Bewegung gesetzt werden. Die Bauten wurden auf dem Tempelhofer Felde bei Berlin aufgestellt, die Spielleitung besetzte Ernst Lubitsch)

Lotte Neumann. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S. 67)
Zu den jüngsten Filmsternen allererster Ordnung gehört eine Schauspielerin, die sich in mehreren großen Gesellschaftsfilms in sehr kurzer Zeit einen Namen gemacht hat: Ria Jende (Abb. S. 61), die Künstlerin mit den traumhaft schönen Augen, die bei einer Konkurrenz sieghaft aufleuchteten. Als Partnerin Moissis, begann dieser neue Star der »Ufa« in dem Film »Der Ring der drei Wünsche«. (Abb. S. 60.) Nach Versuchen beim Lustspiel, die sie wenig befriedigten, schwenkte sie zum Drama ab, und fand bald jenen großen, internationalen Rahmen, den ihre kleine pikante Erscheinung braucht. In einem Unionfilm »Die Pantherbraut«, der in Europa und Indien spielt, wird sie ihr eigenartiges Können zeigen. – Oh, wie viele wären noch zu nennen! Erna Morena, die feinnervige, Maria Carmi, die Madonnenkühle, etwas Gezierte, die lustige Hanni Weiße (Abb. S. 9), die lyrische Hedda Vernon, die von jugendlich ungezierter Anmut beseelte Stella Harf (Abb. S. 67), die artistische Wanda Treumann, der nordisch blonde Sonnenschein Egede Nissen, Carola Toelle (Abb. S. 69), die muntere, lichte, dann die empfindsame, viel umschwärmte Lotte Neumann (Abb. S. 66), die zierliche Gilda Langer, die junge, pikante Bulgarin Mania Tzatschewa (Abb. S. 68), die aufregende Schlangentänze zeigte und gewagten Situationen mit lockender, zugreifend harmloser Natürlichkeit alles Peinliche nimmt.
Die Sprechbühne hat viele große Namen zum Film entsandt und ist im Reich des flimmernden Bildes durch einige wohlangeschriebene Gesandtschaften vertreten. Es sei nur auf einen, freilich überragenden Frauennamen verwiesen, auf Maria Orska. (Abb. S.71.) Alles, was sie auf der Bühne an geducktem, zum Sprung bereitem, ewig schillerndem Weibchentum gibt, hat sie auch in den Film hinübergetragen. Rasse, Sinnlichkeit, fast krankhafte Ausdruckskultur, glühendes Temperament, orientalische Weichlichkeit, seltsam gepaart mit slawischer Wucht der Gebärden eignet ihrem Filmspiel, wie es ihren Bühnenschöpfungen eignet. Sie sinkt nie zum Kitsch hinunter, hält immer die Grenzen der Kunst, die Gebärde literarischer Sammlung auch auf der Leinwand fest. Für die Veredlung des Films, freilich in dem nicht weit gesteckten Rahmen, der ihrer Eigenart entspricht, ist sie eine der Berufensten.

Stella Harf. Aufnahme von Becker & Maaß, Berlin (Zu S. 67)
Den Damen wurde in dieser Starübersicht der Vortritt gelassen. Dadurch kommen die Herren zu kurz und müssen es sich gefallen lassen, nur in ganz wenigen, aber bezeichnenden Erscheinungen als männliche Vertreter der Lichtbildkunst genannt zu werden. Den elegantesten Bonvivant stellt, von keiner Konkurrenz erreicht, Bruno Kastner. (Abb. S. 28.) Sein ausdrucksfähiges, scharf geschnittenes, dabei durchaus harmonisches Gesicht, die Überzeugungskraft seines Spiels und die gewinnende Liebenswürdigkeit seines gepflegten Wesens lassen kleine Backfische und reife Frauen in gleicher Weise für ihn schwärmen, aber auch den Kritiker aufrichtige Freude an diesem feinen Darsteller erleben. Vielleicht noch volkstümlicher als Bruno Kastner ist Max Landa (Abb. S. 37), der elegante, ein wenig müde Junggeselle mit der ruhigen, gelassenen Geste, der bei der Sprechbühne hohen literarischen Ehrgeiz hatte und sich im Film allerdings mit sicherem Gelingen völlig dem Detektivstück verschrieben hat. Er sieht vor dem Kurbelkasten seine Arbeit keineswegs mit der Wiedergabe erschöpft, vielmehr interessiert seinen Betätigungsdrang jede Szene, in der er auch nicht beschäftigt ist. So sind die Landafilms wirklich wie aus einem Guß; schade, daß dieser Könner fast restlos in dem an sich undankbaren und geistlosen Detektivschlagertum zu versinken droht. Ein Liebling der Filmanbeter darf, und zwar mit Recht, auch der frische, liebenswürdige und elegante Harry Liedtke genannt werden. (Abb. S. 29.) Ausdruckstark und ein vielseitiger Gestalter ist Viggo Larsen. (Abb. S. 36.)

Die bulgarische Filmschauspielerin Mania Tzatschewa Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S. 67)
Drei Sterne, in ihrer geistigen und künstlerischen Fassungskraft nicht zu messen mit dem bei allem gutem Willen doch oberflächlichen weiblichen Startum, Wegener, Moissi und Bassermann, stammen von der Sprechbühne. Sie machen nur gelegentliche Ausflüge vor das Objektiv bis auf einen, Paul Wegener (Abb. S. 64), der ein geborener Erneuerer und Beleber, eine schöpferische Kraft von einzigartiger Originalität dem Film neue Wege weist, wenn sich der Film nur eben so ohne weiteres neue Wege weisen ließe. Was er an Aufbau, lebendiger und geistvoller Durchdringung der Szene an künstlerischer Absicht und künstlerischem Vollbringen in seinen großen Films »Rübezahl«, »Der Golem«, »Student von Prag« geleistet hat, ist ein Kapitel deutscher Theatergeschichte, eine Ehrentafel an dem vierschrötigen Gebäude des Films. Alexander Moissi (Abb. S. 60), der Meister der Sprache, ist im Film seines edelsten Instrumentes, des musizierenden Organs beraubt. Er sucht es durch hohen künstlerischen Bewegungsreiz, durch nervöse und mitteilsame Sprache der Gebärde glücklich zu ersetzen. Albert Bassermann (Abb. S. 62) endlich, der Virtuose der Kleinmalerei, der Zerpflücker von Charakteren ist schon durch seine unterstreichende, analysierende Art auf einen unendlichen Reichtum der Einzelheiten verwiesen, der ihm im Film außerordentlich zustatten kommt. Alle drei sind Künstler, führende, leitende Künstler und Menschendarsteller auch im Film geblieben. Zu ihrer Ehre sei's gesagt, sie wurden als Filmdarsteller nicht populär!

Carola Toells in ihrem Ankleideraum. Sonderaufnahme für die Zeitschrift »Bühne und Film« (Zu S. 67)
*
Eine mit so ungeheurem Aufwand, mit einer so selbstverständlichen Überwindung von Hindernissen und Schwierigkeiten arbeitende Industrie, die sich immer auf Superlative einstellt, mußte natürlich bald zu einem riesenhaften Reklameapparat greifen. Und so ist beim Film alles zur Reklame geworden; einer Reklame, die schon kein Schreien mehr ist, sondern ein Überschreien des Konkurrenten. Es gibt Bezeichnungen, die der Film zu Reklamezwecken geradezu ausschließlich für sich in Anspruch genommen hat. All die tönenden Worte, die nach Riesenhaftem schmecken – Kolossalfilm, Monumentalfilm, Klassefilm – sind ausschließliches Eigentum der Kinematographie geworden. In den Fachzeitschriften der Industrie sieht es wüst aus. Es wimmelt von »noch nicht dagewesen«, von unerreicht und beispiellos, man stolpert über das Wort Schlager; dem Käufer, für den ja die Fachzeitschrift geschrieben ist, wird unablässig der Vorzug eines Filmwerks in die Ohren getrommelt, mit einer unerhörten Papierverschwendung werden Serien- und Einzelfilms angepriesen, oft ist auf einem einzigen dieser meist auf Kunstdruckpapier bedruckten Blätter bloß ein Ausrufzeichen, ein Fragezeichen zu sehen, dem auf der nächsten eine in lärmenden Farben gehaltene Zeichnung und dann erst Name und Beschreibung des angebotenen Films folgen. Es wimmelt von Zivil- und Szenenbildern der Filmstars, für die die Reklame auch in alle Welt getragen wird. Die Tagespresse hat der jungen Industrie in verschämter Nähe des Theaterteils eine eigene Spalte eröffnen müssen, in der jede Einzelheit aus dem Leben einer Diva bis zur sozialen Standeserhöhung einer meist schnell vorübergehenden Vermählung mit liebevoller Ausführlichkeit breitgetreten wird. Denn schließlich ist die Filmindustrie die beste Inserentin und verschlänge noch mehr Ankündigungsseiten, wenn das die allgemeine derzeitige Papierknappheit gestattete. Das Bild der Diva und des männlichen Filmstars leuchtet von allen Zeitungskiosken, es überschwemmt in unübersehbarer Vielseitigkeit die Schaufenster und lächelt oder weint aus hunderttausend Ansichtskarten. Wo die Filmindustrie nicht mehr für sich selbst Reklame treibt, hilft ihr das Publikum, das je nach Geschlecht die Stars anschwärmt und in allen Lebenslagen, unter dem Donner der Kanonen, unter dem Bluthauch der Revolution, im Glockenklingen des Friedens noch von den Filmhelden spricht. Auch in den Film selbst trägt die Industrie ihre Reklame. Vor Beginn des Spiels erscheint der sogenannte »Vorspann« oder die »Repräsentation«, die den Kopf des Regisseurs, das Gesicht der Diva in Großaufnahme zeigt, wichtig oder huldreich lächelnd in die Menge hineinstarrend. Auch die Diva mit ihrem Lieblingshündchen, das bisweilen natürlich auch ein Lieblingskätzchen sein kann, wird als Repräsentation gezeigt; und Innenaufnahmen aus den Wohnungen berühmter Flimmerleute füllen die Seiten illustrierter Zeitschriften solange, bis jedermann im Geiste ganz heimisch ist bei dem Helden oder der Heldin seiner Träume; die Kinodiva in der Garderobe gibt Anlaß zu Photographien, die gerne allerlei ausplaudern, die von einer ehrfürchtig staunenden Menge mit Entzücken ausgenommen werden. Die oft mit unerhörtem Geschmack und aus wundervollem Material erbauten Kinopaläste (Abb. S. 72ff.) sind im Grunde nichts anderes als Reklamekapital, das sich rasch amortisiert. Jede Straßenaufnahme ist Reklame; mancher Flug über dem Weichbild der Stadt: Kinoreklame. Und wenn aus dem Flugzeug weiße Zettel wie eine Schar aufgeregter Tauben zur Erde flattern, dann muß nicht ein politischer Agitator diese hohe Warte erklettert haben, es kann sich sehr leicht um die Einladung zum Besuch eines eben fertig gedrehten Films handeln. Vor einiger Zeit wurden sogar täuschend echte Nachahmungen von Fünfzigmarkscheinen über Berlin abgeworfen, die in dem weißen Eirund die Reklame für einen Film enthielten. Die sogenannten Filmbeschreibungen, die zunächst nur für die Käufer berechnet waren, bald aber auch in die Programme der Lichtspielbühne aufgenommen wurden und in einem barbarischen Hintertreppendeutsch die Vorgänge des Films festzuhalten sich bemühen, dienen selbstverständlich auch der Reklame, denn sie werden mit nach Hause genommen und stützen dort das Gedächtnis für das Genossene. Die wirksamste Reklame bleibt das Plakat. (Abb. S. 72 u. 80.) Wenn auch auf diesem Gebiete noch viel schreiender Unfug geschieht, so hat sich doch ein sehr ernsthafter, sehr künstlerisch betonter, von Einfällen gesegneter Plakatstil entwickelt, dem die ernsthaftesten Künstler dienen. Eine gewisse Schönheit in der Architektur dieser Bilder, ein zugreifender Rhythmus, eine eigenartige Anordnung und Einkomponierung der Schrift in den bildhaften Charakter machen das Plakat meist lebendig und ästhetisch. Ganze Straßenzüge sind mit Kinoplakaten übergossen, die Linien der Kinopaläste verschwinden unter diesen Bildern, und für ein empfängliches Auge, das den Mist vom Guten scheiden kann, wird so die Straße zur Ausstellung. Sie schwimmt in Farben und Linien und predigt: Kino, Kino, Kino!

Maria Orska. Aufnahme aus dem Atelier Eberth, Berlin (Zu S. 67)

Der Filmpalast Eines am Nollendorfplatz zu Berlin. Architekt Oskar Kaufmann in Berlin, Bildhauer Franz Metzner †. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S. 71 u. 78)
*
Ist schon das Theaterstück der Sprechbühne – vom wirtschaftlichen Standpunkt gesehen – eine Ware, deren Wert genau wie bei jedem anderen Handelsgegenstand sich nach Angebot und Nachfrage feststellt, so tritt das noch viel sinnfälliger beim Film zutage, wo tatsächlich so und soviel Meter bespielten Filmbandes in einer ganzen Reihe von Exemplaren (nämlich Kopien) in den Handel gelangen. Und wie jede andere Ware wandert auch der Film durch verschiedene Hände, ehe er an den »Verkäufer« gelangt, der das Publikum unmittelbar bedient. Wollte dieser »Verkäufer«, d. h. der Besitzer des Kinotheaters, seinen Film gleich vom Erzeuger, dem Filmfabrikanten, beziehen, so hätte er eine Riesenarbeit zu bewältigen. Denn welcher Theaterbesitzer wäre imstande, den ganzen mächtigen Filmmarkt zu übersehen, aus der Zahl der fast täglich neu entstehenden Films gerade diejenigen auszuwählen, die für ihn, d. h. für sein Publikum geeignet sind? Es ist ja klar, daß ein Luxuskino im vornehmsten Viertel der Großstadt schon ganz andere Films braucht, als etwa ein mittleres Kinotheater in einer bürgerlichen Wohngegend derselben Stadt. Um wieviel schwerer wäre es für den Theaterbesitzer in der Kleinstadt, das Richtige zu finden! Zwar gibt die Filmfachpresse einen ziemlich lückenlosen Überblick über alle entstehenden Films, allein aus den Filmzeitungen ersieht der Theaterbesitzer kaum mehr als den Titel des Films, die Namen der Hauptdarsteller und eine kurze Inhaltsangabe. Diese Anhaltspunkte genügen natürlich nicht, um die einzelnen Films auf ihren eigentlichen Gehalt hin zu beurteilen, und wollte der Theaterbesitzer sich wirklich ein klares Bild schaffen, so müßte er alle vierzehn Tage nach einer der wenigen in Frage kommenden Großstädte reisen und die Neuheiten des Filmmarktes persönlich studieren. Das ist freilich unmöglich, und so tritt hier der Zwischenhändler als notwendiger Vermittler in Funktion. Dieser Zwischenhändler ist der Filmverleiher. Da in den meisten Kinos kaum ein Film länger als acht Tage »läuft«, so wäre es sinnlos, wollte der Theaterbesitzer den Film kaufen. Auch wäre es gar nicht möglich, einen erfolgreichen Film in soviel Kopien herzustellen, wie nötig wären, um alle Städte damit zu versorgen. Aus dem natürlichen Bedürfnis heraus hat sich daher seit Jahren ein Verleihgeschäft entwickelt, bei dem der Filmverleiher der eigentliche Käufer ist, der den Film von dem Fabrikanten erwirbt. Die Haupttätigkeit des Filmverleihers besteht nun tatsächlich darin, ständig zwischen dem Wohnsitz des Erzeugers und dem seiner Kunden, der Theaterbesitzer, unterwegs zu sein. Eine jede Filmfabrik hat in ihren Bureaus auch einen Vorführungsraum, der es gestattet, dem nach frischer »Ware« Ausschau haltenden Verleiher jederzeit den neuesten Schlager vorzuführen, lange bevor der Film in der Öffentlichkeit erscheint. Der Verleiher seinerseits kennt die besonderen Bedürfnisse seiner einzelnen Kunden ganz genau. Er weiß, daß der »Zentral-Kino« in X-Hausen eine Vorliebe für kurze Lustspiele hat, während das »Olympia-Theater« in Y-Stadt gern langatmige Dramen mit möglichst viel Leichen erwirbt. Und so ist der Verleiher in der Lage, jedem einzelnen von ihm bedienten Theater genau das anzubieten, was das Publikum dieses Theaters liebt. Der Verleiher arbeitet meistens nach Bezirken, d. h. er hat die Kinotheater der größeren und kleineren Städte einer bestimmten Gegend als Kunden.
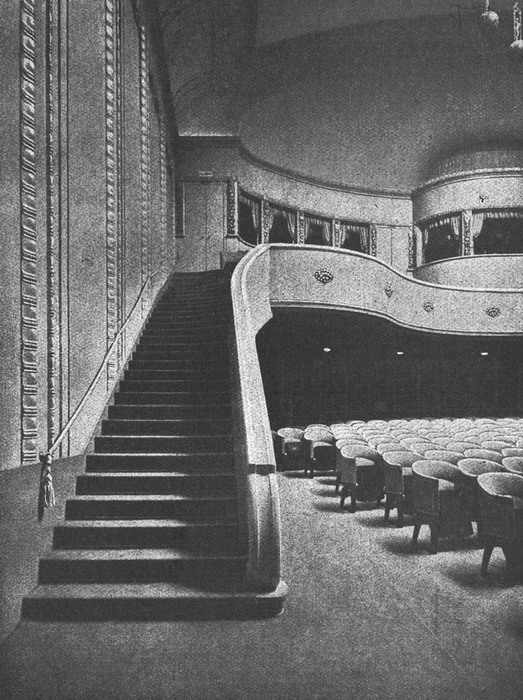
Der Zuschauerraum des Filmpalastes Cines am Nollendorfplatz zu Berlin (zu S. 71 u. 78). Aus »Schliepmann, Lichtspieltheater« (Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin)

Wandelraum in den Union-Palast-Lichtspielen am Kurfürstendamm zu Berlin Architekten Nentwich & Simon in Berlin. (Zu S. 71 u. 78.) Aus »Schliepmann, Lichtspieltheater« (Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin)

Lucy Kieselhausen. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S. 77)
Jedenfalls ist der »Verleiher« im ganzen Filmhandel eine der gewichtigsten Persönlichkeiten, die selbst von den größten und stolzesten Fabriken »wie ein rohes Ei« behandelt wird. Ja, selbst die berühmte Filmdiva wird nicht verfehlen, einen größeren Verleiher bei zufälliger Begegnung durch eine besonders liebenswürdige Begrüßung auszuzeichnen.
*
Mode und Gesellschaft können vom Film nicht unbeeinflußt bleiben. Das kleine Mädel, das mit hochklopfendem Herzen zum erstenmal bestellt wird, um in der Komparserie mitzuwirken, nimmt die Sorge um das »Gesellschaftskleid« mit. Denn ein Gesellschaftskleid muß sie haben, das hat ihr der Hilfsregisseur auf die Seele gebunden. Von dieser ersten Verzweiflung der Anfängerin, die sich einen Ersatz ihres Alltagsfähnchens irgendwo auspumpt oder bei einer berühmten Kollegin »stets dankbar hochachtungsvoll ergebenst« leiht oder kauft, um es niemals zurückzugeben oder zu bezahlen, bis zum Wutausbruch der Diva, die sich mit der Schneiderin bis aufs Messer rauft, weil die Toilette, die berufen ist, Stadtgespräch zu werden, nicht rechtzeitig fertig ist, gehen die Kleidungssorgen der Filmmenschen immer und immer wieder im Zickzack um die Modenfrage herum. Der Mann, der sonst weiter kein Talent hat, als daß er für das Gutangezogensein geboren ist, er, der zum »lebenden Frack« wurde, hat genau so diese Schneidersorgen wie die Diva mit den unbegrenzten Toilettegeheimnissen. Manche feine Schneiderwerkstatt lebt davon, daß sie die führenden Filmkünstlerinnen bekleidet, denn der Ruf der Firma wird gehoben, wenn sie in einem Atem mit dem Filmgeschäft genannt wird. Von der Toilette der Kinodiva beim Rennen spricht man, von den Kleidern, die sie bei den Filmbällen trägt, will man den Hersteller wissen. Wo die Mode ein Wort zu reden hat, dort ist das gesellschaftliche Interesse um so stärker betont. Film und Gesellschaft haben mannigfaltige Berührungspunkte gewonnen. Man nimmt die Filmwelt in der großen Welt bereits ebenso ernst wie das Theater; und es liegt im Wesen des Films, daß seine Menschen, wo sie, sei es auf Bällen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Schönheitskonkurrenzen selbständig auftreten, sei es sich in die übrige Gesellschaft als neue und von einem besonderen Interesse umschwärmte Gäste einfügen, sich ein wenig lärmend, ein klein bißchen zu großartig, etwas zu selbstbewußt und mit den winzigen Resten der Unarten einer emporgekommenen Kaste geben.
Film und Presse haben eine Zweckgemeinschaft geschlossen. Vor noch gar nicht langer Zeit tat die Tagespresse die Erzeugnisse der Filmliteratur mit wenigen Zeilen ab, als eine durch die Benutzung des Inseratenteiles erwachsene Verpflichtung. Es galt als selbstverständlich, daß man eine Ware, die inseriert wird, nicht schmähen darf. Es entwickeln sich aber immer mehr Ansätze für eine ernsthafte Filmkritik in der Tagespresse, binnen kurzer Zeit hatten sich die Filmberichterstatter der Blätter eingeschrieben und den Aufstieg zu stilistisch gewandten, alle technischen und literarischen Werte eines Films gewissenhaft prüfenden, Kritikern gemacht. Ihr Ehrgeiz ist es, mit den Theaterkritikern auf gleicher Stufe zu stehen. Die Filmindustrie tut alles, um mit der Tagespresse Berührung zu halten. Es werden bald in den Kinotheatern, bald in den meist vornehm aufgemachten Vorführungsräumen der Gesellschaften – oft in Verbindung mit einem Tee – eigene Presseveranstaltungen gegeben. Einige Regisseure verfallen auch auf die Idee, die Presse zu besonders interessanten Aufnahmen zu laden. Der Besonderheit halber sei erwähnt, daß kürzlich ein Regisseur Pressevertreter zu einer Luftfahrt im Passagier-Zeppelin bat, in dem ein paar ziemlich halsbrecherische Aufnahmen gemacht wurden.
So wie von der Sprechbühne Brücken zum Film geschlagen wurden, so hat sich auch das Varieté immer wieder an den Film herangedrängt. Es ist der Ehrgeiz vieler Kräfte der Buntbühne, ihre Nummern auf der Leinwand zu zeigen, und gelegentlich wird diese Bereicherung des bildmäßigen Eindruckes von der Fabrikation nicht undankbar angenommen. Auch die Tanzkunst behauptet ihren Platz im Kinoprogramm. Die kultivierte Bewegung, die rhythmische Geschlossenheit der tänzerischen Pose ist vorbestimmt, im Filmbilde zu erscheinen, an dem Reichtum des Ausdrucks mitzuwirken. Eine gewisse Anpassung an die besonderen Erfordernisse des Kurbelkastens wird der künstlerisch empfindsamen Tänzerin nicht schwer fallen. So hat sich der Film bereits die persönlichsten tänzerischen Erscheinungen der Gegenwart verschrieben. Die feinsinnigste, von der natürlichsten Anmut beseelte und für das Lichtspiel hervorragend geeignete Wienerin Lucy Kieselhausen (Abb. S. 75) wird in den Films der nächsten Zeit als Darstellerin und auch als Tänzerin die holdselige Frische, den gedanklich und seelisch erfüllten Reichtum ihrer begnadeten Kunst in den Dienst des Filmbildes stellen. Auch die geschmeidige Anita Berber (Abb. S. 77), die rassige Rita Sacchetto dienen dem Film. Woher immer das Kino Anregung und Belebung erfährt, muß diese Erstreckung der Grenzen freudig begrüßt werden; vom Tanze kommt neuer Rhythmus, kommt neues Leben, neue Schönheit in das flackernde Bild.

Die Tänzerin Anita Berber. Aufnahme von A. Binder, Berlin (Zu S. 77)
Es ist kein Dörflein so klein – ein Kintopp muß drinnen sein! In der wackeligsten Scheune, im Wirtshaus des kleinsten Fleckens hat sich das Kino heimisch zu machen verstanden, es überschwemmt die Vororte der großen Städte und nützt die stickigen, dunklen Grüfte der freud- und lichtlosen Mietkasernen für seine Zwecke. In andächtigem Staunen füllt die Menge diese Kintöppe vierten Ranges und folgt hingerissen dem, was der reichlich »abgespielte«, durch vielfachen Gebrauch bereits recht unscharf gewordene Film da draußen zu erzählen hat. Stullenpapier knistert in die lyrischen Szenen hinein, die Liebesdinge auf der Leinwand finden ein beherztes Echo in den eng aneinander geschmiegten Paaren (Abb. S. 79), aufgewühlte Phantasien träumen von großen Aufgaben, Helden und Verbrecher werden für Augenblicke geboren, um dann im nüchterneren Lichte des Alltags die heroischen Masken wieder fallen zu lassen und das Kinoheldentum den berufenen Gauklern zu überlassen. Im Dorf, in der Vorstadt feiert die Menge Andachtsstunde, wenn sie die zappelnden Lügen einsaugt, einatmet wie Sauerstoff in verbrauchter Werktagsluft. Der Kintopp – weiß Gott, wer diesen Namen in sinngemäßer Verquickung der Begriffe Kino und Topp – Getränkemaß – zuerst ersonnen hat, – das »Vitaskop« oder »Bioskop«-Theater (ein bißchen Fremdtümelei macht sich ja großartig) verzaubert die Züge der Zuschauer; jede Regung ihres Gesichtes spiegelt die Vorgänge auf der weißen Fläche wieder. Vom Vorstadtkino zum vornehmen Lichtspielpalast des Stadtinneren, zum Festspielhaus der vornehmen Welt führt ein weiter Weg. Aber die Anhänglichkeit der Menge ist da und dort die gleiche. In den breiten, die Gestalt des Zuschauers wie ein Gebäude umfangenden Sesseln der mit erlesenem Geschmack ausgestatteten Kinopaläste – mit zu den schönsten und künstlerisch vollkommensten gehören die Theater der Ufa in Berlin (Abb. S. 72 ff.) – schlägt das Herz ebenso begeistert, ist der Geist ebenso aufnahmefähig wie draußen, wo die Stadt zum Dorfe wird und der Palast Kintopp heißt.
*
Diese Schrift sollte keine Standrede für oder gegen den Film werden. Sie hatte die Absicht, anzudeuten, wie tief in das Volksbewußtsein, in den Volksbesitz die Kinematographie eingedrungen ist; wie weite Kreise sie erfaßt hat, wie vielen Schichten sie Arbeit gibt, Anregungen bietet; sie sollte objektiv aufzeigen, welche Werte vom Film geschaffen, welche zerstört werden. Der Film als volkspsychologisches Problem; als ein Massenhypnotiseur ersten Ranges; als ein Gaukler, der sich in die Phantasie des Volkes einzuschleichen verstand, ihm seine billigsten Sensationsbedürfnisse ablauschte, in Bilder und Geschehnisse umsetzte, die dem Volksempfinden in breitester Form entgegenkommen, sich täuschend volkstümlich geben und doch im tiefsten Wesen volksfremd sind. So ist der Film ein Feind, ein Taschenspieler, der die Menge beschwatzt, der ihr Ersatz für Echtes einredet und sie nicht merken läßt, daß sie belogen wurde. Volkstümlich ist niemals die Kopie des Volkes; erst ein beseelter Realismus ist innig mit der Psyche des Volkes verwachsen. Dort, wo aus der Empfindungssphäre des Volkes nur gesteigerte, aber keine vertieften Stimmungen losgelöst werden, ist nur Täuschung möglich; nicht aber Spiegel und Abbild. Daraus ergibt sich der scheinbar widersinnige Schluß, daß eine Erscheinung, die so ungeheuer volkstümlich wurde wie der Film, im Grunde volksfremd ist. Eine durch mancherlei Entgegenkommen geförderte Massenpsychose hat das Feld für den Film gedüngt, und die große Menge geht mit den flatternden Fahnen eines brennenden Interesses auf einem Wege der Begeisterung und Hingebung, der ihm fremd ist. Volkstümlich ist Kunst. Auch eine harte, lehrhafte, rücksichtslose Kunst, gegen die sich Trägheit, Beharrungsvermögen, Konservativismus stemmen. Irgendwie findet auch die unbedingteste Kunst in das Herz des Volkes. Alles Volksechte will erobert werden, es verschließt sich keusch, überrumpelt nie. Es hat Zeit. Der Film aber hat sich dem Volke an den Hals geworfen: nimm mich, hier bin ich! Die Grenzen der Kunst sind dem Film eng gesteckt. Wo wirklich ein künstlerischer Wille revoltierend die Entwicklungslinie des Lichtspiels durchbricht, dort wendet er sich an wenige. Er schafft: » l'art pour l'art«. Die dramatische Kunst hat vom Film nichts mehr zu befürchten. Er ist ihr nicht mehr Konkurrenz. Die Kinotheater sind heute bereits eine ziemlich kostspielige Angelegenheit, so daß eine Abwanderung des Theaterpublikums nach dem Lichtspielhaus nicht mehr sonderlich zu befürchten ist wie einst, da man für eine Bagatelle den besten Kinoplatz kaufen konnte.

»Das Auge sieht den Himmel offen,
Es schwelgt das Herz in Seligkeit – –«.
Im Vorstadtkino. Aufnahme von Mac-Walten, Berlin (Zu S. 78)
Der Filmregisseur Max Mack, der über das Problematische des Films viel nachgedacht hat, sagte einmal: »Das Publikum sucht im Film nun einmal nicht den naturalistischen Alltag, sondern immer eine gewisse Feststimmung.« Der Satz ist gut gemeint, und klug gedacht. Aber ich glaube, das Publikum sucht nicht die Feststimmung, es sucht die Maskerade. Es ist, auch in Feststimmung, nicht so wie im Film. Nur in Maskenlaune, in einem seichten Rausch ist es so, wie es, tatsächlich, durch Erziehung gewöhnt und kaum mehr davon zu entwöhnen, die Stimmung auf der Leinwand wünscht. Es ist in die Filmlüge verstrickt, ist mit volkstümlicher Kraft in eine volksfremde Welt verliebt.
Der Film als wissenschaftlicher Faktor ist ein ernsthaftes, über jede Kritik erhabenes Ding; der Unterhaltungsfilm eben eine Sache des Unterhaltungsbedürfnisses; der seltene wahre Kunstfilm, volksmäßig gesprochen, ein noli me tangere.
Aber die Posaune, die große Töne in das Surren der Apparate hineingeheimnist, die von Kunst, von Kultur, von Volkserziehung zu trompeten versteht, die möge schweigen. Schließlich ist der Film eine industrielle, eine kaufmännische Angelegenheit, eine wirtschaftliche. Vielleicht hat das Lichtspiel auch Entwicklungsmöglichkeiten nach der edelsten Seite. Werke wie die gewaltige Filmdichtung »Madame Dubarry«, von Ernst Lubitsch mit hinreißender Größe inszeniert, Begebenheitskunst im vornehmsten Sinne, klar durchdacht, geschmackvoll, schön im Aufriß und im Bilde weisen einen solchen neuen Weg. Vielleicht wird das Volk auch auf diesem neuen Wege dem Kino treu bleiben; dann erst wird man von dem Lichtspiel sagen können: Es ward Licht!

Ein bezeichnendes Kinoplakat der Hella Moja-Filmgesellschaft (Zu S. 71)
Druck von Velhagen & Klasing in Bielefeld