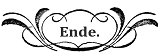|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
» Jetzt kann es los gehen,« dachte der Maler Julius Decaro und öffnete weit seine Türen. Er hatte endlich ein Bild, der »Morgen« betitelt, vorteilhaft verkauft und sich mit den vielen für das Bild gelösten Goldstücken ein schönes Atelier, ein menschenwürdiges Dasein geschaffen. Nun mußten die Aufträge aus den ersten Kreisen der Gesellschaft, mußte der Ruhm bei ihm Einkehr halten. Doch vorerst kamen nur die alten Freunde, welche sich wirklich recht alt und grau ausnahmen in den neuen Räumen – dann allmählich erst neue Freunde – die ersten Masken.
Doch die »erste Gesellschaft« ließ noch auf sich warten.
Er machte sich also auf die Suche mit dem festen Entschlusse, nur mit der edelsten Beute heimzukehren. Alle Türen öffneten sich ihm, viel schöne Augenpaare winkten ihm verheißungsvoll zu, die Fülle der Wahl machte ihn immer wählerischer, und noch war ihm sein Ideal nicht begegnet.
Im ersten Stock seines Hauses wohnte eine Beamtenfamilie in bescheidenen Verhältnissen. Die Frau Rätin Martius war eine große Kunstfreundin und zog Julius mit dem Aufgebot all ihrer Liebenswürdigkeit in ihr Haus. Was sollte er dort bei den trockenen Bureaukraten? Die Schmeicheleien der Rätin konnten ihn doch nicht über die verlorenen Abende hinwegtrösten, und das schöne Röschen, von dem die Mutter ihm vorschwärmte, nützte nichts, es war noch ein Kind, in einer auswärtigen Erziehungsanstalt und, abgesehen davon, wahrscheinlich ebenso spießbürgerlich und unbedeutend wie die Eltern.
Ostern solle Röschen nachhause zurückkehren, je näher die Zeit kam, desto häufiger und begeisterter erzählte die Mutter davon.
»Da werden Sie staunen, Herr Decaro, etwas ganz Apartes – ein Gesichtchen, ein Figürchen! O, Sie müssen sie malen, ja, Sie werden glücklich sein, sie malen zu dürfen; wenn sie nur nicht gar so furchtsam, so schüchtern, so verschlossen wäre. Sie nennen sie immer das ›Schüchterchen‹ im Pensionat – nun, das wird sich schon verlieren, wenn sie einmal in die Welt kommt.«
Der ständige Hinweis auf Röschen hatte Decaro zuletzt unwillkürlich neugierig gemacht, er glaubte eine Absicht darin zu sehen, über die er lachen mußte – ein Backfisch! Das war gerade das, was er suchte, und jetzt noch die Aufschlüsse dazu; ein Figürchen – ein Schüchterchen! Die Abende bei Rats mußten ein Ende nehmen, lieber floh er in ein anderes Haus, wenn er es nicht übers Herz brachte, ungezogen zu sein.
Da, kurz vor Ostern, bemächtigte sich eine große Aufregung der künstlerischen Welt; Fräulein Warwara Onegin, die neue tragische Liebhaberin der Hofbühne, eine slavische Schönheit, mit allen unwiderstehlichen Reizen ihrer Rasse ausgerüstet, tauchte auf. Das war, was Decaro suchte. Seine stürmische Hast, mit der er sich an die umworbene Komödiantin drängte, blieb nicht ohne Eindruck. Die Warwara wurde aufmerksam, bevorzugte ihn, versprach ihm vor allen seinen Kollegen die erste Sitzung zu einem Porträt. Das war ein Erfolg von der größten Tragweite; das Bild, wenn es ihm gelang – und es mußte ja gelingen, wenn die Leidenschaft den Pinsel führte – würde ihn mit einem Schlage zum populärsten Künstler machen. Er war nicht mehr fähig, ruhig zu arbeiten, machte unzählige Farbenskizzen, Entwürfe, immer die schöne Warwara. Im Pelz, im Purpur, en face, im Profil, ganze Figur, Büste, er studierte sie in ihren Rollen, im Salon, auf der Straße, wenn er ihr den Weg abpaßte.
Endlich kam der Tag, an dem die Künstlerin ihr Erscheinen zur ersten Sitzung meldete. Das Atelier war sorgfältig aufgeräumt, die Leinwand stand bereit, Julius sah schon eine Stunde zuvor mit ängstlicher Spannung zum Fenster hinaus; vor einem Jahre noch ungekannt, mißachtet, an sich selbst verzweifelnd, von Nahrungssorgen gepeinigt, in einem Hinterhausatelier der Vorstadt, und heute blickte er aus diesem üppigen Nest hinab auf die vornehmste Straße und erwartete den strahlenden Stern der Hauptstadt, um den sich die Größen drãngten.
Da hielt ein Wagen vor dem Hause, ein Mietfuhrwerk. Ein alter, umfangreicher Lederkoffer war auf den Bock gezwängt. Die Frau Rätin stieg aus, dann kam ein unförmlicher schwarzer Hut mit flatternden hellblauen Bändern zum Vorschein, ein zierliches Persönchen in braunem Kleide und schwarzer Mantille um die schmalen Schultern sprang aus dem Wagen; ein drolliger alter Zug lag über der in Bewegung und Form kindlichen Erscheinung. – Schüchterchen – kein Zweifel.
Julius mußte lachen. Hatte sie es gehört oder war es Zufall? – das Mädchen blickte herauf. – Die Frau Rätin hatte nicht zu viel erzählt, das Gesichtchen unter dem großen Hut war reizend. Ein zarter, mädchenhafter Duft lag darüber. Die großen blauen Augen waren echte Kinderaugen.
Das Mädchen schlug sie errötend nieder und zog den häßlichen Hut noch tiefer ins Gesicht. Die Rätin winkte glückstrahlend herauf. Julius vergaß die Erwiderung. Er sah nur die kleinen Elfenhände nach dem unförmlichen Koffer greifen und ärgerte sich, daß der vierschrötige Kutscher keine Miene machte, der Kleinen zu helfen.
»Rühren sie sich doch, Mensch!« schrie er zornentbrannt hinunter.
Der Kutscher erhob sich erschrocken. Schüchterchen blickte wieder herauf und eilte in arger Verlegenheit ins Haus.
Julius übersah darüber den eleganten Broom, der eben neben der Mietskutsche hielt; erst als der Schlag sich öffnete und ihm eine große, in kostbaren Pelz gehüllte Dame entstieg, wurde er aufmerksam. Unglaublich, er hatte über diesem Kinde mit den blauen Augen Warwara vergessen.
Mit nervöser Hast eilte er im Atelier umher, hier etwas anders legend, dort einen Teppich zurechtzupfend. Rascher, als er es für möglich gehalten, trat die Dame ein. Ein stolzer Anblick, dieses blühende Weib im Pelz!
Warwara Onegin freute sich über den Eindruck, den sie auf den Künstler machte.
»Ich denke, in Pelz wird es sich am besten machen,« sagte sie, rasch vor einen großen Spiegel tretend und eine geeignete Pose suchend. »Warum kleidet uns eigentlich Pelz so gut, die Haut eines wilden Tieres, uns das höchste Geschöpf, das Ebenbild Gottes, das sich so erhaben fühlt über jenes? Als Maler müssen Sie das doch wissen.«
»Ich denke das Weiche, Geschmeidige, jeder Form Schmeichelnde, dann die Fülle der Farben,« erwiderte Julius.
»Meinen sie nicht eben das Wilde, das leidenschaftlich Grausame, Naturkräftige –?«
»Katzenartige vielleicht,« ergänzte er lachend.
»Warum nicht, ein Löwe ist auch eine Katze: wir vergessen über seiner Pracht, seiner Majestät die niedrige Verwandtschaft über seinem Mut und seiner Kraft seine Falschheit und nennen ihn den König der Tiere. Ob es nicht die Elektrizität des Pelzes ist, die uns so prickelt? Geheime Wahlverwandtschaft?«
Sie schlug mit einer wohligen Bewegung den Pelz zusammen, dann nahm sie das Barett ab und steckte mit den spitzen langen Fingern die rötlich schimmernde Haarflut zurecht.
»So, jetzt – vielleicht so?«
Sie warf sich auf den persischen Diwan, das Haupt leicht zurückgebeugt, auf den Arm gestützt.
Julius antwortete nicht, er sah nur. Das war seine Vision, in tausend heißen Künstlerträumen vorgeahnt, das göttliche Weib mit dem rötlichen Haar. Der feuchte Blick aus den mandelförmigen Augen unter den halbgeschlossenen Lidern hervor entfachte die Glut in seinem Innern.
»Bleiben Sie so, verrücken Sie keine Linie,« flüsterte er, von einem plötzlichen begeisterten Schaffensdrang gepackt, rückte seine Staffelei zurecht, zog den grünen Vorhang zurück, daß volles Licht sie überströmte.
»Das geht ja wie beim Photographen. Jetzt aber freundlich« sagte sie lachend, ihre weißen Zähne zeigend. »Und sprechen darf man gar nicht, und es wäre so gemütlich hier zum Plaudern.«
»Gewiß, plaudern Sie ungeniert, ich bitte Sie sogar sehr darum. Das belebt die Züge, erhält ihren Charakter: das gewaltsame Schweigen fälscht sie uns, macht sie fremdartig.«
»Ja, was soll ich denn gleich – was Sie anregt, doch –«
»Eine Warwara Onegin ist doch darum nicht verlegen,« erwiderte Julius, die Zeichnung mit der Kohle beginnend.
»Komödiantengeschichten, meinen Sie? Daß diese lächerliche Welt doch ihren Reiz nie verliert für die Männer, auch nicht für die geschmackvollsten. Ah! mich ekelt diese geschminkte Leidenschaft, hinter welcher die Langeweile grinst, diese weiblichen Männer und männlichen Weiber. Meinen Sie nicht, daß dieser Anziehungskraft eine gewisse Degeneration zugrunde liegt? Dieses Verlassen der weiblichen Sphäre reizt den Mann, weil er vollblütige Weiblichkeit nicht mehr würdigen kann, wie der weibische Tenor die nervöse Weltdame, welche vor der wahren Männlichkeit entsetzt entflieht. O, dieses Halbmanntum, das uns Gefeierte umgibt, wie es mir verhaßt ist!«
Sie machte eine zornige Bewegung mit dem Arme. »Ah, so, verzeihen Sie, aber das ist meine schwache Seite, und es tut mir so wohl, mich einmal aussprechen zu können – ich kann mich doch aussprechen?«
»Nur zu, nur zu! Je mehr Sie sich erregen, um so schöner werden Sie,« erwiderte Julius, ohne sich einen kostbaren Augenblick entgehen zu lassen. Schon war die kühne Form des Hauptes mit schwarzen, wirren Linien angedeutet.
»Nur bitte ich Sie, mich nicht auch unter dieses Halbmanntum zu rechnen. Was mich an Ihnen begeistert, ist gerade das Vollblutweib, das ich in Ihnen zu sehen glaube, das ich mit den Augen des Malers sehe, der jede Hülle durchdringt, dem die Schminke nichts verdeckt, und wären Sie ein zerlumptes Zigeunermädchen im Chausseegraben, ich würde Sie gerade so sehen.«
»Alterieren Sie sich nicht, lieber Meister,« entgegnete sie mit verführerischem Lächeln; »daß ich da bin, ist der deutlichste Beweis, daß ich Sie nicht dazu rechne. Ich werde doch einen Verhaßten nicht eigens aufsuchen! Wegen des Bildes? Ah bah, was liegt mir an dem Bild!«
Sie sprang zum Entsetzen Decaros auf. »Ich verstehe ja gar nichts davon. Ich kam zu Ihnen aus Langeweile, aus Verdruß, aus Ekel an der ganzen Welt, aus was Sie wollen, nur nicht aus Begeisterung für – Ihre Kunst, das ist schmerzlich für Sie, aber wahr.«
»Fräulein Warwara, Sie werden mir doch die Sitzung nicht verweigern, ich beschwöre Sie!« flehte Julius.
»Ah, denke ja gar nicht daran, so lange Sie wollen: ich möchte nur Klarheit zwischen uns. Wenn man immer Komödie spielt, werden Sie begreifen, daß einmal ein unwiderstehlicher Drang einen packen kann nach Wahrheit, wie ein Geier. Er packte mich eben, als ich Sie so eifrig arbeiten sah. Jetzt bin ich wieder bereit, und will stillhalten wie eine Statue.«
Sie nahm wieder ihre Pose.
»Ich habe Sie gekränkt, das tut mir leid, aber daran können Sie wieder sehen, wie ungerecht ein Mann ist. Machten Sie mir meiner Kunst zu liebe den Hof, Herr Decaro – weil ich die Eboli ganz erträglich spiele? Lächerlich! Weil Sie mit ihrem Künstlerauge ein Vollblutweib in mir entdeckt haben, wie Sie eben sagten, nur deshalb. Nun ich mache es gerade so.«
Julius errötete tief, trotz seiner geschmeichelten Eigenliebe war ihm die Offenheit doch zu stark, ein unangenehmes Gefühl beschlich ihn. Er antwortete nicht und schien sich noch mehr in seine Arbeit zu vertiefen.
Warwara las in seinem Innern.
»Die Dosis war etwas stark, nicht wahr?« fuhr sie fort. »Sie sind einmal gewohnt, von unsereinem langsam, systematisch verführt zu werden und mit raffinierter Begehrlichkeit eine Station nach der anderen durchzumachen. Das ist ein Katzenspiel; ich bin lieber eine Löwin. Ein Sprung – gelungen oder nicht gelungen!«
Sie schnellte wirklich empor, ihr Auge leuchtete, die gelblichen Hände gruben sich in den bläulichen Flaum des Pelzes.
»Nicht gelungen! Jetzt bin ich ganz zahm, beruhigen Sie sich. Nur einen Augenblick Pause und eine Zigarette, dann stehe ich wieder zur Verfügung.«
Es war nicht bloß Scherz, ausgelassene Laune, wie Julius im ersten Augenblick vermutete; ein leiser Verdruß zitterte durch ihre Züge, und es lag eine Energie in ihrer Bewegung, als sie die Zigarette entzündete.
Jetzt war sie berückend schön und er ein rechter Narr, nicht zuzugreifen. Warum nicht? Was hielt ihn denn ab? War er sonst so zimperlich? Sie war eine Künstlerin, hatte freiere Ansichten-. Warum ergriff er nicht diese feuchtglänzende Hand und bedeckte sie mit heißen Küssen? Sie würde es gewiß dulden. Sonderbar, es war ihm, als dränge sich der große schwarze Hut zwischen ihn und sie, und darunter blickten zwei große blaue Augen auf ihn. Ganz blöde stand er da, verlegen wie ein Schulknabe, auf der Leinwand herumkratzend. Eine falsche Scham ergriff ihn plötzlich, er legte Palette und Pinsel weg.
»Verzeihen Sie einem Künstler, wenn er etwas verwirrt ist. Schon Sie malen zu dürfen, ist ja für mich ein so unerwartetes Glück, nie durfte ich auf ein persönliches Interesse –« Er küßte galant ihre Hand.
»Sie sind wirklich naiv,« erwiderte sie lachend, »Damen haben Sie noch nicht viele gemalt, das merkt man. Sie haben wenigstens den Vorteil, gleich in eine gute Schule zu kommen. Doch lassen wir das. Weil wir gerade von naiv reden, Sie haben ja die verkörperte Naivität im Hause, eben begegnete ich ihr auf der Treppe. Ein Institutsfräulein wohl? Ich sah noch nie ein so reizendes Gesichtchen – ist Ihnen das auch entgangen? Aber, lieber Meister –«
»Die Dame ist eben aus der Pension angekommen; ich sah sie zum erstenmal vom Fenster aus – ganz flüchtig,« erwiderte Julius, dabei zu seinem Ärger wie ein Kind errötend.
»Das wäre ein Pendant zu meinem Bilde. Was sagen Sie dazu? Naivität und Raffinement? Man liebt ja solche Allegorien.«
»Neben Warwara Onegin dieses Backfischchen? Das wäre eine Geschmacklosigkeit. Übrigens, ich werde sie wirklich malen; die Mutter will es, sie ist furchtbar eitel auf ihr Kind, auf ihr ›Schüchterchen‹. Das ist nämlich ihr Spitzname, weil sie unglaublich schüchtern, unbeholfen sein soll.«
»Gerade das kommt ihr wohl zu statten, kleidet sie so gut. O, man glaubt nicht, wie rasch wir darauf kommen,« meinte die Schauspielerin.
»Nein, das kann ich Ihnen versichern, an diesem Kinde ist alles echt, keine Spur von Berechnung, die lauterste Natur,« entgegnete etwas ärgerlich Julius.
»Dem widerspreche ich durchaus nicht, aber eben die lauterste Natur läßt uns instinktiv zu den für uns passendsten Waffen greifen. Nehmen Sie sich in acht vor dieser lautersten Natur! Im Frühling ist sie ja entzückend, aber dann kommt ein dürrer Sommer, ein naßkalter Herbst und sehr rasch der Winter. Sie sind zwar als Deutscher an dieses Klima gewöhnt, immer bleibt aber die Sehnsucht nach dem Süden mit seiner Farbenglut, seinen Palmen und ewig blühenden Hainen –«
»Und Schlangen,« fügte Julius sarkastisch bei.
»Ganz richtig, und Schlangen. Oder glauben Sie nicht, daß man sich auch nach diesem Ungeziefer sehnen kann? Nach ihrem Zauberblick, von dem gebannt, trunken, die armen Vöglein von den Zweigen sinken? Na, was sehen Sie mich denn so starr an, als ob ich eine solche Schlange wäre? O, nein, haben Sie keine Angst, mein Zauber wirkt nur von der Bühne herab, beim Lampenlicht.«
»Er wirkt überall,« entgegnete er leidenschaftlich, »aber tausendfach in dieser Stunde, wo ich mich ganz in ihn versenken muß, um ihn wiederzugeben, aber ich darf ja nicht trunken werden wie jene glücklichen Vögel, ich muß ja arbeiten, ich will arbeiten wie noch nie, will ein Meisterwerk schaffen. Darum haben Sie Mitleid, setzen Sie sich und sprechen Sie kein Wort.«
»Ah bah, bilden Sie sich nur nichts ein; Sie sind ja so furchtbar vernünftig. Also gut, für eine Viertelstunde garantiere ich, länger aber nicht.«
Sie nahm wieder ihren Platz und betrachtete die Bilder und Skizzen an den Wänden. Lautlose Stille herrschte, nur die Kohle rauschte auf der glatt gespannten Leinwand.
Da klopfte es vorsichtig. Warwara wollte sich erheben, der Maler winkte ihr, sitzen zu bleiben, und gleich darauf zwängte sich ein Frauenkopf zur Tür herein.
»Stören wir, Herr Decaro? Dann gehe ich gleich wieder, nur einen Augenblick.«
»Bitte, nur herein, gnädige Frau, Sie stören durchaus nicht,« beruhigte Warwara die Eintretende, zum hellen Ärger des Malers, der zornig die Kohle zerbröckelte.
»So komm doch, sei doch nicht so ungeschickt, es geschieht dir ja nichts.«
Es war die Frau Rätin Martius, welche diese Worte auf den Flur hinaus sprach.
»Aber siehst du denn nicht, daß wir stören, wenn Besuch da ist?« ließ sich eine weibliche Stimme vernehmen.
»O, diese Klöster, gnädige Frau, diese Klöster! Es ist etwas Entsetzliches.«
»Fräulein Warwara Onegin – Frau Rätin Martius,« stellte Julius die Damen vor.
»Nicht wahr, mein liebes Fräulein, wir stören nicht? Wir gehen ja gleich wieder. Wissen Sie, es handelt sich um eine Überraschung für meinen Mann, er soll nichts davon wissen, daß mein Röschen gemalt wird von Herrn Decaro, und gerade ist er nicht zu Hause, – aber, Röschen! Ist das nicht wirklich ein Schüchterchen, Herr Decaro?«
Sie zog mit beiden Armen das Mädchen in das Atelier.
Das schwarze, einfache Kleid ohne jeden Aufputz verriet knospende Formen, die widerspenstigen braunen Locken hielt ein häßliches blaues Band unter der weißen Stirne. Sie machte einen steifen Knix vor Warwara, nestelte verlegen an dem kleinen Korallenkettchen, welches sie um den Hals trug, und schlug erst allmählich die großen Augen auf mit demselben verwunderten Ausdruck wie eben auf der Straße.
»Da hast du gleich Gelegenheit, zwei Berühmtheiten der Kunst, von denen du noch viel hören wirst, kennen zu lernen,« begann die Rätin in einem schulmeisterhaften Tone. »Den Maler Julius Decaro, die berühmte Tragödin Fräulein Warwara Onegin.«
Röschen warf einen scheuen Blick auf die Schauspielerin, dann auf den Maler: dieser schien ihr sichtlich mehr Vertrauen einzuflößen. »Das ist eine große Ehre,« sagte sie mit einem neuen Knix, »aber wir stören, Mama.«
»Durchaus nicht, mein Fräulein, die Sitzung kann ja ein anderesmal fortgesetzt werden,« bemerkte Warwara. »Sie wollen sich also auch malen lassen?«
»Mami meinte, dem Papa würde es Freude machen; ich glaube es aber nicht,« erwiderte Röschen.
»Warum glauben Sie das nicht?« 5
»Aber ich bitte Sie, Fräulein Onegin, hören Sie doch nicht auf das törichte Gerede dieses Kindes, gewiß wird es ihm Freude machen, große Freude sogar. Können Sie es glauben, das Närrchen fürchtet sich vor dem Malen.«
»Vor dem Malen wohl nicht, aber vor dem Maler,« erwiderte Warwara lachend. »Nun, da haben Sie auch ganz recht, Fräulein Röschen; es sind gefährliche Leute, diese Maler, man muß sich in acht nehmen vor ihnen.«
»Das verstehe ich nicht,« entgegnete das Mädchen mit einem ängstlichen, fragenden Blick auf Julius, »aber ich denke nur – verzeihen Sie, ich meine nur, es muß ein eigentümliches Gefühl für ein Mädchen sein – ach, ich kann mich nicht ausdrücken –«
Sie wurde feuerrot und blickte zu Boden, an ihrem Kleide zupfend.
»Von einem Manne so scharf beobachtet, förmlich studiert zu werden, nicht wahr, das meinen Sie?« ergänzte Julius.
»Ja, ja, das meine ich: es ist wohl recht kindisch, aber das meine ich.«
Ein dankbarer Blick für sein Verständnis traf ihn aus den blauen Augen.
»Ah, das ist ja reizend!« bemerkte Warwara, ihre Lorgnette aufklappend.
»O, ich danke Ihnen für Ihre Nachsicht,« meinte die Rätin, »aber man muß ihr die Wahrheit sagen, sonst wird es immer ärger mit diesen Manieren, albern ist es, einfach albern,« sagte sie erregt. »Du blamierst dich einfach mit solchen Reden. Ein eigentümliches Gefühl, gemalt zu werden, von einem Mann angesehen zu werden. Du weißt gar nicht, wie umständlich das ist, was du damit sagst, in welch schiefes Licht du dich stellst. Ein anständiges Mädchen fühlt dabei überhaupt nichts; du bringst mich wirklich in Verlegenheit.«
Die Augen Röschens füllten sich mit Tränen.
»Und ich verstehe Fräulein Röschen vollkommen,« wandte sich mit auffallendem Nachdruck Julius an die Rätin, »und kann nur vollkommen beistimmen. Es muß wirklich ein eigentümliches Gefühl sein für ein junges Mädchen wie Ihr Fräulein Tochter, vor dem sie zittern mag wie gewisse zarte Blüten von dem rauhen Angriff der menschlichen Hand.«
Ein inniger Ton klang aus seinen Worten.
»Bravo! Sehr poetisch!« warf Warwara ein.
»Ich bin kein Schauspieler, ich spreche jetzt, wie ich fühle«
Ein gereizter Blick traf sie.
»Jetzt!? Ah, so!« sagte sie spitz.
»Aber ich denke, Fräulein Röschen,« wandte sich Julius wieder an das Mädchen, »dieses peinliche Gefühl, das ich schätze und verehre, ließe sich mildern, der Blick des Fremden verletzt Sie, der Blick des guten Bekannten – des Freundes – warum denn nicht? – des aufrichtigen Freundes wird Ihnen nicht wehe tun. Wollen wir zuerst gute Kameraden werden und dann erst anfangen zu malen? Dann schlagen Sie ein!«
Röschen war es anfangs, als müsse sie sich vor Scham verkriechen, als der berühmte Mann so warme Worte an sie richtete, aber allmählich verschwand das beklommene Gefühl, sie wußte selbst nicht, wie es möglich war, aber sie sah frei und offen dem jungen Manne ins Gesicht und ergriff sogar mit entschlossener Bewegung seine Hand.
Jetzt war das Erstaunen an der Rätin.
»Schüchterchen,« rief sie, die Hände zusammenschlagend. »Das ist ja wieder nichts! Ja, habt ihr denn nicht jede Woche eine Anstandsstunde gehabt? So gibt man doch einem Herrn nicht die Hand, den man zum erstenmal sieht. Was werden Sie sich denken, Fräulein Onegin, eine so feine Dame! Aber sie ist eben noch gar nicht weltläufig; ich sage oft zu meinem Manne, wozu gibt man eigentlich so viel Geld aus? Da lernen sie Physik und Anatomie und alles Mögliche, aber der Chic, dieses savoir vivre fehlt ihnen gänzlich, wenn sie herauskommen.«
»Aber das ist ja sehr gut, Frau Rätin, das reizt ja am meisten die Männerwelt – die lautere Natur.«
Ein spöttischer Blick traf den Maler.
Die Frau Rätin, entsetzt über diese unpassende Äußerung, machte eine abwehrende Bewegung.
»Warum ich eigentlich gekommen bin,« wandte sie sich an den Maler, »Ende dieses Monats ist der Geburtstag meines Mannes, bis dahin – glauben Sie, daß es möglich wäre –«
»Wenn Fräulein Röschen fleißig sitzt, warum nicht? Sehen Sie sich einmal meine Arbeit von einer Stunde an, geht das nicht rasch?« Er wies auf das angefangene Bild der Schauspielerin.
Röschen eilte, von einer unwiderstehlichen Neugierde gefaßt, vor die Staffelei und verglich die flüchtige Skizze mit dem Original.
»Ah, sind Sie schön!« sagte sie plötzlich in rückhaltloser Bewunderung. »Da geht's freilich schnell.«
Warwara lachte hell auf, aber innerlich war sie entzückt über dieses Lob, daß ihre Schönheit noch nie einen unmittelbareren, echteren Triumph gefeiert hatte als in diesem Augenblick. e
»Wenn es darauf ankommt, können Sie beruhigt sein, das Bild wird fertig zu Papas Geburtstag. Um eines aber bitte ich Sie im Namen der Grazien, lassen Sie das blaue Band weg.«
»Das blaue Band? Ist es wirklich so häßlich? Ja, dann muß ich wohl, aber Papa – Herr Decaro, werden Sie nicht böse – Papa möchte mich so gerne in dem Institutskleide haben, und da es doch für Papa eigentlich sein soll, nicht wahr, Mama?« Sie warf einen bittenden Blick auf die Rätin.
»Ja, allerdings, ich selbst finde es ja entsetzlich, aber der gute Mann möchte sie durchaus als das Schüchterchen haben, übrigens, wenn es Ihnen schwer fällt, ich begreife das sehr wohl von Ihrem künstlerischen Standpunkte aus.«
»Nein, durchaus nicht, der gute Herr Rat soll sein Schüchterchen bekommen, wie es leibt und lebt. In die Augen sehen können wir uns jetzt schon, nicht, Fräulein Röschen?«
»Ich glaube auch, es geht, Sie sind ja so gut; aber jetzt, Mama, ist es Zeit, daß wir gehen. Wenn Papa uns erwischte, – – –«
»Ja, du hast recht, Kind, das gäbe etwas. Also gleich morgen vielleicht, der Rat ist jeden Tag von zehn bis zwölf Uhr vormittags im Bureau. Ist Ihnen die Zeit angenehm?«
»Gewiß, Frau Rätin.«
Die Dame machte eine streng abgezirkelte Verbeugung vor der Schauspielerin, welche sich mit einem herablassenden Nicken rächte. Julius begleitete die Damen bis zur Tür.
»Also morgen um zehn Uhr in voller Uniform, Schüchterchen,« setzte er flüsternd hinzu.
Das Mädchen errötete bis unter die Halskrause. »Herr Decaro,« sagte sie in vorwurfsvollem Tone und stolperte über die Türschwelle.
Warwara hatte sich eine frische Zigarette angezündet, sie lehnte in malerischer Stellung an einer Gipssäule, die einen Antonius trug.
Julius fühlte sich beklommen unter ihrem forschenden Blick.
»Sie sind ein großer Schwerenöter! Zu welchem Gefühlspathos Sie sich emporschwangen! Und fühlen Sie gar keine Gewissensbisse dabei?«
»Gefühlspathos? Gewissensbisse? Ich verstehe Sie nicht, Fräulein Onegin,« erwiderte unangenehm berührt Julius.
»Sie meinen es also ganz ehrlich mit dem neuen Freundschaftsbund, und sehen darin nicht die geringste Gefahr für die Kleine?«
»Ich wäre einfach ein Schurke, wenn ich es anders meinte, und das wollen Sie doch nicht sagen.«
»Wie extrem, wie hochgespannt Sie sind, ein Schurke gleich, weil es Sie momentan gelüstet, dieses hübsche Köpfchen etwas zu verrücken.«
»Mein Fräulein, entschuldigen Sie, aber unsere Ansichten gehen scheint es, in diesem Punkte auseinander.«
»Natürlich, ich bin ja eine Schauspielerin, ich kann ich nicht auf die reine Höhe Ihrer Empfindung schwingen, mir gegenüber braucht man nicht ehrlich zu sein in der Freundschaft und ist doch kein Schurke.
Heute Nacht wird sie von Ihnen träumen, morgen sich sehnen nach der ersten Sitzung, im rosigen Licht der eben erwachten Weiblichkeit wird sie doppelt reizend erscheinen. Sie werden sie lieben, sie lieben müssen, Sie werden ehrlich sein und unglücklich werden, Sie und das Mädchen, weil das alles nur ein Phantom ist, ein Bubenstreich der Natur, weil ein Mann, ein Künstler von Geist und Genie wie Sie, mit einem Kinde, nicht glücklich werden kann, und dieses Mädchen wird ewig ein Kind bleiben.«
Eine gewaltige Erregung riß sie fort, gab ihren Worten den Ausdruck der Überzeugung, ihrem Antlitz den der unwiderstehlichen Leidenschaft. Nie war sie so gefährlich! Dabei glaubte Julius die Töne schmerzlicher Eifersucht, gekränkter Liebe herauszuhören. Dieses verführerische Weib, nach dem er jahrelang gelechzt hatte in seiner Phantasie, liebte ihn, litt um ihn – nur ein Wort und sie war sein, lag an seiner Brust. Eine heiße Blutwelle stieg ihm ins Gesicht, und doch lachte er gezwungen.
»Welch glühende Phantasie! Daran erkennt man die große Künstlerin; ein unschuldiger Händedruck, ein Lächeln, ein Erröten, und das Drama ist fertig. Ein Genie heiratet ein niedliches Gänschen frisch aus dem Pensionat, nach kurzem Glück wird er ihrer überdrüssig, hintergeht sie mit einem seiner würdigen Weibe, als Genie ist ihm ja das erlaubt. Das Gänschen kommt dahinter, vergiftet sich, er wird wahnsinnig aus Gewissensbissen: der Vorhang fällt, weil niemand mehr am Leben ist. Bravo! Bravo!«
»Sie haben ganz recht, sich lustig zu machen, meine Erregung muß unwillkürlich komisch auf Sie wirken, ich sehe das vollkommen ein, sie muß sich fast wie Eifersucht ausnehmen,« erwiderte Warwara. »Denn an die Freundschaft, welche Sie mit diesem Mädchen für möglich halten, glauben Sie ja doch nicht. Ich habe schon so viel Unglück entstehen sehen aus so ungleicher Liebe, daß ich nun einmal nicht ruhig zusehen kann, wenn sich vor meinen Augen neues bereitet, selbst auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen.«
»Dieser Gefahr setzen Sie sich niemals aus,« entgegnete Julius mit Wärme, »ich danke Ihnen vielmehr für die Warnung, ich werde vorsichtiger sein von nun an, ich werde das Mädchen überhaupt nicht malen, diese aufbrechende Knospe, nach der mich gelüsten soll, mich, in dem Augenblicke, wo ich berauscht bin von dem Duft einer glühenden, voll entfalteten Rose. O, daß Sie mir eine solche Geschmacklosigkeit zutrauen, mir, einem Künstler, das kränkt mich.«
Warwara lächelte leise, während ihre Hand über die Locken des Antonius strich.
»Wenn Sie wüßten,« fuhr Julius immer leidenschaftlicher fort, »aber Sie sollen es ja nicht wissen, nein – Sie sollen es wissen: Wie Sie hier vor mir stehen in Ihrer ganzen weiblichen Pracht, sah ich Sie unzähligemale im glückdurstigen Traume meines armen, kalten Lebens. Dieses rötlich schimmernde Haar, diese stolzen Züge, diese Hand, alles, alles, und ich schwor mir, es soll einst mein werden, und jetzt, wo dieser Traum erfüllt vor mir steht –«
»Malen Sie ihn, das wird das beste sein,« unterbrach lachend Warwara den leidenschaftlichen Erguß, auf den Diwan zuschreitend.
»Ich kann nicht, jetzt nicht, das Lachen ist jetzt an Ihnen, Sie können sich rächen, nur das Glas nehmen Sie von den Augen, ich ertrag' es nicht!«
Warwara klappte die Lorgnette zu, durch welche sie den erregten Mann mit beleidigender Neugierde beobachtet hatte.
»Aber Sie sind ja ein ganz gefährlicher Mensch! Hören Sie, was ich Ihnen sage, heiraten Sie das Schüchterchen, das wird Ihre Nerven beruhigen, dann malen wir weiter, ja!«
Sie wandte sich zum Gehen.
Julius vertrat ihr den Weg und streckte ihr beide Hände entgegen. »Seien Sie mir nicht böse, ich bin ganz verwirrt, ich ärgere mich zu Tode über meine Unbeholfenheiten, ich werde nie ein Mann von Welt werden. Die Not, das Elend fraßen zu lange an mir. Sie kommen wieder, nicht wahr? Und ich darf ihn zu Ende malen, den Traum?«
»Bevor Sie das Schüchterchen geheiratet haben?«
»Fräulein Warwara!«
»Nun denn, ich wage es, wozu bin ich denn Heroine. Samstag also!«
Julius küßte innig die schmale Hand. Mit einem Verzeihung kündenden Blick verließ die Tragödin das Atelier.
Decaro warf sich erbost auf den Diwan. »Hast dich benommen wie ein Gymnasiast, bist verloren für die Gesellschaft,« räsonnierte er. Dieser schülerhafte Gefühlsausbruch der koketten Schauspielerin gegenüber. Erobert man damit ein Weib? Was brachte ihn denn nur so in Hitze? Dieser betäubende Duft! Er bückte sich, – ihr Schleier lag am Boden. Er drückte sein Gesicht hinein.
* * *
Zwei Wochen waren vergangen, sonderbare Wochen für Julius. Sie glichen einer traumvollen, ruhelosen Nacht, in welcher ein Bild das andere verdrängt, schroffe Gegensätze unvermittelt, sinnlos sich aneinander reihen.
Vor ihm standen zwei Bilder, Röschen im Institutskleide, noch unvollendet, nur die großen blauen Augen waren ausgeführt – er hatte noch nie so schwere Augen gemalt, sie hatte sie eben aufgeschlagen, noch hatte eine schüchterne Röte die zarten, durchsichtigen Wangen nicht verlassen, – Warwara vollendet, in glühender Farbenpracht, das edle Profil etwas zurückgebeugt, daß der kräftige, fein modellierte Hals in Vollreife aus dem dunklen Pelz hervorleuchtete, der kleine, volle Mund verlockend wie eine Kirsche etwas nach aufwärts stand und das dunkle, feuchte Auge in seiner ganzen Tiefe wirkte.
Gestern war er damit fertig geworden, er malte noch nie so schnell: es war ein wilder, nie gefühlter Genuß, wie ein Vampyr sog er sie in sich, die lüsterne Schönheit dieses Weibes und gab sie auf der Leinwand wieder. Jeder Nerv arbeitete mit; er ließ sie kein Wort mehr sprechen, er geriet in Wut, wenn sie es dennoch versuchte, und behandelte sie derb wie ein Modell. Er wollte nur sehen. Diese Gier nach ihrer Schönheit, dieses Festsaugen reizte Warwara, ein schläfriges, wonniges Gefühl überkam sie, schwüle Stille herrschte.
Plötzlich versagten seine angespannten Nerven, die Kraft der Inspiration ließ nach, dann kam die Pause, vor der er sich fürchtete.
Sie entzündete sich eine Zigarette, stützte sich auf die Lehne des Stuhles und blies die duftigen Ringe über ihn hinweg gegen das Bild.
»Bin ich wirklich so gefährlich hübsch?«
Sie beugte sich über ihn, daß ihre Wangen fast die seinen streiften. Der Duft ihres Haares betäubte ihn, er wollte sie umfassen, sie küssen, da traf sein Blick das andere Bild, auf Röschen. Es war wohl nur der Widerschein des roten Haares Warwaras, aber es kam ihm vor, als stiege Schamröte in dieses Antlitz, als senkten sich die blauen Augen. Und er umfaßte sie nicht, küßte sie nicht.
Sie erhob sich mit einer ärgerlichen Bewegung und, als ob sie die Ursache seiner Unbeholfenheit ahnte, blickte sie eben falls auf das Bild, die Stirn runzelnd.
»Diese kleine graue Maus macht Ihnen wohl viel Arbeit. Sie kommen ja gar nicht vorwärts damit. Natürlich, die Frau Rätin setzt Ihnen tüchtig zu, begreiflich! Sie wären ja gar kein schlechter Fang.«
Er lachte mit und machte einen faden Scherz, und als sie fort war, ärgerte er sich über seine Blödigkeit. Wie ganz anders arbeitete er bei einer Sitzung Röschens. Wie in einer stillen, feierlichen Landschaft, am Ufer eines spiegelglatten Sees, in dem sich grüne Wälder und Matten, der blaue Himmel spiegelt. Nie störte sie durch ein Wort, eine Frage seine gesammelte, selige Ruhe. Machte er eine Pause, überraschte sie ihn durch ihr treffendes, klares Urteil, das natürlich, quellfrisch über die Lippen perlte.
Er glaubte, die Neigung eines Vaters für sie zu empfinden, solch ein Kind zu haben, dünkte ihn das höchste Erdenglück, und auch sie schien in ihm nur den Freund zu erblicken, vor dem sie keine Scheu empfand, ihren Lehrmeister, der sie einführte in das ihr unbekannte Reich der Kunst.
In Pensionat war darüber nie gesprochen worden. Er lehrte sie zuerst künstlerisch sehen und fühlen, künstlerisch genießen, die Sprache der Formen und Farben verstehen, lehrte sie, mehr sehen als die bloße Erscheinung im engen Rahmen, ließ sie das Auge nach der Tiefe richten, nicht nach der Fläche, und die geheimnisvollen Wechselbeziehungen heraus fühlen, die alle Dinge und Wesen umschlingen, dem Unscheinbaren, Schlichten neben dem Großen und Gewaltigen Bedeutung verleihen.
Er durchblätterte mit ihr Skizzen und Kupfer, alte und neue Meister und gründete ihr Urteil durch Betrachten des Großen und Erhabenen, des Tüchtigen, des Mühseligen, des Mittelmäßigen und Schlechten. Er selbst glühte wieder auf, aus der Tiefe seiner Künstlerseele erhob sich wieder unter allem Schutt die heilige Flamme der Begeisterung, reinigend, neu belebend, und Röschen hörte ihm andächtig zu. Sie verstand nicht alles, aber es klang so schön, und Tränen traten ihr in die Augen vor innerer, unbegreiflicher Rührung.
Erst die zürnende Stimme der Rätin mahnte sie wieder an den eigentlichen Zweck dieser Stunde. Nicht, daß die gute Frau Angst hatte für ihr Kind; solche Gespräche schienen ihr gefahrlos, aber das Bild wurde ja auf diese Weise nicht fertig bis zum Geburtstage des Rats.
Den nächsten Tag machte er keine Pause bei Warwara und erklärte ihr am Schlusse der Sitzung, er dürfe ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Warwara verstand ihn und nahm mit einem verletzend mitleidigen Blick von ihm Abschied, den er nicht vergessen konnte.
Er war eben im Begriffe, das Bild zu firnißen, da lächelte die schöne Lippe wieder so spöttisch. »Narr, nie wirst Du voll genießen, nur träumen konntest Du davon. Du hast den Mut nicht, den brennenden Durst zu stillen. Das Elend hat Dich klein gemacht, nie wirst Du Dich erheben auf die freie, sonnige Höhe des Genusses. Ein kleines, bescheidenes Los an der Seite eines kleinen bescheidenen Weibchens, eines ›Schüchterchens‹.« Er blickte auf das andere Bild, sah eine entzückende Morgenröte heraufsteigen hinter der zarten, durchsichtigen Haut, und die Augen öffneten sich groß und weit, und auf dem blauen Grund blinkte ein Schatz, wie er ihn nimmer blinken sah.
Das waren zwei Gegenstücke, die mußten Effekt machen, die Pole der Weiblichkeit, die raffinierte Weltdame, die Unschuld aus dem Pensionat.
Da klopfte es, und gefolgt von Röschen trat die Rätin ein, ein dickes Buch unter dem Arme: er schämte sich in diesem Augenblicke, an das Geschäftliche gedacht zu haben.
Röschen blieb vor dem Bilde Warwaras stehen und betrachtete es neugierig; als sie sich dabei von dem Maler beobachtet sah, errötete sie tief.
»Gefällt Ihnen das Bild?« fragte er.
»O, zum Sprechen ähnlich, aber doch, ich weiß nicht –« sie stockte verlegen. »Die Dame ist ja schön, es gefällt mir aber doch nicht –«
»Röschen,« verwies sie die Mutter, »wie kannst Du Dir ein Urteil erlauben! Bitte, hören Sie nicht auf das Kind, es ist ja großartig, das Bild, voll Geist und Geschmack. Ich wundere mich nur, wie Sie so schnell fertig werden konnten damit, während Ihnen das da so viel Arbeit macht.«
»O, ich begreife das ganz gut,« bemerkte Röschen; »ein so schöner Vorwurf geht einem Künstler leichter von der Hand als ein einfaches Alltagsgesicht.«
»Ein bißchen Wahrheit liegt in Ihren Worten, abgesehen von dem Alltagsgesicht, an das Sie wohl selbst nicht recht glauben. Ein Kopf, in dessen Zügen bereits das ganze Seelenleben mit all seinen Höhen und Tiefen sich scharf ausgeprägt hat, wie dieser hier, ist leichter zu malen als einer, in welchem es noch nicht dazu Zeit gehabt, worin es erst leise durchzuschimmern beginnt, mehr geahnt, gefühlt, als gesehen werden kann; das erfordert ein viel intensiveres Versenken in die Arbeit und infolgedessen auch mehr Zeit.«
Röschen nahm zaghafter als sonst ihre Stellung. Sie erwachte heute mit seinem Namen auf den Lippen und freute sich so herzlich auf die Sitzung, auf seine schönen Worte, und als sie ihre Toilette machte, blieb sie zum erstenmal in ihrem Leben eine halbe Stunde lang vor dem Spiegel sitzen und weinte über ihre häßliche kleine Stumpfnase. Decaro mußte sie dringend ermahnen, ihn doch frei anzusehen.
Das war leichter gesagt als getan. Er lächelte schon so verdächtig, gewiß hatte er wieder etwas recht Komisches entdeckt, oder waren es am Ende die plumpen Schnürschuhe, die ihn zum Lachen reizten.
Sie zog sie krampfhaft zurück und strich den schwarzen, faltenlosen Rock zurecht.
Am Tische saß die Rätin, in ihren Roman vertieft, hie und da einen Blick über das Buch hinweg auf Röschen werfend.
Da klopfte es, die Dienstmagd der Rätin. Die Schneiderin sei unten zum Anprobieren. Frau Martius überlegte einen Augenblick, doch sah sie Julius in die Arbeit vertieft, auf die flehentlichen Blicke Röschens achtete sie nicht, sie klappte das Buch zu, legte die Brille darauf und mit einem kurzen »Gleich komme ich wieder, Röschen,« verschwand sie mit der Magd.
Julius arbeitete heftig weiter, die Mutter existierte überhaupt nicht für ihn, er nahm nie Rücksicht auf ihre Gegenwart.
»Sie werden jetzt in die sogenannte Welt eintreten und dieses Kostüm wohl an den Nagel hängen?« begann er, eben an dem breiten weißen Kragen arbeitend, der Röschens Hals umschloß. »Freuen Sie sich denn recht darauf?«
»Das wird wohl nicht so schlimm werden,« erwiderte das Mädchen. »Papa meint, es kostet zu viel, ich passe auch gar nicht hinein, dazu gehört Geist und Geschick, und beides fehlt mir. Allerdings, ein neues Kleid brauche ich schon, mit dem geht's nicht weiter, Mama hat auch schon eines bestellt, braun mit schwarzem Plissée.«
»So, braun, mit schwarzem Plissée? Na, das muß ja sehr hübsch sein,« meinte lächelnd Julius.
Lautlose Stille trat ein, von der Straße herauf tönte das Gelärm der Großstadt.
»Sie lieben wohl braun nicht?« sagte plötzlich das Mädchen, »es ist keine schöne Farbe.«
Julius freute sich innerlich über den Gedankengang Röschens während des Schweigens.
»Es gibt keine an sich häßliche Farbe, es handelt sich nur um ihre Zusammenstellung mit anderen Farben, um ihre Stimmung; für Sie würde ich gerade nicht braun wählen.«
»Was denn?«
»Blau, weiß, rosa, junge Farben, die gleichsam noch im Erblühen sind, wie Sie selbst.«
»Sie schmutzen aber so leicht, meint Mama.«
»Mama? So! Das glaube ich, aber Sie selbst denken doch nicht so praktisch, nicht wahr? Der Geschmack ist Ihnen nicht ganz gleichgültig. Sie lieben doch auch das Schöne?«
Röschen wurde purpurrot und schwieg.
»Eine schöne Landschaft, eine Blume, schöne Menschen,« fuhr Julius fort, ohne seine Arbeit zu unterbrechen.
»Gute Menschen, ich meine, das ist wichtiger,« entgegnete sie mit leiser Stimme.
»Nun, und wenn sie dabei schön sind, so macht das doch wenigstens nichts. Sie müssen ermüdet sein, setzen wir aus.«
Er steckte den Pinsel in die Palette und trat zurück, das Bild betrachtend, Röschen damit vergleichend.
Sie wagte nicht aufzustehen; jetzt, wo sie allein mit ihm war, das Wächterauge der Mutter fehlte, fühlte sie erst das Preisgeben ihrer Persönlichkeit, es war ihr, als sei sie von nun an mit unlöslichen Banden an diesen Mann gefesselt. Das beängstigte sie, und doch hätte sie es nicht anders haben wollen. Das Leben bei Vater und Mutter ohne diesen dritten kam ihr plötzlich unmöglich vor. Die finstere Wohnung mit den geschmacklosen Möbeln, die einförmigen Gespräche, die langweiligen Besuche, dagegen das lichtvolle Atelier mit seinem bunten Allerlei, seinen interessanten Bildern, die so geheimnisvoll entstanden, um das Staunen der Welt zu erregen, das ewig Neue, Wechselvolle, was es zu hören und zu sehen gab. Und er selbst, der Künstler! So ganz anders als all die Menschen, mit denen sie zu Hause verkehrte, die Kollegen ihres Vaters mit dem Knastergeruch und den ernsten Bureaumienen.
Julius zündete sich eine Zigarette an.
»So stehen Sie doch auf, fürchten Sie sich vielleicht vor mir,« er sah sich unwillkürlich um, »weil Mama nicht da ist? Da, rauchen Sie auch eine, ganz leicht.« Er reichte ihr das Etui.
»Aber, Herr Decaro, ein Mädchen …«
»A bah, das macht gemütlich, probieren Sie es nur einmal, 's ist keine Sünde und – es müßte Ihnen gut stehen mir zu liebe.«
Es zuckte ihr im Herzen, wie er das so innig sagte, mir zu liebe!
Mit zögernden Fingern griff sie darnach, er reichte ihr seine brennende Zigarette. Röschen kam nicht damit zu stande, er mußte ihr helfen, dann tat sie einen kräftigen Zug. Das schmeckte wirklich gut, sie sah mit kindischem Staunen den Rauchringen nach.
Er hatte recht, das macht gemütlich; ihre Scheu schwand, er kam ihr so kameradschaftlich vor. Als er die Skizzenmappe aufschlug, setzte sie sich neben ihn auf die Bank vor den großen altdeutschen Kachelofen, guckte ihm über die Schultern und blies ihm den Rauch ins Gesicht.
Italienische Skizzen kamen ihm unter die Finger, Aquarelle, die er selbst gesammelt hatte, die Felsen von Capri im Purpurglanze der untergehenden Sonne. Szenen aus der Campagne, aus den Ruinen des alten Rom.
»Wenn man das alles sehen könnte, das müßte ein Glück sein!«
»Reisen würde Ihnen also Freude machen?«
»Ach, reisen!« Sie seufzte sehnsüchtig auf.
»Und der Papa reist nicht?«
»O nein, er hat keine Freude daran, zu Hause sei es viel schöner.«
»So, bei ihm zu Hause, für ein junges Mädchen, wie Sie sind? Viel schöner!«
Julius empfand einen Zorn gegen den Rat. Diese frische Blume mußte also verwelken in dieser dumpfen, lichtlosen Philisteratmosphäre, oder was noch wahrscheinlicher war, sie gewöhnt sich daran und führt das duft- und farblose Pflanzenleben weiter.
»Da müssen Sie eben rasch heiraten,« – es stürzte ihm nur so heraus – »um reisen zu können.«
Röschen legte plötzlich die Zigarette beiseite und zog ihr Köpfchen zurück.
»Aber, Herr Julius.«
»Nun ja, heiraten müssen Sie so bald als möglich, was wollen Sie denn da unten? Ihre schönsten Jahre vertrauern?« Er sprach jetzt ganz erregt.
»Aber wie soll ich denn? Ich bin ja noch zu jung, und dann – reich sind wir auch nicht, und der Papa ist sehr strenge, er wird so rasch nicht seine Einwilligung geben.«
»Dann brennen Sie durch.«
Julius schleuderte die Zigarette in die Ecke und sprang erregt auf.
»Was ist das?«
Julius sah sie groß an, ein Gefühl beschlich ihn, das er nie gekannt hatte vor einem weiblichen Wesen, ein Gefühl, über das er noch vor einer Stunde gelacht hätte, heilige Scheu, stumme Ehrfurcht und doch wieder das weltmännische Gelüste, diese reizende, nie auch nur von einem unreinen Gedanken berührte Blüte zu besitzen.
»Nichts, Unsinn, ich meinte nur, wenn Sie einmal einen Mann wirklich lieben, dann würden Sie auch Ihren Vater zu bestimmen wissen, oder – echte Liebe kennt keine Hindernisse, Sie das gewiß schon gelesen?«
»O ja, das habe ich schon, im geheimen, wissen Sie. Hero und Leander – o, ist das schön.«
Julius war begeistert von dieser Naivität.
»Nun, und was Sie an Hero und Leander begeisterte, was ist es anders als die alles, selbst den Tod verachtende Liebe. Könnten Sie nicht auch einmal so stark fühlen, gegen den Willen Ihres Vaters, wie Hero?«
»Ja, damals war das alles wohl anders, das waren aber auch Heiden, allein jetzt –«
»Liebt man nur noch mit Einstimmung der lieben Eltern, vernünftig, ohne Sturm und Wogenprall, aber auch ohne alle Poesie,« vollendete im Tone einer sittlichen Entrüstung Julius.
»Eigentlich haben Sie recht,« entgegnete Röschen unendlich drollig in ihrer Einfachheit.
»Nicht wahr! Wie könnte man auch mit solchen Augen keinen Sinn haben für die Poesie der Liebe.«
Dunkle Röte stieg ihm in das Gesicht, diese ahnungslose Mädchenhaftigkeit stachelte seine ungestümen Triebe. Röschen beschlich ein ängstliches Gefühl, seine Blicke taten ihr jetzt weh.
»Wollen wir nicht wieder anfangen?« sagte sie, auf ihren Platz zugehend. »Wo nur Mama so lange bleibt?«
»Fürchten Sie sich etwa vor mir?«
»Fürchten, was fürchten? Und doch, ja ich fürchte mich, lassen Sie mich gehen für heute,« bat Röschen.
»Nein, so nicht, mit diesem Gefühl. Sie sind kein Kind mehr, Sie sind ein Weib und sollen sich Ihrer Macht bewußt sein und frei werden. Ich liebe Sie, schöne Hero.«
Er erfaßte ihre beiden Hände. Röschen sah ihm mit dem Ausdruck grenzenlosen Erstaunens in das Gesicht.
»Ja, ich liebe Sie, nicht als Künstler, nicht als Freund, als Mann liebe ich Sie, der Sie befreien will aus Ihrer dumpfen Gefangenschaft, der Sie an das Licht führen will, ans Licht der Freude, der Lebenslust, der Schönheit, nach Italien, wohin Sie sich sehnen, wohin Sie wollen.«
In Röschen pochte es stürmisch, sie begriff es selbst nicht, sie hatte keine Angst mehr vor diesem völlig veränderten Mann, vor seinem rauhen Händefassen, seinen sonderbaren Blicken, seine Worte brausten in ihren Ohren. Befreiung, Italien, Lebenslust und mitten darin tauchte die väterliche Stube auf mit ihrem stumpfen Licht, ihrem Tabaksgeruch, der alte, launige Vater. – Nach Italien mit ihm! Aber –
»Daß Sie mich lieb haben, das glaube ich schon, ich habe Sie ja auch lieb, das ist gar nichts Unrechtes, aber nach Italien, mit Ihnen? Wie können Sie nur so scherzen – Papa reist ja nicht, und wenn er reist – mit Ihnen? Sie passen ja doch nicht zusammen.«
»Das soll er auch nicht, mit mir! Beileibe nicht, sondern allein, ganz allein reisen wir – als Mann und Frau.«
Röschen lachte laut auf und hielt sich dann plötzlich, nach der Tür sehend, den Mund zu.
»Gott, wenn das Mama hören würde, nie dürfte ich mehr kommen. Sie und ich, als Mann und Frau.«
»Ich scherze nicht, es ist mein voller Ernst, Mama soll es hören, eben kommt sie, hören Sie?«
Schritte wurden laut auf der Treppe.
»Also rasch, wollen Sie? Ja, Sie wollen, ich lese es in Ihren Augen. Sie wollen.«
Er umfaßte sie, er drückte einen Kuß auf den zitternden kleinen Mund, der sich vergebens sträubte, da ging die Tür, mit einem leisen Aufschrei entwand sich Röschen seinen Armen. Ein Bild auf der Staffelei verdeckte den Eingang. Julius trat vor, jetzt in seiner höchsten Erregung wollte er der Rätin alles bekennen, sonst war er ein Schurke, – da stand er vor Warwara.
»Ich störe wohl, Modellgeheimnisse, aber vor mir brauchen Sie sich doch nicht verstecken,« sagte sie, hinter dem Vorhang das Füßchen Röschens bemerkend. »Ich bin ja Herrn Julius Schwester in Apoll.«
»Sie irren sich, Fräulein Warwara, es ist kein Modell hier, sondern eine Dame, die Sie kennen; kommen Sie doch, Fräulein Röschen.«
»Fräulein Röschen! – Pardon, das ahnte ich allerdings nicht, es ging so laut zu.«
»Fräulein Martius – meine Verlobte,« saute Julius mit fester Stimme, auf das Mädchen deutend, welches verwirrt, fassungslos hervortrat.
»Verlobt, und seit wann, wenn ich fragen darf?« fragte lauernd Warwara.
»Seit heute.«
»Seit eben wohl? Ich war doch nicht etwa die unschuldige Veranlassung zu diesem Verlöbnis? Ich wollte nur wegen meines Bildes mich erkundigen, übrigens ergreife ich jetzt die günstige Gelegenheit und mache es Ihnen zum Präsent, zur Erinnerung an diesen freudigen Tag. Ich gratuliere Ihnen, mein Fräulein, Sie machen einen raschen Weg, um den Sie noch Ihre Freundinnen beneiden werden, direkt aus dem Pensionat in die Ehe, einen berühmten Mann, da wird Mama eine große Freude haben.«
»Sie weiß es ja noch gar nicht, die Mama,« sagte Röschen.
Julius warf ihr einen verzweifelten Blick zu.
»Weiß es noch gar nicht? Das ist reizend.«
In dem Augenblick trat die Rätin mit geschäftiger Eile ein.
»Das hat etwas lange gedauert, sie muß es mir ganz abändern, viel zu auffallend, du weißt, sie läßt sich absolut nichts sagen; wir hätten hier keinen Geschmack, das sagt sie mir ganz frei ins Gesicht, sie hat auch dein neues Kleid mitgebracht.
»Sehr fleißig, Frau Rätin,« sagte Warwara, welche von der Rätin gar nicht bemerkt wurde.
»Ah, entschuldigen Sie, mein Fräulein, Sie wissen ja, was uns Frauen die Toilette für Sorgen macht; meine Schneiderin war eben bei mir, und da bin ich immer ganz zerstreut.«
»Sie waren so fleißig, daß sie sich verlobt haben,« fuhr Warwara lachend fort, »mehr können Sie doch nicht verlangen.«
»Ver– verlobt! Wer hat sich verlobt?«
Die Rätin sah erschrocken auf den Maler und ihr Kind, das, sich in sich selbst verkriechend vor Scham, jetzt in helle Tränen ausbrach.
»Ich bedaure, Frau Rätin, daß Sie auf so umziemliche Weise, von vollkommen unberufener Seite, von einem Ereignis unterrichtet werden, worüber die Entscheidung allein bei Ihnen liegt. Ja, denn, Fräulein Warwara soll es nur hören, ich liebe Ihre Tochter, habe ihr eben meine Liebe gestanden und sehe sie erwidert. Ich wollte heute noch bei Ihrem Herrn Gemahl um die Hand Röschens anhalten,« stammelte Julius seine Brautwerbung.
Die Rätin schlug entsetzt die Hände zusammen.
»Röschen, ist es denn möglich? Ja, sagen Sie mir nur, wann – wie – ich war ja nur eine Viertelstunde aus. Dieses Kind, sehen Sie es doch an, ein Mann wie Sie. Und der Rat, was wird der Rat sagen? Ich kann mich gar nicht fassen, entschuldigen Sie, mein Fräulein,« wandte sie sich zu Warwara, »aber Sie werden begreifen –«
»Daß ich hier überflüssig bin, vollständig, Frau Rätin; bin aber wirklich ganz unschuldig, ich war ebenso überrascht wie Sie selbst. Empfangen Sie meine Gratulation, es wird sich das alles machen, bei Künstlern geht es einmal etwas rasch, und das Malen ist gefährlich.«
»Ja, sehr gefährlich, Sie haben recht, aber ich wußte es ja nicht,« meinte die Rätin.
»Ich empfehle mich den Herrschaften. Auf Wiedersehen, Herr Decaro, Fräulein Röschen, Sie werden mich doch als Zeugin Ihrer glücklichsten Stunde nicht so rasch vergessen. Ein herzliches Glückauf; ah, sie ist ja reizend, gang reizend«
Lachend entfernte sie sich.
»Jetzt sprich, Röschen, wie ging denn das zu? Wie ist's denn nur möglich? Lieben – heiraten – ja, woher weißt du denn nur davon?«
»Nichts weiß ich, Mama, gar nichts, ich weiß selbst nicht, wie es so kam, wir sprachen von Hero und Leander –« sie schluchzte immerfort.
»Hero und Leander!« jammerte die Rätin; »ja, wie kamst du denn zu Hero und Leander? Im Pensionat doch nicht? Hören Sie, Herr Decaro, das habe ich von Ihnen nicht erwartet, daß Sie dem armen, unerfahrenen Kind den Kopf so verrücken, von Liebe sprechen und dergleichen unpassenden Dingen, wenn die Mutter sie nur eine Viertelstunde allein läßt. Sie kennen ja Röschen noch gar nicht, und dann die Jahre, sie ist ja noch ein Kind.«
»Wenn ich aber dieses Kind liebe, wenn ich diesem Kinde eine schöne Existenz bieten kann? Ich komme ja nicht mit leeren Händen; ich habe einen guten Namen, ich habe ein reichliches Auskommen.«
»Ja, das haben Sie, insofern kann ich Ihnen nichts entgegnen, ja, insofern wäre es sogar ein Glück, aber da muß ich Ihnen gleich bemerken, Röschen bekommt kein Vermögen, sie ist die Tochter eines unbemittelten Beamten, ja, insofern, was Ihre Stellung, Ihr Einkommen anbetrifft. – Ja, was sagst du denn eigentlich dazu, Röschen? Sprich doch! Willst du ihn wirklich? Es ist ein ernstes Ding, mein Kind, und wenn ich daran denke, wie unerfahren du bist, so gar nicht geschaffen gerade für einen Mann wie Herrn Decaro, der mitten im öffentlichen Leben steht. Aber wenn du ihn wirklich liebst, so will ich in Gottes Namen mit dem Vater sprechen. Er wird außer sich sein, ich gestehe es offen, Herr Decaro, er hat ein Vorurteil gegen die Künstler, aber das wäre meine Sorge, da braucht Ihnen nicht bange zu sein. Nun, Röschen?«
Die Frau Rätin versöhnte sich sichtlich rasch mit dem Unerwarteten.
»Gut bin ich ihm schon, sehr gut, dem Herrn Decaro, und glaube ich ihm auch jedes Wort, daß er mich recht lieb hat, daß er mich nach Italien führt, in das schöne Italien, ja, ich weiß es ja nicht, was der Papa – aber wenn es sein könnte, wenn ich wirklich seine Frau werden dürfte, so – so –«
Sie sah flehend auf Julius, er solle ihr doch aus der schwierigen Lage helfen.
»So würden Sie recht glücklich sein, nicht so?« ergänzte Julius.
»Ja, das glaube ich bestimmt, so würde ich recht, recht glücklich sein,« wiederholte sie.
»Haben Sie es jetzt gehört, Frau Rätin?«
»Ich bin starr, Herr Decaro, starr. Dieses Schüchterchen!«
Röschen eilte bei diesen Worten auf die Mutter zu und barg schluchzend ihr Antlitz.
»Nun, nun, mein Kind, zu weinen brauchst du deshalb nicht, ich werde es schon machen, wenn mir auch recht schwer ums Herz dabei ist. So jung, so unerfahren, Herr Decaro, wenn Sie mein Kind unglücklich machen, haben Sie es mit mir zu tun. Auf mir ruht die Verantwortung, ich bin schuld an allem. Komm, Röschen, laß mich nur machen beim Papa. Ihnen rate ich aber, sich bei meinem Manne nicht sehen zu lassen, bis ich es für gut finde.«
Mutter und Tochter entfernten sich. Röschen reichte Decaro mit abgewandtem Gesicht die Hand.
»O, dieses Bild! Dieses Bild! Wer hätte das geahnt!« jammerte die Rätin, an dem Porträt vorüberschreitend.
Als die Türe hinter ihnen zufiel, warf sich Julius erschöpft in den Lehnstuhl und hielt sich den Kopf.
Er sprang auf und fuhr sich durchs Haar. Warum mußte dieses Teufelsweib auch gerade jetzt kommen! Man hätte sich das alles noch überlegen können, warum nimmt sie denn solch ein Interesse daran, warum ärgerte sie sich so? Sie ärgerte sich, kein Zweifel. War sie am Ende eifersüchtig?
Unten im Stiegenhause hustete der Justizrat die Treppe herauf – der Herr Schwiegerpapa. – – –
Die beiden Porträte erregten in der Kunstausstellung Aufsehen. Der Bekanntenkreis des Justizrates Martius war größtenteils entrüstet über die öffentliche Ausstellung einer Beamtentochter als Pendant zu einer Schauspielerin, über welche verschiedene pikante Gerüchte gingen. Das Verhältnis, in welchem das Mädchen zu dem Maler stand, war dafür keine Entschuldigung.
Der Justizrat selbst war wohl am unglücklichsten darüber. Er hatte überhaupt nie die Erlaubnis zu den Sitzungen erteilt, aber was wollte er machen, als er an seinem Geburtstage außer dem Bilde mit dem Antrag des Herrn Decaro überrascht wurde, welchem seine Frau sekundierte?
Die ganze Sache war ihm unbegreiflich, unfaßlich. Im ersten Augenblicke sah er nichts als einen Riß mitten durch seine Lebenssphäre, in welche er sich sorgfältig eingepuppt hatte.
Das ganze Künstlerprogramm mit seinem lockeren, schrankenlosen Wesen war ihm unsympathisch, obwohl er sich, soweit es die Sitte und die landläufige Gewohnheit der gebildeten Welt erfordert, als Kunstverehrer benahm und mit gewohnter Gewissenhaftigkeit jeden Sonntag die ständige Ausstellung besuchte. Und jetzt sollte er in seinen alten Tagen mit hinein gezogen werden in diese fremdartigen Kreise, sein Kind, das er über alles liebte, sollte darin Wurzel schlagen!
Nachdem das erste offizielle Aufbrausen, der erste Entrüstungsschauer wirkungslos über Mutter und Tochter dahingezogen war, gab er sich Mühe, Röschen seine Befürchtungen zu erklären, und wenn er dabei auch aus alter Gewohnheit in einen trockenen Ton verfiel, so klang doch auch dann und wann ein warmes Gefühl hindurch, ein liebevoller Schmerz, der Röschen ergriff.
Besonders eine Bemerkung beunruhigte sie: »Diese Schauspielerin, die er zugleich mit dir gemalt hat, die er in seiner Künstlerunbesonnenheit mit seiner Verlobten, einem Kinde zugleich ausgestellt, um einen trivialen Vergleich zu erzielen, vor welchem du erröten müßtest, wenn du ihn verständest, sie paßt zu ihm, schön, genial, Weltdame! Moral ist ja Nebensache bei diesen Herren, oder soll vielleicht Warwara deine Lehrmeisterin werden?«
Das hatte sie selbst schon gedacht, so oft sie die Dame sah, mit einem geheimen Wunsche, vor dem sie jetzt errötete bei den ernsten Worten des Vaters: »Wenn Du auch so schön, so geistreich, so gewandt wärst wie sie, kein so einfältiger, garstiger Backfisch!« und doch hatte sie eine ihr unbegreifliche Abneigung gegen jene Dame.
Zuletzt trug doch die praktische Erwägung der Frau Rätin den Sieg davon.
Decaro war daran, eine glänzende Karriere zu machen, schon jetzt überstieg sein Einkommen das des Justizrates: es war eine Gewissenssache, sich entschieden gegen die Heirat zu erklären. Die Tochter eines vermögenslosen Beamten darf sich heutzutage nicht lange besinnen. Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, nahm sich die Sache ganz anders aus. Dazu kam, daß Julius es vortrefflich verstand, mit dem Justizrat zu verkehren, ihn in kurzer Zeit durch gewandte Liebenswürdigkeit, Eingehen auf seine Schwächen und Marotten ganz für sich zu gewinnen, so daß der alte Herr zuletzt sogar auf seinen entschieden ausgesprochenen Wunsch, die Heirat möge bei den Jugend seiner Tochter erst in einem Jahre stattfinden, verzichtete.
Julius fühlte sich unsicher, in einer ängstlichen Stimmung, oft raunte ihm eine innere Stimme zu: »Tu es nicht, es ist ein Schabernack, den dir dein Herz spielt. Denke an deine leuchtende Bahn, dein Endziel, an die Träume von einst,« und er sah Warwaras spöttisches Lächeln. Dann entzückte ihn wieder die holde Weiblichkeit seiner Braut, und er war stolz auf seine frische, unverdorbene Empfindung, die er sich gar nicht mehr zugetraut hätte.
Warwara ließ sich nicht mehr sehen und in einer übertriebenen Anwandlung von Pflichtgefühl, dessen Grund ein moralisches Mißtrauen gegen sich war, untersuchte er jedes mal, bevor er das Theater besuchte, den Zettel, ob die Tragödin spielte.
Mit einer nervösen Hast beschleunigte er die Hochzeit; eine Studienreise, welche er im Herbst nach Italien machen müsse, diente ihm zum Vorwand. Diese sollte zur Hochzeitsreise werden.
Frau Martius und Röschen arbeiteten jetzt unermüdlich an der Ausstattung und versäumten nicht, den Geschmack Julius' bei der Wahl der Stoffe, dem Schnitte zu Rate zu ziehen. Das braune Kleid mit den Plissées kam nicht mehr zum Vorschein, alles rosa, hellblau, weiß, jugendliche Farben, wie er sie nannte, ja Frau Martius weihte ihn in die intimsten Toilettengeheimnisse seiner künftigen Gattin ein. Sie brachte zierliche Jäckchen, spitzenbesetzte Hemden und Höschen mit geheimnisvoller Miene und glücklichem Lächeln, ihm die Wahl der farbigen Seidenbändchen überlassend, mit welchen sie durchzogen werden sollten. In ihrem schlichten Unverstande lag mehr Raffinement als in allen Toilettenkünsten einer Warwara.
An die Stelle der üppigen Träume des angehenden Weltmannes traten bei Julius die einzigen Wonnen einer ersten, jugendfrischen Liebe mit ihren poetischen Kindereien und Tollheiten, über die er sich längst erhaben fühlte. Von ihr nicht berauscht, sondern nur gehoben, sah er allmählich alles in anderem Licht, den Lumpenkönig Erfolg, die Gunst der Welt. Warwara auf der einen Seite, auf der anderen die stillen Genüsse ernsten, redlichen Schaffens, das Glück des Selbstgenügens, die reine Liebe Röschens. Auf welcher Seite das Glück lag, schien ihm jetzt sonnenklar, die alten Zweifel und Besorgnisse verstummten; er hatte sich nicht übereilt, Warwara zu liebe, wie er glaubte. Das Gefühl war echt, das ihn damals bestürmte.
Auch der Rat erschien allmählich öfter bei ihm im Atelier. Jetzt, nachdem die Sache einmal so lag, hielt er es für seine Pflicht, Decaro näher zu treten. Sein Kind über alles liebend, nahm er einen wohlgemeinten Anlauf und gab sich Mühe, in das ihm fremdartige Wesen der Kunst einzudringen, so schwer es ihm auch wurde.
Decaro machte es Freude, den trockenen Mann allmählich in sein Zauberreich einzuführen, und wenn es auch nicht so leicht ging wie bei Röschen, so hatte er doch einigermaßen Erfolg damit. Der Rat lernte wenigstens mit Staunen die ungeahnten Schwierigkeiten, die weitläufige Vorbildung des künstlerischen Schaffens kennen, den Aufwand konzentrierter Kraft, und indem er sich in seinem reellen Sinne mehr für die Erläuterung der Technik als des Wesens der Kunst interessierte, kam er dazu, in ihr eine ernste Arbeit zu sehen, nicht bloß geniale Tändelei, und das beruhigte ihn. Am meisten beschäftigten ihn die Früchte dieser Arbeit, die Honorare, er konnte nicht genug hören von den Riesensummen, die ein Makart, ein Meissonier, ein Lenbach verdiente, im stillen verglich er damit seinen spärlichen Gehalt nach mühevoller dreißigjähriger Arbeit im Dienste des Staates und gestand sich, daß sein Verständnis immer noch nicht ausreiche, diesen gewaltigen Unterschied gerecht zu finden, so sehr er sich Mühe gab. Mit inniger Freude vernahm er dann die Hoffnungen, die farbenglühenden Pläne Decaros. Die Leidenschaft, welche den Künstler ergriff, teilte sich ihm selbst mit, die matten grauen Augen leuchteten jugendlich auf unter der dunklen Brille, er sah ein vielverheißendes Streben, er ward ordentlich neidisch. Wie weit hätte er es gebracht, wenn die Natur ihm ein solches Temperament verliehen? Zum Präsidenten, zum Minister! Das krankhaft überreizte, das dem Künstler so viel Gefahren bereitet, entging ihm vollständig. Er sah nur sein Röschen im Überfluß, einem Glanz, von dem er oft ohne Groll, aber mit bitterer Wehmut träumte in seinem kahlen Bureau. Er fühlte sich bald heimisch in dem überladenen, prunkhaften Atelier, das ihm anfangs so unsolide erschien, und er rauchte mit Behagen, auf dem Diwan sich streckend, eine Zigarre, wie er sie selbst bei den Diners des Ministers nicht besser bekommen hatte.
Das einzige, woran er sich nicht gewöhnen konnte, was immer von neuem seinen Unmut und ängstliche Bedenken weckte, waren die weiblichen und männlichen Akte, welche er unter den Bildern zur Genüge fand. Da halfen alle Erklärungen des Künstlers über die Notwendigkeit solcher Studien nichts. Als verheirateter Mann werde er doch das frivole Zeus entfernen – vor Röschen.
Und als eines Tages, – er war eben anwesend, – ein junges Mädchen mit frechem Benehmen in auffallender Toilette eintrat und sich als Modell anbot, konnte er es kaum abwarten, bis sie, von Julius kurz abgewiesen, mit einem frechen Lachen und einem spöttischen Blick auf ihn das Atelier verlassen hatte, dann brach er ernstlich los.
»Julius, ich beschwöre Dich, Du wirst doch solches Volk nicht hereinlassen, wenn Röschen Deine Frau ist? Sie müßte ja vergehen vor Scham.«
Julius versuchte es anfangs, die Sache ins Lächerliche zu ziehen, doch das verfing nicht, es war dem Rat voller Ernst.
»Wenn das die unerläßliche Bedingung zu einer großen Karriere ist, dann verzichte ich lieber darauf, dann –«
Ein herbes Wort lag auf seinen Lippen.
»Aber ich bitte Dich, was hat denn meine Frau mit einem Modell zu tun? Ich verspreche dir, daß sie sie gar nicht zu Gesichte bekommt, und wenn auch, wird sie so vernünftig sein und daran nichts finden. Soweit hoffe ich sie denn doch in kurzer Zeit selbst künstlerisch und wahrhaft sittlich zu denken zu lehren, ja, ich sage wahrhaft sittlich,« sagte Julius in dem Brustton der Überzeugung, der selbst den Rat stutzig machte.
Decaro entging es nicht, und er fuhr fort in heiligem Zorne, den er stets zu empfinden glaubte, wenn irgendwo auf dieses Thema das Gespräch kam:
»Natürlich, ihr braucht immer ein Mäntelchen, hinter dem ihr lustig weiter sündigt, wenn nur der Schein gewahrt, aber die unverhüllte Wahrheit scheut ihr.«
Der Rat war sprachlos. Diesem Phrasentum war der schlichte Mann nicht gewachsen. Ja, was sündigte er denn? Er, der sich nur jeden Sonntag ein Gläschen Wein erlaubte, das hundert Zigarren zu fünf Mark rauchte!
»Ich muß Sie schon ersuchen, Herr Decaro, etwas deutlicher sich auszudrücken,« sagte der Rat mit der ganzen gekränkten Würde seiner rechtlichen Persönlichkeit. »Sie sprechen mit einem königlichen Beamten, Herr Decaro, der sein ganzes Leben immer treu und ehrenhaft gedient hat und von diesem Mäntelchen nichts weiß, der aber zu alt ist, um neue Sittlichkeitsbegriffe sich anzueignen.«
Der würdige Ernst machte Decaro erröten, seine Redensarten waren diesmal schlecht angebracht und es war dumm, den Rat zu kränken und zu ängstigen.
Er versprach ihm, die anstößigen Bilder aus dem Atelier zu entfernen, und beruhigte ihn betreffs der Modelle, die Malerei des Nackten sei ohnehin augenblicklich im Handel schwer verwertbar.
Der Rat war seit dieser Unterredung wieder sehr beunruhigt in seinem Innern, er fürchtete die künstlerische Erziehung Röschens, welche Julius vornahm. Er verwandte wenigstens jetzt ein noch sorgfältigeres Auge auf den Verkehr seiner Tochter mit ihrem Bräutigam und gab sich redliche Mühe, in der kurzen Frist ihr seine Lebensgrundsätze möglichst fest einzuprägen. Da er jedoch alles aus seinen engen Verhältnissen heraus betrachtete, sich möglichst Mühe gab, seine eigene Hoffnung in Bezug auf die glänzende Zukunft Decaros zu verbergen, so machte er auf das alles im rosigsten Lichte sehende Mädchen, dem stets die glühenden Worte des Bräutigams wie himmlische Musik im Ohre brausten, wenig Eindruck. Sie ertrug diese Stunden mit Zöglingsgeduld wie noch vor wenigen Wochen, mit einem Ohre stets auf das Schlagen der Freistunde horchend.
All ihr Fühlen und Denken war Julius, er wuchs vor ihr zur Riesengröße.
Ende August war die Hochzeit angesetzt; trotz des hartnäckigsten Widerstandes des Rates, nahm die Einladung dazu die weitesten Dimensionen an und wurde das Diner in dem ersten Hotel der Stadt bestellt. Decaro hielt es für notwendig. Seine Heirat durfte nicht unbesprochen bleiben wie die eines einfachen Bürgers, für Notizen in den Zeitungen in allen möglichen Lesarten sorgte er schon Wochen zuvor, zur Verzweiflung des Rates, welcher sich vor seinem gesperrt gedruckten Namen in den Tagesneuigkeiten ordentlich fürchtete. Es war ihm, als ob man ihn plötzlich gewaltsam aus seinem stillen, verborgenen Bureau, dessen Fenster in ein enges, dunkles Gäßchen mündete, vor das grelle Licht zöge, vor alle Gaffer.
»Ich bin einmal für die Öffentlichkeit nicht geschaffen, ich hasse sie,« sagte er voll Aufregung, als er beim Morgenkaffe die erste Notiz las:
»Wie wir aus sicherer Quelle hören, hat sich Julius Decaro, der vortreffliche Meister, auf den man in künstlerischen Kreisen mit gespannter Erwartung blickt, mit Rosa Martius, der Tochter des Justizrates Martius, eines hochverdienten Beamten, verlobt.«
Erst als Röschen mit ihrem zierlichen Nagel wiederholt einen Strich machte unter »eines hochverdienten Beamten« beruhigte er sich wieder.
»Ist das nicht schön, wenn man das liest? Oder ist es etwa nicht wahr?« sagte sie schmollend. Dann las er wiederholt die paar Worte, zündete sich eine frische Pfeife an und küßte sein Kind.
»Nein, es ist nicht wahr, nur meine Schuldigkeit habe ich getan; das hat der Julius wieder gemacht, das ›hochverdient‹. Aber am Ende – so gut wie mancher andere bin ich es auch, es liest sich nur komisch, wenn man gar nicht daran gewöhnt ist an solche Lobhudeleien.«
Und nun kam erst der Tag der Hochzeit, wo er mitten hineingerissen werden sollte in den Strudel der Welt, die bisher an ihm achtlos vorübergerauscht war. Er hatte ja nicht einmal ein farbiges Bändchen im Knopfloch aufzuweisen; das würde sich gut ausnehmen in dieser strahlenden Gesellschaft! Er war nicht ehrgeizig, kein Streber, das alles war längst erloschen im Aktenstaub, aber als er sich morgens erhob und die Rätin den frisch geplätteten altmodischen Frack zurechtlegte, fühlte er zum ersten Male diese Leere und, ganz im Stillen natürlich, rechtete er mit dem Staate, der ihn ganz vergessen hatte in seinem grauen Bureau. Heute galt es, sich nicht verblüffen zu lassen von all den Titeln, von all dem Genie und Geist, was sich da herandrängen würde. Du bist der königliche Justizrat Martius, das darfst du keinen Augenblick vergessen. Dann muß eine kleine Rede gehalten werden, sehr schwierig bei den heterogenen Elementen, welche sich zusammenfinden werden. Was er hauptsächlich dabei fürchtete, war die Rührung, welche ihn immer bei solchen Gelegenheiten übermannte und am Sprechen verhinderte, und vor allem heute, wo es seinem Röschen galt, standen ihm jetzt ja schon die Tränen im Auge, als er sich vor dem Spiegel mit seinen Hemdknöpfen abquälte, die in alter gediegener Fassung, ein Erbstück seines Vaters, des Rechnungsrates, in die engen Knopflöcher des modernen Hemdes gezwängt werden mußten.
Das war ein ängstliches Rufen, Schreien, Türenaufundzuschlagen, Hinundherlaufen. Der ganzen kleinen Wohnung schien sich die Aufregung mitgeteilt zu haben, alles zitterte, klirrte, die Standuhr, die schönen Tassen, das Silber im Glasschrank, das Geschirr in der Küche, die Säbel im Zimmer des Rates, welche, noch von der napoleonischen Zeit stammend, in der friedlichen Familie sich fortgeerbt hatten. Der alte Caro hatte sich mit eingezogenem Schweif unter den Schreibtisch verkrochen und beobachtete von da aus mit sorgenvollem, fragendem Blick seinen Herrn.
Plötzlich verstummte jedes Geräusch, eine beängstigende Stille trat ein, auch der Rat, erschöpft von der Anstrengung der Toilette, saß zusammengesunken in seinem Lehnstuhle, den frischen Kragen noch in der Hand, den er vergeblich eine Viertelstunde lang sich abmühte, einzuknöpfen. Er dachte über seine Rede nach.
Da öffnete sich weit die Türe und Röschen stand in der Füllung – die Braut! Sie schwebte förmlich in dem duftigen, schneeweißen Kleide wie in einer lichtvollen Wolke. Das Köpfchen war auf die pochende Brust geneigt unter der Last der Wonne, jungfräulicher Scham. Von der dunklen, üppigen Haarkrone, welche die Myrte zierlich schmückte, wallte der Schleier wie feiner Nebel, der ganzen Gestalt eine überirdische Unbestimmtheit verleihend. Hinter ihr schluchzte die Mutter, die alte Magd. Der Rat fühlte sich in den Sessel gebannt bei diesem Anblick, die Füße versagten ihm den Dienst.
»Röschen«, stammelte er.
Da flog das Wölkchen heran und ließ sich zu seinen Füßen nieder. Die Myrte zitterte vor seinen nassen Augen.
»Der Herr segne dich!« Seine zitternden Hände drückten sich in den knisternden Schleier und er küßte den rot schwellenden Mund.
»Wirst du auch mein Röschen bleiben, mein Schüchterchen, draußen in der Welt? Über ihrem Lärm deinen alten Vater nicht vergessen?«
»Nie, nie!« erwiderte Röschen, sich wie von einer plötzlichen Angst befallen enger an ihn schmiegend, ihn einhüllend in den Brautschleier, als wolle sie ihn mitnehmen in das neue Leben: nur das gealterte Antlitz mit den kleinen Zügen, der kahle Scheitel des Rates, ragte aus dieser Wolke von Jugend, Glück und Liebe heraus, wie eine ernste Mahnung.
Die Rätin sah stattlich aus in knisternder schwarzer Seide, sie wischte sich mit dem Spitzentaschentuch die feuchten Augen; die Sorge um die Toilette Röschens hemmte die Rührung. Sie hob das Mädchen auf, strich gutmütig scheltend den zerknitterten Stoff zurecht, rückte den Kranz.
»Regt euch doch nicht jetzt schon auf, wie soll denn das in der Kirche werden? Die ganze Stadt wird ja der Trauung beiwohnen; du mußt recht heiter drein sehen, Röschen, wenigstens bei dem Gang durch die Kirche bitte ich dich darum. Oder willst du in deine Ohren hören: ›Das arme, junge Blut, das reinste Opferlamm!?‹ – Wie schön sie ist, Martius, das liebe Schüchterchen! O, wie hart ist es doch, Mutter zu sein.«
Nun liefen ihr selbst die hellen Tränen Über die geröteten Wangen.
Die Glocke ging jetzt unausgesetzt, der Salon füllte sich mit Hochzeitsgästen: Die Brautführerinnen, Töchter befreundeter Familien, der Bruder des Rats, ein Postbeamter mit seiner Frau und Tochter, ein junger Rechtspraktikant, ein Neffe der Frau Rat, ihre Schwester, Registratorswitwe Schönlein. Von seiten Decaros war niemand anwesend, seine ganze Verwandtschaft gehörte der Kunst an und war in der Welt zerstreut, seine Gäste kamen nur zum Diner ins Hotel.
Nun trat er selbst in das kleine Zimmer in tadelloser Salontoilette.
»Na, was ist denn für ein Unglück passiert? Alles in Tränen? Eine Einweinung,« sagte er lachend, »und ich bin der fluchwürdige Attentäter. Röschen, morgen um diese Zeit bist du im Lande deiner Träume, im sonnigen Italien – und noch Tränen? So greife ich zu dem mächtigsten Zauber,« rief er in komischem Pathos, und drückte einen innigen Kuß auf die Lippen seiner Braut.
»Jetzt auch noch zu früh, Papa?« wandte er sich in heiterster Laune, ohne die Verwirrung Röschens zu beachten, an den Rat.
Der zog die Stirne in besorgte Falten.
»Es ist eine ernste Stunde, Julius, für uns alle, und dieser Kuß, den du eben deiner Braut gabst, ist ein ernster, heiliger Kuß – wenigstens zu meiner Zeit war er es, in meinen Kreisen – in manch schwerer Stunde dachten wir dieses Kusses, ich und meine Leonore, es war unser Palladium, dieser Kuß, und wir scherzten nicht bei diesem Kuß.«
Von Satz zu Satz klang die Stimme des Rates erregter und seine gelben Wangen rötete der Unmut.
Julius kam diese Standrede lächerlich vor.
»Mit eurem ewigen Ernst und eurer altfränkischen Rührseligkeit, sagte er in fast mitleidigem Tone, »als ob im Humor nicht tausendmal mehr wahres Gefühl steckt. Sag, Röschen, willst du einen streng konventionellen Brautkuß haben mit Menuettschritt – zur ewigen Erinnerung? Hat dich mein Scherz wirklich auch gekränkt?«
Er faßte ihre Hand und hob ihr Köpfchen empor.
Sie lächelte, während die Augen noch in Tränen schwammen.
»Nein, gekränkt nicht, ich weiß, du meinst es ja gut, aber doch, wenn ich so daran dachte, an diesen Augenblick, wo ich als Braut vor dich hintrete mit Schleier und Kranz – ein bißchen feierlicher habe ich mir das schon gedacht.«
»So, wie man es in den Romanen liest, nicht wahr? ›Und er drückte wonnebebend, mit schüchternem Zagen den ersten Kuß auf ihre Lippen.‹«
»Du verstehst mich nicht,« erwiderte Röschen, und ein flüchtiger, wehmütiger Zug huschte über ihr Gesicht.
Der Rat nickte stumm.
»Aber, Kinder,« mischte sich jetzt die Rätin ein, »ihr werdet euch doch nicht an dem heutigen Tage um einen Kuß streiten! Martius, sei doch vernünftig, man küßt einmal heutzutage anders als vor dreißig Jahren. Julius hat recht, tu einmal dein Amtsgesicht auf einen Tag in die Schublade und sei wieder jung! Da, probier es einmal!« Sie breitete lachend die Arme aus, trat auf ihren Mann zu und spitzte den Mund.
»Auf die alte Manier, damit wir von neuem daraus Kraft schöpfen für den – einsamen Rest.«
Innig umarmte der Rat die Gattin. Es war ein inhaltsschwerer langer Kuß, den sie sich gaben, von selbstloser Liebe durchglüht, welche nur das Alter kennt.
Das wachsende Geflüster im Salon nebenan mahnte zur Eile.
Julius trat ein, seine Braut führend, mit einer gewissen kühlen Zurückhaltung von den Verwandten beglückwünscht.
Röschen stellte, von den Brautjungfern sofort mit Beschlag belegt, bei sich Vergleiche an, die sehr zugunsten ihres Bräutigams ausfielen. In dieser Umgebung erschien er ihr in doppelt günstigem Lichte. Sein geistreicher Kopf mit den lebhaften, jede Empfindung widerspiegelnden Augen, die Vornehmheit seines Benehmens; alles um ihn her erschien ihr ein Puppenspiel, er der einzige Lebende.
Als sie mit Julius im Wagen saß, der sie durch die belebtesten Straßen der Stadt der Kirche zuführte, wich die letzte mädchenhafte Beängstigung, es klang und sang in ihren Ohren.
Das weiße Kamelienbukett erfüllte den engen Raum mit seinem Duft. Alle Vorübergehenden blieben stehen und lächelten ihnen zu, priesen ihr Glück. Ihre Hand ruhte in der Julius', über die zierliche Brücke wallte herüber und hinüber ein heißer, wonniger Strom.
»Schüchterchen, jetzt nimm dich zusammen,« sagte zärtlich Julius, als der Wagen dem Portale der Kirche sich näherte. »Jetzt gilt es dein erstes Debüt in der Welt, an Neugierigen wird es nicht fehlen.«
Sie sah ihn flehend an. »Ich bitte dich um eines, Julius, gib mir die Hand darauf, daß du es mir erfüllst. Nenne mich nie mehr ›Schüchterchen‹, es klingt so verächtlich in deinem Munde, du kannst kein Schüchterchen brauchen als deine Frau – und ich will es auch nicht mehr sein.«
Sie sprach das »will« sehr energisch und die blauen Augen blickten mit einem Ernste, dessen er sie nie für fähig gehalten hätte.
»Abgemacht! Das Schüchterchen ist tot – es lebe das Röschen!«
Der Wagen hielt vor der Kirche, neugieriges Volk hielt die Stufen besetzt zum Portale.
Röschen betrat sie sicheren Schrittes an der Hand ihres Bräutigams, mit einem fast herausfordernden, kühnen Blick rings umher. Durch eine Seitentür trat man in die Sakristei, in welcher bereits die Zeugen Decaros warteten. »Kollegen: Maler Löbe, Bildhauer Biedemann!« stellte Julius die beiden Herren der Gesellschaft vor.
Röschen trat zu den Eltern und Verwandten, welche in dem weihrauchduftenden Raume sich nur flüsternd unterhielten, während Decaro und seine beiden Freunde in ungezwungener Weise plauderten, mit Künstleraugen das eigenartige Milieu dieses Raumes betrachteten und besprachen. Kunstvoll geschnitzte gotische Chorstühle aus dunklem Eichenholz, in die weißgetünchten Wände eingelassen, mit verblichenen Purpurkissen belegt, gaben dem sonst nüchternen, hochgewölbten Raume etwas Behagliches. An den Wänden hingen alte Bilder, eine Kreuzigung, Heiligenköpfe, von Weihrauch und Kerzenqualm verdunkelt, nur das Fleisch in schimmerndem Goldton leuchtete hervor, während in den geöffneten Schränken, aus denen ein weichlicher Duft herauswehte, priesterliche Ornate in bunter Goldstickerei flimmerten und glitzerten, auf goldenem Grunde feurige Blumen sich wanden, Herzen bluteten, kostbares weißes Spitzenzeug sich herausdrängte. Dazu das geheimnisvolle Schlurfen und Rauschen der ein- ausgehenden Priester und Bediensteten, das gebrochene farbige Licht, das durch die bemalten Spitzbogenfenster hereinfiel. Es lag wirklich eine interessante Stimmung darin, welche die Künstler ganz in ihren Bann nahm, während die anderen keinen Blick dafür hatten und sich über das freie Benehmen der Drei ihre Bemerkungen zuflüsterten.
Die Verschiedenheit der Anschauungen und Gefühle konnte sich nicht deutlicher kundgeben. Die einen sahen nichts als Farben und Formen, alles belebt von unzähligen wechselnden Lichtern, in jedem Gegenstande steckte ein Kobold, der ihnen eine Geschichte erzählte; Stimmung hieß der Zauber, dem sie sich hingaben; die anderen sahen nichts als eine Sakristei, in der man auffallend lange warten mußte.
Röschen hörte jetzt trockenen Auges die guten Lehren ihrer tiefbewegten Eltern, sie wollte nicht mit rotgeweinten Augen bei dem Diner erscheinen, sie war nicht eine Braut wie tausend andere, sondern die Braut eines Decaro, eines berühmten Mannes, der einer Welt angehörte, von welcher das große Publikum keinen leisen Begriff hatte, am wenigsten ihre Verwandten um sie her. Sie kränkte sich jetzt schon gar nicht mehr darüber, daß Julius sich so ganz anders benahm, Kunstgespräche führte, Pläne entwarf, Eindrücke sammelte, selbst in diesem Augenblick. Das begriffen diese Menschen freilich nicht, konnten es nicht begreifen, aber sie begriff es, die Künstlerfrau.
Ja, als sie endlich, den Zug eröffnend, mit Julius in die Kirche schritt, machte sie ihn selbst auf die alte Tür in künstlerischem Schnitzwerk aufmerksam, welche aus der Sakristei führte. Zunächst folgte der Rat, die vorwärts gebeugten Schultern möglichst hinaufziehend, seine Gattin an den Fingerspitzen haltend. Beide sahen nichts als das weiße Wölkchen vor sich, nur wenig Stunden, und es zog über ihren Horizont hinweg, um nie wieder aufzutauchen vor ihnen in dieser glücklichen Reinheit.
Julius blickte mit dem prickelnden Bewußtsein, auf allen Seiten besprochen zu werden, über die Menge. Ein zahlreiches, elegantes Publikum, vorwiegend Damen, hatte sich eingefunden. Plötzlich stockte sein gleichmäßiger Schritt, welchen Röschen ängstlich einzuhalten bestrebt war, seine Hand zuckte in der ihren, sie folgte seinem Blick nach links – Warwara Onegin stand in der ersten Reihe und betrachtete das Paar durch ihr Lorgnon, lächelte ihnen mit einer gemachten Herzlichkeit zu. Jetzt galt's, schon fühlte Röschen es wieder heiß aufsteigen in ihren Wangen und das Herz pochen, das Schüchterchen regte sich wieder. Doch gelang es, sie ging an ihr vorüber, ohne die Augen zu senken.
Als Julius vor wenigen Tagen die Hochzeitsannoncen versandte und die Adresse an Warwara schrieb, ärgerte er sich über das peinliche Gefühl, welches er dabei hatte. Er sah sie in ihrem Boudoir sitzen, das Couvert öffnen und in helles Lachen ausbrechen. Was kümmerte ihn jetzt noch diese Person, nachdem er mit sich völlig im reinen war! Und jetzt erschrak er sogar, hätte viel darum gegeben, wenn diese drei Schritte an ihr vorüber schon hinter ihm lägen. Wie schön sie war! Mit welch feinem Geschmack gekleidet, alle ihre zahlreichen Genossinnen um sie her verschwanden, – eine fleckige, formlose Masse.
Er warf sich in die Brust und sah sie herausfordernd an; das schien sie erst recht zu amüsieren. Während der Zeremonie fühlte er ihren Blick auf sich ruhen; Röschen kam viel sicherer zustande mit den verschiedenen rituellen Gebräuchen, ihr »Ja« klang hell und klar. Sie freute sich, ihn etwas unbehilflich zu sehen, es ging ihm doch auch zu Herzen, bis jetzt verstellte er sich nur so. An Warwara dachte Röschen nicht mehr in diesem feierlichen Augenblick voll der innigsten, hingebendsten Liebe; und vor der erschütternden Macht des Schwures schwieg auch die leise beunruhigende Stimme, die sie eben wieder vernommen hatte beim Anblick dieses Weibes.
Als sie wieder zurückschritten, war Warwara verschwunden und Julius in ausgelassener, heiterer Laune. Während der Fahrt nach dem Hotel flüsterte er ihr so süße Dinge ins Ohr, daß sie ganz betäubt die Treppe hinaufstieg.
Im Salon des Hotels wartete die von Julius geladene Gesellschaft ungeduldig auf die Hochzeitsgäste; es ging schon auf zwei Uhr; um sich den Appetit nicht zu verderben, hatte man nur kurz gefrühstückt, und jetzt regte sich der leere Magen.
Es waren fast ausschließlich bekannte Namen der Stadt vertreten, einige Chefredakteure mit ihren Frauen, Professoren der Akademie, zwei Kunstgrößen, einige Kollegen aus Decaros schlimmer Zeit, welche durch ihre »nicht klappende« Salontoilette auffielen. Im Mittelpunkt der Gesellschaft ein beleibter Herr von auffallendem Aussehen, mit langen, weißen Locken, einem scharf markierten, glattrasierten Schauspielerkopf, welcher mit behender Unruhe in knarrenden Stiefeln auf und ab ging, jeden Augenblick zum offenen Fenster der Straße hinausblickte, dann wieder auf die Uhr sah, seine Mähne schüttelnd, seinem ganzen Auftreten, dem gnädigen Zunicken, den schnell hingeworfenen und von den jungen Leuten ehrerbietig aufgenommenen Worten nach eine herrschende Stelle in diesem Kreise einzunehmen schien, Herr Spindler, der berühmte und gefürchtete Kunstkritiker der Hauptstadt.
»Herr Decaro braucht länger zum Heiraten als zum Karriere machen,« bemerkte er schmunzelnd.
Der Witz wurde mit mehr Gelächter aufgenommen, als er verdiente.
»Dafür hoffen wir auch, daß sein Eheglück einen längeren Bestand haben wird,« erwiderte einer der älteren Herren.
Spindler zuckte die Achseln. »Förderlich wird ihm die Heirat mit dem Ratstöchterlein gerade nicht sein.«
»Legen Sie wirklich dem Einfluß einer Frau auf den Künstler so großen Wert bei?« fragte die Frau des Chefredakteurs Schlakmann, eine stattliche Dame mit energischen Gesichtszügen.
»Gewiß, wir sind alle von unserer Umgebung abhängig, Philisterhaftigkeit tötet die besten Keime in uns, eine geistreiche Frau von Welt –« Spindler blieb vor Frau Schlakmann stehen und blickte sie, über seine Augengläser hinwegblinzelnd, mit einem schmeichelhaften Lächeln an, »kann auf ein mittelmäßiges Talent befruchtend wirken. Ich habe Beispiele, viele Beispiele – ja, ich behaupte, die größten Kunstwerke haben wir den Frauen zu verdanken.«
»Dem Einfluß der Liebe, allgemeiner gesagt; Pardon, daß ich Sie korrigiere,« mischte sich ein dürres, kahlköpfiges Männchen mit lebhaft beweglichen Gesichtszügen und scharf blickenden Augen, Doktor Schlakmann, in das Gespräch, neben sein hünenhaftes Weib tretend, »welche alle Energie weckt, den Enthusiasmus, die Leidenschaft –«
»Aber das meint ja Herr Spindler,« erwiderte die Frau Doktor mit einem wenig liebevollen Blick auf ihren Gatten, »den Einfluß der Frauen durch die Liebe.«
»Jawohl, aber es brauchen gerade nicht unsere Frauen zu sein,« erwiderte dieser mit faunischem Lächeln. »Rafael starb als Junggeselle, und gerade er schuf das Höchste unter dem weiblichen Einfluß. Byron verstummte während seiner unglücklichen Ehe mit Miß Milbanks und schrieb seinen ›Childe Harold‹, begeistert von den schönen Augen der Gräfin Guiccioli; Vittoria Colonna beeinflußte Michel Angelo –«
»Du wirst uns zuletzt noch beweisen, daß die Ehe das Verderben jedes Künstlers und – ach, er meint es nicht so schlimm, mein gutes Männchen,« wandte sich mit verstecktem Hohn und einem vielsagenden Blick Frau Schlakmann an Spindler.
»O, ein Hauptschwerenöter, der Herr Doktor, nehmen Sie sich in acht,« sagte dieser.
»Ich bin nicht eifersüchtig,« erwiderte sie, ihren Fächer zuklappend, »aber auch keine Freundin laxer Moral«, setzte sie in tiefem Brustton hinzu, ihrem Manne den Rücken kehrend.
Endlich fuhren die Wagen an, alles eilte an die Fenster. Die Damen kritisierten die Toiletten, die Frau Rätin war altväterisch, das neue Seidenkleid galt als aufgefärbt. Die Braut war ein ganz nettes Ding, »aber unbedeutend,« ein Schulmädchen. »Eigentlich ein Skandal,« meinte eine ältere Dame, welche unverheiratete Töchter zu Hause hatte. Der Rat und seine Verwandten waren vortreffliche Modelle für Spitzweg. Nur die Alten von der Akademie urteilten etwas milder und hielten das kleine Weibchen ganz passend für Decaro. Über diesen lautete das Urteil einhellig: »Ein interessanter Mann!« – »Schade,« fügte noch eine weibliche Stimme hinzu.
Nichtsdestoweniger war der Empfang des Bräutigams ein überaus herzlicher. Da klapperten schon die Kellner mit den Tellern, und der Appetit hatte seinen Höhepunkt erreicht.
Jetzt war Röschen »süß«, »das reine Maiglöckchen«, »zum Küssen.«
Der Justizrat glaubte in der ersten Hitze der Vorstellung bei dem Anblick so vieler Ordenskreuzchen durch übertriebenes Entgegenkommen sich etwas vergeben zu haben und wurde ebenso plötzlich etwas zugeknöpft, während seine Gäste sich unbehaglich zusammenhielten.
Doktor Spindler kam neben die Registratorswitwe, die Schwester der Frau Rat; die moralische Frau Doktor Schlakmann neben den Postbeamten, während ihr Gatte zwischen den beiden Brautjungfern förmlich unterging und die hohe Akademie zur Seite des Justizrates und seiner Gemahlin Platz nahm. Röschen ließ sich die beiden Zeugen nicht rauben.
Die Unterhaltung ging schleppend, der Lärm der Mahlzeit mußte die peinlichen Pausen füllen, bis der Wein seine Schuldigkeit tat. Spindlers Baß bildete den Grundton, die geistreichsten Aussprüche sprudelten nur so von seinen Lippen, ohne daß er dabei auf das Interesse seiner Umgebung besonders Rücksicht nahm. Er hörte sich selbst gerne sprechen, und die eingeworfenen Redensarten seines Nachbarn, des Postbeamten, ertranken in dem schillernden Wortsprudel.
Der Rat schnitzelte im stillen an seiner Rede, wodurch die Unterhaltung sehr litt. Die Braut, auf welche man ein wachsames Auge hatte, erregte allgemeine Bewunderung, da und dort Enttäuschung; sie bewegte sich mit sicherem Takte, voll natürlicher Anmut, Geist und Humor.
Julius entzückte diese Veränderung, sie ging ihm fast zu rasch vor sich, er empfand ein bißchen Heimweh nach dem Schüchterchen, an dessen Stelle jetzt ein reifes, sich ihrer Reize vollbewußtes Weib getreten war, dem sogar ein leiser Hauch der Koketterie nicht mehr fehlte.
Unwillkürlich kam das Gespräch auf die Kunst. Die Herren bekamen rote Köpfe. Die Namen Meissonier, Makart, Lenbach, Defregger schürten die Glut des Ehrgeizes, kühner Hoffnungen – des Neides. Die ganze Welt mit ihren vielgestaltigen Interessen, ihren Kämpfen und Errungenschaften wurde dem Genius der Malerei zu Füßen gelegt, während die kleinen Beamten ihre schmalen Gehälter zusammenrechneten und zu dem Resultate kamen, daß die Summe nicht den Preis der Arbeit weniger Tage eines solchen Heroen erreichte.
»Und doch ist eine bescheidene, feste Anstellung jedem raschen Erwerbe, mag er noch so glänzend sein, vorzuziehen.« bemerkte Doktor Schlakmann. »In dem sozialen Zukunftsstaate werden auch die Künstler vom Staat besoldete Beamte sein, dann erst wird die Kunst ihre edelsten Blüten treiben, das Unkraut der künstlerischen Spekulation, das jetzt alles überwuchert, muß dann absterben, alles Virtuosentum, man wird weder dem Publikum noch dem Markte zu liebe malen, sondern nach seinem inneren Drange, das Volk wird infolge vernünftiger Preise dann imstande sein, sich die Kunst anzueignen, seine bescheidenen Räume damit schmücken, was jetzt nur das Vorrecht des Reichen ist. Es wird die Kunst lieb gewinnen, sie verstehen lernen und nicht dem Berühmtesten, dessen klingenden Erfolg es oft blöde anstaunt, sondern dem Tüchtigsten den Lorbeer reichen. Nur in der Sicherheit der Existenz bildet sich der Charakter.«
Die klugen Äuglein des Doktors blitzten begeistert auf, und wenn auch der Justizrat bei Erwähnung des sozialen Staates den Stuhl rückte und sich räusperte, drückte er in Gedanken doch Doktor Schlakmann herzlich die Hand.
Einen Augenblick der Stille hielt Spindler für geeignet, an das Glas zu klopfen und seine Rede vom Stapel zu lassen.
Mit überlegenem Lächeln, die rechte Hand zwischen Weste und Hemd, wartete er, bis völlige Ruhe eingetreten war: dann pries er in hinreißenden Worten das Glück des heute vollzogenen Herzensbundes. Den freien, schrankenlosen Geist des Künstlers und den schlichten, ihn wie Mondstrahlen sanft bestrahlenden, echt weiblichen Sinn, herangebildet in einer die weisen Schranken des bürgerlichen Lebens streng einhaltenden Familie, unter den Augen eines von Pflichtbewußtsein erfüllten hochverdienten Beamten.
»Ich aber wünsche dem verehrten Bräutigam, daß sich an ihm der Einfluß dieser gesunden Atmosphäre jetzt schon bewähre, daß er, fern von allem Virtuosentum, nur nach seinem inneren Drang schaffe und ihm dann das Volk wenn auch nicht als dem Berühmtesten, so doch als einem der Tüchtigsten den Lorbeer reiche. Darauf hin ergreife ich das Glas und bitte Sie, einzustimmen in ein donnerndes Hoch auf die beiden glücklich vereinten Elemente, auf unser junges Paar!«
Obwohl man sich im ersten Augenblicke über diese, mit seiner früheren Äußerung über diese Ehe im Empfangssalon durchaus nicht im Einklang stehenden Worte wunderte, riß der scheinbar warme Gefühlston, der zuletzt fast in Rührung ausklang, mit fort.
Das Hoch klang wirklich herzlich. Der Rat wischte sich die hellen Tränen aus den Augen, ging mit seinem Glase zu Doktor Spindler und drückte ihm stumm – die Worte versagten ihm – die Hand. So war er noch nie geehrt worden, im stillen schämte er sich der kleinlichen, falschen Ansichten, die er bisher über die Kunst, des Mißtrauens, das er gegen ihre Jünger gehabt hatte, und fühlte sich durchdrungen von einer warmen Begeisterung.
Selbst Decaro bedankte sich, wenn ihm auch gewisse Anspielungen des Doktors nicht sehr angenehm waren. Doktor Spindler hielt noch einen Augenblick zurück.
»Haben Sie das Neueste schon gehört von der Onegin?« flüsterte er ihm lachend zu. »Sie soll verlobt sein, natürlich ein Aristokrat, Graf Araschin soll der Glückliche sein.«
Julius fühlte, daß er errötete, er preßte in seinem Zorn darüber das Champagnerglas, daß es in Stücke ging.
»Der reiche Araschin, der bekannte Sportsmann?« fragte er ungläubig. »Den kenne ich ja.«
»Wird wohl Sport sein, die Warwara zu heiraten. Ein Blitzweib! War es Ihnen nicht ein wenig schwül bei den Sitzungen damals?«
Spindler drohte schmunzelnd mit dem Finger. »Na, für heute ist das allerdings eine unpassende Frage, aber wir sind ja Menschen, schwache Menschen, aber sehen Sie, mir steigt's in den Kopf wie Champagner, in diese alten Knochen, ja, lachen Sie nur, wenn ich eine Kritik über sie schreibe.«
»Schön ist sie, aber mir unsympathisch, sehr unsympathisch,« erwiderte Julius. »Eine Kokette ersten Ranges.«
Spindler betrachtete ihn scharf unter seinen buschigen Augenbrauen hervor. »Aber eine geistreiche Kokette! Übrigens begreife ich vollkommen, ein Mann, der eine solche Wahl getroffen,« er deutete auf Röschen, die unbemerkt von Julius eben hinter ihn getreten, um mit Doktor Spindler anzustoßen, »dem muß eine Warwara Onegin unsympathisch sein.«
»Das ist etwas zweideutig, Herr Doktor,« bemerkte Röschen. »übrigens wissen Sie ja nicht, was alles ungeweckt in mir schlummert. Ich habe ja noch hübsch Zeit: bis ich im Alter von Fräulein Onegin stehe, kann ich es vielleicht auch so weit gebracht haben.«
»Wogegen ich mich sehr ernstlich verwahren möchte,« fiel Julius ein; »wie kannst du nur so sprechen? Du und diese Komödiantin!«
»O, ich glaube immer, es steckt in mir auch etwas von einer Komödiantin.« Sie hielt sich mit einem drolligen Blick auf den Vater den Mund zu. »Mein Gott, wenn Vater das gehört hätte!«
»So würde er dir zu guter Letzt eine ordentliche Strafpredigt gehalten haben, die du auch verdienst,« erwiderte in auffallend ernstem Tone Julius.
»O, es ist etwas Wahres daran, gnädige Frau,« fuhr unbekümmert Spindler fort. »Ich habe einen Blick darin – alte Praxis. Die ausgesprochene Naive, deine Frau Gemahlin! Vielleicht ein unersetzlicher Verlust für die Kunst! Diese Frische der Empfindung, Organ, natürliche Grazie! Warum haben Sie daran nicht früher gedacht, ehe Sie diesen gestrengen Herrn Maler kennen lernten? Meines lebhaften Interesses wären Sie sicher gewesen.«
Julius war diese Wendung des Gesprächs unangenehm, er wußte nicht warum, es war ja doch nur ein unschuldiger Scherz, aber immer wieder diese Zusammenstellung seiner Frau mit dieser Warwara – was hatten nur diese beiden mit einander zu tun? Er empfahl sich mit Röschen, einem andern Herrn Platz zu machen. Der Graf Araschin beschäftigte ihn, und er gab nur zerstreute Antworten. Er kannte ihn nur oberflächlich vom Rennplatze her; ein einfältiger, beschränkter Mensch, dessen Welt der Turf, dessen Ideal das Pferd war.
Ausgedörrt vom Training und der Leidenschaft des Spieles, krummbeinig, ein Monocle in dem starkknochigen, braunen, bartlosen Gesichte, so sah er ihn vor sich. Wie kamen die beiden zusammen? Sehr einfach! Er verfügt über Millionen, sie hat Rasse, ist Vollblut.
Er warf seine Zigarette in die Ecke, stürzte ein Glas Champagner hinunter und erwiderte plötzlich aufspringend, nur um seinen Gedankengang zu unterbrechen, die Rede Spindlers. Es waren Worte, welche die Damen zu Tränen rührten, mit besonderer Emphase sprach er von der echten Weiblichkeit.
»Ein echtes, wahres Weib mit all seinen Schwächen und Vorzügen braucht der Künstler, ein heiteres, treues Gemüt, in dem er Erquickung findet nach seinem, jeden Nerv anspannenden Schaffen, nicht einen exzentrischen Geist, der ihn in Verwirrung bringt mit sich selbst, ihn noch mehr überreizt. Zur bürgerlichen Einfachheit sollen wir zurückkehren, welche unsere alten Meister übten, ihr hatten sie ihre gesunde Schaffenskraft, ihre eisernen Nerven zu danken, die wir staunend bewundern.«
Seine stattliche Gestalt schien zu wachsen, seine linke Hand agierte zur Faust geballt, jeder Muskel spannte sich in der Erregung, als wolle er seine Vollkraft zeigen. Doch die Rechte strafte die Linke Lügen, sie schwankte so bedenklich, daß das gefüllte Champagnerglas überfloß.
Mit einem Hoch auf alle echte, gesunde Kunst schloß er unter allgemeiner Zustimmung seine Rede.
Röschen war begeistert, hingerissen, sie fing jeden Blick auf, den er ihr zuwarf, und antwortete mit stillen, heißen Schwüren. Ein heiteres, treues Gemüt, ja, das wollte sie ihm bewahren. Sie hörte sehr wohl heraus, daß manches auf Spindler gemünzt war, den Verehrer Warwaras; in ihrer Unerfahrenheit machte sie sich aber keine Gedanken darüber, warum Julius in seiner Hochzeitsrede sich darüber so ereiferte. Er mußte sie unendlich lieben, daß er, der gescheite Mann, sich durch einen solchen Spaß beunruhigen ließ.
Nachdem noch der Rat, mit dem aufsteigenden Trennungsschmerz ringend, einige Worte des Dankes gestammelt hatte, dachte man daran die Tafel aufzuheben; um sieben Uhr ging der Expreßzug nach Verona, welcher die Neuvermählten entführen sollte. Röschen mußte erst noch nachhause, ihr Brautkleid mit der Reisetoilette zu vertauschen.
Die Herren hatten sich so vortrefflich zusammengesprochen, daß Julius neuen Champagner kommen ließ und sie bat, sich durch seinen Aufbruch nicht stören zu lassen.
Unter allgemeinem Hochrufen und Händeschütteln schritt er mit Röschen und dem Rat, von flammenden Köpfen umdrängt, der Türe zu.
Als eine Stunde darauf Röschen in eleganter Reisetoilette aus dem Zimmer trat, mußte er unwillkürlich an die Worte Spindlers denken, die ihn so unangenehm berührten. Ihr Verwandlungstalent war wirklich staunenswert. Eine zierliche Modedame stand vor ihm, die auf den hohen Stöckeln so gewandt daher trippelte, als habe sie nie andere getragen. Und zu seinem Entsetzen betrachtete sie ihn lachend durch ein Lorgnon. Und vor wenigen Monaten lachte er über den großen Hut mit den blauen Bändern, über den steifen weißen Klosterkragen!
Die Frau Rat lachte verschmitzt in heimlichem Triumph über sein Erstaunen, während der Rat kopfschüttelnd die neue, ihm ganz fremde Erscheinung betrachtete.
»Kann ich mich nun sehen lassen neben dir?« fragte sie, die Stiefelchen zusammenklappend, mit einer koketten Verbeugung, »oder bin ich nicht bürgerlich einfach genug?« setzte sie mit einer Anspielung auf seine Rede hinzu.
Er ärgerte sich selbst über sein Erstaunen – mußte er nicht glücklich sein, ein so reizendes Weibchen zu besitzen, um das ihn jedermann beneiden würde – und überschüttete sie mit Schmeicheleien.
Der Abschied von den Eltern belehrte ihn, daß ihr Herz unter dieser äußerlichen Veränderung nicht gelitten hatte, sie weinte und schluchzte wie ein Kind, als der zitternde Rat ihr den Abschiedskuß zwischen die dunklen Stirnlöckchen drückte, und von der Mutter mußte er sie gewaltsam loslösen.
»Bringen Sie mir das Kind wieder so brav, so gut zurück, wie ich sie Ihnen jetzt mitgebe; ich habe sonst nichts auf dieser Welt,« sagte der Rat und begab sich in das andere Zimmer.
Julius nahm erste Klasse bis Bozen und drückte dem Schaffner, welcher verständnisinnig auf Röschen blickte, einen Taler in die Hand.
Die roten Sammetsitze glühten im gelben Licht der untergehenden Sonne, das sich in den Vergoldungen der Wände tausendfältig brach.
Das war der Beginn der glänzenden Zukunft, die wie ein weites Feld voll farbenprächtiger, duftiger Blumen vor ihnen lag.
Die einzige Reise, die Röschen bisher gemacht, war die in das Pensionat, oder eine kleine Landpartie in den Ferien, dritter Klasse auf hölzernen Bänken. Sie schmiegte sich wohlig wie ein Kätzchen in die weichen Kissen und blickte traumverloren in stummer Seligkeit auf Julius, der ihre kleinen Hände zwischen die seinen preßte. Jetzt war es Wahrheit geworden, worüber sie damals im Atelier so erschrak– nach Italien als Mann und Frau. In einer Stunde ist es Nacht, da ging sie sonst mit der Mutter zu Bett. Mit einem ängstlichen Blick sah sie auf die vorbeifliegenden Wälder, auf die scheidende Sonne, dann wieder auf Julius. Der Zug hielt auf der ersten Station, die Lampen wurden angezündet. Ein Herr sprach laut mit dem Schaffner auf dem Perron, plötzlich riß dieser die Coupetüre auf, mit einer entschuldigenden Bewegung gegen Julius.
Der Herr stutzte einen Augenblick beim Anblick des Paares, doch schon pfiff die Lokomotive, er mußte einsteigen.
Julius erwiderte mürrisch den kurzen Gruß des Fremden.
Das war ein netter Anfang der Hochzeitsreise! Als er den Störenfried, während jener eine kleine Ledertasche in das Netz über dem Sitz warf, näher betrachtete, fühlte er sich doppelt unangenehm berührt. Das magere Gesicht Graf Araschins von der Farbe eines englischen Sattels blickte ihm entgegen, und schon hatte ihn auch der Graf erkannt. Er ließ das Monocle fallen.
»Herr Decaro, wenn ich nicht irre,« und mit einer Handbewegung gegen Röschen, »Frau Gemahlin wohl? Hochzeitsreise! Habe schon gehört, charmant.«
»Graf Araschin!« stellte ihn Julius seiner Frau vor.
Der Graf verbeugte sich militärisch.
»Pardon, daß ich störe, aber alles besetzt. Fahre nur bis Innsbruck, Pferdeangelegenheit mit Graf Spaur.«
Julius gebrauchte eine konventionelle Redensart.
Röschen errötete tief unter dem Blick des Grafen. Dieser machte es sich in der Ecke bequem, zog ein Buch heraus, auf dessen Titelblatt eine rote Reiterin über eine Hürde setzte und gab sich wohl aus Rücksicht für das Pärchen den Schein eifrigen Lesens, obwohl das flackernde spärliche Licht es fast unmöglich machte.
Die Unterhaltung des Paares beschränkte sich auf zärtliche Blicke, Händedrücke, auf die unendlich süßen Freuden, welche in solchen Stunden ein verirrtes Härchen, der warme Hauch des Atems, das Bewußtsein inniger Zusammengehörigeit bereitet; ein Gespräch verhinderte schon der Lärm des Zuges.
Nach einer halben Stunde fühlte Julius, der sich nicht zu bewegen wagte, das Köpfchen Röschens auf seiner Schulter.
Die ermattende Wonne hatte sie eingeschläfert.
Graf Araschin hatte das Buch fallen gelassen und schlummerte ebenfalls, die langen Beine auf den Sitz gegenüber gestreckt.
Julius konnte den Blick nicht wenden von der hageren Gestalt, dem braunen Gesicht mit der hervorstehenden Nase, über welche der Schein der Lampe gaukelte. Das war also der Vollblutmann, den Warwara endlich gefunden! Gräfin Araschin! Ja, das reizt die Weiber. Und wenn ich gewollt – aber ich wollte nicht! Gott sei Dank, wollte ich nicht.
Röschen machte eine leise Bewegung, schmiegte sich noch enger an ihn, ihre Stirne berührte seinen Mund, er drückte einen langen Kuß zwischen die feuchten Löckchen.
* * *
Warwara Onegin lag auf ihrer Ottomane, eine abgegriffene, von Kaffee und Fettflecken beschmutzte Rolle in der Hand, »Messalina« stand darauf. Ein mit dem Hefte völlig im Einklang stehender Schlafrock mit zerschlissenen, oft nur lose an einem Fädchen noch hängenden Seidenbändchen verziert und deutlichen Spuren der Fettschminke und Pudermasse, die sich über ihn seit Jahren ergossen, umhüllte sie. Auf dem Tische trieben sich unter aufgeschlagenen Büchern, wirr umherliegenden Photographien und einem welken Bukett die Überreste des Frühstücks umher; angebrochene Semmeln, Cakes, ein Wasserglas halb gefüllt mit abgestandenem Kaffee, ein zierlicher goldener Löffel darin.
Auf den Sammetmöbeln lag die Toilette von gestern abend, eine elegante Straßentoilette, los hinaufgeschleudert. Das zierliche Hütchen hatte sich noch glücklich mit seinen Bändern an eine Stuhllehne festgeklammert.
Ein schwerer moderiger Geruch ging von den riesigen verwelkten Lorbeerkränzen aus, unter deren Last sämtliche Bilder schief hingen, von der Decke herab gaukelte, von der schwülen Luft bewegt, eine ausgestopfte weiße Taube, ein goldenes Körbchen mit verlockenden Blumen im Schnabel, eine sinnreiche Widmung.
»Ich brenne, Marcus, wie mirs noch nie geschehen! Drum fürchte mich. Was anders in dir heißt als Messalina, das stirbt in dieser Flamme –«
Den Arm mit der Rolle erhoben, daß die weiten Ärmel zurückfielen, um die linke Hand, auf welcher ihr Haupt ruhte, lange Strähnen des nächtlich ungepflegten Rothaares wickelnd, deklamierte Warwara diese Verse. Die weißen Zähne blitzten, dann schloß sie die Augen und nur die Lippen flüsterten noch einmal leise: »Ich brenne, Marcus.«
Aus der halbgeöffneten Tür des Nebenzimmers drang der Lärm des Aufräumens, Schlüsselgeklapper. Stuhlgerück, das Ausklopfen von Betten. Plötzlich warf sie die Rolle auf den Tisch und sprang auf.
»Wollen Sie endlich Ruhe geben da drinnen! Der Teufel soll da studieren.«
»Ich scherze nicht, sieh diese zarte Hand,« fuhr sie fort, vor den Spiegel tretend. Dann hielt sie ein mit der Deklamation und lachte selbst über ihr Bild, warf sich in einen Fauteuil und tippte mit den schlanken Fingern auf den gähnenden Mund.
O, wie langweilig! »Ich brenne, Marcus!« Sie legte die Hände in den Nacken und streckte die Glieder. »Den meinen hat mit ein Schulmädchen geraubt – eine nette Messalina, die sich das gefallen läßt. – Du machst Fortschritte, Warwara!« Sie nickte lachend ihrem Spiegelbilde zu. »Was wollt' ich denn eigentlich mit ihm? Ein schöner Mann! Das kann sich eine römische Kaiserin leisten, aber nicht ich armer Teufel mit einem Heer von Schulden. Tante!« rief sie in das Nebenzimmer.
Eine robuste, ältliche Frau mit einem derben, mürrischen Gesicht trat, eine Waschschale in der Hand, unter die Türe.
»War die Maison heute schon da? Sie schrieb mir gestern ins Theater, sie muß Geld haben.«
»Und was soll ich da machen?« fragte die Frau. »Hörst du auf mich, wenn ich dir sage –«
»Nein, nein, ich höre nicht auf dich!« wehrte die Schauspielerin ab.
»Ich scherze nicht, sieh diese zarte Hand.« – Dieser langweilige Araschin mit seinem Pferdegeschwätz – aber diese kleinlichen Plackereien hätten eine Ende – Gräfin Araschin! Ich wollte es ihnen schon zeigen, diesem eingebildeten Aristokratenvolk, diese schlechten Komödianten sollten bald ihren Meister erkennen – dem Herrn Decaro mit seinem Gänschen an der Nase vorbeisausen mit vieren, ihm die Zähne lang werden lassen auf meinem Salon! Der Graf ist am Ende ein guter Mensch, Kavalier, nimmt alles par force.
»Schwacher Mann, denkst du, dich laß ich? Du bist mein, mein Kaiser – Und Erd' und Himmel sollen es erfahren,« las sie lachend weiter.
Da klingelte es. Warwara erwartete den Theaterdiener, Das Dienstmädchen kam herein und meldete den Grafen Araschin.
Warwara sprang erschrocken auf, raffte die Straßentoilette zusammen und warf alles der hereintretenden Tante in die Arme. Dann verdeckte sie rasch mit einigen Albums die Brotkrumen und Überreste des Frühstücks und stellte die Tasse hinter den Ofen.
»Laß ihn eintreten, ich werde sogleich erscheinen.« Nach diesem Befehl an das Mädchen huschte sie in das Nebenzimmer.
Graf Araschin war kein Fremder in diesen Räumen, er machte es sich bequem auf dem Sofa. Seine sehnige Gestalt, die harten, verwetterten Züge seines knochigen Antlitzes, das scharfe, kühne Reiterauge, ließen ihn trotz der ausgewählten Toilette einer Morgenspazierfahrt – seine Equipage stand vor dem Hause – durchaus nicht geckenhaft erscheinen. Araschin liebte alles, was Rasse hatte. Sein Rennstall war in der ganzen Sportwelt berühmt, ebenso seine Hundezüchterei, der Viehschlag auf seinen Gütern, die Schafe auf seinen Weiden; die Katzen in seinem Hause waren aus dem Geschlechte der Angora. Auf seinem Gig neben ihm saß ein silbergraues Windspiel, ein direkter Abkömmling des berühmten Windspiels der Königin von England. Ritt er aus, begleitete ihn eine mausgraue dänische Dogge mit herabhängenden Wangen und gestreckter Schnauze; in seinem Stall kläffte ein tadelloser glatthaariger Rattenpinscher. Livre, Wagen, Geschirre bis zur Peitsche herab waren tonangebend für die Saison, während er sich in seinem sonstigen Tun und Lassen nicht im geringsten um die Sitten und Schranken seiner Gesellschaft kümmerte, in seinem Umgang nichts weniger als wählerisch war, die obskursten Lokale besuchte, sich alle möglichen exzentrischen Scherze erlaubte, die ihm den volkstümlichen Namen »der lange Poltl« eintrugen.
Von solchem Standpunkte betrachtete er auch das weibliche Geschlecht, ein Gesicht, eine Gestalt, welche nicht die Linien des » racing Like« zeigte, beachtete er nicht, mochte die Besitzerin die Erbin von Millionen sein, aus den ältesten Geschlechtern stammen, strahlen von Geist, ihm die größten Avancen machen: die Abwege, auf welche er bei der rücksichtslosen Suche nach seinem Ideal sich begeben, trugen gerade nicht zu seinem guten Rufe bei.
Jetzt hatte er es wirklich gefunden, auf den ersten Blick erkannt in Warwara.
Das Bild Decaros im Kunstverein machte ihn erst auf die Künstlerin aufmerksam, er war kein Theaterliebhaber. Da war keine Linie, kein Farbenton, der störte, das feurige, immer feuchte Auge unter feinen braunen Bogen, die Haut von der Farbe alten Elfenbeins mit einem flammigen Hauch überzogen, der hochgewölbte, zierliche Fuß, die langen, schmalen Finger, alles durchflutet von dem geheimnisvollen prickelnden Strome, der jeden Nerv, jede Sehne spannt und nur für den Eingeweihten sichtbar, fühlbar ist.
Araschin war begeistert, selbst seine kostbare Never-mind, die Perle seines Stalles, um die ihn die ganze Sportswelt beneidete, die Siegerin von Hoppegarten, verlor für ihn Interesse.
Er liebte, wie eben der lange Poltl lieben konnte, mit den Augen, die ihn schon Unsummen gekostet hatten auf dem Rennplatz und Pferdemarkt, die unter der glänzenden Haut jeden Muskel, jeden Nerv erblickten.
Warwara muß sein werden, wie die Never-mind sein wurde, und der Sohn von »Massaplix«, der berühmte »Heißsporn«. Sie kosteten ihn ein Vermögen, Warwara höchstens das Nasenrümpfen seiner Standesgenossen – was gab der lange Poltl darum?
Er blätterte in den Albums auf dem Tische, las die goldgedruckte Schrift auf den Bändern der Lorbeerkränze; trat dabei auf das Rollenheft, welches auf dem Boden lag, und hob es auf. »Messalina« las er, dann blätterte er darin.
Er klemmte das Monocle fest.
»Donnerwetter! Das ist Rasse, muß ich mir ansehen, Messalina.«
Er vertiefte sich in das Heft, aus welchem das Parfüm Warwaras ihm entgegenduftete.
Endlich trat sie ein, in einer eleganten Morgentoilette, das rote Haar zu einem hohen Knoten geschürzt.
»Großartige Rolle für Sie,« sagte der Graf, das Heft schwingend, »geborene Messalina!«
»Sehr schmeichelhaft, Herr Graf.«
»O, kein Mißverständnis, meine nur, was Schönheit, Leidenschaft betrifft, die Rasse, mit einem Worte.«
»Ich habe Sie gestern erwartet,« erwiderte Warwara, die Schmeicheleien des Grafen mit gnädigem Lächeln empfangend.
»War noch nicht zurück von Innsbruck, habe Glück gehabt, herrlichen Traber gekauft, Jährling, kommt gleich auf den Miniatur-Track, werden sehen, mache was daraus. Da fällt mir eben ein, mit wem glauben Sie, daß ich gefahren bin? Mit einem Hochzeitspärchen!«
»Das Langweiligste, was einem passieren kann,« erwiderte Warwara.
»Stimmt, Gnädige, aber wird Sie doch interessieren. Der Maler Decaro, dem ich eigentlich das Glück Ihrer Bekanntschaft verdanke, und sein kleines Weibchen. Ein reizendes Geschöpfchen in seiner Art.«
Warwara errötete auffallend, sie machte sich an dem Tische zu schaffen.
»Sehr zärtlich, natürlich.«
»Das reinste Finkenpärchen, beneidenswert! Ich schlief bald ein, bin nicht unbarmherzig; als ich in Innsbruck erwachte, saß er noch auf demselben Fleck, ihr Lockenköpfchen ruhte auf seiner Schulter und er wagte sich nicht zu rühren. Die reinen Kinder, diese Künstler!«
»Schade, daß solche Kindereien nicht lange dauern. Er tut mir leid, dieser Decaro, er hat eine Dummheit gemacht,« bemerkte Warwara.
»Meinen Sie? Mein Gott, so ein Maler kann doch nicht viel Ansprüche machen; ein bescheidenes Weibchen, einfach erzogen, gar nicht übel, was will er denn mehr?«
»Er will aber bedeutend mehr,« erwiderte Warwara in gesteigertem Tone, »und er hat auch die Berechtigung dazu, mehr zu wollen, als ein ausnahmsweise genialer und schöner Mann.«
»Schön? Decaro? Das ist Geschmackssache; ich liebe diese Gesichter nicht, keine Rasse darin.«
»Mit Ihrer ewigen Rasse! Was verstehen Sie denn eigentlich unter Rasse?«
»Sehr schwer zu definieren, sehr schwer, mein Fräulein. Rasse, das ist –« – die schmale braune Stirne zog sich in ungewohnte Denkerfalten – »wenn die Natur in einer Laune ein Wesen schafft, das in allen seinen Teilen, äußeren und inneren Eigenschaften Temperament, Kraft, Farbe, Knochenbau, dem Ideal seiner Art am nächsten kommt oder es ganz erreicht. Sehen Sie, ›Never-mind‹, ›Heißsporn‹ an – ah bah, alles nichts, sehen Sie sich selbst in den Spiegel, und Sie wissen, was Rasse ist.«
Der Graf war sichtlich zufrieden mit seiner Definition, in der Zusammenstellung Warwaras mit seinen zwei Stallperlen sah er eine Schmeichelei.
In Gedanken verfolgte Warwara das glückliche Paar nach Italien. Wie ekel erschien ihr das Zimmer mit all dem welken Tand, welk wie ihr Leben an der Seite der griesgrämigen Tante. Und die Maison und die anderen drängten alle. Die häßliche Theaterluft, die ganze geschminkte Existenz. Nie werde sie so glückliche Stunden erleben, so geliebt werden samt ihrer Rasse. Ein Sehnen, das sie bisher nie gefühlt hatte im Geräusch und Gedränge ihres Lebens, stieg jetzt in ihr auf und preßte sogar Tränen in ihre Augen.
Araschin suchte den Grund ihrer sichtlichen Verwirrung in dem günstigen Eindruck, den er heute gemacht hatte, er war auch noch nie so geistreich, so voll » Spead«, es war ihm, als säße er im Sattel der » Never-mind« und flöge als Sieger dem letzten Hindernis zu; und es ging ihm wie in solchem Fall, alle Bedenken schwanden, mit trotziger Kühnheit, mit einem stupiden Eigensinn stürmte er darauf los.
»Fräulein Warwara, ich bin ein ehrlicher Reiter, drauf und dran; ich schleiche nicht lange hinten herum, kenne ich nicht. Ich liebe Sie, ich will Sie heiraten.«
Der unvermittelte, offene Antrag kam Warwara doch überraschend, ein Graf Araschin hätte nach Art seiner Genossen auch auf andere Weise versuchen können, sie zu erobern. Diese Ehrlichkeit bewegte sie, er liebte sie wirklich, wenn auch auf seine Art: trotzdem ließ sie sich nicht überraschen, und jetzt, wo sie sich seiner sicher fühlte, wollte sie sich den Reiz nicht rauben, sich möglichst kostbar zu machen.
»Ich gefalle Ihnen als Rasse und Sie begehren mich zur Vervollständigung ihres Sportarsenals; so liegt die Sache,« entgegnete sie. »Nun, am Ende ist das eine Auffassungssache und Sie würden mich gewiß gerade so lieben, gerade so sorgsam pflegen als ihre ›Never-mind‹, aber ich verlange etwas mehr. Ich war so lange Schaustück, Augenweide, daß ich mich, wenn ich schon das Opfer bringe, meinem Beruf zu entsagen, darnach sehne, endlich einmal nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Herzen betrachtet zu werden. Nicht daß ich glaube, es sei Ihnen unmöglich, aber ich meine, warten wir ein wenig, binden Sie sich noch nicht, vielleicht führt Sie Ihre Begeisterung irre, beruhigen Sie erst Ihr leidenschaftliches Auge und dann dann fragen Sie noch einmal Ihr Herz.«
Ihr Auge, welches bisher die gesenkten Wimpern bedeckten, richtete sich jetzt mit all seiner Zaubermacht auf den Grafen, den ihr ganz unerwarteter Widerstand noch mehr entflammte.
»Wie unrecht Sie mir tun, Warwara, mit Ihrem Spott! Sehen Sie denn nicht, daß Sie mich ganz verändert haben, daß mir an den ganzen Sport- und Pferdegeschichten kein Deut mehr gelegen ist, daß ich mehr im Theater zu sehen bin als auf dem Rennplatz? Wenn Sie es verlangen, leere ich meinen ganzen Stall und meine Remisen und gehe mit Ihnen wie ein junger Referendar mit seinem Bräutchen durch die ganze Welt. Aber Sie werden es selbst nicht wollen, Sie werden selbst die kühnste Reiterin werden, die sorgsamste Pflegerin meiner Lieblinge, Sie werden entzückt sein von dieser neuen Welt, in der Sie eine glänzendere Rolle spielen werden, als Sie je gespielt haben, und werden sie nicht mehr verachten. Fliegen Sie nur einmal dahin auf dem Rücken eines edlen Vollblutes an meiner Seite! Da liegt auch Poesie drin, eine Ihrer würdige Poesie. Gott, wenn ich daran denke, wenn ich dieses Bild vor mir sehe! Warwara –«
Wilde Reiterleidenschaft belebte seine Züge, der hagere Körper spannte sich in zäher Kraft und Energie.
»Sie dürfen mich nicht abweisen, nicht einmal zögern, Sie müssen mein werden.«
Er erfaßte ihre beiden Hände und drückte sie, daß sie laut aufschrie; auch ihre Wangen brannten. Jetzt gefiel er ihr wirklich, der Graf Araschin.
»Sie sind ein Stürmer, Graf, Sie überrumpeln mich! Wie sollt' ich widerstehen, Sie abweisen! Aber lassen Sie uns so wichtige Dinge doch in Ruhe überlegen. Eine Künstlerin muß vorsichtig sein; was die Welt ohnehin glauben wird, müßten auch Sie mir einst zum Vorwurfe machen: ich hätte einen unbedachten leidenschaftlichen Augenblick ausgenützt. Zu diesen Geschöpfen gehöre ich nicht, will ich nicht gehören.«
»Weiß ja alles, Warwara, gar nicht mehr nötig zu berühren. Haben Sie denn gar kein Vertrauen zu mir?«
»Vertrauen? O ja! Ich werde es Ihnen beweisen, Ihre Equipage steht unten?«
»›Alma‹ und ›Diadem‹, ein Prachtpärchen!«
»Gut, ich werde mich rasch ankleiden, wir machen zusammen eine Spazierfahrt in den Park, die frische Luft wird uns gut tun und die böse Welt kann sich auslästern. Daß ich nicht als die Geliebte des Grafen Araschin gelten will, wissen Sie ja, also kennen Sie auch die Bedeutung dieses Schrittes.«
Sie lächelte ihm verführerisch zu.
Er küßte stürmisch ihre Hand, und als sie ihm diese länger als nötig überließ, ihren Mund.
»Beruhigen Sie sich, ich werde es heute noch im Klub öffentlich verkünden, mit wem ich in den Park gefahren bin, und wehe dem, der nur mit den Wimpern zuckt.«
Das Gespann des Grafen bildete den Mittelpunkt des Interesses auf dem Korso. Das Verhältnis des Grafen zu Warwara war längst bekannt und bei seiner Geschmacksrichtung nicht auffallend; es war auch nach der Moral der Großstadt gar nichts weiter darüber zu sagen, so lange es in den allgemein üblichen Schranken blieb, das heißt, kein öffentliches Ärgernis gab. Man rümpfte schon längst die Nase über seine durchaus nicht stilgerechten Liaisons, die den guten Geschmack beleidigten, aber dieses öffentliche Auftreten mit Warwara war ein Skandal, eine Ohrfeige, die er der Gesellschaft in seiner bekannten Rohheit und Rücksichtslosigkeit gab. An das Gerücht von ernsteren Absichten des Grafen wollte man nicht glauben, im Interesse all der jungen Aristokratinnen der Hauptstadt, deren Hoffnung der reiche Graf war.
Warwara war mit einfacher Vornehmheit in Hellgrau gekleidet und erwiderte all die beleidigenden, eine deutliche Sprache redenden Blicke, welche sie von allen Seiten trafen, mit einer entwaffnenden Gelassenheit. In wenigen Monaten fließt ihr alle von Liebenswürdigkeit über und drängt euch in meine Salons. Der Gedanke machte ihr unbändige Freude, sie genoß ihre Rache voraus.
Der Graf entschädigte sie außerdem durch die Aufmerksamkeit, welche er ihr erwies, indem er gerade bei besonders gefährlichen Begegnungen lebhaft in sie hinein sprach, womöglich eine scharfe Bemerkung fallen ließ, welche gehört werden mußte.
Die ganze Aristokratie, selbst der Hof war vertreten, in dem Schatten- und Lichtspiel des Blättergewölbes war alles Farbe und Bewegung, die unzähligen auf und ab sich bewegenden, einander fast berührenden Pferdeköpfe mit den silbernen, schäumenden Trensen und feurigen Augen, die farbige Blitze werfenden Räder, die grellfarbigen Livreen ließen die in der apathischen Ruhe des Sehens und Gesehenwerdens zurückgelehnten Insassen der Wagen immer mehr als farbloses Beiwerk erscheinen, um welches sich auch die Fußgänger, mit gemischten Gefühlen diesen Strom des Reichtums betrachtend, wenig kümmerten.
Warwara empfand trotz allen Versuchen, es ihr zu vergällen, ein wonniges Gefühl, keineswegs nur das des befriedigten Ehrgeizes und Stolzes. Jetzt, wo sie sich mitten in dieser Sphäre befand, war sie sich erst recht ihrer geistigen und körperlichen Überlegenheit bewußt, die kleinen Mätzchen und Allüren, welche ihr vielleicht noch fehlten, kosteten sie, die routinierte Künstlerin, nicht viel Zeit zum Erlernen, und wie manche dieser stolzen Damen in den wappengeschmückten Wagen hatte auf eine zweifelhafte Vergangenheit zurückzublicken! Alles Schein, Komödie, sie brauchte kein Heimweh zu haben nach ihrem Berufe, er werde ihr voll und ganz bleiben mit all seinen berauschenden Erfolgen und kleinlichen Intriguen.
Nein, das wonnige Gefühl hatte noch einen anderen Grund. Der nagende Schmerz um ein von ihr verscherztes Glück, der sie seit Wochen quälte, war verschwunden, ein neuer, heißer Lebensstrom durchbrauste sie: herrschen, glänzen, zu ihren Füßen sehen wollte sie diese ganze närrische Welt um sie her, dazu fühlte sie sich geboren, nicht zu einem kindischen Liebesgetändel mit einem Decaro, dem nur zu bald die äußerste, ärmlichste Prosa folgen mußte; der Mann war nur ehrlich und etwas vernünftiger als sie, darum verzichtete er auf die ihm zu hoch hängende kostbare Frucht und griff nach der kleinen, unscheinbaren Beere, die sich willig seinen Händen bot.
Sie stellte im stillen Vergleiche an zwischen dem Grafen neben ihr und Julius, hier an diesem Platz, inmitten dieser Welt fiel er zu Gunsten des Grafen aus, außerdem hatte er wirklich edel gegen sie gehandelt, mit echtem Mannesmut, das Urteil der ganzen Welt verachtend; sie empfand eine dankbare Liebe zu ihm.
Die Wagenreihe stockte, dicht neben dem Grafen hielt der Landauer des Fürsten K., eines intimen Bekannten, auf der Rückfahrt begriffen; seine Gattin und Tochter saßen bei ihm.
Araschin stach der Mutwille, außerdem waren ihm auch die Blicke nicht entgangen, welche seine Gefährtin trafen. Das Verblüffen hatte für ihn stets den höchsten Reiz.
»Darf ich Dich meine Verlobte nennen?« flüsterte er Warwara zu, »es gibt einen Hauptspaß.«
Warwara ahnte, was er beabsichtigte, ihr Entschluß stand ja schon lange fest.
»Nenne mich so,« erwiderte sie leise.
Araschin wandte sich gegen den Fürsten und grüßte; dieser war gezwungen, ein Gespräch anzuknüpfen, so sehr sich auch seine Damen an der Begleiterin des Grafen stießen.
Araschin stellte mit völliger Gelassenheit vor. »Fräulein Warwara Onegin, meine Braut.«
Die Hüte der Damen stießen aneinander, die junge Fürstin wurde feuerrot, der Fürst verneigte sich stumm gegen Warwara. Zum guten Glück für ihn bewegten sich die Wagen wieder vorwärts und er neigte sich leise vor, den Kutscher zur Eile antreibend. Die Wagen trennten sich, ehe noch ein Wort gesprochen werden konnte. Doch die ungeheuerliche Nachricht schien auf unbegreifliche Weise über die Kutscher und Bedienten, die Pferde hinweg voranzufliegen, im Zirkel wieder zurück, hinter Araschin her mit Windeseile. Als er jetzt auf dem andern Geleise zurückfuhr, sah er in jedem Wagen, an welchem er vorbeifuhr, die Köpfe zusammenstecken und aus dem Geflüster klang sein und Warwaras Name. Man wandte sich um, man erhob sich die gute Sitte vergessend, von den Sitzen.
Der Fürst hatte seine Schuldigkeit redlich getan, bis heute abend war die Verlobung kein Gerücht, sondern eine Tatsache.
Warwara genoß auf ihrem hohen Sitz in vollen Zügen ihren Triumph. Und das alles hätte sie bald einer phantastischen Marotte geopfert. Sie empfand jetzt ein Gefühl der Dankbarkeit gegen das Schüchterchen.
Als sie nach Hause kam, fand sie Madame Maison, ihre Schneiderin, in dem kleinen Salon, in welchem sich noch immer die Brotkrumen auf dem Tische herumtrieben. Die Gläubigerin hatte sich von der Tante nicht mehr vertrösten lassen und trat Warwara mit einem entschiedenen Tone gegenüber.
»Mit wem reden Sie denn eigentlich?« fragte die Schauspielerin.
»Hier steht es schon lange genug, daß ich es wissen kann«, erwiderte die erregte Schneiderin in fast weinerlichem Tone, eine lange Rechnung vorzeigend.
Warwara nahm sie und las.
»Schreiben Sie darauf: Rechnung für die hochgeborene Gräfin Warwara Araschin und kommen Sie in einem Monat wieder.«
Frau Maison faßte sich rasch, in ihrer langjährigen Praxis hatte sie sich das angewöhnt, mit einer tiefen Verbeugung und einem einschmeichelnden Lächeln empfahl sie sich.
Warwara erfaßte eine unbändige Freude, sie fiel der alten Tante um den Hals und drehte sie im Zimmer umher, es war ihr zu Mut, als müsse sie all diesen armseligen Flitter um sie her zum Fenster hinauswerfen, die staubigen Lorbeerkränze mit den aufdringlichen Schleifen, die Photographien und Widmungen, ihr ganzes vergangenes Leben. Ihre Seele wußte ja nichts von der Kunst, ihren erhabenen, unersetzlichen Genüssen. Sie gehörte der Kunst wie viele ihrer Genossinnen nur als Weib an, jetzt, da sie eine andere glänzende Gelegenheit gefunden hatte, ihre Vorzüge in volles Licht zu bringen, gab sie alles leicht hin, ohne das geringste Weh, wie ein verbrauchtes Kostüm.
Sie kauerte sich mit der alten Tante, ihrer Vertrauten, in eine Ecke des Sofas und schmiedete mit ihr glänzende Pläne für die Zukunft. Araschin selbst war darin nur ein kleiner Punkt, der allmählich ganz verdämmerte im Gefunkel ihrer Phantasie.
* * *
Das war ein molliges, behagliches Nest, in welches das junge Ehepaar Decaro sich förmlich einwühlte. Die Ausfüttterung übernahm während der zweimonatlichen Abwesenheit ihrer Kinder in Italien die Frau Rat; den künstlerischen ersetzte die innige Liebe, welche dem Einfachsten, Unbedeutendsten ihre mystische Wärme einhaucht, unbewußt nur nach dem Schönen greift.
Der Inhalt ihrer Sparkasse, alle diese kleinen, mühseligen Errungenschaften der jahrelangen Selbstentsagung einer Mutter, die Resultate genialer geheimer Schachzüge im Haushalt, wurden fast vollzählig geopfert. Auf dem kleinen Vermögen ruhte fest und unerschütterlich die Hand des Rates, dagegen duldete er gelassen die kleinen Raubzüge seiner Leonore im eigenen Heim, wenn er auch manch altes Stück mit schwerem Herzen scheiden sah, in der Überzeugung, daß es da oben nicht gehörig geschätzt wurde.
Der Glasschrank mit den Tassen leerte sich zusehends, da und dort fehlte ein Bild, das alte Klavier, an welchem er oft seine bescheidenen musikalischen Kenntnisse verwertete, wurde hinaufgeschafft. Selbst des Rats Zimmer blieb nicht verschont, ein Lehnstuhl, ein altes Erbstück seiner Familie aus dem vorigen Jahrhundert, welcher Julius besonders wert war, verschwand eines Tages. Bis in das Heiligtum seines Schreibtisches streckte die Mutter ihre nimmersatten Hände. Er ließ alles ruhig über sich ergehen, nur als sie das Bild Röschens im Mädchenkleide, welches im Salon hing, entfernen wollte, brauste er auf, nie käme das Schüchterchen über seine Schwelle, so lange er lebe – er nahm es selbst von der Wand und trug es in sein Zimmer.
Besonders dem Schlafzimmer widmete die Rätin ihre ganze liebende Sorgfalt. Die Wäsche war von jeher ihr Stolz, das war in ihren Augen der größte Schatz der Hausfrau und Röschen sollte darum keine Fürstin zu beneiden haben.
Mit einer wahren Angst erwartete sie den Tag der Rückkehr, ob auch alles zur Zufriedenheit Decaros ausgefallen sei. Obwohl dem Maler das Ganze etwas hausbacken nüchtern vorkam, konnte er sich doch den Eindruck dieser behäbigen Ruhe und gewissenhaften Ordnung, die ihm in seinem Junggesellenleben geblieben war, nicht verschließen und gab sich auch gerührt dieser Fülle von Liebe und Aufmerksamkeit willig hin. Eher daß Röschen nicht einverstanden war mit vielem, und mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit, die ihn peinlich berührte, der Mutter offen ihre Meinung äußerte. Doch das schmerzte nicht, wenn nur er sie lobte.
Und je länger er in diesen niedlichen Räumen weilte, mit den gestickten Schutzdeckchen auf den nagelneuen Möbeln, den Porzellan- und Gipsfigürchen, alten Standuhren, den strahlenden Spitzenvorhängen mit den großen Blumen, welche das Licht so voll und klar hereinfallen ließen, desto lieber wurden sie ihm.
Er fühlte einen wohltätigen, ihn beruhigenden Kontrast mit seinem üppigen, farbigen Atelier, und Röschen mit der weißen, spitzenbesetzten Schürze über dem einfachen Hauskleide, paßte so vorzüglich herein. Er gefiel sich in seiner burschikosen Hausvatermiene, kaufte einen seidenen Schlafrock, steckte seine Füße in gefütterte Pantoffeln und machte sogar Proben mit der Meerschaumpfeife des Rates. Das alles war für ihn ein ganz originelles Stimmungsbild, an dessen malerischen Reizen er sich erfreute. Alles freudiges Licht, Herzlichkeit, Behaglichkeit, dämmernde Ruhe, so recht einladend zu süßem, weltvergessenem Liebesgetändel.
Röschen war zuerst fassungslos über dieses Wunder, das sie in ihrem Julius vor sich gehen sah, nur aus Angst um ihn übte sie ja so strenge Kritik an der Mutter. Die ganze Reise beunruhigte sie der Gedanke, was wird die Gute wohl alles zusammenbasteln zum Entsetzen ihres Julius. Bald aber sah sie darin nur die Allgewalt der Liebe. Julius, der große Julius wollte nichts und sah nichts als sein kleines Weibchen.
Was waren alle die hohen Genüsse der italienischen Reise, die Zaubernächte von Sorrent und Capri, gegen die Wochen, die jetzt kamen! Es war eine selbstvergessene, fast erschlaffende Ruhe, der er sich hingab, und er spürte keinen Drang zu neuem Schaffen. Er glaubte selbst im stillen nicht an den langen Bestand seiner Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustand. Alles war ihm noch lange nicht in Fleisch und Blut übergegangen, mehr ein Traum, aus dem er sich ungern losmachte.
Auch Röschen drängte ihn nicht zu neuem Schaffen, der Haushalt beschäftigte sie ganz, sie überschüttete ihn mit kleinen Sorgfalten, spielte mit ihm wie mit einer Puppe und war froh, ihn wenig im Atelier zu wissen, wo er ihr nicht mehr angehörte. Ihr Interesse für die Kunst, zu dem sie sich als Braut so mächtig aufschwang, schien ganz untergegangen in den Tändeleien der jungen Ehe. Der Rat und seine Frau waren es jetzt, welche Julius aus seiner Untätigkeit aufrüttelten. Sie taten es jedoch, wenn auch in der besten Absicht, auf eine völlig verkehrte Weise, indem sie in ihrer Ängstlichkeit immer die materielle Seite vorkehrten, den notwendigen Erwerb. Daß eine künstlerische Tätigkeit nicht in gleichmäßiger stetiger Weise verlaufen könne wie irgend eine andere Arbeit, von allen erdenklichen seelischen Stimmungen, einer gewissen Inspiration abhängig sei – ein Zustand, welchen Julius mit »aufgelegt« oder »nicht aufgelegt« bezeichnete, wollte der Rat nicht zugeben, ebenso wenig den Grundsatz, daß der Künstler immer arbeite, auch bei scheinbarem Nichtstun, ja oft dabei gerade am angestrengtesten.
So schlichen sich allmählich bereits die ersten Mißtöne ein. Julius, eine gewisse Berechtigung der väterlichen Ermahnungen einsehend, wurde mißtrauisch, unzufrieden mit sich selbst; schon tauchte der Vergleich auf zwischen jetzt und einst, und der unvermittelte Kontrast, in den er sich begeben hatte, begann sich zu rächen.
Was wollte er denn eigentlich in diesem warmen Nest? Allmählich lüftete er die weißen Vorhänge, es kam ihm manchmal der Gedanke, ob sie nicht zu seinem Leichentuche werden könnten.
Seit er von der Reise zurück war, hatte sich niemand um ihn bekümmert, selbst seinen alten Freunden war es wohl jetzt zu langweilig bei ihm. Dagegen las er in den Zeitungen spaltenlange Artikel über rastlose Kollegen. Der hielt ein großes Fest ab, bei welcher die Spitzen der Gesellschaft vertreten waren, jener hatte Audienz bei Hofe oder bekam einen Orden.
Eines Morgens las er unter dem Titel »Aus der Gesellschaft« folgende Notiz:
»Die Wintersaison verheißt dieses Jahr sehr abwechslungsreich zu werden, besonders in den aristokratischen Kreisen regt sich auffallend frisches Leben, im Vergleich mit früheren Jahren. Das gräflich Araschinsche Haus geht allen mit gutem Beispiel voraus. Nachdem die Herbstjagden auf Schloß Hohenheim in glänzender Weise abgehalten und die Herrschaft in die Stadt zurückgekehrt ist, rüstet man sich in dem Palais an der Königsstraße bereits zu neuen Festlichkeiten, Diners wechseln mit glänzenden Routs, für die Karnevalszeit soll unter Leitung der Gräfin ein Liebhabertheater arrangiert werden, zu dessen Darstellern man die ersten Namen der Residenz rechnet. Die Gesellschaft darf sich zu dem ›neuen Eindringling‹ nur gratulieren,« fügte das demokratische Blatt hinzu.
Julius las immer wieder diese Zeilen. Seine lebhafte Phantasie schuf die Bilder dazu: Warwara zu Pferd, Warwara als Tänzerin, Warwara als gefeierte Herrin des Hauses Araschin … Ja, sie verstand es, dieser langweiligen, eintönigen Gesellschaft neues Leben, neuen Geist einzuhauchen; dem Eindringling werden sie alle huldigen, der Komödiantin, der Abenteurerin, alle die hochnasigen Komtessen und Baronessen. Und sie müssen ihr huldigen, weil dem Geist und der Schönheit sich von jeher alles gebeugt hat in der Welt. Wie wird sie lachen, wenn sie der Sitzungen gedenkt, seiner stürmischen Huldigung, – nein, sie hat kein Recht zu lachen und sie wird auch nicht lachen, sie hatte lebhaftes Interesse an ihm, liebte ihn vielleicht – wer weiß! Daß sie den Grafen Araschin geheiratet hat, beweist gar nichts: er bietet eine glänzende Zukunft, Reichtum, Rang. Dieser Juchtenmensch und dieses Weib!
Er ging ins Atelier, holte Warwaras Bild hervor und stellte es vor sich auf die Staffelei.
Das warme Licht spielte in dem roten Haar, die leise geöffneten Lippen schienen sich zu bewegen, ihr Duft füllte den Raum.
Da legten sich zwei Hände um seine Augen.
»Verschaue dich nicht in deine schöne Warwara,« kicherte es in sein Ohr – Röschen!
Er hatte das häßliche Gefühl des Ertapptseins.
»Laß doch diese kindischen Spässe,« sagte er ärgerlich, die Hände rauh abstreifend.
Röschen zog sich erschreckt zurück und blickte ihm mit unbestimmter Angst ins Gesicht.
Da bereute er seine Heftigkeit; er hatte in diesem Augenblick, zu seinem eigenen Entsetzen, bereits das Gefühl des Mitleids und war infolgedessen von einer plötzlichen Herzlichkeit, die Röschen nicht minder beunruhigte.
»Du verstehst das nicht, Kindchen, aber man muß hie und da seine Arbeiten wieder studieren. Es ist höchste Zeit, es muß wieder etwas geschehen – schau, ich hätte gerade so gut ein anderes Bild erwischen können – reiner Zufall, daß mir gerade dieses in die Finger kam,« sprach er verwirrt, im Tone einer Entschuldigung.
»Aber natürlich, das verstehe ich sehr wohl, warum sollst du denn dieses Bild nicht – es ist ja ein Meisterwerk – ah, jetzt hab' ich's, du ärgerst dich, daß sich die Frau Gräfin nicht mehr um dich bekümmert, in ihr Haus ladet – das ist aber ungerecht von dir, an uns wäre es ja, ihr Besuch zu machen. Das willst du aber nicht, du bequemer Kater –«
Sie streichelte zärtlich seinen Bart, welcher die Modeform längst überschritten hatte.
»Willst Du das?« fragte er.
»Gewiß! Offen gesagt, ich möchte selbst einmal solch ein Haus sehen, ein Stückchen von der großen Welt, ich denke, es müßte dann doppelt heimlich sein zu Hause, und Du wirst gewiß neue Anregung finden. Komm, probier es gleich heute, so etwas darf man nicht aufschieben. Ich ziehe mein schwarzes Seidenkleid an, da kann ich mich schon sehen lassen. Du siehst ja so wie so aus wie ein Fürst. Willst Du, so ziehe ich mich gleich an, es ist gerade Besuchstunde.«
Julius zögerte, das arglose Drängen seiner Frau ließ ihm seine innere Unruhe recht erbärmlich erscheinen. Fürchtete er sich denn vor Warwara?
Er mußte jetzt gehen um sich selbst Lügen zu strafen.
»Es ist ein entscheidender Schritt, den wir tun,« warnte er noch einmal. »Werde Dir klar darüber! Es handelt sich nicht um den Grafen Araschin allein, eines gibt das andere, wir werden dann unaufhaltsam in die große Welt gerissen. Willst Du es? Hast Du keine Scheu?«
»Schüchterchen liegt Dir auf der Zunge, nicht wahr?« erwiderte Röschen. »Na, warte, jetzt will ich Dir einmal zeigen, daß es endgültig tot ist. Wir gehen zu Araschin, in einer Viertelstunde bin ich bereit.«
Sie eilte hinaus.
»Röschen hat recht, so kann es nicht fortgehen, die Person glaubt am Ende selbst, ich scheue mich, mit meiner Frau bei ihr zu erscheinen.«
Julius ging nun mit größter Sorgfalt an seine Toilette.
Röschen bot sich zum ersten Male Gelegenheit, die Schätze ihrer Aussteuer zu benützen, und Julius war diesmal völlig einverstanden mit ihrer Erscheinung, die ihm im Gegensatz zu der täglichen, einfachen Hauskleidung tadellos schien.
Das Paar warf bei dem Verlassen der Wohnung noch einen selbstzufriedenen Blick in den Wandspiegel – man konnte sich sehen lassen.
Auf der Treppe begegnete ihnen der Rat und seine Frau.
Er war sichtlich unangenehm überrascht von der Absicht seiner Kinder. »So hoch hinaus, zu Araschin? Glaubst du, daß man dich dort erwartet?« fragte er.
Das war Öl in das Feuer.
»Das gibst du gut! Hoch hinaus!« erwiderte Julius verletzt. »Als ob es einen Kreis gäbe, der für einen Künstler zu hoch ist! Wir machen ihn ja hoch; was sind diese Leute ohne uns samt Titel und Geld? Ich bitte dich, überlasse derlei Unterscheidungen mir; du wirst nie unsere Stellung begreifen können. Allerdings, wenn ich mich noch lange da oben verkrieche, wird mich niemand mehr erwarten, so weit will ich es aber nicht kommen lassen, darum – adieu, Papa.«
Die Frau Rat neigte sich auch seiner Ansicht zu.
»Graf Araschin wird gewiß eine große Bestellung machen, das sind Leute, welche die Kunst bezahlen können.«
Kopfschüttelnd sah der Rat dem Paare nach.
* * *
Das Araschinsche Palais überragte, im Stile der Frührenaissance gebaut, mit seinem flachen Dache das ganze Viertel.
Ein Portikus, von mächtigen Säulen getragen, deren Schäfte nach dem Muster der Certosa zu Pavia, die Form antiker Kandelaber mit reichem Blattschmuck hatten, die geschwärzten, mächtigen Quader des Unterbaues, die hohen Fenster mit reichen Gesimsen, erinnerten an die römischen Adelsburgen. Die beiden Rossebändiger zur Seite der Einfahrt, Nachahmung der berühmten Kolossalgruppe auf dem Quirinal, vervollständigten diesen Eindruck, während sie zugleich eine Anspielung bildeten auf das Lebensideal der Besitzer.
Röschen schmiegte sich enger an ihren Gatten, als sie die Kühle der mächtigen Eintrittshalle umfing, und auch ihn beschlich ein sonderbar ehrwürdiges Gefühl, über das er lachen mußte, wenn er an den Herrn dieses Hauses dachte, den Grafen mit dem Jockeigesicht.
Sie sprachen kein Wort das stattliche, breite Treppenhaus hinauf, dessen Wände alte Ahnenbilder in Lebensgröße schmückten.
Die Araschin waren russischen Ursprungs. Zur Zeit der Reformation, welche vereinzelte Lichtstrahlen selbst bis in das barbarische Rußland warf, war die Familie, deren damaliges Haupt, Iwan Araschin, in Paris die neue Lehre eingesogen hatte, nach Verkauf der Güter und Verzicht auf alle Ehren des Hofes nach Deutschland ausgewandert.
Starkknochige, derbe Slavenköpfe blickten unter Zobelmützen und Pelzturbanen, starrend von Waffen, auf das Paar.
Der öffnende Lakai warf einen langen Blick auf Besucher und die Karte und entfernte sich ohne Bescheid über die Anwesenheit oder Abwesenheit der Herrschaft.
Röschen hatte Zeit, an ihrem Gatten zurecht zu zupfen, jedes Stäubchen an ihm zu entfernen. Sie schöpfte tief Atem und lauschte nach dem geheimen Pulsschlag dieser fremdartigen Räume, während Julius sein mächtig pochendes Herz durch Betrachtung der vortrefflichen Pferdebilder zu beruhigen suchte, welche das Vestibül schmückten.
Endlich schlich der Diener wieder lautlos heran, mit einer Verbeugung und Handbewegung andeutend, daß man ihm folgen möge.
Dies schweigsame Zeremoniell wirkte beängstigend auf Röschen, sie war trostlos über die knarzenden Stiefeln ihres Gatten, welche einen so profanen Lärm machten. Sie fühlte wieder das Schüchterchen sich rühren. Als sie auf Julius blickte, um neue Kraft zu schöpfen, bemerkte sie eine sichtliche Aufregung an ihm, die er vergebens hinter einem Hüsteln zu verbergen suchte
»Aha, jetzt hat es ihn selbst gepackt,« dachte sie mit leiser Schadenfreude, »jetzt will ich erst recht mutig sein.«
Der Salon war leer, soviel in dem Dämmerlichte zu erkennen war, welches sich durch herabgelassene Seidenvorhänge mühsam Bahn brach. Bei der gediegenen Vornehmheit, die hier herrschte, fiel eine gewisse Unsauberkeit und Unordnung auf.
Auf einem kostbaren Diwan lag nachlässig hingeschleudert eine Damenbrosche, unter kostbarem Nippes trieb sich ein Handschuh umher, und auf dem weißen Bärenfell unter einem kleinen, kostbaren Tischchen lagen Orangenschalen. Die Spiegelwände warfen von allen Seiten das Bild des Paares zurück und ließen den Raum endlos erscheinen.
Röschen kam das entsetzlich ungemütlich vor, sie empfand ordentlich Heimweh nach ihrer kleinen Wohnstube; ihre Füße, in dem indischen Teppiche ganz versunken, brannten, als stünden sie in heißem Wasser. Doch belustigte es sie, sich und ihren Gatten von allen Seiten zugleich betrachten zu können; das war ihr etwas völlig Neues. Sie nahm alle möglichen Stellungen ein und mußte über die drollige Wirkung lachen.
»Wenn man sich da küßt, das müßte aber komisch sein,« sagte sie im Flüsterton.
»Julius, küsse mich einmal, rasch!« Sie legte die Hände auf seine Schultern und blickte nach dem gegenüberliegenden Spiegel.
Julius war entrüstet über diese Zumutung.
»Na – rasch!«
»Aber ich bitte Dich, laß doch diese Dummheiten, jeden Augenblick kann ja jemand kommen.«
»Eben darum – rasch!«
Röschen spitzte lachend den Mund, sie hatte nun einmal die Laune, eine unbezwingliche Neugierde, diesen verzehnfachten Kuß zu sehen.
Julius schien es am besten, ihr den Willen zu tun, ja er freute sich einen Augenblick über diese überraschende Unbefangenheit Röschens, ihren kindlichen Humor.
Er küßte sie – da rauschte die Portiere, die Gräfin trat, beide Hände ihnen entgegenstreckend, mit liebenswürdigem Lächeln auf die beiden zu, welche vergeblich ihre Bestürzung zu verbergen suchten.
»Herzlich willkommen, meine lieben Kinder!«
Diese zwischen den Kulissen gebräuchliche Ansprache hatte sich Warwara nicht nehmen lassen. »Nach ihrem Befinden zu fragen ist überflüssig nach dem erquickenden Anblick, den Sie mir eben verschafft haben. Wie glücklich sind Sie, Herr Decaro – wie lange haben wohl diese Spiegel einen solchen Kuß nicht mehr wiedergegeben! Nicht erröten, junges Frauchen! Seien Sie stolz darauf, einen solchen Mann zu haben, der sich die Frische der Empfindung so bewahrt. Ich bin nun einmal dazu berufen, Sie in so zärtlichen Momenten zu überraschen, gönnen Sie mir dieses bescheidene Glück! Ach, ist sie reizend, das Schüchterchen – pardon, Frau Decaro!«
Sie sagte das alles verschiedenartig, bald mit feinem Sarkasmus, bald mit warmen, fast wehmütigem Gefühle.
Julius war unglücklich, ein unbegreifliches Verhängnis ließ ihn gerade diesem Weibe gegenüber stets als die lächerliche Figur eines knabenhaft verliebten, völlig unweltläufigen Mannes erscheinen, er konnte sich nicht mehr ganz erholen von der neuen Schlappe und war in diesem Augenblick erbost über Röschen, die an allem schuld war.
»Nun erzählen Sie von ihrer Reise, nein, erzählen Sie nicht, ich will Ihnen erzählen von Ihrer Reise – o, ich habe überall meine Spione,« begann Warwara. »Abends sieben Uhr sind sie abgereist mit dem Expreßzug, selig in einander versunken, die Hände verschlungen, um neun Uhr neigte sich das kleine Köpfchen da auf Ihre breite Schulter, Sie mucksten sich nicht mehr von der Stelle und drückten einen Kuß auf die schöne weiße Stirne, zwischen diese kleinen Löckchen – da gucken Sie, wie ich das alles weiß, nun, am Ende gehört nicht viel Phantasie dazu, aber ich weiß es sogar von einem Augenzeuge – wer kann da schlafen, selbst Graf Araschin nicht.«
Julius sah sie scharf an bei diesen Worten, sie klangen wie ein Seufzer, die Gräfin erwiderte seinen Blick unter den langen goldenen Wimpern hervor.
»Der Graf ist sonst nicht gerade sentimental, zu abgehärtet vom Sport – wie werden Sie erst lachen, wenn ich Ihnen sage, daß dieses Zusammentreffen im Coupé nicht wenig beigetragen hat zu meiner raschen Heirat.«
»Unser Zusammentreffen mit Graf Araschin? Sie machen mich wirklich neugierig, Gräfin,« bemerkte Decaro.
»Der Graf,« erwiderte die Gräfin, »erzählte mir die Szene in so reizenden Farben, daß ich selbst lüstern wurde nach einer solchen Hochzeitsreise. Eine Stunde nach seiner Erzählung verlobten wir uns.«
Der zierliche Schuh Warwaras tippte nervös vor Julius' Augen auf und ab.
»Und wohin ging Ihre Hochzeitsreise?« fragte Röschen.
»Nirgendshin; wir blieben zu Hause. Der Graf kannte Italien bereits. Die späte Jahreszeit – und dann der Stall.« Sie lachte kurz auf. »Sie wissen nicht, was das heißt, er nimmt meinen Mann völlig in Anspruch – habe selbst viel Interesse daran, bin Reiterin geworden – ein ganz gesundes Vergnügen.«
»Haben Sie gar kein Heimweh nach der Kunst, dem Theater?« fragte Julius.
»Nein, gar nicht, im Gegenteil. Sie kennen ja meine Ansicht darüber von den Sitzungen her. Erinnern Sie sich denn nicht mehr?«
»O gewiß, Gräfin, an jedes Wort, Sie sprachen von den Halbmännern, die ihnen so zuwider wären.«
»Also, die finde ich wenigstens nicht im Stall, wahre Centauren!«
»Centauren waren aber auch Halbmänner, nur daß die eine Hälfte ein Pferd war,« bemerkte sarkastisch Julius.
»Allerdings, und sogar die größere Hälfte, da bleibt nichts übrig, als selbst Centaurin zu werden, und ich bin auf dem den Wege dazu, mein Verwandlungstalent wird mich nicht im Stiche lassen. Übrigens ist auch das Ihrige staunenswert, aus dem ehrgeizigen, hochstrebenden Julius Decaro ist ein schlichtes Hausväterchen geworden.« Sie nahm plötzlich einen ernsten Ton an. »Das sollten Sie nicht tun, es ist geradezu ein Verbrechen, mit einer so reizenden Frau – das ist es eben, nicht wahr? – die reizende Frau, die sie neidisch hüten wie einen geheimen Schatz.«
»O, ich möchte nicht schuld daran sein,« fiel Röschen energisch ein; »ich war es, die ihm Mut machte, Frau Gräfin zu besuchen.«
»Gehört denn Mut dazu?« fragte Warwara lachend, mit einem Seitenblick auf Julius.
»Ich bitte Sie um eines, Gräfin, legen Sie die Worte meiner Frau nicht auf die Wagschale, sie haben noch einen Pensionat-Beigeschmack.«
»Gleichviel, ich sehe, daß ich Ihren werten Besuch nur Ihrer Frau zu danken habe, und es wird gewiß nicht Ihr letzter sein. Die Saison beginnt, ich habe große Pläne, zu deren Ausführung ich einen Decaro sehr notwendig brauche, ein Kostümfest, ein kleines Theater – für letzteres habe ich schon lange Ihre Frau Gemahlin im Auge – ja, gucken sie nur so erstaunt, gerade wegen dieses reizenden Guckens, die geborene Naive!«
Röschen sah unwillkürlich auf Julius, zum zweiten Male hörte sie aus berufenem Munde dieses Urteil. Es mußte doch etwas daran sein. Der Gedanke, in diesem glänzenden Kreis, der jetzt schon magisch auf sie wirkte, vielleicht eine andere Rolle spielen zu dürfen als die der einfachen Justizratstochter, welche ihr Dasein nur ihrem berühmten Manne zu danken hatte, ging ihr plötzlich durch den Kopf.
»Da werden Sie schlimme Erfahrungen machen,« bemerkte Julius, »sie ist viel zu ängstlich.«
»Das käme doch auf eine Probe an,« erwiderte Röschen fast herausfordernd.
»Die wir bald machen werden, ich habe schon eine Rolle für Sie in Aussicht. O, wir wollen einen recht lustigen Winter verbringen! Mit Ihrer Idylle ist es zu Ende, Herr Decaro, sie taugen auch nichts, die Idyllen, bei Licht betrachtet sind es nur rosengeschmückte Gräber. Das rastlos bewegte schillernde Leben ist für den Künstler, wenn er auch nicht so alt dabei wird wie Methusalem; auf die Zeit kommt es ja nicht an, nur auf den Inhalt. Nicht meiner Meinung, Herr Decaro?«
»Offen gesagt, meine Meinung hat sich etwas geändert in dieser Beziehung. Mir dünkt jetzt die Ruhe, das Gleichmaß der Seele viel notwendiger für unsereinen als das Leben in der Welt –«
»Ah, ich verstehe, Sie wollen wohlbestallter Professor werden,« entgegnete nicht ohne Spott Warwara. »Die Höhen des Ruhmes verlocken Sie nicht mehr, ja, dann rate ich selbst zur Ruhe.«
»Sie mißverstehen mich, Gräfin, aber Sie werden begreifen – ich habe jetzt Verpflichtungen, ich muß arbeiten, in diesem Strudel der Gesellschaft, in den Sie mich ziehen werden, fürchte ich für mich selbst. Der Leichtfuß könnte wieder zum Vorschein kommen.«
»Sie, ein Leichtfuß? Sie sind ja ein felsenfester Mann, jeder Verführung unzugänglich, so weit ich Sie kenne.«
Julius fühlte seine Wangen heiß werben bei dieser höhnischen Anspielung. Sporengeklirr auf dem Gange rettete ihn vor einer Antwort.
»Hören Sie meinen Centaur!« sagte Warwara.
Der Graf trat im Reitkostüm ein.
»Ah, Herr Decaro, mein Reisegefährte! Entschuldigen Sie mich, gnädige Frau,« wandte er sich an Röschen, »aber ich komme eben von der Arbeit. Bitte, behalten Sie Platz! Reise natürlich gut bekommen? Warum früher nicht sehen lassen? Flitterwochen. Haben unsere gleich hier abgemacht.«
Er wieherte wie ein junges Pferd.
»Frau Gräfin haben mir bereits erzählt, daß Sie so beschäftigt sind.«
»Mitten im Training, man kann sich auf die Kerls nicht verlassen; ein Tag kann alles verderben. Malen Sie auch Pferde?«
»Bis jetzt habe ich nie Gelegenheit gehabt.«
»Möchte gerne eine kleine Galerie anlegen, Prachtexemplare, Kunstwerke der Natur – Apropos da wir gerade von Bildern reden, ich wollte Sie schon deshalb aufsuchen. Das Porträt meiner Frau – großartig – kann ich es haben?«
»Ich habe es Herrn Decaro zum Geschenk gemacht,« bemerkte rasch Warwara.
»Und als solches ist es selbstverständlich um keinen Preis feil,« entgegnete der Maler, dem die Hast, mit welcher Warwara einen etwaigen Ankauf verhindern wollte, das Blut in die Wangen trieb.
»Pardon, wußte ich ja nicht, läßt sich ja vielleicht noch einmal machen,« meinte der Graf.
»Eine Kopie dürfte schwerlich das Original erreichen, es fehlt immer die momentane Inspiration,« bemerkte Julius.
»Wenn Sie ein neues wünschen in einer andern Auffassung,vielleicht zu Pferd –«
»Zu Pferd? Famos! Reiten Sie, Herr Decaro?«
Julius hätte viel darum gegeben, wenn er diese Frage hätte bejahen können.
»Nein, ich hatte nie Gelegenheit.«
»Schade!« sagte der Graf, mit einem Blick an des Malers Gestalt herab, der diesen schamrot machte, als habe er einen häßlichen Fehler bloß gelegt.
Der Graf bemitleidete, verachtete ihn wohl; ein Mann, der nicht reitet, war kein Mann in seinen Augen.
»Probieren Sie es doch, ein Mann wie Sie wird leicht damit fertig werden«, meinte Warwara, welche ihn durchschaute.
Julius war in diesem Augenblick die verblümte Anerkennung seiner körperlichen Vorzüge wertvoller als sein künstlerisches Genie.
»Wenn Sie, Herr Graf, meinen Lehrmeister machen wollten –«
»Warum nicht? So was man für das Haus braucht, kann man auch noch in Ihrem Alter erlernen. Mein Stall steht Ihnen zur Verfügung.«
»Sehen Sie, schon wieder eine neue Zerstreuung«, bemerkte Warwara. »Damit Sie mir aber nicht einmal wirklich den Vorwurf der Verführung machen können, werde ich auch für Arbeit in Hülle und Fülle sorgen. Der Graf läßt Schloß Hohenheim neu einrichten, da haben Sie ein weites Feld für Ihren Pinsel; dann die Pferde, mich –«
»Siehst du, wie gut es war, daß wir Frau Gräfin besuchten«, begann jetzt Röschen, welcher die übergroße Freude über die glänzenden Bestellungen das Herz schier abdrückte. »Wie dankbar wir Ihnen sind. Meine Mutter sagte es gleich, nicht wahr, Julius? Der Herr Graf werde gewiß eine große Bestellung machen.«
Die freudige Erregung betäubte sie förmlich, die kleinliche Sorgsamkeit des Justizrates schlug in diesem Augenblick wieder in der Tochter durch. Sie bemerkte nicht das Lächeln auf den Lippen des Grafen, nicht den sonderbaren Blick, den Warwara mit ihrem Gatten wechselte.
Julius fühlte sich vernichtet, blamiert vor Warwara, in deren Blick er alles las, Mitleid, Hohn, Rache. Er hatte sich bereits in solche Sicherheit gewiegt, seine Frau ließ sich ja vortrefflich an, aber das war alles nur äußerlich, innerlich würde sie ewig die Tochter ihrer Eltern bleiben, unmöglich für die große Welt, für ihn, dämmerte es in ihm auf.
»Hoffen Sie jetzt noch auf Ihre Naive?« fragte er Warwara mit einem vernichtenden Blick auf Röschen. »Sie werden sich einen netten Begriff von mir machen, Herr Graf, nach dieser Schilderung meiner Gattin, nur daß ich völlig unschuldig bin und nicht mit dem leisesten Gedanken an eine Bestellung Ihr Haus betrat.«
Der Graf tat sein Möglichstes, ihm über die Peinlichkeit des Augenblicks hinwegzuhelfen, Warwara pries, nicht ohne Spott, den praktischen Sinn der jungen Hausfrau.
Röschen ließ fassungslos, zitternd alles über sich ergehen. Zum ersten Male empfand sie, seit ihrer Hochzeit, ein bitteres Weh, das Angstgefühl des Verlassenseins in einer fremden, feindseligen Welt, voll tückischen Hinterhalts und Fallgruben, und der Blick ihres Julius traf sie wie eine Messerklinge, so eisig kalt.
Plötzlich liefen ihr die hellen Tränen über die Wangen.
Julius stand brüsk mit schwerem Seufzer auf, sich zu empfehlen.
»Seien Sie doch kein Kind!« sagte Warwara zu ihm: »das sind so kleine faux pas, die jedem Neuling in der vornehmen Welt passieren. Wir sind ja unter uns. O, Sie werden noch Wunder erleben mit Ihrem Röschen, lassen Sie mich nur machen. Ich will ihre Lehrerin sein, ich kenne den Schulplan ganz leidlich. Wollen Sie, Röschen?«
Sie reichte Frau Decaro die Hand, diesmal mit wirklicher Herzlichkeit.
Röschen ergriff und küßte sie.
»O, wie dankbar, wie unendlich dankbar bin ich Ihnen für Ihre Güte. Ja, ich will Ihre Schülerin sein, und Sie werden sehen, ich werde Ihnen keine Schande machen. Ich meinte es ja so gut, ich freute mich so für Julius, aber man darf so etwas nicht zeigen, ich wußte es schon längst –«
Warwara küßte Röschen auf die Stirne mit einem langen, sonderbaren Blick auf die jugendliche Erscheinung. Ein edles, wehmütiges Mitleid zuckte einen Augenblick auf in ihrer Brust und auch ihr Auge war feucht.
Sie mußten versprechen, bald wieder zu kommen, der Graf bestimmte einen Tag zum Besuche in Hohenheim. Julius sprach kein Wort, als sie auf der Straße waren. Erst zu Hause platzte er los.
»Dein erstes Debüt in der Welt ist ja reizend ausgefallen!«
»Julius, verzeihe, habe ein wenig Geduld mit mir«, flehte Röschen.
»Verzeih! Geduld! Du kannst ja nichts dafür. Du bist einmal so kleinlich, unbeholfen, spießbürgerlich wie deine Eltern. Da heißt es einfach wegbleiben, sich einmauern oder in einer andern, für dich passenden Gesellschaft verkehren.«
»Und wegen meines Unverstandes, meiner Torheit sollst du deine glänzende Zukunft opfern, diese Kreise meiden, die dich mit offenen Armen aufnehmen, dein Glück begründen? Julius, nur das nicht, das nicht!«
Röschen war außer sich.
»Nein, das nicht,« erwiderte ganz gelassen Julius. »Ich denke nicht daran, diese Kreise zu meiden, ich darf nicht daran denken, es wäre der reine Selbstmord, das fühle ich jetzt mehr wie je – aber –«
»Aber?« Röschen wurde blaß, ihre Augen wurden erschrecklich groß.
»Aber du mußt sie meiden, diese Kreise,« fuhr Julius schonungslos fort, er hatte augenblicklich kein Gefühl für Röschens Leiden.
»Ich muß sie meiden,« wiederholte sie, förmlich in sich zusammensinkend. »Und du – du gehst allein, ohne mich – immer ohne mich – und wenn sie dich fragen nach deiner Frau, dann – dann? Was sagst du dann?«
Röschen preßte jedes Wort mühsam heraus, mit den Tränen ringend.
»Du hättest keine Lust. Du kannst doch auch wirklich keine Lust mehr haben nach dieser Blamage –«
»Nein, ich habe sie auch nicht mehr. Ekel habe ich vor diesem Lügen und Heucheln. Aber – ich will mich bezwingen, ich will lernen, von der schönen Gräfin will ich lernen; ich bin nicht so dumm. Nur allein lasse ich dich nicht, nein, ich lasse dich nicht.«
Die Tränen versiegten, die kleine Gestalt schien zu wachsen, ein loderndes, drohendes Feuer blitzte aus den blauen Augen.
Julius war betroffen, überrascht; so sah er sie noch nie, so klang noch nie ihre Stimme, ein fremder Strahl, der jetzt aufblitzte in diesem Auge. Seine Entschiedenheit ließ bedeutend nach.
»Du willst dir also die Gräfin zum Muster nehmen?«
»Alles will ich lernen und tun, was dir gefällt, und sie gefällt dir doch, die Gräfin?«
Die Frage machte ihn verwirrt, er wagte es nicht, in dem Ausdruck ihres Gesichtes die Absicht zu entziffern, und kehrte ihr achselzuckend den Rücken.
»Sie gefällt mir und gefällt mir nicht, und – eines paßt nicht für alle; was ihr gut ansteht, kann dich lächerlich machen – ob du das unterscheiden kannst?«
»Ein gutes Wort, ein Blick von dir wird es mich unterscheiden lassen, Liebe kann alles. Julius, sei nicht so streng mit mir!«
Der fremde Strahl war wieder verschwunden, flehend blickten die blauen Augen ihn an. Einen Augenblick empfand er ein banges Gefühl, wie vor einer großen Gefahr; es war ihm, als müsse er sie in seine Arme schließen und sagen: »Bleib, was du bist: mein liebes Kind, mein Schüchterchen!« Dann sah er wieder das mitleidige Lächeln Warwaras, und er konnte sie nicht sprechen, die Worte.
Es litt ihn jetzt nicht mehr zu Hause, ein innerer zielloser Drang trieb ihn fort.
»Wir werden noch darüber sprechen, jetzt habe ich Geschäfte, sagte er verweisend und verließ die Wohnung.
Röschen setzte sich in den alten Lehnstuhl des Vaters. Das Zimmer schien ihr jetzt nicht mehr heimlich, sondern geschmacklos, läppisch wie sie selbst. Die peinliche Szene bei Araschin zog immer wieder an ihr vorüber. Was sprach sie denn eigentlich so Unrechtes, Dummes? Verriet Julius nicht selbst seine Freude über die Bestellung des Grafen? Er wurde ja ganz rot und seine Augen leuchteten, und wie demütig er plötzlich wurde vor dem Grafen, den er im stillen doch gering schätzte! Daß sie die Hoffnung der besorgten Mutter erwähnte, war das etwas Unnatürliches, Unrechtes? Konnte es den Grafen überraschen? Es handelt sich also bloß um den Schein, um das Verschweigen seiner wahren Gefühle. Gleichgültig erscheinen, wo man glüht, glühen, wo man gleichgültig ist, sollte sie das nicht auch können, so gut wie die anderen, mit ihrem Bühnentalent, das man ihr eben wieder von neuem zugesprochen hatte. Komödie spielen, darum handelt es sich, die beste Komödiantin trägt auf diesem Boden den Sieg davon. In den Winkel gestellt sein wie eine Magd – nimmermehr! Lieber heucheln und lügen nach außen, in ihrem Innern konnte sie ja bleiben, wie sie war, den Schatz der Wahrheit hüten, für ihn, nur für ihn; es würde vielleicht die Stunde kommen, wo er gierig darnach griffe.
* * *
Der »lange Poltl« war zur allgemeinen Überraschung Kunstmäcen geworden, Julius Decaro Sportmaler. » Never-mind« und »Heißsporn« erschienen im Kunstverein, die ehemalige Warwara Onegin prangte dazwischen als Schulreiterin, und in der Ecke der drei Bilder funkelte gleichmäßig das gräfliche Wappen.
Julius war Mode geworden, wie Araschinsche Peitschen, Führungen, Farbe.
Die Pforten seines Ateliers waren zu enge, all die hohen Namen einzulassen, die sich herandrängten, um selbst gemalt zu werden oder ihre Pferde malen zu lassen. Es roch nach Leder und Stall im Atelier, und das Sporengeklirr treppauf und treppab nahm kein Ende.
Rat Martius fürchtete sich jetzt vor seinem Nachhauseweg und wartete auf einen günstigen Augenblick, wann er unbeachtet in seine Wohnung huschen konnte. Bei seinem Schwiegersohne ließ er sich nie mehr sehen, auch die Rätin fühlte sich dort nicht mehr heimisch, obwohl sie sich ihrem Kinde zuliebe über die neue Kundschaft herzlich freute.
Röschen war selten zu Hause, immer auf Besuch, und war sie einmal daheim, kannte sie nur zwei Beschäftigungen: die Sorge für ihre Toilette und das Einstudieren ihrer Rolle für das Theater der Gräfin Araschin; das Hauswesen lag völlig in den Händen der Magd.
Julius dagegen steckte gewöhnlich in glänzenden Reitstiefeln, klirrte mit den Sporen, fuchtelte mit der Reitpeitsche, sprach von Jagden und Pferden, als wäre er damit aufgewachsen.
Da fand sich die Rätin nicht mehr zurecht, obwohl Röschen ihr gegenüber unverändert herzlich und liebevoll war; sie fühlte doch die langsame, aber stetige Wandlung, welche in ihrem Kinde vorging. Es war ihr oft, als käme sie zur einer Schauspielerin und ihrem Geliebten, einem reichen Kavalier; auch der Ton, der zwischen den beiden herrschte, erinnerte etwas daran.
Sie lächelte jetzt oft so verschmitzt, warf ihm Kußhändchen zu, alle ihre Liebesbezeugungen hatten etwas Berechnendes, während er sich mit kühnem Schwunge auf das Sofa warf, die Stiefel mit der Peitsche klopfte, eine sonderbare, die Rätin verletzende Art von Zärtlichkeit an den Tag legte.
Decaro fand sich vortrefflich in die neuen Verhältnisse und war zu der Einsicht gelangt, daß er diesem Kreise großes Unrecht getan hatte; es waren liebenswürdige, lebenslustige Leute, die Herren und Damen, und durchaus nicht ohne Interesse für die Kunst, wie er sich bisher immer einbildete. Sie bedurften in ihrem aufgeregten, abwechslungsvollen Leben nur einer Anregung dazu, und dafür war er der geeignete Mann; außerdem tat seinen reizbaren Künstlernerven die männliche Frische der Sportvergnügen ungeheuer wohl. Er fühlte seine Muskeln sich stählen, seine Brust sich weiten, er hatte einen tüchtigen Appetit, und den üppigsten Gelagen folgte kein Katzenjammer mehr. Dabei füllte sich bei geringer Anstrengung seine Kasse, »das Volk« bezahlte gut, und seine Kundschaft dehnte sich immer mehr aus. Schon hatte er begonnen, sich »in das königliche Haus« hineinzumalen, wie sich weniger begünstigte Neider ausdrückten, und bei der nächsten Gelegenheit war ihm der jetzt doppelt ersehnte Orden sicher.
Röschen machte sich wider Erwarten gut unter der Leitung Warwaras, ihr erstes Auftreten auf dem Liebhabertheater war ein wirklicher Erfolg; die Leistung ging, wie Decaro selbst gestehen mußte, weit über den Dilettantismus hinaus. Das unangenehme Gefühl, welches ihn beschlich, als er sie zum ersten Male mit ihrer kindlichen Naivität, ihrem verschämten Augenaufschlag und herzlichen Lachen, mit dem Schüchterchen Komödie spielen sah, verflog rasch bei den Schmeicheleien und Glückwünschen, die ihn umschwirrten. Er sah in ihr bald nur noch eine mächtige Stütze auf seiner goldenen, genußreichen Bahn zum Ruhm und Reichtum.
In diesem vielgestaltigen Leben kamen sie aber immer mehr auseinander, eine Menschenflut wälzte sich zwischen sie, über die hinweg sie sich ihre vertraulichen Blicke zuwarfen. Die Sonne beider war jetzt Warwara, deren heißem Strahl sie alles zu danken hatten.
Röschen fand es ganz natürlich, daß ihr Mann sich in Galanterien für die Gräfin erschöpfte, jedem ihrer Blicke ein williger Diener war, daß er bei seinen Arbeiten mehr die Gräfin als sie zu Rate zog. Sie war ja die Bestellerin, sie trieb ja, ihre Geißel schwingend, dieses ganze Heer von Hohlköpfen samt ihren Pferden durch das Atelier Julius'. Ein besonderes Bewußtsein fesselte außerdem diese beiden Frauen aneinander; so verschiedenartig ihre Herkunft, ihre Vergangenheit auch war, etwas war ihnen doch gemeinsam – beide waren Eindringlinge in dieser erlauchten Gesellschaft, und beide beseelte, wie das immer so bleiben wird, der Trieb, sich eine herrschende Rolle zu sichern.
Bei Warwara gesellte sich noch ein gut Teil Geringschätzung und Rachegefühl dazu für früher erlittene Demütigungen, womit sie auch Röschen bald anzustecken wußte, in der sie eine Verbündete erblickte. Sie ließ Röschen, ohne die Wirkung auf die junge Frau zu bedenken, hinter die Kulissen dieser Welt blicken, wo die konventionelle Moral, die lächelnde Herzlichkeit, der Stolz, die Würde, die Religion nur zu oft wie verbrauchte Kostüme an den Nägeln herumbaumeln und die Lüsternheit, der Haß, niedere Kriecherei und Frivolität frei und frech umherstolzieren.
Zuerst empfand Röschen ein heftiges Weh über die entschwundene holde Täuschung, bald aber lachte sie mit Warwara des Puppenspieles, über das sie sich noch erhaben fühlte.
Einsehend, daß man mit seinem wahren Wesen nur eine lächerliche Rolle spiele, ja, sich unmöglich machen würde, verlor sie die reizende Unbefangenheit, welche ihr so gut stand, wurde über Gebühr vorsichtig, bis Warwara, den Fehler bemerkend, sie aufmerksam machte, daß gerade in ihrer Naivität ihr Erfolg beruhe, daß diese die beste Maske sei. Und indem sie diese anmutige Gabe ihres Herzens zur Waffe gebrauchte, damit experimentierte, ward sie allmählich zur Koketterie, jener langsam, aber sicher wirkenden Giftpflanze.
Graf Araschin war Decaro nur dankbar dafür, daß er den maitre de plaisir zu machen verstand, seiner Frau eine anregende Unterhaltung bot; so blieb ihm völlig freie Zeit für den Turf, außerdem hatte er in ihm ein ganz leidliches Reitertalent und überhaupt einen brauchbaren Menschen erkannt, von gutem Humor und sympathischem Geiste. Eifersüchtig war er nicht, dazu war ihm die Kluft zu groß zwischen dem Grafen Araschin und dem Maler Decaro – und Warwara zu vernünftig.
Diese war fast enttäuscht von dem jetzt ungestörten Beisammensein mit Decaro, sie hatte sich davon ganz andere Vorstellungen gemacht, einen kleinen Roman ausgesonnen, den sie sicherlich nie ernst nehmen wollte, der aber eine pikante Abwechslung bringen sollte in das sonst zu aufregungslos und flach verfließende Leben. Sie waren einfach gute Freunde geworden, offen und harmlos vor aller Welt, er von Dankbarkeit durchdrungen, sie die gnädige Gönnerin, keine Spur von geheimer Beziehung, nichts Unausgesprochenes schien mehr zwischen ihnen zu liegen. Es gab kein listiges Wortgefecht mehr, keine leise Anspielung, das Weib schien nicht mehr auf ihn zu wirken. Das kränkte sie, fing an, sie zu langweilen. Beherrschte ihn wirklich die kleine Frau so, vielleicht gerade mit den Errungenschaften und Listen, die sie ihr zu verdanken hatte? Oder hatte sie selbst eingebüßt? Der Spiegel sagte ihr nichts davon. Dabei gefiel er ihr jetzt doppelt mit seinen jetzt erst in das rechte Licht gerückten körperlichen Vorzügen, den Sitten der eleganten Welt, die er sich rasch aneignete. Das ließ zugleich ihren Gatten noch unbedeutender neben ihm erscheinen.
Der alte Trieb zur Intrigue erwachte wieder in ihr, zu dem frivolen Spiel mit Männerherzen, mehr des Spieles wegen, als einer verbrecherischen Leidenschaft.
Warum sollte gerade dieser Mann nicht zu ihren Füßen liegen, der doch unzähligemale sich schon ihr gegenüber verraten hatte? War er zu feig, oder zu stark? Was kümmerte sie ihre Verpflichtung gegen den Grafen? Was ihre Freundin Röschen? Sie dachte ja an nichts Schlimmes – nur ein Spiel sollte es sein, ohne tödlichen Ausgang, wenn auch ein bißchen Herzblut floß.
Nach den Frühjahrsrennen bezog Graf Araschin Schloß Hohenheim, welches während des Winters restauriert wurde. Decaro hatte dort umfangreiche Arbeiten übernommen, der Speisesaal sollte mit Fresken aus dem Jagd- und Sportleben geschmückt werden. Warwara hatte weitgehende Pläne für ihre Privatgemächer. Sie machte ihm den Vorschlag, sich mit Röschen für den Sommer ganz in Hohenheim einzuquartieren.
Trotzdem der Gedanke sehr verführerisch war und Julius geradezu die Notwendigkeit einsah, anzunehmen, wenn er die Arbeiten in einem Sommer durchführen wollte, zögerte er doch anfangs.
In den Künstlerkreisen machte man ohnehin schon spöttische Bemerkungen über den gräflich Araschinschen Maler und erinnerte sich mit bissigen Bemerkungen seiner früheren Bekanntschaft mit Warwara Onegin; es war eine abgekartete Geschichte und der lange Poltl nichts als das Werkzeug der beiden.
Obwohl er sich rein wußte von jedem Vorwurf in dieser Beziehung und dieses gehässige Gerede, welches seinen Ursprung doch nur im Neide hatte, verachtete, wollte er ihm doch keine neue Nahrung geben.
Spindler, welchem es trotz aller seiner Bemühungen nicht gelang, bei Araschin eingeladen zu werden, sah in Decaro den Schuldigen oder wenigstens Lässigen und verfolgte ihn nun mit seiner ätzenden Satire durch die ganze Presse. Mehr als all das aber fürchtete Decaro sich selbst und die ländliche Einsamkeit auf Hohenheim, die gefährlich werden konnte. Warwara hatte an Reiz mehr zu- als abgenommen, und je mehr Röschen durch die neue Lebensweise von ihm getrennt wurde, in der Schule der Gräfin, unter dem Einfluß der neuen Kreise sich ihres eigenartigen Wesens begab, um so wirksamer war dieser Reiz.
Julius fühlte, was in Warwara vorging, daß sie ihres Mannes schon längst überdrüssig war, daß unter dem Mantel der Freundschaft die Leidenschaft pochte.
Oft war er fest entschlossen, ihr zu entfliehen, wenn es sein mußte, mit Einbuße aller Vorteile, Röschen fest im Arme haltend; noch hatten sie die einfache Wohnung über den Schwiegereltern. Röschen hielt mit äußerster Zähigkeit daran fest. An stillen Abenden, welche sie sich förmlich rauben mußten, saßen sie dann zusammen beim Schein der Lampe, wie in der ersten Zeit ihrer Ehe. Röschen war dann nicht mehr zu kennen, die alte natürliche Frische umgab sie, daß er zwar oft erschrak über ihre unglaubliche Wandlungsfähigkeit, sich aber doch erquickt fühlte wie nach einem frischen Bade, und mit Ekel zurückblickte auf das dürre Land, das er eben verlassen hatte. Röschen selbst war es, die solche Gedanken immer wieder verscheuchte, nach der Zurückgezogenheit weniger Tage erwachte in ihr wieder die Weltlust, während sie sich den Eltern gegenüber als Opfer aufspielte für das Glück und die Ruhe ihres Mannes.
Sie war schon so weit, daß sie die Lehre Warwaras, sich nie in die Karte sehen zu lassen, bereits gegen ihren alten Vater anwandte, der in seiner Arglosigkeit seine kleine Heldin zu bewundern anfing.
Im großen Ganzen hatte er keinen Grund, Julius einen Vorwurf zu machen; er hatte redlich Wort gehalten und jeden entsittlichenden Einfluß, den das künstlerische Handwerk seiner Ansicht nach auf ein junges Frauengemüt ausüben mußte, von seiner Tochter ferne gehalten; kein Modell betrat das Haus. Seine Tochter verkehrte in den ersten Kreisen der Stadt, vor welchen er als loyaler Mann die größte Ehrfurcht hatte, ja selbst der Umgang mit Warwara hatte für ihn nichts Anstoßendes mehr, seit diese Gräfin Araschin war; sie mußte wohl oder übel sich jetzt den Gesetzen ihres Standes beugen, von deren Lauterkeit er durchdrungen war. Seine Sorge war mehr, ob sein einfach erzogenes Kind sich dabei glücklich fühlte, ihre Gesundheit nicht litt durch das ungewohnte aufregende Leben, die durchwachten Nächte; als er sich aber vom Gegenteil überzeugte, verschwand auch diese und er nahm die ihm unliebsame Veränderung, welche er an ihr bemerkte, als ein unabänderliches Muß hin, als eine Forderung der neuen Zeit, welche nun einmal alles wirr durcheinander schüttelt, alle Prinzipien des Standes und der Verhältnisse über den Haufen schiebt. Von der praktischen Seite aus, die der Rat nie aus dem Auge ließ, war erst recht nichts einzuwenden, das Einkommen seines Schwiegersohnes war ein für ihn geradezu beschämend großes.
So unterstützte er auch in der Frage des Sommeraufenthaltes in Hohenheim seine Tochter, welcher das Zögern ihres Gatten unbegreiflich schien. Man ersparte ein schönes Geld im Haushalt und genoß einen herrlichen Landaufenthalt – warum da zögern?
Julius ärgerte sich fast über die Arglosigkeit seiner Frau, über ihre Vertrauensseligkeit zu Warwara, er fühlte sich dadurch in seiner Eigenliebe verletzt; er war doch der Mann, für dessen alleinigen Besitz diese kleine Frau etwas besorgter sein sollte.
Er war bereits in seinem Innern so gelockert, daß er darin mehr eine kränkende Geringschätzung, als ein ihm ehrendes Vertrauen sah, zumal er wohl wußte, daß Röschen über die Moral der großen Welt, über allerlei skandalöse Vorkommnisse den Winter über längst aufgeklärt worden war.
So ging er auf den Vorschlag der Gräfin ein, indem er im voraus sein Gewissen mit dem Gedanken einschläferte, er sei wider seinen Willen von Röschen dazu gedrängt worden.
Seine Befürchtungen schienen wirklich übertrieben gewesen zu sein; von der ländlichen Einsamkeit war nicht viel zu merken, Hohenheim lag zu nahe an der Hauptstadt, als daß man sich nicht stets des gastfreundschaftlichen Hauses erinnerte. Außerdem war jetzt der Graf selbst, welcher für die winterlichen Unterhaltungen wenig Sinn hatte und darin seiner Frau völlig freien Willen ließ, der anfeuernde Teil. Das war sein Feld. Jagden wechselten mit Parforcetouren zu Pferde, improvisierten kleinen Szenen; zu dem ständigen Stab seiner Freunde aus der Stadt gesellten sich die Gutsnachbarn, die Offiziere der naheliegenden Garnisonen. Hohenheim glich oft einem gut besetzten Hotel, in welchem fast ausschließlich Herrenpublikum sich einfand, Küche und Keller tüchtig in Anspruch genommen wurden.
Warwara war die sorgsame Hausfrau, Röschen ihr diensteifriger Adlatus, die Gegenwart beider würzte die ungebundene Abendunterhaltung, welche sich die Freiheiten des Landlebens in Gespräch und Benehmen zu nutze machte.
Julius machte es den Eindruck, als ob die Gräfin absichtlich mit ständigem Seitenblick auf ihn sich immer neue Günstlinge auswählte und in ihrem Entgegenkommen nicht weiter ging, als mit ihrer Stellung vereinbar war. Es war ein ständiges gegenseitiges Beobachten, und es entgingen ihnen darüber ganz die Erfolge, welche Röschen in dieser Gesellschaft hatte. Ihr zierliches, neckisches Wesen, ihr trefflicher Humor, die scheinbare Unbefangenheit, mit welcher sie ausgerüstet war, reizte die Männer fast mehr als die unnahbar scheinende Warwara, abgesehen davon, daß man sich gegen die Malerfrau eher etwas herauszunehmen wagte, als gegen die Gräfin, die Herrin des Hauses, die Standesgenossin.
Röschen erkannte in ihrer geschmeichelten Eitelkeit das Demütigende, das in diesem Benehmen lag, nicht und ging geblendet immer weiter auf der beschrittenen Bahn.
Der »lange Poltl« regte sich wieder einmal in Graf Araschin. Er kam eines Tages mit einem ganzen Zirkus nach Hohenheim, den er auf einem nahen Jahrmarkt aufgegabelt hatte. Das ganze Personal bis zum Clown herab saß in dem gräflichen Wagen. Er versprach sich einen großen Ulk. Den andern Tag war Fuchsjagd anberaumt, zu welcher Offiziere geladen wurden; abends sollte dann in der großen Manege eine Vorstellung abgehalten werden. Das sollte ein Tag werden nach seinem Sinne!
Nach einer toll durchschwärmten Nacht, an welcher sich die Damen doch scheuten, teilzunehmen, brach ein herrlicher Morgen an. Im Schloßhofe versammelten sich die Reiter, in roten Jagdröcken und Uniformen und warteten auf den Master, den Schloßherrn. Von den Strapazen des Sportes und militärischen Dienstes gestählt, wettergebräunte Männer, jugendlich kräftige Jünglingserscheinungen; keine Spur der durchschwärmten Nacht war zu bemerken in den heiteren, von der Reitlust belebten Gesichtern. Vor den Stallungen, aus welchen ungeduldiges Gewieher und Kettengerassel drang, stand der Zirkusbesitzer Philippi in seinen schiefgetretenen Reiterstiefeln mit einigen Mitgliedern, den kummervollen neidischen Blick auf die stattliche Reiterschar gerichtet; seine stramme Haltung, der steif gewichste schwarze Schnurrbart, das magere, ausgewitterte Gesicht boten eine auffallende Ähnlichkeit mit einigen Gestalten der Reitergesellschaft.
»Wir werden uns gut ausnehmen heute abend«, sagte er, bedenklich den Kopf schüttelnd, zu einem jungen, athletisch gebauten Manne, dessen graukarrierter Anzug und dunkler Krauskopf noch die Spuren des nächtlichen Heulagers trugen.
»Hätt es doch nicht tun sollen, trotz dem Geld, s ist doch der reinste Hohn.«
»Ah bah, wegen der roten Kittels da!« bemerkte der andere mit heiserer Stimme, »die machen's nicht aus, ich fürcht' mich nun einmal nicht davor.«
»Liebenswürdige, gute Herren!« meinte ein junges, hübsches Mädchen in braunem, trotz der Wärme bis oben zugeknöpftem Regenmantel.
»Wäre noch schöner, fürchten! Wenn man sein ganzes Leben darunter zugebracht hat«, bemerkte eine etwas beleibte Kollegin, welche über die erste Jugend schon hinaus war und an ihre ruhmreiche Vergangenheit dachte.
»Ja, ihr, das glaub' der Teufel, ihr, und fürchten!« sagte verächtlich Philippi; »euer ganzer Ehrgeiz steckt in dem Trikot – das Material, wenn man hätte!« Ein schwerer Seufzer entrang sich seiner Brust.
»Und alle Tage den Champagner von gestern«, scherzte die Kleine.
»Hab' ich gehabt!« brüstete sich ihre Kollegin.
Die Reiter ignorierten die Leute vollständig, welche sie gestern abend in einer Anwandlung toller Laune zu ihrem Gelage gezogen; es beschlich sie alle ein peinliches Gefühl, als sie das leichte Völkchen jetzt im grellen Tageslicht vor sich sahen. Da war nur der tolle Graf daran schuld, als Gast konnte man sich doch nicht dagegen auflehnen.
Endlich führte ein Reitknecht das Pferd des Schloßherrn vor, und der Graf erschien mit seiner Gemahlin am Arme, von einer Fanfare der Piqueurs begrüßt. Philippi machte eine ehrfurchtsvolle, stilgerechte Verbeugung, und zur Verwunderung seiner Gäste segelte Araschin auf den Direktor los, ihm, laut wiehernd nach seiner Art, von weitem schon die Hand entgegenhaltend, – er empfand sichtlich nicht die geringsten Gewissensbisse über den Exzeß der vergangenen Nacht.
Philippi war ein vortrefflicher Pferdekenner und Dresseur, damit war er hoffähig auf Hohenheim. Daß er jetzt heruntergekommen war, nahm Araschin nicht so genau, und da sich selbst die Gräfin nicht scheute, mit den Zirkusdamen ein Gespräch anzuknüpfen, gab auch wenigstens der jüngere Teil der Gesellschaft seine Zurückhaltung auf, und die eben noch Geniedamen, bildeten bald den Mittelpunkt der Gruppe.
Oben am hohen Bogenfenster des Speisesaales stand Decaro und machte rasch eine Skizze des bunten, lebensvollen Bildes im Hofe. Er hatte die Einladung zur Teilnahme an der Jagd abgelehnt in der Hoffnung, dadurch endlich einmal einen Tag ungestörter Arbeit zu gewinnen; er war daher unangenehm überrascht, als er die Gräfin nicht im Reitkostüm erblickte. Er war froh, als er Röschen eintreten hörte, welche die Neugierde trieb, die Jagdgesellschaft zu sehen; sie sollte ihn den ganzen Vormittag nicht verlassen. Er war stolz auf diesen Entschluß.
Die Herren unten drückten allgemein ihr Bedauern aus, die Gräfin bei dem Ritt vermissen zu müssen. Warwara schob die Schuld auf ihren Gatten.
»Ich weiß, er will keine Dame dabei haben, es geht ihm dann zu zahm her. Übrigens kann ich ja nachkommen; wo findet die Rast statt? Oder störe ich die Herren?«
Allgemeiner Protest, an dem sich der Graf notgedrungen beteiligte; er war wirklich kein Freund von Damengesellschaft bei solchen Ritten.
»Die Rast findet im Jagdhaus Hubertus statt; es handelt sich nur um die Begleitung.«
»Decaro!« meinte die Gräfin.
»Natürlich, Decaro«, bekräftigte der Graf mit einem Blick hinauf. »Wollen Sie die Güte haben und so etwa bis ein Uhr die Gräfin nach Hubertus begleiten?« rief er hinauf; »bis dahin werden Sie sich doch satt gepinselt haben – bei dem Wetter?«
Julius war in dem Augenblick überzeugt, daß die Gräfin eine bestimmte Absicht verfolge.
»Ich wollte heute einmal ein gutes Stück vorwärts kommen mit der Arbeit, ich war recht faul die letzten Tage – aber wenn Frau Gräfin wünscht …«
Die Herren sahen sich fragend an bei dieser offenbaren Taktlosigkeit.
»Das kann nur ein Maler sich erlauben,« meinte Dragonerleutnant Pritwitz, ein glühender Verehrer der schönen Warwara, welcher um diesen Auftrag auf die ganze Jagd verzichtet hätte.
»Ja, die Gräfin wünscht es,« rief spöttisch Warwara.
»Also abgemacht, um ein Uhr bei Hubertus! Und jetzt meine Herren, en avant!«
Der Master sprengte vor, in genau berechneter Distanz folgte ihm das rote Feld.
»Ich werde Sie jetzt dafür ungestört lassen, Sie Übereifriger,« rief Warwara Julius hinauf. »Schicken Sie Röschen herunter, wir wollen der Probe bei Herrn Philippi beiwohnen und das Programm festsetzen.«
Julius schickte Röschen fort und vertiefte sich in die Arbeit. Er gab sich alle Mühe, nicht an den bevorstehenden Ritt zu denken, den ersten Ritt allein mit Warwara, den er bis jetzt sorgfältig zu vermeiden wußte.
Vier Längsfelder der kunstreichen Eichenvertäfelung des Saales hatte er für die allegorische Darstellung der vier Jahreszeiten bestimmt, eben war er mit dem Sommer beschäftigt. Eine vollreife Frauengestalt betritt zögernd, furchtsam um sich blickend, die klare Flut eines Baches, welche eine trauliche Bucht bildet. Das goldige Licht der Sonne fällt, tausendfältig gebrochen, durch üppiges, schimmerndes Laubwerk, dessen Blätterschatten auf den rosigen Gliedern der Schönen hin und her zu zittern scheinen. Eine wonnige Kühle atmet der Bach, der Wald, während im Hintergrunde eine weite Ebene sichtbar ist, über welcher gewitterschwüle Hitze lastet. Das rötliche Haar der Frau fällt aufgelöst den edelgeformten Rücken hinab; das Angesicht war dem Hintergrunde zugewendet, als fürchte die Schöne Gefahr von der Lichtung her; nur das kräftige Oval und ein schon etwas zur Fülle neigendes Kinn waren sichtbar, und doch behauptete Röschen eben kichernd: »sie könne nichts dafür, aber wenn die Frau sich umdrehe, so sei es ganz gewiß Warwara.« Er dachte nicht daran, diese zum Vorbilde zu nehmen, er arbeitete genau nach einer früheren Skizze und ärgerte sich über diese Bemerkung. Jetzt aber, wenn er zurücktrat und das Bild betrachtete, kam es ihm selbst so vor, je länger, desto deutlicher, und immer wieder wendete sich der Kopf nach ihm und die ganze Huldgestalt durchrieselte ein warmer Lebensstrom.
Hätte sein Werk wirklich diesen Effekt ausgeübt, so wäre er sich bewußt gewesen, das Beste, Höchste geschaffen zu haben. Das war es aber nicht, nur seine heiße Phantasie zauberte solches Leben hinein. Dieses Wallen in den weißen Gliedern, das er zu sehen glaubte, war das Wallen seines eigenen heißen Blutes.
Und an dieser Orgie seiner Phantasie war nichts schuld als die lodernde Unruhe, in welche der geplante Ritt an ihrer Seite schon voraus seine Seele versetzte. All seine bisherige Ruhe war Täuschung, der unglückselige Einfluß, welchen dieses Weib auf ihn ausübte, bestand noch immer. Es war nicht Liebe, es war eine Naturgewalt. Bis jetzt hatte Warwara ihn sicher gemacht, seine Vorsicht eingeschläfert, heute wagte sie vielleicht den ersten Überfall; wenn er den abschlug, war er gerettet.
Wenn er den Angriff machte, sie in die Falle lockte und dann verhöhnte, verlachte – dann mit Röschen auf und davon ginge in das kleine Zimmer mit den weißen Vorhängen und dem großen Lehnstuhl! Röschen ist aber nicht mehr das Röschen von damals, das Schüchterchen, es will selbst nicht mehr in das kleine Zimmer, es gefällt ihm viel besser in dem Schlosse, in der lustigen Gesellschaft. Röschen ist eine kleine, pikante durchtriebene Frau geworden, dank Warwaras Fürsorge, sie kümmert sich oft tagelang nicht um ihn, sie würde ihn am Ende auslachen.
Nachdem er so eine Stunde mit sich gerechtet hatte, war er im reinen und die Arbeit ging ihm wieder flott von der Hand. Er vergaß darüber ganz, sich umzukleiden. Warwara überraschte ihn mit Röschen. Sie trug den roten Rock, die Farbe hob noch ihre Figur, das rote Haar, welches die Harmonie der Farben gestört hätte, war unter dem niederen Zylinder hoch aufgekämmt, um welchen sich ein silbergrauer Schleier wand.
»Sehr sommerlich!« sagte sie, das Bild betrachtend.
Röschen flüsterte ihr kichernd etwas in das Ohr.
»Wäre noch schöner, vor meinen Tafelgästen …«
Röschen lachte laut auf.
»Was bemerken Sie Auffallendes?« fragte er, den Grund des Gelächters ahnend.
»Nichts! Gar nichts. Ihr lockeres Frauchen sieht immer etwas. Machen Sie, rasch! Wir wollen keinen Parforceritt machen bei dieser Hitze«.
Julius entfernte sich.
»Lockeres Frauchen!« Diese Bemerkung Warwaras ging ihm nicht aus dem Kopfe, es war nur eine Redensart, ein Scherz, aber es war etwas daran. Er wußte, welche Bemerkung Röschen zur Gräfin gemacht hatte. Ihr Lachen tat ihm weh. Ja, es war wirklich etwas gelockert in ihr, vielleicht mehr, als er ahnte – vielleicht hatte Warwara noch einen anderen Grund, sie so zu nennen, sie war sehr beliebt in der Herrengesellschaft. Wer wäre denn schuld als er, der dieses einfache Kind hineingesetzt hatte in diese ihm fremde Welt und dann hilf- und ratlos sich selbst überließ – und einer Warwara.
Über die Besorgnis um Röschen, die plötzlich in ihm aufstieg und von seiner noch wahren Liebe zu ihr zeugte, vergaß er die Gefahr, die ihm selbst drohte.
Warwara saß schon im Sattel, als er in den Hof kam. Sie ritt eine hellbraune, leichtfüßige Stute, ein Reitknecht hielt für Julius einen stark gebauten, wohl zugerittenen Rappen bereit, welcher seinem ruhigen Temperamente nach keine allzu große Anforderung an seinen Reiter zu stellen schien.
Röschen sah mit Schmerzen die beiden zum Schloßtore hinausgaloppieren; wäre es nach ihr gegangen, hätte sie längst auch reiten gelernt, aber Julius sträubte sich hartnäckig dagegen, er fühlte, daß sie sich zu sehr emanzipiere auf dem Grafenschloß – und am Ende hatte er recht, die Tage von Hohenheim würden zu Ende gehen und dann – sie dachte jetzt mit Bangen an ihre enge, schlichte Wohnung, ihren kleinen Haushalt.
Die Hubertushütte lag drei Wegstunden entfernt von Hohenheim im Forst, sie war bis auf eine kurze Strecke von der Straße aus zu erreichen, welche das Reiterpaar eingeschlagen hatte.
Heiße, bewegungslose Luft zitterte über die Halme der Felder, unter den Hufen der Pferde hob sich eine glühende Staubwolke.
»Es wird ein Gewitter geben, fürchten Sie nicht?« brach Julius das beklemmende Schweigen.
»Fürchten Sie? Was fürchten Sie doch alles! Man kommt ja zu keinem Genuß vor dieser ewigen Furcht! Und das ist am Ende doch alles – genießen!! Zum Beispiel dieser Ritt! Wie frei, wie gesund, wie kräftig fühle ich mich. Das alles gehört mir. Sehen Sie!«
Sie zog einen Kreis um die ganze Landschaft mit der Reitpeitsche.
»Nicht, weil der Graf Araschin mein Mann ist – pah! Weil ich auf diesem Pferde sitze, weil ich das alles überfliegen kann wie ein Vogel. Nicht wahr, das ist ihnen ganz fremd, dieser unbändige Freiheitsdrang? Mir ist diese Straße langweilig, die jeder Handwerksbursche, jeder Fuhrmann mit mir teilt.«
»Dann verlassen wir sie, wer hindert uns daran?« erwiderte Julius, der es überdrüssig war, für furchtsam zu gelten.
»Das ist einmal ein Wort – hopp!«
Schon setzte sie über den Straßengraben. »Und jetzt los! Wir wollen auf eigene Rechnung jagen, ohne Schnitzel, ohne Fuchs und – ohne Ziel.«
Sie stieß einen lauten Hetzruf aus und galoppierte durch eine sumpfige Wiese in die weite Ebene hinaus, daß das braune Moor sie umspritzte. Ein Graben zog sich quer über, Julius rief ihr warnend zu: sie schwang die Reitgerte hoch und lachte hell auf – drüben war sie, dann ging es über Stoppelfelder, durch Rüben- und Kartoffeläcker, an erstaunten, unwilligen Landleuten vorbei.
Julius blieb zuerst bedeutend zurück, sein schweres Pferd lief nicht so leicht auf dem von Regen durchweichten, brüchigen Boden. Er sah nichts mehr vor sich als die rote Reiterin, wie eine züngelnde Flamme flog sie über das Land. Es war ihm, als fliehe sie vor ihm, als gelte es sein Leben, sie zu erhaschen. Der ungewohnte Ritt versetzte ihn in einen wilden, besinnungslosen Taumel, in dem sich alle seine gefesselten Leidenschaften freimachten. Endlich gelang es ihm, sich an ihrer Seite zu halten, der Hut saß ihr im Genick, ihr Antlitz flammte, jeder Muskel zitterte unter der roten Jacke.
Sie war wirklich Centaurin geworden, wie sie einst im Scherze erwähnte, halb Tier, halb Weib.
Der Wald setzte dem Rasen ein Ziel, sie hielt ihr schaumbedecktes Pferd an; ihr Haar hatte sich gelöst, sie versuchte es hastig in einen Knoten zu schlingen. Julius glaubte ihr helfen zu müssen – es war glühend heiß, ein betäubender Dunst ging davon aus.
»War es so nicht schöner als auf der Straße? O diese Straßen!« sagte sie, schwer atmend: »und doch suchen wir sie immer wieder auf und traben geduldig fort in ihrem häßlichen Staub! Wie es noch keine gab, alles Wildnis, Wald und Sumpf war, da hätte ich leben mögen.«
»Aber in der Wildnis ein Schloß wie Hohenheim, mit allem Komfort des Reichtums, mit Menschen, die Sie als Königin dieser Wildnis verehren«, erwiderte Julius, während die Pferde im Schritte den Hochwald betraten.
»Glauben Sie …?« Sie lachte. »Ja, ich glaubte es auch einmal, daß darin das Glück läge, jetzt glaube ich es nicht mehr, – vergoldete Ketten, ein rosengeschmücktes Gefängnis! Das ist das Glück – unter diesen bemoosten Stämmen, die uns die Aussicht nehmen auf jede Besitzgrenze, auf jede Menschenwohnung mit ihren Qualen, all ihrem Zwang, ihren Gesetzen und Sitten, die wir verlachen und doch befolgen.«
»Und warum suchen Sie diese Wildnis nicht öfter auf, es hindert Sie ja niemand daran?« fragte Julius, einem Stein ausweichend und so sein Pferd dicht an das der Gräfin bringend.
»Allein? Man muß auch jemand zum Mitgenießen haben, auch die Wilde bedurfte des Wilden, an den sie sich schmiegen, dem sie ihre Lust und ihr Leid erzählen konnte.«
»Und ist Graf Araschin Ihnen nicht wild genug, der tolle Poltl!« Julius gebrauchte zum erstenmal vor ihr diesen volkstümlichen Spitznamen.
Eine kleine Falte zeigte sich auf der feuchten Stirne der Gräfin.
»Spott? – den kann ich wiedergeben. ›Schüchterchen‹ ist auch kein passender Name für die Frau eines – Wilden – ach so, Sie sind ja kein Wilder, Sie sehen nur jetzt so aus mit Ihrem zerzausten Bart, Ihren leuchtenden Augen, in diesem Halbdunkel – aber Sie gefallen mir so …«
»Nur ein Kinderscherz«, entgegnete Julius, die Bemerkung der Gräfin wie absichtlich überhörend, »ein Spaß, der gar nicht mehr auf meine Frau paßt.«
»Viel weniger, als Ihnen lieb ist …«
»Vielleicht«, entgegnete Julius, indem er die Gräfin vor dem überhängenden Zweige einer Buche schützte.
»Vielleicht? Gewiß! sage ich Ihnen. Zuerst gefiel Ihnen die niedliche Puppe, aber ein Mann mit einer Puppe, das geht doch nicht in der Welt. Gut, machen wir eine Dame daraus, wie sie alle sind. Jetzt ist sie gerade, wie sie alle sind, jetzt möchten Sie wieder die Puppe haben, für daheim wenigstens, und dieses frivole Spiel mit einem Weibe nennen die Herren ›Liebe‹. Ich wette, Sie sind fest davon überzeugt, daß Sie Ihre Frau lieben.«
»Das bin ich auch«, entgegnete Julius in einem sieghaften Tone, stolz auf den abgeschlagenen Angriff. Warwara lachte hell auf, daß es durch den Wald schallte, und ließ ihr Pferd die Spitze der Reitpeitsche fühlen, daß es einen Sprung vorwärts machte.
»Aber, wo sind wir denn eigentlich?« Sie zog eine winzige Uhr hervor. »Ein Uhr! Und wie dunkel es auf einmal wird. Wissen Sie den Weg?«
Julius sah sich vergeblich um, rings dehnte sich die endlose Säulenhalle des Hochwaldes. Kein Blatt, keine Fichtennadel bewegte sich, ein beklemmendes, schwüles Schweigen lagerte zwischen den grauen Stämmen, über dem weichen Moose, in dessen Fülle die Pferdehufe lautlos versanken. Und tückisch lautlos kamen riesige Schatten gezogen, umwoben die schwarzen Wipfel der Fichten, verwischten die Umrisse. Der erste Donner grollte.
Sie ritten rechts, sie ritten links, sie trennten sich, um einen Ausweg aus dem Labyrinth der Stämme zu finden, und riefen sich wieder zusammen. Der rote Rock Warwaras leuchtete wie ein Glühwurm in dem matten Lichte.
Julius bekam Angst; er war verantwortlich für seine Begleiterin. An ein Eintreffen in Hubertus war nicht mehr zu denken, und schon fielen schwere Tropfen – Zurückreiten war das beste, obwohl man durch das ständige planlose Herumreiten die Richtung gänzlich verloren hatte.
Jetzt zuckte es violett auf, ein polternder Donner, der Sturm flog in die Wipfel, der rote Punkt war verschwunden, aber ihr greller Zuruf tönte durch das Tosen: »Hallo! Hoh!«
Er ritt darauf zu, rief ihren Namen – »Gräfin!«
»Hallo! Hoh! Hussa! tönte der Walkürenschrei. Ein Blitz zuckte auf und in jäh ihm folgenden Donner mischte sich dämonisches Gelächter, das Splittern und Krachen von Holzwerk.
»Warwara!« schrie er jetzt, von einem eigenen Schauer gepackt.
»Julius!« tönte es spöttisch, in siegendem Tone dicht vor ihm, und der Glühwurm tauchte auf. »Kommen Sie, ich habe ein trockenes Plätzchen gefunden.«
Der Regen prasselte wie Hagel, plötzlich schien der ganze Wald zu flammen, eine riesige Eiche ragte als schwarze Silhouette in das grünliche, blendende Licht. Das Pferd Warwaras warf sich entsetzt auf die Hinterfüße, ihr rotes Haar war völlig aufgegangen und wallte, vom Hut befreit, weit hinab über den Rücken des Pferdes, den Arm hielt sie hoch erhoben, um das Gleichgewicht zu halten. Das war kein Weib, ein flammender Dämon – eine Göttin!
»War das schön!« rief sie aus. »Dieses schwarze Ungetüm, wie es nach uns die Arme reckte – ja, wo sind Sie denn, Julius?« rief sie, den Namen wieder so eigentümlich betonend.
»Hier, Gräfin, der Blitz hat mich ganz geblendet und das Bild, das ich in seinem Feuer erblickte«, erwiderte der Maler.
»Die schwarze Eiche?« ö
»Ich sah keine Eiche, ich sah nur das lodernde Zauberweib.«
Die Pferde drängten sich zusammen und ihr Haar flog ihm in das Gesicht. Sie ergriff seine Hand. »Kommen Sie unter Dach, das Zauberweib wird Sie führen.«
Er folgte willenlos. Ihre Hand war heiß und feucht. Die schwere, dunstige Luft war geladen mit Elektrizität, ununterbrochen flimmerte es, zuckte es auf, bald ferne zwischen den jetzt blau leuchtenden Stämmen, bald nahe die Waldesnacht spaltend.
Eine Futterhütte für das Wild war das Obdach, welches die Gräfin gefunden hatte.
Sie stiegen ab und banden die zitternden Pferde an die Raufe. Das nasse Heu strömte einen betäubenden Dunst aus.
Warwara setzte sich auf einen Heuhaufen.
»Da ist's ja ganz gemütlich zum Plaudern. Von was sprechen wir denn nur? Wovon wir sonst nicht sprechen würden, wenn wir uns einander ins Gesicht sehen – zum Beispiel. Sagen Sie mir ehrlich, bei dem, der da oben donnert«, fügte sie in komischem Pathos hinzu, »hätten Sie Röschen so rasch geheiratet, wenn ich Sie damals nicht bei einem Kuß ertappt hätte? Ehrlich, Julius!«
Sie legte ihre Reitgerte auf seine Schulter.
Dieses sonderbare »Julius« jagte sein Blut gegen die Schläfe; gab er ihr je das Recht, ihn so zu nennen?
»Das ist schwer zu sagen – allerdings – es war meine Pflicht, mein voreiliges Benehmen zu rechtfertigen, aber es hätte sich nur um eine kurze Zeit gehandelt, denke ich –«
»Das glaube ich aber nicht, die kurze Zeit hätte genügt, daß Sie Röschen nicht mehr geheiratet.«
»Warum glauben Sie, hätte die kurze Zeit genügt?«
»Weil Sie dann gesehen hätten, daß dieses Kind keine Frau für Sie ist, daß Sie etwas ganz anderes zu begehren berechtigt sind.«
»Ein Vollblutweib, nicht wahr?«
Die rote Flamme berührte ihn, es war wie ein elektrischer Schlag.
»Ein Zauberweib«, ergänzte sie flüsternd, und ihr leuchtendes Auge schien sich zusammenzuziehen, dann plötzlich wieder auszudehnen, als wollte sie ihn in sich saugen.
»Warwara, Sie wollen damit nicht sagen –«
»Daß ich Sie liebte – will ich sagen – wenigstens damals liebte, weiter nichts.«
»Und daß Sie Ja gesagt hätten, wenn ich um Ihre Hand geworben?«
»Kaum. Eben weil ich Sie liebte, weil ich eine Wilde bin und weil ich in der Gefangenschaft nicht lieben kann –«
»Und frei bleiben wollten für einen Grafen Araschin.«
»Großes Kind! Graf Araschin! Was kann ich dafür, daß ich ihm besser gefiel als alle seine Pferde – ebenso wenig, als Sie dafür können, daß ich Sie zur Unzeit überraschte – Zufall, Schicksal, das wir mit Lüge aufputzen. Daß ich Sie liebte, war aber kein Zufall, keine Lüge, und daß Sie mich begehrten, – ich spreche beim Manne nie von Liebe – und Sie begehrten mich heiß, glühend – war auch kein Zufall, keine Lüge. Wie soll nun ein Zufall, eine Lüge die Wahrheit plötzlich vernichten?«
»Noch Wahrheit, Warwara?«
»Nicht mehr Wahrheit, Julius?«
Er rang nach Luft, nach Rettung, nach den Worten »nicht mehr«. Er beschwor Röschens Antlitz herauf, jede glückliche Stunde seiner Ehe drängte sich herein in den schwülen, engen Raum, aber die rote Flamme an seiner Seite verbrannte alles zu Asche.
Röschen benützte ihre Einsamkeit, sich mit den Zirkusleuten zu unterhalten. In der Manege herrschte die regste Tätigkeit, den Abend wenigstens einigermaßen befriedigend zu gestalten.
Philippi gab sich alle Mühe, sein Pferdematerial an den neuen Raum zu gewöhnen, kämmte und bürstete mit eigener Hand und ärgerte sich über die unverschämten, höhnischen Mienen der gräflichen Stallknechte, welche, die Hände in den Hosentaschen, müßig zusahen. Das männliche Personal putzte und flickte das Riemenzeug, die beiden Clowns übten ihre besten Witze ein, die Damen waren mit ihrer Toilette beschäftigt.
Das war eine neue, originelle Welt für Röschen. Fifine, Philippis hübsche Tochter, machte es ein Vergnügen, sie wenigstens in die alltäglichsten Geheimnisse einzuweihen.
Sie hatte mit ihrem Vater, der früher einen berühmten Zirkus besaß und erst vor einigen Jahren verkrachte, große Reisen gemacht und die Triumphe ihrer Kunst genossen, von denen sie in den lebhaftesten Farben zu erzählen wußte.
Das Unglück, das den Vater betraf, hatte sie nicht mißmutig gemacht, und ihr die frohe Hoffnung nicht rauben können auf eine glänzende Zukunft. So nahm sie die herbe Gegenwart mit echtem Künstlerhumor, während sie die strenge Zucht des Vaters ferne hielt von den Klippen ihres Berufes.
Röschen konnte es sich nicht versagen, auch von ihren künstlerischen Erfolgen zu erzählen im vorigen Winter und von der Freude, die sie darüber empfunden hatte.
Fifine drückte ihr Bedauern aus, daß es Röschen bei solchem Talente nicht vergönnt war, ganz der Bühne anzugehören, das sei für sie immer der Gipfelpunkt des Glückes gewesen, sie begreife die Gräfin nicht, daß sie trotz all dem Reichtum, den sie damit erworben, es über das Herz gebracht habe, eine so glänzende Laufbahn zu verlassen.
In ihr eifriges Gespräch mischte sich das Knallen der Chambriere, das gezwungene Gelächter, die klatschenden Ohrfeigen der Clowns, die Flüche Philippis, welchem heute die erste Schulreiterin, Fräulein Arabella nichts zu Dank machen konnte.
Frau Decaro war eben beschäftigt, Fifine bei Ausbessern ihres seidenen Trikots zu unterstützen, als ein gräflicher Diener meldete, ein alter Herr und eine Frau seien da und wünschten sie zu sprechen. Aus dem geringschätzigen Tone des Dieners schloß sie auf eine gewöhnliche Bettelei und gab Auftrag, die Leute hereinzuführen. Mit einem lauten Schrei der Überraschung sprang sie auf, als sie plötzlich den kahlen Kopf des Rates über der Rampe der Manege erblickte, und in heller Kindesfreude eilte sie auf den erstaunt sich Umblickenden zu und erstickte ihn fast unter ihren stürmischen Küssen.
Sie vergaß in der Eile ganz das Trikot, das sie wie einen Schal um den Hals geschlagen hatte, bis Fifine unter lautem Lachen daher gestürmt kam und es ihr abnahm.
Die Rätin sah kopfschüttelnd bald auf ihr Kind, bald auf das bunte Völkchen vor sich. – »Ja, sag mir einmal, wo ist denn Julius? Der Graf und die Gräfin? Was geht denn hier eigentlich vor? Du allein unter diesen Leuten? Das sind ja Seiltänzer oder so etwas! Weißt du, in meinen Jahren, du mußt schon entschuldigen, faßt man das alles nicht so rasch«, stammelte der Rat, sich die perlende Stirne abtrocknend.
»Das ist eine Zirkusgesellschaft, die der Graf für heute abends zur Belustigung seiner Gäste hat kommen lassen. Er selbst ist mit mehreren Herren auf die Jagd geritten, Julius begleitete die Gräfin zum Rastplatz. In einer Stunde sind sie alle wieder zurück, und du kommst gerade recht zum Diner. Das ist die ganze unglaubliche Geschichte, liebes Papachen!«
»Zum Diner? Wie kannst du nur an so etwas denken, als ob wir vom Grafen eingeladen wären! Und in dieser Toilette!« meinte die Rätin.
»Man wird hier nicht eingeladen und macht keine Toilette. O, das geht hier alles ohne Umstände, gar nicht krampfhaft; ihr werdet euch sehr gut unterhalten. Abends sehen wir uns die Vorstellung an, kneipen ein bißchen zusammen. Adieu, Fifine!« rief sie der Kunstreiterin zu, »machen Sie Ihre Sache gut heute abends, für Beifall werde ich schon sorgen.«
Der Rat machte ganz verwirrt ein verlegenes Kompliment.
»Höre, Röschen, ich denke, das beste ist, wir fahren mit dem nächsten Zuge wieder nach Hause und kommen einmal wieder, wenn wir weniger genieren. Ich bitte dich darum; wir passen nicht in diese Gesellschaft.«
»Passen nicht? Wer ist denn da? Ein paar Leutnants und ein Rittmeister. Passen nicht! Ein königlicher Justizrat mit Majorsrang.«
»Ja, ja, das ist richtig, ich habe Majorsrang, aber doch – darin liegt es nicht, ich bin schon zu alt, kurz, ich bitte dich –«
»Passen nicht! Da muß ich allerdings auch protestieren,« ergriff die Rätin jetzt die Partei ihrer Tochter, »wenn du deshalb nicht bleiben willst.«
Das heraufziehende Gewitter, ein tüchtiger Donner verhalf den Frauen zum vollständigen Sieg. Man beschloß, wenigstens die Gesellschaft abzuwarten, es sähe ja vor der Dienerschaft aus, als habe man absichtlich die Abwesenheit der Herrschaft zum Besuche ausgewählt.
Röschen zeigte den Eltern das ganze Schloß, zuletzt auch die Entwürfe und angefangenen Arbeiten ihres Mannes im Speisesaal.
Der Rat warf vor den vier Jahreszeiten einen vielsagenden fragenden Blick auf seine Gattin und einen forschenden auf Röschen.
»Und das wird also der Speisesaal für Herren und – und Damen?« fragte er zögernd.
Röschen lachte. »Du meinst wohl wegen dieser Figuren? O, man ist nicht so skropulös hier. Frisches Leben, Gesundheit, Glück soll einem von allen Wänden entgegenlachen. Die Freude, das ist die Losung in diesen Räumen.«
Der Rat hörte mit offenem Munde die Erklärung seiner Tochter. »Ja, ja, die Freude, das ist die Losung,« murmelte er, von der schwülen Luft, dem Farbengeruch im Raume betäubt, schwer aufatmend.
Mitten im strömenden Regen, unter Donner und Blitz sprengte das rote Feld in den Hof. Die Gräfin und Julius waren nicht dabei.
Der Graf war der Meinung, seine Gattin sei, das drohende Gewitter fürchtend, zu Hause geblieben; als er aber hörte, daß sie weggeritten, war er doch etwas besorgt, sie mußten einen Umweg gemacht haben, sonst hätten sie sich ja begegnen müssen; er tröstete sich mit der Begleitung Decaros, welcher das Gewitter in irgend einem Gehöft mit ihr abwarten werde.
Die Herren waren weniger vertrauensselig als der Graf, und besonders Leutnant Pritwitz machte spitzige Bemerkungen über Decaro.
Araschin empfing mit der ihm eigenen kurzen Höflichkeit die Eltern Röschens, indem er sich mit seinen durchnäßten Kleidern entschuldigte und das Wiedersehen bei Tisch als selbstverständlich betrachtete. Die Rats waren ernstlich besorgt um Julius; er war ja kein geübter Reiter, wie leicht konnte ihm bei diesem Unwetter etwas zugestoßen sein – oder der Gräfin, und er war verantwortlich dafür. Sie wunderten sich über die Ruhe Röschens, welche behauptete, sie säßen entweder ganz ruhig in einem Bauernhause und warteten den Regen ab, oder der Gräfin sei plötzlich irgend eine andere Idee gekommen, und sie seien ganz wo anders hingeritten, bei ihr sei alles möglich.
Der Rat hatte jetzt nur noch eine Sorge, das Diner, ob der Graf wohl wisse, daß er Majorsrang habe und ihm infolgedessen der erste Platz gebühre, er wäre ja lieber auf dem untersten, unscheinbarsten gesessen, am liebsten überhaupt nicht dagewesen, aber da es nun einmal so war, galt es vor allem, seine Stellung zu wahren und er überlegte im stillen, was er tun sollte, wenn es anders käme.
Mit einer ängstlich forschenden Miene, als begäbe er sich auf eine unsichere Eisfläche, betrat er, geführt von Röschen, welche sorgfältig Toilette gemacht und auch der Mama ausgeholfen hatte, den Speisesaal, in welchem sich die Herren Offiziere allmählich einfanden.
Er fragte sofort ganz heimlich den Diener um seinen Platz. Dieser wies auf die Spitze des Tisches. Der erste neben dem Herrn Grafen. Da atmete er erleichtert auf und war in seiner Freude nahe daran, dem Diener die Hand zu drücken, gerade zog er sie noch zur rechten Zeit zurück, dankte ihm aber herzlich für die Auskunft, so daß dieser ein leises Lächeln nicht überwinden konnte. Dann schlich er, seine Gemahlin am Kleide zupfend, allmählich auf seinen Platz und ergriff mit beiden Händen die Lehne seines Stuhles, auf der gefalteten Stirne den festen Entschluß, nicht mehr zu weichen.
Röschen war nicht mehr zu sehen, nur ihr silbernes Lachen tönte aus dem schnarrenden Stimmengewirr.
»Gar nicht ein bißchen eifersüchtig, gnädige Frau?«
»Auf eine Freundin ist man nicht eifersüchtig.«
»Auf eine so schöne Freundin?« meinte Leutnant
»Sehr liebenswürdig, Herr Leutnant, aber trotzdem bin ich es nicht,« erwiderte Röschen schlagfertig.
Jetzt erst bemerkte man den Rat, der krampfhaft hinter seinem Sessel stand. Die Offiziere stellten sich dem alten Herrn und seiner Gattin mit peinlichstem Zeremoniell vor, und als er sich als der Vater Frau Decaros entpuppte, überhäufte man ihn und die Rätin mit Schmeicheleien, ob seiner reizenden Frau Tochter, welche so viel zur Geselligkeit auf Schloß Hohenheim beitrage, tauschte Vermutungen aus über das auffallende Ausbleiben ihres Gatten mit der Gräfin.
»Die Herrn geben sich nämlich alle Mühe, mich eifersüchtig zu machen,« erzählte Röschen, »sprechen von einer Hütte im Walde, wo das Paar Schutz sucht gegen das Unwetter à la Dido und Aneas. Das rührt mich aber alles nicht; da müßte ich ja in steter Angst sein, auch ohne Wald und ohne Gewitter.«
Der Rat wunderte sich höchlichst, wie der Angelegenheit in diesen Räumen selbst von den Gästen und Freunden des Grafen eine frivole Deutung gegeben werden konnte, an die Möglichkeit der Berechtigung dachte er nicht im geringsten, außerdem war er so erfreut über das liebenswürdige, herzliche Entgegenkommen der jungen Kavaliere, für die er als alter Mann doch kein Gegenstand des Interesses sein konnte.
Anders wirkten diese Bemerkungen auf die Rätin. Ihr weiblicher Scharfsinn witterte sofort, daß diese Andeutungen und Stichelreden nicht so harmlos waren, als sie schienen, daß ihnen ein bestimmter Verdacht zugrunde liege. Sie nahm sich vor, scharf zu beobachten, wenn die Gräfin zurückkäme.
Araschin trat endlich ein in weißem Flanellanzuge, mit einem Wolfshunger, wie er beschwor, durch sein freies, auf jede Etikette verzichtendes Benehmen seinen Gästen völlige Zwanglosigkeit anempfehlend. Er ließ das Diner beginnen, ohne die Gräfin abzuwarten.
Das Wetter hatte sich rasch wieder aufgeheitert, es versprach ein schöner Abend zu werden. Obwohl der Graf sich nicht die geringste Sorge anmerken ließ und in heiterster Laune schien, herrschte doch eine etwas gedrückte Stimmung und die Uhr war der allgemeine Gegenstand der Aufmerksamkeit. Endlich hörte man Pferdegalopp, die allgemeine, künstlich verhehlte Spannung äußerte sich jetzt am deutlichsten in dem allgemeinen Aufspringen und an das Fenster eilen.
Warwara sprengte mit Decaro in den Hof.
Sie winkte ihrem Gatten mit der Reitgerte. Julius traute seinen Augen nicht, als er den Kopf des Rates neben Röschen am Fenster erblickte, ein peinliches Gefühl beschlich ihn. Der Rätin entging nicht das Erzwungene seiner Bewillkommnung.
»Wo wart ihr denn so lange?« Röschen war die erste, welche diese Frage stellte, die wohl allen im Sinn lag.
»Wir verirrten uns – dann kam das entsetzliche Wetter – wenn es auf die Herren ankäme, könnte man ganz verloren gehen, sie scheinen sich nicht sehr um mich geängstigt zu haben.«
Warwara sprang rasch aus dem Sattel und verschwand mit ihrem Begleiter im Hause. Gleich darauf erschienen beide, ohne sich Zeit zum Umkleiden zu nehmen, im Saale.
Warwara über und über mit Kot bespritzt, den Schleier zerrissen, die Stirne blutig geritzt, noch glühend vom schnellen Ritt, während ihr nicht minder derangierter Begleiter eher blaß erschien. – Es schien ihm wohl nur so, daß alle Augen forschend auf ihn gerichtet waren.
Nur Röschen kam ihnen ganz unbefangen und lachend entgegen und war sichtlich nur von der Freude beseelt, ihren Gatten wohlbehalten wieder zu sehen.
»Nun erzähle uns einmal von eurer Verirrung. Da bin ich wirklich neugierig,« begann der Graf, seiner Gemahlin zwischen dem Rat und der Rätin Platz machend.
»Sehr einfach,« erwiderte sie, die Handschuhe ausziehend. »Wir ritten von der staubigen Landstraße ab und unternahmen eine kleine Jagd auf eigene Rechnung quer durch die Felder; dadurch gerieten wir auf einer andern Seite in den Wald, wurden vom Gewitter überrascht und verfehlten den Weg.«
Der Graf entfernte mit den Fingerspitzen einige Heuhälmchen, die sich im Haar und im Schleier der Gräfin eingenistet hatten.
»Und habt glücklich einen Unterstand gefunden, wie ich sehe –«
»Natürlich, sonst wären wir ja patschnaß. Wir fanden einen Futterstadel, der uns vortrefflichen Schutz gewährte –«
»Einen Futterstadel! Da seid ihr allerdings weit abgekommen; es gibt nur einen Futterstadel dort, und der ist auf der entgegengesetzten Seile von Hubertus. Ein kühner Reiter geworden, Herr Decaro, wußte ich noch gar nicht.«
Er betrachtete den Maler auffallend scharf durch sein Monocle.
»Was wollte ich machen, Frau Gräfin wollte durchaus quer über das Feld – kam mir schwer genug an –«
»Ach, reden Sie nicht so, es gefiel Ihnen selbst ganz gut, und das Gewitter im Walde – drei Schritte vor uns schlug es in eine Eiche – großartig! Göttlich, ich möchte um vieles die Erinnerung daran nicht entbehren.«
»Herr Decaro scheint weniger entzückt von der Erinnerung, eher etwas angegriffen – drei Schritte, Donnerwetter! Das ist auch kein Spaß,« meinte der Graf.
»Wart ihr denn nicht betäubt?« fragte Röschen, welche nachträglich noch der Schreck durch alle Glieder fuhr, ihren Gatten.
»Geblendet, ganz geblendet,« erwiderte er.
»Und was machten die Pferde?« erkundigte sich der Graf.
»Diana stieg kerzengrade auf, ich hatte Not, mich zu halten. Nicht wahr, Herr Decaro?«
»Das muß ein phänomenales Bild gewesen sein! Frau Gräfin auf sich bäumendem Roß, blitzumzuckt,« bemerkte Leutnant Pritwitz. »Werden bald etwas Derartiges zu sehen bekommen von Herrn Decaro. »Brunhild in wabernder Lohe!««
»Danke Ihnen für die Anregung, Herr Leutnant. Vielleicht werden Sie mir zum Siegfried sitzen, dem Drachentöter, der Brunhild erwartet auf der Flammenburg,« erwiderte Julius spitzig.
Man war froh, lachen zu können, und tat dies über Gebühr. Der Graf lenkte das Gespräch ab auf die Jagderlebnisse, und bald war die Affäre vergessen, der man wohl nur gewohnheitsmäßig einen pikanten Beigeschmack gegeben hatte.
Julius beschäftigte sich angelegentlich mit seinen Schwiegereltern, indem er die versäumte Freudenbezeugung über ihren unerwarteten Besuch redlich nachholte. Der Rat war in heiterster Laune, er hätte nimmer gedacht, sich in diesem fremdartigen Kreise so wohl zu fühlen. Der ungewohnte feurige Wein rötete seine Wangen und riß ihn ganz aus seiner gewohnten Zurückhaltung. Er erzählte unschuldige Jugendgeschichten, Studentenstreiche, ließ sich sogar hie und da ein etwas gewagtes Anekdötchen entschlüpfen, selbst staunend über seine Kühnheit.
Die Harmlosigkeit seiner Worte mutete die blasierte, an viel Pfeffer gewöhnte Jagdgesellschaft gar sonderbar an, man lachte mehr über die Art des gutmütigen Alten, als über ihn selbst.
Unterdessen ließ sich die Rätin nicht irre machen in ihren Bewegungen; ihr Verdacht war einmal rege und trotz allem sichtlichen Bemühen der Gräfin und Decaros sich unbefangen im Gespräch zu begegnen, entgingen ihr doch nicht gewisse unbedachte Blicke, die ihre Beunruhigung noch vermehrten. Nicht minder überraschte sie das Benehmen Röschens, welche weit ab von Julius mitten unter Herren saß und dort der Mittelpunkt der Unterhaltung war. Man stieß mit ihr kameradschaftlich an, ihr Nachbar, ein junger, auffallend schöner Mann, hatte sogar den Arm auf ihre Stuhllehne gelegt und flüsterte wiederholt in sie hinein, worauf sie ihm bald einen Klaps auf die Schulter gab, bald ihr Gegenüber mit Brotkügelchen bombardierte. Ihre Wangen glühten vom Weine, ihre blauen Augen leuchteten. Als sie sich einmal von der Mutter beobachtet sah, kam sie in sichtliche Verlegenheit und gab ihren Nachbarn geheime Weisungen, worauf diese der Reihe nach ihr Monocle auf die Rätin richteten.
Der Zirkusdirektor machte mit der Meldung, es sei alles zur Vorstellung bereit, dem Diner ein Ende, welches schon zum Gelage auszuarten drohte.
Man begab sich in die Manege. Der Rat hatte längst die Heimfahrt vergessen und die Einladung des Grafen zum Übernachten angenommen. Ein eigentümlicher, jugendlicher Übermut hatte ihn erfaßt, und seine Gattin, welche am Arme des Grafen folgte, konnte sich nicht genug über die lebhafte Unterhaltung mit seiner Begleiterin, der Gräfin, wundern, über das Feuer seines sonst so verschleierten Blickes, das unter den Augengläsern hervorsprühte. Die geröteten Wangen des Greises vor ihr, sein andächtiges Emporblicken zu dem schönen, üppigen Weibe neben ihm, sein Scherzen empörte und beunruhigte sie, vermöge einer plötzlichen Resignation, welche über sie kam. Das war einfach Schicksal, unentrinnbar, dem Banne dieses Weibes war sie nicht gewachsen mit all ihrer Liebe. Armes Röschen! Armer Julius! Da galt nur noch eins: zur Rettung bereit sein, wenn es einmal so weit war.
Zu Anfang wurde die Vorstellung ziemlich ernst genommen, bald aber regte sich bei den Herren der Hang zum Ulk, man wollte selbst mitwirken. Der Graf machte den Anfang mit einem verblüffenden Voltigeurkunststücke, und im Nu mischten sich die Kavaliere unter die fahrenden Künstler. Einige steckten sich zur allgemeinen Heiterkeit in übrig gebliebene Trikots, sie sprangen durch Reifen, voltigierten, ritten Schule, übertrumpften die Clowns in derben Spässen; zuletzt saßen im Zuschauerraume nur noch Rats und Frau Decaro. Eine Fantasia, geritten von allen Herren, Künstlern und Künstlerinnen der Gesellschaft, an deren Spitze Gräfin Warwara, endete die Vorstellung. Wie ein Gewittersturm brauste die Reiterschar durch die Arena, lachend, schreiend, das wilde Heer; bald loderte die rote Jacke der Gräfin an der Tete, bald mitten im Gewirr der herumgeworfenen Pferde. Röschen war außer sich, der Anblick war herrlich, hinreißend! Ein heißer, fast erstickender Wind flog der Schar voraus. Ihr Nachbar vom Diner hielt sich stets dicht hinter ihr und flüsterte leichtbeschwingte Scherze hinauf.
Sie klatschte und jubelte vor Lust, und auch der alte Rat beugte sich weit vor und applaudierte. Heute ärgerte ihn zum erstenmal seine Leonore mit ihrer eisigen Ruhe.
»Einmal könntest Du mir ja einen fröhlichen Abend gönnen,« sagte er verdrossen.
Von diesem Augenblick an tat sie sich Gewalt an, und niemand ahnte das bittere Weh in der Brust der heiteren Frau.
Als nach der Vorstellung der Graf sie fragte, ob sie ihm verstatte, die Zirkusmitglieder an dem Souper teilnehmen zu lassen, fand sie selbst nichts Unpassendes mehr dabei.
Röschen war entzückt von dieser Idee des Grafen und nahm Fifine sofort für sich in Beschlag.
Es war eine toll zusammengewürfelte Gesellschaft in dem schwülen Saal, aus dem die Eßluft des Diners noch nicht gewichen war. Alle hatten einen verwandten Zug gemeinsam, die Reiter und Jongleurs mit den Kavalieren, die Reiterinnen und Tänzerinnen mit Warwara und Röschen; das Martiussche Ehepaar stand vereinzelt fremdartig in dieser Welt.
Man war auf Hohenheim gewohnt, sich frei zu bewegen. Der ehrwürdige alte Rat mit seinem langweiligen Amtsgesicht entpuppte sich als ein ganz fideles Haus, vor dem man sich nicht zu genieren brauchte, und nach der Rätin hatte man keine Veranlassung, sich viel umzusehen.
Die Herablassung der Herren wurde bald zur Vertraulichkeit. Die champagnererhitzten Köpfe vergaßen immer mehr die Verschiedenheit der hier vereinigten Elemente. Die Tafellust verwischte immer mehr die Unterschiede, die konventionelle Form; eine allgemeine, unbedachte Rücksichtslosigkeit ließ jede Maske abstreifen.
Warwara dampfte Zigaretten mit übergeschlagenen Beinen und lehnte sich im eifrigen Gespräche mit der ersten Schulreiterin nach ihrer alten Gewohnheit weit in den Tisch hinein. Der Graf erzählte mit greller Stimme stark gepfefferte Anekdoten.
Röschens Ausgelassenheit hatte trotz allem etwas Kindliches, wirklich Naives, als ob sie nur auf kurze Zeit, erregt vom Weine und der Unterhaltung, aus dem Kleide des Schüchterchens geschlüpft wäre.
Der Rat bewies, daß der trockene Ton, die strenge Amtsmiene ihm mehr anerzogen als angeboren waren und unter der Hülle orthodoxen Beamtentums noch manches jugendliche Fünkchen glühte.
Die schwüle Ruhe Decaros, sein leuchtender Blick, den er, jede Vorsicht vergessend, oft zu lange auf Warwara ruhen ließ, ließ den nüchternen Beobachter den Vorgang in der Waldhütte ahnen.
Das freie Benehmen Röschens, die alle Grenzen des Anstandes und der Sitte nahezu überschreitenden Huldigungen des Leutnants Pritwitz schienen ihn nicht im geringsten zu beunruhigen, im Gegenteil, er schien sie mit einer Genugtuung zu beobachten, sei es, daß er sich in seinem Schuldbewußtsein freute, gegen sie einen Vorwurf bei der Hand zu haben.
Am besten hielt sich Fifine, welche ohne gemachte Prüderie sich auf taktvolle Weise der Zudringlichkeit einzelner Herren erwehrte, und auch ihr Vater, der Direktor, der seine gemessene Würde keinen Augenblick vergaß und mit spöttisch selbstzufriedenem Schmunzeln die immer mehr anschwellende Orgie beobachtete.
Die Frau Rat fühlte bei der Beobachtung dieses Mädchens doppelt den Schmerz über ihr Kind, doppelt die Gefahr dieser Atmosphäre. Bitter bereute sie es, nicht sofort wieder abgereist zu sein; der Rat bemerkte jetzt nicht mehr ihre um Aufbruch flehenden Blicke, und durch eine direkte Aufforderung wollte sie ihm den »fröhlichen Abend« nicht verkürzen. Sie hatte ihn noch nie so gesehen! Der schmächtige Körper erzitterte förmlich unter der plötzlichen Befreiung ein langes Leben hindurch gebundenen Genuß- und Freudendranges. Warwara trieb ihr kokettes Spiel mit ihm, sie hatte ihre Freude daran, welche Macht sie auf diesen ungeschulten Mann ausübte, amüsierte sich an seinen drolligen Bemühungen, alte Erinnerungen an längst entwöhnte jugendliche Kurmacherei sich wieder aufzufrischen und auszunützen.
Mitten im Tumulte des Gelages erhob er sich schwankend, eine Ansprache zu halten. Die Züge gehorchten ihm nicht mehr, er stotterte, lachte über seine eigene Unfähigkeit unter den lauten Zurufen und Bravos der Zecher, welche der alte, angeheiterte Herr höchlichst belustigte. Als er zum Schluß das Champagnerglas mit zitternden Händen erhob, glitschte er auf dem glatten Parkett aus und stürzte, Gläser und Flaschen mit sich reißend, zu Boden.
Das Gelächter verstummte. Die unter Gläsertrümmern hingestreckte, vom verschütteten Wein triefende Gestalt des jetzt totenblassen Greises wirkte abschreckend. Man kam etwas zur Besinnung, die Unwürdigkeit des ganzen Auftrittes wirkte jedenfalls ernüchternd.
Julius war empört über die Blamage.
»Ziehen Sie sich zurück, Sie sind betrunken,« flüsterte er dem Rat in das Ohr.
Die Wirkung war eine unerwartete. Der Rat zuckte zusammen wie von einem Peitschenhieb getroffen, sah, wie aus einem Traume erwachend, an seinem beschmutzten Anzuge herab und erhob sich hastig, jede Hilfe fast derb zurückweisend. Sein blasses Gesicht lag wieder in ernsten Falten, nur die Unterlippe zitterte in heftiger Erregung.
»Bitte, meine Herren, lassen Sie sich durch meine Unvorsichtigkeit nicht stören; ich habe keinen Schaden gelitten«, sagte er, mit einem verbindlichen Lächeln. Julius, Röschen und die Rätin, welche ihn umstanden, mit einem drohenden Blick zurückweisend. Dann nahm er seinen Platz wieder ein.
In dem erregten, bleichen Gesichte, das der Schreck versteinert zu haben schien, lag etwas, das jede Bemerkung über den Fall auf jeder Lippe zurückdrängte. Er sah jetzt gar nicht mehr komisch aus, der alte Herr, samt seiner plötzlichen Steifheit, die unter diesen Umständen eigentlich lächerlich hätte wirken sollen.
Man fand den alten Ton nicht mehr, der bleiche alte Kopf am Ende des Tisches blickte so vorwurfsvoll mahnend in das ausgelassene Fest.
Der Rat wartete nur kurze Zeit ab, dann stand er auf, sich bei dem Grafen und der Gräfin zu empfehlen, die späte Stunde vorschützend.
»Wie können Sie sich denn die Laune verderben wegen des kleinen Mißgeschicks,« meinte Araschin. »Wir sind unter uns. Ein kleiner Schwips, das ist ja reizend in ihrem Alter! Wird Ihnen schon lange nicht mehr passiert sein. Sehr schmeichelhaft für uns, jedenfalls sehr gut amüsiert, Herr Rat.«
»Gewiß, Herr Graf, die Herren waren ja so liebenswürdig, aber der Schwips, der war nicht schuld an dem Fall, glauben Sie das nicht, Herr Graf, nur das Parkett. Ich bin es nicht gewohnt – das Parkett. Ich habe keinen Schwips, ich hatte noch nie einen in meinem ganzen Leben und jetzt mit siebenzig Jahren sollte ich –«
»Na, einen ganz kleinen müssen Sie schon zugeben«, bemerkte Warwara.
»Einen Ratsschwips«, sagte einer der Herren nicht leise genug, daß Martius es nicht gehört hätte. Er reichte seiner Gattin mit staunenswerter Sicherheit den Arm und entfernte sich mit einer kurzen, würdevollen Verbeugung.
Röschen begleitete die Eltern auf ihr Zimmer. Dort angelangt, sank der Rat in einen Stuhl, die Hand der Rätin krampfhaft festhaltend.
»Ich bin verloren, entehrt.«
Aus einem hohen Wandspiegel blickte ihm sein Bild entgegen: das Haar wirr, der Rock beschmutzt vom Fall, auf dem weißen Hemd Spuren vergossenen Weines. Justizrat Martius trunken! Im Hause des Grafen Araschin, zum Gelächter, zum Spott der Offiziere und des Zirkusvolkes! Er barg sein bleiches Antlitz vor Scham in den Händen.
Röschen, selbst angeheitert, lachte und scherzte über diesen neuen Beweis der väterlichen Schwäche. Der strenge Papa mit einem kleinen Räuschchen – das machte ihr einen Höllenspaß.
Da sah er sie durchdringend an. »Röschen!«
Noch nie blitzte sein Auge so zornig, klang seine Stimme so drohend. Sie fürchtete ihn jetzt.
»Röschen!« rief er dann noch einmal voll Mitleid und Schmerz, »her zu mir!«
Er streckte die Arme aus nach seinem Kinde, Tränen standen ihm im Auge.
Sie kniete, von einer plötzlichen Rührung erfaßt, vor ihm nieder, und er preßte sie fest an sich.
»Rette dich aus diesem Schlamme! Rasch, rasch, sonst ist es zu spät, wenn es mich gepackt hat, mich alten Mann, dieses häßliche Fieber! Fliehe mit uns! Mutter, komm.« Er streckte die Hand aus nach der Rätin. »Heute noch, gleich jetzt. Holt auch Julius, er muß auch mit. Dieses Weib, diese Luft wird auch ihn vergiften, verzehren –«
Er blickte wie von einer tödlichen Angst erfaßt im Zimmer umher und drückte die beiden Frauen an sich; sein Atem ging schwer.
»Rettet mich! Rettet mich!« keuchte er, sich erhebend, von beiden unterstützt gegen die Türe wankend. Plötzlich knickte er zusammen und hing röchelnd in ihren Armen.
Die Rätin schrie entsetzt auf, sie befürchtete das Ärgste. Röschen eilte, laut um Hilfe rufend, auf den Gang, die Treppe hinab, wo ihr bereits die ganze bekneipte Gesellschaft, Herren und Damen, an der Spitze Julius, entgegen kam.
»Papa stirbt, Hilfe! Einen Arzt, einen Arzt!« gellte ihr Schreien durch das gewölbte Stiegenhaus.
Der Graf gab Order, sofort einen reitenden Boten nach der Stadt zu senden; für die erste Hilfeleistung wurde der Dorfarzt geholt.
Der heftige Schmerz, der wahnsinnige Schreck Röschens packte auch Julius und brachte ihre innige Zusammengehörigkeit wieder voll in sein Bewußtsein.
Die Rätin kniete schluchzend vor dem schwer atmenden, auf das Bett hingestreckten Greise. So viel Julius verstand, war es eine schwere Ohnmacht, vielleicht ein leichter Schlaganfall.
Röschen warf sich in rückhaltlosem Schmerze über den Vater. Unter der Türe drängte sich die neugierige Gesellschaft, die Gäste des Grafen, gemengt mit den Zirkusleuten, sogar die beiden Clowns waren aus der Küche, wo sie das Dienstpersonal unterhielten, herbeigeeilt; der eine noch im Kostüm mit untermalten Augen und verzerrtem Munde.
Warwara schloß, ärgerlich über diese Zudringlichkeit, die Tür und nahm sich mit großer Herzlichkeit der beiden Damen, besonders Röschens, an.
Sie war ihre mitempfindende, tröstende, liebevolle Freundin, als ob sich nicht das Geringste den Tag über ereignet, kein schwarzer, tückischer Verrat, kein gemeiner Raub am Heiligsten. Und dabei verstellte sie sich gar nicht, sondern fühlte wirklich herzliche Teilnahme, inniges Mitgefühl und warf keinen Blick auf den sie fragend anblickenden Julius, der sich nie so gedemütigt fühlte als in diesem Augenblick. Was war ihr diese verhängnisvolle Viertelstunde in der Waldhütte, die ihn in seinen tiefsten Tiefen aufwühlte, ein vorübergehendes Abenteuer, ein leichtfertiges Spiel, das kaum die Oberfläche ihrer Seele kräuselte!
Er schwur sich, ein Ende zu machen. Um jeden Preis fort von Hohenheim!
Der Arzt erschien und fand den Zustand des Kranken nicht so bedenklich, als man fürchtete. Es sei allerdings eine Mahnung, und der alte Herr müsse Exzesse im Trinken sorgfältig vermeiden. Die Rätin beugte die Scham bei diesen Worten.
Warwara forderte vergebens Röschen und ihren Gatten auf, alles Aufsehen im eigenen Interesse des Rates zu vermeiden und wieder in der Gesellschaft zu erscheinen.
»Der kleine Pritwitz wird untröstlich sein, wenn Sie nicht wiederkommen,« fügte sie scherzend, zu Röschen gewandt, hinzu.
Julius verstand sie, er legte ostentativ den Arm um Röschen.
»Heute muß der kleine Pritwitz schon verzichten; meine Frau bleibt,« sagte er energisch, fast rücksichtslos.
»Nun, dann will ich nicht länger stören. Sie fassen alles zu tragisch auf, Herr Decaro, Angenehmes und Unangenehmes. Das ist ein großer Fehler für einen Künstler. Wenn man eine Nacht darüber geschlafen hat, sieht sich alles anders an, und wir lachen über Dinge, die uns ein großes Ereignis schienen.«
Mit einem spöttischen Blick auf Julius entfernte sie sich.
Der Rat erwachte aus seiner Ohnmacht, blickte verstört um sich. Von unten herauf erscholl von neuem Gläserklang, lautes Gelächter, der Lärm des Gelages.
»Was lacht ihr denn? Ich bin nicht betrunken, Julius, gewiß nicht. Nur der Boden war zu glatt für meine alten Füße. Betrunken, der Rat Martius – er ist nicht mehr Rat, sie haben ihn pensioniert, entlassen –«
»Papa, komm doch zu dir, liebes Papachen! Du bist ja nur ohnmächtig geworden in dem heißen Saal, und jetzt ist wieder alles gut,« beruhigte ihn seine Tochter.
»Röschen, du auch hier?« Er ergriff mit zitternden Händen ihr Haupt, das sich an seine Brust lehnte. »Mein armes Schüchterchen, und wo ist denn der Julius, daß er dich rettet aus dieser Hölle? Hörst du sie toben um die rote Flamme – siehst du sie, wie sie an dir hinaufleckt, an ihm, an mir selbst – flieh, Röschen, flieh mit ihm, an mir ist nichts mehr gelegen.«
Er atmete schwer auf und sein graues Haupt fiel wieder zurück in die Kissen.
»Wir müssen fliehen, Röschen, er hat recht – gleich morgen,« flüsterte Julius seiner Gattin zu.
»Gebe Gott, daß es nicht zu spät ist,« betete die Rätin.
Warwara hatte recht mit ihrem Grundsatze, daß sich den anderen Tag alles anders ansah. Decaros blieben auf Hohenheim; Julius konnte doch einem Verstoß seines Schwiegervaters zu liebe nicht alle angefangenen Arbeiten zurücklassen, fest abgeschlossene Aufträge; außerdem war zu fürchten, der Graf möchte eine plötzliche Abreise unwillkürlich in Zusammenhang bringen mit dem etwas unklaren Irritt im Walde; auf einige Wochen kam es nicht an.
Anders verhielt sich die Sache bei Rat Martius, ihm schien sein Benehmen bei Araschin andern Tags, als er wieder völlig bei klarer Vernunft war, durchaus nicht im milden Lichte. Die Ehre seines Standes hatte er verletzt, noch dazu in einer Gesellschaft, in welcher er doppelt Grund hatte, sie zu wahren. Immer wieder sah er sich in der schmachvollen Situation wie ein Trunkenbold am Boden liegen, unter zerbrochenen Flaschen, zum Gelächter der Offiziere, und er sollte je wieder im Stande sein, in voller Amtswürde am grünen Tische zu sitzen? Abgesehen davon, daß die Herren sicher nicht reinen Mund darüber hielten und seine unverantwortliche Aufführung binnen kurzem in der ganzen Residenz bekannt sein würde.
Vierzig Jahre voll treuer, redlicher Arbeit, voll Pflichtbewußtsein lagen hinter ihm, keinen Schritt trat er in dieser langen Zeit aus seinem Lebenskreis, mit peinlicher Gewissenhaftigkeit wachte er über seine Standesehre. Diese eine unheilvolle Nacht, in welcher unbegreifliche, dämonische Möchte längst entschlummerte, ja, wie er wähnte, nie erwachte Leidenschaft in ihm weckten, beschmutzte in seinen Augen alles.
Ohne Wissen seiner Frau suchte er um seine Pension nach, die dem veralteten Beamten, welcher ohnehin in das neue, jugendfrische Regime nicht mehr paßte, gerne bewilligt wurde.
Mit Sehnsucht wartete er täglich auf Röschen und Julius. Sie kamen nicht und er glaubte nicht einmal mehr das Recht zu haben, sie darum zu tadeln. Allmählich beruhigte er sich darüber, am Ende war für Decaro unschädlich, was für ihn verderblich war. Einem jungen Künstler nimmt die Welt derartige Exzesse nicht übel, und so schlimm wie er wird dieser sich nicht vergeben, dazu war er zu erfahren und gewandt. Nur für Röschen war ihm bange, er erinnerte sich jetzt erst an ihr Benehmen bei Tische, das ihm damals in seiner Erregung gar nicht aufgefallen, doch Julius schien es nicht anders zu wollen, und in dieser Welt dachte man wohl anders als er darüber.
Die Frau Rat schwieg wohlweislich von ihren Beobachtungen, sie wollte ihn nicht weiter beunruhigen.
Plötzlich kamen die jungen Leute angeflogen und zogen mit sichtlichem Behagen in die stille, bescheidene Wohnung im zweiten Stocke. Besonders Julius atmete erleichtert auf, war von einer Herzlichkeit gegen seine junge Frau, welche die Rätin bis zu Tränen rührte, und sie im stillen alles abbitten ließ. Es war einfach unmöglich, daß dieser Mann das Bild eines anderen Weibes in seinem Herzen trug als das Röschens.
Er schlüpfte wieder in seinen Schlafrock und seine Pantoffeln, sie steckte die Küchenschürze vor, bediente bei Tische, rauchte dann ihre Zigarette auf seinem Schoße und schwärmte von dem stillen Glücke im Vergleich mit der rastlosen Vergnügungsjagd auf Hohenheim. Nur eines fehlte, bemerkte sie dann in holder Verschämtheit, ein lebendiges Pfand der Liebe, ein süßes Kindchen, und auch in ihm weckte sie diese heilige Sehnsucht. Sie versetzten sich ganz in diese neue Welt mit allen ihren erhebenden Freuden, hohen Opfern, erschütternden Schmerzen. Sie saßen an der Wiege, hörten das entzückende Lallen, sahen das drollige Strampeln, standen vor dem brennenden Weihnachtsbaum und blickten in blaue, staunende Märchenaugen. Ein reinigender Hauch ging von Röschen aus und kämpfte oft siegreich mit den üblen Dünsten von Hohenheim. Die junge Frau empfand plötzlich die Verpflichtung, sich bereit zu halten für die hohe Würde einer Mutter, und wenn sie in diesem Licht die letzten Monate betrachtete, ihr ausgelassenes Wesen, mußte sie erröten. Er hingegen sah in dieser Empfindung seiner Frau eine sichere Ahnung eines nahen Glückes, von dem er sich Heilung versprach für seine wunde Seele. Er hatte sich redlich Mühe gegeben während seines letzten Aufenthaltes in Hohenheim, jedes Alleinsein mit Warwara zu verhüten, und diese selbst schien es nicht zu suchen, aber das Bekenntnis in der Waldhütte ließ sich deshalb nicht ungeschehen machen. Sie verkehrten doch ständig unerlaubterweise mit einander mit Blicken, Gedanken, immer wieder sich regenden Wünschen; jetzt, ferne von ihr, fühlte er sich völlig frei von ihrem verderblichen Einfluß; das beruhigte ihn über seiner Leidenschaft, aber er fürchtete ihre Wiederkehr – da wäre ein Kind der beste Schild.
Die Ahnung Röschens erfüllte sich nicht, und eines Spätherbsttages erschien Warwara in der Wohnung, nach ihren alten Freunden zu sehen. Beide empfanden ein häßliches Gefühl, eine peinliche Störung, doch ihrem bestrickenden Wesen war nicht zu widerstehen. Sie machte eine versteckte Anspielung, daß mit den Aufträgen doch nicht auch die Freundschaft zu Ende sein sollte, und entwickelte einen Plan, der für Julius wirklich etwas Bestrickendes hatte.
Es sollte ein großes Kostümfest veranstaltet werden, dessen Grundidee die szenische Darstellung der hervorragendsten Werke der letzten großen Kunstausstellung sein würde. Decaro sollte das ganze Arrangement übernehmen, Auswahl und Urteil über die Zulassungsfähigkeit der Masken einer Jury von befreundeten Künstlern und Autoren zustehen, an deren Spitze der Maler; sie allein nahm sich das Recht, die Wahl der Kostüme eigenmächtig zu bestimmen, auf ihren guten Geschmack könne er sich ja verlassen.
Das war ein weites, dankbares Feld, Julius brachte es trotz einer warnenden Stimme in seinem Innern nicht zustande, eine abschlägige Antwort zu geben.
Auch Röschen war entzückt von der Idee, besonders als ihr Warwara ihren Plan zuflüsterte. Jetzt wußte sie auch, was sie vorzustellen hatte, den »Backfisch«, das sollte eine famose Überraschung werden.
Die Vorbereitungen begannen frühzeitig. Der Ausschuß tagte bei Warwara, dreimal in der Woche. Man ließ sich die Einschränkung der freien Wahl, die strengsten Vorschriften, die rücksichtslosesten Prüfungen gerne gefallen, glücklich, eine Einladung zu dem Feste zu erhalten, dem beigewohnt zu haben zum guten Ton gehörte.
Julius waltete strenge seines Amtes. Unter seinen Beigeordneten fand er zu seiner Überraschung einen gewissen Gußmann; dieser brachte vor Jahren ein historisches Drama in Jamben durch die Protektion Warwaras auf die Bühne, doch hatte er schon seit langer Zeit mit seiner dichterischen Vergangenheit gebrochen und gehörte jetzt der extremsten naturalistischen Partei an. Gerade deshalb fand er Einlaß bei Warwara. Sie war der eintönigen aristokratischen Gesellschaft vom vorigen Winter satt, dürstete nach Neuem. Dem frischen Luftzug, wie sie sich ausdrückte, der modernen Geistesrichtung sollte das dumpfe Palais Araschin geöffnet werden; außerdem reizte es sie, die Probe zu machen, wie weit diese Gesellschaft sich von ihr führen ließe. Ihre Lektüre den Sommer über in Hohenheim, französische, russische Romane der extremsten Richtung, in möglichst schlechter Übersetzung, wie sie die Leihbibliothek ihr lieferte, pikante Broschüren und Flugschriften, welche mit großer Zungenfertigkeit ein neues, ihr sehr verwandt dünkendes Sittengesetz predigten – der Graf hatte sie gelegentlich seiner Fahrten in die Stadt als amüsante Eisenbahnlektüre gekauft – hatten in ihr den Wunsch wachgerufen, auf diesem Gebiete eine Rolle zu spielen.
Sie glaubte alle Eigenschaften dazu zu besitzen, Geist, Schönheit, Reichtum – an Gläubigen konnte es nicht fehlen. Sie hätte am liebsten auf Gußmanns Rat, von Anfang an offen Farbe zu bekennen, mit Ibsens »Gespenster« eröffnet, doch vor allem wollte sie Julius wieder bei sich sehen, und da sie fühlte, daß der schwache, feige Mann ihr absichtlich auswich, daß die neue Richtung, welche sie einschlug, ihm einen willkommenen Anlaß bieten könnte, fernzubleiben, ersann sie den Plan mit dem Kostümfeste; in diese Falle ging er, dazu kannte sie ihn zu gut.
Gußmann war seiner äußeren Erscheinung nach nichts weniger als interessant, ein gesunder, derber Blondkopf mit apfelroten Backen und einem stattlichen Leutnantsschnurrbart.
Da die Ausschußsitzungen und Vorstellungen stets am Abend stattfanden, schon des Beleuchtungseffektes halber, knüpften sich lange Unterhaltungen daran, reizende, ganz intime Soupers. Der Graf ging kurz nach dem Souper in den Klub, die ganze Kostümgeschichte langweilte ihn. Der semmelfarbige Gußmann mit dem erkünstelten Kavalierston und seinen Schreibmanieren, seinen verrückten, aufdringlichen Ansichten war ihm unleidlich. Auch dieser schien zu Julius Überraschung nicht sehr begeistert von Warwara, er richtete seine Lehren und Vorträge mehr an Röschen, die ihm wohl eine dankbarere und bekehrungsbedürftigere Schülerin war; er fand bei ihr einen solchen Wust von Vorurteilen, Idealen, altväterischen Ansichten, daß er gar nicht wußte, wo anfangen, doch Röschen hörte ihm aufmerksam zu, seine Worte fielen nicht auf unfruchtbaren Boden. Seine Kunstausdrücke, dieses Aposteltum der Wahrheit imponierten ihr sichtlich, besonders seine bombastischen Phrase über die geknechtete Frau, über den egoistischen Mann, über die moderne Ehe. Dazwischen klang verführerisch von seinen vollen roten Lippen das neue Evangelium des Genusses, die logische Folge einer pessimistischen Weltanschauung, inhaltsvolle, bestechende Worte, die ihr oft das Blut in die Wangen trieben, ihr oft recht unanständig und frech vorkamen in Gegenwart von Damen, die sie aber doch gerne hörte. Auf Warwara machten die Sprüche wenig Eindruck, das war ihr ja alles nichts Neues mehr. Das Interesse, welches der junge Mann in Röschen wachzurufen verstand, ließ sie um so ungestörter sich mit Julius beschäftigen. Das war die Hauptsache.
Die Isolierung der beiden wurde immer vollständiger. Das redselige, wißbegierige Röschen wurde der Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Seine immer noch nicht ganz verwischte Naivität, die Frische seines Empfindens reizte die Lebemänner mehr als die raffinierte, überreife Warwara. Gußmanns scheinbar gesundes, natürliches Wesen gefiel der jungen Frau, seine Offenheit flößte ihr Vertrauen ein, die unruhige, fieberhafte Stimmung, in welche sie oft seine freien Reden, die Gedichte und kleinen Novellen versetzten, welche er als Muster vorlas, wurden ihr bald unentbehrlich.
Julius erschien, von diesem Standpunkte aus besehen, fürchterlich langweilig, alltäglich.
Der Tag des Festes war angebrochen. Röschen hatte sich in hartnäckiges Schweigen gehüllt, so sehr auch Julius darauf drang, daß sie sich mit ihrem zu wählenden Kostüm den allgemeinen Bestimmungen unterwerfe; Warwara unterstützte die junge Frau darin, sie war offenbar einverstanden damit. Bis zum letzten Augenblick war Röschen selbst noch unentschlossen, mit einer gewissen Scheu betrachtete sie immer wieder von neuem das schwarze, schlichte Institutskleid, den unförmlichen weißen Kragen, den häßlichen Hut.
Ein unbegreifliches, wehmütiges Sehnen ergriff sie.
Süße Erinnerungen wurden wach gerufen, an den ersten Kuß, die junge Liebe. Ihre Gedanken gingen einen weiten Weg zurück und wieder bis zu diesem Tage.
»Seit einigen Tagen war ihr sonderbar zumute, bald entsetzlich ängstlich, bald zum Weinen vor seligem Gefühl. Ein paarmal befiel sie jäher Schwindel, in den Ohren sauste und brauste es wie von tausend Stimmen, die ihr alle nur ein Wort zuzurufen schienen, ein heiliges Wort, vor dem sie erbebte in all ihren Fasern – Mutter!
Sie wollte nicht sprechen mit Julius, ehe sie nicht Gewißheit hatte, die Enttäuschung hätte ihn doppelt geschmerzt, selbst der Mutter gegenüber hatte sie noch geschwiegen. Papa war so leidend die letzten Wochen, der Arzt empfahl sorgfältige Ruhe, jede Aufregung konnte tödlich für ihn werden. So schwieg sie und horchte von Stunde zu Stunde auf die holde Offenbarung in ihrem Innern.
Es dunkelte schon, auf den Straßen lag der erste Schnee. Röschen saß in ihrem einfachen Schlafzimmer. Vor ihr auf dem Bette lag ausgebreitet der schwarze, einfach gefältelte Rock, der schwarze runde Kragen; die weiße, steife Krause leuchtete durch die Dämmerung. Auf dem Boden standen die plumpen Schnürstiefel, für das kleine Füßchen im blauen seidenen Pantoffel gewiß nicht gemacht, das unruhig auf die Diele tippte; an der Wand hing an breitem blauen Bande ein silbernes Kreuz.
Jedes Stück erzählte Röschen eine lange Geschichte. Die Laternen wurden auf der Straße angezündet und warfen ihren gelben Schein in das Zimmer, und noch immer horchte Röschen darauf. Sie kniete wieder auf den Steinfliesen der Klosterkirche, von oben wie aus den Wolken ertönte der jubelnde Choral der Schwestern und erfüllte die junge Seele mit erhabener Andacht. Sie hörte wieder das geisterhafte Rauschen der faltigen Gewänder in den feierlichen Hallen, die sanften, liebevollen Stimmen der Nonnen, sie fühlte die weißen, duftigen Hände auf ihrem Scheitel. Alles so eigentümlich erdentrückt, so ganz anders als draußen in der Welt, deren dumpfes Brausen jetzt ihre Fenster beben machte. Es lag doch ein großes Glück in diesem weltfernen Frieden, in diesem stillen Entsagen.
Ein heißer Strom stieg in ihr auf, die Augen brannten, das Herz pochte ungestüm, dann stand es wieder fast ganz stille, wieder erfaßte sie der Schwindel, das Zimmer mit dem Bett, die Kleider, alles tanzte um sie her. Sie erwachte in den Armen ihrer besorgten Mutter, die einen verdächtigen Fall gehört hatte und schnell aus dem Nebenzimmer herbeigeeilt war.
»Röschen! Um Gottes willen, Röschen, was fehlt dir denn? Und da willst du auf den Ball gehen? Sprich doch, was fehlt dir?«
Röschen blickte in das teure, alte Gesicht, die blauen Augen liefen ihr über in Tränen.
»Mutter!« schrie sie plötzlich auf. »Mutter! Ahnst du es denn nicht? O, wie glücklich bin ich!« Dann sank sie an die treue Brust laut schluchzend. Lange hielten sich die beiden umfangen, die Weihe der Botschaft war zu groß für Worte.
Die völlige Dunkelheit erinnerte Röschen daran, daß sie Eile hatte. Die Rätin erklärte es für ein Verbrechen, bei solchen Hoffnungen den Ball mitzumachen, doch da half keine Einrede.
Julius war bereits seit Mittag im Palais Araschin mit Vorbereitungen für den Abend beschäftigt. Gene noch wollte sie ihm sein Glück zuflüstern.
»Und in diesem Kleide?« fragte die Mutter, auf das Bett deutend.
Röschen war verlegen, sie wollte den Eltern nichts davon sagen und jetzt kam es ihr selbst wie ein Frevel vor.
Die Mutter ahnte den seelischen Vorgang in ihrem Kinde und wollte es nicht länger quälen.
»Nun, so gehe, mein Kind, in diesem Kleide muß ihn ja die frohe Nachricht doppelt bewegen. Aber bleibe nicht zu lange, dein Vater gefällt mir gar nicht – nicht, daß du dich ängstigst, ums Himmels willen nicht – aber er könnte nach dir verlangen.«
Röschen versprach, in wenigen Stunden heimzukehren, Julius werde gewiß die Freude der Aufregung auch nicht lange bei dem Feste lassen.
Die Rätin half ihrem Kinde beim Ankleiden. Tränen traten ihr in die Augen und ihre Hände waren unsicher. Sie fragte mit Besorgnis Röschen aus über die Zukunft; wenn einmal ein Kleines da sei, werde das Leben in der großen Welt nicht mehr gut möglich sein, dann gebe es neue Arbeit und Sorgen, und fremden Händen werde sie ihr Kind doch nicht anvertrauen wollen.
Röschen lachte über diese unglaubliche Idee der Mutter; keinen Schritt würde sie mehr aus dem Hause gehen, von ihrem Schatze weichen, das sei es ja gewesen, was sie fortgetrieben, das Gefühl der Verlassenheit, der Kummer über ihre Kinderlosigkeit. Auch bei Julius sei das der Grund gewesen, sein ganzes verstörtes, zerfahrenes Wesen sei daher gekommen.
Sie stand fertig vor dem Spiegel, auf und nieder das Schüchterchen, nur der Blick war anders und die Taille nicht mehr so schlank. Wie sie sich das ausgedacht hatte für den Abend – Warwara hatte sie ein Couplet gelehrt für ihr Erscheinen als Schüchterchen.
Die Schamröte stieg ihr ins Gesicht. Was war aus ihr geworden! Unzählige Szenen, Gespräche tauchten vor ihr auf aus der letzten Vergangenheit. Es war ihr, als ob das Wesen unter ihrem Herzen das alles mit angehört, mit angesehen hatte, und jetzt als Mutter – das war sie von dem Augenblick an, wo sie sich als solche fühlte, – wieder hinabtauchen in diesen tollen Strudel! Das Gefühl einer hohen Würde erfaßte sie, sie kam sich unendlich läppisch, albern vor in dieser Maske.
Mit einem eiligen Kuß empfahl sie sich von der Mutter.
»Sage dem Papa nichts davon, es würde ihn kränken, er hält ja viel auf dieses Kleid!«
Die Rätin blickte entzückt auf ihr Kind, sie vergaß einen Augenblick die Verkleidung, das Schüchterchen stand vor ihr, wie es einst ihr gehörte, ganz allein in kindlicher Reinheit: erst als es aus dem Zimmer verschwunden war, dachte sie des süßen Geheimnisses, das sich unter diesem jungfräulichen Kleide barg.
Das Palais Araschin glühte im Lichterglanze, ein endloser Wagenzug rollte in seinen hellerleuchteten, weit geöffneten Eingang. Da die Wagen durch den rückwärtigen dunklen Park sich entfernten, machte das Tor den Eindruck einer nimmersatten, alles verschlingenden Kinnlade. Ein bunteres Völkchen hatte der große Saal niemals gesehen. Trachten aller Länder, aller Zeiten, üppigster Reichtum, grinsende Not, asketische Mönche, tief verhüllte Nonnen, Bauernmädel, japanische Tänzerinnen, Ritter, Stierfechter, Schiffer, Arbeiter, fahrendes Volk aller Art, jung und alt. Der Realismus mit klappernden Holzschuhen, schmutziger Bluse und Holzpfeife, das konventionelle historische Kostüm, die veralteten Allegorien, der akademische Zopf, alles war vertreten und bewegte sich jetzt noch in bunter Sinnlosigkeit durcheinander.
Julius übernahm eben die schwierige Arbeit, aus dieser schwatzenden, gaffenden, durch die Fülle der Eindrücke verwirrten, geblendeten Masse die verschiedenen Tableaux zu formen, mit deren Darstellung das Fest beginnen sollte.
Vergeblich hatte er Warwara zu bestimmen gesucht, ein anderes Kostüm zu wählen. Er machte ihr die verlockendsten Vorschläge, sie sollte an Schönheit alle überstrahlen; doch sie bestand auf ihrem geheimen Plan. Noch immer hatte sie sich der Gesellschaft nicht gezeigt, der Graf, trotz seiner Abneigung gegen derartige Festlichkeiten, sich auf Zureden Decaros als spanischer Grande gekleidet, machte bis jetzt allein die Honneurs.
Da machte ein Diener Julius die geheime Mitteilung, die Gräfin wünsche ihn vor ihrem Erscheinen wegen ihrer Toilette zu sprechen. So unangenehm es ihm war, die fast glücklich vollendete Sonderung abbrechen zu müssen, so war er doch selbst zu neugierig und fühlte sich zu sehr geschmeichelt von dieser besonderen Gunst, als daß er dem Ruf nicht sofort Folge geleistet hätte. Er übergab die Vollendung seines Werkes Gußmann, seinem Adlatus, welcher als belgischer Arbeiter in blauer Bluse, plumpen Holzpantoffeln, die Hände in den Hosentaschen, die kurze Pfeife schief im Munde, aus dem Rahmen eines Courbet herausgetreten zu sein schien.
Julius folgte dem Diener durch den hellerleuchteten Empfangssalon, durch die Wohnzimmer der Gräfin. Man wies ihn mit einer gemessenen Handbewegung auf die geschlossene Portiere, welche in das Boudoir der Gräfin führte.
Julius verweilte einen Augenblick, heftige Unruhe befiel ihn, eine Angst vor dem Anblick, der seiner wartete. Sie wird ihre Schönheit in das vollste Licht stellen mit allem Raffinement; das verstand sie, und ihre Absicht war offenbar, daß er sie zuerst und allein bewundere, daß ihr Reiz um so sinnverwirrender auf ihn wirke. Noch hatte sie keinen zweiten Sieg über ihn zu verzeichnen und der erste in der Waldhütte trat jetzt klar vor seine Seele.
Er dachte an Röschen – warum blieb sie so lange aus? Auch sie schmückte sich nur für ihn, wollte ihn überraschen, sie lachte auch so geheimnisvoll, als er sie heute mittag verließ. Sie liebte ihn immer noch gleich innig, trotz der Vernachlässigung, die sie seit Wochen erfuhr, trotz allem Ansturm dieses Literaten auf ihre Weiblichkeit, den er nicht nur duldete, nein, mit Wohlbehagen ansah. Er war sich in diesem Augenblick der schiefen Bahn völlig bewußt, auf der er sich bewegte, des frivolen Spieles, das er trieb. Zurück in den Saal, zu ihr; hinter diesen roten Falten lauerte der Verrat, das Verbrechen –
Da knisterte es ganz leise, ein Gegenstand fiel zur Erde, ein Taumel erfaßte ihn, er öffnete die Portiere. Vor ihm auf dem Diwan lag Warwara, in einem Handspiegel sich besehend, gerade so wie damals in seinem Atelier, aus dem dunklen zurückgeschlagenen Pelz leuchtete der üppige blühende Nacken einer Göttin, das rote Haar fiel in schweren Lockenringen darauf herab.
Das Weib seiner heißen Jugendträume, da lag es wieder in seiner ganzen Pracht, im spitzenwogenden Gewand, umzuckt von märchenhaften Lichtern.
Sie lachte und warf die Locken zurück.
»Man erwartet Sie, Gräfin, Ihr langes Ausbleiben erregt Aufsehen«, stammelte Julius.
»Lassen Sie sie warten; was kümmert mich das Volk! Für Sie habe ich so gewählt, Undankbarer, Treuloser! Alte, liebe Erinnerungen wachzurufen, da man einmal die Zeit nicht zurückrufen kann. Sind Sie zufrieden? Erkennen Sie Ihr Werk, für das Sie sich einst so begeisterten? Oder ist es veraltet, nachgedunkelt? Wollen Sie es verleugnen?«
»Sprechen Sie nicht von meinem Werk, Gräfin, Pfuscherarbeit ist es geworden, seitdem das Original sich tausendmal verschönt!«
»Dafür bin ich das Zauberweib, Sie selbst nannten mich ja so. Erinnern Sie sich nicht mehr, im Gewittersturm, blitzumzuckt?«
»Warwara, haben Sie Mitleid – ob ich mich erinnere – aber es war ein Verbrechen und ich will kein neues begehen, darum –«
»Wollen Sie fliehen? Als ob es darum besser wäre. Was kümmert mich die Welt! Daß Sie ein Kind, daß ich einen Stallburschen geheiratet habe! Ich liebe Sie vor der ganzen Welt, Ihnen selbst zum Trotz.«
Sie war aufgesprungen, der Pelz fiel von ihren Schultern, im meergrünen, diamantenübersäten Kleide schillerte sie wie eine Schlange. Die weiße Brust hob sich im Sturme der Leidenschaft.
Julius starrte sprachlos auf dieses gleißende Weib, es wuchs zur Riesin vor ihm, es füllte den engen schwülen Raum mit seiner wilden Leidenschaft, seiner unwiderstehlichen Schönheit. Sein Gehirn brannte, jedes Gedächtnis war erloschen, jede warnende Stimme in seinem Innern schwieg, er sank willenlos auf die Knie, umfaßte den knisternden Leib, die roten Locken fielen ihm über das Antlitz, heiße Lippen drückten sich auf die seinen – da gellte ein wilder Schrei, von dem der ganze Raum zu erbeben schien.
Noch kniend wandte er sich entsetzt gegen den Eingang, und das Blut erstarrte ihm, – unter der geöffneten Portiere stand das Schüchterchen im schwarzen Kleide, mit dem unförmlichen Kragen und dem Kreuz am blauen Bande. Unter dem großen Hute aber blickten starr zwei große Augen aus aschfahlem Antlitz. Noch ein dumpfes, röchelndes Stöhnen, dann schlossen sich wieder die Falten, das Bild war verschwunden.
Zitternd, fragenden Blickes auf Warwara erhob er sich.
War es ein Phantom, ein Spiel seiner erhitzten Phantasie, seines Schuldbewußtseins oder Wirklichkeit?
»Der Backfisch!« klärte ihn Warwara lakonisch auf. Noch mehr als die Bestätigung, daß er recht gesehen hatte, entsetzte ihn der kalte, nüchterne Ton, in dem dieses Weib noch zu scherzen verstand, in diesem Augenblick.
Er blickte mit Grauen in das jetzt marmorkalte, schöne Antlitz, in dem kein Zug den Sturm verriet, der eben hier getobt hatte.
»Kommen Sie, jetzt ist es wirklich Zeit, daß wir uns sehen lassen; die Kleine wird schweigen«, sagte sie und nahm seinen Arm.
Mechanisch wandelte er neben ihr durch die Gemächer wie ein Automat.
* * *
Röschen suchte vergebens ihren Gatten unter dem Maskengewimmel, von allen Seiten wurde sie aufgehalten, angesprochen, jeder erkannte den »Backfisch«, welcher in der letzten Ausstellung figurierte.
Unter den bunten Kostümen, die nicht jedem zu Gesichte standen, trotz der Sorgfalt Decaros, fiel die schlichte, naturwahre Mädchenerscheinung vorteilhaft auf. Das war keine Maske, das war wirklich der vielgepriesene Backfisch, wie aus dem Rahmen getreten. Von allen Seiten umdrängte man die liebliche Erscheinung, die wie ein Frühlingshauch durch die überfüllten Räume huschte. Endlich gab ihr Gußmann Auskunft, Julius sei eben gerufen worden, die Toilette der Gräfin zu prüfen.
Er sprach das mit einem zynischen Lächeln. Das ganze Benehmen dieses Mannes, die Vertraulichkeit, die er sich ihr gegenüber, die Maskenfreiheit benützend, erlaubte, während er sie durch den Saal begleitete, empörten jetzt Röschen. Die ganze Maskerade ekelte sie an, hatte sie doch nur einen Gedanken, einen Sinn, ein Wort auf den Lippen. In diesem Raume, unter diesen Menschen allen hätte sie es nimmer sprechen können, es war ihr ganz recht, daß Julius nicht da war. Warwara war ja ihre Freundin, die durfte schon dabei sein bei dem glücklichen Bekenntnis; keine Stunde wollte sie versäumen. Er wird der glücklichste von allen sein diesen Abend.
Sie erwartete, ihn im Salon zu treffen bei Warwara. Er war leer, auf einem Stuhl stand ein Herrenhut, sie besah ihn, Julius Decaro stand auf dem weißen Damastfutter in goldenen Buchstaben, und hinter der Portiere vernahm man gedämpfte Stimmen, das waren sie. Eine köstliche Bangigkeit befiel sie, wie man sie vor großen Überraschungen empfindet, die man jemand Liebem bereitet. »Wie soll ich es denn sagen? Werde ich lachen oder werde ich weinen? Julius, lieber Julius, böses Männchen, jetzt ist es aus mit deinem Zürnen und Gramsein, ich – ich – nein, so nicht – das Bubi – ein großes Glück – Erfüllung – mein Gott, um den Hals falle ich ihm und küsse ihn und flüstere ihm ins Ohr: Mutter!«
Sie schritt gegen die Portiere – Warwaras Stimme klang unverständlich heraus.
Mit einem Ruck riß sie die Portiere auf, und sah und hörte, und konnte sich nicht bewegen, nicht aufschreien. Tausend glühende Funken stoben vor ihren Augen und eine riesige schillernde Schlange züngelte nach ihr mit unzähligen feuerroten Zungen. Die Worte jagten sich sinnlos wie die Funken um ihr sausendes Gehör. Da glitt ein Mann herab an dem grünlichen Schlangenleib, der sich um ihn schmiegte, und die roten Zungen umringelten sein Haupt: – das Haupt ihres Gatten – des Vaters!
Ein jäher Schmerz zuckte auf unter ihrem Herzen, da schrie sie auf, ließ den Vorhang fallen vor dem höllischen Anblick und floh, floh sinnlos durch die Räume, bis Musik, Stimmengewirr, Gelächter ihr entgegenbrauste, das wogende, schlürfende Geräusch Tanzender – da stutzte sie, da löste sich ihre Verwirrung. Hinein in den Reigen, in den Mummenschanz und im tollen Taumel alles vergessen! Genießen, rücksichtslos genießen, darin liegt die Wahrheit, und alles andere war Lüge, erbärmliche Lüge – Liebe, Treue, alles Lüge, ein Kindermärchen. Wach auf, Schüchterchen, auch du bist schön, begehrenswert, und dieses Kleid ist gut gewählt – die verhöhnte Unschuld!
Schon war sie daran, die Flügeltüren zu öffnen zum Saal, da zuckte wieder der Schmerz in ihr – sie ließ die Klinke los und eilte auf den Gang, die Hand auf das Herz gepreßt.
Gußmann trat ihr entgegen in der blauen Bluse.
»Wohin so eilig, kleiner Käfer?« rief er, die Maskenfreiheit benützend, mit ausgebreiteten Armen ihr den Weg sperrend. »Fürchtest du dich vor der blauen Bluse? O, wir sind nicht so schlimm, als wir aussehen. Ein kleines Küßchen, sonst kommst du nicht durch.«
»Lassen Sie mich, ich beschwöre Sie, lassen Sie mich«, flüsterte Röschen entrüstet.
»Ja, was haben Sie denn, Frau Decaro, so bleich, so verstört? Ah, ist es das? Gefunden den Ausreißer bei der Kostümprobe! Na, dann erst recht, erst recht, schöne Frau, Aug' um Aug', Zahn um Zahn, Kuß um Kuß! Ein Frauchen wie Sie wird sich doch darum nicht grämen.«
Er haschte nach ihr, umspannte sie mit seinen Armen, da traf ihn ein Schlag mitten in das Gesicht.
»Elender!«
Röschen riß sich los, sie eilte die Treppe hinab an den erstaunten Dienern vorbei, hinaus in das Freie, in die Winternacht. Wohin? Nach Hause! Es gibt kein nach Hause mehr. Zur Mutter! Sie stieg in eine Droschke. Jetzt erst trat alles klar vor ihre Seele; was sie gesehen hatte, war nur ein Augenblick des ständigen Betruges, dessen Opfer sie seit langem war. Wann fing es an? In Hohenheim? Vorigen Winter schon, während sie sich am innigsten geliebt glaubte. In ihrer Gegenwart, unter ihren Augen vollzog er sich täglich, und doch war er oft so voll Liebe und Zärtlichkeit, aus Mitleid wohl. – Sie bedeckte ihr tränenfeuchtes, glühendes Antlitz mit den Händen. O, welch entsetzlicher Gedanke. Was vor einer Stunde ihre höchste Lust, ward ihr jetzt zur fürchterlichen Qual. Sie flehte zu Gott, daß sie sich geirrt haben möge, und wenn nicht, nie sollte Decaro die Wahrheit erfahren, nie er das Glück genießen. Fort von ihm um jeden Preis, ein ferneres Zusammensein wäre unauslöschliche Schmach, lieber in Not und Elend vergehen, als mit diesem Manne noch ein Stück Brot verzehren. Sie – aber das Kind? Sie stöhnte laut auf. Zu was denn Not, dämmerte es in ihr auf, bist du nicht ein Talent, ein großes Talent! Haben sie es dir nicht tausendmal gesagt, die Schmeichler. Ist es eine Schande, zu arbeiten, die Mutter für ihr Kind, eine größere Schande als leben von einem fremden Manne. Das war er jetzt für sie, ein fremder Mann!
Dann verwirrten sich wieder alle Gedanken, Verzweiflung erfaßte sie, das Gefühl namenloser Verlassenheit.
Da hielt der Wagen vor dem Hause. Was wollte sie denn hier? Der Mutter alles gestehen. Und würde sie nicht vergehen vor Scham, hatte sie der Mutter warnende Stimme je gehört, war sie selbst denn rein und makellos? Sie dachte des ausgelassenen Abends in Hohenheim, deren Zeugin die Mutter gewesen war, ihrer Welt- und Gefallsucht, ihres unbeständigen, wankelmütigen Wesens, das sie selbst immer wieder herausdrängte aus dem stillen Heim.
Auf der Stiege war es auffallend lebendig für die späte Zeit. Laute Stimmen drangen herab. Türen wurden auf- zugeschlagen, und als sie die ersten Stufen bestieg, kam die Magd in fliegender Haft herab.
»Wohin, Hanne?«
Das Mädchen prallte entsetzt zurück.
»Zu Ihnen, zur Frau Gräfin, um Sie zu holen, gnädige Frau.«
»Wozu? Warum? Ist der Vater …?«
Röschen mußte sich an dem Stiegengeländer halten.
»Es geht nicht gut mit dem Herrn Rat, der Herr Doktor meinte –«
»Du sollst mich holen, der Vater kann jeden Augenblick sterben«, stammelte Röschen.
»Ja, so sagte er, aber der Herr Decaro, ich muß ihn holen, oder –«
Hanne wollte an Röschen vorübereilen.
Sie hielt die Magd fest. »Bleib, Hanne, und laß den Herrn; du bist nötig zu Hause. Komm, hilf mir ein wenig – der Schreck – ich bin so elend –«
Gestützt von Hanne wankte sie die Stiege hinauf, an den Neugierigen, die bei dem Anblick des Klosterzöglings die Köpfe zusammensteckten und flüsterten.
Es war kein Raum mehr in ihrem Herzen für den neuen Schmerz.
Vor der Tür des väterlichen Arbeitszimmers schöpfte sie noch einmal Luft, dann trat sie ein.
Die Rätin kam ihr weinend, mit ausgebreiteten Armen entgegen; über die Schulter der sie umarmenden Mutter erblickte sie den Vater im Lehnstuhle sitzend, das bleiche Haupt mit den geschlossenen Augen zurückgelehnt, schwer atmend. Daneben stand der Arzt, die Hand am Pulse, mit bedenklicher Miene.
Sie blickte mit kalter Neugierde in dem engen Gemache umher, es war ihr alles fremd geworden, die alten Kupfer an der Wand, der Brautkranz der Mutter unter Glas und Rahmen, eine Bleistiftzeichnung, die sie einst dem Vater zu Weihnachten gemacht hatte, das große Bücherregal – es war ein Festtag, wenn sie unter seiner Aufsicht darin herumkramen durfte – die zerbrochene Marmorstatue auf dem Kachelofen, die sie immer für eine Heilige gehalten hatte, es war aber eine Venus, den Pfeifenschrank, die zwei gekreuzten Säbel, die einfachen Palisandermöbel, das alles musterte sie jetzt, die Welt ihrer Kindheit, die nun der Tod betrat. Dann tauchte plötzlich ein anderes Gemach vor ihr auf in grellem Kontrast, ein üppiges, spitzenumflortes, wie ein Garten duftendes, und darin prangte – der Verrat.
»Wo bleibt Julius?« unterbrach die Mutter die lange Stille.
»Laß ihn, was soll er hier?« erwiderte sie herb. Da regte sich der Leidende. Auf den Fußspitzen schlich sie vor gegen den Lehnstuhl und übermannt vor Schmerz warf sie sich auf die Knie, drückte die kalten Hände, das feuchte Antlitz.
Der Rat öffnete die Augen groß, erstaunt ruhten sie auf Röschen und ein seliges Lächeln überflog die langen, starren Züge. Er nickte müde mit dem Kopfe ihr zu.
»Schüchterchen! Du hier? Ferien? Habe schon gehört, warst recht fleißig und – brav. Bist halt meine Freude, mein Glück.«
Seine Hand hob sich mühsam auf ihren Scheitel.
»Bleib so, nimm dich in acht – es ist so glatt draußen in der Welt – siehst du – siehst du – jetzt« er klammerte sich krampfhaft an sein Kind – »jetzt falle ich wieder – alles schwindet – Röschen?«
Ein schwerer Seufzer löste sich, der Kopf des Rates fiel auf die eingezogene Brust herab, seine Gestalt schrumpfte förmlich zusammen. Der Arzt stützte sie, neigte das Haupt zurück in den Sessel.
»Fassen Sie sich, jetzt naht er –« sagte er feierlich.
Röschen fühlte sich wie ausgefroren, sie konnte ohne Scheu in dieses Totenantlitz sehen – noch einmal verzog sich der Mund im Kampf um den Atem, dann erhellten sich die Züge, eine große Klarheit breitete sich darüber, ein stolzes, sieghaftes Lächeln blieb stehen. Der Arzt drückte dem Toten die Augen zu.
Die Frauen knieten betend vor der Leiche. Dieses friedsame Antlitz hatte jetzt keine Schrecken mehr für Röschen, er, dessen Ankunft der Arzt so feierlich verkündigt hatte, der Gefürchtete, Verlästerte – der Tod, erschien ihr jetzt als ein wohlmeinender Freund in dem schmerzvollen Kampf ihrer Seele. Als reines, glückliches Kind, als Schüchterchen schied sie vom Vater, er blickte nicht mehr unter die Maske, sah nicht mehr ihr blutendes Herz. Der Tod entrückte ihn inmitten einer glücklichen Täuschung sanft dem bittersten aller Schmerzen.
Ihr ganzes Leben flog an ihr vorbei bis zu den letzten qualvollen Stunden, und alles erschien ihr so klein, so bedeutungs- und inhaltslos im Angesichte dieses Totenantlitzes, in dessen im Leben so kleinen, ängstlichen Zügen jetzt erhabene, ruhige Verachtung thronte. Still war es im Gemach, es ging schon gegen Mitternacht, und noch immer knieten die Frauen.
Da öffnete sich leise die Türe, Julius trat ein in der Toilette des Abends, bleich, das Haar verwirrt, mit einem scheuen Blick auf den Toten, auf sein Weib vor ihm; zerknirscht wagte er keinen Schritt vorwärts.
Röschen wandte sich nicht. Die Rätin ging ihm entgegen, an ihrer Hand trat er zögernd vor.
»Röschen!« Flehend klang der Name, reuevoll.
Sie wandte sich nicht und griff, wie um Schutz suchend, nach der Hand des Toten.
Noch einmal rief er, da wandte sie sich, ein erbarmungsloser, strenger Blick traf ihn.
»Vor diesem Toten bitte ich dich, schweig, es wäre ein neuer Frevel.«
Eine abweisende Bewegung hieß ihn gehen.
Gebrochen ging er der Tür zu – noch einmal wandte er sich.
»Um dieses Toten willen, verzeih!«
»Verzeih?« wiederholte sie in einem bitteren, harten Ton, der jede Hoffnung in ihm schwinden ließ. Auf die stumme Frage der Mutter antwortete er nicht – er ging.
»Was ist geschehen, Röschen?«
»Er hat mich verraten.«
»Warwara?« fragte die Rätin.
Röschen nickte stumm.
»Meine Ahnung! Armes Kind! Und doch mußt du dich fassen, eine höhere Pflicht verlangt es.«
»Täuschung – ich bete zu Gott, daß es Täuschung war.«
»Kind frevle nicht!« rief entsetzt die Mutter.
Da griff Röschen mit leisem Stöhnen nach dem Herzen, ihr Gesicht verzerrte sich schmerzvoll, sie sank wie leblos über des Vaters Leiche.
Rings vom Tod umgeben fühlte sie, wie sich in ihr neues, kräftiges Leben kündete.
* * *
Julius' Anstrengungen, Röschen zu sehen, zu sprechen, waren vergebens, er wurde nicht vorgelassen, nicht einmal bei der Leiche des Vaters war sie zugegen, er folgte allein dem Sarge. Hatte sie die Stadt verlassen, sich bei der Mutter eingeschlossen, er wußte nicht. So vergingen qualvolle Tage bitterer Vorwürfe und wilder, fieberhafter Phantasien. Bald erblickte er das lachende Schüchterchen mit den frohen, treuen Augen, wie er es zum erstenmal in seinem Atelier gesehen hatte, bald das drohende, aschfahle Gesicht mit dem entsetzensvollen Blick, bald atmete er wieder den betäubenden Duft roter Locken, neigte sich der sprühende Leib über ihn, umfingen ihn weiße, volle Arme – er war noch nicht geheilt, das fühlte er und konnte noch keinen Anspruch machen auf Vergebung.
Warwara nahm im ersten Augenblicke die Überraschung durch Röschen nicht so tragisch, die Kleine würde sich schon wieder beruhigen und es nicht wagen, sie öffentlich bloßzustellen. Als sie aber noch während des Festes erfuhr, daß Frau Decaro nicht mehr zu finden sei, das allgemeine Aufsehen bemerkte, und der Maler seine Frau vor den Gästen mit einem plötzlichen Unwohlsein entschuldigte, wurde sie selbst besorgt und zog sich den ganzen Abend von Julius sichtlich zurück. Seitdem hatte Decaro die Gräfin weder gesehen noch gesprochen.
Da erhielt er eines Tages folgenden Brief.
Geehrter Herr Decaro!
Da Ihre Frau durch ihr auffallendes Benehmen, welches sie nach von mir eingezogenen Erkundigungen auch Ihnen gegenüber fortsetzt, beweist, daß sie unser kleines Tete-a-tete. welches sie belauschte, viel ernster nimmt, als es gemeint war – es war doch nur ein vielleicht etwas gewagter Maskenscherz – so ersuche ich Sie, um uns gegenseitig alle weiteren Unannehmlichkeiten zu ersparen, unseren Verkehr abzubrechen. Es tut mir leid, auf eine so wertvolle Akquisition verzichten zu müssen, jedoch Ihre unweltläufige Frau wird Ihnen ein längeres Verweilen in der großen Welt doch zur Unmöglichkeit machen.
Ich scheide ohne Groll als Ihre Sie verehrende
Gräfin W. Araschin.
Das war der kalte Wasserstrahl, nach dem er sich sehnte, so qualvoll auch seine Wirkung war. »Ein Maskenscherz!« Lüge! – es war kein Maskenscherz, sie liebte ihn, wenn auch auf ihre Art, und nur kalte Berechnung diktierte ihr den Brief; sie wollte die einträgliche Stelle als Gräfin Araschin nicht riskieren. Unendlicher Ekel packte ihn.
Er ging mit dem Brief zur Frau Rat, sie mußte ihn empfangen. Und sie empfing ihn auch in tiefer Trauer, mit verweinten Augen.
Er gab ihr den Brief, er wußte, daß sie von allem unterrichtet war.
»Und dieses Weib, dieser Dämon soll mich ewig von Röschen trennen? Sage selbst, Mama, trotz aller Schuld, zu der ich mich bekenne, das ist zu hart. Es war ein Taumel, ein Rausch, keine Neigung: Röschen muß verzeihen können, sie ist zu jung, zu edel zum Hassen. Führe mich zu ihr, hilf mir!«
Die Rätin las den Brief.
»Ich wußte alles seit meinem Besuch in Hohenheim, es mußte so kommen. Ihr habt beide den falschen Weg beschritten, ich schwieg nur, weil ich überzeugt war, daß keiner von euch auf meine Warnungen hören würde. Die Sache steht schlimmer, als du glaubst. Ich kann dich nicht zu Röschen führen, sie hat vor zwei Tagen das Haus verlassen ohne mein Wissen. Sie fürchtete, zurückgehalten zu werden von mir, von dir. Heute schrieb sie mit aus Hamburg.«
Die Rätin zog einen Brief hervor und mühsam mit den tränenvollen Augen die Zeilen suchend, las sie eine Stelle:
»Ich würde mich schämen, noch Julius' Brot zu essen, eines fremden Mannes. Das ist er mir jetzt, und da ich die Kraft fühle, mich selbst durch das Leben zu schlagen, verlasse ich Dich, meine gute Mutter – nicht auf lange. Ich weiß, Du gibst mir recht, auch Du bist stolz und kommst bald zu mir. Ich bilde mich zur Bühne aus, ich bin überzeugt von meinem Talent. Schlechter als dort, wo ich verkehrte, kann es da auch nicht zugehen, und ich bin gehärtet wie Stahl im Feuer durch all den namenlosen Schmerz. Julius soll jeden Versuch aufgeben, mich anders zu stimmen. Auch wenn er einsieht, daß seine Neigung zu Warwara nur ein Rausch, keine Liebe war, daß er einen Frevel begangen hat, mich diesem Weibe zu opfern, wovon ich sogar fest überzeugt bin, so ist es doch für uns beide besser; wenigstens für absehbare Zeit kann ich nicht die Möglichkeit einer Rückkehr zu ihm fassen, und bis ich sie vielleicht fassen kann, hat er mich schon längst vergessen –«
»Nie, nie werde ich sie vergessen«, unterbrach Julius die Rätin. »Heute noch reise ich zu ihr, sie muß mich hören, mir folgen.«
»Ich reise, du bleibst, wenn du nicht alles verderben willst«, erwiderte energisch die Rätin. »Röschen hat recht, ich würde gerade so handeln; solche Giftwunden müssen langsam heilen und das Blut muß sich erneuern, dazu aber gehört Zeit.«
»Du gibst mir also Hoffnung?« fragte Julius, dem die energischen Worte der Mutter jeden Widerstand nutzlos erscheinen ließen.
»Hoffe immerhin; wenn der rechte Augenblick gekommen und deine Heilung bis dahin eine wahre und vollkommene ist, rufe ich dich, verlasse dich darauf, das heißt, wenn ich noch rufen kann. Bis dahin mache nicht den geringsten Versuch, dich Röschen zu nähern, ich bitte dich darum als Mutter, die nichts mehr hat auf dieser Welt als ihr Kind. Auf Wiedersehen, Julius!«
Die Rätin schritt der Tür zu. »Und rüste dich«, setzte sie noch inhaltsvoll bei, »es wird ein großer Augenblick, er wird dich vernichten, wenn du seiner nicht würdig bist.«
Es lag etwas Geheimnisvolles, Ergreifendes in den Worten der einfachen Frau.
Julius fühlte, daß sie ihm immer als ernste, heilige Mahnung in seiner öden Verlassenheit ins Ohr tönen würden.
* * *
Der Winter verging. Julius sprach sich in einen ihm gewissermaßen berechtigt erscheinenden Groll auf Röschen hinein. Hatte sie die Berechtigung, ihn so ohne weiteres, ohne die Unterredung, um die er bat, ohne jeden Abschied zu verlassen? Sie hatte ihn nie wirklich geliebt. Ein Weib, das liebt, verzeiht, gibt nicht so rasch auf. Das Theater steckte ihr wohl schon lange im Kopfe, die Triumphe, die sie gefeiert, hatten sie verdorben, er hätte von Anfang an nie seine Zustimmung geben sollen zu diesem öffentlichen Auftreten.
Bald änderte sich aber diese Stimmung, es imponierte ihm diese Entschlossenheit, die Energie, der Stolz seines Weibes. Wie er sie verkannt hatte! Das war das Unglück, daß er immer und immer das Schüchterchen in ihr sah, immer ein Kind vor sich zu haben meinte. Hätte sie ihm in einer rührvollen Szene unter Tränen verzeihen und dann ruhig mit ihm weiter leben sollen, hätte ihn das glücklich gemacht, ihn geheilt? Gewiß nicht. Die Rätin hatte recht, Giftwunden müssen allmählich heilen – wenn sie überhaupt heilen – das ist die Frage.
Zuerst war er entschlossen, aus der alten Wohnung auszuziehen, um die alten Erinnerungen zu bannen, ganz zu brechen mit der Vergangenheit, doch er verzögerte den Entschluß von Woche zu Woche. Es war ihm, als gäbe er damit die letzte Hoffnung auf, die in seinem Innern lebte, und was hatte er denn noch als die Erinnerung!
Die Rätin hatte ihm das Bild Röschens zurückgelassen, das Schüchterchen, er war nicht allein. Oft zwar veränderte sich plötzlich der große, seelenvolle Blick und zorniges Leuchten drang herab, dann sah er sich zu den Füßen Warwaras im üppigen Boudoir; es war eine tief beschämende Erinnerung, in ehrlicher Abbitte erhob er sich zu dem Bilde, und der kleine Kindermund lächelte wieder verheißungsvoll. »Es wird ein großer Augenblick, bereite dich darauf vor.« An die Arbeit, das war jetzt das Beste! Die vielen Aufträge, bei denen es sich nicht so um hervorragende Leistungen als um Chic und rasches Fertigwerden handelte, hatten ihn verdorben, ungewissenhaft gemacht; unwillkürlich paßte er sich seinen Bestellern an, denen eine gewisse glatte Gefälligkeit das Höchste in der Kunst war. Die Stunden inneren gewaltigen Schaffensdrangs mit ihrem hinreißenden Zauber waren ihm fremd geworden; jetzt kamen sie wieder. Aus ungestilltem Sehnen, Reue, Hoffnung wob sich in ihm eine Seelenstimmung, die dem Künstler in ihm sehr vorteilhaft war.
Eine Erinnerung peinigte ihn förmlich, trotz ihres heiteren Inhaltes, durch ihre ständige lebendige Wiederkehr, die Erinnerung an die Ahnungen Röschens, an die Pläne, die sie geschmiedet –
Ein Kind! – Welche Fülle von Wonne lag jetzt für ihn in diesem Wort, und es gab eine Zeit, in welcher es für ihn ein gefürchtetes Wort war, das nur alle erdenklichen Sorgen, Ärger und Beeinträchtigung des eigenen feinen Lebensgenusses in sich barg. Jetzt kam ihm das wie ein Frevel vor, der sich an ihm gerächt hatte. Der Gedanke bedrängte ihn, seine Phantasie war so voll davon, daß ihn verlangte, dies Empfinden wenigstens künstlerisch auszuleben.
Ein sonderbares Leben kam in das bisher so stille Atelier. An tadellosen Modellen war kein Mangel, sie kamen getragen an der Mutterbrust, getrippelt und gelaufen in allen Größen und Farben. Er ließ sie ruhig gewähren, schreien, lärmen, alles herumzerren, begucken und benützen auf ihre Art und beobachtete jeden Blick, jede Bewegung und Gebärde, jede ihrer Freuden, ihrer Schmerzen, das Schmollen und Lächeln, den jähen Zorn, die überschwengliche Liebe, und von Tag zu Tag verstand er diese neue Welt, ihre Geheimsprache, den tiefen vorbildlichen Sinn, der ihr innewohnte, besser, und aus seinen eigenen Seelentiefen stieg die Kindheit wieder herauf, und die Weisheit der Welt erblaßte vor ihrem milden, beruhigenden Licht.
Er machte unzählige Skizzen. Mitten in der Arbeit ließ er sich von der lärmenden Schar widerstandslos bedrängen. Wenn sie ihn dann umkletterten, auf seine Erzählung horchten, sein Werk kritisch betrachteten, dann sah er oft auf zu Schüchterchen an der Wand und es war ihm, als müsse es heraus treten aus dem Rahmen und nach einem der Kleinen greifen, und er konnte nicht wegsehen, bis ein nasser Schleier ihm den Blick trübte.
Was er eigentlich wollte mit der Schar kleiner Modelle? Die Leute im Hause, die ganze Nachbarschaft lachte über den verrückten Maler. Unter seinen Kollegen ging das offene Gerücht, Decaro sei übergeschnappt; ein vernünftiger Mensch bringe doch nicht ein Schock Kinder auf sein Atelier, am wenigsten ein Lebemann wie Decaro, der bisher in den besten Gesellschaftskreisen verkehrte! Am Ende hatten sie recht, ein Wunder wär es ja nicht. Er wußte wirklich selbst nicht recht, wo das hinauswollte. Schon waren Monate vergangen, und er hatte keine ernste Arbeit angefangen. In seiner Brust regte sich schon lange das Motiv, aber den rechten Ausdruck dafür wußte er immer nicht zu finden, die rechte Erhebung fehlte ihm noch immer.
Es dämmerte im Atelier. Julius hatte unermüdlich gemalt, sein kleines Modell, ein zweijähriger Knabe, war vom Schlafe übermannt in die Purpurkissen zurückgesunken, jetzt lösten sich alle Farben und flossen ineinander. Das sind die Stunden der Empfängnis für den Künstler, die Außenwelt zerfließt, die Innenwelt wagt sich hervor in das freie Revier.
Im Hintergrunde saß die Mutter des Kleinen, auch eingeschlafen, Julius hatte sie ganz vergessen; auch er träumte, die Palette noch in der Hand, sein Blick ruhte auf Schüchterchen, in dem schwindenden Licht gewann es Leben. Wenn er die Augen halb zudrückte, war es ihm, als ob sie ihm zunicke und zu dem schlafenden Kinde sich wendete. Immer stärker wurde der Eindruck, jetzt trat sie deutlich vor, streckte die Arme darnach aus, die weiße Krause bewegte sich, sie ergriff das Kind, hob es hoch und küßte und herzte den leuchtenden Leib.
Julius zitterte vor Erregung, sehnsüchtigem Verlangen.
»Röschen«, flüsterte er unwillkürlich, da lachte das Weib auf, die Mutter des Kleinen.
»Schon ausgeschlafen, Herr Professor? Und's Gusti halt auch – Das liebe, gute Gusti!« Ihre Küsse schnalzten laut. »Dürf'n wir gehn?«
»Ja, gehen Sie nur, aber morgen in aller Frühe kommen Sie mit dem Gusti; ich brauche Sie mehrere Wochen.«
Jetzt wußte er, was er malen wollte, »Das Mutterglück!«
»Wann macht er Ihnen denn am meisten Freude, der Gusti? fragte er den andern Tag die Frau.
»Das ist schwer zu sagen«, meinte sie, »in der Früh', meine ich, wenn ich aufwach' und er mich so freundlich anlacht, dann wird er gebadet, dann sollen Sie ihn sehen, was er da für G'schicht'n macht.«
»Nun, so baden Sie ihn einmal hier, morgen früh gleich und lassen Sie ihn die G'schichten machen.«
Den andern Tag waren sonderbare Vorbereitungen getroffen im vornehmen Atelier Decaros; in einer kleinen Badewanne patschte der kleine Gusti seelenvergnügt und fuhr sich mit dem großen Schwamm über das dicke Gesichtchen. Die Mutter stand schmunzelnd daneben. Plötzlich hob sie ihn hoch empor mit kräftigen Armen, mitten hinein in das goldige Sonnenlicht, das zum Fenster hereinbrach, und der Junge jauchzte vor Lust und Lebenswonne, streckte die derben Glieder und ein Strahl verklärte das einfache Gesicht der Mutter. Sie dachte jetzt nicht an die Sitzung, nicht an den Maler, war daheim in ihrem ärmlichen Stübchen und freute sich ihres Gusti.
Das war's, der Eindruck haftete. Decaro malte mit Feuereifer, lachte und scherzte mit Gusti, um ihn bei guter Laune zu erhalten; als das Bübchen aber zur Mutter kam, da flog des Malers Blick immer wieder hinauf zu dem Bild an der Wand und zuletzt war es auf einmal das Schüchterchen, das den kleinen Gusti emporhielt, und ein solches Freudegefühl, ein solches Glück sprach aus dem ganzen Körper, der seiner köstlichen Frucht förmlich entgegenjauchzte, daß er selbst begeistert davon war. Er konnte fortan nicht mehr aufhören zu malen, und wenn Feierabend war, saß er allein stundenlang vor dem Bilde mit überquellenden Augen.
Wenn es so gekommen wäre, alles wäre anders geworden. Was war dagegen Warwara, der zweifelhafte Ruhm, der glänzende Verdienst, das lärmende Genußleben! Und konnte es nicht so kommen, wenn der große Augenblick – er harrte darauf von Woche zu Woche. Auf Weihnachten hoffte er sicher – doch er saß allein in der öden Wohnung an dem heiligen Abend und harrte vergebens auf einen Brief, ein Lebenszeichen. Ostern, Auferstehungsfest! Nichts. Das Frühjahr kam, die Bäume schlugen aus; er sah zwar wenig davon, aber er fühlte es, das Drängen wuchs und das Hoffen ins Unendliche. Das ist die Zeit, in der neues Blühen den alten Moder bedeckt, der zarteste Keim neue Wurzeln schlägt, sich alles sehnt, was noch zu sehnen hat – wenn er jetzt nicht kam, der Augenblick, kam er wohl nie mehr – der Sommer bringt nicht, was der Frühling versagt, und wenn zum zweitenmale die Blätter darüber fallen, dann ist alles darunter begraben – für immer.
Röschen hat ihre Studien beendet, sie wird ein Stern der Bühne werden, gefeiert, angebetet, sie wird des geschmacklosen Narren lachen, der sie, die köstliche Knospe, der überreifen, entblätterten, aufdringlichen Rose geopfert hat. Oft war er entschlossen, nach Hamburg zu reisen, oder sich wenigstens bei der dortigen Polizei um die Adresse der Rätin Martius zu erkundigen, immer unterließ er es wieder aus Furcht, der Rätin, seiner treuen Sachwalterin, alles zu verderben, etwas auch aus männlichem Stolz, er könne nicht gewinnen in den Augen Röschens durch einen solchen Schritt. Warwara Araschin verlor er unterdessen ganz aus dem Gesicht, nur einzelne Kunde drang von ihr in seine Einsamkeit. Sie hatte bereits eine neue Station auf ihrem Wege zurückgelegt, der Realismus, welchem sie für diese Saison ihr Haus geöffnet hatte, war bereits wieder daraus verdrängt und zwar von dem Spiritus in Gestalt des berüchtigten Doktors und Professors M. aus Wien, der im Palais Araschin eingezogen war und in der Gräfin selbst ein vorzügliches Medium entdeckt haben wollte.
Es schauerte ihn bei dem Gedanken, Röschen, sein Weib, zu ihrer Gefährtin bestimmt zu haben, und er mußte zuletzt noch das Schicksal preisen, daß es so gekommen war, wie es kommen sollte.
Aber auch das Frühjahr verging, die Blüten zerstäubte der Wind, auf den Feldern reifte schon die Ernte. Im Atelier war es wieder still geworden, das »Mutterglück« stand fertig auf der Staffelei. Von verschiedenen Seiten waren ihm Angebote gemacht worden, die Kunsthändler, die ihn aufsuchten, mußten alle wieder unverrichteter Sache abziehen. Julius konnte sich nicht trennen von seinem Bilde.
Endlich entschloß er sich. Wozu länger die Qual, es sollte die letzte Dämmerstunde sein, die er vor seinem Glück verträumte, morgen sollte es fort. Einen Strich gemacht durch die Vergangenheit mit ihrer Lust, ihrem Schmerz, ihrer Schuld, und ein neues Leben begonnen!
Wenn du es nur verantworten kannst, du trotziges, hartes Röschen!
Wie sehr er sich auch Mühe gab, einen Groll gegen sie in sich zu erregen, seinen ganzen Männerstolz wachzurufen, das aufwärts gewandte lichtvolle Gesichtchen war zu entzückend, und wenn er seinem Blick folgte auf das strampelnde Gusti, dann war es vorbei, verloren, für immer verloren ein namenloses Glück, und alles Aufraffen, Vergessensuchen war vergebens, nichts blieb als die Reue, bitterer Vorwurf.
Das Dienstmädchen brachte die Post, Zeitungen, Briefschaften, er machte ihr ein Zeichen, sie solle alles auf den Tisch legen; was kümmerte ihn das alles! Morgen verkaufte er das Bild, kündigte die Wohnung – aus, alles aus!
Er wartete, bis die letzte Kontur der glücklichen Mutter in der Dunkelheit untertauchte, dann trat er an den Tisch, entzündete die Lampe und griff mit einem schweren Seufzer nach den Briefen. Das Ausstellungskomitee in Brüssel, Kunsthandlung F. und Söhne, Figaro – achtlos, uneröffnet warf er alles zur Seite – da fiel ein Brief auf den Boden, ein kleiner Brief – er mußte lachen über die hastige Eile, mit welcher er ihn aufhob – närrisches Herz, immer noch Hoffnung!
Es war eine Damenschrift, Poststempel Hamburg. Die Finger zitterten ihm, er wandte ihn hin und her. Aus Hamburg – eine Dame! Unsinn, Narr! Und immer noch öffnete er ihn nicht. Er mußte sich setzen, dann nestelte er mit fieberhafter Hast an dem Kuvert, er kam nicht zustande damit, ein Falzbein war auch nicht zur Hand, mit einem Ruck riß er es entzwei, den Brief mit.
»Lieber Julius!«
Die Buchstaben wälzten sich durcheinander, er stand auf und trat dicht vor die Lampe.
»Endlich! Der große Augenblick ist da!« Er las nicht weiter, er drückte den Brief an die Lippen, als ob er von Röschen selber käme, und bedeckte ihn mit Küssen und Tränen, dann trat er vor das Bild, wie eine Verheißung stand es vor ihm. Doch das war Übermut, eine üppige Phantasie, er war ja so glücklich genug, mehr als er verdiente. Es dauerte lange, bis er den Brief weiter las.
»Röschen ist reif zur Verzeihung, ich hoffe, Du auch. Erinnere Dich, was ich Dir bei unserem Abschiede sagte: ›Es wird ein großer Augenblick, er wird Dich vernichten, wenn Du nicht seiner würdig kommst.‹ Ich erwarte Dich in den nächsten Tagen, teile mir Deine Ankunft mit. Auf frohes Wiedersehen.
Deine treue Schwiegermutter.
Hamburg, Wilhelmstraße Nr. 14.«
Ein großer Augenblick! Die Mutter war sonst nicht so pathetisch angelegt. Doch war jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, das Kursbuch her! Neun Uhr zehn Minuten Expreßzug nach Hamburg. Jetzt ist es acht Uhr, es geht noch, es muß gehen! Das war eine wilde Hast, Junggesellenpacken, einhalb neun Uhr stand er mit dem Kofferchen im Atelier. Und der Kunsthändler, den er für morgen vormittag bestellt hatte? – Soll froh sein, wenn er es überhaupt noch bekommt, das Mutterglück!
* * *
»Wilhelmstraße 14!« Der Kutscher sah mißtrauisch auf den bleichen, erregten Mann, der mit auffallender Hast ihm den Befehl gab.
Julius hatte von der Bahn aus einen Boten an die Rätin gesandt mit dem Auftrag, das Billett nur der Dame selbst zu übergeben, er ahnte irgend eine notwendige Vorbereitung, Überraschung.
Was hatte er sich nicht alles zurecht gelegt diese Nacht im Coupe? Warum wartete die Rätin so lange, über das Frühjahr hinaus? Was hatte sich wohl besonders ereignet? Was mußte denn abgewartet werden? Einmal glaubte er schon die Wahrheit zu erraten, Röschen war mit ihren Studien zu Ende und daran, ein Engagement anzunehmen, die Mutter wollte es um jeden Preis verhindern und hoffte auf seine Hilfe. Wenn es das wäre, war die Reise wohl umsonst, eine neue, furchtbare Enttäuschung. Doch das stimmte nicht mit dem Ton des Briefes – ein großer Augenblick! Krank am Ende, schwer krank – zum Abschied für immer! Der ganze Brief der Sarkasmus eines verzweifelten Mutterherzens! Nein, auch das war unmöglich, man hätte ihn vorbereitet.
Die Zweifel und Fragen der Nacht bestürmten ihn auch jetzt wieder.
Er war fremd in der Stadt, hatte keine Ahnung, wo die Wilhelmstraße lag. Ein paarmal blieb der Wagen stehen im Gedränge des lebhaften Verkehrs, dann schnürte sich ihm die Brust zusammen, eine unendliche Angst befiel ihn vor dem großen Augenblick.
Jetzt hielt der Wagen wirklich, der Kutscher öffnete den Schlag, es war eine enge, finstere Straße, ein altes, düsteres Haus, die Nummer 14. Die Pension der Rätin war schmal, vielleicht trieb sie nur die Not zur Versöhnung. Zwei dunkle Treppen hinauf; er fragte eine Magd nach Frau Martius.
»Im vierten Stock«, antwortete sie, mit einer geringschätzigen Miene ihn betrachtend.
Die Not, es war nichts anderes, nur die Not!
Er stieg langsam hinauf. Wie sollte er vor ihr erscheinen, zerknirscht, reuevoll, oder im männlichen Selbstbewußtsein? Plötzlich sprang er stürmisch hinauf und zog heftig an der Glocke. Er war mit sich im reinen, stürmisch an die Brust drücken wollte er sie, jeden Vorwurf wegküssen von den heißersehnten Lippen.
Tritte näherten sich, leise öffnete sich die Türe, die Rätin war es. Sie legte den Finger auf den Mund, Schweigen gebietend. Er las es in ihrem strahlenden Antlitz, es war nicht die Not, nicht der Tod, der ihn rief, ein unbändiges Freudegefühl erfaßte ihn, er küßte die mütterliche Hand. Da – was war das? Jeder Nerv bebte – dieser Ton! Ein Lallen, ein Lachen – hatte er alles nur geträumt und kam er aus seinem Atelier, zu seinem kleinen Modell? Wartete Gusti, auf ihn?
»Komm,« flüsterte die Rätin, »fasse dich!«
Da öffnete sie die Türe, eine Lichtflut drang in den finstern Gang.
Julius prallte zurück – das Bild, das Mutterglück! Die hölzerne Wanne auf dem Tische, das weiße Linnen, die Mutter vom grellen Lichte überflutet, Gustis rosige Glieder hoch über goldigem Gelock strampelnd, jauchzend. Da schrie er auf: »Röschen!«
Die Mutter wandte sich, sie war's, sein Weib. Das Kind entglitt fast ihren Händen, da lag es schon in den Armen des Mannes, der es mit Küssen zu ersticken drohte. Geängstigt streckte es das Ärmchen nach der Mutter aus und zog so den fremden, fürchterlichen Mann mit hinüber zu ihr, eine lebendige Brücke bildend, und mit stürmischer Wonne, alles vergessend, flogen die beiden wunden Herzen einander zu auf dieser köstlichen Brücke. »Julius! Röschen!« Das Kind hing stumm, erstaunt zwischen den Vereinten.
Und dann – dann ging es an ein Fragen, Erzählen, als ob das Entsetzliche nicht geschehen war, als ob er nur zurückkehre von einer langen Reise zu seinem Glück.
Röschen – wie gesund und herzig er sei, der kleine Julius – ja, Julius hieß er, da lag ja alles darin, aller Schmerz des letzten Jahres, alle Sehnsucht, alle Vergebung – und wie klug, wie kein Kind in seinem Alter – »Mama – sage Juli – süßer Juli – Mama!«
Der Kleine lallte lachend, mit der Faust um sich schlagend, die zwei Silben, die wie Himmelsmusik klangen in Julius Ohr.
Er – mit was er denn genährt würde, doch mit Milch und Mus und nicht mit künstlichen Sachen. Wie viel er schon wiege? Ob er schon einmal krank gewesen? Und das Grübchen im Kinn und diese kräftigen Arme, die breite Brust. »Was wird denn aus meinem kleinen Juli, was denn? Ein Soldat? Nein, dazu ist er zu klug. Ein Gelehrter? Nein, dazu ist er zu ausgelassen. Ein großer Sänger? Ja, ein großer Sänger wird aus meinem Juli, er singt ja jetzt schon wie ein Vogel.« Und dabei ging der kleine Engel von Hand zu Hand und das Körperchen wurde feuerrot von den Küssen der Eltern.
Die Mutter hatte das Zimmer verlassen, der kleine Julius schlief ermattet vom Bade in seinem Bettchen, feierliche Stille weckte beide aus der seligen Betrachtung, sie sahen sich verwirrt an und erstaunten selbst, daß sie sich gar nichts gesagt hatten.
An Julius war es, und er begann, das schlummernde Kinderantlitz unverwandt betrachtend. Es war eine Befreiung, diese Schilderung, seiner Reue, seiner Sehnsucht und Bekehrung, und als Röschen dann eingestand, daß es ihr trotz allem, was er ihr angetan hatte, hart angekommen sei, bei ihrem Vorsatze zu verharren, daß sie oft nahe daran war, ihm zu schreiben, und nur die Mutter in bester Absicht sie daran verhinderte, wie sie dann, als ihre Stunde nahte, sich nach ihm gesehnt hatte, sich einen Vorwurf machte, ihm sein Glück nur einen Tag vorzuenthalten, wie sie noch einen Monat warten mußte und noch einen, da der Arzt jede Aufregung verbot und wie sie endlich nun heute förmlich überrumpelt wurde – die Mutter versprach ihr, erst die nächste Woche zu schreiben, wie sie sich das Wiedersehen ganz anders, viel ernster vorgestellt, daß sie sich davor gefürchtet hatte – da war seines Glückes kein Ende.
»Schüchterchen! Nicht wahr, jetzt darf ich dich wieder so nennen?«
Sie nickte ihm selig zu.