
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Buchenwald: Die Buche oder Rotbuche – Die Weiß- oder Hainbuche – Ahorne – Linden – Die Obstbäume – Die Sträucher im Buchenwald – Die Bodenpflanzen – Vorfrühlingsblumen – Frühlingspflanzen – Sommerpflanzen im Buchenwald – Eichenwald und Auenwald – Der Neuenburger Urwald – Der Hasbruch – Die Eichenwaldungen des Spessart – Eichen-Niederwald – Eichenkratts – Der Auenwald und seine Bäume – Tierleben im Laubwald.
Laubwald! Wie anders wirkt er in der Landschaft, wie anders auch auf den Menschen ein als der immergrüne Nadelwald. Auch der hat, wir wissen es, eigene Reize für den, der seine Sprache versteht und sein Leben und Weben zu deuten weiß, und wenn von der zauberhaften Schönheit des Winterwaldes gesprochen wird, ist immer der Nadelwald gemeint. Das Gefühl der Ehrfurcht, des heiligen Schauers vor den »unbegreiflich hohen Werken« der ewigen Schöpferin Natur ruft dennoch nur der Laubwald hervor. Sein Rauschen, sein leises Blättergewisper ist wundersame Musik für das Ohr und seine Seele der Vogelgesang aus hundert und aber hundert Kehlen. Er ist lauschiger als der Nadelwald, wechselvoller, erquickender. Die drei bedeutungsvollsten Sinne, der Gesichtssinn, der Gehörsinn und der des Geruchs finden mindestens während der Zeit des Frühlings dauernd in ihm Beschäftigung.
Nicht überall freilich ist es so. Der unterholzarme geschlossene Hochwald, so hoheits- und eindrucksvoll er sich darstellt, kann schweigsam sein wie der Nadelholzforst, weil die Gleichmacherei kein »Waldwesen« litt, sondern nur eine Masse artgleicher Bäume von gleichem Alter duldete. Wo aber in Buchen- und Eichenwäldern die Einförmigkeit unterbrochen ist durch Einsprengung anderer Laubholzarten und Unterholz sich zu entwickeln vermag, da herrscht unvergleichlich regeres Leben als selbst im lichtesten Nadelwald. Am üppigsten entfaltet es sich, wenn die Wälder von Bächen durchschlängelte Gründe oder Ufer von großen Flüssen umsäumen, wenn sie Mischwälder oder Auwälder sind.
Zweimal im Jahr wird der Buchenwald mit Vorliebe von seinen Freunden besucht. Das erstemal, wenn im kahlen Walde Frühlingserwachen gefeiert wird, wenn die ersten leuchtenden Blumenaugen aus der braunen Vorjahrslaubdecke lugen, die noch von der letzten Schneeschmelze feucht ist, und täglich neue Lenzpioniere der Kalenderweisheit spotten. Es ist so viel froher Lebenswille, so viel unbändige Lebenskraft in all den farbigen Frühlingskündern, die da im März und im April dem Laubausbruch zuvorkommen müssen, um noch im Sonnenlicht blühen zu können, daß der Naturfreund sich dieses Schauspiel im Buchenwald ungern entgehen läßt. Zum zweitenmal kommen die Freunde des Waldes zur Hochsommerzeit in seine Hallen, dann jedoch nicht, um Blumen zu finden, sondern kühlen, erquickenden Schatten, den die mächtigen Häupter der Buchen spenden. Auch in der Zwischenzeit ist er schön, vor allem um Anfang Mai herum, wenn das ungemein zarte grüne Laub mit seidig behaarter Unterseite aus den braunen Knospen bricht und wie ein feiner, duftiger Schleier das Zweigwerk der Kronen schmückend umhüllt.
Überhaupt ist die Buche oder Rotbuche ( Fagus silvatica) der schönste Waldbaum, dessen sich unsere Heimat erfreut, und der Buchenwald wird mit gutem Recht von den Dichtern als Waldesdom verherrlicht, ist er doch das erhabenste, wahrhaft zur Andacht stimmende Waldbild deutschen Bodens.
»Hier quillt die träumerische
Urjugendliche Frische,
In ahnungsvoller Hülle
Die ganze Lebensfülle.«
Wie Säulen streben die silbergrauen, mächtigen Stämme vom Waldboden auf, keiner dem andern vollkommen gleichend. In wechselnder Höhe zerteilen sie sich, vielfach erst bei zwanzig Meter, in starke, aufwärts gerichtete Äste und breiten auf diesem festen Gerüst ihr reichverzweigtes, prachtvoll gewölbtes und dicht beblättertes Laubdach aus, so Kraft und Schönheit in sich vereinend. Auch wenn das lichte Maiengrün mit dem Wachstum der Blätter zum Dunkelgrün wird, verliert das Laub seine Schönheit nicht. Derb ist es zwar, aber glänzend wie Lorbeer, und selbst im Hochsommer nie so verstaubt und zerschlissen wie das Laub der anderen Bäume. Den erhabensten Anblick gewähren Bestände im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahrzehnten, in denen nur noch ein Sechzigstel des im Freien herrschenden Sonnenlichts wie durch einen Filter den Boden erreicht. Im Punkte Licht ist die Buche bescheiden, und auch sonst ist sie gar nicht so anspruchsvoll, wie ihr häufig nachgesagt wird. Schon Möller, der geniale Forstmann und Vorkämpfer des echten Dauerwaldes, hat nachdrücklich daraus hingewiesen, daß es in unserm deutschen Tiefland keinen trockenen Boden gibt, auf dem nicht Buchen gedeihen konnten. Er nannte die Buche die »Mutter des Waldes«, weil ihr Laub und ihre Bewurzelung auf den Boden von günstigstem Einfluß sind, indem sie die Krümelung befördern, und neuerdings wird sie aus diesem Grunde häufig in Nadelwälder gepflanzt, wo sie zugleich durch die Sommerbeschattung dem wuchernden Heidekraut Einhalt gebietet. Der Kiefernwald wird, wie der Forstmann es ausdrückt, mit jungen Buchen »unterbaut«.
Nur in klimatischer Beziehung stellt sie einige Anforderungen. Vor allem verlangt sie während des Sommers zur Wärme genügende Feuchtigkeit, also ausreichend häufige Niederschläge, was bei der starken Wasserverdunstung ihrer Belaubung verständlich ist. Den bogig nach oben gerichteten Ästen hat die Buche es zu verdanken, daß nahezu alles von der Krone aufgefangene Regenwasser für ihren Haushalt geborgen wird. Sie leiten es sämtlich dem Stamme zu, an dessen glatter Oberfläche es in Strömen herunterfließt und so den Wurzeln nutzbar wird. Ein schwärzliches Band auf der grauen Rinde, das bis zum Waldboden abwärts führt, bezeichnet deutlich die Leitungsbahn.
Deutschland ist das einzige Land, in dem die Buche, man darf wohl sagen, überall ihr Gedeihen findet, im Norden ebenso wie im Süden. Nur der nordöstlichste Zipfel Ostpreußens weist keine Buchenbestände auf. Am liebsten besiedelt sie niederes Bergland, doch ist sie der Ebene keineswegs abhold, und wo sie nicht reine Waldungen bildet (mit eingestreuten anderen Laubhölzern), trifft man sie in Mischwäldern an oder mit ihresgleichen in kleinem Bestand. Außerhalb Deutschlands ist ihr Vorkommen außerordentlich unregelmäßig und nicht entfernt so ausgedehnt wie das Verbreitungsgebiet der Eiche, die wir so gern mit dem Ehrennamen des »deutschen« Baums zu bedenken pflegen. Der Buche gebührt er im Grunde noch mehr, nur hat diese, was entscheidend ist, in der Geschichte der Germanen zu keiner Zeit eine Rolle gespielt. Daß sie jedoch von altersher beliebt war und geschätzt worden ist, bezeugen rund fünfzehnhundert Ortschaften, die den Namen nach ihr tragen und alle einmal in der Nähe von Buchenbeständen gegründet wurden. Heute bedeckt der Buchenwald in Deutschland zwei Millionen Hektar, etwa 13 vom Hundert der ganzen Waldfläche. Sein Anteil am deutschen Laubwaldbereich beträgt etwas über 40 vom Hundert. Weit bleibt die Eiche dahinter zurück.
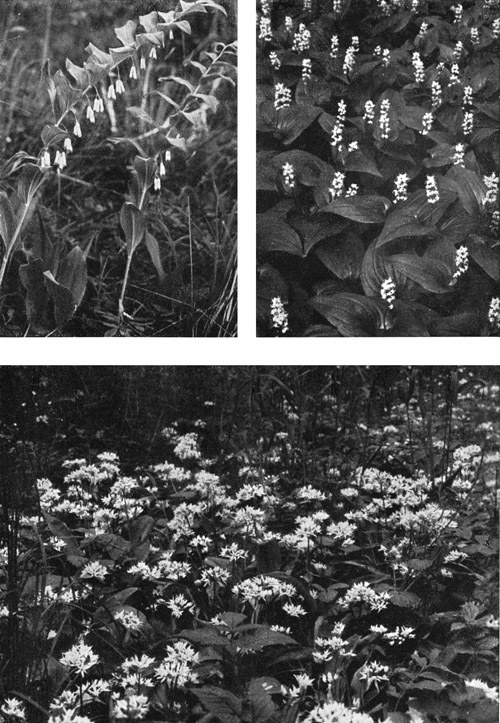
Tafel 48
Frühlingsblüher im Laubwald
Oben links Salomonssiegel,
rechts Zweiblättrige Schattenblume
Unten Bärenlauch

Tafel 49
Walderdbeere

Waldveilchen

Bingelkraut, mit Waldmeister vergesellschaftet
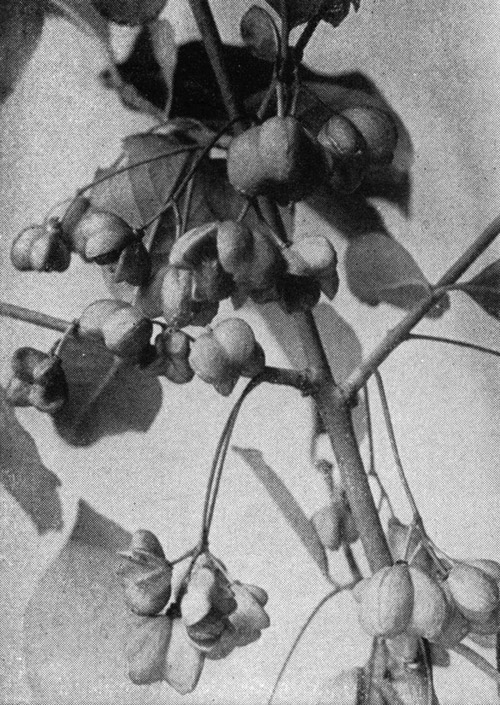
Tafel 50
Fruchtendes Pfaffenhütchen

Türkenbund

Katzenpfötchen im Kiefernwald

Tafel 51
Waldschnepfen

Ein Zweikampf am Waldrand: Hamster und Großes Wiesel
Gleichzeitig mit dem Ausbruch des Laubes kommen die »Kätzchen« der Buche zum Vorschein, unscheinbare weibliche Blüten, in den Achseln der obersten Maitriebblätter zu zweit auf kurzen Stielchen stehend, und kugelige männliche Blütenstände, an langen Stielen im Winde pendelnd. Jede einzelne Blüte in ihnen birgt zehn oder noch mehr Staubgefäße, die große gelbe Staubbeutel tragen, und wenn der Wind die Blütenstände besonders kräftig ins Schaukeln bringt, häuft sich der ausgeschüttelte Pollen oft derart auf dem Bodenlaub an, daß der Wanderer gelbe Schuhe bekommt. Die Fruchtblüten sind bis auf die Narben, die purpurfarben ins Freie schauen, von zahlreichen Deckblättern eingeschlossen, aus denen sich später der weichbestachelte, langsam verholzende Fruchtbecher bildet. Zur Zeit der Reife, meist im Oktober, zuweilen auch schon im September, springt er vierlappig auseinander und gibt die bekannten rotbraunen Früchte, die Bucheln oder Bucheckern frei, die ein vortreffliches Speiseöl liefern. Um mannbar zu sein, muß aber die Rotbuche, wenn sie mit andern im Schlusse steht, ein Alter von mindestens sechzig Jahren, im Freistand von etwa vierzig haben, und keineswegs kommt es danach alljährlich zu einer reichen Fruchterzeugung, zur »Vollmast«, wie die Forstleute sagen. Fünf bis acht Jahre pflegen die Buchen nach einer starken Tracht zu pausieren; nur einzelne Bäume im Gebirgswald schütten wohl auch in der Zwischenzeit einen reichlichen Erntesegen aus, ein Vorgang, der dann »Sprengmast« genannt wird.
Die im Herbst zu Boden gefallenen Eckern keimen im nächsten Frühling auf, im Frühjahr ausgesäte Früchte schon nach anderthalb Monaten. In dem auffallend kräftigen jungen Pflänzchen, das sich aus der Frucht entwickelt, erkennt kein Laie den Buchensprößling. Die großen, fächerähnlich runden, oberseits glänzend dunkelgrünen und unterseits weißlichen Erstlingsblätter, hoch über den Boden emporgehoben, erzählen nichts von der Herkunft der Pflanze, und ebensowenig läßt ihre Erscheinung den Uneingeweihten darauf schließen, daß hier eine neue Buche entsteht. Ob sie sich durchringt, ist ungewiß. Schon alte Buchen, denen der Winter, wie streng er auch sei, wenig anhaben kann, sind während der Zeit ihrer Laubentfaltung gegen Nachtfröste ganz und gar nicht gefeit, und noch empfindlicher ist der Nachwuchs, dem die berühmten »Gestrengen Herren«, die Eisheiligen Mamertus, Pankratius und Servatius (11. bis 13. Mai), nur allzu leicht den Tod bringen können.
Das Wachstum der Buche geht langsam vonstatten, besonders in den ersten fünf Jahren. Mit zehn Jahren mißt sie dreiviertel Meter, mit zwanzig erst drei, mit dreißig sechs, mit vierzig zehn und mit fünfzig etwa vierzehn Meter. Am raschesten nimmt ihr Höhenwachstum zwischen dreißig und fünfundfünfzig zu. Mit hundert bis hundertzwanzig Jahren hat sie die größte Höhe erreicht, die 25 bis 30 Meter, selten bis 35 beträgt. Auf armem Boden aufgewachsen, ist sie mit hundertzwanzig Jahren, auf gutem ein paar Jahrzehnte später gewöhnlich schon kernfaul und wipfeldürr. Das höchste Alter von dreihundert Jahren bei etwa zwei Meter Stammdurchmesser wird nur in seltenen Fällen erreicht.
Bekannt ist die seltsame Herthabuche am Herthasee auf der Insel Rügen, ein leider schon altersschwacher Baum, der weniger durch die Dicke des Stamms als durch seine weitausladende Krone von 20 Meter Durchmesser Achtung einflößt. Das Traggerüst des gewaltigen Laubschirms bilden außer dem kurzen Stamm von 4,25 Meter Umfang acht gleichfalls imposante Äste, von denen der erste schon in einer Höhe von 0,75 Meter dem Stamm entspringt und die übrigen einen Meter höher. Die Inselbewohner geben dem Baum, den sie mit Recht wie ein Heiligtum hüten, zumal er von Sagen umwoben ist, ein Alter von rund fünfhundert Jahren, doch sprechen Ehrfurcht und Stolz dabei mit. Eine andere riesenhafte Buche mit 6,4 Meter Stammumfang bei 25 Meter Höhe steht als Rest eines einstigen Waldes unweit der kleinen Ortschaft Küps am Rodachflüßchen in Oberfranken. Angeblich liefert sie bei Vollmast 25 Zentner Eckern. Die größte der in die Eichenwälder des Spessart eingesprengten Buchen, die den Namen Knerzbuche führt, ist 34 Meter hoch bei 5,3 Meter Stammumfang.

Die Buche oder Rotbuche
1. Maitrieb mit weibl. Blütenstand (oben) und männl. Kätzchen.
2. Einzelne männl. Blüte.
3. Weibliche Blüte.
4. Ziemlich ausgewachsener Fruchtknoten.
5. Derselbe, vorn ein Stück weggeschnitten.
6. Reife, aufgesprungene Kapsel mit zwei Bucheckern.
7. Dieselbe geschlossen.
8. Triebspitze mit zwei Knospen.
9. Tragknospe.
(Mit Ausnahme von 1, 3, 6, 7, 8 vergrößert)
Bald nach der Fruchtreife im Oktober setzt bei der Buche der Laubfall ein, der oft bis in den November anhält. Der Wald schmückt sich zum zweitenmal und prunkt mit so viel Farbentönen, daß keine noch so bunte Malerpalette ihm darin die Waage halten kann. Das Buchenlaub färbt sich beim Vertrocknen in ein leuchtendes Braungelb oder Braunrot um, aber während die anderen großen Waldbäume sämtliche Blätter von sich werfen, halten die beiden wichtigsten Laubhölzer, Buche und Eiche, das ihrige zum großen Teil bis zum Frühjahr fest. Der Grund dafür ist schwer einzusehen, denn daß das sitzenbleibende Laub einen wirksamen Winterschutz bilden könne, wird schwerlich nachzuweisen sein. Vielleicht ist die Eigentümlichkeit ein treu bewahrtes Familienerbe, sind doch botanisch Buche und Eiche bis zu gewissem Grade verwandt, und gibt es doch innerhalb beider Gattungen, im besonderen unter den Eichen, heute noch immergrüne Arten. Auffallend ist, daß das trockene Laub nach witterungsmäßig schlechten Jahren länger am Baume hängenbleibt, manchmal bis in den Juli hinein, als nach normalem Jahresverlauf. Am reichsten hängt im Winter das Dürrlaub an jungen Buchen. Wie bei allen Waldbäumen, so treten gelegentlich auch bei der Buche Spielarten auf, die dann wegen ihrer Absonderlichkeiten durch Ableger oder durch Pfropfung erhalten und vermehrt werden. Die häufigste und bekannteste Buchenspielart ist die Blutbuche mit dunkelrotbraunem Laub.
Der Nutzen der Rotbuche beruht außer auf ihren bodenerhaltenden und verbessernden Eigenschaften im wesentlichen auf ihrem Holz. In früherer Zeit, als Stein- und Braunkohlen wirtschaftlich noch keine Rolle spielten, war Buchenholz der bevorzugte Brennstoff. Als Nutzholz wurde es wenig verwendet, weil es die Eigentümlichkeit aufwies, bei Feuchtigkeit sich auszudehnen und bei Trockenheit wieder zusammenzuziehen, zu »arbeiten«, wie die Tischler das nannten. In neuerer Zeit aber hat man gelernt, ihm dieses »Arbeiten« abzugewöhnen und es durch Tränkung mit fäulniswidrigen Flüssigkeiten, in erster Linie mit Teeröl, nahezu unbegrenzt haltbar zu machen. Zur Herstellung von Eisenbahnschwellen, Holzpflaster, Treppenstufen, Brückenbelag usw. ist es fast unentbehrlich geworden. Tischler und Stellmacher schätzen es hoch, und Tausende von Gebrauchsgegenständen, von der Wäscheklammer oder dem Schuhleisten bis zum Rodelschlitten und »Brettl«, werden aus Buchenholz gefertigt. Seine große Verwendungsmöglichkeit wird überdies noch dadurch gesteigert, daß es durch Wasserdampfbehandlung unglaublich biegsam und formbar wird. Die Bereitung von Speiseöl aus den Früchten stößt wegen der nötigen Ernte vom Baum auf unüberwindliche Schwierigkeiten, denn das Sammeln der abgefallenen Bucheln bringt keine so großen Mengen zusammen, daß die Ölerzeugung sich lohnen würde. Ein bedeutender Teil des Ertrags der Bäume wird obendrein von Rehen, Wildschweinen, Eichhörnchen, Siebenschläfern und Waldmäusen oder von Vögeln verzehrt und verschleppt.
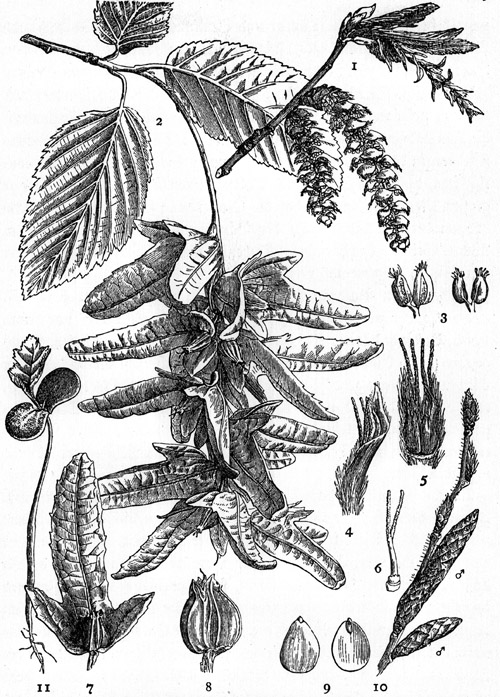
Hainbuche, Weißbuche oder
Hornbaum
1. Zweigspitze mit zwei männl. und einem weibl. Kätzchen.
2. Fruchtkätzchen an einer Triebspitze.
3. Staubgefäße.
4. Deckblatt mit zwei umhüllten weibl. Blüten.
5. 6. Blütenpaar mit u. ohne Hüllschuppen.
7. 8. Reife Frucht mit u. ohne Hüllschuppe.
9. Die auseinandergelegten Samenlappen,
10. Triebspitze mit Laubknospen und männl. (♂) Blütenknospen.
11. Keimpflanze.
Ausgedehnten Buchenwäldern sind häufig vereinzelt oder horstweise andere Laubhölzer beigemischt, die entweder gar nicht oder nur selten eigene Bestände bilden: Weiß- oder Hainbuchen, Ahorne, Linden, Wildobstarten und Eibenbäume, dann und wann auch wohl Ebereschen. Der Eibe wurde bereits gedacht (Seite 169), von den anderen sei das Nötigste, was der Waldfreund von ihnen erfahren muß, an dieser Stelle mitgeteilt, obgleich sie keineswegs zu den Bestandteilen unserer Buchenwälder gehören, zum Teil sogar beträchtlich öfter im Misch- oder Auwald zu finden sind.
Die Weißbuche, Hain- oder Hagebuche ( Carpinus betulus), hier und da auch Hornbaum genannt, hat äußerlich Ähnlichkeit mit der Rotbuche, ist jedoch gar nicht mit dieser verwandt. Ihr Stamm ist ebenfalls silbergrau, ihre Blätter zeigen die Umrißform und die herbstliche Färbung der Rotbuchenblätter, sitzen zweizeilig an den Zweigen und stellen die Blattfläche waagerecht. Genauer betrachtet, ergeben sich dennoch unverkennbare Unterschiede. Der graue Stamm ist nicht walzig-rund, sondern »spannrückig«, wie der Fachausdruck lautet, das heißt der Länge nach gewulstet, und außerdem ist er selten gerade und nie so hoch astrein wie bei der Buche. Die immer scharfgefalteten Blätter sind am Rande doppelt gesägt. Völlig anders als bei der Rotbuche sind die erst am belaubten Baume im Mai oder Juni erscheinenden Blüten. Die männlichen Kätzchen von bleichgrüner Farbe, 3 bis 5 Zentimeter lang, hängen schlaff herab von den Vorjahrstrieben, die weiblichen bilden lockere Ähren an den neuentstandenen Kurztriebenden, wachsen sich aber bis zum Herbst zu ansehnlich großen Fruchtständen aus, die massenhaft am Baume hängen und ihm ein seltsames Aussehen geben. Am Grunde der großen dreilappigen Hüllschuppen sitzt je ein kleines kantiges Nüßchen, das der Wind zugleich mit der Schuppe verweht.

Der Bergahorn
1. Blühender Trieb.
2. Fruchtbare Zwitterblüte.
3. Dieselbe nach Entfernung der Kelch- und Kronenblätter.
4. Männliche Blüte, ebenso.
5. Doppelflügelfrucht.
6. Einzelne Flügelfrucht mit gespaltenem Samenfach.
7. Triebspitze. 8.
Keimpflanze.
Die bezeichnendste Eigenschaft der Weißbuche ist ihr erstaunliches Ausschlagsvermögen, ihre fabelhafte Erneuerungskraft. Sie verträgt nicht nur das Beschneiden gut, man kann sie auch ohne weiteres köpfen und ähnlich wie Weiden nutzbar machen. Auf dieser Ausschlagsfähigkeit beruht ihre häufige Verwendung zu Lauben oder lebenden Hecken, wie sie in Holstein als »Knicks« bekannt sind, und ferner ihre besondere Eignung für den Niederwaldbetrieb. Niederwald heißt in der Forstwirtschaft ein aus Laubholz zusammengesetzter Wald, dessen Stämme nach kurzen »Umtriebszeiten« planmäßig abgehauen werden und sich aus eigener Kraft durch Stockausschläge wieder ersetzen. Im Hasbruch, in der Nähe von Bremen, dem Rest eines uralten Eichenwaldes, heißt ein Bezirk »Gespensterwald«, weil sich in ihm viele in früheren Zeiten zur Brennholzgewinnung geköpfte Hainbuchen lediglich durch ihre Ausschlagskraft bis heute am Leben erhalten konnten und nun in der Tat höchst seltsam erscheinen. Kurzstämmig, drehwüchsig, aufgespalten und schier unglaublich toll verastet, sehen sie wirklich gespenstisch aus, kaum noch als Bäume bezeichenbar. Auf die Schwere und Festigkeit des Holzes, des härtesten unsrer gesamten Baumwelt, geht der Name Hornbaum zurück, auf die weißgelbe Färbung der Name Weißbuche, zum Unterschied von der echten Buche, die rötlich getöntes Holz besitzt. Verwertung findet das Weißbuchenholz zur Anfertigung von Gegenständen, die zähe Widerstandskraft erfordern, wie Schrauben, Axt- und Spatenstiele, Dreschflegel, Schuhzwecken und dergleichen. Auch die Bezeichnung »hanebüchen«, eine Entstellung von »hagebüchen«, hängt mit dem schwer spaltbaren, derben Holz der Hain- oder Hagebuche zusammen.
Von den drei deutschen Ahornarten kommen für uns nur zwei in Betracht, der Bergahorn ( Acer pseudoplatanus) und der Spitzahorn ( A. platanoides). Der dritte im Bunde, der Feldahorn ( A. campestris), tritt bei uns nicht als Waldbaum auf. Guten Boden vergönnt man ihm nicht, und auf armem gedeiht er nur in Strauchform, in Feldgeholzen oder in Hecken, wo ihn sein Ausschlagsvermögen beliebt macht. Von anderen Laubhölzern sind die Ahorne ziemlich leicht zu unterscheiden durch ihre handförmig gelappten Blätter, von denen je zwei sich in gleicher Höhe am Zweige gegenüberstehen. In ihrer Gestalt erinnern sie an Weinlaub oder Platanenblätter.

Der Spitzahorn
1. Blühender Trieb.
2. Männliche Blüte.
3. Stempel.
4. Doppelflügelfrucht.
5. Einzelne Flügelfrucht mit gespaltenem Samenfach.
6. Same.
7. Derselbe quer durchschnitten.
8. Blatt.
9. Triebspitze mit Knospen.
10. Keimpflanze.
Der Bergahorn ist, wie sein Name sagt, von Haus aus ein echtes Kind des Gebirges, doch hat er sich, vielfach aus seiner Bergwelt in die Niederungen verpflanzt, auch diesen vortrefflich angepaßt. Sein Verbreitungsgebiet entspricht in Deutschland etwa dem der Edeltanne. Reine Bestände bildet er selten, außer in den Voralpentälern oberhalb der Buchengrenze. Sonst findet er sich nur eingesprengt in ausgedehnten Buchenwäldern, die ihm zur Entfaltung Raum gewähren, in Mischbeständen aus Nadel- und Laubholz sowie in Fichten- und Tannenwäldern. Vollentwickelt, besonders im Freistand, ist er ein malerisch schöner Baum mit tief angesetzter mächtiger Krone, von einem starken Astwerk gestützt. Steht er mit anderen Bäumen im Schluß, so bildet er einen regelmäßigen, nahezu vollkommen astfreien Stamm. Bis zum dreißigsten Lebensjahr wächst er schnell, erlangt dabei im günstigsten Fall eine Höhe von etwa 15 Meter und schließt mit reichlich hundert Jahren gewöhnlich sein Höhenwachstum ab. Das Dickenwachstum geht jedoch weiter. Zwei Meter starke Ahornbäume, die drei oder vier Jahrhunderte an sich vorüberziehen sahen, sind keineswegs eine Seltenheit. Die Rinde bleibt lange glatt und grau, entwickelt jedoch bei bejahrten Bäumen allmählich eine bräunliche Farbe, die dann wie bei der Platane ausreißt, sich schuppenartig vom Stamme löst und die darunterliegende Rinde von weißgrauer Farbe hervortreten läßt. In Bergwäldern pflegt die Wetterseite der Ahornbäume von oben bis unten dicht von Moos überzogen zu sein.
An den großen, schöngeformten Blättern sind die fünf Lappen durch spitze Buchten mehr oder weniger tief getrennt und an den Rändern stumpf gezähnt. Oberseits sind sie dunkelgrün, unterseits hellgraugrün von Farbe und hier zudem an den Nervenwinkeln mit weißen, flaumigen Härchen bedeckt. Bald nach der Entfaltung des jungen Laubes, gewöhnlich im Anfang des Wonnemonats, erschließen sich die zu hängenden Trauben zusammengeschlossenen gelbgrünen Blüten, die bald danach zu einem Teil aus den Ahornkronen zu Boden fallen. Das sind die nur Pollen erzeugenden Blüten mit unvollständig entwickeltem Fruchtboden und desto größeren Staubgefäßen. Die anderen bleiben am Baume hängen und reifen bis zum September die Früchte, paarweis beisammenstehende Samen, jeder mit einem ansehnlich großen geschweiften Flügel ausgerüstet. Die Kinder nennen sie »Nasenstüber«, sammeln sie unter den Bäumen auf und setzen sich die im Reifezustand am klebrigen Samen gespaltenen Früchte als Klemmer auf den Nasenrücken. Beim Bergahorn bilden die Rücken der Flügel zusammen einen spitzen Winkel, im Unterschied vom Spitzahorn, bei dem sie immer einen stumpfen, beinahe gestreckten Winkel bilden. Die Spaltfrüchte kommen als »Schraubenflieger«, sich fortwährend drehend, vom Baume herab und werden daher, wenn der Wind sie erfaßt, oft weit vom Mutterbaum fortgetrieben.
Der Spitzahorn, häufiger als sein Verwandter, steht gleichfalls in allen Mittelgebirgen, steigt aber weniger hoch hinauf. Er hält sich mehr an die Wälder der Vorberge. In der Ebene ist er außer im Walde, besonders im Misch- und Auenwald, fast überall in den Städten zu finden, sei es als Park- oder als Straßenbaum. Seine schöne Belaubung, die zur Herbstzeit in allen Zwischentönen prunkt, die von Gelb zu Rot hinüberführen, hat ihm die große Beliebtheit verschafft. Leider werden oft sämtliche Blätter von einem Runzelschorfpilz ( Rhytisma acerinum) befallen, der zahlreiche unregelmäßig verteilte schwarze Flecke auf ihnen hervorruft, die in der Mitte gerunzelt sind. Die Blätter machen dann den Eindruck, als seien sie mit Teer bespritzt, und werden dadurch häßlich entstellt. Vom Bergahorn sind die Spitzahornblätter auf den ersten Blick unterscheidbar. Sie haben zwar die gleiche Grundform, doch sind ihre Lappen nicht durch spitze, sondern durch runde Buchten geschieden, und außerdem tragen sie am Rande lange, fein zugespitzte Zähne, denen der Baum seinen Artnamen verdankt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Eigentümlichkeit, daß der Spitzahorn in seinen Blattstielen, die in der Regel rot gefärbt sind, und ebenso in den jungen Sprossen einen weißen Milchsaft führt. Er tritt sofort an der Bruchstelle aus, wenn man einen Blattstiel am Baume knickt. Die Rinde des Spitzahorns bildet frühzeitig eine längsrissige schwärzliche Borke, die selbstverständlich nicht abblättern kann.
Zwischen Mitte April und Mitte Mai, immer noch vor dem Laubausbruch, steht der Spitzahorn im Blütenschmuck und ist dann schon von weitem erkennbar. So unscheinbar die Einzelblüten von grünlichgelber Färbung sind, so auffällig werden sie einmal dadurch, daß sie in doldenähnlichen Sträußen zu vielen aufrecht beisammenstehen, und dann, weil diese gelben Sträuße wiederum in großer Menge die laublose Ahornkrone erfüllen. Oft summt und singt es im ganzen Baum von nektarsuchenden Honigbienen, die die Bestäubung der Blüten vermitteln. Die Früchte, die im September reif sind und sich im Oktober vom Baum herabschrauben, ähneln denen des Bergahorns, nur bilden die Rücken der beiden Flügel gemeinsam einen stumpfen Winkel.
Wie aus dem Saft des Zuckerahorns ( Acer saccharinum) in Kanada und den Vereinigten Staaten in Menge Zucker gewonnen wird, so glaubte man in der Not des Weltkriegs auch unsern Spitzahorn zur Vermehrung des Zuckervorrats heranziehen zu können. Tatsächlich träufelte aus seinem Stamme nach Anbohrung eine Flüssigkeit, aus der sich Zucker gewinnen ließ, doch war ihr Süßstoffgehalt zu gering, um zur Fortsetzung der Versuche zu reizen. Der Nutzwert unserer heimischen Ahorne besteht allein in ihrem wie Atlas glänzenden Holz, das Tischler, Drechsler und Holzschnitzer schätzen und das außerdem zu Wandtäfelungen und Furnieren verwendet wird.
Nicht allzuoft, aber auch nicht ganz selten treffen wir Linden ( Tilia) im Walde an und grüßen sie dann mit besonderer Freude. So wie wir alte Freunde begrüßen, die plötzlich am unwahrscheinlichen Orte wie aus der Versenkung vor uns stehen, halb fremd geworden im Laufe der Jahre, doch mit dem gleichen vertrauten Ausdruck der Biederkeit und Treuherzigkeit. Seit langen Jahrhunderten ist die Linde bei uns schon ein seltener Gast im Walde, vermutlich durch die Buche verdrängt, die ihren Nachwuchs nicht hochkommen ließ. Aber ebenso lange ist sie dafür aufs innigste mit dem Volke verwachsen, das mit der Linde die Waldromantik in seine Dörfer und Städte verpflanzte. Vielerlei hat wohl zusammengewirkt, um dem Baum seine Volkstümlichkeit zu verschaffen. Als erstes die Überlieferung, daß die Linde bei den alten Germanen Wodans Gemahlin Freya geweiht war, der Göttin der Fruchtbarkeit und des häuslichen Herdes. Sodann der bunte Sagenkranz, der den heiligen Baum seit alters umrankte, und schließlich als drittes der Aberglaube, der allem Geheimnisvollen geneigt ist. Das reichte aus, um Achtung und Ehrfurcht vor der Linde hervorzurufen. Daß aus der Ehrfurcht Liebe wurde, bewirkten die Eigenschaften des Baumes, die ihn vor anderen schätzenswert machten, vor allem sein ehrwürdig hohes Alter, seine imponierende Wipfelhöhe, seine breitausladende schattende Krone, sein zartes, zur Herzform gestaltetes Laub und schließlich der wundersam süße Duft, mit dem seine bienenumschwärmten Blüten im Sommer balsamisch die Luft erfüllen. Wie ehedem im Schatten der Linden Gerichtstag abgehalten wurde, so kamen fortan die Gemeindealten unter dem Laubdach des Baumes zusammen, um über Wohl und Wehe des Dorfes und seiner Insassen zu beraten. Umwehte die Dorflinde Frühlingsodem, so lud sich an Sonn- und Feiertagen die tanzfrohe Jugend bei ihr zu Gast. Noch heute ist sie an tausend Orten so etwas wie ein geheiligter Baum, der Lust und Leid von Generationen mit seinem Rauschen begleitete.
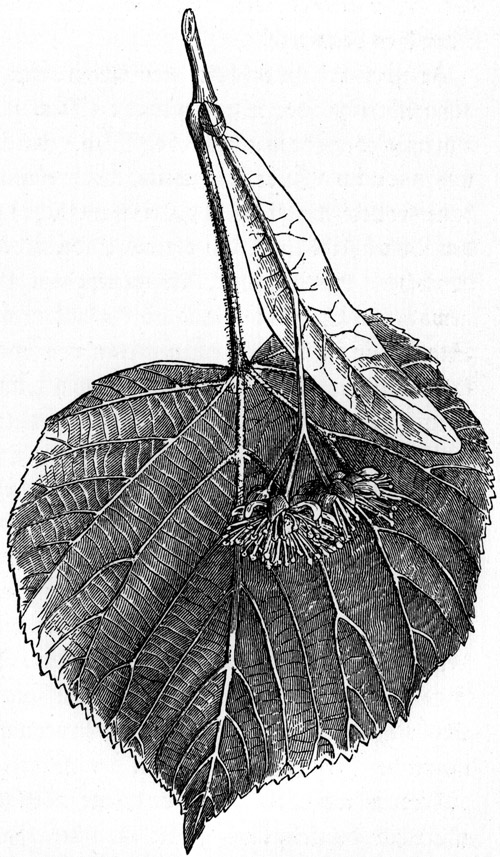
Sommerlinde. Blühender Triebzweig
In zwei gut unterscheidbaren Arten tritt die Linde bei uns auf, als Kleinblättrige oder Winterlinde ( Tilia parvifolia) und als Großblättrige oder Sommerlinde ( Tilia grandifolia). Die erste begegnet uns mehr im Walde, die zweite, als Gesamterscheinung bedeutend eindrucksvollere Art ist der als Dorfwahrzeichen bekannte, seit Walther von der Vogelweide unendlich oft als Schirm der Verliebten im Liede verherrlichte »Lindenbaum«. Er erreicht eine Höhe von 30 Meter bei oft gewaltigem Stammumfang, in Ausnahmefällen, wie bei der Linde von Staffelstein in Bayern, einen solchen von 16 Meter, und ist der Methusalem unserer Baumwelt. Die meisten »tausendjährigen« Linden hat freilich der Heimatstolz überschätzt, doch darf wohl als erwiesen gelten, daß einzelne Bäume so alt werden können. Die Winterlinde lebt weniger lange und ragt auch nicht so hoch in die Luft, kann aber, wenn sie im Schlusse steht und einen schlanken, astreinen Stamm mit kugelförmiger Krone bildet, doch 25 Meter messen. Im Freistand bleibt sie weit darunter, trägt aber dann auf einem zwar kurzen, doch entsprechend massigen Stamm eine tief angesetzte mächtige Krone. Zur Unterscheidung der beiden Arten eignen sich am besten die Blätter. Bei der Sommerlinde sind sie groß, mitunter bis zehn Zentimeter lang, und oben und unten gleichfarbig grün; in den Nervenwinkeln der Unterseite fallen weißliche Haarbüschel auf. Bei der Winterlinde sind diese rostrot und außerdem weist die Blattunterseite bläulichgrüne Färbung auf, die Oberseite dunkelgrüne. Prüft man die Haarbüschel mit der Lupe, so entdeckt man, daß sie von Milben bewohnt sind, die sich bei Tage ruhig verhalten, bei Anbruch der Dunkelheit aber hervorkommen und hurtig auf der Blattspreite umherrennen. Wahrscheinlich suchen sie nach Pilzsporen und anderem schädlichen Blattanflug. Die im Frühherbst gereiften hängenden Früchte sind dünnschalig bei der Winterlinde, so daß man sie ohne jede Anstrengung zwischen zwei Fingern zerdrücken kann, aber fest und hart bei der Sommerlinde. Das leichte und weiche Holz der Bäume ist wertvoll als Rohstoff für Holzbildschnitzer, die Lindenholzkohle für Künstler zum Zeichnen. Der in langen Streifen gewinnbare Bast wird zum Binden und zu Flechtwerk benutzt, der Tee aus getrockneten Lindenblüten wird seiner schweißtreibenden Wirkung wegen sogar von den Apotheken geführt.

Die Winterlinde
1. Blühender Sproß.
2. 3. Blüte seitwärts von oben und von unten.
4. Stempel.
5. Frucht.
6. Dieselbe längs durchschnitten.
7. Triebspitze mit Knospen.
8. Keimpflanze.
Daß es in unseren deutschen Wäldern vereinzelt auch Apfel- und Birnbäume gibt, ist wahrscheinlich nicht allen Lesern bekannt. Wer aber glaubt, nur zulangen zu können, wenn im September die Früchte gereift sind, vom letzten Sonnenstrahl mit hübschen roten Bäckchen bemalt, erlebt jedoch eine »herbe« Enttäuschung. Die Birnen sind noch leidlich genießbar, wenn sie nach dem Abfall eine Zeitlang auf dem Boden gelegen haben und dabei teigig geworden sind, die Äpfelchen aber schmecken dem Wilde entschieden besser als dem Menschen. In vielen vorgeschichtlichen Siedlungen, besonders in den Schweizer Pfahlbauten, hat man zwar »Holzäpfel« aufgefunden, ein Zeichen, daß sie in jenen Zeiten oft in der Küche verwandt worden sind, doch fehlt uns leider jegliche Nachricht, wie sie den Leuten gemundet haben und wie sie ihnen bekommen sind. Reinere Freude an Wildobstbäumen empfinden wir jedenfalls im Mai, wenn sie ihre hübschen, in Doldentrauben beisammenstehenden Blüten entfalten, die Holzbirne weiße mit purpurnen Staubbeuteln, der Holzapfel außen rosa behauchte, aus denen gelbe Staubbeutel ragen. Die Blüten des Birnbaums duften freilich für unsere Nasen keineswegs lieblich, vielmehr fatal nach Heringslake, ein Grund dafür, daß der blühende Baum von allerlei Fliegengesindel umschwärmt wird.

Tafel 52
Hängebirken im frischen Maiengrün

Tafel 53
Keulenförmiger Bärlapp mit Sporensäcke enthaltenden Ähren

Vogelnestorchis, eines unserer eigenartigsten Gewächse

Tafel 54
Der Frauenschuh, unsere schönste Orchidee, die in Bergwäldern blüht

Wildes Geißblatt, ein naher Verwandter des weithin duftenden Jelängerjelieber

Tafel 55
Die von Scheffel verherrlichte Staffelsteinlinde am Fuße des Staffelsteins in Oberfranken, angeblich über tausendjährig.
Einige Meter über dem Boden teilt sie sich in zwei Teile, von denen der eine abgestorben ist
Die Holzbirne ( Pirus communis), die bei günstigem Standort auf Lehm- und Kalkboden stattliche Bäume von etwa 15 Meter Höhe und 0,6 Meter Stammdicke bildet, ist oft schon an ihrer Krone kenntlich, deren Äste vorwiegend aufwärts streben und den Baum dadurch schlank erscheinen lassen. Die Langtriebe enden in spitzen Knospen oder in einem noch spitzeren Dorn, den auch ihre zahlreichen Kurztriebe tragen. Die rundlich geformten derben Blätter glänzen auf ihrer Oberseite, wenn sie älter geworden sind; den Stamm bedeckt eine schwarzgraue Borke, die immer tief gerissen ist und im Alter oft würflig geteilt erscheint. Der wilde Apfelbaum ( Pirus malus), der selten über 7 Meter hoch wird, unterscheidet sich äußerlich von der Wildbirne durch seine breite und sperrige, immer tiefangesetzte Krone und seine bei alten Bäumen hellfarbige, in dünnen Schuppen abblätternde Rinde. Die spitzeiförmigen Blätter sind in der Regel doppelt so lang wie ihr Stiel, und ihre Rippen treten viel deutlicher hervor als beim Birnbaum. Bedornt ist der Apfelbaum wie dieser. Die Bestäubung der Blüten beider Bäume besorgen vorwiegend Bienen und Hummeln. Vom Spätherbst bis in den Winter hinein tanzen in den Abendstunden oft Frostspanner um die Obstbaumstämme, wovon weiter vorn schon erzählt worden ist (Seite 59).
Im Volksglauben und in alten Sagen spielt der Wildapfel eine bedeutende Rolle, vor allem zur Versinnbildlichung der Liebe. Den alten Germanen galt er als Sinnbild der Mutterbrust, und in der Edda wirbt Freyr um Gerd mit elf goldenen Äpfeln:
Der Äpfel eilf habe ich allgolden,
Die will ich, Gerd, dir reichen.
Deine Liebe zu kaufen, daß du Freyr bekennst,
Daß dir kein lieberer sei.
Auch Kirschen kommen im Walde vor und beleben ihn zur Frühlingszeit, wenn sie ihr Schmuckkleid angelegt haben, nicht minder erfreulich als Apfel- und Birnbaum. Leider sind sie nur spärlich vertreten, weil ihr forstlicher Wert zu geringfügig ist. Besonders die weißen Blütentrauben der Ahlkirsche oder Traubenkirsche ( Prunus padus), die im April oder Anfang Mai von den Kurztriebenden herunterhängen, durchduften weithin den lenzlichen Wald, besonders stark in den Abendstunden, und locken durch diese Aufdringlichkeit in Massen Bienen und Fliegen herbei. Auch allerlei ungeflügelte Gäste trifft man beständig auf dem Baum. Die langen, scharfgesägten Blätter, unterseits bedeutend heller als auf der Oberseite gefärbt, sind in der Regel in so großer Anzahl von einer grauen Blattlaus besiedelt, daß diese geradezu als Kennzeichen für die Ahlkirsche gelten kann, die vielerorts auch »Läusebaum« heißt. Die Blattläuse ziehen Ameisen nach sich, die auf die süßen Auswurfstoffe der winzigen Pflanzensauger erpicht sind, in diesem Fall aber auch ohne Läuse zu schmackhafter Kost gelangen können. Die Stiele der Traubenkirschenblätter tragen nämlich zwei grüne Drüsen, aus denen süße Säfte fließen, so daß man in der Tat nicht weiß, aus welcher der beiden Honigquellen das Ameisenvölkchen am liebsten schöpft. Die schwarzen, erbsengroßen Früchte, die gegen Ende Juli reif sind, schmecken unangenehm bittersüß. Am häufigsten treffen wir Traubenkirschen entweder als mäßig hohe Bäume oder in Strauchform am Rande des Waldes sowie auf feuchten Lichtungen an. Beschattete Standorte lieben sie nicht, es sei denn auf recht feuchtem Boden, weshalb sie auch selten in Auwäldern fehlen.
Verwandt mit ihnen, doch leicht unterscheidbar ist die Wild- oder Vogelkirsche ( Prunus avium), ein stattlicher Baum mit dünnen und schlaffen, verhältnismäßig kleinen Blättern, die an ihrem Rande grob gesägt sind und sich im Herbst prangend rot verfärben. An den Stielen sitzen zwei rötliche Drüsen, größer als bei der Traubenkirsche, die auch wieder für die Waldameisen starke Anziehungskraft besitzen und dem Baum vielleicht insofern nützen, als die durch sie angelockten Insekten die Blätter vor allerlei Schädlingen schützen. Die glänzendgraue Rinde der Wildkirsche ist anfänglich glatt und von zahlreichen queren rostroten Streifen überzogen; bei älteren Bäumen lösen sich ringförmig biegsame Lappen von ihr ab, und noch später wird sie dunkel und rissig. An mannbaren Kirschbäumen, die ein Alter von mindestens zwanzig Jahren haben, erscheinen im April oder Mai die zu Dolden vereinigten duftenden Blüten, aus denen sich bis zur Hochsommerzeit die kleinen roten und schwarzroten Früchte von bittersüßem Geschmack entwickeln. Durch Zucht und Veredlung sind aus ihnen die Süßkirschensorten hervorgegangen.
Vertrauter als die wilden Kirschen ist uns die nicht bloß als Waldeinsprengsel, sondern auch als Straßen- und Parkbaum weitverbreitete Eberesche ( Sorbus aucuparia), im Volk in der Regel Vogelbeerbaum, in Norddeutschland vielfach Quitsche genannt. Der gebräuchlichste Name Eberesche ist hergeleitet von Aberesche, wobei das »aber« in gleicher Weise wie bei dem Worte Aberglaube als »falsch«, »verkehrt« zu deuten ist. Aberesche heißt »falsche« Esche, denn durch ihre unpaar gefiederten Blätter sieht sie tatsächlich der Esche ähnlich, obgleich sie durchaus nicht mit dieser verwandt ist. Der Vogelbeerbaum ist ein Kernobstgewächs, was außer den Blüten besonders deutlich seine roten Früchte bezeugen. Man sehe sie nur einmal daraufhin an. Genau wie bei unsern Äpfeln und Birnen zeigen sie am oberen Pol noch die vertrockneten Reste des Kelchs, und in ihrem Innern sind sie gleichfalls durch Querwände in einzelne Fächer geteilt, in diesem Falle gewöhnlich in drei, in denen die Samenkerne liegen. Die Blüten sind ebenso wie beim Apfel nach der Fünfzahl angeordnet, und auch ihre Stellung ist die gleiche, nur sind die doldenähnlichen Sträuße der Eberesche viel reichblütiger und die Einzelblüten bedeutend kleiner. So pomphaft wie beim Apfelbaum ist ihre Wirkung im Frühling nicht, auch ist ihr Geruch ziemlich unangenehm. Desto mehr aber prunkt die Eberesche, wenn ihre Krone in Spätsommertagen über und über mit Perlenbüscheln von lebhaftem Rot behangen ist, dessen Eindruck durch das dunkle Grün des überaus zierlich gefiederten Laubes noch beträchtlich gehoben wird. Es gibt nicht leicht einen schöneren Baum als die Eberesche im Schmuck ihrer Früchte, bestimmt nicht in unserm deutschen Wald.
Dieser Üppigkeit im Blühen und Fruchten verdankt sie auch wesentlich ihre Verbreitung. Bekannt ist, daß zahlreiche Vogelarten, keineswegs nur unsere Drosseln, eifrig hinter den Beeren her sind und die für sie unverdaulichen Samen unbewußt mit dem Kot verstreuen. Nur so ist es möglich, daß Ebereschen nicht selten auf Mauern und Türmen grünen, nur so auch, daß vielfach in Waldrevieren, wo weit in der Runde kein Vogelbaum steht, seine Sämlinge aus dem Boden sprießen. Und da diesen jede Bodenart recht ist und sie auch in bezug auf das Licht keine übertriebenen Ansprüche stellen, so wachsen sie, falls der Förster sie duldet, ziemlich rasch zum Bäumchen heran, und wenn sie im Alter von zwei Jahrzehnten etwa drei Meter Höhe haben, erzeugen sie selbst wieder Nachkommenschaft. Die größte Höhe, die sie erreichen, schwankt zwischen 10 und 16 Meter. Der Waldfreund kann nur aufs innigste wünschen, daß sich die Zahl der Ebereschen in unsern Wäldern mehren möge, nicht nur um ihrer Schönheit willen, auch weil ihre Früchte vom Spätsommer an bis oft tief in den Winter hinein auf viele Vögel anziehend wirken, besonders auch auf die nordischen Gäste, und dadurch mittelbar zur Belebung des herbstlichen Waldes beitragen helfen. Die Forstästhetik ist auch ein Bestandteil verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Aufs engste verwandt mit der Eberesche ist der in unseren Mittelgebirgen ziemlich häufige Elsbeerbaum ( Sorbus torminalis), dessen glänzend dunkelgrüne Blätter indessen nicht gefiedert sind, vielmehr entfernte Ähnlichkeit mit denen der Ahornbäume haben. Seine weißen Blüten erinnern dagegen täuschend an die des Vogelbeerbaums, sind aber weniger dicht gehäuft. Die fünf Millimeter großen Früchte sind im Anfang rötlichgelb, im reifen Zustand lederbraun, mit weißlichen Punkten übersät.
Seltener werden wir in Bergwäldern einem Mehlbeerbaum ( Sorbus aria) begegnen, erkennbar an seinen großen eiförmigen, doppeltgesägten Blättern, die oberseits glänzend dunkelgrün sind und unterseits weißfilzig behaart. Ein gleiches gilt von den Stielen und Kelchen der ziemlich großen weißen Blüten, die doldensträußig beisammenstehen. Die 1,5 Zentimeter großen, mehr ei- als kugelförmigen Früchte sind orange- bis scharlachrot. Das Holz beider Bäume ist fest und elastisch und wird als Werkholz hochgeschätzt.
Zu den Bäumen im Buchen- und Buchenmischwald gesellt sich eine beachtenswerte und vielfach reizvolle Strauchgesellschaft. Sofern sie lichtbedürftig ist, besiedelt sie gern die Randgebiete, oder sie sichert sich an den Wegrändern einen geeigneten Platz an der Sonne, der ihr ein leichtes Leben verbürgt. Einwandfreier ausgedrückt: sie kommt an anderen Orten nicht auf, weil ihr die großen Herren des Waldes zu wenig Lichtgenuß vergönnen. Andere sind nicht so wählerisch, weil sie ihre Aufgaben ohne Gefährdung auch im Schatten erfüllen können, und so einer ist der bekannteste und gleichzeitig nützlichste unserer Sträucher.

Haselstrauch
1. Zweig mit männl. (♂︎) und weibl. (♀︎) Blüten.
2.Zweig mit ziemlich reifen Früchten.
3. Staubbeutel.
4. 5. Reife Nüsse.
6. Herausgeschälter Kern der Nuß.
7. Längsdurchschnitt durch den Kern mit dem Keim.
Der Haselstrauch oder kürzer die Hasel ( Corylus avellana) hat in den früheren Buchabschnitten schon mehrfach das Augenmerk auf sich gelenkt, so einmal bei unserer Wanderung durch den erwachenden Frühlingswald (Seite 63) und ein zweites Mal als Pionier der wärmeliebenden Waldbaumarten, die nach dem Abstrom der Eissintflut von neuem in Deutschland Unterkunft suchten (Seite 96). Wenn die Hasel zu erzählen vermöchte, was ihr Geschlecht in verklungenen Zeiten, als der Mensch noch gar keine Rolle spielte, alles erlebt und erlitten hat, es käme ein fesselndes Buch zustande. Sie war schon dabei, als sich die Erdpole um die Wende zur Quartärzeit allmählich mit Eiskappen überzogen, lange bevor auf deutschem Boden der Alp der furchtbaren Gletscherzeit lag, denn ihre Nüsse sind versteinert auf Grinnelland gefunden worden, zwischen 81 und 82 Grad nördlicher Breite. In den Zeitläuften, da diese Nüsse reiften, herrschte in der Umgebung des Nordpols also noch ein viel wärmeres Klima. Auch in Nordgrönland und auf Spitzbergen war sie vor der Eiszeit zu Haus, während der wärmeren Zwischenzeiten hier und da auch auf deutscher Erde. Nachdem sie in nacheiszeitlichen Tagen als Wegbahner unserer heutigen Laubhölzer aus der Fremde heimgekehrt war, überwog sie Jahrtausende hindurch so stark die sämtlichen anderen Arten, daß die Wissenschaft von einer »Haselzeit« spricht. Diese Pioniereigenschaft hat sich die Hasel seitdem bewahrt. Wo immer es gilt, ein freies Gelände, das einzig mit krautigen Pflanzen bedeckt ist, erneut mit Holzwuchs zu besiedeln, da ist unser Strauch in der Regel dabei. Er paßt sich fast jeder Bodenart, fast allen Lichtverhältnissen an, nur dürfen nicht beide ungünstig sein. Und hat er irgendwo Fuß gefaßt, so hält er zähe am Standort fest. Wer den Haselstrauch über dem Erdboden abschlägt und damit vernichtet zu haben glaubt, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Triebkraft und Ausschlagsvermögen der Hasel sind über alle Vorstellung groß. In kurzer Zeit bildet sie neue »Ruten« und hat gewöhnlich schon vor dem Abhieb tief unten vom Stamm aus Sprosse entsandt, die teilweise unter der Erde hinkriechen und sich dann aufrichten und bewurzeln, eine Fähigkeit, die so oder ähnlich auch viele andere Sträucher besitzen.
Ende Februar oder Anfang März, wochenlang vor dem Ausbruch des Laubes, erfreut uns der Haselstrauch durch seine Kätzchen, die schon den ganzen Winter über geschlossen an den Zweigen hingen, jetzt aber ihren Pollenvorrat in gelben Wolken verstäuben lassen. Die empfangsbereiten weiblichen Kätzchen sind in Knospen eingeschlossen und strecken nur je ein kleines Büschel karminroter Narben daraus hervor. In kurzer Zeit ist das Blühen beendet. Die männlichen Kätzchen schrumpfen ein und lösen sich von den Zweigen ab, die weiblichen bilden sich im Sommer zu den ölreichen Nüssen aus, von zipflig geschlitzter Hülle umgeben.
Nicht jedes Jahr liefert gute Ernte, und nicht jede Nuß auf dem Weihnachtsteller birgt in sich den erwarteten Kern. Wo er fehlt, war im Frühling, im Mai oder Juni, als die Nüsse noch weiche Schalen hatten, ein kleiner Rüsselkäfer am Werk, und zwar einer weiblichen Geschlechts, der Haselnußbohrer ( Balaninus nucum). Er setzte den Rüssel wie einen Bohrer auf die Außenhülle der Nuß, bewegte sich, ihn als Drehpunkt benutzend, so lange fleißig im Kreise herum, bis ein Loch in der Schale vorhanden war, und beförderte mit demselben Werkzeug ein Ei durch das Loch auf den schmackhaften Kern. Die Aufräumungsarbeit im Innern der Nuß besorgte dann die gefräßige Larve. Sie fraß bei Tage und fraß bei Nacht, daß nichts als die Kernhülle übrigblieb, bohrte dann ihrerseits mit den Kiefern ein neues Loch durch die Wandung der Nuß (das erste vernarbte nach kurzer Zeit), zwängte sich mit dem Körper hindurch und ließ sich einfach zu Boden fallen. Dort schuf sie sich eine kleine Höhle, um sich im Frühjahr zu verpuppen, kurz vor dem Beginn der Flugzeit der Käfer. Wenn wir also taube Nüsse erwischen, so wissen wir, hier hat ein kleiner Rüßler seiner Mutterpflicht genügt und seinen Sprößling satt werden lassen. Und nebenbei ist ein Wunder geschehen, ein Wunder tierischen Instinkts.
Fast ebenso zeitig wie die Hasel blüht ein kleiner niedriger Strauch, der Seidelbast oder Kellerhals heißt ( Daphne mezereum). Begegnen wir ihm zur Vorfrühlingszeit, so grüßt er uns schon aus der Entfernung mit seinen zierlichen rosigen Blüten, die bald zu dreien, bald zu vieren dicht beieinander am Zweige stehen. Es scheint, als seien sie unmittelbar aus der braungelben Rinde hervorgebrochen, denn etwas wie Stiele bemerken wir nicht. In Wirklichkeit sitzen sie in den Achseln der abgefallenen Vorjahrsblätter, wo sie noch ein paar Wochen früher in braunen Knospen verborgen lagen. Diesjährige Blätter gibt es noch nicht, nur an der Spitze der Blütenzweige ist ein grüner Schopf schon dabei, einen Büschel langer und schmaler Blätter, die leise an die des Lorbeers erinnern, behutsam auseinanderzufalten. Nach ihm erscheinen die seitlichen Blätter. Einstweilen verhauchen die Seidelbastblüten einen würzigen Mandelduft und locken damit Insekten an, die ersten aus dem Winterschlaf erwachten Hummeln und Einzelbienen, Füchse und Zitronenfalter, die auf der Suche nach süßem Nektar die Bestäubung der Blüten bewirken. Die späteren Früchte sind erbsengroß und leuchten im herrlichsten Scharlachrot.
Wie das spärlich verzweigte niedere Sträuchlein, das zu den schönsten Deutschlands zählt, zu seinem seltsamen Namen kam, ist noch nicht endgültig aufgeklärt. Kellerhals soll von Quellerhals kommen und quellen hieß im Althochdeutschen quälen. Die giftigen roten Früchte der Pflanze wurden früher vielfach als Gewaltkur gegen Halsschmerzen angewandt und erzeugten nach alten Kräuterbüchern dabei ein heftiges Brennen im Hals. Der zweite Name Seidelbast wird häufig, aber vermutlich zu Unrecht als eigentlich »Zeidelbast« lautend gedeutet und so mit Zeidlern, das heißt Bienenzüchtern, in engere Beziehung gebracht, weil der Strauch für diese im ersten Frühjahr als Bienenweide von Wichtigkeit sei. Andere, darunter Jakob Grimm, bringen »Zeidel« mit Ziu oder Tyr, dem altgermanischen Gott, in Verbindung, dem der Seidelbast geheiligt war. Uns sei die Berühmtheit des Strauches ein Grund, ihn überall, wo er vorkommt, zu schützen. Am häufigsten wächst er im Bergbuchenwald.
Ein dritter Frühblüher unter den Sträuchern, der die Ränder der Buchenwälder bevorzugt, meist aber nur vereinzelt auftritt, ist die Kornel- oder Judenkirsche ( Cornus mas). Auch Echter Hartriegel oder Herlitze wird sie hier und da genannt. In Thüringen mit seinen Kalkbergen, im Moselgebiet und auf der schwäbisch-bayerischen Hochebene ist sie am sichersten anzutreffen. Wie beim Haselstrauch und Seidelbast erscheinen die goldgelben Blütendolden schon einige Zeit vor dem Laubausbruch, nicht selten schon Ende Februar, gewöhnlich in den ersten Märztagen, und wer die Blütezeit verpaßt hat, erkennt den Strauch an seinen Blättern, die unterseits weiße Haarbüschel tragen und deren Rippen auf jeder Blatthälfte im Bogen nach der Spitze verlaufen. Die etwa zwei Zentimeter langen kirschroten und sehr fleischigen Steinfrüchte werden im Mittelmeergebiet, wo der Strauch viel häufiger ist als bei uns, zu Marmelade eingekocht. Das rötliche, feste und schwere Holz ist bei den Drechslern sehr beliebt, und die jüngeren, schön geraden Triebe liefern die zuerst von den Bauern des Dorfes Ziegenhain bei Jena hergestellten Knotenstöcke, die dann von Studenten als »Ziegenhainer« durch ganz Deutschland verbreitet wurden. Die Griechen benutzten das Holz zu Speeren, verwendeten aber die Früchte nicht. Homer bezeichnet sie im zehnten Gesang seiner »Odyssee« als »das gewöhnliche Futter der erdaufwühlenden Schweine«.
Ein naher Verwandter der Kornelkirsche, ungleich stärker bei uns verbreitet, doch gleichfalls ein Freund der Waldrandbezirke, ist der Hornstrauch oder Rote Hartriegel ( Cornus sanguinea), benannt nach seinem hornharten Holz und seinem im Herbst und noch mehr im Winter blutrot leuchtenden Geäst. Seine Blätter sind ebenfalls »bogennervig«, unterseits aber nicht bebartet, und seine Trugdolden bildenden Blüten mit schmalen, gespitzten Blumenblättern, die sich erst im Mai oder Juni öffnen, also nach der Entfaltung des Laubes, sind anstatt goldgelb leuchtend weiß. Die kugeligen, erbsengroßen, prächtig glänzenden schwarzen Früchte, im rohen Zustand ungenießbar, sollen in einer verdickten Abkochung schokoladeähnlich schmecken. Beide Arten sind stattliche Sträucher, die wegen des großen Ausschlagvermögens auch vielfach zu Hecken verwendet werden.
Mehrfach im Buchenwalde vertreten ist die Familie der Geißblattgewächse, nicht bloß durch das Geißblatt selbst, sondern auch durch zwei Heckenkirschen und außerdem durch den Traubenholunder, einen Vetter des in allen Gärten angepflanzten Schwarzen Holunders, auch Holler oder Flieder genannt ( Sambucus nigra), dessen Blüten den bekannten schweißtreibenden Tee und dessen schwarzviolette Beeren beliebte schmackhafte Suppen liefern. Der im Flachland meist fehlende Traubenholunder ( Sambucus racemosa) ist viel weniger bekannt, obgleich er in allen Mittelgebirgen als Unterholz an lichten Waldstellen, an Waldwegen oder am Waldrande vorkommt. Zuweilen trifft man ihn noch in Höhen, die über der Buchenwaldgrenze liegen, dann besonders auf Fichtenwaldschlägen, wo er durch reichen Wurzelausschlag in kurzer Zeit sein Gebiet erweitert. Seine Blätter sind kleiner als die des Hollers, aber gleichfalls unpaar-gefiedert, die Blüten stehen jedoch nicht in Trugdolden, sondern in eiförmigen Rispen beisammen und haben hübsche grüngelbe Färbung. Die Blütezeit fällt je nach dem Standort in den April oder in den Mai. Im Herbst erscheinen an Stelle der Blüten korallenrote runde Steinfrüchte, deren Kerne durch Vögel verbreitet werden.
Auch die Heckenkirschen sind vorzugsweise im Randgebiet der Wälder zu finden, seltener als Unterholz. Die verbreitetste Art, die Gemeine Heckenkirsche ( Lonicera xylosteum), ist kenntlich an ihren mit flaumigen Härchen bedeckten jungen Sprossen und Blättern, welch letztere sich zu zwei und zwei an den Zweigen gegenüberstehen. In den Achseln dieser »gegenständigen« Blätter erheben sich im Mai oder Juni auf gleichfalls behaarten kurzen Stielen zierliche, lippig gestaltete Blüten, die anfangs weiß, später gelblich sind und immer paarweis das Stielende krönen. Ebenso zwillingsmäßig vereint, am Grunde leicht miteinander verwachsen, leuchten im Juli die purpurnen Beeren. Man lasse sich aber durch ihr Aussehen keinesfalls zum Kosten verlocken. Erbrechen würde die Folge sein. Seltener ist die Schwarze Heckenkirsche ( Lonicera nigra), deren Heimat schattige Bergwälder sind, gleichviel ob Laub- oder Fichtenwälder. Ihre anmutigen rosigen Blütenstände sind wie bei Xylosteum angeordnet, nur sind die Stiele bedeutend länger und niemals von einem Haarflaum bedeckt. Die ungenießbaren Beeren sind schwarz.
Die vierte Art der Geißblattgewächse, das Wilde oder Waldgeißblatt ( Lonicera periclymenum) ist aus der Familienrolle gefallen und hat Gewohnheiten angenommen, die es besonders beachtenswert machen. Liane – man braucht nur den Namen zu nennen und augenblicks taucht in unserer Vorstellung das Bild eines tropischen Urwaldes auf, wie er seit Alexander von Humboldt unzählige Male geschildert ist. Eine undurchdringliche Baum- und Strauchwelt erscheint vor unserem geistigen Blick, eine malerisch bunte Pflanzengemeinschaft, von Affen und Papageien belebt, von farbenprächtigen Blumen durchduftet, erfüllt von einem Durcheinander phantastischer Schlingpflanzen oder Lianen, die bald als breite grüne Bänder die Stämme der Urwaldriesen umwinden, bald sich als blumenreiche Girlanden von einer Krone zur andern spannen und wieder woanders als lebende Seile schwankend vom Zweigwerk herunterhängen. Dem deutschen Walde ist alles das fremd. Eichkätzchen müssen uns die Affen, Kreuzschnäbel die Papageien ersetzen, und das für den Urwald der Tropenländer vor allem bezeichnende üppige Wachstum der mannigfaltigsten Kletter- und Schlingpflanzen fehlt unsern heimischen Wäldern völlig. Nur eine kleine Zahl von Lianen hat unser prunkloser, biederer, ernster und dennoch so wunderschöner Wald in seine treue Hut genommen, und eine davon ist das Waldgeißblatt. Einen rechten Begriff von den Urwaldlianen kann es uns freilich nicht vermitteln, doch was es uns zu erzählen vermag, ist immerhin interessant genug, besonders wenn uns das Glück zuteil wird, seine Bestäuber am Werke zu sehen.
Von der Pflanze an sich ist nicht viel zu berichten, nachdem wir ihre nahen Verwandten, die Heckenkirschen, schon vorgestellt haben. Was sie von diesen unterscheidet, ist einmal ihre Fähigkeit, erreichbare Zweige oder Stämme mit ihren Stengeln zu umwinden und so unter Umständen fünf Meter hoch an einer Stütze emporzuklettern. Dabei ist das Stengelseil des Geißblatts, das oft beträchtliche Stärke erreicht, von einer so zähen Beschaffenheit, daß die in die Dicke wachsenden Stützen, etwa ein Baum im Stangenholzalter, es nicht zu zersprengen imstande sind. Die Bäume »umwallen« daher die Umschlingung, so daß diese an den Stämmen und Ästen häufig wie eingedrückt erscheint. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal sind die im Hochsommer an den Zweigenden zu förmlichen Sträußen gehäuften Blüten, in der Färbung gewöhnlich gelblichweiß mit mehr oder minder rosigem Anflug. Nicht wenigen Lesern wird unser Strauch überdies durch seinen Vetter bekannt sein, durch den als Laubenwand beliebten, oft angepflanzten Jelängerjelieber ( Lonicera caprifolium), und wer einmal eines schwülen Abends in solch einer blühenden Laube saß, kennt nur zu gut den berauschenden Duft, den die zahlreichen Blüten entströmen lassen. Der Jelängerjelieber, das »echte« Geißblatt, teilt so vollkommen die Eigenschaften der »wilden«, im Walde heimischen Pflanze, daß wir an ihm genau wie an jener unsere Studien vornehmen können. Blütenstudien. Denn seine Blüten und ihre Anpassung an die Bestäuber sind am Geißblatt das anziehendste.
Nicht Bienen und Hummeln bemühen sich, als Liebespostboten tätig zu sein, sondern große, dickbäuchige Schmetterlinge – Schwärmer ( Sphingidae) nennt der Naturforscher sie –, mit einem dichten Haarpelz bekleidet und ausgerüstet mit langen Vorder- und sehr viel kürzeren Hinterflügeln. In der Dämmerung sausen sie pfeilgeschwind mit surrendem Geräusch durch die Luft, und wenn aus der Ferne kommender Duft von Nachtfalterblumen wie der des Geißblatts ihre Geruchsorgane umspült, so stürmen sie geradeswegs auf diese lockende Duftquelle zu, lassen sich aber nicht auf ihr nieder, wie es bei Tagfaltern so der Brauch ist, sondern schweben nach Kolibriart mit raschem Flügelschlag vor den Blüten und führen ihren Schmetterlingsrüssel von drei bis acht Zentimeter Länge (je nach der Art der Blütenbesucher) den honigbergenden Kronröhren ein. Eine Rüssellänge von drei Zentimeter ist unbedingt erforderlich, um an den Nektar zu gelangen, und da unter allen deutschen Insekten einzig die Schwärmer solch Werkzeug besitzen, so ist unser Geißblatt zu seiner Bestäubung unmittelbar auf sie angewiesen. Wunderbar haben Falter und Blüten sich aufeinander eingestellt. Erst nach Hereinbruch der Dämmerung beginnen die Schwärmer umherzustürmen, denn nur bei abgekühlter Luft vermögen sie ihren plumpen Körper ohne bedrohliche Überheizung so schnellen Flugs durch die Luft zu tragen. Nur während der kühlen Abendstunden entquillt aber auch den Geißblattblüten, deren Leben zumeist nur drei Tage dauert, der kräftige, weithin spürbare Duft. Sie bieten den ihnen befreundeten Faltern nicht den geringsten Sitzplatz dar, strecken jedoch, als ob sie seit alters um die Gewohnheit der Gäste wüßten und es ihnen recht bequem machen wollten, die Mündung der Nektar verheißenden Röhren »mundgerecht« frei in die Luft hinaus. Besonders verschmitzt ist dafür gesorgt, daß die Falter nicht etwa den Blütenstaub, den sie sich eben unfreiwillig beim Schlürfen aufgeladen haben, sofort an der Narbe derselben Blüte wieder abzustreifen vermögen, denn das würde gleichbedeutend sein mit einer Selbstbestäubung der Blüte, die der Insektenbesuch ja gerade zum Heil der Pflanze verhindern soll. Zur Sicherung der Fremdbestäubung gelangen deshalb Narbe und Staubbeutel ein und derselben Geißblattblüte nie gleichzeitig zu ihrem Reifezustand, sondern in zwei sich folgenden Nächten. Bei der pollenabgebenden Geißblattblüte ist die Narbe nicht aufnahmefähig. Wo aber diese empfangsbereit ist, wird umgekehrt kein Pollen gespendet. Es ist für den Naturfreund lohnend, das Geißblatt daraufhin anzusehen, und noch mehr, in der Zeit der Blüte wenigstens den Versuch zu machen, den Schwärmern selbst auf die Spur zu kommen.
Durch weithin leuchtende Früchte macht sich im Spätsommer und im Frühherbst das Pfaffenhütchen ( Evonymus europaeus) bemerkbar, ein etwa drei Meter hoher aufrechter Strauch, der als Unterholz lichte Stellen im Laubwald oder die Ränder des Waldes bevorzugt, jedoch auch in Feldhölzern, auf bebuschten Hügeln und an ähnlichen Örtlichkeiten nicht selten vorkommt. In Gärten trifft man ihn bisweilen in Gestalt eines richtigen Bäumchens an, mit schlankem Stamm und rundlicher Krone, und häufig heißt er dann »Spindelbaum«, in Erinnerung an vergangene Zeiten, da sein gelbliches, feinfaseriges Holz mit Vorliebe zur Anfertigung von Spindeln benutzt wurde. Die vierlappigen Kapselfrüchte, denen er seinen bekannteren Namen verdankt, haben entfernte Ähnlichkeit mit dem Amtsbarett der katholischen Geistlichen und wirken besonders auffällig zur Zeit ihrer Reife, wenn aus den aufgesprungenen karmesinroten Kapseln die in einen orangegelben Mantel gehüllten Samen heraushängen. Unscheinbar sind dagegen die im Mai und Juni in den Blattwinkeln stehenden grünlichen Trugdoldenblüten, zumal sie ihre Kronen erst nach der Entfaltung des Laubes öffnen. Kelchblätter, Blumenblätter, Staubgefäße, alles ist in der Vierzahl vorhanden. Wenn der Strauch weder Blüten noch Früchte aufweist, kennzeichnen ihn seine vierkantigen, bräunliche Korkleisten tragenden Zweige. Im Sommer wird das Pfaffenhütchen häufig von einer Gespinstmotte befallen, deren Raupen sich von seinen Blättern nähren und ganze Zweige von ihnen entblößen. Auf den gelben, breiigen Samenmantel sind ganz besonders die Rotkehlchen erpicht, die so die Verbreitung des Strauches bewirken.
»Wohin des Weges?«
»Den Frühling suchen.«
»Den Frühling jetzt schon, um Mitte März? Möcht' wissen, wo er zu finden wäre.«
»Überall, wo auf kahlen Feldern zwischen dem langsam zerrinnenden Schnee die ersten heimgekehrten Lerchen fröstelnd an grünen Saatspitzen picken oder im Stadtforst die ersten Stare ihre Kehlen zu stimmen beginnen; wo zwischen dem Fallaub auf Gartenbeeten Schneeglöckchen ihre Köpfchen heben und zierliche Krokus ihr lichtes Gefieder verlangend der Sonne entgegenstrecken; wo fern am Waldrand der Haselstrauch seine schaukelnden Blütenkätzchen erschließt, lange bevor er an ein Entfalten der wohlverwahrten Blattknospen denkt, oder wo tiefer im kahlen Laubwald die ersten, verwegensten Blumenjungfern ihre verträumten Lichtaugen öffnen. Da und an hundert anderen Orten ist Mitte März der Frühling erwacht, so fest der Kalendermann auch noch schläft.«
Ich liebe die ersten Boten des Lenzes nicht nur als Künder hellerer Tage, ich liebe sie vor allen Dingen um ihrer Beherztheit und Lebenskraft willen, mit der sie all ihrer Zartheit zum Trotz den Kampf mit den Witterungsmächten wagen. Ich kann nicht einstimmen in den Chor der wehleidig-butterherzigen Seelen, die »etwas ungemein Rührendes« in diesem Wagnis der Schwachen finden, denn Rührung und Mitleid sind Nachbarskinder, und Mitleid brauchen die Ringenden nicht. Sie wissen sich schon ihrer Haut zu wehren.
Was tuts, wenn nach zwei, drei sonnigen Tagen ein kalter Wind aus Osten bläst und die vorwitzig aufgetauchten Schneeglöckchen unter einer Schicht Neuschnee begräbt? Ganz wie von selbst knicken ihre Beinchen infolge des Ansturms der Kälte ein, das Köpfchen senkt sich zum Boden herab, und der Schnee, so bedrohlich er aussehen mag, wird nun dem Pflänzchen zum hilfreichen Retter, der es vor dem grimmigen Ostwind schützt. Sie machen es wie die Eskimohunde, die auch keine mitleidsvolle Hand vor der Unbill der rauhen Polarnacht bewahrt; sie lassen sich ruhig vom Flockengewirbel in eine weiße Schneedecke hüllen und warten den Abzug des Unwetters ab. Wie? Der Vergleich soll nicht zutreffend sein? Freilich, die nordischen Schlittenspitze haben ein dichtes, zottiges Fell und obendrein sind sie Säugetiere und haben dauerwarmes Blut, das heißt einen Wärmeofen im Körper, der Tag und Nacht seine Schuldigkeit tut, solange die Atmung im Gange bleibt. Beides, Haarpelz und warmes Blut, haben die Schneeglöckchen allerdings nicht. Wer aber deshalb der Meinung ist, sie hätten in ihrem zarten Körper auch keine eigene Wärmequelle, der braucht nur gehörig Obacht zu geben, wenn Tauwetter eintritt und die Pflänzchen sich langsam aufzurichten beginnen. Überall, wo die grünen Blättchen nur leicht mit dem Schnee in Berührung kommen, schmilzt er ersichtlich rascher zusammen als in der weiteren Nachbarschaft, und überall, wo ein Schneeglöckchen aufwacht, entsteht in der Schneedecke eine Lücke. Denken wir an die Soldanellen, von deren erstaunlicher Wärmeerzeugung schon weiter vorn erzählt worden ist (Seite 159), und solche Erwärmung der Kinder Floras beruht auf dem gleichen Lebensvorgang wie bei den Hunden der Eskimo, nämlich auf dem Vorgang der Atmung. Nur ist dieser bei den Pflanzen so schwach, daß wir ihn bloß mittelbar nachweisen können. Tiere und Pflanzen atmen gleich, und wie bei den Tieren die Lebenskräfte, die die Maschine des Leibes treiben, durch eine »Verbrennung« gewonnen werden, so heizt auch die Pflanze ihren Körper beständig durch einen Verbrennungsprozeß. Auch sie hat ihren Dauerbrandofen, und wenn dessen Wärme in vielen Fällen nicht ohne weiteres nachweisbar ist, so trägt die ihm feindliche Wasserverdunstung und Ausstrahlung daran hauptsächlich die Schuld.
Verminderung der Wärmeabgabe und Einschränkung der Verdunstung von Wasser, das sind für die zarten Frühlingsboten, die noch mit dem Winter im Streite liegen, naturnotwendige Schutzmaßnahmen. Nicht nur für Schneeglöckchen und Krokus, auch für die lieblichen Anemonen und zahlreiche andere Wagehälse, die gleichsam den Vortrupp der Lenzflora bilden. Einschneien lassen ist eins dieser Mittel, zu denen der Kampf ums Leben zwingt. Ein anderes, das wir bei Anemonen und Schneeglöckchen trefflich beobachten können, ist das Herabhängenlassen der Blüten, das »Nicken«, wie man gewöhnlich sagt, sowie das Schließen der zarten Blüten zur Nachtzeit oder bei widrigem Wetter. Es ist ja klar, daß die Wärmeausstrahlung in die bewegte Luft hinein viel ungehemmter erfolgen muß als die nach dem nahen Erdboden hin, und daß eine sorglich geschlossene Blüte der Kälte viel leichter zu trotzen vermag. Viele Pflanzen sind außerdem durch eine dichte Behaarung geschützt, die auch wieder nur die Bedeutung hat, die Verdunstung nach Kräften hintanzuhalten. Und schließlich erinnern wir uns jenes Farbstoffs, von dem schon früher die Rede war (Seite 46), des Anthokyans der Botaniker (auf deutsch schlechthin Blumenviolett), dessen Gegenwart stärkere Atmung bewirkt und damit erhöhte Wärmeentwicklung. Sie sind allesamt gut ausgerüstet, die Herolde, die der Lenz vorausschickt, sie brauchen unser Mitleid nicht.
Auch der so kurzen Spanne Zeit, die ihnen der unbelaubte Wald zum Ausschlagen, Blühen und Fruchten läßt, bevor er ihnen das Licht abschneidet, sind sie vortrefflich angepaßt. Sie bringen ihren Nahrungsvorrat, den sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben während des Lebens im Lichte brauchen, sozusagen im Rucksack mit, in unterirdischen Gebilden, die entweder Zwiebeln und Knollen heißen oder, wenn sie mehr in die Länge gestreckt sind, Wurzelstöcke oder Rhizome. Im Vorjahr zogen sich die Pflanzen, als die Bedingungen für ihr Fortkommen über der Erde zu mangeln begannen, gleichsam unter die Erde zurück, nachdem sie die in den Tagen des Lichts mit den grünen Blättern erzeugten Stoffe sämtlich in die Erde geleitet, ihren Dauerorganen zugeführt hatten. In diesen unterirdischen Sprossen, in Zwiebeln, Knollen oder Rhizomen, leben die scheinbar erstorbenen Pflanzen im Schutze der Waldbodendecke fort, entwickeln mit Hilfe der Vorratsstoffe die Anlagen für neue Blätter und Blüten und wachsen nach Ablauf der Frostperiode in kurzer Zeit aus dem Erdreich hervor. Bei der Betrachtung der Buchenwaldpflanzen wird davon noch mehrfach die Rede sein.
Wir ordnen sie nach der Zeit des Erscheinens. Den Anfang machen die Frühlingsboten, die entweder noch im winterkahlen oder im eben ergrünenden Laubwald ihre fröhlichen Blüten erschließen, um bald danach ihre Früchte zu reifen und größtenteils im Wonnemonat wieder vom Schauplatz abzutreten. Die zweite Gruppe umfaßt die Flora des frischbelaubten Buchenwalds mit der Hauptblütezeit im Mai, Pflanzen, die im Laufe des Sommers, bald früher, bald später zu fruchten beginnen und in ihren oberirdischen Teilen auch nach der Fruchtreife weiterleben. Den Abschluß bilden die späten Pflanzen, die in den Sommermonaten blühen.

Tafel 56
Blick in den Urwald von Kubani im Böhmerwald

Tafel 57
Der Frühlingsrufer Kuckuck auf einer Jungfichte

Singdrossel mit Futter im Schnabel am Nest

Tafel 58
Eichelhäher, sich sonnend

Ringeltäuber

Tafel 59
Ein uralter Eichenbaum
Einer der ersten Lenzverkünder ist das schon erwähnte Gemeine Schneeglöckchen ( Galanthus nivalis), das bei milder Witterung im Februar seine Blüte erschließt. Der ganze oberirdische Sproß war schon seit Monaten unter der Erde in der Zwiebel vorgebildet, bevor das wärmere Wetter begann. Der Sproß brauchte nur noch emporzuwachsen und die ihn umhüllende Scheide zu sprengen, was in ein paar Tagen geschehen war. Wenigen ist jedoch bekannt, daß dieses Schneeglöckchen eigentlich ein freier Bewohner des Laubwaldes ist und erfreulicherweise auch heute noch in ihm als seiner Heimat lebt, obgleich seinen Zwiebeln rücksichtslos von Blumenhändlern nachgestellt wird. Besonders die Wälder Schlesiens und die der Weichselniederungen beherbergen es noch in beträchtlicher Zahl. Verbreiteter ist eine verwandte, gewöhnlich gesellig auftretende Art, die etwa zwei Wochen später erblüht, die Frühlingsknotenblume ( Leucoium vernum), oft auch Hornsen-, das heißt Hornungsblume, Märzbecher oder Großes Schneeglöckchen genannt. Niemals aber finden die beiden Pflanzen sich in ein und demselben Wald. Sie vertreten sich gleichsam gegenseitig. Wo das kleine, einheitlich weißblütige Schneeglöckchen vorkommt, fehlt die an der Spitze der Blumenblätter durch einen grünen Fleck gezierte größere Art. Die Befruchtung der beiden anmutigen Frühblüher wird hauptsächlich durch zeitig fliegende Einzelbienen bewirkt, auf die die nach unten hängenden Staubbeutel bei der geringsten Berührung ihren Blütenstaub ausschütten. Als Verbreiter der in beerenähnlichen Kapseln reifenden, mit einem fleischigen Anhängsel versehenen Samen kommen ausschließlich Ameisen in Betracht, die dieses Anhängsel mit Vorliebe verzehren. Sie können es sehr leicht erlangen, denn wie bei den meisten »Ameisenpflanzen« sinken auch bei den Schneeglöckchen zur Fruchtzeit die Blütenstiele schlaff auf den Erdboden herab.
Das eigentliche Blumenleben im blätterlosen Buchenwald beginnt um die Wende vom März zum April. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche treten neue Arten ans Licht und helfen den gelbbraunen Waldboden schmücken. In Menge erscheinen Buschwindröschen, wenn ein paar Tage die Märzensonne ein freundliches Gesicht gemacht hat, zuerst die weißen Blütensterne der Anemone nemorosa, die in keinem Walde fehlen, und etwas später, Anfang April, die goldgelben Blüten ihrer Verwandten, der weniger häufigen Anemone ranunculoides. Auch diese ungemein zarten Blümchen harrten schon längere Zeit ihrer Stunde, entsprossen aber keiner Zwiebel, sondern einem Wurzelstock, einer »Grundachse«, wie man auch wohl sagt, in deren Endknospe alle Organe im Herbst bereits vorgebildet waren. Jahrelang dauert der Wurzelstock, der Nahrungsspeicher der Anemonen, mit dessen Hilfe sie überwintern, unter der Bodendecke aus. Jahr für Jahr kriecht er waagerecht ein Stück weiter, indem er sich nach vorn verlängert, solange die assimilierende Pflanze ihn mit der nötigen Nahrung versorgt, und von hintenher langsam abstirbt. In ihm lebt das Buschwindröschen fort, obgleich es oberirdisch vergeht. So zart und gebrechlich das Pflänzchen ist, so gut weiß es dennoch dem Wetter zu trotzen. Nachts und bei Regen schließt es die Blüten, um deren innere Teile zu schützen, und gegen die Nachtfröste wehrt es sich durch Erzeugung des wärmenden Blumenrots, das uns als Anthokyan bekannt ist. Zumal die ersterwachten Blüten sind in der Regel rosa geschminkt, zuweilen gar kräftig violett. Später, bei milderer Witterung, leuchten sie reinweiß vom Boden auf. Den Bestäubern, Käfern, Fliegen und Bienen, winkt kein Honig in den Blüten, sondern einzig Blütenstaub. Im Notfall bestäubt sich das Windröschen selbst. Die Früchte sind kurzgeschnäbelte Nüßchen, deren Keimblätter unter der Erde austreiben.
Zur selben Zeit wie die Anemonen treten die Leberblümchen ( Anemone hepatica) auf, lichthimmelblaue Frühlingskinder, die ihren wenig geschmackvollen Namen lediglich deshalb tragen müssen, weil man sie früher für ein Heilmittel gegen Leberkrankheiten hielt. Sie verdienen umgetauft zu werden, denn sie sind nicht nur schöne Blumen, sondern auch sehr beachtenswerte, weil ihre blauen Blütenblätter sich während der kurzen Blütezeit, die etwa acht Tage zu dauern pflegt, annähernd um das Doppelte verlängern, von 6 oder 7 Millimeter auf 13. Das ist ein sonderbares Geschehen, zu dessen Verständnis kurz gesagt sei, daß die vermeintlichen Blumenblätter in Wirklichkeit den Kelch vorstellen, daß also das hübsche Leberblümchen gar keine Blütenkrone besitzt. Den Kelchblättern fiel die Aufgabe zu, die bunte Krone zu ersetzen, das heißt Insekten anzulocken und ferner bei Nachtkälte und bei Regen die Staubgefäße vor Schaden zu hüten. Und da sich ein Teil dieser Staubgefäße aus Zweckmäßigkeitsgründen allmählich verlängert, so zog das die Notwendigkeit der Vergrößerung der Kelchblätter nach. Sie würden sonst die zu schützenden Teile einfach nicht mehr umschließen können. Wie die Windröschen ist auch das Leberblümchen eine echte »Pollenblume«, die keinen Nektar zu spenden vermag, und ganz wie jene besitzt auch sie einen Wurzelstockspeicher unter der Erde, aus dem sie im Lenz die Aufbaustoffe für ihre Blüten und Blätter bezieht. Während jedoch bei den Anemonen die oberirdische Pflanze stirbt, nachdem sie geblüht und gefruchtet hat, dauern bei unserm Leberblümchen die derben, dreilappigen Laubblätter aus, bis in die herbstlichen Tage hinein. Ein Teil widersteht sogar erfolgreich dem Ansturm des Winters mit seiner Gefolgschaft und ist noch am Leben, wenn sich im Frühjahr die jungen, frischgrünen Blätter entwickeln, was nach der Entfaltung der Blumen geschieht. Oft sind die überwinternden Blätter unterseits rot angelaufen.

Haselwurz
Immergrün ist auch die Haselwurz ( Asarum europaeum), was schon die wie beim Leberblümchen derben, lederartigen Blätter und ihre Anschmiegsamkeit an den Waldboden deutlich zu erkennen geben. Die Derbheit hält das Erfrieren hintan, und die dem Boden nahe Lage schützt vor dem trocknenden kalten Wind, der gefährlicher ist als die Winterkälte. Wir finden die gleichen Eigenschaften noch bei einer dritten Buchenwaldpflanze, beim Singrün oder Immergrün ( Vinca minor), das im April zu blühen beginnt und auch noch im Mai den Waldboden schmückt.

Immergrün
Die Haselwurz ist leicht zu erkennen an ihren ungewöhnlich dunklen und großen nierenförmigen Blättern sowie den darunter halb versteckten dreigezipfelten Blütenhüllen, die außen schmutziggrün gefärbt sind und innen dunkelblutrot glühen. Solange die Zipfel der Blumenblätter noch miteinander verbunden sind und eine kleine Glocke bilden (später klaffen sie auseinander), benutzen allerlei kleine Fliegen, angelockt durch den Kampfergeruch, den die Pflanzen in die Umgebung verströmen, die roten Glocken als Unterschlupf. Als Ganzes macht die Haselwurz im Vergleich mit den anderen Frühlingsblumen einen etwas verschrobenen Eindruck, als passe sie nicht mehr recht in die Zeit, und das hat seinen guten Grund. Ihr Stammbaum reicht nämlich weiter zurück als der des Menschen, des »Herrn der Schöpfung«. Als dieser in der Tertiärzeit zum erstenmal seine Augen aufschlug, war das Geschlecht der Haselwurze schon weit verbreitet über die Erde, viel stärker als in der heutigen Zeit. Wie schmuck sieht dagegen das Singrün aus. Die Blätter, obwohl auch lederartig, sind zierlich und schlanklanzettlich geformt, und die hübschen hellblauen Trichterblüten, nach der Fünfzahl angeordnet, verbergen sich nicht unterm Blätterschirm, sondern wiegen sich einzeln auf langem Stiel, daß die Bienen und Hummeln, ihre Bestäuber, sie unschwer aufzufinden vermögen. Proletarische Fliegen besuchen sie nicht. Das Immergrün ist ein Fremdling bei uns. Seine Heimat ist der sonnige Süden, und seine Verbreitung nach Norden hin reicht deshalb nur bis Mitteldeutschland. In Süddeutschland kommt das hübsche Kräutlein in Laubwäldern besonders häufig vor.
An feuchten Waldstellen oder im Buschwerk der Grabenränder begegnen uns ab Mitte März gesellschaftlich wachsende niedere Pflänzchen, deren fettigglänzende saftgrüne Blätter den Boden teppichartig bedecken und deren goldgelbe Blütensterne von wechselnder Größe sehr auffallend sind. Wir haben die Feigwurz, das Scharbockskraut ( Ranunculus ficaria) vor uns, ein Heilkräutlein, dessen zerstoßene Wurzel, »mit einem süßen gebratenen Apfel vermischt und wie ein Pflaster übergeschlagen«, nach Aussage alter Kräuterbücher aus dem 16. Jahrhundert die Schmerzen der Feigwarzen zu stillen vermochte und dessen Blätter man als Salat zur Vertreibung des Scharbocks (Skorbuts) verzehrte. Mag das genützt haben oder nicht, uns fesselt die Feigwurz aus anderen Gründen, nämlich ihrer »Brutknospen« wegen, durch die sie sich ungeschlechtlich vermehrt. Sind die Pflanzen voll erblüht, so entdecken wir bei genauer Betrachtung in den Blattachseln bräunliche Knöllchen, die täuschend Weizenkörnern ähneln und prall mit Reservestoffen gefüllt sind. Kommen wir im Juni wieder, zur Zeit, da die Pflanze im Absterben ist, so finden wir diese Getreidekörner in Menge am Boden liegend vor, zuweilen in einer Erdvertiefung vom Regenwasser zusammengeschwemmt. Hier überdauern sie den Winter, vom sterbenden Laube überdeckt, und lassen im Frühjahr in kurzer Zeit ein neues Feigwurzpflänzchen entstehen. Größere, keulenförmige Knollen, gewöhnlich zu ganzen Büscheln gesellt, entwickeln sich in der oberen Erdschicht zwischen den fadenförmigen Wurzeln und haben hier die gleiche Bedeutung wie die Zwiebel beim Märzbecher. Früchte setzt das Scharbockskraut bei uns nur in Ausnahmefällen an, selbst wenn es vollkommen ordnungsmäßig von Fliegen und Bienen bestäubt worden ist.
Auf süd- und mitteldeutsche Bergwälder beschränkt ist die Stinkende Nieswurz ( Helleborus foetida), eine nahe, aber viel weniger schöne und obendrein unangenehm riechende Verwandte der herrlichen Christrose, deren Bekanntschaft wir bereits im Nadelwald machten. Auch sie liebt Abhänge und steinige Triften als Standort und siedelt sich gern unter halbschattigen Gebüschen an, wo sie im Unterschied von der Verwandten nichts weniger als auffallend wirkt. Der häufig fingerdicke holzige und ausdauernde Stengel der etwa halbmeterhohen Pflanze ist mit tiefeingeschnittenen, derben Blättern besetzt, deren Form unterhalb des weitverzweigten Blütenstands immer einfacher wird. Fünf gelbgrüne, rötlich berandete Kelchblätter und acht beträchtlich kleinere, zu honigführenden Bechern umgewandelte Blumenblätter neigen sich glockenförmig zusammen und locken Bienen und Hummeln an. Namentlich in Baden, in der Pfalz, im mittleren Rheintal und in Thüringen ist die kalkliebende Stinkende Nieswurz vielerorts aufzufinden. Seltener ist die auf ähnlichen Standorten lebende Grüne Nieswurz ( Helleborus viridis), deren ausgebreitete, blaßgrüne Blumenblätter schon deutlich an die der Christrose erinnern.
Allbekannt ist das Himmelsschlüsselchen oder die Waldschlüsselblume ( Primula elatior), zumal sie von Ende März bis in den Wonnemond hinein nicht bloß feuchte Waldstellen, sondern auch die angrenzenden Wiesen in Fülle mit ihren schwefelgelben Blütendolden zu schmücken pflegt. Biologisch beachtenswert ist, daß die dem Wurzelstock entspringenden jungen Blätter senkrecht stehen, nach der Unterseite zu eingerollt sind und eine merkwürdig gerunzelte Oberfläche zeigen, während die älteren Blätter sich rosettenartig dem Waldboden anschmiegen. All das sind verdunstunghemmende Einrichtungen, die die Blätter vorm Austrocknen schützen. Dem ausdörrenden Frühlingswind wird dadurch die Angriffsfläche bedeutend verringert. Noch interessanter ist die Beobachtung, daß der steif werdende Blütenstandsstiel sich zur Zeit der Fruchtreife auf fast das Doppelte seiner ursprünglichen Länge reckt, wodurch nämlich die Streufläche für die auf Windverbreitung angewiesenen Samen eine beträchtliche Vergrößerung erfährt.

Lungenkraut
Um dieselbe Zeit wie das Himmelsschlüsselchen erschließt das Lungenkraut ( Pulmonaria officinalis) seine Blüten, eine zarte Pflanze mit großen, gewöhnlich weißgefleckten Blättern, die früher als Heilmittel gegen Lungenkrankheiten galt und daher ihren Namen bekam. Das Auffallendste an ihr ist die merkwürdige Umfärbung ihrer vom gleichen Stiel getragenen Röhrenblüten. Im Knospenzustand sind sie leuchtend rosenrot, nach dem Aufblühen werden sie violett, und wieder nach einer kurzen Zeit, wenn die Honigdrüsen im Blütengrunde bereits versiegt sind, geht die violette Tönung in Dunkelblau über. Die eigentlichen Bestäuber des Lungenkrauts, vor allem die langrüsseligen Pelzbienen ( Anthophora), wissen auch sehr genau Bescheid. Sie besuchen nur violette Blüten und lassen die tiefblauen einfach links liegen, während unerfahrene Honigsucher ahnungslos auch die blauen befliegen, das heißt vergebliche Arbeit leisten. Eine weitere Besonderheit der Trichterblüten des Lungenkrauts, die freilich auch sonst in der Blumenwelt vorkommt, wenn auch verhältnismäßig selten (u. a. bei der Schlüsselblume), ist ihre »Verschiedengriffeligkeit«. Beim einen Stock schaut aus den Blütenröhren ein runder Narbenkopf hervor, beim andern der blaugraue Staubbeutelkranz. Bei jener ragt der Staubbeutelkreis nur bis zur halben Höhe der Röhre, bei dieser der narbentragende Griffel. Die Einrichtung hat keinen anderen Zweck, als die Fremdbestäubung sicherzustellen. Die Pelzbiene, die beim Einführen des Rüssels in eine kurzgriffelige Blüte die Staubbeutel um deren Schlund herum streift und sich dabei mit Pollen belädt, wird diesen bei ihrer späteren Einkehr bei einer langgriffeligen Blüte unfehlbar auf die Narbe bringen, denn diese steht in der gleichen Höhe wie der Staubbeutelkranz in der ersten Blüte. Und umgekehrt wird der Blütenstaub, der dem Rüssel der Biene in der Mittelhöhe einer langgriffeligen Röhre angeklebt wurde, beim nächsten Besuch einer kurzgriffeligen Blüte prompt an der Narbe abgestreift werden. Beim Lungenkraut ist Fremdbestäubung nicht bloß vorteilhaft für die Samenbildung, sondern sogar unerläßlich. Wird Lungenkrautpollen auf die Narbe der gleichen Blütenform gebracht, so kommt überhaupt keine Befruchtung zustande.

Blüte des Lerchensporns links im Zustande der Ruhe,
rechts mit herabgedrückter Kapuze. Vergrößert.
Dieselbe frühfliegende Pelzbienenart, die die Bestäubung des Lungenkrauts besorgt, erweist diesen Liebesdienst auch dem Lerchensporn ( Corydalis cava), der übrigens gleichfalls die Farbe seiner Blüten verändert, wenn auch nur an verschiedenen Stöcken, nicht an ein und demselben Stock. In der Regel sind sie purpurrot gefärbt, bald dunkler, bald blasser, doch kommen auch blauviolette, unterseits weiße und mitunter ganz weiße Blüten vor. Immer sind sie zu ansehnlichen Trauben vereinigt und stehen in den Achseln ungeteilter Deckblätter. Aus vier Kronenblättern zusammengesetzt, sind sie höchst kunstvoll gebaut und verlohnen schon eine kurze Betrachtung. Das obere, größte Kronenblatt ist vorn wie eine Hutkrempe aufgestülpt und hinten zu einem 12 Millimeter langen, am Ende nach unten gekrümmten Sack ausgezogen, in dem Honig geborgen ist. Der Sack hat entfernte Ähnlichkeit mit einem Sporn, nur nicht mit dem der Feldlerche, die bei der Namengebung der Pflanze Pate stand. Denn der »Sporn« unserer Frühlingssängerin ist nichts andres als die ein wenig verlängerte Kralle der hinteren Fußzehe. Die beiden seitlichen, wie zwei Löffel oder hohle Hände zusammenschließenden Blumenblätter bilden eine kapuzenähnliche Schutzhülle für den Blütenstaub, und das untere, spatelförmige Blatt dient den Insekten als Anflugplatz. Um zu dem Honig zu gelangen, müssen sie ihren Rüssel unter dem aufgestülpten Teil des oberen Blattes einführen, und um das zu ermöglichen, stützen sie sich mit den Vorderbeinen auf die Kapuze und drücken diese dadurch nach unten. Sofort aber entleert alsdann die Kapuze ihren mehligen Blütenstaub auf die Bauchseite des Insekts, während der ebenfalls vortretende Narbenrand etwa schon von einer anderen Blüte mitgebrachten Pollen aufnimmt und so Fremdbestäubung erfährt. Nicht immer kommen jedoch so ehrlich zahlende Gäste zu Lerchensporns Honigschank. Die Pelzbiene Anthophora avercorum verfügt über einen 16 Millimeter langen Rüssel, ebenso lang wie das ganze Tierchen, und kann daher bis in die Sporntiefe reichen. Hummeln sind dazu meist außerstande, doch wissen sie sich den süßen Nektar auf andere Weise zu verschaffen. Sie beißen ein Spundloch in den Sporn und schlürfen durch dieses den Honig heraus, und zwar verüben sie solchen »Einbruch« nicht bloß in Ausnahmefällen, sondern gewohnheitsmäßig. Besonders die Erdhummel macht es so. Die Früchte des Lerchensporns sind zweiklappige Schoten, die ihre Samen schon im Mai verstreuen und damit den Ameisen zur Weiterverbreitung überlassen. Der oberirdische Teil der Pflanze stirbt danach ab, ihr hohler, kugelig angeschwollener Wurzelstock aber dauert aus.
Steigt uns in feuchten Buchenwäldern (häufiger noch im Auenwald) ein aufdringlicher Knoblauchsduft in die Nase, so können wir sicher sein, daß in der Nähe der Bärenlauch ( Allium ursinum) in großer Menge versammelt ist und auf hohem Schaft seine zu Dolden zusammengeschlossenen schneeweißen, sechsstrahligen Blütensterne ausbreitet. Schnell, wie sechs Wochen früher die Schneeglöckchen, ist er heraufgetaucht aus der Erde Schoß, denn auch in seiner unterirdischen Zwiebel lagen schon während der Wintermonate die Blattanlagen und der junge Blütenstiel aufbruchsfertig vorbereitet. Als Merkwürdigkeit fällt uns auf, daß die lanzettlichen Bärenlauchblätter, die denen des Maiglöckchens ähnlich sind, gegen alles Herkommen ihre hellgrüne Seite dem Himmel und die dunkelgrüne dem Waldboden zuwenden. Sie haben sich während der Wachstumszeit gedreht und damit auch ihren inneren Bau. Die Schwammzellenschicht nimmt die Stelle ein, an der naturgemäß die blattgrünreiche Palisadenschicht zu liegen pflegt. Aus welchem Grunde sie sich drehen, erzählen sie uns leider nicht. Die Blütezeit des Bärenlauchs fällt in die Monate April und Mai. Schon Ende Juni vergilben die Blätter, und bald danach stirbt die Pflanze ab. Die Frucht ist eine tiefgefurchte dreifächerige Kapsel mit schwarzen Samen, die durch Ameisen verschleppt werden.
Alle diese mehr oder weniger zarten Blumengestalten, die der rechte Naturfreund unangetastet läßt, schon weil sie, von roher Hand aus dem Boden gerissen, in kurzer Zeit welken, enthüllen uns ihre Blütengesichter, solange die Bäume ihr Geäst noch vollkommen kahl gen Himmel strecken, bestenfalls schon einen grünen Schleier um ihre Häupter gewoben haben. Die folgenden Lenzpflanzen treten auf, wenn der Buchenwald eben frisch ergrünt ist, den Strahlen der Sonne aber den Zutritt zur Waldbodendecke noch nicht verwehrt. Ihre Hauptblütezeit ist der Wonnemonat.
An den Anfang stellen wir eine der seltsamsten Bodenpflanzen, die unser deutscher Wald beherbergt, am häufigsten in feuchten Schluchten, den Aron oder Aronstab ( Arum maculatum). Wir haben schon weiter vorn gehört, daß die Atmung der Pflanzen Wärme erzeugt, und ebenso ist uns bereits bekannt, daß Käfer, Fliegen, Bienen und Hummeln mit Vorliebe allerhand Sturzglockenblumen als Herberge zu benutzen pflegen. Nachts und an kühlen Sommertagen steigt innerhalb solcher Blütenhöhlung die Wärme immer um einige Grad über die Außentemperatur, und nichts ist verständlicher, als daß die schwärmenden Insekten, die sowieso an den Honigtischen der Blumenwirte zu schwelgen gewohnt sind, beim Eintritt der Kühle gleich sitzenbleiben. Sobald die Sonne zu strahlen beginnt, räumen sie wieder das Nachtasyl, und manches von ihnen bezahlt dann auch ehrlich durch einen freundlichen Gegendienst, indem es ein Päckchen Pollen mit fortnimmt, um dessen Inhalt auf andere Blüten, die später besucht werden, zu übertragen. Es gibt jedoch im Insektenreiche genau wie im Menschenland Drückeberger, die zwar das warme Obdach genießen und Speise und Trank noch obendrein, den Preis dafür aber nicht entrichten, was wiederum bei einzelnen Pflanzen entsprechende Gegenmaßnahmen hervorrief.
Besonders verschmitzt schützt der Aronstab, der im Mai in voller Blüte steht, sich gegen jede Art Prellerei. Den kolbenförmigen Blütenstand umhüllt, wie das Bild auf der folgenden Seite zeigt, ein blaßgrünes tütenähnliches Blatt, die sogenannte Blütenscheide, die oben weit auseinanderklafft, darunter taillenhaft eingeschnürt und am Grunde so erweitert ist, daß sie einen bauchigen Kessel bildet. Der violette Blütenkolben ragt lustig aus der Scheide hervor und sendet kräftige Düfte aus, die zwar für unsere vornehmen Nasen im höchsten Maße abscheulich sind, auf einzelne kleine Schmetterlingsmücken (besonders der Gattung Psychoda) jedoch verlockend und angenehm wirken. Die Tierchen schwärmen in Massen heran, setzen sich auf den stinkenden Kolben und wandern eins nach dem andern abwärts in die Blütenscheide hinein. Was sie hineinzieht, ist die Wärme. Aron hat tüchtig eingeheizt, und da seine tonnenförmige Gaststube keine zugigen Fenster besitzt, so herrscht in ihr eine Temperatur, die volle sechzehn Grad höher ist als die der Umgebung des Pflanzenwirtshauses. Andere angeschwärmte Zweiflügler gleiten unfreiwillig hinein. Sie fliegen die Blütenscheide an, und diese ist innen derartig glatt und obendrein mit Öltröpfchen bedeckt, daß sie sofort den Halt verlieren und wie auf einer künstlichen Rutschbahn in den Kessel hinuntersausen. Gleichviel aber, was die Psychoda-Mücken in Arons warme Stube treibt, jedenfalls dringen sie zu zehn, zu hundert, zu tausend und mehr in sie ein. Bis viertausend fand man im Kessel versammelt, denn das ist bei Aron Geschäftsgrundsatz: die Gäste werden nicht eher entlassen, als bis sie seinen geheimen Wünschen in vollem Umfang entsprochen haben. Sie sollen ihm nämlich behilflich sein, das edle Geschlecht der Aronstäbe nach Möglichkeit üppig fortzupflanzen.
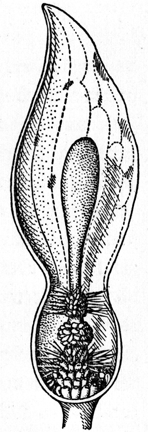
Blütenstand des Aronstabs, der untere Abschnitt geöffnet.
Inwendig ist die Wärmehalle überaus listig ausgestattet. Der Mißduft verströmende blaurote Kolben verjüngt sich innerhalb der Scheide zu einem schlanken gelblichen Stengel, der in verschiedenen Höhenlagen dreierlei Blütengebilde trägt. Zu oberst, just in der Einschnürungszone des tütenförmigen Scheidenblatts, umgibt ihn ein reusenähnlicher Kranz von langen und starren weißlichen Borsten, dem Wesen nach Reste verkümmerter Blüten, dem Zweck nach eine Sperrvorrichtung, die gleichsam die Pforte der Gaststätte bildet. Die Mücken sind aber winzig genug, um glatt durch die Sperre hindurchzuschlüpfen. Ein Stockwerk tiefer gibt's männliche Blüten mit noch geschlossenen roten Staubbeuteln, und abermals etwas weiter unten befindet sich eine breite Zone belegungsfähiger weiblicher Blüten, die lichtgrüne Fruchtknoten sehen lassen. Ahnungslos kriechen oder gleiten die Mücken in den Kessel hinab, erfreuen sich an der Treibhausluft von einigen dreißig Grad Celsius und krabbeln munter und guter Dinge auf den verschiedenen Blüten umher. Wenn sie aus einem schon älteren Warmhaus der großen Familie Aron kamen und von dort Blütenstaub mitgebracht haben, so können sie an den weiblichen Blüten sofort die Fremdbestäubung vollziehen, wofür sie dann als Gegengabe ein Schöppchen süßen Saftes erhalten, der kurze Zeit nach der Befruchtung in Tropfenform der Narbe entquillt. Im andern Fall müssen sie sich mit der Wärme im Unterschlupf zufrieden geben. Entlassen wird vorläufig keine der Mücken. Wie oft sie auch gegen den Lichtschein flattern, der matt durch die Borsten am Eingang dringt, sie taumeln immer zurück in den Kessel, weil ihnen der Durchflug nicht möglich ist. Durch kriechen könnten sie leicht die Sperre, indessen darauf verfallen sie nicht. Der Herbergsvater hat Zeit zu warten. Erst wenn es im Kessel krimmelt und wimmelt, öffnet er in den männlichen Blüten die seither geschlossenen purpurnen Staubbeutel und läßt deren gelben Blütenstaub in Menge in den Kessel regnen. Und wenn sich die unruhig krabbelnden Mücken gehörig mit Pollen bepudert haben, erschlaffen die sperrenden Borsten am Eingang, die eingeschnürte Blütentaille erweitert sich um ein Beträchtliches und alle die eingestäubten Gäste dürfen jetzt ihr Gefängnis verlassen. Man kann sogar, da der Unterstand sich andauernd weiter und weiter öffnet, mit gutem Recht von Aron sagen, er setze die Gäste »direkt an die Luft«. Da draußen ist's aber unheimlich kühl. Ein Wärmesturz um sechzehn Grad ist keine angenehme Sache. Die Mücken suchen deshalb schleunigst ein anderes warmes Stübchen auf, laden darin den Pollen ab und sorgen so, ohne es selbst zu wollen, für das gedeihliche Blühen und Wachsen des edlen Geschlechts der Aronstäbe. Nach der Befruchtung der weiblichen Blüten welkt die Blattscheide langsam hin, und auch der Kolben stirbt nach und nach ab. Die Blüten aber verwandeln sich zu großen kugelig-kantigen Beeren, die im August oder im September korallenrot in die Ferne leuchten und deren Samen sehr wahrscheinlich durch Waldvögel ihre Verbreitung finden.

Gefleckter Bienensaug
Wir werden noch ähnlich seltsame Pflanzen im frischergrünten Buchenwald finden, doch wollen wir auch an den scheinbar schlichten nicht teilnahmslos vorüberschreiten. Bei etwas näherer Bekanntschaft weisen auch sie in den meisten Fällen so viele Besonderheiten auf, mit denen sie ihre kleinen Lebensschicksale meistern, daß sie durchaus nicht reizlos sind. Eine unserer gemeinsten Blumenpflanzen ist beispielsweise der vom April bis zum Herbst blühende Gefleckte Bienensaug ( Lamium maculatum). In Gärten und Anlagen unter Hecken, in Gräben und Büschen an staubigen Landstraßen, allüberall ist er angesiedelt, und auch am feuchten Buchenwaldrande und an Waldwegen finden wir ihn. Was kann uns dieses zum Unkraut herabgesunkene Allerweltskind groß zu erzählen haben? Nun, erstens entbehrt der Bienensaug im Schmucke seiner karminroten Blüten, die in den Achseln der oberen Blattpaare stehen, ganz und gar nicht aller Schönheit, und zweitens sind seine kunstvoll gebauten »Lippenblüten« schon einer Inaugenscheinnahme wert. Obgleich ein wenig beachtetes Unkraut, empfängt der Bienensaug nicht etwa gemeine Fliegen und Käfer als Blütenbestäuber, sondern vornehme Hautflügler, schmuck gekleidete Hummeln mit langem Rüssel, die als Gegengabe am Grunde der rund 15 Millimeter tiefen Blütenröhren schmackhaften Honig vorfinden. Kurzrüsselige Erdhummeln gewinnen diesen wie beim Lerchensporn durch »Einbruch«, und durch die von ihnen gebissenen Löcher stehlen dann wiederum Honigbienen den süßen Saft, weil auch sie ihres kurzen Rüssels wegen nur so an die Quelle gelangen können. Bemerkenswert sind ferner die Blätter, insofern sie in Gestalt und Stellung täuschend denen der Brennessel ähneln, obgleich sie keine Brennhaare tragen. Besonders die jungen, noch nicht in Blüte stehenden Pflanzen sind leicht mit der Nessel verwechselbar, und das Volk hat dem auch Ausdruck verliehen, indem es den Bienensaug »Taubnessel« taufte. Es ist zum mindesten wahrscheinlich, daß die Pflanze um dieser Ähnlichkeit willen von blattfressenden Tieren gemieden wird, wenn auch nicht gerade vom Weidevieh, das sie mit großem Behagen verzehrt. Und schließlich ist der Bienensaug beachtenswert wegen der Art und Weise, wie er sein Ausdauern möglich macht. Er läßt nämlich, wenn er ausgeblüht hat, die Stengel flach auf den Boden sinken, und diese treiben dünne Wurzeln und aus den Achseln der absterbenden Blätter neue blühfähige Zweige. So hat auch ein Unkraut seine Reize für den, der zu beobachten weiß.

Waldziest
Dem Bienensaug ähnlich, aber viel weniger gemein ist die nach ihren leuchtend gelben, auf der Unterlippe hübsch rotbraun gestrichelten Blüten benannte Goldnessel ( Galeobdolon luteum), und als dritter Lippenblütler, dessen angenehm duftende Blumenkronen purpurrot prunken, begegnet uns vom Juni bis zum August an den gleichen Standorten wie sein unkrautartiger Verwandter, der Waldziest ( Stachys silvaticus). Auch er erinnert in seiner allgemeinen Erscheinung an die Taubnessel. Ganz abweichend gebaut ist dagegen ein vierter, im Bergwald heimischer Familiengenosse, das Immenblatt oder die Waldmelisse ( Melittis melissophyllum), eine besonders hübsche Pflanze mit lichtvioletten, rosenrot überhauchten Lippenblüten, die aus einem kurzen aufgeblasenen Kelch hervorschauen und von Hummeln und Nachtschwärmern beflogen werden. Das Immenblatt stellt im Mai und Juni seine Schönheit zur Schau, zählt also eigentlich, wie der Waldziest, nicht mehr zu den Frühlingspflanzen.
Wohl die bekannteste aller Blumen, die der Frühlingswald aufsprießen läßt, ist das zwar giftige, aber köstlich duftende Maiglöckchen ( Convallaria maialis), bei den alten Germanen die Blume der Ostara und bei den Osterfesten als Liebesglückbringerin der beliebteste Schmuck der Jünglinge und Jungfrauen. Die einseitswendig am Stengel hängenden sechszipfligen Glöckchen, die die Maiblume aber nur an verhältnismäßig lichten Waldstellen entwickelt, sind honiglos, werden jedoch ihres Pollens halber gern von Honigbienen besucht. Die aus den Blüten hervorgehenden Früchte, große scharlachrote Beeren mit blauen Samen, werden durch Vögel verbreitet. Verwandt mit dem Maiglöckchen ist die Weißwurz oder das Salomonssiegel ( Polygonatum officinale), deren weißer Wurzelstock die berühmte Springwurzel des Märchens ist, die Felsen und Tore zu sprengen vermag und den Weg zu verborgenen Schätzen öffnet. Stirbt die oberirdische Pflanze, so bleiben am zauberkräftigen Wurzelstock Narben zurück, die sich mit etwas Phantasie als Siegelabdrücke deuten lassen und nach der Legende von keinem Geringeren als König Salomo der »Springwurzel« aufgeprägt worden sein sollen. So kam die Weißwurz zu ihrem seltsamen Namen Salomonssiegel. Das Volk verglich die Narben weniger dichterisch mit Hühneraugen und benutzte sie gegen diese. Die lichtere Standorte beanspruchende Pflanze ist wegen ihrer abwechselnd rechts und links dem kantigen Stengel angehefteten breiten Blätter und der darunterhängenden schlanken Blütenglöckchen unverkennbar. Mitunter findet sich die Weißwurz auch im Kiefernwald.
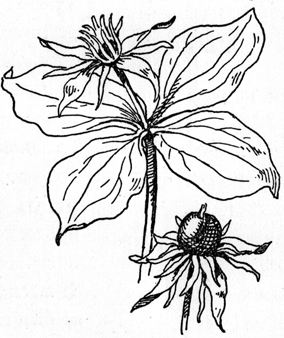
Einbeere
Eine entferntere, aus der Art geschlagene Verwandte der Maiblume ist die in feuchten Laubwäldern verbreitete, im Mai blühende Einbeere ( Paris quadrifolia), ein eigenartiges Gewächs. Aus dem dünnen Wurzelstock entsprießt ein schlanker Stengel, und auf dessen Spitze baut sich über einem Quirl aus vier großen, jedoch sehr zarten Laubblättern eine einzige Blüte auf, die nicht einmal auffällig wirkt. Die Hülle dieser Blüte bilden acht abwechselnd schmale und breitere Blättchen von grüngelber Färbung, und diesem äußeren Kreis schließt sich ein innerer von acht auseinandergespreizten, gleichfalls gelbgrünen Staubgefäßen an, deren Beutel durch ein langes pfriemförmiges Spitzchen ausgezeichnet sind. Inmitten dieser Staubgefäße steht ein dunkelpurpurn glänzender Fruchtknoten, den ebenso gefärbte Narben krönen. Das ist die ganze Blütenherrlichkeit der Einbeere, die obendrein weder Düfte entsendet noch Honig für Gäste vorrätig hält, obgleich sie den Eindruck einer nektarführenden Blume erweckt. Selbst die Insekten, freilich nur wenig begabte Fliegen und Mücken, werden getäuscht und lassen sich auf ihr nieder, ohne mehr als ein wenig Blütenstaub vorzufinden. Wahrscheinlich bestäubt sich die Einbeere vorwiegend selbst. Bis Ende Juli oder Anfang August entwickelt sich der Fruchtknoten zu einer kirschgroßen schwarzblauen Beere, die von der allein noch übriggebliebenen Blütenhülle gestützt wird. Die Frucht enthält ein scharfes Gift, das jedoch Drosseln, Rotkehlchen und andere Beerenliebhaber des Waldes keineswegs abhält, sie zu verspeisen.

Waldmeister
Das im April und Mai aus einer Rosette langgestielter herzförmiger Blätter aufsteigende Waldveilchen ( Viola silvatica) wird auch der sonst nicht pflanzenkundige Waldspaziergänger ohne weiteres an der gespornten hellvioletten Blüte erkennen, und ebenso ist vermutlich für die Mehrzahl der Leser der immer in Scharen aufmarschierende Waldmeister ( Asperula odorata) ein alter Bekannter. Er gehört in den schattigen Buchenwaldgrund wie der dunkle Wacholder oder das rote Heidekraut in den Föhrenwald, gleichsam als hätte die hohe Waldbuche mit dem niederen Kraut einen Bund geschlossen, allzeit sein treuer Beschützer zu sein. Es würde uns etwas fehlen am Buchenwaldfrühling, wenn wir die zarten, frischgrünen Triebe der Blume des Maitranks und ihre zierlichen, stockwerkartig den Stengel umstehenden Blattquirle vermissen müßten, wenn uns die Anmut der milchweißen Blütensterne nicht grüßte, ihr lieblicher Duft nicht umschmeichelte. Es ist der gleiche Cumarin-Duft, der dem Honigklee und mehreren Gräsern eigen ist und dem auch das getrocknete Heu seinen angenehmen Geruch verdankt.
»Schütte den perlenden Wein
Auf das Waldmeisterlein«
heißt es in einem Maibowlenliede, damit nämlich des Weines fröhliche Geister im welkenden Kräutlein den Riechstoff befreien, veredeln und Maitrank entstehen lassen. Naturgeschichtlich ist am Waldmeister noch bemerkenswert, daß seine in Trugdolden stehenden vierzähligen glockigen Blumenkronen bis Ende August oder September kugelige grüne Früchte aus sich hervorgehen lassen, die mit hakenförmig gekrümmten Borsten besetzt sind. Die Waldvögel wollen von ihnen nichts wissen, und der Wind bläst nicht kräftig genug durch den sommerlich stillen Buchenwald, als daß er die grünen Kügelchen auf seinen Schwingen forttragen könnte. So zählt unser Waldmeister darauf, daß sie Gelegenheit finden werden, sich klettenähnlich ans Haarkleid vorüberstreifender Vierfüßler oder ans Federkleid von Waldhühnern oder Tauben zu hängen und sich von diesen verschleppen zu lassen. Waldmeisters zarte, vierkantige Stengel aber legen sich im Herbst, wenn ihre Blätter größtenteils tot sind, auf die Seite und treiben an ihren Knoten Wurzeln in den Waldboden.
Nur selten vereinigt sich »Prinz Waldmeister«, wie er in Roquettes hübschem Märchen genannt wird, ausschließlich mit seinesgleichen. Gewöhnlich hat er einen ganzen Hofstaat anderer Pflanzen um sich versammelt, oder er mischt sich, wenn ihn Bescheidenheit anwandelt, unter eine größere Gesellschaft artgleicher Waldkinder. Auf unserem Bilde erblicken wir ihn zwischen Bingelkraut ( Mercurialis perennis), das ganz dieselben Anforderungen an den Standort stellt wie er selbst und gleich ihm mit einem vielverzweigten Wurzelstock durch den Waldboden kriecht. Auch das Bingelkraut pflegt deshalb wie er stets in Herden aufzutreten. Um möglichst viel Licht aufzufangen, hat es seine Blätter in die Nähe des Stengelendes heraufgezogen. Männliche und weibliche Blüten stehen getrennt auf verschiedenen Pflanzen, jene zu achselständigen Ähren angeordnet, diese einzeln oder zu zweien. Die Früchte sind bestachelt wie die des Waldmeisters, allein die Stacheln sind so weich, daß sie sich für die Rolle von Kletten nicht eignen. Ihre beiden Samen werden daher zweckmäßig durch plötzliches Umrollen der Fruchtklappen, das schon bei leiser Berührung des Fruchtstandes eintritt, oft schon infolge einer bloßen Bodenerschütterung, wie kleine Geschosse fortgeschleudert. Gelegentlich gerät auf diese Weise das eine oder andere Samenkorn doch auf den Pelz des Auslösers der Explosion und wird von diesem weiterbefördert.
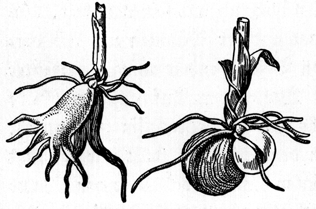
Wurzelknollen einheimischer Orchideen
Zu den auffallendsten Erscheinungen der deutschen Pflanzenwelt, nicht nur der unserer deutschen Wälder, zählen unstreitig die Orchideen, wenn auch die bei uns heimischen Arten mit ihren Verwandten in warmen Ländern keinen Wettbewerb eingehen können. Die zaubervolle Farbenpracht und Vielfältigkeit der Blütengestaltung, die tropische Arten so häufig bekunden, erreichen die unsern in keinem Fall. Von fünfzehntausend Orchideen, die den Botanikern bekannt sind, entfallen auf Deutschland fündundvierzig, und nur ein kleiner Teil von diesen hat seine engere Heimat im Wald. »Häufig« ist keine von ihnen zu nennen. Der wahre Pflanzenfreund schätzt sie entsprechend als kostbare Naturdenkmäler, und helles Entzücken belebt seinen Blick, wenn er eine ihm noch unbekannte, besonders seltene Art entdeckt hat, doch reißt er sie nicht aus dem Erdreich heraus. Die Zeit der Herbariumpflanzenleichen, an denen nichts von alledem, was die Pflanzen im Leben anziehend machte, mit Augen und Lupe erspürbar ist, liegt glücklicherweise hinter uns. Nur die noch atmende Pflanze fesselt, denn sie nur lehrt uns das Geheimnis ihres Werdens und Wachsens kennen und die Beziehungen zu ihrer Umwelt. Und deshalb läßt der Pflanzenfreund mit fühlendem Herzen in der Brust sie an ihrem Standort weiterblühen, nachdem er sie sorgsam ausgehorcht hat, damit auch andere Blumenfreunde sich noch an ihr erfreuen können.
Die Orchideen wachsen langsam. Das Keimpflänzchen, aus einem Samen entsprossen, verbringt seine erste Lebenszeit im Dunkel unter der Bodendecke. Es bezieht seine Nahrung mittelbar, mit Hilfe winziger Fadenpilze, aus Moder und Mulm seiner nächsten Umgebung, taucht erst spät zum Lichte empor und muß dann noch bis zu acht Jahren warten, bis es zum erstenmal blühen darf. Als Überwinterungsorgane dienen den einen Wurzelstöcke und den anderen Arten Knollen, die mannigfaltig gestaltet sein können. Meist zeigen die Knollen Vogeleiform, zuweilen ähneln sie kleinen Händen mit deutlich abgeteilten Fingern, die man im dunklen Mittelalter bald Herrgotts-, bald Teufelshände nannte. Ophelia in Shakespeares »Hamlet«, die Orchideen am Weidengrund sammelt, bezeichnet sie als Totenfinger.
Zwei Arten sind uns bereits bekannt, das Zweiblatt ( Listera ovata) und die bleiche Korallenwurz ( Coralliorrhiza innata). Wir trafen sie im Fichtenwald an (Seite 157). Der Laubwald lehrt uns andere kennen, darunter als meistverbreitete Orchis, die oft auch sumpfige Wiesen schmückt, das Gefleckte Knabenkraut ( Orchis maculata) mit braungefleckten, lanzettlichen Blättern und blaßvioletter Blütenähre, die den mitunter halbmeterlangen, gewöhnlich hohlen Stengel krönt. Unterhalb des Stengels sitzen zwei Knollen, von denen die eine welk und schlaff, die andre dagegen straff und voll ist. Die erste ist die Mutterknolle, die alle zur Bildung der Blätter und Blüten benötigten Stoffe liefern mußte und nach der Fruchtreife ausgesaugt und völlig erschöpft zugrunde geht. Die andere ist die Tochterknolle, aus der nach der Überwinterung im Frühjahr eine neue Orchis entsteht. Ihre seltsame Handform (Johannishand) hat von jeher in Sage und Aberglauben eine beträchtliche Rolle gespielt.
Weit zahlreicher sind bei uns in Deutschland die Arten mit ungeteilten Wurzelknollen, zu denen die herrliche Purpurorchis ( Orchis purpurea) gehört, von deren Stattlichkeit unser schönes Tafelbild eine deutliche Vorstellung gibt. An der dichten, sehr großen Blütenähre neigen sich fünf Blütenhüllblätter zu einem kleinen Helm zusammen, der außen rosa, purpurn gefleckt ist und innen die gleiche prachtvolle Fleckung auf grünlichweißem Grunde zeigt. Das sechste Hüllblatt, die gespornte, besonders große und breite Lippe, ist lichtviolett, fast weißlich getönt und gleichfalls durch rote Flecke und Punkte in hübscher Anordnung aufgeschmückt. Äußerst verwickelt ist der Vorgang der Blütenbefruchtung bei dieser Orchis, der sich nach Klein in folgender Weise abspielt. Die Blüte enthält nur ein einziges Staubgefäß mit zwei aufrechten Staubbeutelfächern, das dem in der Blütenmitte stehenden sogenannten Befruchtungssäulchen angewachsen ist, an dem sich außerdem als klebriges Grübchen die Narbe befindet. Die Pollenmassen der Staubbeutelfächer sind in zahlreichen Päckchen miteinander verklebt, und jedes dieser Päckchen besitzt wieder eine besondere Klebdrüse. Der Sporn sondert keinen Nektar aus, enthält jedoch in seinem Gewebe einen verlockenden süßen Saft, den die Insekten, Bienen und Hummeln, nur dadurch zu erlangen vermögen, daß sie die innere Spornwand mit ihrem Rüssel anbohren. Zu diesem Zweck müssen sie den Kopf so fest in die Höhlung des Helmes zwängen, daß das Staubbeutelchen zerreißt und die dabei freigewordenen Klebdrüsen mit den Pollenmassen am Kopfe des Eindringlings haftenbleiben. Zieht der Bestäuber den Kopf dann zurück, so reißt er mit den an der Luft schnell erhärtenden Klebdrüsen gewaltsam auch die ganzen keulenförmigen Pollenmassen aus den geöffneten Staubbeutelhälften heraus, und diese Keulen werden beim Besuch einer anderen Blüte gerade an die klebrige Narbe gedrückt, die unterhalb des Staubbeutelchens am Eingang zum Sporn ihren Platz hat. Teilweise bleiben sie auf der Narbe haften, wenn das Insekt die Blüte verläßt. Bei ihrem zweiten Blütenbesuch aber beklebt sich die Biene wieder mit neuen Blütenkeulen, »und der Eifer, mit dem immer andere Blüten aufgesucht werden, obwohl die Pollenmassen oft unmittelbar auf die Augen geklebt sind, zeigt deutlich, daß mit diesen Verrichtungen kein nennenswertes Unbehagen verbunden sein kann«. Auf diese Weise gelangen stets außerordentlich zahlreiche Pollenkörner auf die gleiche Narbe, und das ist auch nötig. Der Fruchtknoten enthält nämlich ungewöhnlich viele Samenanlagen, die nur auf diese Weise sämtlich befruchtet werden können. Die Frucht ist eine aufspringende, oben geschlossen bleibende Kapsel, aus der die Samen herausgeweht werden. Die im Mai oder Juni blühende Purpurorchis siedelt sich besonders gern in Bergwäldern an.
Ungeteilte Knollen hat auch die maiglöckchenähnlich duftende Zweiblättrige Kuckucksblume ( Platanthera bifolia), die an lichten Waldstellen und auf Waldwiesen in der zweiten Maihälfte und im Juni ihren weißen oder gelblichweißen Blütenstand entfaltet. In der Einrichtung stimmen die Einzelblüten weitgehend mit der der Purpurorchis überein, in ihrer äußeren Gestalt aber weichen sie um so stärker ab. Die Lippe ist in einen sehr langen fadenförmigen Sporn ausgezogen, der reich mit Honig angefüllt ist, die seitlichen äußeren Blumenblätter sind abstehend, und nur die drei oberen fügen sich zum Helm zusammen. Die Bestäuber sind langrüsselige Nachtschmetterlinge, die der Maiblumenduft aus weiter Entfernung herbeilockt und denen sich die Pollenmassen beim Saugen an den Seiten der Rüsselwurzel anheften. Keine Knolle finden wir dagegen beim Waldvögelein ( Cephalanthera grandiflora), das außer in Norddeutschland überall zerstreut in schattigen Laubwäldern vorkommt und aufrechte, festgeschlossene gelbliche Blüten zur Schau trägt, die nicht in Ähren beisammenstehen. Am Stengelgrunde sitzen zwei länglich-eiförmige Scheidenblätter, weiter oben schmälere Laubblätter.
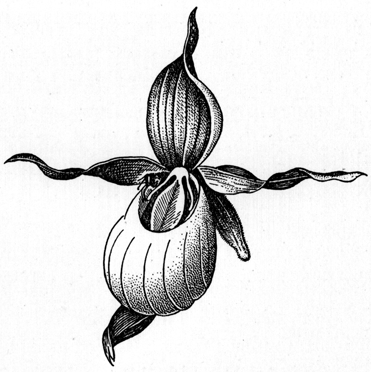
Blüte der Frauenschuh-Orchidee.
Hinter der Befruchtungssäule eine herausschlüpfende Sandbiene oder Andrene.
Dürfen wir die Purpurorchis als die schönste deutsche Art bezeichnen, so ist der vor allem in Buchenwäldern der Bergregion anzutreffende Frauenschuh ( Cypripedilum calceolus) bei aller Schönheit zugleich die unbedingt auffallendste. Denken wir uns zu dem Tafelbild dieser Orchidee noch die natürlichen Farben hinzu, das heißt die pantoffelförmige, mächtig aufgeblasene Unterlippe außenseits lebhaft gelb bemalt und innen prächtig rot punktiert, die vier sternförmig ausstrahlenden, ungleich breiten, aber gleich langen Blütenblätter dagegen angenehm purpurbraun, so müssen wir zugeben, daß die Natur bei dieser Blume ein ausgezeichnetes Farbengefühl offenbart hat. Gleich groß aber war auch in diesem Falle wieder die Erfindungsgabe, die sie bei der Inneneinrichtung der Blüten zur Sicherung der Bestäubung bewies. Wo sich in Blüten Flecke, Punkte, Streifen oder Bänder finden, die lebhaft abstechen von der Grundfarbe, haben sie oft die besondere Aufgabe, Wegweiser für die Insekten zu sein. Vielleicht sollen auch beim Frauenschuh die roten Punkte im Innern der Lippe die Insekten aufmerksam machen, daß hier eine leckere Speise winkt, zumal ihnen diese Süßigkeit auf eigene Art geboten wird: durch saftreiche »Haare«, aus deren Zellen kleine Nektartröpfchen fließen. Jedenfalls wird diese Orchidee von zahlreichen Bienen aufgesucht, und zwar von solchen aus der Gattung der zierlichen Sandbienen oder Andrenen, die alle das Bestreben haben, in die Lippenhöhlung zu schlüpfen und sich an den Safthaaren gütlich zu tun. Drei Wege stehen dazu offen, zwei kleine Löcher im Hintergrunde beiderseits der Befruchtungssäule (wir kennen sie schon von der Purpurorchis) oder die etwas größere Öffnung, die unmittelbar vor dieser liegt. Sie wählen diesen bequemen Zugang und schlüpfen unterhalb der Narbe auf den Boden der Lippe hinab. Nachdem sie sich aber gesättigt haben, bemerken sie, daß sie gefangen sind, zum mindesten jetzt den Zugangsweg nicht wieder als Ausgang benutzen können. Der Rand der großen mittleren Öffnung ist nach innen übergebogen und außerdem ist die Wand so glatt, daß ihr Erklimmen unmöglich ist. Es bleibt ihnen deshalb nach vielen Versuchen keine andere Rettung übrig, als einen der kleinen seitlichen Ausgänge hinter der Säule aufzusuchen und sich mit Mühe hindurchzuzwängen. Wären sie nicht so klein von Gestalt, so kämen sie in dem Gefängnis um, was größeren Bienen oder Fliegen in der Tat nicht selten geschieht. Mit diesem Durchzwängen ist der Pflanze aber auch allein gedient, denn dabei streifen die Andrenen mit ihrer Schulter den klebrigen Pollen eines der beiden Staubbeutel ab, die jederseits der Befruchtungssäule den Rand der Ausgangsöffnung bilden. Bei einer andern Frauenschuhblüte heften sie danach unwillkürlich den Pollen der rauhen Narbe an, an der sie ihr Weg in die Höhlung vorbeiführt. Leider ist die Zahl der Standorte dieser Wunderorchidee durch unverständige Waldbesucher schon derart stark vermindert worden, daß schärfste Aufsicht nötig ist, um die Pflanze vorm Untergang zu bewahren. Aufgabe aller Waldfreunde ist es, durch Aufklärung wirksam mitzuhelfen, damit uns die Pflanze nach Roßmäßlers Wort »unter dem Schutz des Wissens aller« in unsern Wäldern erhalten bleibt.
Noch eine seltsame Orchidee ist in den Buchenwäldern zu Hause, eine, die von den besprochenen Arten so wesentlich verschieden ist, daß das Auge sie schon von weitem erkennt, die Vogelnestwurz ( Neottia nidus avis), die ein Tafelbild uns vorführt. Den Namen verdankt sie der kurzen Grundachse, deren zahlreiche dicke, fleischige Wurzeln so miteinander verflochten sind, daß phantasiebegabte Beschauer sie einem Vogelnest ähnlich finden. Das Merkwürdigste an dieser Orchidee ist aber keineswegs dieses »Nest«, sondern die Eigentümlichkeit, daß die Pflanze fast gar kein Blattgrün besitzt und deshalb außerstande ist, zum Aufbau der oberirdischen Teile die Kohlensäure der Luft zu verwenden. Sie muß sich ihren Nahrungsbedarf auf eine andere Art verschaffen, und das besorgt sie in gleicher Weise, wie grünbeblätterte Orchideen es nur in der ersten Lebenszeit tun: sie lebt mit Hilfe von Fadenpilzen, die in ihren Wurzelzellen hausen, beständig von toten organischen Stoffen, die reichlich im Waldboden vorrätig sind. Die Pilze wandeln die Stoffe so um, daß die Nestwurz sie nur zu verdauen braucht. Sie ist ein echter Fäulnisbewohner, ein »Saprophyt«, wie die Fachsprache sagt. Was sich aus dem »Vogelnest« unter der Erde im Mai oder Juni zum Lichte emporringt, ist ein fleischiger, fahlbrauner Stengel mit scheibenförmigen Schuppenblättern, ohne eine Spur von Grün, und einer ähnlich blaßgefärbten langen und dichten Blütentraube, deren Honigduft zahlreiche Fliegen herbeizieht. Sie sind die Bestäuber der Vogelnestwurz.
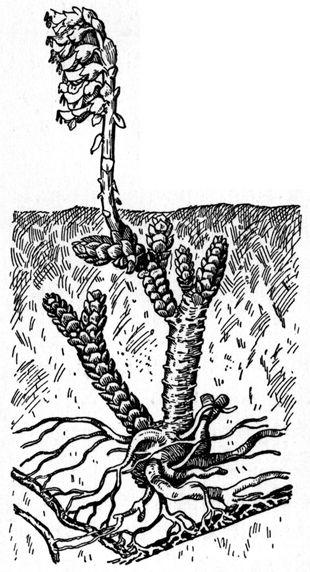
Schuppenwurz
Noch blasser und fahler als die Nestwurz ist die an feuchten Orten im Laubwald, besonders in Waldschluchten oder Mulden aufzufindende Schuppenwurz ( Lathraea squamaria), die außer der [oben]stehenden Zeichnung auch unsere Tafel 63 vorführt. Der größte Teil dieses Sonderlings, der reichverzweigte, über und über mit bleichen Schuppen bedeckte Stamm, lebt dauernd unter der Erdoberfläche und reicht oft metertief hinab. Einzig der fleischige Blütentrieb, der meist leicht rötlich angehaucht ist, doch auch keine grünen Blätter trägt, erhebt sich im Frühjahr über den Boden, um seine stattlichen Rachenblüten von roter Färbung zu entfalten, die insgesamt eine einseitswendige überhängende Traube bilden. Die Schuppen des mächtigen Wurzelstocks, nach denen die Pflanze den Namen trägt, schließen je einen Hohlraum ein, der innen mit kleinen Drüsen bedeckt ist. Früher hat man diese Drüsen als Tierfangwerkzeuge angesehen, zumal in den Hohlräumen gar nicht selten tote Tierchen gefunden wurden. Heute wissen wir, daß die Drüsen Wasserabscheidungsorgane sind, durch die der Nahrungsstrom in der Pflanze ständig in Fluß gehalten wird, denn die Verdunstung ist in der Erde natürlich stark herabgesetzt. Die Schuppenwurz braucht keine Tiere zu fangen für ihren Lebensunterhalt, und ebensowenig bedarf sie der Hilfe winziger Faden- und Wurzelpilze. Sie ist auch keine Orchidee. Sie hat sich, nachdem sie mangels Blattgrüns assimilierunfähig geworden, andere Hilfsmittel zugelegt, um zu ihrer täglichen Nahrung zu kommen. Sie sank zur Schmarotzerpflanze herab. Vom unteren knolligen Ende des Stammes sendet sie in riesiger Zahl immer dünner werdende Wurzeln aus, die an ihrer Spitze Saugwarzen tragen, wurmähnlich durch das Erdreich kriechen und in der Finsternis Holzpflanzenwurzeln, am liebsten solche der Hasel, suchen. In deren Gewebe dringen sie ein und saugen die fertige Nahrung heraus. Die Rachenblüten der Schuppenwurz, aus Ober- und Unterlippe bestehend, erscheinen oft schon zeitig im Frühjahr, gegen Ende März oder Anfang April, und werden gewöhnlich von Hummeln befruchtet. Bleiben jedoch die Besucher aus, so kann vor dem Abschluß der Blütezeit die Befruchtung auch durch den Wind erfolgen, der außerdem später die Samen verstreut. Ist das geschehen, so zieht sich die Pflanze wieder ganz in den Boden zurück.
Wenn die Bäume ihr Laubdach geschlossen haben und kühler Schatten den Hochwald erfüllt, läßt der Blütenreichtum ersichtlich nach, und wenn der Tag der Sonnenwende den langsamen Abstieg des Jahres kündet, ist schon aus weiten Gebieten des Waldes das bunte Pflanzenleben verscheucht. Ganz ohne Blumen jedoch ist er nicht. Im Randbezirk und an lichten Stellen, wo der geschlossene Buchenwald durch eingesprengte andere Holzarten eine Unterbrechung erfuhr oder wo sonst eine Lücke ist, die dem Sonnenlicht Durchlaß zum Boden gewährt, besonders auch an feuchten Waldstellen, gibt es noch blühende Pflanzen genug, die ganz und gar nicht daran denken, bereits vom Schauplatz abzutreten.
In großer Menge finden wir dort den Geißfuß oder Giersch versammelt ( Aegopodium podagraria), den seine weißen Blütendolden, von Käfern, Fliegen und Bienen umschwärmt, bereits von weitem kenntlich machen, und auf der gleichen feuchten Waldlücke können wir in nicht seltenen Fällen auch dem Kräutlein Rührmichnichtan, dem Springkraut ( Impatiens noli tangere) einen kurzen Besuch abstatten. Es ist ein ansehnliches Gewächs mit oben stark verzweigtem Stengel, großen wachsausscheidenden und dadurch bereift erscheinenden Blättern und goldgelben, in ihrer äußeren Form an kleine Trompeten erinnernden Blüten mit einem am verengten Ende nach unten eingekrümmten Sporn. Besonders auffallend werden sie dadurch, daß sie nicht aufrecht am Zweige stehen, sondern an langen schwankenden Stielen unter den Blättern nach unten hängen. Im Sporn wird Honig abgeschieden, und wenn eine Hummel, um ihn zu erlangen, sich an eine goldene Blüte hängt, so wird sie kräftig herumgeschaukelt, was aber nicht hindert, daß sie die Staubbeutel, die über ihr in der Blüte hängen und wie eine Mütze die Narbe umschließen, mit ihrer Rückenseite berührt. Bald nach dem Verstäuben ihres Pollens reißen die Staubfäden unten ab und geben dadurch die Narbe frei. Kriecht nunmehr eine andere Hummel, gleichfalls schon mit Pollen am Rücken, in dieselbe Blüte hinein, so wird die Narbe unfehlbar bestäubt. Die fünfklappigen, schotenähnlichen Früchte springen, wenn sie ausgereift sind, schon bei leiser Berührung auf. Die Klappen rollen sich blitzschnell ein, und die sehr zahlreichen schwärzlichen Samen werden dabei weit fortgeschleudert. Ein Gleiches geschieht, wenn die Springkrautpflanze von einem Windhauch geschüttelt wird.
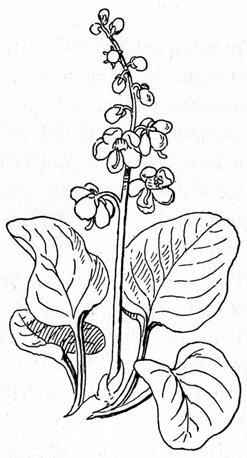
Großblättriges Wintergrün

Rührmichnichtan
Ein Schleuderer ist auch der Waldstorchschnabel ( Geranium silvaticum), den wir jedoch nur im Bergwald treffen, wiederum an einem feuchten Standort, am sichersten an eines Waldbächleins Rand. Sein Steckbrief ist rasch zusammengestellt. Die großen violetten Blüten, immer je zwei zueinandergesellt, stehen auf einem halbmeterhohen, gabelig verzweigten Stengel, der sich aus einer breiten Rosette siebenlappiger Blätter erhebt. Die höher am Stengel sitzenden Blätter sind zu fünf Lappen eingeschnitten, die oberen, kleinsten zu nur drei. Besonderes Merkmal: die Blütenstiele fühlen sich deutlich klebrig an. Die Blüten erscheinen im Juni und Juli, werden viel von Insekten besucht, vor allem von Bienen- und Schwebfliegenarten, und wandeln sich bis zur Hochsommerzeit zu storchschnabelähnlichen Früchten um. Auch sie sind fünfklappig wie beim Springkraut, doch stehen sie aufgerichtet im Kelch. Zur Zeit der Reife springen die Fruchtklappen plötzlich explosionsartig auf, rollen sich nach außen ein und schleudern die Samen nach allen Seiten bis zu zweieinhalb Meter weit fort. Eine Spannung der austrocknenden Gewebe löst die Entladung der Früchte aus.

Gelber Fingerhut
Auch Fingerhüte, gelbe und rote ( Digitalis lutea und purpurea), begrüßen uns im Berglaubwald oft massenhaft an lichten Stellen, am Wegrande oder am Waldwiesensaum, leider nicht überall in Deutschland, am häufigsten im Südwesten und Süden. Ist uns Entdeckerglück beschieden, so finden wir um die Wende zum Juli gleich auch den blühenden Türkenbund ( Lilium martagon), der in der heimatlichen Flora eine der schönsten Pflanzen ist. Er kommt auch in Mitteldeutschland vor, hat aber um seiner Schönheit willen derart durch Verfolgung gelitten, daß er schon vielerorts selten ist und deshalb behördlichen Schutz genießt. Seine rosa gefärbten und dunkler punktierten, großen hängenden Turbanblüten, nach denen er seinen Namen erhielt, entfalten sich nicht zu gleicher Zeit, sondern immer im Abstand von ein bis zwei Tagen und welken nach kurzer Blühzeit dahin. Bei Tage entströmt ihnen nur ein schwacher, zur Nachtzeit ein stärkerer süßer Duft, durch den die Bestäuber, Nachtschmetterlinge aus der Familie der Schwärmer (wir kennen sie schon vom Geißblatt her), zum Honigschlecken geladen werden. Jedes der sechs zurückgerollten rosafarbigen Blumenblätter, aus deren Kreis die langen Staubfäden und der Griffel nach unten ragen, weist eine geschlossene Rinne auf mit millimeterweiter Öffnung, die verlockenden Nektar enthält. In diese Rinne führen die Falter ihren langen Saugrüssel ein, bepudern sich dabei am Bauche mit Pollen und streifen diesen bei anderen Blüten an der Narbe wieder ab. Als Hauptbestäuber der Türkenbundlilie wurde der Taubenschwanz ( Macroglossum stellaria) festgestellt, ein nur mittelgroßer Falter, der gegen sonstigen Schwärmerbrauch auch bei hellem Sonnenlicht fliegt. Er hält sich freischwebend vor der Blüte und saugt dabei nach Kolibriart gleich sämtliche Nektarrinnen leer. Im Herbst stehen an Stelle der Türkenbundblüten steil aufwärtsgerichtete Kapselfrüchte.
Um dieselbe Zeit wie der Türkenbund blüht in den Wäldern der Mittelgebirge, und zwar an besonders lichten Plätzen, die ziemlich häufige Akelei ( Aquileja vulgaris), deren seltsam gestaltete nickende Blüten näher betrachtet zu werden verdienen. Mit großen blauvioletten Kelchblättern wechseln ebenso gefärbte echte Blumenblätter ab, die je einen kleinen Trichter bilden, dessen Öffnung nach unten gerichtet ist und zahlreiche Staubfäden sehen läßt, während er nach oben hin in einen gekrümmten Sporn verläuft, in dem die Akelei Honig verbirgt. Nur Hummeln mit einem langen Saugrüssel können aus diesem Honigvorrat auf ordnungsmäßigem Wege schöpfen, die anderen bohren den Sporn an und laben sich ohne Gegendienst.

Die Akelei
Auch die stattlich hohe giftige Tollkirsche ( Atropa belladonna) wächst an lichten Bergwaldstellen und ist meist unter den ersten Pflanzen, die frische Waldschläge wieder besiedeln. Im Juni und Juli steht sie in Blüte und ist dann an ihren braunroten Glocken mit nach unten gerichteter Öffnung ebenso sicher und leicht zu erkennen wie später an ihren kirschenähnlichen glänzend schwarzen Beerenfrüchten. Der wohlklingende lateinische Name geht einerseits auf Atropos, die schlimme Unheilparze, zurück und spielt auf die Gifthaltigkeit der Pflanze, besonders ihrer Früchte an. Der Genuß der Beeren kann bei Kindern sogar den Tod zur Folge haben, während Waldvögel, besonders Drosseln, sie ohne jeden Nachteil verdauen. Den zweiten Teil ihres botanischen Namens, bella donna – schöne Dame, verliehen die Italienerinnen dem sonst so gefürchteten Gewächs. Sie schminkten sich in früheren Zeiten mit dem violetten Saft, der aus den Beeren herausgepreßt wurde, gleichzeitig Jugend und Schönheit an.

Tollkirsche
Erwähnen wir noch die Weiße Pestwurz ( Petasites albus) und die Waldengelwurz oder Brustwurz ( Angelica silvestris), die beide sehr feuchte Standorte lieben und deshalb vor allem im Auenwald mit Sicherheit anzutreffen sind, so haben wir die bemerkenswertesten, augenfälligsten Blütenpflanzen des Buchenwaldes aufgezählt. Pestwurz und Engelwurz sind nach den Wiedergaben auf unseren Tafelbildern unschwer im Freien festzustellen.
Es gibt jedoch neben den Blütenpflanzen auch blütenlose im Buchenwald, Gewächse, die sich statt durch Samen im wesentlichen durch Sporen vermehren. Dazu gehören außer den Pilzen, Moosen, Farnen und Bärlappgewächsen, von denen in einem früheren Abschnitt ausführlicher erzählt worden ist, die sonderbaren Schachtelhalme ( Equisetinae). Ihre Glanzzeit war das Erdaltertum, genauer die große Erdepoche, da die gewaltigen Wälder grünten, deren Reste wir jetzt als Kohlen verfeuern. Am Aufbau dieser Steinkohlenwälder waren sie neben Farn und Bärlapp damals die Hauptbeteiligten. Was heute vom Schachtelhalmgeschlecht in unseren Waldungen übrig ist, sind im Vergleich zu den riesigen Ahnen unbedeutende, klägliche Zwerge, die aber wie alles ehrwürdig Alte für uns »Naturdenkmäler« bedeuten, wenn sie auch ihrer Häufigkeit und mangelnden Schönheitsreize wegen zum Glück nicht schutzbedürftig sind.
Der stattlichste Buchenwaldvertreter ist der in schattigen, quelligen Waldschluchten, in der Ebene wie im Gebirge, herdenweis wachsende Große Schachtelhalm ( Equisetum maximum), dessen Wurzelstock tief im Erdboden kriecht und im zeitigen Frühjahr, meist Anfang April, bis dreißig Zentimeter hohe unverzweigte Sprosse treibt. Sie bestehen aus leicht zu trennenden Gliedern, von denen jedes das über ihm liegende mit einer am Rande in Zähnchen zerschlitzten braunen Blattscheide überdeckt. Das obere Ende dieser Sprosse krönt eine bis sechs Zentimeter lange, gestreckt eiförmige Sporenähre. Sobald in dieser die Sporen gereift und weithin vom Winde ausgestreut sind, sterben die fruchtbaren Sprosse ab und es erscheinen unfruchtbare, die sich rasch wirtelig verzweigen, oft mehr als Meterhöhe erreichen und dann kleinen Tannenbäumchen ähneln. Wenn sie zur Sommerszeit dichtgeschart eine größere Waldstelle überziehen, gewähren sie einen entzückenden Anblick. Im Gegensatz zu den Frühjahrssprossen, die lediglich der Vermehrung dienen und höchstens Spuren von Blattgrün besitzen, sind die hohen Sommertriebe aufs reichste damit ausgestattet und dank diesem Reichtum dazu befähigt, dem unterirdischen Wurzelstock neue Vorratsstoffe zuzuführen. Die Triebe für das nächste Jahr werden schon zur Herbstzeit angelegt, weshalb sie auch im ersten Lenz erstaunlich schnell in die Höhe schießen.
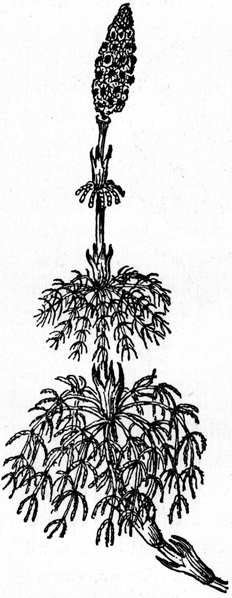
Waldschachtelhalm
Der kleinere, zartere Waldschachtelhalm ( Equisetum silvaticum), der ebenfalls feuchte Standorte braucht, unterscheidet sich dadurch von seinem Verwandten, daß seine quirligen Seitenäste sich nochmals wirtelig verzweigen, was seine Bäumchen noch zierlicher macht. Auch er bringt zweierlei Sprosse hervor, die gleichzeitig nebeneinander erscheinen, doch haben die ährentragenden Triebe von anfangs blattgrünlos bleichem Aussehen bei dieser Art die Fähigkeit, nach Aussaat ihres Sporenvorrats gleich den Laubsprossen zu ergrünen und Seitenäste auszusenden.
Von den Farnen beherbergt der Buchenwald mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit eine ganze Anzahl schöner Arten, die ihm nicht minder zur Zier gereichen als seine farbenfrohen Blumen. Da wächst der herrliche Adlerfarn, uns schon vom Nadelwald her bekannt, in Deutschland, der häufigste seiner Klasse. Da rollt im April der derbe Wurmfarn ( Nephrodium filix mas) die an einen Bischofsstab erinnernden filzigen jungen Wedel auf, die später, im vollentfalteten Zustand meterhohe Trichter bilden. Dem Wurmfarn ähnlich in seinem Wuchs, doch weichlaubiger und viel zarter gebaut, auch wesentlich heller grün als jener ist der Weibliche Streifenfarn ( Athyrium filix femina), in dessen Namen der Zusatz »weiblich« lediglich auf seine Anmut zielt, und zwar im Vergleich mit dem kräftigen Wurmfarn. In alten, vergilbten Kräuterbüchern wird dieser schlechthin das »Farnmännlein« und der ihm ähnelnde Streifenfarn entsprechend das »Farnweiblein« genannt. Im Unterschied zu diesen drei Arten, bei denen die Wedel Trichter bilden, breiten sich die des Buchenfarns ( Nephrodium phegopteris) waagerecht über dem Fallaub aus, sitzen an langen gelben Stielen, sind mit zartem Flaum bedeckt und zeigen im Umriß die Form eines Dreiecks, dessen Basis kürzer ist als die Schenkel. Verwandt mit ihm ist der Eichenfarn ( Nephrodium dryopteris) mit kahlem, breiter dreieckigem Laub, das gleichfalls keine Trichter formt. Im Buchenwald grünt er trotz seines Namens nicht seltener als im Eichenwald. Ganz aus der Rolle fällt die Hirschzunge ( Scolopendrium vulgare), die einfache, ungefiederte Blätter von auffallend derber Beschaffenheit und wechselnder Gestaltung trägt. Sie kommt im Flachlande seltener vor als in den Wäldern der Bergregion, wo sie sich als Freundin dunkler Standorte vielfach an Felsen, in hohlen Bäumen und ähnlich schattigen Orten findet.
Der schönste Schmuck im deutschen Haine,
Die Eiche ist's, wer stimmt nicht bei?
Daß Deutschland doch in allem andern
So wie in diesem einig sei!
An der gesamten Waldfläche Deutschlands beträgt der Anteil unserer Eichen in runder Zahl nur acht vom Hundert, doch war das nicht von jeher so. Wir wissen aus einem früheren Abschnitt, in dem aus der Chronik der deutschen Wälder die wichtigsten Tatsachen mitgeteilt wurden, daß im Verlaufe der Nacheiszeit die Eiche zum herrschenden Waldbaum gedieh. Diese Herrschaft hat sie viele Jahrhunderte, wenn auch nicht überall in Deutschland, so doch auf bedeutenden Gebieten unbestritten ausgeübt. Im Osten hatten die Nadelhölzer wahrscheinlich bei Beginn unserer Zeitrechnung schon das Übergewicht erlangt und ebenso im Bayerischen Wald, im Schwarzwald, im Harz und im Thüringer Wald. In Süd- und Mitteldeutschland dagegen wahrte die Eiche ihr Herrscherrecht, bis sie zuletzt doch dem doppelten Ansturm von Fichte und Buche weichen mußte, zumal der Mensch als dritter im Bunde ihr in den Rodungszeiten des Mittelalters ebenfalls zu Leibe ging.
Der Eichenhochwald stellte früher so wenig wie heute ein geschlossenes, unbezwingbares Ganzes dar, wie es beim Buchenwald etwa der Fall ist. Die Kronen der Eichen sind nicht so beschaffen, daß sie mit denen ihrer Nachbarn ein einheitliches Laubdach bilden. Einmal sind ihre Äste so kräftig, wie sie kein anderer Baum besitzt, und zweitens gehen sie zwar gewöhnlich waagerecht vom Stamme ab, behalten aber diese Richtung nur eine kurze Strecke bei, um danach eckig abzubiegen und ziemlich regellos weiterzuwachsen.

Tafel 60
Insektenleben im Walde
Linke Seite des Bildes von oben nach unten: Glotzauge (
Satyrus dryas), Zipfelfalter (
Callophrys rubi), Blattkäfer (
Melasoma lapponica) und Schillerfalter (
Apatura iris).
In der Mitte des Bildes von oben nach unten: Bläuling (
Lycaena cyllarus), Eisvogel (
Limenitis populi), Trauermantel (
Vanessa antiopa), Lilienhähnchen-Käfer (
Crioceris lilii), Dukatenfalter (
Chrysophanus virgaureae), Gekörnter Laufkäfer (
Carabus granulatus).
Rechte Seite des Bildes von oben nach unten: Feuerfalter (
Chrysophanus phlaeas), Pflasterkäfer (
Lytta vesicatoria), Waldargus (
Pararge egeria), Pappelblattkäfer (
Melasoma populi), Waldmistkäfer (
Geotrupes silvaticus), rechts davon Dungkäfer (
Bolboceras), Netzfalter (
Araschnia prorsa).
Es drängt sich förmlich der Eindruck auf, als lege die Eiche es darauf an, sich Ellbogenfreiheit zu verschaffen: bleibt mir vom Leibe, ich weiß noch nicht, wieviel Raum ich später beanspruchen muß. Und diese Unregelmäßigkeit im Wuchs der breit ausgreifenden Krone verleiht zwar der Eiche das knorrige Aussehen, das kraftvoll Männliche der Erscheinung, bedingt indessen im Kronendach zahlreiche große und kleinere Lücken, unter denen neben dem eigenen Nachwuchs auch der von artfremden Bäumen aufkommt, vor allem der von Fichten und Buchen. Da aber die Eiche nur langsam wächst und ihr Jungwuchs sehr viel Licht verlangt, weit mehr als der ihrer Mitbewerber, so wird sie von diesen in vielen Fällen unbarmherzig unterdrückt und um ihr Lebensglück geprellt. Geht dieses Unheil Jahrhunderte fort, weil den Jungeichen keine Hilfe zuteil wird, so steht schließlich statt des Eichenwaldes ein Buchen- oder Fichtenwald da. So ist es gekommen, daß Deutschlands Waldkarte im Verlaufe von sechshundert Jahren sich derart gründlich verändert hat, daß das Flächenverhältnis von Nadel- und Laubwald ins Gegenteil verkehrt worden ist.
Je nach der Lage und Bodenart sind unsere deutschen Eichenwälder von ganz verschiedenem Gepräge, anders auf hügeligem Gelände wie überhaupt auf trockenem Grund, als auf den feuchten, oft nassen Böden im Überschwemmungsgebiet der Flüsse. Nur selten ist der Eichenwald rein, von keinen anderen Hölzern durchsetzt. Bald stehen die Eichen in Gesellschaft mit ihrer ärgsten Feindin, der Buche, bald im Gemisch mit Birken und Hainbuchen oder mit noch anderen Bäumen, und schließlich fühlt sich die knorrige Eiche auch in den echten Mischwäldern wohl, vor allem in den Auenwäldern, in denen die allerverschiedensten Waldbäume, oft fast sämtliche heimischen Arten, sich innig gesellt zusammenfinden. Sie darf es, denn ihre Eigenart, ihre trutzige, urgewaltige Kraft hebt sie auch aus der Masse heraus.
Besonders weit war früher der Eichwald im nordwestlichen Tiefland verbreitet, und auch noch heute sind Hannover, Westfalen, Rheinland und Hessen-Nassau für ihn ein bevorzugtes Lebensgebiet. Ein günstiges Schicksal hat es gefügt, daß uns an drei verschiedenen Orten Reste der alten Eichenwälder von urwaldartigem Charakter bis heute erhalten geblieben sind, erstens der »Neuenburger Urwald« bei Bockhorn im nördlichen Oldenburg, zweitens der Hasbruch, nicht weit von Bremen auf der Delmenhorster Geest, und drittens der wenig umfangreiche Bentheimer Wald, unfern der Grenze Hollands gelegen, der zahlreiche Alteichen in sich birgt.
Der Neuenburger » Urwald«, ein kleiner, von der Oldenburger Forstverwaltung geschützter Teil des 650 Hektar bedeckenden Neuenburger Holzes, steht auf diluvialem Boden, der als »Geest« bezeichnet wird (vermutlich von »güst«, das heißt unfruchtbar, im Gegensatz zu dem fruchtbaren Marschland). Er ist der Nachfahr eines Eichwalds, der locker und von Birken durchsetzt, bereits im Laufe der jüngeren Steinzeit von viehzuchttreibenden Menschen bewohnt war, denen er als Weideplatz diente. Man hat ihre Siedlungen ganz in der Nähe, bei Woppenkamp, wieder aufgefunden. Mit diesem alten Eichenwald, in dem die primitiven Hütten unserer Steinzeitahnen standen, hat selbstverständlich der heutige Wald nicht mehr das allergeringste zu tun. Er hat große Wandlungen durchgemacht, natürliche und erzwungene, und namentlich seit dem Mittelalter ein vollkommen neues Gesicht bekommen. Teils war das die Folge des Raubbaus am Holze, zu dem die Dorfschaften der Umgebung die Steinarmut ihrer Heimat zwang, und andrerseits der Weidewirtschaft, die bis in die neueste Zeit hinein unmäßig im Walde betrieben wurde. Ein »Urwald« ist er nur insofern, als er nicht forstmäßig ausgenutzt, sondern sich selbst überlassen wird, und wenn man ihn schützt, so wesentlich deshalb, weil er als alter »Hudewald« (das Wort hängt mit unserem »hüten« zusammen) kulturgeschichtlich wertvoll ist.
Die Stieleichen oder Sommereichen ( Quercus pedunculata) fallen natürlich als erste ins Auge, ehrwürdig alte Baumgestalten mit mächtigen Kronen und wenig hohen, aber dafür wuchtigen Stämmen von durchschnittlich 5 bis 6 Meter Umfang, teils 600 bis 700 Jahre alt. Häufig sind die Stämme durch Blitzschlag, durch Frost oder Schneebruch schwer verwundet, nicht selten auch kernfaul oder schon hohl. Nicht wenige hat der Sturm gefällt oder das Alter zu Boden geworfen, wo sie nun den Weg alles Toten gehen. Mit diesen Stieleichen vergesellschaftet (Wintereichen kommen nicht vor) sind vor allem Hain- oder Weißbuchen, kenntlich an ihrem gewulsteten Stamm. Sie sehen vielfach gespenstisch aus, weil sie der Kleinholznutzung halber wiederholt geköpft worden sind und danach die verlorene Krone durch Neuausschlag zu ersetzen suchten. Bei Sonnenschein wecken sie die Erinnerung an den Wald des deutschen Märchens, bei einem Gewitter erschienen sie Kerner, der diesem »Urwald« um die Wende zu unserm Jahrhundert einen Besuch abstattete, unheimlich wie die Wolfsschlucht des Freischützen. Auch Rotbuchen sind an manchen Stellen in beträchtlicher Zahl vertreten, vom kleinsten Keimling bis zu Bäumen, deren Stämme bis zwei Meter Durchmesser haben und deren Höhenwuchs den der Eichen in vielen Fällen übertrifft. Als Einsprengsel gibt es Ebereschen und dort, wo der Boden besonders feucht ist, siedelten sich Weiden an, in Randgebieten auch Fichten und Lärchen.

Die Sommereiche oder Stieleiche
1. Blühender Maitrieb.
2. Triebspitze mit Früchten.
3. Stück eines männl. Kätzchens.
4. Staubbeutel.
5. 6. Weibl. Blüte ganz und im Längsschnitt.
7. Trieb mit Knospen.
Die Eichen sind oft mit Efeu ( Hedera helix) bewachsen, der in der dicken, rissigen Borke besonders gute Gelegenheit zur Anheftung seiner Haftwurzeln findet. Oft rankt er sich bis in die Krone empor, verzweigt sich nach allen Seiten hin und bedeckt mit dem Immergrün seines Blattwerks auf weite Strecken Äste und Zweige. Seine Stämme sind manchmal von Schenkeldicke, und wenn er im Alter die Haftwurzeln einbüßt, ähnelt er tropischen Lianen, weil dann seine vielfach verschlungenen Stämme wie Taue frei nach unten hängen. Auch das uns wohlbekannte Geißblatt ist weit und breit im »Urwald« zu Haus.
Den Übergang von der Baum- zur Strauchschicht bildet die in schattigen Buchenwäldern meist strauchartige Gemeine Hülse ( Ilex aquifolium), im Volke mehr als Stechpalme bekannt, deren immergrüne ledrige Blätter wie mit Lack überzogen erscheinen und auch im Sonnenlicht schimmern und gleißen. Im »Urwalde« bildet die Hülse Bäume von 10 bis 13 Meter Höhe mit oft halbmeterstarkem Stamm und pyramidenförmiger Krone. Die Blätter, bei der strauchigen Stechpalme meistens durchweg dornig gezähnt, sind an den höheren Zweigen der Baumform glattrandig, Lorbeerblättern ähnlich, und nur an den unteren Zweigen stechend. Im Mai und Juni blühen die Bäume mit kleinen weißen, wohlriechenden Blüten, an deren Stelle zur Zeit des Herbstes leuchtendrote Steinfrüchte stehen, die etwa die Größe von Erbsen haben und gern von Vögeln gefressen werden. Die sonstige Strauchflora setzt sich zusammen aus Hasel, Weißdorn und Schwarzdorn, Rosen und Brombeeren, ist also auffallend artenarm. Die Krautschicht stimmt im wesentlichen mit der des Buchenwalds überein.
Wie lange der Eichen-Hainbuchen-Wald, wenn er sich selbst überlassen bleibt, noch weiterhin Bestand haben wird, das ist eine Frage, die seine Freunde mit wachsender Besorgnis erfüllt. Hans Nitzschke, dem wir über den Wald eine ausgezeichnete Arbeit verdanken, und zwar aus allerjüngster Zeit, vertritt mit guten Gründen die Ansicht, der »Urwald« laufe Gefahr zu verschwinden, wenn nicht die heutige Art seines Schutzes eine Änderung erfahre. »Eichennachwuchs ist nicht vorhanden, die Buchen aber nehmen zu und stehen heute ebenso wie Eichen und Hainbuchen unter Schutz.« Daß diese Entwicklung, wenn sie sich fortsetzt, das Ende des Eichen-Hainbuchen-Waldes, des alten Hudewaldes bedeutet, dürfte demnach nicht zweifelhaft sein.
Ähnlich beschaffen ist der Hasbruch in seinen noch urwäldlichen Teilen, die unter dem Eintrieb von Rindern, Pferden, Schafen und besonders Schweinen in früheren Jahrhunderten nicht weniger schwer gelitten haben als der Neuenburger Wald. In seinem weitaus größeren Teile ist der Hasbruch jüngerer Forst, doch stehen in diesem an zahlreichen Stellen noch machtvolle, ehrwürdig alte Eichen, Zeugen dafür, daß auch hier vor Zeiten echter Urwald vorhanden war. Überhaupt sind die Eichenbestände im Hasbruch, verglichen mit denen des Bockhorner Waldes, weit großartiger und hoheitsvoller, denn Riesen von 10,5 Meter Stammumfang, wie die berühmte »Amalieneiche«, kommen in keinem Fall vor. Genaue Zählungen der Jahresringe ergaben für einzelne Hasbruchriesen ein Alter von mehr als tausend Jahren, doch sind leider nicht bloß die Waldveteranen, die meistens besondere Namen haben (Friederikeneiche, dicke Eiche usw.), sondern auch die viel jüngeren Bäume in ihrer Mehrzahl kernfaul und morsch. »Überständig« sind sie fast alle.
Nicht anders steht es um die Hainbuchen, die nächst den Eichen den stärksten Anteil am Baumbestand des Hasbruchs haben und hier genau so wunderlich und fratzenhaft gestaltet sind wie die im Neuenburger Wald. Größtenteils sind auch sie überaltert, so daß von ihnen ebensowenig noch Nutzholz zu gewinnen ist, wie von der Mehrzahl der Sommereichen. Vielfach sind Birken eingesprengt, an feuchten Stellen auch Eschen und Erlen. Rotbuchen (meistens angepflanzt) sind verhältnismäßig selten. An Bäumen, Sträuchern und Bodenpflanzen beherbergt der Hasbruch die gleichen Arten wie der Neuenburger Urwald, dem auch in der Zusammensetzung die meisten kleineren Eichenwälder des nordwestdeutschen Tieflandgebiets im großen und ganzen ähnlich sind, obgleich die Eichenkolosse fehlen.
Von anderer Art sind die Eichenwälder, die den Spessart berühmt gemacht haben. Auch ihre Geschichte reicht weit zurück, bis in die Regierungszeit Karls des Großen, der mehrfach in ihnen dem Weidwerk oblag, doch zeigen sie nirgends Urwaldcharakter. Obgleich es bis vor zweihundert Jahren im Spessart so wenig wie sonst in Deutschland eine geregelte Waldwirtschaft gab, sind die Waldungen seiner Höhen von jeher in besserem Zustand gewesen als die im nordwestdeutschen Tieflandsgebiet. Schon während des frühen Mittelalters waren sie kaiserliche Bannwälder, in denen nur Forstangestellte wohnten. Die Ränder waren zwar besiedelt, doch durften die Anwohner aus dem Bannwald nur ihren eigenen Holzbedarf decken, und sicherlich wird auch die Waldweidefreiheit entsprechend eingeschränkt worden sein. Erst seit dem achtzehnten Jahrhundert wurden die Wälder des nördlichen Spessart für holzverbrauchende Gewerbe (Glashütten, Eisenhämmer und Salinen) lange Zeit stark in Anspruch genommen.
Die Eichen im Spessart sind fast ausschließlich Trauben- oder Wintereichen ( Quercus sessiliflora), die an das Klima und den Standort geringere Anforderungen stellen und keines tiefgründigen Bodens bedürfen. Die fünf- bis sechshundertjährigen Eichen, die noch vor etwa acht Jahrzehnten 5000 Hektar Boden bedeckten, sind bis auf kleine Reste verschwunden, vierhundertjährige sind dagegen noch in reicher Zahl vorhanden, auch in geschlossenen Beständen, mit jüngeren Buchen untermischt. Am weitaus stärksten im Spessart vertreten sind dreihundertjährige Traubeneichen, deren Stammdurchmesser 45 bis 70 Zentimeter beträgt. Sie stehen in getrennten Waldteilen auf 300 bis 600 Meter Höhe in geschlossenen Hainen beisammen und sind mit ihren schlanken Schäften und ihrem ebenmäßigen Wuchs mit Recht der Stolz der Spessartbewohner und das Entzücken aller Fremden. Ihre Schönheit beruht zum größten Teil auf der Rassenreinheit der Spessarteichen, zu deren Verjüngung ausnahmslos einheimische Saat verwandt worden ist.

Die Trauben- oder Wintereiche
1. Blühender Trieb. In den obersten Blattwinkeln die kleinen sitzenden weibl. Blüten.
2. Triebspitze mit ausgebildeten Blättern und Früchten.
3. Weibliche Blüte, vergrößert.
4. Teil eines männlichen Blütenkätzchens, vergrößert.
In West- und Süddeutschland sind die Eichen vielfach in einer Waldform verbreitet, die Niederwald oder Ausschlagswald heißt, weil die sie bildenden niederen Bäume in regelmäßigen Zeitabständen (in »Umtriebszeiten«) abgehauen und durch die den Stöcken entsprießenden Ausschläge oder »Loden« wieder ersetzt werden. Vor allem im Rheingau, im Moseltal, im Saargebiet und im Odenwald sind Eichenniederwälder häufig, doch finden sie sich in kleinerem Umfang und von geringerem Nutzungswert auch hier und da im übrigen Deutschland. Ihr Zweck ist die Gewinnung des Gerbstoffs, den die Eichenrinde enthält und den am besten die jungen Stämme mit noch nicht borkiger Rinde liefern. Alle 15 bis 20 Jahre werden sie zur Frühlingszeit, wenn sie im Saft stehen, abgeschält, und die Lohe gelangt in die Gerbereien. Seit langem ist der Schälwaldbetrieb jedoch im Niedergang begriffen, weil unsere deutschen Eichenarten, was ihren Gerbstoffgehalt betrifft, mit Auslandshölzern nicht wetteifern können und weil auch der chemischen Industrie in wachsendem Maße die Erzeugung guten, brauchbaren Gerbstoffs gelang. Um 1900 waren in Deutschland noch eine halbe Million Hektar mit nutzbaren Eichenschälwäldern bedeckt.
Eine abermals andere Eichenwaldform tritt uns in den Eichenkratts entgegen, deren Heimat Schleswig-Holstein ist. Es sind Bestände von Krüppelwuchs, fast schmerzlich anzusehende Zerrbilder unseres mächtigsten deutschen Waldbaums, die ihre Entstehung teils Menschenhänden und andernteils dem Klima verdanken, in dem sie zu leben gezwungen sind. Vorwiegend stehen sie in der Heide, doch nicht auf der flachen sandigen Ebene, sondern, nach Emeis, immer dort, wo flache Kuppen oder Erhöhungen in Form von langgestreckten Rücken sich aus der Heidelandschaft erheben. Vereinzelt finden sich Eichenkratts auch abseits der eigentlichen Heide, wie denn überhaupt das zerstreute Auftreten dieser sonderbaren Gehölze sehr bezeichnend für sie ist. Zweifellos sind sie Überreste einst ausgedehnter geschlossener Wälder. Im ganzen zählt man rund fünfzig Kratts, die insgesamt eine Bodenfläche von weit über dreihundert Hektar bedecken.
Infolge ihrer erhöhten Standorte sind sie den Seestürmen ausgesetzt, die von Westen her aus vollen Backen über die offene Landschaft blasen, und dieser dauernde Kampf mit dem Wind hat die Eichen in ihrer Überzahl zu häßlichen Krüppeln werden lassen. Hinzu kommt, daß die Krattgehölze in ähnlicher Weise ausgenutzt werden wie die geschilderten Niederwälder im westlichen und südlichen Deutschland, nur nicht zur Gerberlohegewinnung, sondern zur Gewinnung von Holz, das entweder zu Deich- oder Dünenbauten oder als Brennholz Verwendung findet. Hier wie dort wird der Eichenbestand in regelmäßigen Zeitabständen bis auf die Stümpfe abgeschlagen, doch wachsen die Ausschläge in den Kratts nicht wie in geschlossenen Niederwäldern durchweg zu aufrechten Stämmen heran, sondern sie kriechen zum Schutz vor den Stürmen großenteils auf dem Boden dahin. Mehr als etwa fünf Meter Höhe erreicht keine Eiche in den Kratts, auch nicht an günstig gelegenen Orten, die Mehrzahl aber bleibt weit darunter. Gewöhnlich sind überdies die Stämme durch Windbeeinflussung krumm gewachsen und ebenso die Kronen windschief.
Der vorherrschende Baum in den Krattgehölzen ist die Stiel- oder Sommereiche. Die Traubeneiche kommt seltener vor. Rotbuche und Hainbuche fehlen völlig, dagegen sind stets die Zitterpappel und der Faulbaum ( Rhamnus frangula) anzutreffen, häufig auch die Eberesche und ebensooft der Holzapfelbaum. Ein ständiger Gast in den Eichenkratts ist schließlich der Jelängerjelieber ( Lonicera periclymenum). Die gleichfalls an Arten arme Krautflora erweist sich zumeist als eine Mischung von Eichenwald- und Heidepflanzen. Einzelne Kratts sind Naturschutzgebiete und bleiben als solche unberührt.
In ihrer vollen Urwüchsigkeit, in ihrer Hoheit und kernigen Kraft tritt uns die Eiche nochmals vor Augen in den meist prächtigen Auenwäldern im Überschwemmungsbereich der Flüsse und dem von zahlreichen kleinen Rinnsalen durchzogenen Niederungsgelände, besonders in den Stromniederungen des Rheins, der Elbe und der Oder, wo ihr nach dem Maßstab der Häufigkeit neben Eschen und Ulmen der Vorrang gebührt, nach dem Maßstab der äußeren Erscheinung die Würde der Waldeskonigin. Auch hier, in den Auenwaldniederungen, war sie einst ungleich stärker vertreten, doch hat man im achtzehnten Jahrhundert zur Zeit der großen Siedelungen allzu gründlich aufgeräumt, um fruchtbares Ackerland zu gewinnen und dadurch der Landwirtschaft aufzuhelfen. »Durch die bis dahin kaum berührten Flußniederungen«, schreibt K. Hueck in seinem großen Waldbuch, »wurden mächtige Deiche gebaut, Altwässer abgeschnürt und Wald und Weidengebüsch gerodet. So gründliche Arbeit wurde geleistet, daß in dem gewaltigen Oderbruch zwischen Frankfurt und Schwedt kaum noch kümmerliche Spuren der alten Eichenwaldungen erhalten geblieben sind. Etwas besser steht es weiter den Strom aufwärts in Schlesien, wo sich noch an verschiedenen Stellen bemerkenswerte Auwälder finden. Aber auch sie sind nur ein dürftiger Rest des gewaltigen, mehrere Kilometer breiten Aueneichwaldes, der die Provinz früher ihrer ganzen Länge nach durchzog.« Von jeher lockte außerdem der Holzwert gut gewachsener Eichen, und hier, in den Wäldern der Flußniederungen, kam noch die Leichtigkeit hinzu, mit der die gefällten Riesenstämme zu Wasser fortgeflößt werden konnten.
An den Ufern des Oberrheins und der Elbe, die zeitweilig überflutet werden oder von Gräben durchzogen sind, gibt es noch stattliche Auenwälder, und wer sie durchwandert, ist hoch entzückt ob des Artenreichtums der Pflanzenwelt, die sich in ihnen beisammen findet. Ist doch mit dem Pflanzenleben aufs innigste das der Tierwelt verknüpft, in erster Linie der Insekten, die wieder die Vögel nach sich ziehen, die fröhlichsten Bewohner des Waldes, die gleichsam seine Seele bilden. Als echten Lichtkindern, die sie sind, sagt ihnen der Auwald besonders zu. Die Pflanzenwelt, Bäume, Strauch- und Krautschicht, wechselt zwar in den Auenwäldern, wie deren Bodenbeschaffenheit sich je nach dem Grade der Feuchtigkeit und nach der Herkunft dieser ändert, immer jedoch ist sie mannigfaltig aus vielerlei Bäumen zusammengesetzt, in deren Gefolge ein Heer von Sträuchern und Bodenpflanzen mitmarschiert. Die Buche suchen wir freilich vergebens, es sei denn, daß sich hier und dort ein paar erhöhte Standorte fänden, und ebenso fehlen Fichten und Kiefern. Charakterbaum ist die Sommereiche, zu der sich Eschen, Ulmen, Hainbuchen und fast immer auch Birken gesellen. Häufig sind ferner die Pappelarten, Schwarzpappel, Silber- und Zitterpappel, sowie die mit ihnen verwandten Weiden, die ihrer Natur nach in feuchten Senken ihre hauptsächlichsten Standplätze haben, wohin die wasserempfindlichen Holzarten ihnen nicht zu folgen vermögen. Auch Erlen begrüßen uns manchenorts. Der Unterwuchs, der in der Regel sehr dicht ist, besteht im wesentlichen aus Hasel, Faulbaum, Schneeball, Liguster und Pfaffenhut, an trockenen Stellen aus Schlehen und Rosen. Schlingpflanzen finden sich überall reichlich.
Stieleiche oder Sommereiche ( Quercus pedunculata) und Trauben- oder Wintereiche ( Q. sessiliflora), von beiden ist mehrfach die Rede gewesen, ohne daß dabei gesagt wurde, wie sie sich eigentlich unterscheiden. Nun, auffallend sind die Merkmale nicht, doch deuten die Namen schon auf sie hin, die deutschen wie die lateinischen. Bei der Stieleiche sitzen die Näpfchenfrüchte entweder einzeln oder zu zweien am Ende eines langen Stiels, bei der Traubeneiche fast ungestielt zu dritt oder viert zusammengedrängt wie die Beerenfrüchte einer Weintraube. Außerdem weisen die Stieleichenfrüchte, die größer als die der Verwandten sind, stets grünlichbraune Längsstreifen auf, die beim Trocknen allmählich unsichtbar werden, bei Benetzung aber wieder hervortreten. Schwierigkeiten bereitet dagegen die Unterscheidung an den Blättern, denn diese sind sehr veränderlich. Im allgemeinen sind die Blätter der Stieleiche kurz oder gar nicht gestielt (umgekehrt wie bei den Früchten) und die unregelmäßig gebuchtete Blattspreite besitzt am Grunde zwei kleine Läppchen, die ein wenig an Ohren erinnern. Der Blattstiel tritt also durch eine Bucht in die anfangs schmale Blattspreite ein. Schließlich sind die beiden Eichen oft an der Blattoberfläche kenntlich, die bei der Stieleiche matt dunkelgrün, bei der Traubeneiche glänzend ist, was besonders bei Sonnenschein deutlich wird. Eine dritte, aus Nordamerika nach Europa herübergekommene Eiche, die hier und da unsere Wälder ziert, ist die Roteiche ( Quercus rubra), die ganz besonders zur Herbstzeit auffällt, weil sich ihr Laub dann karminrot färbt.
Die Blühbarkeit unserer deutschen Eichen beginnt im Walde mit 80 Jahren, im Freistand schon vier Jahrzehnte früher, und die Blüten selbst sind höchst einfacher Art. Die weiblichen, kugelige Gebilde, die rötliche Narben ins Freie strecken und an ihrem Grunde bereits die Anlage des Eichelnäpfchens erkennen lassen, sitzen gewöhnlich hoch in der Krone, verborgen zwischen dem grünen Laub. Die männlichen Blüten, aufgereiht an lang herunterbaumelnden Fäden, besitzen sternförmige Blütenhüllen, aus denen zahlreiche Staubbeutel ragen. Bei jeder Bewegung der langen Spindel, die schon ein leiser Wind hervorruft, wirbelt der gelbe Pollen empor. Der Aufbruch der Blätter- und Blütenknospen erfolgt bei den Eichen zu gleicher Zeit, und zwar zwischen Ende April und Ende Mai, bei der Traubeneiche zwei Wochen später als bei der Stieleiche. Das hat den Anlaß dazu gegeben, daß die Traubeneiche die »Wintereiche«, die andere die »Sommereiche« wurde. Richtiger wäre es umgekehrt. Entfaltet doch die Traubeneiche Belaubung und Blüten zu einer Zeit, die am weitesten vom Winter ab- und den Sommertagen entgegengerückt ist.
Die sonstigen Eigenschaften der Eiche sind uns bereits von früher bekannt, und auch von der großen Verehrung des Baumes im germanischen Altertum ist wiederholt berichtet worden. Die hohen, geheiligten Eichenhaine, in denen Gerichtstag abgehalten und den Göttern geopfert wurde, durfte kein Uneingeweihter betreten. Wer dem Verbot zu trotzen wagte, wurde mit dem Tode bestraft. Die Eiche war dem Donnergott, dem Donar oder Thor geweiht, der ähnlich wie der Griechengott Zeus oder der Jupiter der Römer durch Donner und Blitz seinen Willen kundtat. Auch Zeus, dessen Sinnbild ebenfalls eine alte heilige Eiche war, offenbarte sich dem gläubigen Volk im Rauschen ihrer gewaltigen Krone. Wahrscheinlich brachten die arischen Völker den mächtigen Waldbaum gerade deshalb mit jenen Gottheiten in Beziehung, weil sie aus langer Erfahrung wußten, daß der vom Himmel zuckende Blitz besonders oft alte Eichen zersplittert.
Die Beobachtung stimmte, die Ausdeutung nicht. Längst sind die alten Götter entthront, und immer noch wählt sich wie ehedem der Blitz unter allen Bäumen des Waldes am häufigsten die Eiche zum Ziel. Wir wissen heute, warum das so ist. Durch sorgsame Blitzspurenuntersuchung kam der Botaniker Ernst Stahl zu dem sehr einleuchtenden Ergebnis, daß Bäume mit rauher, rissiger Borke am meisten durch Blitze gefährdet sind, weil nämlich der Gewitterregen die Rinde nicht schnell genug benetzt und der Blitz keine Oberfläche findet, an der er zum Erdboden abgleiten kann. Anders bei Bäumen mit glatter Rinde. An ihrem Stamm strömt das Regenwasser ununterbrochen zum Boden herab und spielt so die Rolle des Blitzableiters, der den Einschlag unschädlich macht. Durch zielbewußte Untersuchungen hat sich in der Tat ergeben, daß neben der Eiche besonders Pappeln, Birnbäume, Fichten, Tannen und Kiefern, deren Borke erst nach langer Zeit durch den Regen zum guten Leiter wird, am schwersten unter Blitzschlag leiden, während Rotbuchen, Hainbuchen und Roßkastanien keine Gefährdung zu fürchten brauchen. Die Volksmeinung hat also recht, wenn sie anrät: Weiche der Eiche und suche die Buche.
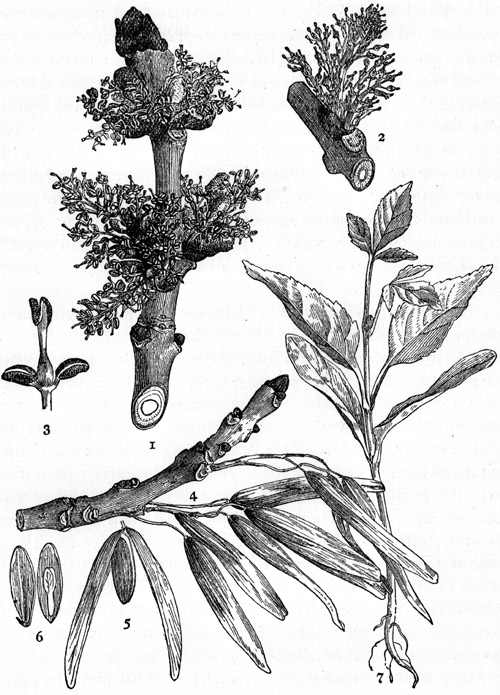
Die Gemeine Esche
1. Blühender Kurztrieb mit Zwitterblüten.
2. Weiblicher Blütenstrauß.
3. Zwitterblüte.
4. Zweigspitze im Winter mit anhängenden Früchten.
5. Geöffnete Frucht.
6. Auseinandergelegte Samenlappen, rechts mit dem Keimling.
7. Keimpflanze.
Von den uns aus den früheren Abschnitten noch nicht bekanntgewordenen Bäumen treffen wir in den Auenwäldern vor allem häufig Eschen und Ulmen, in zweiter Linie Birken, Pappeln und verschiedene Weiden an, die alle zu ihrem Teil dazu beitragen, das an sich schon üppige Waldbild reizvoll und abwechslungsreich zu gestalten. Die Esche ( Fraxinus excelsior) ist vielen dem Namen nach bekannt, nur wenigen aber dem Aussehen nach. Sogar begeisterte Freunde des Waldes, die alle Bäume zu kennen glauben, bleiben gewöhnlich die Antwort schuldig, wenn jemand unversehens fragt: Wie sehen die Blätter der Esche aus? Und dennoch ist kein deutscher Baum so unverwechselbar wie sie, weil ihr kein einziger anderer gleicht. Die Blätter sind ihr bezeichnendstes Merkmal. Sie erinnern an die des Vogelbeerbaumes, der darum auch Eberesche heißt, denn sie sind gleichfalls Fiederblätter, als solche in unserer heimischen Baumwelt an und für sich eine Seltenheit. Der Hauptrippe sitzen auf beiden Seiten schmal-lorbeerblattförmige Teilblättchen an, gegenständig angeordnet und an ihrem Rande flach gesägt, der Spitze der Rippe ein weiteres Blatt. Unkundige meinen, jedes für sich sei schon ein ganzes und richtiges Blatt, doch bilden sie erst gemeinsam ein solches. Schon dieses edel geformte Laub, das sich bis in den Spätherbst hinein immer gleichmäßig grün und frisch erhält, macht die Esche zu einem schönen Baum, und dieser Eindruck wird noch verstärkt durch den schlanken, geraden und astlosen Stamm. Bis dreißig Meter hoch wird die Esche. Die Blüten, die erst spät im Frühjahr vor dem Laubausbruch erscheinen und in Büscheln beisammensitzen, fallen wenig am Baume auf, desto mehr jedoch nach dem Laubabwurf die flachgedrückten bräunlichen Früchte mit ihrem zungenartigen Flügel. In guten Fruchtjahren ist der Baum oft über und über mit ihnen bedeckt.
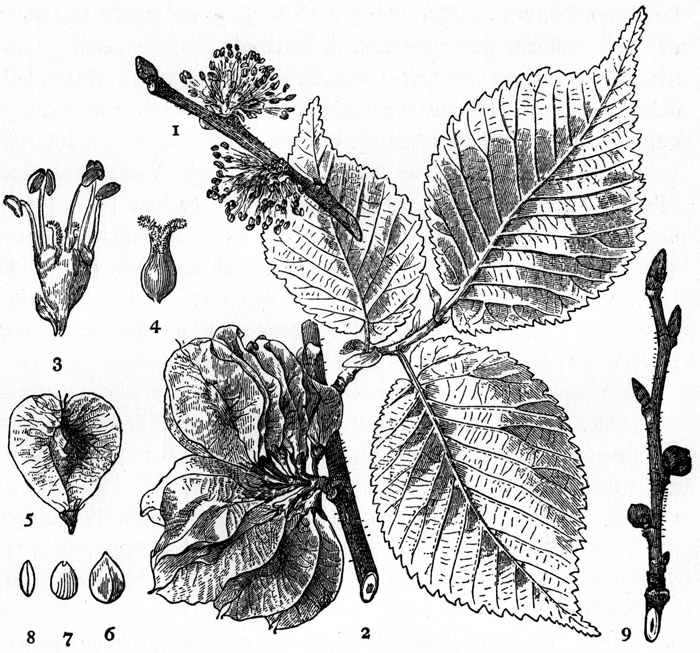
Die Bergulme oder Bergrüster
1. Blühende Triebspitze.
2. Vorjährige Triebspitze mit Fruchtbüschel und jungem Laubtrieb.
3. Einzelne Blüte.
4. Stempel.
5. Frucht.
6.-8. Same mit und ohne Samenschale, Same längs durchschnitten.
9. Trieb mit zwei Blüten- und drei Laubknospen.
In der nordischen Mythologie war die Esche unter den Bäumen der wichtigste. Die Weltenesche Yggdrasil umspannte mit ihrem riesigen Laubdach Himmel und Erde, die ganze Welt, und unter ihrer dreifachen Wurzel quoll ein geheimnisvoller Brunnen, aus dessen Wassern die Nornen stiegen und aus dem Odin Weisheit schöpfte. Es scheint fast, als sei den alten Germanen die Tatsache schon bekannt gewesen, daß die Esche unter allen Bäumen das meistverzweigte Wurzelwerk hat und daß sie nur an Orten gedeiht, wo ihr, wie bei uns in den Auenwäldern, viel Wasser zur Verfügung steht. Aus diesem Grunde war sie bisher in unseren Waldungen wenig verbreitet, doch wird sie neuerdings höher geschätzt und wieder häufiger angebaut, weil sich ihr zähes, festes Holz besonders gut zum Flugzeugbau eignet und ebenso als vortrefflicher Werkstoff zum Wagenbau und zu Sportgeräten, insbesondere zu Schneeschuhen. Im Altertum machte man Speere daraus.
Gleich oft sind in den Auenwäldern – aber keineswegs nur in diesen – die Ulmen oder Rüstern vertreten, am meisten die Feldulme oder Rotulme ( Ulmus campestris), nächst ihr die Bergulme ( Ulmus montana). Am seltensten ist die Flatterulme oder Weißulme ( Ulmus effusa), die ihren etwas befremdenden Namen den wegen ihrer langen Stiele im Winde flatternden Früchten verdankt. Alle, am besten die Flatterulme, sind unschwer an ihren Blättern erkennbar, deren eine Hälfte immer größer und tiefer am Blattstiel angesetzt ist. Bei der Bergulme sind sie oberseits rauh, bei den anderen Arten gewöhnlich glatt. Die Blüten, im März und April erscheinend, sind unscheinbare Zwitterblüten, nur bei der Flatterulme gestielt, die Früchte runde, flache Nüßchen, von einer breiten Flughaut umsäumt. Bei der Feldulme sind sie rötlich gefärbt und liegen im Vorderrande des Flügels, bei der Bergulme meistens in der Mitte. Die gestielten Früchte der Flatterulme sind am Flügelsaum bewimpert.
In neuester Zeit hat unter den Ulmen aus noch nicht aufgeklärten Gründen ein großes Sterben eingesetzt, das ganz besonders auffällig wird, wo die Ulme als Straßenbaum angepflanzt ist. Doch auch in den Wäldern geht der Baum seit Jahren immer mehr zurück. Das Laub vertrocknet vor der Zeit, die Wipfelzweige werden dürr, und diese Anzeichen ernster Erkrankung verbreiten sich über den ganzen Baum, der schließlich gar nicht wieder grünt und damit dem Tode verfallen ist. Und doch sind die Ulmen von Hause aus nichts weniger als weichliche Bäume, vielmehr sehr lebenskräftige, und haben sich bis zum Krankheitsbeginn auch allerorten als solche bewährt. Sie bewiesen das durch ihr rasches Wachstum und die Erzeugung von Unmengen Samen. Hoffen wir, daß es noch rechtzeitig glückt, die Krankheitsursachen zu ermitteln und wirksame Gegenmittel zu finden, damit unserer Heimat die herrlichen Ulmen auch weiterhin erhalten bleiben. Gewiß nicht nur ihres Holzes wegen, obgleich es als eines der schönsten gilt.

Tafel 61
Haselmäuse, die zierlichsten Nagetiere des Waldes

Der Siebenschläfer, ein bekannter Unbekannter

Tafel 62
Geflecktes Knabenkraut

Großblütiges Waldvöglein

Tafel 63
Waldengelwurz mit eben erblühter Enddolde

Die Schuppenwurz, eine Schmarotzerpflanze

Tafel 64
Der schlimmste Singvogelfeind, der Sperber, als gute Mutter im Horst

Ein seltsames Kleeblatt. Junge, kaum flügge Waldohreulen

Die Flatterulme oder Weißulme
1. Blühende Triebspitze.
2. Belaubter Kurztrieb, auf der Spitze des vorjährigen Triebes ein Fruchtbüschel.
3. Einzelne Blüte.
4. Das nach oben spitze Samenfach mit dem seitlich angehefteten Samen darin.
5. Triebspitze mit zwei Blüten- und zwei Laubknospen.
Daß die Birken im Auenwald häufig sind, verwundert uns keinen Augenblick, kennen wir doch schon ihre Begabung, überall leicht Fuß zu fassen, wo sich im Wald eine Lücke zeigt oder wo sich außerhalb seiner Grenzen noch ein freies Plätzchen findet, auf dem es sich für sie leben läßt. Und das ist fast überall dort der Fall, wo ihr Lichthunger voll befriedigt wird. Die Birkensamen fliegen weit, und wo sie auf ihrer Reise landen, keimen sie schon nach längstens drei Wochen. Bevor das Jahr noch zu Ende geht, hat der rührige junge Birkensprößling den ersten Höhentrieb schon vollendet. Dank dieser Verbreitungsfähigkeit gehört auch die Birke zu jenen Pflanzen, die bei der Besiedlung kahlen Bodens mit als erste zur Stelle sind, mag es sich um eine Sandgrube handeln, die nicht mehr ausgebeutet wird, oder um eine durch Feuersbrunst verödete größere Waldbodenfläche.
Es ist aber nicht in allen Fällen ein und dieselbe Birkenart, die solche Pionierdienste leistet. Die Birke, der trockener Sandboden recht ist, wenn nur genug Licht zur Verfügung steht, die also an Anspruchslosigkeit ein Seitenstück zur Kiefer bildet, ist eine andere Art als jene, die wir im feuchten Auenwald treffen. Vielleicht sind beide nur Anpassungsformen, durch Standortverschiedenheiten gemodelt, doch werden sie heute als Hängebirke, Weißbirke oder Gemeine Birke ( Betula verrucosa) und Haarbirke ( Betula pubescens) als »echte Arten« angesehen. Die Hängebirke, so benannt, weil ihre zahlreichen dünnen Zweige gewöhnlich wie trauernd herunterhängen, ist die am meisten verbreitete. Ihr schlanker, lange Zeit glänzendweißer, in dünnen Blättchen abschilfernder Stamm bekommt im Alter tiefe Risse mit schwarzer, borkiger Umgebung und büßt dadurch seine Schönheit ein. Er setzt sich gleichsam als Achse des Baumes bis in den Kronenwipfel fort, und die Krone selbst bilden einzig die Zweige, die dieser Mittelachse entspringen und von geringer Stärke sind. Bei der Haarbirke, die ihren Namen bekam, weil ihre jungen Blätter und Triebe im Unterschiede von der Verwandten samtähnliche Behaarung tragen, ragt gleichfalls der Stamm durch die Krone hindurch, doch streben die aus ihm entspringenden Zweige mehr nach den Seiten und nach oben. Die Borkenbildung tritt später auf und beschränkt sich zumeist auf den unteren Stammteil. Die Haarbirke liebt als Untergrund einen nassen oder moorigen Boden, auf dem die Hängebirke versagt. Da es jedoch zwischen beiden Arten zahlreiche Übergangsformen gibt, so kommen sie in nicht seltenen Fällen auch friedlich nebeneinander vor. Wo immer sie aber beheimatet sind, stets heben sie sich in ihrer Erscheinung, vor allem durch ihre leuchtenden Stämme, vorteilhaft ab von den anderen Bäumen, und wenn im Frühjahr, um Mitte April, ein lichtes Gehänge von zartestem Grün ihre luftig durchsichtigen Kronen schmückt, vom Lenzwind hin und her geschaukelt, so ist die Birke ein wahrer Prachtbaum, der an Anmut nicht seinesgleichen hat. Er verdient es, Künder des Frühlings zu heißen und als ein erster Maiengruß in Haus und Hütte getragen zu werden.
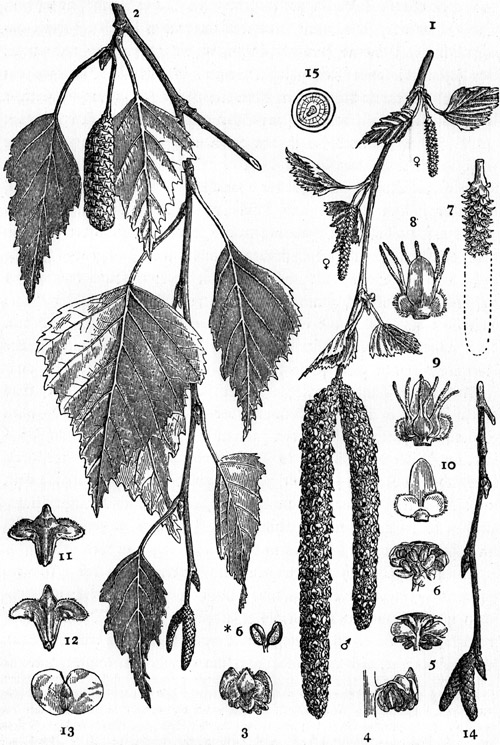
Die gemeine Birke oder Hägebirke.
1. Triebspitze mit männl. (♂) Kätzchen und und weibl. (♀) Ähren.
2. Trieb mit einem Fruchtzäpfchen und (an der Spitze) männl. Blütenknospen.
3.-5. Männl. Blütenhülle von vorn, von der Seite, unten und oben.
6. Staubgefäß.
7. Teil eines weibl. Zäpfchens.
8. 9. Weibl. Blütenhülle mit drei zweinarbigen Blütchen.
10. Die Hülle allein.
11. 12. Die aus ihr erwachsene Schuppe eines Fruchtzäpfchens von oben und unten.
13. Geflügelte Frucht.
14. Triebspitze mit Laubknospen und männlichen Blütenknospen.
15. Querschnitt eines 3jährigen Triebes.
Lenzkinder sind auch die Pappeln und Weiden, die in der Pflanzensystematik gemeinsam eine Familie bilden, so unterschiedlich ihr Aussehen ist. Nur wenige können als Waldbäume gelten. Der Mehrzahl widerstrebt ein Leben im geschlossenen Baumbestand. Sie brauchen einen freien Standort, viel Luft und Licht, um gedeihen zu können, und die
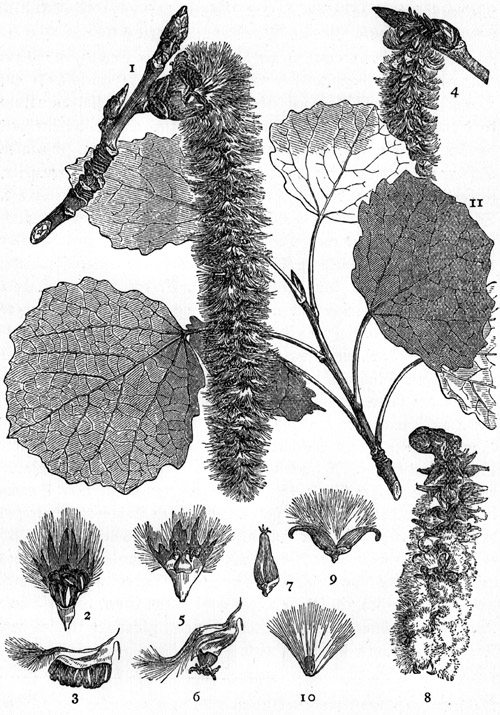
Die Zitterpappel oder Espe:
1. Kurztrieb mit
2 Laubknospen und blühendem männl. Kätzchen.
2. 3. Männliche Blüte von unten und von der Seite.
4. Weibliches Kätzchen.
5. 6. Weibl. Blüte von unten und von der Seite.
7. Reife, noch geschlossene Frucht.
8. Teil eines Fruchtkätzchens.
9. Aufgesprungene Frucht.
10. Vom Haarschopf umhüllter Samen.
11. Beblätterter Trieb.
Weiden lieben es außerdem, in der Nachbarschaft eines Gewässers zu stehen. Am wenigsten Wert auf Vereinzelung legt die Espe oder Zitterpappel ( Populus tremula), die auch im östlichen Europa, in unserm Ostpreußen schon beginnend, sowohl für sich als in Gemeinschaft mit Birken und Erlen Waldungen bildet. Bezeichnend für sie sind die nahezu kreisrunden, am Rande buchtig gezähnten Blätter, deren Oberseite weit dunkler grün als ihre Unterseite ist. Sie sitzen an langen, schwanken Stielen und geraten schon durch den leisesten Windhauch in unruhige, zitternde Bewegung, die ein Raschelgeräusch in der Krone hervorruft. Die Redensart »Zittern wie Espenlaub« bringt einen guten Vergleich zum Ausdruck. Seine enge Verwandtschaft mit den Weiden bekundet der Baum durch die wolligen Kätzchen, mit denen er im zeitigen Frühjahr, im März und April, seine Krone schmückt. Er hat es eilig mit dem Blühen, denn männliche und weibliche Kätzchen sind auf verschiedene Bäume verteilt, und zur Befruchtung der weiblichen Blüten sind deshalb windige Tage nötig, wie sie der zeitige Frühling bringt. Anfangs sind beiderlei Blütenstände kurz und seidig wie bei den Weiden, bald aber werden sie walzig und lang und ähneln dann in ihrer Gestaltung den Haselstrauch- oder Erlenkätzchen. Aus dem grauen oder meergrünen Samt leuchten je nach Geschlecht karminrote Narben oder karminrote Staubbeutel hervor. Die weiblichen Kätzchen entwickeln später erstaunliche Massen weißer Wolle, die Schöpfe, mit denen die reifen Samen im Mai oder Juni auf Reisen gehen. Im zweiten Abschnitt (Seite 71) lernten wir sie bereits näher kennen. Außer durch Samen vermehrt sich die Espe durch sogenannte Wurzelbrut, das heißt durch Ausschläge aus den Wurzeln, die häufig viele Meter weit vom Mutterstamm fern durch das Erdreich ziehen. Auf diese Weise entstandene Espen bleiben jedoch meist kleine Bäume oder entwickeln sich nur zu Buschwerk, das dem Forstmann mitunter sehr lästig wird.
In Auenwäldern besonders häufig ist die Schwarzpappel ( Populus nigra) mit oberseits glänzenden dunkelgrünen und unterseits matten hellgrünen Blättern, die deutlich dreieckige Form aufweisen und ungezähnte Ränder haben. An den dicken, walzigen Pollenkätzchen leuchten im März oder im April die Staubbeutel derart stark hervor, daß die Kätzchen als Ganzes purpurn erglühen, während die schlankeren Fruchtblütenstände entsprechend ihren Blütennarben schlichtere, gelbgrüne Tönung zeigen. Die Schwarzpappel ist ein stattlicher Baum mit anfangs grauweißem glatten Stamm, der leider schon frühzeitig borkig wird, und einer breitgewölbten Krone, deren Blätter meist in Bewegung sind, wenn auch nicht so lebhaft wie bei der Espe. Auf gutem Standort wird der Baum, der mehrhundertjähriges Alter erreicht, zuweilen bis dreißig Meter hoch bei etwa zwei Meter Stammdurchmesser. Gleich alt und ragend, im Stamm noch weit stärker, wird die Weiß- oder Silberpappel ( Populus alba) mit efeuähnlich geformten Blättern, die unterseits weißfilzig behaart sind. Das gleiche gilt von den jungen Trieben, die später kahl und bräunlich werden. Die Kätzchen ähneln denen der Espe. Die Silberpappel ist wie die Schwarzpappel häufig in städtischen Parken vertreten, entwickelt sich zu voller Schönheit jedoch nur in den Auen der Flüsse.
Die Weiden stimmen in vieler Hinsicht mit den Pappeln überein. Wie diese sind sie Kätzchenträger, und die ihre Kätzchen bildenden Blüten sind gleichfalls nicht nur getrennten Geschlechts, sondern stehen auch auf verschiedenen Pflanzen. In einem aber weichen sie ab: sie vertrauen ihren Blütenstaub nicht wie die Pappeln dem Winde an, der launisch und unzuverlässig ist, sondern lassen ihn durch Insektenpost zu einer weiblichen Pflanze tragen und deren Narben mit ihm belegen. Ganz sicher ist freilich auch dieses Verfahren bei der Gemeinschaft der Weiden nicht, denn da sich bei nahe verwandten Arten die Blütenformen sehr ähnlich sehen, so kommt es durchaus nicht selten vor, daß die geflügelten Liebesboten den Pollen nicht sinngemäß auf die Narbe einer Artgenossin bringen, sondern auf die einer fremden Art. Das nehmen die Weiden jedoch nicht übel. Sie sind schon derart verbastardiert, daß die Botaniker Mühe haben, die Blendlinge mit Sicherheit von den reinen Arten zu unterscheiden. In der Mehrzahl der Fälle gelangt der Pollen doch zweifellos an die rechte Stelle, sicherlich öfter, als wenn ihn der Wind auf seine losen Schwingen lüde und weithin auf gut Glück verstreute.

Die Salweide, die Verbreitetste unserer deutschen Weiden:
1. Triebspitze mit männlichen Kätzchen.
2. Männliche Blüte.
3. Deren unterer Teil, um das Deckblättchen und die Schuppe zu zeigen.
4. Triebspitze mit einem weiblichen Kätzchen.
5. Weibliche Blüte.
6. Noch geschlossene Frucht.
7. Geöffnete Frucht.
8. Same.
9. 10. Geschlossene und im Entfalten begriffene Blütenknospen.
11. Beblätterter Trieb, Nebenblättchen.
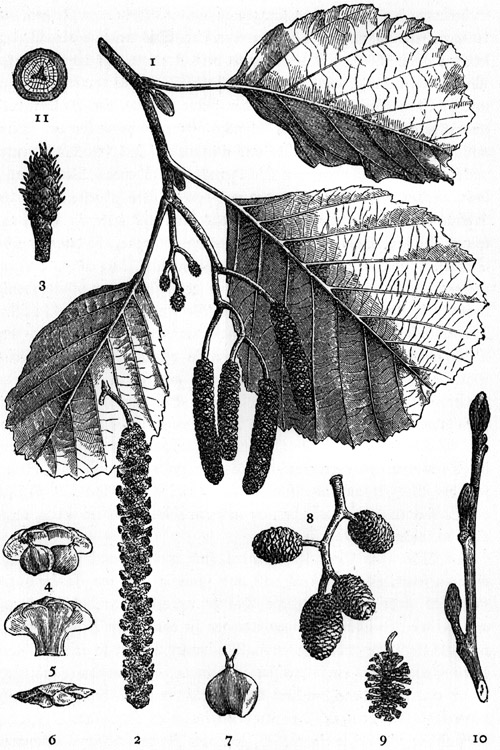
Die Schwarzerle
1. Triebspitze mit den schon vorgebildeten nächstjährigen männl. und weibl. Kätzchen.
2. Männl. Kätzchen.
3. Weibl. Blütenähre.
4.-6. Zapfenschuppe, von innen (mit zwei Früchten), von außen und vorn.
7. Frucht.
8. Reife Fruchtzäpfchen.
9. Entleertes Zäpfchen.
10. Triebspitze.
11. Zweig-Querdurchschnitt.
Wie stark die Insekten vom Wohlgeruch der blühenden Weiden angelockt werden und wie begehrt der von den Blüten abgesonderte süße Nektar bei dem Kerbtiervölkchen ist, das kann uns jeder Frühlingstag lehren. Bienen, Hummeln und Hummelschwebfliegen, Goldwespen und Schmarotzerwespen, Zitronenfalter, Trauermäntel, kurz alles, was im zeitigen Frühling, wo die Blumen dünn gesät sind, nach Blütenhonig begierig ist, stellt sich bei den blühenden Weiden ein, um die es in allen Tonarten summt. Die weitaus häufigste unserer Weiden, die sich der Birke gleich überall im Walde anzusiedeln pflegt, wo noch ein freies Plätzchen winkt, das ihrem Lichtbedürfnis genügt, ist die Salweide ( Salix caprea), deren Blätter, Knospen, Blüten und Samen unsere Abbildung trefflich veranschaulicht. Die Zweige müssen wir uns braunrot, die Blätter oberseits dunkelgrün und unterseits weißfilzig denken, die Staubbeutel der männlichen Kätzchen golden. Um Anfang März setzt die Blühzeit ein und erstreckt sich bis tief in den April. Meist sind die Salweiden hohe Sträucher, die wasserreiche Standorte lieben, nicht aber an solche gebunden sind.
Wo Weiden ein Gewässer begleiten, sind meistens auch Erlen nicht weit entfernt. Nur muß es naß und sumpfig sein, wo sie ihr gutes Gedeihen finden und stattliche Bäume werden sollen. Selbst langandauernde Überschwemmungen ertragen sie ohne jeden Schaden, besser noch als die Mehrzahl der Weiden. Wo immer sie aber in größerer Zahl einen Sumpf oder ein Gewässer umrahmen, da wird die Landschaft düster und ernst, denn dunklere Bäume als die Erlen beherbergt unser Vaterland nicht, obgleich ihre Kronen keineswegs dicht sind. Schon die Belaubung ist nie so freundlich, wie wir sie von anderen Bäumen kennen. Die Blätter sind von schwarzgrüner Färbung und bleiben so während des ganzen Sommers. Sie verfärben sich auch zur Herbstzeit nicht, wenn der Auenwald sich zum zweitenmal schmückt, sondern taumeln schließlich im November, den Herbststürmen weichend, so düster vom Zweig, wie sie von Anfang an gewesen. Sogar die Blütezeit ist nicht imstande, den finsteren Eindruck zu verwischen, den wir beim Anblick der Bäume gewinnen.
Zwei Arten, die Schwarzerle und die Grauerle ( Alnus glutinosa und A. incana), kommen hier für uns in Betracht, und beide sind leicht zu unterscheiden. Die Schwarzerle hat eine tiefbraune Rinde, die sehr zur Borkenbildung neigt, die Grauerle eine silbergraue, die zwar im Alter etwas aufreißt, aber niemals borkig wird. Die Blätter der ersten sind rundlich und stumpf, auf ihrer Unterseite glatt, die Blätter der Grauerle eiförmig, spitz und unterseits grau, fast filzig behaart. Die Fruchtzapfen der Schwarzerle sind gestielt, die der Grauerle meist sitzend. Die schon zur Herbstzeit angelegten männlichen und weiblichen Kätzchen, an ein und demselben Baume hängend, öffnen die Blüten im zeitigen Lenz, oft schon im Februar oder März, stets lange Zeit vor dem Laubausbruch, und bei beiden Arten verholzen die Schuppen der weiblichen Kätzchen zu schwarzen Gebilden, die der Form nach Kiefernzapfen ähneln. Die Samen reifen erst im Winter und fallen gewöhnlich im Vorfrühling aus, um sich vom Winde oder vom Wasser zu neuen Standorten tragen zu lassen.
Für den Spreewald ist die düstere Erle der eigentliche Charakterbaum, der mit seiner Schlankheit, seiner Größe und seinem ernsten Angesicht der Landschaft das Gepräge verleiht. Hier, wo die Erle Wälder bildet oder in Wäldern als Herrscherin auftritt, erreicht sie bei aller Schmucklosigkeit doch eine starke ästhetische Wirkung. Hier ist sie der landschaftformende Baum, wie die Fichte es im Gebirge ist, und schafft sie Naturbilder, wie sie in Deutschland zum zweitenmal nicht zu finden sind.
Es ist im Wesen des Laubwaldes begründet, daß seine Tierwelt viel reicher und bunter als die des Nadelwaldes ist, und zwar gilt das in erster Linie für die leichtbeschwingten Vögel, die den Naturfreund am meisten fesseln. Die Vielfältigkeit der Laubwaldgewächse, der Bäume, Sträucher und Bodenpflanzen, vermag einer größeren Zahl von Arten die Forderungen zu erfüllen, die sie an ihren Wohnraum stellen, sowohl in bezug auf Schutz und Nahrung als auch an Fortpflanzungsmöglichkeiten. Je abwechslungsreicher ein Laubwald ist, desto größer sein Reichtum an Bewohnern, die innerhalb seines Gesamtgebiets noch wieder gemäß ihren Sonderbedürfnissen ihre Aufenthaltsorte wählen. Bei den Vögeln wird das besonders deutlich. Die einen fühlen sich am wohlsten im schattigen Laubdach der hohen Waldbäume und kommen nur selten zum Boden herab, die anderen halten sich vorzugsweise in der niederen Strauchschicht auf. Die dritten bevorzugen Wohn- und Nistplätze in der Nähe von Gewässern, und eine nicht geringe Zahl haust ausschließlich in den Randgebieten und macht von dort aus häufige Ausflüge auf die benachbarten Felder und Wiesen. An Lebhaftigkeit des Vogellebens und Vielstimmigkeit des Vogelgesangs steht der Auenwald unbedingt obenan.
An Säugetieren ist der Laubwald nicht reicher als der Nadelwald. Das Nutzwild und die Raubsäugetiere, die wir in diesem kennenlernten, finden wir unterm Blätterdach wieder, das Eichhörnchen wird in den Laubwaldkronen genau so vom Edelmarder gejagt wie im Gezweig der Nadelbäume, und auch das Kaninchen ist keineswegs allein auf die Kiefernwälder beschränkt. Wie jedes Buschland sie beherbergt, vor allem solches mit sandigem Boden, so sind sie auch im Laubwald zu Hause, besonders gern in Auenwäldern, jedoch nur dort, wo der Untergrund zur Anlage von Bauten tauglich ist. Der nächste Verwandte des Wildkaninchens, der Hase, kommt zwar auch in den Wald, doch benutzt er ihn nur als willkommene Deckung, wenn Wind und Wetter den Aufenthalt auf freiem Felde zu unleidlich machen. Ausschließlich dem Laubwald angehörend ist unter unseren heimischen Säugern nur die zierliche Haselmaus, die wir bald kennenlernen werden, dagegen gibt es etliche Arten, für die er bevorzugte Wohnstätte ist.
Eine von diesen ist unser Igel ( Erinaceus europaeus), der drolligste, sonderbarste Kauz in der Reihe der deutschen Säugetiere, bei dessen Anblick jeder Spaziergänger unwillkürlich die Schritte hemmt. Gemächlich kommt er bei Dämmerungsanbruch aus seinen Waldverstecken heraus und trippelt langsam über den Weg, das Schnuppernäschen dicht am Boden, wo allerlei Kleingetier sich herumtreibt. Ab und zu stutzt er, hebt das Schnäuzchen und schnüffelt ein paarmal in die Luft, setzt aber danach seelenruhig seinen Abendbummel fort. Um das Gehör steht es schlecht beim Igel, sein wichtigster Sinn ist der Geruch. Sobald seine Nase Verdächtiges wittert, schlägt er sich seitwärts in die Büsche und ist dann gewöhnlich rasch außer Sicht. Holt man ihn schnellen Laufes ein, so rollt er sich augenblicklich zusammen und gleicht dann einer Stachelkugel, deren Aufrollung selbst mit geschützten Händen nahezu unmöglich ist. Er hat diese Trutzwaffe dringend nötig, denn alle Hunde hassen ihn und auch der Fuchs ist ihm feindlich gesinnt. Besonders zur Zeit seines Winterschlafes wäre er nie seines Lebens sicher, schützte ihn nicht sein Stachelrock. So aber ziehen seine Verfolger unverrichteter Sache ab, nicht selten mit einer blutenden Nase. Nur bei dem Menschen versagt seine Schutzwehr. Es hat sich zu weit herumgesprochen, daß der Igel als tüchtiger Mäusefänger mit jeder Katze wetteifern kann, und da er trotz seiner rauhen Schale ein ziemlich harmloser Bursche ist und obendrein ganz unterhaltsam, so wird er, ins Taschentuch geknotet, vielfach mit nach Hause genommen, um auf dem Dachboden oder im Keller die Rolle des Kammerjägers zu spielen. Das Ende ist, daß er elend verhungert, weil sich die Nager schleunigst verziehen, nachdem er ein paar von ihnen geschnappt hat, und weil man seine Versorgung mit Futter gewöhnlich nicht für erforderlich hält. Er soll ja gerade Mäuse fangen!
So schlau, wie Märchen und Fabeln ihn schildern, ist unser Swinegel keineswegs, aber einfältig ist er noch weniger. Man hat die alte Erzählung der Landleute, daß er seine Stacheln zur Ernte verwende, indem er sich nachts über Fallobst wälze, um die dabei aufgespießten Früchte huckepack in sein Versteck zu tragen, lange für eine Erfindung gehalten, doch ist sie mehrfach bestätigt worden. In seinem Schlupfwinkel angelangt, schüttelt er sich wie ein nasser Hund, daß die Äpfelchen, Birnen oder Pflaumen nach allen Seiten herunterfliegen, und fällt dann allein oder mit seinen Jungen gierig über die Mahlzeit her. Es kümmert ihn nicht, daß die Zoologen ihn wegen gewisser Eigenschaften zu den »Insektenfressern« zählen. Er wählt aus dem Tier- und Pflanzenreiche, was seinem Gaumen wohlbehagt, und seine Speisekarte ist lang. Käfer oder fette Raupen, Regenwürmer, Frösche, Blindschleichen, Mäuse, gleichviel welcher Art, dem Nest entfallene Singvogelkinder, Eier bodenbrütender Vögel, zur Abwechslung auch wohl ein Pilzgericht – all das und vieles andere mehr gehört zu seinem täglichen Brot. Kann er gar eine Schlange erwischen, so bedeutet sie ihm einen Hochgenuß, einerlei, ob es eine Ringelnatter oder die giftige Kreuzotter ist. Ihm macht es nichts aus, ob die Otter sich wehrt und ihm einen Biß in sein Schnäuzchen versetzt, denn wie Versuche ergeben haben, ist er in hohem Grade giftfest und bleibt deshalb immer Sieger im Kampf. Hätte er keine andern Verdienste – und er hat ihrer übergenug im Vergleich zu seinen geringen Vergehen – so müßte man ihn schon deshalb schützen, weil er ein Kreuzotternjäger ist. Wenn das bunte Herbstlaub zu Boden fällt, nimmt der Igel die Gelegenheit wahr, um sich aus Haufen von Blättern und Moosen an einem windgeschützten Fleckchen ein warmes Lager zu bereiten, und legt sich zum Winterschlaf aufs Ohr. Mit kurzen Unterbrechungen schläft er bis gegen Ende des Lenzmonats durch. Bald nach dem Erwachen sucht er sich zu kurzer Ehe eine Genossin, und diese bringt in der Sommerszeit, meist zwischen Juni und August, ein halbes Dutzend Junge zur Welt, mit denen sie später gemeinschaftlich zur Nahrungssuche den Wald durchstreift.
Aufmerksamen Naturbeobachtern kommt dann und wann in den Nachmittagstunden, wenn die Sonne schon tief am Himmel steht, ein kleiner Vierfüßler zu Gesicht, der in der Gestalt einer Hausmaus ähnelt und ihr auch an Größe nahezu gleicht, jedoch einen deutlichen Rüssel besitzt und einen schwarzen Rückenpelz. Das Tierchen ist eine Waldspitzmaus ( Sorex araneus), und um es gleich im voraus zu sagen, ein Raubtier, das an Mut und Gewandtheit, noch mehr jedoch an Gefräßigkeit von keinem übertroffen wird. Zoologisch ein »Insektenfresser«, also weitläufig mit dem Igel verwandt, beschränkt es sich aber so wenig wie dieser auf wenig nährende Kerbtierkost. Es springt der Waldmaus ins Genick, gibt ihr Opfer nicht eher frei, als bis es tot am Boden liegt, und verzehrt es dann bis auf Haut und Knochen – im Laufe einer einzigen Nacht. Auch wenn zwei Spitzmäuse sich begegnen, gibt es sofort einen wütenden Kampf, von grillenähnlichem Zirpen begleitet, der auch wieder häufig damit endet, daß die Besiegte gefressen wird. Die Forstleute sind ihnen freundlich gesinnt. Sie schätzen die gefräßigen Tiere als Bundesgenossen in ihrem Kampfe gegen die Schädlinge des Waldes, deren Larven und Puppen ein Hauptbestandteil der täglichen Spitzmausnahrung sind.
Anmutiger in ihrer Erscheinung und durch den langen buschigen Schwanz die Erinnerung an das Eichhörnchen weckend, sind zwei Schlafmäuse oder Bilche, die sich in der Lebensweise ähneln, der Siebenschläfer ( Myoxis glis), weniger nach Gestalt und Aussehen als seinem Namen nach bekannt, und sein kleinerer Verwandter, der Gartenschläfer ( Eliomys quercinus). Der erste ist im Bergland zu Hause, in trockenen Buchen- und Eichenwäldern, mitunter in kleinen Gehölzen und Gärten; der zweite findet sich auch im Flachland, zieht jedoch gleichfalls die Bergwälder vor. Am liebsten siedeln sich beide Arten in der Nähe von Walddörfern an, um nachts den Obstgärten der Bewohner ihre Besuche abzustatten und sich an den Früchten gütlich zu tun, die ihnen ersichtlich besser munden als Eicheln, Bucheln und Haselnüsse, besser auch als tierische Kost. Kirschen, Pfirsiche, Äpfel, Birnen, nichts ist vor ihrem Zugriff sicher, und treffsicher wissen sie obendrein die feinsten Sorten herauszufinden. Viel Obst wird an Ort und Stelle verzehrt, denn ihre Gefräßigkeit ist groß, noch mehr jedoch nur angenagt und dann zu Boden fallen gelassen, ein weiterer Teil dazu noch verschleppt und in den Schlupfwinkeln aufgespeichert. Man begreift, daß die Bauern den Obstspitzbuben, die immer gleich in Gesellschaft plündern, beständig auf der Fährte sind und ihnen eifrig Fallen stellen. In solchen Obstgärten kann man die Bilche und ihr eichhornähnliches Treiben auch am besten kennenlernen, vor allem in hellen Mondscheinnächten, denn anderswo kriegt man sie schwer zu Gesicht, weil sie ausgesprochene Nachttiere sind. Es hat einen eigentümlichen Reiz, ihrer Klettergewandtheit und ihren Sprüngen, der Art, wie sie sorgsam den Fruchtstiel durchnagen, ohne die Frucht sich entgleiten zu lassen, kurz ihrer Geschäftigkeit zuzuschauen, wobei im besonderen auch die Kleinheit und Zierlichkeit der Tiere mitspricht. Zur Beobachtung in der Gefangenschaft eignen sie sich leider nicht. Ihr Wesen steht zu ihrer Erscheinung in allzu schroffem Gegensatz. Äußerst reizbar und unliebenswürdig, befreunden sie sich mit keinem Pfleger, wie jung sie auch in die Gefangenschaft kamen.
Die Bilche sind echte Winterschläfer. Schon lange vor den ersten Nachtfrösten machen sie sich in tiefen Erdlöchern, in hohlen Bäumen, in Felsenspalten oder an ähnlich geschützten Orten aus Moos ein weiches Lager zurecht, in das sich gewöhnlich mehrere teilen, und fallen in einen tiefen Schlaf, der mehrfach auf kurze Zeit unterbrochen, bis zum späten Frühling währt. In den Pausen zehren sie von den Vorräten, die sie aufgespeichert haben. Den sieben Monaten Ruhezeit verdankt der Siebenschläfer den Namen.
Der dritte Schläfer, die Haselmaus ( Muscardinus avellanarius), zählt zu den niedlichsten Geschöpfen der ganzen heimischen Säugetierwelt, nach Aussehen und Wesensart gleich entzückend. Der dichte, weiche und glänzende Pelz ist bis auf die weiße Brust und Kehle gleichmäßig gelblichrot gefärbt, auf der Bauchseite um eine Wenigkeit heller, der ringsum kurzbehaarte Schwanz auf der Oberseite bräunlichrot. In der Größe stimmt die Haselmaus mit unserer Hausmaus überein. Im finsteren Hochwald kommt sie nicht vor, nur im Buschwerk der Randgebiete oder in dem der Umgebung von Schlägen. Haselnußdickichte werden bevorzugt, denn ihnen verdankt sie die liebste Nahrung. Gibt es noch keine Haselnüsse, so hält sie sich an Pflanzensamen, Baumknospen und allerlei Früchte und Beeren, besonders an die der Eberesche. Leider ist auch diese Schlafmaus wie ihre Verwandten ein nächtliches Tier und deshalb nur in hellen Mondnächten oder während der Dämmerstunden morgens und abends auffindbar. Am besten suchen wir im August nach ihrem Nest im Haseldickicht, einem großen kugelförmigen Bau, aus Grashalmen, dürrem Laub und Moos mit viel Geschicklichkeit errichtet, der ungefähr in Meterhöhe über dem Erdboden zu stehen pflegt. Glückt die Entdeckung eines solchen Nestes und ist es mit Haselmausjungen besetzt, so haben wir Gelegenheit, morgens und abends oder bei Mondschein Mutter und Kinder zu belauschen. Die Jungen wachsen schnell heran und turnen schon in der dritten Woche nach ihrer Geburt vor dem Neste herum. Um diese Zeit sind die Haselnüsse ebenfalls ziemlich ausgereift, und die Haselmausmutter zeigt uns das Kunststück, wie sich die Nüsse entleeren lassen, ohne sie vom Zweig zu pflücken oder die Schale zu zersprengen. Mit ihren beiden Hinterbeinen hängt sie sich an einen schwanken Ast, was sonst nur Affen fertig bringen, ergreift mit ihren Vorderfüßen eine tiefer hängende Nuß, nagt eine kleine Öffnung hinein und holt mit ihren Nagezähnchen allmählich den ganzen Kern heraus. Dann geht es zu einer zweiten Nuß, die wieder in anderer Stellung entleert wird, und wenn sich an dieser nahrhaften Arbeit gar noch die Kinderschar beteiligt, so trennt man sich schwer von den wechselnden Bildern dieses fesselnden Films der Natur. Wenn im Oktober das Knisterlaub von Bäumen und Sträuchern zu Boden taumelt, ziehen sich die Haselmäuse in ihre Unterschlupfe zurück, erbauen sich ein ringsum geschlossenes und behaglich warmes Nest aus Reisig, Moosen, Blättern und Gräsern, rollen sich zur Kugel zusammen und trotzen dem Winter und seiner Not, bis sie die Frühlingssonne weckt.

Tafel 65
Eine »tausendjährige« Eiche im Schwarzwald
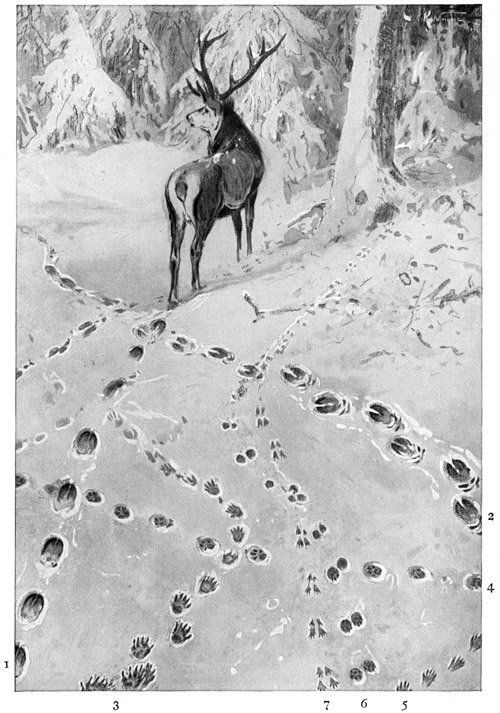
Tafel 66
Fährten und Spuren im Schnee
1. Edelhirsch.
2. Wildschwein.
3. Dachs.
4. Katze.
5. Igel.
6. Marder.
7. Eichhörnchen
(1-5 verlaufen von der Zahl aus nach dem Innern des Bildes, 6-7 umgekehrt)
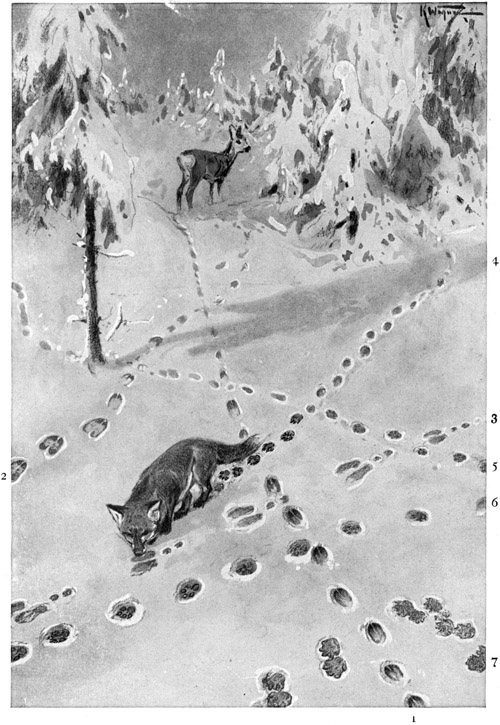
Tafel 67
Fährten und Spuren im Schnee
1. Reh.
2. Damhirsch.
3. Hase.
4. Fuchs.
5. Katze.
6. Hund.
7. Otter
(Sämtliche Fährten und Spuren verlaufen von der Zahl aus nach dem Innern des Bildes)

Tafel 68
Roteiche im Herbst. Nach ihrer vollständigen Verfärbung leuchten die Blätter karminrot

Eichengallen, durch den Stich eierablegender Gallwespen an der Blattunterseite hervorgerufen
Erwähnen wir noch die Waldfledermaus ( Vesperugo noctula), die in den frühen Abendstunden, nicht selten schon am lichten Tag, ihr Ast- oder Spechtloch im Walde verläßt, um über den Wipfeln der Waldrandbäume gewandten Flugs nach Insekten zu jagen, so haben wir die wichtigsten Säuger unserer Laubwälder vorgestellt.
Die Mehrzahl von ihnen, mit Einschluß des Wildes und der verschiedenen Raubsäugetiere, sind während der Nacht besonders rege, und keiner, der sich Waldfreund nennt, sollte deshalb den Frühling verstreichen lassen, ohne auf einem Waldspaziergang unter hellbestirntem Himmel, wenn sich kein Blatt in den Wipfeln regt, den Stimmen der Nacht gelauscht zu haben. So viel uns der Wald bei Tag erzählt, wenn die Augen in seine Geheimnisse blicken, so wundersam ist es, in stiller Nacht auf einem alten Baumstumpf zu sitzen und Eindrücke auf sich wirken zu lassen, die nur der Gehörsinn vermitteln kann. Da raschelt im dichten Bodenwuchs eine langsam ziehende Ringelnatter, nagt deutlich vernehmbar eine Waldmaus am Stamm einer eingesprengten Lärche, quiekt plötzlich ein kleiner Nager auf, vermutlich von einem Räuber erhascht, und tönt aus der Ferne oft wiederholt ein lautes »Juik juik« durch die Nacht, das nur vom Waldkauz herrühren kann. Nachtfalter schwirren durch die Luft, ein brummender Mistkäfer saust vorüber – Geräusche lösen Geräusche ab. Das weiche, langgezogene Heulen, »hu hu hu hu« in dichter Folge, verkündet uns, daß eine Ohreule balzt, und wenn wir statt im Flachlandforste in einem dichten Gebirgswald weilten, vernähmen wir wohl auch das dumpfe »Buhu« der größten Eule im deutschen Land, den schauerlich tönenden Nachtruf des Uhus, der die Sage vom Wilden Jäger hervorrief. Wir wandern weiter den Waldweg entlang und horchen gespannt auf die Stimmen der Nacht. Halt! was war das? Zu unserer Rechten hinter dem Buschwerk schreckte ein Rehbock. Die Schritte hatten sein Mißtrauen geweckt. »Bö! böbö! bö!« dringt es uns ins Ohr, dumpf und tief aus der Kehle gestoßen, die Laute durch kurze Pausen getrennt. Und dann wieder anders, beträchtlich heller: »Bä-u bä-u«, die beiden Vokale deutlich ineinanderfließend – ein weibliches Tier, eine Rehricke »schmält«. Gleich darauf ein Knacken und Brechen – die beiden Rehe sind auf der Flucht. Wer solche Nachtstimmen nie vorher hörte, hält unwillkürlich den Atem an, weil ihm die Urheber unbekannt sind.
Am lautesten wird es frühmorgens im Wald, wenn die Dämmerungsschleier sich mehr und mehr lüften, denn eine Vogelart nach der andern schüttelt den Schlaf aus ihrem Gefieder und grüßt mit Gesang den jungen Tag. Am lebhaftesten ist das Stimmengewirr von der zweiten Maihälfte bis Mitte Juni, und ein besonderer Reiz liegt darin, das Erwachen des gefiederten Völkchens am frühen Morgen zu belauschen und dabei zugleich die Frühaufsteher und die Langschläfer festzustellen. Gegen halb drei Uhr eröffnen Rotschwanz, Singdrossel und Rotkehlchen das Konzert. Die Rufe des Kuckucks mischen sich ein. Etwas später beginnen die Gartengrasmücke und der Trauerfliegenschnäpper. Bald nach drei Uhr ertönt aus den Kronen der klangvolle Flötenruf des Pirols und aus dem Unterholz singt ein Vogel so unerhört kräftig sein Liedlein heraus, daß der Uneingeweihte schwer glauben wird, daß der Sänger ein winziger Zaunkönig ist. Bald schmettert dann auch der Fink seine Strophe, die Kohl- und Blaumeisen werden munter, und kurze Zeit später nehmen die Laubsänger Fitis und »Zilpzalp« teil am Konzert. Zu den Langschläfern zählen außer den Staren vor allem die Waldtauben und die Spechte.
Zu solchen Beobachtungen ist freilich nötig, daß man die Vögel und ihre Stimmen wirklich zu unterscheiden vermag, und zur Gewinnung dieser Kenntnis ist der Laubwald zur Maienzeit der denkbar ungeeignetste Ort. Der Ansturm auf das Gehör ist zu mächtig, das Stimmendurcheinander zu groß und der Laubwald selbst ist zu unübersichtlich, als daß die Entwirrung der vielerlei Eindrücke einem Neuling gelingen könnte. Wer aber ernstlich den Willen hat, zur Steigerung des Naturgenusses die heimische Vogelwelt kennenzulernen, dem sei gesagt, daß es keineswegs schwer ist, sich diese Fähigkeit anzueignen. Ein beträchtlicher Teil der Vögel des Waldes ist auch in Gärten und Parkanlagen sowie auf Friedhöfen anzutreffen, überall dort, wo auf größerem Raume Bäume und Buschwerk beisammenstehen, und hier gibt es während des ganzen Jahres, selbst im Winter Gelegenheit, eine ganze Anzahl Vogelstimmen und deren Urheber festzustellen. Ein offenes, aufnahmewilliges Ohr und ein gutes, schauensfreudiges Auge sind allerdings Vorbedingung dazu. Waldrotschwanz, Amsel, Singdrossel, Star, Buchfink, Kohlmeise, Blaumeise, Sumpfmeise, Kleiber, Fliegenschnäpper, Zaunkönig, Grasmücken der verschiedensten Arten und häufig auch die Ringeltaube, sie alle sind, obgleich echte Waldvögel, entweder schon im Stadtbild selbst oder sicher in dessen Umgebung zu Hause.
Wer im Walde die Vögel »verhören« will, muß schon im Frühling damit beginnen, wenn die Kronen der Bäume und die Gebüsche noch gar nicht oder erst spärlich belaubt und die Zugvögel noch nicht zurückgekehrt sind. Vom März ab erscheinen sie nach und nach, und zwar in zunehmend rascher Folge, wieder in ihrer Brutheimat, und je mehr ihrer sind, desto schwieriger wird es, die Arten auseinander zu halten. Wer vorzeitig die Geduld verliert und keine wirkliche Herzensfreude beim Vogelstudium empfindet, der wird nie »vogelsprachekund«. Hier kann infolge der Artenfülle nicht mehr als ein kurzer Überblick der Laubwaldvögel geboten werden.
Am leichtesten sind die Meisen erkennbar, von denen vier Arten den Laubwald bewohnen, Kohl- und Blaumeise, Sumpfmeise und Schwanzmeise, alle vier reizende Geschöpfe, zum Teil hübsch bunt, wie die Farbtafeln zeigen. Sie wandern nicht mit den Zugvögeln fort, wenn im Herbst die grauen Nebelgespenster die Blätter von Bäumen und Sträuchern pflücken, sondern halten tapfer als »Standvögel« aus. Allzeit lebhaft und gut gelaunt, beständig sich zurufend oder lockend, bringen sie Leben in den Wald, gleichviel ob er maiengrün geschmückt ist oder sich im Winterkleid zeigt. Seßhaft sind sie nur in der Brutzeit, später streifen sie weit umher, nicht nur mit ihresgleichen vereinigt, sondern auch mit verwandten Arten. Bezeichnend sind ihre Lautäußerungen. Der Zuruf »pink pink pink« der Kohlmeise ( Parus major) erinnert etwas an den Finken, klingt aber wesentlich heller bei ihr. Besonders klangschön sind die Rufe, die sie im Frühjahr hören läßt. Bald tönen sie wie Glöckchenläuten in längerer Folge »sididn sididn …«, ein andermal wie »tiwüdiwüdi« und wieder zu einer anderen Stunde wie »fidlfidlfidlfidl«. Sehr hübsch klingt ferner eine Tonfolge, die der Volksmund mit »Sitz i da« übersetzt. Bei Gefahr ruft die Kohlmeise zeternd »terrrr«, in der Aufregung häufig laut »zäzäzäzä«. Die Stimme der Blaumeise ( Parus caeruleus) ist viel schwächer (entsprechend ihrer geringeren Größe) und außerdem fehlt ihr meist Wohllaut und Klang. Das in der Umgangssprache der Meisen dauernd vernehmbare schlichte »Sit« wird bei der Blaumeise oft unterbrochen durch ein scharfes »Zizitätätäh«. Die Sumpfmeise ( Parus palustris), die entsprechend ihrem Namen die Nähe von Gewässern liebt, erkennt man an ihren Rufen »djäh djäh«, aus denen nicht selten ein längeres Zetern: »djähdädädä« zu entstehen pflegt. Für die Schwanzmeise ( Aegithalus caudatus) ist besonders der Lockton »ti ti« bezeichnend, sowie ihr schneidender Warnruf »terrrr«.
In der Gesellschaft streifender Meisen bemerken wir häufig zwei Stammkletterer, die sich wegen ihrer geringen Scheu aus nächster Nähe beobachten lassen. Der eine ist der bunte Kleiber ( Sitta europaea), der andere der Baumläufer oder Baumrutscher ( Certhia familiaris), beide auf unseren Farbentafeln ausgezeichnet dargestellt. Der Kleiber, gleich den ihm verwandten Meisen ein in Höhlen brütender Vogel, trägt seinen Namen nach der Gewohnheit, das meist zu weite Schlupfloch der Nisthöhle mit Lehm oder anderer klebriger Erde auf einen Umfang zu »verkleiben«, daß er gerade hindurchschlüpfen kann. Eine zweite Begabung, die er allein unter allen deutschen Vögeln besitzt, befähigt ihn, nicht nur stammaufwärts zu hüpfen, sondern auch kopfunter herab. Beim Klettern ruft er fortwährend »sit«, zuweilen auch flötend »tü tü tu«, und in der Paarungszeit verrät ihn ein weithin hörbarer pfeifender Ton. Der Baumläufer klettert nach Art der Spechte, das heißt er stützt sich dabei auf den Schwanz. Die Federkiele sind versteift und die widerstandsfähigen Federenden werden dem Stamm fest angedrückt. Starke Bäume mit rauher Rinde zieht der Baumläufer anderen vor. Tief unten fliegt er den Baumstamm an, klettert unter beständigen Sit-Rufen ruckweise bis zur Krone empor und sucht dann die stärkeren Äste noch ab. Bei dieser Gelegenheit zeigt er uns, daß auch er seine Sonderbegabung besitzt. Er rutscht an der Unterseite der Äste genau so behend und sicher entlang wie auf der bequemeren Oberseite, was ihm die Spechte nicht nachmachen können.
Von diesen treffen wir im Laubwald zwei Vettern des Großen Buntspechts an, den wir vom Nadelwald her bereits kennen, den wesentlich schlankeren Mittelspecht ( Dendrocopus medius) und den Kleinspecht ( D. minor), der nicht viel größer ist als der Kleiber. Eine unserer Farbentafeln führt ihn uns naturgetreu vor. Beim Mittelspecht sind beide Geschlechter durch einen hochroten Scheitel geschmückt und das Karminrot des Aftergefieders reicht nahezu bis an die Brust herauf, um dann in Rosenrot zu verblassen. Seine Anwesenheit verrät er zuweilen durch ein beim Platzwechsel ausgestoßenes weit vernehmbares »Gägägäg«, öfter jedoch schreit er »Kickickickick« und erinnert dadurch an den großen Verwandten, der aber während der Paarungs- und Brutzeit nur den Nadelwald bewohnt. Beim Kleinspecht klingen die Rufe ähnlich, nur schwächer, höher und mehr gezogen. Das Scheitelrot ziert nur den männlichen Vogel. In Wesensart und Lebensweise ähneln die beiden Laubwaldspechte im allgemeinen dem großen Vetter wie überhaupt den meisten Spechten, worüber auf Seite 194 ff. das Nötigste gesagt worden ist.
Zu all diesen Turnern und Kletterern, die dauernd in der Heimat weilen und wacker den kalten Wintern trotzen, gesellen sich noch zwei weitere Vögel, ein winzig kleiner im schlichten Kleid und ein krähengroßer im schmucken Gewand mit himmelblauen Achselklappen, der Zaunkönig ( Troglodytes troglodytes) und der Eichelhäher ( Garrulus glandarius). Der kleine tummelt sich gern im Buschwerk oder im unteren Zweigwerk der Bäume, am Waldrand oder am Saum einer Lichtung, der andere überall im Walde, je nach Laune und Nahrungsbedarf. Ein »Zerrr« oder »Zerz«, das sich bald danach in ein vielfaches »Zeck zeck zeck« verwandelt, kann nur aus Zaunschlüpfers Kehle stammen, und wenn wir Glück haben, hören wir später auch seinen markigen Gesang, aus klangvoll-pfeifenden Tönen gebildet und durch einen jubelnden Triller beschlossen. Der Eichelhäher ist kein Sänger, aber ein Tonkünstler ist auch er. Bald schreit er kreischend »räh« oder »rätsch«, bald ruft er »miau« wie eine Katze, und wenn er bei guter Laune ist, gewöhnlich in der Paarungszeit, hört man von ihm ein buntes Geschwätz, das von fern an Menschenstimmen gemahnt, unter denen auch die eines Bauchredners ist. Sein weniger lustiger Verwandter, der braune, weißgefleckte Nuß- oder Tannenhäher ( Nucifraga caryocatactes) ist nur in den Mittelgebirgen zu Haus, und zwar im geschlossenen Nadelwald.
Vom März ab mischen sich Zugvögel ein. Der Star eröffnet als erster den Reigen und singt vom Tage des Eintreffens an sein fröhliches, kunterbuntes Lied, als wäre er gar nicht fortgewesen. An sonnigen
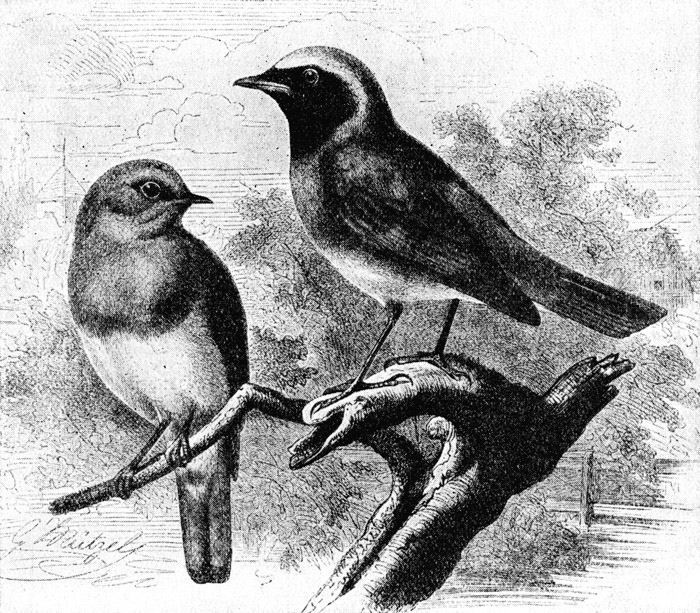
Rotkehlchen (
Erithacus rubecula) und
Waldrotschwanz (
Phoenicurus phoenicurus)
Das Rotkehlchen kommt zwar häufig im Laubwalde vor, noch mehr jedoch im Nadelwald und wurde deshalb bei diesem geschildert (S. 205).
Der Rotschwanz ist unterseits lichtrostrot gefärbt, und die gleiche Färbung zeigt der Schwanz. Die Kehle ist schwarz, die Stirnplatte weiß.
Tagen ruckst die Hohltaube ( Columba oenas) im hohen Wipfel ihr dumpfes »Uru uru uru«, wahrscheinlich auf demselben Baum, der ihr im Vorjahr die große Höhle für den Vollzug ihres Brutgeschäfts bot. Auch die Singdrossel ( Turdus philomelos) mit gelblichweißer Unterseite, prächtig mit braunen Flecken besät, ist Ende März aus der Fremde zurück und bereitet mit ihrem herrlichen Sang auf die Meisterin, die Nachtigall, vor. Oft wird sie sogar mit dieser verwechselt, weil sie in der Tat in einzelnen Strophen der Königin unter den Sängern gleicht, doch mangelt dem Drosselschlage der Schmelz und die wundersam weiche Modulation. Die Singdrossel denkt überdies nicht daran, sich vor ihren Zuhörern zu verbergen, wie es der Nachtigall meistens beliebt, sie singt vielmehr allen Blicken sichtbar vom Wipfelzweig eines Baumes herab. Ein gleiches tut die verwandte Amsel ( Turdus merula) in gleichmäßig schwarzem Federkleid mit schön orangegelbem Schnabel (das braune Weibchen besitzt ihn nicht), die durch ihr feierlich klingendes Flöten die Poesie des grünen Laubwalds bis in die Gärten der Großstadt trägt. Die Rufe »tak tak« oder »tix tix tix« sind beiden Drosselarten zu eigen, doch läßt die Singdrossel außerdem ein durchdringendes »Zieh« oder »Tsi« vernehmen und häufiger noch ihren Lockton »zipp«, dem sie ihren Volksnamen »Zippe« verdankt.
In der zweiten Aprilhälfte, teils etwas später, erscheinen die zarten Grasmückenarten, die nicht ganz leicht zu erkennen sind, weil ihnen die farblichen Kennzeichen fehlen. Alle sind vorherrschend grau befiedert (der etwas befremdliche Name »Grasmücke« ist dem althochdeutschen gra-smiege, das heißt Grauschlüpfer, nachgebildet). Nur am Plattmönch oder Schwarzplättchen ( Silvia atricapilla) fällt die Färbung der Kopfplatte auf (beim Männchen schwarz und beim Weibchen braun) und an der Sperbergrasmücke ( S. nisoria) die Brust, die wie beim Sperber geschuppt erscheint. Man muß sich bei diesen zierlichen Sängern, die meist im dichten Buschwerk hausen, mehr auf das Ohr als aufs Auge verlassen, wenn man sie kennenlernen will, und braucht außerdem etwas Übung dazu. Das Lied des Plattmönchs gehört zu dem Schönsten, was Vogelkehlen hervorbringen können. Nach einem hastigen Gezwitscher folgen flötenartige Töne von solcher Reinheit, Stärke und Klangfülle, daß man in helles Entzücken gerät. Ähnlich bezaubernd ist das aus sanften und dennoch lauten Flötentönen bestehende Lied der Gartengrasmücke ( S. borin), das wegen der langen Melodie, die der Sänger in mäßigem Tempo vorträgt, von manchen Vogelstimmenkennern noch mehr geschätzt wird als das des Mönchs. Gleich mannigfaltig, doch weniger klangvoll ist der Gesang der Dorngrasmücke ( S. communis), aus einem zwitschernden Piano und lauteren, rauheren Forte gebildet, während für die Zaungrasmücke ( S. curruca) besonders das Schlußstück ihres Liedes, ein klingendes oder klapperndes Trillern (daher auch der Name »Müllerchen«), ein sehr bezeichnendes Merkmal ist. Die Sperbergrasmücke ist erkennbar an ihrem sonderbar schnarchenden »Errr«, das sie entweder dem Liede einflicht oder auch einzeln hören läßt, zumal wenn sie ihren Sitzplatz wechselt.
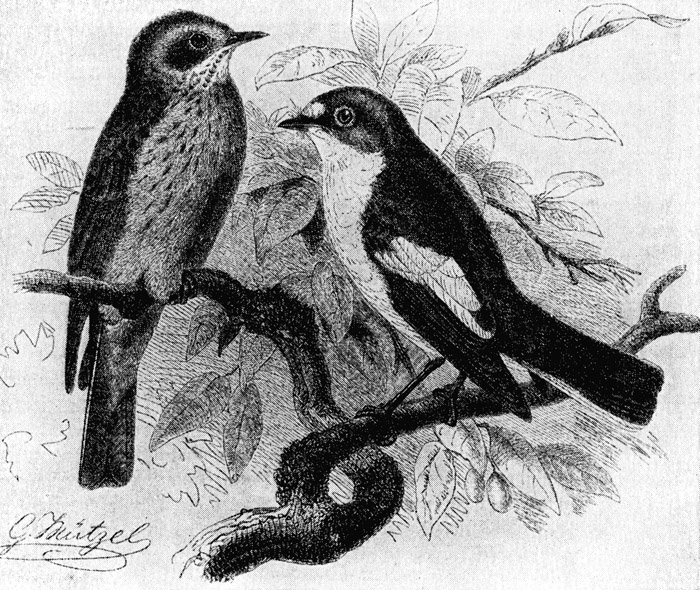
Grauer Fliegenschnäpper und Trauerfliegenschnäpper (Stark verkleinert)
Mehr im Laubdach als in der Buschschicht halten sich die Laubsänger auf, von denen drei Arten bemerkenswert sind, der Waldlaubsänger oder Schwirrer ( Phylloscopus sibilatrix), der Fitis ( Ph. trochilus) und der Weidenlaubsänger ( Ph. collybita). Alle sind aus der Entfernung betrachtet vorwiegend grünlichbraun gefärbt mit schwer zu erkennenden Unterabzeichen und deshalb auch wieder mehr an der Stimme als am Gefieder zu unterscheiden. Der Schwirrer bestätigt seinen Namen, denn erstens »schwirrt« er während des Singens mit zitternden Flügeln durch die Luft, gewöhnlich von einem Zweig zum andern, und zweitens »schwirrt« seine Weise selbst, in nüchterne Buchstaben übersetzt etwa wie »sisisisisirrrrrirrirr«. Am Schluß pflegt er dann noch sanft und schmelzend zwei- oder dreimal »hoid« zu rufen. Das Fitislied ist zusammengesetzt aus einer Reihe klangschöner Töne: »hüid hüid hoid hoid …«, und das des besonders sangesfrohen, sehr weit verbreiteten Weidenlaubvogels, der oft auch im Gebüsch umherstreift, tönt auffallend einsilbig und doch lustig in endlosem Gleichklang und langsamem Zeitmaß: »zilp zalp zilp zalp …« oder in anderer Übersetzung: »dilm delm dilm delm« und so fort.
Gegen Ende April trifft die Nachtigall ( Luscinia megarhyncha) aus ihrer Winterherberge ein, ungefähr gleichzeitig mit dem Kuckuck ( Cuculus canorus), und in der ersten Hälfte des Mai stellt sich als letzter der Pirol, der »Pfingstvogel« oder »Vogel Bülo« ( Oriolus oriolus), in unsern Laub- oder Mischwäldern ein. Pirol und Kuckuck sind schmucke Vögel, doch geht so etwas wie ein Gesetz durch die gesamte Vogelwelt, die tropische mit eingeschlossen, daß die mit prunkenden Farben geschmückten oder sonst augenfälligen Vögel in stimmlicher Hinsicht meist unbegabt sind. Der Pirol in seinem goldgelben Kleide mit schwarzen Flügeln und schwarzem Schwanze mutet uns an wie ein Tropenvogel und bringt aus seiner Singvogelkehle nur einen einzigen Ruf hervor, der allerdings klangvoll flötend ertönt und in engen Grenzen auch wandelbar ist. Gewöhnlich ruft der Pirol »gidleo« (der Nachdruck liegt auf der zweiten Silbe), oft aber wird dieser Flötenruf in ein »Gidilio« abgeändert, zuweilen auch in »gitadidlio«, mit dem Ton auf der vorletzten Silbe. Noch schlichter ist der Kuckucksruf, der in Wirklichkeit nicht wie der Name des Vogels, sondern wie »u-u« erklingt, wobei das erste »u« kurz und scharf, das zweite gedehnt aus der Kehle kommt. Der Frühlingsrufer ist immer ein Männchen. Das Weibchen hat einen kichernden Ruf, der sich entweder wie »jikikickick« oder wie »kwickwickwick« anhört und einem harten Triller ähnelt, doch nicht entfernt so häufig erklingt wie der bekannte Männchenruf. Die Weibchen sind stark in der Minderzahl, und wahrscheinlich ist dieses Mißverhältnis zwischen der Häufigkeit der Geschlechter mit schuld an dem Brutschmarotzertum, das sich unter allen deutschen Vögeln allein bei unserm Kuckuck findet. Es ist ja bekannt, daß das Kuckucksweibchen weder selbst ein Nest erbaut noch seine Eier selbst erbrütet. Es schmuggelt sie in fremde Nester und überläßt es den Eigentümern, das Ei mit den ihrigen auszubrüten und dann den Wechselbalg aufzuziehen. Gewöhnlich kriecht er als erster aus und hat dann nichts Besseres zu tun, als die in kurzen Zeitabständen nach ihm schlüpfenden Stiefgeschwister gewaltsam aus dem Neste zu werfen und so dem Tode zu überliefern. Wie bei verschiedenen Hühnervögeln die »Vielweiberei « zu einer Schwächung des Brutpflegetriebs der Weibchen führte, so hat vermutlich bei unseren Kuckucken umgekehrt die »Vielmännerei« den Anstoß zu der Verwilderung ihrer Ehe- und Brutpflegesitten gegeben. Die stürmischen Männchen ließen die Weibchen einfach nicht zur Ruhe kommen.
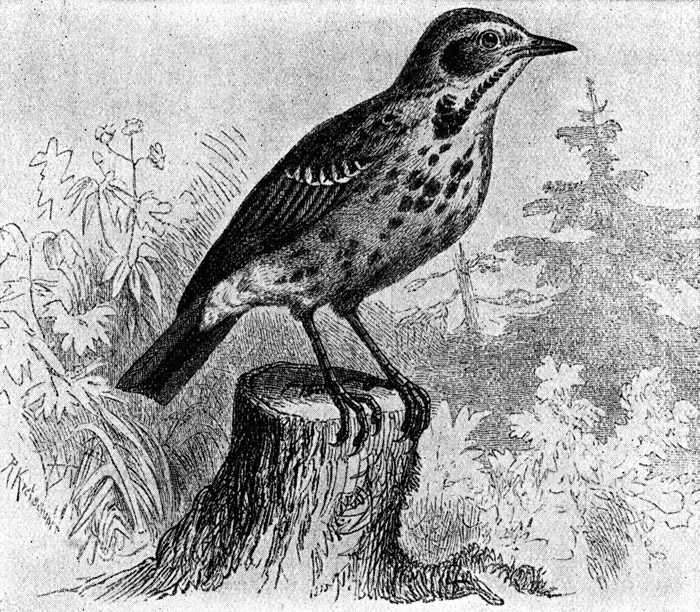
Der Baumpieper ( Anthus trivialis), ein oft am Laubwaldrande anzutreffender Vogel, der gewöhnlich vom Wipfel eines mittelhohen Baumes aus sein Lied vorträgt, das in einzelnen Tonfolgen deutlich an den Gesang des Kanarienvogels erinnert und in der Regel mit einem herabgezogenen »Zia zia zia« abschließt. Oft steigt er singend schräg in die Luft empor und kehrt auch singend in derselben Flugbahn auf seinen Zweig zurück.
Das obenerwähnte Gesetz des Ausgleichs: Gefiederschönheit – Stimmenarmut, Gesangsbegabung – äußere Schlichtheit, bestätigt sich wie bei Pirol und Kuckuck auch bei der Primadonna des Waldes, der Sängerkönigin Nachtigall. Im einfachen, schmucklosen Alltagskleide, oberseits rostbraun und unterseits graugelb, bietet sie sich dem Beobachter dar, doch wenn sie im Dämmerschein des Abends oder morgens vor Anbruch des neuen Tages ihren Gesang erschallen läßt, dann, meint man, müsse alles schweigen, was Lieder und Töne hervorbringen kann. Aus zwanzig bis vierundzwanzig Strophen setzt sich der Nachtigallschlag zusammen, alle durch kurze Pausen getrennt. Sanft flötende wechseln mit schmetternden ab, klagende mit fröhlichen, schmelzende mit wirbelnden. Hört man dieselbe Strophe des Liedes einmal laut und einmal leise, jetzt schnell und dann feierlich vorgetragen, so kann man sich, wie Alwin Voigt, der Vogelsprachenkundige, sagt, nur schwer der Überzeugung verschließen, der Sänger bringe einen Wechsel von Stimmung und Empfindung zum Ausdruck, der an Menschliches heranreicht. Nie werde ich den Frühlingsabend und das Entzücken wieder vergessen, mit dem mich im Auwald bei Steckby in Anhalt, dem herrlichen Forst des Grafen Dürckheim, jetzt Mustervogelschutzgebiet, ein Dutzend Nachtigallen erfüllten, die aus dem Unterholz heraus ihr Glücksempfinden und Liebesverlangen dem schweigsamen Walde anvertrauten. Nicht im geselligen Verein, sondern jede in gemessenem Abstand von ihrer Nachbarin und Rivalin, und jede in anderer Vortragsweise und Tonfolge ihre Strophen formend. In solchen Stunden wird man sich klar, daß die Natur zwar Gewaltigeres an Lautäußerungen hervorbringen kann, doch schwerlich etwas Erhabeneres. Nicht selten hört man die Nachtigall auch während der lichten Tageszeit schlagen, doch wirkt ihr Gesang dann nicht so bezaubernd, als wenn er die Abendstille durchdringt. Ihren Lockruf, ein lautes »Hüitkarr«, läßt sie sehr häufig am Tage hören.
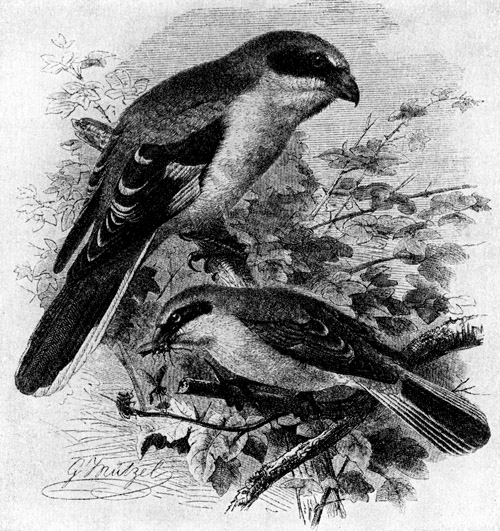
Raubwürger (oben) und
Rotrückiger Würger
(Auf etwas über die Hälfte verkleinert)
Um dieselbe Zeit, wenn der Kuckuck ruft und der Pirol sein »Gidleo« flötet, beginnt im lichten Laub- oder Mischwald die Turteltaube ( Turtur turtur) in früher Morgenstunde zu rucksen, gewöhnlich hoch, aber dennoch sichtbar auf einem dürren Wipfelzweig sitzend. Sie ist die kleinste unserer Wildtauben, und ihre Rufe »turr turr turr« unterscheiden sie leicht von dem dumpfen »Uru uru« der mohnblauen Hohltaube und dem Ahuh-kukuhuh-Geruckse der an ihren weißen Halsabzeichen leicht zu erkennenden Ringeltaube ( Columba palumbus).
Gleichzeitig mit den Turteltäubchen treffen zwei zierliche Singvögel ein, der oberseits graue und unterseits weißliche, dunkelgestrichelte Fliegenschnäpper ( Muscicapa grisola) und sein viel hübscherer Verwandter, der schwarzweiße Trauerfliegenschnäpper ( M. atricapilla), in Auwäldern oft der häufigste Vogel. Beide lieben offene Waldstellen, um nach Insekten Ausschau zu halten, die Beute gewandten Flugs zu erhaschen, wobei man das Schnabelklappen hört, und dann auf die Warte zurückzukehren. Beim Platzwechsel oder beim Niederlassen zucken sie neckisch mit den Flügeln. Der Zuruf des Grauen klingt »tschri« oder »tschie«, oft läßt er ein leises »Pst pst« vernehmen und dann wieder Laute wie »tze«, »zrr«, »zrp«, zuweilen zwitschernd zusammengefügt. Der Schwarzweiße lockt kurz »bit bit bit«, hängt öfters noch ein »teck« hintendran und bringt auch ein kleines Liedchen zustande, in dem die Silben »tiwutiwu« sich taktmäßig auf und ab bewegen.
Und noch einen interessanten Vogel, weit stattlicher als die Fliegenschnäpper, führt uns der Wonnemond wieder zu, den etwa stargroßen Rotrückenwürger ( Lanius collurio), dessen Federkleid schmuck und ansprechend ist. Auf dem Rücken ist es prächtig rostrot, an Brust und Bauch rosenrot überhaucht und auf dem Oberkopf grau gefärbt. Wes Geistes Kind dieser Würger ist, verrät uns außer seinem Namen der hakig gekrümmte Oberschnabel, der ihm etwas Raubvogelhaftes verleiht, und wie ein Räuber sitzt er gewöhnlich auf einem hohen und freien Ausguck, am liebsten am Waldrand, wo Dornbüsche stehen, in denen er auch sein Nest verbirgt. Meist »würgt« er allerdings nur Insekten, Hummeln, Käfer oder Grashüpfer, was ihm gerade vor Augen kommt, nicht selten jedoch auch Singvogeljunge, solange sie unbefiedert sind. Die Beute spießt er vor dem Verzehren gewohnheitsmäßig auf spitze Dornen und speichert so häufig mehr Vorrat an, als er zur Stillung des Hungers braucht. Neuntöter, Dorndreher nennt ihn das Volk. Seine häufigsten Rufe sind »grä« und »gäck gäck«, beim Fortfliegen läßt er in der Regel ein gedehntes »Grä-i« vernehmen, das in der Erregung vervielfacht wird. Der Nachdruck liegt immer auf dem »i«. Weit schlimmer als er ist der selten gewordene, doppelt so große Grau- oder Raubwürger ( Lanius excubitor), oberseits grau und unterseits weiß, Flügel und Schwanz teils schwarz, teils weiß, so wie sie unsere Abbildung zeigt. Als Standort bevorzugt er gleichfalls den Waldrand, als Lugaus einzelstehende Bäume auf den benachbarten Feldern und Wiesen. Im Herbst und im Vorfrühling streift er umher, denn seine Heimat verläßt er nie. In seinen Gewohnheiten ähnelt er im großen ganzen dem kleineren Vetter, nur schlägt er bedeutend größere Beute und ist ein gefährlicher Kleinvogelfeind.
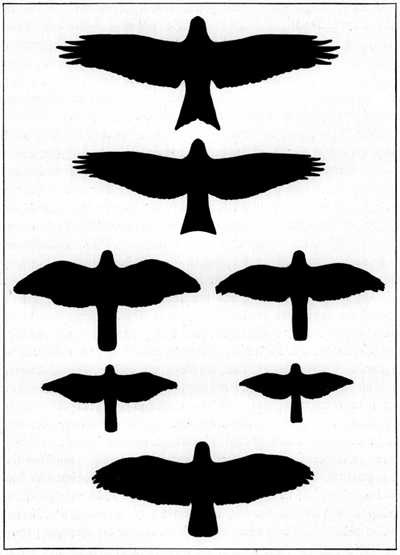
Flugbilder waldbrütender Raubvögel
Von oben nach unten: Roter Milan,
Schwarzer Milan,
Habicht (Weibchen und Männchen),
Sperber (Weibchen und Männchen),
Mäusebussard.
Nach Martin Herberg.
Vom Raubwürger bis zu den echten Raubvögeln ist der Weg nicht allzu weit. Aber auch sie sind schon selten geworden, und nicht jeder Laubwald beherbergt sie mehr. Zwei Arten, die auch im Nadelwald brüten, sind uns von dorther schon bekannt, der Habicht oder Hühnerhabicht und sein kleinerer Vetter, der Sperber, von Jägern und Landleuten »Stößer« genannt. Der erste, ein großer, kräftiger Vogel mit einem Meter Flügelspannung, ist nicht ohne Grund der Meistgehaßte, denn er ist unser gewandtester und obendrein verwegenster Räuber. Fliegende, sitzende, laufende Beute schlägt er mit gleicher Sicherheit, vom kleinen Sänger bis zum Rebhuhn, von der Waldwühlmaus bis zum Hasen hinauf, im freien Feld wie im Wald oder Busch. Der Sperber ist sein Ebenbild im Aussehen wie in Wesens- und Jagdart, nur viel geringer an Körpermaß. Die andern im Laubwald brütenden, doch nicht in ihm jagenden Raubvogelarten sind harmloser als diese wilden Stürmer, teils nützliche Helfer der Landwirtschaft, vor allem der stattliche Mäusebussard ( Buteo lagopus) und der taubengroße Turmfalk ( Falco tinnunculus). Zwei Weihen, der Schwarze und Rote Milan, dieser auch Gabelweihe genannt ( Milvus migrans und M. milvus), sind zwar vom menschlichen Standpunkt gesehen unerfreuliche Taugenichtse, doch nicht entfernt so schlimm wie der Habicht und sein kleinerer Spießgesell. Der Schwarze Milan liebt Wassernähe, weil er gelegentlich Fischfang betreibt, und brütet daher nur in Auenwäldern.
Im Walde selbst bekommt man die Vögel außer der Brutzeit schwer zu Gesicht, um so mehr aber, wenn man die Horste kennt und wenn Ende Mai oder anfangs Juni der junge Nachwuchs ausgeschlüpft ist. Es ist sehr reizvoll, aus guter Deckung und mit dem Fernglas in der Hand den An- und Abflug der alten Vögel, die Verteilung ihrer Beute, kurz ihr Verhalten am Nest zu erkunden, vor allem, wenn das Jungvolk im Horste so weit herangewachsen ist, daß es schon fest auf den Beinen steht. Weithin zerstreut liegen unter dem Brutbaum die Überreste der Beutetiere, zuweilen wohl auch ein toter Sänger, der den Schnäbeln entglitten ist. Lange indessen liegt er nicht da, wie es überhaupt sehr auffallend ist, daß man im Walde und anderswo höchst selten verendete Vögel findet, obgleich doch viele aus ihren Reihen eines natürlichen Todes sterben. Die Natur begräbt ihre Toten rasch. Findet sich kein hungriger Nager, um den Leichnam fortzuschleppen, so kommen anderntags hübsch gezeichnete große Aaskäfer angesurrt, vom Verwesungsgeruch herbeigezogen, und unterwühlen die Leiche so lange, bis sie ins Erdreich versunken ist. Dann legen sie Eier an ihr ab. Totengräber ( Necrophorus vespillo) heißen bezeichnend die bunten Käfer, dieselben, die unsere erste Farbtafel bei einer Goldhähnchenbestattung zeigt.
In der Nähe des Waldes und über ihm sieht man die Habichte, Bussarde, Milane oft genug sich im Blau vergnügen, vor allem an heiteren Frühlingstagen. Die Paare, die sich zusammenfanden, steigen dann hoch in die Luft hinauf und führen oft viertelstundenlang die wundervollsten Flugreigen auf. Schwerelos wiegen sie sich in Kreisen, lange Zeit ohne Flügelschlag, begegnen und trennen sich auf ihrer Flugbahn, übersteigen abwechselnd einer den andern und treiben das hübsche Spiel so fort, bis einer von beiden die Flügel anzieht, um auf den Wald herabzustoßen, zuweilen in hörbar sausendem Sturz. Der Gefährte folgt meistens gleich hinterdrein.
An Hand unserer Flugbilder sind die Vögel nach längerer Beobachtungszeit mit ziemlicher Sicherheit festzustellen, wenn man genau auf die Merkmale achtet, erstens auf Länge und Form des Schwanzes und zweitens auf die Flügelgestaltung. Beim Bussard sind die Schwingen breit, bei Habicht und Sperber zugespitzt. Die Milane unterscheiden sich durch den tief oder flach gegabelten Schwanz. Und noch ein paar Kennzeichen seien genannt. Der Habicht führt stumm seine Flugspiele auf, während der Bussard und die Milane oft ihre Stimmen erschallen lassen. Die gezogenen Rufe »hiäh hiäh« stößt nur der Mäusebussard aus, die Milane rufen in beiden Arten fleißig »hiäh hi hi hiäh« und lassen außerdem zuweilen ein lautes trillerndes Pfeifen hören. Bei einem kreisenden Habichtspaar ist der größere Partner immer das Weibchen.
Mit dieser Betrachtung der Waldraubvögel sei unser Überblick abgeschlossen. Wir haben das gefiederte Völkchen durch den Frühling und Sommer begleitet und aller für den Waldwanderer bemerkenswerten Arten gedacht. Unser letzter Waldgang soll uns noch einmal in den verschneiten Winterwald führen.
Wenn im Herbst die zarteren Sommervögel nach wärmeren Ländern abgereist sind, wird es im Laubwald stiller und stiller. Am Boden raschelt das bunte Herbstlaub, unter dem es von allerlei Kleingetier wimmelt, von wachendem und schlafendem. Nur Eichen und Buchen halten die Blätter als Andenken an den Sommer fest, wie scharf auch der Wind durch das Astwerk faucht. Siebenschläfer und Haselmäuse schlummern in ihren Winternestern, der Igel zog sich gleichfalls zurück, als die Nahrung knapper und knapper wurde, und wenn erst der Winter zur Herrschaft kommt, ist von der lauten Waldsommerlust nur noch ein leiser Nachhall vernehmbar.
Wiederum ist es die Vogelwelt, die das Schweigen im Walde nicht aufkommen läßt, mindestens nicht auf längere Dauer. Der Zaunkönig, scheint's, hat noch gar nicht bemerkt, daß der Winter ins Land gezogen kam. Denn genau so kräftig wie im Frühjahr schmettert er sein Lied in den Wald, und dem Meisenvolk, den Kleibern und Goldhähnchen macht es ebenfalls nichts aus, daß die Zweige der Büsche und Bäume verschneit sind. Sie wissen den Schnee schon herabzuschütteln, wo er Insektenverstecke umhüllt, sonst wären sie nicht so rosig gelaunt. Der Eichelhäher schwatzt zwar nicht mehr, »rätscht« aber noch wie zur Sommerszeit, und die Buntspechte lachen dem Griesgram, dem Winter, geradezu ins Angesicht mit ihrem hallenden »Kickickickick«.
Wo aber sind die Säugetiere? Wo steckt das Großwild, wo der Hase, der angeblich vor den Winterstürmen Schutz und Obdach im Walde sucht? Wohin sind Fuchs und Marder verschwunden, von denen doch keiner die Gabe besitzt, sich wie der Dachs oder wie das Eichhörnchen wochenlang zurückzuziehen, bis wieder einmal sonnige Tage die klirrende Kältezeit unterbrechen? Nun, die Natur hat Buch geführt. Urkundlich weist sie den Verbleib der unsichtbar Gewordenen nach, denn über Nacht ist Neuschnee gefallen, und der Nacht, vom Licht der Sterne erhellt, sind viele Waldtiere, wie wir wissen, nicht weniger hold als dem Sonnenschein.
Wer nie ein Stück Wild im Walde sah, nie einen Fuchs zu Gesicht bekam und von »Waldhasen« immer nur reden hörte, der ist überrascht durch die große Zahl der vielfach sich kreuzenden Spuren und Fährten, die er auf wohlbekannten Wegen, an lichten Stellen oder auf Blößen, besonders auch auf den Feldern und Wiesen, die unmittelbar am Walde liegen, im frisch gefallenen Schnee entdeckt. Er blickt in ein rätselhaftes Buch, dessen Schriftzeichen durcheinanderlaufen und die er nicht zu entziffern vermag, weil ihm der Schlüssel dazu fehlt. Tafel 66 und 67, von dem bekannten Jagdmaler Karl Wagner in einprägsamer Weise geschaffen, liefern ihm den Geheimschlüssel aus. Alle wichtigen Spuren und Fährten sind derart zusammengestellt auf den Bildern, daß nicht bloß die einzelnen Fußabdrücke, die »Trittsiegel«, wie der Jäger sagt, nach ihrer Form zu erkennen sind, sondern auch der Verlauf der Spuren und weiterhin das Größenverhältnis, in dem sie zueinander stehen. »Fährten« sind in der Weidmannssprache die sich reihenweis folgenden Tritte der geschätztesten Jagdtierarten, des sogenannten »Schalenwildes« (mit »Schalen« bezeichnet der Jäger die Hufe), zu dem außer Rothirsch, Damhirsch und Reh auch das bei uns in freier Wildbahn selten gewordene Wildschwein zählt. »Spuren« heißen die Fußabdrücke aller übrigen Waldsäugetiere, die statt der Hufe »Pfoten« besitzen, vom Fuchs und Dachs bis zum Marder und Eichhorn, auch Hund und Hase mit eingeschlossen.
Der Forstmann, der sein Revier »abspürt«, zieht aus den Fährten sichere Schlüsse auf Kopfzahl, Geschlecht und Stärke des Wildes, dem Wald- und Naturfreund jedoch genügt es, die Art der Tiere festzustellen, die vor ihm den gleichen Weg beschritten, und dieser Teil der »Fährtenkunde« bedarf keines langen Studiums. Die Trittsiegel der Hirsche und der Rehe ähneln sich in der äußeren Form, sind aber gewöhnlich leicht unterscheidbar durch ihr verschiedenes Größenmaß. Beim »vertrauten Ziehen«, das heißt im Schritt, wird in der Regel der Hinterlauf genau in den Tritt des Vorderlaufs derselben Körperseite gesetzt. Beim Trab wird die Fährte unregelmäßig, und auf der Flucht lassen alle vier Läufe ihren eigenen Abdruck zurück. Die Wildschweinfährte ist daran kenntlich, daß hinter dem eigentlichen Siegel die Afterzehen mit abgedrückt sind, was bei den Hirschen niemals der Fall ist. Sehr merkwürdig ist die Spur des Hasen, bei deren Anblick der Uneingeweihte sich selten darüber im klaren ist, nach welcher Richtung sie verläuft. Denn ob der Hase gemächlich hoppelt oder mit größter Geschwindigkeit flüchtet, stets setzt er die längeren Hinterläufe vor die Tritte der Vorderläufe, die immer hintereinanderstehen. Die Fuchsspur, in der die vier Zehenballen samt den Krallen abgedrückt sind, hat Ähnlichkeit mit der Spur eines Hundes, vorausgesetzt daß beide »schnürten«, das heißt beim Traben alle vier Läufe in einer schnurgeraden Linie hintereinander niedersetzten. Auf unserem Bilde »schränkt« der Fuchs. Wie schleichend geht er in langsamem Schritt, und die Trittreihe steht in Zickzacklinie. Auf der Flucht ist die Stellung der einzelnen Tritte wieder ähnlich wie beim Hund. Die Spuren der übrigen Säugetiere bedürfen keiner Erläuterung.
So hat uns unser geliebter Wald, bevor wir Abschied von ihm nehmen, noch einmal einen fesselnden Blick in seine Wunderwelt gewährt. Zum wievielten Male? Wir wissen es nicht. Zu oft sind wir in ihn eingekehrt, zu allen Zeiten im rollenden Jahr, bei Sonnenschein und beim Sternenlicht, und jedesmal brachten wir neue Geschenke und Überraschungen mit nach Haus. Wie danken wir ihm, unserm deutschen Wald? Nicht anders, als durch die Übertragung der eigenen Liebe und Treue zu ihm auf die für alles Schöne und Edle so leicht begeisterungsfähige Jugend. Wecken wir ihr Naturgefühl! Erzählen wir ihr, was Deutschlands Wälder für Deutschlands wirtschaftliches Gedeihen, für die Volkswohlfahrt und nicht zuletzt für die Gesundheit der Volksseele sind. Lehren wir sie, daß es sittliche Pflicht ist, den Wald mit allem, was er birgt, vor frevelnden Händen zu behüten, und daß »den Wald lieben« gleichbedeutend mit »seine Heimat lieben« ist.
Die Aufnahmen für die schwarzen Tafeln stammen mit wenigen Ausnahmen von Hermann Fischer, Braunschweig. Fünf lieferte Walter Nöldner, Leipzig, die Vorlagen für die Fährtentafeln die Schriftleitung der Vierteljahrshefte »Lebensblätter« der Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank. Die anerkannt vorzüglichen Textabbildungen der Waldbäume wurden Roßmäßlers Buch »Der Wald« entnommen. Das Umschlagbild und die Pflanzenbilder im Text schuf Hugo Wolff-Maage.