
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
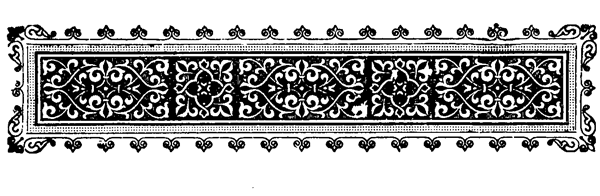
An der vogtländisch-böhmischen Grenze, in einem düsteren Tannicht zieht sich aus einem Quellbrunnen ein Wasserfaden durch Moos und Heidelbeergesträuch hinunter in das Tal, wo er, mit anderen Wasserfäden verbunden und zu einem reichen Bache angeschwollen, an dem schönen Dorfe Elster vorüberzieht und von ihm seinen Flußnamen annimmt, welchen er zugleich seinen Talgründen schenkt, so weit er an Dörfern, Schlössern und Städten vorübergeht, bis zum Grabe Poniatowskys bei Leipzig – und seinem eigenen hinter Merseburg in der Saale. Der immergrüne Tannenwald, in dessen Wurzelarmen die Elster zuerst ihre hellen Augen aufgeschlagen hat, gibt ihr auf ihrer Wanderschaft in die Niederungen so weit das Geleit, als er auf den Hügelketten in ihre Täler herunterklettern kann.
Selbst da, wo die rodende Axt den Wald stundenweit zurückgedrängt hat, verschwindet er nicht ganz aus dem Gesichtskreise, und ehe man es meint, rückt er wieder über die Hügelrücken zu seinem geliebten Kinde herunter.
Dadurch kommt es, daß dieses kleine Ländchen, welches in alten Zeiten dem jedesmaligen deutschen Kaiser gewissermaßen als Schatullengut, mehr aber noch seinen Vögten angehörte, großenteils aus Wald bestanden hat, ehe die treulose Elster sich zur Holzflöße gebrauchen ließ. Doch ist trotz der vielen Rodungen der Feldbau noch heute im oberen Vogtlande von geringem, von größerem Ertrage aber Wiesenbau und Viehzucht, und noch immer finden sich Blöcke für die Sagemühle, Harz für die Pechsiederei, Fichtenrinde für die Rußhütte und auch zartgeädertes Tannenholz für die Geigenmacher im oberen Vogtlande; dennoch gibt es meilenlange Waldstrecken, in deren düsterem Schatten der Kreuzschnabel sein geheimnisvolles Lied singen kann. Auch findet noch immer dort der Bergmann die reichen Eisenerzgänge im Schoße der Berge für die Hochöfen in Morgenröte und Rautenkranz.
Die Menschen, welche in Berggegenden und an dm Quellen der Flüsse wohnen, hegen in sich einen wunderbaren Widerspruch, daheim plagt sie die Wanderlust und in der Fremde das Heimweh. Das eine kann man durch die Fernaussicht von den Bergen hinunter in die Fremde und aus der damit verbundenen Sehnsucht, das Fremde auch kennen zu lernen, vielleicht erklären; zeigt doch oben der Zug der Wolken aus den Wäldern hinunter in die Niederungen, und unten der wanderungslustige Strom den Weg aus den Pforten der Täler hinaus. Doch das Heimweh bleibt unerklärlich wie die Wanderschaft der Vögel im Herbste und ihre Heimkehr im Frühling.
Die Vogtländer halten es aber nach ihrer Art; sie sind die sächsischen Tiroler, nur genügsamer, nur regsamer, nur hartnäckiger in Verfolgung ihres Zieles, doch eben so bieder, wenn auch derber.
Gemischt aus deutschem und slavischem Blute, haben sie das Gute von beiden Arten, wie aus der Kreuzung verschiedener Völker immer ein drittes und vorzüglicheres Geschlecht entsteht, denn die Natur nimmt wenig Rücksicht auf die romantische Idee vom ursprünglichen, unverfälschten Blute; Mesalliance ist eben, was sie will. Daher mag es kommen, daß selbst ein gestähltes Herz, welches daheim den Jungfrauen des Landes glücklich Trotz geboten hat, in der Fremde der Liebe anheimfällt.
Dieselbe Erfahrung hatte ein amerikanischer Kaufmann, Arthur Notham, gemacht, zur Zeit, wo Nordamerika noch unter dem britischen Scepter sich entwickelte. Er hatte eine Reise nach Deutschland unternommen, um sein bedeutendes Handlungsgeschäft, welches er in New-York hatte, durch unmittelbare Verbindungen mit den deutschen Kaufleuten und Fabrikanten noch mehr zu erweitern, denn er war, wie alle Amerikaner, ein Kind der Spekulation. Sein ganzes Gemüt war in seine Kontobücher aufgegangen.
Er stand in dem Vollsaft einer überseeischen Gesundheit, ohne daß ein Funken verächtlicher Schwärmerei durch seinen wattierten, von oben bis unten zugeknöpften Rock in ihn hätte eindringen können; daß keine von ihnen herauskam, dafür sorgte er selbst. So war er nach Gera gekommen und verweilte dort länger, als er früher gedacht hatte. Seine Handelsfreunde hielten dafür, daß ihn das gute Rindfleisch gefesselt hätte; sein Aufenthalt hatte aber eine tiefere Ursache, denn sah sein Gesicht sonst immer aus wie ein schöner, langweiliger Sonntagsnachmittag im Monat August, welcher gar kein Ende nehmen will, so schlich sich jetzt allmählich eine faltige Wolke nach der anderen über seine Stirn. Vergeblich hatte er sich zum besonderen Komfort einen zweiten Stuhl zugelegt, auf welchen er seine transatlantischen Reisestiefel beim Sitzen legen konnte, vergeblich nahm er eine Zigarre nach der anderen aus dem Etui und hüllte sich in Nebel, die Wolken wollten nicht aus seinem Gesichte schwinden. Fast täglich rief er seinen Diener John, welcher mit ihm herübergekommen war, und hieß ihn die Koffer zur Abreise packen. John war der treueste Diener von der Welt, nur hielt er auf seine christliche Freiheit, welche darin bestand, daß er im Zimmer und überall den Hut auf dem Kopfe behielt. Er stand im Gerede, daß er auch mit ihm wie in uralter Zeit ein König mit der Krone, zu Bett gehe. Böse Jungen sagten ihm nach, er trüge darunter einen Vogel, welcher fortfliege, wenn er ihn lüfte.
Trat der alte John mit seinem breitkrämpigen Hute früh an das Bett seines Herrn mit der Meldung, daß alles zur Abreise bereit sei, so hieß es immer: »Pack wieder aus!« Brummend und kopfschüttelnd ging John an die immer neue Arbeit.
So vergingen ein Herbst und ein Winter, Arthur aber blieb in Gera im Gasthof zum Deutschen Hause in seinen Gedanken sitzen.
Er ging wenig aus, nur einen Tag um den anderen nach Leimnitz, einem nahen Dorfe, wo ein alter kaiserlicher Rittmeister wohnte, welcher im Österreichischen Erbfolge kriegelahm geworden war und sich mit seinem Dreimaster und dem mächtigen Haarzopfe dorthin zurückgezogen hatte. Man vergißt selten den Ort, wo es einem wohl geworden ist, und der Rittmeister Lazarus von Thossenfeld war nicht undankbar. Er hatte bei einem Bauer in Leimnitz in Quartier gelegen und Bekanntschaft mit dessen Tochter Maria Theresia gemacht, und nur, wie er vorgab, aus Anhänglichkeit an seine Kaiserin, deren Namensschwester sie war. Doch mochte diese Anhänglichkeit weiter gegangen sein, als es ihrem Vater lieb sein konnte. Eines Morgens stand dieser vor dem Bett des Rittmeisters mit einer Holzaxt und tippte ihm mit ihrem Schaft auf die Schulter, daß der arme Junker vor Schrecken emporfuhr, als hätte ihn die ganze französische Armee überfallen. Der Bauer aber nahm die Axt wagerecht in die Hand und sagte: »Die Therese ist mein einziges Kind und erbt einmal mein schönes Bauergut mit Waldung, Wiese und Feld, Zu- und Einbehör, wie alles liegt und steht; verstanden? – Und das Mädel darf mir keine Schande machen, verstanden? – Und sollte es anders sein, so habe ich gestern meine Axt geschliffen! Was meint der Herr Rittmeister zu dieser Affaire?« Lazarus von Thossenfeld machte ein langes, einfältiges Gesicht, während er doch langsam im Kopfe einen guten und klugen Gedanken herumdrehte. Als er so bei sich bedachte, daß die Maria Theresia freilich keinen adeligen, doch einen kaiserlichen Namen besitze und mit der Aussicht auf die väterliche Erbschaft überhaupt eine Partie sei, fragte er halb verschmitzt, halb verdutzt: »Und wenn ich sie nun heiraten wollte?« – »Topp, es gilt!« rief der Bauer; »Herr Pastor, liebe Nachbarn, tretet herein! komm, Therese, es ist alles gut!« – Und die Gerufenen, welche der kluge Bauer draußen vor der Tür postiert hatte, kamen feierlich herein. Der Pfarrer führte Maria Theresia zu dem Rittmeister, welcher im Bett wie in einer Mausefalle stak, legte Hand in Hand und verlobte beide miteinander mit väterlicher und ihrer eigenen Einwilligung.
An demselben Tage, wo der Rittmeister Marschordre erhielt, fand auch die Hochzeit statt. Der Abschied der Neuvermählten war herzbrechend genug, denn der Rittmeister zog in den Krieg, die Frau Rittmeisterin aber mußte bei ihrem Vater zurückbleiben und ihre Niederkunft abwarten.
Sie genas eines Töchterleins, welches Johanna getauft wurde. Da der Rittmeister zuletzt aus Eger geschrieben hatte, so wurde ihm dorthin die Nachricht gesendet; der Brief kam aber zurück mit dem Bemerken, daß der Inhaber der Adresse irgendwo in der Lombardei stationiert sei. Wir können es zur Schande des Rittmeisters nicht verschweigen, daß er bei seinen Kriegsabenteuern beinahe die Namensschwester seiner Kaiserin vergessen hatte, als ihn an der spanischen Grenze eine Kartätschenkugel invalid machte und an Leimnitz erinnerte. So kam er mit einem natürlichen und einem künstlichen Bein, auf welches er freilich nunmehr eine kleine Pension bezog, nach zehn Jahren zu den Seinen zurück. Sein Schwiegervater war unterdessen verstorben, Maria Theresia aber ihm treu geblieben, wie er selbst seiner Kaiserin.
Es bedurfte für den invaliden Rittmeister nur kurze Zeit, um ihn zum bravsten Ehemann und Vater zu machen. Er wurde mit seiner kleinen Tochter Johanna fast wieder zum Kinde. Sichtbar entwickelte sich das Mädchen zu einer seltenen Schönheit. Von ihrem Vater hatte sie die schönen, schwarzen Augen, von ihrer Mutter das reiche, blonde Haar, welches sie freilich als Standesauszeichnung Sonntags gepudert tragen mußte. In dem rotsamtnen Korsettchen und gründamastenen Reifrock, den weißen Strümpfen mit silbergestickten Zwickeln und den hohen Stöckelschuhen mit roten Absätzen hätte sie sich auch mit jeder adeligen Dame der damaligen Zeit messen können, wenn nicht das blühende Gesicht mit den hellen Augen und den frischesten aller Lippen das Dorfmädchen verraten mußte. Sie war der Stolz ihres Vaters, welcher es an keiner Gelegenheit fehlen ließ, sie zu verhätscheln; er hatte es ihr zu oft gesagt, daß sie das schönste Mädchen sei, warum sollte es sie nicht glauben? Und als sie größer wurde und von den jungen Honoratiorensöhnen in Gera dasselbe hörte, warum sollte sie nicht davon überzeugt sein? Das hätte wohl noch hingehen mögen, denn welches Mädchen hält sich nicht in seinem sechzehnten Jahre vor dem Spiegel für unwiderstehlich? Viel gefährlicher für ihr Gemüt war es, daß Herr Rittmeister Lazarus ihr allen Willen ließ, und sie, wie früher ihre Mutter, doch mit mehr Recht, seine Kaiserin hieß. Ihre Mutter war mit dieser Erziehung ganz einverstanden, zumal er sie versicherte, daß sie so ganz adelig sei.
Er vermied keine Gelegenheit, sein Juwel der Welt zu zeigen, soweit sie vornehm und in Gera zu finden war. Es konnte drüben kein Fest ohne den Rittmeister und seine Familie gefeiert werden; kein Jahrmarkt ging vorüber, welchen er mit ihr nicht besucht hätte. Sein Absteigequartier war das Deutsche Haus am Markte, wo damals österreichisch gekocht, ungarisch getrunken wurde. Zu solcher Zeit fanden sich dort zum Frühstücke die vornehmen Familien aus der Umgegend ein, und nirgends gefiel es dem Rittmeister so, wie dort in der traulichen Weinstube, zumal der Wirt es nie versäumte, ihn unter dem Torwege mit der Samtmütze in der Hand und der Anrede: »Hochwohlgeborner Herr Rittmeister, Dero untertäniger Knecht!« zu bewillkommnen.
An einem Michaelisjahrmarkte saß dort in der Honoratiorenstube der amerikanische Handelsherr Arthur Notham, den rechten Fuß in der linken Hand und die brennende Zigarre in der Rechten. Beide Gegenstände fielen ihm jedoch aus den Händen, als der Rittmeister mit Fräulein Johanna hereintrat. Er fühlte, daß ihm in diesem Augenblicke etwas widerfahren war, was über alle Bilanz hinausging und in Soll und Haben zusammenfiel. In dieser Verlegenheit wußte er zuletzt mit seinen leeren Händen nichts anzufangen; bald legte er sie über das rechte, bald über das linke Knie, bald fuhr er wieder mit der einen oder anderen in die Weste, nur seine Augen wußten, wohin sie blicken sollten, denn es war ihm unmöglich, von der schönen Johanna, welche mit ihren Eltern gegenüber an der zweiten Tafel sich niedergelassen hatte, einen Blick abzuwenden. Damit wäre er zu stande gekommen, nur mit seinen Händen nicht; in dieser Verlegenheit hatte, ihm unbewußt, die Linke die Taschenuhr herausgenommen, die Rechte aber mit dem Uhrschlüssel sie so ungeschickt aufgezogen, daß die Kette zersprungen war, wie er freilich erst am anderen Morgen bemerkte. Der dienstfertige Wirt hatte unterdessen der rittmeisterlichen Herrschaft das Frühstück serviert. So appetitlich, wie Fräulein Johanna, hatte Notham noch keine Person ein gebackenes Huhn essen sehen, so wie sie, verstand ja kein Mensch mehr, Messer und Gabel zu handhaben. Sie war aber auch mehr als sonst reizend, ja verführerisch; denn der Schalk hatte nur zu bald bemerkt, welchen Eindruck ihr Figürchen auf den Fremden gemacht hatte. Wie wußte sie doch so anmutig ihrem Vater das Kelchglas vollzuschenken! der Schnee ihrer Händchen wetteiferte mit der weißglänzenden Tischwäsche; es war, als wenn sich blühende Apfelbaumzweige zum alten Schnurrbart hinüberneigten; und wie blitzten bei ihrem anmutigen Lächeln die Zähnchen aus dem Rosenkelche ihrer Lippen vor; – und wenn sie nun gar den schlanken Nacken wendete, daß der Puder von den Locken ein wenig aufstäubte, und beide Grübchen in den Wangen sich tiefer bohrten, hätte Notham völlig Schiffbruch gelitten, wenn er nicht zuvor schon beide Hände in den Rocktaschen untergebracht und sich an sich selbst, wie um einen Mast, geklammert gehabt hätte.
Auch der Rittmeister hatte endlich die Blicke des Fremden bemerkt; er stieß den Stumpf fester in das Loch auf der Diele, welches er allmählich im Laufe der Jahre hier gebohrt hatte, und fragte den Wirt, welcher die Teller wechseln ließ und eine Tafel Pfeffernüsse in einem Dessertkörbchen auf den Tisch stellte, mit unwilliger Neugierde: »Wer ist denn der Feuerwerker dort, der uns bombardiert?«
»Euer Gnaden zu dienen«, versetzte der Wirt, »ein steinreicher Engländer aus New York, Sir Arthur Notham! – Das obere und das untere Vogtland schickt an ihn seine Waren; – er ist reicher als ein Millionär und kann sich wohl mit den Fürsten von Greiz, Schleiz und Lobenstein miteinander messen!«
»He da!« entgegnete der Rittmeister, »aber wie mit meiner Kaiserin? Daß ihn das Höllenelement!« –
»Meinen untertänigsten Respekt!« antwortete der Wirt und schob die Samtmütze auf das linke Ohr.
»Frag' Er einmal«, befahl der Rittmeister, »den Sir Arthur, ob er nicht lieber mit mir ein Glas Tokayer trinken will, statt mich mit seiner Okularinspektion zu inkommodieren!«
Der Wirt überbrachte Notham den Auftrag, und von diesem Augenblicke an war dieser – so wunderbar ist die Fügung Gottes –! Hausfreund des Rittmeisters.
Der Einladung, die Familie in Leimnitz zu besuchen, so oft es ihm seine Geschäfte erlaubten, folgte der erste Besuch, diesem der zweite und endlich knüpfte sich daran eine solche Kette von Besuchen, daß sie an keinem Tage abriß.
Doch trotz dieser Zerstreuungen begann Arthurs sonst so taktfeste Gesundheit, mehr noch sein Gemüt zu leiden. Das Karmesin seiner Wangen wollte mit ihnen selbst hinwegschmelzen, und von dem anmutigen Doppelkinn, welches, wie ein detachiertes Fort, eine Belagerung herauszufordern geschienen und ihm so wohl gelassen hatte, war kaum noch eine Spur vorhanden. Nur seine großen, himmelblauen Augen hatten einen gewissen sentimentalen Blick erhalten. Mochte an diesem krankhaften Zustande das europäische Klima oder die veränderte Diät in Gera schuld sein, er war nicht mehr der Mann, der hierher gekommen.
Hätte man geglaubt, daß er in Johanna verliebt, unglücklich verliebt gewesen wäre, so würde man doch daran zweifelhaft geworden sein, wenn man seine Selbstgespräche mit angehört hätte. Die mildeste Benennung, mit welcher er sie belegte, war immer noch: »Blutjunges Ding!« – Freilich hieß sie, wenn er mit ihr sprach, dafür einmal um das andere: »Lady!« – was ihr besonders wohlgefiel.
Plötzlich aber nannte er sie bei sich heimlich – auszusprechen ist der Frevel nicht, doch leicht niederzuschreiben –eine ausgesuchte Närrin! – Sie hatte ihm das Haus verboten, wenn er nicht in einer Perücke und einem rotdamastenen Fracke, wie er damals Mode war, das nächstemal erscheinen würde. Vierundzwanzig Stunden lang trotzte er dem Verhängnis, da ließ er den Schneider und Friseur kommen –tags darauf galt es, die Frage zu beantworten, wer der ausgesuchteste Narr war, er oder sie? Als Arthur mit der riesenhaftesten Perücke, welche in Gera aufzutreiben war, und in dem rotdamastenen Fracke herauskam, wollte sich Johanna fast totlachen. Sie sank vor ihm mutwillig auf die Kniee und bat ihn um ein Andenken. Mit tausend Freuden sagte er zu, er mußte sein Ehrenwort darauf geben, ihr den Wunsch zu erfüllen. Mit der heiligsten Beteuerung legte er die Hand auf sein Herz und sagte: »Was Sie wollen, Lady Johanna!«
»So gib mir deine abscheuliche Perücke«, rief sie, »damit du wieder einem Menschen ähnlich wirst.«
Er riß sie vom Kopfe und sie flog damit zur Tür hinaus. Eine Weile darauf kam seine große Dogge, mit der prächtigen Haarwolke geschmückt, in das Zimmer.
Notham war beleidigt; sein empörter Männerstolz ließ ihn den Besuch abbrechen und zurück nach Gera eilen.
»John, es wird eingepackt, morgen früh abgereist!« rief er dem Diener zu; dieser ging unverdrossen an das Werk. Heute hieß Johanna eine kleine Hexe. Damit machte er freilich jede Unbill, die ihm widerfahren war, quitt; er brachte sich um das tragische Mitleid, welches ihm hier vielleicht zu teil geworden wäre.
Aber auch im Hause des Rittmeisters war heute kein gutes Wetter. Die Frau Rittmeisterin hatte sich ein Herz gefaßt und ihren Mann gefragt, was denn aus den Besuchen des fremden Herrn oder den Unarten ihrer Johanna herauskommen solle?
»Will's Gott, eine Heirat!« antwortete der Rittmeister.
»Ihr wollt doch nicht«, versetzte die Rittmeisterin, »das Mädchen da weit hinaus weggeben, daß man sie lebenslang nicht mehr wiedersieht? Und wie viele Meilen sind denn von hier nach Amerika? – Über Leipzig liegt es doch ganz bestimmt hinaus!«
»Aber wenn sich die beiden Leute nun lieb haben?« versetzte der Rittmeister, »he, wie dann? Was sich neckt, liebt sich! Er ist ein Mann von Stande, von seinem Urgroßvater her ist er englischer Baron.«
»Baron hin, Baron her!« rief Frau Maria Theresia, »ich frage nur, wie viele Meilen nach Amerika sind?«
»Es werden wohl über einige zwanzig sein!« versetzte kleinlaut der Rittmeister; »aber Sir Notham ist eine reiche, sehr reiche Partie; und dann wißt Ihr ja, meine Gnädige, daß Fräulein Johanna auch einen Willen hat.«
»Freilich«, versetzte Frau Maria Theresia, »doch sprecht mit ihr darüber, aber wie ein Mann! Ich habe mich heute über ihre Aufführung geschämt, ja bis in das Herz hinein!«
Dieser Auftrag war für den Rittmeister eine große Aufgabe. Er sah es freilich ein, daß er ein ernstes Wort mit seinem unartigen Mädchen reden mußte, aber es fiel ihm schwer, denn Johanna ertrug keinen Widerspruch.
Um seinen alten Mut beisammen zu haben, zog er seine österreichische Offiziersuniform an und stülpte sich den Dreimaster auf den Kopf. Jetzt stampfte er dreimal mit dem hölzernen Beine auf die Diele, womit er Johanna gewöhnlich aus der unteren Stube zu sich nach der oberen rief. Wie ein Wirbelwind war sie da.
»Was befiehlt mein gestrenger Herr Papa?« fragte Fräulein Johanna und küßte ihm die Hand.
»Man hat mit Ihr zu sprechen, Fräulein Tochter! Sie ist – hm! hm!«
»Was? mein Herr Papa?«
»Sie ist heute wirklich unartig zu Sir Notham gewesen, ja beinahe ungezogen; sie hat meiner Edukation keine Ehre gemacht.«
»Nein, lieber Papa!«
»Sir Notham ist ein Ehrenmann und soll als solcher behandelt werden.«
»Was habe ich ihm denn getan?«
»Was hat Sie denn mit seiner Perücke vorgenommen?«
»Pfui über das garstige Ding! Ich habe sie seiner Dogge aufgebunden; der Hund sah zum Totlachen aus.«
»Sieht Sie denn nicht ein, daß Sie den edlen Herrn fortwährend kränkt und beleidigt?«
»Nein, mon cher papa!«
»Warum nicht? – Sie stellt sich dümmer, als Sie ist! Ach, liebes Kind, komm Sie mir anders, ich bitte sehr! Will Sie mit mir ihren Spaß haben? Weiß Sie, daß ich kaiserlicher Offizier bin? – Weiß Sie, wie man sich zu benehmen hat?« –
Der Rittmeister war im Gesichte vor Zorn blutrot geworden, seine schwarzen Augenbrauen, welche seltsam von dem weißen Schnurrbart abstachen, zogen sich bei der Nasenwurzel zusammen, als gälte es, in den Feind einzuhauen. Johanna konnte den Zorn ihres Vaters, welchen sie hier zuerst auf sich hereinbrechen sah, nicht ertragen, sie fiel ihm um den Hals und rief: »Papa, nur wieder gut sein! – Ich will ja alles tun, was Sie wollen! Ich will nicht mehr lachen und immer ernst aussehen! – Ja, ich fühle es selbst, daß ich ein unerträgliches Geschöpf bin, daß ich allen Leuten zuwider sein muß! – Auch mein Papa verstößt mich jetzt, und nun will ich ganz verzweifeln!«
Der Rittmeister merkte nicht, daß sein Goldkind erst jetzt recht unartig war; es stürzten ihm vielmehr selbst die Tränen aus den Augen, indem er sagte: »Sprich nur nicht so, Jeanette! Wir haben dich ja alle lieb, ja recht sehr lieb! – Gräme dich darüber nicht! – Aber sage mir einmal recht ernsthaft: wie gefällt dir Sir Arthur Notham? Wenn er dir nicht gefällt – denn er sieht es bei uns auf eine Mariage mit dir ab – so wollen wir mit ihm den Verkehr abbrechen.«
»Warum denn, Papa?« fragte mit schalkhaftem Lächeln Johanna; »du meinst ja selbst, daß er ein Mann für mich sei. Freilich ist er nicht allzu jung, aber doch nicht mehr so dick als früher! Ich habe meine Lust daran, ihn ein bißchen abzuärgern, da er doch dadurch nur schlanker und hübscher und für das Frauenzimmer umgänglicher wird. Nun habe ich gar nichts mehr gegen ihn, vielmehr freue ich mich jedesmal darauf, wenn er herüberkommt und mir immer eine kleine Aufmerksamkeit beweist.«
»Und wenn er«, fragte der Rittmeister, »ernstlich um dich anhalten sollte?«
»Wenn er hier bei uns künftig für immer bleiben will«, versetzte mit niedergeschlagenen Augen Johanna, »so werde ich alles tun, um der Ordre meines Herrn Papa zu folgen!«
»Du liebes Herzenskind«, rief der Rittmeister, »komm an mein Herz! ja du bist die frömmste und beste, auch die klügste Tochter, die es gibt, von hier bis nach Hispania hinein – so weit ich gekommen bin.«
Er rief jetzt die Frau Rittmeisterin herein und teilte ihr den Inhalt seiner Unterredung mit; die gute Frau war mit allem einverstanden.
Als am anderen Morgen der Wagen Nothams mit den Extrapostpferden vor dem Deutschen Hause hielt und er nur noch einige Zeilen zum Abschied an den Rittmeister von Thossenfeld schreiben wollte, jedoch damit, trotz der fünften Zigarre, welche er angebrannt hatte, nicht zu stande kommen konnte, erhielt er selbst ein Billet aus Leimnitz, das allererste von der kleinen Hexe. Er erbrach es, aber die Buchstaben flimmerten vor seinen Augen. Endlich las er:
» Mon eher ami!
Papa und Mama schicken Ihnen einen Gruß und ich ein Kußhändchen mit einem untertänigen Knix und der Bitte um barmherzige Verzeihung wegen der häßlichen Perücke, welche sich nun zwischen uns wie ein Truthahn aufplustert und uns auseinanderjagen möchte. Den Spaß müssen wir ihr von Grund auf verderben, wenn Eure amerikanische Gnaden mir beistehen wollen. Heute abend kommt der Kantor aus Gera mit seinen Töchtern zu uns, und wir wollen das kleine Lied singen, das Ihnen gefällt, wie Sie mich dessen versicherten. Ich werde mir auch Mühe geben, nach Ihrem Rezepte eine Bowle Punsch zu verfertigen. Was soll nun ein armes Mädchen mehr tun, um einen brummigen Hausfreund wieder gut zu machen? Wissen Sie noch was, so bitte ich um gnädige Buße
Jeanette.«
»Wer kann der possierlichen Person gram sein?« sprach Notham bei sich und rief dann laut: »Es wird abgespannt und abgepackt, John! hörst du, John?«
»Hab es gedacht!« brummte John und schritt gravitätisch hinunter zum Wagen. Notham aber ging ungeachtet des schönen Frühlingstages, welcher mit Duft und Farbe über dem Elstertale lag, bis spät nachmittags in der Stube herum; denn er war daran, einen ernsten Entschluß zu fassen. Jetzt kleidete er sich an, einfach, aber kostbar, wie er gewohnt war. Dann nahm er ein Etui aus dem Schranke, in welchem sich ein kostbarer Juwelenschmuck befand. Er bestand aus Halsband und Ohrgehängen von großen, prächtigen Diamanten vom reinsten Wasser. Mit einem Seufzer, welcher halb den Dukaten, die der Schmuck gekostet hatte, halb der schönen Johanna angehörte, schob er das Etui in die Tasche, setzte den Hut auf den wohlfrisierten Kopf, nahm das hohe Bambusrohr zur Hand, stellte sich noch einmal vor den Spiegel, um seine Zufriedenheit mit sich selbst zu bezeigen, und schritt dann gravitätisch hinaus auf die Straße.
Die Sonne war eben im Untergehen und die Nachtigallen begannen in den Büschen umher zu schlagen. Notham bemerkte von allem nichts, denn seine Gedanken sangen und klangen durcheinander so betäubend, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Auch hatte er keine Aufmerksamkeit auf die schlimmen Zeichen oder kleinen Unfälle, welche ihm auf dem Wege nach Leimnitz begegneten. Dreimal fiel ihm das Bambusrohr aus der Hand, er hob es auf und ging weiter; er wurde selbst nicht zurückgeschreckt, als ein langarmiger Birnbaum bei seinem Eintritte in das Dorf über einen Gartenzaun herüberlangte und ihm den Hut vom Kopfe herunterschlug; er hob ihn auf, stäubte ihn ab, behielt ihn jedoch in der Hand und ging weiter. Vergeblich warnte ihn ein losgeketteter Hofhund, welcher ihn so lange bellend umkreiste, bis ihn ein geschickter Hieb mit dem Bambusrohr von seiner Prophetengabe hergestellt hatte.
Die Verliebten haben wunderliche Launen; es war ihm, als er an das Gehöfte des Rittmeisters kam, unmöglich, den geraden Weg hineinzugehen; – er war in Deutschland Romantiker geworden, ehe vor ihm einer noch genannt worden war. Es gefiel ihm, um das Gehöfte herum und durch den darangehenden Obstgarten zu gehen.
Die Verliebten teilen oft wunderliche Sympathien; als wenn Johanna von diesem romantischen Anfluge ihres Anbeters gewußt hätte, war sie in den Garten hinausgeschlichen und hatte sich auf die Rasenbank gesetzt, um den Staren zuzuhören, welche über ihr das Abendlied pfiffen, oder um die Grashalme vor ihren Füßen zu zählen.
Die Verliebten machen oft eigene Erfahrungen, welche andere Menschen nicht erleben. Noch ehe Notham durch die kleine Pforte trat, welche in den Obstgarten führte, blieb er davor stehen und Tränen traten in seine Augen. Er suchte sich zu fassen, er hatte aber nicht das geringste absolute Bewußtsein mehr; die Tränen nahmen ihren Weg.
So erging es zugleich Johanna, auch sie weinte still für sich hin; denn an diesem süßen Frühlingsabende schwoll auch ihr Herz vor Sehnsucht wie eine Blumenknospe auf, daß es nur eines linden Hauches bedurfte, um es aufblühen zu lassen.
An Gelegenheit, welche bei der ersten Liebe alles ist, sollte es nicht fehlen. Ihr unbemerkt stand schon eine Weile Notham vor ihr; jetzt sank er, von ihrer wunderbaren Schönheit überwältigt, auf das Knie, wie ein Füsilier im ersten Gliede beim Feuern und flüsterte: »Johanna!« – Mehr hätte er nicht sagen können, und wenn es auf schuldig oder nichtschuldig vor einer Jury angekommen wäre.
Johanna wußte kein Wort zu entgegnen; sie hatte beide Hände auf seine Schultern gelegt und blickte in seine Augen, als wollte sie in seiner Seele lesen. Nun hob er, wie von selbst, seinen Arm um ihren Nacken und ein Kuß vereinigte Herz und Herz.
Da trieb ein böser Dämon den armen Notham, in diesem Augenblicke Johannas Herz und sein Glück zugleich zu vergiften. Er drückte ihr das Etui in die Hand und bat, es zu öffnen.
Die Träne, welche sich aus Johannas Auge drängen wollte, wurde von der Neugierde aufgesogen; als ihr aber die Diamanten in vielfarbigen Blitzen in die Seele funkelten, begann schon das Herzblatt ihrer Liebe zu welken.
Sie konnte sich nicht satt sehen an den köstlichen Steinen, fast wie zum Habdank rief sie: »O du prächtiger Notham, komm doch herein zum Vater und zur Mutter!« Notham war entzückt; Arm in Arm traten beide in die Wohnstube, wo der Rittmeister und seine Frau die Gäste erwarteten.
»Mädchen! Mädchen!« rief der Rittmeister und schwang lachend seinen Krückenstock, »was bist du für ein absonderliches Wesen! – Da seht Ihr es selbst, Sir Arthur, ihr kann man nicht böse sein!«
»Vater! Mutter!« sagte verlegen Notham, »dürfen wir um eueren Segen bitten?«
»Ei, ei!« versetzte die Mutter, »ist das eine Art für ein adeliges Fräulein, sich ohne Vorwissen der Eltern zu versagen?«
»Still doch!« versetzte der Rittmeister, »Sir Arthur hat mein Jawort unter der Bedingung, daß er sich hier bei uns ansässig macht, denn Johanna ist unser einziges Kind. So ein hübsches Rittergütchen in der Nähe findet sich schon, wo Ihr Euer Nest bauen könnt.«
»Arthur tut es um mich!« rief Johanna, er hat es mir schon versprochen, nicht wahr, du hältst dein Wort?«
Notham war bei diesen Worten bleich geworden, er dachte an sein Handelshaus, seine Geschäfte und an New York; er konnte, er wollte das alles nicht aufgeben, und doch wollte und konnte er nicht nein sagen; fast vergingen ihm seine Sinne.
Er war aber zweierlei, einmal ein Amerikaner und ein Handelsherr zugleich; beides reichte hin, um eine halbe Notlüge zu sagen und dabei einen halben Vorsatz zu fassen, welche sie und ihn mit der Liebe ausgleichen sollte.
»Allerdings«, sagte er, »habe ich den Entschluß gefaßt, mich hier in oder bei Gera niederzulassen; es versteht sich jedoch wohl von selbst, daß ich erst in New York mein Vermögen aus dem Handel ziehen und bar machen muß. Dazu gebrauche ich einige Zeit, welche ich sehr abkürzen kann, wenn mir dabei meine Hausfrau das Hauswesen in Ordnung bringen hilft.«
»Arthur! mein Arthur!« rief Johanna und sie lag an seinem Herzen; »ein Jahr lang will ich mit hinüberziehen, dann führst du mich wieder hierher zurück, dann bleiben wir immer hier! Du versprichst es mir?«
»Mann und Wort!« rief Notham.
»Alles in Ordnung!« meinte der Rittmeister; »nächsten Sonntag ist das erste Aufgebot; und nun, Johanna, mache dich schmuck, unterdessen soll Arthur deine Mutter trösten, welche sich ja die Seele ausweint.«
Johanna eilte in ihre Stube und kleidete sich an; ihr standen prächtige Kleider; sie wußte es und hatte natürlichen Geschmack. Als sie den blitzenden Schmuck angetan hatte und vor dem Spiegel stand, wurde es ihr klar, warum sich der fremde, vornehme Herr so viele Mühe um sie gegeben hatte. Sie stieg bei sich ungemein im Preise. Die kindliche Unbefangenheit und kindische Laune wischte sich jetzt aus ihrem Gemüte hinweg wie Staub von Schmetterlingsflügeln.
Unterdessen hatte Notham seine zukünftige Schwiegermutter zu erheitern gesucht. Er hatte ihr eine Fahrt über das Meer wie eine Gondelfahrt auf der Elster zu schildern gewußt. Beinahe hätte sie selbst Lust bekommen, ihre Tochter nach, New York zu begleiten, nur der Gedanke an ihren guten Rittmeister, welcher bei seiner von den Kriegsstrapazen zerrütteten Gesundheit der Pflege zu sehr bedurfte, konnte sie zurückhalten. Doch mußte ihr Notham mit Herz und Mund versprechen, wenigstens zum nächsten Frühjahr wieder in Gera einzuziehen.
Allmählich fanden sich auch die Gäste ein, der Pfarrer und Kantor mit ihren Familien, der Förster des Fürsten und der Schösser mit seinen fünf alternden Töchtern.
Johanna aber, das juwelenflammende Mädchen, stand oben noch immer vor dem Spiegel, ein seltsam gespanntes Lächeln um ihren Mund und einen wunderlichen, starren Blick in ihren Augen.
Notham eilte hinauf, um sie zu rufen; sie trat ihm unter der Tür mit der Lampe entgegen; er schrak ein wenig zurück, so groß, stolz und schön stand sie vor ihm. Er fühlte sich von seiner Wahl geschmeichelt.
Als er mit ihr hinunter zur Gesellschaft trat, machte Johanna allen denselben Eindruck. Sie benahm sich so würdig wie eine Fürstin; ihre Freundinnen vergingen vor Bewunderung und Neid.
Sie hatte plötzlich den Takt gefunden, sich als liebenswürdige Wirtin zu benehmen, ohne ihrer Erscheinung das Geringste zu vergeben.
Selbst gegen ihren Verlobten war sie gütig und streng zugleich, fast herablassend. Ihr Vater, welcher die große Welt kennen gelernt hatte, unterdrückte kaum seine Bewunderung. Nur ihre Mutter fand sich zu ihr fremd gestimmt.
Als Notham mit einem ihm gegönnten Handkuß und der Schwarm der Gäste Abschied genommen, auch Johanna sich in ihre Stube zurückgezogen hatte, fragte der Rittmeister, während er die Schlafmütze über die Ohren herunterzog, seine Maria Theresia: »Hm, wie hat dir heute unsere Johanna gefallen? Weiß sie nicht eine Dame zu spielen? He?«
»Es wird schon so sein!« entgegnete die einfache Frau.
Nach dieser Unterredung gingen beide schlafen. Notham aber lag drüben in Gera im Deutschen Hause am Marktplatz fast die ganze Nacht durch am offenen Fenster und schaute dem deutschen Vollmond, dem uralten Türmer, in das Gesicht.
»Ich sollte meinen«, sagte er zum zwanzigstenmal, »daß ich heute ein gutes Geschäft gemacht hätte!« und rieb sich dabei vor Freude die Hände. »Mit dem Comptoirzuschließen und Wiederkommen mag es seine Weile haben. Als wenn das so schnell abgetan wäre wie Stiefelausziehen!« –
Nach Mitternacht begab auch er endlich sich zur Ruhe und schlief bis tief in den nächsten Tag hinein. Als er aufstand, war es ihm, als hätte er ganz und gar die alte Selbstzufriedenheit, nur in schönerer Form wiedergefunden. Auch das Frühstück, welches John gebracht hatte, schmeckte ihm wieder und fast besser als früher. Mit einem Worte, Notham fand sich wieder in seinem alten Dasein zurecht; er zweifelte auch keinen Augenblick daran, daß er seine schöne Verlobte ebenso darin glücklich unterbringen werde.
»Ja, ja, guter John!« sagte er lächelnd zu seinem Diener, »über acht oder vierzehn Tage reisen wir ab.«
John hätte vor Schrecken beinahe die Teller, welche er abräumte, aus der Hand fallen lassen; denn aus dem frischen Ton der Worte seines Herrn erriet er den baren, wirklichen Ernst derselben.
»Aber wir werden eine Reisegefährtin haben«, fuhr Notham fort; »rate einmal!«
John sperrte die Augen auf und hörte, was weiter kommen würde.
»Ich will mich verheiraten.«
»Euer Vater hat das auch so gehalten.«
»Aber wen?«
»Hm?«
»Du wirst es wohl erfahren!«
»Freilich!«
Mit dieser Auskunft konnte John das weitere sich denken, zumal er so gut wie einer um die Ursache der Wallfahrten seines Herrn nach Leimnitz wußte, und seit diesem Zwiegespräche mit seinem Herrn als Brieftäuberich des Tages zwei- auch dreimal hinüber- und herübereilen mußte.
Wie der Rittmeister zugesagt hatte, so fand das erste Aufgebot am nächsten Sonntag statt. Notham hatte der Familie mitgeteilt, daß er gleich nach der Trauung mit seiner Braut abreisen würde. Er hatte mit einer Einsicht, welche einem erfahrenen Familienvater Ehre gemacht hätte, alle Gegenstände des einfachsten Bedürfnisses, worin die Ausstattung seiner Braut bestehen dürfe, mit ihr besprochen und der Ordnung nach ausgeschrieben. Nur in der Leibwäsche wollte er sie nicht beschränken, weil er selbst darin den Überfluß liebte.
Während seine Braut alle Nähterinnen der Stadt in Tätigkeit setzte und selbst das Bräutigamshemd nach altem Gebrauche nähte, dabei aber am wenigsten Zeit für den Austausch der Gefühle mit ihm hatte, eilte er selbst auf zwei Tage nach Leipzig und kaufte dort einen geräumigen Familienwagen zur Reise und die Trauringe ein. Beide Ringe waren sich gleich, jeder stellte das Symbol der Ewigkeit in einer zusammengeringelten Schlange vor, deren Köpfchen ein Rubin bildete. In den einen Reif ließ er »Arthur« und in den anderen »Johanna« gravieren. Es gelang ihm auch, einen besonders herrlichen Seidenstoff zu dem Brautkleide und einen feinen Brüsseler Schleier aufzutreiben. Dabei vergaß er nicht ein Reisenecessaire für sich und seine Braut. Er hatte auch Geschenke für seine Schwiegereltern ausgewählt, für den Rittmeister eine große, emaillierte Spieldose zum Schnupftabak, welche bei jedesmaligem Öffnen den Choral: »Vom Himmel hoch, da komm' ich her!« spielte, und für die Frau Rittmeisterin ein Nürnberger Spinnrädchen von der schönsten, zierlichsten Schnörkelarbeit, übermäßig mit Silber und Perlmutter verziert. So hatte er in der möglichst kurzen Zeit dieses und sonst alles, was die Schwiegereltern und die Braut erfreuen und was die Reise bequem machen konnte, bedacht und besorgt. Im schwerbepackten, neuen Wagen kehrte er nach Gera zurück.
Dort erwarteten ihn in der letzten Woche seines Brautstandes neue Geschäfte, welchen er sich auf Bitten seiner Braut und seiner zukünftigen Schwiegereltern nicht entziehen konnte; denn es verstand sich von selbst, daß das Brautpaar bei den adeligen Familien auf den umliegenden Schlössern und den Honoratioren der Stadt den Abschiedsbesuch machen und sich recensieren lassen mußte.
So war der Sonntag herangerückt, Notham stand mit seiner Braut vor dem Altare und auf der Agende in der Hand des Pfarrers lagen die Trauringe. Er steckte ihr den Arthurring und sie ihm den Johannaring an, und beide sanken einander an die Brust.
Vor der Kirche hielt der Reisewagen.
Als sie heraustraten, stand John mit den Mänteln und Reisemützen an der Türe. Arthur schlug den einen um seine Braut, hüllte sich in den anderen, streckte seinen nachtretenden Schwiegereltern die Hände entgegen und rief: »Verzeiht, daß ich den herben Abschied kürze! Ade, Schwiegervater! ade, Schwiegermutter! Johanna, nimm Urlaub!«
Vater und Mutter standen wie erstarrt vor dem Gedanken der so schnellen Trennung; daß sie so nahe, so entsetzlich sei, hatten sie doch nicht recht sich vorgestellt, obschon sie damit einverstanden, oder dazu von Notham überredet worden waren.
Johanna lag, in Schmerz ausgelöst, in den Armen ihrer Mutter; Notham gab dem Postillon einen Wink, dieser hob das Horn und schmetterte eine lustige Melodie in den glänzenden Tag hinaus. Johanna wandte sich, ihr Vater hielt ihre Hand gefaßt, mit einem Aufschrei stürzte sie ihm an die Brust; denn nun ward ihr alles klar, sie liebte nur ihn vor allen und niemand sie so wie er!
Mit zarter Gewalt hob Notham die Halbentseelte aus den Armen ihres Vaters in den Wagen, er sprang zu ihr hinein, die Kutschentür flog zu, John hinauf in das Kabriolett und wie im Sturmwind der Wagen mit seiner Beute von hinnen.
Der gute, alte Rittmeister hatte mit seiner Tochter die Blume seines Lebens verloren. Er war bis zum Tode verstimmt. Er ging auch nicht mehr täglich in die Stadt und zu dem Wirte in das Deutsche Haus, um dort seinen Stelzfuß in das Loch, welches er getreten hatte, tiefer hineinzubohren und eine Flasche Tokaier auszustechen, zumal auch seine Maria Theresia seit dem jähen Abschied kränkelte. Vielleicht wäre er gar nicht mehr in die Stadt gekommen, wenn er nicht wenigstens zweimal wöchentlich auf der Post nach Briefen von seiner Tochter gefragt hätte, obschon er wußte, daß keiner dort liegen blieb, denn er belohnte den Briefträger jedesmal mit einem Zwanzigkreuzer außer dem Porto dafür. Den ersten Brief erhielt er aus Bremen, wo sich Notham nach Amerika eingeschifft hatte; Johanna schrieb vergnügt, sie mußte sich ganz glücklich fühlen. Im Herbste darauf kam ein zweiter aus New York, in welchem sie sich über die dortigen Menschen, Sitten und Gebräuche lustig machte. »Sie laufen alle herum wie Noten, die mit den fünf Linien nicht zufrieden sind und dafür einen Strich durch den Kopf bekommen.« So schrieb sie; unter anderem erwähnte sie auch Notham mit den kurzen Worten: »Ich bin sein Papagei, den er mit Zuckerwerk füttert und mit dem er sich Spaßes halber unterhält, wenn er aus seinem Comptoir abgestanden hereinkommt! Er läßt sich kratzen und beißen, ich bleibe doch immer sein Joli!« Dreimal hatte sie denselben Satz geschrieben: »Im nächsten Frühjahr kommen wir wieder zu Ihnen, mein herzlieber Papa und meine gute Frau Mama! – denn was Notham verspricht, das hält er.« Auch schilderte sie mit der prächtigsten Laune der Welt eine Gesellschaft von Sägeböcken und Haubenstöcken, welche sie bei sich gesehen hätte. Ich habe dir eine Langeweile, die noch über das französische ennui hinausgeht. Wenn nicht das bissel Musik wäre, stürb' ich daran.«
Einige Tage später hatte sie den Brief fortgesetzt. Sie beschrieb darin einen Schaukelstuhl, welchen ihr Notham angeschafft habe und worin sie sich den ganzen Tag wiege wie ein Kind; – »denn denken Sie nur, Papa, die Qual! ich darf gar nichts arbeiten als nähen; mit der Nähnadel soll ich mich durch die lange, lange Zeit durchfechten; essen kann ich, soviel ich will, und davon werde ich Hamsterbacken bekommen, wie die Leute hier haben. Auch mein Mann ist so ein bißchen Hamster mit; was der knurrig sein kann im Hause umher! Doch zu mir ist er immer freundlich, wie Hirsemus mit zerlassener Butter und Pfefferkuchen darauf. Wer doch die Mannsleute auskennen lernte! Wenn ich ihn nur draußen in Gera habe, da muß er mir wieder ein Mensch werden. Jetzt will er mich fromm machen, gestern hat er mich die Psalmen lesen lassen, heute kommt das hohe Lied Salomonis dran. Hab' ich dir schon gesagt, daß ich dem alten Kantor in Gera für die Arien, welche er mich singen gelehrt, noch im Grabe danken werde? Kauf' ihm doch feines, schwarzes Tuch zu einem Rock und Samt zu einer Weste, bring' es ihm selbst und grüß' ihn schönstens von mir. Die Arie, die wir zusammen gesungen und wovon wir nur den ersten Vers auftreiben konnten, will ich weiter machen, daß ich Platz darin habe. Da mag alles drinnen sein, was mich zu Ihnen zieht, außer Sie und Mama; denn ich muß zu viel weinen, denke ich an meine Eltern, und da ist es mit der Reimerei ganz vorbei. Wenn ich doch mein Reimbüchelchen da hätte! Es muß in meinem Puppenschranke bei den Noten liegen. Schick' mir doch alles herüber!«
Das war das Wesentlichste, was in diesem Briefe stand. Der alte Rittmeister las ihn so oft vor, bis er ihn auswendig wußte. Er bestellte auch gewissenhaft den Auftrag bei dem Kantor. So schwer ihm das Schreiben wurde, doch saß er täglich in seinem Lederpolster am Pulte und berichtete getreulich seinem lieben Kinde über das Weltmeer hinüber von den wichtigen Vorfällen im reußischen Vogtlande. Er vergaß selbst dabei nicht, daß der Fuchs ihre Lieblingshenne, die schwarze mit der weißen Mütze, geholt habe; nur von der Krankheit ihrer Mutter, welche täglich bedenklicher wurde, schrieb er nichts, um Johanna nicht zu betrüben.
Im März bekam er wieder Nachricht, aber eine so sonderbare, daß er einmal über das andere den Kopf schüttelte. Sie schrieb:
»Grüß' Sie Gott, Herr Vater und Frau Mutter! Da schicke ich für Sie und den Kantor das Lied, das alles sagt, was ich freilich länger und breiter schreiben könnte; denn ich gehe nun Notham mit Tränen Tag und Nacht an, mich in meine Heimat zu bringen, wie er versprochen hat. Es müßte keinen Gott mehr im Himmel und kein redliches Herz auf Erden geben, wenn er sein Wort brechen sollte. Das Kind, das sich unter meinem Herzen regt, soll, so Gott will, kein amerikanischer Hamster werden. Es ist, als wenn tausend Hände hinter den Tannenwäldern herüber über das Meer aus den Wolken heruntergriffen und mich in die Heimat zurückzögen. Nun, da hast du mein Lied und mein Leid! Es geht nach der Melodie des Kantors, ein Vers wie der andere:
Wo auf hohen Tannenspitzen,
Die so dunkel und so grün,
Drosseln gern verstohlen sitzen,
Weiß und rot die Moose blühn,
Zu der Heimat in der Ferne
Zög' ich heute noch so gerne!
Wo ins Silber frischer Wellen
Schaut die Sonne hoch herein,
Spielen heimlich die Forellen
In der Erlen grünem Schein,
Zu der Heimat in der Ferne
Zög' ich heute noch so gerne!
Wo tief unten aus der Erde
Eisenerz der Bergmann bricht
Und die Zither spielt am Herde
In der kurzen Tagesschicht,
Zu der Heimat in der Ferne
Zög' ich heute noch so gerne!
Wo die Hirtenfeuer brennen,
Durch den Wald die Herde zieht,
Wo mich alle Felsen kennen,
Drüber hin die Wolke flieht,
Zu der Heimat in der Ferne
Zög' ich heute noch so gerne!
Wo so hell die Glocken schallen
Sonntags früh ins Land hinaus,
Alle zu der Kirche wallen,
In der Hand den Blumenstrauß,
Zu der Heimat in der Ferne
Zög' ich heute noch so gerne!
Doch mein Leid ist nicht zu ändern;
Zieht das Heimweh mich zurück,
Hält mich doch in fremden Ländern
Unerbittlich das Geschick!
Zu der Heimat in der Ferne
Zög' ich heute noch so gerne!
Aber ich will mit dem Geschicke schon fertig werden, ehe noch dem armen Vogel die Flügel ganz lahm geworden sind, daß er nicht mehr den Weg durch die Luft zu seinem Neste machen kann.
Jeanette.«
Dies war der letzte Brief, welchen der gute, alte Rittmeister von seiner Tochter lesen sollte. Als er ihn seiner kranken Maria Theresia vorgelesen hatte und sie nichts darauf sagte, leuchtete er mit der Lampe in das Bett. Sie lag darin mit gefalteten Händen und einem seltsam verklärten Gesichte. Sie war eingeschlafen, um hier nicht wieder aufzuwachen. Der Rittmeister fuhr ihr mit der flachen Hand über das Gesicht; es war marmorkalt. Er warf sich lautlos über sie und lag so eine Stunde lang fast sinnlos, dann sammelte er sich zum Gebete, welches endlich zu vernehmbaren Worten ward:
»Barmherziger Gott, hier liegt vor dir ein alter, zerschossener Kriegsknecht und dankt dir für alle Gnade, welche du ihm in Standquartier und Campagne geschenkt hast. Ich hatte mit meiner Bravour, die ich zu verschiedenen Malen zu beweisen Gelegenheit hatte, nur meine Pflicht getan, du aber hast mir das alles, ja selbst die Sünde meiner Jugend, zum merite angerechnet und mein Lebensglück mit der seligen Maria Theresia so recht grundgut an den Hals geworfen, und da ich beinahe an ihr ein Hallunk geworden wäre, mir das Bein wegschießen lassen und mich armen Krüppel hierher nach Leimnitz kommandiert, um Weib und Kind zu finden und auf meinen Lorbeeren mit gloire und pension auszuruhen. Lieber Gott, mein allmächtiger Kommandeur, warum hast du mich nun den Meinen als Quartiermeister nicht vorangehen lassen? Bedenke ich da in meiner Niedrigkeit, daß bei dir mein bißchen alter Adel und mein Offizierspatent dummes Zeug sein mögen, wie denn auch dem Hauptmann von Kapernaum nur sein Glaube half, so wirst du es wohl auch jetzt mit dem Rittmeister von Leimnitz gut gemeint haben; denn ich habe wohl noch in meinem alten Mantelsack ein Paketchen alter Sünden, die du mit bestem Willen mir nicht ganz vergeben kannst, es müßte denn eine so gute, reine Seele, wie meine selige Maria Theresia, mir hinter dem göttlichen Kriegsgericht Pardon auswirken. So gehe denn hin, meine Maria Theresia, und bitte nur das eine, daß der alte Rittmeister von Leimnitz bei dir sein darf; denn du hast doch eine Stätte im Paradies. Kannst du für mich bei Petrus, der am besten weiß, wie es kommt, daß man darein haut, ein übriges tun, so laß mich im Leben nur noch einmal unsere Johanna sehen! Und hilft das alles nicht, so mag mich mein Herrgott lieber ein bißchen in die Hölle Ordonnanz reiten lassen, wenn nur das liebe Kind dabei glücklich wird.«
Nachdem sich der Rittmeister ausgeweint hatte, pochte er Knechte und Mägde auf und schickte zur Leichenfrau und zu seinen Nachbarn, damit der eine oder der andere mit ihm die traurige Nachtwache teile.
Solange die Leiche sich im Hause befand, behielt der alte Rittmeister noch ziemlich seine Fassung; nachdem er aber die drei Hände voll Erde auf ihren Sarg geworfen hatte, überkam ihn eine so namenlose Sehnsucht nach seiner Tochter, daß er von Tag zu Tag einem ruhelosen Schatten immer ähnlicher wurde. Man hörte ihn bei Tage wie bei Nacht mit seinem hölzernen Beine treppauf, treppab, hinaus vor das Tor und in das Haus stampfen, ohne jemand Rede zu stehen. Nur zuweilen sagte er wie im Irrsinn: »Wir müssen sie holen, ja, ja!« – Er war auch nicht im stande, ihr die Todesnachricht zu melden, sein Freund, der Kantor, schrieb für ihn den Trauerbrief.
In der Zwischenzeit war das Verhältnis zwischen Notham und Johanna immer gespannter geworden. Wie er immer mehr den flüchtigen Gedanken der Rückkehr nach Europa aufgab, desto heftiger drängte ihn Johanna, bis er endlich ungeduldig wurde und ihr einmal und für immer erklärte, daß um so weniger daraus werden könne, je mehr ihre hoffnungsreichen Umstände es ihr verböten.
So ungeschickt Notham es auch angefangen hatte, ihr die Zurückkehr in die Heimat auszureden, so wäre die junge Frau doch noch darüber hinausgekommen, wenn nicht gerade zu dieser Zeit der Brief mit der Nachricht von dem Tode ihrer Mutter eingetroffen wäre.
Notham hatte ihr Vertrauen verloren; er war zu sehr mit seinen Handelsangelegenheiten und seinen Spekulationen auf Millionen beschäftigt, als daß er sich weiter darum hätte bekümmern sollen.
Johanna aber sendete heimlich an ihren Vater einen Brief ab, welcher später an Notham zurückkam und ihn zu spät einen Blick in das Herz seiner Frau tun ließ. Sie hatte geschrieben:
»Die Botschaft von dem Heimgange meiner Mutter hat mir ein Messer in das Herz gestochen, der Gedanke aber an Dich es dreimal darin umgewendet und den Notham ganz totgestochen. Sein Wortbruch hat mich von ihm geschieden, und so bin ich wieder Dein, ganz Dein, Du herzallerliebster Vater! Ich will Dein kummerschweres, graues Haupt in meinen Schoß nehmen und darunter meine Hände legen, daß es warm ruht. Alles ist mir möglich zu ertragen, nur das eine nicht, Dich allein und hilfslos zu wissen in der Welt. Wer soll Dich pflegen bei Deinen Leiden, wenn Dir die vielen Wunden brennen, wer Dich führen, wenn Dein armer, hölzerner Fuß strauchelt? Wer soll Dir das Kopfkissen in der Nacht zurechtlegen, wer bei Dir wachen, wenn Dir unwohl ist, wer Dir beim Ankleiden behilflich sein, wer alle die kleinen Dienste vollbringen, an welche Du gewöhnt bist, da die Mutter tot ist und ich mehr als tot hier im fremden Krämerlande? Gott wird mir verzeihen, wenn ich Notham in Kummer stürze, er kann, wie ich meine, etwas davon ertragen, denn er ist ein harter, kalter Mann! – Wenn er mich wie ein Kind behandelt, so mag er daran denken, daß ich Dein Kind bin und bei Dir sein will. Vater! Vater! warum hast Du mir damals meinen Willen gelassen, als ich Notham versprach, ihm hierher zu folgen? –
Heute schreibe ich nicht mehr, doch morgen! –«
Tags darauf, vormittags.
»Vater! Vater! – Was ist Dir geschehen? – Gewiß bist Du krank, oder es steht Dir noch ein Unglück bevor. Ich habe in der verwichenen Nacht von Dir einen Traum gehabt, es war mehr eine Todesangst! – Mir kam es vor, als wenn ein Schacht von oben herunter aus Europa zu uns nach Amerika ging. Eine lange, lange Leiter lief herab – aber sie reichte kaum bis über die Mitte herein. Nun sah ich Dich oben hereinsteigen; Du hieltest eine Kirchenkerze in der Hand, rücktest herunter und stiegst behutsam mit dem gesunden und dem hölzernen Fuße von Sprosse zu Sprosse, immer tiefer und tiefer bis an das Ende der Leiter; – nun standest Du auf der letzten Sprosse – Du merktest es nicht – jetzt hobst Du wieder den hölzernen Fuß hoch auf, um herunterzutreten, und warst doch noch turmhoch über mir, ich breitete die Arme aus und schrie vor Schreck auf. Da war ich erwacht und lag in Angstschweiß gebadet.«
Nachmittags.
»Heute geht ein Holländer mit seinem Schiffe »Hirundo« ab, und mit ihm der Brief. In den nächsten Tagen will ich den armen Notham verlassen. Ich habe den Schiffskapitän Simm aus Portsmouth mit Geld gewonnen, sein Schnellsegler lichtet, sobald ich an Bord bin, die Anker – von Portsmouth eile ich zu Dir. Vater! Vater! ich werfe mich Dir um den Hals und weine mich tot. – Du kannst nicht glauben, wie leicht mir ist, da ich daran bin, in die Heimat zu Dir zu kommen. Nun wird es sich zeigen, ob Notham mich lieb hat. Sobald ich bei Dir bin, schreiben wir ihm – dann wird er schon nachkommen! – Bete für Deine
Jeannette.«
Tags darauf war sie aus dem Frühstückszimmer in ihre Stube zurückgekehrt. Notham war dort noch geblieben, wie gewöhnlich, in einer Zeitung lesend, und eine zweite unter dem Arm. Er hatte sich in sein Reisekostüm geworfen, ohne ihr über sein Vorhaben etwas mitgeteilt zu haben.
Sie hatte sich jetzt auf ihrem Zimmer in den Armstuhl ans Fenster gesetzt und spielte in Gedanken mit dem kopfwackelnden Chinesen von Porzellan vor ihr, ohne daß sie auf ihn acht hatte.
Wer die schöne, junge Frau hier in diesem prächtigen und doch gemütlichen Zimmer nur auf einen Augenblick gesehen hätte, würde sie für eine der glücklichsten Frauen gehalten haben.
Bis auf den silbernen Griff am Türschlosse war nichts vergessen, was bequem oder reizend war. An der Wand zwischen den Fenstern prangte im goldenen Rokokorahmen der silberreine Spiegel, welcher die großen Sonnenblumen und Arabesken des Teppichs am Fußboden, die kleinen Blumentische umher, welche in allen Farben blühten und dufteten, und alle die tausend gefälligen Kleinigkeiten auf den Mahagonigestellen in den Ecken, die Alabastervasen, die ciselierten Silber- und Goldarbeiten, die Paradiesvögelchen, welche an seidenen Fäden schwebten, und dazwischen seine schöne Herrin abspiegelte.
Johanna wurde jetzt durch Nothams Eintritt in das Zimmer aus ihren Gedanken aufgeschreckt.
»Ich verreise auf einige Tage«, nahm er das Wort, »in Geschäften nach Philadelphia; kann ich Euch dort etwas bestellen?«
»Ihr wißt, Notham«, versetzte sie, »daß ich nur einen Wunsch hege, den Ihr mir erfüllen könnt, nicht aber in New Jork, sondern durch unsere Zurückkehr zu unserem Vater, der jetzt so große Rechte auf mich hat, da er allein ist.«
Nach dieser Anrede versuchte Johanna noch einmal, Notham zu erweichen. Sie begann alle Saiten seines Herzens anzuschlagen, um ihnen einen Ton der zusagenden Liebe abzugewinnen, aber es prallten alle ihre Worte von ihm ab wie Hagelkörner von einem Gepanzerten, ohne ihn im mindesten zu rühren.
Er wiegte sich vor ihr bequem im Schaukelstuhle und blickte mit ruhigen, fast neugierigen Augen sie an. Er hatte sich auf eine solche Scene vorbereitet und die Rede, welche er seiner Frau halten wollte, in Bereitschaft.
Johanna hatte mit feinem Gefühl ihn erraten; sie hielt in beleidigtem Stolze ihre Tränen zurück.
Als sie mit ihren Bitten zu Ende war, lüftete Notham ein wenig sein Halstuch, legte die flachen Hände auf seine Kniee und sprach im Tone eines puritanischen Predigers, fast näselnd, um desto würdiger zu erscheinen:
»Was Ihr da sagt, läßt sich alles gut anhören, es geht ihm nur ein guter Grund ab. Unterbrecht mich nicht, denn ich muß mich weiter darüber auslassen. Ihr müßt das Land der Träumerei und Phantasterei, ich meine damit Deutschland und zum Teil auch England, nicht verwechseln mit dem Norden von Amerika; denn hier ist alles praktisch, wie es sich für Männer schickt. Hier soll, will es Gottes Gnade, erst ein neues Völkerleben begründet werden; es gibt noch Wälder auszuroden, Sümpfe auszutrocknen, Häuser und Städte zu bauen und durch Schiffahrt und Handel alle tausend Fäden mit der alten Welt anzuknüpfen, um mit ihr allmählich in das Gleiche zu kommen. Dazu brauchen wir den klaren Verstand und die tätige Hand. Wir müssen wachen und arbeiten wie ein junges Volk; ihr drüben schlaft und träumt, wie man es dem Alter gönnen kann. Alte Leute haben mancherlei Grillen, und drüben werdet ihr schon alt geboren. Diese können wir hier nicht gebrauchen; sind sie da, so müssen sie sich mit einflechten, ohne die Arbeit zu stören. Oder ich will mit Euren eigenen Worten dieses Verhältnis Euch auseinandersetzen. Ihr habt mir oft geklagt, daß die Menschen hier kein Gemüt hätten. Da müssen wir nun erst zusehen, was hinter diesen Worten steckt.
»Man umfaßt, wie mir's scheint, damit alle niedern Seelenkräfte, welche die Werkzeuge für die höchste Kraft des Menschen, für den Verstand, sind, um damit zu arbeiten. Da aber diese Werkzeuge wie die Knechte und Mägde in einem Hause lebendig sind, so fangen diese, wenn sie keinen Befehl auszurichten und keine Aufsicht haben, sehr bald an, sich unnütz zu machen und das Hauswesen zu zerstören. In einem solchen Falle würdet Ihr sein, wenn Ihr nicht meine Frau wäret und ich nicht den Verstand für Euch hätte. Eure Phantasie, welche Ihr nicht im Zaume halten könnt, malt Euch in müßigen Stunden das Leben in der Heimat nur zu reizend vor, daraus entsteht die Sehnsucht danach; diese will sich gegen meinen Verstand, welcher hier den Oberbefehl hat, mit Macht geltend machen. Dagegen kann ich denn freilich nur Nein! sagen.«
Notham schwieg mit wohlgefälligem Lächeln über die gelungene Rede, Johanna aber gab sich keineswegs gefangen. Indem sie erwog, daß bei den Ansichten Nothams das Recht der Empfindung kaum zur Anerkennung zu bringen war, griff sie ihn plötzlich auf einer Seite an, wo er es am wenigsten gedacht hätte.
Sie hatte dadurch um so eher die nötige Ruhe gewonnen, als sie den Entschluß zur Abreise oder vielmehr zur Flucht schon gefaßt hatte, und nur noch einmal einen Versuch machte, Notham zur Rückkehr nach Deutschland zu bewegen, um sich später sagen zu können, daß sie vor dem letzten Mittel jedes andere versucht habe.
Mit Eiskälte fragte sie daher obenhin: »Also ist Euer Handelswesen nur Verstandessache?«
»Ganz gewiß!«
»Und das Gemüt hätte nichts darein zu reden, wenn es später merkt, daß es bei einem Vertrage, den Ihr mit einander gemacht habt, beeinträchtigt sei?«
»Ganz und gar nicht!«
»Und wenn der Verstand noch mehr daran auszusetzen hätte?«
»Mann und Wort!«
Jetzt richtete sich Johanna mit edlem Zorne hoch empor und sagte mit unterdrückter, gemessener, seelendurchbohrender Stimme:
»Mann und Wort, du Wortbrüchiger! Was hast du mir, was meinen Eltern versprochen, ehe wir zusagten? Mann und Wort, du verständiger Mann? Warum brichst du uns dein Wort, Amerikaner? – Ich will es dir sagen: weil die niedere Leidenschaft, die auch zum Gemüte gehört, der Eigennutz, der Herr deines Verstandes geworden ist!«
Sie faßte ihn bei beiden Schultern und rief: »Mann, besinne dich auf dich selbst, achte dich, selbst und in dir dein Weib, das du mit Füßen trittst.«
Notham war vor dieser Wendung der Sache bis in das Innerste seiner Seele erschrocken; die schöne Röte seiner Wangen hatte sich bis an die Ohren zurückgezogen, seine Nase war kreideweiß geworden, seine Augen hingen an den Spitzen seiner Stiefel, welche sich, wie zum Zwiegespräch, zu einander bewegten.
Endlich sprang er empor und sagte in tödlicher Verlegenheit, doch trotzig und beleidigend:
»Ich bin hierher gekommen, um auf einige Tage von Euch Abschied zu nehmen, nicht um mit Euch über Eure Pflichten zu plädieren.«
Er drehte sich um und zog die Klingelschnur; John trat ein.
»Mylady«, rief er ihm zu, »wünscht den Herrn Pfarrer Spencer zu sprechen; er möchte seine vortreffliche Predigt über den Text: »Ein Weib sei untertan ihrem Manne«, welche er vor vierzehn Tagen gehalten hat, mitbringen und ihr vorlesen!«
John trat ab; Notham ging noch einige Male die Stube auf und ab; denn gar zu gern hätte er ein Wort gefunden, welches seine Niederlage ein wenig beschönigt hätte; es war ihm unmöglich.
»Mylady«, sagte er endlich, »lebt wohl! Auf Wiedersehen! Künftigen Sonntag werde ich wieder hier sein!«
Johanna gab ihm die Hand, ohne ihn anzublicken; er küßte sie und ging nach der Tür.
Ein weiches Gefühl flog jetzt durch Johannas Seele; sie eilte ihm nach und hing weinend, wie ein Kind, an seinem Halse.
»Leb wohl! leb wohl, Notham!« rief sie, »vergiß mich nicht und verzeihe mir alles, alles!«
»Wie sollte ich nicht?« versetzte Notham; »beherrsche nur dein Gemüt, und alles ist gut!«
Johanna ließ langsam die Arme herabsinken; sie hörte Notham die Treppe hinuntersteigen, vor der Türe dem Pferde gebieterisch zusprechen; nun sprengte er die Straße hinauf.
»Es sollte nicht anders sein«, sprach sie, und ihr Entschluß war unabänderlich gefaßt.
Notham hatte bei Bruder Jonathan in Philadelphia seine Geschäfte beschleunigt; eine Unruhe, welche er noch nie gekannt hatte, trieb ihn zurück nach New Jork.
Als er in dem Boote auf dem Flusse Raraton hinunterschwamm, überwältigte den verständigen Amerikaner eine unermeßliche Angst um sein Weib, sein Haus, oder um – Gott weiß was!
Auf großen Wellen liefen sie jetzt in den Hafen von New York ein.
Sonst stand er, kam er von Philadelphia hierher zurück, mit untergeschlagenen Armen auf dem Verdeck, die Brust gehoben von Stolz auf die schönste Tochter Altenglands, seine Vaterstadt. Heute war sein Auge trüb.
Wenn er sonst an den grünen Inseln, welche wie Schildwachen vor der Stadt stehen, vorüberkam und die täglich wachsende Größe und Pracht von New York übersah, nahm er seinen Hut herunter, blickte über die Schulter und flüsterte vor sich hin: »Gott segne meinen König Georg den Zweiten!« Heute unterblieb Gruß und Spruch.
Wenn er sonst sich der südlichen Spitze der Manhattaninsel näherte, welche den Hafen in den nördlichen und östlichen Fluß teilt und die Stadt New York auf ihrem Rücken von Norden meilenweit zwischen den beiden Strömungen heranträgt an die See, nickte er immer mit dem Kopfe und sagte, zum Steuermann Hancock gekehrt: »Es wird, es wird schon werden!«
»Mein' es auch«, entgegnete dieser
»Es ist unser Neuvenedig!«
»Gott geb' uns sein Gedeihen!«
Heute lauschte Hancock vergeblich nach dem alten Gespräche; Notham blieb stumm, düster hinausblickend nach den Häusergiebeln vom Broadway.
Ebenso schweigsam zahlte er das Fahrgeld im Hafen und bog in den mächtigen, schnurgerade von der südlichen Spitze an durch die Stadt laufenden Broadway ein; denn fast in der Mitte auf einem zurückweichenden Grasplatze zwischen einzelnen Bäumen stand dort ein Haus, von tiefbraunen Jersey-Quadersteinen gebaut, von welchen die grünen Jalousien so schön abstachen.
»Da bin ich endlich!« sagte er, und ihm wurde leichter um das Herz, als der Neger Poll, welcher Türhüter war, ihm wie ein liebkosender Hund entgegensprang.
»Alles in Ordnung, Poll?«
»Massa?«
»Nichts vorgefallen?«
»Weiß nichts, Massa!«
»Lady Patroneß?«
»Sehr fromm! ist vor drei Abenden in die Kirche gegangen und noch nicht heim.«
»Ha!«
Mit einem krampfhaften Griff hatte Notham den Neger gefaßt und weit hinein in den Grasplatz geschleudert. Ihm war es, als hätte er einen Schlag vor den Kopf bekommen.
Plötzlich aber richtete er sich in die Höhe, bog die Schultern zurück, daß sie krachten und die Brust weit vortrat. Die Unterlippe eingebissen, daß Blut unter den Zähnen hervorrieselte, trat er mit festen, hallenden Schritten in das Haus.
Seine Haussklaven hatten sich in die Winkel umher zusammengeduckt, ohne sich zu bewegen, und ihre Augen rollten ihm überall unstät und ängstlich entgegen.
»Wo ist John?«
»Hier!«
Beide sahen sich einander lange an. John ließ endlich den Schlüsselbund klimpern.
»Woher hast du die Schlüssel?«
»Von Lady Patroneß!«
»Gib her!«
Er schritt die Treppe hinauf zum Zimmer seiner Frau. Er schloß es auf; die grünen Jalousien lagen vor den Fenstern. Er stieß sie auf und sah in den Armen des porzellanenen Chinesen einen versiegelten Brief mit seiner Adresse liegen.
Lange drehte er ihn in der Hand hin und her; dann warf er ihn unerbrochen auf den Tisch und seinen Hut darüber, als hätte er damit das Unglück, das er nicht fürchtete, sondern mehr noch wußte, ungeschehen machen können.
»John!«
»Sir!«
»Bring Licht!«
Die Sonne war allerdings im Untergehen, doch war es im Zimmer noch hell genug, um einen Brief zu lesen.
Das Licht kam; er winkte John zum Hinweggehen. So war er wieder allein.
Er lüftete sich den Rock vor der Brust, drückte sich wieder den Hut in die Stirn, nahm den Brief und fand die Worte:
»Lieber Notham!
Nur wenige Worte; denn zu viel sind diese für ein empfindendes Herz, und noch mehr immer noch zu wenig für den kalten Verstand.
Meine Pflicht ruft mich zur Pflege an das Krankenbett meines Vaters, der Raum zwischen hier und dort kann sie nicht aufheben. Wenn du diese Zeilen empfängst, bin ich auf der Fahrt in die Heimat. Im übrigen bleibe ich deine treue und gehorsame
Jeannette.«
Wie bei Völkern, welche noch eine Zukunft haben, so wirkt bei dem einzelnen, welcher noch einen Kern in sich hat, ein heftiger Schlag eines zertrümmernden Schicksals wie der geschwungene Hammer eines Erzgießers auf die Lehmform; diese zerspringt, aber aus den Trümmern hervor tritt das höhere, eherne Gebild eines Gottes.
Indem Notham in diesem Augenblick sein ganzes, gegenwärtiges Leben zertrümmert sah, fühlte er fast einen höheren Menschen als der frühere war, in ihm sich emporrichten.
Er las die Abschiedsworte von Johanna noch einmal und sagte endlich laut: »Sie hat recht getan! – Nach ihrer Art!« setzte er hinzu, »möge sie Gott sicher zu ihrem Vater hingeleiten und mir auch einst eine solche Tochter schenken!«
Bei diesem Gedanken trat ein anderer an die Hoffnung, welche Johanna unter ihrem Herzen trug, in seine Seele, und die Hände vor die Augen gedeckt, sank er auf seine Kniee.
Nachdem er seine tiefsten, schmerzlichsten Sorgen in Gottes Hand gelegt hatte, suchte er den Kummer so weit zu beherrschen, daß er seine bürgerliche Ehre zu decken suchte.
Er zog sich in seine Stube zurück und schrieb die ganze Nacht durch Briefe. Am anderen Morgen klingelte er seinem John und sagte:
»Schicke alle Briefe an ihre Adressen aus! Alle meine Sklaven sollen sich auf die Beine machen. Meine Frau, welche ich zur Pflege ihres todkranken Vaters über Meer habe reisen lassen, hatte keine Zeit, sich zu verabschieden.
Da, hier diesen Brief zuerst an Mrs. Austin, die Vorsteherin des Frauenvereins zur Besserung verwahrloster Kinder; hier ist Geld zu einem Dutzend Taschentücher, welche mit dem Briefe übergeben werden. Dieser an Master Spencer, welcher in der Frauenbetstunde für ihre glückliche Reise beten soll; dabei werden fünf Hüte Zucker in seine Küche abgegeben! Da, diesen Brief an ihre Putzmacherin, Mrs. Paulding; die Rechnung wird gleich bezahlt. Hier, hier die anderen Briefe! – – Mach schnell!
Hast du die Sklaven abgesendet, dann mache dich selbst auf die Beine und frage im Hafen nach, welche Schiffe in diesen Tagen nach England oder einer deutschen Hansestadt ausgelaufen sind? Hörst du?«
John entfernte sich so gemessen ernsthaft und schweigsam, wie er eingetreten war; nur unter der Tür sagte er halblaut für sich: »Sehr wohl!«
Notham setzte sich wieder an das Schreibepult und machte eine dritte Abschrift von einem Brief an seinen Schwiegervater, den k. k. Rittmeister Lazarus von Thossenfeld in Leimnitz bei Gera in Deutschland, in welchem er ihn beschwor, sofort ihm zu melden, wenn Johanna bei ihm eingetroffen sei.
Dann schrieb er Briefe an seine Freunde in den englischen und deutschen Seestädten, indem er Aufschrift und Raum für die Namen liest, welche alle dahin lauteten:
»Meine Frau hat sich zwar mit meinem Willen nach Europa eingeschifft, um ihrem todkranken Vater töchterliche Pflege zu bringen, hat jedoch im Drang der Abreise während meiner Abwesenheit in Philadelphia vergessen, das Schiff zu nennen, mit welchem sie abgereist ist. Ausgelaufen ist am ... Kapitän ... Ich bitte, auf Rechnung für mich alle Mittel aufzubieten, sie ausfindig zu machen und sicher nach Sachsen zu befördern.
Arthur Notham.«
Nach einer Weile kam John aus dem Hafen zurück mit der Meldung von den nach Europa in den letzten Tagen ausgelaufenen und den zunächst dorthin abgehenden Schiffen.
Notham füllte die Adressen in den Briefen an die befreundeten Häuser in den verschiedensten Seestädten mit der Angabe der dorthin abgegangenen Schiffskapitäne und Schiffe aus und ließ sie und die gleichlautenden Briefe an seinen Schwiegervater durch drei verschiedene Schiffsgelegenheiten der Sicherheit wegen bestellen.
So hatte er zunächst alles getan, was der Augenblick ihm geboten hatte. Er kleidete sich nunmehr frisch an und ging wie gewöhnlich auf das Comptoir, ließ sich von seinen Buchhaltern Bericht abstatten und begab sich dann auf die Börse.
Wenn nicht die Bleichheit seines Gesichtes, sonst konnte nichts an ihm seine innere Bewegung verraten.
Die Nachricht von der Abreise seiner Frau war durch seine ausgeschickten Briefe bereits in der Stadt herum. Er ließ sich gern den Tadel verständiger Männer gefallen, daß er seine Frau allein die große Reise habe antreten lassen. Andere suchten ihn weiter auszuforschen, er wußte aber so gut zu manövrieren, daß alle vorwitzigen Fragen auf den Sand liefen.
Zu Sommersausgang erhielt er von einem Handelsfreunde aus Portsmouth die Nachricht, daß Lady Johanna vor Eintreffen seines Briefes mit Kapitän Simm eingelaufen, jedoch tags darauf mit dem Paketboot nach Hamburg abgegangen sei.
»Gott sei Dank!« rief er, »so ist sie doch allem Vermuten nach glücklich nach Hamburg gekommen!«
Später erhielt er auch dorther Antwort, jedoch keine andere Auskunft, als daß im Laufe des Frühjahrs und Sommers kein Hamburger Schiff gescheitert sei.
Der Herbst kam und ging vorüber, Notham hatte noch keine Nachricht aus Leimnitz erhalten. Die Zeit, wo Johannas Niederkunft erwartet werden konnte, war längst verstrichen. Gegen Weihnachten traf endlich ein Brief aus Gera ein. Er war schwarz versiegelt.
Der dortige Bürgermeister schrieb ihm:
»Ihr Brief an den seligen Herrn Rittmeister von Thossenfeld ist bei mir, seinem Testamentsvollstrecker, abgegeben worden. Als solcher hielt ich mich für berechtigt, ihn zu eröffnen, so wie ich es mit dem von dero Frau Gemahlin einige Tage zuvor angelangten Briefe getan hatte. Dero Erblasser war aber schon am ... Mai ... infolge eines sonst unbedeutenden Sturzes gestorben; er hatte eine fast übermächtige Sehnsucht nach seiner Tochter, so daß ihre Ankunft ihm zu gönnen gewesen wäre. Dero Frau Gemahlin ist aber bis dato hier nicht eingetroffen, werde aber nicht verfehlen, sofort davon Meldung zu tun, sobald die gnädige Frau hier präsent sein sollte, wie ich denn gar nicht zweifle, daß sie selbst einige Zeilen dazu schreiben wird. Vorläufig möchte eine Vollmacht auf Antritt und Übernahme der Erbschaft, welche Euer Gnaden als Testamentserben zusteht, für dero Geschäftsfreund, wozu ich unvorgreiflich den hiesigen Gerichtsdirektor Schindler Vorschläge, hierher einzusenden sein. Sonst zur besonderen Instruktion lege ich die von mir eröffneten Briefe von dero Frau Gemahlin an Herrn Vater mit bei.«
Sein Auge hatte die Zeilen des Briefes verschlungen; er sah nach dem Datum des Briefes; der Testamentsvollstrecker hatte sich mit seiner Nachricht Zeit genommen; Johanna hätte damals längst schon in Leimnitz sein müssen, wenn ihr unterwegs kein Unglück zugestoßen war. Mit dem Angstschrei: »Mein Kind!« welcher ihm fast die Brust zersprengte, stürzte Notham in die Arme seines alten, treuen Dieners, welcher das Briefpaket gebracht hatte.
Mit Mühe schleppte John den Besinnungslosen auf das Sofa. Nach einer Weile überfiel Notham ein Frost, welcher alle seine Glieder schüttelte. Vergeblich warf John Matratzen und Teppiche auf ihn, vergeblich suchte er ihm Tee einzuflößen, das Zähneklappen und Händezittern hörte nicht auf. Um Mitternacht begann der Kranke zu glühen, das Nervenfieber war ausgebrochen. Kaum gelang es den herbeigerufenen Ärzten, mit heroischen Mitteln Nothams unbändige Natur zu brechen. Vielleicht retteten sie ihn vom Tode, sie hatten aber dabei auch seine Lebenskraft für immer gedämpft. Als er das Krankenbett wieder verlassen konnte und zum erstenmal am Fenster stand, prangten die Bäume vor dem Hause wieder im Schmucke des Laubes und der Blüten. Der Frühling war zurückgekommen, nur nicht für sein Herz.
Im Monate Juni war er soweit wiederhergestellt, daß er sich wieder um die Angelegenheiten seines Hauses kümmern konnte. Sein Entschluß war gefaßt. Mit einem Londoner Kaufmanne, welcher seinen Sohn in New York etablieren wollte, schloß er einen Kauf über die Häuser und Warenlager ab.
Mit den nötigen Kreditbriefen versehen, schiffte er sich nach Hamburg ein. Dort und überall auf den Straßen und Wegen suchte er Nachrichten über Johanna einzuziehen. Obschon er keine Mühe und kein Geld scheute, sie auszukundschaften, so hatte doch alles nicht den geringsten Erfolg. Vielleicht wäre er in jetziger Zeit bei geordneten Verhältnissen in Deutschland glücklicher gewesen. So kam er hoffnungslos und trübsinnig in Gera an. Er hatte niemand bei sich als seinen John, welcher von allen, wie sein Herr auf den ersten Blick von niemand wiedererkannt wurde, so sehr hatte sich dieser verändert. Notham bezog wieder sein altes Quartier im Deutschen Hause. Seine einzige Beschäftigung bestand darin, daß er sich zum Frühstücke auf die Stelle an der Tafel, welche früher so oft der alte Rittmeister eingenommen, und seinen Stock in das Loch setzte, welches dieser dort in die Diele getreten hatte, und dann, daß er ebenso, wie vor Jahren, einen Spaziergang um die Stadt und nach dem Mittagstische seinen Weg, wie früher, in das ererbte und verpachtete Gut machte.
Manchmal begleitete ihn dorthin der Kantor aus Gera, der alte Musiklehrer seiner Frau, welcher ihm auf dem alten Klaviere in dem ehemaligen Zimmer seiner Schwiegereltern die Lieblingslieder der Verschollenen und darunter ihr Lied vom Heimweh vorspielte. Abends saß er gewöhnlich mit John, welcher nun ganz sein Freund geworden war, im Zimmer zusammen bei einer Tasse Tee und ließ sich von ihm die Englische Zeitung vorlesen. Blieb sie ja einmal einen Posttag aus, so spielten sie mit dem einen oder anderen Bekannten eine Whistpartie.
Nichts machte die Zeit kürzer als Langeweile. So barock diese Behauptung klingt, doch ist sie wahr. Man gehe nur einige Wochen auf Reisen, wo man immer etwas Neues erleben muß und fast jede Stunde mit einer neuen Begebenheit füllt, und vergleiche dann einen gleichen Zeitraum, welchen man daheim in müßigem Hinschlendern zugebracht hat – die Wochen der Reise mit ihren Erinnerungen werden zu Jahren und die Jahre des Müßiggangs zu Sekunden zusammenrinnen. Der Jugend dehnt sich ein Jahr unendlich aus, dem Alter, welches keine frischen Eindrücke mehr in sich aufnimmt und verarbeitet, beginnt die Zeit immer schneller zu laufen.
Als Notham mit John an einem schönen Sommernachmittage von drüben nach Gera zurückkehrte und die Blicke auf die untergehende Sonne richtete, fragte er: »Wie lange ist es nun seit unserer Zurückkehr nach Gera her?«
»Hm, lange her!«
»Wie oft ist denn drüben geerntet worden?«
»Siebzehnmal – ja, ja, siebzehn Jahre sind es her!«
»Die Zeit geht schnell!«
»Mit Leid und Lust!«
»Für mich mit Leid, ich gönne dir die Lust!«
»Sir, teilt Ihr nicht mit mir, mag ich davon auch nichts haben!«
»Ich denke heute wieder einmal recht lebhaft an meine Frau. Sie geht mir immer so schlank vor den Augen vorüber und nickt mir so freundlich zu wie in unseren schönsten Tagen. Wenn mir doch wer den Weg zu ihrem Grabe zeigen könnte!«
Als er kaum noch diese Worte ausgesprochen hatte, hörten sie eine kräftige Stimme singen:
»Wo auf hohen Tannenspitzen,
Die so dunkel und so grün.
Drosseln gern verstohlen sitzen,
Rot und weiß die Moose blüh'n,
Zu der Heimat in der Ferne
Zög' ich heute noch so gerne.«
Da verhallte die Stimme und über einen Straßengraben hinüber sprang ein junger, schlanker Mann in Jägertracht und zog mit weiten Schritten den Fußsteig hinunter auf die Stadt zu.
Notham fühlte von diesem Liede die zarteste Saite seines Herzens berührt, welche immer noch nachklang, als der junge Wanderer schon längst verschwunden war.
Langsam und schweigend setzten sie ihren Weg fort und kamen in der Abenddämmerung im Deutschen Hause an.
Sie traten in die kleine Honoratiorenstube ein, wo für beide der Abendtisch gedeckt war. Da sie im Sommer abends dort selten Gesellschaft trafen, so kam es ihnen fast fremd vor, einen Gast am Tische bei einem Kruge Bier und einem spärlichen Eiergerichte zu finden.
Als Notham sich seinem gewohnten Sitz näherte, welchem zunächst der Gast Platz genommen hatte, glaubte er in ihm den jungen Wanderer und Sänger, dessen Lied ihn so nahe anging, wiederzuerkennen.
Er setzte sich zu ihm, John zu seiner Linken, ohne daß der eine oder der andere ein Wort gesprochen hätte.
Der Wirt brachte Schinken, Salat und Eier und wartete unter der Tür auf weitere Befehle.
Der dritte Gast, welcher weniger ernst als trüb vor sich hinblickte, drückte jetzt heimlich einen Fingerring an seine Lippen.
Notham hatte einen Blick darauf geworfen und ließ ihn erbleichend auf dem Ringe haften. Es war eine zusammengekrümmte Schlange, deren Kopf ein Rubin bildete, es war der Zwillingsring von dem, welchen er selbst trug.
»Es ist dein Sohn!« schrie es in ihm mit tausend Stimmen empor; – »vielleicht auch nur ein Dieb oder ein Mörder!« flüsterte der Argwohn dagegen. Er sah ängstlich forschend dem Jüngling in das Gesicht, zwei große, dunkle, ehrliche und doch verwunderte Augen blickten ihm entgegen. »In ihm ist kein Arg!« sagte er bei sich selbst; – »sollte es auf der Welt nur zwei Ringe derselben Art geben?« warf die Klugheit dagegen ein.
Notham konnte diesen Widerstreit der Gedanken und Gefühle nicht länger ertragen; – er eilte hinauf in sein Zimmer, lief darin wie außer sich hin und her und rief einmal um das andere: »Wenn er es doch wäre!«
Jetzt sah er John in der dunklen Stube stehen; er faßte seine Hand, beugte sich an sein Ohr und sagte: »Schaff' mir Gewißheit!«
»Worüber?«
»Der junge Mann unten trägt einen Ring, wie ich meiner Frau am Altar gegeben habe, wie ich den zweiten, ganz ähnlichen, noch trage.«
»Seltsam!«
»Wir dürfen uns nicht übereilen.«
»Nein!«
»Was tun wir?«
»Ihn aushorchen!«
»Wenn es mein Sohn wäre!«
»Freilich!«
»Gehe hinunter zu ihm – nein! Bestelle bei dem Wirte Tokayer und drei Gläser!«
»Drei?«
»Und bitte den jungen Menschen, mit mir einigen Flaschen den Hals zu brechen; ich wäre ein alter, lustiger Kumpan aus Amerika!«
»Lustig, wie gesagt.«
John ging hinunter und kam mit Licht, Wein und Gast in wenigen Augenblicken zurück.
Notham musterte den jungen Gesellen von Kopf zu Fuß; er glaubte nirgend einen schöneren, kräftigeren Jüngling gesehen zu haben. Er gab ihm die Hand, es war ihm, als wenn aus dem Händedruck ein Feuerstrom ihm nach dem Herzen dränge.
»Guten Abend, Herr!« sagte der Fremde, »ich bin Hermann Tannhof, oben von Reichenbach her, und wer sind Sie? Denn es ist das Kalte und Warme durcheinander, mit Vergunst gesagt, gegen meine Liebhaberei!«
»Ältere Leute sind vorsichtig, deshalb nicht kälter als jüngere; ich bin aber Notham aus New York, und der da ist John, mein Freund und Helfer.«
»Das lasse ich passieren!« versetzte Tannhof, »und da Sie aus Amerika sind, so ist es mir recht lieb, denn dorthin möchte ich und kann dabei allerlei guten Rat gebrauchen.«
»So werden wir viel miteinander zu besprechen haben«, entgegnete Notham; »nehmen wir uns Zeit dazu. Der Wirt hat uns mit einem guten Trunk Wein bedacht, setzen Sie sich zu mir!«
Notham schenkte ein und stieß mit Tannhof auf glückliche Bekanntschaft an.
Tannhof leerte das Glas und rief: »Gott segne jedweden, der solchen Wein liebt und gibt!«
Notham gab John einen Wink, und John verstand ihn zu gut, um dem jungen Gast nicht wacker zuzutrinken.
»Warum wollen Sie«, fragte Notham dazwischen, »nach Amerika auswandern? Gefällt es Ihnen nicht mehr in Ihrer Heimat?«
»Gefallen, ja gefallen täte es mir hier wohl, aber damit kommt man lange noch nicht aus!«
»Was sagen denn Ihre Eltern dazu?«
»Freilich, wenn sie noch lebten!«
»Sind sie schon lange tot?«
»Ich habe sie nicht gekannt; ich bin von dem Pfarrer in meinem Dorfe, Günther heißt er, halb und halb erzogen worden.«
In Nothams Seele wogten Furcht und Hoffnung durcheinander.
»Wissen Sie«, fragte er weiter, »ganz genau, daß Ihr Vater Tannhof hieß?«
»Könnt ihr Amerikaner alle so ausfragen? Ich möchte doch wissen, was Ihr hinter mir sucht?« versetzte Tannhof lustig.
»Nun, so erzählen Sie«, entgegnete Notham, »was uns und Sie erheitern kann.«
»Mich macht nichts mehr froh«, seufzte Tannhof, »denn ich bin ein unglücklicher Mensch!« Er leerte dabei das Glas bis auf den Boden und sagte: »Aber das Getränk da bleibt freilich etwas Gutes!«
»Ihr Liebchen soll leben!« sagte Notham und stieß an.
»O zehntausendmal, du liebe Marie!« rief Tannhof mit feuchten Augen und stieß an. »Und denken Sie nur«, sprach er mit gelöster Zunge, »ihretwegen muß ich die Heimat ewig meiden; ich habe es dem Pfarrer versprochen, nicht eher wiederzukommen, bis ich Maria nach Stand, Ehren und Auskommen heiraten kann – das heißt nun nimmermehr! und Ade, du Berg und Tal! Ich habe eigentlich nichts gelernt als das, was ein Junker braucht – ein bißchen Geographie, welche mich auf Amerika gebracht hat, ein bißchen Geschichte und Mathesis; – nun ja, Lesen, Schreiben und Rechnen versteht sich! Werde ich damit in Amerika auskommen?«
»Man gebraucht drüben einen hellen Kopf und eine rege Faust!«
»Donnerwetter, die hab' ich, und wäre der Pfarrer nicht gewesen, so wäre ich jetzt preußischer Husar! Es wird auch das Beste sein! Es ärgert mich nur, daß ich als Bürgerlicher kein Offizier werden könnte!«
»Aber wer hat denn dem Pfarrer so viel Recht über Sie gegeben?«
»Weiß ich es denn? – Aber freilich, wenn er nicht gewesen wäre, sie hätten mich aus der alten Burg auf die Straße gesetzt, ehe ich laufen gekonnt!«
»Wie hieß Ihre Mutter?«
»Johanna! Sie war aber nicht aus der Umgegend, ich dächte, von Hamburg her; mein Vater, der ein verschuldetes Gut besaß, hat sie so weit hergeholt. Sie starben, wie gesagt, in meiner frühen Jugend kurz hintereinander her, und der Pfarrer hat sich meiner angenommen, mir allerlei beigebracht, und wer weiß, was er sonst getan hätte, wär er nicht dahinter gekommen, daß wir uns so lieb haben, ich Marie und sie mich!«
»Johanna?« fragte Notham bei sich; mit der innigsten Vaterliebe blickte er Tannhof an; er mußte sein Sohn sein. Sein Herz schlug ungeduldig dem Augenblick entgegen, wo jeder Zweifel gelöst war und er ihn mit dem Freudenruf: »Ich bin dein Vater!« an sich reißen konnte.
Schon jetzt hielt ihn nur der alte John von einem übereilten Schritte zurück mit der Frage, welche er an Tannhof tat: »Wie viel bares Geld habt Ihr denn zu einem guten Anfange drüben?«
»So viel, als ich zur Überfahrt gebrauche, bekomme auch wohl, wenn das Gut verkauft ist, noch ein Stück Geld heraus, das mir der Pastor hinüberschicken will.«
»Da habt Ihr wohl ein bißchen übel gewirtschaftet, da das Gütchen Euch durch die Finger fällt?«
»Wäret Ihr nicht ein alter, gewichster Mann, so möchte ich Euch auf meine Art antworten; fragt Euch aber jemand darum, so sagt nur: Wenn man vom Vater her ein verschuldetes Gut bekommt, und der Blitz schlägt in die Scheuer, daß es wegbrennt, so muß man es mit Schulden wieder aufbauen, und ehe man sich umsieht, gehört einem nicht mehr der Ziegel auf dem Dache! Freilich, kann man sein Lebelang seine Beine unter fremden Tisch stecken, so ist es keine Kunst, eine Sparbüchse zu sein!«
John verzog das Gesicht, Notham aber lachte über die Abfertigung, wie noch nie.
»Weiß ich nur erst, wie Ihnen zu helfen ist«, wandte sich Notham zum jungen Tannhof, »so kann ich Ihnen vielleicht selbst unter die Arme greifen.«
»Sie sind wohl sehr reich?« fragte Tannhof mit klugem Augenzwinkern.
»Wie viele Taler könnten Sie in einem Jahre in einzelnen Stücken aufzählen?«
»Ich weiß es nicht.«
»So müssen wir es einmal versuchen.«
»Daß dich der Blitz! – Da wäre ein Kauf mit Ihnen zu machen; – es wäre schade um meine Waldung, wenn ein habsüchtiger Barbier darüber her sein dürfte! – Ich hatte wohl immer meine Gedanken auf den Pfarrer und dachte, er sollte mir unter die Arme greifen, wenn ich um Marie bei ihm anhalten würde; denn wir beiden Liebesleute waren miteinander schon einig. Wie das neue Gutsgebäude in die Höhe und ausgebaut war, und alles so aussah, als wenn eine junge Frau es sich schon bei mir gefallen lassen könnte, besprach ich mich mit Marie. Sie sollten das herzige Mädel sehen! – Und wir warteten vorigen Sonntag die Zeit ab, wo die Leute eben die Kirche verlassen hatten und der Pfarrer auf den Altar ging, um in der Agende die Stellen einzuzeichnen, die der Kantor nachmittags in der Betstunde vorlesen sollte.
»Diesmal fand er gar kein Ende mit Blättern; er mochte wohl bemerkt haben, daß wir beide hinter ihm standen und sich das übrige denken.
»Endlich mußte er sich doch umkehren. Ich hatte eine so hübsche Anrede einstudiert, als nur eine sein kann; – als er aber seine großen, hellen Augen auf uns herabsenkte, waren meine Worte schlechte Soldaten, sie wollten nicht marschieren, wußte er es doch so gut, als wir, was uns am Herzen lag.
»Tannhof«, sagte er, »daraus kann vor der Hand nichts werden; ich habe dich und Marie zu lieb, als daß ich euch in das Unglück stürzen sollte.«
»Wir sind ganz und immerdar glücklich«, rief ich, »wenn Marie mit mir Freud und Leid teilt!« »Das stellt sich alles leicht vor«, versetzte er, »aber es ist doch anders. Hat der Blitz dir in das Gut geschlagen und es weggebrannt, so denke, Gott hat deine Absicht auf Marie nicht gemocht; denn, laß dir es frei heraussagen, obschon ich dich damit nicht kränken will, eigentlich bleibt dir für Gut und Waldung kaum Holz zu einem Bettelstäbe übrig. Heute machtest du Hochzeit und führtest die junge Frau in das Haus, morgen kämen die Gläubiger und jagten Adam und Eva aus dem Paradiese! – Was nun anfangen?«
»Wir beide weinten bei diesem Vorhalt bitterlich, sanken auf die Kniee und erklärten aufrichtig, daß wir gern hacken und spinnen wollten miteinander.
Der Pfarrer aber schüttelte mit dem Kopfe und sagte: »Es kann nun einmal nicht sein, ergebt euch mit Fassung in diese erste, große Prüfung, welche Gott euch auferlegt hat.«
»Der Pfarrer dort«, bemerkte Notham, »scheint ein verständiger Mann zu sein!«
»Wenn nun«, entgegnete Tannhof hitzig, »alles und jedes der Verstand ausmachen und abmachen soll, so sehe ich gar nicht ein, wozu der liebe Gott noch da ist; – so habe ich dem Pfarrer gesagt, und seht, ihr klugen Leute, er erschrak dabei und lenkte ein.«
Auch Notham war betroffen; ihm trat die letzte Unterredung mit seiner verschollenen Frau in das Gedächtnis; – doch hielt er an sich, um seinen Sohn, wofür er den jungen Gast hielt, immer mehr ungestört sich aussprechen zu lassen und vielleicht dabei Mitteilungen zu erhalten, welche ihm bestimmteren Aufschluß über das geben könnten, was er so sehnlich wünschte.
Er glaubte um so behutsamer sein zu müssen, als der junge Gast offenbar in dem Glauben stand, ein geborener Tannhof zu sein.
»Wie mich nun«, fuhr der Erzähler fort, »der Pfarrer ansah, so sah ich ihn wieder an. Ich muß euch noch sagen, daß es vorige Sonnabendnacht stark gewittert hatte, wie vielleicht hier unten um Gera auch, und der Sonntagvormittag noch in Wolken und Regen sich herumbalgen mußte. Als jetzt mein Schicksal von einem guten Worte des Pfarrers abhing, brach auf einmal am Himmel die Sonne wie mit einem Hurra durch die Wolken und warf durch das Kirchenfenster einen breiten Strahl herein auf den Altar, daß der Heiland mit der goldenen Auferstehungsfahne, die silbernen Leuchter und die Altargefäße auf dem rotsamtnen Altartuche, oben die Engel mit ihren Flügeln durcheinanderflatterten und selbst Marie mit ihren Tränen wie eine Rose mit Tauperlen funkelte.
Das mochte alles zusammenkommen, um den Pfarrer milder zu stimmen. Ich sah es ihm an und sagte: »Hochwürdiger Herr Pastor! Sie hätten mir gewiß Marie zur Frau gegeben vor dem Brande meines Schlößchens und Hofes, nun trat das Unglück ein und trennte uns, kann denn nicht auch einmal das Glück bei mir einschlagen? – Ich bin jung und gesund, wer weiß, ob es mir nicht einmal begegnet, zugreifen will ich schon!«
Marie umschlang bei dieser Anrede die Kniee des Pfarrers, sie war aber zu verschämt, um ein Wort dazu zu geben, sonst wäre es vielleicht noch besser geworden.
»Gebt euch die Hände, Kinder!« rief darauf der Pfarrer, »unter der Bedingung, daß Tannhof binnen hier und drei Tagen das Dorf hinter sich läßt und sein Glück draußen in der Welt sucht, sollt ihr euch fünf Jahre lang unverbrüchlich treu bleiben; – ist Marie aber dreiundzwanzig Jahre alt geworden und du hast noch kein ordentliches Auskommen für sie, dann soll eins von dem anderen geschieden sein.«
Damit trennte er uns, ich mußte voran zur Kirche hinausgehen, er aber hielt Marie zurück und hat dort noch viel zu ihr gesprochen, bis sie wieder Mut gefaßt hat, so daß wir nun alle beide das Beste hoffen.«
»Wie aber kommen Sie, lieber, junger Freund«, fragte Notham forschend, »auf den Gedanken, nach Amerika auszuwandern? Ist Ihnen vielleicht gesagt worden, daß Sie dort nahe Anverwandte fänden? Oder haben Sie vielleicht meinen Namen Notham einmal gehört? Oder fällt Ihnen sonst etwas ein, was Sie darauf gebracht hat?«
Notham hielt gespannt den Odem an sich, aber ein Seufzer entstieg seiner Brust, als Tannhof den Kopf schüttelte und fortfuhr:
»Da ist ein Buchdrucker aus Plauen, der drüben in Philadelphia ein reicher Mann geworden ist; und nicht nur dieser, auch mancher andere ist arm hinübergegangen und dort zu Mitteln gekommen. Wo sollte ich nun weiter hin?«
Notham sah den jungen Mann schwermütig an, hin- und hergeworfen zwischen Vermutungen und Wünschen.
»Als Sie uns heut' abend vor dem Tore begegneten«, fragte er nach einer Weile, »sangen Sie die Strophe eines mir besonders teuren Liedes. Darf ich fragen, von wem Sie es gehört haben?«
»Da ist ein Dorf mit einem verfallenen Schloß, das liegt droben von Weida her, das Mosen heißt, dort hat es mir ein guter Kamerad vorgesungen heute mittag beim Kruge, ehe ich geradeswegs nach Gera ging.«
Es blieb Notham nur das einzige übrig, den Ring, welchen Tannhof am Finger trug, näher zu prüfen.
»Erlauben Sie mir, junger Freund«, fragte er jetzt Tannhof, »Ihren Ring hier mit dem meinen zu vergleichen?«
Tannhof zog den Ring ab und sagte: »Ich habe mich auch schon gefreut, daß ich gerade so einen Ring habe wie Sie, der reiche Herr aus Amerika.«
Notham hatte das Licht an sich gezogen, indem er den Ring der Flamme näherte und inwendig betrachtete. Es war eine Schrift darin eingegraben, seine Hände zitterten, seine Augen umwölkten sich. Er heftete den Blick schärfer darauf und las: »Arthur. 17..!«
Lange stand er da, überstürzt von allen Wonnen der Vaterfreude, endlich breitete er seine Arme aus und rief mit erstickter Stimme: »Mein Sohn! mein Sohn! mein Sohn!« »Hurra!« jauchzte John und schwenkte seinen Hut.
Tannhof hatte jedoch eine andere Meinung; trotz der Berechtigung seiner Gefühle, welche er dem Verstande gegenüber bei dem Pfarrer geltend gemacht hatte, vergönnte er dem letzteren jetzt den Vortritt.
Er hatte sich schnell genug das, was er hier erfahren hatte, im Kopfe zurecht gelegt, um sich zu sagen, daß es sich hier um ein Geheimnis handle, aus welchem sein Glück aufblühen könne.
»Das kommt mir alles zu jäh«, versetzte er, Nothams beide Hände festhaltend, »um mit mir einig zu sein. Wollen Sie mich denn auch immer als Ihren Sohn ansehen, wenn sich auch ergeben sollte, daß ich es am Ende nicht bin? Oder wenn ich nun eine andere junge Person herbrächte und sagte: »Da sieh zu, das ist vielleicht dein Kind!« – welchen Habdank würde ich dann haben?«
»Yankee!« rief John, »nimm dich in acht, Bruder Jonathan über dich!«
»Junger Mann«, versetzte Notham bestürzt, »daß du mein Sohn bist, muß ich so lange glauben, als ich den Ring hier in Händen habe; aber, Gott sei mein Zeuge, wärst du es nicht und schenktest mir das Kind, vielleicht auch die Mutter, du solltest sein Bruder sein; ich hätte für euch beide genug, um euch glücklich zu machen!«
»Mann und Wort!«
»Und bei diesem Ausrufe erkenne ich noch einmal Johannas Sohn!« versetzte Notham.
»Den Ring hier«, erzählte Tannhof zögernd, »habe ich erst seit gestern, Marie hat mir ihn bei dem Abschiede gegeben; es ist der Trauring ihrer Mutter.«
»Sie ist es!« rief jetzt John; »nun sind wir auf dem rechten Weg!«
»Sie ist aber des Pfarrers Tochter?«
»Pflegetochter.«
»Wie heißt ihr rechter Vater?«
»Arthur!«
»Mein Gott! mein Gott!« rief Notham, »es ist mein Vorname; und ihre Mutter?«
»Weiß nicht; die ist schon lange begraben.«
»Der Pfarrer muß sie gekannt haben«, fuhr Tannhof fort, »denn er sagte einmal, Marie habe die Haare ihrer Mutter.«
»Beschreibe mir das Kind!«
»Denkt sie Euch so schön als Ihr wollt, sie ist immer noch schöner! Schlank ist sie wie eine junge Tanne; ihr Gesicht, ja, Ihr solltet einmal hineinsehen, wenn sie lacht! – und die Grübchen auf beiden Seiten werden tiefer und die kleinen weißen Zähne blitzen um die Wette mit den großen, freundlichen, schwarzen Augen! Damit sie nun erst recht schön ist, hat sie blonde Haare; blonde Haare und schwarze Augen, als sollte man erst recht in sie vernarrt werden! Und was für wunderliche Einfälle sie hat!«
»Von wem sprichst du?« fragte Notham mit starrenden Augen – »du schilderst meine verstorbene Frau, meine unglückliche Johanna!«
»Nun, da ist Marie ihre und deine Tochter!«
»Meine Tochter?« sprach lächelnd und mit tonloser Stimme Notham vor sich hin und faltete die Hände. Bei der Gewißheit, daß er ein Kind besitze und es glücklich wiederfinden sollte, zog das Gefühl des Glücks so gewaltig in sein Herz ein, daß es ihm so weh tat, als müßte es zerspringen.
»Soll ich den Wagen anspannen lassen?« fragte John.
»Ha!« rief Notham; »auf die Post, Wagen und Pferde vor, und du – ach! es ist zu viel für einen Menschen, was mir zu Gemüte will! und du wärest – Mariens Verlobter? – und so am Ende doch noch mein Sohn? Jetzt drücke ich dich erst recht an mein Herz!«
»Nun kann ich es auch aufrichtig tun«, versetzte Tannhof, »denn es wird schon so sein, wie wir alle denken!«
»Ich kann dir nicht helfen«, entgegnete Notham, »du mußt mit uns zu Marie und ihrem Pflegevater fahren; wir fahren die Nacht durch.«
»Da sind wir morgen nachmittag bei ihr! Ich kenne die nächsten Wege! – Und wenn Marie Eure Tochter sein sollte, – dann könnte ich doch auch zum Pfarrer sagen: »Da bin ich, und das Glück hat bei mir eingeschlagen!«
»Wie es Gott auch fügt, so lange du diesen Ring besitzest, bin ich dein Vater!«
»So oder so!«
Während sich Notham und Tannhof auf diese Weise verständigten, kam die Extrapost vorgefahren.
Kaum gönnte sich Notham Zeit, seinen Mantel umzuwerfen; ehe er sich noch recht besonnen, rollte der Wagen mit ihnen in die schöne, klare Julinacht zum Tore hinaus.
Am anderen Nachmittag pochte jemand an die Studierstube des Pfarrers Günther; er rief: »Herein!« und Tannhof stand verlegen lächelnd vor ihm.
»Du bist ein wortbrüchiger Mensch!« rief zornig der Pfarrer; »hältst du so dein Gelöbnis, welches du mir vor dem Altare abgelegt hast?«
»Ja, ich meine so!«
»Also gilt dir der Frieden eines gutgearteten Mädchens nichts in der Verblendung deiner Leidenschaft?«
»Ihr Vater hat es mir nun einmal erlaubt und mich wieder zu Ihnen geschickt, hochehrwürdiger Herr Pastor.«
»Ihr Vater?«
»Ich denke, Arthur Notham aus New York.«
»Arthur?«
»Das ist sein Vorname, der auch im Ringe steht, welchen mir Marie zum Abschied gegeben hat.«
»Wo ist er?«
»Still! still! Marie weiß noch nichts davon. Ich habe ihn zum Tore hinein in den Kirchhof zu dem Grabe ihrer Mutter geführt. Dort wünscht er mit Ihnen zu sprechen.«
»Hat dich Marie schon gesehen?«
»Nein, Herr Pastor!«
»Gottes Schickungen seien gepriesen; doch rauben sie mir vielleicht das Kind meiner Pflege und die Freude meines Alters!
Doch führe mich zu dem fremden Mann, damit ich seine Ansprüche höre und prüfe!«
Von der Pfarrwohnung führte eine hohe Treppe hinauf in den Kirchhof, in dessen Mitte die Kirche stand.
Der Pfarrer hatte seine Amtstracht angelegt und schritt feierlich die Stufen hinauf, Tannhof folgte ihm mit der Mütze unter dem Arme nach.
Unfern des Haupteinganges in die Kirche war ein Grab mit einem einfachen, steinernen Kreuze und der Aufschrift: »Aus der Fremde in die Heimat!« Am Kopfende befand sich eine steinerne Bank unter einem breitästigen, blühenden Lindenbaum.
Dort saß Notham, da John bei dem Wagen zurückgeblieben war, einsam, versunken in die Erinnerung an die Vergangenheit. Seine Augen ruhten mit so schmerzlichem Ausdrucke auf dem Hügel, als sollten sie die Tote auferwecken.
Wie reich und doch so arm ist ein Menschenherz, da es so viele, so gewaltige Gefühle nacheinander durchempfinden kann und doch keinen Raum hat, zwei auf einmal in sich ausklingen zu lassen.
Wie Notham hier am Grabe saß, erfüllte ihn der Schmerz um Johanna so mächtig, daß die Hoffnung, sein und ihr Kind vielleicht in der nächsten Viertelstunde schon an sein Herz zu drücken, davon zurückgedrängt wurde.
Aus diesem betäubenden, schmerzlichen Hinträumen weckte ihn der Pfarrer, welcher mit Tannhof herangetreten war.
»Selig sind, die in dem Herrn ruhen!« sagte der Pfarrer mit einem Blick auf das Grab.
Notham war aufgestanden und reichte ihm die Hand mit den Worten:
»Vielleicht stehe ich vor dem Manne, dem ich alles verdanke, was ein Mensch dem anderen jemals schuldig sein kann. Gott, dessen Hand mich seit achtzehn Jahren zu Boden geschmettert, neigt sich in Ihnen erbarmend zu mir nieder. Auch selbst dann, wenn die wunderbare Hoffnung, welche mir die Brust erfüllt hat, wieder zerrinnen sollte, schmälert sich nicht mein Dank; denn ich habe doch mittelbar durch Sie die Bekanntschaft hier mit Tannhof gemacht, welcher mein Sohn sein und bleiben will.«
Unter diesen Worten hatten sie sämtlich auf der steinernen Ruhebank bei dem Grabe Platz genommen.
Auf die Bitte des Pfarrers, ihm den Zusammenhang der Begebenheiten bis zu seiner Ankunft hier in dem Kirchhofe mitzuteilen, erzählte Notham in kurzem Abrisse das, was wir bereits wissen.
Mit der größten Spannung hörte der Pfarrer zu. Als Notham seine Leidensgeschichte beendet hatte, sagte er:
»Es waltet kein Zweifel mehr ob, daß dieses Grab Ihre selige Frau in sich schließt. Die Zeit ihrer Ankunft im Orte, oder vielmehr ihres Sterbens trifft mit Ihren Angaben genau zusammen, rechnet man die Zeit hinzu, welche sie zu ihrer Herreise gebraucht hat. Im Herbste, nun bald vor achtzehn Jahren, wurde ich in der Nacht hinaus in das Hirtenhaus gerufen mit der Nachricht, daß die Hirtenfrau, welche dort wohnte, bei ihrer Heimkehr aus dem Walde, wo sie Holz geholt hatte, auf der Straße in der Dunkelheit der Nacht eine Frau in Kindsnöten gefunden, sie in ihre Hütte gebracht und dort entbunden habe; das Kind wäre am Leben, die Wöchnerin aber ohne Besinnung und dem Tode nahe.
»Ich eilte, so schnell ich konnte, in das Hirtenhaus; die Fremde lag bereits im Verscheiden. Als ich ihr meine Hand aus die Stirn legte, sprach sie das erste und letzte Wort: »Mein Kind!«
»Ich ließ es ihr zeigen; ein eigenes, glückliches Lächeln spielte um ihren Mund, dann suchte sie sich emporzuheben, um, wie es schien, noch einiges zu sprechen, aber schon fuhr ein Schauer mit Blässe über ihr Gesicht, sie faltete die Hände mühsam zusammen, sank tot zurück in die Kissen, ich drückte ihr die Augen zu.
»Nachdem ich ihre Seele dem Vater im Himmel empfohlen hatte, wandte ich meine Gedanken zurück auf die notwendigsten Erörterungen über ihre Herkunft.
»Hatte nun die Verstorbene in ihren schweren Leiden des Augenblicks nicht die Besinnung gehabt, der Hirtenfrau die nötigen Mitteilungen zu machen, oder hatte diese, eine schwachsinnige Frau, nicht recht darauf gemerkt, sie wußte nur sich mit Mühe zu erinnern, daß sie von Meer und Schiff und Not gesprochen. Da Ihr nun Notham heißt, so erklärt sich alles von selbst. War sie auf der Reise beraubt oder mittellos geworden, sie hatte nichts bei sich, als die Kleider, welche sie anhatte. Diese waren fein und zeugten von vornehmem Stande.
»Ich zog ihr den Trauring ab, weil häufig darin der Name des andern Gatten zu finden ist. Es ist der Ring, welchen Sie bei Tannhof gesehen.«
»Doch das Kind? Wie wurde das Kind erzogen?«
»Da meine Ehe nicht mit Kindern gesegnet war, so hielt ich das Kind der Fremden für ein Geschenk des Himmels. Ich ließ meine Frau rufen, welche Sie kennen lernen werden, und trug ihr bei der Leiche der Unglücklichen meinen Wunsch vor. Sie war mit mir einverstanden. Das Kind, ein Mädchen, wurde »Marie Arthur« getauft und von uns bis zu dieser Stunde erzogen. Gott hat unsere Mühe reichlich belohnt. Mit Dank für die vielen Freuden, welche er uns mit und in ihr gewährt hat, aber auch mit herben Schmerzen über ihren Verlust geben wir das Kind ihrem Vater zurück mit der Überzeugung, daß wir alles für sie, unsere Marie, getan haben, was nur immer ihre leiblichen Eltern für sie hätten tun können.«
»Edler deutscher Mann«, rief Notham, »wir müssen uns hier das Herz in die Hände fassen, soll es standhalten in dieser großen Stunde! Günther, laß mich so bei deinem Namen dich nennen, du bist mein Bruder für Zeit und Ewigkeit!«
Beide Männer umarmten sich, verbunden miteinander durch jedes Band, welches zwei Seelen vereinigen kann.
»Und nun, Günther«, sagte Notham, »stille auch du deinen Kummer; wir bleiben, solange wir leben, hier zusammen! Ich werde hier bei unserem Sohne wohnen!«
»So geh denn, Tannhof, hinunter zu Marie«, unterbrach ihn der Pfarrer, »teile ihr alles mit, was du gehört hast; von dir, dem sie bald auf immer angehören soll, mag sie den Vater zum Brautgeschenke erhalten!«
Mit drei Sprüngen war Tannhof an der Treppe; wie ein Sturmwind eilte er hinunter.
Während der Pfarrer von der Erziehung des Kindes, seinem vortrefflichen Herzen, seiner Liebe zu seinen Pflegeeltern und dann von Tannhof, welchen er von Jugend auf kannte und immer mehr lieb gewonnen hatte, seinem neuen Freunde und Bruder erzählte, kam auch John herbei. In wenigen Worten teilte ihm Notham die glückliche Lösung seines Verhängnisses mit.
Es verging eine ziemliche Zeit, während sie auf Johannas Kind warteten.
So schnell Tannhof hinunter in die Pfarre geeilt war, so vorsichtig hatte er Marie auf das Wiederfinden ihres Vaters vorbereitet.
»Am Grabe deiner Mutter«, sagte er nach Hin- und Herreden, »sitzt ein alter Mann und weint. Wer mag es sein?« –
Marie hing sich bestürzt an ihre Pflegemutter.
»Mag er sein, wer er will!« versetzte die Pastorin, »mir soll niemand mein Kind nehmen, das ich mir erzogen habe!« –
»Aber der Herr Pfarrer sitzt mit ihm zusammen, und sie haben viel miteinander zu verhandeln.«
»Ich möchte doch in aller Welt wissen«, warf die besorgte Frau ein, »wer nach beinahe achtzehn Jahren ein Recht auf das Kind haben sollte, wenn nicht wir?«
»Wenn es nun mein Vater, mein Vater wäre!« schluchzte Marie.
»Ich mußte ihm den Fingerring geben, welchen du mir neulich geschenkt hast, weil darin der Vorname des guten, alten Herrn steht!«
Marie sank in die Knie, raffte sich aber wieder in die Höhe und rief: »Ich will ihn sehen!«
»Deshalb bin ich auch hergeschickt worden, um dich und die gute Pflegemutter hinaufzuführen, denn dort – ja wirst du dir auch ein Herz fassen – wenn ich es dir sage?«
»Es springt mir entzwei!« seufzte sie mit erstickter Stimme.
»So laßt uns hinaufgehen!« versetzte Tannhof und trat mit beiden den Weg an.
Er trug Marie mehr, als daß er sie führte, die Treppe hinan.
»Stütze dich nur fest auf mich; siehst du den schönen, alten Mann, welcher dort neben deinem Pflegevater sitzt?«
Notham erblickte seine Tochter; – er breitete die Arme aus, Marie wankte, von Tannhof gestützt, näher und sank in die Arme ihres Vaters Arthur Notham, des Handelsherrn von New York.
Die Sonne war im Untergehen, ein purpurroter Schein breitete sich über die Gruppe, und die Abendglocke begann zu läuten.
