
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

 Wintergewölk umbraust die Berge von Bracciano. Vom Tyrrhenischen Meer zieht die Wetterhexe übers römische Land; sie faucht aus ihren kalten Backen den Seewind auf die Erde, die dem grauen Abend entgegendämmert. Aus dem dunklen Bergkranz, der im Sturm erbebt, ragen die fünf massigen Rundtürme des Orsinischlosses in den fahlen Dämmer. Immer dunklere Wolkenberge wälzen sich heran, angefüllt von Verderben und Unheil. Der Sabinersee zu Füßen der Baronalburg wallt auf. Erschreckt hetzen die Fischerkähne an das felsige Ufer.
Wintergewölk umbraust die Berge von Bracciano. Vom Tyrrhenischen Meer zieht die Wetterhexe übers römische Land; sie faucht aus ihren kalten Backen den Seewind auf die Erde, die dem grauen Abend entgegendämmert. Aus dem dunklen Bergkranz, der im Sturm erbebt, ragen die fünf massigen Rundtürme des Orsinischlosses in den fahlen Dämmer. Immer dunklere Wolkenberge wälzen sich heran, angefüllt von Verderben und Unheil. Der Sabinersee zu Füßen der Baronalburg wallt auf. Erschreckt hetzen die Fischerkähne an das felsige Ufer.
Über den Burgzinnen stoßen die Dohlen wütend in die grauen, jagenden Wolken hinein. Trotzig läßt der Orsinikoloß den Sturm um seine ehernen Mauerflanken rasen. Tose, Meersturm, brause heran! Wir halten stand! heult es aus den alten Steinen heraus.
Öde, baumlos, schwermütig strecken sich die Tuffhügel in die tuskische Campagna vor, und zerrissene Berggesichter starren westwärts den heranschnaubenden Wolkenrossen entgegen, die Kälte und Regen in ihren schwarzen Bäuchen bergen. Die Einöde der Berge ist zur Wildnis geworden. Kein Leben regt sich nah und fern.
Und doch – von dem Schatten der in dichte Dämmerung gehüllten Hügel hebt sich der wilde Galopp eines kleinen Reitertrupps ab. Durch den Sturm klingen dumpf die jagenden Hufe. Sechs Reiter sind es in den Farben der Orsini. Die weißen Pferde keuchen den Landweg nach Norden hinauf, ihre Mähnen flattern wie weiße Flammen durch das dunkler werdende Abendgrau des Dezembertags. Die Blicke der Reiter spannen sich nach vorn, wo der Weg um eine Felsnase biegt und die Häuserklumpen von Manziana wie Gespenster aus den grauen Dünsten herüberäugen.
»Vorbei! Wir haben sie!« rief der jüngste der Reiter, der schlanke Fabio Orsini, und trieb seinem Roß die Sporen in die Weichen. Die fünf Reitersknechte hetzten ihrem Führer nach.
»Da – es sind Colonnafarben!« Ein Reiter wies auf vier in derselben Richtung vor ihnen trabende Gestalten.
»Lanzen fällen! Vor!« befahl der Jüngling. Er zog die Sturmhaube fester in den Nacken und griff nach dem Degen, während die Rossehufe das Feuer aus dem Boden schlugen. Die Pferde dampften unter dem kalten Regen, der jetzt, vermischt mit Hagel und Schnee, aus dem aufgelösten Gewölk niederprasselte. Von den Felsen am Wege flatterten ängstlich verscheuchte Vögel ins Grau und machten die Pferde scheu. Wie flüchtende Banditen sprangen die Hirten vom Weg herab in die spärlichen Büsche.
Da schälten sich aus den windgepeitschten Regenschleiern die vier Reiter los. Das wilde Schlagen der Hufe machte die Verfolgten stutzig. Sie rasten plötzlich über die tuskische Erde dahin.
Fabio Orsini flog wie der Sturmgott selbst auf seinem weißen Roß in die beginnende Nacht. Die Wolken öffneten ihren Rachen und spien das nasse Gemengsel von Regen und Eis auf die wilden Verfolger nieder.
Jetzt hatten die Reiter das vierfache Wild eingeholt. Sie warfen sich mit eisernen Leibern auf die Gehetzten heran, mitten im freien Feld. »Colonna und alle Teufel!« schrie der ergrimmte Fabio und schwang den Degen über einem Pferdekopf. Im Nu ward der Feindeshaufe umzingelt. Die Waffen schlugen aneinander, ein Klirren und Sausen zerbrach die Gewalt der Tramontana, drei der feindlichen Reiter stellten sich, der vierte kam mit dem schwarzen Roß zu Fall und blieb wie tot liegen. Die Orsini hieben wie Teufelsgesellen drein und schlugen ihre Degen und Lanzen an den Panzerhemden der drei Reiter mürbe. Zwei von ihnen fielen endlich wundenüberdeckt vom Pferde und blieben gliederstarr liegen. Da blies der letzte die Hoffnung in den Wind und schrie grimmig: »Satanskerle – da nehmt mich!«
Die Orsini schwangen sich aus dem Sattel. Fabio riß dem gefangenen Reiter die Haube vom Kopf. »Was habt Ihr vorgehabt?«
Der Kriegsmann wischte sich den Kampfschweiß von der Stirn. »Wir sind keine Colonnaschufte, wir tragen nur die Farben der Sippschaft.«
»Den Kniff kennen wir!« Fabio überlachte das Sturmheulen. »Wer wollt Ihr sein?«
Der Reiter zeigte auf den Klumpen Leiber auf der Erde. »Fragt diese. Von mir kriegt Ihr nichts heraus.« Er trottete schwerfüßig nach einem Felsen, wo ein Menschen- und ein Pferdeleib miteinander verklumpt lagen. Dort tastete er mit der Eisenhand hilflos nach der reglosen Masse.
Fabio schnellte heran. »Es scheint Euer Führer zu sein – sieh nur – das feine Wams –«
»Feines trägt Feines. Schade um das Leben!« Dem feindlichen Alten kollerten die Tränen in den Bart. »Hebt ihn auf und singt ihm das schönste Totenlied, dem Reiter da!«
»Windlichter heran!« Eia Reiter holte aus dem Sattelsack die Leuchtstange.
Fabio tastete nach dem Arm der noch immer unter dem Pferde liegenden Gestalt. Dann fuhr er zurück. »Bei Gott – das ist – kein Männerarm!« Er blickte näher. »Bei der Madonna – ein Weib!« Das Windlicht jagte seinen wild flackernden Schein über das Gesicht und verlöschte dann in der nächsten Sturmwelle. »Packt an, Reiter!« befahl der Orsini. »Aber habt Vorsicht mit den Händen!« Und er arbeitete selbst mit Unruhe den weichen Menschenleib unter dem Roß hervor. Zwischen seinen Fingern spürte er die Seide des Gelocks fließen. Das zerrissene Barett knisterte, das Wams war noch trocken, aber der Mantel fühlte sich wie ein vollgesogener Schwamm an, das Rapier lag fest in der Scheide, als wüßte es nichts von Klingentanz und Blut.
»Wohin wolltet Ihr?« fragte Fabio den Reiter.
»Nach Viterbo.«
Fabio legte sein Ohr an des Weibes Brust. »Das Leben läuft. Macht rasch, Reiter. Wir bringen sie aufs Schloß. Koppelt die Pferde zusammen. Macht aus den Armen eine Tragbahre. Gebt mir das Haupt. Was ist mit den Knechten dort auf dem Boden?«
»Sie hören keinen Hahnenschrei mehr,« meldete ein Knecht des Orsini.
»Wir holen sie morgen ins ehrliche Grab. Vorwärts.«
Der Zug setzte sich umständlich nach der Burg in Bewegung. Die Kälte hatte zugenommen, der Regen peitschte über das steinige Gelände. Fabio warf seinen Mantel über das erstarrte Weib, dessen verhüllter Kopf in seinen Armen lag. Aufwärts ging es an zerzaustem Gebüsch vorbei. Die Haut der Knechte dampfte im Schweiß. An den gigantischen Kämpfen in den Lüften gemessen, sank das eben bestandene Scharmützel zu einem Knabenstreit herab, trotzdem rotes Blut geflossen und den Raben Menschenfleisch aufgetischt worden war.
Wie klagender Geisterruf klang durch das Brausen der Wetter das Aveläuten der Burgglocke. Bald war der Fels erreicht, auf dem sich das Riesengemäuer in die Höhe türmte. Tief unten hinter Wasser- und Nebelschleiern grauten die gepeitschten Wogen des Sabinersees herauf, die sich chaotisch durcheinander wälzten. Es war plötzlich heller geworden, die Wolken zerrissen, fahles Licht ergoß sich über den gischtenden See. Es war der letzte Scheidegruß des unheilvollen Abends. Gleich darauf wirbelten Schneefetzen durch das neue Dunkel, die Grenze zwischen Luft und Wasser schwand, unheimliche Finsternis nahm den Pfad gefangen, auf dem sich die leichten Sieger mit ihrer Beute der schützenden Burg entgegenarbeiteten.
Auf dem still gewordenen Kampfplatz hoben sich schwerflügelige Krähen aus dem Dunkel.
 Zur selben Stunde jagte auf schnaubendem Roß ein einsamer Reiter von Südosten her gegen die Burg. Auch er schien von Rom herübergeritten zu sein. Die Nacht verdunkelte sein Gesicht, der lange Mantel verhüllte die jugendlich geschwellten Glieder, der fliegende Atem kämpfte mit dem Meerwind, und Roß und Reiter schienen der völligen Erschöpfung nahe zu sein. Wenn ein Blitz die Nacht erhellt hätte, er hätte die angstverzerrten Züge eines jungen Menschengesichts bloßgelegt, das mädchenhafte Weichheit trug; und wenn er dem Reiter bis ins Herz geleuchtet hätte, welch ein Chaos von Schreckgefühlen hätte er der gepeinigten Brust entrissen. Doch der Jüngling dankte der Nacht, daß sie mitleidig den Blitz in ihrer winterlichen Tiefe verschlossen hielt, denn so konnte seine Flucht einem Feindesauge verborgen bleiben. Wie Irrlichter sprangen seine Blicke nach allen Seiten in der Finsternis und er erschrak, wenn ihn das Gespenst eines Strauches äffte.
Zur selben Stunde jagte auf schnaubendem Roß ein einsamer Reiter von Südosten her gegen die Burg. Auch er schien von Rom herübergeritten zu sein. Die Nacht verdunkelte sein Gesicht, der lange Mantel verhüllte die jugendlich geschwellten Glieder, der fliegende Atem kämpfte mit dem Meerwind, und Roß und Reiter schienen der völligen Erschöpfung nahe zu sein. Wenn ein Blitz die Nacht erhellt hätte, er hätte die angstverzerrten Züge eines jungen Menschengesichts bloßgelegt, das mädchenhafte Weichheit trug; und wenn er dem Reiter bis ins Herz geleuchtet hätte, welch ein Chaos von Schreckgefühlen hätte er der gepeinigten Brust entrissen. Doch der Jüngling dankte der Nacht, daß sie mitleidig den Blitz in ihrer winterlichen Tiefe verschlossen hielt, denn so konnte seine Flucht einem Feindesauge verborgen bleiben. Wie Irrlichter sprangen seine Blicke nach allen Seiten in der Finsternis und er erschrak, wenn ihn das Gespenst eines Strauches äffte.
Seit zwei Tagen hetzte er unter dem Schutze der Nacht flüchtend durch das Gebirge. Hinter ihm lagen die Trümmer einer zerschlagenen Kindheit, in die sein Geist jetzt zurückirrte. Sein Schloß Sermoneta dämmerte auf den Vorhöhen der Volskerberge auf, und darüber die Zyklopenmauern von Norba, unten aber die Ruinen von Nympha, und über die Pontinischen Sümpfe hinweg schweifte sein Auge in die sonnentrunknen Weiten des Tyrrhenischen Meeres. Zu seinen Füßen zog die alte Via Appia ihren leuchtenden Strich durch das Land und fern im Süden dämmerte traumhaft das geheimnisvolle Kap der Kirke in die Himmelsbläue hinein. O Sermoneta! klagte sein zerrissenes Herz. Kühlende Bergbäche! Wo ich den Schmätzer schoß und die Eule in den Ruinen fing, wo ich meine kindischen Abenteuer in das Land der Herniker trug! Ihr Berge von Cora mit den Kirschbäumen und schönen Mädchen! Ihr Hügel von Ardea, wo ich mein Roß in der Schlacht mit den Jugendgefährten herumtummelte und die toten Helden der Äneide des Nachts ihre Geisterkämpfe noch einmal vor den Augen der schwärmerischen Jungen kämpften! Und meiner Burg geheime Kammer, wo ich mit meinem Oheim die schwarze Kunst betrieb, und du, lieblicher Eichenhain, wo ich in Mondnächten mit dem treuen Accolti, dem feurigen Rhapsoden, nach Schätzen grub und er seine Schauergefühle in den Klang der Laute warf! Unwiederbringlich verlorene Jugend! Sermoneta!
Aber der junge Reiter hatte auch einen ermordeten Bruder, einen gefangenen Oheim und das ungewisse Schicksal einer teuern Mutter zu beklagen, und vor ihm lag das hoffnungslose Nichts, eine streng verhüllte Zukunft, von keinem Sternenschimmer erhellt. In ihm aber loderte wie ein heiliges Himmelsfeuer der Rachebrand seines Herzens, und die Flammen schlugen dem Wüterich entgegen, der alle Schuld an der fürchterlichen Zerstörung seiner Lebensgüter hatte, dem schönen Tyrannen des Kirchenstaates, dem die Teufel dienten und der Christum mit jedem Atemzug aufs neue kreuzigte, dem gräßlichen Vampir, dem Papstsohn Cesare Borgia. Mit der Begeisterung eines Harmodius nährte der Jüngling das Feuer des Tyrannenhasses, aber noch war seine Zeit nicht gekommen, noch rüttelten die Schauer der Geschehnisse seine Fibern zusammen, und das Ungestüm seiner leidenschaftlichen Jugend lag noch in den Banden der todbringenden Gefahr. Und in seiner Brust lag der Name des Mannes eingegriffelt, an dessen Schwelle er jetzt wie ein irrender Ulysses um ein Obdach flehen wollte, der Name des Kardinals Giambattista Orsini.
Müde keuchte das Roß die Steine zur Felsenburg hinan. Die Türme stießen wie Gigantenfinger in das Grauen der Nacht. Aus einigen Fenstern gloste Licht. Es glich den gespenstischen Augen eines höllischen Ungeheuers.
Der Torwächter sprang beim Klang des Hufschlags zu dem verrammelten Tor. Es waren böse Zeiten, und man mußte auf der Hut sein.
»Gebt Namen und Herkunft!« hallte der Wächterruf aus dem Dunkel.
»Gaetani, Herr auf Sermoneta!« klang es stolz zurück. Aber die Träne um ein verlornes Herrentum brach den Stolz entzwei. Mit dem Aufgebot seiner letzten Kraft schritt er, das verhetzte Roß am Zügel führend, durch den hallenden Torweg. Hinter ihm fiel polternd das eiserne Flügelwerk ins Schloß.
 In einem Turmgemach des Schlosses, weitab von den Frauengemächern, saßen zwei Herren der Orsini an dem intarsierten Tisch, auf dem mehrere Rötelzeichnungen nahe in Gefahr waren, von dem verschütteten Frascatiwein durchnäßt zu werden. Vorsichtig schob sie nun Herr Jacopo Galli, der Freund schöner Künste und Wissenschaften, aus dem nassen Bereich Bacchus'.
In einem Turmgemach des Schlosses, weitab von den Frauengemächern, saßen zwei Herren der Orsini an dem intarsierten Tisch, auf dem mehrere Rötelzeichnungen nahe in Gefahr waren, von dem verschütteten Frascatiwein durchnäßt zu werden. Vorsichtig schob sie nun Herr Jacopo Galli, der Freund schöner Künste und Wissenschaften, aus dem nassen Bereich Bacchus'.
»Dieses häßliche Faungesicht hier scheint doch mit dem Wein schon Bekanntschaft gemacht zu haben,« sagte der mohrendunkle Feldhauptmann Pagolo Orsini mit dem weißen Fetthaar und dem mächtigen grauen Knebelbart. Er saß breit und faul wie ein ruhebedürftiger Rüde nach dem Fraß da. Das Kriegswetter hatte seine Haut gegerbt und ihm eine frühverrunzelte Stirn verschafft, unter der die kühn gebogene Hakennase der Orsini ein trutziges Profil zeichnete.
Neben ihm saß der Kardinal Giambattista Orsini, das Haupt in die feine Gelehrtenhand gestützt, und besah sich ernst prüfend den gezeichneten Faun. In seinen beseelten klaren Augen spiegelte sich die Freude an der kunstvollen Linienführung, die dem Faun ein halb possierliches, halb sinnliches Aussehen gab. Dann nahm er die Studie eines Männerarmes zur Hand. »Hm –sagte er nachdenklich, »ich möchte mich nicht gerne täuschen lassen wie der Kardinal Riario, dem ein blutjunger Florentiner Künstler vor Jahren eine selbstverfertigte Statue für antik verkaufte.«
»Es war ein Meisterstreich eines seiner Kunst sichern Menschen,« entschuldigte Jacopo Galli den beschuldigten Bildhauer und warf einen flüchtigen Blick auf einen jungen Mann, der im Dunkel des Gemaches in bescheidener Zurückhaltung mit der Betrachtung eines Ornamentes beschäftigt war. Ein schlichtes Wams engte seine dünne Gestalt noch mehr ein, und der Überrock aus weinrotem schillerndem Taft hing ihm schlottrig über die etwas schief gewachsenen Glieder. Ein nach oben sich verbreiternder Kopf, der dem unschönen Gesicht eine dreieckige Form gab, und eine breite Stierstirne hoben noch die Gedrungenheit der sehnigen Gestalt, die von aller durchschnittlichen Menschenanmut verlassen gewesen wäre, wenn nicht das beseelte, geistvolle blaue Auge und die energisch gespannten Gesichtszüge mit all der Häßlichkeit versöhnt hätten, zu der auch noch eine spitze, an der Wurzel gewaltsam gebrochene Nase nicht wenig beitrug. Bartlos und trotz seiner Jugend schon faltenreich, ähnelte er fast ein bißchen dem Faunkopf, den der Kardinal mit kritischen Blicken untersuchte.
»Habt Ihr noch mehr solcher Zeichnungen?« fragte jetzt dieser den mißgewachsenen Gast.
Der Bildhauer wurde durch den warmen Ton aus seiner Verträumtheit gerissen. »Exzellenz, ich werde meine Kammer nach andern durchstöbern.«
»Ich höre, Ihr arbeitet schwer, Messer Michelangelo,« sagte Giambattista Orsini.
»Wenn ich meine Gedanken in Stein haue, schlägt mir der Meißel ihre Formen zu langsam aus.«
Da mischte sich der Feldhauptmann Pagolo wieder ins Gespräch, während er die Kerzenstrahlen im Pokal funkeln ließ. »Ihr solltet Kriegsmann werden, da hättet Ihr bessern Zeitvertreib als Eure schweren Gedanken. Kommt mit nach Imola. Ich reise morgen dahin zu Cesare Borgia, um mich neu anwerben zu lassen von ihm. Es gilt, die Burg Imola und ihre Verteidigerin, die Löwin Katharina Sforza, in die Klauen zu bekommen. Dann rollt uns der Cesare die ganze Romagna bis zu den Marken auf. Es wird ein lustiger Tanz werden.«
»Ein Tanz, edler Herr, bei dem Menschen bluten,« sagte Michelangelo mit verdüsterten Brauen. »Meine Seele leidet den Tod andrer viel zu tief mit.«
Pagolo machte lachend mit seinem Rapier einige Hiebe durch die Luft. »Sind Euch so viele Freunde gestorben?«
»Erst die Toten wurden mir zu Freunden. Ich habe in Florenz –«
»Ihr seid auch Florentiner?« fragte Pagolo spöttisch.
Der geringschätzige Ton reizte Buonarroti. »Ich weiß, die Florentiner waren in der Kriegskunst nicht die ersten, aber in den edlen Künsten –«
Dem Feldhauptmann gurgelte das Naß in der Kehle vor Ärger. »Ei, junger Fant, die Kriegskunst sollt Ihr mir nicht verachten. Sie ist ein vornehm Ding und mächtiger als alle sieben freien Künste.«
»Wir kennen deine sieben freien Künste, Vetter,« sagte der Kardinal gutlaunig, indem er Pagolo wie ein störriges Roß abklopfte. »Hinterhalt legen, dreinhauen, morden, plündern, trinken, Weiber verschandeln und dem, der am besten zahlt, die Treue halten.«
Da lachten die übrigen, und Pagolo mußte mitlachen. »Nichts für ungut, Steinschläger, aber alle Gelehrtheit läuft mir wider den Strich. Versteh nicht den Cicero zu lesen, Rhetorik« und Eloquenz erzeugen bei mir Stuhlverstopfung und ich rieche lieber Pferdemist als den Staub alter Handschriften, die jetzt die römischen Kopisten überall durchschnüffeln, als wäre salomonisches Tempelgold darin verborgen. Vor Wissenschaft und Weibern behüte uns ein Heiliger nach dem andern.«
Alles lachte, denn man wußte, daß der Feldhauptmann vor seinem eigenen Weibe übermäßigen Respekt hatte. Wenn sein Degen feierte, arbeitete um so eifriger das Zungenschwert seiner keifenden Frau Simona, und böse Menschen erzählten, daß die roten Kriegernarben auf des Pagolo edlem Haupt nicht von den Klingen der Feinde, sondern von den Wurfgeschossen seiner Frau herrührten. Trotzdem hatte der Graukopf seine grobe Gefährtin nicht unlieb und er hatte auch pflichteifrig für den Nachwuchs der Orsini gesorgt, drei stattliche Söhne verteidigten das Schloß Galera und die Feste Cervetri im Süden des Sabinersees gegen alle Angriffe der neidischen Colonna, darunter auch sein Lieblingssohn Fabio, der heute mit ihm nach Bracciano gekommen war, um einen der verhaßten Trupps aufzulauern, den seine Spione signalisiert hatten.
Galli wäre heute beinahe diesem jungen Kampfhahn bei der Reise in die Marmorbrüche in die Hände gefallen, wenn sich nicht der Irrtum bald aufgeklärt hätte. Der edle Kunstfreund hatte dann mit dem Bildhauer vor dem Unwetter Schutz im Orsinischloß gesucht, dessen Herrn er mehr liebte als das Schloß selbst. Denn finster und trotzig streckte es seine Türme und Zinnen aus dem Felsenklumpen heraus, und es glich einem Streithans, vor dem man auf der Hut sein mußte. Jacopo Galli hauste freundlicher in Rom in seiner Villa auf den neronischen Wiesen, wo er platonische Gelehrte und Künstler zu traulicher Disputation um sich zu versammeln pflegte. Sein Haus schmückten die Fresken des alten Mantegna und seiner Schüler und die Statuen der Jünger des Antonio Pollajuoli. Die Strahlen seines Mäzenatengeistes fielen auch auf Michelangelo Buonarroti, den der Kardinal Riario nach Rom gelockt hatte, ohne ihn dann würdig zu beschäftigen. Ihm riß Galli den Künstler aus den willigen Händen. Durch Gallis Vermittlung gelangte Rom zu dem Ruhm, das erste der Meisterwerke aus den Händen des Bildhauers zu besitzen, die ergreifende Gruppe der Pietà in der Kapelle der französischen Könige im Sankt Petersdom, die versteinerte Hymne auf die hehre Göttlichkeit des Todes.
Die Kunstfreundlichkeit des römischen Mäcenas band ihn auch fester an den feinsinnigen Kardinal Giambattista Orsini, den Herrn auf Monterotondo, der gegenwärtig nur vorübergehend die Herrenrechte auf Bracciano ausübte, da dessen eigentlicher Besitzer Giangiordano Orsini bei dem französischen König weilte. Giambattistas Leben war im Gegensatz zu jenem der Kardinäle seiner Zeit weniger prunk- und geräuschvoll gewesen. Eine einsame, aber von reichem Innenleben erfüllte Natur, hatte er es verstanden, sich überall Hochschätzung und Ehrfurcht zu erwerben. Er liebte Talente und war selbst talentiert, den Wissenschaften und Künsten ergeben, eine seltene Ausnahme im Geschlecht der kriegswilden Orsini, die auch den besänftigenden Grazien und Kamönen die Fehde erklärt hatten. Man brauchte nur ihre Schlösser anzusehen, so wußte man, welcher grimmige Gott hier Patronatsherr war. Aber in Monterotondo, auf einer Vorhöhe der Sabinerberge gelegen, hatte der Kardinal Giambattista Orsini sich sein Tuskulanum angelegt, das mit würdevoller Einfachheit und künstlerischem Geschmack den Hausherrn pries. Dort verlebte er zurückgezogen den größten Teil des Jahres mit seiner alten Mutter Ginevra. Rom lockte ihn wenig an mit seinen kirchlichen Forderungen und er hielt sich lieber an Horazens Wort: Beatus ille qui procul negotiis, glücklich, wer fern den Geschäften!
Eine edle äußere Gebärde, die oft etwas hierarchisch Getragenes an sich hatte, gab seiner Wohlgestalt noch einen erhabeneren Ton. Er war groß, schlank, sehnig und kraftvoll, und auf dem schön geschnittenen Gesicht lag ein edler, durchaus nicht trauriger Ernst. Das geistvolle dunkle Auge hatte den Glanz der Nachdenklichkeit, aber wenn ihn ein großer Gegenstand hinriß, flammte in seinem Blick die leidenschaftlich bewegte Seele. Mit seinen Gedanken war er seiner Zeit vorausgeeilt und hatte für den sehnsüchtigen Herzschlag freier Geister ein aufmerksames Ohr und ein feines Empfinden. Aber er hütete sich mit einer in stiller Zähigkeit großgezogenen Klugheit, die freien Regungen seiner Gedanken zu verraten. Er kannte den sittlichen Unrat, der sich hinter den vatikanischen Mauern aufgestapelt hatte, nur allzu gut und ihn graute vor der Tatsache, daß sein Geschlecht, im Dienste der Kirche großgezogen, sich dazu hergab, auch einem Papst Alexander skrupellos Gefolgschaft zu leisten. Er sah die Orsini in den schimpflichsten der Ketten liegen, aber nicht minder die Kirche selbst. Ja, das heilige Grab dünkte ihn sicherer in den Händen der Ungläubigen als das Kirchenregiment in den Händen der Borgia. Aus diesem schrecklichen Erkennen hatte er sich nach und nach mit Hilfe tröstender Geister aus dem Reiche der Kunst und Wissenschaft in reinere Sphären geflüchtet. Beide band er mit der Religion zu einem schönen Strauß zusammen, den er immer frisch erhielt. In ihrer Harmonie sah er das wahrhaftige, ewige Licht der Menschheit glühen.
Auf den stillen Tastwegen nach künstlerischen Zielen war er auch Jacopo Galli begegnet, der ihm heute den jungen Michelangelo Buonarroti zugeführt hatte. Der Künstler hatte ihm eine wahllos zusammengestellte Sammlung von Rotstiftzeichnungen vorgelegt, die er nun mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. »Ihr habt gründliche Studien gemacht, habt Modelle gehabt, die –«
»Kein einziges lebendiges, aber viele tote,« war die kurze Antwort.
»Wo nahmt Ihr die her?«
»Der Prior des Klosters San Spirito in Florenz verschaffte mir den Eintritt zu der Totenkammer. Dort machte ich anatomische Studien und zeichnete nach der Natur.«
»Eine erstarrte Natur,« warf der Kardinal vorsichtig ein.
Da wurde es laut auf dem Gange. Im nächsten Augenblick stand ein durchnäßter, schweißtriefender Reiter auf der Schwelle.
»Rainero, was bringst du?« Der Feldhauptmann riß den Leutnant mit seinen Bärenfäusten ins Licht der Kerzen.
»Um den See ist's nicht geheuer,« meldete der von Kälte durchschauerte Kriegsmann. »Ich hörte Schwertergerassel durch die Nacht. Es müssen Colonna mit den Unsern im Kampf liegen.«
»Hei – so hat mein Fabio doch Arbeit bekommen. Vielleicht hörtet Ihr sein Hussasa!«
»Ich sah ihn nicht. Doch bringe ich herrliche Botschaft: Imola ist gefallen.«
Pagolo fuhr mit einem Freudenschrei in die Höhe. »Und Katharina Sforza in den Händen Cesares?«
Der Reiter schüttelte ergrimmt den Kopf. »Die Tigerin hat sich wie durch ein Wunder mit ihren Jungen des Nachts nach Forli gerettet. Dort will sie ihre zweite Burg mit derselben Hartnäckigkeit verteidigen wie die erste. Wir fingen die römischen Boten Cesares auf, die es uns berichteten.«
»Die Katharina entwischt!« rief Pagolo mit Ingrimm aus. »Das wird dem Cesare üble Nächte eintragen.« Er rief auf den Gang hinaus: »Laßt die Burgglocke läuten! Imola gefallen! Alles Schloßgesinde in die Kapelle zum Dankgebet!«
Der Reiterleutnant setzte eine gewichtige Miene auf. »Noch etwas. Rom ist in Aufruhr.«
»Was sagt Ihr?« Alle Herren fuhren auf.
»Papst Alexander war nahe daran vergiftet zu werden.«
»Erzählt,« rief Pagolo und drückte den Reitersmann in einen Sessel.
»Ein Musikus aus Forli namens Tommaseo brachte vorgestern im Auftrag der Gräfin Katharina Sforza einen Bittbrief an Seine Heiligkeit. Der Papst übernimmt den Brief, aber die seltsame Farbe des Umschlags beunruhigt ihn, er läßt den Brief durch einen Kammerdiener öffnen, dessen Hände plötzlich kreideweiß werden. Kein Zweifel – der Brief ist vergiftet! Der Papst läßt den Tommaseo festnehmen, der erbleicht und gesteht, daß ihm der Astrolog der Katharina den Brief mit genauen Weisungen übergeben, wie er ihn in Händen zu halten und dem Papst zu überreichen habe. Wenige Augenblicke darauf fühlte der Papst sich einer Ohnmacht nahe, und der Diener, der den Brief geöffnet, stirbt vor seinen Augen. Man ist einer Verschwörung auf die Spur gekommen – die Verwandten der Katharina –«
Der Leutnant nickte. »Kardinal Riario ist seit vorgestern aus Roms Mauern entwichen.«
Keine Bewegung in Giambattistas Antlitz verriet, daß ihm die Nachricht ans Herz ging. Der Kardinal hielt seit gestern auf seiner Burg Monterotondo den verfolgten Riario verborgen, und es schien, als wären die Verfolger bereits auf falscher Fährte.
Rainero labte seine vertrocknete Kehle mit Wein. Dann schnaufte der Reiter laut auf und rückte mit seiner dritten Neuigkeit heraus: »Sermoneta ist in den Händen Cesare Borgias.«
Wieder sprang Pagolo wie ein erschreckter Frosch in die Höhe. »Sermoneta? – Die Gaetani?«
»Das Haupt des Hauses, der greise Giacomo Gaetani wurde vom Papst mit List nach Rom gelockt und in die Engelsburg geworfen.«
Der Kardinal erblaßte. »Der edle Giacomo? Und sein Bruder?«
»Soll entkommen sein. Aber Cesare veranstaltet eine Treibjagd auf die Neffen des Giacomo. Den jungen Bernardino ermordeten die Söldlinge des Cesare bei Sermoneta, er fiel in den Pontinischen Sümpfen in ihre Hand –«
»Das ist zuviel!« unterbrach plötzlich der Kardinal den Unglücksboten. »Erträgt das noch die Güte Gottes?«
Der Feldhauptmann sah den Kardinal verwundert an. »Trink, Kardinal,« sagte er. »Was schauderst du? Haben die Gaetani nicht längst gewußt, was ihrer harrt? Sie hätten sich wie die Colonna durch Verträge rechtzeitig sichern sollen. Sie galten schon seit dem Schisma nichts mehr, ihre Stunde mußte nun endlich kommen. Sie hatten sich mit uns nicht vertragen und waren ein schwaches Geschlecht obendrein, aber zu stolz, sich nach Bundesgenossen umzusehen.«
Wieder wurde der Kardinal von der Wärme seines Herzens bedrängt. »Feldhauptmann, das Schicksal der Gaetani geht mir persönlich nahe. Mein Vater fand einst in harter Bedrängnis ein Asyl bei dem edelherzigen Niccola Gaetani, als wir in Fehde lagen mit Papst Innozenz. Damals versammelte er seine Kinder um sich und nahm uns den Schwur ab vor dem Jesus der Schloßkapelle zu Sermoneta, wenn einmal ein Gaetani in Not sei, ihm beizustehen und der Politik bösen Zwang über der Dankesschuld zu vergessen. Und nun sind die Gaetani in Not und wir stehen fern und sind ohnmächtig, weil wir des Papstes treue Vasallen sein – müssen. Wiewohl er uns vor drei Jahren bekriegt hat, um uns zu vernichten, wie er jetzt die Gaetani vernichtet hat. Ich fühle mich im Schuldbuch dieses Geschlechts eingeschrieben und mein Gewissen ruft mir zu: tilge diese Schuld! Rainero, habt Ihr von dem Bruder des Ermordeten, dem jungen Marcello Gaetani nichts gehört?«
»Er soll glücklich entkommen sein.«
»Laßt Euch im Keller noch einen Becher füllen, Rainero,« sagte Pagolo gnädig. »Morgen reitet Ihr mit mir zum Herrn Vitellozzo Vitelli, dem Oberbefehlshaber Cesares, nach Forli. Die Ruhe sticht mich in allen Gliedern.«
Der Leutnant hatte sich erhoben. Mit einer tiefen Verbeugung vor seinem Dienstherrn schritt er aus der Stube.
Jacopo Galli, der sich mit Michelangelo zum Kamin zurückgezogen hatte, wo sie beide eifrig Dante kommentierten, kam nun wieder zum Eichentisch zurück. »Seit Cesare die Hilfe König Ludwigs von Frankreich besitzt und Herzog Valentino geworden ist, glückt ihm so ziemlich alles.«
Pagolos Kondottierengeist glühte mit. »Ludwig von Frankreich läßt sich von ihm bestricken, Venedig in eine Liga mit dem Papst einfangen, das mächtige Florenz von ihm bedrohen, und nun beginnt er seine Siegeslaufbahn durch die Eroberung der Romagna. Gott und seine Engel – an die niemand glauben will – schützen ihn dabei! Ich eile zu ihm. Es gibt keinen edleren Kriegsherrn als den Herzog Valentino.«
Der Kardinal hatte sich von dem Kriegsjubel seines Vetters nicht mitreißen lassen. Er blieb versonnen, stand nun auf und näherte sich den beiden Gästen, Galli mit dem puterroten Kopf fuchtelte mit den Händen vor der Nase Michelangelos herum. Des Künstlers Augen hatten erhöhten Glanz, seine verfaltete balkenbreite Stirn leuchtete hell und alle Häßlichkeit schien mit eins verflogen.
»Seht, Exzellenz,« sagte Galli, »dieser junge Springinsfeld will sich einbilden, die Natur übertrumpfen zu können. Er will Gott selbst überlisten –«
Michelangelo zupfte verlegen an seinem Wams. »Messer Galli will in den griechischen Skulpturen die Vollendung sehen. Ich sagte, die Griechen ahmten die reine Natur nach in ihrer schönsten Erscheinungsform, im menschlichen Körper. Aber mich dünkt, sie haben noch immer nur die Natur gegeben und nicht sich selbst. Und das soll, meinte ich, der Künstler.«
»Nur weiter,« sagte der Kardinal aufmunternd.
»Ich sage, die Bildung an der Natur liefert dem Bildhauer die unumstößlichen Gesetze der Harmonie, nach denen er nun seine eigenen Gedanken so zu formen hat, daß sie die Natur des Gegenstandes nicht verletzen, aber zugleich ein Abbild von der Schöpferkraft des Künstlers darstellen.«
»Ihr habt nicht unrecht. Wie alt seid Ihr?«
»Fünfundzwanzig Jahre, edler Herr.«
»In solchen Jahren denkt man als Künstler gewöhnlich noch nicht so reif. Messer Galli teilte mir mit, daß Ihr im Hause des Lorenzo de Medici, des großen Kaufmanns, öfter zu Gast gewesen seid.«
»Mein Freund Granacci führte mich in die Gärten des Medici ein. Unser edler Herr Lorenzo gewann mich lieb, wies mir ein Zimmer in seinem Palaste an und ich genoß die Ehre, an der Mittagstafel mit ihm und seinen Söhnen zu sitzen, mit ihnen über Philosophie, Altertum, Kunst und Schönheit zu disputieren. Poliziano, der Erzieher der Söhne des Medici, munterte mich zu meiner ersten großen Basreliefarbeit auf, dem Kampf der Kentauren mit Theseus, und stand mir bei, wenn ich mich, recht ungeübt, in Platons Weisheit vertiefen wollte.«
»Habt Ihr sonst noch Führer gehabt in Eurer Geistesbildung?« fragte der Kardinal voll Anteilnahme an dem Geschick des jungen Menschen.
»Drei Menschen traten bisher wegweisend in mein Leben: Dante, Platon und Savonarola.«
»Ein disharmonisches Dreigestirn. Aber es strahlt von jedem Stern ein eigenartiges Licht aus, das auf gute Menschen veredelnd wirken muß. Und wer war Euch Führer in Eurem Beruf?«
»Masaccio in der Malerei, Donatello in der Skulptur.«
»Wer könnte an ihnen vorbei?« sagte Giambattista voll Verständnis.
Galli rieb sich vergnügt die Hände. »Gebt ihm Aufgaben, Kardinal.«
Michelangelo errötete. In seiner Brust spannte der Ehrgeiz seine Flügel und flog über Donatellos und Masaccios hellstrahlende Glorie hinaus.
Der Kardinal dachte nach. »Monterotondo ist noch aus mehrfachen Gründen für Euch nicht zugänglich. Um die Weihnachtszeit aber quartiere ich Euch gerne dort ein. Denkt unterdessen über eine Madonna in Marmor nach, die das Portal der Schloßkapelle zieren soll. Ich möchte aber nicht die trauernde Mutter der Pietà haben, sondern die sanfte Trösterin der Betrübten, von einer fraulichen Weichheit im Ausdruck, die zur höchsten Rührung stimmen soll.«
Man hörte Bewegung auf dem Gang. Die Orsini sahen einander an. Schritte hallten. Dazwischen klirrte der Nordwind ans Fenster und im Kamin prasselte jäh das Feuer auf. Dann wurde die Tür geöffnet.
An der Schwelle stand im Licht eine halb gebrochne, todesmatte Jünglingsgestalt. Der nasse Mantel umhüllte knabenzarte Glieder, die Barettkrempe verschattete die Augen. Aber jetzt hob sie der Fremdling ins Licht und sah die Männer mit dem Ausdruck hilfloser Verzweiflung an.
Da erschrak der Kardinal.
Im nächsten Augenblick warf sich der Jüngling zu seinen Füßen nieder und schluchzte seine Herzzerrissenheit aus.
 Mit einem stummen Blick bat der Kardinal die übrigen, daß man ihn mit dem Jüngling allein lasse. Da polterte der verwunderte Feldhauptmann, gefolgt von den Gästen, zur Tür hinaus. Michelangelo warf noch einen prüfenden Blick auf den edelgebauten Jüngling, dessen Schönheit sein Künstlerauge gleich erfaßt hatte.
Mit einem stummen Blick bat der Kardinal die übrigen, daß man ihn mit dem Jüngling allein lasse. Da polterte der verwunderte Feldhauptmann, gefolgt von den Gästen, zur Tür hinaus. Michelangelo warf noch einen prüfenden Blick auf den edelgebauten Jüngling, dessen Schönheit sein Künstlerauge gleich erfaßt hatte.
Als sie allein waren, riß der Kardinal den knienden Jüngling empor. »Ihr seid Marcello Gaetani.«
Des Edlen Kehle würgte ein verzweifeltes Ja heraus.
»Cesare Borgia verfolgt Euch.«
»Mein ganzes Geschlecht vernichtet, die Burgen in Sermoneta und Anagni zerstört! Durch die Schluchten des Sabinergebirges rettete ich mich und suchte Monterotondo zu erreichen. Die Schreckgespenster saßen mir im Nacken: das Bild meines ermordeten Bruders, die jammernde Mutter –«
»Wo ist sie, die edle Eleonora Orsini?« fragte der bestürzte Kardinal.
»Sie floh auf neapolitanisches Gebiet. Wie weit sie gekommen, weiß ich nicht. Borgiareiter schnitten mir den Weg zu ihrer Straße ab, ich wurde von allen Seiten eingeschlossen, fand mühevoll eine Lücke bei Nacht, schlug mich durch und erreichte heute nachmittag Monterotondo, wo man mir sagte, Ihr hättet vorübergehend Herrenrechte auf Bracciano ergriffen.«
»Wer wies Euch an mich?«
»Meine Mutter hatte uns Kindern ans Herz gelegt, wenn wir in Not wären, sollten wir des Kardinals Orsini gedenken, dessen Vater einst bei dem unsern ein freundlich Asyl gefunden. Ich formte mir ein Bild von Euch in meinem Herzen zurecht, sah Euch hochherzig, edelsinnig, erfahren und kunstliebend –«
»Laß das, Knabe –«
»Und zwischen den Tugenden bildete sich mein Geist auch die Gestalt. Und als ich jetzt an der Schwelle stand, schlug mein Herz unter allen Männern Euch als meinem Retter entgegen.«
Der Kardinal sah mit leiser Verwirrtheit über das Haupt des Jünglings hinweg in die Nacht, die mit undurchdringlicher Schwärze vor den vergitterten Fenstern lagerte. Unaufhörlich fuhren die Sturmstöße gegen die Scheiben, als wollten sie sich Einlaß erzwingen in die feindliche Wärme der Ritterstube. Giambattista ergriff die Hand des Knaben. »Ihr seid willkommen,« sagte er mit dem Ernst eines Mannes, der eine schwere Verantwortung auf sich lädt.
Marcello Gaetani wollte mit Ungestüm die Hand des Retters ergreifen. »Laß das, stürmischer Knabe,« sagte rasch der Kardinal. Dann besann er sich und sprach mit mahnender Gewichtigkeit: »Du weißt, daß die Orsini jetzt mit dem Papst versöhnt sind, daß sie die erste Stütze der Kirche unter den römischen Baronen sind. Mein Vetter, den du eben aus dem Zimmer gehen sahst, hat bei Cesare Borgia Kondottierendienste genommen, Pagolo geht morgen ins Feldlager bei Forli, Giangiordano, der Herr dieses Schlosses, zieht eben im Gefolge des französischen Königs heran und unterstützt die Politik des Papstes, alle Orsini stehen mit gezognem Degen an der Seite Cesare Borgias, desselben Mannes, der dein Geschlecht gebrandschatzt hat. Ich wage viel, wenn ich dir heimlich ein Asyl biete. Doch Menschlichkeit und Dankesschuld fordern von mir eine Handlung, die mein Gewissen ruhig schlafen läßt. Aber ich bitte Euch, sinnt vorderhand nicht auf Rache, solange Ihr in des Friedens Bezirken lebt. Zur Rache kann ich Euch nie und nimmer verhelfen, das verbietet mir meine Würde und meine Erfahrung. Gott wird wissen, wann er das Schwert über Eure Feinde zu schwingen hat und wen er als Schwertschwinger wählt. Greift ihm nicht in den Arm. Spielt in Monterotondo den harmlosen Besucher und Freund – und –« er besann sich – »ich will Euch unter dem Namen eines sizilianischen Edelmannes Marcello Chiaversa bei meiner alten Mutter einführen –«
»Die Schuld erdrückt mich, Kardinal –« stammelte der Gerettete.
»Schaut Euch in meiner Bibliothek, in meinen Schätzen des Geistes um. Ihr habt in Bologna studiert, nützet die Weisheit, Ordnung in mein Schriftenchaos zu bringen. Daneben könnt Ihr Befestigungskunst treiben, den Verteidigungszustand des Schlosses heben –«
»Wittert Ihr Gefahr von den Colonna?« fragte der Jüngling.
»Wer will den Wetterwinkel in Italien bestimmen? Aber die Gedanken sind nicht für dein geängstigtes Herz. Armer Knabe! Was hat Gott mit dir vor? Ich kannte dich gleich, als du eintratst, wiewohl ich dich nur als kleinen Knaben gesehen, als du mit dem Vater gegen Neapel rittst, die schöne Fürstin von Squillace einzuholen. Wann warst du zum letztenmal in Rom?«
»Vor zwei Monaten – mit meiner Mutter – meinem unglücklichen Bruder –« Marcello schloß die Augenwimpern über den hervorquellenden Tränen. »Mein armer Bernardino – ermordet!«
Giambattista fuhr tröstend über den sonnengoldnen Scheitel des Gastfreunds. Dann ließ er durch einen Diener ein Abendbrot für ihn bringen. Er rückte den stärkenden Wein an den Jüngling heran und fragte: »Ist's wahr, Euer Oheim Giacomo soll in der Engelsburg –«
»Er hat sich durch den listigen Papst nach Rom locken lassen, hörte ich in den Sabinerbergen.«
»Die Schicksale der ewigen Stadt gehen weit draußen an Monterotondo vorbei, ich lebe gar einsam, und wenn doch düstre Bilder vorüberziehen, schließe ich herzzitternd die Augen in dem Bewußtsein, nicht helfen zu können.«
Ein polterndes Geräusch wie von schweren Tritten setzte ein, das der heulende Wind sogleich verschlang. Giambattista öffnete die Tür. Spärlicher Fackelschein erhellte ein wenig den finstern Gang, in dem sich jetzt ein Knäuel von Gestalten heranschob. Aus ihm riß sich der junge Fabio Orsini los und eilte auf den Kardinal zu. »Beute, Beute, Beute!« jubelte er seinen Oheim an. »Unter dem Schutz des Jupiter pluvius hoffte uns der schöne Krieger zu entwischen, aber wir haben ihm arg zugesetzt.«
»Wer ist es?« fragte der Kardinal.
»Das birgt sich noch in den Falten der Nacht. Da, seht selbst.«
An die Schwelle schleppten die Söldlinge ihre Last heran. Pagolo war herbeigeeilt. Die Türflügel des Turmgemaches flogen auf und in den Schein der Kerzen setzten die Bahrenträger den sonderbaren Raub nieder. Alles umringte die reglose Gestalt. Zu ihren Häupten stand schnaufend und mit grimmig zusammengebissnen Zähnen der alte gefangene Schnauzbart.
Der Kardinal hob den Mantel von der Gestalt. Da fuhr er bestürzt zurück. Ein Weib! Da ward es still im Raum, als hätte sich der heilige Name der Mutter Gottes in ehrfürchtig stillem Gebet aus den Brüsten gerungen. Alles starrte nach der Gestalt, die in Wams und Mantel einen Jüngling vortäuschen wollte und nun halb enträtselt den zudringlichen Blicken der neugierigen Burginsassen preisgegeben war. Schwarzes, vom Regen durchnäßtes Haar quoll unter dem Barett hervor und floß, losgelöst von Sturm und Wetter, über die Griffe der Tragbahre herab.
Da schnellte der junge Fabio empor. »Das Geheimnis ist entzwei!« rief er bewegt. »Knechte hinaus!« Das Gesinde trampelte über die Schwelle. »Wir werden gut tun, morgen den Reisewagen zu rüsten. Ich selbst will der edlen Frau das sicherste Geleite geben nach Rom.«
»Wer ist es?« fragte der Kardinal, die Blicke unverwandt auf das marmorbleiche Gesicht geheftet.
»Als ich im Sommer die Herzogin Lukrezia Borgia in ihre neue Stadt Spoleto begleitete, erschien dort an ihrem Hof eines Tages eine Ehrendame, die in wenigen Tagen der Liebling der Herzogin wurde. Es ist kein Zweifel, daß vor unsern Augen der edle Leib der Ehrendame Lukrezia Borgias liegt. Graukopf! In des Teufels Namen!« Er wandte sich verärgert an den gefangenen Dienstmann – »gesteh, die schöne Beute ist Donna Tiziana de' Calvi!«
Der Alte warf den Kopf grimmig zurück. »So handelt edelmännisch an ihr, Herr, sie ist aus dem Geschlecht der Calvi von Trevi, verwitwet nach dem Kapitän Brancaleone, gewesene Ehrendame der Herzogin Lukrezia Borgia. Und nun haut mich in Stücke, ich bin ihr treuer Knecht gewesen vier Jahre lang, und es soll nicht heißen, daß Pietro Tolomei seine Herrin verraten hat. Sie war gütig wie Gottes Engel und mein Schwert hätte für sie zehn Euresgleichen von der Erde weggemäht, wenn Eure Klinge mir nicht zuvorgekommen wäre. Haut zu, ich will ihr den Weg in den Himmel bereiten.«
»Du sollst leben,« sagte der Kardinal, den die Haltung des Knechtes rührte. »Niemand ist hier Feind. Ein unseliger Zufall warf dir diese Beute in den Arm, Fabio. Schickt um Monna Rosaura und um den Astrologen Lorenzo.«
Ein Diener wurde beauftragt, die Gattin des Giangiordano Orsini und den heilkundigen Sterndeuter zu holen.
Die Orsini sahen einander in einiger Verlegenheit an. Der Hauptmann Pagolo fand sich zuerst wieder. Seine grauen Haare behüteten ihn vor allzu großer Verwirrung. Er hätte lieber einen Colonnareiter unter seine Fäuste bekommen. »Fabio, das war kein Meisterstreich,« sagte er beinahe gekränkt zu seinem Sohn.
»In der Nacht sind Kühe und Weiber schwarz,« entschuldigte sich der Wildling mit einem verlegenen Gesicht.
Unterdessen hatte Galli die dunkle Haarflut auf dem edlen Haupte bewundert. »Seht, Michelangelo, Ihr liebt keine Modelle. Aber dieses scheint auch für einen Kostverächter beachtenswert.«
Michelangelo antwortete mit einem düstern Schweigen. Seine Augen waren in neugieriger Gespanntheit auf der Ohnmächtigen bleiches Antlitz gerichtet, das sich jetzt unter dem Hauch der Wärme mit Rosenschimmern bedeckte. Auch das gehemmte Leben unter den Brüsten, die das unnatürliche Wams spannten, schien leise in Bewegung zu geraten und bannte nun des Künstlers Auge in sanfter Gewalt.
Der Kardinal schien befangen zu sein von dem Anblick des Frauenleibes, der als unwillkommnes Beutestück seiner Macht überantwortet worden war. Er wandte sich an den gefangenen Knecht: »Was suchtet Ihr mit der Herrin bei Nacht und Wetter auf der gefährdeten Straße?«
Der Graukopf kehrte sich mürrisch ab. »Fragt sie selbst, Herr. Und gibt sie keine Antwort, wird sie wissen, warum. Mich laßt ungeschoren. Die alte Schnauze bellt nur, wenn es die Herrin gebeut.«
Pagolo hatte die Faust zum Schlage geballt. »Soll ich deinen Trotz brechen, knurriger Hund?«
Der Kardinal hielt ihn zurück. »Entwürdige dich nicht, Pagolo. Er hat's nicht besser gelernt, und seine Treue rührt. Man hat's, scheint es, in Italien verlernt, Treue zu bewundern.« Auf seiner Stirn lag eine ernste Falte. »Seltsames Geschick!« sagte er dann mit einem leichten Aufatmen. »Da bringt uns ein Abend zwei Fremdlinge ins Haus. Hier ein verirrter Edelmann aus Taormina, Marcello Chiaversa, aus seiner Heimat durch König Federigo vertrieben. Er sucht Schutz beim Gonzago in Mantua. Der Sturm ließ ihn nicht weiterkommen. Er soll morgen mit mir nach Monterotondo, vielleicht erspart ihm die Bekanntschaft mit meiner Burg die Reise nach Mantua. Still – – – sie bewegt sich –«
Die Gestalten drängten zur Bahre hin. Dort begann das Leben die starren Fesseln der Ohnmacht zu lösen. Über das Antlitz zuckte ein leiser Schmerz wie aus einem Traum heraus.
Etwas seitwärts stand, gedrückt von gastlicher Bescheidenheit, Marcello Gaetani. Sein Herz zitterte noch in Dankbarkeit nach, denn die Klugheit des Kardinals hatte ihm zu einer Maske verholfen, deren Notwendigkeit der Kardinal wohl verantworten würde.
Tolomei hatte sich jetzt ungestüm in die Nähe der erwachenden Herrin gedrängt. Mißtrauisch rollten seine Augen von einem zum andern.
Nun öffnete Tiziana de' Calvi die Augen. Schwer und beinahe feierlich, als wäre ihr Erwachen die Neugeburt ihres eigenen Lebens auf einem andern Stern des Alls. Der Kardinal hob leise ihren Kopf auf und schob als Stütze seinen zusammengefalteten Mantel darunter. Die Berührung brachte sie zu sich. Bange Stille legte sich lähmend auf alle. Nachtdunkle, glanzerfüllte Augen blickten verloren in das fremde Reich. Der Seele halber Schlummer lag noch in ihnen. Tastend suchte das Leben nach seinem Recht. Aber wie in müder Entsagung schien es sich wieder zurückziehen zu wollen in den Kerker der Bewußtlosigkeit, die Lider zitterten leise, und bald darauf legten sich die großen Wimpern wie ein schützender Mantel über den Glanz der Sterne. Es ward wieder Nacht in der Seele Tiziana de' Calvis.
Seltsame Wirkungen hatte dieses kurze Leuchten des Lebens erzeugt. Der Kardinal sagte tief bedrückt: »In diesen Augen schlummert viel Leid.«
»Es sind Augen, die man dem Bild einer Kleopatra geben möchte,« sagte der kunstsinnige Galli.
Michelangelo schwieg. In seinem Innern aber rührte eine tiefe Bewegung an seiner Seelenharfe und ließ sie halb andachtsvoll, halb schmerzlich erklingen. Sie sang ihm das Lebenslied der Entsagung.
Der alte Kampfhahn Pagolo spürte einen leisen Sprung in seinem Herzen und sagte verlegen: »Mein Fabio hat selbst in der Nacht Geschmack. Oder es hat ein Hecht im Schlaf eine Fliege geschnappt.«
Marcello Gaetani aber starrte unverwandt auf das feingeformte Frauenantlitz, das unter dem nähern Schein der Kerzenflammen wie von einem warmen Bronzeschimmer umsponnen schien. Und er dachte an jenes Madonnenauge von Giovanni Bellini, das ihn einmal als Knabe in Venedig so zauberhaft tief über dem Sakristeialtar der Santa Maria bei Frari angeblickt hatte, daß er darüber ganz verwirrt aus der Kirche geschlichen. Eben als die Tür aufging und Donna Rosaura, die Frau des fernen Giangiordano Orsini, mit blassem Antlitz hereintrat, schlug Tiziana das bewunderte Auge auf. Donna Rosaura, eine steife Frau mit kerzengeradem, fleischarmem Leib und einem Bildsäulengesicht, das die Gabe des Lächelns nie verschönt hatte, war erst aus ihrem Bette geholt worden. Der Kardinal begrüßte sie mit formvollendeter Höflichkeit. »Diese Samariterhand wird nicht zögern, Hilfe zu leisten. Unser Fabio hat in seinem Ungestüm eine Unschuldige zur Gefangenen gemacht. Das Leben kehrt hier neu zurück, nehmt Euch der edlen –«
»O – es ist Tiziana de' Calvi,« sagte Donna Rosaura ohne innere Bewegtheit, nachdem sie einen Blick auf die Tragbahre geworfen. »Es ist die Braut des Luigi Savelli.«
»Savelli?« fuhr Pagolo empor. »Dann hätten wir ja den Teufel richtig im Haus.«
»Du siehst schwarz, Haudegen!« besänftigte ihn der Kardinal.
»Haha! Die Savelli! Den Colonna aufs Blut verschworen! Ein ritterlicher Bräutigam! Sitzt auf seinem Schloß Arignano bei Turteltauben und Falerner, und seine Braut jagt angstverhetzt bei Sturm und Wetter über die tuskischen Straßen! Trabanten der Colonna! Spielen wir den Savelli einen Streich, so juckt den Colonna das Schwert in der Scheide. Und hier, scheint es, haben wir ihnen einen Streich gespielt.«
»Ereifert euch nicht, Freunde,« sagte Giambattista. »Wenn dieser stumme Mund gesprochen haben wird, werden wir wissen, was wir zu tun haben werden. Da kommt der Astrolog.«
Ein Diener schleppte den halb blinden alten Lorenzo Nani herein, der die Schicksale des Schlosses Bracciano seit urdenklichen Zeiten aus dem Planetenstand gelesen und die Nativität jedes neuen Bärensprößlings – denn vom Ursus leiteten die Orsini ihr Geschlecht ab – auf die sorgfältigste Weise zu ergründen hatte. Er wußte aber auch in der Medizinkunst Bescheid und hatte noch die alten zweiundsiebzig Schriften des Hermogenes aus Smyrna studiert und kannte die einundsechzig Substanzen des Theriaks auswendig.
Lorenzo neigte nun schnell fern Ohr an die Brust der reglos daliegenden Frau und horchte gespannt den Atemzügen. Das blaue, nasse Auge des Alten leuchtete warm. »Nur Ruhe, nichts als Ruhe!« sagte dann seine beruhigende, dunkeltönende Stimme. »Tragt die Bahre in das Schlafgemach.« Und er ging voraus, seine Mixturen und Verbände zu holen.
Weit öffneten sich die herrlichen Türflügel, und alle Umstehenden machten der Bahre Platz.
In diesem Augenblick hatte Marcello Gaetani das Gefühl, als trüge man eine Tote da hinaus. Sein Knabenherz erbebte unter der Wucht dieser Einbildung, die die Erschöpfung seiner Natur und die Ereignisse des Tages krankhaft gereizt hatten. Auch der Kardinal sah nach der Tür. Noch leuchtete das dunkelrote Barett, das Fabio der Schlummernden aufs Haupt gedrückt hatte, einen Augenblick lang auf. Dann schloß sich die Tür.
»Zur Ruhe, ihr Herren, der Tag war bewegt.« Der Kardinal drückte den Gästen die Hand. Auch die Orsini verabschiedeten sich vom Kardinal und nahmen den grimmen Tolomei mit sich, um ihn im Knechtesaal bewachen zu lassen.
»Laßt mich rufen,« bat der Kardinal die müde Rosaura, »wenn Donna Tiziana nach mir fragen sollte.« Dann gab er ihr den Gutenachtgruß.
Als Giambattista mit Marcello Gaetani allein war, legte er ihm die Hände auf die Schultern. »Der Kastellan wird Euch die Gaststube weisen. Es wird gut sein, wenn Ihr die Nacht benutzet zum Ritt nach Monterotondo. Die Schergen Cesares sind wachsam. Im übrigen seht keine Gespenster und habt guten Mut.«
Der Jüngling schritt mit einem heißen Dankgefühl im Herzen auf den schwach beleuchteten Korridor hinaus, wo ihm ein Knecht die Stube des Kastellans zeigte.
Der Kardinal blieb allein. Die Stimmen der Unruhe, die noch vor wenigen Augenblicken wie ein bewegtes Meer gerauscht hatten, hallten in seinem Ohre nach. Er suchte sich zu sammeln. Ein paar Tage mußte er noch auf Bracciano bleiben, um die hier zusammenkommenden Orsini der andern Schlösser zu begrüßen. Es sollten wichtige Beratungen vorgenommen werden. Die bevorstehende Colonnafehde stand im Vordergrund. Aber der Kardinal dachte nicht an sie. Die seltsam verrauschte Abendstunde warf ihren Schein noch in seine Brust.
Da war also noch ein Weib in die Mauern der Burg gekommen. Ein halb totes, fremdes, vielleicht auch gewöhnliches Weib. Noch hatte das Leben in ihr kein deutliches Zeichen gegeben, und doch glaubte der Kardinal Giambattista – nein, er wollte nichts glauben. Er vertrieb unwillig die Erinnerung an das schlafende Bild. Unter dem Schein der Kerzen lag eine Schrift des eben verstorbenen Marsilio Ficino, des berühmten platonischen Philosophen von Florenz. Der Kardinal setzte sich zum Tisch und blätterte in der Schrift. Der Sturm hatte sich gelegt, nur wie fernes Rauschen klang es an die Fenster, als tönten die unruhigen Wellen des Sabinersees herauf. Eine Gelehrtenstille legte sich um das Gemüt des geistlichen Nobile, und er fand sich bald tief in den Netzen der alten Weisheit verstrickt. Da war vom Tode die Rede, daß er keine Trauer in dem erkenntnisreichen Gemüt erzeuge, denn die Seele lebe erst, nachdem sie vom Körper befreit sei, durch den Tod erst werde sie von Gott neu erschaffen. Und ein liebes Wort leuchtete in des Kardinals warmes Herz hinein: Die Gottheit hat alles um der Schönheit willen geschaffen. Er wurde unruhig. Warum rief man ihn nicht schon? Verlangte sie noch nicht nach dem Schloßherrn? Und dann klang wieder das Wort dazwischen durch: Die Gottheit hat alles um der Schönheit willen geschaffen. Also auch dieses Weib –?
Er schlug das Buch unwillig zu. Mit den sonstigen Geheimnissen der Erde und des Himmels hatte er sich sein Leben lang genugsam befaßt, aber mit den Geheimnissen der Frauenseele nicht. Sie blieben an dem Rätsel Welt als ein nichtiges, bedeutungsloses Zubehör hängen. Er fand der Frauen Tugend für achtenswert und ihre Untugenden verzeihlich, aber er hatte die Notwendigkeit nie empfunden, die Wesenheit Weib zu analysieren, und was er davon verarbeitet hatte, war die Lese aus den Werken der Alten und das wenige aus den Reichen neuer Kunst. Selbst in früherer Zeit, da er noch mit leicht beweglichem Blut das Leben durchstöbert und wie mancher andre jugendliche Kardinal an der Prunkentfaltung und dem weltlichen Gehaben ein Ergötzen gefunden hatte, stieß ihn das Vergnügen am Weibe ab, dem fast die gesamte Prälatur hemmungslos frönte. Er haßte Zeloten und Frömmler ebenso ehrlich wie die sinnlichen Genußmenschen, die der Zeit ihren grellfarbigen Stempel aufgedrückt hatten. Er nahm sein Priestertum ernst und hatte deshalb von den Kardinälen mancherlei Spott zu erleiden. Auf Monterotondo vergrub er seinen unruhigen Geist in Wissenschaft und Kunst, für die Denkmäler des alten Rom brachte er schon frühzeitig eine rührende Begeisterung auf, und für die Taten und nationalen Träume Dantes und Petrarcas hatte er ein ebenso empfängliches Herz wie für den Ideenkern des Savonarola und die gemütstiefe Glaubensschwärmerei des Franz von Assisi. Seine alte Mutter sorgte für ihn und seine Behaglichkeit im Schloßrevier. Wenn er von seinem Fenster auf die latinische Welt zu seinen Füßen blickte, auf die stillen Berghänge und den melancholischen Tiberstrom, dann hörte er leise das Mutterwort an sein Ohr klingen: Sind wir nicht glücklich, Kardinal? Und dann küßte er voll Ehrfurcht und Dankbarkeit diesen verwelkten Mund, der so bewegt die Gefühle der Herzenszufriedenheit aussprach.
Seine feinfühlende Seele hatte in der Verkommenheit der Zeit ein schweres Dasein. Eine eiserne Welt bewegte sich rings um ihn, in der ein Mensch mit dem Drange nach Mitleidübung, Gerechtigkeit und Sittenvervollkommnung schwer zu ringen hatte. Die Mitleidlosen, Ungerechten und Verkommnen siegten, und auf allen Lebenswegen lag die Tugend verdorrt, die Menschenliebe zerknickt. Worte der Barmherzigkeit und Mahnungen zur Buße fielen ins Leere. Die mahnende Posaune Savonarolas war verstummt, ihr Nachhall wurde übertönt von dem Jubelschrei des sinnlos schwelgenden Rom. Das eifernde Treiben des Florentiner Mönches stieß den Kardinal ab, ebenso das Kampfgeschrei der baronalen Parteien. Das Blut des alten Bärengeschlechts floß verfeinert in seinem Edelleib und hatte keine wilde Streiternatur aus ihm geformt wie aus den andern Orsini, die schon in ihrem Äußern das Merkzeichen ihrer Abstammung trugen, denn es waren lauter breitschultrige, hünenfeste, markige Männer, während der Kardinal die Blicke der Künstler und Frauen durch seine schlanke, zarter gegliederte Gestalt immer wieder fesselte, wenn er durch die Straßen Roms ritt. In seinem Auge aber lag ein Gemisch von Versonnenheit und leuchtender Klarheit, das wie der Glanz eines Frühlingstages anmutete. Selbst das dunkle Haar gab seinem Wesen keinen düstern Schatten, sondern hob seinen Denkerernst auf der helleuchtenden Stirn.
Der Kardinal wollte sich eben wieder in seinen Marsilio Ficino vergraben – da näherten sich Schritte der Tür. Und er wunderte sich, daß ihm das Herz schneller schlug. Ein Diener rief ihn an das Lager der Tiziana de' Calvi.
 Um diese Stunde sann Michelangelo Buonarroti mit verquälter Seele in die Augenblicke zurück, die er eben durchlebt. Das Weib auf der Bahre – eine tote Madonna. Dem grübelnden, bohrenden Sinn seiner Künstlerjugend gefiel dieser Gedanke, den noch kein Maler oder Bildhauer vor ihm durcharbeitet zu haben schien. Er dachte an den toten Leib des Herrn, den er im Steinbild der Pietà im Schoß der jugendschönen Mutter gebettet hatte. Das war noch immer ein gewöhnlicher Vorwurf der Bildhauer gewesen; aber an die tote Madonna, die noch nicht dem Himmelreich entgegenfuhr, an das einfache Weib, das der Natur seinen Tribut im Sterben zollte, hatte noch niemand gedacht. Das breite Geleise der gewöhnlichen Kunstanschauung verließ der Künstler, sooft es anging. Und nun konnte er wieder mit einem neuen bildnerischen Ausdruck spielen. Wenn er sich Galli anvertraute?
Um diese Stunde sann Michelangelo Buonarroti mit verquälter Seele in die Augenblicke zurück, die er eben durchlebt. Das Weib auf der Bahre – eine tote Madonna. Dem grübelnden, bohrenden Sinn seiner Künstlerjugend gefiel dieser Gedanke, den noch kein Maler oder Bildhauer vor ihm durcharbeitet zu haben schien. Er dachte an den toten Leib des Herrn, den er im Steinbild der Pietà im Schoß der jugendschönen Mutter gebettet hatte. Das war noch immer ein gewöhnlicher Vorwurf der Bildhauer gewesen; aber an die tote Madonna, die noch nicht dem Himmelreich entgegenfuhr, an das einfache Weib, das der Natur seinen Tribut im Sterben zollte, hatte noch niemand gedacht. Das breite Geleise der gewöhnlichen Kunstanschauung verließ der Künstler, sooft es anging. Und nun konnte er wieder mit einem neuen bildnerischen Ausdruck spielen. Wenn er sich Galli anvertraute?
Aber da zogen sich Spinnwebnetze um seine Seele. Nicht schaffen können, was in der Seele nach Gestaltung rang! Seine freien Gedanken nicht frei in den Stein schlagen können! Sich plagen müssen mit den einförmigen Statuen ausdrucksloser Madonnen, wo das Leben ringsum Gottes herrlichste Schöpferkraft in irdischen Leibern offenbarte, die, umgeformt durch den eigenen Schöpferwillen, das Loblied des Künstlers singen würden! Hei, da lag so ein schönes Weib vor ihm, das noch in seiner Totenstarrheit den lebendigen Meister pries, und er war verdammt, diesen Ausdruck des Erdenleides, um den sich mehr als ein Hauch von Schönheit spann, nur mit fiebernder Seele durchsinnen, aber nicht gestalten zu dürfen, weil das Bild nicht in den Vorstellungskreis der gewohnheitsträgen Banausen paßte. Sein Inneres war ja vollgepfropft von Gestalten und Werten. in jedem Marmorblock, in jedem Stein sah er das aus seiner Seele gegrabene Werk bereits enthalten, er brauchte nur den Meißel anzulegen und das überflüssige Steinwerk abzubröckeln, und vor seinen Augen hob sich aus der starren Maste der verlebendigte Gedanke feines Künstlerhirns heraus.
Jetzt lockte es ihn, dabei zu sein, wenn da unten in einem Gemach ein neues Werden begann. O, was hätte er dafür gegeben, das gierige Atmen nach des Lebens schon halb verlornen Wonnen zu studieren! Ihn packte der Gedanke, aus diesem heiligen Erleben ein »Rinascimento«, eine Wiedergeburt, aus dem Stein zu meißeln. Er warf sich ärgerlich auf das weiße Bettzeug.
Du hast dich belogen! rief er sich selbst zu. Nicht der künstlerische Schöpfergedanke lockt dich zur Auferstehung – das Weib selbst war's. Das Wunder dieser stillen Schönheit. Und du wolltest das liebearme Herz an diesem Wunder erquicken. Laß ab, Tor! Spiegel her!
Und er stellte sich mit einem halb erstickten Fluch vor das silberumrahmte Glas und grinste sein Spiegelbild an: den dreieckigen, breitstirnigen Kopf, die farblosen Augen, die Riesenschultern, die den Körper drückten, die abgeplattete Brust, die unförmigen Hände, die sich zu Metzgerfäusten zusammenballten, und im Gesicht die zerschlagene Nase, den Denkzettel des brutalen Kameraden in Florenz, des wilden Pietro Torrigiano, der ihm mit der Roheit eines Henkersknechtes in der Brancaccikapelle vor dem Heiligtum der Masacciofresken im Streit das Nasenbein zertrümmert hatte. Der Neid, der häßliche Schatten der Künstlernatur, hatte die Faust niedersausen lassen auf das arme, schon von der Natur geschlagene Gesicht des Buonarroti. Und der schwächliche Bursche hatte sich schmachbedeckt mit zusammengebißner Lippe und zuckendem Herzen in einen Winkel der Kapelle zurückgezogen und seine Tränen der Scham verschluckt. Und als er seine entstellte Nase sah, krampften sich seine Finger zusammen und er wollte fürchterliche Vergeltung üben. Aber da erinnerte er sich der Wunderblüte seiner christlichen Erziehung, die ihm sein Vater hatte angedeihen lassen und sein Gemüt erwärmte sich plötzlich an des Nazareners Wort: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Mit so rührender Einfalt hielt er den Schlägen des Schicksals stand. Der Meißel wurde ihm das Werkzeug für seine rastlos arbeitenden Gedanken, der Tröster im Leid, das ihm die Menschen schlugen mit ihrer Mißachtung seiner körperlichen Formen. Und gerade ihn, den Anbeter der Wunder Gottes, traf diese Verachtung so schwer. Sein Hochgefühl schwärmte in der Schönheit des griechischen Statuenleibes, und wenn er seinen eigenen Körper ansah, grinste ihn das Gespenst der Häßlichkeit an. Mit einer Art Trotz warf er sich auf den Gegenstand der idealen Menschenschönheit, um ihn künstlerisch zu bezwingen, als hätte er gleichsam dem Schöpfer seines Ich zeigen wollen, daß er trotz seiner eigenen Häßlichkeit den Sinn für das Schöne nicht eingebüßt habe.
Aber die Menschen gaben sich keine Mühe, eine Entschädigung für seine Mißgestalt in dem reichen Künstlerleben seiner Seele zu suchen. Das kräftige Werden in ihm witterten nur wenige, und so rang er sich mühsam mit seinem Können durch allen Neid und die Verunglimpfung seiner Genossen durch. Eine hypochondrische Bangigkeit vor den bevorstehenden Arbeitsstunden überschlich ihn. Er wollte sich noch jetzt in der Nacht dieses Gefühl von der Brust wegschreiben. Dem Vater wollte er sein Herz ausschütten. Wenn seine Gedanken nach Florenz schweiften, wurde er gewöhnlich die eingebildeten Sorgen los. Aber die Feder sträubte sich heute gegen seine eigenen Gedanken. Da rief er sich's mit Ingrimm und gelinder Verzweiflung zu: Ein Weib hat dich verwirrt! Künstlerisch ergriffen! Eine tote Schönheit! Hast du Angst vor der lebendigen? Wird sie nicht Gift und Galle aus dir hervorbrechen lassen? Wirst du nicht wieder den göttlichen Willen anklagen, der dich so erbärmlich schuf? Vermagst du nicht die Hoffnung auszudenken, daß du einmal den Widerwillen eines andern Menschenkindes gegen deine Häßlichkeit niederringen wirst durch die Kraft deines Genius? Nein, ewig wirst du Mitleid auslösen, Liebe nie! Drum richte weiter die Bollwerke deines Menschenhasses ringsum auf und ringe dich weiter deinem Ziele zu, die Natur zu übermeistern durch die Schöpfung des marmornen Edelmenschen! Und es tropfte heiß aus dem unschönen Auge nieder aufs Papier, das die angefangenen Worte der Sehnsucht nach Florenz trug. – –
Neben dem selbstquälerischen Künstler bangte ein andres verwirrtes Herz.
Marcello Gaetani stand klopfenden Herzens in seiner Stube am Fenster. Der Sturm war vertost, Wolken kämpften mit Sternen, und durch wallende Nebel düsterten die Flecken des Sees herauf. Aber in Marcellos Hirn glühten farbige Bilder hinein. Die Ermüdung ließ ihn nicht schlafen. Traumhaft bunt wirbelten seine Gedanken durcheinander, und die Bilder des Tages deckten, verschoben und kreuzten sich. Er sah sich wieder durch das Sabinergebirge irren, von den schrecklichen Erinnerungen der zerstörten Heimat verfolgt, er sah die Schergen Cesares in den Hütten lauern und er pries die Nacht, die ihn in ihren Schutz genommen hatte. Und er sah die Mutter durch das Saccotal flüchten und ihre noch immer goldnen Haare im Sturmwind wie lichte Fahnen flattern. Überall lauerte der Verrat. Wer war vor Cesare Borgia sicher? Der unheimliche Natternkönig stach nach allen Seiten. Er überlistete Satan, dem er diente und der in Wahrheit sein Knecht war. Die unzähligen Schreckbilder, die sich an die Gestalt des Herzogs Valentino hefteten, – so nannte man ihn nach seinem neuen Herzogtum – leuchteten mit Höllengluten in die angstverhetzte Seele Marcellos. Der Papstsohn, der sich statt des Kardinalspurpurs den Herzogsmantel umgeworfen hatte, um jetzt über Leichen seinem Thronziel zuzuschreiten, stand in der Blüte seiner Jugend vor ihm und hielt wie ein Traumdämon seinen Sündenzettel mit Glutbuchstaben geschrieben in der herrisch geballten Faust. Dort stand der Brudermord an dem Herzog von Gandia verzeichnet, dann der Mord an dem jungen Schwärmer Serafino d'Aquila, dessen dichterische Liebesklagen für Lukrezia Borgia samt seinem Leibe in den Fluten des Nemisees begraben lagen. Und Bruder und Schwester des schönen Dichters fielen in den dunklen Abgrund des Todes, ohne daß sich ein rächender Arm erhoben hätte. Und der ermordete Kammerdiener des Papstes, eine nichtige, kleine Leiche, grub seinen Namen Perotto in die Sündentafel ein. Und dann kamen die vergewaltigten, betrogenen Mädchen und Frauen und griffelten ihre Schande in den verbrecherischen Adelsschild des Herzogs, und die Kardinäle und Prälaten, Sekretäre und Offizianten, die um ihrer Gewissensreinheit willen in der Engelsburg saßen, ätzten ihr Schicksal in die Schuldtabelle ein. Und der Papst Alexander VI. schrieb sein höhnendes »Für gut befunden!« darunter.
Die Schrecken des Inferno, die Dante gemalt hatte, erblichen vor den Taten dieses Sendlings Luzifers. Und die Teufel sannen wohl auf neue Martern, die sie dereinst dem Papstkind bereiten wollten. Und wie würde jetzt Cesare den Reigen der Ruchlosigkeiten fortsetzen? Mit welcher Spitzfindigkeit des Gehirns würde er seine vermeintlich notwendigen Schandtaten zur titanischen Verbrechergröße steigern? Vernichtungsschauer wehten aus seinem Atem durch die Welt, die Geschlechter zitterten vor seinen heimlichen Winken und Befehlen, denn sie auszurotten, durchsann er schlaflose Nächte, opferte er die Würde des Menschen und setzte den Vampir an ihre Stelle. Wenn Cesare die armseligen Gaetani für unbequeme Stolpersteine auf seinem Pfad zur Höhe hielt, dann mußten ihm die Orsini, Colonna und Savelli als trutzige Burgtürme gelten, die seinem stürmischen Ehrgeiz den Weg verstellten. In Erkenntnis dieser unheimlichen Gefahr waren die Orsini so klug gewesen, sich mit dem Papst auszusöhnen und ihm Satellitendienste zu leisten. Vielleicht rechneten sie, daß ein Mensch mit großen Zielen sich nach großen Verbündeten sehnte. Wenn sie sich aber verrechneten? Wenn die Colonna, diese Erzfeinde des Papsttums, schlauer waren als sie und ihre ehrliche Feindschaft offen bekannten in dem starken Bewußtsein, daß es ihnen gelingen würde, die Borgia auszurotten wie die biblische Rotte? Dann hätten die Colonna die Gewalt in den Händen, und dann – wehe den Orsini!
Und bei einem Orsini hatte jetzt Marcello Gaetani sein Heil gesucht.
So blitzten die grellen Lichter der Angst in die Seele des Jünglings hinein. Und sie drohten die ermatteten Nerven vollends zu lähmen. Aber da fiel mitten in das Wetterleuchten der Gedanken ein milder Schein, der dem irrenden Flüchtling wie ein stiller, schöner Herdfeuerglanz vorkam, der Ruhe und Erwärmung verheißt. Wie eine Traumblüte war heute vor seinen Blicken ein Engel erschienen. Die vom Todeszauber halb berührte wunderbare Schönheit leuchtete mit belebender Kraft in sein Innres. Ein seltsames Töneschwingen und wundersame Bilder löste dieses Licht in ihm aus. Vor seinem bang staunenden Auge stieg der Reiz der durch zarte Poesie verklärten Simonetta, der einstigen Geliebten des Giuliano de' Medici, auf, die noch im Tode den Liebreiz des Lebens auf den Wangen hatte. Lag sie nicht vor ihm, die von der Sage umkoste Simonetta mit dem lilienschlanken Leib, den schimmernden Rosenwangen und dem berückenden Haar? Aber dieses blonde Haar war nun nachtdunkel geworden und der Name Simonetta hatte sich in Tiziana verwandelt.
Marcello schreckte zusammen. Und auch er ließ sein Bild im Spiegel leuchten wie sein Zimmernachbar Michelangelo Buonarroti. Aber jugendschön und ebenmäßig formte sich dieser Körper im geschliffnen Glas. Das Antlitz hatte ein Feuer von Begeisterung beseelt, wenn es nicht von der ausgestandenen Qual Züge der Erschöpfung getragen hätte, die aber trotzdem die apollonische Schönheit nicht verscheuchen konnte, welche die Herzen der Mädchen von Sermoneta verwirrt hatte. Nußbraune Locken fielen auf den gebräunten Nacken herab, ein schwarzes Aresauge, sonst von heißen Gluten erfüllt, war jetzt von den Schleiern der Müdigkeit umflort, und nur die dürstenden Lippen, von der Winterkälte zernagt, dem Abenteuer der Liebe zudrängend, waren auch jetzt heiß geschwellt und brannten vor Erregung. So schien Marcello einem jungen Frühlingsgott zu gleichen, voll Stürmermut und einem Feuer, das jedoch Grenzen, die das adelige Blut in ihm zog, gefällig eindämmten.
Der Jüngling löschte das Licht aus und warf sich in die Daunen. Aber der Schlaf floh ihn. Er öffnete das Fenster. Kalt griff die Nacht nach seinem Leib. Sie lag schwer unter einem sternenarmen, umwölkten Himmel und wurde zum Bilde für Marcellos hoffnungsloses Herz. Aber da – eine Wolke teilte sich plötzlich – und mit himmlischer Klarheit strahlte der Gürtel des Orion aus der Höhe. Und er wurde für den seltsam bewegten Jüngling zum leuchtenden Geschmeide der Aphrodite.
 In einem reichgeschnitzten, mit Fellen überworfnen Sessel saß Tiziana de' Calvi, das marmorblasse Antlitz in die heißen Kissen gedrückt. Hinter ihr zählte der Astrolog ölige Tropfen auf einen Löffel. Donna Rosaura war schon zur Ruhe gegangen, nachdem sie zuvor die schwarze Haarflut der Kranken in geordnete Knoten geflochten hatte. Lorenzo hatte eine Verletzung des Fußknöchels und einen Bruch des Oberarmes festgestellt. Er hatte Verbände angelegt, die zersplitterten Knochen mit Schienen und Polstern umspannt und den Arm in eine Mitella gelagert. Als die Schmerzen vorbei waren, weihte der Greis die Kranke in alle Einzelheiten des Schlosses ein. Die bangen Schwingungen in ihrem Herzen kamen zur Ruhe, als sie hörte, daß der Kardinal Orsini gegenwärtig Herrenrechte auf Bracciano ausübe. Sie kannte ihn nicht, wußte aber, daß ganz Rom in ihm den Menschen und Priester hochschätzte. Tizianas Auge weilte jetzt ohne Schrecken auf ihm, als er aus dem Türrahmen in die Helle der Kerzen trat. Er fand kein Wort des Grußes, Tiziana keines für ihre Bewegtheit. Ein seltsames, unerklärliches Etwas legte sich zwischen die Gefühle der beiden. Endlich befreite sich Giambattista aus der Beengung des Augenblicks. »Ihr fühlt Euch wohl, Donna Tiziana?« fragte er sanft.
In einem reichgeschnitzten, mit Fellen überworfnen Sessel saß Tiziana de' Calvi, das marmorblasse Antlitz in die heißen Kissen gedrückt. Hinter ihr zählte der Astrolog ölige Tropfen auf einen Löffel. Donna Rosaura war schon zur Ruhe gegangen, nachdem sie zuvor die schwarze Haarflut der Kranken in geordnete Knoten geflochten hatte. Lorenzo hatte eine Verletzung des Fußknöchels und einen Bruch des Oberarmes festgestellt. Er hatte Verbände angelegt, die zersplitterten Knochen mit Schienen und Polstern umspannt und den Arm in eine Mitella gelagert. Als die Schmerzen vorbei waren, weihte der Greis die Kranke in alle Einzelheiten des Schlosses ein. Die bangen Schwingungen in ihrem Herzen kamen zur Ruhe, als sie hörte, daß der Kardinal Orsini gegenwärtig Herrenrechte auf Bracciano ausübe. Sie kannte ihn nicht, wußte aber, daß ganz Rom in ihm den Menschen und Priester hochschätzte. Tizianas Auge weilte jetzt ohne Schrecken auf ihm, als er aus dem Türrahmen in die Helle der Kerzen trat. Er fand kein Wort des Grußes, Tiziana keines für ihre Bewegtheit. Ein seltsames, unerklärliches Etwas legte sich zwischen die Gefühle der beiden. Endlich befreite sich Giambattista aus der Beengung des Augenblicks. »Ihr fühlt Euch wohl, Donna Tiziana?« fragte er sanft.
»Woher kennt Ihr mich? Hat mich mein Diener verraten?«
Der Kardinal schüttelte den Kopf. »Er war treu und bissig wie ein Hund. Fabio Orsini, der Euch irrtümlich gefangennahm, hat Euch erkannt trotz dem Wams, das Euch sehr stattlich kleidet. Wir werden Euch, sobald Ihr genesen seid, zu Donna Lukrezia zurücksenden –«
Ihr Auge weitete sich im Schreck. »Nein – bei allen Heiligen, Kardinal – tut das nicht! Tut das, so Ihr selig werden wollt, nicht!«
Der Astrolog legte ihr behutsam die Hände auf das erschreckte Gesicht. »Es sind schöne Aspekten in der Stunde Eurer Gefangennahme sichtbar geworden. Venus leitet den Morgen ein, Mars und Saturn kämpfen miteinander – Ihr könnt beruhigt sein.«
Der Kardinal hatte sich näher zu ihr herabgebeugt. »Wollt Ihr mir etwas vertrauen?«
Sie nickte leicht und warf einen bangen Blick nach dem Astrologen. Da hieß ihn Giambattista aus dem Zimmer gehen.
Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, hetzte die helle Verzweiflung aus Tizianas Brust: »Rettet mich, Kardinal!«
»Vor wem?«
»Gierige Arme greifen nach mir – nach der Ehre einer schutzlosen Frau –«
»Ihr seid aus Rom entflohen?«
Sie nickte so heftig, daß sich das Haar aus den Knoten warf und über die Schultern herabfiel. Hastig rafften es ihre gemeißelten Finger wieder auf. »Calvi und Orsini bekämpfen einander, denn unser Geschlecht steht auf der Seite der Colonna. Ihr könnt mich als Beute zurückbehalten, Kardinal, und es wäre das Schlimmste nicht. Denn wenn Ihr mich ausliefert – o – die Angst schnürt mir die Kehle zu – mein Vater – Ihr kennt ihn nicht! Meine Mutter starb früh. Ganz in Händen seiner zweiten Gattin, vergißt mein Vater die Liebe zu dem Kinde aus erster Ehe und will mich durch das fürchterliche Gesetz des Hauses, das uns zu gehorchen zwingt, auch wenn wir Frauen geworden sind, in die Hände eines Mannes werfen, für dessen niedrige Gesinnung ich meine Frauenwürde opfern würde.«
»Ihr seid – dem Luigi Savelli – verlobt?« fragte der Kardinal leise.
Durch Zähren rang sich das bittere Geständnis durch: »Dem Bastard des Antonio Savelli – dem von den Teufeln Gezeichneten –«
»Dessen drei Frauen so leicht und schnell dahinstarben, daß das Volk ihn zu ihrem Mörder stempelte?«
»Eben dem!«
»Der an einem Tage zehn Hengste auf der Ravona zu Tode rannte? Den berüchtigten Freund des Trunkenbolds Francesco Colonna? Ihm sollt Ihr –«
Zu dem seelischen Schmerz der Kranken schnellte der körperliche wie eine stechende Viper dazu. »O Kardinal! Hätten mich die Hufe meines Rosses zertreten!«
»Gott lädt Euch viel auf,« sagte der Kardinal voll Mitleid.
Tiziana raffte fröstelnd das Tuch um den Hals zusammen und beichtete: »Aus unserm Haus in Trevi machte ich mich gestern auf, als es dunkel wurde –«
»Euer erster Gatte –«
»War Luca Brancaleone. Ich liebte ihn nicht und haßte ihn nicht. Das Qualvollste, was einem Frauenherzen begegnen kann. Als er starb, begrüßte ich die Freiheit meines Herzens. Aber nur für einen Augenblick. Um die Kampfbrüderschaft mit dem Geschlecht der Savelli zu stärken, mußte ein Opfer gebracht werden. Mein Vater wählte einen furchtbaren Bräutigam. Sein erstes Angebinde war ein geschossenes Täubchen, und es wurde mir zum Sinnbild meines eigenen Geschicks. Auch erkannte ich mich entsetzt im Wappen der Savelli wieder, ein armes Vöglein, von Löwenklauen bedroht. Die Gaben wurden gewogen, der Goldschatz wurde gezählt, der Schmuck bei Romano bestellt, und von Haus zu Haus ritten die glückwünschenden Nobili – Ihr kennt unser Haus mit den vergitterten Fenstern –«
»Bewundernd stand ich oft im Säulenhof vor den zwei Löwen der Freitreppe.«
»Der Palast hat zwei Eingänge. Mit Hilfe meines getreuen Tolomei –« sie erschrak – »Kardinal – ist er tot?«
»Der grimme Bär ist in unsern Händen,« beruhigte sie lächelnd Giambattista. »Er wehrte sich mit Riesenkräften. Ihr rittet also gestern abend –«
»Unter dem Vorwand, das Apostelgrab in San Paolo zu besuchen. Tolomei mit zwei Knechten hatte ich vorgeschickt. Er erwartete mich bei San Lorenzo, hier jagten wir nach Nord auf die Via Flaminia und von hier in das Dunkel.«
»Ohne Ziel, planlos, Donna Tiziana?« fragte der bestürzte Kardinal.
Sie schüttelte das Haupt und ihre Augen glänzten. »Ich wollte Nepi erreichen, wo ich einen Unterschlupf finden konnte bei dem Meier der Borgia. Dann wollte ich über Viterbo nach Siena flüchten, wo die Verwandten meiner verstorbenen Mutter ihr Haus haben. Dort wäre ich fürs erste geborgen. Knapp vor Cesano brach das Unwetter los, wir gerieten, verirrt, in die Höhen von Bracciano – ich hielt mich kaum mehr in dem Sattel – da ereilte uns das Schicksal.« Die Erinnerung an die ausgestandene Angst durchschauerte ihren Leib.
»Ich löse mit Eurem Willen die Gewalt, zu der ich kein Recht besitze,« sagte der Kardinal warm, indem er sich erhob. »Beschließet selbst, wohin Ihr Euch wenden wollt, um sicher zu sein vor Euern Feinden.«
»Sind sie nicht auch die Euern?«
»Savelli und Colonna sind die Feinde meines Geschlechts, nicht die meinen. Die Geschichte der Orsini trieft von Haß, der zwischen ihnen und den Colonna eine Kluft öffnete, die nur selten geschlossen wurde. Über zerbröckelndes Menschentum und über Menschenhoheit hinweg ziehen sie die Lust an Feindschaft und Haß groß und kennen keinen andern Triumpf als den zu herrschen, keinen andern Ehrgeiz als den, die Ersten in Rom zu sein. Wer tiefer in die Menschenseele geblickt und dem Erlöserwerk von Golgatha auf den Grund geschaut hat, hat es verlernt, solchem Ehrgeiz nachzujagen.« Er senkte das Haupt, fuhr jedoch gleich darauf freier fort: »Eure Flucht wird in diesem Augenblick in Rom entdeckt sein, die Savellireiter sind hinter Euch vielleicht her, sie werden die Colonna zu Hilfe rufen, und die Hetzjagd beginnt. Meine Leute hier könnten leicht plaudern, ich werde meine Gäste wohl unter Eid nehmen, aber wer schaut in die Abgründe einer Menschenseele? Seht – Euer Arm bedarf der Pflege. Ich will Euch nicht drängen, aber entscheidet selbst, ob Ihr in Eurem Zustand nach Siena reisen könnt. Die Wege sind unsicher und schlecht, die Straßen füllen sich mit Pilgern, die zur Jahreswende nach Rom wallen. Auf Bracciano könnt Ihr aber auch nicht bleiben. Wir müssen trachten, Euch geschickt hier wegzubekommen. Es muß aussehen, als hätten wir Euch nach Rom oder Siena befördert, in Wahrheit aber –« Er stockte.
Tiziana aber riß in ängstlicher Spannung den Oberleib empor, den Schmerz verbeißend. »Ihr überlegt –?«
»Verscheucht jedes Mißtrauen, Donna Tiziana,« sagte Giambattista mit herzlicher Wärme. »Ich biete Euch Gastfreundschaft auf Monterotondo an.«
Tiziana de' Calvi sah ihn mit den großen dunklen Augen verwirrt an.
»Unter der Sorge von Mutterhänden soll Eure Gesundheit dort erblühen. Kein Mensch wird wissen, daß ich eine Tiziana de' Calvi beherberge. Ihr wechselt nur den Namen Eures Geschlechts mit dem der Malaspina. Das Geschlecht ist weit verzweigt und ich habe viele Freunde dort.«
»Kardinal – was – wagt Ihr? – was ich?« Der Widerschein des Kaminfeuers überflammte die heiße Erregung ihres Antlitzes.
»Es ist die Freude an einem Samariterwerk,« sagte der Kardinal. »Jeder Eurer Atemzüge soll im Bewußtsein Eurer Freiheit getan werden.«
Tiziana löste langsam, feierlich ihre angstbedrückten Glieder. Es war, als schritte sie jetzt in ein neues Leben. Leise glitt das Tuch von ihren Schultern und raffte einen Teil der herrlichen Haare mit sich, die sich nun wirr über die Achseln warfen. Dann sagte sie mit beschwerter Brust: »Kardinal – man kennt Euch in Rom als einen sonderbaren Schwärmer vor Gott und der Menschheit, aber auch als einen edelherzigen Priester. Ich traue Euch. Nehmt das Wort in seiner ganzen Schwere, denn es gilt viel in dieser Zeit, die ihre Geschichte mit Blutbuchstaben schreibt. Die römischen Kardinäle haben nicht immer so gehandelt, daß sich ein blindes Vertrauen rechtfertigen ließe. Aber ich will's gerne erproben, ob die Tugend ihre Freistätte auch einmal unter dem Purpurmantel gefunden.« Sie senkte errötend das Haupt.
»Jede Enttäuschung Eurerseits würde ich mit dem Verlust meiner Gewissensreinheit bezahlen.« Er streckte ihr mit leichtem Beben die Hand hin, die sie rasch ergriff. Einen Atemzug lang lagen die Hände wie zu einem Treubündnis ineinander. Dann sagte der Kardinal freier: »Noch eins, Donna Tiziana. Ich muß zu den Adventfeierlichkeiten nach Rom und werde Euch schwerlich nach Monterotondo das Geleit geben können. Dennoch müßt Ihr sicher reisen. Es ist ein junger Ritter hier, der Euch Kavalier sein wird und zugleich mein Gast auf der Burg wie Ihr.«
»Wer ist der Mann?« fragte Tiziana mit leichtem Stirnrunzeln.
»Ein Sizilianer, Marcello Chiaversa aus Taormina, blutjung, noch ohne Flaum. Er wird Euch Gesellschaft leisten auf der Burg, ist im Pindar und Virgil zu Hause, ist selbst ein Vertriebener und darum doppelt tauglich, mitfühlend Euer Unglück zu verstehen.«
Ein fraulicher Ernst lag auf ihren Zügen. »Ich lege mein Geschick ganz in Eure Hände.«
»Habt Dank, Donna Tiziana.«
»Nur meine Augen sind so schwer. Nun muß doch bald der Morgen da sein.«
»Schlummert tief in ihn hinein.«
Ein leichtes Lächeln flog zum erstenmal über die reinen, schönen Züge. Das Flackern der Holzscheite hatte aufgehört. Leise summten die Windstöße im Kamin. Tizianas Augen tranken gierig den ersten Dämmerschein des Morgens.
»Schlaft wohl!« Der Kardinal streckte ihr die Hand hin. Bei der Tür warf er noch einen Blick zurück. Er fing ihr Bild im Spiegel auf, von den leisen Morgenrosen verklärt. Ein friedlicher Schimmer hatte sich auf ihren Wangen entzündet. Zu ihren Häupten flammte das Gold eines gekreuzigten Nazarenerleibes auf.
 Ein strahlender Wintertag. Rom liegt in fiebernder Erregung. Durch die Porta Flaminia wälzt sich der unabsehbare Zug der Pilger zum Fest der Jahrhundertwende.
Ein strahlender Wintertag. Rom liegt in fiebernder Erregung. Durch die Porta Flaminia wälzt sich der unabsehbare Zug der Pilger zum Fest der Jahrhundertwende.
Heute wird Papst Alexander VI., der entsetzliche Vikar Gottes, die goldne Pforte von Sankt Peter mit dröhnendem Hammerschlag öffnen, um den bußfertigen Sündern, die aus aller Herren Ländern zusammenströmen, den Weg zum erbarmenden Himmel zu zeigen. Heute ist Weihnachtstag. Die Pilger begrüßen der Sonne Strahlendiadem auf den Knien wie die Erscheinung einer Riesenhostie, die des Herrgotts unsichtbare Hand ihnen entgegenstreckt. Über die langobardische Ebene und den Apennin haben sich die Massen unter den Wehrufen des Misericordia herabgewälzt in die heilige Stadt, zum heiligen Dom. Und »Misericordia!« schreien die unheimlichen Flagellanten, die setzt wie trunkne Bacchusknechte der Sonne entgegenwanken, den Rumpf entblößt, auf dem die Striemen der Geißelung glühen, das Haar verwildert, das Gesicht von Angst verzerrt. Reihenweise schreiten sie durch die staunende Menge, werfen sich vor dem Riesentor der Santa Maria del Popolo in die Knie und peitschen mit den in der Sonne aufblitzenden Geißeln ihre Leiber. Und hinter ihnen die Scharen der fremdländischen Waller, Franzosen, Provençalen, Deutsche, Polen, Ungarn, Spanier, Böhmen und was sich sonst an glaubenstiefen Völkern zusammengeschart hat in heiliger Sehnsucht, die geweihte Apostelstätte zu sehen und Buße zu erlangen vor den Altären der sieben Hauptkirchen. Seit Monden war der Ruf der römischen Kurie an alle Sünder der christlichen Welt ergangen, alles horchte erlösungsgierig auf die mahnenden Worte der Bettelmönche, die den großen Ablaß verkündeten, alles begaffte die seltsamen Züge der Pilger, die sich durch die Dörfer der Alpen nach Süden wälzten wie riesige Herbstschwärme von Zugvögeln. Schauer der Reue hatten sich ihrer Herzen bemächtigt, inbrünstige Gebete stiegen allnächtlich aus bedrängten Seelen empor, und die Glocken der gotischen Kathedralen und der kleinen Bergweilerkapellen riefen die schwer tragenden Büßer nach Rom.
Seit Wochen wimmelte es auf den Straßen von bunt zusammengewürfelten Haufen. An den Söldnerlagern vorbei, aus denen die Spottlieder erschollen, zogen die Trupps nach Süden. Mitten in die Kleinkriege der Städte, in die Fehdezüge der kleinen Tyrannen Italiens hinein drang der Friedensruf aus dem Vatikan, und er machte die wilden Herzen der Krieger einen Augenblick lang aufhorchen. Aber dann ging die Belagerung von Forli ihren schleppenden Gang weiter. Das Morden, Plündern, Fressen, Saufen, Huren und Spielen war zur Gewohnheit geworden, und der Glockenruf zur Buße verhallte achtlos im Ohr der Wildlinge Cesares. Sie wußten, der Papst war selbst der größte Mörder, der habgierigste der Plünderer, der abgefeimteste aller Lüstlinge, nur waren seine Taten vom leuchtenden Mantel der Weltoberherrlichkeit verhüllt. Aber den rissen ihm die Mietlinge in den Feldlagern hohnlachend herunter: Papst Alexander, du weißt, wie man's macht! Und wir machen's dir lustig nach, so gut wir's können! Laster und Gewalt waren die Devise im Schilde der Söldlinge.
Doch die Pilger an der Porta Flaminia bewegten andere Gedanken. Für die meisten war der Papst noch das unangreifbare Idol der Glaubensherrlichkeit. Um seinen Segen zu erhalten, den Saum des Schweißtuches der Veronika zu küssen, die Spitze der heiligen Lanze zu erblicken, liefen sie sich gerne die Füße wund und sangen sie sich die Kehle heiser in den rührenden Gesängen des Stabat mater. Und heute, am Tage der Geburt des Erlösers, sollte ihnen das höchste Glück zuteil werden, durch die goldne Pforte einzuziehen in den heiligen Tempel der Christenheit und im goldnen Glanz unzähliger Lichter die Vorschauer des Paradieses zu genießen. Das Gebet vor dem Apostelgrab mußte sie entsündigen, der Anblick der Reliquien in den sieben Hauptkirchen Roms ihnen Gnade bringen, denn durch fünfzehn Tage sollte ein jeder von ihnen in inbrünstigem Gebet vor den Altären und Reliquienschränken liegen, um die Absolution zu erhalten. Und sie mußten Gold und Schmuck niederlegen auf den Opfertischen, um sich die Seligkeit zu sichern. So sangen es die Ablaßkrämer auf den Landstraßen, die die Almosen für den Papst einsammelten.
»Der Papst gibt uns unser Geld wieder zurück!« rief mitten im Schwarm der Pilger ein halb verhungertes Bettelweib.
Ein Schmied mit halbnackter, zottiger Brust bestätigte das Wort. »Wißt ihr es noch, bei seiner Thronbesteigung hat er gesprochen: ›Gold und Silber ist nicht für mich, was ich aber habe, gebe ich euch!‹ Und er warf das Geld vom Stuhl unters Volk!«
Da gab ihnen ein dickgefressener Söldner eine andre Meinung hin. »Haha! Das Papstgeld rollt an einem Tage unters Volk und an dreihundertvierundsechzig Tagen zieht er's ihnen wieder aus der Tasche.«
Das wühlte wie ein Stock den Ameisenhaufen auf. Die Leute schnellten zusammen, Fäuste ballten sich, die Pilgerstäbe schwangen in der Luft, Schreie gellten, und im Nu war der wüste Geselle umringt. »Er lästert den Papst! Ein Ungläubiger! Auf die Knie! Buße!«
Da erscholl vom Kirchentor von Santa Maria del Popolo der Trauerchor » Dies irae«, das schauerliche Klagegebet des Thomas Celano. Deutsche Mönche sangen es, mächtige Gestalten in schwarzen Kutten. Der Aufruhr erstickte.
Immer neue Züge drängten sich an der Kirche vorbei. Die sonderbarsten Gestalten hoben sich aus der buntfarbigen Menge ab. Prälaten zu Pferd, Kardinäle im Glaswagen, Herren der päpstlichen Kammer, Edelleute in Samt und Seide, die Frauen an ihrer Seite im kostbarsten Staat. Daneben die abgehärmten Gestalten der müden Fußwanderer in zerrißnen Schuhen und Kleidern, barhäuptig, die kahlen Scheitel der Sonne ausgesetzt, Weiber mit megärenhaften Gesichtern, schreiende Kinder am Arm, hinter ihnen die Männer mit Karren, auf denen armselige Hadern lagen, dazwischen die Bettelmönche mit den emporgehaltenen Händen, in denen die weißen Ablaßzettel in der Sonne blinkten, die würdigen Pönitentiare der Kammer zu Pferd, die die Absolvierung der Gläubigen im Stamm des Papstes vorzunehmen hatten, dann die in bunten Harlekinkleidern einherstolzierenden Spaßmacher, die in den düstern Büßerton der Menge die helleren Farben der Weltfreude warfen, und die ungezählten in Lumpen gehüllten Bettler, für die so mancher Lazarusbrocken von der Ablaßtafel fiel. Das alles kribbelte, verschlang sich und drängte einer einzigen Richtung zu, nach der heiligen Basilika von San Pietro. Aus allen Kirchen schollen die Chöre der Mönche, das klagende Intemerata, Psalmen und Litaneien, halb gesungen, halb gesprochen. Sie erregten die Herzen bis zum Fieberwahn.
Die Paläste der Kardinale bildeten das Objekt allgemeiner Neugier. Manche unsaubere Liebesgeschichte sprudelte dabei von den flinken Lippen der erklärenden, geldhungrigen Bettelbrüder. Da wohnte die Kurtisane des Kardinals von San Giorgio, hier die des Kardinals von San Elemente, und der Palast der Fiammetta Pandolfi, der verstoßenen Geliebten des Cesare Borgia, wurde ebenso bewundert wie die Säule des Mark Aurel. Vor dem Palast der Lukrezia staute sich die Menge, alles wollte die Papsttochter sehen und ihren zweiten Gemahl, den schönen Alfonso, Herzog von Bisceglia, der seit einem Jahr an Stelle des vom Papst vertriebnen Giovanni Sforza das zweifelhafte Glück hatte, der Schwiegersohn des Herrn der Christenheit zu sein. Aber hinter den Fenstergittern blieb es geheimnisvoll still.
Da lief es von Lippe zu Lippe: der Papst hat eine Tochter. Eine Herzogin. Und man munkelte dunkle Gerüchte weiter von einem schönen Jüngling, der vor zwei Jahren an dem Herzen der Lukrezia Borgia die Liebe studiert haben sollte, bis ihr eigener Bruder Cesare ihn mit einem Degenstoß von der schwindelnden Höhe der Fürstenliebe herabgestürzt. Und sie nannten den Namen des Dichters Serafino d'Aquila. Auf dem Grund des Nemisees läge sein frühlingsschöner Leib, von den Nymphen der Diana behütet, unverwesbar und hold wie ein Marmorbild von Künstlerhand. Und von einem Söhnchen Rodrigo flüsterte man sich zu, das die Herzogin zärtlich liebe und dessen Vater ein rätselhaftes Etwas, halb Satan, halb heidnischer Gott sei. Vor einem Mond war der Knabe geboren worden, und Novemberkinder, das wisse man ja, hätten immer zwei Väter, von denen der eine bei der Mutter lockende Karnevalslieder gesungen.
Die Menge gaffte den Palast an, und einer, der es wußte, zog die neugierigen Köpfe an sich und erzählte: »Alle Pforten da drinnen sind von Gold, das Bett der Lukrezia von himmelblauem Samt, die Wiege des kleinen Rodrigo mit Seide und Brokat behängt. Ich war damals bei der Taufe, als ich noch Lakai bei der verwünschten Herzogin war. Sechzig römische Edeldamen waren anwesend, mein Freund Gasparo war Schildknappe und trug das goldne Salzfaß, die Büchse mit der Moschusseife und das Handtuch.«
»Stillt sie das Kind selbst?« erkundigte sich eine zaundürre Lombardin.
Der gewesene Lakai grinste. »Ei, ei, so eine Herzoginmutter muß feste Brüste haben, aber nicht für das Kindergeschäft – hihihi.«
In wenigen Augenblicken war der Ehrenname Frau, den diese Herzogin unter Leiden und Seufzern trug, zerrissen.
Und nun wurde auch gleich der Papst selbst zerzaust. Jetzt wußte man's ja, wohin die Ablaßgelder kamen. In diesen goldenen Palast. Die fremden Pilger bekamen plötzlich Augen und Ohren für recht weltliche Dinge. Und sie horchten der neuen Mären von Cesare Borgia, dem Papstsohn. Ein Lederhändler warf ihnen sein Wissen vor die durstigen Ohren. »Er lagert vor Forli und spitzt auf die Katharina Sforza, die ihre Burg verteidigt. Ihr kennt die Katharina nicht? Hui! Hat einmal schon ihr Schloß verteidigt gegen die Orsi, die ihre Kinder gefangen hatten. Und als man ihr gedroht, ihre Kinder zu ermorden, wenn sie das Schloß nicht übergäbe, öffnet sie ihren schönen Schoß und ruft: Seht, Gott hat mir das Mittel gegeben, andre Kinder zu gebären! Und die Orsi warfen sich vor so viel Heldentrotz in den Staub. Aber ob der Cesare Borgia vor ihrem Geburtswerkzeug auch zu Kreuze kriechen wird? Er hat schönere Weiber genossen.«
»Ja, ja,« mischte sich ein Schuster ins Gespräch, »über den etruskischen Apennin ist gestern in gläserner Karosse seine Kurtisane ins Lager gefahren, um Weihnachten mit ihm zu feiern.«
»Wer ist das?«
»Hm – heut die schwarzäugige Elisabetta, morgen die blauäugige Rinalda, immer eine andre. Sie begegnen einander oft auf der Straße, die eine fährt hin, die andre zurück. Sein schöner Davidleib muß Nahrung haben. Oft liegen die Buhlerinnen dutzendweise im Quartier, eine Meile vor dem Lager.«
»Man spricht von einer Fürstin, die er geprügelt hat,« zischte eine Megäre aus Bologna hinein, die nach Rom gekommen war, ihren Ehebruch mit einem Apotheker vor dem Apostelgrab zu bereuen.
»Ach, die Sancia, die Fürstin von Squillace! Die Frau seines Bruders Don Jofré! Die hat er nach Neapel geschickt. Er macht es sonst kürzer und befördert Damen, die ihm lästig geworden sind, in den Palast aus Erde, wo die Würmer am dritten Tag ihren Besuch machen.«
Eine Frau kreischte entsetzt auf.
Der Lederhändler duckte schnell seinen Kopf hinter die Schultern der Horchenden. »Pst! – da drüben sehe ich verdächtige Gesichter. Man darf gewisse Dinge nicht zu laut in den Wind schreien, die Schergen des Herzogs von Valentino hören Käfer nagen.«
Posaunende Reiter schafften sich einen kümmerlichen Weg durch die Pilgermassen. Auf dem Sankt Petersplatz hielten sie still und lasen die Jubiläumsbulle des Papstes den aufhorchenden Leuten vor. Als die Schlußformel ertönte, warf sich das Volk in die Knie und rief den Namen der Gottesmutter in das Blau und Gold, das den Wintertag durchleuchtete.
Nun hoben sich die staunenden Augen der Beter zur Loggia empor, auf der heute abend der Papst vor dem Volke erscheinen würde. Und wie glücklich waren die, die schon jetzt durch die Bronzetüren in das Heiligtum eindringen konnten. Vor den Grabmälern der Päpste, der Petrusstatue, dem Bildwerk der Pietà drängten sich die andachtslosen Fremden, darunter viele Florentiner Künstler.
Einer dieser schönheitsfreudigen Menschen stand vor dem Grabmal des Sixtus IV. Er hatte ein geistvolles feingeschnittenes Gesicht, und trotz seiner dreißig Jahre trug sein Antlitz noch die Spuren einer frühen Jünglingszeit, doch lag ein klösterlicher Ernst in seinen Zügen, so daß sich sein Kopf gar anmutig in ein Fresko des frommen Fra Angelico hätte einfügen lassen. Nur die steil herabfallenden Schultern und die eingefallne Brust gaben ihm ein etwas linkisches Aussehen. Er hörte eben zu, wie ein neben ihm stehender Priester in fanatischer Weise einem Haufen maulaufsperrender Frauen das Wesen der Kirche erklärte. »Die Kirche ist im Gleichnis das Firmament, liebe Frauen, der Papst die Sonne, der König von Frankreich der Mond, der Tag ist die Klerisei, die Nacht das Laientum, die Sterne sind die Bischöfe und Äbte. Kann das Firmament einstürzen, die Sonne in nichts zergehen? Nimmer! Sie sind ewig.«
Der junge Mann wandte sich verstimmt ab und schickte sich eben an, die schönen Voluten des Paradebettes Sixtus' in sein Gedächtnis zu zeichnen, als sich eine Hand auf seine Schulter legte und eine ruhige Stimme ihn aus der Versunkenheit riß. »Seid gegrüßt, Baccio de la Porta.«
Der nachdenkliche Künstler sah dem Störenfried ins Gesicht. »Michelangelo – Ihr?« Und er drückte dem Bildhauer bewegt die Hand. »Kommt, führt mich zu Eurer Pietà.«
»Was macht mein Florenz? Wie kommt Ihr her?« fragte Buonarroti.
Baccio zog den Landsmann durch die zusammengedrängten Massen nach der französischen Kapelle. Er hatte mit Michelangelo eifrig in Florenz den Masaccio studiert, und gar manches seiner charaktervollen Bilder schmückte eine Kirche. Der strenge architektonische Aufbau seiner Schöpfungen hatte den skulpturellen Geist Michelangelos angezogen und beide hatten einander gefördert. Und dann war noch ein Gegenstand dagewesen, der sie verband. Das waren die Predigten des Savonarola, nun für die meisten verhallt, den beiden Künstlern aber ins Herz geprägt mit glühenden Stempeln. Das gemeinsame Schwärmen für die flammende Inbrunst des Dominikanermönchs hatte sich an stillen Feierabenden in den Höhenwäldchen von Florenz zu einer Art christlich-platonischer Andacht erhoben.
Nun standen beide vor Michelangelos erhabner Schöpfung. Baccio legte dem Bildhauer die Hand auf die Schulter. »Welch ein Aufstieg von dem Bacchus bis zur hehren Gottesmutter! Ach, Michelangelo, ganz Florenz erwartet, daß Ihr zurückkehrt, um Euer Talent in den Dienst der treuen Vaterstadt zu stellen.«
»Was macht der Geist Savonarolas?« Scheu kam's ihm von den Lippen.
Der Maler verfärbte sich. »Die lebendige Hülle ist nicht mehr, die Wirkung des leblosen Wortes ist schwach.« Die schönen langen Wimpern schlossen sich schwermütig über den Augen.
Michelangelo wollte ihn fortziehen von der Pietà, deren Anblick ihn immer merkwürdig bitter stimmte. Er fühlte, daß die Steingruppe noch nicht Vollendung bedeutete. Er spielte sogar mit dem Gedanken, die Gruppe einmal zu zertrümmern.
Baccio de la Porta bestaunte die Jugendschönheit der Maria. »Jung, schön, ein Gebilde des Geistes, über das sie in Florenz die Köpfe schütteln, denn der Sohn überaltert die Mutter.« Es klang beinahe wie ein leise tastender Vorwurf.
»So hab' ich's gewollt,« antwortete Michelangelo mit harter Betonung. »Die Gottesmutter war die keuscheste aller Frauen. Diese aber bewahren sich lang ihre Jugendlichkeit. Kommt noch die Gnade Gottes hinzu, die ihr eine unvergängliche Reinheit und Jungfräulichkeit der Welt geschenkt hatte. Endlich fordert das ungeschriebene Gesetz der Schönheit, das marmornen Figuren innewohnt, daß man verkläre und verjünge, was Gott wert gehalten hat, der Menschheit für ewig als Vorbild zu schenken.«
»Warum habt Ihr dann nicht auch Christus verjüngt?«
»Er war im Namen Gottes Mensch geworden. Als solcher hatte er alles Leid der Menschheit auf sich genommen. Für solche Taten gehört Reife und geistige Kraft, die der Jugend nicht gegeben sind. Man würde ihm das Erlösungswerk nicht zutrauen, wenn er als ganymedischer Jüngling dargestellt werden würde. Wo malt Ihr jetzt?« fragte er ablenkend, während sie beide den Weg ins Freie suchten.
De la Porta war überrot geworden. »Meine Hand feiert. Ich habe meine Bilder – verbrannt.«
»Mensch!« rief Michelangelo aus. »Aus Selbsterkenntnis? Aus Verzweiflung?«
»Aus Verzweiflung über meine menschliche Geringwertigkeit. Es ist alles eitel. Der Ruhm vor allem. So lehrte es Savonarola. Und darum habe ich meine Bilder verbrannt.«
Michelangelos Stirn hatte sich schwer verrunzelt. »So weit könnte ich's nicht treiben.«
Baccios Antlitz bekam einen herben Zug. »Ihr wißt, wie ich Leonardo da Vinci vergötterte, bis ich mich selbst fand und mein Eigenstes gab. Aber ich wurde Savonarolas Freund. In jener unseligen Palmsonntagsnacht geschah's. Noch am Abend predigte Savonarola in San Marco und sagte alles vorher, was kommen würde. Die Arrabbiati drängten vom Dom nach San Marco, wo sich die Piagnonen um Savonarola geschart hatten, darunter die edelsten Namen von Florenz. Zu den Waffen! gellte überall der Ruf. Und man begann die Klosterkirche zu stürmen, deren Tore verrammelt, deren Mauern befestigt waren. Savonarolas treue Mönche, den Panzer über der Kutte, die Arkebuse in der Hand, verteidigten das Kloster mit Löwenmut. Savonarola hielt das Kreuz unter seine Freunde und beschwor sie, ihn auszuliefern. Aber wir rissen ihn zurück und schossen unsere Kugeln in die stürmenden Arrabbiati. Eine schwüle Nacht brach an, in den Pulverdampf mischte sich der süße Duft der Rosen aus dem Klosterhof. Auf unsere Zunge legte sich ein salziger Geschmack wie Blut. Plötzlich heulte es draußen auf und greller Schein flammte auf. Die Torflügel brannten, die Palastgarde stürmte herein, Schüsse fielen, zwei bärtige Kerle ergriffen Savonarola und schafften ihn fort mit zweien seiner Brüder.«
»Ärmster! Ärmster!« jammerte Michelangelo.
»Die Garde schützte ihn vor der Wut des Volkes. Die Mönche eilten hinaus, zu helfen, zu retten – nicht mehr zu kämpfen, denn ihr liebstes Kleinod war verloren. Die Wut der Arrabbiati verkühlte, als Savonarola gefangen war. Um die törichten Mönche kümmerte sich keiner mehr. Aber meine Gedanken brandeten wie ein Meer an meine Gehirnschale. Ich schleppte mich zu Füßen des Gekreuzigten im Klosterhof hin und schwur dort, die Sache Savonarolas zu verfechten und die irdische Eitelkeit in mir zu ertöten. Ich wollte nicht mehr liebäugeln mit der Freude an der Farbe, ausgelöscht sollte die Erinnerung an frohe Schaffenskraft und heitre Arbeitsstunden sein und nur der Kreuzweg Savonarolas sollte mir zum Pfad des Lebens werden. Ohne Herzangst warf ich die Leinwand, auf der ein großes Golgatha prangte, in die letzten Flammenreste des Klostertors.«
Michelangelo ergriff mit Wucht den Arm des Malers. »Guter, Guter – aber ein Tor seid Ihr doch! Die Gabe Gottes wegzuwerfen in einer Wallung des Gemüts! Die Reue trieb Euch nach Rom, nicht wahr?«
Baccio de la Porta schüttelte das Haupt. »In Sankt Peters Dom gelobte ich heute, im Klosterfrieden von San Marco meine Tage zu verbringen.«
Michelangelo entsetzte sich. »Verblendeter, Ihr wollt niemals den Pinsel –?«
Baccio ergriff krampfhaft die Hand Michelangelos. »Das hab' ich nie gelobt. Das Kloster soll der Kunst kein Hemmnis, sondern ihr Behüter sein. Unter der Weihe des Kleides hat Fra Angelico seine Bilder gestaltet, ein Weltleben hätte ihn unsicher gemacht und ihm alle Anmut genommen.«
»O, über den Wahn Eures Gottesgelöbnisses!« rief Michelangelo erzürnt aus. »Ihr wollt als Gottesmann dem kräftigsten Antrieb des Künstlerherzens entsagen, dem Neid!?« Da war's heraus.
»Mit Freuden will ich's tun.« Begeisterung wehte aus seinem Innern.
»Dann seid Ihr kein Künstler gewesen.« Mit unverhohlener Bitterkeit stieß Michelangelo es heraus. »Dem Neid entsagen! Kann das ein Schaffender? Er ist die Peitsche, die unser zweifelndes Können aufstachelt zur Tat, wenn alles dunkel und unheimlich in uns wird. Der Neid hetzt uns in das heiße Wollen, das zum Können wird. Habt Ihr nie die Lust empfunden, einen andern Eurer Art zu überflügeln? Wer nicht das Blut in sich wallen fühlt beim Anblick eines fremden Werkes, das größer ist als das seine, ist kein Künstler. Ghirlandajo hat mich aus seiner Werkstatt gejagt, weil er fühlte, daß mein Schaffen ihm gefährlich werden könnte. Das war ein richtiger Künstler. Ich hätt's nicht anders gemacht. Und so ist's dem Squarcione ergangen mit dem jungen Mantegna, und dem Donatello mit dem Verrocchio.«
Sie standen vor dem Dom. Riesenhaft hob sich die Fassade empor, die Säulen schimmerten im Sonnenglanz.
Baccio wurde es heiß im Gemüt, die Ehrlichkeit drängte auf seine Zunge. »Angesichts dieses Heiligtums soll keine Lüge mein Herz entstellen. Ja, ich habe sie empfunden, die Stachel der Eifersucht –«
»Seht Ihr!« triumphierte Michelangelo. Nun, glaubte er, würde der Neid nach seiner Pietà züngeln.
Aber Baccio sprach: »Im Dom zu Orvieto.«
Michelangelo klappte zusammen. Gelb war sein Gesicht. »Im Dom zu –?«
»Da krampfte sich mir die Brust zusammen, ja. Ich sah dort einen Greis an der Arbeit, heiter den Pinsel führend, und vor ihm das Gewirr gigantischer Gestalten, die Himmel und Hölle in fürchterliche Unruhe bringen. Ich sah Luca Signorelli an seinem jüngsten Gericht arbeiten.«
Michelangelos Zähne knirschten leise aneinander. »Signorelli? Keine große Pinselführung, aber der Mensch zeichnet gut. Ich kenne nur sein Mosesbild in der Sixtinischen Kapelle.«
»Bewegungslos gegen die Wandtafel in Orvieto. O Signorelli! Er, nur er und Leonardo!«
Durch Michelangelos Leib ging es wie Speerstiche. »Ja – Leonardo! Sein Können stört mir den Schlaf. Ich weiß es, Florenz vergöttert ihn. Seht, da kommt ein herrlicher Zug. Es ist der Kardinal Giovanni de' Medici. Wenn er aus seinem Palast mit seinem Gefolge ausreitet, glaubt man, ein König ziehe daher.«
»Wahrhaftig, er ist es,« lächelte Baccio. »Ich sehe ihn noch, wie er, dem Volkszorn gegen die Medici zu entgehen, als Mönch verkleidet aus San Marco flüchtete. Die Zeit hat ihn dicker gemacht. Liebt er noch die Kunst?«
»Sein Hof wimmelt von Künstlern, aber er hält sie nur aus Gnade und Freude an dem Weihrauch, den sie ihm streuen. So erzieht er sie zu Schmeichlern.«
»Er ist häßlich wie ein Frosch,« sagte Baccio lustig. »Wer ist der ernste Greis neben ihm? Zwei Schildknappen führen sein Roß –«
»Es ist der blinde Brandolini Lippus, sein Lieblingssänger. Der häßliche Zisterzienser auf dem Falben ist Fra Mariano Fetti, der Spaßmacher des Kardinals. Man sagt ihm nach, er lese das Meßbuch von rückwärts. Übrigens ein Freund der Maler, den Ihr brauchen könnt. Und so geht die Reihe fort. Alles sogenannte Künstler oder Narren.« Er war neuerdings in Gefahr, schmähsüchtig zu werden, und brach seine Erklärung ab.
Die Sonne schien heiß, die Massen auf dem Platz strömten einen Schweiß aus, der die Luft mit Gestank erfüllte. Michelangelo lud den Landsmann ein, mit ihm im Haus »zur Sonne« zu speisen. »Heute abend könnt Ihr mich nach dem Hospital San Spirito begleiten, wo ich in der Leichenkammer anatomische Studien mache. Ihr könnt dabei lernen.«
Schrille Evvivarufe hielten sie vor dem neuen Schenkentor zurück. Durch die Menschenmenge fuhr in feierlichem Tempo eine Prachtkarosse, von vier goldbezäumten Schimmeln gezogen. Neben dem Wagen ritten Lanzenknechte und Schildknappen. Das Volk schwenkte die Mützen. Aus der nahen Universität kamen die jungen Skolaren herbeigelaufen, gerade aus dem Hörsaal des Kopernikus; sie wollten sich an dem irdischen Stern erquicken, der jetzt vor ihren Augen meteorartig vorüberflog.
»Was ist das?« fragte Baccio neugierig.
»Es ist die schönste Frau Roms –« Michelangelo stockte. Ein nachtschwarzes Haar dunkelte plötzlich in sein Preislied hinein. »Man nennt sie die schönste Frau Roms,« berichtigte er sich schnell. »Es ist die Herzogin Lukrezia Borgia, des Papstes natürliche Tochter. Man muß sie gesehen haben, wenn man in Rom gewesen sein will. Drängt Euch heran.«
Baccio gebrauchte seine Ellbogen. Da sah er sie. Die blonde, berückende, traurige Lukrezia. Die lüsternen Lügen Roms vermochten ihrer Schönheit nichts anzuhaben. Und neben ihr saß ihr Gatte, der adonische Alfonso von Bisceglia, mit den zwei Kinderaugen voll Schwermut, die in den erregten Bienenkorb Rom starrten. Wie zwei griechische Marmorbüsten zogen sie an den erstaunten Augen des Malers vorbei.
Eben brausten die Mittagsglocken über das bußfertige Heer der Pilger.
 Durch die beginnende Dämmerung rollten die Karossen der Kardinäle dem Vatikan zu. Dunkle Züge von Klerikern, Mönchen und Bruderschaften wälzten sich aus den Gassen des Borgo dem Petersplatz zu, wo die päpstlichen Banner auf hohen Triumphsäulen flatterten. Ein Wald von brennenden Kerzen bewegte sich durch das brausende Menschengewoge. Alles drängte nach der goldverzierten Marmorpforte an der Kapelle der heiligen Veronika im Sankt Petersdom.
Durch die beginnende Dämmerung rollten die Karossen der Kardinäle dem Vatikan zu. Dunkle Züge von Klerikern, Mönchen und Bruderschaften wälzten sich aus den Gassen des Borgo dem Petersplatz zu, wo die päpstlichen Banner auf hohen Triumphsäulen flatterten. Ein Wald von brennenden Kerzen bewegte sich durch das brausende Menschengewoge. Alles drängte nach der goldverzierten Marmorpforte an der Kapelle der heiligen Veronika im Sankt Petersdom.
In der Papageienkammer versammelten sich die Kardinäle, um die schweren weißen Kerzen zu empfangen, mit denen sie im Gefolge des Papstes zum feierlichen Amt der Pforteneröffnung schreiten sollten. Als es auf fünf Uhr ging, trat der alte Zeremonienmeister Burckhardt in die dritte Kammer, deren Tür in die Privatgemächer Alexanders führte, öffnete diese und verneigte sich tief vor der greisen Gestalt im Scharlachstuhl, die sich jetzt erhob und die kalten, klaren Augen auf den Eintretenden richtete. Aber das Eis dieser Blicke erzeugte neue Hitze in dem Leib des Zeremonienmeisters. Leise stammelte er: »Eure Heiligkeit, die Stunde ist gekommen.«
Der Papst griff wortlos nach dem kleinen, zierlichen Stock, auf den er sich zu stützen pflegte, und folgte Burckhardt in die Papageienkammer, wo sich die Kardinäle vor ihrem Herrn stumm und tief verneigten, um dann einzeln zum Handkuß zugelassen zu werden. Die purpurnen Gewänder bekamen unter dem Schein der Kerzen einen schillernden Glanz. Der Papst warf stutzerhaft wie ein Jongleur den Stock in die Hand Burckhardts und empfing von diesem die Paramente und die dreifach gekrönte, goldflimmernde Tiara. Alexander blickte nur flüchtig in die Reihe der Kardinäle. Als er die Gestalt des spanischen Kardinals Romelino da Ilerda, seines Lieblings, erblickte, lächelte er ihm einen leichten Gruß zu. Dann trat er zu ihm und fragte leise: »Von Riario noch immer keine Spur?«
»Er hatte ein Asyl beim Kardinal Orsini gefunden, floh aber dann nach Toskana.«
»Orsini?« Der Papst winkte den Kardinal aus der bewegten Reihe heraus. Über sein fettes Gesicht glitt ein heitres Lächeln. »Riario war bei Euch?« fragte er harmlos.
Der Kardinal Orsini faßte sich schnell. »Drei Tage, allerheiligster Vater. Am letzten Tage erst beichtete er mir sein Unglück, daß er im Verdacht der Teilnahme an der Verschwörung der Sforza stehe. Darauf riet ich ihm, sich Eurer Heiligkeit reuig zu Füßen zu werfen, und gab ihm Geleite nach Rom. Er zog es jedoch vor, nach Toskana zu flüchten.« Der Kardinal fühlte ob der Lüge keine Gewissensbisse. Er wußte, diesem Borgia gegenüber verlor die Wahrheit ihre Tugendkraft; sie konnte ihm selbst nur zum Verderben werden. Alexander war aus Tücke und Lüge zusammengesetzt und achtete auch beim Gegner keine Tugend.
Der Papst kniff das linke Auge ein und schielte mit dem andern den Kardinal mißtrauisch an. »Ich möchte Euch raten, Eure Gäste sehr scharf zu prüfen. Ich war Euch immer ein sehr gnädiger Herr. Die Orsini sind mir ans Herz gewachsen.« Er log wie immer.
Burckhardt schlug die Zeremonienglocke an. Der Papst reckte seine Gestalt kothurnartig empor und gab den Kardinälen, die jetzt mit den Kerzen in der Hand voranschritten, einen Wink. In der Sala regia wurde er unter einem goldnen Baldachin auf den Tragsessel gehoben und die Treppe hinuntergetragen. Der Lärm der ungeduldigen Menge schlug an sein Ohr. Ein Gefühl grenzenlosen Stolzes schwellte seine kindische, eitle Brust. Nun konnte er die Majestät seiner Weltherrlichkeit entfalten. Eine Gottähnlichkeit überkam ihn. Das Urbi et orbi gewann in seiner Brust die Bedeutung eines Machtspruches, der Ewigkeiten in seinen Bann zog. Auf den Domstufen empfingen ihn die Antiphonen der seraphischen Chorknaben, himmeljauchzende Wechselgesänge, die alle Pilger in die Knie zwangen.
Die Phantasie des Volks spann um den Papst die Zauber der Dämonie, wiewohl die fette Gestalt mit dem feisten Kinn und der leicht gebognen Nase im speckglänzenden Gesicht eher den Eindruck eines gemütlichen Prälaten machte. Aber der Pomp, der sich reliefartig rings um ihn erhob und ihn über sich selbst in eine Sphäre glorioser Bestrahlung emportrug, die leuchtenden Farben und theatralischen Bilder, das himmlische Tönen und Brausen der Gesänge, das Dröhnen der Glocken von allen Türmen der ewigen Stadt, die Weihe dieser einzigartigen Jubiläumsstunde drückten ihm den Stempel der Majestät auf, die die Einbildungskraft der erregten Gemüter ins Göttliche steigerte.
Nun sahen sie ihn, Alexander Borgia! Keinen altersschwachen Greis, keinen geisterhaften Schatten, von des Todes Vorschauern gestreift, sondern eine rüstige, adelig schöne, etwas fette Abrahamgestalt, die die Anwartschaft hatte, sich in ein angenehmes Methusalemalter hineinzusündigen.
Das Volk hätte viel dafür gegeben, noch seinen Sohn zu sehen, den Herzog Valentino – Cesare Borgia! Ihn, um den sich ein Kranz schauervoller, leicht gebundner Legenden flocht, von Blut und Liebe durchwoben. Aber der Herzog lag vor den Mauern von Forli.
Nun reckten sich die Hälse und die Augen quollen hervor. Man wollte den Papst sehen, wie er den silbernen Hammer hob zum Durchbruch der goldnen Jubelpforte. Da setzten die Glocken aus – eine herzbeklemmende Stille legte sich über den weiten Platz – aller Atem stockte – Drei dünne, kurze Schläge – und die marmorne Pforte fiel – eine wohlvorbereitete Theaterdekoration – knirschend auseinander. Der Papst sank auf der Schwelle in die Knie und betete das Miserere.
Dumpf fielen die Glocken ein. Nun trat der Pontifex durch die Pforte in den heiligen Dom. Hinter ihm folgte der ungeheure Zug der Kleriker und Barone. Alles in buntem Feststaat oder im dunklen Kleid der Entsagung. Das Te Deum laudamus ertönte. Die Vesper begann. Ein Meer von Licht verströmte seinen Glanz in die weiten Säulenhallen und umgoldete das Apostelgrab und die Mäler der toten Päpste. Mit sinnverwirrenden Mitteln hatten Künste und Handwerk daran gearbeitet, die monumentale Marmorschönheit des Innern zu zerstören und mit einem Mosaik von Dekorationen, Teppichen, Festons und Heiligenbildern eine Wirkung auf das einfältige Pilgergemüt zu erstreben, die auf jede Andachtserweckung verzichtete. Der Langobarde sollte sein Maul aufreißen vor Erstaunen über die Herrlichkeit des Vorparadieses in Rom, dem Deutschen sollten die Augen übergehen vor Rührung, wenn er aus seiner Waldheimat hergekommen war, die Wonnen der Gottesnähe zu verspüren und zu sehen, wie der Papst, der Verweser des Reiches Gottes auf Erden, den strahlendsten Tempel der Christenheit mit sardanapalischer Üppigkeit ausstattete zur größern Ehre Gottes. Und keiner dachte in stiller Ehrfurcht daran, daß vor 1499 Jahren um diese Stunde ein galiläisches Weib in Lumpen gehüllt in einem Stall ein Söhnlein zur Welt gebracht hatte, um dessentwillen der Papst all den Prunk verschwendete. Die Erinnerung an Marias heilige Wehestunde ging unter im strahlenden Tabernakelglanz.
Als die Vesper zu Ende war, schritt der Papst, in Weihrauch gehüllt, von den Purpurgestalten der Kardinäle begleitet, in die Loggia di benedizione und erteilte der Menge den apostolischen Segen. Das Volk versank in heiliges ergreifendes Schweigen. Hunderte von Fackeln warfen ihre düsterroten Fahnen über die Häupter der Knienden. Als die Glocken einfielen, kam Bewegung in die Menge und die Knäuel begannen sich zu entwirren.
Im Innern des Domes aber reihten sich die bußfertigen Pilger bei den Beichtstühlen an. Sünden, Sünden fielen ab, o welche Sünden! Und Gnade und Barmherzigkeit warfen die Priester ins Volk.
Aber es war eine kurzatmige Reue dieser Kinder Adams. Als die Nacht den Sternenmantel über den Petersplatz breitete, kroch die Verführung aus den Lasterhöhlen Roms heraus und begann ihr zersetzendes Werk. Sie hatte es leicht. Die alten Sünden waren vergeben, man konnte also beruhigter neue begehen. Die von der Bußfahrt ausgehungerten Männer fielen in die Umarmungen der dunklen Dirnen, und die Weiber, die aus Weltenfernen gekommen waren, ihrer Seele Buhlschuld vor den Altären abzuwerfen, ließen sich, kaum gereinigt, aufs neue in den Netzen des Liebesteufels fangen. Die Römer mit den Feuergliedern machten sich über die blonden Frauen, die aus Mitternacht gekommen waren, wie lechzende Hyänen her. Und die lichtlockigen Knaben aus den deutschen Städten sanken in die Arme der nachtäugigen Römerinnen. Ein Heer von Dirnen zerteilte sich wie flüssiges Gift in der Menge. Auf den kalten Steinen lagerten Männer und Frauen, Kinder und Diebsvolk, und die freche Sünde lagerte sich dazu und prahlte mit ihrer Gemeinheit.
Um Santa Maria del Popolo ging es hoch her. Die Riesenkirche war umzingelt von absolvierten Wallern. Würfel, Wein und Weib bildeten den Inhalt des Freudentaumels. Je weiter die Nacht vorrückte, desto unverhüllter stolzierte das Laster durch die Lagerreihen und entfesselte Leidenschaften, wilde Instinkte, Streit und Hader. Vor dem Tor der Kirche lagen sich Männer und Weiber in den Haaren. Es ging um ein Weib. In der Nähe fauchte eine schwarzäugige Frau ihren blonden Geliebten an, der mit ihr aus Rieti gekommen war, um für den mit ihr begangenen Ehebruch Absolution zu erlangen. Als gereinigtes Schäflein hatte er sich in die Arme einer andern Buhldirne geworfen und wurde dabei von der Betrogenen ertappt. Die Weiberhexen neben ihnen sekundierten der Frau wacker, und mitten in das Fluchkonzert schrie ein Abruzzese hinein, dem ein Magister auf der Treppe einen Zahn zog. Aus der Kirche erklang der Klagegesang einer Bruderschaft, deren Gestalten jetzt paarweise wie Orkusschatten aus dem Tor schritten. Das geifernde Weib stürzte beim Anblick der totenhaften Gestalten zu Boden. Da warf sich einer aus dem düstern Zug mit einer Gebärde des Wahnsinns heraus und umarmte plötzlich das zerknirschte, betrogene Weib.
»Antonio!« schrie dieses auf.
Es war ein entlaufener Mönch, der einst der Liebhaber der Frau gewesen. Nun knäulten sich Männer und Frauen zu einem wüsten, schlagenden, beißenden, stechenden, tierischen Haufen zusammen, bis die Stadtknechte heranmarschiert kamen und notdürftig Ordnung machten.
Eine Greisin wankte heran in wallendem, zerrissenem Gewand. »Führt mich zum Papst!« wehklagte ihre Sibyllenstimme.
»Was wollt Ihr von ihm?« fragte ein Vogelhändler.
Die Megäre zitterte an allen Gliedern. »Ihm prophezeien.«
»Was wollt Ihr ihm prophezeien?«
»Seinen nahen Tod! Er erstickt in Wollustsünden. Sieben Affen werden auf seiner Brust sitzen und ihm sein zerliebtes Herz zernagen. Sagt es ihm! In Feuernächten hat es mein Auge erblickt, das Auge der Seherin von Arendal.« Die norwegische Sibylle hob beschwörend die Arme gegen den Himmel, und es schien, als schlügen Schwefelflammen aus ihrem weitgeöffneten Munde. Die Leute in ihrer Nähe fuhren entsetzt zurück und machten ihr eine Gasse. Wie eine grauenhafte Meduse schritt sie durch das Kirchentor ins Innere. Hinter ihr schlugen die Spaßmacher ihre Purzelbäume. Ein schreiender Barbier bespritzte ihr weißes Gewand mit Seifenschaum. Elend und Witz vermengten sich zur unheimlichen Fratze. In der Kirche schauerten die Priester zusammen. Sie bekamen Sünden aufgetischt, die das Herz eines Teufels erschauern gemacht hätten. In einem Beichtstuhl wälzte sich ein Ratsschreiber in Sündenpein und bat den Priester, ihm zu erlauben, daß er mit drei Frauen gemeinsam lebe, sein Adam habe mit zwei Frauen nicht genug. Das größte Aufgebot an Erzsündern stellten die verkommenen Kleriker bei. In einem Sündenstuhl beichtete ein abtrünniger Zölestiner, daß er mit einer davongelaufenen Bäckersfrau die Ehe geschlossen und drei Kinder von ihr habe, nach ihrem Tode aber eine neue Ehe eingegangen sei. Schrecklicher würgte ein andrer entlaufener Mönch seine Schuld aus der Kehle. »Ich habe meine junge Nichte wie ein Stier angefallen und den Sohn, den sie gebar, erwürgt und im Stall begraben.« So schrie er, daß alle Umstehenden es hörten. »Dann zelebrierte ich zwanzigmal die Messe.« Dem Beichtiger stiegen die Haare zu Berg; er warf ihn kurzerhand aus dem Beichtstuhl.
Ein dritter Klosterbruder hatte fünfmal das Ordenskleid gewechselt, weil er in jedem eine neue Ehe eingegangen war und sie wieder gelöst hatte. Nun lag er im Kleide der heiligen Maria der Teutonier reuezerschlagen im Beichtholz. Ach ja, es war ein Kreuz mit den Kuttenmännlein! Rom war überfüllt von reuigen Brüdern. Aber zur selben Zeit, da die Ehemänner aus aller Herren Länder verschiedener Sünden wegen nach der heiligen Stadt zogen, wallfahrten die Mönchlein zu den unbehüteten Tempeln der Ehefrauen und gaben letzteren einen Ablaß, an dem manche neun Monate zu tragen hatten.
Der silberne Hammer, mit dem Alexander heute die goldene Pforte eröffnete, war das Symbol der Sittenreinheit, mit der der Gläubige vor das Heiligtum Gottes trat. Nie ward ein Werkzeug unreinlicheren, frevelhafteren Händen anvertraut worden, und nie ward das kirchliche Rüstzeug der Absolution gewissenloser mißbraucht worden als zur Zeit dieses Papstes, der sich genötigt sah, alle Sünder loszusprechen, weil keiner mit seiner Sündenlast an ihn heranreichte.
Aber auch wahrhaftige Frömmigkeit trieb mitunter ein müde gewordnes Herz nach Rom. Der Maler de la Porta – der spätere Mönch Fra Bartolomeo – war nicht der einzige, der mit heißer Entsagungsfreude an den Tisch des Herrn trat. Noch immer gab es treue Herzen, die sich ihren Glauben an die reinigende Kraft der Kirche durch die Mißwirtschaft des Papsthofes und die Ruchlosigkeit seiner hierarchischen Priester nicht zerstören ließen. Solange der Tempel der Christenheit nicht von oben bis unten in Stücke sprang, konnte keine Lastertabelle des Papstes den wahrhaftig frommen Menschen an der Erbschaft des christlichen Erlösungsheils zweifeln lassen. Der größte Sünder saß auf dem Stuhle Petri, aber er erschien den unschuldigen Kindern als ein durch sein hehres Amt geheiligter Halbgott, dem die Sünden vor des Höchsten Thron nicht angerechnet wurden. Die Hammerschläge, die Alexander auf Gott und die Christenheit niedersaußen ließ, machten sie nicht irre.
Die Opfertruhen standen in allen Kirchen. Noch in der ersten Nacht füllten sie sich bis zum Rande. In Sankt Peter scharrten zwei Kleriker mit Schaufeln die Almosen vom Opfertisch in weiße, geweihte Säcke.
Bis tief nach Mitternacht wogte das Volk um die großen Kirchen. Die Sterne schimmerten in Adventklarheit über der heiligen Stadt, milde war die Luft. Als der Morgen dämmerte, fiel der Großteil der Pilger erst in Schlaf. Aber die kurzlebige Liebe blieb wach und verjauchzte ihre leichte Sünde, bis die bleichen Lichter Phöbus', die über der Engelsburg und dem Quirinal herangrauten, in rosenrote Töne übergingen, vor denen sich die Schande wie lichtscheues Gewürm verkroch. Und ein seliges Adventlied, von einer dünnen Knabenstimme gesungen, klang schläfrig aus einem Quadernwinkel des Domes über die schlafenden Köpfe ins fröstelnde Grau des Platzes: Sie trägt ein Knäblein aufs Heu – es ist gewachsen aus ihrem Schoß – daß unser Heil gekommen sei – aus der süßen schönen Marienros' – es sangen's die Hirten bei ihrer Wacht – in der bethlehemitischen Wundernacht ...
 Den Papst Alexander überrieselten keine Weihnachtsschauer. Er erlebte das Licht der Welt nicht. Ihn plagten wichtige Erdendinge. Im Gemach der freien Künste, unter den Bildern Pinturicchios, ging er auf und ab, die fetten Finger ins Brevier gelegt, die Lippen unruhig zuckend, andachtslos Gebete murmelnd, deren Sinn an seinem Hirn vorüberglitt. Am Fenster stand der Vertraute des Papstes, der Kardinal Ferrari, vom gleichen Geiz und vom Alter gekrümmt, die weißen spärlichen Haare glatt über die Schläfen gestrichen, die Habichtsnase und die kreisrunden Augen über die Liste der Pönitentiare gebeugt. Auf dem runden Ebenholztisch schwamm auf silberner Schüssel ein Langustenstück in Öl, umlagert von dick aufgeschwellten Spargelköpfen. Der Kardinal kostete vorsichtig von dem Krebsstück und vertiefte sich dann wieder in das Verzeichnis.
Den Papst Alexander überrieselten keine Weihnachtsschauer. Er erlebte das Licht der Welt nicht. Ihn plagten wichtige Erdendinge. Im Gemach der freien Künste, unter den Bildern Pinturicchios, ging er auf und ab, die fetten Finger ins Brevier gelegt, die Lippen unruhig zuckend, andachtslos Gebete murmelnd, deren Sinn an seinem Hirn vorüberglitt. Am Fenster stand der Vertraute des Papstes, der Kardinal Ferrari, vom gleichen Geiz und vom Alter gekrümmt, die weißen spärlichen Haare glatt über die Schläfen gestrichen, die Habichtsnase und die kreisrunden Augen über die Liste der Pönitentiare gebeugt. Auf dem runden Ebenholztisch schwamm auf silberner Schüssel ein Langustenstück in Öl, umlagert von dick aufgeschwellten Spargelköpfen. Der Kardinal kostete vorsichtig von dem Krebsstück und vertiefte sich dann wieder in das Verzeichnis.
Plötzlich ließ der Papst das Brevier fallen. »Legt es auf den Tisch,« sagte Alexander mürrisch. Dann verschlang er gierig einen Bissen der Languste. »Ruft den Bischof von Sutri.«
Ferrari öffnete die Tür. Gleich darauf stand der ergraute Bischof im Gemach. Im nächsten Augenblick warf er sich zu den Füßen des Papstes hin und küßte den purpurnen Seidenschuh. »Gnade!«
»Ihr habt Euch selbst ausgeliefert. Wann seid Ihr zurückgekehrt und warum?« fragte Alexander gnadenlos.
»Das Heimweh trieb mich nach Rom!« beichtete stammelnd der Bischof. »Ich konnte Sankt Peter nicht vergessen.«
»Aber Eure schuldige Ehrfurcht vor dem Herrn der Christenheit konntet Ihr vergessen. Habt im geheimen Rebellion gemacht. Es liegt alles am Tage. Ihr habt dem Kardinal Askanio Sforza zur Flucht verholfen, nachdem mein heiliger Zorn ihn verfolgt hatte. Ihr habt ihn zum Kardinal Colonna begleitet. Über die Colonna wird ein furchtbares Blutgericht niedergehen. Wohin ist Ascanio geflüchtet?«
»Nach Mailand zu seinem Bruder, dem Herzog.«
»Welches Schiff nahm ihn auf?«
»Drei Schiffe des Königs von Neapel standen bereit und brachten ihn nach Siena.«
Alexander brauste auf. »Neapel! Wieder der alte Widersacher! Er soll es spüren, wie es der Sforza spürte, der von Frankreich flüchtete bis ins Herz Tirols hinein. Mailand ist in des Königs Gewalt, alle Städte haben sich ihm angeschlossen oder fielen durch Verrat und Feigheit in Ludwigs Hände. Ascanio entgeht seinem Schicksal nicht.« Der Papst fauchte seinen Grimm dem Bischof ins Gesicht. »Neapel, Colonna, Gaetani, alle Vikare und Tyrannen der Kleinstaaten gegen mich! So sieht das Weihnachtsfest beim Alexander aus! Und nun windet sich die erste Natter in meiner Hand. Bischof, Ihr habt um Gnade gefleht, Ihr sollt sie haben –
»Allerheiligster Vater –« Der Bischof umklammerte schluchzend die Knie des tückischen Papstes.
»Aber Eure Gefährlichkeit liegt am Tage. Kardinal Ferrari, geleitet den Bischof in die Engelsburg und weist ihm eines der bessern Zimmer an. Er soll reichlich zu essen haben und die Bibel mitbekommen. Habt Ihr sonst gelehrte Gelüste?«
Den Bischof überlief es eisig. Alle Hoffnung in ihm brach kläglich zusammen. »Allerheiligster Vater – meine Reue ist unendlich –«
»Ihr sollt in der Engelsburg Zeit haben, dies zu beweisen,« sagte der Papst beinahe aufgeräumt.
Der Bischof erhob sich und wankte an dem Arm Ferraris nach der Tür, wo er von einem draußen harrenden Subdiakon in Empfang genommen wurde.
Alexander schnaubte seine gekühlte Rache in einigen hörbaren Atemzügen aus. »Er war noch einer der Getreuesten, Ferrari, aber es mußte ein Exempel statuiert werden für die übrigen Kardinäle. Ascanio entflohen, Riario, Sanseverino, der Bischof von Genua, der Herzog Alfonso –« der Papst furchte plötzlich die Stirn. Der Name seines herzoglichen Schwiegersohns war durch sein Hirn geblitzt und hatte einen Gedanken erhellt. Er riß die Schultern zurück. »Die Sänfte! Ich will zur Herzogin Lukrezia Borgia.«
Wenige Augenblicke darauf schritt der Papst im weißen Pluviale durch die drei Säle, die vor seinen geheimen Gemächern lagen, hinab in den Belvederhof, wo die Sänfte harrte.
*
Die Weihnachtsempfänge der Herzogin Lukrezia dehnten sich bis in die Abendstunden aus. Vor dem Hause reihten sich die Karossen der Kardinäle und Barone an, und ein unaufhörliches Räderrollen zeigte den Bewohnern des Borgo an, daß die vornehme Welt Roms in Aufregung war, denn es galt der junonischen Grazie der jungen Herzogin die zärtlichsten Huldigungen zu Füßen zu legen. Ein Farbengewoge erfüllte das Treppenhaus und belebte die düstern Korridore mit seinem schreienden Licht. Aus den Sälen erscholl Musik, durch die weitgeöffneten Türen erblickte man den gemessenen Tanz junger Hofdamen und Edelmänner, in den blumengeschmückten Ecken lehnten die alten Monsignori und sagten den betagten fetten Matronen des Adels billige Schmeicheleien. Auf weißen Tischen, vom sinnberückenden Duft der Treibhausblumen überströmt, standen Silberschüsseln mit geschmackvoll aufgebauten Backwerkgrotten, in denen niedliche Tragantpuppen in den verfänglichsten Stellungen ihre zuckersüße Liebe verküßten. Von den Wänden hingen schwere Festons über die prachtvollen Arrezzoteppiche herab, in den intimeren Gemächern, in denen eine stilvolle Ornamentierung die Vorherrschaft des toskanischen Architekturgeistes verriet, schimmerten Marmorkopien griechischer Statuen und blinkten silberne und goldene Aufsätze aus den ersten florentinischen Werkstätten, und ein Strahlenbündel aus unzähligen Lüsterkerzen, durch phantastisch geformte venezianische Kristallgehänge regenbogenartig gebrochen, verschwendete seinen Glanz über das frohbewegte Bild.
Im Danaidenzimmer – nach einem Wandteppich so benannt – saß das Herzogspaar bei einem sechseckigen Erlentischchen und horchte dem dünnen Geklimper einer Spieluhr zu, eines mechanischen Kunstwerks des römischen Goldschmieds Nardo Antonazzo. Ringsherum standen die gaffenden Edelleute und wiegten die Köpfe nach dem Takt der Kanzonette. Lukrezia hatte unfrohe Augen. Sperulo, Maddaleni, Procari und Porcius, die Hofdichter des Vatikans, boten vergebens ihre schmeichelnden Künste auf, die poesieempfängliche Herzogin aufzuheitern. Und auch die schlanken Kavaliere stielten heute umsonst ihre Augen, um die sprichwörtliche Anmut in ihren Zügen zu entdecken. Die Frauen der Orsini und Colonna und der andern baronalen Geschlechter Roms hatten es schon langsam satt bekommen, überall nur die Schönheit der Lukrezia Borgia ausrufen zu hören, und sie spießten mit ihren Neiderblicken nur mehr die kostbaren Hüllen der Herzogin auf und werteten tuschelnd den fürstlichen Schmuck ab, der als Gesteck und Gehänge Kopf und Brust dieser ersten Eva Roms zierte. Lukrezia fing diese Blicke gelassen auf. Sie wußte, nach ihren Reizen dürsteten die schönen Jünglinge der Universität, die platonischen Akademiker, die Maler und Bildhauer, und ihrem Geschmack guckten die vornehmen Frauen die Tragart der Kleidung und die Haltung ab, nach ihr sah man sich die Augen wund, wenn sie durch die Straßen ritt, und ihre Vergnügungen wurden die Muster aller gesellschaftlichen Lustbarkeiten. Aber ihr Stolz darüber hatte keinen häßlichen Beigeschmack, ein natürlicher Hoheitsglanz hob ihre kindliche Schönheit ins Frauenhafte empor und adelte ihr Selbstbewußtsein zur fürstlichen Erhabenheit, die ihr wohl anstand.
Der Herzog Alfonso von Bisceglia saß im enganliegenden goldverzierten Lederwams, die Mantella nachlässig um die Schulter geworfen, auf dem erhöhten Sitz neben seiner Gattin und sah ihr über die Achsel auf die feingeformten Finger, die das klingende Spielzeug umklammert hielten. Er hatte als einziger unter den anwesenden Männern den Degen im Gehänge und das hermelinverbrämte Barett auf dem Haupte. Auf seinem Brustlatz schimmerte in schwerer Goldfassung ein Rubin. Der neapolitanische Bastard des verstorbenen Königs Alfonso II. war blühend schön, so schön, daß man ihm an seinem Vaterhof das Sonnenlicht entzogen hatte, damit seine Haut nicht abgedunkelt werde. Wenn die Frauen in die schönen Augen dieses Tituskopfes sahen, kam ein leises Mitleid über ihr Herz, denn nie hatten sie so traurige, abgrundtiefe Augen gesehen. Auch hatte Alfonso eine Abneigung gegen das höfische Gespräch, dem er ein drückendes Schweigen vorzog, was ihn noch verschlossener machte. Man war bald dahinter gekommen, daß Alfonso allzufrüh an die Kette einer fürstlichen Ehe gelegt worden war. Zum Überfluß hatte er von seiner bürgerlichen Mutter ein tüchtiges Erbteil natürlicher Moral mitbekommen, denn Antonetta war wohl die Geliebte Alfonsos, aber dabei keine Kurtisane im gewöhnlichen Sinne gewesen. Sie hatte sich aus wahrhaftiger Liebe an das Königsherz geworfen, sie war edel, freigebig und bescheiden und hatte den schönen, jungen Alfonso in den Tugenden des Mark Aurel zu erziehen gesucht. Aber was sollte der Herzog mit diesem Tugendbündel an einem Hofe anfangen, an dem jede Säule von dem Pesthauch der widerlichsten Laster umweht war? Er nahm sich nicht einmal die Mühe, vor seiner eigenen Gemahlin seinen sittlichen Adel zu verteidigen. Vom ersten Tag seiner jetzt einjährigen Ehe an verzichtete er darauf, einen Jubel darüber anzustimmen, daß er der Mann des allerschönsten Weibes geworden war.
Diese gewaltsam zusammengeschmiedeten Kindernaturen, Opfer der väterlichen Politik, hatten noch nicht die Kraft, sich vor der Welt die höfischen Masken des Wohlergehens umzuhängen. Man las ihnen von den Augen die Wonnelosigkeit ihrer jungen Ehe ab. Der blonde und blinde Erzieher des jungen Herzogs, der gutmütige Raffaello Brandolino, hatte sich vergebens bemüht, seinem Zögling die Pflichten des vornehmen Fürstengrades nahezulegen, worunter eine der größten war, heiter zu scheinen. Alfonso blieb dem Rate seiner Mutter getreu, der ihn anwies zu scheinen, was man ist. Sein Gemüt litt tiefer unter den Widerständen als die von ein wenig Trotz angehauchte Seele der Herzogin. Diese hatte schon heftige innere Erschütterungen mitgemacht, und das gab ihr den Mut, auch den Kampf mit ihrem Gemahl zu führen. Aber trotz allem fieberte in Lukrezia eine noch unbewußte Sehnsucht nach einer Annäherung an den knabenhaften Mann, dem es noch nie eingefallen war, den Gebieter über ihr Herz hervorzukehren. Aber die Stunde, die das Eis in ihren Herzen brechen sollte, war noch nicht gekommen.
Lukrezia warf jetzt die Spieluhr beiseite und ließ durch einen Kammerdiener die Palastglocke läuten. Das war das Zeichen, daß sich die Herrschaften davonmachen sollten. Man hatte Anstand und Scheu. Schon wenige Minuten darauf hörten die Schildknappen, die an den Fenstern des Korridors standen, das Rollen der abfahrenden Wagen. Die Windlichter der Lakaien und Läufer blitzten ihren Schein in das Dunkel der Straße.
Es war um die zehnte Stunde, als es dunkel und ruhig wurde im Palast der Lukrezia. Die Herzogin rauschte in ihrem weißseidenen Damastkleid an dem Arm ihres Gatten aus dem Gemach und stieg in ihr Schlafzimmer empor, wo sie gewöhnlich noch bis tief in die Nacht zu lesen oder zu zeichnen pflegte, während ihr Gemahl früh zu Bette ging.
Als sie in das von leichter Rosenglut überschimmerte Zimmer trat, warf sie den ersten Blick nach der Wiege, in der der kleine Rodrigo, betreut von einer Kammerfrau, schlummerte. Vorsichtig neigte sich Lukrezia über den Kleinen und ließ den schlafwarmen Hauch der Kinderlippen über ihr Antlitz streifen. Sie murmelte puppensüße Worte über das Köpfchen hin, entließ dann die Kammerfrau, zündete zwei neue Kerzen an, legte den Schleierbau vom Haupte, der das goldne Nackenhaar bändigte, steckte die Juwelen und Cesares goldne Brustzier ab und ließ sich dann wortlos an der Seite der Wiege in einen Stuhl nieder und griff nach den lateinischen Versen, die ihr ein feinsinniger Sonettist aus Ferrara namens Pietro Bembo geschickt, der sie bei einem kurzen Aufenthalt in Rom vor einigen Wochen bewundert hatte und dem die Seele bei ihrem Anblick in eine solche Unruhe geraten war, daß sie sich jetzt in feingeschliffnen Versen ausschwingen mußte. Lukrezia lächelte versonnen über den zierlichen Anstand des Versemachers.
Da traf sie ein weher Blick Alfonsos. Sie legte die Schrift beiseite und starrte nach dem schlafenden Kinderköpfchen, als wäre hier das verbindende Zaubermittel zu suchen. Sie wollte nicht trotzen, sondern der ehrlichen Regung ihres Herzens nachgeben. So erbärmlich fremd und frostig konnte sich diese Ehe doch nicht weiter ausleben, das Recht auf eine offene Auseinandersetzung glaubte diese kleine Herzogin geradeso zu haben wie das Weib eines Ratsschreibers.
»Ganz Rom war zu Gast bei uns,« sagte Lukrezia leise. »Es war also sehr schön.«
»Wenn Ihr damit zufrieden wart, soll es mir recht sein,« antwortete der schöne Gemahl mit einem leichten Anflug von Bitterkeit. Er ging zur Wiege und sah sein Kind traurig an. Und wieder lagerte der undurchdringliche Nebel des Mißtrauens zwischen den beiden Gatten. So galt es denn aufs neue, sich durchzuquälen, bis ein Stück Sonnenschein gewonnen wurde, das dann freilich nicht von langer Dauer war. Ach, sie litten sehr an ihrer Jugend.
Da tönte Pferdegetrappel durch die Stille der Nacht. Der Herzog erblaßte und trat ans Fenster. »Nur Stadtwächter!« atmete er auf. »Weiß Gott, Pferdehufschlag klingt mir immer in den Ohren wie Geklapper von Gerippen, seit damals – in der Julinacht – da ich nach Genazzano flüchtete vor den Ränken des Papstes –«
Lukrezia warf die Verse Bembos beiseite. »Ihr habt damals übel gehandelt, als Ihr ohne den Willen des Papstes –«
»Bin ich sein unterwürfiger Stallknecht? Sein Kleriker?« Er wandte sich vom Fenster weg. »Es war unwürdig vom Papst, mir seine Reiter nachzusenden, als wäre ich ein Verbrecher –«
»In seinen Augen wart Ihr's auch,« sagte Lukrezia mit böse verzogner Lippe. »Ihr hattet Zusammenkünfte mit den Colonna, und der Papst wittert überall Ränke, wo der Name auffliegt. Das hättet Ihr wissen sollen.«
»Wer hätte mich's lehren sollen?« Alfonso sah seine schulmeisterliche Ehefrau vorwurfsvoll an. »Ihr habt doch nie versucht, mir freundschaftliche Winke zu geben.«
Verärgert blickte Lukrezia an ihm vorbei ins Leere. »Als ob Ihr auf meine Winke etwas gegeben hättet! Unsere Seelen fliegen wie gleichgültige Käfer aneinander vorbei und auf unsern Lippen erfriert jedes warme Wort.«
Alfonso tat einen wehen Atemzug. Also wieder die gegenseitige Qual, die sich täglich erneuerte und die er vergrämt in seinem Herzen einsargte!
Lukrezia wollte, da ihr Gefühl nun ein wenig mit ihr durchgegangen war, auch andre Verbitterungen abstoßen. »Ich erinnere mich an die Klostertage von San Sisto, dort war ich geborgen vor allem Weh dieser Welt. Die Frauen halfen mir mein Leid tragen.«
»Was war das denn für ein Leid?« fragte er mit großen Augen. »Ich wüßte nicht, was eine geschiedene Frau in Eurem Alter, mit Eurer Beweglichkeit des Geistes und des Herzens, mit Eurem leichten Gemüt –«
»Schmäht nur weiter, Don Alfonso.« Sie griff mit der zusammengekrampften Faust nach ihrer Brust, als wollte sie ihr aufwallendes Herz beruhigen. »Als mich der Papst in San Sisto begrub, geschah es nicht, um die Trennung von Giovanni Sforza vergessen zu machen –« Sie stockte, und Schamröte überflammte ihr Gesicht.
»Laßt Euch nicht das Herz bange werden,« sagte Alfonso kühl. »Ihr solltet dort zum klösterlichen Gehorsam erzogen und für die bevorstehende Ehe mit dem Bastard von Neapel gründlich vorbereitet werden. In Wahrheit aber scheiterten alle Versuche an der Verzweiflung, die Euer Herz über eine gewisse Sache ergriffen hatte.« Er hatte die Anspielung mit unverhohlener Herbheit hingeworfen.
Lukrezia zuckte zusammen.
»Über eine unglückliche Liebe wäre Euer Herz fast gebrochen. Der schöne Sänger gab sich selbst den Tod, weil er und Ihr nie zusammenkommen konntet.«
Die Herzogin straffte Sehnen und Muskeln an. Ihr Blick flammte. »Die ganze Welt wurde betrogen. Ihr mit! Sarafino d'Aquila wurde in meinen Armen ermordet.«
»Ermor –?« Der herzogliche Jüngling wich entsetzt zurück.
»Verurteilt mich denn in Gottes Namen, daß ich mit meiner Schande prahle, aber es mußte einmal der Stein von meiner Seele gewälzt werden. Ja, ja, ja – ich habe den schönen Freier geliebt, aus ganzer Seele geliebt. Hört es, Don Alfonso – geliebt!! Und weil man mir den Fall von der Höhe des Herzogsthrones in die Arme des armseligen Dichters nicht verzeihen konnte, mußte eins von uns beiden aus der Welt geschafft werden. Die Wahl war nicht schwer.«
Alfonsos leicht bewegbares Herz zuckte zusammen. »Wer war – der Mörder?«
Lukrezia flog nach der Tür und horchte hinaus. Dann eilte sie wieselgleich zurück und duckte sich vor Alfonso in einen Stuhl zusammen. Ihr heißer Atem strich knapp an des Herzogs Gesicht vorbei, das sich über sie geneigt hatte. »Ich gebe Fürchterliches preis. Teufel würden zusammenschauern, wenn ich's in ihre eisenharte Brust legte. Schwört mir, Euer Herz, das jetzt dem Mörder fluchen wird, zu beschwichtigen, löscht die Erinnerung an diese Stunde aus, sobald meine Beichte verhallt ist. Glaubt, Ihr hörtet im Fieberwahn, und es war nichts Wirkliches, was Euer Blut erstarren machte.«
Da war es Alfonso, als strichen schon die Schauer des Namens über seine Glieder. »Ich ahne alles,« sagte er erstickt.
»Nicht der Mörder wird Euch erzittern machen, denn er hat schon größere Blutschuld auf sein Herz geladen. Aber was ihn zu diesem Dolchstoß trieb, ist mit glühenden Buchstaben in das Geheimbuch der Verworfenheit eingeschrieben, und die abgefeimtesten Teufel hüten das Wort aus Angst, es könnte die Hölle selbst zusammenstürzen über dem Triumph, den ein Mensch über sie errungen.«
»Es ist Cesare Borgia!« fuhr es wildgehetzt aus der Knabenseele.
»Pst! Die Luft ist in seinem Sold und wird zum Verräter. Ein Schreckliches raste durch seine Sinne, als er den jungen Leib mordete. Durchblättert die Geschichte aller Zeiten, Ihr müßt bis zu den atridischen Greueln hinabtauchen, um das Furchtbare zu entdecken, das der Natur ins reine Antlitz speit.«
»O Gott!« Der Herzog begann zurückzutaumeln.
»Die Bruderliebe – verhüllt Euer Antlitz! – zerbrach die geheiligten Fesseln und nahm die verzerrte Gestalt –«
»Genug! Lukrezia!« Der Herzog verhüllte sein Gesicht.
Die Scham der Herzogin glühte in die zitternden Hände hinein.
Die Kindesunschuld schlief ruhig mitten im Gewoge der Seelen. Der sanfte Atem des Kleinen glich dem ersten Lenzlüftchen, das im Winterbrausen ungefühlt verhaucht und verweht.
Alfonso spürte in seiner Jünglingsseele ein leises Zusammenbröckeln der Widerstände, die die Ursache seiner Qualen geworden waren. Er wehrte sich nicht gegen den Ansturm des Mitleids, das jetzt über diese ungeliebte Frau milde zu Gericht sitzen wollte. Seine Hand streichelte über den goldnen Scheitel hin. Es war die erste herzliche Liebkosung, seit er gezwungen worden war, ihr Schicksal äußerlich an das seine zu fesseln.
»Verachtet mich nicht zu früh,« bat Lukrezia mit tränenerstickter Stimme. »Ich bin schuldlos. Noch hat keine Tat dem Gedanken Cesares die fürchterliche Krone aufgesetzt. Wer aber kann sagen, wann die Stunde kommen wird, wo Cesares Inbrunst schamlos die Schranke niederreißt, die die Natur zwischen uns aufgerichtet? Urteilt, Don Alfonso, welche Angst die Begleiterin meines Daseins ist. Ihn fern wissen, ist Seligkeit. Ich liege allabendlich im heißen Gebet, Gott möge dem Herzog herrliche Siege schenken, möge ihn festhalten in der Romagna, er möge – Gott verzeih mir den Frevel! – ihn von Blut zu Blut waten lassen, damit sich seine verruchten Sinne im Todesschrei seiner Opfer ausschwelgten, aber Meere, Berge und Täler möge er zwischen ihn und mich legen, daß sein wilder Wunsch nicht nach meinem Leibe greife, den er, ein fürchterlicher Herostrat, in einer einzigen Nacht triumphierend zerschänden und zerstören würde. Fühlt Ihr mir es nun nach, wie ich nach einer Stütze lechze? Ich brauche Schild und Waffen eines treuen Ritters und Gemahls –« Weh brach sie ab.
Die Klage des Weibes brauste wie ein Frühlingswind daher, der morsche Äste bricht, aber auch den Bäumen die Hoffnungslieder neuen Lebens singt. Und die Klage dieses Weibes wurde zur Anklage. Sie rief in Alfonsos Herzen die Ritterlichkeit mahnend wach und forderte von ihm eine heilbringende Wandlung. Schild und Waffen eines treuen Ritters und Gemahls! Es überrieselte den schwachen Knaben wie Stolz und Heldensehnsucht. Aber das natürliche Ehrgefühl, das dieser Bastardsohn als Wiegengeschenk mitbekommen hatte, sehnte sich doch zuvor nach einer reinlichen Durchsichtung der Vergangenheit. Erst wenn er eine Würdige vor sich hatte, wollte er von dem Hoheitsrecht der Verzeihung Gebrauch machen und sein eignes Herz durchpflügen, um es für den Samen eines tiefern Gefühls empfänglich zu machen. »Die Reine allein ist wert, beschützt zu werden,« sagte er deshalb zögernd. »Habt Ihr Euch vor Gott keiner Schuld anzuklagen? Ihr habt diesen Serafino d'Aquila geliebt?« Er senkte seinen Blick tief in die Seele Lukrezias.
»Ja,« hauchte sie zurück. Die ganze Liebe einer Frau lag in dem Geständnis. »Unsere Liebe zählte nach Tagen. Sie war von Schuld belastet, aber wir haben gebüßt. Ich bin mit zerrissenem Herzen an Eure Brust geworfen worden. Ich sträubte mich gegen den Schacher, den der Papst mit meinen Gefühlen trieb, aber es war umsonst. Ich mußte Euch betrügen nach dem Willen meines Vaters.«
Bittre Wermuttropfen fielen in den Kelch der erwachenden Liebe Alfonsos. Monde waren sie aneinander vorübergegangen, trotzdem sie nebeneinander gelebt hatten. Sie warfen sich mit der Unehrlichkeit, die ihnen von andern zur Pflicht gemacht worden war, ins Brautbett und mußten nun das Leid dieses Herzenshandels gemeinsam durchs Leben schleppen. Niemand half es ihnen tragen, sie allein mußten damit fertig werden, mit den allzu schwachen Kräften ihrer Jugend.
Aber Alfonso wollte doch dieses Herantasten der Seelen durch Mut und Zutrauen unterstützen. »Donna Lukrezia,« sagte er mit ungewöhnlicher Sanftheit, »ich danke Euch für die Aufrichtigkeit, die ich mit gleicher Münze bezahlen muß. Ich habe mich wie ein edles Tier, das man ins Joch spannen will, gegen diese Ehe mit Euch gewehrt. Ich war von meiner Mutter sittenstreng erzogen worden. Und doch – ich kann Euch nicht um einer Schuld willen verdammen, die in gleicher Art meine Mutter auf ihre Seele geladen hatte, als sie sich in eines Prinzen Liebe geworfen. Aber sie tat alles, um diese Schuld abzuzahlen, denn sie erzog mich in reiner, ritterlicher Tugend, und ich lernte Achtung haben vor der Würde der Frauen. Da warf man mich an das Herz einer – Lukrezia Borgia!«
Die Herzogin wimmerte in sich hinein.
»Wenn der Name in Neapel erklang, glaubte ich das Ausläuten der Schande zu vernehmen –«
»O meine Ehre! Meine besudelte Ehre!« schluchzte das bitterste Weh aus dem jungen Frauenherzen.
»Ich wußte ja nur, was man so sagte. Die Papsttochter, das Kind des heiligen Vaters, dreimal verlobt, dann in die Kammer des Giovanni Sforza geworfen, der sich, angeekelt von der lieblosen Frau, aus dem Staube machte –«
»Lügen, gräßliche Lügen!« Sie rang die Hände in Verzweiflung.
»Mußte ich sie nicht für Wahrheit halten, da sich kein Verteidiger Eurer Ehre fand? Und was da noch an Schande und Schmach herumflatterte, das das unreine Bild der Lukrezia Borgia zum wahrhaftigen Konterfei einer Satansdirne machte! Man munkelte von wilden, unsittlichen Tänzen nackter Frauen im Palast des Papstes, von wüsten Lasterszenen und Spielen, zu denen der Papst, Cesare und Lukrezia ihr wildes Lachen ertönen ließen, und wie bei hellem Sonnenschein auf dem Damasushofe, in der Nähe des heiligen Domes, brünstige Hengste vor den Augen der Lukrezia auf Stuten losgelassen –«
Da stöhnte es sich an des Herzogs Herz heran: »Alfonso – das alles – ist – wahr! Aber eines nicht! Mein Lachen ist eine Lüge! Mit Gewalt wurde ich in die Sänfte gepreßt, ich biß meine Hofdamen, als sie mir die Perlen umlegten für die furchtbaren Schauspiele, und ich schloß meine Augen, um nicht in Ohnmacht zu sinken vor Scham über die Entwürdigung meines Frauentums. Aber der Papst drohte, mich zu verbannen, wenn ich mein silbernes Lachen nicht in den gräßlichen Sinnenwirbel schüttete. Und so lachte, lachte, lachte ich mit geschlossenen Augen und fiebernder Seele, bis mir einmal das Blut vor Lachen zu Herzen stieg und ich wie tot hinfiel, während sich die nackten Dirnengestalten um ausgeschüttete Kastanien balgten. So sinnenfroh und, wie Cesare sagt, so arkadisch ungebunden wurde Eure Lukrezia erzogen! Aber dafür mußte ich immer nachher die heilige Beichte ablegen, und mein Priester sprach mich aller Sünden los, die andre an mir begangen, und der Weihrauch um das Tabernakel trug meine Bußgebete himmelan, aber aus der Apsis glaubte ich den Verdammungsruf Gottes zu hören: unerhört ist dein Gebet, zurück in das verfluchte Herz, aus dem du kamst. Und eines Tages fand man mich wie tot vor dem Sinaibild des Rosselli in der Sixtinischen Kapelle. Cesare selbst hatte mich nach einer mit Dirnen durchtaumelten Nacht, bei der ich Zuschauerin sein mußte, im Kardinalskleid vor den Altar geschleppt und mit mir die Litaneien gebetet. Jetzt werft Steine und Blitze auf mich, wenn Ihr könnt!«
Alfonsos Hände aber streichelten mitleidig durch das aufgelöste, fliegende Haar. Schuldanklagen erstickten in seiner Brust. Er hob den feindlichen Blick auf ein Bildnis an der Wand, das den Menschen darstellte, dessen dämonische Verderberkraft die Frauenwürde seines Weibes zu zerstören suchte. Das Bild Cesares blickte mit den kalten, herzlosen Augen herab. Rings um die schlanke Gestalt hatte der Maler eine blutrote Draperie angebracht, die stilgerechte Folie für den Tyrannen. Das Bild hatte der Herzog Valentino in Venedig durch einen jungen Maler namens Tizian herstellen lassen. Er wollte auch den Maler nach Rom ziehen, doch Tizian war nicht zu bewegen gewesen, die sonnentrunkene Meerluft und die schönen Frauen Venedigs zu verlassen. In das Porträt Cesares legte der Künstler das erste Tasten seiner Farbensehnsucht hinein, in das Antlitz des werdenden Tyrannen den sinnlichen Zug des Lieblings Eros' und in den Körperbau die Sehnenkraft des Bullen. Mit Schaudern betrachtete jetzt Alfonso den in Farben glühenden Feind.
Es war still geworden im Gemach. Nur Lukrezias stoßweißes Schluchzen drang durch die Nacht. Aber die Krämpfe ihres Herzens ließen nach, ihre Glieder wurden matt, sie sehnte sich in einer Art Vision nach dem Frieden der Klosterzelle zurück und hörte die frommen Klänge der Evangelienspiele und Mysterien an ihr Ohr tönen, und in besänftigenden Wellen zog es ihre Sinne in ein ruhigeres Vergessen hinein.
Und es waren wirklich Friedensklänge, die sich jetzt wie aus Gottes heiligen Bezirken in ihre Seele schmeichelten. Ein Pilgerzug, von Fackeln umloht, ging draußen an dem Palast vorbei zum mitternächtigen Gebet vor Sankt Peter. Der fromme Chorgesang stieg zwischen den Palastmauern zum sternbesäten Himmel auf.
Alfonso war zum Fenster getreten. Das Erleben dieser Stunde hatte seinen natürlichen frühreifen Ernst mächtig aufgerüttelt. Er dachte nun daran, wie diese pilgernden Massen da unten am Dreikönigstage vor dem Segen des Papstes in die Knie sinken würden, des Papstes, der seine eigene Tochter in die Schamlosigkeit wilder Dirnenorgien hineingeschleudert hatte. Sein Grimm steigerte sich zur Wut, er ballte seine Knabenfäuste und streckte sie hinüber nach dem Vatikan, wo jetzt Alexander wohl seine Giulia Farnese in Armen hielt. Aber Alfonsos Zorn durchkreuzte auch das Gefühl völliger Ohnmacht. Was wollte er, der geduldete Puppenherzog, mit seinem armseligen Jungenzorn anfangen? Da drüben waren ein Papst und sein Sohn am Werk, die Widerstände der italischen Welt zu brechen. Und er, der Bastard von Bisceglia, wollte es wagen, auch nur in spielerischen Gedanken mit diesen Gewalten zu kämpfen? Er wollte Tränen um seine innere und äußere Schwachheit weinen, die aus ihm einen unbeholfenen Schützer einer unglücklichen Frau machte?
Das Jubeljahr 1500 setzte ein. Alfonso schaute bang in die Zukunft. Ob wohl dieses neue Jahr wieder, belastet mit Unheil und Fluch, ein Stück von seinem Leben abschneiden würde? Aber er beschloß doch, seinen Sinn fortan freier zur Schau zu tragen, die ängstliche Puppenhaftigkeit zu verscheuchen, und er dachte an die frohen Jünglingsgeister der florentinischen Republik, die ihre Gesinnung auf der Zunge, ihren Stolz im Nacken, ihre Würde in den Augen tragen durften. Er wollte ihre Freiheitsgebärde in einer Anwandlung von Mannhaftigkeit nachahmen. Hoch schlug sein Herz, freier wölbte sich seine zarte Brust, und seine vom Feuer eines heißen Willens beseelten Augen sahen nach der Herzogin, die im halben Schlummer an der Wiege des Kindes zusammengekauert dalag. Er wollte sie wecken, daß sie zu Bett gingen.
Da weckte sie ein andrer.
An der Schwelle des Schlafgemaches stand Alexander.
 In dem Heiratsvertrag der Lukrezia befand sich ein ungeschriebener Paragraph, der dem Papst gestattete, jederzeit unangemeldet bei seiner Tochter vorzusprechen. Der Papst wußte, daß Lukrezia heute nach den weihnachtlichen Besuchen das Bedürfnis der Sammlung haben und daher länger aufbleiben würde. Und er spürte eine eigentümliche spionierende Lust in seinem Blute prickeln.
In dem Heiratsvertrag der Lukrezia befand sich ein ungeschriebener Paragraph, der dem Papst gestattete, jederzeit unangemeldet bei seiner Tochter vorzusprechen. Der Papst wußte, daß Lukrezia heute nach den weihnachtlichen Besuchen das Bedürfnis der Sammlung haben und daher länger aufbleiben würde. Und er spürte eine eigentümliche spionierende Lust in seinem Blute prickeln.
Als Lukrezia den Papst sah, fuhren ihre Hände in Angst über die verschlafenen, verweinten Augen.
Alfonso aber fiel augenblicklich in sein unseliges Jungenzittern zurück. Er wußte, daß Alexander zu dieser Stunde keinen frommen Weihnachtsgruß bringen werde.
Des Papstes Gruß aber lautete: »Hat er dich geschlagen, Lukrezia?«
Die Herzogin machte eine rasche Wendung. Es war, als wollte sie ihren Gemahl vor diesem schmählichen Verdacht in Schutz nehmen. »Wie könnt Ihr denken, allerheiligster Vater –«
»Ich komme, scheint es, zu einer ehelichen Auseinandersetzung. Kinder, Ihr vergiftet euch das Leben. Alfonso, ich möchte Euch raten, mein frommes Kind seiner Würde und Schönheit nach zu behandeln. Ganz Rom bewundert den heitern Abglanz des Himmels auf ihrem Gesicht, und hier ziehen Wolken auf –«
»Allerheiligster Vater, mein Herz war nur von den Gedanken an mein Kind beschwert –« Sie errötete.
Der Papst wußte, daß sie log. Aber er ließ es sich nicht merken. Er setzte sich behaglich in einen Stuhl. »Ich kam so spät, weil in meinen Gemächern Gerüchte in Umlauf sind, daß Alfonso neuerlich daran denkt, ohne meine Erlaubnis die Pferde satteln zu lassen und –«
»Wer wagt es –?« fuhr der Herzog empört auf. Doch leise zitterte die Angst in seine Erregung hinein.
»Eure Heftigkeit scheint den Verdacht zu bestätigen.« Der Papst spielte mit den Blättern des Bembobriefes und stieß seine Blicke inquisitorisch in das Antlitz des Schwiegersohnes, der bleich geworden war. »Die ganze Welt beneidet Euch um das kostbarste Frauenkleinod und Ihr schätzt es geringer ein als einen Glasstein.«
»Das tu' ich nicht,« verteidigte sich Alfonso unbehilflich. »Und es fiel mir nicht ein, Weib und Kind zu verlassen. Lügen eines Bösewichts!«
Alexander entfaltete einen Brief. »Der Bösewicht, der diese Lügen ausgedacht, steht meinem Herzen nahe. Es ist Cesare selbst.«
Die Leiber der jungen Eheleute fuhren empor.
»Den Brief brachte ein Eilbote aus dem Lager bei Forli. Er besagt, daß ich meine Augen schärfen soll, denn es sind Zeichen vorhanden, daß die Colonna gegen die Orsini losziehen wollen, und wir haben alle Gründe, die Orsini als – vorläufige – Pfeiler unsrer Macht zu stützen. Man hat Euch nun mit Vespasiano Colonna auf die Falkenjagd reiten sehen. Eure Sänfte hält mehr als notwendig vor dem Portal ihres Palastes auf dem Quirinal, ja, man will bemerkt haben, daß im Turm der Conti heimliche Zusammenkünfte stattge–«
»Das ist nicht wahr!« brauste der sonst so stille Jüngling auf. »Mit Vespasiano Colonna verbindet mich eine unschuldige Freundschaft, die noch aus den Tagen herrührt, da er in Neapel mit seinem Vater zu Gast war. Aber nie wurden aufwieglerische Reden zwischen uns geführt, nie fiel es uns ein, gegen die päpstliche Autorität zu konspirieren. Der Herzog Valentino ist übel berichtet –«
»Was man sonst im allgemeinen nicht zu behaupten wagt,« unterbrach ihn der Papst mit großer Empfindlichkeit.
»Dennoch erkühne ich mich, ihn der Voreiligkeit zu zeihen,« sagte Alfonso unbeirrt. »Ich bin zu jung, um mich in die politischen Händel der Colonna zu mengen.«
»Jugend ist leicht entzündlich. Ich verbiete Euch, bei den Colonna aus- und einzugehen. Es ist an der Zeit, daß Ihr Eure Verträumtheit abschüttelt und Eure Blicke für die Welt um Euch öffnet.« Seine fetten Finger falteten den Brief Cesares zusammen.
»Allerheiligster Vater,« stotterte Alfonso, «man hat mir schon mehr als notwendig die Flügel gestutzt –«
»Weil es Adlerflügel werden könnten, die ihre Schnelle dazu benützten, um sich meinen Einwirkungen zu entziehen. Ich erinnere Euch daran, daß Ihr zweimal Rom verlassen habt, Ihr seid nach Genua entwichen, weil Ihr die Folgen meines Bündnisses mit Frankreich fürchtetet, welches Eurem Oheim in Neapel gefährlich werden konnte. Meine Reiter setzten Euch nach und brachten Euch glücklich nach Haus. Bald darauf floht Ihr zu den Colonna, und abermals mußten Euch meine Boten zurückholen. Ich warne Euch diesmal, bevor es zu Taten kommt. Denn meine Reiter sind nicht dazu da, ihre Pferde nach einem rebellischen Schwiegersohn abzuhetzen.«
»Und wenn ich Euch schwöre, allerheiligster Vater –«
»Man bricht Eide, wenn es sich um Politik handelt.« Seine Tonschärfe schnitt in das Herz des jungen Herzogs, der erblaßt war.
»Man kommt mit mir besser aus, wenn man sich in meine Entschließungen fügt,« setzte der Papst etwas ruhiger hinzu. »Ihr habt vorderhand einen Wirkungskreis, um den Euch jedes Erdenkind beneidet. Das Glück, Lukrezia zu besitzen, sollte Euch abhalten, unkluge Gedanken zu spinnen, die Vaterfreude Euch bestimmen, nur im Kreis der Familie zu leben und Euch mit der Erziehung Eures Kindes zu befassen –« Sein Ton wurde noch wärmer. »Ich möchte Euch warnen, mir oder dem Herzog Valentino Ursache zu Mißtrauen zu geben. Des Herzogs Unversöhnlichkeit könnte gefährlich werden.«
»Dieser Unversöhnlichkeit ist bereits meine Schwester Sancia zum Opfer gefallen,« sagte Alfonso gedrückt.
»Cesare hat ihre Liebe beiseite geworfen und wir haben die edle Dame nach Neapel verbannt –«
»Allerheiligster Vater! Meine Schwester hat sich gewiß entwürdigt, als sie sich an den Herzog Valentino wegwarf und ganz Rom zum Spott wurde, aber Cesare Borgia hätte immer eine mildere Form finden können, seine Schwägerin abzuschütteln, als sie nächtlich aus ihrem Palast zu holen und im Reisewagen über die neapolitanische Grenze zu befördern. So behandelt man keine Fürstin von Squillace.«
Jäh fuhr dem Papst der Zorn in die alten Glieder. »Das zu beurteilen überlaßt meinem Sohn und mir,« bellte er heiser. »Wir werden die Art, wie unsaubere Fürstinnen zu behandeln sind, nicht von Eurer herzoglichen Genehmigung abhängig machen. Worauf pocht Ihr, unreifer Knabe?«
»Ein Knabe, der aber reif genug war, einer Lukrezia Borgia als Gatte zu dienen!« rief Alfonso in erstaunlicher Kühnheit aus. In seinem schwärmerischen Auge entzündete sich das Feuer des Stolzes, das man ihm nie zubilligen wollte an diesem Hof, wo sonst alle Kreaturen vom Hochmutsteufel besessen waren.
Vor dieser Wandlung verfiel selbst der Papst in Verwunderung. Er fühlte, daß er zu weit gegangen war. Seine Schlauheit gebot ihm, sich den jungen Herzog nicht frühzeitig zum Feind zu machen. »Genug davon,« sagte er schnaufend. »Wir haben andre Sachen in Ordnung zu bringen.«
Lukrezia war in tiefster Erregung der Auseinandersetzung gefolgt. Eine bange Freude überkam sie, als sie die hochaufgerichtete Gestalt Alfonsos sah, denn ihr war, als wüchse er bereits unter ihrem Einfluß zur Ritterlichkeit empor. Seine Selbstachtung stieg, und bald, bald mußte er auch sie achten und sie herausziehen aus den furchtbaren Lastersümpfen Roms. Ihre Brust ging hoch und sie sah dem Papst mit furchtlos gespannten Blicken ins Antlitz.
Alexander spreizte die dicklichen Finger auseinander und klatschte die Handflächen spielend zusammen. So machte er's immer, wenn er sich aus einer Aufregung in eine ruhigere Gemütsstimmung retten wollte. Sein Hirn suchte nach einer schicklichen Ablenkung. Er stand auf und ging mit seinen unheimlich tappenden Schritten langsam auf und ab. »Lukrezia, ich habe dich um eine große Gefälligkeit zu bitten. Auf der Burg in Subiaco wächst unter den Händen einer gewissen Landini ein pausbackiger Junge auf, der sich rühmen kann, mein Sprößling zu sein. Es liegt mir viel daran, daß dem Kleinen eine Erziehung zuteil werde, die ihn befähigt, einmal hoheitliche Rechte in Anspruch zu nehmen. Das Kind heißt Juan und ist jetzt drei Jahre alt. Den richtigen Schliff kann er erst unter der Leitung einer Frau bekommen, deren Wesen selbst aus natürlichem Adel und Wohlbildung zusammengesetzt ist. Es ist wohl selbstverständlich, daß mein erster Gedanke auf dich fiel, mein frommes Kind.«
Die Herzogin errötete leicht. Alfonso verbiß einen aufwallenden Zorn. Seine Frau sollte Erzieherin eines päpstlichen Wechselbalgs werden!
»Du hast hier große Bewegungsfreiheit im Palast, kannst deine Hofdamen nach Belieben für den Knaben verwenden, ich verdopple dir die Gelder, und der kleine Rodrigo wird einen Spielgefährten bekommen. Die Kinder werden zusammen heranwachsen, und ich gedenke Sermoneta für dich, liebe Lukrezia, anzukaufen als Entschädigung für deine Mühe, die du mit dem Kleinen haben wirst.«
»Allerheiligster Vater –« zitterte plötzlich die eitle Freude Lukrezias.
»Ich will Sermoneta zum Herzogtum erheben und damit binnen Jahresfrist deinen kleinen Rodrigo belehnen. Desgleichen will ich Nepi dem kleinen Schreihals in Subiaco verleihen. Du bist also einverstanden, Lukrezia?«
Sie nickte mit glühenden Wangen. Perlen und Länder nahm sie nicht ungern entgegen, jeder Zuwachs an Land bedeutete für sie eine Vergrößerung ihres Ansehens.
Der Papst hielt in seiner gemächlichen Zimmerwanderung inne. Als er Alfonsos unbewegliches Antlitz sah, ging ein Ärger durch seine Seele, aber er bezwang sich abermals. »Ich werde Anstalten treffen,« sagte er jetzt, »daß der kleine Juan recht bald in deine – ei, da fällt mir ein, du könntest ihm als Aufsichtsdame Donna Elvira zuteilen oder –« er runzelte die Stirn. »Wie lang ist das nun her, daß deine Hofdame Tiziana de' Calvi in nichts zerflossen ist?«
»An dem Tage, da Imola fiel, wurde sie vermißt.«
»Du warst mit der schönen Frau, die ich leider nie gesehen, sehr zufrieden, als sie in Spoleto an deiner Seite lebte.«
»Es waren glückliche Stunden, die wir miteinander verbrachten,« sagte Lukrezia in fast trauriger Nachdenklichkeit. »Ich schätzte in ihr die tugendhafteste Frau, die anmutigste Freundin, die sorgsamste Hüterin meines Hauses. Im Palast ihres verstorbenen Gatten Luca Brancaleone in Siena verkehrten die ersten Künstler Toskanas, von denen sie den hohen Sinn für alles Schöne lernte. Sie wußte im Virgil ebenso Bescheid wie im Donat, verstand die Eloquenz und versenkte sich mit rührender Liebe in die heiligen Legenden nach den Kommentaren des Tommasio di Vio. In Rom saß sie, sagte man, stundenlang in der Bibliothek des Kardinals Grimani und studierte die griechischen Strophen, kam dann zu mir, und uns brannten die Köpfe vor Eifer, die katalektischen und hyperkatalektischen Verse zu durchstöbern und regelrechte Trimeter aufzubauen. Seit sie fort ist –«
Da wurde geklopft. Der Sekretär Cesare Borgias erschien aus der Schwelle. »Eure Heiligkeit, der Herzog Valentino ist soeben von Forli angekommen und bittet Eure Heiligkeit um eine gnädige Audienz.«
Alle drei fuhren empor. Des Papstes Augen leuchteten. »Cesare da! Der Tausendsasa! Wieder bei Nacht und Nebel!«
»Er ist wie immer maskiert durch die Stadt geritten. Er wünscht, daß man ihn im Lager bei Forli vermutet.«
Der Papst nahm den Mantel über die Schulter. Lukrezia und Alfonso küßten ihm die Hand.
Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, flüsterte Lukrezia mit erschreckten Augen ihrem Gatten zu: »Er ist da!«
»Er ist da!« klang es wie ein schauriges Echo zurück. »Und die Hennen verkriechen sich ins Haus, wenn sie den Geier in der Nähe wissen.«
Im Nu waren alle Gedanken an Tiziana de' Calvi verscheucht. Alfonso ging aufgeregt auf und ab, seine Blicke durchstöberten die Winkel, als suchte er irgendeine Ablenkung aus seiner quälenden Unruhe. Plötzlich ergriff er die Hand Lukrezias. »Ich werde abermals meine Pferde satteln lassen müssen. Und Ihr, Lukrezia – müßt diesmal mit.«
Lukrezia klammerte sich in Angst und aufwallender Liebeshoffnung an ihn. »Ihr wollt mich – mitnehmen?«
»Die Gattin soll fortan an die Seite des Gatten gehören,« sagte er mit trotziger Entschlossenheit.
Da flogen ihre weißen Arme um seinen Hals. Und ein leises, glückliches Schluchzen sagte ihm Dank für das erlösende Wort, das den Eispanzer gebrochen, mit dem sich ihre Herzen aus gegenseitiger Angst gewappnet hatten.
Doch plötzlich rang sich Lukrezia aus seinen Klammern los. »Ich habe noch ein Geheimnis auf dem Herzen,« sagte sie bedrückt. »Jene Flucht Tizianas –« Sie stockte.
»Mißtraust du mir?«
»Von dieser Stunde an nicht mehr,« erwiderte sie und warf die letzten Bedenken über Bord. »Hör' mich an. Ich selbst habe die Flucht meiner Hofdame ins Werk gesetzt.«
»Du?! Warum?«
»Ihr drohte Gefahr von – dem Herzog Valentino.«
Alfonso warf den Oberleib bestürzt zurück. »Ist denn die Luft erfüllt von dem Grauen, das sein Name ausströmt?«
»Cesare sah Tiziana zum erstenmal in Spoleto. Als wir nach Rom zurückkehrten – Tiziana war eben mit ihrer Garderobe in meinen Palast übersiedelt – kam ein Abend – denke ich daran, klopft mir noch das Herz. Es war schon Nacht, Ihr wart bei den Anibaldi geladen, da klopft es an meine Tür – Tiziana liegt halb tot an meiner Schwelle, ich ziehe sie an meine Brust, und sie gesteht mir, daß sie soeben einen fürchterlichen Augenblick erlebt. In dem Zimmer, das sie soeben bezogen hatte, standen in einer Vase wundervolle Rosen und Lilien. Sie hielt sie für ein Geschenk Savellis. Plötzlich vernahm sie ein leises Knistern, wie wenn kleine Mauerstückchen abbröckelten. Unheimliche Angst erfaßte sie. Sie konnte nichts sehen und doch bestürmte sie ein unerklärbares Gefühl, als wäre etwas Feindliches in ihrer Nähe, das noch nicht Gestalt angenommen, sie aber doch schon bedrohe. Sie wollte eben die Kleider abwerfen, hatte schon das Haar gelöst, die Tür versperrt, und es war alles still im Palast – da erstarrte ihr Herz vor Schrecken. Die Wandtapete neben ihrem Bett bewegte sich plötzlich an einer kleinen viereckigen Stelle, als wäre sie leichter Flor. Und nun gewahrte sie, daß einer der lichten Tulpenkelche, die das Tapetenmuster bildeten, sich sonderbar verfärbte, und als sie mit der Kerze hinleuchtete, erkannte sie, daß der Kelch ausgeschnitten war und durch das Loch – ein Auge auf sie herabglühte. Vor Entsetzen ließ sie den Leuchter fallen und stürzte hinaus. In den Armen einer Kammerfrau, die durch ihren Hilferuf aufgeschreckt worden war, erholte sie sich, flog dann in mein Zimmer, an meine Brust. Ich ahnte, was vorgehen sollte. Tiziana schlief diese Nacht bei mir. Am nächsten Morgen untersuchten wir das Zimmer. Mein scharfes Verhör bei der Dienerschaft brachte es zutage, daß das angrenzende Zimmer vor einigen Tagen im Auftrag des Herzogs Valentino von seinem Leutnant Michelotto, dem unheimlichen Vertrauten seiner Pläne, bezogen worden war, angeblich, um dort Vermessungsarbeiten für ein alchemistisches Laboratorium vorzunehmen. Nun reimten wir uns alles zusammen. Die Gefahr war zu groß und zu nahe. Ich selbst riet Tiziana zur Flucht, denn es war für mich eine Gewißheit geworden, daß es der Herzog bei einem mißglückten Abenteuer nicht bewenden lassen würde. Wir berieten noch im Laufe des nächsten Tages und ließen ihren getreuen Tolomei kommen, der sie noch als Kind auf den Knien geschaukelt hatte, und so setzten wir die Flucht ins Werk, um so mehr, als auch Savelli bereits zu drohen begann. Ist sie nun in die Hände Cesares gefallen? Ist ihr ein Unfall zugestoßen? Hat sie mit der Madonna Hilfe Toskana erreicht? Die Ungewißheit peinigt mich. Und nun ist Cesare wieder hier!« Der Gedanke ließ sie aufs neue zusammenschauern.
Alfonso hatte ein beengtes Herz. Er hätte so gern seiner Frau ein Zeichen seiner Gesinnungswandlung gegeben, aber es erdrückte ihn zu gleicher Zeit das Gefühl seiner gänzlichen Ohnmacht. Hyänen umschlichen lautlos sein Herzensreich, er kam sich wie das sanfte Lamm vor, das wehrlos den Tatzen der Erzfeinde ausgesetzt ist. Alexander und Cesare, der Doppelklang dieses schaurigen Geläutes durchschauerte sein junges Herz und übertönte die Schwingungen seines schwachen Willens. »Lukrezia, was sollen wir tun?« fragte er hilflos. »Wie sollen wir uns schützen vor den Mächten, die uns umgrausen? Wo ist der rettende Engel, der –« sein Antlitz brannte plötzlich in Entschlossenheit – »ich flüchte zu den Colonna nach Genazzano, von dort in mein Heimatland, in mein Herzogtum Bisceglia. Ihr kennt es nicht, das Meer leuchtet bis in die Dunkelheit der Paläste hinein, der Wein blüht an den Hängen und die Lüfte sind sanft vom Salz der Wellen durchdrängt, und niemals überschreitet Cesare den Liris.« Er drängte ungestüm in die zaghafte Brust Lukrezias.
Die Herzogin überlief es heiß. Sie dachte an eine Zeit zurück, da auch sie einmal ins neapolitanische Land fliehen wollte mit einem, der ihr treu und teuer gewesen war. Der kurze Traum ihrer ersten Liebe bekam wieder Gestalt. Sie sah sich mit Serafino d'Aquila im Jagdhaus am Nemisee vereint, von den Schauern der Verzückung überrieselt, sie hörte ihre eigene Stimme tönen: »Komm mit an den Liris!« Und sie hörte den See leise gurgeln und da – jetzt gellte der eigene Entsetzensschrei: Cesare Borgia! an ihr Ohr. Und dann fiel die Wolke der Bewußtlosigkeit auf sie herab – und ihr Erwachen sah einen toten Körper zu ihren Füßen – und zu ihren Häupten ein lebendiger – und das Wort San Sisto tönte in ihre Seele hinein ...
Nun stand ein andrer an Serafinos Stelle, einer, der nicht wie ein brausender Orkan über ihre Seele gekommen, nein, erst nach einem Jahr brach sich sein Trotz unter dem Anprall der Schicksalsgewalten. Gemeinsame Gefahr rückte ihre Herzen einander näher. Noch tasteten sie zaghaft in den Labyrinthen ihrer Gefühle umher, noch blieben ungelöste Reste des Zweifels bestehen, aber die Versöhnung war angebahnt, das Eis im Schmelzen, und es rauschte das Frühlingsahnen ihrer Liebe durch die Brüste.
»Wenn Ihr flieht, ist Euer Schicksal auch das meine,« sagte Lukrezia mit aufgepeitschtem Mut.
Alfonso zog ihr Haupt an seine Brust. Dann sagte er unruhig: »Lukrezia – wir werden heute nacht wachen – ich will mein Panzerhemd umlegen –«
»Ihr glaubt doch nicht –?«
»Cesare ist da!« Der Warnruf klang leise aus der gedrosselten Brust. Und Alfonso löste weich ihre Arme von seinem Hals und holte seinen Schuppenpanzer hervor. Er ging nie ohne dieses Kleidungsstück aus.
Als das Hemd auf seinem Leibe rasselte, sagte er fast aufgeräumt: »Ich lasse mir mein Gemüt nicht länger von dieser Angst zermürben. Und wenn ich nun noch ein Mittel wüßte, dich und mich und das Vaterland von dieser Furcht zu befreien – für immer –«
»Sagt es mir,« drängte Lukrezia an ihn heran.
»Ahnst du es nicht, Liebste?« Er umklammerte ihre Hände und preßte gleichsam seine Gedanken in ihre Glieder hinein. »Die wirksamste Waffe der Verteidigung ist der Angriff.«
Lukrezia fuhr empor. Ihre katzenweichen Glieder streckten sich an seinem Leib hinauf. »Du – du –« das trauliche Wort fand endlich das Herz in Schrecken und Not. »Das kannst du – nicht – das kannst du – nie und nimmer – tun –«
»Es wird getan werden müssen!« Ein feuriger Knabentrotz wühlte plötzlich in ihm. »Wenn Cesare jetzt erfährt, daß die Colonna mich aufgenommen haben und daß Tiziana de' Calvi durch deine Mithilfe entflohen, wird er alles daran setzen, uns zu verderben. Ich habe treue Herzen unter meiner Dienerschaft, es sind Neapolitaner darunter, Barbieri ist hundetreu, geschickt und verwegen, er läßt sich die Tat nur mit meiner Liebe bezahlen –«
»Unseliger! Mit Blut deine Hände besudeln – mit dem Blute meines Bruders – und ich soll Mitwisserin sein – Alfonso – töte deine Gedanken, nicht ihn!« Sie zog ihn, von Ängsten und Nöten durchrüttelt, auf den Rand ihres Bettes nieder und streichelte seine Stirn, hinter der die wildgewordnen Gedanken wie brandende Wogen gingen. Und wahrhaftig ebbte die grausige Flut ab, das ungestüme Herz schlug ruhiger, das sanfte Jünglingsgemüt befreite sich aus der Umklammerung böser Gewalten, und Alfonso schmiegte sich zärtlich an den kostbaren, in Trotz und Verblendung verkannten Leib seines Weibes heran und sog mit durstigen Sinnen die Schönheit ein, an der er so lange vorbeigegangen war. Mit jeder Bewegung seiner streichelnden Hände erschloß sich die empfindsame Natur des Herzogs willig den Zaubern von Schönheit und Liebe, die sich wundersam vor seinen Augen und in seinem Herzen ausbreiteten. Wie verliebte, junge Frühlingskinder tranken sie wortlos die unter Leid erkauften Wonnen seligen Besitzes.
Die Nacht lag schwer über Rom. Aber hier in dem Schlafgemach des Herzogspaares war sie von rosigen Gluten erfüllt, und holde Sterne des Glücks leuchteten hinein. Und es war wie neues Brautglück, das über ihre Seelen zog, und Hymenäos entzündete die Brautfackel neben ihrem Lager und rief seinen brüderlichen Freund Eros aus verschleierten Höhen herab, auf daß er dem neu geschmiedeten Bunde die süße Weihe gebe.
Da brach des Herzogs sinnliche Entsagung in seinem Herzen entzwei.
Durch die Stille der Nacht loderten die Brautfeuer der Liebe. Sie verbrannten die Blutgedanken, und in ihren Lohen schmiedete sich der Glaube an die Schützergewalt des Himmels fest. Das Panzerhemd fiel von dem schönen Jünglingsleib. An der segnenden Macht des Liebesgottes mußte doch die tückische Kraft eines Cesare Borgia zerschellen.
Arme Lukrezia! Armer Alfonso!
Sie ahnten nicht, daß schon in dieser Nacht im Turmzimmer der Borgia im Vatikan über ihre auferstandenen Leiber und Seelen fürchterliches Gericht gehalten wurde.
 Der Blütenflaum des südlichen Frühlings trieb rings um das Schloß Monterotondo aus dem Grün. Und doch war das Fest der Kerzenweihe kaum vorbei. Aber dem Römer machte die Natur sein Sprichwort wahr:
Candelora, inverno va fuora, zu Lichtmeß
flieht der Winter. Die rosenroten Blüten der Mandelbäume in den Kardinalsgärten ballten sich wie riesige Tafelsträuße zusammen, und die ersten Falter taumelten sonnentrunken über die Nektarkelche. In Rom tollte noch der Karneval; hier oben aber, wo die ernste Majestät des Bergschlosses sich aus lachenden Fluren in die Morgennebel erhob, wußte man nichts von der Regentschaft des liederlichen Prinzen, der als Zepter den Narrenstab schwang und das Heer seiner Amoretten in alle Winkel der heiligen Stadt recht unheilig zerstreute. Das Schloß des Giambattista Orsini lugte wohl über die Hügel hinüber nach dem Sodom des Papstes, und der vergrämte Turmwächter glaubte wohl manchmal, wenn er des Nachts auf der Zinne stand, wie im Traum das koboldische Gelächter der Karnevalsgeister zu hören, und er sah, wenn er die alten Augen anstrengte, das Leuchten der feurigen Garben, die opferartig von den Altären der Lust zu einem fröhlichen Gott himmelwärts stiegen. Aber den greisen Lynkäos lockte das Flammen und Brausen da drüben nicht mehr, und er wußte, daß auch in der Burg, die er bewachte, sich kein Herz nach dem Taumel aussehnte. Da unter ihm in den engen Gemächern, die sich im halb gotischen, halb toskanischen Stil aneinanderreihten, wandelten tagsüber nur Menschen mit verschlossenen, stillen Herzen, denen keine Karnevalsfreude aus den Antlitzen leuchtete.
Der Blütenflaum des südlichen Frühlings trieb rings um das Schloß Monterotondo aus dem Grün. Und doch war das Fest der Kerzenweihe kaum vorbei. Aber dem Römer machte die Natur sein Sprichwort wahr:
Candelora, inverno va fuora, zu Lichtmeß
flieht der Winter. Die rosenroten Blüten der Mandelbäume in den Kardinalsgärten ballten sich wie riesige Tafelsträuße zusammen, und die ersten Falter taumelten sonnentrunken über die Nektarkelche. In Rom tollte noch der Karneval; hier oben aber, wo die ernste Majestät des Bergschlosses sich aus lachenden Fluren in die Morgennebel erhob, wußte man nichts von der Regentschaft des liederlichen Prinzen, der als Zepter den Narrenstab schwang und das Heer seiner Amoretten in alle Winkel der heiligen Stadt recht unheilig zerstreute. Das Schloß des Giambattista Orsini lugte wohl über die Hügel hinüber nach dem Sodom des Papstes, und der vergrämte Turmwächter glaubte wohl manchmal, wenn er des Nachts auf der Zinne stand, wie im Traum das koboldische Gelächter der Karnevalsgeister zu hören, und er sah, wenn er die alten Augen anstrengte, das Leuchten der feurigen Garben, die opferartig von den Altären der Lust zu einem fröhlichen Gott himmelwärts stiegen. Aber den greisen Lynkäos lockte das Flammen und Brausen da drüben nicht mehr, und er wußte, daß auch in der Burg, die er bewachte, sich kein Herz nach dem Taumel aussehnte. Da unter ihm in den engen Gemächern, die sich im halb gotischen, halb toskanischen Stil aneinanderreihten, wandelten tagsüber nur Menschen mit verschlossenen, stillen Herzen, denen keine Karnevalsfreude aus den Antlitzen leuchtete.
Als sich die Nebel hoben und silberne Durchsichtigkeit bekamen, blinkten die Berghalden freundlicher und heller. Die Landschaft streckte ihre grünen Brüste sehnend dem ersten Sonnenstrahl entgegen, und die Auen und Tuffhügel dehnten sich weit in die Tiberebene hinunter, wo, jetzt noch von den weißen Dünsten verhüllt, der uralte, von der Geschichte geheiligte Strom sein geschlängeltes Band in den Frühlingsteppich wob. Da jagten, von der frischen Morgenbrise getrieben, die zerrissenen Schleier aus der Tiefe die Hänge hinauf und herunter, entschleierten da und dort die blütenübersäten Hutweiden, auf denen schon die Rinderherden grasten, lösten den Bann, der über dem Gelände lag, und legten die Felsenhänge frei, die steil vom Schloß nach den Wassern niederstießen. Jugendlich ging der Herzschlag der Natur. Das funkelnde Haupt der Sonne erhob sich aus dem rotglühenden Wolkenbett und begrüßte gnädiglich das tuskische Land rings um Monterotondo. Und über den Zinnen und Türmen hetzten die verjagten Nebel davon, und sieghaft begann das italische Celeste aus reinen Höhen zu strahlen. Gold und Rosen streute die junge Aurora über das wellige Grün der Hänge und auf die fernen Bergspitzen, die sich ostwärts aus dem Dunst schälten. Im Norden aber ragte, ein kleiner König, der Soracte mit seiner schimmernden Schneekrone über die Köpfe der Bergvasallen ringsum. Wie ein weißer Schemel lagerte vor seinem Thron eine Wolke.
In diese Wolke träumte Tiziana hinein. Ihre Gestalt drückte sich an die Fensterbrüstung, ihr Arm lehnte in edler Rundung an der Mauer, ihr Oberleib straffte sich, als wollte er zum Fluge anheben und den Gedanken folgen, die jetzt unter der Stirn ins Weite jagten. Die weiße Wolke hatte die Sehnsucht der freiwilligen Schloßgefangenen entfacht. Sie und der Nachklang der Laute, die Tiziana auf das elfenbeinerne Tischchen niedergelegt hatte. Beide hatten ihr die Brust mit heißem Schmerz gefüllt.
Nun zerrann die Wolke gelassen. Bald ward sie zum Nichts, und in purpurner Bläue schimmerte die Bergwand herüber. Ein Vogel flog morgentrunken vorbei und jubelte sein Lied ins Blau. Ein zweiter antwortete aus dem grüngebetteten Haldenhof. Mägde zogen aus der Burg den Hang hinab, wo die schwarzen Pflugstiere, von den saatbestellenden Campagnuolen gelenkt, in schwerem Joch über die dunkle Erde stampften. Knechte ritten auf Maultieren mit weitbauchigen Körben im Sattel ins Land, um Waren einzukaufen. Der Tag hub an.
Tiziana begrüßte ihn jetzt mit ein paar leisen Lautenschlägen.
Da klang eine dünne Stimme an ihr Ohr. »Versonnenes Kind! Ich habe dreimal den Morgengruß gesprochen. Aber Saitenklang macht taub.«
»Er macht nur verträumt, Mutter Ginevra,« sagte Tiziana und küßte der alten Orsini, der Mutter des Kardinals, die Hand. Dann half sie der Greisin in den polsterweichen Stuhl.
»Es war schon einer da und fragte nach dem kranken Kind,« sagte Ginevra unter leichtem Hüsteln und schob die Füße in die warmen Pantoffeln.
Tiziana überhörte mit gerötetem Antlitz die Kunde. Da wiederholte die alte Frau scharf, wie schwerhörige Leute zu tun pflegen, ihre Worte.
Tiziana nahm die purpurblaue Bergwand wieder mit den Augen in ihren Besitz und sagte nur leichthin: »So, so?«
Da glitt ein listiges Lächeln über das Gesicht der Greisin. »Und es wird noch ein andrer aus Rom kommen, von dem Kinde Abschied zu nehmen, das sich nun auf nach Siena machen will.«
»Der Kardinal kommt zurück?« fragte Tiziana mit einer lebhaften Wendung.
»Er hat seinen Knecht vorausgesandt. Eure Kleider sind gepackt?«
»Alles. Morgen, so Gott will, geht es nach Viterbo, dann nach Siena.« Es klang durchaus nicht hoffnungsfroh. Tiziana deckte nun den Frühstückstisch. Jede ihrer Bewegungen war edel und maßvoll, doch ohne Gespreiztheit. Das schöne, griechisch geschnittne Antlitz leuchtete im warmen Ton einer hellen Bronze, Ernst und Anmut verbanden sich darin zu seltenem Reiz, eine hohe Stirn krönte es und hob es in die Sphäre einer bewegten Geistigkeit empor. Gereifte Jugend, ihres Wertes bewußt, doch frei von Stolz und Hoffart, atmete ihr Wesen, das eine glückliche Anlage zur Viragonatur zu besitzen schien, wie sie damals so mancher geistvollen Frau eigen war. Wenn sie in leichter Lässigkeit dahinschritt, die geschwellten Glieder, die alle Krankheit abgestreift hatten, frei gelöst, das ernste und doch so milde Auge vom Abglanz einer tugendhaften Seele erfüllt, glich sie einer hoheitsvollen Vestalin, die unter der Gewohnheit ihres Altardienstes eine priesterliche Gemessenheit in ihre tägliche Erscheinung herübergenommen hat und die Würde ihres Amtes auf ihre Umgebung ausstrahlt.
Tiziana nahm von einer Kammerfrau die Tassen in Empfang und richtete nun sorglich die Colazione, den morgendlichen Imbiß, her, Milch und Eier und das noch warme, nach Honig duftende Weizenbrot, das im Schloß gebacken wurde. Einsilbig saß sie neben der alten Frau.
»Grüßt mir die alte Gaspari, wenn Ihr nach Siena kommt,« sagte Ginevra. »Ihr werdet eine rauhe Reise haben in den toskanischen Bergen, wo noch der Schnee liegt. Man spürt den kalten Hauch noch bis zu uns herüber. Aber ich kann Euch nicht zurückhalten, Donna Tiziana.«
»Mein Herz schlägt hier unfrei,« sagte Tiziana bedrückt. »Die Gastlichkeit des Kardinals verpflichtet mich zu sehr und belastet mich mit einer Schuld, die ich nimmermehr abzahlen kann. Mein Arm ist geheilt, die zwei Monate auf Monterotondo haben mich gesund gemacht. Nie war eine Gefangene von so sanften Ketten gedrückt. Aber nun gibt mir die innere Unruhe die Zügel meines Rosses in die Hand. Marcello Chiaversa hat nach mir gefragt, sagt Ihr?« Auf ihren Wangen leuchtete leises Rot, als spiegelte sich dort der Morgenschein der Bergwand von Scrofano.
Donna Ginevra schlürfte behaglich die warme Milch hinab. »Er ritt früh um das Schloß und winkte einen Gruß zum Fenster herauf, der aber sicherlich Euch galt, denn er lächelte, als säße ein Junges am Fenster.«
»Er muß ja nun auch bald fort,« sagte Tiziana verwirrt. »Und er weiß ja noch nicht, daß ich morgen reise. An einem Tage kamen wir hierher, vielleicht an einem Tage werden wir –«
Draußen polterte es, als stürmte ein wilder Skythe daher. Gleich darauf stand Marcello Gaetani im Zimmer, den Reitermantel umgeworfen, die Sturmhaube und einen Blumenstrauß in den Händen. Er verneigte sich ehrfürchtig vor den Frauen. Frohmut schmückte sein Antlitz, seine Augen blinkten und seine Brust ging hoch. Er sah die schöne Frau an. Welch edle Haltung! dachte er. Jedes Glied des Körpers blütenschön geschwellt, jede Gebärde voll Anmut! Und der Augen tiefdunkles Rätsel! Die Pracht des Haares, der stolze Brauenbogen, der Wangen Rosenglut, von milchigen Tönen gesänftigt, alle Geschenke der Chariten an ihr verschwendet! Ihre Gedanken immer sichtlich bewegt, ihr Herz aber – Gaetani verfinsterte die Brauen – ihr Herz nicht aus dem Gleichmaß zu bringen!
»Ihr habt schon die Runde gemacht?« fragte Tiziana freundlich.
Er nickte. »Unsere Wachen am Tiber haben eine Colonnafähre aufgefunden, dicht bespickt mit Waffen und Kugelbeute.«
»Kein Savelliboot?« atmete Tiziana auf. »Der Madonna sei Dank!«
»Nein. Aber wir erfuhren von der Besatzung neue Märe. Der Herzog von Mailand ist mit seinem Bruder, dem Kardinal Ascanio Sforza, wieder aus dem Exil zurückgekommen, von den Mailändern mit Jubel empfangen. Sie jagten die französischen Herren davon und setzten sich in den Besitz der Stadt.«
»Was geht uns Mailand an?« sagte Tiziana geringschätzig.
»Doch, denn der König von Frankreich, durch die Mailänder so hart bedrängt, hat dem Cesare Borgia die Hilfstruppen für die Eroberung der Romagna entziehen müssen, und der Herzog Valentino ist nun verurteilt, auf die restlichen Städte zu verzichten. Cesares Lieblingstraum ist zerstört und er wird auch die eroberten Städte herausgeben müssen, denke ich, Katharina Sforza wird –«
»Frei aus der Engelsburg gehen?« horchte Tiziana auf.
»Man wird es hoffen können.«
»Es wäre die erste Gnadentat eines Cesare Borgia.« Ihre Stirn hatte sich verdunkelt.
»Können diese armen Blumen Eure Sinne nicht erhellen?« Marcello reichte ihr den Strauß hin.
Tiziana nahm ihn errötend an. »Dank, Ritter Marcello.« Sie legte die Blumen auf die Hirtengedichte des Ovid, die ihr der Kardinal geschenkt. »Hier haben sie einen poetischen Wiesengrund. Kennt Ihr das Buch?«
»In Sermoneta las ich es mit einem Freund –« Er hielt erschrocken inne.
»Wie kommt Ihr nach Sermoneta?«
»Freunde brachten mich manchmal zu den Gaetani,« stotterte er verlegen.
»Ein armes, unglückliches Geschlecht,« sagte Tiziana. »Der Borgia Hand lastet schwer auf ihm.«
Marcello sah schnell weg, um seine Rührung zu verbergen. »Der Kardinal kommt heute von Rom«, sagte er hastig.
Donna Ginevra erhob sich geschäftig. »Und ich höre euch beim Schwatzen zu, statt die Zimmer –«
»Ich will's besorgen,« sagte Tiziana und drückte die alte Frau wieder in den Sessel. »Ritter Marcello wird mir helfen, die Bücher zu ordnen, die der Frater gestern gebracht. Ist er denn nicht Archivarius des Kardinals?«
Sie schritt mit Marcello hinüber nach dem Bibliotheksaal, während sich Donna Ginevra in den Ovid vertiefte.
In der Bibliothek standen die Handschriften, Kopien und Drucke in einem regellosen Durcheinander auf den Wandregalen verkeilt, dann zwischen alten Fragmenten von Basreliefs und Statuentorsos hineingeworfen, und man sah, daß ein gelehrter Geist hier unermüdlich in den Tiefen der Weisheit schürfte. Die gesamte Wissenschaft der Zeit war hier vertreten, alle freien Künste, kirchliche Schriften, die Sammelarbeit florentinischer und römischer Gelehrter in vielfachen Kopien. Und in der Mitte des toskanisch-gotischen Saals, dessen Kreuzgewölbe sich steil nach oben streckte, lagen in massigen Vitrinen die wunderbarsten Gemmen, Edelsteine, Münzen und ausgegrabene Funde der latinischen Erde jeder Art. Hier stand auch der Arbeitstisch des Kardinals, unberührt, so wie ihn sein Herr vor einigen Tagen verlassen. Auf dem Tisch lagen noch Papiere, Dokumente, Versuchsinstrumente und die aufgeschlagenen Sonette des Florentiners Burchiello, dessen satirischer Geist alle Berufe und Stände witzig zerriß. Und auf einem besondern Lesepult lag der handschriftliche Homer, von Poliziano ins Lateinische übertragen. Er schien der Liebling des Kardinals zu sein.
Hier hielten Marcello und Tiziana still.
»Welche Ruhe!« sagte Tiziana seltsam berührt von dem Zauber der Stille, die hier zwischen Staub und ehrwürdiger Schriftweisheit gleichsam gefangen lag. Ihre Worte hallten dumpf von den Wänden.
»Es ist Grabesruhe,« meinte der helläugige Jüngling. »Draußen lacht die Sonne. Arbeiten wir rasch, und dann setz ich Euch aufs Pferd, Donna Tiziana, und wir reiten in die Hügel nach Osten, mitten in die Sonne hinein.«
»Also auf Bücherweisheit wollt Ihr wohl Euer Leben nicht aufbauen, Ritter Marcello? Liebt Ihr sie nicht?«
»O, ich hatte Bücher in Sermoneta –« Wieder hielt er bestürzt inne.
»Ihr weilt ja mit dem Geist oft in Sermoneta, als wäre es Euch eine zweite Heimat.«
»Das ist es auch,« gestand Marcello. Und ein dunkles Rot flammte über seine Wangen.
»Sonderbar!« Tiziana rückte ein paar Bücher in Ordnung. Ihr war, als hätte sie ein Geheimnis in dem Herzen des Jünglings gewittert. Aber sie lenkte rasch ab. »Sagt, wie denkt Ihr – über den Kardinal?«
Marcellos Auge blickte noch einmal so hell. »Kann einem solchen Mann die schwache Kraft eines Jünglingsherzens ein Lob singen? Kümmert es den Löwen, wenn ihn auch die Maus für einen König hält? Er ist ein heiliger Mann und doch ein so wunderbarer Heide.«
»Diese Mischung steht ihm schön,« sagte Tiziana lebhaft bewegt. »Mir ist es immer, als wittere der Kardinal in jedem guten Menschen einen Gedanken Gottes.«
Er schien zerstreut. »Da sind Bücher von San Agostino. Wir wollen sie in den nächsten Tagen ordnen.«
»Das werdet Ihr – von nun an – allein besorgen müssen,« erklärte Tiziana.
»Was – heißt – das?«
»Ich reise morgen für immer fort.«
»Nein?!« Er schnellte nur so seinen Schreck heraus.
»Ihr wart mir ein treuer Kamerad,« sagte Tiziana sanft. »Unsere gepeinigten Herzen fanden durch Zufall ein und dasselbe Asyl. Das helfende Menschentum eines Mannes ward uns zum Hafen, in dem wir für einige Zeit Kräfte sammeln durften. Nun müssen wir in die Welt. Ihr geht, höre ich, demnächst auch in die Marken.«
»Nach Ancona,« nickte er, noch völlig blaß.
»Ich will nach Siena, wo Verwandte meiner verstorbenen Mutter leben. Ihr – Ihr werdet das Geheimnis nicht verraten.«
»Morgen also!« sagte Marcello mit dumpfem Klang. Und der Abglanz des Lenztages auf seiner Stirn war erloschen. Er nahm wie verloren die Bücher in die Hand und stellte sie, ohne sie anzusehen, in eine Reihe.
»Und wann – gedenkt Ihr zu reisen?« fragte Tiziana etwas gedrückt.
»An dem Tag – da Ihr geht – gehe ich auch,« antwortete er und hob die Augen zu ihr auf, in denen die ganze zärtliche Verschwärmtheit eines Knaben schimmerte.
»Und seid Ihr sicher, daß Euch der Kardinal ziehen lassen wird?«
»Ich war sein – Gast, nicht sein Gefangener.«
Nach einer Pause sagte Tiziana beunruhigt: »Ich möchte Euch bitten, nicht schon morgen zu reisen. Dem Kardinal würde es nahegehen, seine Seele ist empfindsam, tut's ihm nicht an.«
»Warum tut Ihr es ihm an?« fragte Marcello mit leiser Herbheit.
Tiziana senkte das Haupt. »Er hat allzuviel Sorge, meine Anwesenheit vor aller Welt zu verschleiern. Er hütet mich wie eine verzauberte Magd, verwandelt sich selbst zum Drachen –« sie lächelte trüb – »damit mir kein Leids geschähe. Auch schwebt er in fortwährender Furcht, von den Seinen verraten zu werden, wenn auch ungewollt –«
»Haben wir nicht alle in jener Nacht in Bracciano Euer Geheimnis in der Brust versargt durch einen Eid? Mußte ich Euch nicht zum Schein nach Viterbo bringen, damit man glaube, Ihr seid dahin entflohen? Es wird ihm, dem Kardinal, ein Leichtes sein, Euern Aufenthalt auch weiter zu verschleiern.«
»Ich habe aber, völlig genesen, nicht das Recht auf seine Gastfreundschaft. Es ziemt sich, zu gehen, bevor diese gekündigt wird.«
Mißstimmung war da. Sie erzeugte eine unbehagliche Stille.
Marcellos bewegtes Herz zerbrach sie endlich. »Wenn Ihr wirklich morgen gehen wollt, dann – soll auch mein Geheimnis fallen.«
Tiziana sah jäh auf. »Ein Geheimnis?«
»Der Name Chiaversa deckt nur das Unglück meines Geschlechts. Und wenn der Name Sermoneta sich öfter auf meine Lippen verirrte, so sprach ihn – das Heimweh aus.«
»Ihr seid –« Tiziana fuhr bestürzt auf. »Ihr seid aus dem Geschlecht der Gaetani?«
»Marcello Gaetani.« Er rückte nahe heran und gab ihr Kunde von seinen Schicksalen.
Sie hörte mit Schaudern das Unheil an. Da stand einer vor ihr, um den sich ein Netz von Häschern schlang wie um sie, dem derselbe Ort, dasselbe ritterliche Herz zur Freistätte geworden war. Was hatte der Himmel mit der Verhängung dieses gemeinsamen Leidertragens vor? Warum warf er sie beide auf diesen kleinen Fleck Erde zusammen?
»Ihr werdet mich nicht verraten,« sagte Marcello innig. »Ich hoffe in Ancona bei einem treuen Freunde Unterschlupf zu finden. Dort starb mein Vater bei einer stürmischen Meerfahrt. Dorthin will ich auch meine Mutter kommen lassen. Die römische Erde brennt mir unter den Füßen. Die Nacht, die die Gewaltherrschaft der Borgia über sie breitet, schreckt mein Gemüt. Es sehnt sich nach den Strahlen des Tages, der über Ancona und seinem Meer für mich aufgehen wird.«
»Eben diese Nacht treibt auch mich in einen freiern Morgen hinein. Der Alp der Borgia lastet auch auf meiner Brust. Ganz Rom seufzt unter diesem Druck, ich aber –« sie senkte das Haupt – »ich habe allen Grund, das Ende dieser Nacht zu ersehnen. Denn der Feind, vor dem Ihr floht, ist auch mein Feind.«
»Cesare Borgia?« Der Name riß sich gewaltsam aus des Jünglings Brust. Sein Atem fauchte. Die Augen leuchteten wild, die Hände hatten sich zur Faust verkrampft. »Donna Tiziana – Ihr verfolgt – von ihm? Bei Gott – dieser Herzog Valentino – o Donna Tiziana! – dieser Herzog wird in meinen Armen stückweis sein Leben lassen müssen!« Er schäumte seinen Knabenzorn heraus und blickte wild wie ein Tyrannenmörder.
Tiziana hatte ihre Ruhe wiedergefunden. Die wilde Empörung ihres Ritters, geboren aus dem edlen Feuer der erwachenden Liebe, verwirrte sie nicht. Ihre aufrechte Seele, die nur Reinheit atmete, schien die Stürme, welche diese Jünglingsbrust entfesselte, ertragen zu können. Ein wehes Lächeln spielte um ihre Lippen, als sie ihn nun mahnte: »Ihr sollt mich in den Mauern dieser Burg gegen Savelli verteidigen, wenn es not tut. Aber den zerstörungssüchtigen Mordplänen eines sonst so braven Knabenkopfes würde unser Schutzherr nimmer seine Billigung geben. Taten, die aus einer Augenblickswallung entspringen, könnten geeignet sein, meine Stellung zu Euch in ein falsches Licht zu setzen. Nein, Ritter, so überrasch will ich meinen guten Leumund nicht verlieren, so leichtsinnig das Schild meiner Frauenehre nicht beflecken lassen.«
Marcellos Trotz aber brach jetzt in Hilflosigkeit, seine Trauer in Bitterkeit zusammen. So stand er erbarmungswürdig vor den Augen der schönen Frau, die nun mit raschem Entschluß über die Verfänglichkeit des Augenblicks hinwegzukommen trachtete. »Kommt in reinere Gefilde, seht, dort liegen Zeichnungen – und da ist auch –« Sie errötete sanft.
Auf einem künstlerisch geschnitzten, mit Silberarabesken verzierten Lesepult lag ein kleiner Karton, auf dem ihr Bild als Madonna gezeichnet war.
Ein Ruf des Erstaunens sprang von Marcellos Lippen. »Wie schön! Das hat dieser –«
»Michelangelo Buonarroti hat das skizziert für die große Statue in der Burgkapelle, die der Kardinal errichtet wissen wollte. Aber es ist alles nur ein Traum gewesen, den der Eigensinn dieses Künstlers zerstört hat.«
»Ich erinnere mich, er war nach Weihnachten hier –«
»Einen Tag blieb er, dann nahm er Reißaus. Er bat schriftlich um Verzeihung, eine Lächerlichkeit hindre ihn, diese Madonna zu bilden –« Tiziana lächelte weh – »seine zerbrochene Nase sei daran schuld – o lacht nicht, Michelangelo verdient es nicht – er schämte sich seiner Häßlichkeit, aus der so schöne Gedanken sprangen.«
»Ja ja, seine Nase hatte zwei Rücken.«
»Das Geschenk eines Neidhammels, der ihm im Streit die Nase zertrümmerte. Und mit dem Andenken läuft der arme Junge mit der feinen, großen Seele nun durch die Welt. Und alle, die ihn sehen, sagen zuerst: wie häßlich! und dann erst: aber er hat schöne Gedanken. Er zeichnete mich damals so schnell ab, als schwänge jemand die Peitsche hinter ihm. Und dann wurde er rot wie ein Mädchen und noch häßlicher als ein Krebs und flüchtete, wortlos, ohne Gruß, ohne Essen, hinaus in die Nacht. Ich glaube sogar, er vergaß den Hut.«
Sie hielt das Blatt in der Hand. Es war eine Rötelzeichnung mit scharfen charakteristischen Strichen. Ein wallendes Idealgewand umhüllte die Glieder Tizianas. Der schöne Oberleib streckte sich in schöner Majestät aus den Hüften. Aus dem Antlitz ging ein Hauch von Gnade und Milde aus, der das Herz jedes Beschauers ergreifen mußte. Über den klaren Augen, von langen Wimpern schwermütig beschattet, spannten sich in sanftem Bogen die Brauen, die Lippen waren halb geöffnet, als flösse eben das Trostwort darüber, und die Stirne war königlich, doch ohne Stolz geformt. Aus der zeichnerischen Skizze ersah man schon die monumentale Anlage der Figur. Mit einer tröstenden Geste hob sich die rechte Hand, ganz leicht gebogen, in wunderbarer Rundung vom Oberkörper weg und blieb doch innerhalb des Rhythmus von Form und Linie.
Marcello vertrank sich in ihre Schönheit wie der Falter im berauschenden Duft der Rosen. Das Herz spannte seine Forderungen hoch über sein Alter hinaus, das sonst gewöhnlich vor den knospenhaften, angedeuteten Mädchenreizen die Altäre der Verliebtheit zu bauen pflegte. Sein schwärmender Sinn ließ sich gerne gefangennehmen von diesem jetzt halb abgewandten Antlitz, das aus der schwarzen Umwallung des Haares wie der Iriskelch aus dämmerdunklen Gartengründen herausleuchtete, und sein Auge koste und küßte diese Lippen, gleich von Tau beträufelten Sommerrosen schimmernd, und er tauchte in die Abgrundtiefe dieser nachtschwarzen Sterne, hinter denen geheimnisvolle Regungen der Seele verborgen zu liegen schienen. Die alte Weise, die von Glück und Not zweier Königskinder erzählt, hub in ihm zu klingen an, und er stellte in schmerzlicher Verschwärmtheit Tiziana und sich als die hungrigen Abenteurer mitten in den Märchentraum hinein. Er wußte gar nicht, wie das jetzt gekommen war, daß er zu ihren Füßen lag, wie ein in seine Königin verliebter Page kniend, das Haupt mit den braunen Locken gesenkt, die Hände beteuernd an die Brust gepreßt, hochatmend und von Seufzern bedrängt. »Madonna! Madonna!« In der rührenden Erhöhung zur Gottheit fand er den einzigen tönenden Ausdruck für seine Gefühle.
Da legte sich Tizianas Hand auf seinen Scheitel. Die zärtliche Berührung durchschauerte ihn. Und mit raschem Ungestüm erfaßte er ihre Hand und küßte seine Glut in sie hinein.
Tiziana spürte die Finger brennen. Sie riß die Hand aus seiner Umklammerung. »Kleiner Tor,« sagte sie mit gepreßtem Lächeln, »das darf nie und nimmer sein. Hütet Euch, mein Mitleid auszunützen.« Und mit rascher Wendung gegen den Hof sagte sie plötzlich: »Der Kardinal kommt! Seine Hunde jagen gegen das Tor.«
Der Jüngling sprang auf. Mit einer leichten Handbewegung strich er sich die Haare aus der Stirn, als wollte er die Verwirrung verscheuchen, denn seine knabenhaft weichen Züge waren zerrissen. Nun gab er sich Mühe, die ritterliche Haltung wiederzugewinnen, die sonst einen Zug seines Wesens bildete.
Da tönte das Gekläff der Rüden. Die Burgwachen im Tor sprangen empor und ergriffen die Lanzen.
Tiziana riß das Fenster auf. Aus dem dunklen Torweg ritt der Kardinal Orsini in das Sonnengold des Hallenhofes hinein. Sein erster Blick traf das Fenster, dessen Flügel jetzt so ungestüm geöffnet wurden. Ein Lächeln, sonnigwarm wie der Frühlingstag, der seine goldnen Lichter über die Backsteinmauern warf, grüßte das schöne Frauenbild.
Im Halbschatten des Saals aber zitterte ein Knabe voll Bangigkeit und Weh.
 Der Kardinal übersah mit Freude die trauliche Halle, wo sein wissensdurstiger Sinn alltäglich von den Quellen der Weisheit und Schönheit trank. Und als sich ihm die Hand Tizianas entgegenstreckte, tauchte er mit seinem warmen Blick tief in ihre Augen.
Der Kardinal übersah mit Freude die trauliche Halle, wo sein wissensdurstiger Sinn alltäglich von den Quellen der Weisheit und Schönheit trank. Und als sich ihm die Hand Tizianas entgegenstreckte, tauchte er mit seinem warmen Blick tief in ihre Augen.
»Ihr bringt Lenzgeruch mit, Kardinal,« sagte Tiziana mit hellschwingender Stimme.
Giambattista drückte Marcello die Hand. »Knabe, Ihr seht zerzaust aus. Welcher heidnische Gott ist Euch erschienen?«
Marcello zauberte schnell ein Lächeln auf sein verstörtes Gesicht. Der Kardinal machte sich beziehungsvolle Gedanken. Doch spiegelte sich keiner von ihnen in seinem Antlitz wider. Mit jäher Wendung trat er auf Tiziana zu, die einen seiner Hunde gestreichelt hatte. »Seid herzlichst gegrüßt, Ihr seid in den wenigen Tagen noch voller und schöner geworden. Das Wunder der Genesung leuchtet aus Euren Zügen. Der Lenz ist ein milder Arzt.«
»Sein Hauch berührt die Schläfen wie eine milde Blütenhand und alle bösen Gedanken fallen ab,« sagte sie versonnen.
»Hat Donna Tiziana auch böse Gedanken?« fragte Giambattista mit heller Stirn. »Das zerbräche die platonische Harmonie. Der Gedanke gestaltet sich im Ebenmaß mit der Schönheit der Seele. Wie könnte sich Tugend aus einem bösen Gedanken entwickeln? Aber ich komme von Rom und habe andre Dinge auszupacken als sittliche Lehren.« Er rückte die Stühle an den Studiertisch heran. »Ihr wißt, Donna Tiziana, daß ich Abschied nehme von Euch, denn Ihr reiset morgen. Ihr habt doch Euern braven Kavalier schon eingeweiht?«
Marcello nickte und sagte beengt: »Auch ich habe heute die letzten Schleier gelüftet, Kardinal. Der Ritter Chiaversa hat die Maske abgeworfen und den Unglücksnamen seines Geschlechts angenommen.«
»So bringe ich Euch denn frohe Kunde, Marcello. Eure Mutter ist wohlbehalten in Neapel angekommen.«
»Ah!« Die Freude ließ ihn zu des Kardinals Füßen niedersinken.
»Die Arme Cesares strecken sich nicht mehr nach ihr aus. Wohl schmachtet Giacomo Gaetani noch in der Engelsburg, Guglielmo ist glücklich nach Mantua entkommen, aber es scheint, daß die Borgia fürstliche Gnade walten lassen wollen über den Trümmern des Hauses Gaetani. Euer Weg nach Ancona ist frei.«
Marcello erhob sich mit leuchtendem Blick. »Mein Herz strömt in Dankbarkeit über.«
»Bevor Ihr nach Ancona reiset, habe ich aber noch eine Bitte an Euch.« Des Kardinals Stimme wurde leiser.
»Sie ist erfüllt, noch ehe sie ausgesprochen.« Marcello ergriff in überwallender Innigkeit des Wirtes Hand.
»Diese edle Frau wird morgen nach Siena reisen. Sie braucht einen Schutz auf der unsichern Straße. Söldlingshaufen, Abenteurer, Diebe, Räuber erfüllen jetzt die Berge. Notdürftig beschützt sie der treue Tolomei. Wollt Ihr Donna Tiziana mit drei Knechten das Geleit geben?«
Marcellos Augen strahlten. Zügellos und verräterisch strömte seine heiße Empfindung hervor. »Euer Wunsch ist der meine.«
»Wenn Ihr diesen Spazierritt nach Siena hinter Euch habt, könnt Ihr über den umbrischen Apennin in die Mark reiten.«
Marcellos Herz schlug heftig. »So sind die Tage der Geborgenheit zu Ende. Im Glück ergreift mich Weh. Gott beschützte mich durch Euch vor Cesares Armen. Milde legtet Ihr mir die Fessel an, erhobt mich zu Eurem Archivarius, vergönntet mir, der Feierstunde ernste Freude mit Euch zu teilen, gabt mir die Freiheit, dieses Schloß wie das meinige zu begehen, und ließet mich, mein Glück zu vollenden, Ritter der hehrsten aller Frauen sein. Zur zweiten Heimat wurde mir die Burg. Mir ward das Glück, Euch einen Vater und Freund nennen zu dürfen, und mit Beschämung stehe ich am Ende dieser Tage vor Euch und weiß nicht, wie ich die Schuld abzahlen soll, die Eure Huld in meiner Brust aufgehäuft.«
Der Kardinal wies sanft seine Hand von sich. »Ich wollte Euch die Wege ebnen zu einem neuen Leben. Als Dank erwarte ich nichts als Treue, das seltene Geschenk in dieser falschen Zeit. Wenn Ihr in Ancona seid, gedenkt der Tage, die Euch der Orsini mit ein wenig Freude würzen wollte, und will es Gott, daß mich ein Bedrängnis heimsucht, dann, könnt Ihr's in Ehren tun, stellt Euch an meine Seite und verteidigt mich. Aber ich hoffe, es bleibt Euch erspart.«
»Vor dieser Frau, die unsres still geschloßnen Treubunds Zeugin war, schwöre ich's, für Euch das Schwert zu ziehen in schweren Tagen, Freundschaft zu hegen und Eure Ehre zu verteidigen mit Freimut und Kraft.«
Der Kardinal sah seinen Schützling ernst an. »Heilig ist die Stunde, wo sich das Herz begeistert einem Freunde schenkt.« Er drückte die knabenweiche Hand mit überströmendem Gefühl. »Und Gott verhüt' es, daß in der Freude du den Freund vergißt.« Er warf einen kurzen, aber warmen Blick auf Tiziana, an deren Ohr die rauschenden Quellen von Freundschaft und Schwertbrüderschaft vorüberbrausten, und die nun auch das innere Ohr geöffnet hatte und etwas bedrängt die Weihe dieser Stunde empfand.
Der Blick des Kardinals rettete sie aus verfänglichen Gedanken.
»Donna Tiziana, ich bringe Euch kein heitres Geschenk aus Rom,« sagte Giambattista jetzt mit verfinsterter Stirn.
Tiziana durchfuhr der Schreck. »Ist meine Spur entdeckt?«
Der Kardinal verneinte. »Die Herzogin Lukrezia soll unglücklich sein, daß Eure Spur verloren ist. Ich verriet nichts.«
»Die Gute! Liebe! Sie war mir mehr Freundin als Herzogin.«
»Ich erfuhr mehr von ihr,« sagte der Kardinal bedrückt. »Euer Vater ist krank, schwer krank.«
»Mein Vater?!«
»Er bereut es, Euch in die Arme dieses Savelli gejagt zu haben.«
»O, mein Vater!« Das Bild des reuigen Vaters verdrängte das des grausamen in ihrem Herzen. Und wenn er nun starb? O, über die Leiche des Vaters hinweg würde die Hetzjagd nach ihr durch Luigi Savelli aufs neue beginnen. Die Schatten dieser Angst dunkelten in ihren Blicken.
Giambattista erriet ihre Gedanken. »Im Augenblick haben die Savelli eine falsche Fährte aufgenommen. Luigi fuhr nach Genua.«
»O, leite ihn Gott weiter in ein Labyrinth von Spuren!« betete Tiziana.
»Noch eines: Man erwartet Cesare Borgia aus der Romagna zurück.«
Tiziana und Marcello rückten angstvoll heran.
»Ganz Rom rüstet zu einem feierlichen Empfang des Herzogs Valentino. Wenn er zurück ist, dürfte er zuerst daran denken, seine persönlichen Abenteuer, die der Schrecken aller Mütter und Ehegatten sind, ins Werk zu setzen.«
»Laßt mich ihm das Schwert –« züngelte Marcello empor und pflanzte sich wie ein schirmender Mars vor der zusammengeschreckten Tiziana auf.
»Was faßt Euch an?« Mit Verwunderung sah der Kardinal die seltsame Empörung in des Knaben Antlitz flammen.
Da bekam Marcellos Wildheit einen Bruch. Seine Leidenschaft war zum Verräter geworden. Ihn überkam Reue. Das Wogen seiner eifersüchtigen Brust ließ nach.
Der Kardinal warf seine äußerliche Gelassenheit in den Aufruhr des Augenblicks hinein. »Mordsüchtiger Held! Ihr steckt Euch herkulische Ziele. Aber ich rate Euch, lieber still nach der Mark Ancona zu reiten und dort Salat zu pflanzen, als Euch in das Racheabenteuer von Rom zu stürzen. Begnügt Euch damit, edel und tugendhaft zu bleiben. Verschwörer, sie mögen es noch so ehrlich meinen, haben am Ende doch neben dem Märtyrerkranz das Blutmal im Antlitz leuchten. Über Eueren katilinarischen Eifer habe ich vergessen, Donna Tiziana Bescheid zu sagen.« Er wandte sich gedrückt zu der angstvoll harrenden Frau. »Nehmt Eure Kraft zusammen, es ist Nachricht aus – Siena gekommen.«
»Von Gaspari?«
»Donna Bianca Gaspari –«
»Kardinal – Eure Augen sagen – o, sprecht, sprecht –«
»Die edle Frau – ist nicht mehr.«
»Madonna!« Tiziana fiel entsetzt in die Lehne zurück. »Kardinal – das kann nimmer – o! o! Das kann nicht –« Sie riß die Hand des Kardinals an sich. »Donna Bianca – tot?«
»Vor einer Woche senkten sie den edlen Leib in die Erde.« Des Kardinals tröstende Hand fuhr leise über den glänzenden Scheitel der im Schmerz dahingesunknen Frau.
Ehrfurcht vor der Heiligkeit dieses Schmerzes trieb Marcello abseits und er näherte sich dem Lesepult, auf welchem das Bild Tizianas lag. Dort blieb er in stummer, stiller Betrachtung stehen.
Tiziana hob den Kopf. »Nun ist mein Dasein zwecklos.« Es klang wie ein Abschied an das Leben.
»Sagt das nicht, Donna Tiziana,« unterbrach sie der Kardinal mit patriarchalischer Milde. »Der schwere Augenblick verdunkelt das Gemüt, und alle Entscheidungen des Menschenherzens sind wie aus fremder Brust geboren.«
»Was verhängt Gott da über mich?« fragte sie erschauernd.
»Die Frage ist so tief menschlich,« sagte der Kardinal, »daß wir Gott damit nicht weh tun. Wann verstehen wir ihn denn überhaupt? Was soll unser kleiner Verstand mit seinen Ratschlüssen anfangen? Nehmt Abstand von dem Unglück, auf daß Ihr es in seiner wahren Größe seht, dann wird es Euch vielleicht nicht einmal so groß erscheinen. Donna Bianca ist tot. Dort in Siena ist mit dieser Frau auch ein schöner Zukunftstraum gestorben für Euch. Oder irre ich mich?«
»Mit ihrem Tode sind die Brücken abgebrochen, die mein Leben mit dem Haus Gaspari verbanden.« Tiziana starrte mit verlornem Blick in den Sonnenschein. Was war ihr diese Sonne jetzt, die das vor ihr liegende Dunkel des Lebensweges nicht erhellen konnte? Es war Nacht in ihr geworden, trostlose Nacht, überall, wohin ihre Gedanken tasteten, lag die verschloßne Tür des Wortes: unmöglich. Rom, wo die Feinde lauerten, Siena, das vom Tod berührte und für sie zerschlagne Haus, die latinischen Städte, wo kein Zweig ihrer Familie lebte – da hellten sich plötzlich ihre Augen auf.
»Es gäbe einen Ort,« sagte sie wie traumverloren, »wo das Unglück unter den sanftern Erquickungen der Religion seine Härte verlöre, wo die Quellen der Christusworte in das verzagte Herz rauschten, ein Asyl, vor dessen geheiligter Schwelle auch die Verfolgungswut des furchtbaren Bräutigams Halt machen müßte.« Und sie zeichnete sich diesen Zufluchtsort mit freundlichen Linien in das Himmelsblau. Sie sah die Mauern unter dem milden Strahl des Abends glühen, überragt von dem Kreuzturm, aus dessen Glockenstube die erzne Stimme zur Hora rief, sie sah die weißen Gestalten der frommen Frauen zwischen den wilden Gartenhecken mit tief versenkter Seele wandeln, Psalmbuch, Betkranz und das goldne Kreuzlein in den Händen, und sie hörte den leidlösenden Gesang der Schwestern vom Chor der kleinen Kirche hallen und sah den Weihrauch seine Wolkengirlanden um Gold und Silber schwingen. Und die Kirche verdämmerte, durch die Fenster schimmerte das Rosenrot des Untergangs, das sich über dem Monte Maggiore zu einer himmlischen Aureole entzündete. Da jagte ihre Sehnsucht die Worte heraus: »Kardinal – ich will zu den Klosterfrauen von Santa Chiara gehen und dort das große Gelübde ablegen.«
Der Wunsch kam Giambattista nicht unerwartet. Aber seine Augen verdunkelten sich. »Der Ausweg ehrt Euer Denken, Donna Tiziana,« sagte er sanft, »denn wohl ist es ein bewundernswertes Gefühl, wenn sich die Weltverschmähung bis zum Frieden Gottes durchringt. Aber bedenkt es wohl, die schöne Beweglichkeit Eures Geistes, der durchdringende Verstand, der sich so mannigfach mit den Erscheinungen der Welt abmüht, einer Welt, die doch am Ende auch eine Welt des Schöpfers ist, Euer sonnenhelles Gemüt, über das jetzt nur die Wolken des Leides schatten, Eure blühende Jugend, die in sich selbst die Widerstände der Entsagung schmerzlich fühlen wird, die Erinnerung an verlorne Aufgaben, die Euch das Leben gestellt und noch stellen könnte, an das reiche Wirken, das Eurer Frauenseele noch bevorsteht im geschäftigen Treiben der Welt o, prüft das alles, bevor Ihr handelt. Ich könnte Euch ein andres Bild malen, Donna Tiziana.«
»Und ich bitte Euch, es zu tun,« sagte sie etwas gedrückt.
»Dem Mai entsagen, dem Blütenlächeln der Freude? Brevier und Legende zum abwechslungslosen Inhalt Eures Lebens machen? Allein zu sein mit Eurer Brust! Grausiges Wort: allein! Vor dem die Freude erschauert und das Glück sich ängstlich wegstiehlt. O, die Welt wird Euch enge werden in diesen Freudebezirken, der aufgeweckte Geist wird sich in den Gebeten einer Horastunde nicht unbeirrt bewegen können und statt des Klosterfriedens wird Euch eines Kerkers abgetöntes Grau umdüstern.«
»Kardinal!« schauerte Tizians zusammen.
»Ihr wart gewohnt, des Lebens üppige Bilder zu schauen, und nun soll Euch die Schwermut eines ewigen Herbstes die Frühlingstage Eurer Seele umnebeln. Ja, es könnte leicht geschehen, daß der Himmelsruf zur wehen Posaune wird, die in Eure Psalmen hallt, daß Grabglockenruf die Melodie Eures Lebens singt. Und wird das junge Nonnenherz, von Sehnsucht übervoll, das todesmatte Wimmern der Gewissensglocken ertragen können? In den Winkeln der Klostergänge werden Euch Gespenster narren, von Euch vertriebene Erinnerungen, die von des Lebens schöner Unrast Euch erzählen, und Euer Schleier wird nicht die süßen Gebetsworte Christi auffangen, sondern die Tränen der Reue. Keine Maienkränze, nur Blumen, aus dem Gram der Herzenseinsamkeit entsprossen, werden Euch blühen, Myrte und Rosmarin sind verdrängt vom traurigen Glanz der Astern, die Lider der Dulderin rötet die unversiegbare Träne, und im Siechtum der Seele zerbröckelt der Leib, des Lebens schöne Form, und fallen die Blütenblätter, die Euch zur allerschönsten Rose im irdischen Garten Gottes –« Bestürzt hielt der Kardinal inne. Er war aufgesprungen und schritt nun rasch ans Fenster.
Tiziana war wie ein stilles, von Schauern überrieseltes Beichtkind dagesessen, das sein Herz den Mahnrufen des edelsten Priesters öffnet. Jetzt zuckte sie unwillkürlich zusammen. Das Ende der Bußpredigt glühte in ihre schamfrohe Frauenseele hinein. Das Weltkind, das eben ihre Wünsche ertötet hatte, regte sich wieder und begann den Kampf mit der Klosternovize.
Marcello aber hatte die malerischen Gedankenbilder des Kardinals mit der zustimmenden Freude seines Jünglingsherzens verfolgt. Den ernsten Warner grüßte sein Herz mit verhaltener Glut. Doch als er sah, wie die Beredsamkeit des Kardinals in einer Huldigung vor den Reizen Tizianas ausflutete, stieg ihm das Blut heiß zu Herzen.
Giambattista hatte die Zügel seines davongaloppierten Gefühls gleich wieder in den Händen. Er sah die verwirrte Frau freundlicher an und sagte: »Ich habe vielleicht allzu lebhaft gemalt, Donna Tiziana, schabt etwas Farbe von dem Gemälde ab.«
Tiziana hob traurig das Haupt. »Habe ich einen andern Ausweg?«
Der Kardinal nickte ernst. Auf seinem Antlitz war die Schwere abzulesen, die seine Brust bedrückte. »Der Ausweg ist der, daß Ihr keinen mehr sucht. Daß Ihr der Geborgenheit hier so lange vertraut, bis sich von selbst ein Ausweg findet.«
Tiziana sah ihn groß und angstvoll an. »Ich soll – hier – bleiben?«
Der Kardinal antwortete bewegt: »Nennt es immerhin eine Art Gefangenschaft. Auf dem Grunde Eures Herzens wurzelt doch Eure freie Entschließung. Wenn Ihr Euch draußen sicherer fühlt als hier, stehen meine Pferde bereit.«
Da kämpfte sich Tiziana mit aufgeregtem Gemüt von dem Gedanken weg. »Nimmermehr. Ohne zwingenden Grund Eure Gastfreundschaft mißbrauchen –«
»Die Gefahr für Euer Leben nennt Ihr keinen zwingenden Grund?«
»Euch im Hause liegen wie eine zudringliche Bettlerin –«
»Donna Tiziana!«
»Mich einnisten wie eine Motte, Euch in den Verdacht bringen, gegen meine Feinde zu konspirieren, Zwietracht werfen in Euer friedliches Haus, die lebendige Ursache sein für den neu auflodernden Hader zwischen Orsini und Colonna!«
»Die Not will Wahrheit haben.« Mit Leidenschaftlichkeit jagte der Kardinal die Gefahr vor ihre Seele. »Hört denn, was sich draußen begibt. Orsiniknechte haben einen Colonna erschlagen. Das wilde Geschlecht wütet. Giovanni Orsini und sein Sohn Renzo, Jacopo Santa Croce, der junge d'Alviano haben sich auf Monte Giordano im Orsinipalast eingeschlossen. In den nächsten Tagen wird der Kampfruf durch die Straßen Roms schallen: Orsini! Colonna! Der junge Heißsporn Fabio Orsini hat den Feuerbrand in den Colonnapalast geworfen. Fabrizio Colonna ist im Anmarsch von San Marino. In diesem Augenblick kann der Kampf entfacht sein, wenn nicht die päpstlichen Truppen sich dazwischen werfen, wenn nicht Cesare Borgia kommt. Die Savelli haben sich an die Seite der Colonna geworfen und ihre Reiter durchstreifen die Campagna. Ich kam hierher, damit das Schloß seinen Herrn habe, wenn es zum Äußersten kommen sollte. Aber Monterotondo war immer ein hesperidisches Eiland in der Fehdewoge der Geschlechter. Bracciano werden sie anrennen, Cere, Galera und Isola, aber vor diesen Toren werden sie wie immer ehrfürchtig Halt machen. So sicher bin ich meines Gottes, daß ich die Wachen einziehen könnte und, der Sorge meiner Freunde spottend, ohne Panzerhemd, ohne Degen, ohne Diener einen lustigen Ritt über die grünen Berghalden versuchen wollte. Gilt Euch diese Sicherung nichts, Donna Tiziana?«
»Kardinal, wie lange wird sie anhalten? So lange, bis man weiß, daß Ihr das Wild, nach dem die Savelli jagen, in Eurem Gehege schützt. Oder glaubt Ihr, Wut und Zorn der Colonna werden vor dem Engel der Gelehrsamkeit zu Lämmersanftmut zusammenschrumpfen?«
»So fest ist mein Glaube, daß ich es in die Lüfte schreien möchte: ›Seht, hier ist Tiziana de' Calvi! Mein guter Stern! Wagt es doch, ihn mir zu –‹« Er hielt erschreckt inne. Glut durchströmte sein Antlitz.
In der Ecke, vor dem Bilde der so stürmisch verteidigten Frau, fiel aus den Händen Marcellos ein dicker Foliant zu Boden, die Chronik von Monterotondo. Der dumpfe kurze Schall klang, als hätte eine zornige Hand das Buch zu Boden geschleudert.
Tiziana sah erschrocken den Kardinal an. Was drohte ihr so heiß aus diesen sonst so johannesmilden Blicken? Was gab ihm so frohe Begeisterung? So hohen, über sich hinauswachsenden Mut? Verschwendete er seine flammende Beredsamkeit, um ihr den Abschied schwer zu machen? Ja, dachte sie denn noch an den Abschied? O, wenn nur nicht dieses jubelnde Wehren gewesen wäre, das sich um ihr Bleiben da vor ihr abspielte! Da galt es, den Kopf oben zu behalten, denn es ging um ihre Frauenwürde. Tiziana streckte dem Kardinal die Hand entgegen: »Nichts für ungut, aber – es könnten hier Dinge vorgehen, die mich zwingen müßten zu bereuen, daß ich – hier geblieben.« Und noch freier fügte sie hinzu: »Solange die Landschaft in hellem Aufruhr ist, nehme ich Eure Gastfreundschaft mit Dank an, Kardinal. Aber nachher laßt mir die Rosse satteln und gebt mir Ritter Marcello zum Begleiter nach –« Sie stockte.
»Nach?« fragte der Kardinal gespannt.
»Nach Rom.« Es klang Trotz darin.
Der Kardinal sah sie verdutzt an. »Ihr wollt Euch selbst in die Höhle des Drachen –«
»Luigi Savelli wird über die leichte Beute frohlocken,« sagte sie mit einem erkünstelten Leichtsinn. »Und vielleicht wird er gnädiger sein, als meine Angst es sich träumt.«
Giambattista fühlte, das war eine ertrotzte Ergebenheit, mit der sich Tiziana das Zeichen der Aufopferung auf die Stirn drückte. »Ich kann Euch nicht zwingen, Donna Tiziana,« sagte er milde. Dann wandte er sich an Marcello. »Und Ihr?«
»Herr – mit Eurer Erlaubnis laßt mich bleiben, bis –«
»Bis Donna Tiziana der Burg Lebewohl sagt.« Es war ein wohlgezielter, klingender Schuß. Aber er war von keiner Feindeshand getan. Der Kardinal lächelte und hatte dieses Lächeln so in seiner Gewalt, daß man es ihm nicht ansah, wie schwer es mit einer innern Träne kämpfte. Er drückte dem Gastfreund die Hand und sagte warm: »Diese Burg ist eine seltsame Freistätte geworden. Zuerst Riario, dann Ihr und Donna Tiziana! Über dem Burgtor scheint das Wort des Herrn zu leuchten: Kommt, die ihr mühselig und beladen seid.«
Hell lag die Sonne über dem Burghof. Farbenprächtige Diener des Kardinals ritten auf und ab. Der Tag war schön, lustig klangen die Stimmen des erwachenden Frühlings durchs Fenster. Das Blau strahlte den Gruß Gottes auf die latinische Welt. Die ärmsten Gräser in den Mauerritzen und zwischen den Hofsteinen, die Stiefkinder der Blumengöttin, streckten ihre graugrünen Leiber dem Licht der segnenden Sonne entgegen, und die windbewegten Ranken auf den Pfeilern der Bogenhallen flatterten wie grüne Fähnlein.
Ein Reitertroß sprengte in den Burghof. Der Kammerherr des Kardinals, der alte Jacopo Landini, führte ihn an.
Bald darauf stand er selbst auf der Schwelle. »Auf Monte Giordano ist der Kampf entbrannt zwischen Orsini und Colonna,« meldete er, vom Ritt erhitzt.
»Menschenmord und Zerstörung um den Wahn, der Erste in Rom zu sein!« rief der Kardinal betrübt aus. »Und der Papst lacht sich ins Fäustchen, und über den sich selbst mordenden Adel schlägt er heimlich das Kreuzzeichen und segnet den Tag, da er den übriggebliebenen Sieger zu Boden schmettern wird. Verblendete Orsini! Unglückliche Colonna! Wann erwacht ihr aus eurem Traum, die Tyrannen Roms werden zu können?«
Und seine Klage, aus dem vaterlandsstolzen Herzen geboren, drang tief in Tizianas Brust. Aber das stürmische Jünglingsherz Marcellos vermochte ihr nicht zu folgen. Dem letzten Sproß der Gaetani brannten die Feuer der Liebe, Eifersucht, Rache und Fehdelust das Herz wund. Und er griff unwillkürlich nach der Hüfte, wo sonst das Schwertgehänge saß. Dreinschlagen wollte er. Um diese Tiziana! Der Name bekam den Klang eines Kampfrufes für ihn. Und sie selbst wuchs vor seinen Augen zur lieblichen Andromeda empor, die er mit dem Perseusschwert befreien wollte aus den Ketten, die sich unsichtbar in den Mauern dieser Burg um ihre Seele legten.
 Der Name Cesare Borgia wirkte Wunder. Er fiel plötzlich in den Kampfruf: Orsini! Colonna! hinein wie der donnernde, zürnende Hall der Ägis. Als im Morgengrauen durch die Straßen Roms die Haufen der Söldlinge wogten und Degen, Lanzen, Schwerter und Schilde aufeinanderprallten, als aus dem Colonnapalast auf dem Apostelplatz die Feuer schlugen und hoch aufgetürmte Holzbarrikaden vor den Häusern der Orsini und Colonna in Brand gerieten, so daß die Gluten und Schwelen die düstern, vom Dämmerungsgrau umsponnenen engen Straßen füllten, in denen die schweren absperrenden Eisenketten vom Anprall der Wurfgeschosse klirrten, als das Schießen, Steinewerfen und Menschenschlachten in den festungsartig verrammelten Vierteln der Geschlechter den Höhepunkt erreicht hatte und sich die feindlichen Leiber der Söldlinge ineinander verkeilt und verschlungen hatten wie Lapithen und Kentauren, als in den Thermenresten und Tempeltrümmern die ohrenzerreißenden Kampfrufe der Parteien die Luft erschütterten, erscholl plötzlich Fanfarenruf aus der Richtung der Engelsburg.
Der Name Cesare Borgia wirkte Wunder. Er fiel plötzlich in den Kampfruf: Orsini! Colonna! hinein wie der donnernde, zürnende Hall der Ägis. Als im Morgengrauen durch die Straßen Roms die Haufen der Söldlinge wogten und Degen, Lanzen, Schwerter und Schilde aufeinanderprallten, als aus dem Colonnapalast auf dem Apostelplatz die Feuer schlugen und hoch aufgetürmte Holzbarrikaden vor den Häusern der Orsini und Colonna in Brand gerieten, so daß die Gluten und Schwelen die düstern, vom Dämmerungsgrau umsponnenen engen Straßen füllten, in denen die schweren absperrenden Eisenketten vom Anprall der Wurfgeschosse klirrten, als das Schießen, Steinewerfen und Menschenschlachten in den festungsartig verrammelten Vierteln der Geschlechter den Höhepunkt erreicht hatte und sich die feindlichen Leiber der Söldlinge ineinander verkeilt und verschlungen hatten wie Lapithen und Kentauren, als in den Thermenresten und Tempeltrümmern die ohrenzerreißenden Kampfrufe der Parteien die Luft erschütterten, erscholl plötzlich Fanfarenruf aus der Richtung der Engelsburg.
Die angstzitternden Römer horchten den kampfstillenden Tönen. Von Lanzenreitern umringt, den Helm mit dem gelbroten Federbusch in den Nacken gedrückt, die Menge streng musternd, ritt der päpstliche Kapitän Rodrigo Borgia, ein Neffe des Papstes, in das in hellem Aufruhr flammende Orsiniviertel Monte Giordano. Er kündete den müdgekämpften Parteien den drohenden Wunsch des Papstes an: »Im Namen Seiner Heiligkeit Friede und Ruhe! Cesare Borgia rückt heran!«
Wie die Flamme unter dem zischenden Anprall der Wasserwogen zusammenprasselt, so verlosch plötzlich die Kampfwut, als das Nahen des Herzogs Valentino angekündigt wurde. Es war eine List des Papstes, denn noch war der Herzog nicht im Anmarsch. Aber die römische Not und die eigene Gefahr brachten Alexander auf den Gedanken, den Zauber des Schreckensnamens Cesare Borgia zu erproben. Das Geschrei verhallte allmählich, die wütenden Haufen sprengten aneinander vorüber, die Brände aus den Türmen und Barrikaden verwandelten sich in aufqualmende Rauchsäulen, in denen der Frührotschein spielte, und bald hallten nur mehr die trabenden Hufe der Papstreiter durch die Straßen, während sich die Vasallen der Orsini und Colonna in ihre Paläste zurückzogen und sich dort verbarrikadierten. Über still gewordene, zerfetzte und verblutende Menschenleiber hob sich die Sonne.
Prinz Karneval hatte ein blutiges Antlitz bekommen. Aber bald lächelte er zwischen den Wunden hervor und pochte gebieterisch auf seine lustigen Rechte. Schon in der nächsten Nacht hörte man in den Straßen die Canti carnascialeschi und die Canzoni a ballo des Medici singen, die verliebten Römerknaben huschten mit den schwarzäugigen Mädchen durch die engen Gäßchen der schmutzigen Lasterviertel, von Bacchus freundlich gesegnete Häuflein lärmten an den verrammelten Palasttoren vorbei, Kommissare verkündeten das Programm der Fastnacht, und ganz Rom freute sich auf das bevorstehende Judenrennen, wobei Abrahams ungelenke Söhne vom Campo di fiore bis zur Engelsburg um den Preis eines roten Seidentuches unter dem Spottgelächter der römischen Christenheit sich die Lunge aus dem Leib galoppieren mußten. Die vornehmere Welt freute sich auf das Rennen der Berberhengste, welchem zum Schluß noch das Wettlaufen der schwarzen Büffel und Esel folgen sollte. Dann sah man durch die Straßen Roms die Stiere ziehen, die für Cesares Kampfspiel auf dem Petersplatz ausersehen waren. Während draußen vor den Bronzetüren des Domes die Grausamkeit der Catalani ihre Triumphe feiern wollte, sollten bedrängte Beterherzen in den Beichtstühlen für das Heil ihrer Seelen den Himmel anrufen.
Mitten im Karnevalstaumel saß in vornehmer Haft die noch immer schöne Katharina Sforza, die Cesares Kriegsglück zu Boden geworfen hatte. In Angst vertrauerte sie ihre Tage, bei jedem Bissen zitterte sie, es könnte das weiße Pulver der Borgia darin verborgen sein, das langsam die Eingeweide zerfraß. Und sie horchte auf jeden Schritt, der draußen auf dem Korridor ging, denn es konnte der Schritt ihres Todfeindes Cesare Borgia sein.
Aber der Herzog war noch nicht in Rom. Noch hoffte er, daß der König von Frankreich, Ludwig XII., ihm die Truppen zur Fortsetzung seiner Eroberung der Romagna beistellen werde. Aber als vom französischen Hof, dem das verlorene Mailand so grimmige Sorgen machte, ein unabänderliches Nein erscholl, rüstete Cesare zum Aufbruch nach Rom.
Das Vaterherz frohlockte. Als Cesares Sekretär dem Papst die bevorstehende Ankunft seines Herrn meldete, brach Alexander in Tränen aus. Im Nu ließ er alle päpstlichen Sekretäre, Kommissare, die beiden Zeremonienmeister Burckhardt und Podio, die Maler und Dekorateure versammeln, um sich mit ihnen über den festlichen Empfang zu beraten. Cesare sollte wie ein marathonischer Sieger begrüßt werden. Alle Kardinäle wurden von ihren Landsitzen nach Rom beordert, die Barone vergaßen ihre Fehden, rüsteten ihre Söldlinge ab und richteten ihre zerschlagenen Paläste wieder her. Alexander erwog, ob seines Sohnes Einzug nicht bei Nacht stattfinden sollte, um die Feier phantastischer zu gestalten. Er wollte nackte Mädchen mit Rosen in den Haaren auf einigen von Fackeln beleuchteten Triumphwagen dem Hohenpriester der Venus entgegenschicken, und nur mit Mühe konnte ihn Burckhardt davon abbringen. Man wollte doch nicht den Pilgern gar zu großes Ärgernis geben. Die berühmtesten Festajuoli aus Florenz, die Dekorationskünstler, wurden sofort durch Eilboten nach Rom gebeten, um durch kunstvolle mechanische Apparate und Spiele das Programm besonders abwechslungsreich zu gestalten. Die Wälder und Gärten um Rom wurden geplündert, denn riesige Girlandenbogen sollten sich über die Straßen spannen und die Triumphpforten umschlingen.
Auch Michelangelo Buonarroti wurde für den Festzug um Rat gebeten. Aber er ließ sich krank melden. Und er war auch krank.
In seinem einfach eingerichteten Zimmer, das eine spartanische Genügsamkeit enthüllte, lag er mit verlorenen Gedanken über Zeichnungen und anatomischen Skizzen gebückt und hörte nichts, als das unruhige Wellenschlagen seines Herzens. Er hatte den Spiegel aus seinem Zimmer entfernt, denn die Fratze Mensch grinste ihn daraus an. Nie war ihm die Schwere dieser Last mehr zum Bewußtsein gekommen als an jenem Abend in Bracciano, wo er das Wunder eines Menschenantlitzes erschaut hatte, das ihm den Unterschied zwischen Mensch und Mensch gepredigt hatte.
Während andre ihre Jugend an den Formen der Schönheit verjauchzten, verkümmerte die seine unter dem Druck der empfindsamen Seele, die überall Schönheit suchte und fand, nur nicht in sich selbst. Und doch sah er ein, daß nur mit ihr die Liebe des Weibes zu erringen war. Schönheit in männlicher Form, Stattlichkeit, Edelgestalt, sicheres Auftreten, lauter Gewinste der Forschung in antiken Kunstwerken, Äußerlichkeiten, die gerade in dieser Zeit die Forderungen der Daseinsfreude bildeten, sie blieben ihm versagt. Das Menschengebilde als die schönste Offenbarung Gottes war in ihm, dem künftigen Künder dieser Wesenheit, zu einem Zerrbild geworden.
Der Abend von Bracciano – o, er war der Anfang des Übels gewesen. Dann bohrte sich seine Erinnerung schmerzhaft in den Tag zurück, als sie, diese einzig schöne Frau, in den Reizen der halben Genesung vor ihm stand und er den Zeichenstift ansetzen mußte, um ihre Schönheit auf den Karton zu bannen. Da splitterte das festgeglaubte Gefüge seiner Seele zusammen unter den Griffen dieser Schönheit. O, daß diese Schönheit so furchtbare Krallen haben konnte! Und als er daran gehen sollte, diese Idealform in Marmor zu hauen, bebte er davor in unbegreiflicher Scheu zurück. Die Blicke dieser Frau erzählten ihm aufs neue von dem Mitleid, das man mit seiner mißgestalteten Natur hatte, und sie entfachten aufs neue den nervenzerwühlenden Jammer in ihm, daß er dazu geboren worden sei, sein Leben zu vertrauern in Einsamkeit, Lieblosigkeit, Frostigkeit und Bemitleidung. Und er war hinausgestürmt in die Nacht, unschicklich, trotzig, jede Lebensart verleugnend, er, der Nachkomme eines Grafen von Canossa.
Verbittert verbrachte er den Karneval. Er wußte, daß er die höchsten Fähigkeiten besaß. Es war keiner neben ihm, weder in Rom noch in Florenz, der – und doch! Einer lebte jetzt in Florenz, vor dem er Angst hatte. Der war ihm über. Er modellierte nicht, aber mischte wunderbare Farben und schuf Menschen auf die Leinwand, die Seele hatten. Und sein »Abendmahl« in Mailand würde die feierliche Verneinung aller sonstigen künstlerischen Taten der Menschen sein. Leonardo da Vinci! Über diesen Namen vergaß man, daß in der Peterskirche eine Pietà stand, die an Gereiftheit nichts zu wünschen übrigließ.
Da klopfte es an seiner Tür. Galli trat ein, mißmutig und verstimmt. Michelangelo bot ihm einen Stuhl. Galli lehnte ab. »Mit Euch ist nichts zu machen, Buonarroti,« sagte er kurz. »Ich hätte Bestellungen für Euch nach Brüssel, Portugal, Frankreich, aber Ihr macht's mir wieder so wie beim Kardinal Orsini, wo meine Bürgschaft für Euch mir übel gelohnt wurde.«
»Ich konnte dort nicht annehmen. Erlaßt mir die Aufzählung der Gründe. Ich will überhaupt nicht mehr den Meißel in die Hand nehmen. Wenn ich künftig meine Gedanken zum Ausdruck bringen will, soll's in Farben geschehen.«
»Ihr experimentiert mir zu stark,« sagte Galli unfreundlich und mit überlegener Geschäftskühle. »Ich muß mich auch für mein Landhaus anderswo umschauen als bei Euch.«
»Tut das nur,« sagte Michelangelo gereizt. »Kann ich mich doch kaum mehr auf mich selbst verlassen.« Er warf ein paar Zeichnungen durcheinander.
»Ich habe bei Pietro Perugino angeklopft –«
»Dem Stümper mit den aneinandergereihten, leblosen Mumien? Er hat keinen Sinn für die Handlung, für die Zusammengehörigkeit der Figuren. Ja, ja, Figuren. Jede eine leblose Puppe, an der das Gewand das beste ist. Stand- und Spielbein ohne Abwechslung in platter Aufdringlichkeit.« Michelangelo belferte und war kreideweiß geworden.
»Aber seine Köpfe machen alles wieder gut,« sagte Galli verärgert über die kritische Anmaßung des Werdenden. »Er ist bei Sechzig und hat ein Anrecht, daß man vor seiner errungenen Meisterschaft eine Verbeugung macht. Ich gebe zu, daß er durch die vielen Aufträge nachlässig in der Zeichnung wird. Aber das Gewesene soll doch auch bedacht und beurteilt werden.«
»Wenn das Gewesene nicht der Grundstein für die Zukunft wird, ist das Gewesene – gewesen. Ich würde mich schämen, meine Entwicklung nach abwärts fortzusetzen. Da verroste ich lieber gleich.«
»Ihr scheint dabei zu sein,« sagte nun auch der gemütliche Mäcenas etwas unwillig. »Der Marmor liegt haufenweise in der Werkstatt und Ihr liegt in Eurer Stube und verschaut den Tag. Wißt Ihr überhaupt, was in der Welt vorgeht? Daß Cesare Borgia kommen soll –«
»Mag er. Man hat meine Meinung für den Festzug haben wollen. Aber da sie den Triumphzug des Mantegna nachäffen wollen, habe ich dabei weiter nichts mehr zu tun.«
Galli wurde von dem ärgerlichen Ton seines ungebärdigen Schützlings angesteckt. »Also Cesare kümmert Euch nicht. So wird es Euch vielleicht mehr interessieren, daß Bramante zum Papst berufen wurde, um einen Plan für San Pietro in Montorio zu entwerfen. Es soll ein Rundtempelchen mit unzähligen Säulchen werden, von einfachen Nischen belebt.«
»Laßt es fertig werden, dann wollen wir darüber sprechen. Habt Ihr sonst Neuigkeiten?«
»Was soll's Euch dann noch kümmern, daß über die Malerei ein großes Unglück gekommen ist,« antwortete Galli zaghaft, denn er wußte nicht mehr, wo und wie er Michelangelo anpacken sollte.
»Das wäre?«
»Das Abendmahl Leonardos –«
»Was ist's damit?« fuhr der Künstler herzzitternd in die Höhe.
»Es wird dahinsiechen, sterben. Fra Mariano aus Mailand brachte die Kunde. Eine Überschwemmung hat die Mauern des Klosters Santa Maria delle Grazie mit Feuchtigkeit durchsogen, die Farben des Bildes, eine eigenartige Zubereitung des Meisters, litten furchtbar unter dem heimtückischen Naß, Risse und Abbröcklungen zeigen sich. Man rief Leonardo. Er stand mit verhaltnen Tränen vor seinem dem Untergang geweihten Werk.«
»Und er wird ein andres Werk schaffen, des seid gewiß.« Michelangelos Brust arbeitete heftig. Ein gefährlicher Rivale war mit dem Zusammenbruch dieses Meisterwerks beseitigt. Gott wollte also ihm, dem jungen Florentiner, den Weg zur Höhe leichter machen. Der Neid, der traurige Freund des Künstlers, hatte in seinem sonst so gutmütigen Herzen arge Zerstörung angerichtet.
Galli erhob sich. Die Lenzsonne lockte ihn aus der verdüsterten Sphäre des Neides hinaus auf sein Landgut, wo außer Bildern und antiken Steintafeln auch Salat und Artischocken auf ihn warteten. Dort ließ sich freier atmen als hier unter diesem grämlichen Volk von Künstlern, das er aber doch nicht entbehren konnte, da es für sein seelisches Gleichgewicht auch sein Teil beitrug.
Als er fort war, warf sich Michelangelo wieder über seine Zeichnungen. Der Stift ging leichter, freier, die Gedanken schienen eine Fessel los zu sein, die Seele hatte einen Teil Neid abgeladen. Das idolisch angebetete »Cenacolo« des Leonardo war nicht mehr zu fürchten. Und doch – wenn er andres schuf, noch Besseres, Heiligeres? Aber Leonardo war nahe an den Fünfzig, hatte den Zenit überschritten, und war ein langsamer, bedächtiger Arbeiter. Aber vielleicht gerade deshalb sammelte er seine Kräfte, verschleuderte sie nicht wie er, Michelangelo, an nichtige Aufgaben. Zudem war er schön, von idealer Männlichkeit getragen, ein Kopf von patriarchalischer Würde, Augen, die noch jetzt die Frauenseelen verwirrten – man sprach sogar von einer Frau, einer Neapolitanerin, die einen Florentiner geheiratet hatte – und diese Frau sollte einen Altar im Herzen des Meisters –
Der Vampir stieg wieder aus dem Winkel des Herzens aus und streckte die Saugarme nach dem Künstler Michelangelo Buonarroti aus.
*
Er kam. Straßauf, straßab wogte die Menge der Römer, staute sich und vergaß allen Parteihader und Hausstreit, denn die Farbenglut und der Prachtaufwand inmitten des düstern Häuserklumpens betäubte alles. Ein Gedanke riß alles auf die Straße: ihn sehen, den Fürchterlichen, Großen, den Liebling der Hölle, und wie es schien, auch des Himmels. Denn gnadenvoll überstrahlte er mit seinem Blau das festliche Gepränge, und eine lenzwarme Sonne warf ihre Lichtwogen auf die Plätze, Türme, Kuppeln, Mauern, Gärten und Hügel und schuf aus den grellen, aufblitzenden Farben der Draperien und Blumen, mit denen alle Straßen überdeckt waren, eine in allen Tonfarben wechselnde Hymne zum eigenen Preis, die ihr Maestoso in den Triumphpforten erreichte, welche an der Porta del Popolo, auf der Navona, bei der Engelsburg, am Eingang der eben vollendeten Via Alexandrina und vor dem Vatikan errichtet worden waren. Dort flatterten von den riesigen Säulen unzählige Banner und Fähnlein um das Wappen der Borgia. Über die Navona spannten sich von blumenumrankten Holzpfeilern schwere Lilienfestons, die ein wunderbar gegittertes Netz bildeten, durch das der Sonnenglanz in weiße Glut gebrochen wurde. Tribünen türmten sich an den Fassaden der Häuser empor, von leuchtenden Bändern umflattert. Die prachtvollen Teppiche der Kardinäle, Brokatgehänge, Brabanter und lombardische Gewebe hingen an den Backsteinmauern der düstern Paläste in protzigem Gepränge herab. Gigantische Körbe in phantastischer Form standen zu Füßen der Tribünen, daneben wunderschöne Mädchen in fast durchsichtigen Schleiergewändern, bereit, die in den Körben befindlichen Sträuße von Rosen und Lilien, Veilchen und Hyazinthen auf den Festzug zu werfen. Jedes Tor, jedes Fenster trug ein Gewinde von Lorbeer und Efeu. Vor den Wohnungen und Werkstätten der Künstler und Goldschmiede standen in Blumennischen antike Skulpturen und goldnes Ziergerät, mythologische Figuren und Heiligengruppen. Unter goldflimmernden Baldachinen erhoben sich die Statuen der Madonna, und da und dort waren lebende Bilder aus der römischen Geschichte zu sehen. Der Olymp stieg mit seinen Göttern zur römisch-katholischen Erde herab und gruppierte sich zu wunderbaren, manchmal verfänglichen Szenerien in den Ecken der Navona. Dionys tröstete die trauernde Ariadne, Selene küßte Endymion wach, Jupiter koste die verführerische Io, deren herrlicher Mädchenkopf aus einer schneeweißen Kuh hervorragte, Venus lag in den Armen Mars', Leda streckte sehnsüchtig die Arme nach ihrem Götterschwan aus, unter einem Geranke von wilden Rosen lagen Amor und Psyche auf dem Brautbett und in den Thermentrümmern führten Satyre und Nymphen schalkhafte Spiele auf. Der größte Triumphbogen, dem Konstantinbogen nachgebildet, stand beim Eingang in die Via Alexandrina, von einem in sinnlicher Farbenglut prangenden Gesimse gekrönt, aus Füllhörnern und Girlanden, goldglitzernden Reliefs und bunter Bemalung zusammengesetzt. An den Seiten standen in Rosennischen wunderschöne Albanermädchen in Phantasietracht, die verschiedenen Tugenden symbolisierend. Überall prangten an den Friesen und Gesimsen reich verschnörkelte Inschriften, die auf den romagnolischen Sieger Bezug hatten und ihn mit Julius Cäsar, Miltiades, Hannibal und Titus verglichen. Lange Spaliere der päpstlichen Wachen sperrten die blumenübersäte Straßenmitte von den drängenden Volkshaufen an den Häuserfassaden ab und schufen Platz für die Kavalkaden und heranrollenden Karossen des hohen Klerus und des Adels. Auf der Piazza del Popolo vor der Kirche standen die vier Triumphwagen mit den Allegorien des Krieges, der Tapferkeit, des Sieges und des Ruhms und viele andre mit Girlanden geschmückte Phantasiewagen, auf denen wieder mythologische Gruppenbilder in lebendiger Natürlichkeit prangten.
Hier stellte auch die üppig geschwellte Sancia, Fürstin von Squillace, Schwägerin und ehemalige Geliebte Cesare Borgias ihre schon halb verblühte Schönheit aus. Ihre Glieder lagen, umhüllt von einem duftigen blaßgrünen Schleiergewand, in welchem Goldspinnen eingestickt waren, auf einem fellbedeckten Ruhelager, das einen turmartig aufgebauten Triumphwagen krönte, und rings um sie spielten Mädchen in Pagentracht mit goldnen Bällen. Zu ihren Füßen lag in der Maske des Petrarca der junge Baron Pandolfo Anibaldi, ihr gegenwärtiger Liebhaber, und las ihr Verse vor, die weder er noch die Fürstin verstanden.
Ihnen gegenüber standen bekränzte weiße Stiere, von spanischen Toreros behütet. Es war eine sinnige Anspielung auf die Lieblingsbeschäftigung Cesares, den Stierkampf, und auf das Wappen der Borgia.
Auf einer Tribüne in der Nähe des Orsinipalastes hatte ein Bäckermeister eine Riesenburg aus Marzipan aufgebaut, die der eroberten Burg von Forli glich. Kleine heranstürmende Tragantfiguren waren ringsherum postiert. Gegenüber dieser kindlichen Spielerei war die übergroße Büste Romas aufgestellt, von einem künstlichen Netz farbiger Wasserstrahlen überdacht, die springbrunnartig aus einer von einem Florentiner Künstler ersonnenen Maschinerie in die Höhe stiegen.
Da ging Bewegung durch die Menge. Die Geliebte des Papstes, Giulia Farnese, fuhr in geschloßner Karosse nach dem Vatikan. Durch die Fenster schimmerte das Weizengold ihres Haares. Ein Troß von Gardisten flankierte den Wagen der Kurtisane.
Und da kam an der Spitze einer Kavalkade der leutselige, fünfundzwanzigjährige Kardinal Giovanni de' Medici, umgeben von einem Stab von Dichtern und Gelehrten.
Und dann die Gesandten von Florenz, Venedig, Ferrara, Mailand, Mantua und Neapel mit ihren Sekretären und Dienern. Die Prälatenwagen rollten gelassen durch die Menge, aus der Blicke des Hasses auf die blumengeschmückten jungen Gestalten fielen, die in ritterlichem Wams, das Barett auf den wallenden Locken, hochmütig auf Armut und Lumpentum herabblickten. Dann die erzgepanzerten Züge der Colonna und Orsini, mit ihren Freunden und Vasallen, immer noch von Mißtrauen und Feindseligkeit gegeneinander erfüllt, trotzig und herausfordernd aneinander vorbeireitend, so daß es manchmal schien, als wollten die eisenbespickten Barone den kaum erstickten Kampf aufs neue entfachen. Vor ihnen ritten ihre Herolde mit den Wappenschildern und Bannern.
Im Borgo wogte plötzlich ein Summen und Gebrause. Alles verkeilte sich nach dem Palast der Lukrezia Borgia. Da kam ihre Sänfte. Und ein Evviva Lukrezia! heulte durch die Gasse.
Die schöne Herzogin ließ ihr unfrohes Lächeln über die Menge gleiten und zeigte den Römern ihr goldnes Seidenhaar, in dem ihre geliebten Perlen schimmerten. Und neben ihr Alfonso von Bisceglia, dessen Schwermutsaugen ganze Zaubernetze über die Frauenwelt der heiligen Stadt warfen. Es gab viele römische Edeldamen, die nächtlich davon träumten, in den Armen dieses Knaben zu liegen, und der Neid spann seine gelben Fäden nach dem Körper der Lukrezia, der das Glück hatte, von dem schönen Alfonso genossen zu werden. Und gerade dieser war sinnlich so wunschlos gewesen.
Da begann das feierliche Glockenschwingen von allen Türmen Roms. Nun ging es durch die bis zur Siedehitze erregten Gemüter: Er ist da! Er ist vor der Porta del Popolo angekommen! Cesare Borgia! Und immer jubelnder klangen die Glocken und sangen ihm den unehrlichen Willkomm der Stadt. Und ins Sonnengold ringelte sich der Qualm der Pechfackeln bei den Triumphbogen empor, alle Farben gerieten in Bewegung, sprangen blitzend von Ort zu Ort, rote, gelbe, grüne Wellen, aus dem windbewegten Blumenmeer steigend, gingen auf und ab, es schien, als wollte sich das Häusermeer selbst in Bewegung setzen, um dem prahlsüchtigen, kleinen Sieger entgegenzuwallen.
Da kam der Zug der zwölf Triumphwagen. Die Viktoria an der Spitze, eine Geliebte Cesares mit flatternden rabenschwarzen Haaren, in denen der Goldreif mit blitzenden Rubinen lag, in der Rechten das Schwert, in der hochgehaltenen Linken den Ruhmeskranz. Dann der Zug der berittenen Kardinäle. Und die Leibwache Cesare Borgias unter den Klängen von Trompeten, Zinken, Trommeln und Tamburins.
Und jetzt auf schneeweißem, goldbezäumtem Zelter er selbst! Die sehnigen Fechterglieder in das tiefschwarze ernste Wams gehüllt, auf dessen Latz die goldne Siegeskette funkelte, das von Federn umwogte Barett auf dem Haupt, die braungoldnen Locken bis auf die Schultern wallend, das streng geschnittne Gesicht dem Volke preisgebend, von einem Glanz umschimmert, den die südliche Phantasie zu legendärer, blutroter Glorie ausspann. Rings um ihn eine Schar von berittnen Lautenschlägern, die ihm Preislieder zusangen. Ein gemachtes Lächeln spielte um seine Lippen, als er die schönen Mädchen als Sirenen gekleidet bei der ersten Triumphpforte erblickte, und sein Auge wählte, mit der eigenen Lüsternheit spielend, eine der verführerischen Schönen aus, die ihn mit zartklingenden Gesängen huldigend begrüßten, während aus breiten Opferpfannen, die auf silbernen Kandelabern standen, wohlriechende Dämpfe zum Himmel stiegen.
Plötzlich hielt der Zug. Auf der Navona tönten Fanfaren. Lukrezia empfing ihren Bruder mit lächelndem Gruß. Aber hinter dem Lächeln stak heillose Angst. Die Nähe entzauberte Cesares Erscheinung. Seine Stirn trug das Schild einer furchtbaren Krankheit. Eitrige Schwären saßen dort, die das Haar nicht verdecken konnte. Die grausen Spuren des Lasters, dem er sich im romagnolischen Lager in die Arme geworfen, schleuderten seine apollonische Schönheit aus dem Olymp herab.
Abermals stockte der Zug. Diesmal ging Bestürzung durch die Menge. Aus einer Seitengasse der Navona drängte sich wie ein Bohrwurm durch die Menge der Zug einer Bruderschaft, in den Farben des Todes gekleidet. Und mitten aus dem schwarzen Wurm sprang plötzlich ein Weib hervor und warf sich durch das päpstliche Spalier dem schimmernden Zelter Cesares entgegen. »Fluch dir, Cesare Borgia!« gellte ihr Ruf. »Verführer du! –«
Wirbelnder Trommelschall schmetterte die Stimme entzwei. Die Wachen ergriffen das Mädchen und schleppten es in die Torre di Nona. Es war Fiammetta Pandolfi, eine der auf dem Altar der Venus hingeopferten Geliebten Cesares. Der Drommetenruf des Fluches schallte an dem Ohr des Herzogs Valentino vorbei. Gelassen betrachtete er die aufgeregte Menge. Stadtsoldaten lenkten den Zug der Bruderschaft in eine Seitengasse.
Der Herzog hatte mit Alfonso von Bisceglia kaum ein Wort gewechselt. Er wandte sich an Lukrezia und sagte mit seiner kalten Stimme: »Du bist voller geworden, Schwester, und schöner. Ich höre, es soll ein Kampf zwischen Orsini und Colonna stattgefunden haben?«
»Sie kommen nicht zur Ruhe,« erwiderte die Herzogin.
Im Weiterreiten fragte Cesare: »Wie lebst du mit deinem Gemahl?«
Lukrezias Auge bekam einen hellen Glanz. »Gut, Bruder, o, so gut!«
Cesares Hand verkrampfte sich in die Zügel seines Rosses. Aber der Menge zeigte er ein unbefangnes Antlitz. O diese Menge! Wie gezwungen feierte sie seinen Sieg! Aber er empfand selbst die Leichtigkeit seiner kriegerischen Erfolge, bei denen er nichts zu tun hatte als zuzuwarten, bis der eingeschloßne Feind ausgehungert war. Das war seine bescheidne Taktik. Aber er wußte, daß man diesem leicht entzündbaren Volke die Schwere des Ringens vortäuschen mußte, um es für wirklich schwere Eroberungen desto empfänglicher zu stimmen. Dieses Volk hatte nie genug der Abwechslungen, nie genug des Prunkes, nie genug der Beschwichtigung mitten in seinem dumpfen, geistesarmen Trott. O, Cesare Borgia kannte sein Rom. Rom ist Italien! dachte jetzt sein unbändiger Geist, als Sankt Peter in Sicht kam. In diesen Mauern des Vatikans wird durch unsern Willen das Geschick Italiens entschieden werden. Daß andre atmen dürfen, soll unser Wille bestimmen. Als Eroberer sich an Herodot oder Mark Aurel zu bilden, habe ich mir abgewöhnt. Ich muß andre Lehrmeister zu Rate ziehen.
Hinter dem Herzog ritt der Oberbefehlshaber seiner Truppen, der ehrgeizige, von Ruhmsucht angekränkelte Kondottiere Vitellozzo Vitelli, sehnig wie ein spanischer Stierkämpfer, mit Raubtierblicken, die der Schreck seiner Söldner waren. Er schien mit seinem Pferd zu einer eisernen Einheit verwachsen zu sein. Dann folgte der gutmütige, verstruppte Graukopf Paolo Orsini, der des Lagerlebens satt war, da es nie zum Dreinschlagen gekommen war, und der jetzt von seinem eben begrüßten Sohn Fabio die Neuigkeiten Roms in Empfang nahm. Söldlinge aus allen Gauen Italiens, Deutschlands, der Gascogne und der Schweiz folgten auf müdgerittnen Pferden.
Paolo Orsini schaute sich die Augen nach dem Kardinal aus.
Fabio lachte. »Ei, wir haben ihn seit dem verhängnisvollen Abend auf Bracciano nicht wiedergesehen. Er hat sich auf Monterotondo verklausuliert und liest, scheint es, das Brevier aus dem Auge einer schönen Frau. Er hat eine unsichtbare Hecke um sein Schloß gespannt, und wer eintreten will, muß zuerst den Eingang suchen.«
»O, über den christlichen Epikuräer! Oder ist er ein Stoiker? Ich kenne mich in der Sippschaft nicht aus. Jedenfalls hätte er seiner verträumten Weisheit die Krone aufgesetzt, wenn er jetzt so weise wäre, sich wie alle übrigen Kardinäle ein Weib –«
Die Glocken übertönten den Spott. Und nun schlugen auch donnernde Bombarden hinein und kündeten, daß der Zug beim Petersplatz angekommen war. Und vor dem Heiligtum der Christenheit empfing der Papst, umgeben von der Kurie und dem stolzen Adel Roms, seinen geliebten Sohn. In diesem Augenblick schwiegen die Glocken, die ganze Aufmerksamkeit sollte auf Vater und Sohn hingelenkt werden. Alexander umhalste seinen einzigen Cesare, den schönen Mörder seines ältesten Sohnes Juan, küßte ihn unter Tränen, segnete ihn und konnte sich nicht genug tun an Zärtlichkeit und Liebe. Immer rannen ihm die Tränen über die gespannten, fast von keinem Fältchen entstellten Backen, aber sein Herz zitterte vor Weh, als er die Eiterbeulen auf der Stirn seines Sohnes entdeckte. O, er kannte die Krankheit nur zu gut.
»Cesare, mein Liebling!« jammerte der Papst in seine Tränen hinein.
Der Sohn kniete vor ihm nieder und küßte den Saum seines Gewandes und den mit Rubinen besetzten Pantoffel. Dann stand er auf und dankte dem Vater in spanischer Sprache für den Empfang, und Alexander antwortete und pries die Stunde, da ihm durch das kriegerische Talent seines Sohnes ein Teil der Romagna geschenkt worden war. Sie überboten sich beide in der gegenseitigen Beräucherung ihrer Person und im Schwulst ihres Panegyrikus.
Nun ging Cesare gesenkten Hauptes zur Peterstreppe, kniete nieder und verrichtete ein kurzes Gebet vor den weitgeöffneten Türen, die den Blick in die Tiefe des Doms freigaben. Im Hintergrund leuchtete, von unzähligen Kerzen bestrahlt, der Aufbau über dem Apostelgrab. Gold, Silber und Weihrauch, die Elemente der christlichen Verehrung, verströmten ihre geheimnisvollen Kräfte auf das Haupt des großen Sünders.
Alexander wankte dem Sohne nach und ließ sich neben ihm auf dem goldgestickten Teppich Nikolaus's V., auf dem die Schöpfungsgeschichte eingewebt war, zum Gebet in die Knie. Wohlriechende Dampfsäulen stiegen zu beiden Seiten der Vorhofhalle in die Sonne auf. Weiße Tauben schwebten wie erstandne Phönixe darüber hin.
Hinter den knienden Borgia schloß der Halbkreis der berittnen Kardinäle die Betenden von der Menge ab. Und ein Wald von Lanzen zog sich drohend als zweiter Halbring um die Gruppe. Auch während des Gebetes mußte man die Borgia vor dem Haß der Römer schützen.
Cesares laues Gebet erstickte nach ein paar Worten. Sein Sinn taumelte in ehrgeizige Träume hinein, von denen dieser festliche Empfang nur ein kleines Vorspiel war. Nicht Rom allein, ganz Italien sollte so in Ehrfurcht oder Furcht vor seinen großen Gedanken der Macht erstarren. Ein Teil der Romagna lag zu seinen Füßen, der Rest mußte demnächst folgen, sobald Frankreichs Hilfe wieder lebendig werden würde. Alle Kleinstaaten sollten in seine Klauen kommen, und ihre Tyrannen würde er unter dem Triumphbogen des Titus vor seinem Siegeswagen hertreiben wie einst Marius den numidischen König Jugurtha. Und da hörte er auch schon im nächsten Augenblick des Papstes Stimme an sein Ohr klingen: »Ich ernenne Cesare Borgia, den Herzog von Valentinois, zum Bannerherrn der Kirche.«
Es tönte wie ein leiser präludierender Akkord zu der großen Musik, die sein Leben mit gewaltigem Maestoso durchflutete. Bannerträger der Kirche! Es war das Amt, das der von Cesare ermordete Bruder Juan bekleidet hatte.
 Der Papst hatte sich beruhigt. Die üppige Abendtafel war zu Ende. Man hatte den Gaumen an verschiedenen Fischen, Wildpasteten, Hühnern und Backwerk geletzt, Gerichte, die in Phantasieformen mit Blumen und silbernem Zierat geschmückt, aufgetragen worden waren, hatte die Weine Siziliens und Spaniens geschlürft und das Spiel der päpstlichen Musici ohne besondere Andacht genossen, und als die Tänze der verführerisch gekleideten Mädchen aus Sora zu Ende waren, gab Alexander das Zeichen zum Aufbruch, denn er wollte mit seinem Sohn noch allein sein.
Der Papst hatte sich beruhigt. Die üppige Abendtafel war zu Ende. Man hatte den Gaumen an verschiedenen Fischen, Wildpasteten, Hühnern und Backwerk geletzt, Gerichte, die in Phantasieformen mit Blumen und silbernem Zierat geschmückt, aufgetragen worden waren, hatte die Weine Siziliens und Spaniens geschlürft und das Spiel der päpstlichen Musici ohne besondere Andacht genossen, und als die Tänze der verführerisch gekleideten Mädchen aus Sora zu Ende waren, gab Alexander das Zeichen zum Aufbruch, denn er wollte mit seinem Sohn noch allein sein.
Im Turmgemach verbreiteten die zwei dicken Kerzen einen schwülen Geruch. An den Wänden leuchteten Delphine und Fabelwesen auf und schienen vom flackernden Schein phantastisch bewegt, als wollten sie an die Propheten und Apostelgestalten heranschwimmen, die die Lünetten ausfüllten. Vor dem mit einer roten Decke überhangenen Eichentisch saß der Papst und verfolgte mit beinahe ängstlicher Aufmerksamkeit die gewaltigen Schritte seines Sohnes.
»Liebes Kind, ich kann deine Pläne mit Katharina Sforza nicht billigen,« sagte er etwas unbehaglich.
»Haha, sie wird im Belvedere Mittel und Wege finden, sich mit den Ihren zu verbinden,« lachte Cesare unwillig. »Und dann haben wir die Hunde neuerlich auf dem Hals.«
»Halten wir sie fest oder beseitigen wir sie, dann rüstet Ludovico Sforza gegen uns, denn er wird den Schimpf nicht auf sich sitzen lassen. Er ist neu gestärkt nach Mailand zurückgekehrt, die Lombarden jubeln ihm zu, und wir müssen froh sein, wenn wir einen Bundesgenossen an ihm finden, um Venedig in Schach zu halten.« Der Papst glaubte einen politischen Trumpf ausgespielt zu haben.
Aber Cesare verbiß die Lippen. »Ludovicos Herzogsthron wankt bereits aufs neue. Seine Städte werden ihn verraten. Er stützt sich auf die Schweizer, aber auch die kämpfen dort, wo der Sold heller klingt. Schafft also getrost Katharina Sforza aus der Welt, sonst werden ihre vergifteten Briefe aufs neue in den Vatikan geschmuggelt werden. Ihr vergeßt, wer sie ist. In einer Sphäre des Mordes erzogen, den Anblick von Blut gewöhnt, wird sie im Blut weiterwaten. Ihr Vater Galeazzo fiel unter den Händen von Tyrannenmördern, bald darauf ihr eigener Gatte unter den Dolchen von Verschwörern, ihr Bruder starb durch Gift, ihr zweiter Gatte wurde ebenfalls durch Verschwörer umgebracht, wobei sich das beherzte Weib aufs Roß setzte und in die Quartiere der Mörder sprengte, wo sie Männer, Weiber und Kinder niedermetzeln ließ. So viel Blut im Dasein eines Menschen macht bei dem einen das Herz fühllos und das Gewissen weitmaschig, bei dem andern erzeugt es Nervenschwäche und Melancholie. Katharina gehört zu den ersteren. Und einer solchen Person weist ihr die besten Gemächer im Vatikan zu, statt sie in der Engelsburg schmachten zu lassen. Sie wird Euch noch Nüsse zu knacken geben, allerheiligster Vater. Sie hat persönliche Anhänger. In Florenz besonders. Der Kanzler der Republik, ein gewisser Niccolò Macchiavelli, wollte ihr Gebiet als Durchzugsland in die Hand bekommen. Ich muß mir diesen schlauköpfigen Burschen näher besehen. Es ist immerhin möglich, daß man mit Florenz rechnen muß. Die Leute verstehen sich dort nicht nur auf Kunst und Gelehrsamkeit, sondern sie betreiben auch Staatskunst auf fester Basis. Allerheiligster Vater, ich möchte Euch dringend bitten, das sanfte Händestreicheln auf Euer heiliges Hirtenamt zu beschränken, dagegen in den rauhern Sphären der Hausmachtpolitik die Kralle des Löwen zu zeigen.«
Alexander war längst zur Puppe geworden. Sein Sohn hatte ihn mit der Zeit durch die Verwegenheit seiner Gedanken und durch die Unerschrockenheit seines Handelns derart willenlos gemacht, daß er es nicht mehr wagte, gegen die Forderungen seines Kindes aufzutreten. Die väterliche und päpstliche Autorität hatte er sich von ihm entreißen lassen. Die Schwäche des Alters vermehrte seine Hilflosigkeit und machte ihn zum gefügigen Werkzeug der Pläne Cesares. Sein Widerstand trug nur mehr den Schein des Ansehens, das er sich geben wollte, seine Gegenvorstellungen hatten nur mehr den Zweck, dem fürchterlichen Sohn Mäßigung ans Herz zu legen; aber er dachte gar nicht mehr daran, sie zu bekämpfen oder ihnen mit sittlichen Einwendungen zu begegnen. Cesare war seit der Ermordung des Herzogs von Gandia der grausige Dämon des Vaterherzens geworden. Auch Rom gehorchte in Furcht dem Gewaltgeiste des Sohnes, die Romagna lag halb bezwungen in Cesares Händen, die Vasallen der Kirche, die Malatesta, Sforza, die Varani und Manfredi wurden ihrer Lehen verlustig erklärt. So setzte sich mosaikartig sein unermüdlicher Ehrgeiz die zukünftigen Länder seiner Gewaltherrschaft zusammen. Vorderhand aber mußte in Rom Ordnung geschaffen werden.
»Colonna und Orsini, höre ich, liegen sich wieder in den Haaren,« sagte Cesare. »Aber Ihr tatet unrecht, sie wieder zu versöhnen. Ihr hättet den Kampf auslaufen lassen sollen, dann wäre endlich eines der starken Geschlechter zu Boden gesunken, und wir hätten mit dem übriggebliebenen leichtes Spiel gehabt. Sagt, lebt der alte Giacomo Gaetani noch in der Engelsburg?«
Der Papst nickte. »Er protestiert gegen die Einziehung der Güter.«
»Er mag's tun. Unterdessen bereiten wir ihm die weißen Pulver, die seinen Protest von Tag zu Tag schwächer machen werden. Und nun entscheidet Euch, wer daran kommt, Colonna oder Orsini. Sonst versöhnen sich die Parteien und kehren den Stachel gegen uns.«
»Du glaubst, Cesare?« fuhr der Papst in die Höhe.
Der Herzog zog einen Zettel aus der Tasche. »Seht, das hat man soeben vor Eurer Tür gefunden.« Und er las dem Papst ein Pamphlet vor, das die Orsini und Colonna aufforderte, allen Hader beiseite zu setzen und gemeinsam gegen den vatikanischen Stier vorzugehen, der Ausonien verwüstet, und ihn mit seinen Bullen in den Tiber zu werfen.
Den Papst schauderte.
»Man müßte dergleichen Skribenten die Hände abhacken und den Raben vorlegen,« meinte Cesare kaltblütig. »Das wäre ein heilsames Mittel gegen die poetischen Versuche der lieben Römer. Ihr seid zu milde, allerheiligster Vater, die zersetzenden Machenschaften werden nie aufhören. Kardinäle hängen, Barone um einen Kopf kürzer machen, das wird abschrecken –«
»Hab' ich nicht meinen eigenen Neffen, den Kardinallegaten Juan Borgia in Urbino töten lassen –«
»Das war ein kleiner Anfang –«
»Cesare!« Der Papst schreckte vor seinem Sohn zurück.
Unerbittlich fuhr der junge Geier fort: »Schafft jetzt neue Kardinäle aus Eurem Hause. Vor allem den jungen Ludovico und den jüngern Juan Borgia. Der Purpur dürfte ihnen gut stehen. Sie werden unter seinem Schutz unlautere Reichtümer sammeln, die Ihr ihnen auf die gewohnte Weise abnehmen könnt.«
Der Greis tastete mit den Händen in die Luft. Wo sollte er diesen Sohn, der Blutgeruch ausströmte, anpacken? O, es war unmöglich, ihm zu entkommen. Zu fest war des Papstes Schuld mit der seines Sohnes verknüpft. Keine Reue war groß genug, um das Gewesene auszulöschen aus seinem Leben. Es trieb fortwirkend seine furchtbaren Keime weiter ins Herz und hatte sich zersetzend wie ein Pilz in sein Gemüt eingenistet.
Cesare machte einen Schluck von dem dunklen Wein, der vor ihm stand. »Es treibt mich eine Sorge an Euer Herz, allerheiligster Vater. Die Sorge um – Lukrezia.«
Der Papst horchte auf und spürte eine wohlige Erregung durch sein beklommenes Gemüt gehen. Der Name Lukrezia wirkte immer wie Tau auf sein Herz. Er gab sich keine Rechenschaft darüber, mit welch ungeheurem Frevel er seine Seele belud, wenn er seine Gedanken in einsamen Stunden nach ihrem Palast schweifen ließ und er sich dann ihre Schönheit herzauberte, sie langsam ihres Schmuckes und ihrer Kleider beraubte, um sie dann, wie er sich ausreden wollte, mit Maleraugen zu betrachten. Er schloß diese künstlerisch genießenden Augen, atmete röchelnd und hörte durch seine Adern das Blut rauschen, das den Greis zum sehnenden Jüngling machte. Und eines Tages war er wirklich aufgestanden, war zur Tür geeilt, um Lukrezia zu holen und – da warf ihn ein Ohnmachtsanfall zu Boden. Die Greuel des Atridenhauses dämmerten warnend vor seinen Blicken auf. Und er nahm nach dem Erwachen eine dünne Peitsche und geißelte sich damit Rücken und Nacken.
Lukrezia! Der Name klang ihm jetzt wie der Sirenenlaut in die Sturmnacht des Schiffers. »Du sprichst von Lukrezia? Ist sie nicht schöner geworden?«
»Aber die Perle der Frauen ist unter die Säue geworfen.«
Der Papst blinzelte den Sohn an. »Du meinst, sie ist nicht glücklich.«
»Sie ist so unglücklich, daß wir endlich Schluß machen müssen.«
»Du irrst,« sagte der Papst. »Sie leben jetzt wie Turteltäubchen. Man kenne sich bei den Weibern aus. Eines ist sicher. So leichtes Spiel wie bei Giovanni Sforza werden wir bei ihrem zweiten Gatten nicht haben. Lukrezia wird sich wehren und der Herzog auch.«
Cesare sagte gelassen: »Er hat nur die Wahl, freiwillig zu verzichten oder zu –« Er wulstete die Lippen und schwieg.
Alexander verstand schnell. Unbeweglich lag er in seinem Scharlachstuhl, als wäre er auf Blutpolstern gebettet, die ihm sein Sohn als einzig richtige Folie für seine Erscheinung hingebreitet.
Über dem Hof lag eine helle Sternennacht. Cesare öffnete das Fenster. Verfrühte Lenzwärme drang in Stoßwellen in das sündenbeschwerte Turmgemach, wo schon so oft die Pläne der Borgia ausgesponnen worden waren. Kein Laut regte sich. Nur fern klang der dumpfe Schritt eines wachenden Papstsoldaten.
Der Papst drängte sich zitternd, von leisem Mitleid getrieben, an seinen Sohn heran: »Er ist – so jung! Verschone ihn! Versprich mir, daß du ihn nicht –« Das Wort würgte ihm die Kehle zu.
Aber er sah die gefühllosen Augen Cesares auf sich gerichtet. Der Herzog stand beim Fenster, wo seine herkulischen Glieder statuenhaft leuchteten. »Gut,« sagte Cesare. »Dann wird Alfonso so gütig sein müssen, die Ehe zu brechen.«
»Lösen können wir sie nicht, das kann nur der Tod.«
»So wollen wir ihn bitten, zu gehöriger Zeit zu kommen,« sagte der Herzog Valentino. Das Wort schnitt durch die Luft wie ein scharfer Sensenhieb. Durch des Papstes Brust rieselte das Grauen. Das reiche Essen mit den Weinen hatte sein Blut schwerflüssig gemacht. Er fühlte sich aufgedunsen und abgespannt. »Wir wollen morgen weiter reden –«
»Nur noch eines, allerheiligster Vater,« sagte Cesare etwas verlegen. »Mein Töchterchen Luise in Frankreich wird bald die nötige kleine Würde bekommen müssen, die der Tochter eines Herzogs der Romagna gebührt. Ich möchte Euch bitten, der ohnehin reichlich bedachten Lukrezia das Herzogtum Sermoneta abzunehmen. Spoleto und Nepi sind schon eine schwere Last für so junge Schultern.«
Der Papst seufzte. Seine Hand machte eine Gebärde der hilflosen Zustimmung. Er war so entsetzlich müde. Aber dieser stürmende Sohn hatte kein Mitleid mit dieser Müdigkeit.
Cesare wollte Barett und Mantel nehmen. Da fiel ihm noch eine Kleinigkeit ein. »Man könnte meine Schwester ja durch ein neues Herzogtum entschädigen, das auszusuchen ich mir alle Mühe geben will. Prunk und Pracht soll sie umgeben, wir wollen sie mit den schönsten Frauen ausstatten, ihre Hofhaltung soll einer Königin gleichkommen. Unter ihren Begleiterinnen soll Giulia Farnese –«
»O, laß sie mir!« bat die unheilbare Verliebtheit des alten Papstes. Das lebendig gewordne Blut des lüsternen Greises pulste mit einem Male schneller durch die Adern, und die schläfrigen Augen bekamen einen wollüstigen Glanz.
»Giulia Farnese verdient Tadel, allerheiligster Vater,« sagte Cesare mit einem feinen Lächeln. »Ihre blendende Schönheit hat uns eine andre vertrieben. Es scheint, Giulia Farnese fürchtete die Rivalin in der himmlisch schönen Tiziana de' Calvi und war so unvorsichtig, diese Furcht durch öffentliche Äußerungen zu bekräftigen. Und da Donna Tiziana fühlte, daß die Strahlenkraft der Sonne Giulia ihr eigenes Licht verdunkeln könnte, zog sie es vor, rechtzeitig selbst zu erlöschen. Und so verschwand sie.« Und er setzte mit einem Lächeln hinzu: »Leider!«
Der Papst hatte seine Sinne so weit geöffnet, daß er diesen Seufzer auffangen konnte. »Du scheinst an dieser Hofdame Gefallen gefunden zu haben.«
»Sie war geheimnisvoll wie eine in der Muschel eingeschloßne Perle. Brancaleone muß sie priesterlich streng geschont haben, da er sie so unversehrt in ihrer Blütenreinheit der Nachwelt übergeben konnte, die nun nichts mehr von ihr besitzt als die Erinnerung an ihre meteorenhafte Erscheinung. Sie kam und schwand. Findet Ihr das nicht merkwürdig?«
»Ich kannte sie überhaupt nicht,« sagte der Papst.
»Es war reizend, sie neben Lukrezia zu studieren,« sagte Cesare genußsüchtig. »Dieses goldne Blond und das tiefe Schwarz, diese verführerischen Gegensätze, dabei die innerlichen Verschiedenheiten, die eine voll heitrer Anmut und kindlichem Gemüt, die andre von hoheitsvoller Gemessenheit, die eine Mutter, die andre, den süßen Segen entbehrend – o, es war keine üble Laune von Euch, allerheiligster Vater, dem Hof durch zwei so schöne Frauen eine malerische Stimmung zu geben.« Plötzlich sagte er scharf: »Ich glaube nicht, daß Tiziana de' Calvi in Toskana ist. Auch nicht, daß sie dem Luigi Savelli entfliehen wollte. Die kluge Frau hat mit viel Glück ihre Flucht ins Werk gesetzt, und das reizt mich eben, meine Anstrengungen zu verdoppeln.«
»Ich rate dir, dein Augenmerk auf Colonna oder Savelli zu richten,« sagte der völlig aufgemunterte Papst.
Cesare schmunzelte. »Es ist auffallend, daß sich ihre Spur hinter – Bracciano verloren hat. Ich werde mich also an die – Orsini halten.«
»Du glaubst, daß –«
Cesare nickte. »Giangiordano, der Schloßherr von Bracciano, ist allerdings in Frankreich. Aber es ist einer unter den Orsini, der mir bisher noch immer ein Geheimnis geblieben ist, ein Mann, der sich mit dem Strahlenkranz der Unantastbarkeit schmückt, der aber noch nicht den Beweis geliefert hat, daß er seinen Ruf auch verdient.«
Der Papst spannte die Augen und Ohren. »Du denkst an –?«
»An den Kardinal Giambattista Orsini.«
Der Papst runzelte die Stirn. »Der Mann ist unangreifbar, ehrenwert und ohne Falsch. Ein Sonderling, zugegeben. Aber einer, der den Engel der Unschuld zum Verteidiger hat. Das Weibliche hat überhaupt, scheint es, noch nie in seiner Gelehrtensphäre Einlaß gefunden. Sein Schloß Monterotondo beherbergt Künstler, Gelehrte und –«
»Und eine gewisse Malaspina, Gesellschafterin der alten Orsini, einen Gast aus Bologna.« Wie einen wohldurchdachten Trumpf spielte er sein Wissen aus. »Alle Gründe, die Ihr für die Askese dieses Sonderlings ins Treffen geführt habt, sind für mich ein Anlaß mehr, mißtrauisch zu sein. Wer dreißig Jahre hindurch seinen Keuschheitspanzer im Stand gehalten hat, wird dadurch für Frauen so verlockend, daß er am Ende Mühe hat, vor ihren verführerischen Unternehmungen die Wehr nicht abzuschnallen. Ich glaube an die lebenslängliche Unberührtheit des Leonardo da Vinci ebensowenig wie an jene des Kardinals Orsini. Auch der weise Sokrates hat am Ende eine Xantippe heimgeführt, und die Enthaltsamkeit will doch um so ausgiebiger belohnt werden, je länger sie ihr prahlendes Dasein geführt hat.«
Durch die Nacht stieß der rauhe Wächterruf, der Mitternacht ankündigte. Cesare küßte dem Vater Hand und Fuß. Die Zeremonie war ihm heilig.
Da klopfte es hastig. Der diensthabende Offizier der vatikanischen Wache stand an der Schwelle, bleich und verstört. »Allerheiligster Vater – Katharina Sforza – ist entflohen!«
Die Borgia fuhren empor. Cesare triumphierte. »Sagte ich's nicht? Das Belvedere als Gefängnis einer Katharina!«
Alexander trat der Schaum auf die Lippen. »Mensch! Teufel! Den Kopf ab von einem so untauglichen Rumpf!« schnaubte er den Offizier an.
»Unsere Reiter haben sie noch rechtzeitig ergriffen, als sie über den Tiber wollte,« meldete der Offizier.
»Sofort in die Engelsburg mit ihr!« wütete der Papst. Mühselig stützte er seine erschreckten Glieder auf seinen Stock. Als der Offizier fort war, warf er sich an Cesares Hals. »Ich muß dir folgen, mein herrlicher Sohn. Deine Gedanken tragen Gottes heilige Siegel.« Plötzlich blieben seine Augen an den Stirnmalen der Wollust hängen. Angst und Mitleid durchzitterten ihn.
Cesare kam den Fragen des Vaters zuvor. »Die Heimtücke eines Weibes malte mir die Beulen ins Antlitz. Ich habe die schöne Pompea de Berla durch zwanzig Nächte mit meiner ganzen Wollusttiefe genossen, bis mir der Apfel zu süß schmeckte. Da warf ich ihn weg. Aber was tut meine schöne Pompea? Aus Rache wirft sie sich in einer einzigen Nacht fünf Schiffern und fünf Schweizer Söldlingen in die Arme, die sie sich aus dem Hospital der Franziskaner in Bologna hatte heimlich kommen lassen. Sie waren alle mit dem französischen Gift angesteckt. Als sie gewiß war, daß auch sie der Krankheit verfallen war, warf sie sich mit scheinheiliger Liebe an meine Brust, ich ließ mich von ihrer Verführungskunst hinreißen und trank mit ihren Küssen das Gift der Söldlinge ein. Sie gestand und nahm mir die Rache selber ab; sie sprang bei Imola von der Brücke in den Santerno. Aber ihr Gift ließ sie in meinen Gliedern zurück. Es sticht mich nachts mit Nadeln, und ich spüre meine Gedanken wie knabbernde Wölfe in meinem Hirn hin und her rasen.«
»Mein armes Kind!« Die Tränen liefen ihm über die Backen, und er umarmte den Gezeichneten.
Cesare setzte das Barett über die granatroten Beulen. Dann schritt er den Kammerdienern entgegen, die an der weitgeöffneten Tür standen, um ihn in die obern Gemächer des Vatikans zu geleiten. Dort ließ er sich von seinem Sekretär das zyprische Kupfer reichen, das er sich, vermischt mit dem Theriak des neronischen Leibarztes Andromachus, in die Haut reiben ließ. Dann erschien sein Astrolog und reichte ihm den Horoskopzettel. Der Mond ging durch das Zeichen des Widders und der Wage. Er konnte eine ruhige Nacht erwarten. Er begann sie mit der Lesung der »Sforziade«, die die Geschichte des großen Feldhauptmanns Francesco Sforza behandelte. Daneben lagen die Skizzen der neu erfundnen Kriegsmaschinen des Leonardo da Vinci, das Programm für das Wagenrennen und für die Stiergefechte auf der Navona und das Konzept für die Kundmachung, nach welcher kraft apostolischer Autorität den Juden der Zwanzigste und dem Klerus der Zehnte auferlegt werden sollte zur Verteidigung des wahren Glaubens gegen die ruchlosen Türken. Das alles wollte der unermüdliche Arbeitseifer Cesares noch in dieser Nacht bewältigen. Seine Nerven glichen gespannten Schiffstauen: sie gaben keinem Sturm, keiner Arbeit nach.
 Nur wie im Traum streifte Tizianas Auge das blühende Gelände der Hügel. Vor dem Fenster des Turmzimmers lag wie ein Gnadengeschenk des Himmels die römische Campagna ausgebreitet, darüber die rosenroten Schleier des Abends. Der Himmel schob seine glühenden Wolkenteppiche der goldnen Königin entgegen und entzündete die Riesenleuchten vor den Toren des Sonnenuntergangs. Die Hügel wiegten sich in der süßen Ruhe des Abends in den Traum, und dann bewegten sich leise und rhythmisch die sanften Wellen der Gräser unter dem Hauch des Meerwinds, der von Civitavecchia herüberstrich.
Nur wie im Traum streifte Tizianas Auge das blühende Gelände der Hügel. Vor dem Fenster des Turmzimmers lag wie ein Gnadengeschenk des Himmels die römische Campagna ausgebreitet, darüber die rosenroten Schleier des Abends. Der Himmel schob seine glühenden Wolkenteppiche der goldnen Königin entgegen und entzündete die Riesenleuchten vor den Toren des Sonnenuntergangs. Die Hügel wiegten sich in der süßen Ruhe des Abends in den Traum, und dann bewegten sich leise und rhythmisch die sanften Wellen der Gräser unter dem Hauch des Meerwinds, der von Civitavecchia herüberstrich.
Wenn Tiziana ihre unruhigen Gedanken verjagen wollte, saß sie immer bei diesem hohen Fenster, eines der alten Bücher in den Händen, und ließ dann von Zeit zu Zeit den Blick in die unermeßlichen Räume stiller Einsamkeiten schweifen, und ihre empfindsame, bewegte Seele wurde bald ruhiger gestimmt. Aus dem Grün der Berghänge zu ihren Füßen, wo wilde Weide mit Eichen sich bis zum Tiber erstreckte, blühte es in österlicher Pracht herauf. Sie saß da am Morgen, wenn die betaute Erde dampfte und die blitzenden Lichter das Berghaupt des Soracte entzündeten; in den schwülen Mittagsstunden, wenn das heiße Himmelsblau eine wohlige Müdigkeit in die Glieder drückte; am Abend, wenn der Opalglanz des Firmaments sich in Rosentöne auflöste und dann des Herrgotts herrlichste Palette im Westen ihre Farben aufdeckte; und selbst die anbrechende Nacht lockte sie noch ans Fenster, und sie hörte auf das Rauschen der alten Eichen da unten und sah das Mondlicht die blassen Zauber in die Wipfel weben, und sein Flimmern rieselte die Hänge hinab bis zum Tiber. Aber auch an trüben Tagen lag ihre Seele im Bann der Einsamkeit, und ihr Auge trank die Trauerstimmung der übergrasten alten Grabhügel, die an die Latinerkämpfe der vergrauten Zeiten erinnerten, und sie hörte leise den Boden nachzittern unter dem Hufschlag der Rosse, die der lange Kampf zwischen Orsini und Colonna bei den Burgen der Campagna gegeneinander hetzte. Dann war ihr, als ob die Schwermut der Hügel nur der Ausdruck des von ihnen erlittnen Leides wäre. Und es kamen Tage, wo erschreckte Vögel vorbeiflogen und über dem fernen Meer ein verdüsterter Himmel sich in Bewegung setzte, um dann Wolkenungeheuer von phantastischer Form, aus denen böse Engel ihre blitzenden Schwerter zückten, gegen die Orsiniburg loszulassen. In solchen Stunden überkam sie die Angst, wiewohl zwei Schützer ihre Helferdienste an sie verschwendeten. Und wenn der graue Regen in die Hügel fiel, seine Schleier den Tiber aus dem Bilde verdrängten und die Himmellosigkeit ihre Melancholie ins Herz der schönen Frau warf, versenkte sie ihr Leid in den Klang der Laute.
Da standen dann zwei Männer in der Stille ihrer Zimmer, der eine frühlingsjung, der andre sommerreif, und horchten mit bang verquältem Herzen hinauf nach dem Fenster, wo die Klänge in den Regen hinausrauschten. Beide wußten noch nicht, was sie mit der Frau beginnen sollten, deren Schönheit in ihre Herzen einen wilden Aufruhr gebracht hatte.
Heute aber war eine Entscheidung gefallen. Der Kardinal war vor Tiziana hingetreten und hatte ihr die letzten Nachrichten gebracht. Luigi Savelli war von Genua zurückgekehrt und in der Gegend von Bracciano waren Savellireiter gesehen worden. Die Unruhe der Jagd kam wieder übers Land. Cesare Borgia war in Rom und träumte von marathonischen Siegen. Alle Wege waren von Söldnerhaufen, Pilgern, Bettlern und verdächtigem Gesindel voll. In Rom herrschte Furcht und Verzagtheit. Man wußte nicht, welche Schrecken das Papstregiment Alexanders noch aus dem Vatikan speien würde, man sah nur Leichen durch die Straßen tragen, von denen niemand wußte, wer sie waren, man hörte von grauenvollen Morden, und vor zwei Tagen sahen die Kardinäle Grimani und Caraffa, als sie über die Engelsbrücke ritten, rechts und links auf einfachen Galgen je neun Wegelagerer und Mörder baumeln. Zur selben Zeit tötete Cesare Borgia unter dem Jubel des Volkes auf dem Petersplatz einen Stier, nachdem er zuvor einem gefangenen Prälaten in der Engelsburg persönlich Gift gereicht hatte. Die schöne Elisabetta von Urbino war mit großem Geleite von ihrer österlichen Romfahrt in San Marino eingetroffen, nachdem sie zuvor auf dem Wege von Räubern überfallen worden war. Auch schwärmten geheimnisvolle Reiter von Imola um Rom herum, die die Katharina Sforza aus der Engelsburg entführen wollten.
Vor der Fülle unheimlicher Nachrichten sank der Mut Tizianas zusammen. Und der Kardinal nahm aufatmend ihren Entschluß entgegen, daß sie den Sommer über noch zu bleiben gedenke. Keine Miene regte sich in ihrem fast bis zum Stolz verdüsterten Antlitz.
Da war auch der Jüngling eingetreten, verwirrt, bleich, die Stirn von Trauer umwölkt. Und in diesem Augenblick gerade hatte Tiziana das hellklingende Wort des Dankes gefunden für die fernere Gastfreundschaft. Da zerriß das Gewölk auf der Stirne des Jünglings.
Tiziana blieb! Halb gefangen durch die Not der Zeit, halb freiwillig. An diesem Tage aber vermied sie es, die Bibliothek zu betreten, wo der Kardinal arbeitete, und zeigte sich überhaupt nicht im Schlosse. Erst am Abend nahm sie die Roma triumphans des Historikers Flavio Biondo und setzte sich damit zum Fenster. Marcello Gaetani war noch nicht zurückgekehrt; er mußte einen weiten Streifritt gegen Nepi unternommen haben.
Nun sank die Sonne, und die letzten verzuckenden Strahlen blitzten über die Burgzinnen. Im Tal lagerten schon die grauen Dämmerungsschatten. Dort ringelten sich die Rauchsäulen der Hirtenfeuer träg in die Gespinste des Abends.
Da ritt Marcello mit seiner kleinen Kavalkade heran. Nun zog sich Tiziana vom Fenster zurück. Er sollte nicht glauben, daß er erwartet wurde. Der Reiter spähte angestrengt, aber vergeblich zu dem leeren Fenster hinauf und schlug dann dem Roß die Sporen in die Flanke, daß es sich hoch aufbäumte. Und im Torweg hallte der Hufschlag, als ritte ein zürnender Pelide ins Schloß.
Tiziana lächelte den ritterlichen Knaben an, der bald darauf, den Blumenstrauß in der Hand, seine stattliche Schönheit vor ihr aufpflanzte; er war gar schmuck anzusehen, vom Scheitel bis zur Sohle ein wohlgebildeter Edelmann, der seine Glieder gar flink zu bewegen wußte.
»Ihr kommt von Nepi?« fragte Tiziana leicht befangen.
Er nickte. »Die Blumen pflückte ich am Fuß von Scrofano. Dann ritt ich gegen den ciminischen Bergwald und grüßte den Soracte. Lukrezia Borgia, sagt man, soll bald in Nepi einziehen. Den Herzog Ludovico haben seine eignen Schweizer verraten. Er fiel in die Hände der Franzosen. In Bracciano erwartet man Giangiordano aus Frankreich zurück.« Der Name Bracciano belebte doch das dunkle Auge Tizianas, und Marcello wußte, was für sie in dem Namen schwang. Dort spielte das Schicksal den Auftakt zu ihrer künftigen Lebensmelodie. Das schien sie jetzt zu übersinnen. Drum warf Marcello mit Absicht die Frage hin: »Ihr habt die Burg Bracciano wohl sehr in Euer Herz geschlossen?«
»Es war mein erster Hafen,« sagte sie leise versonnen. »Mit Dankbarkeit muß ich seiner gedenken.«
»Und dessen, der Euch in den zweiten Hafen geleitet,« sagte Marcello. Es war, als unterstriche er jedes Wort mit dem hellen Klang seiner Stimme.
Tiziana sah ihn gekränkt an, und dunkel flammten die Rosen auf ihren gebräunten Wangen. »Edler Menschen Tun griffelt sich tief in unsre Seele. Was wäre ich ohne den Kardinal?«
Marcello senkte beschämt die Augen. »Und was war ich? Ein zu Tode gehetztes Wild. Er rettete mich! Des Himmels Segen auf sein Haupt!«
»Manchmal ist es, als berührte man in seiner Nähe den Himmel selbst. Selten trübt der Zorn sein gefestigtes Wesen, und zürnt er, so tut er es mit sich selbst, indem er sich anklagt, ungerecht zu sein. Ist er nicht ganz Güte, Verzeihung, Verständnis? Wenn er des Morgens aus seiner Burg reitet, hat er das Ansehen eines Kriegsmannes, wenn er in der Kapelle die Messe liest, strahlt seine Gestalt priesterliche Hoheit aus, wenn er seine Diener versammelt, ist er ganz Herr ohne den Schatten einer Tyrannis. Sein Auge befiehlt und bittet zugleich. Und wenn er über seinen Arbeiten sitzt und in ferne Zeittiefen hinabtaucht, um kostbares Gold des Geistes zutage zu fördern, dann gleicht er dem griechischen Philosophen, und er entzückt durch die Ruhe und Sicherheit der Gedanken.«
Marcello stand mit verfinsterter Miene vor ihr, seine unruhigen Finger spielten am leeren Degengehänge. »Ich will Euch Gutenacht sagen – für heut und morgen – und für immer.« Es klang todtraurig.
Tiziana wandte sich jäh um. »Ihr geht fort?«
Er antwortete nicht.
Da schwieg auch sie. Die Nacht sank mählich vor den Fenstern über das blühende Land. Der Lenzduft strömte herein. Über den Hügeln und Bergen, deren Umrisse verschwammen, lagen noch die fahlen Lichter des Untergangs. Eine erwartungsvolle Stille senkte einen süßen Frieden in die Welt, deren Tag verrauscht war. Aber bis in das Turmgemach vermochte er seine tröstenden Zauber nicht zu spinnen. Hier kämpften zwei Seelen mit den in ihrem Innern wogenden Wellen, die das Herz zu überfluten drohten. Marcellos Blick erhaschte eine schöne Perle, die auf einem Goldgehänge zu funkeln begann, gerade als Tiziana die Kerzen anzündete. Das Gehänge lag auf einem samtnen Kissen unter mancherlei Geschmeide, und Marcello erinnerte sich, es noch vor wenigen Tagen beim Kardinal gesehen zu haben. »Diese Perle gab Euch der Kardinal?« schnellte er heraus.
Tiziana nickte unbefangen. »Erst heute vor seinem Wegritt. Es ist das erste und letzte Angebinde, der Dank für mein Bleiben.«
»O, wäre es das letzte!« seufzte die Qual aus des Jünglings Brust. »Seid Ihr ihm nicht selbst eine Perle geworden?«
»Marcello!« Die feurigen Gluten in dieser Knabenbrust begannen die Dämme zu sprengen, die seine natürliche Zucht aufgerichtet hatte. Und nun hörte Tiziana das erste Krachen und Bersten.
»Gönnt mir diesen Beterplatz vor dem Altar Eurer Schönheit, Donna Tiziana!«
»O Marcello!«
»Ich kann sie nicht mehr zügeln, die Wildheit, die mein Wesen zermalmt wie die ungestümen Rossehufe das zarte Leben, das sich ihnen in den Weg wirft.«
»Steht auf, Marcello!«
»Laßt mich hier knien, mit Bettlerhänden die Kleinigkeit Eures Kleides streicheln, laßt mich die Wonnen des Augenblicks, der nicht bedacht sein will, in vollen Zügen schlürfen. Und dann stoßt mich hinaus in mein drohendes Schicksal.« Er schmeichelte wie ein Kind. Und er war nicht mehr als ein Kind.
Tiziana kämpfte sich mühselig aus der Verwirrung heraus. »Das ist der Knabe nicht mehr, an dessen Zartheit sich mein Herz erfreute,« klagte sie ihn mit wehen Blicken an.
»Ja, ich war zart und schüchtern und ein Knabe,« stammelte er in das duftende Gewebe hinein. »Ich schuf mir ein Traumbild aus Eurem Sein, erhob es zum Idol und lag kniend davor. Und da blühte buntfarbig die Welt um mich her und sonnte sich im Abglanz meines selbstgeformten Götterbilds. Meine Nächte waren durchleuchtet von dem Licht, das Eure Schönheit ausstrahlte wie der kostbare Edelstein in Midas' Krone. Des Dichters süßes Genügen erfüllte meine Seele, wenn ich Euch durch die Auen schreiten sah, ›wie junger Mädchen Fuß beim Fest der Tänze die Erde kaum berührt, o lieblich Bild, kam sie geschwebt im reichen Schmuck der Kränze durchs rot und goldig blühende Gefild!‹ Und alle Tugenden wob sich mein Geist um Euch, wie ein Gewölk von Blumen umgaben sie die herrliche Gestalt, verbildlicht alle und zu Euch gehörig wie die Chariten zu Aphroditens göttlicher Gestalt. Ihr zürnt, Donna Tiziana, und ohnmächtig formen meine Lippen vielleicht Worte, die verletzen, wo sie schmeicheln sollen. O, sprecht jetzt nicht, oder laßt Eure Augen sprechen, und diese nur mit dem Blick der Liebe.«
»Ei, wo ward Euch die feine Gabe des Worts?« Ihr Auge erhellte sich, ihre Angst wich, da seine natürliche Zartheit wieder die Oberhand gewann. »Kommt zu Euch, Guter, ich schätze Euch so hoch, aber rührt nur nicht an dem Heiligtum des Frauenherzens.«
Ihr fraulicher Stolz wuchs in seinen Augen noch schöner auf und gab seiner Werbung noch zärtlichere Farben. »Ich will ja nur ein gnädiges Lächeln und einen zarten Druck der Hand empfangen, will meine Träume um Euch bilden und Alleinherrscher sein in diesen Träumen. Formt mich nach Eurem Willen, ich will stillhalten und die Wandlung mit staunendem Auge erleben. So fügsam bin ich, Donna Tiziana.«
Die zürnende Stirn entwölkte sich, das Auge war zum Spiegel einer freundlicheren Seele, und nun näherte sie sich ihm mit zaghaften Schritten und hob ihm das gesenkte Kinn empor. »Ihr seid so jung und schön, Marcello. Verkümmert Euch nicht die Blüte, indem Ihr sie vorschnell der heißen Sonne eines Gefühls aussetzt, das sie versengt. Seid erst da draußen im Gewühl der Welt, im Kampf der Jugend, so werdet Ihr empfinden, daß ich nicht die einzige bin, die es wert ist, Euer Herz in Aufruhr zu bringen.«
Marcellos Schmerz wühlte sich abermals einen Weg zur Lippe. »Ich liebe, Donna Tiziana!«
»Das glaubt Ihr jetzt!« kühlte sie seine Hitze ab. »Ihr wollt Euch glücklich sehen, nicht das Weib, das Ihr liebt. Ihr kennt nur den einen Schmerz, Euch ungeliebt zu wissen, aber Liebe hat andre Schmerzen zu ertragen. Ach, Jüngling, wie spielst du mit deinem Gefühl!«
»Nein – nennt es nicht so!«
»Umgaukelt mich wie ein schöner Falter die Blume und laßt alle neidischen Wünsche erloschen sein, trübt nicht die Reinheit Eures Seelenspiegels, Tugend sei Euer Leitstern.«
Es war still geworden in der Burg. Gliederlösend sandte die Frühlingsnacht ihre Zauber durchs Fenster. Die Eichenkronen auf dem Berghang rauschten leise, und durch die Stille klang der Hufschlag streifender Reiter. Über die Halden hatte die milde Mondhelle silberne Schleier gebreitet, und da und dort blinkten schneeweiße Mauern von den Hängen herüber, in denen sich das fließende Licht verfangen hatte. Eben schob sich vor Tizianas Augen über eine der Zinnen die bleiche Scheibe Lunas wie ein neugieriges Antlitz heran. Tiziana sehnte ihr Herz in diese Nacht hinaus, daß es ein Schimmer dieses Friedens berühre und mit sanften Ahnungen erfülle.
Marcello stand noch immer, von den Klängen der fast mütterlichen Ermahnung betäubt, hilflos wie ein Knabe da. Und nun tönte es leise an sein Ohr: »Marcello, nun werdet Ihr leichter von hier scheiden –«
»Ich bleibe!« hetzte er hervor. Es klang wie Angst um sein kaum erhaschtes Glück.
Jäh fuhr der Schreck durch Tizianas Glieder. »Ihr bleibt?«
»Ich bat heute den Kardinal um eine Gnadenfrist.«
»Unseliger! Was wird er von mir denken? Von Euch?«
Marcello senkte die Augen. »Er ahnt, daß meine Seele zittert.«
»Ahnt und – schweigt?« Ungestüm rang es sich aus ihrer Brust. »Und duldet, daß Ihr bleibt?« Ihre Wangen glühten. »Ich beschwöre Euch, verlaßt mich, um meiner Ruhe willen, verlaßt mich und –«
»Und ihn!« Blitzartig fuhr das Wort aus seiner eifersüchtigen Seele. Und hemmungslos brauste er weiter: »Hinter der Maske der Gelassenheit verbirgt er ein andres Gesicht –«
»Schweigt, Unseliger!«
»Mit jedem Tag brach ein Stück der Unnahbarkeit und des Gleichmuts in der Numa-Seele ab! O, mit welchem Eifer suchte er Euren Beistand bei seiner Arbeit, wie heiter erregt war er, wenn Ihr Euer Lächeln in seine gelehrte Rede warft, wie seltsam bewegt, wenn Ihr ihm Nachricht von Eurer fortschreitenden Genesung gabt, wie hilfreich und geschickt, wenn Ihr als sein Page des Abends ausrittet, wie beredt war sein sonst so stummer Mund, wenn Ihr ihn batet, die Geschichte der Orsini zu erzählen, und wie beflissen sein Wesen, wenn es galt, Euch einen Wunsch vom Auge zu lesen –«
»Soll ich den Kardinal bitten, daß er mich von dem beleidigenden Eifer eines Jünglings befreit?« Mit größtem Unmut brach sie seine Klage entzwei.
Da warf er seinen Knabenschmerz vor ihre Knie hin. »Madonna! Madonna!« stammelte er unter Tränen.
»Schweigt! Schweigt!«
»Der heilige Mann mit den unheiligen Gedanken – er liebt Euch! Seine Perle! Seinen Stern!«
»Schweigt!«
»Der beste Mensch – aber doch – ein Mensch! Liebe bricht alle Menschlichkeit in Stücke –«
»Marcello –!« Wie ein strafender Cherub wies sie ihm die Tür.
Der Knabe schleuderte seinen Kopf in seine heißen Hände und weinte.
Tiziana wollte verdammen und doch überflutete das Mitleid den Vorsatz. Sie eilte auf ihn zu und ergriff seine zitternden Hände. »Knabe, Knabe, verdirb dich nicht, laß nicht den Wurm der Eifersucht an deinem Herzen fressen. So dankt Ihr es dem Kardinal, daß er Euch aufnahm?«
Da wirbelte es im Herzen des Jünglings zusammen. Er schlug mit den Fäusten an seine Brust. »Brennt mir das Mal der Schmach auf die Stirn, denn ich habe dem besten Menschen die Treue gebrochen.« Seine Zähren durchschüttelten die armen Glieder.
»Seht Ihr, seht Ihr! Liebestränen sind nur die Vorboten der Reuetränen. Nehmt die Verzeihung Eurer Frau mit in einen bessern Traum. Und ich will Gott bitten, daß mein Wesen anders werde, da es solche Leidenschaften entzündet.«
»Eure Verzeihung wird mir der Wegweiser zu Gott sein, den ich beleidigt, indem ich die besten Menschen beleidigte.« Völlig gebrochen raffte er sich auf.
Tiziana streichelte leise, mütterlich über sein zerwühltes Haar, als segnete sie seinen frommen Willen.
Da verrauschte der leidenschaftliche Wogenschwall in seiner Brust. »Nur eines, Donna Tiziana, nur eines bitte ich Euch«, sagte er, indem er zur Tür schritt. »Zerstört mir den Tempel der Hoffnung nicht in meinem Herzen.«
Ein gütiger Frauenblick gab ihm segnendes Geleite. Seine Gestalt verdunkelte in der Tür.
Die Nacht mit den verworrenen Geisterstimmen weckte Tiziana aus der Tiefe der Versunkenheit. Schwer lösten sich ihre Glieder aus der Bedrückung. Sie übersann das Glühen eines jungen Schwärmerherzens. Der galante Dienst hatte unliebsame Kräfte entfesselt, die jetzt ein Flugfeuer in das Herz eines braven Knaben geworfen und ein ebenso braves Frauenherz in arge Verwirrung gebracht hatten. Tiziana sah im Geiste den Eifernden noch immer vor sich stehen, und sie redete ihm einen ganzen Berg von Vernunft in seinen schönen Kopf hinein. Sei erst frei und laß die schönen römischen Mädchen wie bunte Schmetterlinge um dich tanzen, und der Stern Tiziana wird plötzlich erblassen in deiner Liebesnacht. O, du betrügst dich selbst, wenn du der Wollust den geweihten Schleier der Liebe umhängst. Dein Sehnen fliegt in eine sündige Umarmung hinein und sinkt dann ermattet zusammen. Was gilt dir der Ehe beglückendes Gleichmaß? Floras Liebling, der Chloe verliebter Hirte, was hätten sie mit ihren Idolen angefangen, wenn ihre Göttinnen erst ihre Frauen geworden wären? Das Brautbett des Mythos würde in Wirklichkeit das Grab ihrer Liebe geworden sein. Geflügelt sind die Freuden der Jugend und schweben schnell dahin, der Becher ist schnell gefüllt und schnell getrunken, und wo der Weise behutsam genießt, schmölzest du Olympiaden zu einer einzigen Nacht zusammen.
Aber da klang in ihr Herz ein anderes Tönen hinein, das bang hallte wie mahnendes Geläute. »Der Kardinal liebt Euch, Donna Tiziana!« Adlerfänge krallten sich in ihr Herz. Vor ihrem bangen Geist erstanden ein paar Stunden, die ihr den Menschen Giambattista Orsini nahegebracht hatten. Seine fürsorgliche Betreuung am ersten Tag in Bracciano, dann die Stunde, da er sie nach Monterotondo begleitete, die Augenblicke der Sorge, wenn Savellireiter in der Gegend schwärmten und der Kardinal seine nächtlichen Runden um das Schloß machte. Der Tag, da er sie das erstemal in seine Bibliothek lud, die Arbeitsstunden mit ihm zu teilen, wo sie ihn in den alten Geschichtsbüchern des Plutarch und Herodot schürfen und die Philosophien des Platon und Aristoteles zergliedern sah. Und dann blitzte die eine späte Nachtstunde auf, da er ihr das Märchen des Apulejus von Amor und Psyche erzählte und zum erstenmal eine ungewöhnliche Bewegtheit durch seine Seele ging. Der stumme Händedruck damals beim Scheiden. Und als sie schon in ihrem Zimmer lag, hörte sie ihn noch die Laute spielen, eines der anmutigen Reigenlieder von Poliziano, das die Schönheit der Sterne besang – –.
Das alles gewann jetzt eine tiefere Bedeutung. Hatte sie heute den Besuch dunkler Schicksalsgewalten? Warum warf sie eine unbekannte Macht aus einer Erregung in die andre? Ihr war, als drängten sich Geister, denen sie keinen Namen geben könnte, in dieser Burg an sie heran, um ihre seelische Festigkeit zu erproben.
Da lag die mondhelle römische Landschaft vor ihr, ganz eingesponnen in Duft und Dunst. In ergreifender Erhabenheit glänzte zu Häupten der bangen Frau die heilige Sieben des Sternenwagens, während die andern Augen Gottes in der schimmernden Höhe blasser grüßten. Das Licht rieselte über die vorspringende Mauer einer Bastion herab und schmückte das Wipfelgewoge der Eichen in der Tiefe mit silbernen Säumen. Lautlos webte die schöne Göttin Selene ihren Zauber in die Natur und warf den glänzenden Schleier ihres Gewandes als Tau über die wohlig atmenden Fluren. Und Tiziana glaubte im Spiel eines heidnischen Gedankens die frauensegnende Göttin anflehen zu müssen, daß sie sie vor aller Unruhe des Herzens bewahren möge.
Eines Vogels Traumruf ging leise durch die Stille. Dann klang der einschläfernde Gesang der Zikaden aus dem lichtüberfloßnen Berggrund herauf.
Fern aber lag das Ungeheuer Rom unter dem geheimnisvollen Gewebe silberner Mondnebel.
Da tönte Pferdegetrappel. Vor der Burg wurde es plötzlich lebendig. Undeutlich unterschied Tiziana in dem Strauchwerk Reitergestalten, die der Burg zusprengten. Und da – sie erkannte den Falben des Burghauptmanns Spinozzi und den Rappen ihres getreuen Tolomei, der jetzt die Oberaufsicht über die Söldnerstuben hatte.
Ihr erster Gedanke war: die Savelli in Sicht! Ihr Herz begann zu zittern. Sie riß die Tür auf und eilte auf den Gang.
Da sprengte der Hauptmann Spinozzi auf den Hof und schwang sich vom Pferde. Knechte stürzten herbei. Und der Hauptmann rief zur großen Loggia hinauf, die an die Zimmer des heilkundigen Burgdiakons stieß: »Holla! Krankenwache! Verbände!«
An der Loggienbrüstung erschien ein Söldling.
»Linnen und Tragbahre! Der hochwürdige Kardinal ist verwundet!«
Da erstarrte das Blut in Tizianas Adern. Aber im nächsten Augenblick befreite sich die Angst aus dem Gefängnis des Herzens. »Spinozzi – was ist geschehen?« rief Tiziana hinab.
»Seine Exzellenz ist von Wegelagerern überfallen –«
»Er lebt?« Es glich einem Schrei.
»Lebt und bittet Euer Gnaden, ohne Sorge zu sein. Wir bringen ihn.«
Das klang nur mehr wie fernes Windrauschen an ihr Ohr. Er lebt! Das überhallte alles! Und Tiziana spürte, wie wonnige Fittichschläge das halb erstarrte Leben wieder in Gang brachten. Er lebt! Sie warf sich an der Brüstung der Bogenhalle in die Knie und dankte der Madonna für den Trost, der in ihr angstverhetztes Herz geworfen worden war. Er lebt! In das Wort schwang das Brausen ferner Glocken hinein, die ihren Auferstehungsgruß einem herannahenden Herzensfrühling entgegenjauchzten. Und jeder Atemzug war ein Dankgebet, jeder Blick zu den Sternen ein jubelndes Salve Regina!
In dieser Nacht wurde es ihr klar: sie liebte den Kardinal Giambattista Orsini.
 Dämmergraue Schatten spinnen mählich die Türme Roms ein. Auf den Kuppeln und Dächern lagert noch die letzte Tagschwüle und braut ihre Dünste heiß wie Wüstenhauch. Von den Türmen fallen schwere Klänge, die hallenden Abschiedsgrüße des verlöschenden Tags, über dem Monte Mario leuchten die roten, goldumsäumten Fahnen, die die Engel dem scheidenden Gestirn nachschwingen, das seine letzte Kraft verblutet. Und aus dem Sabinerland, über die veilchendunklen Berge wälzt sich lautlos der rote Vollmond herauf und wirft über das latinische Land im Osten einen blassen rosaroten Schleier.
Dämmergraue Schatten spinnen mählich die Türme Roms ein. Auf den Kuppeln und Dächern lagert noch die letzte Tagschwüle und braut ihre Dünste heiß wie Wüstenhauch. Von den Türmen fallen schwere Klänge, die hallenden Abschiedsgrüße des verlöschenden Tags, über dem Monte Mario leuchten die roten, goldumsäumten Fahnen, die die Engel dem scheidenden Gestirn nachschwingen, das seine letzte Kraft verblutet. Und aus dem Sabinerland, über die veilchendunklen Berge wälzt sich lautlos der rote Vollmond herauf und wirft über das latinische Land im Osten einen blassen rosaroten Schleier.
Über der Peterskirche liegt goldige Nachglut. Die bronznen Türen sind weit geöffnet. Ein feiner Weihrauchduft strömt aus dem Innern in die beginnende Nacht auf dem Platze. Ein Abendchoral verhallt in den Wölbungen und dringt wie Geistergesang aus himmlischen Sphären durch die Dommauern. Goldne Kerzenflammen, wie Sterne in dunkler Nacht zu schauen, blinken durch die Türvierecke hinaus in das Zwielicht.
Draußen wird es still und leer.
Der Kardinal Orsini hatte beim Goldschmied Romano ein feines Gehänge für Tiziana bestellt und gegen den Abend noch den kunstsinnigen Kardinal Grimani besucht, mit dem er fleißig über die letzten venezianischen Drucke des Aldus Manutius disputierte. Giambattista liebte es, in Rom nur im einfachen Ritterwams zu erscheinen, wenn nicht eine kirchliche Zeremonie ihm die Last des Kardinalsgewandes auflud. Nun wollte er morgen wieder nach Monterotondo zurückkehren. Er wandte seine Schritte nach dem Orsinipalast, wo er sein Nachtquartier hatte, sooft er nach Rom kam. Auf dem Weg dahin drängte es ihn jedoch nach dem großen Dom der Christenheit. Er wollte die mondhelle Nacht benützen, um den hehren Bau Rosselinos zu studieren, über den sich heute beim Kardinal Grimani ein kleiner wissenschaftlicher Streit entsponnen hatte.
Die Nacht graute an den Mauern hinauf, als Giambattista vor den Türen des Filarete stand. Unwillkürlich kam ihm das Meisterwerk ähnlicher Art am Baptisterium in Florenz in den Sinn, wo die wenigen Figuren Ghibertis eine so beredte Sprache voll Wucht und Pathos sprachen, während hier ein willkürliches Durcheinander von christlichen und heidnischen Elementen den Beschauer nicht zur Sammlung kommen ließen. Was sollten die Äsopischen Fabeln und das Grabmal des Hadrian, die römischen Kaiserköpfe und Leda mit dem Schwan neben der Verherrlichung der Kirchenunion? Der Unmut des Gläubigen wie des feinsinnigen Gelehrten wurde in Giambattista entfacht.
Über dem Platz lag völliges Dunkel. Eintönig rauschte das Wasser des Springbrunnens an sein Ohr. Da begann es über dem Borgo im Osten leise zu dämmern. Ein blaßsilberner, durchsichtiger Nebel legte sich über die Dächer der Kardinalspaläste. Der Mond ging auf. Die mächtigen Säulen des Tempelvorhofs begannen in der Höhe zu leuchten wie schneebedeckte Riesenstämme.
Der Kardinal hielt plötzlich inne. Ihm war, als sprengten Reiter fern durch die Straßen. Aus der Via Alexandrina näherten sich Schatten. Es mochten Pilger sein, die zu nächtlichen Gebeten nach Sankt Peter zogen. Da sah er auch schon die Gestalten einiger Reiter aus einer Gasse traben. Nun hielten sie still und saßen ab. Sie scharten sich um einen Punkt, den Giambattista nicht erkennen konnte. Und dann blieb die Gruppe bewegungslos. Aus ihr schälten sich plötzlich zwei Gestalten heraus, die nach dem Vatikan liefen. Die Zurückgebliebenen drängten sich mit ihren Pferden in die Mauerschatten.
Der Kardinal wußte nicht, warum ihm auf einmal das Herz so laut schlug. Er konnte den Blick nicht von der dunklen Gruppe wenden, die wie ein zusammengeklumpter Trümmerhaufen reglos an der Häuserwand klebte.
Die Einsamkeit der Nacht warf das Gemüt des Orsini in eine Art Bangigkeit. Er stand im Schatten einer Säule, die den Eingang eines Palastes flankierte, und ein unbestimmtes Gefühl zwang ihn, sich nicht von der Stelle zu rühren.
Plötzlich bekam die Nacht Bewegung und Töne. Der Kardinal hatte die Vorstellung, daß graue, mächtige Eulenflügel durch das Mondlicht flatterten, die es im Nu verschatteten. Dann war ihm, als stöhnten ferne Wälder unter der Wucht heranziehender Gewitter auf. Seltsame Stimmen, gurgelnd und klagend zugleich, zerrissen die Stille, und aus dem Menschenklumpen am Borgoeingang lösten sich Einzelschatten los und schossen wie dunkle Kugeln ins Licht des Mondes, wo sie einen Augenblick aufleuchteten, als wären es geharnischte Ritter, um dann wieder zurückzusausen in die zusammengeballte Masse.
Eben als eine schwarzgraue Wolke mit einem weißseidenen Saum über Sankt Peter herangeschwebt kam, wurde es auch im Winkel beim Vatikan lebendig. Dort ritt in behaglicher Ruhe eine kleine Kavalkade hervor. Vor ihr schritt eine zart gebaute Gestalt. Sie bewegten sich in den Häuserschatten hinein, und es sah aus, als wären es unnatürliche, modellierte Figuren, die irgendein Drahtzieher lenkte.
Plötzlich schoß der Klumpen der abgesessenen Reitergestalten aus dem Dunkel hervor und löste sich rasend schnell in einen Ring auf, der die kleine Kavalkade und den Fußgänger umschloß. Ein Klirren und Rasseln und Schreien zerbrach die bange Stille. Im Nu verfinsterte sich der Mond. Der ganze Knäuel geriet in unheimliche Bewegung, schwang sich bald nach dieser, bald nach jener Seite, sank förmlich in sich zusammen, dehnte sich wieder aus und schnellte dann, wie von einer grauenvollen Macht getrieben, in die Via Alexandrina hinein, wo er verschwand. An der Stelle, wo sich die Masse in wildem Kampfe zusammengeballt hatte, lag nur mehr ein dunkler Körper auf dem Boden. Ein Menschenleib. Nicht weit von den Stufen zum Dom entfernt.
Colonna und Orsini! blitzte es im Gehirn des Kardinals auf. Er schloß die Augen, die Ohren. Er glaubte, jetzt müßten seine Sinne für immer still stehen. Er hatte zum erstenmal ein lebendiges Kampfbild aus der Nacht Roms geschaut. Hörbar schlug sein Herz. Es war, als tröpfelte Blut aus der silberbesäumten Wolke, als flöge Perseus mit dem abgeschlagnen Haupt der Gorgo Medusa durch die Luft. Der Orsini wußte nicht, wie lange er so dagestanden. Als er das Blut in seinen Adern wieder fließen fühlte, öffnete er die Augen. Die Stelle, wo der Körper gelegen hatte, war leer. Aus den Gassen huschten neugierige Gestalten hinaus in das Mondlicht. Stimmen schlugen hin und her. Die Nacht wurde neuerlich lebendig.
Der Kardinal erschauerte. Er wankte die Häuser entlang nach dem Orsinipalast.
Als der Morgen graute, jagten Sbirren und päpstliche Soldaten durch die Gassen von Rom. Und ein Geschrei erfüllte die Luft: Der Herzog von Bisceglia ermordet!
Das Gerücht übertrieb. Der Herzog war in der Nacht angefallen worden und hatte sich schwerverwundet in den Vatikan schleppen können. Arme und Schenkel waren zerstochen. Lukrezia Borgia, sagte man, sei außer sich.
Gleichzeitig ging die Kunde durch die Stadt, daß in Perugia eine furchtbare Bluthochzeit gefeiert worden war. Astorre, aus dem Tyrannenhaus der Baglioni, wurde nach der Hochzeit mit Lavinia Colonna vorgestern nachts samt mehreren Verwandten von den Verschworenen Griffone Baglione und Carlo Barciglia ermordet. Giampolo Baglione brüte furchtbare Rache.
Zur selben Stunde drang aus der Engelsburg die Nachricht, daß daselbst der edle Protonotar Giacomo Gaetani an Gift gestorben sei.
Durch ganz Rom liefen Blutschauer. Die Leute drückten sich an die Häuser, um den päpstlichen Schergen auszuweichen, die überall Schuldige witterten. Alfonso, so munkelte man, sei von den Orsini angefallen worden.
Als der Glutball der Sonne sich über Santa Maria Maggiore wälzte, ritten die Kondottieri des Herzogs Valentino aus dem Vatikan: Vitellozzo Vitelli, Pagolo und Giulio Orsini und Ercole Bentivoglio. Hinter ihnen ein leuchtendes Gefolge in Harnisch und Waffen. Sie zogen in die Romagna, den schönen jungen Herzog Manfredi in seiner Stadt Faenza zu belagern und auszuräuchern.
Wenige Augenblicke darauf sah man Cesare nach dem Lateran reiten. Der Herzog stak in schwarzem Wams und trug ein violettes Barett, um den Hals die goldne Drachenkette. Alles schauerte zusammen, alles wußte, in dieser schönen Form, die aber schon angefressen war, barg sich eine Welt voll prahlender Laster.
Eben als mit fürstlichem Gepränge Cesare Borgia durch die Straßen zog, flatterte es von Mund zu Mund: er hat Alfonso niederstechen lassen!
Ein Volksgefühl, dem der Verstand noch keine Bestätigung zu geben vermochte, richtete den Herzog Valentino. Der Ruf »Evviva Cesare Borgia!« klang wie ein schauerliches » Evviva l'assassino!« Es lebe der Mörder!
An einem Fenster des Zenopalastes stand mit verschluchzten Augen eine arme Herzogin und sah, hinter dem Brokatvorhang verborgen, auf den stattlichen Rappenreiter herab. Der Papst hatte sie nicht zu ihrem schwerverwundeten Gemahl gelassen. Er brauche Ruhe, ließ er ihr sagen. Alles Menschliche mußte sie in ihrer Brust ersticken. Ihre zarte, kaum erwachte Liebe zu Alfonso hatte von außen den ersten Stoß bekommen. Sie hatte bis jetzt in ihrem Gehirn noch gar keinen Platz für die Frage: wer hat es getan? Nur ihr Herz zitterte vor gräßlichem Leid. Das blumenzarte Leben Alfonsos konnte nur allzu leicht den Dolchstößen des Hasses oder der Eifersucht erliegen.
Hinter der Herzogin stand die goldschimmernde Giulia Farnese, die Favoritin des Papstes, die böse Ratgeberin Lukrezias. Ihr liebliches Gesicht, hinter dem man kaum das ränkevolle Herz einer diplomatischen Teufelin vermutete, neigte sich mit zärtlicher Trostgebärde über die unglückliche Lukrezia. »O meine schöne, süße Freundin,« schmeichelte sie sanft, »ängstige dich nicht. Es schützen ihn die Madonna und die Heiligen. Zwölf Frauen pilgern noch heute zur wundertätigen Madonna nach Genazzano, ihre Gnade zu erflehen für das Haupt des Herzogs von Bisceglia.«
»Er wird sterben,« jammerte Lukrezia, deren feines Empfinden sich gegen den seichten Trost der falschen Freundin wehrte.
»Er wird leben!« versicherte die Kurtisane mit der Pose glaubensfester Überzeugung.
»Sein schöner Leib zerstochen, sein Haupt, seine herrliche Stirn! Sprang des Mörders Herz nicht entzwei, als sein Eisen den Panzer dieser Reinheit berührte? Erstarrte er nicht bei dem Anblick der erkalteten Rubine dieses edlen Blutes? Lege mir das Bußkleid an, Giulia, ich will selbst meinen Leib mit Wunden bedecken und mich vor den Altar der Jungfrau hinwerfen. Die Sänfte! Nach Santa Maria del Monserrato!«
»Nein, nein, deine Fibern brennen ja!« Giulia drückte die aufgeregte Herzogin in einen seidenglänzenden Stuhl. »Jeder Augenblick kann dich an das Krankenlager deines Gatten rufen. Und der Papst würde zürnen –«
»Der Papst?!« Rauh stieß sie das Wort hervor. »Steht er seinem Herzen so nahe wie ich? Ziemt es sich, daß dem kranken Herzog der erste Trost von den Lippen des Papstes fließt? Ich sehe sie alle, die zudringlichen Gestalten in Brokat und Gold, wie sie ihre Augen nach der Tür hinstielen, sie alle dürfen ihr erheucheltes Leid vor die Füße meines Alfonso legen, nur mir ist es verwehrt, die Tränen, die ihm schon halbe Genesung sein würden, über seine gute Hand zu tauen. O, ich weiß, er zittert nach mir, durch seinen fiebernden Kopf wirbeln die Träume süßer Stunden, durch sein Herz zucken die Küsse seiner Lukrezia. Laßt mich zu ihm!« Mit einem wilden Ruck schleuderte sie die umklammernden Arme der Freundin beiseite und sprang empor. Schleier und Mantel riß sie vom silbernen Traghaken.
Da verriegelte Giulia Farnese die Tür. Mit einem verdunkelten Blick pflanzte sie sich an der Schwelle auf.
»Bin ich – nicht – Herrin?« Lukrezia starrte sie entsetzt an.
»Nein!« sagte mit grausamer Kälte Giulia Farnese. »Der heilige Vater wird Gründe haben, wenn er verlangt, daß du vorderhand deinen Gatten nicht sehen sollst.«
Da zuckte es wie ein Schwertstreich durch Lukrezias Gehirn. »Er ist – tot?« taumelte sie empor und warf die Hände in die Luft.
»Er lebt!« versicherte Giulia mit gleicher Empfindungslosigkeit. Dann ging sie zum Spiegel und ordnete mit natürlicher Eitelkeit ihr Haar. »Daß du so kindisch sein kannst, Lukrezia,« sagte sie, während sie sich putzte. »Du weißt doch, daß eine Frau in deiner Stellung Rücksichten zu üben hat –«
»Und daß ich nicht Mensch sein darf, wenn mein Gatte verblutet!«
»Du übertreibst immer.«
»Warum läßt man mich dann nicht vor? Fürchtet man, ich könnte ihn zur Rache anspornen? An wem soll er sich denn rächen? Kennt er seine Mörder? Waren es die, welche zugestoßen haben? Wem hat Alfonso so Schweres getan, daß er keinen andern Ausweg fand, sich zu rächen als durch unzählige Dolchstiche? Die Orsini! schreit man in den Straßen. Ich glaub's nicht. Alfonso haßte alles, was Haß großzieht, er ist ja voll Güte und Liebe, und wenn man Blumen in seiner Nähe abreißt, so schmerzt es sein Herz. Sein schönheitstrunkenes Gemüt kennt nur Harmonie und Musik im Leben, es berauscht sich an dem Rhythmus der Sprache, freut sich an Tugend und Sittlichkeit. Sein Gedanke war Lukrezia, sein Wille, mir Gutes zu tun. Und wer hätte Gründe, einen solchen Engel an Güte aus der Welt zu schaffen – wer hätte Gründe als –« Ihre Augen weiteten sich.
Die Fanfaren des Cesare Borgia schmetterten den Satz zu Ende.
Und Lukrezias Leib duckte sich katzengleich wie zum Sprung zusammen. Ihr Gesicht war schreckhaft verzogen, ihr Mund geöffnet, als wollte er dem bedrängten Gefühl den Weg zur Klage freigeben, und die ausgestreckten Arme und die weitgespreizten Finger waren bereit, sich zu einem wütenden Griff zu schließen.
»Was hast du?« fragte die lauernde Giulia.
»Hörst du die Trompeten?«
»Sie blasen ihm den Triumph!«
»Wem?«
»Dem Mann – der – meinen Gatten – morden wollte!« Ihr Atem schnaubte durch die bange Stille. Die Augen bohrten sich in das Herz der wissenden Freundin.
Diese schwieg. Gnadenlos ließ sie den Gedanken der Freundin auswuchten. Kein Trost, kein Verneinen floß von dem ernsten Mund. Endlich sagte sie ohne Rührung: »Wie kommst du auf den entsetzlichen Gedanken?«
»Weil das Entsetzliche immer da zu finden ist, wo der Atem meines Bruders weht. Dein Schweigen aber drückt meiner Befürchtung das Siegel auf.«
Und Giulia schwieg abermals. So entledigte sie sich am leichtesten der Aufgabe, der geschlagenen Frau das Geheimnis im Namen des Papstes zu enthüllen.
Da stöhnte ihr die Verzweiflung der Herzogin entgegen: »Was hat er ihm getan? Er hat mich geliebt! Das ist die große Sünde seines kleinen Lebens.« Sie warf sich in das Betpult vor das Bild der schmerzensreichen Jungfrau und goß den Tränenstrom ihres Leides in die Polster.
Und Giulia Farnese, das Weib mit dem rechnerischen Herzen und dem sinnlichen Blut, beneidete die unglückliche Herzogin um den süßen Schatz einer Liebe, den zu hüten ihr die Natur verwehrt hatte. Sie war die Geliebte eines Greises, der mit jeder streichelnden Bewegung seiner lüsternen Finger einen Teil seiner Schande in die ihre warf.
 Wüstenheiße Stickluft unter einem strahlenden Azurhimmel. Das Land um Monterotondo glüht. Der Tuff scheint zu schwitzen. Prall glänzend liegt das Gestein da, wehrlos der inbrünstigen Umarmung Sols preisgegeben. In den Maisfeldern blinkt das Fruchtgold, die Campagnagräser versinken in Dürre
und Staub, die Hitze flimmert über den ersten Stoppeln in der Tibertiefe, wo goldner, durchsichtiger Dunst über den Wassern lagert. In dieser vulkanischen Landschaft leuchtet kein reicher Erntesegen von Hügel zu Hügel; Öde und Einsamkeit, vom grellen Licht des Südens zu düstrer Schwermut erhoben, breiten sich weithin aus und geben der Kraterlandschaft stygische Strenge. Da und dort streckt eine Pinie oder Zypresse ihren dunklen Leib in die Glut, und man glaubt einen vergeßnen Schatten aus dem Orkus zu schauen, der zur qualvollen Versengung verdammt ist.
Wüstenheiße Stickluft unter einem strahlenden Azurhimmel. Das Land um Monterotondo glüht. Der Tuff scheint zu schwitzen. Prall glänzend liegt das Gestein da, wehrlos der inbrünstigen Umarmung Sols preisgegeben. In den Maisfeldern blinkt das Fruchtgold, die Campagnagräser versinken in Dürre
und Staub, die Hitze flimmert über den ersten Stoppeln in der Tibertiefe, wo goldner, durchsichtiger Dunst über den Wassern lagert. In dieser vulkanischen Landschaft leuchtet kein reicher Erntesegen von Hügel zu Hügel; Öde und Einsamkeit, vom grellen Licht des Südens zu düstrer Schwermut erhoben, breiten sich weithin aus und geben der Kraterlandschaft stygische Strenge. Da und dort streckt eine Pinie oder Zypresse ihren dunklen Leib in die Glut, und man glaubt einen vergeßnen Schatten aus dem Orkus zu schauen, der zur qualvollen Versengung verdammt ist.
In der Bibliothek ist es still und kühl. Scharlachvorhänge dämpfen das laute Licht ab. Rosentöne schweben über alten Handschriften und Pergamenten.
Der Kardinal war eben damit beschäftigt, seinem Sekretär Sorapisa eine Rede Ciceros, die er ins Italienische übersetzt hatte, in die Feder zu diktieren. Er war vor ein paar Tagen vom Krankenlager aufgestanden, auf das ihn der Streich der Wegelagerer geworfen hatte. Nun war er so weit, sich wieder an die Arbeit machen zu können.
In der Nähe des Tisches saß Tiziana und übte sich, die übersetzten Blätter ins Lateinische zurückzuübersetzen.
»Genug der Arbeit für heute,« sagte Giambattista. »Ihr werdet müde sein. Die Hitze drückt. Und die Nachrichten aus Rom bringen den Geist in unruhige Schwingungen. Ich danke Euch, Sorapisa, und möchte Euch nur bitten, Euch das Tagesprogramm für morgen zu notieren. Es ist der Empfangstag für meine Burgleute. Für den gescheiten Guido Silvestro bereitet das gewünschte Exemplar des Epiktet vor. Dann gebt dem jungen Riccardo Spinozzi ein Roß aus meinem Stall, er soll die ersten Reitversuche unter Führung des Tolomei machen.« Hier empfing er einen freundlichen Blick Tizianas. – »Dann sorgt, daß dem Maler Andrea die Schloßkapelle zur Verfügung gestellt wird. Morgen wird auch die Witwe von dem verstorbnen Reitknecht Ranconi vorsprechen, weist ihr das ganze Landstück des kinderlosen Leopardi zu, sie soll darauf, so gut es geht, Mais und Öl bauen. Den Burgknechten gebt von morgen an den Wein bis zum zweiten Strich gefüllt, wir haben eine gute Ernte, und sie haben sich beim letzten Scharmützel mit den Straßenräubern brav gehalten. Die Beschwerde des Riemers Capoldi über einen Feldstreit zwischen ihm und seinem Nachbar Timoteo prüft genau und erstattet mir Bericht. Wenn Timoteo sich zu Schlägen hat hinreißen lassen, gebt ihm sie wieder – doch nein, beschämt ihn und laßt ihn Milde spüren, wo er grob war. Dann sorgt, daß die Madonnenfigur in der Hofecke frisch angestrichen wird. Die alte Teresa, des Kochs Mutter, betet jeden Abend davor und bildet sich ein, die verkratzte Madonna wirke nicht mehr. Sie soll ihre kleine Freude haben. Und laßt die Bank vor der Burg verlängern, daß sich die wachthabenden Knechte nicht auf die heißen Steine setzen müssen.«
Der zuhorchenden Tiziana wurde warm ums Herz. Alles, was Giambattista besorgte, kam aus einer gütigen, tieffühlenden Brust. Und niemals fiel es dem Kardinal ein, Dank zu begehren, noch weniger, mit seiner Fürsorge zu prunken. Es geschah alles still und hinter dem Rücken der Bittsteller, denen er durch seine Organe ihre Wünsche gleichsam von den Augen ablesen ließ. Aus sklavischen Knechten hatte er so treue Diener und Freunde geschaffen, auf die er in der Not zählen konnte.
Nun entließ er den Sekretär. Tiziana reichte ihm die Übersetzung hin.
»Ihr seid gewachsen,« sagte er freudig. »Schwere Wendungen machen Euch keine Sorgen mehr. Und doch ist die Materie für eine Frau schwer zu bearbeiten. Doch Ihr seht ernst, das Lob macht Euch keine Freude – nein, nein, ich habe ein Auge für das Auge meiner Mitmenschen und lese wie ein Arzt durch das kristallne Organ in dem Grund der Seele. Es bedrückt Euch Kummer, Donna Tiziana.«
»Ich will's nicht leugnen,« sagte Tiziana scheu. Dann atmete sie rasch auf. »Lassen wir den Kummer und freuen wir uns an der Gunst des Augenblicks.«
»Nicht doch,« meinte Giambattista ernst. »Das wäre eine schöne Medizin, die nur betäubt, anstatt zu heilen. Oder ist das Forum, vor dem Ihr Euern Kummer ausbreiten könnt, nicht dieses Herz? Taugt Euer Leid nur für das Ohr einer Frau? Dann will ich meine Mutter –«
»Nein, nein, nein,« sagte Tiziana rasch und errötete. »Es gibt Dinge, mit denen selbst eine Mutterliebe nicht viel anzufangen weiß. Aber wo ich bisher noch am meisten Linderung empfand, das war die Entrücktheit des Gebets.«
»Ihr betet viel, Donna Tiziana?«
»Nicht einmal so. Nur wenn ich fühle, jetzt, und nur jetzt begegne ich gerade Gott.«
»Auch mein Gebet klammert sich nicht gerade an das Gebot der Kirche,« sagte der Kardinal freimütig. »Es ist auch meistens wortlos und wird gleichsam in einem Augenblick von der himmelsehnsüchtigen Seele abgepfeilt.«
»Da legt Ihr wohl viel Wünsche in Euer Gebet?« fragte Tiziana mit einer Art kindlichen Neugierde.
»Ich bin unbescheiden genug,« erwiderte Giambattista lächelnd. »Man meint gar oft, daß derjenige, der keine Wünsche ausspricht, auch keine besitzt. Wer in die Werkstatt meiner Gedanken eindringen könnte, würde wahrnehmen, daß ich eigentlich ein recht unzufriedener Mensch bin.«
»Und es wäre zudringlich, in diese Werkstatt einzudringen?« fragte Tiziana mit einem beinahe schelmischen Lächeln.
Der Kardinal fing den Ton auf und gab ihn heiter zurück: »Frauen, sagt man, haben das Recht, ein wenig zudringlich zu sein. Ihre Neugierde wird bald befriedigt, wenn sie durch die Antwort enttäuscht werden.«
»O, wie schlecht kennt Ihr die Frauen!« Sie drohte lächelnd mit dem Finger. »Aber Eure Wünsche?«
»Seht, da ist einer: hier einen Hof zu haben, wie ihn der Herzog von Mantua hat. Eine Zuchtstätte edler Kunst und Wissenschaft. Und mitten drin eine Pflegerin des blühenden Gartens, deren Geist die Keime des neuen Werdens ringsherum zur Entfaltung bringt. Sie würde für ihre Dichter die aneifernde Muse werden, die die Hippokrene zum Sprudeln brächte, der Anblick und die Betrachtung ihrer Tugend und Schönheit müßte wie bei der Isabella von Mantua die Saiten Apolls zum Schwingen bringen, sie würde zur Heldin neuer Romanzen und zum Vorbild lieblicher Madonnen werden. Ja, sie könnte einen neuen Mantegna oder Perugino aus der Erde stampfen. Ihr Geist würde auf alle belebende Wirkungen ausstrahlen. Aber das sind Träume, die in dem Hirn eines Kardinals eine üble Behausung haben. Ihre Verwirklichung würde mich in den Ruf eines lasterhaften Menschen und die Sonne meines Hofes in den Geruch einer Kurtisane bringen.«
Tiziana senkte das dunkle Haupt. »Dann wird Euch nichts übrig bleiben, als andre Dinge zu träumen.«
Giambattista nickte verträumt und baute ihr im nächsten Augenblick ein neues Luftschloß auf. »Mein zweiter Wunsch geht dahin – o lächelt nicht – die Menschen zu bessern.«
»Wie wollt Ihr das?« fragte sie verwundert mit großen Kinderaugen.
»Sie durch geistige Erkenntnis zum Bewußtsein ihrer Würde bringen.«
»Tut das denn nicht die Religion?«
»Sie könnte es tun, wenn sie nur Religion wäre,« antwortete der Kardinal trübe lächelnd. »Aber was Papst und Priester der Menge durch Dogmen und Zeremonien vor Augen halten, ist nur das Zerrbild einer Religion, das wohl bestechen, aber nicht beglücken kann. Ich denke mir sittliche Kräfte als Mitarbeiter bei der Reformation der Menschenseele. Dazu müssen wir zuerst niederreißen, was als Truggebäude dastand. Der gleißende Tempel der Form müßte fallen, um dem unsichtbaren des Geistes Platz zu machen. Man müßte das Volk an die auferstehenden Werte heranführen, die einst ein edles Volk zum Inhalt seines Lebens gemacht hat, ein Volk, das seine Götter anders angebetet als wir unsern Gott, und doch sittlicher und freier war als das unsre.«
»Ihr meint die Griechen,« sagte Tiziana mit lebhaft bewegter Seele.
Der Kardinal nickte. »Gelehrte und Bildner, Forscher und Maler reißen schon das scheinbar Verlorene aus dem Moder des Grabes der Vergangenheit. Aber noch haben die Riesen der rohen Gewalt und der Tücke und nicht die des Geistes die Führung in den Händen. Tyrannen morden, ist das Schlagwort der Zeit, Tyrannen zur Menschenwürde führen, ist mein Bannerspruch. Sie den Krieg verachten lehren, ihnen das Gorgonenhaupt des Mordes zeigen, sie vor die schönheitatmenden Gebilde der Griechenkunst führen, des Landmanns schwere Arbeit, die für sie getan wird, zum heiligen Gottesdienst adeln, dessen Zeremonialgerät nicht aus Gold und seidenen Gewändern besteht, sondern aus dem Eisenpflug und dem Schweiß des Pflügers. Sie aufreißen aus den Taumeln der Wollust und aus Bacchus' Armen, sie in das Feuer eines fürchterlichen Ernstes werfen, damit sie zur Besinnung kommen und die Gottähnlichkeit mit Schaudern verdammen.«
»Kardinal!« rief Tiziana leidenschaftlich aus. »Wer bewegt Euch das Herz zu solchen Taten?«
»Gedanken!« Der Kardinal ließ entmutigt das Haupt sinken. Wie aus wonniger Wolkenhöhe der Adler mit zerschossenen Flügeln herabstürzt, so flog sein sehnsüchtiger Geist aus der goldnen Höhe des Ideals in die Wirklichkeit nieder. »Verzeiht, es war ein Ikarusflug. Und wir leben im Rom der Triumphatoren Borgia. Des Himmels Sonne strahlt, und doch bedeckt Nacht die heilige Stadt der Christenheit. Ich weiß, schon sind die wilden Männer geboren, die ihre Dolche nach den Herzen der Tyrannen zücken werden; aber wird es darum besser? Italien wimmelt von Tyrannen, alles Kleine bläht sich zur Größe auf. Was gilt das Land, was das Volk? Die Stadt ist alles! Das Kastell ist der Herd, wo der Haß geboren und die Liebe getötet wird. Reißen wir die Kastelle und die Mauern nieder und lassen wir nur alle Geister in den freien Tempel Gottes wallen – o, zu wem spreche ich?«
Tiziana war mit zusammengepreßten Händen dagesessen, und ihr war, als brächen sich rauschende Bergwässer gewaltsam einen Weg ins Tal. Noch nie war vor ihr die Gedankenglut des Kardinals mit einer so vulkanischen Kraft über seine Lippen geströmt, und Tiziana empfand mit diesem Hereinwogen einer fremden Begeisterung das Wachsen ihrer eigenen Kräfte. Noch brauste es verworren in ihrem Kopfe herum, aber sie fühlte, daß des Kardinals Vertrauen sie fester an ihn band als die Fessel des Dankes, den sie ihm schuldete. »Wie froh macht mich das Bewußtsein, Mitwisserin Eurer Gedanken zu sein. Ich bin eine schwache Frau, aber ein großer Wille hebt auch Frauenkräfte ins Ungeahnte. Geschäftig ist gewöhnlich der Frauen Art; aber neben der geschäftigen Martha des Evangeliums glänzt auch die nachdenkliche, versonnene Maria, die mit dem Geiste schafft. Laßt mich dies Bild recht innig ins Herz schließen.«
»O Donna Tiziana, wie glücklich macht Ihr mich,« sagte der Kardinal mit überströmender Empfindung. Sie sahen einander in die Augen und beide unterdrückten die Gewalten, die jetzt in ihrem Innern an der Kette strenger Sitte rüttelten.
Da tastete Tiziana mit ihrer sanften Neugierde abermals in sein Herz. »Und einen dritten Märchenwunsch habt Ihr nicht, Kardinal?«
Giambattista lächelte. »Ich habe mir schier die Schlüssel zum Herzen der ganzen Menschheit gewünscht. Mehr würde die schuldige Demut vor Gott verletzen. Genug davon. Die Stille ist so verlockend für ein Abenteuer der Odyssee. Wollt Ihr den buntfarbigen Teppich Homers zu Euren Füßen ausgebreitet sehen?«
Mit leuchtenden Augen bat sie darum. Und in der meisterhaft strengen Art eines Rhapsoden ließ er vor ihren Augen das Bild des lieblichen Phäakenlandes erstehen, und bald sah sie die schöne Nausikaa mit purpurnen Zügeln die Rosse zum Stromgestade lenken.
Da polterten draußen Schritte. »Das ist das Bärengetrapp meines Vetters!« rief der Kardinal erstaunt aus.
Da stand die gewaltige Gestalt des Kondottiere schon im Türrahmen. Das gutmütige Brummbärengesicht war in unzählige Falten gezogen, und der ganze Kopf glich einem glühenden Kürbis. Übellaunig, als wäre er eben von einem verspielten Wagenrennen gekommen, begrüßte er die schöne Tiziana und erkundigte sich flüchtig nach ihrem Befinden. Dann ließ er sich geräuschvoll auf einen Sessel nieder.
»Du bist nicht vor Faenza?« fragte Giambattista verwundert.
»Ich erbat mir Urlaub vom Herzog,« sagte Pagolo mürrisch. »Sie machen mir dort zu langweilige Arbeit.« Dann sah er wieder Tiziana von der Seite an.
Giambattista verstand diesen Blick und kam seiner Frage zuvor. »Die edle Frau muß meine Gastfreundschaft noch in Anspruch nehmen, da ihr Gefahren von allen Seiten drohen.«
»Gefahren – ja, ja,« sagte er finster. »Kann ich einen Augenblick mit dir allein sprechen, Giambattista?«
Tiziana erhob sich schnell. »Ich will mit Donna Ginevra die Hühner inspizieren.« Hurtig wie ein Reh war sie fort.
»Cesares Heer liegt vor dem Kastell des Astorre Manfredi, und Ihr –«
»Die Augustglut hat meine Kehle ausgedörrt.« Er feuchtete sich die Gurgel mit dem dunklen Sabiner, dann sagte er schnaufend: »Wer weiß, wie lange wir uns die Glieder wund liegen vor Faenza. Der junge Astorre wehrt sich, daß man glauben könnte, es handle sich um die Verteidigung von Jerusalem. Fünfmal haben unsre erznen Schweizer die Mauern gestürmt, fünfmal wurden sie zurückgeschlagen. Die Faenzer vergöttern ihren Knaben, der schön ist wie Phöbus Apoll.«
»Seid Ihr gekommen, Euch die Sorge von Faenza von der Seele zu plaudern?«
»Meines Herzens harte Rinde gibt nach,« gestand der Feldhauptmann. »Ich habe schon viel mitgemacht vor den Städten, war schon Zeuge, wie Pius II. vor den Gascognern des Piccinino zitterte, hab' des Forteguerra Züge mitgemacht, half dem Malatesta sein schönes Rimini gegen den Papst halten und bin mit dem Colleoni übers Mailändische hergefallen, aber jetzt hab' ich's erlebt, daß mein sturmgewohntes Herz noch vor etwas gebangt hat, was andre marmorkalt gelassen hätte. Ich hab's verbissen und verkaut, aber nicht verdaut, es liegt wie gärendes, faules Zeug in meiner Seele. Sieh, Giambattista, ich war ein rauher Kriegskerl gewesen, ein Plünderer, aber ein – Mörder nie!« Er sah sich vorsichtig um. »Aber nun hat mich einer für schlechter gehalten, als ich bin, und hat das Böse in mir angerufen, das zu beherbergen ich nie verstanden habe. Das wurmt mich nun.«
»Ich versteh' dich nicht, Vetter.«
»Muß es ein Beichtstuhl sein, in dem ich vor Euch knie, um Euch alles, alles zu gestehen? Ich komme zum Kardinal, zum Priester, zum Menschen. Bei Gottes heiligem Namen bekenne ich, daß ich einen Augenblick geschwankt habe, als man mir das Ungeheure auf die Seele binden wollte.«
»Was werde ich hören?«
»Vor einem Monat ist der junge Herzog Alfonso von Bisceglia in einer Nacht angefallen und schwer verwundet worden.«
»Sah ich das Entsetzliche nicht selbst?« rief der Kardinal. »Und man munkelt von einem furchtbaren Täter.«
Den Haudegen durchbeutelte es. Dann schlug er gleichsam seine Unheimlichheit auf den Tisch hin: »Cesare Borgia wollte mich dingen, den Herzog zu ermorden.«
Der Kardinal fuhr empor. »Pagolo!«
»Mit meiner Treue rechnend, mit dem stahlharten Kriegergewissen, dem ergrauten Kopf, meiner verlotterten Hauswirtschaft, wagte er, mir das Furchtbare anzusinnen.«
»Und du sagtest nein!«
»Sagte nein und zog mir des Herzogs Ungnade zu. Er kürzt mir das Recht der Befehlsgebung, kränkt meinen Ehrgeiz, und durch Verrat wurde mir mitgeteilt, daß Cesares schwarze Liste, auf der alle mißliebigen Persönlichkeiten stehen, auch meinen Namen enthält.«
Der Kardinal hatte sich verfärbt. »Warnte ich dich nicht in jener Nacht in Bracciano vor den Machenschaften des Papsthofes? Du verlachtest meine Warnung. Sag' dich los vom Herzog.«
»Bevor ich meine Truppen aus dem Lager zöge, wäre mir der Ausgang durch hundert Hellebarden versperrt. Bei Gott, dieser Herzog Valentino macht es einem Menschen schwer, Mensch zu bleiben.«
»Sind nicht andre Unzufriedne in seinem Lager?«
»Wohin drängst du meine Gedanken, Kardinal?« fragte Pagolo betroffen.
»Starr' mich nicht an. Ich, der verlachte Weise von Monterotondo, ich dränge dich in das Verzweiflungsmittel der Verschwörung hinein. Ja, ja, es ist nichts andres, was ich denke. Von selbst weicht der Laufschwamm nicht, der sich an die Mauern des Papsttums angesetzt hat. Das Joch ist überschwer geworden. In dem Augenblick, da Cesare auch zum Herzog der Romagna ernannt wird, wird er daran denken, sich seiner Helfer zu entledigen. Oliveretto, Vitellozzo, der Herzog von Gravina, Bentivoglio, sie alle werden unnötig werden in der Stunde, da der Herzog sein vorläufiges Ziel erreicht hat. Und unnötig sein, heißt bei Cesare Borgia gefährlich sein. Und gefährliche Menschen schüttelt er gründlich ab. Wollt ihr alle zu dem Fallaub gehören?«
»Bei Gott, du scheinst furchtbar recht zu haben. Wenn ich den Herzog von Gravina dahin brächte! Er ist ängstlichen Charakters, und Cesare hat manches bei ihm auf dem Kerbholz.«
»Und Vitellozzo ist ehrgeizig und sinnt darauf, selbst Tyrann zu sein. Er wird leicht zu haben sein.«
Pagolo sah den Vetter bestürzt an. »Du wühlst meine Seele furchtbar auf, Kardinal! Der frömmste der Orsini –«
»– kann zum Verschwörer werden, willst du sagen, wenn die Tugend nicht mehr imstande ist, mit gerechten Mitteln den Kampf gegen die Verruchtheit auszufechten. Nur eben hättest du Zeuge sein können, wie dieser selbe Mann mit den allerfeinsten Gedanken spielte, die die Menschheit reformieren sollten. Aber es gibt Lagen, in denen die wuchtigsten Taten die Vorbedingungen für erhabene Gedanken sind.«
Da klang Hufschlag auf dem Hof.
»Spinozzi kommt aus Rom,« sagte der Kardinal. »Er scheint scharf geritten zu sein.«
Gleich darauf stand der Burgvogt im Zimmer. »Edler Herr – in Rom ist Furchtbares geschehen – der Herzog von Bisceglia –«
»Was ist's mit ihm?«
»– In seinem Bette ermordet! –«
»Himmel und Hölle!« schrie der Feldhauptmann auf. »Der Mörder?«
»Der Arzt und ein buckliger Narr, der ihn in Gemeinschaft mit Lukrezia gepflegt hatte, sind verhaftet worden.«
»O! o!« lachte Pagolo wild. »Ich ahne es, wie es kam.«
»Es gehen furchtbare Gerüchte um. Donna Lukrezia und Donna Sancia pflegten den verwundeten Herzog mit aller Hingebung und kochten ihm selbst die Speisen, weil sie eine Vergiftung fürchteten. Ja, selbst der Papst stellte Wachen auf. Im Bereich von Sankt Peter durfte niemand mit Waffen gehen. Aber es kam einer, dem niemand befehlen kann, auch der Papst nicht – und dieser eine – darf ich frei reden, Kardinal? – dieser eine fand den Weg zu ihm –«
»Cesare Borgia!« schnellte der Kardinal heraus.
Der Burgvogt schwieg die Antwort aus.
»Unglücklicher Prinz! Armes, junges Leben!« sagte der Kardinal voll Mitleid. »Angestochen wie ein Keiler und endlich verblutet!«
»Des Herzogs grimmiger Hauptmann Michelotto hat ihn in Gegenwart des Herzogs selbst ermordet, erdrosselt. Lukrezia Borgia fiel über der Leiche in Ohnmacht. Dann sah man den Herzog sein Lieblingsroß besteigen und auf die Falkenjagd reiten. Noch in der Nacht wurde Alfonsos Leichnam nach Sankt Peter getragen. Cesare behauptet, der junge Prinz hatte nach ihm vom Fenster aus mit Pfeilen geschossen. Ach, es mußte ein Vorwand gefunden werden.«
»Und das Volk erwacht nicht?« fragte der Kardinal mit blutender Seele.
»Es denkt nicht daran,« antwortete Spinozzi. »Vor drei Tagen wurden zwölf Kardinale ernannt, und die Römer hielten Maulaffen feil und gratulierten den Ernannten.«
Der Kardinal bebte. »Es ist kein Geheimnis mehr, Pagolo. Die neuen Kardinäle mußten ihre Würden erkaufen, damit das Gold für den Feldzug in der Romagna zusammenkomme.«
»Man spricht von hundertzwanzigtausend Dukaten, die die neuen Würden dem Cesare eintrugen,« berichtete Spinozzi. »Es mag nur Volksgerücht sein.«
»Beutel auf, Cesare!« höhnte der Kardinal. »Ein Danaerregen auf dich! Die Welt ist lustig, meinst du nicht, Vetter? Was habt Ihr noch, Spinozzi?«
»Die Leichen zweier Prälaten hängen an der Engelsbrücke, man kennt sie nicht, es sind nur die Rümpfe vorhanden. Und auf dem Weg hierher begegneten wir der Leiche des Kämmerers Dulcibus des Kardinals Giuliano della Rovere, auf einem Maultier angebunden. Er wurde an der Flaminischen Straße von einem Rietiner ermordet, dessen Frau sich der Kämmerer ins Bett geholt hatte.«
»O, Nacht über Rom!« rief der Kardinal ergriffen aus. »Und doch leuchtet noch die Sonne in diese Nacht hinein! Der Herr der Nacht geht um und macht die Herzen aufstöhnen unter dem Alp.«
»Morgen aber ist ein festlicher Stierkampf auf der Navona. Cesare Borgia wird sechs Stiere erlegen!«
» Evviva il toreadore!« brauste Pagolo auf. »Zuerst Menschenblut, dann Stierblut! Es ist eine lustige Abwechslung!«
»Aber der Papst soll im Fieber liegen,« berichtete Spinozzi weiter.
Teufel, nimm ihn zu dir! betete der Kardinal in sich hinein. Aber er wußte, dem Satan graute vor dem Bissen. Drum verschob er's, solange es ging.
»Und die Herzogin Lukrezia soll noch diese Nacht nach Nepi reisen.«
»Sind Eure Nachrichten zu Ende, Spinozzi? Dann ist's gut. Ich hab' für Euer Söhnchen ein Roß aus meinem Stall bereitgestellt.«
»Dank, Exzellenz! Er soll ein tapfrer Orsinireiter werden.« Dem Burgvogt glänzten die Augen. Und er ging, seinem Jungen die Freude ins Herz zu legen.
Als die beiden Orsini allein waren, trat Pagolo mit gedrückter Miene auf den Kardinal zu. »Noch eines, bevor ich gehe.« Es schien ihm schwer von der Seele zu wollen. »Seid auf der Hut!«
»Vor wem?«
»Vor den Savelli.«
Giambattista sah den Vetter bestürzt an. »Du machst ja ein Gesicht wie ein Novemberhimmel. Savelli? Gefahr? Vielleicht für –?« Wie ein Blitz zuckte es durch sein Herz. »Gefahr für Donna Tiziana?«
Pagolo sah ihn verlegen an. Endlich preßte es sich von seiner Brust. »Meine alten Knochen – o meine alte Ehre! Wie soll ich vor dir bestehen? Wie die Schmach ertragen, die mir – mein eigener Sohn –«
Der Kardinal näherte sich ihm mit entsetzten Blicken. »Pagolo!«
»O, daß wir den kleinsten Zufällen so ausgeliefert sein müssen! Gebunden an ein Wort, der Raub einer Sekunde!«
»Rätsel über Rätsel! Fabio, dein Sohn, Tiziana, Savelli – ein Knäuel von Menschen und Namen –«
»Gnade für meinen Sohn!« In tiefster Ergriffenheit wollte der alte Krieger sein Knie beugen.
Der Kardinal hob ihn bestürzt auf. »Bist du wahnsinnig?«
»Er bringt dich in Gefahr – durch Leichtsinn, Unbedachtsamkeit, Raschheit – nein, wozu Beschönigung? Seine unselige Neigung, dem Wein mehr als nötig zuzusprechen –«
»Pagolo!«
»Vor vier Tagen war's. Er liegt plötzlich zu meinen Füßen und bekennt alles. Er war mit mir im Lager vor Faenza und ging dann nach Rom. Und dort in einer Gesellschaft von jungen Freunden in der Osteria des Davanzati – kommt es zu einem leichten Handel. Die Zunge war gelöst, man sprach von Liebe und schönen Weibern, die herrlichsten Frauen wurden gegeneinander ausgespielt – und in der Schenke saß abseits auch ein Savelli –«
»O Gott, mir ahnt –«
»Fabio, den Wein im Gehirn, wußte die Lippe nicht mehr zu zügeln – und im übersprudelnden Eifer, in kindischer Prahlsucht gab er das Geheimnis deines Schlosses preis – Donna Tiziana –«
»Bei Christi –« Der Kardinal schauerte zusammen.
»Der Savelli sprang auf, es entstand ein Kampf – der Savelli wurde niedergeworfen –«
»Genug!« Der Kardinal ging mit schweren Schritten durch die Bibliothek. Sein Antlitz war bleich, seine Hand zitterte. Aber langsam veratmete seine Brust die Wallung und er wartete, gleichsam in sich hineinhorchend, den gleichmäßigen Schlag seines Herzens ab. »Fabios Zunge regierte ein Dämon, nicht sein Herz. Aber es kann Unheil daraus entstehen.«
»Die Savelli rüsten,« sagte Pagolo gänzlich zerschlagen.
»Wer sagt das?« Der Kardinal wandte sich jäh um.
»Fabio selbst, dem seine Schuld keine Ruhe läßt. Er schlich sich verkleidet in die Häuser der Savelli und kitzelte allerlei durch Bestechung heraus. Der Savelli hat geplaudert, es ist ein Vetter des Luigi, die Colonna werden aufgemuntert, die Fehde zu unterstützen, sie rüsten ihre Reiter, alles deutet auf bevorstehenden Kampf –«
Der Kardinal fühlte plötzlich eine Glut zu Herzen steigen. War das möglich? Sie sollten so wahnwitzig sein, ihre Söldlinge in die Schanze zu werfen wegen dieser Frau? Und durfte er selbst diesen Kampf entfesseln? Er, der friedfertige Menschenfreund! War er's denn nicht, der die Versöhnung der Geschlechter auf seine Friedensfahne geschrieben? Doch womit hatte er bisher gerechnet? Nur mit den Menschen einer kommenden, bessern Zeit, nicht aber mit den von rohen Kräften getriebenen Gewaltherren der Gegenwart, die mit einem Schwertstreich den friedfertigen Gedankenpfleger in den Himmel schicken konnten, nicht mit Menschen, die Mord, List, Betrug, Schamlosigkeit, Tücke, Habsucht und Gewalt als Devise im Herzen trugen, nicht mit Menschen, die einen Federzug des klaren Menschenrechts durch ihre Tyrannis aus der Welt schafften.
Der Kardinal drückte dem Vetter schweigend die Hand.
»Vergib meinem Sohn, der sich in wilder Herzzerrissenheit nur danach sehnt, die Schande wieder gutzumachen. Er hat sich auf der Burg Cervetri eingeschlossen mit seinem jungen Weib und sinnt mit ihr darüber nach, wie die Schmach zu tilgen wäre. Bei Tag übt er sich im Fechten und Bogenschießen, um seinen Mann zu stellen, wenn die Savelli ernst machen sollten, bei Nacht liegt er in furchtbaren Gewissenskämpfen und Reuetränen.«
Giambattista legte dem geschlagnen Mann die Hand auf die Schulter. »Armer Vater, bringe deinem Sohn die Verzeihung. Und er soll künftig den Wein, den großen Leiderwecker, meiden. Ich erwarte dich zur Cena.«
»Und du – die Savelli – die Gefahr?« schreckte Pagolo zusammen.
»Das liegt in des Höchsten Hand,« sagte der Kardinal mit großer Ruhe.
»Laß mich morgen früh bei dir die Messe hören, dann reite ich nach Faenza zurück.« In des alten Haudegens Auge glänzte eine Träne. Der Kardinal umarmte ihn und sah ihm lange nach.
Die Sonne schwebte langsam dem Meere zu. Tief bewegt schritt Giambattista auf und ab. Er durchsann die neue Lage, aus einem Nichts geschaffen, aus der Geringfügigkeit eines Rausches. Ein Tropfen Wein konnte die Ursache zu einem Blutmeer sein, das im lebendigen Lauf der Geschichte seinen dunklen Platz angewiesen bekommen konnte. Aber am Ende war dieser Tropfen doch nicht die Ursache des möglichen Leides. Er, der Kardinal, hatte bewußt ein Geheimnis großgezüchtet, freilich aus tiefster Ritterlichkeit und Menschlichkeit heraus. Das war seine ganze Schuld, die er vor allen verantworten konnte, nur nicht vor den rachelüsternen Savelli und ihrem Anhang. Aber er mußte nun einmal mit den Zahlen rechnen, die bei diesen Geschlechtern galten, Gewalt und Übermacht. Mit Schrecken wurde er inne, daß sich in sein friedfertiges Planen immer die wilden Geister seiner Zeit hineindrängten und sein feines, gütiges Sinnen und sein treues Trachten verwirrten. Kein sonnenklares Recht beschirmte ihn und diese schutzlose Frau vor dem heranbrausenden Trotz der Savelli. Ja, ja, so sehr er es sich verhehlen wollte, es ging um diese Frau, um diese schöne, heißumstrittne Tiziana de' Calvi.
Und da spürte er wieder das unheimliche Wogen in seinem Herzen wie immer, wenn ihr Name in seine Gedanken fiel. Verteidigte er sie gegen diese Savelli wirklich nur mit dem selbstverständlichen Recht des Schutzherrn? Unterstützte dieses Recht nicht heimlich eine andre, tief im Herzen webende Kraft? War das Treubündnis, das er mit ihr geschlossen, wirklich nur auf dem Gefühl männlicher Ehrenhaftigkeit und Ritterlichkeit gegründet? Trieb ihn nicht eine zärtlichere Macht in das Schutzengelamt hinein, das er so hehr auffaßte? Ein Schwall von Gedanken und Gefühlen überstürzte ihn in diesen Augenblicken der Entscheidung. Er glaubte, die Sonne verdunkle sich plötzlich und der Tag verwandle sich in Nacht, in der er irrte und keinen Ausweg fand.
Vergiß dein heilig Amt nicht, Kardinal! rief er sich selber an. Erinnere dich deiner Gelübde, Vorsätze, Gebete und deiner sittlichen Forderungen! Halte die Teufel von deinem Leib, die die Gestalt von Engeln haben! Vor deinem Geiste dämmert der Berg der Versuchung, morgendlich schön und strahlend liegt ein neues Land vor dir, aufgetan sind die Pforten eines schimmernden Paradieses, in dem Amorinen die Leuchten schwingen und die traumschöne Gestalt der lieblichsten Göttin über Rosenwege schreitet – und Augen leuchten dich an wie Belladonnen, in denen die Sonne funkelt – mit rotflammender Fackel schreitet der Göttin zur Seite der Gott Hymenäos –
Mit schreckhaft geweiteten Augen wehrte er die Vision von sich.
Da klopfte es scharf.
In der Tür stand der Burgvogt. »Hochwürdiger Kardinal, ein Gesandter der Savelli wünscht dringend vorgelassen zu werden.«
Der Kardinal tat einen tiefen Atemzug. Er hörte das Schicksal heranbrausen. »Er mag kommen,« sagte er gelassen.
 Orazio Fioravanti, der Wappenträger und Legat der Savelli, verneigte sich ehrfürchtig vor dem Kardinal. Um die hagern Glieder legte sich das weißgefensterte, violette Wams und das gleichfarbige Beinkleid, und auf dem Brustlatz leuchtete das Wappen der Savelli. Tiefer Ernst furchte die Stirn des Gesandten.
Orazio Fioravanti, der Wappenträger und Legat der Savelli, verneigte sich ehrfürchtig vor dem Kardinal. Um die hagern Glieder legte sich das weißgefensterte, violette Wams und das gleichfarbige Beinkleid, und auf dem Brustlatz leuchtete das Wappen der Savelli. Tiefer Ernst furchte die Stirn des Gesandten.
»Exzellenz, im Namen meines Herrn Luigi Aristide aus dem edlen Geschlecht der Savelli, Herrn auf Aspra und Palombara, Burgherrn auf Monte Aventino, bitte ich, Orazio Fioravanti, in schuldiger Ehrfurcht vor Eurer Würde um Aufklärung in der Rechtssache meines Herrn, die zu vertreten ich Schrift und Siegel habe. Luigi Savelli, durch einen Verlöbnisvertrag mit dem edlen Rinaldo de' Calvi an dessen Tochter Tiziana, Witwe nach Brancaleone, gebunden, hat in Erfahrung gebracht, daß Eure Exzellenz in den Mauern auf Monterotondo die Braut meines Herrn Tiziana de' Calvi seit Monden in Verwahrung halten. Wollen Eure Exzellenz die Tatsache bekennen oder leugnen?«
»Ich bekenne,« sagte der Kardinal ohne Regung.
»Und seid Ihr, Exzellenz, gewillt, Donna Tiziana de' Calvi im Laufe dieses Tages aus der Verwahrung zu entlassen und mir in die Hände zu geben, oder gewillt, die edle Frau noch weiterhin auf der Burg zu halten?«
»Ich bin gewillt, den Willen der edlen Donna Tiziana de' Calvi zu dem meinigen zu machen.«
»Und es ist der freie Wille der Donna Tiziana de' Calvi, auf der Burg Monterotondo unter Eurer Schirmherrschaft zu verbleiben?« Es lag bereits Nachdruck in den Worten des Gesandten.
»Donna Tiziana de' Calvi mag selbst entscheiden.« Der Kardinal öffnete die Tür und rief einem Kammerdiener den Auftrag zu, die edle Frau zu bitten. Dann wandte er sich an den Gesandten: »Erlaubt, daß ich Eure Beglaubigung durchsehe.« Er nahm die Schrift und prüfte Unterschrift und Siegel. »Herr Luigi Savelli focht vor vier Jahren auf der Seite des Papstes gegen die Orsini?«
»Seine Tapferkeit wurde durch Wunden besiegelt,« sagte der Wappenträger.
»Ich schätze sie. Aber die Savelli hatten trotzdem kein Glück. Als ihnen Pius II. sieben Städte genommen, fing ihr Unglück an. Sie suchten einen Halt an den mächtigen Colonna.«
»Und haben ihn gefunden,« ergänzte mit leichter Überlegenheit Fioravanti.
»Ich weiß, ich weiß,« lächelte der Kardinal. »Auch unter Sixtus IV. gab es einen tapfern Kardinal unter den Savelli, der meinen Namen trug.«
»Er starb vor zwei Jahren.«
»Ein Savelli ist verbannt und befindet sich am Hofe Maximilians –«
»Ich bewundre die Vertrautheit Eurer Exzellenz mit –«
Da trat Tiziana de' Calvi ins Gemach. Als sie den Gesandten erkannte, schien ihr Herzschlag zu stocken.
Der Kardinal führte sie zum Sessel. »Was will man von mir?« fragte sie mit scheinbarer Ruhe.
»Luigi Savelli bittet um Eure Entscheidung. Wollt Ihr Euch freiwillig in die Rechte des Bräutigams begeben?« fragte Giambattista.
Tiziana erblaßte. Dann sagte sie fast tonlos: »Nein.«
»Erkennt Ihr den Vertrag Eures Vaters an?«
»Nein.«
»Seid Ihr gewillt, die Folgen dieser Weigerung auf Euch zu nehmen?«
»Kardinal – was will man von mir?« bebte plötzlich die Angst in ihr. »Was will dieser Mann? Er trägt die Farben der Savelli –«
»Es wird Euch kein Leid geschehen,« versicherte der Kardinal.
»Wer bürgt mir dafür?«
»Der Kardinal Giambattista Orsini.«
Es war plötzlich, als spannten sich alle drei Herzen in ihren verschiedenen Gefühlen unter dem Druck des Augenblicks aufs höchste an. Eine bange Stille trat ein.
Fioravanti erhob sich. »Ich möchte Euch zu bedenken geben, daß die Savelli gezwungen wären, mit allen Mitteln auf ihrem Rechte zu bestehen, das auf Verträge aufgebaut ist. Mein Herr, Luigi Savelli, ist nicht gesonnen, auf das Recht, Donna Tiziana als Hausfrau heimzuführen, zu verzichten, wohl aber bereit, die Ehre der Waffen anzurufen für den Kampf um das Recht.«
»So hört die Gegenkunde. Der Kardinal Orsini ist nicht gesonnen, eine schutzlose Frau, die sich freiwillig vor der Gewalt des Herrn Luigi Savelli auf seine Burg geflüchtet, dem Manne auszuliefern, der sein Eherecht ohne Einwilligung der beteiligten Tiziana de' Calvi geltend macht. Der Kardinal Giambattista ist aber bereit, die Ehre der Waffen einzusetzen für den Kampf um das Recht, die Ehre einer Frau zu verteidigen.«
Tiziana de' Calvi fuhr empor und stand mit glühenden Wangen hochaufgerichtet an der Seite Giambattistas.
Fioravanti verneigte sich tief.
»Und saget Eurem Herrn,« fuhr der Kardinal fort, »er würde an meiner Stelle nicht viel anders handeln, wenn es um das Leben und die Frauenehre einer Bedrängten ginge, wo nicht, so müßte ich ihm den Edelnamen des römischen Barons versagen.«
»Das heißt also – Kampf?« Fioravanti blinzelte unter den weißen Brauen hervor.
»Den zu verantworten ich mir vor Gott getraue.«
»In dem Augenblick, da meine Reiter diese Burg verlassen und ihre roten Fahnen in der Sonne flattern lassen, werden die Savelli, unterstützt von den Colonna, gegen Monterotondo ziehen. Es könnte geschehen, daß diese Nacht ein rotes Gesicht bekommt.«
»Auch wir werden rote Gesichter bekommen, aber vor Kampffreude,« lächelte der Kardinal. »Und Ihr sollt sehen, daß der geistliche Herr, der sein Knie vor der Menschen Friedfertigkeit beugt, auch die Kunst der Schwertführung versteht.« Und er faltete die Hände und hob den Blick zu dem Gekreuzigten an der Wand. »Herr, irre ich, so führe mich; taste ich, so gib mir das richtige Gefühl, schwanke ich, so laß mich nicht fallen. Meine Stimme und mein Herz sind fest, der Herr führt mich.«
Schon im nächsten Augenblick schloß sich die Tür hinter dem Gesandten.
Gleich darauf stürzte Tiziana zu Füßen des Kardinals hin. »Herr – gütiger Herr –« Dank, Schmerz, Verzweiflung quollen in Tränen hervor.
Giambattista zog wortlos, aber mächtig bewegt, die Kniende empor und richtete ihre Schönheit vor sich auf. »Das mußte getan werden. Es ging um das Recht des freien Menschenherzens. Sollte der Kardinal Orsini in der Stunde der Not die Frau ausliefern, die er mondenlang bei sich zu Gast geladen hatte? Das hätte kein Campagnuole, kein roher Söldner getan. Es gibt Augenblicke, wo alle Philosophenweisheit vor der Macht des Gefühls zuschanden wird. Einem Savelli trotzt man nicht mit Aristoteles, sondern mit dem gezückten Schwert. Seid ruhig, edle Frau, wir haben nun an die erste Sorge zu denken. Euch aus der Burg zu schaffen.«
»Nimmer!« flammte Tiziana auf. »Ich teile alle Gefahren mit Euch, Kardinal.«
Giambattista runzelte die Stirn. »Ihr wißt nicht, was Ihr beschließt. Es werden Kugeln sausen und Brände fliegen –«
»Sie sollen mir der Frohklang der Tapferkeit und die Fackeln des Mutes der Orsini sein!« In ihren Augen entzündete sich ein hehres Feuer.
Da wurde die Tür aufgerissen. Marcello Gaetani stürzte herein. »Savellis Farben reiten durch das Tor hinaus. Ihre roten Fehdefahnen flattern im Abendschein. Was gibt es?«
»Kampf!« rief der Kardinal mit mutgeschwelltem Herzen. Und mit kurzen Worten legte er dem Jüngling das Gewicht der Stunde aufs Herz.
Marcello fühlte einen Strom unnennbarer Begeisterung durch Mark und Bein fließen. Sein Auge sprühte Blitze. »Das Schwert des jüngsten Gaetani soll für die Ehre einer Frau klaffende Wunden in die feindlichen Schädeldecken schlagen.«
Tiziana blickte voll Rührung auf den schönen Jüngling. Sie war versucht, dieses blütenschöne Haupt, in dem nur der Gedanke an sie seine wirbelnden Phantasien gesponnen hatte, an sich zu reißen und ihm den Kuß der Weihe auf die Stirn zu drücken. Aber sie ergriff nur heftig bewegt seine Hand und sagte: »Dank, Marcello! Dank für Eure – Treue!«
Der Kardinal wandte sich ab. Er wußte längst, was für ein Brand dieses stürmische Jünglingsherz ergriffen hatte, wußte längst, mit welch innern Nöten es kämpfte, aber er wußte auch, daß die herbe Keuschheit Tizianas der Panzer war, der sie vor dem Ansturm dieser Knabenbrust schützte. Aber wie sah's in ihrem Busen aus? Gab es Augenblicke, in denen sie sich gegen den Widerstreit ihrer Gefühle wehrte? Zog sie ein Gedanke heimlich an das Herz dieses brausenden Ganymed, der im Begriffe war, zum Mann heranzureifen? Riß der Klang seiner Stimme sie nicht aus dem Gleichmaß der Arbeit, aus der Tiefe der Betrachtung, aus dem Wachtraum am Fenster? Zitterte sie nicht für ihn und schloß sie seinen Namen nicht liebend in die Glut ihrer Andacht ein? Schlug nicht in diesem Augenblick in ihrem Gemüt eine Glocke den Ton der Furcht für ihn und sein Leben an? Ein Meer von bedrückenden Gefühlen wogte in der Brust Giambattistas, und seine Wellen umbrandeten das sonst so weisheitsfeste Gehirn und machten es hilflos und wankend.
Da gab Giambattista seinem ganzen Menschen einen Spornhieb und lenkte ihn in die künftige Kampfnot hinein. Er ließ den Burghauptmann Spinozzi, den Leutnant Monfort, den Burgvikar, den Rüstmeister und den Reiterführer Capri rufen. Dann befahl er einem Kammerdiener: »Die Sturmglocke läuten lassen! Alle Mann in den Hof! Tore schließen und Kugelketten spannen!« Und zu Tiziana gewandt: »Ihr werdet so gut sein, meiner Mutter Gesellschaft zu leisten und ihre Angst zu beschwichtigen, falls sie der Nachtlärm aufwecken sollte. Die Sonne sinkt. Wir können um Mitternacht die ersten feindlichen Reiter um die Burg schwärmen sehen. Capri, es liegt mir viel daran, meine Vettern auf den Burgen zu alarmieren. Wollt Ihr der Wagehals sein, einen nächtlichen Ritt nach Bracciano zu machen und den Schloßherrn Giangiordano zu benachrichtigen, daß ich in der Klemme sitze?«
Dem jungen Florentiner leuchteten die Augen. »Ihr macht mich glücklich, Kardinal.«
»Ihr setzt mit drei Reitern bei der Madonnenstatue nördlich unserer Burg über den Tiber, sprecht noch in der Nacht auf dem Wege beim Burgvogt auf Scrofano vor und bittet ihn, daß er zum Entsatz bereit wäre, sobald auf meinem Turm die Pechfackel lodert oder die grüne Fahne weht.«
Da hallte die Burgglocke in den feierlich schweigenden Abend hinaus. Der Atem der erznen Mahnerin klang gehetzt, und alles wußte, daß Gefahr im Anzug sei.
In der Bibliothek versammelten sich die Führer der Söldlingshaufen. Der Kardinal weihte sie kurz in die bevorstehende Gefahr ein. Dann gab er seine Befehle, als hätte ihm der Freibeuter im Blut gelegen. Der Leutnant Monfort, ein Provençale, den Abenteuerlust nach Italien getrieben hatte, bekam die schweren Reiter zugewiesen, die die Ausfälle der Söldlinge unterstützen sollten. Zwei Kammerherren mußten die Arbeiten im Hof überwachen, ein Schweizer die Verteidigungsarbeiten im Vorfeld leiten. Die Kostbarkeiten der Bibliothek ließ der Kardinal in den Keller schaffen, damit einstürzendes Mauerwerk keinen Schaden anrichten konnte. Frau Ginevra Orsini wurde in das schußsicherste Gemach gebracht.
Als die Schatten des Abends über dem Gemäuer lagen und der stickige Dunst der Tagschwüle einem mildern Hauch zu weichen begann, stand das massierte Volk der Fußleute mit dem Häuflein der schwarzen Orsinireiter im engen Geviert des Hofes und der Kardinal trat aus der Bogenhalle vor sein getreues Gesinde. Noch nie hatten die Leute ihren Herrn mit dem strengen Antlitz der Gefahr vor sich hintreten sehen, immer nur hatte eine Stimme zu ihnen gesprochen, deren Klang, wenn persönliche Bedrängnis ein Herz in Not versetzt hatte, schon allein Linderung brachte. Und nun sahen sie einen in Erz strotzenden Kriegsmann daherschreiten, die hohe Gestalt durch Panzer, Beinschienen und Helm, auf dem der Bär mit der Rose in der Tatze prangte, zum dröhnenden Mars erhöht, das Antlitz streng gefurcht, doch ohne Bangigkeit. Das weiche Gelehrtengemüt schien für immer verabschiedet zu sein.
Der Kardinal trat unter sein Volk. Seine Stimme dröhnte, als spräche das Erz seines Harnisches selbst. Dieser Priester im Eisenkleide rief jetzt die Hilfe Gottes an für den Kampf um ihr armes, kleines, flatterndes Herz.
Da unten stand das Kriegsvolk, diese zusammengewürfelten Haufen von Römern, Mailändern, Gascognern, Provençalen, Schweizern und Deutschen, die sich hier um die nie entfaltete Kriegsfahne des Kardinals geschart hatten. Es waren gar abenteuerliche Leute, die beim Schwerterziehen nicht nach Beweggründen, sondern nur nach dem Sold fragten. Aber sie hatten doch ein andres Gesicht als das der gewöhnlichen Freibeuter.
Es waren zum größten Teil alte Invaliden, die wohl nicht mehr marschtüchtig waren, aber dafür die Erfahrung unzähliger Scharmützel besaßen und die Erinnerung an ein zerschlagenes Freibeuterleben mit sich herum trugen. Die ergrauten Köpfe sannen nun in einer Art lustigen Wehmut den vergangenen Abenteurerzeiten nach, aus denen ihnen die hellen Ehrenschilde ihrer einstigen Führer Colleoni, Piccinino, Gattamelata, Forteguerra und Francesco Sforza wie ferne Lagerfeuer nachblinkten. In der Burghalle erzählten sie einander des Abends Geschichten bei Öllicht und Wein, munterten sich gegenseitig auf, wenn da und dort die alte Sehnsucht nach Hieb und Stich gar zu lebendig wurde, liebäugelten mit der Hoffnung, daß für sie noch einmal eine Stunde fröhlichen Schwerterschwungs kommen werde, und trösteten sich am Ende doch wieder mit der schönen Gegenwart, die ihnen ihr sichres Fäßlein Wein und das sorglose Gnadenbrot bei diesem prächtigen, gütigen Kardinal gab. Sie hatten sich hier versessen, während auf den andern Orsiniburgen es häufig Händel gab. Und wenn man auf Bracciano, Cervetri und Galera die Fahnen flattern sah und man den Kampflärm von Scrofano herüberhörte, dann bat manch einer, da hinüberzulaufen und mithelfen zu dürfen, den Orsinischild rein zu waschen.
Und nun standen sie zur Masse zusammengeschweißt auf dem Hof und sahen ihren Herrn, den sanften Kardinal, der ihnen die Messe las und die Hostie an hohen Feiertagen gab, im Panzer stehen und hörten den donnernden Ruf: Orsini und die Kirche!
Der Kardinal rief ihre Vergangenheit an.
»Der Bär der Orsini wird gereizt. Rüstet euch, Männer auf Monterotondo! Die Savelli und Colonna rücken heran. Wollt ihr für euern Herrn kämpfen?«
» Evviva Orsini! Orsini e la chiesa! Orsini und die Kirche!« So hallte der Wille zum Streit.
»Gedenkt eurer Ruhmestage! Dort drüben seh ich einen mit weißem Haar, den gichtbeuligen Manotti, er hat den Sforza, den Bauernsohn, als Herzog in den Mailänder Dom einziehen gesehen; und der dort mit dem Narbengesicht, Gianandrea, hat schon einmal einem Kardinal mit der Sturmhaube gedient, dem Niccola Forteguerra. Und viele unter euch haben dem tapfern Virginio Orsini, meinem Ohm, treue Gefolgschaft geleistet, als er mit dem Papst haderte. Denkt an die Tage von Campo morto, teilt Hiebe aus wie damals. Schärft die Bärenklauen und packt an, was euch anpacken will. Haltet Mannszucht, sucht keine Händel, betrinkt euch nicht! Verteidigt mich als euern Herrn! Evviva Orsini!«
Schwerterklirren erfüllte die stickige Luft. Fackeln wurden entzündet, denn der Abend dunkelte in die Nacht hinein. Über das Geviert des Hofes spannte sich ein Stück des schwärzlich-blauen Himmels.
Schwer rasselten die bepanzerten Rosse der Streifer durch den Torweg hinaus in die Nacht gegen Rom zu. Marcello führte sie. Sein Banner trug er im Herzen, die Liebe zu Tiziana.
Auf den Türmen zeigten sich die ersten Helme der Wächter. Alle Augen lugten gespannt ins Vorfeld. Dort ritt der kleine, bewegliche Leutnant Montfort auf seiner schlanken Stute von Posten zu Posten. Ins Uferrohr am Tiber legten sich die Wachen und lauschten dem Wellenschlag, der vielleicht das Nahen feindlicher Barken künden konnte.
Die Stille der Nacht fing an, Regentin zu werden. Manchmal hörte man den Hufschlag auf dem harten Gestein im Vorfeld, dann täuschende, unbestimmte Geräusche, oft aus dem Schoß der Einbildung geboren.
Der Kardinal stieg zur Grabkapelle der Orsini hinab und ließ die eisenbeschlagne Pforte öffnen. Dort stand er lange in Gedanken versunken. Er ließ sich in die Knie und bat an der Gruft des Geschlechts, wo seit mehr als zweihundert Jahren die edlen Häupter von Monterotondo lagen, seinen Gott um Schutz für Tizianas Leben. Der Geist des Ahnherrn Rinaldo Orsini, dessen marmornes Relief unter dem Schein der Fackel geisterhaft aufleuchtete, schien sein Gebet zu segnen. Und der ehrwürdige Senator Matteo Orsini rührte sich wohl in seinem Sarkophag und gab sein Amen ebenso zu dem Gebet wie der wackre Kardinal Napoleon Orsini, der jetzt den geistlichen Nachfahren seines Geschlechts aus der Gruft heraus zum Sieg anspornte. Der Manen leiser Geistergruß in stiller Nacht erfüllte des Kardinals Herz mit Zuversicht.
Mit raschen Schritten verließ er die Gruft und eilte die Treppen hinauf in die obern Gemächer und Wehrgänge. Durch eine Luke sah er in die Nacht hinaus, die sich in ihr silbernes Kleid warf. Die Bergklippen senkten sich da drüben jäh zum Tiber hinab und waren jetzt von finstern Schatten überdeckt, während der sanfte nahe Hang im weißlichen Licht blendend wie am Tage da lag. Die steilragenden Mauern der Burg, das Gezacke, die düstern Fenster und Schießscharten riefen wohl ein Gefühl der Unbezwinglichkeit in seinem Herzen wach, aber dennoch bangte ihm bei dem Gedanken, daß eine längere Belagerung oder Feuerbrände alles vernichten konnten.
Da wurde er zu seiner Mutter gerufen. Frau Ginevra saß mit verweinten Augen im Bett. Zu ihren Füßen kauerte, den Kopf in die Arme geworfen, Tiziana. Der Kardinal lief wie ein Knabe der Mutter ans Herz. »Mutter, sei beruhigt –«
»Diese Savelli! Diese finstern Savelli! Was wollen sie von dir?« zitterte das greise Herz. Der lebensmüde Kopf konnte das alles nicht mehr fassen.
»Sie sagen mir Kampf an,« belehrte sie der Kardinal. Und dann deckte er ihr mühselig das ganze Geheimnis der Tiziana Malaspina auf.
»Ehrenhafter, teurer Sohn!« Die Mutter zog Giambattista an die Brust. Dann streichelte sie das zerwühlte Haar der in Schmerz aufgelösten Tiziana und sank müde in die Polster zurück. Tiziana legte ihr die Haube zurecht und nahm ihre Hand in die ihre. Bald schlossen sich die Augen der Greisin zum Schlummer. In ihn schien ein schmerzvoller Traum seine ersten Bilder zu werfen, denn die sanften Züge der Greisin verquälten sich.
Der Kardinal legte seine heißen Hände auf ihre Stirn. »Ich werde sie wohl nicht mehr lange haben,« sagte er, während er die Alkovenvorhänge niederließ und mit Tiziana zum Fenster trat. »Dann wird es noch einsamer auf der Burg werden.«
»Ihr wart ja die ganzen Jahre her die Einsamkeit gewöhnt.« Sie sagte es dumpf und unsicher. Kein Blick traf ihn. Dann rüttelte es ungeduldig an ihrem Herzen. »Kardinal – ich gehe zugrunde – unter dieser Schuld. Gebt mir den Weg frei zu Euern Wachen. Ich will mich noch in letzter Stunde dem Savelli ergeben.«
»Nein,« sagte der Kardinal entschlossen. »Das ist die Sprache der Verzweiflung. Nun halte ich Euch auch wider Euern Willen gefangen.«
Mit Schrecken blickten ihn ihre Augen an. »Kardinal! – O Gott, ich bin wahrlich die unglücklichste Römerin.«
»Dies tut mir leid, Donna Tiziana, aber meine Ehre fordert nun, daß ich meine Pflicht bis zum letzten Augenblick erfülle, den Schutz Eueres Lebens.«
»Und was ist dieser letzte Augenblick? Ihr schweigt? Es kann nur Euer Tod sein oder der meine. Fällt aber Luigi Savelli, so ist –«
»Dann seid Ihr frei von aller Sorge,« sagte der Kardinal rasch, »und könnt fort von Monterotondo ziehen, die Welt liegt wie ein Blumengarten vor Euch und Ihr könnt aus Italiens hehrsten Geschlechtern Euch den Schirmherrn wählen, der Euer Herz für alle Zeit zum Altar seiner irdischen Gebete machen wird.«
Tizianas Augen, von der Seele Glut durchflammt, suchten hilflos die silberne Sternenwelt nach einem Pünktlein ab, das einen Hoffnungsstrahl entsenden könnte in die Nacht ihres Herzens. Kalt und erbarmungslos blinkten Gottes Augen herab. Da holte sie aus ihrem Gehirn in einer Anwandlung von Trotz und Verzweiflung einen rettenden Gedanken hervor, den ihre Einbildungskraft zu einem rettenden Felsen formte. »Das Herz, von aller Werbenot des Savelli befreit, würde vielleicht nicht lange zu suchen brauchen, um den zu finden, der ihr wahrhaftiger Beschützer, Held und Gemahl sein könnte.« Mit gespannten Augen, von tausend Foltern beengt, breitete sie ihr Hirngespinst aus.
Der Kardinal horchte auf. Der Wogenschlag in seiner Brust schien ihre Wände zum Bersten zu bringen. »Glückliche Frau, die sich mit solcher Hoffnung über die schweren Stunden hinwegzuretten vermag! Und darf ich wissen, wem Ihr das beneidenswerte Glück ewiger Gebundenheit gönnen wollt?« Sein Blut schoß, wie von Erinnyen gepeitscht, durch die Adern, und seine Augen brannten an der lieblichen Gestalt hinauf, die sich im Licht des Mondes aufgepflanzt hatte, eingehüllt in wallenden, weißen Damast, durchblitzt von silberner Zier. Und wie ein geheimnisvolles, nachtschwarzes Meer schien das Haar um den herrlichen Kopf zu wogen, und der Duft der Locken strömte berauschend durch die Leere zwischen beiden und zerwühlte Giambattista das Mark.
Und Tiziana sprach es mit bebender Stimme in die Nacht hinaus, als wollte sie diese zur Helferin in ihrer Herzensnot anrufen. »Ich kenne einen, der gesonnen wäre, sein Leben für mich in die Schanze zu schlagen. Er hat alle berückenden Eigenschaften der Jugend, ja, er ist fast noch ein Knabe. Es ist sicher, daß er mich jetzt liebt –«
»Marcello!« Wie einen Pfeil schossen die Lippen des Kardinals den Namen ab.
»Noch ist sein Herz rein und ehrenhaft, doch steht es jeden Tag neben der Versuchung. Sein hoher Gedanke will mich hinausführen in eine, wie er meint, beßre Welt. Den ganzen Blütenreichtum einer jungen Erstlingsliebe streut er mir mit verzücktem Herzen vor die Füße und ist verzweifelt, weil ich ihm nur schwache Hoffnung gebe.«
»Warum – tut – Ihr das?« hauchte der Kardinal mit Bangigkeit aufhorchend.
»Weil ich weiß, daß seine Liebe schwinden wird, wenn ihn das Leben von andern Mädchenlippen anlacht. Liebt er denn mehr an mir als meine Augen, meine Haare, meine Hände, meine Glieder? Wenn das alles verglänzt, verbleicht und verschrumpft? Wird ihm meine Seele unvergänglich sein? Und dennoch könnte ich vielleicht dahin kommen, diese sorgenden Gedanken in den Wind zu schlagen. Ihr solltet ihn hören, wenn er Paphos' schöne Göttin aus dem Olymp in seine Lieder zwingt, wenn er mir mit jauchzenden Lippen den thusischen Wein kredenzt oder mich zur heißbegehrten Arethusa adelt. Kardinal, man darf einer Frau nicht allzuviel Standhaftigkeit zumuten, wenn sie ein freies Herz hat. Seine Wunden der Seele könnten am Ende das Mitleid entzünden, die gefährliche Schwester der Liebe.«
»Ihr – liebt also – Marcello Gaetani?« fragte der Kardinal mit verwürgter Kehle.
»Das – weiß – ich – nicht.« Ihre Stimme verrieselte gleichsam in die Nacht.
Giambattista drückte den Eisenhelm in seinen Händen zusammen, als wollte er ihn in Stücke brechen. Sie liebt ihn! schwang es wie ein drohender Glockenton in seinem Herzen. So inbrünstig und verschämt zugleich verteidigt nur Liebe! Was soll der arme Kardinal von Monterotondo, der Büchermensch und Weisheitsgräber, neben diesem entflammten und geliebten Epheben andres tun, als seinem Wesen getreu bleiben und segnen, wo andere verdammen würden? Was soll ich, der reife Mann, neben diesem glühenden Jüngling? Bedauern, daß ich nicht früher gelebt? Beklagen, daß mir der nahe Herbst die Aussicht auf eine Liebe verstellt, die nichts andres wäre als ein verzweifelter Kampf gegen das eigene Gewissen, gegen übernommene heilige Pflichten und Gelübde? Wach auf, Giambattista Orsini, kröne dein bisheriges Lebenswerk durch eine wahrhaftige Tat der Selbstentäußerung. Fasse ihre Hand ohne Herzzucken, ohne schmerzvolles Bedenken und lege sie in die Hand des Jünglings, der dir zum Freunde geworden und der dir durch seine Liebe nicht zum Feind werden soll. Das ist der größte Sieg, den du über drei Herzen erringen könntest.
Und er ließ sein Sinnen zu Worten werden. »Versprecht mir eines. Wenn Ihr mit Eurem Herzen einig seid und das heiße Werben Marcellos erhören wollt, dann laßt mich's wissen, auf daß ich Eure Hände in die seinen lege. Ich billige Euren Ausweg aus meinem Kerker. Marcello Gaetani ist gut und edel. Er wird Euch glücklich machen.«
Da ging es wie ein Frühlingsbrausen durch das junge frauliche Geblüt. Sie fühlte, wie sich dieser ernste Mann gegen den Ansturm der Liebe wehrte. Durch sein Opfer wehte der Gluthauch der Eifersucht. Er wollte sich selbst getreu bleiben, liebte sie und ging in seiner Liebe so weit – daß er sie einem andern gönnen wollte? So weit sollte er seine Tugend treiben dürfen? Wollte seinen Gott zum Zeugen anrufen für die Reinheit seiner Gesinnung? Den Menschen hätte sie so gern in ihm gesehen und er zeigte ihr den Heiligen. Und der Mensch erschien ihr jetzt plötzlich so klein. Er hatte zu tun, um sich in ihren Augen von dieser Kleinheit loszureißen.
»Ich werde Euch um Euern Segen bitten, Kardinal, wenn es an der Zeit ist,« sagte sie mit überlegener Ruhe beinahe kalt. So quälten sich die beiden Herzen aneinander vorbei.
Da tönte es durch die Nacht, scharf und schrill. Dann Schwerterklang und Rasseln von Eisenschienen. Der Kardinal eilte zum Fenster.
»Reiter- und Pferdeleiber aneinander! Das ist Marcello! Lebt wohl!«
»Ihr wollt hinaus?«
»Donna Tiziana – Kampf ist zur Pflicht geworden!«
»Und diese Pflicht – kämpft – für mich?« Aus höchster Angst jagte das Wort heraus.
Eine donnernd zugeschlagene Tür gab ihr die Antwort: Siehst du nicht, wie ich verbrenne unter der Glut meiner Liebe?
Männer! Ungestüme, hitzige Männer! Verhetzt eure Herzen in die Wildnis der Eifersucht! O, könnte ich euch zu Brüdern machen, die eine Schwester beschirmen! Aber nein – ich kann nur den einen beglücken, nur den einen vom Born der Liebe trinken lassen, und dieser eine wehrt sich in törichter Eifersucht gegen die dargebotne Hand – wilder, geliebter Mann! Du mußt sie nehmen, diese Hand – ich, ich kann sie dir nicht reichen!
Das Glück warf Tiziana in die Knie. Und in die Sterne hob sie des Königslieds sehnsüchtige Worte: Er ist's! Er ist's! Mein Freund ist mir eine Traube von Zyperblumen in den Weingärten von Engedi! O, wann werde ich ihm die Blume zu Saron und die Rose im Tal sein? Und sie schluchzte ihre wehe Freude hinaus in die Nacht, wo der Kampf um sie entbrennen sollte.
 An diesem Abend lag in einer Ecke des Schlafgemachs, in einem blauseidnen Stuhl zusammengekauert, Lukrezia Borgia vor dem Papst. Lässig hingeworfne genuesische Trauerschleier bedeckten ihrer Glieder zarte Pracht. In dem reich geknoteten Haar flimmerte sternhell ein Smaragd aus einem goldnen Pfeil. Um sie herum standen halb gepackte Koffer, in denen Kassetten voll Geschmeide, Hauszierat, Wäsche und Bücher durcheinander lagen, denn die Abreise nach Nepi, öfter verschoben, stand nun bevor.
An diesem Abend lag in einer Ecke des Schlafgemachs, in einem blauseidnen Stuhl zusammengekauert, Lukrezia Borgia vor dem Papst. Lässig hingeworfne genuesische Trauerschleier bedeckten ihrer Glieder zarte Pracht. In dem reich geknoteten Haar flimmerte sternhell ein Smaragd aus einem goldnen Pfeil. Um sie herum standen halb gepackte Koffer, in denen Kassetten voll Geschmeide, Hauszierat, Wäsche und Bücher durcheinander lagen, denn die Abreise nach Nepi, öfter verschoben, stand nun bevor.
Der Papst hatte einen seiner Fieberanfälle hinter sich und sah blaß und mager aus. Auch die blutigen Ereignisse der letzten Tage hatten seine Gesundheit erschüttert. Der Mord an Alfonso, von ihm gewünscht, wenn auch nicht gefördert, bohrte jetzt seinen Stachel in des Mitschuldigen Gewissen.
Alexander griff linkisch mit den Fingern in einem Bündel seiner Stickereien herum. Dann sah er nach der Tür, als lauerte hinter ihr das Gespenst seines Sohnes Cesare. »Mir ist immer so bang, wenn ich ihn nicht in meiner Nähe weiß,« log er sich selber an.
Lukrezia blieb reglos. Schon der Name ihres Bruders zerwühlte ihr Herz gleich glühenden Schlangen. Aber sie fand keine Kraft, sich aus diesem Grauen zu befreien.
Des Papstes weißseidner Talar rauschte an Lukrezia heran. Sie spürte die knorpeligen Hände über ihr Haar streichen. Und Alexanders bedrücktes Gemüt geriet in sanftere Wallung. »Deine schönen Augen, mein frommes Kind, werden sich in Nepi wieder trocknen. Du nimmst, wie ich dir sagte, ein Gefolge von sechshundert Reitern mit, das eine prächtige Wache für das Kastell darstellt.«
Lukrezia schwieg.
Der Papst wurde ungeduldig. »Rede doch endlich, mein frommes Kind.«
»Jeder Strauch in Nepi wird mir ein Lied von meiner verlornen Liebe singen, wenn der Wind darin spielt. In allen Ecken des alten Schlosses werde ich den Geist des geliebten Toten erblicken.«
»Ich habe Sorge dafür getragen, daß alles umgestellt wird. Sangallo ist an der Arbeit, er baut die Säle aus, alles wird heller geschmückt, Blumenfüllhörner sollen in deinen Gemächern paradiesische Düfte ausströmen –«
»Um den Geist des Toten zu vertreiben!« höhnte Lukrezia bitter.
Der Papst wurde ärgerlich. »Ich habe kein andres Mittel, deine trauernden Sinne zu zerstreuen als Farben, Musik, Spiel, Vergnügungen. Ich hätte dich gern hier behalten, aber – ich habe – vor Cesare Angst –« Das Bekenntnis quälte sich ihm vom Herzen. »Er hat allerhand Pläne mit dir,« sagte er verwirrt.
»Pläne! Pläne!« jammerte Lukrezia. »Das Wort überrieselt mich mit dem Grauen der Hölle.« Ihr langhaariger Rüde schmiegte sich an sie. »Ach, ich möchte in das Fell dieses Hundes fahren, um sicher zu sein vor den Plänen meines Bruders.«
Pagen öffneten plötzlich die Türflügel. Der Gefürchtete stand im Zimmer.
Ein Hauch von Kälte wehte über die Herzogin hin. Sie dachte an das Haus Athamas', wo die Mauern leise zu zittern begannen, als Tisiphone mit dem Schlangenhaupt hineintrat, wie Ovid es singt. Sie wagte kaum ihren Bruder anzusehen, nur undeutlich schimmerte sein Kleid, das wie jenes des Ägisthos vom Morde gerötet schien.
Der Herzog küßte dem Vater die Hand und empfing dessen Stirnkuß. »Lukrezia wird ihre Reise wieder verschieben müssen,« sagte Cesare mit verdunkeltem Blick. »Die Straßen sind voll Reiter der Barone. Colonna und Savelli ziehen in dichten Trupps auf Monterotondo.«
Der Papst erhob sich bestürzt. »Verbeißen sich die Geschlechter wieder einmal?«
»Gott sei Dank!« sagte Cesare. »Doch davon später. Das Schicksal meiner erlauchten Schwester will zuerst erwogen sein. Lukrezia, du zürnst mir, und dennoch habe ich alle Ursache, dir zu zürnen. Denn du fährst fort, deine Herzensangelegenheiten über die Notwendigkeiten der staatlichen Entwicklung zu stellen. Zum erstenmal ist mir Gelegenheit gegeben, meine sogenannte Schreckenstat zu verteidigen.« Cesare ließ sich, wie zu einem diplomatischen Geschäft, in einen der dickgepolsterten Armstühle nieder, kreuzte die muskelstraffen Beine und stützte die gefalteten Hände auf das Knie. »Alfonso von Bisceglia mußte umkommen. Er war der Besitzer eines Namens, der in der Geschichte der Borgia nur einen Stein des Anstoßes bilden mußte. Du wirst sagen, Schwester, er war schwächlich, unbedeutsam, zartfühlend, ungefährlich –«
»Nicht ich, die ganze Welt sagt es!« schluchzte Lukrezia im neuaufgewühlten Schmerz.
»Ich gebe es zu, er war menschlich, aber diese Menschlichkeit machte ihn unfähig, die Dinge praktisch anzugreifen, über sie stolperte sein diplomatisches Talent. Ich habe Beweise in meinen Händen, daß er den Colonna zuneigte, weil diese mit Neapel eng verbunden sind. Er hätte, wäre er länger am Leben geblieben, unsere geheimsten Pläne an Neapel verraten. Die Colonna mußten endlich erfahren, daß der Vatikan entschlossen sei, alle Fäden, die hinter seinem Rücken mit Aragon gesponnen werden, zu zerreißen. Die Früchte zeigen sich: am selben Tag fast, da Alfonso stirbt, verbinden sich die Colonna mit den Savelli, da sie fühlen, daß ihnen ein Halt genommen ist. Sie gehen gegen das Geschlecht der Orsini vor, obwohl sie wissen, daß diese vorläufig von uns beschirmt werden. Sie wollen ihre Schwäche durch eine Angriffspolitik bemänteln. Aber wir wollen ihnen den Herrn zeigen. Damit geben wir auch Neapel den ersten Stoß, den zweiten gibt ihm Frankreich und Spanien, die bereit sind, Aragon zu bekriegen auf Grund eines eben geschloßnen Vertrags, nach welchem Neapel unter beide Mächte aufgeteilt werden soll. Dadurch verliert zugleich der Papsthof seinen grimmigsten Feind und die Colonna und Savelli ihren treuesten Beschützer. Die Orsini sind dann das einzig mächtige Geschlecht und – um so leichter aus der Welt zu schaffen.«
»Cesare!« Der Papst verfiel wieder in Bewunderungskrämpfe. »Du glaubst, daß dieses teuflische Werk mit des Himmels Segen zu Ende geführt werden könnte?«
»Sicherlich mit dem Glück unsrer Waffen!«
»Zwei christliche Könige fallen über den dritten her und teilen die Beute –« Der Papst schlug die Hände zusammen.
»Und sie liegen sich dann selbst in den Haaren. Nun aber kommt der berühmte Dritte und reibt sich die Hände. Denn es müßte nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn dann der Tisch nicht auch für uns gedeckt wäre. Ich selbst werde den neapolitanischen Thron besteigen, nachdem ich zuvor die Romagna unterworfen, wo wir eben im schönsten Zuge sind.«
Die großen Pläne seines Sohnes rieselten durch des Papstes Gebein. Was braute dieser junge, fürchterliche Kopf für ernste Streiche zusammen! Unten Neapel, oben die Romagna, in der Mitte Latium! Da lag ja fast die ganze Einheit Italiens zusammengeschweißt in den Krallen des Geiers. »Engel und Teufel du!« rief Alexander aus.
Mit sichtbarem Stolz baute Cesare seine Pläne weiter auf. »Uns fehlen dann nur mehr die Perlen des Nordens Italiens. Auch die müssen daran glauben. Wir müssen unter allen Umständen zuerst Ferrara gewinnen, um ein Gegengewicht gegen das neidische Venedig zu erhalten und es dann mit Florenz und Bologna angreifen zu können.«
Die wie von brausenden Orkanen umtobte Herzogin schreckte empor. »Was hat Bisceglia mit Euern furchtbaren Streichen zu tun?«
»Wir wollen, sagte ich, Ferrara an uns ketten, aber – durch die zartesten Fesseln, die je ein diplomatisches Hirn ersonnen, wir wollen dich, erlauchte Schwester, an das Herz des zärtlichsten Prinzen legen, den die Welt kennt: Alfonso d'Este von Ferrara.«
Lukrezia fuhr wie unter dem Biß einer Schlange empor. »Cesare – mich aufs neue ver–«
»Du wirst einst nicht genug Worte des Dankes finden für die Wahl, die wir für dich, vielgeliebte Schwester, getroffen.«
Die Herzogin taumelte mit den Händen in die Luft. Dann warf sie sich Vater und Bruder zu Füßen. »Um Himmels willen, werft mich nicht in ein neues Labyrinth von Qual! Denkt heilig von meinem Herzen! Treibt es nicht zum äußersten! Mein junges, liebefieberndes Herz! Wieder verkuppelt an einen fremden Mann!«
»Alfonso Bisceglia war einst auch für dich ein fremder Mann! Und doch klagst du ihm jetzt nach.« Dem Papst stieg die Verzweiflung seiner Tochter zum Herzen. »Du wirst auch diesen neuen Jüngling lieben lernen und unsre Macht vergrößern helfen, mein frommes Kind.«
»Ich will nicht!« schrie Lukrezia ihren Peinigern wie eine Rasende ins Gesicht.
Aber mit kalter Gefühllosigkeit bohrte Cesare seinen Rededolch in das unglückliche Herz der Schwester. »Deinen Willen zu achten, wäre das beste Mittel, unsere Staatsklugheit an den Pranger zu stellen. Verzeih, meine zärtlich geliebte Lukrezia, du kennst den Hof von Ferrara nicht, du bist noch zu sehr im Schmerz befangen, um den Blick für die Größe zu haben, die deiner harrt. Ich habe bereits durch den ferraresischen Gesandten Beltrando Costabili die ersten Verhandlungen angeknüpft. Du wirst in diesem zweiten Alfonso nicht nur den süßen Klang eines geliebten Namens begrüßen, sondern in seinem Herzen mit der Zeit auch mehr als einen Ersatz für den Verlust des Herzogs von Bisceglia entdecken. Wenn dieser für dich ein tugendhafter Engel war, so wird Alfonso von Ferrara dir ein Held werden. Er ist Witwer, also vereinsamt wie du, drei Jahre älter als du, kriegstüchtig, seinem Vater, dem regierenden Herzog Ercole, in Liebe ergeben, voll Staatsklugheit, sparsam, den Künsten und Wissenschaften hold. An seinem Hof, der die Heimat eines Bojardo war, wirst du die besten dichterischen und künstlerischen Talente erblicken. Geist und Regsamkeit der Gedanken und Empfindungen beherrschen den Hof. Ercole liebt das Theater, die Musik, die Improvisation und alle schönen Begabungen. Eine prächtige Hofhaltung wird dich zur ersten Fürstin auf italienischem Boden erheben, die Brüder des Erbprinzen werden miteinander wetteifern, dir galante Dinge zu sagen, herrliche Frauensterne werden mit dem üblichen Neid um die Sonne deiner Schönheit kreisen, Maler werden sich um deinen Reiz bemühen, die beiden Strozzi das Füllhorn ihrer blumigen Verse über dich schütten, der aufblühende Ariosto wird dich mit seinen tönenden Stanzen und seiner eigenen Jugend bezaubern. Zudem bringt diese Verbindung politische Vorteile mit sich. Der junge Erbprinz ist mit den Dynastien in Mantua und Urbino verschwägert und zieht so diese Landschaften in unser Interesse hinein. Wir haben damit um die Romagna auf die friedlichste Weise einen schützenden Panzer gelegt, und es könnte am Ende eine prächtige Allianz zwischen Papsthof, Frankreich, Romagna, Ferrara, Mantua und Urbino deiner Liebe ihre Entstehung verdanken. Ist das nicht ein überwältigendes Machtgefühl?«
»Das mit dem Opfer meines Frauenherzens erkauft wird!« unterbrach Lukrezia den weit ausgerollten Herrschaftsplan ihres Bruders. Ihre Stimme klang gebrochen. Ihre Augen hatten eine gläserne Starre.
Cesare wehte über ihren Schmerz hin: »Wir werden dieses Opfer durch die prächtigste Ausgestaltung deines Hofes belohnt machen. Ei, ich sehe schon die eifersüchtigen Damen von Ferrara ihre schönen Toiletten vor Wut zerknittern, weil sich eine Papsttochter in ihre altedle Verwandtschaft hineinschmuggelt. Aber die Erregung wird der schönen Isabella von Gonzaga und der geistvollen Elisabetta von Urbino sehr schön zu Gesichte stehen und deinen Wert noch erhöhen. Ja, ich rechne damit, daß Alfonso selbst uns im ersten Augenblick mit Schreckschüssen von seinem Leib halten wird, aber wir wollen die Künste unsrer Überredung spielen und das Gold unsrer Kardinalsernennungen funkeln lassen.«
Die furchtbare Notwendigkeit klang rauh und unbarmherzig in die leidzerrißne Seele der Herzogin. Der Name Alfonso trieb die Erinnerung an den gemordeten Gemahl in das Hirn Lukrezias, der Tod verklärte ihr noch seine Tugenden und hob ihn selbst in den Glorienglanz eines unwiederbringlich verlornen Idols.
Der Papst hatte längst gewußt, wohin die Ströme des Ehrgeizes Cesares flossen, aber nun waren sie hörbar vor seinen Ohren vorbeigerauscht, durch keine Dämme mehr eingeengt, von den Quellen eines grübelnden, kühnen Verstandes genährt. Und Alexanders Altersmüdigkeit gab sich keine Mühe, Durchführbarkeit und Haltbarkeit dieser Pläne zu untersuchen. »Lenke alles in die vorgezeichnete Bahn,« sagte er mit gekünstelter Autorität, indem er sich schwer aus den Polstern erhob. »Deine Tiefgründigkeit in den Entschlüssen werde ich belohnen, indem ich dich morgen zum Herzog der Romagna ernenne.«
Cesares Antlitz strahlte Dank. Er durfte also schon den Titel tragen, der zur Eroberung der noch fehlenden Städte und Landschaften verpflichtete. Er ließ sich auf sein Knie nieder und küßte des Papstes Hand voll Ehrfurcht.
Lukrezia gratulierte dem Bruder schweigend mit einem tränenumflorten Blick. Dann sagte sie entsagungsmatt: »Du erlaubst, daß ich dir auch meine Würden übergebe, um den Glanz deines Namens zu erhöhen. Was soll eine zukünftige Herzogin von Ferrara mit den kleinen Herzogtümern Nepi, Spoleto und Sermoneta beginnen? Es sind keine Waffen in einer Frauenhand.«
»Wir werden diese Sache noch erwägen,« meinte der Papst mit gerunzelter Stirn, denn die Entschlußselbständigkeit seiner Tochter paßte ihm nicht. Die Kinder wollten über seinen Kopf hinweg schon Herzogtümer verschenken, als wären es Spielbälle. Er ließ sich von Cesare den leichten Mantel umwerfen. Der Herzog rief die Sänftenträger. Pagenschritte schlieften auf dem Gang. Fackelschein hellte durch die Türöffnung.
Cesare küßte die Schwester auf die Stirn. Eine unnatürliche Hitze überlief ihn. Seine Lippen blieben länger als gewöhnlich auf den goldnen Lockenringeln haften, die sich aus dem schwarzseidnen Stirnband hervorwirrten.
Der Papst wurde ungeduldig. Er tappte endlich, nach Cesares Hand greifend, zur Tür.
Lukrezia sah ihnen nach. Jetzt würden sie wieder für sie handeln! Handeln in des Wortes grausigster Bedeutung. Sie warf ihre Herzensnot in einen Tränenschwall hinein.
*
Cesare begleitete den Papst in den Vatikan. Es war die Zeit der geheimen Aussprache zwischen den beiden. Im Torre di Borgia, in der Sala del Credo, mitten unter Propheten und Fabelwesen, ließ sich der Papst in seinen Armstuhl nieder. Der Scharlachpanzer des Stuhls umhüllte seine weiße Gestalt wie eine große erstarrte Blutwelle.
»Ich erwarte jeden Augenblick das Nahen der Eilboten von Faenza,« sagte Cesare. »Sobald sich Astorre Manfredi ergibt, werde ich meine Truppen nach Pesaro ziehen lasten, um meinen ehemaligen Herrn Schwager Sforza zu vertreiben.«
»Was willst du mit Astorre beginnen?«
»Mich zuerst gnädig zeigen, indem ich ihm freien Abzug gewähre, denn die Faenzer hängen schwärmerisch an dem jungen Tyrannen. Sobald er aber in meinen Händen ist, soll ihn meine Garde fürstlich nach der Engelsburg geleiten.«
Der Papst warf sich mühevoll in eine Art Entrüstung. »Cesare, spiel' nicht mit den Fürsten, es könnte der Tag kommen, wo sie mit dir zu spielen beginnen, und es wäre dann ein Spiel von hundert Katzen mit einer Maus. Die romagnolischen Tyrannen sind untereinander uneinig, das ist wahr, aber alle angegriffen, werden sie sich furchtbar einigen –«
»Es gibt keine kurzsichtigeren Menschen als diese Tyrannen,« lächelte Cesare ungerührt. »Ihr Hochmut läßt sie unüberwindlich erscheinen. Sie sollten den Stier im Wappen tragen, nicht wir. Uns stünde der Fuchs besser. Laßt die Zeit herankommen, allerheiligster Vater. Vor allem möchte ich Euch bitten, mir bei dem Colonnaspiel freie Hand zu lassen.«
»Was geht dort vor?« Der Papst nippte an der Abendmilch.
»Ein wunderliches Schauspiel, aus unsrer Zeit heraus entstanden. Ich wollte vor Lukrezia nicht sprechen. Wir erleben einen kleinen Trojanischen Krieg vor den Mauern Roms. Es handelt sich um nichts andres als um eine schöne Helena, die der Herr von Monterotondo, Kardinal Giambattista Orsini, in einer Art freiwilligen Gefangenschaft zu halten scheint. Luigi Savelli, der halsstarrige, gewalttätige, unritterliche Bräutigam der Tiziana de' Calvi, kämpft um sein schönes Liebchen, das auf eine noch unaufgeklärte Weise in den Besitz dieses weltflüchtigen Stoikers im Purpur gelangt ist. Ich hätte diesem Orsini niemals die Fähigkeit zugetraut, einen derartigen Geschmack zu entwickeln.«
»Dieser Antikenkrämer war immer ein Sonderling, aber nie ein geschmackloser,« sagte der Papst. »Mich reizt es beinahe, dieses geheimnisvolle Schloß zu besuchen.«
»Weil sein schönster Schatz nicht der antiken Welt, sondern der unsrigen angehört,« lächelte Cesare. »Aber ich meine, er wird sich uns gegenüber ebenso zur Wehr setzen wie gegen die Savelli. Er wird sich sagen – denn er ist klug – ich verteidige wohl die Kirche, aber ich wehre mich gegen den Papst und dessen Helfer, die mir die Annehmlichkeit meines durchwärmten Bettes verleiden wollen. Und es ist sehr die Frage, ob die übrigen Orsini diese Anschauung nicht teilen. Ich möchte daher, Eure Einwilligung vorausgesetzt, das Räderwerk anders ineinandergreifen lassen.«
»Ich bin neugierig.«
»Ich habe den Auftrag gegeben, daß noch in dieser Nacht meine Söldlinge gegen die Colonnaschlösser Palestrina und Genazzano ziehen, die verlassen dastehen. In diesem Augenblick belagern meine Bogenschützen den Colonnapalast in Trevi. Morgen ergeben sich alle übrigen Burgen von selbst, des bin ich gewiß. So befreien wir die Orsini von dem Druck, und diese, unsre Hilfe belohnend, werden nun nicht anders können, als unsre Forderungen anzunehmen.«
»Und die werden sein?«
»Unumschränkte Gefolgschaft der Kirche, Zahlung einer Befreiungssumme, und das dritte –« er stockte ein wenig und fuhr dann lächelnd fort: »Kardinal Giambattista Orsini möge die Freundlichkeit haben, die duftende Rose seines Schloßhofes auszuliefern – den schönen Stern –«
»Donna Tiziana?« horchte der Papst lüstern auf. »Mit welchem Rechte?«
»Sie war Hofdame der Lukrezia Borgia und ist dem Hof entflohen. Die andern Orsini werden den Kardinal isolieren, wenn er zum Narren eines Weibes werden sollte. Im äußersten Falle aber könnten uns immer noch List und Gewalt zu unserem Scheinrecht verhelfen.« Mit der hundertarmigen Kraft eines Typhäus kämpfte er gegen alles an, was Reinheit und Tugend hieß.
»Unerreicht in seinen Kühnheiten! wird einst auf deinem Grabmal stehen,« sagte Alexander, dessen Lippen schmatzende Laute formten. »Und darf man einmal diese Tiziana de' Calvi zu Gesicht bekommen, wenn sie in deiner Hut ist?« Der Papst blinzelte den Sohn von der Seite an.
Cesare reizte das Abenteuerliche, nicht der Gegenstand. Eine Teilung beschwerte sein Gewissen nicht, besonders wenn er dafür Entschädigungen erhalten konnte, die er dem Vater gegebenenfalls unterbreiten würde. Den Primat würde er sich jedenfalls sichern, und nach ihm konnten Schmutz und Schmach das Opfer vollends vernichten. »Allerheiligster Vater, wir werden einen ungeschriebnen Vertrag ausarbeiten, nach dem die schöne schwarze Beute zur gerechten Verteilung gelangen soll. Es wäre mir lieb, wenn Giulia Farneses Einfluß ein wenig gebrochen werden würde –«
»Mein goldnes Kind!« verschwärmte der Papst seine Gefühle. »O, o! Ihr Verlust könnte nur durch einen vollwertigen Ersatz verschmerzt werden.«
»Allerheiligster Vater, Ihr werdet bei der Abwechslung zum feurigen Jüngling werden. Giulia Farnese ist sinnlich ruhebedürftig, Tiziana de' Calvi sicherlich nicht. Und wenn Euch das leuchtende Haar Giulias wie salomonisches Gold zwischen den Fingern dahinfloß, wird Euch der schwarze Samt auf Tizianas Scheitel wie das herrliche Fell eines schwarzen Pantherweibchens anmuten. Und es ist am Ende auch ein Labsal, nach dem ewig blauen Himmel des schönen Auges der Farnese in die dunkle Sternennacht eines andern Auges zu tauchen. Und ich könnte Euch, allerheiligster Vater, auch noch verraten, daß mir ein günstiger Augenblick die Gliederweiße dieses sylphidischen Leibes enthüllt hat, vor dem Phidias' Künstleraugen jubelnde Gebete verrichtet hätten.«
Dem Papst zuckte der alte Adam durch die Glieder. Der letzte Fieberrest floh aus seinem Körper, verjagt durch die Kraft seiner sinnlichen Natur. Sein Gesicht wurde beinahe augenblicklich voller, die Haut straffte sich und wurde glatt, selbst das spärliche Haar schien unter der Macht erotischer Energien graugolden zu schimmern. Er warf den Frauenköpfen an der Decke listige Blicke zu und nahm endlich eine kleine Statue zur Hand, die eine wollüstig zurückgebeugte Pasiphae darstellte, betrachtete sie lange und drückte endlich einen Glutkuß auf die gespannten Brüste. Dann sagte er keuchend: »Laß Giulia Farnese holen!«
Es war tief in der Nacht.
Da klirrten schwere Tritte auf dem Korridor.
»Gianmatteo, was bringst du?« rief Cesare dem Reiterleutnant zu, der eben hereintrat.
»Der Herzog von Pesaro, Giovanni Sforza, verließ beim Nahen der französischen Hilfskontingente in Eile Kastell und Stadt Pesaro. In diesem Augenblick sind unsre Truppen bereits einmarschiert.«
»Die Hasen beginnen zu laufen!« jubelte Cesare. »Laß dir gleich den Keller öffnen und mach' dich dort bezahlt. Vitelli soll sofort auf Rimini marschieren. Pagolo bleibt in Pesaro. Ich hoffe, daß der Malatesta von Rimini sich an Pesaro ein Beispiel nehmen wird, wenn er die Franzosen wittert. Braver König, ich will deine Helferhand küssen!« Innerlich aber fügte er hinzu: um sie nachher fortzustoßen. Er war konsequent in seiner Feind und Freund vernichtenden Eroberungspolitik. »Was sonst?« fragte er hungrig.
»Auf dem Weg hierher mußte ich mich mühsam durch die Ketten der Colonna und Savelli durchschlagen, die gegen Monterotondo ziehen.«
»Laß dir den Wein durch die schönste Dirne kredenzen,« sagte Cesare. Der Leutnant stiefelte ab.
Der Papst horchte hilflos den hagelschlagartig niedergehenden Befehlen seines Sohnes, der sich nun wie ein befreiter Löwe reckte. »Orsini und Colonna! Sie wollen aus der ewigen Stadt ein Mailand machen. Sie sind dumm wie junge Hunde. Die beiden vereint wären des Papstes Tod, so aber leben wir von ihrem Hader.«
Die Tür flog weit auf. Pagen neigten sich an der Schwelle. »Donna Giulia Farnese!« meldete einer mit gesenktem Haupt.
Der Papst erhob sich mit lustzitternden Knien. »Sieg, Giulia, Sieg!« lallte er.
Die schimmernde, blendende Sonne der Favoritin ging an der Schwelle der Sala del Credo auf.
Und Rom lag in Nacht.
 Zartes Mondlicht fließt an den Mauern der Burg hinab.
Zartes Mondlicht fließt an den Mauern der Burg hinab.
Tiziana liegt im Zimmerschatten auf den Knien. Das Brausen des Todes umgeistert sie. Ihre Hände sind krampfhaft ineinandergefaltet, die Lider verschluchzt, das Herz zerwühlt von Leid und Stolz, Schmerz und Angst. Blut rief man an zum Zeugen der Liebe für sie. Und da reitet jetzt ein Mann in den Kampf, der es nicht über sich brachte, um ihretwillen das letzte von sich zu werfen, das heilige Kleid des Gottesknechts, der aber bereit ist, Wunden und Tod für sie zu empfangen. Damit sie lebe und – wie der arme Mann glaubte – mit einem andern glücklich lebe, sprang er in den Kampf und versuchte eine fremde Liebe zu retten vor dem Würgeratem des Savelli. Deshalb? Wirklich deshalb? Sie glaubte es nicht. Es überfiel sie mit fürchterlicher Wucht, daß ein andrer Trieb es sei, der Giambattista in die Lanzen der Feinde jagte. Er suchte den Tod, um dem andern Sterben in seinem Herzen zu entgehen. Sie hatte die Eifersucht in ihm entfacht, und sie war schuld, daß er sein Herz in wilden Zweifeln zerwühlte, bis es keinen andern Ausweg fand als den Tod. O, was war das für eine Welt um sie? Da fochten drei Männer draußen um ihr Herz und keiner wußte es zu erringen. Der eine liebte sie brutal um ihres Leibes willen; der andre liebte sie, weil er sich selbst verkannte, um ihrer Schönheit willen, und auch der mußte seine Liebe zerbrechen, wenn ihre Schönheit zerbrach; und der dritte liebte sie als ganzen Menschen, Seele und Leib zur Harmonie verschmelzend, und war der einzige, der es wert war, daß sie ihm beides gab. Und dieser dritte war zugleich ein armer Tor und wollte sich's nicht eingestehen, daß er sie liebte.
Was trieben diese Menschen! Sie brachten ihre Gedanken und Gefühle in Verwirrung und fanden zum Schluß keinen Ausweg als Blut und Tod.
Da schleuderte sie ihre Bedrängnis in wilde Gebete hinein. Schütze sie, Madonna! Giambattista und Marcello! O, seid ihr Gleichgewichte auf der Wagschale meines Schicksals? Nein, ihr seid's nicht! Die Schale des einen sinkt liebeschwer hinab und zeugt gegen die Reinheit meines Gebetes. Herrgott im Himmel, wäge nicht den Hauch meiner Gedanken! Entscheide du! Was sein soll, wirf mir als gnädiges Geschenk ins Herz! Rette mich vor mir selber! Sieh, da liege ich! Liebebeschwert und ohnmächtig, dich zu bitten – gib mir ein Zeichen, daß du entschieden hast – wie ich wollte! Du hast den Geist der Liebe und Gerechtigkeit –
Sie fühlt den Kelch der Liebe vorüberschweben, einer weißglühenden Lilie gleich, über deren Rand es überquillt von seligem Inhalt. Und da reißt es sich plötzlich los, aus den tiefsten Tiefen des Herzens, und zerbricht das Gebet mit stammelndem Laut: Schütze Giambattista! Mein Herr und Gott!
Und da kommt es auch schon über sie wie Sturmesmacht. Angst und Jubel ringen in ihrer Brust. Es duldet sie nicht mehr in den drückenden Mauern der Burg. Es geht da draußen um sie! Und sie will Zeuge sein der Taten, die jetzt um ihretwillen geschehen, will helfen, wenn es not tut, oder zugrunde gehen, wenn ein andrer zugrunde geht. Der Name dieses andern wagt sich nicht über ihre Lippen.
Tiziana wirft die gelösten Haare in den Nacken und bindet sich den weißen perlengestickten Schleier, den ihr Giambattista verehrt hatte, über das Haupt. Das Männerwams, das ihr einst heimlich zur Flucht verholfen, legt sie wieder um ihre fraulichen Glieder, den dunklen Mantel wirft sie über die Schulter, und so eilt sie die Treppe hinab in den Hof. Dort besteigt sie das Roß eines zurückgekehrten Spähers. Die Torwachen machen der kühnen Herrin Platz. Die Flügel öffnen sich. Tiziana fliegt auf dem Pferd hinaus in den grünsilbernen Glanz der Sommernacht.
Panzerrasseln und Hufgepolter weisen ihr den Weg. Und da drüben dunkelt auch schon ein lebhaft bewegter Knäuel von Gestalten. Dort ringt man um ihr Herz. Wie eine wilde Amazone jagt sie darauf los. Und im nächsten Augenblick hält ihr zitterndes Roß vor dem Schreckbild des Einzelkampfes.
Sie erkennt eine hochgewachsene Gestalt im Eisenpanzer, sieht den silbernen Helm blitzen, auf dem der Busch wie eine Flagge Luzifers flattert. Nun bäumt sich das Roß – da drüben jagt der Rappen des Kardinals daher – hinter ihm eine Handvoll Orsiniknechte.
Tizianas Herzensschrei hallt durch die Nacht. Vor ihren Augen spielt sich das blutige Schauspiel ab: Klingenkreuzen, Rossestampfen, Panzerblitzen – der Helm des Savelli fällt – das Roß bricht in die Knie – des Kardinals hochgeschwungnes Schwert saust nieder mit der Wucht der Todeshippe – vom Rücken des Pferdes fällt lautlos ein Körper herab.
Da fliegt ein jubelnder Schrei in die toddurchzitterte Nacht. Der Kardinal wendet sein Roß, und mit weh- und wonnedurchstürmter Brust jagt er auf die geliebte Frau zu und hebt sie vom Roß.
Orsinireiter stürzen sich auf das heranbrausende Häuflein der Savelliknechte und treiben es in die Flucht. Führerlos ergreifen sie das Hasenpanier.
Die Luft scheint zu zittern, das Mondlicht bekommt unheimlichen Glanz, Erde und Himmel leuchten auf, als wäre ein saturnalisches Fest im Gang.
Der Kardinal blickt wie traumverloren auf das Weib neben sich, das der Schreck in die Knie gezwungen hat. Er sieht, wie sich ihre Augen weiten, als wollten sie den grausen Inhalt des Geschehnisses zu messen beginnen. Und plötzlich fühlt er, wie zwei Hände an seinem Leib emportasten. Und er hörte die geliebte Stimme flüstern: »Was – ist – geschehen?«
»Euer Feind ist nicht mehr.«
»Ihr – habt ihn –?« Es würgte sich schwer aus der zusammengeschnürten Kehle.
Der Kardinal schwieg, leichenblaß. Dann sagte er verhalten: »Der Savelli hat die Unvorsichtigkeit begangen, sich als erster zu nahe an die Burg zu wagen. Oder war es Kühnheit gewesen? Konnte er es nicht erwarten, sich mit dem Herrn auf Monterotondo zu messen? Gott hat schnell entschieden, wo das Recht liegt.«
»Ich bin – befreit –?« Hoch gingen die geschwellten Brüste.
»Um diesen Preis!« sagte der Kardinal, und seine Rechte wies auf eine hingestreckte Gestalt, die im verdorrten Gras dalag wie ein Marmorbild auf einem Sarkophag.
Tiziana riß ihren Leib empor. Dann taumelte sie über den Panzer hin, unter dem ein Jünglingsherz, auf das ein ernster Gott seine Hand gelegt, in schwachen Schlägen ging.
»Er ist –?«
»Noch lebt er,« sagte der Kardinal mit heisrer Stimme. Aber Blick und Ton gaben keiner Hoffnung den Weg frei.
Da sank Tizianas Haupt auf die Brust. Die schwarze Flut der Haare floß über das schmerzerstarrte Gesicht. Leblos wie eine Grabgestalt kauerte sie neben Marcellos schönem Leib.
»Ruft den Vikar!« sagte Giambattista zu einem heransprengenden Reiter.
Bewegten Herzens trat der Kardinal zur Leiche des Savelli. Kein Schauer erfaßte ihn mehr. Er breitete seinen Mantel über den toten Recken.
Die Erde dunstete feine Nebel in das Mondlicht. Fern hörte man Roßgewieher und den Tritt marschierender Haufen. Es mußten die nahenden Trupps der Feinde sein.
Giambattista kniete neben Marcello nieder, dessen Brust sich schwer hob. Das Panzerhemd war von einem wuchtigen Schlag zerhauen, und an der Schädeldecke klaffte eine breite Wunde. Der Kardinal riß ein Stück seines Brustlatzes herab und stillte damit das Blut. Marcello bewegte sich schmerzhaft. Den geistlichen Ritter überkam heiliges Erbarmen und er spannte das Netz seiner Gefühle über Tiziana, den todblassen Jüngling und sich selbst aus, und ihm war, als flatterten sie alle drei in diesen Maschen wie arme, vom Schicksal gefangene Vögel, die sich nicht selbst daraus erlösen konnten.
Aus dem Schloß nahte der Vikar mit Männern, die eine Tragbahre trugen. Gleich darauf schritt der kleine Zug leise und vom Mondlicht gespenstisch beleuchtet nach dem Burgtor.
Im Hof harrte ungeduldig und kampfgespannt das Kriegsvolk des Herrn auf Monterotondo. Alles lauerte in die Nacht hinaus, die noch immer nicht in Bewegung kommen wollte. Der Kardinal ließ Wein kommen, um die Männer munter zu halten.
Den Schwerverwundeten ließ er auf dessen Zimmer schaffen, und Tiziana folgte ihm wie einer Trauerbahre. Der Vikar machte sich gleich an die Untersuchung.
Den Kardinal litt es nicht in der Sphäre der Trauer und des furchtbaren Wehs. Er schritt schwer die große Turmtreppe hinauf bis auf die Zinne, wo die Wächter standen. Dort hielt er Umschau ins Land. Drüben lag Rom in nächtiges Grau gehüllt. Von dort her mußten die Haufen kommen, die Burg zu umzingeln. Was würden sie wohl tun, wenn sie hörten, daß ihr Führer gefallen? Würden sie abstehen von dem unseligen Beginnen? Würde die Wut in den Rächern des Erschlagnen neu entbrennen? Der Kardinal wollte die Leiche des wilden Barons, die jetzt auf einem Wagen im Hof lag, im Morgengrauen mit ehrenvollem Geleite in den Belagerungsring der Feinde senden.
Nun stieg er hinab und betrat den Gang, wo Marcellos Gemach lag.
Als er die Tür öffnete, stockte sein Fuß. Bang hielt er den Atem an.
Auf der Bahre lag der Jüngling hingestreckt; er hatte die Augen geöffnet, um seine Lippen lag der Schimmer eines Lächelns. Zu seinen Häupten kniete Tiziana mit schmerzerstarrten Augen. Der Burgvikar richtete beim Tisch einen Verband her.
Giambattista trat leise heran.
Tiziana erhob sich, wankte und fiel wie Holz zu seinen Füßen nieder.
 Noch immer lag die Nacht über der schlafenden Campagna. Aber die Mondnebel verblaßten und fahle Lichter dämmerten im Osten auf. Und noch immer war kein Feind zu sehen. Alles fieberte nach Gewißheit.
Noch immer lag die Nacht über der schlafenden Campagna. Aber die Mondnebel verblaßten und fahle Lichter dämmerten im Osten auf. Und noch immer war kein Feind zu sehen. Alles fieberte nach Gewißheit.
Da sprengten in der Morgenfrühe die ausgesandten Reiter zurück. Der Leutnant Montfort polterte mit seinem schweren Pferd in den Hof und eilte dann in das Zimmer des Kardinals.
»Was gibt's?« fuhr der wie im Traum liegende Gebieter auf.
»Frohe Nachricht!« jubelte Montfort. »Die Savelli haben Reißaus genommen!«
»Bist du bei Sinnen?«
»Wir haben einen ihrer Leutnants gefangen. Der sagte das Unerhörte aus. Das ganze Kriegsvolk der Colonna aus den Schlössern von Genazzano und Palestrina war auf den Beinen gegen uns, und sie hatten schon den Aniene überschritten, als alles zurückflutete, denn hinter dem Rücken der Colonna ist Cesare Borgia über ihre Burgen hergefallen.«
»Nein?!« Ein vom Weh halb gebrochner Jubel entrang sich der Brust des Kardinals. Dann umarmte er den Bringer der frohen Botschaft und öffnete ihm seinen Keller.
Aber dann preßte es ihm das Herz ab, daß er seine Rettung dem Menschen verdanken mußte, dem zu danken ihm höchste Qual war. Sein Feind wurde ihm zum Helfer, ohne daß er es wollte. Wohin trieb der Himmel sein Schifflein?
Giambattista ließ die Burgknechte tafeln und bechern und die Freudenfeuer auf den Türmen entzünden.
Aber seinen Jubel erstickte die würgende Kraft seines Herzleids.
Auch des Lichtes heiliger Quell, der jetzt aus dem Morgentor sprang, spülte die Qual des Herzens nicht hinweg.
Den ganzen Tag schloß sich der Kardinal in sein Zimmer ein. Stündlich ließ er sich Nachricht über das Befinden Marcellos geben, der im Wundfieber lag und an dessen Lager Tiziana schmerzerfüllt jeden Atemzug der kranken Brust bewachte.
Die Knechte des Orsini machten saure Gesichter trotz der Völlerei, die ihnen heute der Kardinal bewilligt hatte. Die Freude an dem Kampf war ihnen vergällt. Wie feige Hasen hatten sich die Colonna und Savelli zurückgezogen.
Gleich in der ersten Morgenstunde war die Leiche des Savelli nach Rom geschafft worden. Ausgesandte Reiter konnten keinen Feind melden. Es schien also alles durch das Eingreifen Cesare Borgias erstickt zu sein.
Als der Abend nahte, lag Mutter Ginevra in Herzkrämpfen. Der Vikar bemühte sich um sie, da Tiziana und Giambattista an das Lager Marcellos gerufen worden waren. Nun stieg der Kardinal gedankenschwer die Treppe hinauf. Kläglich sah er die schwer errungenen Tröstungen der Bücherweisheiten zusammenbrechen. Dieser eine Tag hatte ihn aus seinem Priester- und Gelehrtentum hinausgeschleudert in eine Welt inwendigen Lebens, in der er aufs neue zu lernen hatte. Unveränderlich wie der Korund in seinem Glanze gedachte er vor Gott und der Welt dazustehen in seiner Tugendstärke, und nun hatte ihn ein Tag zum Renegaten seiner Weltanschauung gemacht. Vor der Tür, hinter der der Tod mit lautlosen Flügelschlägen an der Liebe vorbeistrich, hielt er still. Er verhehlte sich's nicht: des Todes Erbarmen war für ihn, der jetzt leise die Klinke in die Hand nahm, ein Stoß ins Herz.
Tiziana kam dem Kardinal mit einem traurigen Lächeln entgegen. Marcello schien zu schlafen. »Er hat mit mir gesprochen,« sagte Tiziana, wie von einem leisen Glück umschimmert. »Er war selig, meine Hände drücken zu dürfen.«
»Laßt mich hier weilen bei ihm,« sagte der Kardinal mit verschleierter Stimme. »Und Ihr sollt auch dableiben. Ich will Euch das Abendbrot heraufschicken lassen.«
Tiziana wehrte ab. Ihre Augen waren unausgesetzt auf das Antlitz des Schlafenden gerichtet. Es war ein Antlitz, dem Heldentum, Liebe und Todesgeweihtheit ihre wunderbaren Male gezeichnet hatten. Wer es anblickte, konnte nicht ohne Klage vor das Schicksal hintreten, das hier einen bittern Streich geführt. Und der Kardinal sann mit immer lebhafter werdenden Gedanken, die sich endlich zu flüsternden Worten formten, in das apolloschöne Bild.
»Seht nur, Donna Tiziana, ist es nicht, als hätte seine ungestüme Heldensehnsucht, die für Euch Wunden empfing, freundlichere Genien beruhigt und sie auf ein friedsames Gefilde gewiesen, wo nicht der Lorbeer der Schlacht, sondern die zarte Myrte grünt? Brauten hinter dieser edlen Stirn nicht schönere Gedanken, die sich dem Herzen beugten, das unter dieser Brust schlug? Und dieses Herz schlug für Liebe.«
Da erhob Tiziana den ernsten, unsäglich wehen Blick. »Es war aber noch eines in ihm, das seine Seele noch größer machte, die Treue.«
Der Kardinal zuckte zusammen. Dann sagte er schwer gedrückt: »Es war ihm leicht gemacht vom Himmel, einer solchen Frau die Treue zu halten.«
»Ihr irrt, Kardinal,« sagte Tiziana. »Er ist Euch treu geblieben.«
Giambattista blickte sie verwundert an.
»Er hat etwas getan, was hundert andre in seinem Alter nicht getan hätten. Wenn er eines jener wilden Tyrannenherzen hätte, die ganz Italien durch Untreue schänden, so hätte er sich nicht für den Orsini geschlagen und hätte nicht den Todfeind vor den Mauern der Burg ausgesucht, sondern es Euch überlassen, mit ihm fertig zu werden. Und wenn er eines jener wilden Tyrannenherzen hätte, würde er sich über mich gestürzt haben mit dem Schwung eines Jupiteradlers und hätte sich die Liebe geraubt, die ich ihm nicht gewähren konnte.«
Giambattista starrte sie an.
Tiziana fuhr heiß flüsternd fort: »Und er hätte sich mit den Dolchen seiner Eifersucht auf – Euch gestürzt und sich selbst nach bösen Mustern geschändet. Aber dieses stürmische Herz hatte eine Tugend großgezogen, die heute nur mehr sagenhaft klingt: die Treue. Er wehrte sich um seine Liebe wie ein Mann. Dennoch wart Ihr nahe daran, sein Feind zu werden –«
»Donna Tiziana!«
»Ein von Liebe und Gnade und Entsagung überströmender Feind, aber sein Feind doch. Er hielt Euch für den Rivalen seiner Liebe, goß erst die Schale seiner Eifersucht mit Zorn und Ingrimm voll und siegte endlich über sich durch die Reinheit seines Herzens. Er setzte die Freundestreue über die Liebe. Sagt, kann dies ein Weib so bald verzeihen?«
In des Kardinals Brust dröhnte es leise, als wären ferne Wetter zum Kampf im Anzug.
Und Tiziana ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. »Dieser Jüngling ist Euch ebenbürtig in der Reinheit der Empfindung. Der Kampf hat ihn zum Mann gereift. Ein andrer hätte mit der Hoffnung geliebäugelt, daß ein satanischer Schwertstreich Euch im Kampfe fällt, ja, ein andrer hätte Euch vielleicht getötet und wäre dann vor der unbeschützten Heiligkeit der Frauenkeuschheit nicht hirtenfromm in die Knie gesunken. Ein Bruder tötete in Rimini den Bruder um einer Liebe willen. Marcello war Euch nicht Bruder und tötete Euch nicht.« Ihr Herz schlug heftig. Sie beruhigte es mit den aufgelegten Händen.
Vor den Augen des Kardinals dunkelte ein Frauenrätsel. Tiziana hatte in das eifersüchtige Herz Marcellos geblickt. Und ihr sollte verborgen geblieben sein, was der schöne Nebenbuhler mit dem starken Herzen entdeckt hatte? Das glaubte er nicht, konnte er nicht glauben. Sie wußte um sein eigenes Herzzittern. Was aber empfand sie für Marcello in Wahrheit? Und was für ihn, Giambattista?
Mitten in diesem Gedankentreiben öffnete plötzlich Marcello die Augen.
Der Kardinal und Tiziana schritten an sein Lager. Der Kranke streckte die Hände nach Tiziana aus. Giambattista zuckte mit keiner Wimper. Freundlich neigte er sich über den Erwachten und streichelte ihm die Stirn.
»Eure Hand ist mild,« lächelte der Kranke.
»Ihr sollt ruhig liegen,« schmollte Tiziana.
»Wie kann man das, wenn so viel Güte und Liebe um einen ist?« Dann streckte Marcello die Hand nach dem Kardinal aus. »Verzeiht mir –«
Giambattista verbiß seinen Schmerz. »Ihr habt mit Treue für mich gekämpft.«
»Mußte ich's nicht? Ihr gabt mir Asyl und ein Freundesherz.«
»Denkt nicht daran,« wehrte der Kardinal unruhig ab.
Marcellos Lippen verzogen sich schmerzvoll. »Und ich – aus meiner Brust kroch eine Giftschlange – Undank!« Er wandte den Kopf nach dem Fenster. »Es ist Nacht?«
»Tiefe, klare Nacht,« sagte Tiziana.
»Nacht!« sagte der Kranke wie im Traum befangen. »Aus deinen Flügeln träufelt Mohnbalsam – Nacht – in dir feierte ich die Geheimnisse der Liebe zu ihr – meiner Lieder Opferrauch –« Er wurde wieder wach und gegenwärtig. »Der Feind ist verjagt?«
»Er ist's,« nickte der Kardinal.
»Und – Luigi Savelli?«
»Ist tot,« sagte Tiziana ohne Grauen.
Eine tiefe Bewegung ging durch des Kranken Brust.
»Der Kardinal hat ihn gefällt, der Euch fällen wollte,« sagte Tiziana mit schwer ringender Seele.
Marcello warf einen leuchtenden Blick nach dem Retter. »Habt Dank!«
»Wofür?«
»Für die Guttat – es sprang der Tod von mir auf ihn – durch Eure Kraft. O Kardinal!« Plötzlich wandte er sein Auge auf die starre Tiziana. »Ich bitte Euch, lest mir Petrarcas himmlische Verse vor – da wo Ihr stehengeblieben seid, als wir das letztemal – als ich noch morgenfrisch im Leben stand und Eurer Blicke Tau mein heißes Herz –«
Tiziana nahm mit schmerzbewegter Seele den Band des avignonischen Sängers zur Hand und las mit halb verschluchzter Stimme ein Sonett der segnenden Liebe. Wie süße, bräutliche Geheimnisse troff es leise durch die Nacht, lösend und bindend zugleich, Tropfen aus dem Urmeer der Liebe.
Aber bald winkte Marcello mit der Hand, als wollte er Schweigen haben. Dann wies er auf eine silberbeschlagene Kassette, die auf der Kaminkonsole stand, und bat den Kardinal, daß er sie öffne. Dieser tat es und zog ein paar Pergamente heraus, eng beschrieben und sorgfältig zusammengeknüpft.
»Es sind meine Lieder an meines Herzens zarte Dame,« flüsterte Marcello. »Wenn es tief in der Nacht ist, lest sie.«
»Es ist tief in der Nacht,« nickte Giambattista.
Und der Kardinal las, während der Kranke leise einschlummerte. Er las heiße, versengende Worte der Qual und der Freude, wild aufflatternde Lieder der Sinnlichkeit, Fanale eines begehrlichen Herzens, aber auch zärtliche, streichelnde Worte, die einer guten Mutter guter Sohn ersonnen hatte, um die reine Bewegtheit seines Herzens auszudrücken. Die Tiefe der Leidenschaft versöhnte mit der Maßlosigkeit der Bilder und der Zerfahrenheit der Gedanken. Oft mengte sich in die Verliebtheit ein marathonischer Schwertklang hinein, der männliche Kraft vortäuschen sollte. Und er träumte von seiner Dame bange, nervenstechende Träume, die die Kraft aus seinem Körper sogen, er enthüllte ihre gottgeschaffne Schönheit, schuf sie zum lebendigen Marmor um und umschlang die allerschönste Form mit den sinnlichen Girlanden seiner Worte. Seine Leidenschaftlichkeit eilte mit Götterungestüm vom Blick zur Begierde, Brust an Brust wollte er Seligkeiten atmen, vor denen die Wonnen des Himmels zergehen sollten. Die schönen Keime seiner Tugend wurden zu freundlichen Blumen auf dem wilden Graswuchs seiner Sinnlichkeit.
Der Kardinal hielt inne und sah Tiziana ernst an. »Dieser Jüngling liebt Euch sehr.«
»So sehr, daß ich fürchten muß, in seine Gewalt zu fallen, wenn er wieder genesen sein wird.«
Als der Kardinal die Lippen aufeinanderpreßte und beiseite sah, öffnete Tiziana schreckweit die Augen. »Kardinal – Ihr glaubt doch nicht, daß –«
Tiziana war aufgesprungen. Sie näherte sich dem Lager Marcellos und starrte ihn an. Sie suchte das Rätsel der nächsten Stunden zu lösen, aber das Tor blieb ehern verschlossen. Da fragte sie mit qualvoll verzerrtem Antlitz: »Kardinal! Wollt Ihr – daß dieser Jüngling – stirbt?«
»Donna Tiziana!« Wie ein Schrei des Schreckens rang es sich los von der übervollen Brust.
Tiziana aber ließ die Hände schlaff sinken, ihr Kopf neigte sich langsam und schwer auf die Brust. »Jetzt – wird – dieser Jüngling – sterben,« sagte sie tonlos.
»Warum?« hauchte ganz nahe an ihrem Antlitz des Kardinals Stimme.
»Weil ich – heute morgen – im Augenblick höchster Verzweiflung – Gott angefleht – um – Euer Leben – Gottes Schutz über dieses junge Haupt aber – unerfleht gelassen –«
»Tiziana!« Der Kardinal erfaßte voll Glut und Weh ihre Hände. »Gott richtet solche Gedanken nicht.« Mit der Wucht eines Gewalthabers pflanzte er seine schöne Gestalt vor ihr auf und sagte mit großer Ruhe: »Dieser Jüngling stirbt nicht.« Es lag Glaubensinbrunst in dem Wort. Dann fügte er mit erstickter Kehle hinzu: »Donna Tiziana – ich ging in den Kampf – um nicht mehr wiederzukehren. Ich wollte von des Savelli Schwert getroffen werden.«
»Weshalb?« hauchte todesblaß Tiziana.
»Eure Liebe zu – diesem trieb mich dazu.«
Tiziana fühlte ihre Pulse wie Lava glühen. Die Zeit schien stillzustehen und eine Stimme rief an ihr Ohr: dies ist die Ewigkeit. Endlich fuhren ihre Hände leise den Körper hinauf zum Herzen, wo der fürchterliche Schmerz brannte. Und ihre Lippen begannen zu tönen: »Und – was nun?«
Der Kardinal ließ restlos Gewicht auf Gewicht von seiner Seele fallen. »Des Savelli Schwert traf nicht. Der Himmel sprach sein Nein.«
»Unseliger!«
»Da brach ein andres aus meiner Tiefe –«
»Redet – schweigt –«
»Ein Ungeheuerliches – hört, Donna Tiziana – wenn dieser Jüngling heil erwacht – o, schaudert nicht – ringe ich mit ihm durchs Schwert um Eure Liebe!«
»Kardinal!« Ein jubelnder, unartikulierter Laut schnellte aus dem finstern Winkel. Dann war es still. Todesbangigkeit schwang ihre Fittiche.
Giambattista glaubte durch seinen eigenen Atem versengt zu werden. Des Geistes schöne Schale überflammte das Feuer des Herzens. In den zusammenwirbelnden Gefühlen versank des Denkers arme Kraft. »Tiziana – wißt Ihr einen andern Ausweg?« fragte er mit fremder Stimme.
Da richtete sich Tiziana mit der Erhabenheit einer Seherin auf. »Gott!« sagte sie leise, aber schwer.
»Wie meint Ihr das?«
»Stirbt Marcello Gaetani, dann war's sein Wille, lebt er, dann ist's sein Wille. Und dann –«
»Dann?«
»Entscheide ich, nicht Ihr, wer meines Herzens Lust sein soll.« So hielt sie, eine geheimnisvolle Richterin, das Urteil über zwei Herzen in ihrem eigenen verborgen.
»Tiziana – so wollen wir bitten um dieses Jünglings Leben,« sagte der Kardinal voll Inbrunst.
»Ja.«
Da warf sich der Kardinal, erfüllt von innigster Erhörungsgewißheit, beim Fenster neben Tiziana in die Knie, und beider Gebet trug Marcellos Leben zu Gott empor.
Sternenschein funkelte zu ihren Häupten, silberne Weiten öffneten sich, als gäben sie den Weg für zwei ringende Gebete zum Thron des Höchsten frei.
Als die Frühdämmerung mit bleichem Schein über die Sterne strich und ein leiser Wind vom Meer herüber salzigen Hauch in die Schwüle trug, rückte Gott einen Zeiger auf der Lebensuhr des schönen Menschenkindes zum letzten Schlag. Draußen klirrte seltsam ein leiser Ton, wie ein Botschaftsruf des Himmels.
Marcello öffnete die Augen. Und er sah Tiziana und den Kardinal, sie hingeworfen in den Polstern des Sessels, ihn daneben stehend in aufrechter Haltung, ein ganzer Mann. Und in die Trübnis der Sinne machte dieses Bild einen Riß. Marcello wollte die Hände heben –
Da hörte er des Todes ehernen Schritt. Allen Willen zerbrach der furchtbare Gegner des Willens. Rasch sauste die Hippe durch die Luft ...
Über dem Totenlager des edlen Ritters reichten der Kardinal Giambattista Orsini und die schöne Tiziana de' Calvi einander stumm die Hände.
Grauweißliche Gespinste, vermischt mit den bleichen Mondnebeln, schwebten um die Burgfenster. Vom Tiber stieg der Atem des Wassers dick und zäh in die Höhe. Die Natur wob dieser Stunde keinen feierlichen Untergrund. Über dem fernen Meer ballten sich rotschimmernde Gewölke zusammen und zogen nun wie Heerhaufen Gottes heran, den jungen Helden in himmlische Höhen zu geleiten.
Giambattista drückte dem toten Knaben die Augen zu und betete dann still das Gebet des Herrn.
Tiziana aber nahm Rosen aus einer Vase und legte sie in die Hand des Jünglings. Dann nahm sie sein Schwert und gab es ihm an die Seite. Endlich schlug sie ein Buch auf, das neben dem Petrarca lag, und drückte es ihm in die erkaltete Hand. Es war die Todesfeier des Adonis von Theokrit. Die schmerzflutenden Worte las sie leise:
Klage, Gesang, um Adonis; verblüht ist der schöne Adonis!
Wehe, verblüht ist Adonis! So klagen mit uns die Eroten.
Nicht auf Purpurgewand, o Kypria, schlummre ferner;
Gib dich schwarz umhüllt, Elendeste! Schlage die Brust dir
Heftig, und ruf, ruf allen: verblüht ist der schöne Adonis!
Und wie um gutzumachen, was sie schamvoll versäumt, drückte sie jetzt voll heiliger Inbrunst einen sanften Abschiedskuß auf die blasse Todesstirn.
Mit zuckendem Herzen hörte und sah der Kardinal die seltsamen Exequien. Er fühlte, wie sich in Tizianas Herzen das Bild des schönen Jünglings zum Seraph verklärte, und düster stieg aufs neue die quälende Ahnung in ihm auf, daß er von diesem Toten verdrängt worden wäre, wenn er weiter gelebt hätte. Nun stand er, der Kardinal, allein als werbender Mann. Aber der Totenschatten dieses Jünglings mußte sich störend zwischen ihn und sie stellen. Ihm war's gnädig vergönnt, als Lebender den Toten vergessen zu machen. Wie aber, wenn Marcello und er noch in der Vollkraft ihres Lebens vor ihr gestanden wären! Wie hättest du dich entschieden, Tiziana? Der Kardinal gab sich in eifersüchtiger Selbstqual die verzweifelte Antwort. Nun konnte er den Notmast für ihr Liebesschifflein bilden, durfte bescheidentlich den Mann ersetzen, der jetzt ihrer Wünsche heimlich Ziel gewesen war. Immer tiefer trieb der Zweifel seinen Stachel ins Herz.
Da schreckte Tiziana aus ihrem Klagegesang empor. »Dem Toten ward sein Recht,« sagte sie leise.
Der Kardinal schwieg. Aber dann wandte er sich um und schritt an das Totenbett. »Sein Bild liegt in mir verschlossen wie die Erinnerung an den Statuenleib des Dionys. Er war eine wunderbare Form, die den Schöpfer pries.«
»Und es war auch eine wundersame Seele darin.«
Der Kardinal schwieg.
Da fühlte sie einen leisen Trotz in sich aufsteigen, der ihrem Gefühl abermals eine Steigerung ins liebende Weh gab. »Seht doch, Kardinal, wie auf diesen toten Lippen noch ein wildes Jünglingsfeuer loht, das die römischen Mädchen wohl verbrannt hätte. Und seine Stirn ist so schön und heiter, wie sie im Leben war.«
Da befreite sich der Kardinal von seinem brennenden Weh, indem er leise und schwer sagte: »Wenn er lebte, er wäre Euer Gatte geworden.«
Tizianas Herz weitete sich zur letzten Befreiung. Mit hochklopfender Brust entsiegelte sie ihr Geheimnis dem Manne, der es noch immer nicht glauben wollte, daß er im innern Kampf der Herzen Sieger geworden war. »Kardinal! Vor dieser Jünglingsleiche hört es: Wäre er noch am Leben, ich hätte ihn nicht gewählt.«
»Tiziana!« So tönt der Schrei des Hirsches in der Herbstnacht.
Und das Haupt der qualbefreiten Frau fällt in ihre Hände, das schwarze Gewoge der Locken löst sich, eine Spange mit einem blitzenden Korund fällt herab, und über Schultern und Nacken ergießt sich die schwarze Flut.
Aber des Kardinals innrer Jubel bricht plötzlich ab.
Bestürzt blickt Tiziana den verwandelten Mann an. »Kardinal –?«
»Donna Tiziana – schlagt meinen Zweifel in Stücke,« preßt es sich aus seiner verquälten Brust.
»Nennt ihn!« Sie liegt mit vorgeschnelltem Leib da, lauernd, herzbangend.
»Ob Ihr nicht jetzt nur so gewählt, wo keine Wahl mehr blieb –«
Da geht ein Erkalten über ihr Antlitz, über ihre Seele. Und ihre Hände fallen herab, ihre Knie zittern, der beleidigte Stolz bricht in ein herzerschütterndes Schluchzen aus.
Der Kardinal reißt sie empor, schleudert die Arme über ihrem Nacken zusammen, und in der eisernen Klammer liegt wehrlos der süße Leib. Liebe und Weh verstümmeln sich in dem Namen: Tiziana!
Und die so qualvoll geliebte Frau löst sich langsam aus den Armen des ebenso qualvoll geliebten Mannes. Dann gibt sie sich selbst dem gemeinen Leben zurück. »Der Morgen weht kalt heran.«
Der Kardinal richtet sich auf. »Wir wollen die Totenmesse lesen,« sagt er mit fremder Stimme.
Wortlos schreiten sie zur Schloßkapelle hinab. Ihre Herzen bluten.
 Cesare Borgia hatte diesmal kein Glück. Als seine zerstreuten Truppen sich den Colonnaburgen näherten, kam von seinem Oberbefehlshaber in der Romagna, dem grimmigen Vitellozzo Vitelli, die dringende Bitte um Verstärkung der Truppen vor Faenza, da eine Seuche im Lager viel Unheil angerichtet hatte. Und der Herzog mußte das Nebenziel, die Vernichtung der Colonna, um des Hauptzieles wegen aufgeben. Er beorderte die Haufen, die schon knapp vor Genazzano, Palestrina und San Marino standen, zurück und ließ sie noch am selben Tage nach Norden ziehen. Er fluchte seinem Stern. Nun lag ja der Plan, die widerspenstigen Colonna auszurotten, klar am Tage. Aber der geniale Ränkeschmied tröstete sich bald. Als vollständiger Herr der Romagna hatte er zu einem spätern Zeitpunkt um so leichteres Spiel mit dem stolzen Geschlecht.
Cesare Borgia hatte diesmal kein Glück. Als seine zerstreuten Truppen sich den Colonnaburgen näherten, kam von seinem Oberbefehlshaber in der Romagna, dem grimmigen Vitellozzo Vitelli, die dringende Bitte um Verstärkung der Truppen vor Faenza, da eine Seuche im Lager viel Unheil angerichtet hatte. Und der Herzog mußte das Nebenziel, die Vernichtung der Colonna, um des Hauptzieles wegen aufgeben. Er beorderte die Haufen, die schon knapp vor Genazzano, Palestrina und San Marino standen, zurück und ließ sie noch am selben Tage nach Norden ziehen. Er fluchte seinem Stern. Nun lag ja der Plan, die widerspenstigen Colonna auszurotten, klar am Tage. Aber der geniale Ränkeschmied tröstete sich bald. Als vollständiger Herr der Romagna hatte er zu einem spätern Zeitpunkt um so leichteres Spiel mit dem stolzen Geschlecht.
Die Colonna aber waren Stümper gewesen. Sie ließen sich einschüchtern. Der zufällige Tod zweier Edlen aus ihrem Geschlecht, die bei einem Gastmahl in Genazzano an einem Tage anscheinend durch eine Vergiftung umkamen, brachte Bestürzung in ihre Reihen. Die Fehde mit dem Orsini hatte für sie allen Reiz verloren. Sie sagten den verbündeten Savelli alle Kampfbereitschaft für die nächste Zeit auf. Und die Savelli selbst gaben es auf, Monterotondo zu bestürmen, da derjenige, um dessentwillen sie sich zusammengeschart hatten, auf der Walstatt liegengeblieben war. Die Edlen des Geschlechts sahen nicht ein, daß sie sich dem alten Rinaldo de' Calvi zuliebe die Knochen zerschlagen lassen sollten. Der Alte mochte sich selbst um seine Tochter raufen. Dieser aber hielt jetzt seine Sache für verloren, da die Orsini als Sieger hervorgegangen waren. Das ungeratene Kind sollte für immer aus Herz und Haus verstoßen sein.
Cesare Borgia rüstete zur Abreise in die Romagna. Im Vatikan überstürzten sich die Nachrichten. Das Vorzimmer beim Herzog Valentino war tagsüber erfüllt von Eilboten, Abgesandten und Führern.
Cesares Sekretär Agapito war in Schweiß gebadet. Es gab viel Arbeit. Lukrezia Borgia sollte morgen nach Nepi reisen, begleitet von sechshundert Reitern. Dafür mußte er Dispositionen treffen.
Die Herzogin war durchaus nicht gesonnen, sich die erwünschte Einsamkeit des düstern Campagnaschlosses durch allerhand Hoffeste, wie es der Papst wollte, verunstalten zu lassen. Die Trauer um den schönen Gemahl warf ihr Gemüt ganz in Entsagungsgedanken. Sie freute sich auf die graue Verlorenheit des etruskischen Felsenkastells am Rio Falisco, das Alexander eigens für sie durch seinen Architekten Sangallo hatte umbauen lassen. Dort konnte sie in dem zerrißnen vulkanischen Geklüft der Berge, beim brausenden Klang der Wildwasser oder auf den weiten Triften des Hochlands beim schwermütigen Ton der Zampogna ihren dunklen Gedanken nachhängen und sich mit zusammengepreßtem Herzen auf die ferrarische Hochzeit freuen. Aber sie hatte auch ihr Kind ganz allein, ihren kleinen Rodrigo, der zum Herzog von Sermoneta ernannt worden war.
Cesare wollte sie noch einmal besuchen. Aber er war bei seinem schwarzen Erlentisch mit Arbeiten überhäuft. Der Mord an seinem Schwager belastete sein Gewissen nicht mehr. Der Ehrgeiz erdrückte alle Reuegedanken. Es galt jetzt, Truppen zu erschaffen und sie nach der Romagna zu leiten.
»König Ludwig verweigert uns seine Kontingente,« klagte er seinem Sekretär. »Auf diese Weise werden wir Bologna nie in unsere Hände bekommen. Ist Ortolani noch nicht von dort zurück?«
Agapito schüttelte das Haupt. »Vielleicht haben ihn die Reiter der unruhigen Barone aufgefangen.«
»Die Barone!« Das war eine vergessene Kleinigkeit. Aber sie machte jetzt sein Auge leuchten. Er dachte an den Kardinal Orsini. Der hielt wohl jetzt sein Liebchen fester denn je in seinen Armen. Und Cesare sah im Geiste das Bild seines mißglückten Abenteuers im Borgiapalast erstehen. Er witterte Sinnenluft, roch den Parfüm eines schönen Weibes und sah bloße Schultern, herrlich quellende Brüste ... Er schüttelte die Vision ab. In den großen Raubzuggedanken der Romagna paßte die Kleinigkeit einer Tiziana de' Calvi nicht hinein. Die konnte warten, bis die Romagna zu seinen Füßen lag. Dann konnte er vielleicht mit einem kleinen Länderstrich als Liebesgabe vor die schöne Geliebte des Kardinals hintreten. Und sollte sie die Narrheit so weit treiben, den Kardinal noch immer begehrenswerter zu finden als den Herzog der Romagna, dann – Cesare verschluckte den Gedanken, der würdig war, unter dieser Schädeldecke geboren worden zu sein.
Ein Hauptmann stand auf der Schwelle, erschöpft vom Ritt und verstaubt. »Endlich, Ortolani, endlich! Deine Augen haben keine Glut, deine Züge hat die Hölle gestempelt. Du bringst schlechte Nachricht aus Bologna.«
Der gebräunte Kriegsmann ließ sich in einen Stuhl fallen und kreuzte die Hände über dem Degen. »Verflucht seien die Bentivogli!« knirschte er.
»Sie wollen Bologna nicht –?«
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Wollen's nicht hergeben. Und zudem sind sie auf unsere Verschwörung mit den Marascotti gekommen. Es war alles im besten Gang, die Bentivogli sollten schon die Hölle offen sehen, aber der alte Giovanni bekommt Wind, läßt die Tore besetzen, den Palast der Marascotti umzingeln, die Häupter herausschleifen und in diesem Augenblick –«
»Sprich's aus!«
»Könnte eine zweite Salome die Köpfe der Marascotti dem Herodes auf einigen Schüsseln darreichen.«
Cesare Borgia war blaß geworden. Aber im nächsten Augenblick fegte er über seinen eigenen Grimm hinweg: »Es ist gut so. Ist Pesaro noch nicht geflohen?«
»Er scheint sich auf einen Widerstand vorzubereiten.«
»Gut, gut. Und Bologna – hm –« Immer wieder mußte er die Wut ersticken. »Wir wollen die Bentivogli – zu Freunden machen und uns mit ihnen auf Florenz stürzen, das jetzt seine Macht vor Pisa konzentriert hat. Wirf dich aufs Roß, Ortolani –«
»Eure Herrlichkeit – darf ich nicht zuvor einen Tag ruhen, ich bin –«
»Ich arbeite in der Nacht,« sagte Cesare mit grausamer Schärfe. »Wollen meine Hauptleute in der Nacht schlafen? Deine Frage verdient einen Faustschlag. Laß dir Wein geben und dann komm wieder her. Mach' weiter.« Er stieß ihn mit den Blicken zur Tür hinaus.
Gleich darauf schrieb der Herzog einen Brief an seine in Spanien weilende Frau, kalte, aber stilistisch fein gemeißelte Worte, die erst wärmer wurden, als er seinem kleinen Töchterchen Luise, das er noch nie gesehen, eine Kußhand schickte. Mitten im Briefe korrigierte er einen Belagerungsplan des Vitellozzo Vitelli und zeichnete auf einer Karte von Florenz Trancheen zur Einschließung der Stadt. Dann warf er ein paar Zeilen auf ein duftendes Billett und ließ es an die schöne Witwe Emilia Sarazzeni befördern. »Wie heißt der feine Künstler aus der Schule des Verrocchio?« fragte er dann unvermittelt.
»Lorenzo di Credi?« forschte Agapito.
»Nein, anders. Der unter dem Herzog von Mailand arbeitete und jetzt in Florenz ist.«
»Ach, Leonardo da Vinci.«
»Er soll Maler, Bildhauer, Mechaniker, Kriegsingenieur, Baumeister und Dichter sein. Der Mann nötigt mir Respekt ab. Macht ihm einen Antrag, in meine Dienste zu treten. Vielseitige Talente schätze ich höher als ausgeprägte einseitige, wie dieser Bramante eines ist. Vielleicht kann uns Leonardo vor Faenza die Stellungen verstärken helfen.«
Agapito merkte sich den Namen vor.
»Bei Gott, dieses Italien ist ein saftiger Nährboden für große Talente. Und wie würden sie erst ausgenützt werden, wenn ein Fürst seinen Hof zum Sammelpunkt der Geister machen würde. Federigo von Urbino hat's versucht, die Herzoge von Mantua und Ferrara eifern ihm nach, aber sie erziehen ihre Künstler zur Unselbständigkeit. Die Jungen sollen an mich glauben.«
Er warf im nächsten Augenblick, während Agapito die Boten im Vorzimmer abfertigte, ein paar Verse aufs Papier, die die Staatskunst feierten.
Er ließ die Abgesandten seiner Kondottieri eintreten. Hinter ihnen wartete schon eine Deputation junger Klarissinnen, welche ihm zu danken kamen für ein Heiligenbild, das er ihrem Kloster geschenkt als Dank für die nächtliche Umarmung der reizendsten Schwester Bertalda. Das Bild sollte eine Sühne für seine und ihre Sünde sein. Die drei Nonnen der Deputation, eigens von der Priorin ausgesuchte schöne Schwestern, zitterten in den Knien; sie wußten, daß eine von ihnen oder gar alle drei der herzoglichen Gnade zum Opfer fallen würden.
Als eben die Sprecherin in schauspielerischer Demut ihren Dank stammeln wollte, meldete ein Kammerdiener, daß ein junger Panther und eine Löwin in einem Doppelkäfig zum Kampf bereit wären. Cesare hatte das Schauspiel für sich bestellt. Er wollte prüfen, ob die beiden Bestien einander zerreißen oder ob sie sich begatten würden. Und mit einer liebenswürdigen Handbewegung lud er die Nonnen und die Kondottierensendlinge ein, ihm als Zuseher zu folgen. Er warf den roten Samtmantel über die prallgeschwellten Glieder und schritt den zitternden Mägden der heiligen Klara voran. Der unersättliche Lüstling war auch unerschöpflich in der Erfindung erotischer Geschmacklosigkeiten. Sein Laster schändete den Adel seines Geistes. Er dachte bald daran, alles Weibliche auf einmal in einer wilden Sinnesorgie zu genießen, Tier- und Menschenleib. Er entgötterte die Menschenbrust und hing mit dem Menschentum nur mehr durch den Verstand zusammen; das Herz trieb ihn ins grauenvolle Meer der Vertiertheit hinaus. Und die Welt um ihn erschauerte bereits vor der Möglichkeit, es gäbe keinen Gott, der ihn bestrafte.
*
Über die Siebenhügelstadt rast die Windsbraut dahin. Sie stürzt sich auf die himmelragenden Säulen und Obelisken, Schornsteine, Pinien, Zypressen und Eichen und heult ihnen ihr wildes Lied in die Seele. Ins Unbewegliche kommt Bewegung. Alles ächzt unter dem Rasen des Wildfangs. In den Dächern splittert und kracht es. Es ist, als sausten Geister des Pandämoniums durch die Luft.
Ganz Rom liegt in Angst und Entsetzen zur selben Zeit, da Cesare mit seinen Nonnen und Hauptleuten den Zwinger betritt, um die Tafel der Wollust mit neuen Gerichten zu bereichern.
Von dem Ruinenwerk der alten Tempel fliegen die Steine wie Wurfgeschosse unsichtbarer Zyklopen herab, scheue Pferde durchjagen die Straßen, Menschen fallen unter ihren Hufen, über Kinderleichen stürzen sich wahnsinnig gewordne Mütter. Kam der Zahltag für die Buhldirne Rom?
Der Abend bricht mit einem schwefelfahlen Licht herein.
In den Kirchen und Klöstern liegen die Gläubigen auf den Knien, zusammengepfercht in betenden Massen. Wenn der Sturm in den Mauern zittert, zittert auch das klumpige Heer der Verzweifelten. Vergebens versuchen die Soldaten des Governatore die Massen zu bewegen, die gefährdeten Kirchen zu verlassen. Die Pilger fühlen sich unter Gottes Hut sicher und drängen sich in gemeinsamer Not zusammen.
Durch Rom wirbelt das Gerücht, daß eine fromme alte Nonne, die seit langem im Vatikan in einer Klause eingemauert lebt, vor drei Tagen für den heutigen Tag ein furchtbares Unglück prophezeit hat. Die heilige Stadt würde erzittern unter Gottes Schlägen, aber der Papst sollte unversehrt aus dem Unheil hervorgehen. Und nun zittert Rom.
Aber der Papst zittert doch mit. Er läßt sich, während das Unwetter tobt, in den Saal der Päpste führen und auf den Thronsessel geleiten, den ein blauseidner, goldgestickter Baldachin umspannt. Dort versenkt er seinen Geist in Gebete und düstre Gedanken. Der Datar Ferrari und der Kammerherr Gaspari stehen neben ihm und beten Litaneien. Lorenzo Chigi, der Bruder des berühmten Bankherrn Agosto, steht ehrfürchtig vor ihm. Alexander hat ihn kommen lassen, um Wechselgeschäfte mit ihm zu besprechen. Mitten in seine Gebetsbrocken fallen die Gedanken der Habsucht. Wenn Alexander einen Psalm beendet hat, wirft er seine unruhigen Blicke in die Zinsentabelle, die ihm Lorenzo Chigi gereicht. Ein kräftiger Sturmstoß läßt ihn mitten in der Berechnung zusammenzucken.
»Kammerherr Gaspari!« sagt der Papst erschrocken. »Fahrt fort mit der Geschichte des Papstes Johann XXI.« Alexander ist kreidebleich geworden.
Gaspari nimmt den Folianten zur Hand. Dann liest er monoton wie die Epistel bei der Messe die Stelle: »Der Papst war der Wissenschaft sehr ergeben. Seine Gelehrsamkeit erregte sogar das Mißfallen des Volkes, welches den heiligen Vater heimlich mit magischen Kräften ausgestattet glaubte und ihn mit der schwarzen Kunst in Verbindung brachte. Eigentümlich war sein Tod. Er wurde in Viterbo von einer herabfallenden Decke erschlagen.«
Der Papst erblich neuerdings. Der milde Johann erschlagen durch den Zorn Gottes! bebte es durch sein Gemüt. Bin ich böse vor deinen Augen, mein Herr und Gott? Kann ich bestehen mit den Zielen, die sich mein Ehrgeiz gesteckt? Was rinnt mein Blut so zaghaft durch den Leib, wenn ich gute Taten um mich sehe? Warum fesselt mich nicht der Glanz der Tugend? Was zittert jetzt mein Gebein, da der Wind durch die Mauern fährt? »He, Gaspari – wie war das mit dem großen Unglück unter Papst Klemens V.?«
Der Kammerherr blätterte wieder in dem Folianten. »Bei der Krönungsprozession erschrak des Papstes Pferd auf dem Ritt nach dem Lateran infolge einer einstürzenden Mauer. Er wurde vom Roß geworfen, die Tiara rollte in den Staub, ihr prachtvollster Schmuck, ein herrlicher Karfunkel, war spurlos verschwunden. Die herabgefallene Mauer hatte zwölf Barone seines Gefolges getötet, darunter den Herzog der Bretagne.«
Der Papst fuhr empor, von einer seltsamen Unruhe gepeinigt. »Genug der Geschichten. Betet die Nonne für mich?« Er schrie den Datar an.
»Unaufhörlich.«
»Sie betet nicht!« bebte die Angst aus des Papstes Brust. »Niemand betet für mich. Sie werfen ihren Haß in ihre Gebete. Ganz Rom wirft seinen Haß hinein. Was hab' ich ihnen getan? Ich habe über ihren Kopf weg für Roms ehrwürdige Größe gesorgt. Ferrari, mein lieber guter Ferrari, ist es nicht so?«
»Es ist so,« tremolierte der häßliche, schiefrückige Datar.
»Aber sie wollen noch mehr, mehr. So gebt ihnen mehr! Gebt dem Volke, was es will, nur beten soll es für mich. Ich brauche ein Schloß von Gebeten für meine Untaten –« Es entschlüpfte ihm in heilloser Angst, und er schauerte vor der Wahrheit zusammen. »Laßt morgen die besten Vögel schießen und gebt sie dem Volke! Füllt ihre Schüsseln mit Gebackenem, gebt den ärmsten Leuten Anweisungen auf Fett und Brot, gebt ihnen Kleider, Spiele, Lasttiere, daß sie geringer zu tragen haben, baut ihnen Kähne, daß sie des Sonntags auf dem Tiber fischen können, gebt ihnen, was sie wollen – nur beten sollen sie für mich. Aber sie wollen in Wahrheit meine Macht stürzen, sie wollen den Vikar Gottes beseitigen, ihm die Schlüssel des Segens und des Verderbens aus den Händen reißen. Gebt den Pilgern den Auftrag, sich zu sammeln – zu beten –« Mit angstverzerrtem Gesicht riß er an seinem Kleid herum. Verwirrt jagten einander die Gedanken. Und nun fuhr er den Lorenzo Chigi an: »Verweser des Mammons, ich will Euer Geld nicht. Der Schweiß der Edelsten klebt daran.« Dann hüpfte er auf seinem Thron herum und grinste den Kammerherrn Gaspari an: »Trefflicher Geschichtenerzähler, wie starb Augustus? Klatschet Beifall, wenn Euch die Komödie gefallen! Werden die Römer Beifall klatschen zum Finale des Alexander Borgia? Ich habe die Komödie zur Zufriedenheit meines Hauses gespielt, aber Gott und das Volk –« Er fröstelte wieder zusammen. »O, ich will wie dieser Augustus Gott um einen sanften Tod bitten, daß er mich dahinnimmt in friedlicher Euthanasie – nur jetzt nicht, grollender Himmel, sende deine Donner auf mein Haupt – Gaspari, bring' mir doch einen Spiegel – ich will sehen, ob es wahr ist, daß auf meinem Gesicht Satan seine Fratze gezeichnet, wie's der Pasquino behauptet – einen Spie ...«
Dumpfes, orkanartiges Brausen bricht seinen Jammer entzwei. Der Vatikan zittert in allen Fugen. Krachen – Splittern – aufheulender Sturm – – – –
Gleich darauf fliegt es durch ganz Rom: der Papst ist tot! Durch einen eingestürzten Kamin erschlagen!
Das Volk heult und weint vor Freude. Der Papst tot! Seine Sünden zu erschlagen, mußte ein ganzer Kamin einstürzen! Ein Hammer hätte es nicht getan. Ungeheure Gerüchte wälzen sich durch die Stadt. Siebzehn Teufel seien in schweflichter Lohe um die Zimmer des Papstes tanzend gesehen worden. Auch in Gestalt von häßlichen Affen und Hunden rase die Hölle um den Vatikan. Die Windsbraut sause als Teufelsbraut um die Schornsteine des Borgo, wo die Paläste der Kardinäle in den Grundfesten zittern. Der Tiber habe einen grünbleichen Glanz bekommen und aus seinem Grund sprängen unheimliche Flämmchen an die Oberfläche, das Wasser aber steige unaufhörlich. In dem Palast der Giulia Farnese sei alles in purpurne Seide gehüllt und man sehe keine Möbel und Fenster mehr vor lauter rotseidenen Wellen, die in fortwährender Bewegung seien wie eine dickflüssige Lava. In allen Burgen des Papstes sei gleichzeitig mit dem Einsturz des Kamins ein furchtbarer Blitz in die Haupttürme gefahren. So trieb die Volksphantasie ihre wunderlichen Schreckensblüten.
In den finstern Gassen stauten sich die Menschenknäuel. Papstsoldaten trieben die Leute im Borgo auseinander. Aus den lichtschimmernden Toren der Kirchen wälzten sich die Ströme der Pilger hinaus in die Nacht. Viele Leute wurden erdrückt und totgetreten.
Da kam eine Botschaft aus dem Vatikan geflogen, die allen Jubel erstickte.
Der Papst lebt!
Herolde sprengten durch die Gassen: der Papst lebt!
Der Sturm hatte einen Rauchfang des Daches im Vatikan niedergerissen, die fallende Last zertrümmerte das oberste Geschoß, fiel durch die Decke des Saales der Päpste, und der einstürzende Trümmerhaufe begrub den Papst, doch ohne ihn zu töten. Dagegen lag Lorenzo Chigi tot und starr unter den Ziegelmassen. Ferrari und Gaspari hatten sich durch einen Sprung ans Fenster gerettet. Als man den Papst unter den Trümmern hervorzog, bemerkte man zwei Wunden auf dem Kopf. Aber er atmete.
Und er kam zu sich. Und er deutete den Fingerzeig Gottes dahin, daß ihm noch Zeit gegeben sei, sich zu bessern. Als er den toten Chigi sah, weinte er heftig.
Der Himmel begnadete Alexander wunderbar und der Papst rechnete es sich freventlich als sein Verdienst an. Die Römer wurden in ihren Köpfen irre. Die Papstsöldner sahen nur Mienen des Hasses, der Enttäuschung und Niedergeschlagenheit, als sie die Kunde durch die Straßen riefen: der Papst lebt. Und die Freudenschüsse aus den Kanonen der Engelsburg klangen an der Römer Ohr wie drohende Donner, die neue Unwetter ankündigten.
Um Mitternacht legte sich der Höllengraus. Die Nacht wurde hell und klar und ließ ihr friedliches Leuchten aus dem dunklen Grund. Gebändigt rauschte der Tiber an den finstern Mauern der Engelsburg vorbei. Dort saß die stolze Katharina Sforza. Sie hatte im Sturmwüten auf den Knien gelegen und des Papstes Tod, des Cesare Borgia Höllenfahrt erfleht. Der Himmel war erbarmungslos. Alexander war unversehrt, Cesare lag wollustverseufzt in den lilienweißen Armen einer provenzalischen Dirne. Mit unergründlicher Weisheit deckte Gott die Sünden seiner fürchterlichen Reichsverweser zu.
 Auf Monterotondo herrschte Selbstqual und Seeleneinsamkeit. Tiziana war frei. Kein sinnengieriger Bräutigam verfolgte sie mehr. Aber in ihr war Blütensterben und Freudelosigkeit.
Auf Monterotondo herrschte Selbstqual und Seeleneinsamkeit. Tiziana war frei. Kein sinnengieriger Bräutigam verfolgte sie mehr. Aber in ihr war Blütensterben und Freudelosigkeit.
Nimmer konnte sie ungeschehen machen, was ihr Herz verschuldet. Der Zweifel lag wie ein unzerreißbarer Anker in der Seele des stolzen Kardinals. Ihn zu lockern, zu lösen, war ihr einfaches »Ja, ich liebe dich!« nicht mehr stark genug.
Also mußte sie wohl fort von hier. Und bald mußte es geschehen. Hinter dem Rücken des süßen Peinigers. Schon rötelte der Herbst im Land, die kalten Nächte waren für eine Flucht nicht mehr günstig. Äolus blies den Hauch seiner kühlen Lungen über Tuskien. Als Tramontana strich er über die verdorrten braunen Gräser und über die Tufffelsen. Die Burgmauern lagen schon unter dem schwachen Schein einer sterbenden Sonne und in den Eichen unten zitterte angstvoll das sommermüde Laub.
Der Kardinal ließ an einem solch sonnenmatten Tag Tiziana in den Bibliotheksaal bitten, der noch nicht in Ordnung gebracht worden war. Er hatte die letzten Tage ein Alleinsein mit der geliebten Frau ängstlich vermieden. Eigenwillig, seine großen Tugenden verleugnend, lebte er die Stunden bei halber Arbeit dahin, gestört von den uneingestandenen Unlustgefühlen.
Und nun stand sie vor ihm. Auch über ihr Wesen hatten sich die Netze des erschütterten Gemüts geworfen. Herb waren die schönen Lippen geschlossen, und über den Augen lagen graue, böse Schleier.
Giambattista war von Stößen Büchern und Schriften umstellt, die einst seine Welt ausgemacht hatten. Aber seit das lebendige Buch dieses Weibes zu ihm gesprochen, hatten sie alle ihre tröstenden Kräfte eingebüßt. Auch die antiken Funde, Inschriften, Gemmen, Münzen und Statuen lagen und standen als unnütze Dinge überall umher. Die ordnende Hand fehlte. Ein neuer Christus, als Meister seine Jünger belehrend, hing als Temperabild zwischen den Fenstern. Giambattista wollte keinen Sterbenden in seiner Nähe haben. Auch die Heiligen hatte er verbannt, denn sie erinnerten ihn zu sehr an die politheistische Weise Griechenlands, und weil das klügere Volk seine Götterlieblinge anmutiger darzustellen wußte, gönnte ihnen der Kardinal mehr Platz in seinen Räumen als den etwas langweilig dreinblickenden Heiligen. Aber heute blickten sie düster inmitten der dogmatischen Schriftstöße auf die beiden Menschen herab, die ihre Liebe gegenseitig verschließen wollten.
Da versuchte der Kardinal den Bann zu brechen. »Wollt Ihr mir nicht wieder bei der Arbeit helfen?« fragte er mit Angst in der Stimme.
»Wenn ich Euch nicht kränke, möchte ich bitten, mich von der Mitarbeit befreien zu wollen. Ich habe überhaupt die Absicht –« Sie stockte. Die verwirrten Augen fingen die Blicke des lehrenden Christus auf. Aber sie gaben ihr weder Mut noch Trost.
»Redet ungescheut, ich werde alles ertragen.«
»Es ist so viel über uns beide gekommen, Kardinal. Wir müssen endlich den Mut haben, dieses alles zu bewältigen. Marcello ruht in der Gruft des Schlosses. Ich komme eben von seinem Sarge. Aus diesem herben Tod, für mich erlitten, weht ein kalter Hauch auf mein Leben, der es nimmer froh machen will.«
»Ich verstehe. Die Luft hier wird Euch zu drückend durch die Erinnerung an ihn,« sagte der Kardinal leise. Und vorsichtig streiften seine Blicke ihre Gestalt. O, welche Schönheit war hier frommen, künstlerischen Augen geschenkt. Die Chariten schienen alle Gaben des Olymps auf sie gestreut zu haben. Das dunkle, halb vertrotzte Auge hatte heute einen ockerfarbigen Schimmer und dabei doch eine tiefe Klarheit, ihre Gestalt war hoheitsvoll, ihr Wuchs zypressenschlank und ihre Glieder von griechischer Meißelung und zart gebildet. Und gerade jetzt, da sie im Begriffe war, sich der Fesseln zu entziehen, die er liebend um ihre Seele gelegt, kam ihm auch der sittliche und geistige Wert ihres Wesens so recht zum Bewußtsein. Er dachte an ihre treffenden Urteile in Dingen der Religion, Philosophie und Kunst, an ihren feinen Geschmack, an ihre scharfsinnigen Betrachtungen, an ihre Besonnenheit und Güte, an ihre Hilfsbereitschaft, die ihr alle Herzen im Umkreis der Burg gewonnen hatte, und an ihr häusliches Walten. So waren Herz, Gemüt und Geist in diesem Weibe in harmonischer Geschlossenheit zum wunderbaren Inhalt einer ebenso harmonisch durchgebildeten Form geworden.
»Nach allem, was geschehen, habe ich keine Macht mehr, Euch zu halten,« sagte der Kardinal mit selbstquälerischer Gelassenheit.
»Ich bin Euch zu ewigem Dank verpflichtet,« erwiderte sie mit gleicher Gedrücktheit. »Euer Zweikampf befreite mich von meinem Peiniger.«
Da zuckte der Kardinal zusammen. »Ja, ja – von Euerm Peiniger.« Er zog die Brauen zusammen und sein Auge wurde zum Spiegel unruhiger Gedanken. »Ihr scheint Euer Dasein nicht mehr hoch zu werten, da Ihr es leichtsinnig den Mächten preisgebt, die Euch noch umdrohen.«
Sie verstand und senkte das Haupt.
»Eure Freiheit, Eure Kostbarkeit, Euer Reiz werden in Bälde zur Freibeute eines noch größern Feindes werden, wenn Ihr nicht bald einen sichern Hafen erreicht.«
Dunkle Wimpern schlugen über dunklen Sternen zusammen. »Eben deshalb – will ich die Freistatt des Klosters aufsuchen.«
»Und Ihr glaubt hinter Klostermauern sicher zu sein vor den höllenüberwindenden Gewalten Cesare Borgias?«
Sie nickte stumm. Das verflammte Antlitz zeugte von ihrem Selbstbetrug. Dann nahm sie alle ihre Kraft zusammen und bat innig: »Nur eines noch. Gebt meinem Entschluß Euern priesterlichen Segen.«
Der Kardinal legte die Hand auf ihr Haupt und sprach tief bewegt: »Segnen heißt, die eignen Kräfte auf einen andern übertragen. Glaubt Ihr, Donna Tiziana, daß gute Kräfte in mir walten?«
»Ja,« hauchte sie kaum hörbar.
»Dann segne ich Euch aus der Tiefe meines Herzens und flehe des Himmels Heil auf Euern Weg.« Da verließ ihn die Festigkeit. Er warf sich in ein Polstergestühl und drückte den Kopf in seine Hände.
»Was ist Euch?« fragte Tiziana mit sturmdurchbrauster Seele.
»Das Gleichmaß meiner Tage ist gestört, die Ruhe meiner Arbeit für immer dahin.« Er sprang leidenschaftlich auf und ging mit großen Schritten durchs Zimmer. »Ich möchte mir selbst entfliehen und den alten Kardinal Giambattista suchen, der seines Gottes so sicher war und mit seinem Weisheitsstolz, seiner eingebildeten Lebensklugheit und seiner Festigkeit prahlte. Mein Blut hat einen andern Lauf bekommen; einst floß es, vom Rhythmus sanfter Gedanken bewegt, ruhig durch meine Adern, jetzt rauscht es wie ein beängstigender Strom durch meinen Leib, als suchte es Damme zu zerreißen. Kein traumloser Schlaf erquickt mich mehr, das Herz, einst von der Gewißheit edler Tugend hell besonnt, zuckt schmerzlich zusammen, denn die Leidenschaft wirft häßliche Flecken darauf. O, dieser Kardinal sehnt sich nach Schwerthieb und raschen Taten, die die Sinne betäuben. Ich fürchte mich vor mir selbst, fürchte mich vor der Stille der Nacht, die einst mich Suchenden zwang, an den Geheimnissen Gottes zu rühren, ich fürchte mich vor der Helle des Tages und fürchte mich – vor Euch, Tiziana. Ja, ja, es wird gut sein, wenn Ihr geht!« Das glühende Leid sprang und tropfte aus seiner Seele.
»Kardinal, Ihr seid krank,« sagte Tiziana mit erschreckten Augen.
»Und es ist so der Lauf der Welt, daß die Kranken und Elenden zugleich die Verlassensten sind. Das Gesunde flieht sie. Ja, krank bin ich, frierend und brennend zugleich, entzückt und verzweifelt taumelt meine Seele, aus Wonnen in Schmerzen fallend, weiß sie ihren Gott nicht mehr zu finden. Was ist das alles? Warum zerbricht alles in mir? Sind nur für mich die Bronnen der heiligsten Schrift versiegt? Warum stärkt mich Platos Geist nicht mehr? Warum verjüngt mich nicht mehr Anakreons froher Sang? Auf meinem Herzen liegt ein Grabstein, schwer wie ein Atlasgewicht, er deckt das Grab meiner Liebe – o Donna Tiziana! –« Die aufwirbelnde Leidenschaft schleuderte den Priester des Herrn zu ihren Füßen hin. Und sein schönes, stolzes Haupt taumelte in ihre Madonnenhände hinein und seine Lippen sogen sich in Glut an den zarten Fingern fest, als wollten sie ihr das Leben aus dem geliebten Blut trinken.
Tiziana stand in Brand und Not. Ihr Leid brach unter der Augenblicksgewalt zusammen. Triumphierend rauschte das sinnliche Blut, der Quell der lebendigen Natur, über die nagenden Gedanken hinweg, die Liebe pflanzte das Siegesbanner auf dem Altar ihres Herzens auf, und ein frohlockender Ruf, aus zyprischen Landen kommend, klang in ihre Aufgelöstheit hinein. Ihr herrlicher Leib schnellte hinab zu dem Knienden und ihre reine Liebe drückte den erlösenden Kuß, Aphroditens seliges Sakrament, auf seinen Scheitel. Da sprang er empor und riß sie mit gewaltigen Händen an sich. Der ganze sanfte Kardinal brannte lichterloh, und in seinen Armen fieberte das süße Weib und wehrte sich nicht mehr gegen die Glut der Küsse, die ihre schwellenden Lippen aussogen. Auf dem weichen Pfühl, das unter dem Bilde einer schmachtenden Alkyone in altrömischer Teppichpracht prangte, zog er den fraulichsüßen Leib an sich und mit dem Feuer eines liebenden Jünglings küßte er ihr Lippen, Augen, Haare, Nacken und Schultern, bis sich seine Küsse in ein ohnmächtiges Stammeln verloren. Dann begann die Leidenschaft glühende Worte zu formen und nur mählich gewannen die Gedanken Macht über die aufgeregten Sinne. Während Tiziana in die rauschende Verzücktheit der Hingabe an den geliebten Mann versank, fluteten die Wonnelaute der Liebe über ihr Herz hin: »Einzige du – um die ich mit verzweifelter Seele gekämpft –«
»Geliebter!« rauschte ihr Blut in den süßen Klang hinein.
»Und nun bist du mein –«
»Dein!«
»Rosen sollen dich umglühen fortan, wo deine Seele von Dornen umrankt war.« Und er nahm ihr Haar kosend in seine Hände. Mit geschloßnen Augen lag sein Antlitz in der schwarzen Seidenflut ihres Hauptes und ihm war, als strömten Hauche aus seraphischen Höhen durch seine Sinne. Seine ganzen armseligen, so hoch bewerteten Sittlichkeitskräfte stürzten zusammen unter dem Anprall der neuen Gewalten. Langsam nur lösten sich die Empfindungen in Worte auf. »Was für ein Wunder kommt über uns? Erstickt sind sie alle, die wehrenden Kräfte in uns! Geöffnet ist der heilige Quell der Erkenntnis des Herzens, und rein und gnadenvoll fließen seine Wasser auf den Grund unsrer Seelen. O, wie wehrtest du dich, wie wappnete ich mich gegen die Pfeile des göttlichen Knaben, und dennoch trafen sie und schufen glühende Wunden. Nun tagt es in unsre selbstgeschaffne Dämmerung hinein. Liebe, Liebe, Liebe! jauchzt es wie Frühlingsvogelsang an allen Ecken und Enden der Welt! Tiziana, willst du die meine sein?«
In Scham und Verwirrung löste sich der Zweifel aus ihrer Brust. »Wie kann ich's, Geliebter? Der Purpur legt sich zwischen mich und dich.«
Der Kardinal riß ihre Hände an seiner Brust empor. »Und wenn ich ihn von mir werfe?«
»Nimmermehr!« schnellte sie in die Höhe. »Er ist geheiligt durch deine Person, durch deine Würde als Glaubensstreiter des Herrn. Ganz Rom blickt auf dich als den einzigen Kardinal, der seines Amtes in Ehren waltet. Die Orsini sollen nicht durch eine Calvi um den Glanz eines Namens gebracht werden, der seine Strahlen weithin sendet und vor dessen kirchlichem Ruhm sich alle Fürsten neigen. Und du wolltest nun treulos das Kleid von dir werfen, das deinem Wesen die äußerliche Weihe gab?«
Der Kardinal zog ihr schönes Haupt mit den schmollenden Lippen an sich. »Du sollst mich nicht lau und treulos schelten. Mein nächstes Ziel will ich vor Papst und Konzilium mit dem liebendsten Eifer verfechten und Menschlichkeit und Sittlichkeit und des Herrn heiliges Wort selbst zum Zeugen und Streiter für mich anrufen im Kampf um die Priesterehe.«
Tizianas Auge glänzte in Jubel und Verstehen. Die Schande war's, vor der sie zitterte. »Siehst du, du herzallerliebster Mann, ich wollte mich nicht in einem Atemzug mit jenen Frauen nennen hören, die ihre Ehre durch die Umarmung eines Kirchenfürsten besudeln, wollte es nie und nimmermehr erleben, deine Kurtisane zu heißen –«
»Tiziana!« Er küßte den süßen Rotmund voll Zärtlichkeit und warf in ihre glühende Scham ein heilig Versprechen hinein: »Vor Gott gelobe ich, Euch zu halten wie mein angetrautes Weib und Euch vor aller Welt als solches zu bekennen, bis auch das Konzil und die Welt Euch als mein eigen bekennen. Ihr sollt hausen auf Monterotondo in Hausfrauenehre und es soll sich alles Gesinde vor meiner Herrin beugen in schuldiger Ehrfurcht. Ihr sollt walten über Kammer und Vorrat, über Linnen und Kleider und Zier, über Magd und Diener, und sollt zu Rat sitzen mit mir über allem Geschäft, das dieser Burg Wohl und Wehe betrifft. Und bei der Mediceischen Bank will ich Euch das reiche Erbe sicherstellen und für die Anerkennung Eurer Rechte im Geschlecht der Orsini bis zum äußersten kämpfen.«
»O Giovanni!« Sie lehnte glückzitternd ihr Haupt an seine Schulter und ihr süßer Atem durchwogte ihre Brust. »Du warst mir Ziel und Gipfel aller meiner Wünsche,« sagte sie erschauernd, »und bei dem Haupte meiner Mutter schwöre ich dir's, daß auch Leben und Tod des armen Marcello, in die du heimlich deine Eifersucht geworfen, mein Ziel nicht verrückt haben. Er war ein braver, treuer Knabe, der für seine Herrin sterben, aber nicht leben konnte. Nie hat sein Kuß mich berührt, eifersüchtiger Mann, seine Leidenschaft spielte nur mit seiner und meiner Liebe, und hätte er weiter gelebt, ich hätte ihn, wenn's not gewesen wäre, mit diesen Händen erwürgt, wenn er das Heiligtum meiner Frauenehre geschändet hätte. Ihn zog ein Gott zur rechten Zeit ans Herz, denn sonst wäre Schuld und Unheil über diese Burg gekommen. Es lebt ein Gott, er gab uns freie Bahn, er offenbart sich selbst in der Bitterkeit des Sterbens.«
Der Kardinal taumelte mit der Glutenseele in ihre heiße Empfindung hinein. »Herrliche, Süße! Und solche Rosenblüten der Seele wollten hinter Klostermauern verwelken?«
»Ich will sie hinter diesen Mauern verwelken lassen,« lächelte Tiziana glückselig.
»Nein, nicht nur hier sollen deine Tage verrauschen, Geliebte. Ich träume von einem bessern Himmelsstrich, wo des Lebens Wunden rascher heilen als hier. Es zieht mich mit Allgewalt nach Florenz –«
»O mein Traum!« jubelte Tiziana.
»Dort, wo die Blumengärten auf den Hügeln von Careggi und Fiesole die Düfte zyprischer Haine ausströmen, laß uns glücklich sein, Tiziana!« Seine Worte brausten wie sanfte Wogen in ihr Gemüt, sie hoben die Schätze des Arnoparadieses ins Licht der Verklärung. Er schwärmte von der leuchtenden Stadt, wo noch der Nachklang mediceischer Geisterkämpfe ans Ohr schlug und die Gedanken in höheren Schwingungen Platos selige Welt durchflogen und man heitre Weisheit, kredenzt aus dem Kelche Sokrates', anmutiger zu schlürfen verstand als in Rom. Wo man noch Feste zu feiern und Kunst und Künstler zu ehren wußte, wo neben dem ernsten Sonett die fröhliche Ballata von Dichterlippen sprang, wo ein farbenfroher Karneval durch die Straßen leuchtete, von Geist beschwingt, von Grazie getragen. Dort im Florenz des Verrocchio, Lorenzo Magnifico, Rucellai und Alberti wollte der Kardinal sich eine zweite Heimat schaffen für sich und sein Weib. Die Wege dazu wurden ihm leichter gemacht durch die Verwandtschaft mit dem Haus der Medici, die, wenn auch von dort vertrieben, doch noch zahlreiche Freunde hatten. Dort sollte Tiziana zur anmutigen Aspasia werden, von ihr sollten freudeweckende und kräftewirkende Strahlen ausgehen wie von einer alles belebenden Sonne in einem Reich der Geister. In Florenz spannte man noch Herz und Nerven für edlere Genüsse an, dort band man noch das Schicksal mit Rosenketten an das eigene Dasein, befreite sich von Murren und Geklage, ja, dort hatte man den düstern Nachlaß savonarolischer Aszese heiter lächelnd von sich gestreift und sich wieder gemäßigter anakreontischer Weltfreude hingegeben.
Plötzlich verfaltete sich die Stirn Giambattistas. »Es lauert noch eine Natter und wartet auf den heimtückischen Biß.«
»Schützt mich vor ihr!« bebte sie leise.
»Sei getrost, Geliebte, ein Gott wird über unserem Glück die Hände halten.« Und er legte ihr die langsam werdenden Bestrebungen der Orsini dar, die nach einer Loslösung vom Papsttum zielten. Er sprach ihr vom heimlich geplanten Abfall des Pagolo und zeigte ihr, wie die Orsinipolitik der Vergangenheit gar manches Beispiel der Absage an den Papst aufwies. Ein Napoleon Orsini wechselte seine Treue zwischen Papst und Kaiser, und unter Klemens IV. zerfiel das Geschlecht selbst in zwei feindliche Lager, Guelfen und Ghibellinen, und die rauhe Bärenklaue der Orsini war in ganz Latium gefürchtet, selbst Alexander hatte vor kurzer Zeit noch Angst vor ihr gezeigt.
Dann besprachen sie wie jauchzende Kinder das erträumte Glück im Wald zu Careggi und trugen dann alle Glücksgewißheit vor das alte Mutterherz der Ginevra Orsini. Und sie zog die bebende, langgeliebte Frau ans Herz und segnete diese wundersam erblühte Liebe, um dann einen Strom von Fragen von ihrer Brust zu wälzen.
Der Kardinal ließ die Flöten- und Lautenspieler des Schlosses kommen und ordnete eine Serenata an für die Abendtafel. Und Reiter sollten morgen nach Rom sprengen und ein Maultier voll Blumenkörbe mitbringen, denn Tizianas Gemach sollte mit Floras lieblichen Kindern geschmückt werden. Und in seiner Freude über die Lebenswende ließ Giambattista von den Türmen Feuer aufflammen in die klare Herbstnacht.
Der Vikar wurde gerufen. In der Stille der einsamen Schloßkapelle sollte sofort ohne Zeugen und ohne kirchliche Zeremonien, nur vor Gottes heiligem Antlitz durch ein Ineinanderlegen der liebenden Hände der Ehebund geschlossen werden, dem die Kirche ihre Weihe noch versagen mußte.
Im Nachtfrieden der Kapelle, vor dem Bilde des segenspendenden Heilands, gab der Kardinal sein festes Gelöbnis ab, Tiziana wert zu halten wie sein Weib. Und sie gelobte ihm ewige Treue.
Dann geleitete er sie hinauf in ihr Turmzimmer. Dort blickten sie beide in eine Nacht voll Sternenglanz und Klarheit. Zu ihren Füßen weitete sich die Campagna zu einem silberumschimmerten Teppich aus, der zu leben schien. Feine Mondnebel flimmerten über dem Tiber und stiegen wie Opferrauch von Artemis' Altären zu den Sphären auf, aus denen heute göttliche Strahlen beider Herzen erleuchtet hatten. Nicht wie der Sterbehauch der Natur, sondern wie der junge Frühlingsodem wehte es aus dem Schoß dieser Nacht über sie hin, und ihr Blut rauschte auf und ging wie Lavaglut durch ihre Pulse. Die der Blumenfreude beraubten Haine vor ihnen wandelten sich unter dem fließenden Glanz in hesperidische Gärten, und verklärt von den Gesichtern der Liebenden, schwebten durch die silbernen Gefilde holde Liebesgötter und wanden duftige Kränze um ihre Häupter. Der Weisheit frommer Herold lag gefangen in dem süßen Netz, das unerbittliche Geister über ihn geworfen, die für der Menschheit ewigen Bestand walteten und webten.
Der Kardinal versank mit seinen Blicken in ihrer duftenden Schönheit. In seidenflimmerndem Gewebe stand sie vor ihm, der goldgestickte Saum schimmerte sanft, und von dem Gürtel, der das Gewand um die Hüften raffte, blitzten die kostbarsten, der Bergnacht entrißnen Edelgesteine auf herrlich getriebnem Arabeskengrund. Über den Brüsten blinkte das zartgesponnene Hemd wie ein Schleier der Arachne, mehr hingehaucht als eine Hülle bildend, unter der die Haut wie Milch schimmerte. Und das Goldstirnband gab ihr königliche Majestät, die die roten Rosen im schwarzen Haar zur sanftesten Anmut milderten.
Von Herz zu Herz, von Sinn zu Sinn rauschte das sehnsüchtige Blut.
Der Kardinal löste das Haar von ihrem Scheitel, wie ein fließender, dunkler Fall ergoß es sich über die schimmernden Schultern, und aus der Flut leuchtete ihm das wunderbare, keusche Antlitz der geliebten Frau entgegen. Und seine Augen brachen sinnlich diese letzte wehrende Keuschheit entzwei, und seine Hände enthüllten die zarte, götternackte Formung irdischer Schönheit. Mit einem erstickten Jubelruf erzwang sich der milde Tyrann das Weibliche in ihr zur ewigen Beute.
 Das Wild der Treibjagd, die der Herzog Valentino in diesem wunderschönen römischen Herbst veranstaltete, waren die romagnolischen kleinen Tyrannen, die, von ihren Städten bald geliebt, bald gefürchtet, vor dem herannahenden Schrecken entweder Reißaus nahmen oder sich in der kurzen Rolle des heldenmütigen
Verteidigers gefielen. Der erste Hase, der den Speer Cesare Borgias zu scheuen allen Grund hatte, war der junge Giovanni Sforza, der einstige Gemahl der Lukrezia Borgia. Der Valentino rückte mit sechstausend Fußsoldaten und neunhundert Reitern an Pesaro heran, dessen Volk gegen seinen Herrn aufgewiegelt wurde. Vergebens rief der Dichter Guido Posthumus die Leute von Pesaro zum Widerstand gegen Cesare auf. Man verlachte ihn und jauchzte dem neuen, noch verkannten Tyrannen entgegen, der mit Pracht und Prunk in Pesaro einzog und von den Zinnen des schönen Schlosses durch zwölf Trompeter die Besitznahme der Stadt verkünden ließ. Und Giovanni Sforza härmte sich in Mantua ab, daß nun in seinem blauseidenen Himmelbett zu Pesaro sein unversöhnlicher Feind das allerschönste Mädchen von Pesaro mit Raubtiertatzen in seine Lustgewalt nahm.
Das Wild der Treibjagd, die der Herzog Valentino in diesem wunderschönen römischen Herbst veranstaltete, waren die romagnolischen kleinen Tyrannen, die, von ihren Städten bald geliebt, bald gefürchtet, vor dem herannahenden Schrecken entweder Reißaus nahmen oder sich in der kurzen Rolle des heldenmütigen
Verteidigers gefielen. Der erste Hase, der den Speer Cesare Borgias zu scheuen allen Grund hatte, war der junge Giovanni Sforza, der einstige Gemahl der Lukrezia Borgia. Der Valentino rückte mit sechstausend Fußsoldaten und neunhundert Reitern an Pesaro heran, dessen Volk gegen seinen Herrn aufgewiegelt wurde. Vergebens rief der Dichter Guido Posthumus die Leute von Pesaro zum Widerstand gegen Cesare auf. Man verlachte ihn und jauchzte dem neuen, noch verkannten Tyrannen entgegen, der mit Pracht und Prunk in Pesaro einzog und von den Zinnen des schönen Schlosses durch zwölf Trompeter die Besitznahme der Stadt verkünden ließ. Und Giovanni Sforza härmte sich in Mantua ab, daß nun in seinem blauseidenen Himmelbett zu Pesaro sein unversöhnlicher Feind das allerschönste Mädchen von Pesaro mit Raubtiertatzen in seine Lustgewalt nahm.
Kaum war Pesaro gefallen, verjagte auch das kleine Rimini seinen Tyrannen Pandolfo Malatesta.
Mit unersättlicher Gier und gleichzeitiger Klugheit riß der junge Sohn für den alten Papstvater einen Edelstein nach dem andern an sich. Das fruchtbare Land der Romagna erschloß seine Schätze für das Haus der Borgia.
Der Winter zog mit streichelnder Milde übers Land. Selbst der Apenninschnee hatte seine weißen Schmuckbänder nur spärlich über die Grate gelegt, und in der Campagna und in Rom grünten im Eismond Lorbeer, Eiche und Olive. Die Rosen begannen zu blühen, und als das Kerzenweihfest in Rom gefeiert wurde, blaute der Krokus aus dem satten Grün, und die Mandelbäume in den Gärten schwellten zu zauberhaft schönen, rosigen Fanalen an, die von den sieben Hügeln wie Opferfeuer ins Land schimmerten.
Im Vatikan spannten sich alle Blicke nach Norden. Fano und Cesena hatten sich ergeben. Aber die Stadt des hübschen jungen Astorre Manfredi noch nicht. Der Papst glaubte in den von habsüchtigen Träumen erfüllten Nächten den Kanonendonner von Faenza zu hören.
Endlich erfüllte sich auch das Geschick dieser Stadt, deren Bürger ihren schönen Herrscher mit heldenmütiger Aufopferung verteidigt hatten. Faenza feierte ein trauriges Ostern. Zusammengebrochen lag die Stadt da. Und der heimtückische Herzog Valentino gab sich den Schein des gnadenvollen Siegers und versprach dem löwenkühnen Jüngling Astorre freien Abzug. Doch kaum hatte sich dieser ihm ergeben, ließ er den unglücklichen Knaben samt seinem Bruder in die Engelsburg schleppen. Faenza stöhnte auf vor Wut und Qual.
Schon war auch die Stadt Camerino dem dortigen Tyrannen Varano öffentlich abgesprochen worden. Die florentinische Perle stach Cesare ebenfalls in die Augen. Die vertriebenen Medici suchten sich des republikanischen Regiments zu bemächtigen und verbanden sich mit Cesare, um nur vorerst Florenz zu bedrohen. Durch allerlei Hilfstruppen verstärkt, die des Herzogs Kondottieri Vitelli, Bentivoglio, der Herzog von Gravina und Pagolo Orsini führten, rückte Cesare ins florentinische Gebiet. Die Signoria von Florenz aber schätzte ihren Bedränger richtig ein. Der Herzog braucht Geld, sagte sie sich, viel Geld, und wir sind reich, unsre Bankhäuser spielen klug auf allen Weltmärkten der Welt. Geben wir ihm Geld! Soviel er will! Und Cesare nahm an, gleich sechsunddreißigtausend Dukaten. Und er durfte zum Dank für die glückliche Lösung der florentinischen Sache sogar Piombino angreifen. Mit starken Kräften warf er sich jetzt über die toskanischen Berge nach dem Meer.
Da spielte sich Frankreich plötzlich wieder als Beschützer der bedrängten Staaten auf. Sein Argwohn befürchtete, daß des Papstes anwachsende Macht in Mittelitalien seinem eigenen mailändischen Gebiet bedrohlich werden könnte. Es brauchte willige Staaten, die auch seinen Truppen freien Durchzug bei seinem Marsch nach Neapel sichern sollten, dessen Königsdynastie Aragon Ludwig XII. zu stürzen beabsichtigte, um dann das Land zwischen sich und Spanien zu teilen. Und schon rückte Frankreichs Armee unter Aubigny von Norden her gegen Rom. Da mußte auch Cesare sein Abenteuer abbrechen.
*
In Monterotondo hielt wirklich ein guter Gott seine Hand über doppeltes Glück. Wohl blieb der Traum von Florenz unerfüllt, da sich die Signoria gegen die Aufnahme eines mit dem Medici verwandten Orsini wehrte. Aber in der Burg Monterotondo wehte trotzdem elysische Friedensstimmung. Der Kardinal sah den Vatikan in den Banden einer Außenpolitik liegen, die ihm, dem Orsini, nicht gefährlich zu werden schien. In der Romagna war sein eigentlicher Feind durch Eroberungen festgehalten. Cesare Borgia hatte sich noch im Herbst in die Romagna begeben und war nicht mehr nach Rom zurückgekehrt, trotzdem Winter, Frühling und Sommer übers Land gekommen waren. Der Kardinal spann sich nun wie in einem Märchenschloß ein und streute seiner geliebten Frau die Schätze eines Krösus zu Füßen. Die Burg erstand in ihren Räumen zu urbinatischer Pracht und Herrlichkeit. In den Hauptgemächern der schönen Tiziana wurden blumig mosaizierte Fliesen gelegt, die Mauern erhielten Onyxglätte und schimmerten feenhaft, herrliche Türschnitzereien erfreuten den Blick, wunderbare Arabesken von Gold zogen sich als Friese in der Höhe dahin und wurden überdacht von seidenen Deckengeweben. Da und dort warfen riesige Kristallspiegel die ganze Pracht zurück, die durch Konsolen, silberne Kandelaber, elfenbeinernes Gestühl und allerhand Ziergerät aufs höchste gesteigert wurde.
An den blassen Winterabenden überkam beide Glückskinder eine wunderbare Traumversonnenheit, so daß sie den Gang der Welt draußen weder sahen, noch hörten. In trauter Seelenbescheidenheit zogen sie sich vor der Berührung mit dem lauten Tag zurück, dessen Pulsschlag aus Rom herüber mitunter hörbar war. Der Kardinal besuchte die Stadt nur, wenn es die kirchlichen Feste und die Zeremonien des Papsthofes vorschrieben.
O, was waren das für Winterabende! Tiziana war dem Kardinal die getreue Gehilfin in der mühsamen Sammelarbeit seines Fleißes geworden, die verständige Verwalterin seines Hausgutes. Aber er hob sie über die bescheidene Frauenwürde in die geistige Sphäre seines Wesens hinauf. Sie hatte an allem Teil, was sein Geist durchsann. Und das war viel. Mit wissensdurstiger Seele durchstöberte Giambattista den großen Inhalt des Lebens, grub in den Tiefen der geschichtlichen Vergangenheit, studierte die bewegenden Kräfte der Gegenwart und versuchte die geheimnisvolle Zukunft zu entschleiern. Sitten und Gebote der alten Römer durcharbeitete er, durchforschte die Philosophen und Dichter der Kaiserzeit, jagte den Kirchenfunden in fernen Landen nach, lernte Hebräisch und Spanisch, schrieb an der Geschichte seines Geschlechts, an Reformgrundsätzen der Kirche, übte sich in der Beredsamkeit des Strabo und schrieb »Briefe an die Orsini«, worin er ihnen hohe sittliche und volkserzieherische Aufgaben stellte und ihnen die Versöhnung mit den Colonna als ein würdiges Ziel vor Augen hielt.
Und in das Wintergrau sandte bald der Frühling seine linden Boten. Feine Glocken läuteten in den Lenznächten an Tizianas Ohr. Unter ihrem Herzen reifte eine kleine Welt heran, die von der Liebesseligkeit durchsogen und behütet wurde. Und über diesem Herzen schwellten mutterselig die Brüste. Ein sinniger Geist tat alles, um das Wesen der neuen Aufgabe zu durchdringen. Lässige, mühelose Ritte und Spaziergänge stärkten die bildenden Organe, Beschäftigungen mit den Idealen griechischer Kunst gaben der Seele friedliche und schöne Regungen, und Gespräche über Sitte, Schönheit und Erziehung bildeten ihren Geist nach der Richtung des kommenden Ereignisses. Tagträume trugen sie auf weichen Flügeln in ein von süßen Schauern erfülltes Land, wo die Mutterliebe ihre Schwingen entfaltete.
Dieser südliche Frühling, durchsogen von Licht und Duft, diese Tage voll durchsichtiger Klarheit, in denen der Himmel sich zur Erde niederzusenken schien, diese morgendlichen Lüfte, die den Atem der See über die etruskischen Hügel herübertrugen, diese sonnenwarmen, matten Mittagsstunden mit dem unbeschreiblichen Dunst über den leise schlafenden Gräsern, die rosenroten Abende, wenn die Sonne über Wolkenteppiche in die goldene Unendlichkeit versank, und der müde Nachglanz ihrer Glut, unter dem die ganze latinische Welt sich in ein süßes Dämmern verspann, das mählich in die dunklen Geheimnisse der Nacht überging, und diese Nacht selbst, erfüllt von den Schauern seliger Geborgenheit an der Brust des geliebten Mannes – o, welche Zauber wirkte das alles im Gemüt der gesegneten Frau, die durch eine natürliche Geistesbildung für die Offenbarungen des Schöpfers so empfänglich war.
Und nun war Pfingsten mit Blumenpracht und Vogelschall herangekommen. Der Heiligegeistgruß fand keine schlichten, sehnsüchtigen Apostelherzen mehr auf Erden, ihre Nachfolger waren berechnende Geschäftsleute geworden, die aus dem Geistesfest eine schöne, zinsentragende, spektakulöse Augenweide machten.
Am geheiligten Sonntag, zur selben Stunde, da in Sankt Peter das Tedeum in feierlichem Schwall durch die Kathedrale brauste, während die heilige Lanze unter Weihrauchwolken in einem Meer von Licht dem Volke gezeigt wurde, kämpfte sich auf Monterotondo ein Knäblein ans Licht, das wenige Tage darauf in der Schloßkapelle vom Burgvikar auf den Namen Valerio Orsini getauft wurde.
Während des Taufaktes zogen gerade die französischen Kontingente von Civita Castellana gegen Rom heran, um nach Neapel zu marschieren. In den Trompetenschall quietschte der kleine Täufling lustig hinein, und der Astrolog weissagte, daß Valerio schon in jungen Jahren Kriegsgetön zu hören bekommen werde, um so mehr als die Nativität eine kriegerische Zukunft gekündigt hatte.
Strahlender denn je schritt Tiziana durch die Burghallen, den herzigen jungen Bären auf den Armen. Oder sie wanderte mit der Kammerfrau über die nahen Hügel, während sich die Sonne von Feld zu Feld schwang und die ganze Landschaft den schweren Duft der nahenden Reife atmete. Eine neue Welt tat sich ihr auf. Alle Sorge wollte sie allein haben. Sie schlief ganze Nächte nicht und war doch niemals ärgerlich. Voller blühte jetzt ihre Gestalt auf, fürstlicher denn je erschien sie unter den Schloßleuten, wenn es galt, ihre kleinen Klagen und Wünsche entgegenzunehmen. Ihre segnenden Hände legte sie auf das ärmste Haupt, wanderte manchmal in die kleinen Tenuten und schüttete Kleider und Geld aus den Taschen des Maultiers in die Hände der Bauern. Auf ihren Befehl wurden die Sklaven menschenwürdig behandelt und Vergehen milde bestraft. Sie geriet nach und nach in den Ruf einer kleinen Heiligen, und wenn sie ausritt, liefen die Leute aus den Hütten und knieten beinahe andächtiglich nieder, wenn sie an ihnen vorbeizog. Sie holte Bauernkinder und ließ sie mit dem kleinen Valerio spielen und saß stundenlang, wenn der Kardinal in Rom war, bei einem einfachen Hirtenherd und horchte den Klängen der Zampogna.
Alle Schatten ihrer Liebe waren vertrieben. Verklärt stand das Bild des toten jungen Freundes vor ihrer Seele, dem sie an manchem Tag in wehmütiger Betrachtung nachsann, um dann sein Grab gemeinschaftlich mit dem Kardinal mit Blumen zu schmücken.
Bald war das Land von Erntesegen übergoldet. In die Glut der Sonne tauchten die dunklen Obelisken der Zypressen, und in ihrem Schatten ruhten die finstern Gestalten der Campagnuolen. Wie von einem Silberhauch überschimmert, dehnten sich ins westliche Land die weiten Olivenhaine, aus denen von Zeit zu Zeit Kramerkarren in langen Reihen herauskrochen. Die heilige Stadt lag Tag für Tag in einen bräunlichgrauen Schleier gehüllt, und nur mühselig konnte Tiziana die Türme und Kuppeln erschauen, die in den Frühlingstagen so klar umrissen waren.
Aus dieser Stadt kamen in die Sommerfreude die Kampfnachrichten der französischen Armee. Cesare Borgia hatte sich ihr angeschlossen, denn es galt, die Colonna, die auf Neapels Seite fochten, zu vernichten.
Da flog die Kunde heran, Capua sei gefallen, der tapfere Fabrizio Colonna, der es verteidigte, in französische Gefangenschaft geraten. Giangiordano Orsini, der Herr auf Bracciano, hatte es erobert, und Cesare hatte ihm eine große Summe geboten für den lebendigen oder toten Colonna. Aber Giangiordano bewies eine zeitfremde Großherzigkeit. Er ließ Fabrizio Colonna frei. Cesare schäumte und zeichnete einen Schuldstrich auf das Konto der Orsini.
Als der Kardinal davon erfuhr, las er seine »Briefe an die Orsini« noch einmal durch. Seine Warnrufe bekamen eine erhöhte Bedeutung. Orsini, hütet euch! Cesare schmeichelt euch, weil ihr ihm noch nötig seid. Habt acht, wenn erst die Stunde naht, da er euch zu dem Verbrauchten wirft. Ihr sagt, er liebe Giangiordano, weil er zu Frankreich hält, und ich sage euch, er liebt ihn nicht. Und er liebt auch dich nicht, Pagolo, trotzdem du ihm die Romagna erobern halfst, und er wird mit euch allen fürchterliches Gericht halten. O, daß ihr großen Geschlechter Roms euch endlich zusammenschließen könntet, um den einen zu verderben, der des Verderbens wert ist. Überstolze Blüten am Baum der Menschheit! Krieg und Mord ist eure Losung, ewiger Rachedurst gräbt seine Zeichen auf eure finstern Stirnen, und doch stünde euch das Wappen des Friedens besser zu Gesicht. Hohe Aufgaben locken euch nicht, nur der Colonna Vernichtung steht auf eurem Banner geschrieben. Den Gelehrten, Künstler, Bauer und Handwerker zu schützen, habt ihr verschmäht. O, gebt euren Gedanken edle Ziele, mäßigt eure abenteuerlichen Herzen und schärft euren Blick für den wahren Feind. Er sitzt im Vatikan an geheiligter Stätte, die euer Arm blindlings verteidigt. Alexander schläft nicht, aus seinem Mund dampft der Atem des Giftes. Im Jahrbuch der Geschichte steht sein Name mit blutigen Lettern geschrieben.
Der Kardinal warf die Blätter zu. Ein Grauen packte ihn. Wenn diese Blätter je in unberufne Hände kämen!
Neue Nachrichten flogen heran. Cesare hatte Capua plündern lassen. Vierzig schöne Mädchen aus den vornehmsten Häusern hatte er mit sich schleppen lassen. Ein Teil der Frauen von Capua hatte sich, um demselben Schicksal zu entgehen, in die Fluten des Volturno gestürzt.
Die Colonnaburgen und -städte wurden zerstört. Der unglückliche König Federigo von Neapel flüchtete nach Ischia.
Wie ein Geier stürzte sich jetzt Alexander im Rücken der vormarschierenden französischen Armee auf die Burgen der Colonna. Die päpstlichen Söldner wüteten in den mit Kunstschätzen überladenen Baronalpalästen. Auch die Güter der Savelli wurden zerschlagen und in Brand gesteckt.
Zur selben Zeit beglückte der Papst die Christenheit mit einem Einfall, der bei allen Gläubigen höchste Erbitterung hervorrief. Als er, um die zerstörten Burgen zu besichtigen, Rom verließ, setzte er seine Tochter Lukrezia als Statthalterin Gottes auf den päpstlichen Thron. Es war die bis zum Wahnwitz gesteigerte Idee eines Greisengehirns. Er übergab ihr das Recht, Briefe zu eröffnen und zu erledigen und Entscheidungen zu fällen, und vergebens wehrte sich die arme Herzogin gegen die Entweihung der heiligen Würde durch ihre kleine sündige Peron. Der Witzkopf Pasquino, die steinerne Zeitung Roms, hatte eine ganze Girlande von Spottversen auf seinem Statuenhals zu tragen.
Als der Papst zurückkehrte, verkündigte er den überraschten Römern durch Kommissare, daß Lukrezia Borgia demnächst an den Erbprinzen Alfonso d'Este von Ferrara vermählt werde. Rom bekam Befehl zu jauchzen. Auf der Engelsburgterrasse dröhnten die Freudenschüsse. Und eine Herzogin weinte.
Die Güter der Colonna, Gaetani und Savelli wurden nun zwischen den zwei kleinen Borgiakindern verteilt, Rodrigo, dem Sohn der Lukrezia, und Giovanni, dem jüngsten Papstsprößling jener unbekannten Frau, die Alexander neben seiner Favoritin Farnese in einem Anfall von Zeugungssucht ans Herz gedrückt hatte.
Der Sommer ging zu Ende. Die französische Armee zog mit großen Teilen nach Norden zurück, nachdem das Haus Aragon vertrieben worden war. Die Straßen durch die römische Campagna waren überfüllt von Fuhrwerken und Trupps. Auch Cesares Söldner zogen nordwärts, um die Belagerungstruppen von Piombino zu verstärken.
*
An einem glühenden Augustmorgen ritt ein Mann auf einem Maultier das Tibertal aufwärts an Monterotondo vorbei in die Berghänge der Sabina hinein. In der Nähe der Burg hielt er noch einmal still und sandte einen stummen Gruß hinüber. Michelangelo wandte der Buhldirne Rom angeekelt den Rücken, um nach seiner Heimat Florenz zu gehen. Die römische Luft hatte ihm die Wangen gebleicht, das Mark ausgesogen, das Gemüt zermürbt, das Herz gelähmt. Pinsel und Meißel hatten mondelang gefeiert. Er sah in Rom das Christentum, das ihm durch Savonarola teuer geworden war, durch einen fürchterlichen Papst verwaltet, der weder Geist noch Kunstgefühl besaß, Kräfte, die nach Michelangelos Meinung der Religion als Stützen beigegeben worden waren von Gott. Die Religion selbst war dem Papst zur Maske geworden. Drum verabscheute ihn der gläubige Jünger Savonarolas, dem Religion ein ehrliches Alltagskleid war, dessen er sich nicht schämte.
Auch die Sorge um seine Familie drückte Michelangelo schwer. Der Vater und die Brüder darbten in Florenz. Auch sonst zog ihn manches dahin. Leonardo da Vinci, dessen hohes Schaffen er argwöhnisch verfolgte, war dort mit Ehren überhäuft worden. Und es reizte ihn, den Vergötterten kennenzulernen.
Vor ein paar Tagen war sein Jugendfreund Granacci mit einer Neuigkeit nach Rom gekommen. Die Wollenweberzunft in Florenz hatte die Absicht, einen alten Marmorkoloß, aus dem vor Jahren ein Bildhauer einen Giganten halb ausgehauen hatte, neu bearbeiten und einen jungen David daraus meißeln zu lassen. Sanseverino hatte den Auftrag abgelehnt, und so munterte Granacci den Freund auf, sich darum zu bewerben. Ein David! Der biblisch kühne Jüngling erhob sich im Hirn Michelangelos mit visionärer Wucht. Er sah den Hirten mit den königlichen Geistesanlagen vor sich, die seine körperlichen Kräfte idealisierten, er schlug die Bibel auf und las das erste Buch Samuelis durch, und eine ganze Nacht lang lebte er im Schauen des Bildes. Dann stand sein Entschluß fest, die Heimat aufzusuchen.
Und nun malte ihm auch Granacci noch das Bild des neu verjüngten Florenz aus, das gleichsam auf ihn zu warten schien. »Und Grüße habe ich zu bringen von Baccio de la Porta,« sagte er, »der jetzt als Fra Bartolomeo ein Altarbild für den Saal des Consiglio grande arbeitet.«
»Er ist Mönch geworden, der Unselige!« schimpfte Michelangelo.
»Und fühlt sich wohl,« versetzte Granacci.
Dann schwärmte er von einer Auferstehung der Gärten des Medici, von dem bewegten Künstlerleben in den Klostermauern von San Marco, von dem Gelehrteneifer in den Schreibstuben und den Goldschmiedwerkstätten und -buden auf dem Ponte vecchio, von den Dichtern und Improvisatoren, die in den Häusern der Salviati, Rucellai und Alberti sangen, von den Frauen und Jünglingen des ganzen Dorados, und bald schwamm Michelangelo in den wohlig bewegten Wellen der Jugenderinnerung.
Noch am selben Abend begann er mit Granacci den kleinen Hausrat einzupacken, bestellte bei Galli das Maultier, holte sich dort einen Fluch über den andern über seine Untreue und war aber doch nicht zu bewegen, in Rom zu bleiben. Dann besuchte er am nächsten Morgen den Dom Sankt Peter und nahm Abschied von seiner Pietà. Er streichelte mit den Blicken das tiefe Werk seiner Seele, die ihre eigene Schwermut mit Meißelschlägen in den Marmor gehauen hatte. Seele in diesem Rom! Das war schon ein Gewinn. In dem verpesteten Dasein erhob sich diese Pietà wie eine reine Opferflamme, die ein glaubenstiefes Genie im geschändeten Tempel der Christenheit angezündet hatte. Mit seinen jungen Jahren hob Michelangelo schon seine Phantasie ins Übergroße hinauf, und keine Grazie beflügelte sie. Dinge schaffen, die des Menschen höchstes Verlangen nach Gott ausdrücken, das wollte seine Kunst.
Und nun war er auf dem Weg nach Florenz. Auf den Vorhügeln der Sabina hielt er sein Tier an und sah nach Monterotondo hinüber. Dort lebte das Weib, das vor einem Jahr wie ein süßer Traum von Glück in die sinnliche Sphäre seines Lebens getreten war. Er hatte das Schicksal dieses Weibes verfolgt und sich nicht eingestehen wollen, daß es leise an seinem Herzen gerührt hatte. Und er hatte sich gegen den Klang gewehrt, den die Harfe in seinem Innern bei dieser Berührung ertönen ließ. Es war ja nur die anmutige Gewalt der Erscheinung, der Schönheit gewesen, die auf sein leicht bewegliches Künstlerherz angestürmt war. Aber sie setzte das sich trotzig sträubende Herz in Flammen, und der Brand glomm lange fort und ließ endlich ein Aschenhäufchen zurück, aus dem durch eine Begegnung mit dem schönen Bilde neue Flammen emporgeschlagen hätten.
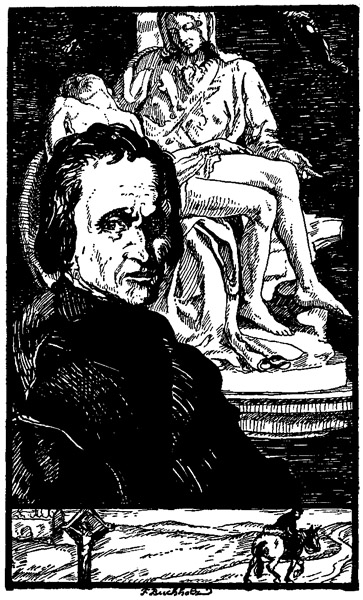
Auf dem Tuffhügel, inmitten von Sonnenglanz und verdorrtem Gras, packte der Künstler aus der Maultiertasche das heimlich gezeichnete Bild Tizianas heraus, wie es die Erinnerung an sie skizzenhaft entworfen hatte. Er sah es lange an und riß es dann mit fester Hand entzwei. Er spürte den Riß bis in sein armes, in Bitternissen schwimmendes Herz hinein. Ach, die schöne junge Mutter Tiziana hatte keine Ahnung, daß da in ihrer Nähe ein verbißner Mensch mit seiner Traumliebe die letzte Abrechnung hielt.
Nun bestieg Michelangelo wieder sein Tier und bald schwand das Schloß vor seinen Augen. Das schöne Weib aber blieb noch in seinem Sinn. Der Abschiedsgruß von Hügel zu Hügel hatte sein Gefühl neu durchwühlt. Der Bruch mit der Vergangenheit wollte noch nicht recht gelingen. Die römische Luft wehte ihm in das Bergland der Sabina nach, und sie war vollgesogen von schwerem Blütenduft und trug den Hauch eines süßen Frauenmundes bis in sein ungeliebtes Herz hinein.
Erst auf den Hügeln im Süden des Arno, wo der Abendwind in den Pinienwipfeln Florentiner Lieder sang, kam das bewegte Herz, das sich selbst aus Rom vertrieben hatte, zur Ruhe. Da lag die Heimat vor ihm, von den Chariten mit Anmut und Lieblichkeit gesegnet. Über dem Wunderbau Brunelleschis und den Türmen der Stadt und den weithin wallenden Gärten hingen Rosenwolken im dunkelnden Abendblau. Es war, als hätte sich die Heimat festlich mit Girlanden geschmückt, den verlornen Sohn willkommen zu heißen.
 Die fried- und freudelose Herzogin Lukrezia lag im weichen Pfühl, gebildet aus Parder- und Löwenfellen. Rosenfarbige Kerzen leuchteten über die seidene, goldstrotzende Pracht des fürstlichen Gemaches, das einst Cesare für sie hatte herrichten lassen. Da waren marmorglatte Wände, an denen liebliche Statuen gleißten, ein fellbedeckter Fußboden dämpfte jeden Schritt, den gute und sündige Menschen taten, Blumenkörbe mit der Doldenpracht fremdländischer Gewächse bedeckten die Konsolen, und in silbernen Käfigen schnäbelten verliebte Sittichpaare und tauschten offene Geheimnisse der Liebe aus. Von der seidenüberspannten Decke, deren Blau den Himmel vortäuschen sollte, blitzten und flimmerten Kristallgehänge in unerhörter Pracht.
Die fried- und freudelose Herzogin Lukrezia lag im weichen Pfühl, gebildet aus Parder- und Löwenfellen. Rosenfarbige Kerzen leuchteten über die seidene, goldstrotzende Pracht des fürstlichen Gemaches, das einst Cesare für sie hatte herrichten lassen. Da waren marmorglatte Wände, an denen liebliche Statuen gleißten, ein fellbedeckter Fußboden dämpfte jeden Schritt, den gute und sündige Menschen taten, Blumenkörbe mit der Doldenpracht fremdländischer Gewächse bedeckten die Konsolen, und in silbernen Käfigen schnäbelten verliebte Sittichpaare und tauschten offene Geheimnisse der Liebe aus. Von der seidenüberspannten Decke, deren Blau den Himmel vortäuschen sollte, blitzten und flimmerten Kristallgehänge in unerhörter Pracht.
Aber die verwöhnte Herzogin gewann dem Spielzeug keinen Geschmack mehr ab. Sie sah böse und unfreundlich drein.
»Die Colonna geächtet? Und die Savelli?« fragte sie den vor ihr stehenden Kammerherrn und Sekretär Piccinino. »O, es kommt viel Unheil über die stolzen Geschlechter Roms.« Sie sprang unruhig auf. »Mein herzoglicher Bruder noch nicht gemeldet?«
Piccinino senkte das Haupt. »Er vergnügt sich eben im Hof seines Palastes damit, zehn Verurteilte mit Pfeilschüssen persönlich zu richten.«
Lukrezia lief ein Schauer durchs Gebein. »Er hat sonderbare Belustigungen, mein Herr Bruder.«
»Es ist wieder etwas im Werke, erlauchte Herzogin,« sagte Piccinino mit mürrischer Miene. »Hauptmann Michelotto hat Befehl erhalten, unter den fünftausend eingeschriebnen Lustdirnen Roms, die er im Zirkus Maximus zusammentreiben ließ, die schönsten auszusuchen. Es sollen Kastanien unter die Mädchen geworfen werden, und der allerheiligste Vater will sich mit Seiner Herrlichkeit dem Herzog an dem Balgen und Raufen der nackten Leiber ergötzen. Auch die Anatomen, Bildhauer und Maler sind geladen, damit sie Gelegenheit haben, die Beweglichkeit und das Muskelspiel junger Frauenleiber zu studieren. Seine Heiligkeit gedenkt ihr Badezimmer mit den besten Bildern, die die Künstler dann liefern werden, auszuschmücken.« Der Sekretär durfte sich so freie Schilderungen erlauben. Aber er wurde doch ein wenig verlegen.
»Wer hat Euch befohlen, mir das alles zu melden?« fragte die Herzogin schamvoll.
»Seine Herrlichkeit der Herzog der Romagna.«
Lukrezias feine Nüstern zitterten. »Hat man auch etwas Ehrbares zu berichten?«
»Der Papst hat dem Herzog von Ferrara das Dukat bestätigt und den Jahreszins von viertausend Dukaten auf hundert Florentiner Gulden herabgesetzt.«
»Man wird jetzt im Vatikan sehr viel Gnaden ausschütten über den Hof von Ferrara. Sind die Hofdamen bestimmt, die mich begleiten sollen –«
»Donna Imonez, Donna Porzia de Cantani, Donna Angela Borgia, Donna Mariana Durante.«
»Und keine Donna Tiziana dabei!« seufzte die Herzogin. »Man sagt, die seltsame Frau des Kardinals Orsini sei ganz in Mutterfreuden eingesponnen.«
»Die päpstliche Kurie will sie nicht als seine Frau, sondern nur als seine Kurtisane ansehen. Das Gesuch des Kardinals um Legitimierung seiner Ehe wurde, wie nicht anders zu erwarten war, lächelnd abgeschlagen.«
»Die beiden haben die Größe aufgebracht, über dieses Lächeln der Kurie zu lächeln.« Die Herzogin verzog spöttisch die schönen Lippen. »Ich werde es über mich bringen müssen, meine einstige Hofdame in ihrem Retiro aufzusuchen, wenn ich mich wieder an dem Anblick eines tugendhaften Herzens erquicken will. Der ganze Hof hier riecht nach der Pianta palustre, der Sumpfblume. Und was treibt dieser brave, standhafte Kardinal?«
»Er verschließt sich und seine Geliebte –«
Die Herzogin flammte empor. »Gebt Ihr den Ehrennamen Frau.«
Piccinino verneigte sich gehorsam. »Wie Ihr befehlt, erlauchte Herrin. Darf jetzt Messer Bembo –«
»Den vergaß ich ganz.« Sie nahm zerstreut ein paar Zeichnungen und spielte damit. Es waren einige kleine, von ihr mit Rötel nachlässig hingeworfne Landschaftsskizzen, weichgeformt und verschwommen im Ausdruck. »Der Herr mag kommen.«
Der Edelmann Pietro Bembo trat gleich darauf in das Marmorzimmer. Er war von Ferrara gekommen und brachte einen Gruß von dem Herzog Ercole d'Este, dem künftigen Schwiegervater Lukrezias.
Die Herzogin betrachtete den schönen Mann mit sichtlichem Wohlgefallen. Er war über dreißig Jahre alt, gar wohlgestaltet, von hoher Figur, hatte ein bleiches Antlitz, welches das glatte schwarze Haar anziehend beschattete, und Augen, die eine bewegliche und geistvolle Seele verrieten. Sein gelblichweißes, goldgesticktes Gewand hob seine etwas geschniegelte männliche Schönheit über das gewöhnliche Maß hinaus. Er drückte nach Höflingsweise das schwarze Barett mit der wallenden weißen Reiherfeder an die Brust und verneigte sich tief.
Die Herzogin nickte mit gehörigem Anstand. »Ihr kommt von Ferrara?«
»Ich bin beauftragt, Eurer Herrlichkeit die Grüße des Erbprinzen Alfonso d'Este, Eures Bräutigams, zu überreichen.«
Lukrezia neigte wieder leicht das Haupt. Sie sah, daß dem Edelmann, dessen Gelehrsamkeit ihr gar wohl bekannt war, auch eine Wohlanständigkeit und eine feine äußere Bildung eigen waren, wie sie den Jünglingen der Wissenschaft nicht immer beschieden waren. Sie sprang gleich mitten in den Bereich ihrer Neugierde hinein. »Herrscht reges Leben im herzoglichen Palast?« fragte sie mit gespannten, klaren Augen.
»Er ist der Sitz holder Musen und das Asyl stiller Denker. Man findet in Italien, den herzoglichen Hof von Urbino ausgenommen, keine Stätte, wo Kunst und Wissenschaft so eifrig gepflegt werden. Um so mehr freut sich ganz Ferrara auf die Krönung dieses Sternenhimmels durch eine Sonne, die Eure Gegenwart entzünden soll.« Mit zierlicher Galanterie legte er die Schmeichelei der Herzogin zu Füßen.
Sie betrachtete den Mann mit neugierigem Erstaunen. Und sie fand es begreiflich, daß die Frauen von Messina, wie man sagte, noch heute von ihm und der Zeit schwärmten, da Bembo dort das Griechische gelernt hatte. »Dann wird man sich dort wohl angenehmer bewegen können als an dem römischen Hof, wo ein edles Weib inmitten der frivolen Monsignori erröten muß.« Sie erschrak über ihre Offenheit und lenkte schnell ab. »Ihr macht sonst lateinische Verse?«
»Ich habe versucht, die Sprache Quintilians zu meistern und rhythmisch zu beleben,« sagte er, verschwieg jedoch, daß er auch den römischen Priap in Hexametern besungen. »Ich habe mir höhere Ziele gesteckt. Auch unsre schöne Sprache ist wert, klingend zu werden. In Ferrara leben einige gelehrte junge Köpfe, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, Italiens schöne Sprache durch Gesetze zu stützen und durch Formen zu bereichern. Wir haben auch Dichter, die vorzügliche Latinisten sind und doch ihrer Heimat wertvolle Dichtungen im Volgare schenken.«
»Ihr meint wohl die beiden Strozzi?« sagte Lukrezia, froh, ihre Kenntnisse aufdecken zu können.
Bembo nickte. »Titus und Ercole Strozzi, ganz recht. Das Erbe des guten Bojardo aber scheint ein stürmischer, feuriger Jüngling anzutreten, Ludovico Ariosto. Er ist der Liebling des Kardinals Ippolito d'Este, der keinen Abend vorübergehen läßt, ohne von ihm einige Verse anzuhören.«
»Und die Künstler?«
»Talente erster Größe. Vor allem der edle Lorenzo Costa. Dann sind gewaltige Baumeister versammelt, die der Stadt ein prächtiges Aussehen geben.«
»O, da freut sich mein Herz!« jubelte die Herzogin.
»Der Palast des Herzogs Ercole wird stündlich verschönt, und es gibt keinen lieblicheren Aufenthalt als den Garten, den der Herzog anlegen läßt. Man wandelt an sanften Frühlingstagen zwischen Marmorsäulen, die von Weinlaub umsponnen sind, plaudert in vergoldeten Pavillons beim leisen Rauschen des Hydrabrunnens und labt das Auge an den wunderbaren dekorativen Malereien der Kasinos. Auch im Tiergarten sammeln sich Künstler und Dichter zu eifrigen Disputationen. Und die Paläste Paradiso und Belfiori wetteifern miteinander in der Vornehmheit und in der Arabeskenmalerei. Euer zukünftiger Gemahl, der liebenswürdigste Herr des Hofes, gedenkt ein Belvedere auf einer Poinsel im schattigen Park mit springenden Brunnen zu bauen. Es soll ein Geschenk an Eure Hoheit werden.«
Der Herzogin Antlitz belebte sich zusehends. »Wir brauchen dergleichen, um die Erinnerung an Rom zu verscheuchen.« Sie hielt wieder verlegen inne, da die Zunge mit ihr durchgegangen war.
»Man wird alles tun, um Euch zufriedenzustellen,« sagte Bembo. »Und der Erbprinz wird seine Leidenschaft, Kanonen zu gießen, mit der Kunst, Euch zu vergöttern, vertauschen, eine Kunst, die ihm leicht genug sein wird, edle Herzogin.«
»Ihr selbst, verehrter Latinist, wollt hoffentlich auch dazu beitragen, meine gute Laune zu erhalten?« sagte Lukrezia mit leichtem Erröten.
»Plato hat mich nicht nur dem Geist, sondern auch der Schönheit verpflichtet,« erwiderte er mit Selbstgefühl.
»Reitet Ihr gern?« fragte die Herzogin plötzlich.
Bembo nickte lebhaft. »Mein Gehirn ruht auf dem Rücken des Pferdes aus, und ich durchstreife leidenschaftlich gern die Haine des Po, um griechische Götter zu suchen.«
»Dann werdet Ihr so freundlich sein, mich auf meinen Ritten zu begleiten, wenn –« sie wurde verwirrt – »wenn Ihr griechische Götter sucht.« Und mit einem freiem Blick fügte sie schnell hinzu: »In den Gassen von Ferrara liegt, hör' ich, düstre Schwermut und in den Gärten wenig Licht.«
»Unsere Maler fangen es doch in trefflichen Bildern auf,« widersprach Bembo. »Und es ist auch schön, durch die weitwallenden Herbstnebel zu reiten, wenn hier und da aus einem Haingebüsch der Demantstrahl der Sonne blitzt. Das ganze Land um die Stadt ist von einem Netz von Alleen und Buschstreifen übersponnen, herrliche Ulmen laden mit ihrem Schatten zum traulichen Geplauder ein. Und wenn der Po silberne Spiegel in der Sonne formt, wenn der Sand gleißt und die kleinen Waldinseln dunkeln, die Wasser schlafen und die Libellen drüber schaukeln, ist eine Anmut in der Landschaft, die ein empfindsames Herz zur Freude stimmen muß. Und man weiß in Ferrara, daß das Herz der künftigen Herzogin für derlei Schönheiten empfänglich ist.« Er ließ das klare, dunkle Auge ruhig auf ihr ruhen.
Da trat Piccinino ein. »Seine Hoheit, der Herzog von Valentinois.«
»Nehmt Abschied,« sagte Lukrezia. Und ihre Augen drückten plötzlich Angst und Beklemmung aus. Sie reichte ihm die Hand zum Kuß.
Pietro Bembo drückte sie mit Grazie und Gefühl. Lukrezia hatte Eindruck auf ihn gemacht. Er nahm ihr schönes Bild mit auf die Reise nach Ferrara und umrahmte es mit der Phantasie seines dichtenden Geistes.
Die Herzogin blickte nach der Tür. In ihrem Kopf bewegte sich eine neue Welt von Gedanken, in ihrem Herzen eine neue Welt von Gefühlen. Es war ihr bange zumute, da diesen schmucken Ferraresen der unheimliche Bruder ablöste. Sie spielte verloren mit den flirrenden, springenden Sittichen und sah angstvoll nach der Tür.
Da stand auch schon der Herzog im Zimmer.
»Wer war der Edelmann, der so spät von Euch ging?« fragte Cesare mit gerunzelter Stirn. Und er warf sich familiär auf das fellüberlastete Pfühl.
»Ein Abgesandter des Hofes von Ferrara,« sagte Lukrezia kleinlaut.
»Ah, dann war es Pietro Bembo. Nimm dich in acht vor ihm, er ist ein Frauenjäger. Er gilt viel an dem Hofe. Schöne Schwester, Ihr werdet bald mehr Bewunderer Eurer Schönheit dort finden, als es Eurem Tugendstolz lieb ist. Und Ihr werdet die vergessen, die hier Eure Reize in Weihrauchwolken gehüllt haben.« Mit erregter Galanterie verneigte er sich vor ihr. In seinen Augen leuchtete ein lebhaftes Feuer, als hätte er leicht getrunken. Kein Mensch hätte ihm angesehen, daß er eben vom Blutrausch einer Hinrichtung kam. »Ich habe heute vormittag das Programm der Hochzeitsfeierlichkeiten mit dem ferraresischen Gesandten besprochen. Der Kardinal Ippolito ist dazu bestimmt, Euch abzuholen und in die Arme seines Bruders zu führen.«
»Wann soll das Hochzeitsfest stattfinden?« fragte Lukrezia unterwürfig.
»Knapp vor dem Weihnachtsfest wird Ippolito seinen feierlichen Einzug in Rom halten, am 30. Dezember wird im Vatikan die Übergabe der Ringe und Geschenke des Bräutigams stattfinden. Die nächsten Tage werden Feste in den Papstsälen und Komödien in den Kardinalspalästen ausfüllen, darunter eine Moresca, dann sollen Stiergefechte auf dem Sankt Petersplatz abgehalten werden, und am Heiligendreikönigsfest reist Ihr nach Ferrara ab. An diesem Tag wird Rom an Schönheit verarmen.«
»Die Artigkeit steht Euch schön, Herzog,« sagte Lukrezia mit einem Lächeln, während der Frost durch ihre Glieder zitterte.
»Ich werde Euch das Geleite bis vor die Tore Roms geben. Euch weiter zu folgen, verbietet mir mein Herz, das seinen Schmerz nicht gern zur Schau stellen möchte. Ich werde an diesem Tage heimlich eine Art Seelenmesse für eine verlorne teure Frau und Schwester lesen müssen.«
Lukrezia blickte mit leichtem Spott auf. »Wart Ihr es nicht, der mich nach Ferrara verkaufte? Man verkauft gewöhnlich nicht, was einem teuer ist.«
Der Herzog biß sich in die Lippen. Seine Hand spielte mit den Zeichnungen der Schwester. »Die Übereilung tut mir leid,« sagte er scheinbar gedrückt.
»Ist das alles, was Ihr zu bereuen habt?« fragte Lukrezia kalt.
»Ich werde Mittel finden, Euch Rom in Erinnerung zu bringen,« sagte der Herzog ablenkend. »Ich werde Euch auch besuchen.«
»Tut das nicht,« warf die Herzogin rasch und angstvoll ein. »Tut das um Gottes willen nicht. Denn es könnte leicht geschehen, daß ich mich glücklich schätze, von Rom entfernt zu sein.«
»Von Rom! Aber – von mir?« Er zielte mit seinem beleidigten Herzen in die Tiefe ihrer Brust. »Lukrezia, Ihr tut mir weh.«
»Kann das jemals eine Frau? Bis jetzt hat der Herzog Valentino den Frauen weh getan. Es ist spät, Herzog. Meine Damen warten.«
»Ihr wollt uns nicht das Vergnügen machen, das Fest der Mädchen zu besuchen?«
Lukrezia machte eine böse Lippe. »Es würde meinen zukünftigen Gemahl wenig freuen, wenn er erführe, daß sich seine Braut in die sinnlichgemeine Sphäre eines Lüstebacchanals begibt, die deshalb nicht weihevoller erscheint, weil der Papst und sein Hof in sie hinabsteigt.« Sie erhob sich und rauschte an ihm vorbei in eine Ecke voll Blumenwolken hinein. »Herzog Cesare, ich bin es müde, den Ekel länger zu ertragen, mit dem man mein Herz erfüllt hat durch all die Jahre her, da meine Schönheit sich zum Verderben andrer entwickelt hat. Was will man eigentlich mit meiner Seele? Was hat euch allen dieses bescheidne Ding getan? Muß alles, was hold und anmutig ist, durch die Berührung mit euren Händen und Blicken beschmutzt werden? Sorgt dafür, daß wenigstens diese letzten Wochen in Rom eines reinen Gedenkens wert seien, sorgt dafür, daß ich mit versöhntem Herzen auf den Rest meiner Brauttage zurückblicken kann, daß ich nicht eine Erinnerung an die Schmach und Verderbtheit eines Hofes mit mir nehme, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Glauben an das keusche Wunder einer Frau zu vernichten. Bis wohin wollt ihr denn Eure Schamlosigkeit noch treiben? Seid ihr nicht schon an der Grenze des Möglichen angekommen? Ich kenne keine unverdorbene Frau an diesem Hof. In allen Frauenadern fließt ein vergiftetes Blut, durch euch alle vergiftet, die ihr nach Stand und Würde zu Wächtern des Tugendhortes berufen wäret. Lodert euch denn nicht schon das Feuer der Verdammnis entgegen? O diese Frauen! Wen würde ich denn heute an der Ballustrade erblicken, vor der sich die nackten Leiber der abscheulichsten Dirnen Roms in wollüstigen Zuckungen wälzen? Die Damen der vornehmsten Geschlechter, die Buhlerinnen der Kardinäle, die Tänzerinnen der Prälaten. Meine Seele speit den Ekel endlich von sich. Kein römischer Kaiser hätte die Durchtriebenheit so weit gezüchtet wie Ihr, Cesare Borgia, keiner mit der edlen, frohen Gabe Eros' so zügellos Raubbau getrieben, keiner die Heiligkeit der Frauenwürde so in den Kot gezerrt wie Ihr, Herzog Cesare Borgia! Bedeckt Euer Haupt mit Asche und tretet mit bußfertigem Herzen vor den Altar Gottes, wenn Ihr wollt, daß der letzte Rest meiner Achtung vor Euch nicht schwinden soll.« Sie ging mit hochwogender Brust nach der Tür und zog die Glocke.
Aber keine der Hofdamen erschien.
»Was ist das?« fragte Lukrezia bestürzt.
Cesare saß mit vornüber gebeugtem Haupt auf dem Lager von Fellen und Samt und zuckte mit keiner Wimper. Draußen lag eine dumpfe nächtige Stille, erfüllt von einer unheimlichen Schwüle, die beinahe süßlich roch. Lukrezia glaubte plötzlich das leise Knirschen von Zähnen zu hören, als lägen irgendwo lauernde Panther verborgen. Ihre Augen füllten sich mit Schrecken. »Was – ist – das?« wiederholte sie mit erstickter Kehle.
»Die Antwort auf Euern bösen Sermon,« sagte Cesare, ohne das Haupt zu erheben. »Ich habe Befehl gegeben, daß sich die Damen zur Ruhe begeben. Es ist niemand zu Eurer Bedienung da – als ich.«
Ihre Augen wurden gläsern. »Ich verstehe – Euch – nicht –.«
»Die Reue ist über mich gekommen. Nicht jetzt, da die Zornpeitsche Eurer Rede über meine Seele klatschte, schon gestern, als ich Euer Leben und das meine überdachte, als ich mir den Abschied von Euch, den Ritt nach Ferrara mit den Farben der Verzweiflung ausmalte. Da riß es mich zusammen und ich warf meinen ganzen unseligen Menschen in das Glutbad der Reue. Als ich zu Euch kam, strich ich das tolle Abendprogramm aus und lud mir den Zorn des heiligen Vaters auf mein Haupt. In diesem Augenblick wird er durch seine Säle rasen und seinem Sohn fluchen, der ihn um die schöne Augenweide gebracht hat. Lukrezia!« Er sprang auf und schritt wie ein wildschäumender Eber durchs Gemach. »Ich – o, ich leide fürchterliche Qualen.«
»Cesare!« schrie Lukrezia auf. Sie pflanzte sich mit ausgestreckten Armen in einer Ecke auf dem Untergrund eines goldbrokatnen Vorhangs auf. In ihre Augen jagte das Entsetzen.
Der schreckliche Titan der Lüste, wie aus des Erebus Schlünden entstiegen, wälzte seine Pein mit blutunterlaufenen Augen von der Seele. Es klang wie das Dröhnen einer fernen, von Wassern begrabenen Glocke an ihr Ohr. Immer mächtiger schwoll es an, um endlich in Sturmrufen höchster Not auszubrausen. »Dieser Kadaver ist nicht mehr Mensch, göttliche Lukrezia, ich weiß es! Er ist von tausend Teufeln in höchste Bedrängnis gejagt und windet sich jetzt unter ihren Krallen. O, wüßtet Ihr, was ich leide, erdulde! Was ich gelitten all die Jahre her, da Eure Schönheit schwesterlich neben mir erblüht war mit Rosenpracht und -duft und ich aller Augen auf den Tempel Eurer Keuschheit gerichtet sah. Da stachen Skorpione nach meinem Herzen, ihr Biß entzündete meine Sinne, und es geschah, daß eine gräßliche Hölle in mir triumphierte. Wisse es, Lukrezia, es gibt einen, den ich anklage vor dir und Gott, daß er mir teuflischer Wegweiser in dem Labyrinth meiner Gefühle wurde. Es gibt einen, der mir die Skrupellosigkeit des Gewissens predigte, einen, vor dem meine Verehrung bis in den Staub eine Forderung der Menschennatur sein sollte, und der dennoch mich zwang, ein Hohngelächter über den Kniefall vor ihm auszustoßen. Dieser eine schläft jetzt oder schleift mit schlappen Gliedern durch die Nacht der Säle und stöhnt schweißgebadet nach der erlösenden Umarmung eines Weibes – und Lukrezia ist ihr Name!«
Die Herzogin fiel blaß und hölzern in die seidnen Polster.
»Siehst du, der Schrei erstickt in dir, wird nicht geboren, aus Angst, die keusche Luft zu erschüttern. Das Grauen sitzt in deiner Kehle. Aber es ist, es ist! Mein Vater, der Vikar Gottes, bebt in wilden Gedanken, die Steine schaudern machen könnten, in deine süße Schönheit hinein. Und er ließ mir das erregte Blut, das furchtbare Erbe eines furchtbaren Menschen, der das Kreuzzeichen über die Christenheit segnend schlägt, mit beschmutzter, vertierter, geschändeter Seele. Da warf ein dunkler Feind Feuerbrände in mein Herz. Als ich es sah, was er für dich empfindet, da schrie mein Blut gegen ihn, da jagte und lohte die Eifersucht durch meine wehrlosen Pulse – ich neidete ihm den schönen Bissen – ich – o, bedecke Augen und Ohren, daß der Schauder dich nicht würgt – ich schlug meinen Vater, den Papst, mit diesen meinen Händen, ich schlug ihn! Liebe und Neid schlugen ihn, den heiligen Vater der Christenheit! So öffnete ich den Abgrund meiner Seele, so spie ich der Natur ins Angesicht. Schlag mich tot, Lukrezia!«
Mit ächzender Brust warf er sich in den Stuhl und bedeckte das Gesicht. Die Sittiche glucksten zart, und fern zitterte eine feine Glocke.
Lukrezia lag wie ein zur Strecke gebrachtes Wild in den Fellen. Es sauste um ihre Sinne. Die Nacht bekam rotgrüne Ringe, die einen fürchterlichen Tanz vor ihren geschloßnen Augen aufführten. Sie glaubte das Krachen ihrer Knochen zu hören, die das Grauen zerbrach.
Cesare wühlte mit ausgetrockneter Kehle in seinem Jammer weiter. »Und da umhalste er mich – der Vater den Sohn – und mit lallender Stimme schenkte er mir kraft seiner väterlichen Autorität deine süße Herrlichkeit, den Fluch abstreifend von meinem Haupt –«
»Du lügst, Würger!« wimmerte es aus ihrer Brust.
Aber er taumelte darüber hinweg. »Cesare lügt nicht. Vor deinem empörten Blut liege ich hier und bekenne reumütig meine und seine Sünde, dich begehrt zu haben in blutschänderischer Sinnennot. Spei mich an, den Auswurf des Menschengeschlechts, züchtige mich mit glühenden Ruten, laß Ratten und Mäuse an mir nagen, aber nur segne mich dann in den Martern, daß ich auferstehe aus der Verdammnis Schrecken.«
Wie rieselnde Bächlein liefen die Schauer über ihren Leib. Keine Regung des Mitleids wagte sich aus ihrer geschändeten, getretenen Seele hervor. Keinen Blick erhob sie zu dem schrecklichen Giganten der Sünde.
Er rauschte weiter, der wilde Sturzbach seines Herzens. »Nur eine Gnade begehr' ich, Lukrezia. Und sie wird mich entsündigen. Was jetzt in höllischen Gelüsten mich durchflutete, kann ersterben durch die Gnade. Reinige mich nach Griechenart, du Reine, kühle mein Blut durch die Reinheit deines Wesens, sänftige das Brausen, indem du deine Göttlichkeit vor mir enthüllst –«
»Cesare!« Es war wie ein Lallen. Schatten des Orkus geisterten um sie.
Und der Herzog zitterte auf den Knien an sie heran und streichelte mit den Händen die Luft um ihren Leib, während neue Glut von seinen Lippen sprang. »Du bist ja ein von kostbaren Schleiern verhülltes Götterbild, das seine reinen Zauber nur ausströmen kann, wenn die Hüllen fallen und deine nackte Schönheit in schimmernder Majestät das Loblied dem Schöpfer singt. Das Menschliche fällt dann mit ab und Gottes schönster Gedanke liegt segnend vor dem menschlichen Auge. Da will ich stillhalten in höchster Andacht, nur mein Blick soll die geoffenbarte Gnade Gottes in vollen Zügen trinken. Laß mich dich schauen als die keuscheste Frauenperle Roms, als das überirdische Weib, als das von den Künstlerhänden Gottes geformte Sinnbild geheiligter Schönheit. Hier ist ein Dolch –« die Waffe blitzte in seinen Händen – »du stößt ihn mir in den Nacken, wenn meine Tierglut deine geweihten Glieder entheiligt. So stell ich Gericht und Urteil deiner Seele anheim, und du wirst sie gebrauchen kraft deiner Keuschheit. Lukrezia, willst du mit diesem Abschied von Rom deinen Cesare beglücken? Willst du seine zerschlagene Seele durch die Bethesdawellen, die deine reine Nacktheit verströmt, erlösen von aller Sündenschlacke? Läutre mein Herz im Namen Aphroditens, nahe dich mir mit dem Blumenzauber der uranischen Gottheit, nur geschmückt mit dem Diadem deiner weiblichen Scham. Und ich will vor dir stumm im Gebet liegen wie Apelles vor dem Reiz seines Lieblings und will Rosen streuen über dein goldnes Haar und dich mit Perlen behängen und deine süße Haut mit Narden besprengen. Und in dem köstlichsten Gemach meines Palastes will ich die Andacht vor Aphroditens Altar feiern, dort, wo die Blumenlasten goldnen Zierat bedecken, wo Himmel sich niederneigen und der Glanz indischer Kristalle die Nacht durchblitzt. Bevor der Brautnacht brünstiger Jubel durch dein Herz klingt, öffne dein Heiligtum für meine Gott preisenden Gebete!«
Sein Glutatem hauchte an ihren Lippen vorbei.
Sie schwieg wie ein starres Bild.
Aber Cesare wußte, was dieses Schweigen bedeutete. Er erhob sich. Mit wankenden Knien wich er von ihr und tauchte in das Licht der Kerzen. Dort fand er seine fürstliche Haltung wieder.
In dieser Nacht rauschte es durch die Träume Lukrezias wie blutrote Flammenströme. Immer sah sie den Dolch in ihren Händen blitzen.
Aber in der Nacht vor dem Einzug des Kardinals Ippolito d'Este, der mit einer Kavalkade von fünfzig Reitern die schönste Braut nach Ferrara zu entführen kam, feierte Cesare Borgia seine eigenartige künstlerische Andacht vor dem Götterbild Lukrezia.
Eine schimmernde Adventnacht voll heiliger Klarheit lag über Rom.
Und diese Nacht löste sich auf in Schauder und Weh. Im Palast des Cesare Borgia, inmitten von Schönheit und Pracht, brach alles Menschentum zusammen.
Schwüle Tropenluft erstickt die seltsame Herrlichkeit. Marmorwände, Statuen, Bilder, Blumen, Farben und Duft weben an der sinnlichen Harmonie des Gemaches. Ein Gestein von schimmernder Turmalindunkelheit hebt sich im Geviert empor, gekrönt von einem Arabeskenfries, der sich in einer saphirblauen seidenen Decke fortsetzt, aus deren Mitte ein kleines Lichtmeer strahlt, von phantastischen Kristallgehängen farbig gebrochen. In den Ecken prangen riesige Blumenkörbe, wo aus sanftem Grün gelbe Narzissensterne blitzen, dunkle Violen ihren Duft verströmen, der Hyazinthen Farbenglut leuchtet und die Doldenpracht des Flieders sich zu gigantischen Sträußen emporbaut. Alle Blüten schießen wie bunte Flammen aus dem grünen Grund. Und darüber hin blitzt das Gefieder zahmer Rosenstare und Tigerfinken, die frei über den Blumenhain flattern. Unter dem Standbild einer mächtigen, starren, spiegelnden Achatsphinx mit Smaragdaugen, die geheimnisvoll flimmern, breitet sich ein kostbares Ruhelager von Samt und Seide aus, durchduftet von der Rosen zartem Seelenhauch. Ein genuesischer Schemel aus Silber und Elfenbein steht daneben, umwogt von babylonischen Teppichwellen, die über den ganzen Estrich fließen. Aus einem goldflimmernden Dreifuß steigt wollustweckender bläulicher Rauch zum grünseidnen Baldachin empor, der sternbesät darüber schimmert, und aus breiten Amphoren wehen rosenrote Flammen wie heilige Opferfeuer aus eleusinischen Altären. In der Höhe aber schweben leise klirrend stalaktitartige Kristallgehänge, in denen sich das Licht regenbogenfarbig bricht.
Auf dem rosenfarbigen Polsterpfühl ruht der Leib der Lukrezia Borgia. Er ist zur Anbetung für den Sendling Luzifers bereit. Der Herzogin Antlitz ist blaß wie morgendliches Mondlicht. Das goldne fließende Haar ist durch blitzende Edelsteinreifen gebändigt, neben denen elfenbeinerne Kämme leuchten. Schneeschimmernde Brabanter Gewebe falten sich lose in durchsichtigen Schleiern um die schwellenden Glieder, unter den Brüsten von einem demantfunkelnden Gürtel zusammengehalten. Um den linken freien Arm ringelt sich eine goldne, schuppige Schlange mit Rubinaugen, und in der Rechten blinkt Cesares Dolch.
Der Herzog kniet neben ihr, schweigend, wie zum höchsten Opferfest gesammelt. Und er grüßt ihre Lippen mit einem Kuß, der die Zeit stillestehen heißt.
Wie aus verborgnen Hainen quillt unsagbar süß der Locklaut der Nachtigall, und mitten hinein girren Tauben ihre brünstige Lust. Die Dämpfe aus den Opferpfannen verdichten sich zu farbigen Nebeln, die ihre Schleier über Körper und Sinne breiten. Leise beginnt ein ferner Brunnen waldquellenartig zu raunen. Lukrezia horcht dem reinen Lied, und es ist ihr, als tönte darin der letzte Akkord ihrer sterbenden Unschuld. Sie öffnet das Auge wie im halben Traum. Über ihr, zu Füßen der starren Sphinx, liegt auf einem silberhellen Felsen ein altrömisches Instrument mit zerrißnen Saiten, ein Heptachord, als hätte es eben der Musengott in Trauer von sich geschleudert. Es wird ihr zum Sinnbild ihres zerrißnen Lebens.
Und Cesare erhebt sich im veilchenduftenden Nebel, und seine Hand streichelt über die siedende Haut der hingeopferten Aphrodite. Die Edelsteine klirren – die Rosenstare pfeifen – wollustsüße ferne Musik schmeichelt heran – der Lüster hebt sich, Dunkelheit naht, schwindet wieder, verdrängt von rosenrotem, schwerem Dämmerschein, der aus einer langsam herabschwebenden Ampel seine sinnberückenden Zauber über alle Pracht zu spinnen beginnt.
Da löst Cesare das seidene Gewebe auf Lukrezias Leib. Arkadisch frei fängt die zarteste Frauenhaut in Rosentönen zu leuchten an. Der furchtbare Genießer küßt das Lilageäder der allerschönsten Hände – das erhabne Rund der vollen Brüste –
Der Weihrauch dampft in dicken Wolken aus den silbernen Pfannen.
Durch die Sinne Lukrezias blitzt es. Phantasien, aus des Avernus glühenden Schlünden geboren, umnebeln ihren Geist, durchtaumeln ihr Gehirn – ihr Grauen greift fester nach der Dolchklinge – ihre Augen zielen nach dem gebeugten Nacken – Todesschauer umwehen sie – ihre Wimpern werfen Nacht über ihre Augen – die Welt um sie beginnt zu rasen.
Das letzte Wort, das ihre Sinne verarbeiten, ist: Kleopatra.
Da gebiert sich aus dem Höllenkessel Cesares das Unbeschreibliche. Des Kozytus Wasser triefen von seiner Seele und aus seinem Munde strömt der Rachendampf des Zerberus über Lukrezias Blütenleib.
Trauernd senkt die Natur über ihr gegebenes, von einem Menschen zerrißnes Gesetz das Haupt. – – –
Am andern Morgen zitterten die Hände der Kammerfrau Sansobina, als sie das Haar der schönen Herzogin durchkämmte; denn sie erschrak vor der Blässe und Starrheit des bräutlichen Antlitzes.
Und im Nacken des Herzogs Valentino bemerkte der Kammerdiener Grimaldi eine kleine, kleine Wunde, als ob eine Dolchspitze leicht darauf gespielt hätte. Aber diese Dolchspitze hatte dem brausenden Strom des atridenhaften Blutes keinen Ausgang geschaffen. Und der Sonnengott hatte seinen Wagen nicht nach rückwärts gelenkt; feierlich hehr, nur blutrot stieg er aus dem sabinischen Gewölk in den Brauttag hinein.
*
Aus der Richtung von Ponte molle trabte die glänzende ferraresische Kavalkade heran. Der Kardinal Ippolito d'Este führte sie im wallenden Purpur mit seinen Brüdern Ferrante und Sigismondo. Bischöfe und Edelleute von Ferrara in brokatnen Gewändern, goldne Ketten um den Hals, folgten mit dem Geleite von dreizehn Trompetern. Von den Weinhängen des Monte Mario stiegen Feuersäulen in den strahlenden Wintertag auf.
Zweitausend Söldlinge standen vor den Toren Roms. Dann trabten hundert Edelleute des Herzogs Valentino den Ferraresen entgegen. Cesare selbst ritt neben dem französischen Gesandten und begrüßte lächelnd den Kardinal Ippolito. Neunzehn Kardinäle standen hinter der Porta Flaminia. Unter Hörnerschall und Trompetenwirbel zog der Sendling Ercoles in die heilige Stadt nach dem Vatikan, wo Alexander ihn begrüßte.
Unter endlosen Deklamationen und Ansprachen verging der Tag. Erst am Abend führte Cesare den Kardinal von Ferrara nach den Gemächern der Lukrezia Borgia.
Das Antlitz der herzoglichen Braut hatte Alabasterglanz. Ihre Glieder erdrückten schimmerndes Gold und Weiß, herrlicher Brokat und Zobel, Perlen und Rubine.
Der Kardinal schrieb noch am selben Abend an seine schöne Schwester Isabella Gonzaga nach Mantua über – das Brautkleid der Lukrezia Borgia.
Und der ferraresische Gesandte Giovanni Luca Pozzi schrieb an seinen Herrn, den Herzog Ercole: Die Braut ist sehr klug und liebenswürdig und von guter Natur. Sie besitzt vollkommene Grazie in allen Dingen nebst Bescheidenheit, Lieblichkeit und Sittsamkeit. Auch ist sie gläubige Christin und gottesfürchtig. Morgen soll sie zur Beichte gehen und am Weihnachtsfest kommunizieren.
An den Schlußtagen des alten Jahres wurden Spiele, Tänze und Komödien aufgeführt. La Comedie del Menechino des Plautus gefiel ebenso wie eine Pantomime, die die Gloria Domus Borgiae verherrlichte.
Und der Himmel stürzte nicht ein. Auch kein Kamin brach über der Lügenwelt zusammen.
Unter einem Ehrengeleit von zweihundert Reitern, Buffonen und Musikanten zog Lukrezia Borgia, die ein Hofstaat von hundertachtzig Personen umgab, am Heiligendreikönigstag des Jahres 1502 von Rom hinaus, in der Seele vergiftet durch den Dämon Borgia. Einhundertfünfzig Maultiere und viele Wagen trugen goldne und seidene Lasten nach Norden. Es war der Schatz, den der Papst der Christenheit durch Almosengänger und Opferstöcke abgebettelt hatte, um damit seine geliebte Tochter zu schmücken.
Der kleine Rodrigo mußte zurückbleiben. In der Camera del Papagallo nahm die Herzogin Abschied von ihrem furchtbaren Vater, von ihrem furchtbareren Bruder. Sie ritt auf einem weißen Zelter, Scharlach und Hermelin hüllten ihren kostbaren Leib ein.
Cesare begleitete sie noch bis vor die Porta Flaminia. Dann entschwand seinem Auge der Scharlach und der Hermelin. Die Herzogin nicht seinem Herzen. Dieses schlug gewaltig.
*
Noch am selben Abend stand in Monterotondo Tiziana am Turmfenster, den Knaben Valerio am Arm. Sie blickte angestrengt hinüber nach Castel nuovo, wo heute Lukrezia Borgia die erste Nachtstation halten sollte. Heiteres Mutterglück durchleuchtete wie Frühlingsgold ihr dunkles Auge. Und aus dem reinen Frauenherzen hob sie ein Dankgebet zu Gott empor. Wird Ferrara gutmachen, was Rom an dir gesündigt? sann sie in die rosenrote Weite. Du schönes Opfer zweier rastloser Sünder, geschändetes, gebrochnes Herz, hin und her geworfen von den Launen eines gräßlichen Vaters, eines gräßlichen Bruders! Ich kannte deine Geheimnisse nicht, aber ich fühlte sie in deinen Augen brennen und sah dich leiden unter dem Peitschenschlag eines Geschicks, das zu brechen du keine Kraft hattest! Du warst mehr unglücklich als schuldig, mehr beklagenswert als fluchwürdig, schöne Freundin! Mögen dich die Schattenbilder der Erinnerung nicht schrecken, du süßes Kind! O, führte dich ein guter Engel jetzt in reinere Gefilde, wo du die Schmach tilgen könntest, die andre auf dein Haupt gehäuft!
Sie wandte sich um. Der Kardinal stand hinter ihr. Rote römische Rosen wand er seiner Frau ins Haar. Und leise sprach er dazu: »Es ist ein Abschiedsgruß der Herzogin Lukrezia. Sie gab mir die Rosen für dich, Tiziana. Und eine Träne schimmerte in ihrem Auge.«
Und er verschwieg ihr, was die Herzogin ihm heimlich in sein Ohr geflüstert: »Hütet Donna Tiziana, Kardinal! Es lauert ein Vampir ihrem Herzblut auf!«
 Jeden Tag brachte ein Eilbote dem Papst ein Blatt mit der Handschrift Lukrezias. Eine goldne Kassette bewahrte die süßen Grüße. Und die Kavaliere, die von den einzelnen Reisestationen zurückkehren mußten, erzählten wunderbare, rührende Dinge von dem Empfang in allen Orten.
Jeden Tag brachte ein Eilbote dem Papst ein Blatt mit der Handschrift Lukrezias. Eine goldne Kassette bewahrte die süßen Grüße. Und die Kavaliere, die von den einzelnen Reisestationen zurückkehren mußten, erzählten wunderbare, rührende Dinge von dem Empfang in allen Orten.
Der Papst hätte so froh sein können. Aber er war nicht froh. Die päpstlichen Auditore brachten Nachrichten von dem unzufriednen Volk der Römer. Man wußte nun, wo das Blutgeld der Steuern, das Kirchenalmosen und der Bettelpfennig hinkamen. Die goldbeladnen Maultiere der Lukrezia konnten die Römer nicht aus dem Sinn bekommen.
Der Papst ließ in seinem leichten Gruseln Cesare kommen.
»Gott segne dich!« begrüßte er ihn mit verrosteter Stimme. »Sieh, was man aus Deutschland für Briefe an das Oberhaupt der Christenheit zu schreiben wagt.« Und Cesare las einen Schwall von Verunglimpfungen und einen Mahnruf an alle Länder, das Joch abzuschütteln, das unter der Vorspiegelung der religiösen Lenkung den armen Gläubigen auferlegt werde. Der Vatikan, hieß es, wimmle von Kupplern, Dirnen und blutschänderischen Individuen, der Ablaß werde verkauft, um die Taschen Alexanders und seines Sohnes zu füllen, die Tochter Lukrezia auszustatten und die romagnolischen Städte mit Krieg zu überziehen. Der größte Teil des Adels sei verarmt, verbannt oder vernichtet, und seine Burgen und Städte seien den Nipoten des Papstes ausgeliefert worden. Die ehrlichen Kardinäle seien vertrieben, und die übrigen bestochenen wagten es nicht, sich zu wehren aus Furcht vor der Rachsucht des alten Apostelschänders. Cesare Borgia sei vom Kardinal zum Meuchelmörder avanciert.
Cesare las unbewegt den ohnmächtigen Verdammungsbrief. Kein Muskel zuckte in seinem Antlitz. Es waren nicht die ersten wütenden Faustschläge, die auf den Papsthof niederfielen. »Wer hat Euch das eingehändigt?« fragte er gelassen.
»Der Datar Kardinal Ferrari, von dem in dem Brief auch die Rede ist.«
»Ja, ja, man wirft ihm vor, daß er Ehebündnisse und -scheidungen durch Bestechungsgelder erzwungen, Ämter und Würden verkauft hat und daß er – o allerheiligster Vater, der alte Fuchs wird Euch noch in einen üblen Ruf bringen, und er scheint seine Ruchlosigkeit dadurch bemänteln zu wollen, daß er Euch die Eurige so unter die Nase schmiert. Ich rate Euch, mit dem gefährlichen Menschen aufzuräumen.«
Der Papst hatte den Datar ins Herz geschlossen. Er wollte sich Zeit lassen, einen Freund zu beseitigen. Wie ein unwilliges Kind wehrte er sich gegen die Zumutung Cesares. Er warf den beleidigenden Brief beiseite. »Ich habe andre Sorgen, als mißliebige Kardinäle unschädlich zu machen. Die Römer wollen die goldnen Maultiere der Lukrezia nicht vergessen, sie werden aufgewiegelt, sie rotten sich zusammen, doch konnte der Governatore noch keine Handhabe finden, um den oder jenen zu verhaften.«
Cesare runzelte die Stirn. »Ihr werdet gut tun, Civita Castellana zu befestigen, damit wir uns im Falle eines Angriffs zurückziehen können. Aber noch besser, Ihr verlaßt Rom für einige Zeit. Ich will Euch ein kleines Reiseprogramm entwerfen, allerheiligster Vater. Schifft Euch mit mir zu Ende des Karnevals nach dem eroberten Piombino ein, wir wollen dort einen schönen Hafen bauen und es befestigen. Mittlerweile haben meine Truppen Camerino und Urbino genommen, und Ihr könnt dann gleich die neuen Städte besichtigen.«
»Das ist prächtig, das wird mich kräftigen, mich trösten. Ich habe so wenig Trost, seit Lukrezia weg ist.« Seine Augen tränten.
»Moncada, ihr Kavalier, schreibt, daß ihr Einzug in Ferrara glänzend war. Alfonso ist aus seiner Verschlossenheit erwacht, seit die schöne schwesterliche Sonne seine Seele beleuchtet hat. Im Vertrauen, allerheiligster Vater, ich denke daran, diese Menschen nicht lange in ihrem Glück schwimmen zu lassen. Wenn Alfonsos Staatskunst mit Venedig liebäugeln sollte, muß auch der arme Erbprinz die Wege gehen, die die Gatten Lukrezias zu gehen pflegen.«
Der Papst erschrak nicht mehr. Die Mordpläne seines Sohnes hatten bereits jede Ungeheuerlichkeit für ihn verloren. Gebietserweiterung, Vergrößerung der Hausmacht, das waren Ziele geworden, zu deren Erreichung jedes Mittel des Papstes Sanktion erhielt. Grauenlos sah Alexander seinem Sohn in die Augen. »Freilich wird Ferrara entweder eine treue Papststütze werden müssen oder–« Er nickte sein gefühlloses Ja.
Cesare nahm wie von ungefähr den Anklagebrief wieder in die Hand. »Dieses Zeter- und Mordioschreien führt mich auf einen Gedanken,« sagte er mit gefurchter Stirn. »Der wilde Rufer schreibt, die ehrlichen Kardinäle seien vertrieben. Ich vermisse unter diesen ehrlichen Herren noch einen –«
»Der wäre?«
»Der absonderliche Giambattista Orsini.«
»Wir brauchen das Geschlecht noch,« sagte der aushorchende Papst, während er die weiche Samtdecke über die fröstelnden Knie zog. »Aber ich hätte immerhin eine Handhabe, ihn zu packen, er soll, höre ich, gar seltsame Anschauungen unter den Kardinälen verbreiten, Reformbestrebungen innerhalb des Kirchenlebens das Wort reden –«
»Dahinter sind auch meine Agenten gekommen,« bestätigte Cesare. »Der gute Kardinal befaßt sich nicht nur mit Altertümern, Malerei, Dichtkunst, Eloquenz und Scholastikbekämpfung, sondern auch mit – Liebe. Er hält jene Tiziana de' Calvi geradezu als Ehefrau in seiner Gewalt, und es dringt niemand in die sorgfältig gehütete Häuslichkeit ein. Aber wir würden uns nur den Haß der römischen Barone zuziehen, wollten wir jetzt zugreifen, um dem Unwesen zu steuern. Doch kommt noch anderes dazu. Wenn mich nicht alles trügt, spinnt der unfähige Feldhauptmann Pagolo Orsini Ränke –«
Der Papst fuhr in die Höhe. »Der alte Narr? Will er mir das Herz beunruhigen? Die Orsini sollten –?«
»Ich tue, als wüßte ich nichts,« sagte Cesare kühl. »Unter meinen Kondottieren ist der Herzog von Gravina ein befähigter Kopf. Solange es geht, will ich die Fähigkeiten der Orsini ausnützen, dann aber Gnade ihnen Gott.«
Der Papst ließ die Abgesandten von Nepi vor und nahm ihre Huldigung entgegen. Cesare vertiefte sich in die Pläne von Piombino.
*
Mitte Februar schiffte sich Alexander mit Cesare nach Piombino ein. Ein Tanz schöner Frauen im Evakleid unterhielt den Papst in der eroberten Stadt auf das angenehmste. Auf der Rückfahrt überfiel sie ein Seesturm schrecklichster Art. Schon nahm man an, der Himmel habe den Aufruhr der Elemente ins Werk gesetzt, um die Borgiasippe zu verderben. Aber sie entkamen alle den Fangarmen der Hölle.
Mit Ungeduld erwartete Cesare den Sommer. Im Verein mit Perugia, Siena und den verbannten Medici wollte er sich auf Florenz stürzen. Da gebot abermals das mißtrauische Frankreich Halt. Cesare wütete. Sein Gemüt suchte nach einer Ablenkung. In der Engelsburg saß noch der schöne Jüngling Astorre Manfredi, der gewesene Herr von Faenza. Seine Einsamkeit war von schrecklichen Gesichtern erfüllt.
Eines Morgens schwamm im Tiber der gebrochne Blütenleib des schönen Faenzer Jünglings und der seines Bruders Oktavian. Rom selbst trauerte um das geknickte Leben, als wäre er der Herrscher der Stadt gewesen. Und man wußte, wer der Henker war.
Cesare reiste sofort zu seinen Truppen, die in der Nähe von Cagli ihr Feldlager hatten. Er fand sie undiszipliniert und durch Müßiggang verderbt. Wie sollte er so Urbino in seine Gewalt bekommen? Drum holte er aus der Rüstkammer seiner Schandtaten eine Waffe hervor, die nie versagte: die Heimtücke. Er sandte Boten an den jungen Herzog Guidobaldo von Urbino und trug ihm ein Bündnis an. Der vertrauensselige Tyrann schlug mit Freuden ein und sandte Cesare Hilfstruppen ins Lager von Cagli. Kaum waren diese angekommen, wurden sie – entwaffnet. Guidobaldo erfuhr die Schreckensnachricht, als er beim Abendmahl saß. Noch in der Nacht flüchtete er in die Bergwildnis seines Landes und durchirrte die Gegend im Pilgerkleid tagelang aus Furcht vor den Schergen Cesares, bis es ihm gelang, nach Mantua zu entkommen. Auch sein junger Erbe Francesco Maria della Rovere entkam den Krallen des nahenden Geiers. Ende Juni war der ganze Staat Urbino von den Truppen Cesares besetzt.
Der Herzog der Romagna fand reiche Beute vor. Der Palast, den noch Federigo da Montefeltre erbaut hatte, war ein Juwel architektonischer Schönheit. Er enthielt Kostbarkeiten aller Art. Die wunderbare Bibliothek allein kostete einst den Herzog Federigo dreißigtausend Dukaten. Vierzig Kopisten waren in den schönen Räumen damit beschäftigt, die klassischen Schätze der Alten abzuschreiben. Die Tage waren erfüllt von Disputationen und Waffenübungen. Es mußte ein anziehendes Bild gewesen sein, Federigo unter dem blauen Himmel an seiner reichen Gartentafel schmausen und bechern zu sehen, während ihm seine Gelehrten den Ovid und Strabo vorlasen, und nicht weit davon auf der blumenschweren Wiese die Jugend des Städtchens sich in Waffen und gymnastischen Spielen übte. Für den Aufbau des Schlosses hatte Federigo selbst alle Maße angegeben und auch die Pläne für den herrlichen Hallenhof entworfen. Besondere Bewunderung erregte bei den fürstlichen Gästen die farbige kassettierte Decke in Gold, dann die Intarsienarbeiten an den zahlreichen Türen der Prachtsäle, das Getäfel im Arbeitsraum des Herzogs und die hebräische Bibel auf einem kostbar geschmückten Adlerpult.
Aber auch Federigos Sohn Guidobaldo hatte das Schloß durch Kunstschätze bereichert, und seine Gemahlin, die schöne Elisabetta Gonzaga, hatte um sich eine Schar von Gelehrten und Künstlern versammelt, die den Hof weit berühmt machten. Elisabetta, die rosenschöne Frau, teilte nun getreulich das Schicksal ihres flüchtenden Gemahls.
Cesare stand im kunstgesegneten Heiligtum Urbinos und nahm Besitz von allen Kostbarkeiten. Das Glück war ihm hold. Noch in Urbino kam die Nachricht, daß auch die kleine Tyrannenstadt Camerino in die Hände der herzoglichen Truppen gefallen sei. Durch ähnlichen Verrat nahm Cesare den Dynasten der Stadt Giulio Varano mit seinen zwei Söhnen gefangen. Fünf Eilboten galoppierten nach Rom, dem Papst die Frohbotschaft zu bringen.
Alexander weinte Freudentränen. Schamlos wetteiferten Dichter und Improvisatoren, das Lob Cesares zu singen, das in kriecherischen Panegyriken unters Volk geworfen wurde.
Der Papst wußte gar nicht mehr, wie er das Geld beschaffen sollte, welches die Feste verschlangen. Da erinnerte er sich des Mahnrufes seines Sohnes. Er dachte an den Datar Ferrari.
Der alte Geizhals, eine Geiernatur schlimmster Art, verschluckte drei Tage nach dem Fall von Camerino in seinem Landhaus auf dem Quirinal ein weißes Pulver, das ihm im Namen des Papstes der Arzt Pinzone gereicht hatte. Der Papst kam hierauf selbst in das Sterbezimmer des alten Freundes und nahm das Inventar auf. Der tote Geier hatte in seiner Truhe dreißigtausend Doppeldukaten und Gold- und Silbergefäße im Wert von zehntausend Dukaten liegen. Als der Papst die Schätze sah, überkam ihn vor Freude eine Ohnmacht. Und mit wahrer Schadenfreude las er einige Tage darauf die Epigramme, welche spottlustige Römer auf den Sarg des Kardinals geheftet hatten. Selbst der Sargmacher wollte sich an dem berüchtigten Geizhals rächen. Hast du dein Lebelang gegeizt, so will ich's jetzt auch. Und er nahm weniger Holz, so daß der Sarg zu klein wurde. Und als der Leichnam des Kardinals nicht hinein wollte, preßte er ihn etwas unsanft, so daß die bucklige Figur noch wie eine Karikatur auf die eigene Verwachsenheit aussah. Der Papst aber ließ seine Wagen vorfahren und Gold und Silber des vergifteten Kardinals aufladen. Um die Wagen schlichen haßerfüllt die Lumpen und Bettler Roms wie lauernde Hyänen.
Bei einem prächtigen Freudenmahl zu Ehren des Falls von Camerino ließ der Papst alle Kardinäle und Kammerherren versammeln. Er musterte die schönen Frauen der Barone und die Kurtisanen der Monsignori, die ebenfalls geladen waren. Er ließ ihnen die Wappen der eroberten Städte, aus Butterteig geformt, auf silbernen Schüsseln reichen. Sein Blick fiel auf den Kardinal Orsini. Er ließ ihn zu sich bitten. »Irre ich nicht, so habt Ihr ein wertvolles Gut auf Monterotondo in Verwahrung?«
Der Kardinal verbeugte sich verlegen.
»Warum habt Ihr sie nicht mitgebracht, die schöne Frau?«
»Weil ihr die Kirche noch den Ehrentitel Frau verweigert,« sagte Giambattista mit Ruhe.
Alexander schob die Lippen hin und her, das Doppelkinn glänzte fett im Licht der Kerzen. »Das tut mir wahrhaftig leid, aber Ihr werdet schwerlich eine Änderung der Gesetze erleben. Es ist nicht klug, das Licht unter den Scheffel zu stellen. Ihr habt Euch diese Frau durch harte Kämpfe ertrotzt und dadurch bewiesen, daß sie Euch des Kampfes wert war. Bringt sie mir einmal zur bescheidenen Augenweide.«
Der Kardinal verneigte sich stumm und ward entlassen. Und er verschwieg seinem Weibe das Wort des Papstes, um sie nicht in Unruhe zu versetzen.
*
Kein Wolkenschatten düsterte noch über dem Ehefrühling auf Monterotondo. Traulich spannen Tiziana und Giambattista ihr selbstgeschaffnes Glück weiter und schlossen es von der Berührung mit der von Sturm und Wetter umtobten Außenwelt ab. Das ganze Orsinische Land schien unbedroht unter Gottes heiliger Hand zu ruhen, und die Glücklichen nannten dieses Stück Erde das gute Herz Italiens. Die Burgeinsamkeit flößte ihnen keine Schwermut ein, sondern gab ihrem verinnerlichten Leben eine stille, anheimelnde Folie. Einem unverwelkbaren Rosenblühen, von heitrer Sonne genährt, glich dieser Herzensbund, der in Freiheit geschlossen worden war. Der Kardinal fühlte, wie sein Leben erst durch das Geschenk dieses Weibes Gehalt und Form bekam, wie Tiziana gar manche gebundenen Kräfte in ihm zur schönen Entfaltung brachte, wie sie auch den unruhigen Geist besänftigte, wenn er allzuweit über die Grenzen des Sinnlichen hinausstrebte. Sie war ihm zum guten Stern geworden.
Alles, was die Menschenbrust erhebt und erbeben macht, schloß jetzt Giambattista in den Kreis philosophischer Betrachtung und gab dieser dann eine wohlgeschliffne, stilistische Form, in der er sie der erwachenden Gelehrtenwelt unterbreiten wollte. Was das unruhige Menschenherz zur Sonne sehnt und wovon es in finstre Abgründe geschleudert wird, was es in Not und Neid, in Krankheit, Armut und Entbehrung leidet, was es nach Ruhm lechzen läßt und mit dem Stempel des Verbrechens zeichnet, der Arbeit frohes Glück, der Schönheit verklärende Macht, des Mitleids streichelnde Hand, der Liebe hohes Lied, den Sinn des allergrößten Erlösertums, das Ringen nach Enträtselung des Gottesgedankens, Christentum und heidnisches Gottsuchen – alles, alles durchflog er mit den gestärkten Sinnen, ohne flügellahm zu werden. Als richtiger Philosoph führte er die Menschen auf dem Umweg des Gedankens zu Gott, verteidigte aber auch die Religion, die den Weg des Gefühls zu demselben Ziele schritt.
Auf seinem Tisch stand heute ein neuer Statuentorso, den nun Giambattista seiner wissensdurstigen Frau erklärte, indem er auf das hohe Alter der Statue hinwies und einen Disput über griechische Kunst daran knüpfte.
Da trat plötzlich der staubbedeckte Tolomei in die Stube. Erstaunt erhob sich der Kardinal, und Tiziana drückte dem Grimmbart einen Zinnbecher mit Wein in die Faust. »Wie siehst du aus, Alter?« fragte sie entsetzt, indem sie auf die Striemen seiner Wangen deutete.
»Strauchbanditen haben mich überfallen,« knurrte der Alte mit halbem Gelächter. »Oder waren es ehrliche Soldknechte? Ich weiß es nicht.«
»Du kommst vom Vetter Pagolo?« forschte der Kardinal.
»Gerade aus dem Feldlager von Perugia. Und Ihr sollt gutes Mutes sein, Exzellenz. Herr Pagolo hat mich beauftragt, diesen Brief nur mit meinem Leben einem andern zu geben als Euch. Die verruchten Schurken, die mich heute nacht bei Palombara in die Enge getrieben, hätten bei einem Haar Leben und Brief bekommen. Aber ich habe die Schelme um zwei Nasen ärmer gemacht.«
Der Kardinal hatte den Brief geöffnet. Tiziana sah ihn nun erbleichen.
»Was – ist – geschehen?« fragte Giambattista mit großen Augen.
»In dieser Stunde gehorchen die Truppen Cesare Borgias in der Romagna nicht mehr ihm, sondern dem Vitellozzo Vitelli. Der Herzog selbst ist nach Mailand geritten zum König Ludwig.« Dem Alten verschlug's den Atem.
»Da ist Unheil im Zug,« sagte der Kardinal. Und er ließ Tolomei ins Nebengemach treten. Dann las er hastig den Brief des Vetters vor.
»Ehrenwerter Kardinal und Vetter! Der Herzog der Romagna ist in Mailand. Dort will er es beim König Ludwig versuchen, sich zum Herrn von ganz Mittelitalien zu machen. In Latium hat er bereits, wie du weißt, die Macht aller Barone mit Ausnahme der Orsini gebrochen. Nun aber hat die Stunde auch für uns geschlagen. Cesare kennt keine Dankbarkeit, keine Schonung. Er hält uns für schnittreif. In Erkenntnis dieser Lage haben wir uns mit den übrigen Herren zu einem Bündnis zusammengetan –«
»Eine Verschwörung, Giambattista?« zitterte Tiziana hinein.
Der Kardinal nickte. »Es ist nicht anders.« Dann las er weiter: »Es haben sich vereinigt die Herren Carlo und Francesco Orsini, Vitelli, Oliveretto da Fermo, der Herzog von Gravina, Giampolo Baglione, Pandolfo Petrucci, Giovanni Bentivoglio und meine Person. Ein Unterhändler ist auf dem Weg nach Florenz, um die Republik für uns zu gewinnen. Wir wollen trachten, Cesare, dessen Kerntruppen bei Imola stehen, einzuschließen. Ist dies geschehen, dann ist's Zeit für die Orsini, in Rom loszuschlagen. In dieser Sache werden wir sogar unsre Erzfeinde, die Colonna, an unsrer Seite haben. Wir haben unsre Fühler bereits nach ihnen ausgestreckt. Verständigt hiervon die Burgherren von Bracciano, Cere, Vicovaro, Isola, Scrofano, Galera, Trevignano und Farfa. Den Tag der römischen Rache werden wir Euch durch Eilboten bekanntgeben. Bis dahin seid auf Eurer Hut. Daß Frankreich im Begriffe ist, nach Neapel zu marschieren und sich dort mit dem Spanier um die schöne Beute raufen wird, ist Euch bekannt. Gott schütze die Orsini!
Ja – Gott schütze sie!« sagte der Kardinal schwer. »Warum will kein freier Atemzug diese Brust weiten? Wird sich das Geschick Cesares erfüllen? Mein Gefühl spannt um diese frohe Nachricht ein Netz von Zweifeln.«
Auch Tiziana sah den Kardinal herzbeklommen an. »O, das Ohr des Herrn öffne sich der Sehnsucht Tausender, die unter dem Alp des Herzogs leiden. Frankreich an seiner Seite! Das wird ihm Mut geben!« Von einem mächtigen Gebetsdrang getrieben, warf sie sich in den Kreuzschemel. »Allmächtiger, laß Florenz weise sein und sich für die Kondottieri entscheiden! Segne ihren Bund! Rette die Orsini!« Sie riß sich selbst empor. »Giambattista! Über den nächsten Tagen liegt des Schicksals schwere Hand. Laß mich mit dir, bei dir stehen und fallen!«
Der Kardinal zog den heiß bebenden Leib an sich. Seine Küsse beruhigten die sturmbewegte Seele. »Weib, wir müssen Entschlüsse fassen. Ich sende Eilboten nach den genannten Burgen, und sie sollen auch meine ›Briefe an die Orsini‹ mitnehmen. Sie bilden ein Stück meines Lebens, sie sind die Dokumente meines großen Willens. Ich will, daß der Papst vor dem geeinigten Volke niedersteigt von der blutbesudelten, schmachbedeckten Thronhöhe der Christenheit und einem Würdigen Platz macht, dessen Geist und Herz das Evangelium in unbefleckter Majestät und Ehrfurcht vor der heiligen Abkunft verwaltet.«
»O, daß sie dich hören könnten, Mann!«
»Diese Briefe könnten Erlösertaten zeitigen, wenn ihr Inhalt in empfängliche Herzen fällt. Denk es aus, Tiziana! Des Papstes verderbliche Macht gebrochen, des Reiches Republiken vereinigt durch Gedanken und Sprache, Landbau, Handel und Gewerbe! Und Wissenschaft und Kunst zu einem Gebilde vereint, das in sich selbst die Stärke zur Erhaltung findet, weise verwaltet durch die Besten des Volkes! O, täte der Brief Wunder an meinem Geschlecht. Hilf mir, mein Weib, sei mir eine getreue Kopistin, wir müssen Nächte durcharbeiten, die Briefe abzuschreiben, die in wenigen Tagen durch Tolomei an die Burgen befördert werden sollen. Ich traue die Sache keinem meiner Schreiber an, es ist ja doch kein sicheres Herz darunter.«
Tiziana, des Eifers und der Sorge voll, nahm das Manuskript der Orsinibriefe in die Hand. Es war auf feinem Pergament geschrieben und sorgfältig geheftet. Während der Kardinal den Brief des Pagolo Orsini angestrengt zergliederte, las Tiziana die große Gedankenarbeit des Herrn ihres Herzens. Leidenschaftlich bewegt gab sie sich der ebenso leidenschaftlich beschwingten Apologie des Volksrechtes hin. Und wortlos strömte das Gefühl ihres glückseligen Stolzes in des Kardinals Brust, als sie ihn plötzlich heiß umarmte.
Die nächsten Tage und Nächte widmeten sich beide der mühevollen Abschrift. Bis gegen den Morgen brannte oft das Licht in der Bibliothek.
Dann bestellte der Kardinal Tolomei und legte ihm die Briefe in die Hand. Er sollte von Burg zu Burg reiten, überall eine Abschrift des pergamentnen Geheimnisses dem Herrn selbst einhändigen und den Brief Pagolos von Hand zu Hand weiterreichen.
Es war ein wehmütiger, segnender Blick, den der Kardinal dem abreitenden treuen Knecht nachwarf.
 Cesare Borgias stahlharte Nerven zitterten auch diesmal nicht. Die kühne Empörung der Kondottieri kam an sein Ohr, als er in der Zitadelle von Cesena die Festungspläne Leonardos da Vinci studierte. Er lächelte jetzt bei seinem schriftenbedeckten Tisch nach der Tür hin, durch die eben der Gesandte von Florenz, Niccolo Macchiavelli, abgegangen war. Die Kerze war tief niedergebrannt, die Nacht lag still über der Stadt, die der Herzog dem Tyrannen Malatesta entrissen hatte. Kühl bis ans Herz sann Cesare dem Gespräch nach, das er eben mit dem florentinischen Sekretär geführt hatte.
Cesare Borgias stahlharte Nerven zitterten auch diesmal nicht. Die kühne Empörung der Kondottieri kam an sein Ohr, als er in der Zitadelle von Cesena die Festungspläne Leonardos da Vinci studierte. Er lächelte jetzt bei seinem schriftenbedeckten Tisch nach der Tür hin, durch die eben der Gesandte von Florenz, Niccolo Macchiavelli, abgegangen war. Die Kerze war tief niedergebrannt, die Nacht lag still über der Stadt, die der Herzog dem Tyrannen Malatesta entrissen hatte. Kühl bis ans Herz sann Cesare dem Gespräch nach, das er eben mit dem florentinischen Sekretär geführt hatte.
Irrsinnige Tröpfe, diese Kondottieri! Auf eine Stärke zu pochen, die ihnen ein paar unzufriedne Tyrannen vortäuschen! Ei, ei, meine Orsini an der Spitze des Aufruhrs! Die täppischen Bären! Ich will ihre Wappenrose zerpflücken wie ein Herbststurm. Und dieses Florenz! Es hat sich einen feinen Kopf für seine Schachzüge ausgesucht. Dieser Herr Macchiavelli mit der krummen Judennase und den ebenso krummen Blicken, mit diesen Lügenlippen und dem überlegenen Lächeln, das Herz vollgesogen mit Schlauheit, den Beutel ebenso voll mit Schulden, er ist wahrlich zu possierlich. Und doch – sollte dieser Mensch, wie es den Anschein hat, die Gabe haben, hinter meinen Verbrechen Größe zu wittern? Aber er hält mich für so dumm, an die Freundschaft der Signoria von Florenz zu glauben, die mir jetzt ihre Dienste gegen die aufrührerischen Hauptleute anbietet. Als ob ich nicht wüßte, daß die Signoria nicht aus Liebe zu mir, sondern aus Haß gegen die Orsini, die die Medici wieder in Florenz einsetzen wollen, meine Partei ergreift. Sie macht aus der Not eine Tugend, an deren Wahrhaftigkeit ein dümmerer Mensch glauben müßte als ich. Hm, meine einfältigen Florentiner, ich bin doch gezwungen, euch zu mißtrauen. Und ich werde daher meine eigenen Mittel anwenden, um mich von eurer Hilfe unabhängig zu machen. Hauptleute! Cesare Borgia ist nicht der Mann, sich von einem Häuflein Übelgesinnter ins Bockshorn jagen zu lassen. Ihr seid im Augenblick die Stärkeren, nun will ich euch zeigen, wer der Klügere ist. Und meine Klugheit wird meine Stärke sein und die eure niederringen. Wenn mehrere Hirne meine große Tat ausspinnen, liegt schon der Keim des Mißerfolgs in ihr. Ein einziger Kopf, von allen Eifersüchteleien und Sonderbestrebungen befreit, brütet ein Zyklopenwerk aus. Er ist wahrhaftig bewundernswert, dieser schleimig-breiige Nervenklumpen unter der Schädeldecke, nicht größer als eine ausgewachsene Krabbe, aus dem ein gescheiter Besitzer ein neues Werde! über die Welt zu schleudern vermag. Man sollte das Gehirn der klügsten Menschen nach ihrem Tode studienhalber einbalsamieren und der Nachwelt in kostbaren Amphoren überliefern. Das Sichtbare ist doch nur eine erbärmliche Welt gegenüber dem Unsichtbaren. Und doch freuen wir uns so sehr über das sichtbare Produkt des Geistes, als ob es das Endziel seiner geräuschlosen Tätigkeit wäre. Ich muß über diese Unlogik meinen Grübler Leonardo fragen.
Er schlürfte seinen geliebten heißen Honigwein hinab und ging dann mit verschränkten Händen auf und ab. Die Leute draußen konnten warten. Er hatte zuvor das unerschöpfliche Lagerhaus seiner Ruchlosigkeiten zu durchstöbern, um das Mittel zu finden, seine Kondottieri ins Herz zu treffen.
Da leuchtete sein stahlkaltes Auge auf. Ich will jeden dort packen, wo er am empfindlichsten ist, sann er in die Kerze. Pagolo Orsini ist ruhmsüchtig, ich werde ihm also Gelegenheit geben, seinen Ruhm zu erfechten. Ich will einen Krieg mit Florenz vorspiegeln und ihm darin die erste Führerrolle zuweisen. Dann der Herzog von Gravina. Er ist eitel und will einen glänzenden Hofstaat und einen Harem haben. Ich will ihm Cesena unter die Nase halten, und er wird sich vor dem Spiegel die Gebärde des kleinen Tyrannen einüben. Die Schönen vom Piombino sollen wagenweise an seinen Hof befördert werden. Dann Oliverotto da Fermo. Er ist so schlecht auf Dukaten zu sprechen, weil sie ihm so leicht davonlaufen. Ich will drei neue Kardinäle ernennen lassen und das Investiturgeld in die Taschen des Oliverotto fließen lassen. Der Bentivoglio von Bologna. Ich will ihm versprechen, seine Feinde, die Marascotti und Malvazzi, binnen Monatsfrist zu vernichten, damit er in Zukunft nicht zu zittern braucht. Das wird ihn mir geneigt machen. Endlich Vitellozzo Vitelli. Das ist der Gefährlichste, weil er mißtrauisch ist. Aber er ist der Todfeind von Florenz. Ich will ihm die Tyrannis der Stadt anbieten. Das wird seinem Ehrgeiz schmeicheln. Die übrigen aber fallen ab wie Blätter im Herbst, wenn sie sehen, daß sie allein stehen. Und was sämtliche Versprechungen anbelangt, so werde ich sorgen, daß sie nicht gehalten werden. Vorderhand muß ich die ungetreuen Herren wieder im Lager haben. Gottfried von Bouillon hieb Kamelköpfe ab, ich will's mit Eselsköpfen probieren.
Er wollte eben fröhlich mit dem Finger schnalzen, als der Sekretär Agapito eintrat, das Antlitz verstört, die Augen in Angst gespannt. »Erlauchter Herzog, Euer getreuer Feldhauptmann Moncada ist von den Verschwörern bei Fossombrone geschlagen worden, die Kondottieri drohen Imola einzuschließen.«
Der Herzog drehte sich ruhevoll um. »Die Truppen zurückziehen aus Imola und auf Faenza marschieren lassen. Wir werden an die zehntausend Mann haben. Vorwärts.« Agapito sprang davon.
Sie handeln schnell, aber unüberlegt, die spaßigen Tröpfe! Moncada hat einen schlimmen Stand, denn er hat wenig Reiterei. Aber die Wolken werden an dem Stern meines Glücks vorbeiziehen.
Da klirrte ein Unterführer heran. »Erlauchter Herzog, Guidobaldo ist wieder in Urbino eingezogen, vom Jubel des Volkes begrüßt.«
»Ich werde Sorge tragen, daß er unter dem Jubel des Volkes wieder hinauszieht. Fünf Reiter bereitstellen, die an den französischen Hof nach Mailand sprengen sollen. Ruft Michelotto.«
Cesare strich beinahe kosend über eine Handschrift Ludwigs XII. »Noch brauche ich dich, mein König,« sagte er leise. »Deine glänzenden Reiter werden mir das Mark meines kleinen Heerhaufens stärken. Holla, Michelotto!«
Der Bluthund Cesares stand im Zimmer. Die stechenden schwarzen Augen des Hauptmanns, den der tierische Blutdurst unter der Maske einer gewinnenden Liebenswürdigkeit von einem Verbrechen zum andern jagte, suchten in den Blicken des Herzogs neue Arbeit. Aber diesmal appellierte der Herzog an seine diplomatischen Talente. »Du weißt, wie die Sachen stehen. Ich werde dir schriftliche Instruktionen mitgeben, mit denen du dich in das Lager der abtrünnigen Feldhauptleute begibst. Die Schriften werden dir sagen, wie du den Ehrgeiz jedes einzelnen befriedigen sollst. Versprich ihnen Berge Goldes, Ländereien, Höfe, Lustbarkeiten, Weiber und Ablaß ihrer Sünden. Sie sind in Gnaden bei mir aufgenommen –«
Der Hauptmann prallte entsetzt zurück. »In Gnaden –? Die Verräter –?«
Der Herzog lächelte verschmitzt. »Auf Grund dieser Gnade wirst du so gütig sein, Strick und Dolche zu beschaffen.«
Der in allen Sätteln gerechte Michelotto begriff. »Ist Eurer Herrlichkeit bekannt, daß auch der junge Gianmaria Varano nach Camerino zurückgekehrt ist?«
»Ich will ihm die Freudenfeuer seines Volkes zu Leichenfackeln wandeln. Sein Vater Cesare ist mit zwei Söhnen noch in unsrer Gewalt?«
»Sie liegen im Kerker zu Pergola.«
»Mach' dich in den nächsten Tagen dahin auf und laß Totenmessen für die Varani lesen. Hat nicht Cesare Varano einst seinen Bruder Rodolfo ermordet? Dann soll er fühlen, daß sich der Himmel zuweilen gar sonderbarer Werkzeuge bedient für sein strafendes Amt. Und nun schick' mir die neuen Pläne des Hafens von Cesena, die Leonardo entworfen, dann den Lautenspieler Ogliardo, den Poeten Orfino, den Statthalter Don Ramiro de Lorqua«.
»Man beschwert sich über die Strenge des Statthalters,« warf Michelotto wie nebenbei ein. »Er füllt die Gefängnisse und schafft grausam eine fürchterliche Ordnung.«
»Strenge und Grausamkeit sind Tugenden, solange sie gerecht geübt werden. Im Gegenfall würde selbst mein braver Statthalter –« Er verschluckte den Rest des bedauernden Gedankens.
»Befehlt Ihr noch etwas, Hoheit?«
»Den Hauptmann der romagnolischen Garde. Ich will ihm den Schnitt für eine neue Uniform seiner Leute geben. Dann laßt diesen Florentiner – wie heißt er schnell? – richtig, Macchiavelli, noch einmal kommen. Ich möchte mich mit ihm über das kleine und große Tyrannenproblem unterhalten, dann über Tugend und das Recht auf Skrupellosigkeit.«
»Eure Herrlichkeit –« wagte der Hauptmann bescheiden einzuwenden – »es sind Augenblicke der höchsten Gefahr –«
»Durch friedsame Gespräche zwingt man das Herz zur Unerschrockenheit,« erwiderte der Herzog mit überlegenem Lächeln. »Davon verstehst du nichts. Ruf die Personen in der Reihenfolge, die ich angegeben.«
Die Raubtierblicke des Hauptmanns verglühten im Dunkel des Türvierecks.
Der Herzog nahm lässig ein Pergament zur Hand und unterschrieb es. Es war die Ernennung des Malers Pinturicchio zum Hofmann. Kaltblütig und gegenständlich warf er seinen Geist von Sache zu Sache. Unausgesetzt flossen die ruhigen Kraftströme durch seine Adern, die nur dann bewegt wurden, wenn schönes, warmes, duftendes Frauenfleisch in den Kreis seiner Sinne rückte. Nur wie auf ein nebensächliches Ballspiel schleuderte er seine Gedanken in die Affäre der Kondottieri hinein, die wie Puppen unter seinen Händen zerbrechen sollten. O, er fühlte sich wohl in seinem politischen Ränkespiel, dieser entsetzliche Praktiker verwegener Staatstheorien. Die Not seines Vaterlandes machte aus ihm keinen Helden, sondern einen grausamen Schurken, da er bis ins Mark entsittlicht war, da sein Charakter der menschlichen Natur ins Gesicht spie. Seine Seele enthüllte Abgründe der Verworfenheit.
Nachdem er die zur Audienz befohlenen Personen um Mitternacht erledigt hatte, ließ er sich eine schöne Zigeunerin aus Fano kommen und warf seine Menschenwürde in gefräßige Lüste. Doch mitten im Paroxismus der Wollust überfiel ihn ein süßer Sehnsuchtsschauer. Seine rasenden Sinne trugen ihn nach Rom zurück – eine Erinnerung tauchte flammenhell auf – er warf die Arme der Zigeunerin nach beiden Seiten des Lectus und sah sie lange, lange an. Er dachte plötzlich an einen weißen Lilienleib, über den ein Kardinal Herr geworden war. Herz und Leib standen plötzlich in hohem Brand. Er ließ die Zigeunerin davonpeitschen.
*
In den Ecken des Gemachs der freien Künste lagen Halbschatten. Die Kerzen auf dem metallnen Lesepult des Papstes nahmen nur die nächsten Gegenstände in ihren flackernden Schein. Sie beleuchteten liebkosend den »Hermaphrodit« des abenteuerlichen Dichters Beccadelli, der voll war von lüsternen Epigrammen. Alexander lachte sich breit in den Schmutz hinein. Es war ihm eine willkommne Ablenkung von den Sorgen, die die Nachrichten aus der Romagna über sein Herz geschüttet hatten.
Da trat sein Lieblingskardinal Romelino da Ilerda herein. »Allerheiligster Vater! Gerettet! Alles gerettet! Segen auf des Herzogs Haupt!«
»Was ist geschehen?« fragte freudezitternd der Papst.
»Wir werden in den Kirchen das Te Deum laudamus singen lassen. Ach, allerheiligster Vater, die Kondottieri sind wieder zum Herzog übergetreten, reumütig und gehorsam, echte Christenkinder.«
Der Papst machte schreckfrohe Augen. Aber in den Tiefen seiner Brust wand sich die alte Schlange. Er wußte von den heimlichen Absichten Cesares. »O! o! Welche Gnade Gottes!« rief er heuchlerisch aus. »Gott segne die erleuchteten Herzen! Wie konnten sie auch anders als reumütig werden? Und dabei handelten sie auch klug, denn es wäre doch einmal ihr Verderben geworden, wenn sie sich vom Herzog für immer losgesagt hätten. Der Herzog versprach ihnen wohl viel und wird sein Wort halten. Er ist doch ein kleiner Hexenmeister, der das Unmögliche möglich macht.« Innerlich aber dachte er: er balanciert die Menschen auf den Fingerspitzen seines grausamen Gemüts, wirft sie hin und her, schafft absichtliche Konflikte, balanciert wieder mit diesen und gefällt sich in der Verwirrung, die er scheinbar anrichtet und die sein Geist doch beherrscht. Er ist ein Meister in der Kunst, Kräfte und Menschen gegeneinander in Bewegung zu setzen und daraus Vorteile zu ziehen. Ei, ei, diese Kondottieri! Ich fürchte, wenn der Schnee auf dem Apennin liegt, werden sie die Prankenschläge des Tigers zu spüren bekommen. Narren! Sie dürsten alle danach, von einem zweiten Verrocchio in Stein gehauen zu werden. Sie und die Tyrannen! Sich gegenseitig zerfleischende Bestien, die keinen großen Gedanken, keine Staatskunst kennen! »Es ist gut,« sagte er laut, von einem freudigen Herzschlag bewegt. »Noch eines, hat Marades meine Aufträge erfüllt?«
Ilerda nickte. »Es reiten heimlich bei Tag und Nacht verkleidete Reiter durchs Orsiniland, die jede Bewegung in den Burgen beobachten und verdächtige Reiter abfangen.«
»Brave Fanghunde!« Alexander naschte von dem süßen Konfekt, das vor ihm lag. »Ich traue ihm nicht, diesem Bärengeschlecht, so sehr es jetzt den Versöhnten spielt.«
Der Geheimkämmerer Gabagnas trat ein. «Allerheiligster Vater, Cesare Varano –«
»Der Gefangene in Pergola?«
»Der gestürzte Tyrann von Camerino ist samt zwei Söhnen in seinem Kerker erwürgt worden.«
Dem Papst schillerte das Auge. »Ah! Ah! Cesare arbeitet gründlich. Laßt Messen lesen in Santa Maria del Popolo. Und nun werden die Kondottieri meinem Sohn helfen, dieses kleine Urbino und Camerino zu Fall zu bringen. Und Sinigaglia wird das nächste Ziel sein. Ei, Kardinal, wir haben Gründe, dem Himmel dankbar zu sein für den Verstand, den er unserem Sohn gegeben.«
»Das haben wir sicherlich,« sagte Gabagnas schmeichelnd.
Glück, Glück, Glück überflutete heute den Hirten der Christenheit. Marades, der Geheimsekretär des Papstes, eilte mit Kinderaugen herein. Alexander erhob sich mit Hast. Seine Knie zitterten. Er stützte sich auf seinen goldknopfigen Stock. »Gute Nachrichten?« hetzte er ihm atemlos entgegen.
Wortlos reichte Marades ihm einige Schriften hin. Der Papst rieb sich die Hände. »Wir schwimmen in Nudeln! Den Gerechten hilft Gott!« Er winkte den beiden Monsignori zum Abschied.
Als sie sich entfernt hatten, riß er ungeduldig den zerknitterten Umschlag der Schriften auf. »Woher kommt das?« fragte er Marades.
Der Sekretär keuchte: »Zwei der Landreiter, die zwischen Ceri und Bracciano streiften, fingen zwischen den Hügeln bei Sanguinara einen verdächtigen Reiter auf, der sich wie eine vom Hund angegriffene Katze zur Wehr setzte. Nach kurzem Degentanz hieben sie ihn vom Pferd herab und machten ihn maustot. In seinen Taschen fand man diese sechs schweren, umfangreichen Briefschaften, einige darunter von Frauenhand geschrieben, alle tragen die Aufschrift ›An die Herren der Orsiniburgen‹.«
Dem Papst zitterten die Finger. Dann las er den Titel des Manuskriptes: »Briefe an die Orsini, geschrieben von Giambattista Orsini.« Langsam begann er zu lesen. Schon nach den ersten Worten sagte er: »Marades, Marades, laßt mich allein. Und es soll niemand vorgelassen werden. Nachrichten aus der Romagna soll Ilerda in Empfang nehmen.«
Als Marades draußen war, ließ der Papst durch einen Kammerdiener neue Scheiter im Kamin aufflammen und zog ein weiches Fell über die Knie.
Und nun spannten sich seine Augen, sein Geist und sein tückisches Herz nach den leidenschaftlichen Briefworten des unseligen Kardinals. Was war das alles? Den Papst durchfröstelte diese nie geahnte Glut seines Priesters. Hei, das war ein Schreiber von Gottes Gnaden! Wenn diese Worte die Wirkung taten, die sie tun sollten, dann war ganz Rom unterwühlt von den Maulwürfen der Orsini. Versöhnung mit den Colonna! Ei, friedfertiger Kardinal! Du weißt, deine Gedanken zu formen und deine Leidenschaft unter einer apostolischen Maske zu verhüllen. Das also kreißt im Schoß von Monterotondo? Deine Einsamkeit, die wir nur von den Geistern harmloser Gelehrsamkeit belebt glaubten, durchzucken die Strahlen unbesonnener Empörung, und deine Weisheit ist dir gerade tauglich genug, um damit die Grundfesten des heiligen Stuhls zu erschüttern? Einigung Italiens? Ein edles Ziel. Aber unter der Herrschaft des Volkes? Eine mediceische Republik vielleicht? Und du selbst, Kardinal, als Mediceer obenauf? Was machte diesen Mediceer groß? Die Kunst, das Volk zu beherrschen und es dabei im Glauben zu belassen, daß es sich selbst beherrsche. Er war ein Tyrann, und der größten einer. Er schmeichelte dem Volk mit der Klugheit seiner Tyrannei. Als es darauf kam, wie sehr es betrogen war, starb Lorenzo glücklicherweise, und dann jagte das Volk die Erben der mediceischen Krämerweisheit zum Teufel. Hahaha, dieses Italien ein Bund freier Republiken? O Schwärmer, kindlicher, einfältiger Schwärmer! Das Volk, das sich selbst beherrscht, muß erst geboren werden, Giambattista Orsini!
Er las mit Spannung weiter. Seine Stirn verrunzelte sich. Du willst das Leben veredeln, die Gesellschaft erziehen, die Sittlichkeit zum staatengründenden Element machen? Such' dir dein Nirgendland, aber nicht in Italien. Unser Volk ist ausgesogen von uns, ich gebe es zu, auch für uns, aber es ist auch nicht wert, sich selbst zu lenken, denn es ist zur Knechtschaft geboren, es hat sich selbst erniedrigt. Ei, und die Auslese großer Geister treffen diese selbst.
Je tiefer er in das Manuskript eindrang, desto mehr erschauerte er. Aber ein Selbstbewußtsein, das Vertrauen auf seine Gewaltherrschaft erhob ihn über alle düstern Zweifel. Vergebens rufst du, Kardinal, das Selbstgefühl deiner Barone an, vergebens verdammst du das lasterhafte Priestertum, vergebens weissagst du den Untergang wie einst, da Alarich vor den Mauern Roms stand, vergebens verfluchst du die nimmersatte Kurie Alexanders, vergebens verlangst du einen heroischen Tod des Papsttums. Wir werden gemütsruhig am Leben bleiben und Diener zu züchtigen wissen, die in das Horn des Aufruhrs blasen. Und dich ernannte man zum Kardinal? Wir werden uns von heute an die Männer besser besehen, die die Messe im Purpur lesen. Wie brauchen Männer wie Vitelleschi, die Schwert und Bibel zum Heil des Papsttums zu gebrauchen wissen. Und du glaubst ernstlich, Kardinal, wir wollten das Volk den fremden Eroberern ausliefern? Für so klein hältst du uns? Frankreich und Spanien werden sich demnächst über Neapel zerfleischen, und Cesare wird mit den Helfern fertig werden. Ha, Orsini! Ein erschlagner Colonna gilt euch noch immer mehr als ein erschlagner Papst. Dein Flug zum Olymp, Kardinal, wird mit einem Sturz deines Sonnenwagens enden!
Nach einstündiger Lesung schlug er den Brief zusammen. Dann nahm er die Seiten nochmals her und strich liebkosend darüber. Es war eine Frauenschrift. Das tat ihm wohl. Arme, schöne Finger, die sich mit so schweren Gedanken abgemüht hatten! Süße Knöchelchen, ihr versteht die zärtliche Schmeichelei doch besser als das trostlose Skribieren. Hier zitterte die Hand – und hier blinkten wohl gar Tränlein und fielen aufs Papier. Es war ein eigenartiger Tyrann, der diese Hand zu solch grausamer Verrichtung zwang. War's nicht Cesare selbst, der mich auf diese schwarze Lilie aufmerksam machte? Sie verkommt in der Düsterheit der einsamen Burg. Ein Grund mehr, mit dem Kardinal ins Gericht zu gehen.
Er dachte an die schöne Giulia Farnese, die blonde Hexe. Aber das Gold ihres Haares begann seine Leuchtkraft zu verlieren, die Zärtlichkeit fand schon einen durch die Gewohnheit ermatteten Leib, und Giulias Buhlkünste übten nicht mehr ihre erfrischende Wirkung aus. Der Papst sann angestrengt darüber nach, wie man der beleidigten Rose des Herzens klarmachen sollte, daß sie ihren Duft schon eingebüßt habe. Durch eine hohe Rente vielleicht ließe sich das erzürnte Gemüt beschwichtigen. Voll wachsender Unruhe wühlten Alexanders Sinne in dem Bilde des neuen Frühlings herum. Mit unverwüstlichem Vertrauen in die Segenskraft einer priapischen Gottheit gab er sich dem Gedanken an schauersüße Nächte hin, die er an der Brust eines von allen dunklen Zaubern italischer Schönheit umfloßnen Weibes durchtaumeln wollte. An einen Widerstand ihrerseits dachte seine Eitelkeit nicht.
Er öffnete die Tür zum Saal der Heiligenleben. Dann leuchtete er mit der Kerze zu dem Rundbild über der Tür hinauf. Die Hetäre Giulia Farnese, zur Madonna geadelt, lächelte ihn sanft an. Er winkte ihr mit den gepflegten Greisenfingern und hatte sogar eine Träne im Auge. Es war wie ein Vorabschied von dem lebenden Blumenleib, ein leises Blätterfallen.
Schon dämmerte in die bewegten Gedanken das Bild der neuen Gottheit hinein. Um bronzne, herrliche Statuenglieder wogte eine Flut rabenschwarzer Haare, in die sich seine vulkanischen Sinne verfingen. Der nimmersatte Sybarit der Liebe näherte sich mit neu gestrafften Schwanenschwingen dem Altar seiner Leda. Seine Lippen schmatzten genußsüchtig: Variatio delectat.
Alexander löschte die Kerzen aus. Wollüstige Träume gaukelten freundlich in das Hirn dieses alten Freibeuters der Liebe. Er schmückte sich eitel wie der göttliche Farre Jupiter, um sich der Tochter Agenors im schneeweißen Gewand zu nahen. Des Mythos üppige Bilder umtänzelten sein träumendes Herz.
 Der Kardinal Orsini erbebte bis ins Mark. Tolomei niedergestochen! Seine Leiche hatten Burgleute von Cere im Tuffgerölle der Sanguillera gefunden. Er war beraubt worden. Es konnten Wegelagerer gewesen sein, aber auch Feinde der Orsini. Der Kardinal konnte das Unheil nicht mehr vor Tiziana verheimlichen, als man die Leiche des treuen Knechtes ins Schloß brachte. Angst und Leid durchschauerten die Glieder Tizianas.
Der Kardinal Orsini erbebte bis ins Mark. Tolomei niedergestochen! Seine Leiche hatten Burgleute von Cere im Tuffgerölle der Sanguillera gefunden. Er war beraubt worden. Es konnten Wegelagerer gewesen sein, aber auch Feinde der Orsini. Der Kardinal konnte das Unheil nicht mehr vor Tiziana verheimlichen, als man die Leiche des treuen Knechtes ins Schloß brachte. Angst und Leid durchschauerten die Glieder Tizianas.
Giambattista wartete die nächsten Tage in Unruhe ab.
An einem aschgrauen Wintermorgen traf ein Schreiben Pagolos ein. Der Kondottiere malte darin sein Entzücken über die Versöhnung mit dem Herzog aus. Er schilderte die berückende Liebenswürdigkeit des Fürsten, der durch seinen Abgesandten Michelotto den Friedensgruß an die Aufständischen hatte ergehen lassen, und er bat den Kardinal, alles aufzubieten, um das Mißtrauen der Orsini gegen die Borgia zu zerstreuen. Er klagte sich geradezu an, daß er es unternommen hatte, eine Verschwörung anzuzetteln, und pries die Gnade des Herzogs, der sogar mit klingendem Gold und einem Feldherrnpatent eine Tat belohnte, die jeder andre mit einem furchtbaren Strafgericht vergolten hätte. Nun aber würden die Kondottieri den Herzog in allen seinen Unternehmungen unterstützen und ihm sogleich helfen, den zurückgekehrten Herzog von Urbino zu vertreiben und Camerino zu nehmen.
Dem Kardinal zitterte der Brief in den Händen. »Tiziana, nie haben sich die Orsini schändlicher benommen als in diesem Zwist mit dem Herzog. O, Cesare wird nicht gespart haben, den leicht verführbaren Hauptleuten die teuersten Speisen aufzutischen. Kurzsichtig sehen sie die Falle nicht, die der Herzog ihnen bereiten wird. Er sollte es vermögen, die Verwegenheit einiger Freibeuter, die ihn ums Leben zu bringen trachteten, aus dem Schuldbuch zu streichen? Mit der streichelnden Linken gab er ihnen die fettesten Bissen, mit der furchtbaren Rechten wird er zuhauen, wenn sie sich in sie verschnappt haben.«
Am selben Abend war Giambattista mit sich und Tiziana einig geworden. Er fühlte sich in seiner Burg nicht mehr sicher. Ja, so töricht es klang, er glaubte, wirkliche Sicherheit nur in – Rom finden zu können. Dort hatten die Orsini ihre eigenen Paläste, nein, ein ganzes Palastviertel, eine Festung mit starken krenelierten Mauern, bewehrt und bemannt. Rings um den größten Palast lagen die Häuser des Geschlechts, jedes wieder selbst eine kleine Festung mit Turm und Mauern, Schießscharten und vergitterten Fenstern. Ein Heer von jungen Söldlingen hielt dort scharfe Wacht, und wenn einer der Herren Orsini durch die Straßen ritt, folgte ihm ein Troß von schwerbewaffneten Reitern nach, und es sah aus, als kröche ein Riesenigel mit aufgestellten Stacheln durch die Straßen.
Hier wohnten treue Freunde des Kardinals. Fabio Orsini mit seiner jungen Gattin Girolama, der Bruder des Kardinals Giulio Orsini, Francesco, der Graf von Pitigliano, Camillo, ein junger Kriegsmann und viele andre Herren, die die rote Rose mit dem goldnen Querbalken im Wappen führten. Auch die List konnte sich in das von Waffen starrende Orsiniviertel schwerer einschmuggeln als in die Verlassenheit von Monterotondo. Zumal auf dem einsamen Weg nach Rom war Giambattista einer heimtückischen Gefahr allzu leicht ausgesetzt.
Noch in der Nacht gab er den Befehl zum Einpacken.
An einem reiffrischen Morgen gegen Ende des Advents zog die lange Kavalkade auf der Straße nach Rom. Lanzen starrten, und in der Wintersonne spiegelten silbern die Eisenschienen. In Monterotondo blieb nur der getreue Burgvogt Spinozzi mit einer großen Zahl von Knechten zurück.
Die Übersiedlung erfolgte ohne Zwischenfall. Wohlbehalten kam der Kardinal mit seiner Mutter und Tiziana im Palast der Orsini an, wo er die Zimmer des längst verstorbnen Kardinals Latino Orsini bezog.
Tiziana ließ sich noch am selben Abend in der verhüllten Sänfte nach der Orsinikirche Santa Maria in grotta pinta führen, wo sie mit ihren Kammerfrauen heiße Bittgebete zum Himmel sandte, während der Kardinal mit den Herren seines Geschlechts in einem Arbeitsgemach eine ernste Zusammenkunft hatte. Das Manuskript der Orsinibriefe bildete die Grundlage der Unterredung. Alle bewunderten den großen Geist und die lautern Tugenden des Kardinals, der hier zum erstenmal aus seiner Zurückgezogenheit heraustrat. Er schien ihnen der würdige Nachfolger des Latino zu sein, dessen Manen in den Räumen des dunklen Palastes lebendig zu werden versprachen.
*
Der süße Weihnachtsdämmer begann sich über die latinischen Hügel und Berge zu spinnen. Fröhlicher als sonst klangen des Abends die Hirtenflöten durch die Dunkelheit der Campagna. Aschgraue Nebel wallten über dem Tiber, und bei Tag geizte die Sonne mit ihrem Gold und lieh den schwachdurchleuchteten Wolken eine Scheinherrschaft über das Land. Mondlose Nächte mit schleierwebendem Reif senkten sich über das Orsinische Bergland, dessen Hänge der eisige Winterwind überfegte. An dem Gemäuer der verlassenen Burg zerbrach er sich die Flügel und bröckelte zornig das Gestein von den Zinnen, daß es in der Tiefe aufschlug. Um Weihnachten hing der Himmel voll traurigen Gewölks, und die Leute sagten, Gott schaudre vor dem Anblick der päpstlichen Mißwirtschaft zurück und gebe dem Satan Gelegenheit, ungesehen aus dem Gewölk hervorzubrechen und sich des heiligen Stuhls zu bemächtigen. Aber auch Satan zögerte. Er hatte auch genug in der Romagna zu tun.
Dort lag ein überfunkelter Weihnachtshimmel über der Perlenschnur der eroberten Städte. In den Lagern der Söldner brannten die Wachtfeuer und schwiegen die Büchsen. Der Advent war keine Zeit zum Dreinschlagen. Man begnügte sich mit Diebsbeute und Dirnenleibern. Dann und wann sang mit dünner Stimme ein durchs Lager wandernder Bauernknabe ein Adventlied vom Christ, der geboren ward im dunklen Stall. Oder es klang ein Lob für San Giuseppe und Santa Maria in ein rauschheiseres Freibeuterlied hinein.
Schrill zerriß ein grausiger Wehruf die friedendurchwehte Adventluft. Der gestrenge Statthalter des Herzogs, der blutig arbeitende Don Ramiro de Lorqua, war knapp vor dem Weihnachtsfest hingerichtet worden. An einem nebelgrauen Wintermorgen sahen die erwachenden Bürger von Cesena den Leichnam des Statthalters gevierteilt auf dem Platz liegen. Der Kopf stak an einer Lanze. Das treue Werkzeug Cesares, ebenso grausam wie er selbst, war durch den Herzog selbst prozeßlos abgeurteilt worden. Alsbald verbreitete sich auch die Ursache der schnellen Justifizierung. Das Volk setzte alle Bluturteile des Statthalters auf die Rechnung Cesares. Als der Herzog davon erfuhr, wurde er wütend. Ja, es war beinahe eine Art Eifersucht, die ihn dazu trieb, den seelenverwandten Würger aus der Welt zu schaffen. Er wollte dem Volke Gerechtigkeit vorspiegeln und so tilgte er den Mann von der Erde, welcher glaubte, ihm durch blutige Strenge gefällig zu sein. Der Herzog täuschte sich nicht über die Wirkung des Urteils. Das Volk pries seine Gerechtigkeit und verzieh ihm alle sonstigen Greueltaten. Er hatte bewiesen, daß er selbst seine Günstlinge nicht schonte, wenn es galt, Gerechtigkeit zu üben. Die Leute jubelten dem gerechten Cesare zu. Er lachte sich ins Fäustchen.
Gleich darauf rückte er nach Fano. Dort quartierte er sich in dem alten gotischen Rathaus ein. Hier hatte er inmitten seiner Scharen seine eigenen Weihnachtsgedanken.
Er freute sich vor allem über sein Kriegsglück. Der Herzog von Urbino und der Tyrann von Camerino hatten richtig wieder Reißaus genommen. Die schönen Städte überzog Cesare mit Mord, Brand und Plünderung. Und nun hatte der Hofastrolog des Herzogs geraten, eine wichtige Unternehmung auf alle Fälle für den letzten Tag des Jahres zu verschieben, denn dieser Tag sei von dem großen Glücksstern Cesares gesegnet. Der Herzog hatte bei diesem Horoskop schillernde Tigeraugen. Dann ließ er Hofdichter und Frauen kommen, zeichnete in den Plänen von Cesena, Imola und Forli die Orte hinein, wo Kirchen, Schulen und Bastionen errichtet werden sollten, machte Verse, teilte Geschenke aus und sandte Grüße an seine wiedergewonnenen Kondottieri, die schon vor Sinigaglia standen.
Stadt und Burg lagen dort in den Händen des Kapitäns Andrea Doria. Er hatte die Fürstin von Sinigaglia, die edle Giovanna da Montefeltre, mit dem kleinen elfjährigen Regenten Francesco Maria della Rovere in Sicherheit nach Venedig gebracht. Je näher das Jahr sich dem Ende zuneigte, desto aussichtsloser schien dem Kapitän der Kampf um die Erhaltung der Stadt. Er schiffte sich endlich nach Florenz ein und überließ die Verteidigung der Burg seinem Leutnant mit dem Auftrag, die Schlüssel der Burg nur dem Herzog selbst zu überliefern. Vergebens forderten die Kondottieri den Leutnant auf, ihnen die Burg zu übergeben. Endlich wollten sie den Sturm wagen. Aber Cesare ließ ihnen sagen, sie mögen warten, er wolle persönlich die Schlüssel in Empfang nehmen.
In einer mondhellen Nacht gab der Herzog Valentino in Fano den Befehl, die Zelte abzubrechen und auf Sinigaglia zu marschieren, wo die Freischaren der Kondottieri Vitelli, Pagolo Orsini, Oliveretto da Fermo und des Herzogs von Gravina bereit lagen, um den Stoß auf die Stadt auszuführen, wenn Cesare die Schlüssel nicht bekommen sollte.
Durch kaltfeuchte Nebel marschierten die Truppen an der Meeresküste südwärts über rauhes Gestein. Die See war erdrückt von Wolkengeschieben und brauenden Dünsten. Cesares Rappen war von reitenden Höflingen, Spaßmachern, Ingenieuren, Gelehrten und Kämmerern umgeben. Heiter wie Apoll plauderte er mit seinen Schmeichlern und rühmte das schmucke Aussehen seiner Gardisten. Als man die Türme Sinigaglias sah, lächelte gerade ein Sonnenstrahl gnädig durch das Wintergrau der Wolken. Dann schloß sich der düstre Vorhang wieder. Die Kondottieri, die schon den Herzog vor Sinigaglia erwarteten, hatten den letzten Gruß der Sonne übersehen. Sie grüßte die Unheilssonne Cesare Borgias. Mit hochklopfendem Herzen schritten sie dem versöhnten Fürsten entgegen, der mit strahlendem Lächeln dahergeritten kam und ihnen die Hände entgegenstreckte.
Alle waren des Entzückens voll. Nur Vitellozzo Vitelli hatte sein mißtrauisches Gesicht aufgesetzt. Er hatte nur mit innerm Widerstreben in die Versöhnung gewilligt. »Der Herzog lacht zu schön, ich fürchte dieses Lachen,« sagte er zu dem neben ihm reitenden Pagolo.
»Narr!« versetzte dieser, und sein verwettertes Gesicht glänzte.
Cesare ließ seine Scharen an der Straße aufstellen. Dann stieg er vom Pferd, trat auf die Hauptleute zu, umarmte und küßte sie und sagte jedem ein paar schmeichelhafte Worte. Dann traten sie den Marsch gegen die Festung an, die Kondottieri, von je zwei Offizieren des Herzogs geleitet, schritten mit den fröhlichsten Gesichtern die Treppen zur Burg hinan, die sich beim Nahen des Herzogs übergeben hatte. Ein halbdunkles Zimmer empfing die Kriegsleute. Abermals hieß sie der Herzog herzlich willkommen und ließ sie dann in ein Nebenzimmer treten, das hell erleuchtet war, trotzdem es Tag war.
»Seltsam!« sagte Pagolo zu Vitelli.
»Ich finde das alles nicht seltsam,« erwiderte dieser schreckensbleich.
»Was hast du? Du wirst ja blaß wie –«
Noch ehe Pagolo den Satz vollenden konnte, spürte er einen Griff an seiner Gurgel. Ein Taumeln, Poltern, Schreien, Ringen begann.
Bewaffnete, die aus einer Tür hervorgebrochen waren, stürzten sich auf die ahnungslosen Kondottieri, warfen sie zu Boden und fesselten sie.
»Hunde!« schrie der alte Haudegen Pagolo.
»Cesares Würger!« fluchte der Herzog von Gravina.
»O Giambattista! Du warntest uns!« wimmerte der Orsini unter den Händen der feigen Knechte.
Da öffnete sich die Tür und Cesare trat ein. »Meine Herren! So lohnt man Verrat und Dummheit!« Es klang wie eine schrille Posaune.
Draußen rasselte die schwere Reiterei Frankreichs heran und stürzte sich in heftigem Angriff auf die Freischaren der Kondottieri, die, ihrer Führer beraubt, die Flucht ergriffen. Ein furchtbares Gemetzel, dessen schauriger Klang zu den Fenstern des Mordsaales herauftönte, setzte vor den Augen Cesares ein, der kaltblütig beim Fenster stand. Unausgesetzt tönten die Verwünschungen der geknebelten Hauptleute hinein. Da verließ Cesare den Saal und rief Michelotto herbei. »Vollende, wie ich dir's befohlen. Zuerst die zwei!«
Der Henkershauptmann schritt in den Saal, ihm folgten seine Knechte mit Stricken und Messern.
Der Herzog Valentino ließ sich im Nebenzimmer bei dem reich geschmückten Schreibtisch nieder und schrieb, während daneben die Verzweiflungsschreie tönten, an den Papst ein Billett. Neben ihm stand blaß und zitternd Niccolo Macchiavelli, der florentinische Gesandte.
Das Billett an den Papst hatte nur ganz kurze Worte: »Die Frucht der Orsini ist reif, pflücket sie!« Durch den Leutnant Marco Romano ließ er es nach Rom befördern. Dann rieb er sich die Hände, blickte auf und sah Macchiavelli stehen. »Ach ja, ich bestellte Euch zu einem Gelage. Es ist soeben im Gang.« Er sprach sehr aufgeräumt, beinahe schmunzelnd. »Seht, das alles ist die Tat der Gerechtigkeit und Klugheit. Man wird dies nicht so leicht verstehen wollen. Ja, man wird mich vielleicht mit dem Alberigo Manfredi von Faenza vergleichen, der unter der Versöhnungsmaske seine Feinde bei einem heitern Gastmahl ermorden ließ. Kurzsichtige werden mich einen heimtückischen Mörder schelten, Weitsichtige in mir einen großen Reformator erblicken. Ja, ja, so sagte ich. Ich habe nicht vier Menschen erwürgt, sondern ein System gebrochen. Diese Kondottieri waren ein Auswuchs am Leibe Italiens. Sie dienten um ihrer persönlichen Vorteile willen heute diesem, morgen jenem Herrn. Sie waren ein Schandfleck an dem Gebilde der Menschheit. Heda –« rief er dazwischen in die Mörderstube hinein, »lasset die Menschen nicht so lang leiden!« Dann wandte er sich wieder gegenständlich und ruhig an Macchiavelli: »Da drinnen habt Ihr vier ruhmsüchtige Köpfe, jeder wollte herrschen nach seiner Weise und ein kleines Stück Land haben zur Befriedigung seiner Tyrannis, keiner hatte den Blick für die wünschenswerte Einheit der Nation, für die Schmach, die darin liegt, seine Dienste zu wechseln je nach der Größe des Soldes. Heerhaufen, von solchen ehrgeizigen Laffen geführt, verheeren das Land, saugen die Bauern aus, verwüsten die Städte, und niemand findet sich, die Nation auf ihre Entwürdigung aufmerksam zu machen. Wir wollen das Land mit unsrer Kraft in Ordnung halten, und ein Geist, ausgerüstet mit allen Eigenschaften des Herrschertalentes, soll die Zügel in die Hand nehmen. Es wird notwendig sein, in dieser Stunde Gewalt, in jener Maß und Milde walten zu lassen. Das Volk erkennt nimmer das Ziel einer Regierung, es sieht nur die Mittel und Wege und urteilt mit blödem Verstand. Das darf uns nicht täuschen, lieber Macchiavelli. Man nennt mich ein Ungeheuer, aber es ist besser ein Ungeheuer mit großen Endzielen als tausend Ungeheuer mit kleinlichen, eigensüchtigen Bestrebungen. Die Tyrannen der Romagna waren wert, aus der Regententafel ausgestrichen zu werden, sie hatten Pygmäentalente, wo wir Titanen brauchen – oder sagen wir deutlicher einen Titanen.«
»Und dieser eine,« sagte Macchiavelli mit einer ehrlichen Verbeugung, »ist eben im Begriff, sich selbst den verdienten Lorbeer aufs Haupt zu drücken. Ich bewundre Eure Herrlichkeit.«
Der Herzog stand ungerührt auf und trat ans Fenster. Unten plünderten französische Soldaten Kaufleute von Sinigaglia aus. Cesare riß die Tür auf. »Hänget alle französischen Plünderer!« Dann sagte er wieder gelassen zu dem verblüfften Florentiner: »Schreibet Eurer Signoria, daß ich mit der Aburteilung der Orsini ganz Florenz gedient habe, denn diese wollten die Feinde der Republik, die Medici, wieder einsetzen.«
»Und ich werde hinzufügen, daß Florenz keinen bessern Freund als Eure Herrlichkeit besitzt und daß ich in diesem Freund den militärischen Reformator Italiens, den Retter der Nation, den vollendeten Diplomaten, den –«
»Genug, lieber Macchiavelli,« sagte Cesare mit einem selbstgefälligen Lächeln. »Ich bitte Euch, sorgt dafür, daß meine Sekretäre kommen. Ich will ihnen den Befehl geben, die Musik spielen zu lassen. Es sollen Tänze und Mummereien aufgeführt werden, meine Reiterei soll die bedrängten Bürger vor Ausschreitungen schützen, meine Gelehrten sollen die kriegsmäßige Befestigung Sinigaglias, die historische Vergangenheit der Stadt und die wirtschaftliche Lage studieren, meine Poeten aber heute nacht die schwungvollsten Hymnen auf Italien singen. Seht, die Sonne tritt aus den Wolken. Der Himmel segnet sichtbarlich meine Tat.«
Die Tür des unheimlichen Blutgemaches öffnete sich. Michelotto trat schwitzend heraus. »Herr Vitelli und Oliveretto sind tot. Sie sind wie feige Mäuse gestorben. Die Orsini –«
»Sollen noch eine Galgenfrist haben. Ihr könnt sie vor die Madonna des Perugino führen, die im Kloster Santa Maria delle Grazie thront. Sie sollen dort Buße tun und um Milderung der Todesschrecken bitten. Das ist das letzte, was ich ihnen gewähren kann. Was ist mit Pandolfo Petrucci von Siena?«
»Er ist entkommen.«
»Verdammt!« rief Cesare geärgert aus. »Der Papst muß trachten, ihn und den Bentivoglio nach Rom zu locken. Wir müssen unsre Arbeit gründlich tun.«
Der Herzog erhob sich und trat ans Fenster. Kalt strich die Winterluft von der See herein. Er reckte die Brust in den Strahlen der erwachten Sonne und trillerte ein Schäferlied, das den Advent besang, in die fliehenden Nebel hinaus.
Der Stadtkanzler von Fano trat ein und überreichte dem Herzog eine Siegeshymne, die Cesare als das strahlende Licht aller Cäsaren, Könige und Fürsten pries. Der Herzog lachte heimlich über den Tropf; aber er ließ ihm eine goldne Kette reichen und klatschte Beifall.
*
Zwei Kammerdiener mußten den Papst stützen, der vor Freude eine Ohnmachtsanwandlung bekommen hatte. Es dauerte eine Weile, bis der alte Bau wieder Kraft bekam. Alexander ließ sich in die Sonne führen. Zwischen den Zypressen des Belvederehofes sahen die Garden den weißen Talar blinken.
Ein blauseidner Friedenshimmel mit einem Abglanz ewigen Sphärenschimmers spannte sich über dem Vatikan aus. Es war, als hätte der schlafende Frühling geweckt werden sollen. Und doch war erst der dritte Tag des neuen Jahres angebrochen.
Der Leutnant Marco Romano schilderte dem Papst die Hinrichtung der zwei Kondottieri. Auf zwei Stühlen sitzend, Rücken an Rücken, waren sie erwürgt worden. Vitelli habe jammernd um des Papstes Absolution gebeten.
Der Papst ließ den Protonotar de Sermoneta kommen. »Setzet eine Urkunde auf, die schöne Stadt Fermo, des seligen Oliveretto letzter Besitz, ihres Tyrannen ledig, wird dem kleinen Rodrigo Borgia, meinem Enkel, mit Grund und Boden auf zehn Meilen im Umkreis der Stadt zu eigen gegeben.«
Die unblutige Eroberung von Sinigaglia ließ der Papst durch Herolde in allen Straßen Roms austrompeten, und auf dem Monte Mario und den sieben Hügeln loderten riesige Freudenfeuer.
Am Tage vor dem Heiligendreikönigsfest ließ Alexander seinen jüngern Sohn Jofré kommen, den unbedeutendsten und unfähigsten Burschen der Welt. »Du ziehst mit fünfhundert Mann, Bogenschützen und Reitern, gegen Monterotondo und belagerst das Schloß, wenn es nicht freiwillig seine Tore öffnet. Ich werde Sorge tragen, daß auch die andern Orsiniburgen zu Kreuz kriechen.«
»Es wird eine schwere Arbeit werden,« wagte Jofré zu erwidern.
»Um so leuchtender wird dein Name strahlen, Junge. Und nun ruf mir den Bischof von Corneto.«
Dieser harrte schon im Vorgemach. Es war der reiche Adriano Castello, der Schatzmeister und vertraute Sekretär Alexanders, ein stattlicher, hochgewachsener Kleriker von stadtbekannter Gelehrsamkeit und hohem Ernst. Seine finanziellen Talente wurden bis nach Florenz gepriesen. Er war der Nachfolger des vergifteten Kardinals Ferrari geworden. Im Borgo stand sein wunderschöner neuer Palast. Alexander wußte, welchen Mann er sich zum Schatzmeister gemacht hatte. Es konnte einmal die Gelegenheit kommen, Adrianos Reichtum in Beziehung zur halbgeleerten Schatzkammer des Papstes zu bringen.
Nun schloß er sich mit ihm im Turmzimmer ein.
»Ihr baut Euch ein Haus an den Hängen des Monte Mario? Und wollt Bramante zu Rate ziehen?«
»Ich habe schon daran gedacht, allerheiligster Vater. Es soll prächtig ausgeschmückt werden. Flandrische Teppiche sind schon bestellt, meine Bibliothek ist beträchtlich erweitert –«
»Ach ja, Eure Bibliothek, sie soll ja der des Kardinals Medici nicht viel nachstehen.« Der Papst tat, als dächte er angestrengt nach. »Wartet – sagt man nicht, daß auch Giambattista Orsini eine große Bibliothek besitzt? Er soll viel im alten Rom herumstöbern –«
»Ich schätze ihn als einen bedeutenden Kenner der römischen Geschichte, als einen tüchtigen Antikenforscher,« sagte Adriano.
»Als der Ihr ja selbst auch geltet. Um auf den Orsini zu kommen – Ihr könntet mir gefällig sein, wenn Ihr von dem Orsini eine Abschrift der Familienbriefe des Cicero für mich erlangen könntet, ich meine nur zur Lesung. Es sollen darunter einige ganz unbekannte sein. Und ich liebe Cicero. Der Kardinal bewohnt seit einiger Zeit den Palast auf Monte Giordano. Weiß Gott, was ihn aus seinem einsamen Monterotondo da hereingezogen hat! Und bei der Gelegenheit könnt Ihr ihm gleich den glücklichen Fall von Sinigaglia melden. Er wird sich freuen, sicherlich freuen.« Der Papst sah zu Boden und schien das Teppichmuster zu studieren. Dann sagte er sehr vertraulich: »Ich gedenke demnächst neue Kardinäle zu ernennen. Es ist sicher, daß ich Euch nicht übergehen werde.« Über sein Antlitz glitt ein fettiger, freundlicher Schimmer.
Adriano verneigte sich glückstrahlend.
Alexander rückte näher heran. »Ihr könnt Euch verbindlich zeigen durch einen mühelosen Gegendienst, der Euch Gelegenheit gibt, Eure Anhänglichkeit an meine Person zu beweisen.«
»Eure Heiligkeit –« stotterte der verwirrte Bischof.
»Ihr braucht nur den Wunsch zu äußern, Eure schöne Bibliothek vermehrt zu wissen durch kostbare Folianten, wie sie zum Beispiel dieser Orsini besitzt.«
»Diesen Wunsch würde ich allerdings haben. Aber ich sehe nicht ein –«
»Wie Euch der Kardinal diese Folianten abtreten könnte?« Der Papst rieb sich langsam, lauernd die Hände. »Ei, man müßte ihm nicht mehr Gelegenheit geben, sie zu durchblättern.«
»Ich verstehe noch immer nicht, Eure Heiligkeit –«
»Ihr seid ein Fischkopf, zukünftiger Kardinal,« sagte der Papst mit leichter Ungeduld. Dann rundeten sich seine Pupillen und die Iris schillerte grün. »Der Purpur ist Euch sicher, wenn ich des Kardinals Orsini – sicher bin.«
Dem Bischof blieb der Mund offen stehen.
Da erhob sich der Papst und pflanzte seinen wohlgepflegten Leib vor dem bestürzten Prälaten auf. Mit einer eisig geschärften Stimme, die aber ganz leise tönte, enthüllte er die Ruchlosigkeit seines Gedankens. »Wenn morgen der Kardinal Orsini mir die Cicerobriefe überreichen wird, hat Eure Glücksstunde geschlagen. Ihr braucht dieses Ereignis nicht anders einzuleiten, als indem Ihr dafür sorgt, daß fünf bewaffnete Söldner hinter dieser Tür auf mein Glockenzeichen harren. Dann nehmt Ihr den Kardinal gefangen.«
»Was – hat – er – verbrochen?« zitterte der entsetzte Bischof.
»Er hat die Unvorsichtigkeit begangen, mit meiner päpstlichen Autorität unzufrieden zu sein. Und zum Überfluß hat er das Unglück, ein Orsini zu sein. Es werden zur selben Stunde, da die fünf Lanzen nach seiner Brust drohen, sämtliche Orsini in den Mauern Roms dasselbe Schicksal erleiden. Die Colonna, Savelli und Gaetani sind vernichtet. Die Bären sind die einzigen, deren Pranken noch zu fürchten sind. Sie haben das ganze Land im Norden Roms vom Tyrrhenischen Meer bis zum Fucinersee in ihrer Gewalt. Diese Gewalt unterbindet und gefährdet die meinige. Ich will sie brechen. Ist das geschehen, dann habt Ihr die Freude, Eure Bibliothek um einen Riesenschatz klassischer Weisheit vermehrt zu sehen. Ihr bedenkt Euch?«
Adriano wußte, daß jedes Zögern ihn beim Papst verdächtig machen konnte. Mit verblaßten Lippen und schreckerfüllten Augen nickte er sein schmerzliches Ja.
»Wählt Euch sogleich aus meinem Marstall das schönste Pferd aus. Es soll Euch ein Zeichen meiner Wertschätzung sein. Und nun schickt nach dem Governatore.«
Der Bischof wankte ab. Alexander sah ihm mit zusammengebißnen Lippen nach. Dein Reichtum ist noch keine Macht, sagte er leise vor sich hin. Er ist es erst in den Händen desjenigen, der ihn zu nützen versteht. Und das werde wohl ich sein müssen. Mit einem sarkastischen Lächeln schlug er die Vulgata auf. Aber er fand keine Ruhe in der erhabenen Diktion des heiligen Buches. Er dachte an alte Geschichten. An die sonderbaren Gelüste seiner lieben Römer. Einst ehrten diese das Andenken ihres besten Senators, indem sie sein totes Haupt in eine kostbare Vase legten und diese über einer Marmorsäule auf dem Kapitol aufstellten. Es war das Haupt eines Brancaleone. Nun denn, sann er, ich will ihnen das Haupt dieses edlen Orsini ebenfalls zum ewigen Gedächtnis auf das Kapitol stecken.
Alexander und Cesare! Es war ein Hirn, das Hirn der Borgia, das die Taten dieser beiden Teufel ausdachte.
 In den Weihrauchnebeln der heiligen Dreikönigsmesse saß der Papst auf dem Faldistorium in der weißschimmernden Dalmatica, die Manipula auf dem Arm, auf der Brust die drei leuchtenden Nadeln des Palliums, und verfolgte mit Aufmerksamkeit die Zeremonien des die Messe zelebrierenden Kardinals Giambattista Orsini. Die strahlende Autorität des Statthalters Christi ließ ihren Zauber auf das Volk auswirken, das in dichten Massen den Dom füllte.
In den Weihrauchnebeln der heiligen Dreikönigsmesse saß der Papst auf dem Faldistorium in der weißschimmernden Dalmatica, die Manipula auf dem Arm, auf der Brust die drei leuchtenden Nadeln des Palliums, und verfolgte mit Aufmerksamkeit die Zeremonien des die Messe zelebrierenden Kardinals Giambattista Orsini. Die strahlende Autorität des Statthalters Christi ließ ihren Zauber auf das Volk auswirken, das in dichten Massen den Dom füllte.
Nach dem Segen setzte der Papst die Krone auf und begab sich unter dem Baldachin nach dem Schiff der Veronika, wo zweimal die Lanze und dreimal das Schweißtuch gezeigt wurde. Dann ließ er sich im Tragsessel in den Saal der Päpste geleiten, wo er den Ornat ablegte. Er trug nun die weiße Kapuze, darüber eine goldblitzende Stola und eine weißseidene Mütze. Er ging in sein Arbeitsgemach, und man meldete ihm, daß der Governatore im Papageiensaal harre. Alexanders Antlitz trug einen apostolischen Friedensschein. Er ließ zuerst seine Nepoten vor, die ihm zum Fall von Sinigaglia gratulierten: die Kardinäle Ludovico und Giovanni Borgia, zwei Kapitäne der Palastwache und den Vizekastellan von Tivoli. Dann wurde der Kardinal Orsini zur Audienz gemeldet. Da zuckte ein eigentümlicher Gedanke durch sein Hirn, eine kleine unbedeutende Erinnerung: er war im Zeichen des Skorpions geboren. Und dieses greuliche, stachelwütige Tier lief jetzt gleichsam mitten durch seinen Kopf; aber es schreckte ihn nicht, sondern ließ ein Gefühl angenehmen Kribbelns unter seiner Hirnschale zurück, als er sich mit Gelassenheit hinter seinem Schreibtisch verschanzte, wo er die Lade öffnete und das Konvolut der Orsinibriefe flüchtig mit den Blicken streifte.
Im nächsten Augenblick stand der Kardinal im Zimmer. Das kalte Winterlicht umspielte seine Gestalt mit einem silbernen Glanz. Mit dem angebornen vornehmen Gebärdenmaß des römischen Edelmannes trat Giambattista zum Hand- und Fußkuß vor den Papst hin.
Alexander ließ ein freundliches Lächeln über den Knienden gleiten. »Ich habe Euch bitten lassen, mir die Kopie der Familienbriefe des Cicero zu bringen.«
»Ich bin beglückt, Euch dienen zu dürfen, allerheiligster Vater,« sagte der Kardinal, indem er sich erhob. Und er sah des Papstes Auge klar leuchten wie einen sonnenüberspielten Tautropfen. Das gab ihm innern Halt; denn mit beunruhigtem Herzen war Giambattista heute dem Ruf des Papstes gefolgt, da er meinte, es handle sich um Tiziana. Doch als er jetzt das Antlitz mit dem bezwingenden Schimmer der Liebenswürdigkeit und Leutseligkeit sah, verdammte er das Mißtrauen seines Herzens.
Alexander betrachtete gütig den seltsamen Schwärmer. Seine überempfindliche Erotennatur schnupperte unwillkürlich in dem Dunstkreis herum, in dem der Duft des allerschönsten Frauenleibes zu schweben schien. Dieser Kardinal lag vielleicht heute nacht in der glutenden Umarmung des Weibes, nach welchem des Papstes Sinne heiß begehrten. Der wollüstige Greis durchflog im Geiste die fremden Wonnen, in die seine Einbildungskraft die eignen frevelhaften Wünsche hineinglühte. Er erinnerte sich, daß ihm sein Leibarzt als stärkende Arznei das Einatmen des Hauches empfohlen hatte, der um die Glieder eines kurz vorher gebrauchten Frauenkörpers wehte. Ein Rest dieses Hauches hatte sich wohl in dem Gewand dieses glücklichen Kardinals verfangen, denn wie hätte sonst der Papst dieses angenehme Prickeln seiner Sinne verspürt? Aber nur einen Herzschlag lang dauerte dieser Reiz. Dann kehrte das Hirn zur nüchternen, fürchterlichen Aufgabe zurück. Er sah wieder prüfend den hohen Priester an. Er erschien ihm als der gefährlichste Mann unter den Orsini, da er ihr größter Denker war. Vielleicht konnten die flammenden Episteln ihm nur der Schemel sein für den Papstthron. Schon saß Papst Nikolaus III. aus dem Haus der Orsini einst auf Petri Stuhl, und das Vorbild konnte ermutigend wirken.
Alexander nahm die Kopie aus des Kardinals Händen. »Ein schönes heidnisches Dokument fürwahr,« sagte er mit Prüferblick. »Ich schätze den Staatsmann Cicero ebenso hoch wie den menschlich durchgebildeten Geist und übersehe gern darüber seine Eitelkeit. Aber den wahren Menschen sollen mir diese Briefe doch näher bringen. Ihr habt sie oft studiert?«
Der Kardinal nickte. »Ciceros Stil ist mir für meine eigene Gedankenformung vorbildlich gewesen.«
»Ja, ja, Ihr seid ja selbst ein Höhenflieger, den die Wolken nicht schrecken, in denen sich der hippogryphische Geist leicht verirren kann.«
»Der gute Stern leuchtet über den Wolken und wird am Ende den Irrenden aus dem Labyrinth befreien.«
»Setzt Euch, setzt Euch,« sagte der Papst aufgeräumt. »Wir wollen disputieren über Schönes und Gutes.«
Der Orsini ließ sich in einen reich geschnitzten Sessel nieder. Sein genußfreudiger Blick wollte die Schöpfungen Pinturicchios studieren. Eine herrliche Farbenglut strahlte von der Decke, den Wänden und Lünetten herab und verwirrte fast das Hirn. Einzelheiten zu genießen, gab Pinturicchio dem Beschauer keine Zeit. Aber auch der Papst nicht. »Ich höre, daß Ihr Euch auf Monterotondo mit viel Geschmack eingerichtet habt. Um so mehr war ich erstaunt, als ich erfuhr, daß Ihr in den Orsinipalast gezogen. Was bewog Euch zu dieser raschen Entschließung?«
»Die allgemeine Unsicherheit, allerheiligster Vater. Seit ich mit den Savelli und Colonna zu tun hatte, fühlte ich mich nicht mehr sicher in der Burg.«
»Ach ja – das war damals – und es hat viel Aufsehen gemacht in Rom. Wenn Ihr Euch noch entsinnt, so waren es zuletzt Cesare Borgias Truppen, die Euch vor dem Ärgsten bewahrt haben.«
»Ich hatte diese günstige Wendung gewiß dem politischen Machtgedanken des Herzogs der Romagna zu danken, der mich, ohne es zu wollen, von meinen Feinden befreite.«
»Wer sagt Euch, daß dies nicht die Absicht war?« fragte der Papst lauernd.
Der Kardinal zögerte mit der Antwort. »Es paßt nicht recht zu dem Bilde, das wir uns von dem Herzog gemacht haben, wenn wir ihm die kleine Rolle des Beschützers der Orsini zumuten wollten.«
»Ihr haltet ihn also nur großer Aufgaben für würdig? Ja, ja, mein Sohn hat diese gute Meinung durch Taten bestätigt. Die Romagna liegt in seinen Händen. Rom feiert Freudenfeste. Der Fall von Sinigaglia –«
»Zu dem ich meine ehrfürchtigsten Glückwünsche vor Eurer Heiligkeit Füßen niederlege,« warf der Kardinal ein, der noch nichts von der verräterischen Handlungsweise Cesares ahnte.
»Ich danke Euch, lieber Kardinal. Es haben ja dort Eure Verwandten mitgeholfen, des Herzogs Werk zu vollenden. Pagolo Orsini und der Herzog von Gravina haben sich Cesare angeschlossen, nachdem sie zuerst in einer unverzeihlichen Verkennung der Tatsachen dem Herzog abtrünnig geworden waren.« Der Papst hatte die Stirn gerunzelt; aber nun flog ein heiterer Schimmer über seine fetten Züge. »Wir kennen kein Nachgrollen, und ein Hasser, einmal gewonnen, wiegt hundert Freunde auf, sagt man.«
Giambattista senkte das Haupt. Wieder schlug ihm der helle Ton der Aufrichtigkeit aus des Papstes Stimme entgegen. »Die Erhebung der Kondottieri geschah sicherlich unüberlegt,« sagte er etwas bedrückt, aber in dem Bewußtsein, keine Lüge zu sprechen.
Alexander machte mit der Hand ein Zeichen der Vergessenheit. »Um auf Euch zu kommen. Ihr lebt ganz der Kunst, glücklich zu sein? Wollt Ihr mir einen Teil dieser Weisheit verraten? Ich fühle mich nicht glücklich auf dem Papstthron. Man wirft mir vor, daß ich mich weniger durch Gefühle leiten lasse als durch den Verstand. Aber ich glaube, die religiöse Frage kann ohne politischen Verstand nicht gelöst werden.« Der Papst sah den gelehrten Mann mit scheinbarer Wißbegierde an.
»Ich weiß nicht, ob mein Freimut Eurer Heiligkeit willkommen sein kann?«
Da rückte der Papst mit inniger Anteilnahme seinen Stuhl näher. »Das Pfauengewedel des sklavischen Geschmeißes ringsum widert mich an. Ich brenne danach, ein aufrichtiges Meinen zu vernehmen. Sagt, wie stellt Ihr Euch die Verwaltung der Religion vor?«
»Als ein Amt ohne Feuer und Schwert,« sagte Giambattista mit dem glücklichen Eifer eines Menschen, dem es gegönnt ist, zum erstenmal frei vor demjenigen zu sprechen, dessen Leben zum Teil ein Gegenstand seiner Gedanken war. »Die Verwaltung der Religion kann, dünkt mich, nur eine leichte Aufgabe für den sein, der wahre Religion hat. Und wer hat Religion? Der recht und gut ist.«
»Das ist sokratische Weisheit,« lächelte der Papst. »Man merkt, daß Ihr mit den Heiden auf gutem Fuß steht.«
»Diese Heiden hatten Religion, sobald sie Gott auf die Finger sahen,« sagte Giambattista mit ehrlicher Überzeugung. »Mich rührt dieses heilige Suchen Platos und Sokrates' ebensosehr wie der Glaubenseifer eines Paulus. Allerheiligster Vater, ich meine, wir haben Gott nur ein neues Kleid gegeben, aber ihn selbst konnten wir doch nicht umschaffen.«
»Das klingt ketzerisch genug,« lächelte der Papst wieder. »Aber ich bin kein Gregor. Man muß zuzeiten die Lüftung der scholastischen Stuben gestatten, und meine Gelehrten besorgen dies Geschäft mit Hingebung. Auch meine Gelehrten im Purpur. Übrigens tut die Helle, die von außen in das dogmatische Gebäude geschleudert wird, auch mir wohl. Nur sollten sich die Weisheitsverwalter hüten, allzuviel Licht in die Dunkelheiten der Religion zu werfen. Haben wir einmal einen sonnenklaren Weg zu Gott, dann brauchen wir keine Priester mehr.« Der diplomatische Teufel rutschte dem Papst zum Kragen heraus. Er besann sich und nahm wieder die Maske des sittlichen Oberpriesters um. »Aber so weit sind wir noch nicht, und das Volk braucht die Priester.«
»Aber nur gute, edle,« wagte der Kardinal einzuwenden.
Der Papst nickte heftig. »Die meisten werden erst gut, wenn es zu Ende mit ihnen geht. Ich wünschte herzlich, daß meine Kardinäle Euch nachgerieten. Es ist eine Freude, Euch in den Schriften aus dem Bronnen der Religion schöpfen zu sehen.« Der Papst log. Er hatte diese Schriften nie gelesen.
»Ich verteidigte in meinen Schriften nicht nur die Religion, sondern alles, was dem Leben Inhalt, Form, Farbe und Duft gibt, also Geist, Weisheit, Tugend, Liebe, Kunst.«
»Ein schönes Programm,« nickte der Papst. »Und Ehre dem, der sich ihm verschrieben.«
»Ehre dem, der es mich erkennen ließ,« wehrte der Orsini bescheiden ab. »Er, der Steinen feste Formen gab, wird wissen, warum er mir die Kraft gab, in seiner Werke wunderbaren Zusammenhang, in dem sich Offenbarung an Offenbarung reiht, Einschau zu halten. Sinnvoll laufen die Räder seines Uhrwerks, sinnvoll binden und lösen sich die Kräfte in Raum und Zeit, in dem kostbaren Licht Gottes wandle ich überwältigt und sehe seine Engel walten.«
Wenn deine Engel dich nur jetzt nicht verlassen! dachte Alexander. Aber noch gefiel er sich in der Maske des gutmütigen Plauderers. »Und wie weit wollt Ihr in die Majestät Gottes eindringen?« fragte er scheinbar besorgt.
»Soweit es meine Demut erlaubt. Vor meines Gottes entsiegeltem Geheimnis müßte ich tot zu Boden fallen.«
»Die Ehrfurcht erweckt Achtung. Und – mit der Scholastik wollt Ihr wohl nichts zu tun haben?«
»Sie ist das Schlackenwerk, das kasuistischer Priestergeist an die Lehre des Nazareners gelegt.«
»Hm, hm – ich habe einige Köpfe unter den Kardinälen, die Euch sehr ähneln in dieser Anschauungsweise. Da ist der Giovanni de' Medici, der Farnese, Caraffa, lauter achtbare Herren, nur haben sie alle ein wenig Neigung zur Rebellion des Geistes. Auch Ihr – ja, ja, ich weiß – habt damit begonnen, unsre Dogmen zu durchstöbern und zu putzen nach Eurem Willen.«
Der Kardinal erschrak leicht.
Alexander ließ sich nicht aufhalten. »Ihr habt eine Reform des Altars vorgeschlagen nach altchristlicher Weise, eine Vereinfachung der bildlichen Verehrung, Einschränkung der Liturgie, Betonung der Predigt, ja, sogar über das Zölibat habt Ihr, höre ich, Eure eigenen Gedanken, seit Ihr–« Er stockte. Dann sagte er rasch: »Ihr habt ein Weib genommen, und zwar auf eine andre Weise, als es sonst meine Kardinäle zu tun pflegen.«
Über Giambattistas Herz ging ein leiser Schauer. Die Berührung seines Lieblingsproblems aber war ihm willkommen. So konnte er vor dem Menschen, dessen Autorität in der Sache entscheidend war, sein Herz ausschütten. »Allerheiligster Vater,« begann er mit Wärme, «ich segne die Stunde, da es mir vergönnt ist, vor Eurem Angesicht das Recht zu verteidigen, das auch mit dem Manne in der Sutane geboren worden ist, das Recht auf Liebe zum Weib. Ich kann nur blutenden Herzens den Weg gehen, den eine klügelnde Sophistik, unterstützt von einer nüchternen Politik, uns Priestern vorgeschrieben hat. Des Heilands Wort nimmt die Ehre der Frau in Schutz und heiligt ihre Liebe, und des Paulus Wort, den Korinthern in die Brust gelegt, ist voll Sinn für die Ehe und voll Verdammnis für die Sünde, die aus einer schlecht verstandnen Liebe geboren wird. Aus dem Tempel der wahren Liebe haben unsre Priester ein Kaufhaus gemacht, in dem sie selbst Kaufmann und Käufer sind und mit der Ware prunken, die ihr Reichtum erstanden. Mir graut vor der Schändung eines Naturheiligtums, das Gott durch die Menschenehe gekrönt hat. Allerheiligster Vater, wenn ein Konzilium sich mit der Verdammung des Konkubinats befaßt, so ist damit nur halbe Arbeit getan. Der Ehe heilige Wesenheit muß es dem Priester gönnen, um ihn zum sittlichen Menschen zu machen. O, laßt die Kraft Eurer Autorität ausströmen und legt den versammelten Kardinälen und Bischöfen ans Herz, daß sie zu einem solchen leidlösenden Konzil drängen. Prüfet ihre Nieren und reiniget ihre Köpfe von listiger Deutung der Schrift. Meine Zunge ist kühn, aber die Kraft, die zur Kühnheit treibt, ist sittlich und stammt aus dem Herzen, das sich schämt, den freien, gottgegebenen Trieb verleugnen zu müssen.«
Der große Pirat des erhabensten Gefühls saß lächelnd in seinem seidenüberwogten Stuhl. »Wir wollen's überdenken,« sagte er mit gespielter Fürsorglichkeit. »Ihr habt allerdings einen Schatz am Herd, der einer solchen Verteidigung wohl wert ist.«
Des Orsini Antlitz errötete in Glück und Stolz. »Mir ward der Liebe spätreifer Kranz zuteil,« sagte er mit innerer Glut. »Um so höher schätze ich den Besitz.«
»Donna Tiziana de' Calvi, die eine Schar von Freiern in Aufruhr gebracht hat, soll der gute Stern Eures Lebens sein.« Des Papstes Linke spielte unruhig mit dem geschnitzten Knopf der Schreibtischlade.
»Sie ist es,« glühte der glückliche Gatte. »Aus Leid rettete ich sie an meine Brust. Am Dorn meines stillen Denkens stärkte sie ihren eignen hohen Geist und wurde mir Gefährtin meines Lebens. Der Mitwelt Achtung hat sie sich errungen, wenngleich der Kirche Sanktion dem Bunde fehlt. Doch drängt es mich, dem Bund Gesetz zu geben, um nicht ungehorsam meiner Obrigkeit zu sein.«
»Habt Ihr Respekt vor dieser Obrigkeit?« Der Papst änderte den Ton. »Mich dünkt, Ihr habt das nicht immer gehabt.«
»Ich verstehe nicht –« sagte Giambattista betroffen.
Der Papst hatte sich ohne Greisenschwere erhoben. Er stand nun mit gespannten Gliedern und hoch erhobnem Haupte vor seinem Opfer. »Ihr werdet mich verstehen, wenn ich Euch daran erinnere, daß Ihr des Papstes Majestät gefährlich nanntet in Wort und Schrift –«
Der Kardinal wurde kreidebleich.
Da raschelte etwas in des Papstes Hand. Giambattista erkannte sein Orsinimanuskript. Eine schreckliche Helle überblitzte ihn. Er fuhr mit der Rechten nach dem Herzen, wo das Blut in wilden Stößen tobte. »Allerheiligster Vater – das ist – eine Falle.«
»Um des gefährlichen Denkers habhaft zu werden.« Selbst der Papst zitterte in den Knien.
»Gefährlich? Ich?« Der Kardinal sah seinen Gott. »Was mir der Himmel an reinen Gedanken in die Seele gelegt, habe ich in diesen Blättern festgehalten.«
»Undiplomatischer Kardinal! Vaterlandsschwärmer!« sagte der Papst mit verzogener Lippe. »Ihr überflogt die Grenze Eurer stillen Wissenschaft und dachtet zu laut, stürmtet mit verlornen Zügeln im Reich der Politik Eures Geschlechts umher. Die Episteln an Eure Barone flammen von Aufruhrgedanken, unwürdig Eures priesterlichen Amtes. Der Orsini lodert seinen neuerwachten Alexanderhaß in die Welt. Was werft Ihr mir vor? Untreue? Als ob die Orsini die Hüter der Treue gewesen wären! Was verlangt Ihr ein Lächeln von dem Papst, den Ihr mit Frankreichs Hilfe einst bekriegt, von dem Papst, dessen Bruder ihr aus den Mauern Roms verjagt, dem Papst, den ihr bei Soriano aufs Haupt geschlagen, dessen Sohn ihr verwundet und dessen Feinde ihr beschützt habt. Glaubt Ihr, Kardinal, wir wüßten nicht die Hände zu erkennen, die schützend einen Marcello Gaetani, einen Riario vor unserm Zorn verbargen? O, wie klein dachtet Ihr von der Gewalt, die Ihr bekämpftet!«
»Ihr irrt,« bebte der Kardinal, dem der Verzweiflungsmut neue Schwingen gab, »ich kannte die Gewalt –«
»Ja, diese Briefe bestätigen es,« triumphierte Alexander. »Und doch wart Ihr so töricht, an sie nicht zu glauben, sonst wären diese Briefe ungeschrieben geblieben. O, wie wohl durchschaut die päpstliche Wirtschaft, aber weniger gut bekämpft! Nein, ich habe wahrhaftig kein Talent für einen Volksheiligen, aber ein um so größeres für einen Herrscher. Man liebt mich nicht, ich weiß es, und meine Epitaphisten werden Triumphgesänge der Hölle anstimmen, wenn der Gruftdeckel sich über mir schließt. Wie soll der Spanier Liebe von dem Italiener verlangen? Die Catalani waren euch immer Nattern, aber auch jeder Papst, solange er nicht aus eurem Geschlecht war, Orsini. Seht, da fällt mir's ein, jener Nikolaus III., was wollte er anderes als ich? Er wollte Italien in drei Reiche teilen, Sizilien, Toskana und die Lombardei, und seine Nepoten wollte er damit als Könige belehnen. Ein trefflicher Hausvater! Und ich will's auch sein! Ihr wollt's nicht unterschreiben, Ihr wollt Italien vereinigt sehen unter einem Zepter, das das Volk schwingt. Verjüngt erst dieses Volk, gebt ihm die Kraft zu herrschen, dann ließe sich mit Euch darüber reden. Doch solange ein Hirn größre Taten ausbrütet als eine Welt voll Hirnen, so lange laßt das Recht dem Einzigen. Kardinal, die Stunde der Vergeltung hat geschlagen. Wir haben die Colonna, Savelli und Gaetani, die Varani, Manfredi, Montefeltre und Sforza gebrochen, wir krönen das Werk mit der Vernichtung der gefährlichsten Feinde Roms!«
»Allerheiligster Vater!« Der Kardinal wankte. Wie der eisige Stoß der Tramontana wehte es ihn aus diesem Munde an.
»Unzufriedne Köpfe, die den kleinen Heldenseelen eines Olgiati, Porcari, Catilina und Brutus ihre Götzenaltäre bauen, müssen rechtzeitig zur Vernunft gebracht werden.«
»Allerheiligster Vater, nie tastete ich das kirchliche Hoheitsrecht des Papstes an, nur der Welt Zügel sollte der Vikar Gottes fallen lassen.«
»Die Petrischlüssel öffnen Himmel und Erde!« rief der Papst mit pathetischer Gebärde aus. Sein kindischer Größenwahn sprudelte über.
Dem Kardinal fuhr Dantes anklagender Wehruf durchs Hirn: Und aus dem Hirten ward ein Wolf voll Tücken! Aber nun wußte er's, er war ein ausgestrichner Posten im Rechenexempel dieses Papstes geworden.
Da tönte wieder die heisre Stimme: »Stiller Held der Kardinäle! Wir wollen Eure heldenhafte Gelehrtheit auf ein bürgerliches Maß herabsetzen, damit sie den harmlos denkenden Köpfen nicht Schaden bringe. Man wird mit Euern Idealen nur fertig, indem man sie mit nüchternen Wirklichkeiten bekämpft. Mit Hammerwucht will ich auf Eure Barone niederfahren. Und das Schwert ist der beste Helfer gegen die Auswüchse aufrührerischer Gelehrsamkeit.«
»So wollt Ihr den Gedanken der Tugend kreuzigen?« zitterte der Kardinal.
»Und den Denker mit!« Alexander verzog sein Fettgesicht zur Grimasse. »Der Sturm auf die letzten Barone Roms hat begonnen. Ihr dürft wieder einziehen in die Burgreste, die einst Eurem Geschlecht gehört hatten; die Torre di Nona öffnet für Euch ihre Pforten.« Es war das Stadtgefängnis.
Giambattista fuhr entsetzt zurück. »Laßt Gnade walten!«
»Das will ich tun. Die Engelsburg hat beßre Stuben.«
»Allerheiligster Vater!«
»Stuben, wo die Einsamkeit, die stille Freundin Eurer Gedanken, Hüterin Eurer gefährlichen Hirngespinste sein wird. Und nun wisset den Meisterstreich, der die Bewunderung der wahren Freunde Italiens erregen wird. Cesare Borgia hat die verräterischen Kondottieri überlistet. Vitelli und Oliveretto sind gerichtet, Pagolo Orsini und der Herzog von Gravina dürften in diesem Augenblick vor Gott stehen –«
»Himmel!«
»Hört Ihr die Glocken läuten? Es ist das Sturmzeichen für die Orsini! Ihre Burgen und Paläste zittern! Der Erzbischof von Florenz, Rinaldo Orsini, der edle Jacopo Santa Croce und der Abt Bernardino d'Alviano, die treuesten Sachwalter der Orsini, werden in diesem Augenblick gefangengenommen.«
»Orsini!« rief der Kardinal schmerzerfüllt aus. Dann erhob er die Rechte zum Himmel. »Papst Alexander, an Eurem Sterbelager wird der Moderhauch unsrer Kerker wehen, der Gemarterten Geister werden Euch schrecken, wenn Ihr die Hände zum Gebet faltet, und er, der dem Maß der Untaten der Borgia sein donnerndes Vollendet! zurufen wird, wird Euch vor seinen Richterstuhl rufen!«
Alexander sprach sein hohnlächelndes Amen dazu, indem er die Glocke schwang. Die Tür öffnete sich. Der Bischof Adriano di Castelli mit fünf päpstlichen Söldnern trat ein.
Giambattista ließ den roten Hut fallen und öffnete sein Kleid. »Hier habt Ihr die Brust, die Gott und das Gute im Herzen getragen!«
Aber keine der Lanzen stach zu. Der Papst winkte dem Bischof. Mit einer tiefen Verneigung und einem traurigen Blick nahm Adriano den edlen Gefangenen zwischen die blinkenden Lanzen.
Wie ein Grabgeläute klangen die dumpfen Glocken Roms in den Kerkergang des edelsten Mannes hinein. Alle seine Hoffnungen sanken in die Gruft aller Enttäuschungen.
Die Glocken riefen zum Sturm auf die Burgen des Bärengeschlechts.
Als der Kardinal Giambattista in der von Lanzen umdrohten Sänfte durch die Via Alexandrina getragen wurde, sah er seine greise Mutter Ginevra mit verzerrtem Gesicht, fliegenden Haaren und in die Luft geschleuderten Armen durch die Straße wanken. Sie war wahnsinnig geworden. Gerade vor seiner Sänfte fiel sie in die Arme eines kotbespritzten Hellebardisten.
 In dem fahlgrauen Dämmerwinkel einer schmutzigen Malerstube, wo Farben, fleckige Tücher, Gläserscherben, Teller und Kehrichtreste in wirrem Durcheinander lagen, kauerte Tiziana mit schreckweiten Augen und tränenfeuchten Wimpern, den Knaben Valerio im Arm.
In dem fahlgrauen Dämmerwinkel einer schmutzigen Malerstube, wo Farben, fleckige Tücher, Gläserscherben, Teller und Kehrichtreste in wirrem Durcheinander lagen, kauerte Tiziana mit schreckweiten Augen und tränenfeuchten Wimpern, den Knaben Valerio im Arm.
Die Stube gehörte dem jungen Andrea Cornaro, einem unbedeutenden Schüler Mantegnas, der hier in der Nähe der Alten Banken zwei Zimmer bewohnte und erst vor kurzem aus Florenz gekommen war. Gutherzig, liebenswürdig, mit dem nötigen künstlerischen Leichtsinn behaftet und nicht gerade talentreich, schwang sich seine Jugend über die Bitternisse des ersten Verdienens hinweg.
Auf der Straße, im Gewühl der aufgeschreckten Römer, war ihm heute das schöne Weib mit dem Knaben in die Hände gelaufen. Er wußte gar nicht zu sagen, wie er die Hilflose plötzlich in den Armen hielt und wie er sie mit sich auf die Stube geschleppt. Er hatte Reiter traben und Sturm läuten gehört und hatte die Menge nach Monte Giordano strömen gesehen; aber was der Lärm zu bedeuten hatte, wußte er zunächst nicht. Aber dann gellte ihm unausgesetzt der Ruf: Orsini! in die Ohren.
Nun stand er ratlos, mit seinen Kinderaugen das Elend in Samt und Seide betrachtend, vor dem fast irrblickenden Weib. »Wer seid Ihr?« fragte er endlich scheu.
Aus der Ecke zitterte die Angst. »Eine unglückliche Frau! O, verbergt mich vor den päpstlichen Schergen!«
Da ahnte er, daß sie eine Verfolgte sei, eine von denen, deren Name jetzt durch die Gassen hallte.
»Rettet mich – seht nach – wie es steht – ob der Palast brennt!«
»Welcher Palast?«
»Auf Monte Giordano!« fieberte die gräßliche Angst. Tizianas Augen weiteten sich, als sähen sie der Welt Ende nahen.
Der Maler setzte ihr einen Trunk leichten Weines vor. »Ihr seid aus dem Palast entflohen?«
Sie ließ das Haupt sinken. Es war eine Antwort. Sie wollte sich nicht verraten und tat es doch. Mit den zitternden Händen griff sie in die Luft. »Ich will Euch reich belohnen, seht –« sie griff nach einem reich gestickten Beutel im Busen – »und ich habe noch Goldschmuck bei mir – verratet mich nicht!«
»Wo denkt Ihr hin? Selbstverständlichkeit läßt sich nicht bezahlen. Ich will sehen, wie es unten steht. Ich sperre zu und bitte Euch, alles als Euer eigen zu betrachten.« Er nahm die Mütze und eilte hinab.
Tiziana hörte den Schlüssel knarren. Sie war eine Gerettete oder eine Gefangene. Mühsam durchirrte ihr Geist die letzten Augenblicke. Sie hörte unausgesetzt die fürchterlichen Glocken im Ohr gellen und sah die drohenden Lanzen, durch die sie sich gekämpft hatte, um unter die aufgeregte Menge zu gelangen. Sie hatte die alte Ginevra vergebens gesucht, um mit ihr zu fliehen, als die ersten Nachrichten von der Gefangennahme des Kardinals kamen. Und als die Orsiniwachen mit den schweren Rüstungen durch den Palast rasselten, suchte sie angstgehetzt, mit verzerrten Zügen das Tor zu erreichen, wo sie endlich die Wächter bestach, die sie ins Freie ließen. In der Menge wurde sie förmlich mitgeschwemmt und gelangte so zu den Alten Banken, wo sie dem Maler halb ohnmächtig in die Arme fiel.
Sie wagte sich nicht zu rühren in ihrem Winkel. Die starren Augen auf den Knaben gerichtet, der mit den Farben spielte, saß sie in ihrer Angst da, die alle ihre Gedanken, kaum geboren, zerstückelte. Aber als nun die Stille der Stube ihre Netze um sie warf und nur der eintönige Schall der Glocken, durch das Fenster gedämpft, in ihre Sinne schlug, lösten sich ihre Schauer auf und sie begann zu denken. Wie aus einem verfitzten Knäuel schälte sich langsam ein Gedanke nach dem andern los. Der erste zerbrach gleich ihr Herz: Giambattista in den Händen des Papstes!
Und augenblicklich dröhnten die Warnrufe an die Orsini an ihr Ohr, die Giambattista in den Briefen erklingen ließ. Der Mahner selbst lag verraten da!
Tizianas Sinne gruben sich aus der Nacht heraus. Nun stand sie da, der Wut ihrer Feinde preisgegeben, die über Nacht die Maske abgeworfen. Wird sich der Papst, dieser Papst mit einer Verbannung begnügen? Und wenn auch – über ihn herrschte Cesare Borgia! Wenn jetzt dieser flammende Würger, unter dessen Händen Menschen und Städte fielen, von Norden heranzog in das aufrührerische Rom, dann war ihr Schicksal besiegelt.
Aber es galt ja gar nicht mehr ihr Schicksal! Giambattista gefangen! Dem sie sich verschrieben mit der Glutschrift ihres liebenden Herzens! Er, der Schöpfer größter menschlicher Gedanken, war in Gefahr, von der brutalen Gewalt eines berüchtigten Cäsarengehirns zertrümmert zu werden. Er, der mit Machtschritten voranging, um die Dornen zu zerhauen, die Tugend, Weisheit, Religion und Menschlichkeit umrankt hatten, er, der auf einsamen Pfaden zu den Menschheitsgipfeln hinaufschritt, um von dort den andern zuzurufen: folgt mir nach! Ich nehme Euch den Druck vom Herzen und vom Hirn. O, ein fleißiger, unermüdlicher Johannes des Geistes, bereitete er dem Heiland den Weg, er, Giambattista! Und im Geiste legte sie ihre frommen Hände auf seine Stirn.
Da quietschte der kleine Valerio spatzenfröhlich auf. Sie warf sich über den geliebten putzigen Leib und drückte ihn, kaum ihrer Sinne mächtig, an ihre Brust. Mitten in der wehen Seligkeit überfiel sie der Gedanke an die Habgier der Borgia. Der Hamster mit der Tiara auf dem Kopfe wartete nun, sich die Backen vollstopfen zu können mit den geschleiften Gütern. Und er, der Unschuldigste, Reinste, Menschlichste des Geschlechts fiel sinnlos als Erster in dem ungleichen Kampf.
Ihr graute plötzlich vor der Gerechtigkeit Gottes. Sie weitete ihr Herz, um es empfänglich zu machen für den unverständlichen Willen Gottes, aber tausend Speere durchzuckten es, und die Glaubensdemut zerbrach unter dem Anprall der furchtbaren Gewalten. Wie konnte Gott das Entsetzliche zulassen? Wie konnte er die Ruchlosigkeit triumphieren lassen über die Unschuld? Mit dem kleinen Menschenhirn suchte sie in der Unerforschlichkeit göttlicher Beschlüsse herumzutappen. Die Opfergröße, die ihr Gott auf die Schultern laden wollte, begriff sie noch nicht, begriff auch nicht, daß sie selbst mit ihrer kleinen Tragödie nur eine kleine Hilfsgröße in dem großen Rechenexempel Gottes bildete, das die geistige Vorwärtsbewegung der Welt zum Ziele hatte.
Da schleiften Schritte. Cornaro kam, erregt und keuchend. »Es geht wild zu bei den Orsinipalästen,« schnaufte er und warf seine bunte Jacke ab.
»O, sprecht, sprecht, ich ertrage alles –«
»Der Palast von Monte Giordano ist geplündert, ganze Wagen voll Silber und Gold stehen davor. Alexanders Truppen ziehen nach den tuskischen Burgen. Monterotondo soll die erste sein, die–«
»Monterotondo! Seine Burg!« Ein Verzweiflungsschrei stieß sich aus ihrer Brust. Die Rosentage ihres Glücks leuchteten grell auf und der blutige Schein der Zukunft warf seinen Abglanz darauf.
»Der junge Don Jofré soll es nehmen, bis Cesare Borgia kommt«, berichtete Cornaro.
Cesare Borgia! Die Hölle begann wieder zu tönen. Er naht! Es wurde Nacht vor Tizianas Auge. Wenn er kam, sich ihrer erinnerte, wenn sie ihm des Raubes wieder wert war, eine leichte Beute seines wollüstigen Sinnes – die Nacht ringelte sich vor ihren Augen farbig zusammen und gebar Schreckgestalten ohne menschliche Formen.
Cornaro zerhieb sie mit seinen Botschaften. »Viele Orsini sind gefangen, viele haben sich gewehrt und sind niedergehauen. Der Kardinal Orsini ist in der Engelsburg.«
Tiziana verhüllte das Haupt. Hammerschläge fielen auf ihre Seele. Und der da vor ihr stand, war er ein Feind, ein Verräter? Durfte sie sich ihm anvertrauen? Ihm sagen, daß sie des Unglücklichen Gattin sei? Sie preßte den Samt ihres Ärmels auf die schluchzenden Augen, ihre Schultern zuckten unter dem Schwall von Tränen.
»Edle Frau, ich ahne, Ihr seid aus dem Geschlecht, das jetzt seinen Fall erleidet. Kann ich Euch meine Hilfe anbieten? Bedrängten beizustehen ist Christenpflicht. Laßt mich Euer Samariter sein. Ihr könnt in diesem Zimmer weilen, solange Ihr wollt. Ich begnüge mich mit der zweiten Kammer. Unterdessen will ich Umschau halten, ob für Euch etwas zu tun wäre. Habt Ihr Freunde, zu denen Ihr flüchten könntet?«
»Was Freund war, muß jetzt darauf bedacht sein, sich selbst zu retten. Ja, ich gehöre dem Geschlecht an –« ein flehentlicher Blick rief sein Mitleid an – »verratet mich nicht, bei allen Heiligen –«
»Bei San Luca, unserm Patron, Ihr könnt meiner Verschwiegenheit sicher sein,« sagte Cornaro mit beteuernder Gebärde.
»Wie ist das alles gekommen?« fragte Tiziana.
»Cesare hat die Kondottieri getötet durch Verrat und List.«
»Es ist der Schlußstein der Zwingburg Alexanders, das letzte Pfand seiner Sicherheit.« Sie fuhr plötzlich zusammen. »Habt Ihr nichts über die greise Mutter des Kardinals gehört?«
»Ja, ja, man hat sie in einer Kirche aufgefunden, halb wahnsinnig, sie schleuderte Altarkreuze gegen die Marienstatue –«
»O Ärmste, Ärmste!« Tiziana preßte die Hände an die glühenden Schläfen. Ihr Blut tobte, als suchte es Befreiung aus dem engen Gehäuse. Mühsam erhob sie sich und wankte zum Tisch. Den Knaben hungerte. Cornaro drückte ihm ein Stück Milchbrot in den kleinen Mund. »Wie gut Ihr seid«, sagte Tiziana dankbar. »Schafft mir doch ein Essen für den Knaben, nur ein wenig Milch –«
»Und für Euch?«
»Nichts, nichts. Und wenn Ihr könnt, besorgt mir bis zum Abend ein Quartier. Hier habt Ihr Geld.«
»Es ist draußen zu unsicher für Euch,« hastete der Maler hervor. »Ich bitte Euch, bleibt hier, ich belästige Euch nicht, bei meiner Ehre! Ich will unterdessen bei meinem Freund Prospecco arbeiten und schlafen, ich nehme das wichtigste Geräte hinüber. Nur verzeiht, daß meine Dürftigkeit so groß ist und ich Euch nichts andres bieten kann als dieses elende Zimmergerät, bei dem die Notwendigkeit der einzige Schmuck ist. Aber ein ordentliches Bett will ich bei Monna Riccarda für Euch erbitten, einer kleinen Freundin von mir, die sich in Wäsche auskennt. Habt nur Nachsicht mit meiner Unbeholfenheit.« Seine gütigen, frischen Augen sprachen und baten tief in ihr Herz hinein.
Und Tiziana rührte die Barmherzigkeit des armen Jungen, und ihre Angst verebbte ein wenig. Auf ihre verweinten roten Lider legte sich der Tau der Hoffnung.
Als der Maler gegen Abend seine Gerätschaften zu seinem Freunde schaffte und die Stube so behaglich als möglich einzurichten begann, hatte Tizianas Herz einen ruhigeren Wellenschlag bekommen, und ihre Gedanken versuchten in die Leere des zerschlagenen Gehirns einzudringen. Sie blickte durchs Fenster, gerade in die verlöschende Glut. Die blutende, weitaufgerissene Wunde des Abendhimmels, die sich langsam schloß und in die sanfte Nacht hinübereilte, wurde ihr zum Gleichnis für ihr eignes Herz.
Bei der Kerze Schein saß sie dann allein mit dem Kinde an dem zerkerbten Tisch. Sie besann sich nun auf ihre schuldige Seele, die feierte und fürchtete und bangte, während Giambattista litt. Sie sollte tatenlos den Mann verschmachten sehen, der ihr Liebstes war, sollte hier die Hände in den Schoß legen, während er –
Mit Speeresschärfe stieß ein Gedanke in das Nebelbrauen ihres Hirns. Sie wollte das Ungeheuer mit der Wehrkraft ihrer Tugend verscheuchen, aber es kam immer wieder, wie ein zudringlicher, gigantischer Vogel, der nach ihr hacken wollte. Sie rettete sich an den kleinen Körper des schon schlafenden Kindes und streichelte ihn, als wollte sie in der Berührung des sanften Atems Linderung für ihre eigene Herzzerrissenheit suchen. Aber der Anblick der Unschuld jagte den Gedanken nicht fort. Und allmählich entfielen ihm die schrecklichen Gewichte der Schuld, die an ihm hingen, und er bekam die Gestalt eines großen Werkes. Entsetzen wandelte sich in Erhabenheit, Schuld in Tugend, Sünde zur Opfertat um. Sie begriff plötzlich, was das Verbrechen unter Umständen zum Heldentum adeln konnte. Von Schauern umflattert legte sie sich in das reinlich bereitete Bett und scheuchte in ruheloser Gedankenarbeit die Träume von sich.
Auf der Straße wogte bis tief in die Nacht der Lärm und die Unruhe des Tages nach. Um die Orsinihäuser standen die Hellebardenkordone der päpstlichen Truppen. Von den Mauern und Zinnen der geplünderten Paläste rieselte das kalte Licht des Mondes nieder. Es spielte auch über den blassen Gesichtern der gehenkten Orsiniknechte, die ihre allzu starke Treue für ihre Herren mit dem Strick bezahlen mußten. Von den Tibersümpfen flogen aaswitternde Krähen herbei. Es war grimmig kalt geworden.
 Oede Wintertage sahen nebelgrau in die Fenster des Vatikans. Aber sie verdüsterten nicht den triumpherfüllten Geist des Papstes. Aus der Romagna traf die beruhigende Nachricht ein, daß auch dort die gefährlichen Orsini auf dem Altar der Borgiahausmacht hingeopfert worden seien. Pagolo Orsini und der Herzog von Gravina waren von Michelotto erwürgt worden. Das Wespennest der Verschwörung war ausgebrannt. Wie ein Äolus jagte jetzt der leichte Sieger durch das mittelitalische Land.
Oede Wintertage sahen nebelgrau in die Fenster des Vatikans. Aber sie verdüsterten nicht den triumpherfüllten Geist des Papstes. Aus der Romagna traf die beruhigende Nachricht ein, daß auch dort die gefährlichen Orsini auf dem Altar der Borgiahausmacht hingeopfert worden seien. Pagolo Orsini und der Herzog von Gravina waren von Michelotto erwürgt worden. Das Wespennest der Verschwörung war ausgebrannt. Wie ein Äolus jagte jetzt der leichte Sieger durch das mittelitalische Land.
Das Erobererglück seines Sohnes versetzte Alexander in einen lachenden Taumel. Und ein Brief von Lukrezia machte die Freude des Papstes vollkommen. Er saß im Belvederegarten, da eine milde Wintersonne für ein paar Augenblicke ihren gütigen Schein über das Grauen Roms gebreitet hatte. Verödet lagen die Orsinipaläste, denn in ihren Mauern nahmen päpstliche Kommissare armselige Inventare auf. Es fielen nicht mehr viel Schätze in ihre Hände, denn der größte Teil war schon abgeführt worden. Der Papst las eben das Ergebnis der Plünderung von großen Verzeichnissen ab, als der Brief Lukrezias kam. Die junge Fürstin schrieb, daß Alfonso von Ferrara sie, wie es einem Gemahl zieme, des Nachts besuche, jedoch bei Tag seinen Freuden auch anderswo nachgehe. Der Papst schüttelte das Haupt. War Lukrezia in Wahrheit mit dieser Behandlungsweise einverstanden? Aber seine Augen kniffen sich zusammen. Die geistig anregende Umgebung des Hofes wird ihre etwas zaghafte Seele sicherlich angefeuert haben zu einem freieren Genießen. Sie hatte doch eine Schar von Dichtern und Sängern um sich. Der gelehrte Calcagnini erschöpfte sich in zärtlichen Hymnen an sie, und Ercole Strozzi, der junge schöne Apoll, soll, so schrieb sie, sich das Herz nach ihr wund schwärmen. Und dann war der venezianische Feinschmecker Pietro Bembo da, der, so sagte man, in seiner Huldigung vor ihren Reizen schon die Eifersucht des Erbprinzen erweckt haben sollte.
Der Papst faltete den Brief nachdenklich zusammen.
Eine Deputation der Kardinäle kam. Der Papst ließ sich in sein Arbeitszimmer tragen.
»Was wollen die Kardinäle?« fragte er den Zeremonienmeister Burckhardt.
»In Ehrfurcht eine Begnadigung Giambattista Orsinis erwirken,« sagte der bewegliche Kleriker mit einigem Angstklappern.
Alexander fuhr empor. »Sie wagen es? Ich hätte Lust, diese Kardinäle zu sehen, um ihnen meine Entrüstung über ihre Kühnheit ins Gesicht zu schleudern. Sie sollen sich hüten.« Seine Zornader schwoll an, die Finger kratzten nervös auf den Schriftblättern, die vor ihm lagen. »Solange die Stadt in Aufruhr ist, will ich keinen Kardinal und keinen Baron im Vatikan sehen. Was erfährt man von den Orsini?«
»Giangiordano und der Graf von Pitigliano sollen im Anmarsch auf Rom sein.«
»Wahnsinnige! Wir werden sie an die Hölle glauben lehren!«
»Die Orsini sollen im Begriff sein, sich mit den Colonna zu versöhnen, um mit ihnen gemeinsam –«
»Hahaha!« lachte der Papst grimmig. »Cesare ist im Anmarsch. Er wird mit einer Handvoll Barone auch fertig werden, wenn er die Romagna bezwungen. Meine Hofnarren mögen Späße darüber machen. Mehr ist die Nachricht nicht wert.«
»Die Orsinifrauen sind mit ihren Männern auf ihre Burgen geflohen. Die Mutter des Kardinals Orsini liegt im Hospital San Girolamo, und man zweifelt an ihrem Aufkommen.«
»Man soll Messen lesen lassen für sie in der spanischen Kirche.«
Da hörte man draußen heftige Stimmen. Der Papst sandte Burckhardt ins Vorgemach. Dort wehrten Hellebardisten und Kammerherren einer Frau den Eintritt. »Wer ist es?« fragte Alexander.
»Allerheiligster Vater – des Kardinals Orsini Kurtisane –«
Eine Helle blitzte durch das verärgerte Gemüt des Papstes. »Laßt sie vor!«
Draußen legte sich das Gemurmel. Gleich darauf stand Tiziana de' Calvi im Saal der freien Künste. Halb ohnmächtig lehnte die schöne Gestalt der Römerin an dem reichgeschnitzten Türpfosten. Der Papst stand auf und schritt federnd auf sie zu. Seine natürliche Galanterie litt es nicht, daß eine schwache Frau vor ihm zusammenbrechen sollte. Er nahm ihre Gestalt voll Artigkeit in seine Arme und führte sie in einen nilgrünen Seidenstuhl, wo er sie schonungsvoll niederließ. Nun schlossen sich die dunklen Wimpern über den angsterstarrten Augen. Ihr Herz klopfte wie dem Lamm, das den schnaubenden Wolf erspäht hat.
Der unersättliche Feinschmecker der Liebe stand mit schlürfendem Sinn vor dem unerwarteten Geschenk Gottes. Sein Rachetriumph zerbrach an der Mauer süßer Gewalten. Aber die Harpyiennatur klammerte sich doch im ersten Augenblick an eine andre Kostbarkeit, die diesen Götterleib schmückte, ein Perlenhalsband von seltener Reinheit und mattedlem Schimmer, und seine Gedanken griffen lüstern in den Glanz hinein. Aber dann zerschlug die Schönheit des Weibes selbst alle häßlichen Habgiergedanken.
Also das ist sie! sann Alexander in die angstverzitterte Blumenschönheit hinein. Wahrhaftig, sie ist des Kampfes und der Sünden wert, die um ihretwegen begangen wurden. Die sehnsüchtigen Träume seines lüsternen Gehirns, die sich mit der stets neuschaffenden Einbildungskraft eines Wüstlings allerlei Schönheiten zusammengesponnen hatten, erblichen vor der Macht der Wirklichkeit. Während sich sonst seine Greisensinne in den blütenzarten Wundern mädchenhafter Anmut verfingen, feierten sie hier vor der reifen Frucht einer Frauenschönheit eine unverhoffte Andacht, die den unermüdlichen Schwelger vor Eros' Altären von Entzücken zu Entzücken jagte. Er kostete mit genießerischer Freude die unverdiente Gnade olympischer Götter aus und drückte im Vorgeschmack des Kommenden die Siegel des Besitzes auf alle diese Reize. Bei Gott, dieser Kardinal hatte Sinn gehabt für die Edelfrucht der Liebe! sann der Papst in das zerbrochne, schöne Bild hinein. Ich brauchte nur die Hände auszustrecken, um die allerschönste Rose zu pflücken. Welche Gewalten hat mir der Himmel gegeben! Und ich mißbrauche sie nicht, wenn ich mir mit zärtlichem Flehen den Weg in den Kelch dieser Blume bahne. Solange ich atme, habe ich meine Liebe gepflegt wie ein Gärtner seine holdesten Rosen und bin immer zart wie ein Daphnis gewesen. Auch diese hier verdient, daß man sich ihre Schönheit erst erobere. Und er studierte den Edelbau dieser Glieder, die der seelische Zusammenbruch nicht zerstört hatte, er dachte sich ein Bündel von heißen Strahlen aus diesem echten römischen Flammenauge, das jetzt die Wimper freigab, stahl sich von der Hochglut dieser Lippen einen Kuß, der sein vermorschtes Mark wieder erschauern ließ, und streichelte mit den Augen die marmorblasse Haut, die allen Duft der Sinnlichkeit für ihn verströmte. Ja, er freute sich still über dem Gedankenbild, daß diese wunderschöne Frau ihm liebend dienen würde wie die Dirne Abisag dem alternden David.
Da traf ihn der erste Blick der Verzweiflung aus dem bewunderten Auge. Er wußte, daß es Zeit war, die unerwartete Audienz zu beginnen. Er mußte das dogmatische Haupt der Christenwelt in sich verdrängen und dieser unglücklichen Frau das Antlitz des Frauenkavaliers zeigen, dessen gewiegte Verführungskunst schon eine Schar herrlichster Frauen zur bedingungslosen Kapitulation gezwungen hatte. Vor der Heiligkeit des Schmerzes konnte er nicht Halt machen. Mit krampfhaft gespannten Gliedern stand er an seinem Tisch. Mit fast schneeweicher Stimme sagte er: »Donna Tiziana, Ihr irrt sehr, wenn Ihr meint, daß ich Euch zürne.« Es war, als erwärmte sich die Luft unter dem Klang dieser gütigen Stimme. Er taute die Erstarrung in des unseligen Weibes Brust auf. Er rauschte in ihre Seele hinein und öffnete dort Tore der Verzeihung. Tiziana wollte sich erheben, um jetzt den versäumten zeremoniellen Hand- und Fußkuß nachzutragen.
Aber der Papst winkte ihr gütig in die weichen Sesselpolster zurück. »Euer Unglück bewegt mich. Kann ich etwas tun, um Euer Geschick zu mildern, Ihr sollt einen bereitwilligen Menschen in mir finden.« Strahlende Leutseligkeit überleuchtete das arme Frauenherz.
»Diese Hand gebot Fürsten und Königen, in ihrem Siegeslauf stillzustehen, sie hat die Erdkugel in zwei Hälften geteilt, vor ihr neigt sich die Christenheit, weil sie die Schlüssel Petri hält, sie sendet Blitze und träufelt Balsam in kranke Seelen, und sie wird auch den Kerker des unglückseligsten Mannes öffnen, über dessen Scheitel die Unschuld leuchtet.« Nächtelang hatte Tiziana den Schmeichelklang der Worte geübt. Aber nun brach alles ungelenk, unglaubhaft, unnatürlich von den Lippen.
Der Papst fühlte den Mißklang zwischen Herz und Zunge. Aber er hütete sich, es zu zeigen. »Euer liebendes Frauenherz sieht die Unschuld, wo die Weltgeschichte seine Schuld richten wird.«
»Sie nicht, wo Ihr nicht richtet, allerheiligster Vater. O, was hat er getan?« Der vom Leid ermattete Leib brach wieder zusammen.
Alexander furchte die Stirn. »Er ist der Kopf jener katilinarischen Bande römischer Barone, die das Papstjoch abschütteln wollen.«
»Nimmermehr!« flammte Tiziana auf. »Italiens Heil sah er in seiner Träume lichtem Reich als höchstes Ziel. Nicht stürzen wollte er die Macht des Papstes, sie nur beschränken auf das Maß, das ihn ein Gotteswort als richtig wies: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, er warf Euch vor, daß Ihr die Menschen erniedrigtet, statt sie zu veredeln, daß Ihr sie verdursten ließet, wo sie schmachteten –«
»Und das ist viel, beim Himmel! Ich ehre Eure Verehrung für den Geist, der seine Grenzen sprengte, aber was Euch ein Hochflug dünkt, war in Wahrheit ein Sturz in eines Abgrunds Tiefe. Giambattista hat sein Los verdient, aber nicht Ihr das Eure.« Er setzte die Maske des warmherzigen Freundes auf.
Tiziana hatte eine feine Witterung für die Falschheit des Wortes. Doch hütete sie sich, ihr Feingefühl sehen zu lassen. »Allerheiligster Vater, wenn Ihr das Recht nicht anerkennen wollt, laßt Gnade walten.«
Der Papst tat, als überhörte er die klagende Bitte. »Ihr seid mit Eurem Elternhaus verfeindet?«
»Weil ich dem Zug meines Herzens gefolgt bin, belastete ich mich mit dem Fluch der Calvi, Savelli und Colonna.«
»Er erdrückte nicht die Liebe, die blumenrein in Eurem Herzen blühte. Wahrlich, dieser Mann war beneidenswert.«
»Er ist es noch,« sagte Tiziana mit einem leisen Stolz, den ihr leidgeprüftes Herz nicht verloren hatte. »Ganz Rom wird, wenn der Blutrausch vorbei, mit Ehrfurcht zu dem Kerker wallen, wo ein Edler für seiner Gedanken Hoheit leidet.«
»Ihr irrt,« sagte der Papst mitleidig. »Das Volk ist noch nicht reif für diese Gedanken. Es wird den Kerker meiden, weil es nicht gern mit Kerkern Bekanntschaft macht. Ja, ja,« fügte er mit Nachdenklichkeit hinzu, »Ihr gleicht ihm, es sprang ein Teil seines Feuers in Euer Herz. Sagt doch, wo herbergt Ihr, wo seid Ihr zu Gast?«
Tiziana senkte das Haupt. »Die Armut gab der Armut ein Asyl. Ein mitleidiger junger Künstler –«
»Das darf nie und nimmer sein,« fuhr der Papst empor. »Eine Edelfrau Eurer Art durch die Straßen gehetzt – ohne Quartier –«
»Der Kerker ist die Behausung des Edelsinns!« Ihre feinen Nüstern zitterten in Hohn und Erregung.
»Ein Edelsinn, der sich mit heimlicher Aufruhrstiftung befleckt hat, verliert seinen hohen Glanz, Donna Tiziana.«
»Das hat Giambattista nie und nimmer getan. Das hat Euer Wille aus seiner Schrift gelesen. O allerheiligster Vater, öffnet den Kerker meines Gatten und laßt mich zu ihm –«
»Er ist Euer Gatte nicht,« sagte der Papst mit milder Eindringlichkeit.
»Gibt das Gesetz mir auch den Ehrentitel nicht, so band ich doch mein Leben an das seine gattengleich vor dem heiligen Altar.«
»Ungültig alles –«
»So laßt die Liebe gelten! Nennt mich die Geliebte des Kardinals, nie hat es eine reinere gegeben, und meine Schmach wird meine Liebe decken.«
»Ihr habt ein Kind?«
»Einen Knaben, sein Ebenbild.« Der Mutterstolz flammte in ihrem Auge.
»Hört mich an. Der Kardinal soll würdiger in seinem Kerker gehalten werden, er soll Speise und Trank durch Euch erhalten –«
»Ich darf ihn sehen – halten –?« Die Gnade wehte wie ein Tauwindstoß in ihr Herz.
Der Papst furchte die Stirn. »So weit geht meine Absicht nicht.«
Da holte Tiziana ihre letzte Waffe aus ihrer Brust. »Allerheiligster Vater – Gold, Perlen, blinkendes Gerät, der ganze Schmuck von Monterotondo, er soll in Eure Kammern übergehen –«
»Das wird er so und so. Jofré belagert das Schloß.« Das rechte Augenlid verzog sich tückisch.
Tiziana wimmerte vor Weh. Da gewahrte sie, wie des Papstes Blick auf ihrem Perlengeschmeide erstarrte. Im Nu nestelte sie die mattschimmernde Herrlichkeit von dem braunen Samt ihrer Haut. »Nehmt das letzte Angebinde meines Kardinals!«
»Wahrhaftig – ein kostbar Ding!« Alexander ließ die gleißende Blankheit durch die wohlgepflegten Finger gleiten. Die Perlen raschelten. Und der Papst dachte an Lukrezia. Wie ein niedriger Krämer, mit gestielten, prüfenden Augen, leicht zitternden Knien und habsüchtigem Herzen wog er das knisternde Kleinod in den Händen spielend ab und ließ es im Licht schimmern. Dann warf er die letzte Scham von sich und trat den kärglichen Rest seiner Würde mit Füßen. »Ich will es gern nehmen, dies Geschmeide,« sagte er, während sich seine Wangen leicht röteten, »es soll ein kostbar Andenken an die schönste und bedauernswerteste Frau Roms sein, ein Andenken an diese Stunde, die mir eine neue Offenbarung irdischer Schönheit schenkte. Und Ihr sollt nicht unbedankt von hinnen gehen: Der Kardinal wird ein fürstliches Gemach erhalten, selbstgewählte Lektüre und schmackhafte, reiche Kost.« Wie ein gewöhnlicher Händler Geld und Ware tauscht, so fertigte er den Menschenhandel ab. Dann wurde seine Rede lebhaft bewegt. »Aber ich müßte mich einen Unwürdigen schelten, wollte ich Euch so ziehen lassen in neue Bedrängnis und Verlassenheit hinaus. Gönnt es mir, Euer Leben in geregelte Bahnen zu lenken.«
»Mein Leben regelt sich nach dem Leben meines Gatten. Leidet er, so leide ich, frohlockt er, so frohlocke ich.« Sie warf es stolz wie eine Fürstin hin.
»O, glaubt mir, das Leben zerbröckelt unsre Ideale durch seine unerbittlichen Forderungen. Die Armut würde Euer Gemüt, Eure Schönheit vergiften.«
»Allerheiligster Vater! Giambattista leidet!!«
»Kann eine edle Schöpfung Gottes sich selbst zertrümmern?«
»Es liegt an Euch, mich nicht zu zertrümmern! Gebt uns frei!«
»Dem Orsini die Freiheit? Sie wäre mein Sargdeckel. Aber Euch, Euch könnte ich sie geben. Das losgerissene Herz wird sich besinnen und das Leben in Freiheit einem Vertrauern hinter Kerkermauern vorziehen. Noch hält Euch das Unglück fest, aber werft Eure Gedanken in das nächste Jahr hinein. Verblichen und verwelkt wird die Erinnerung sein, tot die Vergangenheit, aber in Schönheit flimmern wird Euer Leib, in Schönheit Eure Seele. Blüten eines neuen Frühlings winken Euch, der Himmel wirft ungeahnte Gnadenfülle auf Euer Leben, es ist an Euch, das Herz dem Danaeregen zu öffnen. Wenn Ihr den Vatikan jetzt verlaßt, steht Ihr auf dem Scheidewege. Ein Weg führt Euch in namenloses Elend, der andre –« des Papstes Gestalt richtete sich auf, als wollte sie mit prometheischer Vermessenheit das Jugendfeuer vom Olymp ertrotzen – »der andre führt Euch in ein Reich unendlicher Gnade und Huld, dessen Ende erst das Ende Eures Lebens bestimmt. Pracht und Prunk sollen die Devisen des Hauses Calvi sein, ein glänzender Hofstaat, um den Euch Fürstinnen beneiden sollen, wird Euch umgeben, wolkenlos spannt sich ein Himmel irdischer Freuden über Euer Dasein aus – seht, diese kleine Glocke, die jetzt in meiner Hand ruht, ich läute sie, und fünfzig Läufer sind bereit und zwanzig Edeldamen, Euch zu geleiten in den Palast der Borgia, wo sich hundert flinke Hände im Augenblick rühren werden, die Zimmer für Euch zu schmücken, die Giulia Farnese innehatte –«
Wie von Natternzähnen gebissen, taumelte Tiziana in die Höhe. »Verweser des Reiches Gottes! Schamloser Schächer!« Mit wildjagendem Atem stand sie da, die sprühenden Blitze nach dem prahlenden Sünder schleudernd. »Mordet meinen Gatten! Mordet mich! Und noch im Tod werden wir vereint die Stunde preisen, da wir dem Wuchrer Papst den Kaufpreis unsrer Ehre ins Gesicht geschlagen! Ruft Eure Schergen – ihre Dolche treffen kein unvorbereitetes Herz – doch hütet Euch! Hütet Euch vor den Leuchtfackeln der Orsini! Wenn man mich greift und bindet, brennt Rom an allen Ecken und Enden!« Und sie riß die Tür auf, daß die Stimme in den Vorsaal gellte.
Der Papst war bleich geworden wie der Kreidefels unter dem fahlen Schein des Blitzes. »Werft diese Frau in die Engelsburg!« rief er den herbeieilenden Kammerherren de Caza und Marmoglia zu.
»An deinem Orsinihaß, Papst Alexander, wird sich das neue Brautfeuer unsrer Liebe entzünden! Und der Haß deiner Feinde!« Mit jähem Ruck riß sie sich aus dem Arm de Cazas und zückte einen Dolch nach dem Papst.
Mit dem aufjagenden Ruf: »Hölle!« sprang Alexander beiseite und schleuderte eine Vase nach dem drohenden Arm, der kraftlos herabfiel. Im nächsten Augenblick hakten sich die Hände der Kammerherren in den fraulichen Samt der schönen Haut. Hochatmend, den letzten Blick der Verzweiflung nach dem erbleichten Herrn der Christenheit gerichtet, taumelte Tiziana, von päpstlichen Söldnerlanzen umstellt, in den Saal der Heiligenleben hinaus.
Alexander schien um zehn Jahre gealtert zu sein. Mit gebrochnem Blick sah er ihr nach. Eines Weibes arg beleidigter Stolz hatte nach seinem Herzen gezielt. Er erblickte plötzlich in diesem schwarzen Dämon der Rache den, der gekommen war, für viele zu bezahlen. Aber schon in den nächsten Augenblicken lag er in den Banden seiner heillosen Eitelkeit. Er dachte an seine eben erlittne Schmach. Kein Weib noch hatte seine zärtliche oder stürmische Werbung verschmäht, jeden Widerstand hatte die Hoheit seiner mißbrauchten Würde zerbrochen – und hier erlitt seine berühmte Ars amandi die erste Niederlage. Er glaubte zu sehen, wie das letzte Laubblatt vom alternden Stamm zu Boden fiel und er nun liebeskahl und dürr dastand, dem Spott der Welt preisgegeben. Die Schmach rieselte durch seine Rückennerven und sammelte das Blut in seinen Wangen. Er wich dem Spiegel aus, denn er fürchtete sich vor seinem verfurchten Gesicht, das von einer Frau einen Schlag erhalten hatte. Und er dachte unwillkürlich an seinen lieben Sproß Cesare. Der hätte anders gehandelt. Der hätte sich das Wild erlegt mit der Waffe der Jugend, mit dem Pfeil seiner persönlichen Kraft, mit der Gewalt des Zwingherrn. Er hätte sich mit Sols Ungestüm über die sich sträubende Leukothoe geworfen und ihre Umarmung erzwungen. Aber er, der alternde Gott, hatte die Schmach erlitten, seine eingebildeten Kräfte verlacht zu sehen von einem Weibe. Und dieses Weib war noch schöner in ihrem heroischen Rasen als in ihrem liebenden Schmerz. Er sah das Antlitz noch nachglühen im purpurnen Zorn und die Augen auf sich gerichtet wie dunkle Dolche.
Die furchtbare Erregung hatte seine Festigkeit entzweigebrochen, die Freude an den Siegesnachrichten in den Staub geworfen. Es gab ein Weib, das lieber starb, als sich seiner lüsternen Umarmung zu ergeben. Da kroch aus der Tiefe seines verderbten Charakters der Haß gegen dieses Weib empor. Und nach der Art heimtückischer Naturen holte er aus sich selbst die Rache hervor, die ihm die grausamste schien. Er wankte nach dem Tisch und griff nach einem Zettel. Dann warf er mit seinen stachlichten, zerrißnen Buchstaben dem Sohne Cesare die Beute hin: »Heil dir, Cäsargleicher! Dein Vater hat dir den Willkomm bereitet, der dem erotischen Kostverächter wie ein Nektartrunk anmuten wird. Tiziana de' Calvi liegt in der Engelsburg und harrt deiner Erlösung. Beinahe hätten mich die tisiphonischen Schlangenarme der schönen Römerin gefangen. Aber ich lasse dir das schöne Vorrecht der Jugend. Alexander Sextus Servus Servorum Dei.«
Der eitle Prahler beschönigte seine Niederlage. Er klingelte dem Kammerherrn de Caza. »Das Schreiben durch drei Eilboten an den Herzog der Romagna senden.«
Dann bestellte er ein gepfeffertes Huhn und ließ die päpstlichen Musici für die Mittagstafel holen.
Da tönten plötzlich ferne, dumpfe Kanonenschüsse.
Der Papst fährt empor. Die Tür wird aufgerissen. Der Saal der Papageien drüben ist voller Hellebarden. Zwei Kuriale stürzen herein. »Allerheiligster Vater – die Orsini – haben die Nomentanische Pforte gestürmt – die Wache überrumpelt und sind in die Stadt gedrungen. Gegen dreitausend Söldner ziehen gegen Rom.«
»Leibwächter zu mir!« stöhnt der entsetzte Papst. Seine Hände greifen nach der Stuhllehne. »Furchtbare Sibylle! Sprachst du wahr?!«
Da eilte der verstörte Governatore von Rom, Pietro Isuagli herbei. »Allerheiligster Vater – Muzius Colonna und Silvio Savelli haben im Verein mit den Orsini Palombara genommen und ziehen auf Monterotondo los, das schon in der Gewalt Don Jofrés lag.«
»Colonna – versöhnt – mit den – Orsini?!« Der Papst reißt die Augen wie ein visionärer Seher auf. »Dann fegt Neros Feuerorgie über Rom!«
»Sodom und Gomorra!« schreit der Kammerherr de Caza verzweifelt auf.
Da stürzt ein zweiter Sekretär in Reiterstiefeln staubbedeckt herein. »Bracciano und Cervetri haben sich erhoben. Die Stadt ist voll von Orsinileuten – auf der Navona kämpft man schon –«
Ein Söldnerführer rutscht auf den Knien herein, halb wahnsinnig vor Angst und Schreck. Mit blutendem Gesicht, von Hieben zerfetzt, drängt er sich vor die Füße des zitternden Papstes. »Gnade – Gnade – auf dem Weg zur Engelsburg – die Frau in der Sänfte –«
»Tiziana de' Calvi?! Was ist –?!« Der Papst flammt empor.
»Die Sänfte wurde überfallen – Fabio Orsini tat's –«
»Und? –«
»Die Gefangene ist befreit!« Von Angst zerwürgt speit es der Söldnerführer von sich. Und schnappt zusammen, kläglich, erbärmlich.
»Beim Satan!« faucht sich der Papst in die Hölle hinab. Dann entlädt sich seine Wut über den Söldling. »Und du? Hund! In die Torre di Nona mit dir!«
»Allerheiligster Vater!« bat de Caza für den Unglückseligen.
Der Papst fuhr mit seinem kurzen, dicken Arm wie mit einem Schwert durch die Luft. Dann raffte er mit einem letzten Rest von Entschlossenheit seinen Menschen aus Angst und Entsetzen auf. »Die Schweizer heran! Die Palastwache! Kapitän Raimondo Borgia! Alle Spanier sammeln! Alles, was den Vatikan betritt, nach Waffen untersuchen! In der Engelsburg die Kanonen vorbereiten! Rom niederringen und die Orsini!« Die Prahlsucht grelle durch die Angst: »Eine halbe Welt dem, der mich vor den Orsini rettet.«
Das Schießen wurde heller und schneller. Dumpfes Gemurmel wogte um die Mauern des Vatikans. Man riet dem Papst, sich ja nicht dem erzürnten Volk zu zeigen, das die Partei der Orsini ergriffen hatte. Wilde Glockenklänge brausten über die Stadt hin.
Eine erbarmungslose Sonne, von Winternebeln schmutzigrot umbraut, fröstelte in die Glieder des Papstes hinein, der halb ohnmächtig in dem scharlachnen Samt lag. Die Ärzte eilten herbei. Aber der Teufel auch. Und er hütete das ihm verschriebne Blut mit der Sorgfalt eines treuen Heiligenpatrons. Noch war der Verfalltag nicht gekommen. Noch war die Sündenlast nicht zum Atlasberg angehäuft. Noch war nicht die Zeit, den Skorpion an seinem eigenen Gift verrecken zu lassen.
 Spärlich fällt das Licht in das zweifenstrige Zimmer, in dem ein hoher Geist sein Erdenwallen übergrübelt.
Spärlich fällt das Licht in das zweifenstrige Zimmer, in dem ein hoher Geist sein Erdenwallen übergrübelt.
Der Papst sorgte gar liebevoll für den gefährlichen Kardinal Orsini; er gab ihm ein Gefängnis, dessen Einrichtung der hochpriesterlichen Würde durchaus entsprach. Die Weltgeschichte sollte nicht sagen, daß er ein knauseriger Tyrann gewesen sei. Reichgestickte, kostbare Wandteppiche, weiche Felle, ein kunstvoll geschnitzter Tisch mit Stuhl, ein silbernes Waschbecken, eine Bibliothek von römischen Geschichtsschreibern und Kirchenvätern, Bilder aus dem Märtyrerleben der Heiligen – wahrhaftig, das Gemach hätte einen Hauch von Behaglichkeit ausströmen können, wenn es nicht die Kerkerzelle eines stolzen Gedankenjägers gewesen wäre, bewacht von einer dreifachen Lanzenreihe, die den Korridor absperrte. Auch der Hof der Engelsburg strotzte von Eisen, das sich ständig rührte und Augen hatte.
Der überlistete Orsini konnte seine Natur nicht verleugnen. Auch jetzt noch spielte sein Hirn mit der Möglichkeit der Freiheit. So sehr blühte das Kind in seiner Seele, so sehr lebte der Glaube an den Sieg des Guten in seiner Brust. Sein Haupt war von Wolken umdüstert, aber er sah getrost dahinter das strahlende Licht der Sonne. Die dämonische Borgiamacht mußte an dem Schild der Gerechtigkeit seiner Idee zersplittern. Bibel und Plato, die erhabenen Wegweiser zur Göttlichkeit, übten ihre belebenden Zauber auf den Geist des Sonnenmenschen; aus den beiden unerschöpflichen Quellen rannen ihm die Wasser, in denen sich Gottes ewiger Geist zum Arkanum verdichtet hatte. Er lag, wenn sich sein Herz nach den treuen Augen Tizianas müde gesehnt hatte, im Bann der erquickenden Weisheit, die Gottes Odem durchhauchte.
Zuweilen schreckte ihn der Schritt der ablösenden Wache aus der Tiefe des Denkens. Dann lauschte er, ob nicht ein Zeichen der Außenwelt ihm verriet, daß die Dinge draußen einen guten Gang nähmen. Aber er hörte nur dumpfes Stimmengewirr. Da ging sein Geist seinen Wünschen nach.
Er sah die vertriebenen Orsini geeinigt und versöhnt mit dem großen Geschlecht der Colonna und hörte – wie ein Märchen klang es ihm ins Ohr – wie sie mit Trommeln und Pfeifen gegen Rom marschierten und den Papst von seinem blutigen Thron stießen. Und auf den zerstörten Burgen wehten die Freiheitsbanner. Das Feuer des Kampfes wurde zum Herdsegen und das Schwert zum Sinnbild der Gerechtigkeit. List und Gewalt brachen zusammen vor dem Forum freigewählter Männer, die die Macht im Namen des Volkes in Händen hatten. Florenz, wie es Cosimo und Lorenzo de' Medici ausgestaltet hatten, leuchtete in seine Träume hinein. Nur sollte der Geist ihrer Staatskunst das ganze italienische Volk zur Einheit binden, bei Berücksichtigung der Wesenheiten einzelner Städte und Landschaften. Die Sonderstellung Venedigs sollte geschont, aber auch dort der aristokratische Herrschergeist zur Verschmelzung mit dem Volksgeist genötigt werden. Und der Handel sollte in freier Rivalität über die Meere getragen und das Handwerk durch den Austausch der besten Kräfte und Materialien innerhalb eines Städtebundes gefördert werden, die Bauern sollten Grund und Boden als Eigengut zugewiesen bekommen, die Wissenschaften mußten in den Hochschulen feste, beschützte Burgen erhalten, freie Geistesregung sollte zum Panier aller werden, die Bibliotheken weit geöffnet und ergänzt, der Bücherhandel großzügig und leichter gestaltet werden, und alle schönen Künste mußten auf solchem vorbereiteten Boden als die selbstverständlichen Früchte des menschlichen Geistes und Gemüts herrlich gedeihen. Der Kardinal erfreute sich in solchen Schwelgestunden der Seele an dem Bilde des Bienenstaates. Auch dort war die Seele des Staates die Arbeit, und die Bienen mußten deren Leid und Freud auf ihre Flügel nehmen. Sonnentrunken schwebten sie durch die Luft und blütenweiße Pracht, sammelten und nippten und berauschten sich an dem Blumennektar, aber dann flogen sie, wenn ihre Zeit gekommen war, in den dunklen Schacht ihres Stockes und arbeiteten sich pflichteifrig müde.
Der Gedanke an den Papst machte keinen Hasser aus ihm. Die natürliche Güte verzieh dem Gewaltherrn das entsetzliche Unrecht, und er liebäugelte mit der Möglichkeit, daß ihm Alexander bald reuig die Kerkertore öffnen werde. Dann brannten die Freudenfeuer in seines Weibes Auge.
Aber dieser Papst war nicht der Papst seiner Wünsche. Es waren nicht die Schlüssel Petri, sondern die Schlüssel der Hölle, die er verwaltete, und in Höllenschlünden werden keine Freiheitsgedanken und keine Gnaden geboren. Mit zerschlagener Seele sann der Kardinal dem Ratschluß Gottes nach, der einen solchen Missetäter mit dem heiligen Gold der Tiara gekrönt hatte. Wann wird der Mann kommen, der den zerstörten Tempel des Christentums in hohepriesterlicher Majestät wieder aufrichtet? Wie wird der Papst heißen, der mit siegender Herrlichkeit die Schändung des Thrones wieder gutmachen wird? Donnerwuchtig wird derjenige sein müssen, der die falschen Götzen niederschmettern sollte, die dieser Alexander dem Volke errichtet hatte.
Durch alle Gedanken schnitt das Leid um Tiziana seine tiefen Wunden. Er wußte nichts von ihr. Niemand durfte ihm nahen, wortlos bekam er die schmackhaftesten Speisen von einem Vogtknecht gereicht. Ein Versuch, den Mann gesprächig zu machen, schlug fehl. War Tiziana nach seiner Gefangennahme entflohen? Wohin? Oder saß sie vielleicht jetzt in demselben schauerlichen Gemäuer, vielleicht nur ein paar Schritte weit von ihm, ohne daß sie wußte – und der kleine Valerio? Das Herz mußte in solchen Augenblicken schwere Schläge erdulden. Das ganze Erwachen, Blühen, Reifen und Fruchttragen dieser Liebe erstand vor seinem rückschauenden Geiste, und er erinnerte sich der Herzenskämpfe, die ihn an der drohenden Liebe eines jüngeren, schwärmenden Knaben vorbeigeführt hatten, über den er den Sieg davon trug, ohne daß ihn dieser Sieg zum Unhold gemacht hätte. Der Liebesstreit war durch die Wahl des geliebten Weibes selbst entschieden worden, das triebhaft Reife zur Reife gedrängt hatte. Und als Opfer fiel dieser zarte Adonis. Giambattista hatte die Kraft gehabt, den leidenschaftlichen Liebhaber zu lieben statt zu hassen, aber er klagte sich jetzt freilich an, daß diese Liebe erst aufgeschossen war, als der Tod dem armen Marcello die letzten Rosen auf den Sarg warf. Hätte er bestehen können mit seiner Liebe zu ihm, wenn eine gütige Parze sein Leben weitergesponnen? Es waren oft bange Fragen, die nächtlings des Kardinals Herz beunruhigten.
Auch der andre tauchte auf, der unter dem Schwerthieb des Orsini fiel, der schäumende, freie Lebensgenießer Savelli. Und so schlug die Erinnerung an die Kampfstunden der Liebe gar wuchtig in des Kardinals Gemüt. Dann aber leuchteten die stillen Herdfeuer des errungenen Besitzes herüber, und was die Penaten gesegnet, erglühte im Strahl der seligen Betrachtung: das Walten hausfraulicher Zucht, das Ineinandertauchen der Seelen, das Aneinandergroßwerden der Gedanken, die gemeinsamen Arbeiten im Reich der Geister, das wohlige Schaffen und Genießen in den Künsten, das Ringen um die Erkenntnis der Gottesgebundenheit, und endlich das Mutterschaftsglück und die Vaterfreude, die krönende Frucht des Bündnisses zweier harmonischer Seelen und Leiber.
Und nun der Zerstörung Macht!
Es wird Abend. Der Kardinal schlägt die Bibel auf. Ein Diener zündet zwei Kerzen an. Giambattista liest. Das alttestamentarische Wunder liegt plötzlich in seiner granitnen Wuchtigkeit vor ihm: Sadrach, Mesach, Abed-Nego im glühenden Ofen unversehrt, und Nebukadnezar, der Stolze, sich beugend vor Gottes Rettermacht. O, wenn diese Macht sich an ihm offenbarte, nicht durch ein Wunder im gemeinen Sinne, sondern durch die natürliche Vernichtung des Bösen durch das Böse, damit das Gute erhalten bleibe. Er wollte einfache Rechnung machen. Aber des Herrgotts Rechenexempel war schwer zu studieren.
Und immer unerbittlicher arbeitete er an seiner Seele. Alles, was das reine Gemüt zu entstellen droht, wirft er herzhaft beiseite. Er will selbst diesen schier unliebbaren Papst lieben lernen. Denn er glaubt, mit einem Haß gegen einen Menschen im Herzen könne kein Mensch Gott lieben.
Aber das Bluten des Herzens hört nicht auf, sooft er an Tiziana und das Kind denkt. Die Liebe zu ihnen schwingt durch alle Gedanken durch.
Spät abends öffnet sich die Tür, und ein Arzt der Kurie kommt, ihn zu besuchen. Es ist der greise Andrea Balbetti, ein weiser Mann, in Ehren grau geworden.
»Was hat man mit mir vor?« fragt der Orsini mit gerechter Neugier.
»Ich weiß es nicht.« Wieder ein verschlossener Mann. Aber in seinem Gesicht leuchten so gütige, blaue Augen.
»Wißt Ihr nichts – von – meiner Frau?« Zitternd erheben sich die Arme nach dem Greis.
Der eisgraue Mann schüttelt den Kopf.
»Ihr wendet Euch ab? Schweigt?« Der Kardinal krampft seine Fäuste auf der Brust zusammen. Seine Lippen stammeln etwas, es klingt wie das Murmeln der Verzweiflung. Endlich reißt er seine armselige Stärke entzwei. »Sie ist gefangen – in der Engelsburg?!«
Da hält ihm Balbetti den Mund zu. Dann drückt er den Kardinal in den Sessel nieder, fühlt ihm den Puls, untersucht die Lunge und das Herz. Und wie seine Lippen ganz nahe dem Ohr des Gefangenen sind, flüstert er ihm zu: »Lest in meinen Augen –«
»Das Entsetzliche?«
»Das Gute.«
»Sie ist frei?«
»Hütet Euch zu verraten – ich bin des Todes –«
»Sagt nur das eine – frei?«
»Die Wände haben Augen, Ohren, Taster –«
»Ich halte Euch mit diesen Händen,« flüstert der Kardinal in höchster Erregung. »Ich kralle mich in Euern Leib, wenn Ihr Lärm schlagt –«
»Armer Kardinal,« lächelt der Greis ergriffen, »wie nutzlos wäre Euer Trotz! Hört – und verschließt es grabhaft in Euch!« Und er neigt sich zur Brust herab, als wollte er sie untersuchen, und flüstert: »Donna Tiziana ist auf dem Weg zur Engelsburg von Fabio Orsini befreit worden.«
Der Kardinal taumelt in die Höhe, seine Stimme gurgelt: »Frei?!« Und er stürzt, seiner Sinne kaum mächtig, in die Arme des Alten. »Wo – ist sie?«
»Auf Monterotondo. Die Orsini nahmen die Burg dem Jofré wieder ab, sie berannten das Schloß im Verein mit den Colonna!«
»Orsini und Colonna versöhnt?! Träume, Träume! Blendet ihr?« Er schloß die Augen wie im überströmenden Schauer.
»Aber Cesare Borgia ist auf dem Weg nach Rom.«
Der Kardinal stürmte freudetrunken über das Unheil hinweg. »Die Hasser versöhnt! Das ist das Erwachen der Nation! Sie werden die Spanier vertreiben, das fremde Joch abschütteln! Aus den Trümmern der Paläste wird die Freiheit sich phönixgleich erheben und die goldnen Tage der Saturnalien brechen an!«
»O, schweigt, schweigt!« zitterte der Arzt.
Da öffnete sich die Tür eines Kastens, der in einer dunklen Ecke stand. Ein Höfling in kohlschwarzem Wams, die Maske vor dem Gesicht, den Degen in der Faust, trat heraus und ging mit wuchtigen Schritten auf den Arzt los. »Wollt Eure Zunge künftig hüten!« sagte er mit schneidender Stimme und legte das kalte Eisen sanft auf die Schulter des Greises. »Folgt mir! Euer Zimmer ist bereit.«
Der schneehäuptige Mann brach ohnmächtig in den Armen des Sbirren zusammen.
Giambattista riß die Augen auf. Dann gellte sein Zorn aus der Brust: »Henkersknechte und Spione! Das Weiße des Auges bewacht von den Kreaturen des Satans! Der Fluch der Verdammnis wird dieser Taten Stempel sein!«
»Auf Befehl seiner Heiligkeit wird künftig niemand mehr vorgelassen,« sagte ungerührt der Höfling. »Wachen!«
Vier Partisanenträger traten ein und nahmen den ohnmächtigen Arzt in ihre stählernen Arme. Der geheimnisvolle Scherge machte einen Rundgang durchs Zimmer, ohne den Kardinal eines Blickes zu würdigen. Die lauernden Augen durchsuchten jede kleine Falte in den Teppichen. Dann verschwand die dämonische Erscheinung in dem unheimlichen Kasten, dessen Tür sich geräuschlos schloß. Im Zimmer blieb eine herzbeklemmende Stille zurück.
Der Kardinal starrte entsetzt auf das Requisit der päpstlichen Tücke. Ein unendlicher Jammer ging durch sein Herz.
Aber er hatte nicht Zeit zur Verdammnis. Die Tür knarrte leise. Ein Minorit der Observanz trat ein, ein schleichender Mönch mit taubengrauen Augen in einem pockennarbigen, verzogenen Gesicht.
»Der allerheiligste Vater läßt Euch ankündigen, daß Ihr morgen die heilige Beichte ablegen und die Hostie nehmen sollt, hochwürdiger Kardinal.«
Giambattista sah den Bruder mißtrauisch an. Das Mönchsgelichter war dem weltfrohen Denker verhaßt. Ein leichtes Grauen schüttelte ihn. »Der Papst wolle mir einen Kardinal senden, so werde ich beichten. Ich bitte um den Kardinal Caraffa.«
»Es ist nicht anders zu machen,« sagte der Minorit reglos. »Ein Widerspruch könnte auch mir gefährlich werden.«
Die Unheimlichkeiten, die sich im Verlauf weniger Minuten um den Kardinal verdichtet hatten, beunruhigten ihn. »Wer seid Ihr?« forschte er argwöhnisch.
»Ein gehorsamer Frater.«
»Habt Ihr – Aufträge?«
»Den besagten.«
»Sonst keine?«
»Keine.«
»Euer Auge versteckt sich.«
»Es ist mir von Gott gegeben.«
Oder vom Satan! dachte der Kardinal. »Wann kommt Ihr morgen?«
»Wenn der Tag heranbleicht.« Der Mönch verneigte sich tief und tappte schleichend wie auf Rattensohlen ab.
Eine Schauerwolke lag im Gemach. Des Kardinals Atem war beengt durch eine plötzliche Stickluft, die sich fast greifbar über alle Gegenstände gelegt hatte. Er fühlte, wie ihm das Denken schwer wurde. Erst allmählich wich der unnatürliche Druck von seinen Sinnen und er fühlte, wie das Blut gelöst durch die Gefäße pulste. Was war das nur? Was griff ihn da mit unsichtbaren Waffen an? Wehte von diesem Mönch nicht ein eiskalter Hauch in sein Blut? Seine Gedanken versuchten, sich die Gestalt wieder zu vergegenwärtigen. Und er hörte die belanglosen Worte tönen, aber sie bekamen eine unheimliche Färbung, je deutlicher er den Schall in sein Gemüt dringen ließ.
Aber dann schnellte sein Geist aus allen Nebeln empor. Tiziana frei! Auf dem heimatlichen Schloß in Sicherheit! Und die Orsini und Colonna im Anmarsch auf Rom! Vielleicht wankten und fielen in diesem Augenblick die morschen Säulen des päpstlichen Truggebäudes, vielleicht klangen in wenigen Stunden die Orsinihörner an sein Ohr!
Das Herz klopfte ihm ungestüm. Er lauschte in die drückende Stille der Nacht. Nur der Trittklang der Posten hallte wie ein schwerer Pendelschlag an sein Ohr.
Da – war das nicht ein Murmeln? – Nein! Gedankengespenster gingen um, Ausgeburten der Einbildungskraft, die das Gehörte verarbeitete. Es blieb alles ruhig wie zuvor, und um die Mauern der Engelsburg huschten nur die Hüterschatten böser Geister, die dem Papst dienten.
Es mußte nahe an Mitternacht sein. Giambattista griff nach den Aufzeichnungen, die er aufs Papier geworfen. Es waren bewegte Gedanken über den Gottesfrieden und über die platonische Unsterblichkeitsidee. Aber der Kardinal konnte sich jetzt in die tastenden Wege des alten Heiden ebensowenig hineinfinden wie in seine sittlichen und politischen Reformen, die er jetzt zu überdenken begann. Das dialektische Komponieren scheiterte an der Unruhe des Gemüts.
Aber immer wieder der Ruf: Tiziana gerettet!
Und doch: was würde sie jetzt beginnen? In Sehnsucht verzehrt und verhärmt harrte sie jetzt in den kampfumtobten Burgmauern seiner Rückkehr. Wer würde die Trauer enden? Nur er! Der Sieger über den Papst! Der Sieg der Orsini. Hielt sich der Papst nicht noch in den Mauern des Vatikans? Und wenn der Koloß fiel, geleiteten ihn die treuen Spanier in die unersteigbaren Mauern der Engelsburg. Hier rannten sich noch alle Stürmer die Köpfe blutig. Aber dann saß der Papst selbst gefangen, vielleicht über ihm, und die Angst graute ihm durchs Gebein. O, Stunde komm!
Er ging unruhig auf und ab. Sooft er mit seinen Schritten sich der Tür näherte, wehte ihn ein unbestimmter, unerklärbarer kalter Hauch an. Wer wird der nächste sein, der durch diese Tür schreitet? Der Befreier? Oder –?
Da lief Eiseskälte durch das Mark des Gefangenen. Die erregten Sinne spielten mit einem schemenhaften Gebilde. Dem Kardinal war, als öffneten sich die eisenbeschlagnen Türflügel und der Papst selbst trat herein, in der schimmernden Dalmatica, die Tiara auf dem Haupt, die Maske des listigen Teufels auf dem Gesicht. Und hinter ihm der Mundschenk und seine Läufer, mit dem gedeckten Tisch, der die Speisen des Versöhnungsmahls trug. Und Alexander lud ihn ein, mit ihm Versöhnung zu trinken. Und es funkelte goldner Terraciner in zwei goldnen Kelchen, die der Papst selbst füllte – und er reichte ihm den einen, auf dem die Irislegende ziseliert prangte – und er lächelte das arglistige Lächeln der Hölle – denn in den Geistern des Weins lag die Giftkraft der Borgiatücke.
Der Kardinal wich vor den geschloßnen Türflügeln zurück. Er ging zum Tisch und warf das verblaßte Gesicht in die Hände. Zum erstenmal kam ihm der Gedanke, daß der apostolische Würger das unheimliche Mittel der geräuschlosen Vernichtung eines Menschenlebens auch auf ihn anwenden könnte. Eisen, Blei, Strick und Tiberwasser, der fürchterliche Richtapparat der päpstlichen Tyrannis hatten ihre Schauer schon erschöpft. Und ganz Rom wußte, daß in der letzten Zeit ein zuckersüßes, weißes Pulver zur lautlosen Vernichtungswaffe in der Hand des Papstes geworden war. Es löste sich leicht im Wein und vermischte sich unauffällig mit dem Zucker des feinen Konfekts, es buk sich unbemerkt in zierliche Pastetchen ein und drang sogar in das Fleischgefaser comacchischer Aale. Und auf einmal fieberte der Körper wie unter dem Angriff der Aria cattiva. Die Muskeln siechten hin und die Augen bekamen einen matten Glanz und die Eingeweide wurden brüchig und zerfielen. Der Würger war mild und sanft. Die Verruchtheit spiegelte der Welt den natürlichen Verfall des Körpers vor, den die Kerkerluft zerbrochen hatte.
Giambattista erbleichte bei dem Gedanken. Wenn diese Gliederunruhe, dieses unheimliche Schwappen in den Gelenken, diese Gedankenstockung, das nadelstichartige Prickeln in den Muskeln schon die Auswirkung des Giftes sein sollten, das heute abend in dem starken, duftenden Wein enthalten war? Der Kardinal besah sich entsetzensbleich den Kelch, der noch halb geleert dastand. Es war nichts Auffälliges daran. Der Weinrest roch wie gewöhnlich. Dieser Künstler des Mordes verstand es, das Getränk unverdächtig zu brauen und zu kredenzen.
Oder wenn diese Kerzen, die der Diener eben gewechselt hatte und die jetzt einen süßlich schwülen Geruch verbreiteten und mit rötlich geringeltem, feinem Rauch zu schwelen begannen, eines heimtückischen Giftes verdampfende Seele bargen?
Mit schreckvollem Auge betrachtete er das Kräuseln der unheimlichen Flämmchen. Dann warf er sich entschlossen zum Tisch und blies die Kerzen aus. Eine monddämmernde Helle umspielte deutlich alle Gegenstände. Besonders das Kreuz auf dem Betpult zwischen den vergitterten Fenstern erglomm beinah magisch sanft unter dem Schein der lichtbelebten Nacht. Den Kardinal zog es zum Gebet hin. Vor die Füße des Gekreuzigten legte er seine unschuldige Seele nieder und ließ die Nacht von Gethsemane vor seinem Geiste erstehen.
Er wußte nicht, wie lange er so gelegen hatte.
Aber auf einmal war der Monddämmer heller geworden, fahle Schimmer verdrängten das heimliche Licht. Des Morgens graues Gespenst schlich heran.
Und ein andres stand im Türdunkel. Als sich der Kardinal umwandte, erblickte er den geisterbleichen Minoriten. Ausdruckslose Augen blickten ihn aus grauen Höhlen an.
Ein jäher Schreck riß den Kardinal aus der Gebetstiefe. Er wußte nun, was seiner harrte. In der Hand des Mönches blinkte das Silber einer kleinen Speiseplatte, auf der die Hostie lag. Und diese Hostie – den Kardinal durchschauerte die Gewißheit – barg die teuflische Verruchtheit des Borgiagehirns. Im heiligsten Symbol der Menschenliebe lauerte das Gift des Vaters der Christenheit auf sein edelstes Opfer.
 Die tuskischen Schlösser starrten von Lanzen und Panzern. Zehnfach verstärktes Mietsvolk lag in den Mauern. Das ganze Bergland nördlich der heiligen Stadt, aus dem die Orsiniburgen wie trotzige Inselklippen aus einem erstarrten, welligen Meer emporragten, war von farbigen Reitertruppen bewegt, die von Schloß zu Schloß trabten. Bang spannten sich die Blicke der streifenden Knechte nach Nord in die Tibersenkung. Von dort konnte er kommen, der unversöhnliche Rächer Cesare Borgia, dem sich schon ungeheure Gerüchte voranwälzten wie Staubwolken vor dem Gewitter. Der Herzog sei von eigenen Feuerreitern umringt, brennende Städte und Dörfer beleuchteten seinen Weg Tag und Nacht. Aquapendente, ein kleines Städtchen in den toskanischen Bergen, habe furchtbare Greuel zu erleiden gehabt. Frauen und Kinder seien hingerichtet worden von der wilden Soldateska des Herzogs, und der ganze Ort sei eine einzige Brandruine.
Die tuskischen Schlösser starrten von Lanzen und Panzern. Zehnfach verstärktes Mietsvolk lag in den Mauern. Das ganze Bergland nördlich der heiligen Stadt, aus dem die Orsiniburgen wie trotzige Inselklippen aus einem erstarrten, welligen Meer emporragten, war von farbigen Reitertruppen bewegt, die von Schloß zu Schloß trabten. Bang spannten sich die Blicke der streifenden Knechte nach Nord in die Tibersenkung. Von dort konnte er kommen, der unversöhnliche Rächer Cesare Borgia, dem sich schon ungeheure Gerüchte voranwälzten wie Staubwolken vor dem Gewitter. Der Herzog sei von eigenen Feuerreitern umringt, brennende Städte und Dörfer beleuchteten seinen Weg Tag und Nacht. Aquapendente, ein kleines Städtchen in den toskanischen Bergen, habe furchtbare Greuel zu erleiden gehabt. Frauen und Kinder seien hingerichtet worden von der wilden Soldateska des Herzogs, und der ganze Ort sei eine einzige Brandruine.
In Rom hatten die Bären die Oberhand gewonnen. Sie hielten alle ihre wiedergewonnenen Paläste besetzt, ihre Trupps zogen mit wimpelgeschmückten Speeren waffenrasselnd straßauf, straßab, der Governatore war machtlos, die päpstlichen Söldner zitterten, und Alexander hatte sich im waffenstarrenden Vatikan zurückgezogen und verfolgte schreckensbleich die Vorgänge in seiner wankelmütigen Stadt. Der ganze Borgo war von den fürchterlichen Haufen der Bärenknechte umlagert. Jeden Augenblick konnte der Sturm beginnen. Alle Papstreiter wurden gefangen. Keine Nachricht von dem nahenden Herzog der Romagna gelangte nach Rom.
Da wandte Fortuna ihren Flug um. Wie ein Wirbelwind vor dem Gewitter brauste an einem hellen Wintermorgen aus der sabinischen Tiberenge ein starker Reitertrupp Cesare Borgias daher. In Civita Castellana nächtigte der schreckliche Haufe im Papstschloß. Von dort her flatterte die Kunde in das tuskische Orsiniland: Cesare Borgia naht!
Das Wort wirkte Entsetzen aus. Die Reiterhaufen verschwanden urplötzlich in den sichern Mauerringen der Burgen, und Eilboten brachten die Nachricht in die Orsinipaläste nach Rom. Im Nu zogen sich die lagernden Truppen um den Borgo zurück, die Engelsbrücke wurde freigegeben, alle Orsinihaufen wurden ins Innere der Paläste gedrängt und diese zur Verteidigung hergerichtet. Dämonische Furcht schlug allen ins Gebein.
Der Papst atmete auf. Und der erste Reiterbote seines Sohnes wurde von ihm umarmt. Er brachte die Kunde, daß Cesare auf dem Wege nach Viterbo sei. Der Papst schnaubte seinen unterdrückten Haß gegen die Orsini in die Luft: »Ich will dieses ganze Haus ausrotten!« Und er ließ sich in der Sänfte nach der Engelsburg tragen, stieg auf die Plattform hinauf und äugte wie ein Sperber heraus in die tuskische Campagna. Seine Vergeltungsgedanken flogen den gleichen des Sohnes entgegen. Unter ihm, durch ein Deckengewölbe getrennt, siechte ein ehrwürdiger Leib unter der tückischen Angriffsmacht einer Hostie dahin.
*
Auf Monterotondo lag alles in den Fangarmen der Beklemmung. Das nahe Palombaro war von den Savelli verlassen worden, und päpstliche Haufen hatten sich dort eingenistet. Der erschreckte Bundesgenosse, vor einem Jahr noch der grimmigste Feind des Kardinals, wollte es mit dem nahenden Bluträcher nicht verderben, und der Versöhnungsgruß zwischen Savelli und Orsini war nur ein förmlicher gewesen, bedungen durch die Freude über die Schwäche des Papstes. Die Not aber deckte den schwachen Grund der Freundschaft auf. Die Savelli zitterten und fielen vom tuskischen Bund ab. Nun mußte auch Monterotondo ein banges Herz bekommen.
Hier hatte Jacopo Santa Croce, ein Verwandter des Kardinals, den Befehl über die Burg übernommen. Er hatte sich zuerst in Rom mit zwanzigtausend Dukaten sein Leben vom Papste erkauft und mußte dann den Papstsohn Don Jofré auf das Schloß begleiten, um es ihm zu übergeben. Doch als die Barone Rom mit einem kecken Handstreich in ihre Gewalt bekommen hatten und der Meisterstreich des Fabio Orsini die schöne Kardinalsfrau mitten im Borgo den päpstlichen Wächtern entrissen hatte, nahm Don Jofré von Monterotondo schleunigst Reißaus, um noch rechtzeitig an das Vaterherz zu gelangen. Am nächsten Tage schon brachte Fabio die zitternde Tiziana in die Burg. Gleich darauf holten Orsiniknechte das schreiende Knäblein aus der Malerstube des Cornaro und brachten es jauchzend in die Arme der glücklichen Mutter. Ja, das Mutterglück lag unter dem Gnadenschein des Himmels, das Eheglück lag noch zerbrochen da. Aber der werdende Sieg der Orsini überschüttete die Brust Tizianas mit einem Füllhorn von Hoffnungen. Fabio Orsini aber ritt noch am selben Tag in seine Stammburg Cervetri, um seine Besatzung zu rüsten.
Da kam die erste bange Nachricht. Zwei Reiter brachten sie, die gegen Nepi gestreift hatten. Der Herzog der Romagna sei im Anmarsch auf Rom. Wie eine blutrote Sonne die Angst in die Gemüter der Menschen hetzt, so jagte diese Kunde alle beweglichen Einbildungskräfte der Burgleute durcheinander. Jacopo Santa Croce, der wankelmütige, furchtsame Herr, ließ den tapferen Burghauptmann Spinozzi kommen und besprach mit ihm in Gegenwart der Burgherrin Tiziana die Möglichkeit einer Übergabe der Burg an Cesare Borgia. In diesem Augenblick schnellte Tiziana empor und schleuderte den Fußschemel weit von sich.
»Die Burg gehört meinem Herrn Giambattista Orsini, er hat darüber zu verfügen.« Zorn und Liebe verflammten ihr Gesicht.
»Er ist ein Ohnmächtiger,« widersprach der kleine, bangherzige Santa Croce mit der Wohlbeleibtheit eines Pfäffleins, der in Psalmen besser beschlagen ist als in der Kunst des Francesco Sforza.
»Und wenn sich in diesem Augenblick das Tor der Engelsburg für ihn öffnet?« sagte Tiziana mit glanzerfülltem Auge.
Santa Croce aber holte mit einer Jammergebärde andre Unheilsnachrichten aus seinem Köcher hervor. »In Rom wanken die Orsini, Donna Tiziana. Der Erzbischof von Nicosa ist aus der Stadt entflohen, dem Giulio Orsini in Cere ließ der Papst sagen, daß – o, erschreckt nicht – daß das Haupt Giambattistas verwirkt sei, wenn Giulio das Schloß nicht übergebe.«
Ein Pfeil durchschoß die Brust Tizianas. Aber sie raffte ihre Kraft zusammen. »So wird der Bruder nicht den Bruder sterben lassen!«
»Was noch nicht sicher ist. Es handelt sich um die Waffenehre der Orsini.« Der zaghafte Jacopo gefiel sich in dem Wort.
Da mengte sich der Burghauptmann Spinozzi ins Gespräch. »Ich habe die Ehre, meinem Herrn zehn Jahre auf Monterotondo zu dienen. Ich kenne die Liebe meines Herrn zu seinem Ahnenschloß. Ich würde mich bis in den Tod verfluchen, wenn ich leichtfertig und schnell die Mauern übergeben würde.«
Tiziana wurde es warm ums Herz. »Gebt mir Eure Hand, Burgvogt.« Und sie drückte dem Riesen stark und lang die Hand. Es lag ein tiefer Dank in dem Blick des Auges. Dann wandte sie sich an Santa Croce. »Wenn Ihr die Burg nicht verteidigen wollt, so ist es besser, Ihr kehrt nach Rom zurück.« Es klang beinahe wie unverhohlene Verachtung.
Da nahm der beleidigte Edelmann seinen Abschied. Schon eine Stunde darauf ritt er mit seiner Begleitung aus den ungeliebten Mauern, an denen sein Herz nie gehangen hatte. Er hätte sie nur lieblos und daher auch ohne Erfolg verteidigt.
Kaum war Santa Croce fortgeritten, brachten Reiter die Meldung, daß sich alle Orsini wie Dachse in ihrem Bau verkrochen hätten. Aber sie wollten auch zeigen, daß sie Igelstacheln hatten. Die Burgen Bracciano und Cervetri waren für den stärksten Widerstand ausgerüstet. Man hoffte noch immer auf eine günstige Wendung, die Frankreich herbeiführen konnte, der Schutzpatron der Orsini.
Am Abend kehrten die spähenden Söldner mit der Kunde heim, daß auf der Straße gegen Bracciano des Papstes Artillerie heranrücke. Also wagte der Papst den mächtigsten der Orsini zu belagern. Dann schlug auch für Monterotondo die Schicksalsstunde.
*
Der Himmelsdom brennt in rosenroten Abendflammen. Feurige Wolkenzungen lagern riesenhaft über den violendunklen Umrissen der tuskischen Hügel. Über der Burg schwebt eine einsame weiße Wolke gleich einer marmornen Riesenkuppel durch das dunkle Blau.
In diese Wolke starrt Tiziana mit umflortem Auge. Der Gram hoffnungslos durchwachter Nächte liegt in ihrem Antlitz. Ihre Gedanken tragen zitternde Gebete zu dem Wolkenmittler empor, der majestätisch seinen Weg nach dem karmingoldnen Sonnentor zieht, wohl mitten in den Himmel hinein, vor den Thron Gottes. Dort würde die Inbrunst ihres Gebetes Gnade finden.
Um Tiziana beginnen die Schatten zu dämmern. Das Gerät des Turmes bekommt Farblosigkeit und nimmt verschwommene Umrisse an, während draußen noch der verglühende Abend Hügel und Höfe vergoldet. Die Milde des Vorfrühlings haucht durchs Fenster. In der Campagna lagern geheimnisvolle Dünste über den Niederungen wie zarte Schleier, die das große Werden der Natur bedecken. Es ist, als müßte mit dem morgigen Erwachen des Tages sich der braune Schoß der Erde öffnen, um die Blütenwonnen entsteigen zu lassen, deren erträumter Duft die ahnungsvolle Seele schon seit Tagen einsaugt.
Still liegt die Burg. Aber es ist nicht die friedsame Stille einer bukolischen Natur, die um das Schloß webt, sondern eine Stille, in der alles Leben den Atem bang anhält wie die Landschaft vor dem Nahen des donnernden Gottes. Auch hier kommt ein Furchtbarer gezogen, der sich götterähnlich dünkt, der sich mit frevlerischer Überhebung Gewalten anmaßt, die andre Gewissen erdrücken würden, während sie das seine für neue Untaten weiten. Der Rächer naht! Wie ein Sturmstoß fegt er daher mit seinen zusammengestoppelten Söldnerhaufen und rennt Burgen, Städte, Ortschaften, Trupps und Lager über den Haufen. Und diesem siegenden Teufel sollte ein Weib trotzen können, eingeschlossen von einem Mauerring, umwehrt von einer Handvoll alter Krieger, gattenlos, hilflos der eigenen Ohnmacht preisgegeben und den furchtbaren Forderungen des triumphierenden Feindes, der vielleicht knapp vor dem letzten Ansturm die heuchlerische Larve des Freundes aufsetzen wird!
Von tausend Gefühlen bestürmt lag Tiziana im veilchengeschmückten Betschemel. Die überstandene Not, in der ihr Gottes Engel sichtbarlich zur Seite gestanden, hob zuweilen ihren Kleinmut zum Mut empor. Die Stunde der Befreiung aus den Händen des Papstes knapp vor der einbrechenden Kerkernacht leuchtete wie ein Jesuswunder in ihre Herzzerrissenheit hinein. Als an sie die dunklen Schatten herangeschritten waren, frohlockte sie insgeheim, denn sie glaubte die Nähe ihres Gatten zu spüren, glaubte den Hauch seiner Lippen durch Kerkerwände hindurch zu fühlen, und wie tröstender Psalmgesang hätte die Stille der Nacht erklungen, die sich in einem Kerker über beider Seelen senkte. Und vielleicht hätte sich die Hölle über ihr Weh erbarmt, und sie hätte mit dem geliebten Mann Schmach und Bedrückung in einem Raum teilen dürfen. Da – mitten in ihre Hirngespinste klang der Schwertklang des braven Jungen Fabio Orsini hinein. Wie ein Stoßfalke war er mit den Seinen dahergeflogen, und mitten im päpstlichen Rom hatte er mit adlerkühnem Griff die sichre Beute aus den feindlichen Krallen gerissen, und umtobt von Gefahr hatte er die schöne Verwandte auf ihr Schloß geführt. Ganz Rom stand unter dem Eindruck des Wagestücks. Von den Burgen kamen die Gesandten der Orsini geritten, um der geretteten Tiziana mit Blumen und Geschenken zu huldigen. Aber Fabio Orsini schämte sich. Denn er hatte diese liebe, schöne, unglückselige Frau zum zweitenmal in seine Gewalt bekommen – ohne daß er es selbst wollte. Er wurde wie in jener schweren Schicksalsnacht auf Bracciano ihr Retter, ohne zu wissen, wen er befreite. Das Fischlein, das er abfangen wollte, hieß Don Jofré, und statt seiner zappelte nun wieder Tiziana de' Calvi im Netz. Wie erstaunt war er, als er die von den Trägern befreite Sänfte öffnete und die halb tote Tiziana darin erblickte. Zorn und Freude über seinen abermaligen Irrtum wechselten miteinander ab. Mit ritterlicher Galanterie geleitete er seinen Fang nach Monterotondo, wo er sie dem Burghauptmann Spinozzi übergab. Tiziana wäre vor Freude über ihre Befreiung nahe daran gewesen, ihrem Retter das ganze Schloß Monterotondo zu schenken. Nun stachelte sie den abenteuerlichen Helden noch an, ihren Gemahl zu befreien. Bei einem Haar wäre der Bärenjüngling auch zu diesem letzten Meisterstreich zu haben gewesen, wenn nicht mit einem Mal die Nachricht von dem Herannahen Cesare Borgias gekommen wäre. Da mußte der Plan verschoben werden, denn auf der eigenen Burg Cervetri gab es nun für Fabio genug zu tun.
So sah nun Tiziana mit einem Herzen, das eben noch der Zuversicht voll, nun aber von einer neuen Gefahr bedroht war, dem heranziehenden Wetter entgegen.
Spinozzi hatte seine Reckengestalt vor Tiziana aufgepflanzt. Mit seinen derben Fäusten drohte er in die Schattenlandschaft hinaus, die jetzt ihr Dunkel zu Füßen der Burg ausspann. »Ohne des Papstes Artillerie wird er sich die Zähne zerbrechen an unsrer Burg! Ich kenne Cesare Borgia! Er wagt alles durch List, nichts durch Talente! Es gibt keinen talentloseren Feldherrn als ihn, freilich auch keinen glücklicheren. Wenn ihn das Glück in dieser Stunde verläßt, hilft ihm sein Geist und sein Ansehen nicht über den Mißerfolg hinweg.«
»So bitten wir Gott, daß ihn das Glück verläßt,« sagte Tiziana mit gesenktem Kopf. »Wie ist die Stimmung unter den Burgleuten?«
»Die Raufbolde brennen darauf, den romagnolischen Garden zu zeigen, was Orsinihiebe sind. Unter des Herzogs Leuten sind lauter unzufriedene, abgekämpfte Mietlinge, Galgenvögel, Landstreicher, verkommene Skolaren und Erzschelme. Wir werden nicht allzu schwere Arbeit haben, hoffe ich. Wie sich die Banden Rom nähern, werden sie zuchtlos auseinanderfluten, um zu rauben und zu plündern. Sie haben es von den Franzosen gelernt. Das Satansvolk sehnt sich darnach, zu metzgern und die Bauernställe auszuräumen, Kammern und Löcher zu durchstöbern, als war' darin Salomos Krone verborgen.«
Tiziana versann sich in den hohen Ernst, der sie umdrohte. »Es geht um des Herrn Ehre und Besitz. Und es geht – um meine Ehre.«
»Wir werden daran denken, hohe Frau.« Der Alte neigte huldigend das Haupt.
»Sind die Pferde alle von der Weide zurück?«
»Seit zwei Stunden.«
»Auch die Späher zurück?«
»Die römischen stehen noch aus. Die gegen Nepi gestreift sind, sind in der Dunkelheit zurückgekommen.«
»Sind die Bauern aus dem ganzen Gebiet im Innern der Burg?«
»Samt Hab und Gut,« nickte der Burgvogt. »Es geht ein Sprüchlein durchs Land: Wenn des Herzogs Scharen kommen, fließt dem Bauer der warme Quell aus den Augen, der rote aus den Fingernägeln. Des Cesare Mordgesellen jagen in den Stuben der Bauernweiber von Bett zu Bett und machen blutige Brautbetten daraus.« Er gab sich eins auf den Mund.
»Was sagen meine Gelehrten zu meiner Absicht, die Burg zu halten?«
Spinozzi schüttelte lächelnd den Kopf. »Der Astrolog sitzt unausgesetzt bei den Tabellen und sondiert. Es scheint, daß ihm die Planeten nicht gehorchen wollen. Giampolo dichtet, den Angstschweiß auf der Stirn, lateinische Hymnen auf den gefangenen Kardinal, Buonconti übersetzt seelenruhig den Strabo, eine Arbeit, die ihm noch der Kardinal aufgetragen und mit der er zu Ende kommen will, bevor Cesare ihm den Schlußpunkt setzt.«
»Laßt sie alle bei der Arbeit,« sagte Tiziana gerührt.
»Piersalo will sogar versuchen, den Herzog durch ein Gedicht in Oktaven zu erweichen,« lächelte Spinozzi.
»Laßt ihm die Hoffnung und gebt ihm Ruhe zum Dichten.« Sie sah auf die Burghalde hinab, wo die Eichen dunkelten, unter denen Späher saßen. »Bleiben die Leute über Nacht vor der Burg?«
»Man kann's ihnen nicht wehren. Die Fledermäuse sind erwacht, sie fangen sie ab, um mit ihrem Blut einen pfeilsichern Balsam zu bereiten. Fünf Tropfen der Schwarzwurz nehmen sie dazu und einen Teufelssegen. Damit wären sie auch gefeit gegen die gefürchteten Hellebardenstiche der Schweizer und gegen die Wut der Stradioten, die Cesare den Venezianern abspenstig gemacht hat.«
»Was sagt mein Rabe?« fragte Tiziana. Sie hatte einen, possierlichen Kerl des schwarzen Vogelgelichters gezähmt. Die Burgleute raunten sich zu, wenn der Rabe heftig mit den Flügeln schlage, sei Gefahr im Verzug.
»Er ist unruhig,« berichtete der Hauptmann.
»Um so ruhiger wollen wir sein,« sagte Tiziana. Aber es preßte sich doch ihr Herz zusammen.
Spinozzi sah seine Herrin beinahe mit verklärten Blicken an. »Nimmer hätte ich mir's träumen lassen, edle Herrin, daß Eure zarte Frauenseele des Kampfes Schwert zücken würde –«
»Mein Kardinal hat das Schwert für mich ergriffen, sollte ich's jetzt nicht für ihn versuchen? Die Not verpflichtet. Was eine Katharina Sforza erlitten, kann eine Tiziana de' Calvi auch erleiden. Wenn sich Giambattistas Gefängnis öffnet, soll er auf Freudenschwingen in die Burg seiner Väter ziehen. Kommt, laßt uns die Burg besichtigen.«
Der Burgvogt nahm die Laterne und begleitete mit zwei Knechten die Herrin durch die Zimmer und Gänge. Ihr fürsorglicher, umsichtiger Sinn orientierte sich über alle Einzelheiten. Sie besichtigte die Schießrohre, die aus den Mauerluken drohten, prüfte Harnisch und Gehänge der wachenden Knechte und spornte sie zur Munterkeit an, sie sah der Pulverbereitung zu und lugte mit etwas schaurigem Gemüt in die Pulverkammer, die im Ostturm lag. Sie hämmerte selbst einem halbblinden Söldling die verbogene Pulverpfanne zurecht und bereitete das Pech vor, das zum Sieden gebracht und von den Zinnen auf die Feinde herabgegossen werden sollte. Überall blitzten ihr kampffreudige Augen entgegen.
Dann schritt sie vor das Tor, wo man die schweren Kugelketten gespannt hatte. Dort stand sie lange und sah in die unheimlich schweigende Nacht hinaus, die ihre dunklen Gespinste über die tagmüde Landschaft gebreitet hatte. Das Firmament entzündete seine flimmernden Lichter und Tiziana suchte aus der erhabenen Sphärenschönheit Hoffnung und Trost zu saugen. Ihr Glaube klammerte sich an die Hilfsgewißheit des Himmels, der dem Reinen seine Engelscharen senden mußte. Hatte sie nicht schon einmal die siegende Kraft dieses Glaubens an sich selbst erlebt? Als der erste wilde Werber Savelli vor diesen Burgmauern fiel, war's da nicht Gottes sichtbare Hand, die ihn fällte? Sie würde auch den zweiten, schlimmeren Freier, der wie eine Jupiterwolke herangestürmt kam, um den Namen Weib mit seiner Selbstherrlichkeit zu schänden, in den Staub werfen. Oder sollte dieser von einem Gottesgnadentum umstrahlte Held der Romagna vor der keuschen Burg der Frauenehre haltmachen? Und gerade vor ihr, die sich seinen Schlingen entzogen und dadurch zu erkennen gegeben hatte, daß Cesares Umarmung für sie das Grauen des Inferno bedeutete? Ihr Hirn konnte sich keinen edelmütigen Cesare zurechtlegen. Und so sann sie mit verdunkelter Stirn zu den Sternen empor und bat Gottes strafenden Zorn auf den kommenden Würgengel herab.
Dann ließ sie ihr Pferd in den Hof bringen, einen Zelter von Schwanenweiße. Sie prüfte das Zaumzeug und den Sattel, schwang sich hinauf und ritt mit Spinozzi zu den Vorwachen im Gelände, die sie wohl wachsam fand. Nach ihrer Rückkehr verteilte sie im Burghof Linnen zum Wundverband, ordnete die Tragbahren, untersuchte die Pechfackeln und die Wasserschleusen.
Als das besorgt war, stieg sie die Treppen hinauf in das einsame Gemach an das Lager ihres Kindes. Dort rief sie in Tränen den Geist ihres Gatten an. In des Knaben friedsamen Zügen stieg das Bild des Vaters auf, dessen Ebenbild Valerio war. Fein, aber in klarer Zeichnung lag schon das schöne Profil angedeutet, und wenn das Kind spielte, hatte es schon das beseelte, sinnende Auge des Vaters. Sie sah in dem Knaben den geliebten Mann neu werden.
Da schoß ihr ein dunkler Gedanke durch das Hirn. Ohne den Vater und ohne sie mußte der Knabe zugrunde gehen. Aber noch lag eine solche Möglichkeit ferne – noch konnte der Wahnwitz nicht –
Doch es lauerte um sie, das Schreckgespenst unzähliger Nachtstunden. Der Kardinal schmachtete im Gefängnis der Borgia. Und das war ein Gefängnis der Auserwählten. Man hatte es ihr einst zugeraunt, als sie noch des Brancaleone Gattin gewesen war, daß über den Toren der Engelsburg Dantes Höllenwort in finstern Nächten sichtbar werde: Laßt, die ihr eingeht, jede Hoffnung schwinden.
Nun schauerte sie zusammen. Ihr war, als hätte sie Hufschlag gehört. Waren die römischen Späher zurückgekehrt? Sie gab der Kammerfrau wieder die Sorge um den Knaben und ging auf ihr Zimmer, wo man die Meldungen hinbringen sollte. Es war schwül im Gemach. Sie öffnete das Fenster. Wieder strich eine laue Meerbrise herüber, durchhaucht von unbeschreiblich süßen Vorfrühlingsdüften. Aber die Schwüle wurde drückender, und im Westen sah es aus, als verdunkelte sich die Nacht zu stygischen Finsternissen, die Gewitterschwere in sich bargen.
Jetzt rasselten die Sperrketten, knarrten die Torflügel – dann wieder bange, stille Nacht über dem Gemäuer und über dem Gemüt der einsamen Frau.
Und keine Meldung kam.
Da – wieder eilender Hufschlag im dunklen Gelände. Bangdurchzitterte Minuten. Ein Läufer öffnet die Tür. Der Burghauptmann tritt mit gefurchter Stirn herein. »Hohe Frau – es ist Nachricht von draußen da –«
»Euer Aug' spricht – laßt auch die Zunge sprechen.«
»Es ziehen Kolonnen aus dem Tibertal daher.«
»Sie kommen?« Ihr Herz jagte.
»Man weiß noch nicht, wohin sie schwenken werden; nach Westen, dann gilt es Bracciano, sonst aber –«
»Nach Osten gilt Monterotondo.«
Der Hauptmann schwieg. Durch die Nacht ging ein unbestimmter, dumpfer Ton, der sich zu einem gezogenen Klagelaut zu verdichten schien. Da blitzten in der Tiberdunkelheit Lichter auf. Ein leises Rollen, wie von fahrendem Fuhrwerk, drang durch die Luft. Und nun schlug jagender Hufschlag mitten hinein. Der Burghauptmann eilte ab, da Meldung kommen mußte.
Mit fliegendem Atem harrte Tiziana. Zu ihren Häupten erblaßte der Bootes mit seinem Sternkönig und warf kein tröstendes Licht mehr in ihre bange Seele. Die Nacht schien Gestalt zu bekommen. Das Lichterblitzen vervielfältigte sich. Die funkelnden Augen des Ungeheuers Nacht wurden größer – deutlich sah man das Näherkommen – und nun verschwanden einige Lichtpunkte unter der vorspringenden Tuffhügelnase, die gegen den Tiber steil abfiel. Der Fluß war überschritten.
Da war es, als wäre die Furcht in dem zagen Herzen mit einem Male zerbrochen, als hätte das Herz selbst verdoppelten Spielraum für den höher schlagenden Blutschwall und als öffnete sich die Brust sichtbar für den Einzug einer starken, weihespendenden Kraft, die sonst nur Männer segnet und mit Trotz und Heldenmut erfüllt. Die ganze Vergangenheit schien in einen Lichtkern zusammengepreßt zu sein, der sein Strahlen in Tizianas Herz gleiten ließ. Sie wurde von dem ganzen Zauber dieser fremden Begeisterung überflammt. Es glühte und schnob und brauste in ihr: Ausharren! Für ihn! Deinen Herrn und Gebieter! Das Heroentum alter und legendärer Geschlechter beschwor ihr Geist herauf. Und wieder leuchtete der Name der Katharina Sforza aus allerjüngster Zeit mahnend in ihre Seele. Die näher kommenden Lichter schienen ihr wie Signale zum Beginn des Verzweiflungskampfes. In das schaurigschöne Bangen fielen die wuchtigen Hammerschläge der Eilnachrichten.
Der Leutnant Monfort trat schwerstiefelig ein. »Hohe Frau – es ist Gefahr im Anzug.«
»Sie soll uns gewappnet finden,« tönte es hell und sieghoffend vom Fenster herüber.
Spinozzi stürmte herein. »Die Trupps schwenken nach Ost.«
»So wollen wir nach West feuern!« entschied die zum Jubel gesteigerte Stimme.
Der Burgvogt verbiß die Lippen. Es war, als würgte etwas an seiner Kehle. Tiziana hatte nur Augen für die bleiche Ferne, nur Ohren für die Geräusche der endenden Nacht, und sie sah das verstörte Antlitz ihres getreuen Kampfgenossen nicht.
»Wenn es zu tagen beginnt und wir den Ring um die Burg sehen, werden wir die ersten Bogenschützen arbeiten lassen.« Tiziana legte jedes Wort ruhig und sorgfältig hin.
Da tauchten draußen, und nun ganz nahe, die Windfackeln auf; aber im nächsten Augenblick verloschen sie wieder.
»Es ist Sturm im Anzug vom Meer herüber,« sagte Tiziana mit verhaltener Erregung. »Daß mir die Leute auf den Sturm achten, wenn sie zielen.«
Nun horchte sie wieder hinaus. Durch das geisterhafte Sausen des Windes in den Eichen klang Pferdehufgeklapper.
Montfort zeigte in die überdämmerte Tiefe hinab. »Da seht – ein Reiter mit einer weißen Fahne – jetzt hält er am Tor –«
»Laßt ihn ein,« befahl Tiziana mit einem nach Luft lechzenden Atemzug.
Montfort eilte hinab.
Spinozzi steht noch immer reglos da. In seiner Brust arbeitet die furchtbarste Qual, sie zerreißt ihm das verwitterte Soldatengesicht. Aber er kann nicht reden, seine Lippen bewegen sich nur und formen ein Nichts.
Da tritt Montfort mit einem stattlich gewachsenen Kriegsmann ein.
Tiziana reißt den Oberleib zurück. Sie starrt den Sendling an. Eichenstämmig und herrlich steht er da. Nun neigt er das schöne Haupt. »Im Namen des Herzogs der Romagna Cesare Borgia, dessen Urkunde meine Gesandtschaft beglaubigt, frage ich Euch, edle Herrin, ob Ihr gewillt seid, das Schloß Monterotondo, die Stammburg des gewesenen Kardinals Giambattista Orsini, dem Herzog zu übergeben. Dieser verspricht der Besatzung freien Abzug und dem Schloß vollständige Schonung. Es wird Seiner Herrlichkeit eine große Ehre sein, Euch, edle Frau, ehrenvoll aus dem Schlosse zu geleiten.«
»Wie Astorre Manfredi von Faenza!« höhnte Tiziana mit glühendem Auge. »Er hat dem Knaben das ehrenvolle Geleite bis in die Wasser des Tiber gegeben.« Man glaubte das Beben ihres Markes zu hören. Ein Glutblick, wie ihn nur der beleidigte Stolz aus der Seele schleudert, gab dem herzoglichen Boten einen Vorgeschmack dessen, was er zu erwarten hatte. Tizianas Glieder streckten sich, ihre Haltung wurde eisern, ihr Wuchs reckte sich ins Fürstliche, und mit leisem Zorn in der Stimme kündigte sie ihren Willen: »Saget Eurem Herzog, dieses Schloß ist nicht mein.«
Der Feldhauptmann zögerte mit der Gegenrede. »Verzeiht – wir meinten –«
»Zuerst eine Frage. Wer seid Ihr?«
»Giovanni Montone, Feldhauptmann Seiner Herrlichkeit.«
»Wo steht Euer Herr?«
»Er zieht die Eisenklammer um die Burg.«
»Wir werden sie sprengen.«
»Versucht es nicht,« warnte Montone beinahe traurig, gerührt von der Schönheit dieser gereizten Löwin.
»Wir werden es versuchen,« trotzte es vom Fenster zurück. »Und saget Eurem Herrn, Tiziana de' Calvi ist nie und nimmer gewillt, diese Burg, ihres angetrauten Gatten heiliges Gut, dem Herzog zu übergeben. Diese Burg hat einen Zweig seines geliebten Geschlechts heranwachsen sehen, der die edelsten Früchte getragen. Senatoren, Gelehrte, Kardinäle und Kriegshauptleute haben unter dem Schutz dieser Burg ihren Geist und ihre Tugend gebildet. Die köstlichste Frucht dieses stolzen Stammes, mein Gemahl Giambattista Orsini, hat hier sein edles Leben unter dem Schirm ebenso edler Ahnengeister dem Gipfel entgegengeführt. Nur mit seiner Einwilligung kann ich diese Burg übergeben.«
»Das wird – dann – allerdings – nicht möglich sein,« sagte Montone sichtlich bestürzt.
»Vielleicht in diesem Augenblick nicht, doch wenn das Geschick sich wendet, werde ich Euch Antwort geben.«
Der Gesandte trat blaß näher. »Edle Frau – der gewesene Kardinal –«
»Hat ihn der Papst seiner Würde beraubt?« flammte Tiziana empor. »Er wirtschafte mit Würden und Ämtern! Die Herrlichkeit seiner Geisteswürde kann Alexander niemals aberkennen.«
»Verzeiht, edle Frau – der Kardinal – ist –«
»Herrin! Herrin!« warf sich Spinozzi mit einer Art Aufschrei zu Füßen Tizianas nieder. Um seine Lippen zuckte wilder Schmerz. Das Blut tobte in ihm. Ein schreckliches Geheimnis warf seine Männlichkeit in den Staub.
Tiziana sah den alten Freund mit fragenden, unsichern Blicken an. Da merkte sie, daß auch Montone und Monfort das Haupt gesenkt hatten. Ihre Augen spannten sich, ihre Kehle war wie von fremden Gluten erfüllt, ihre Knie durchrieselte ein unerklärlich heißes Sickern wie von Blut. Und da bröckelte es auch leise, leise von ihrer Kehle los, als rissen sich dort kleine lebendige Teilchen ab: »Ihr – ihr – ihr – sagt doch – was – steht ihr so – betroffen – was – sollen – diese Gesichter – diese –« Plötzlich zerriß ein Schrei die Stille. Dann peitschte sich ihr Leib an die Schultern Spinozzis mit hoch aufgeworfnen Armen heran. Ihre Augen bohrten sich in das verzweifelte Gesicht, die Lippen öffneten sich, ohne zu tönen, die Finger zuckten, krampften sich in der Luft zusammen –
Des treuen Waffenträgers Haltung bekam den letzten Bruch. Er nahm den wankenden Leib seiner geliebten Herrin in die Arme.
Da sah er, wie ein Eishauch über das olivendunkle Gesicht Tizianas jagte und alles Blut in die Herzkammern trieb. Langsam, wie eine von unbarmherzigen Händen zerrissene Rose fiel ihr schöner Leib in seinen Armen zusammen. Der Bruch der Seele und des Herzens zertrümmerte auch ihren Leib. In eine fühllose Ohnmacht löste sich das schwache Leben auf.
Der Sendling Cesare Borgias trat an den Burgvogt heran. »Sie wußte nichts?« fragte er bestürzt.
»Vor einigen Augenblicken brachten es die Reiter aus Rom.«
»Daß Giambattista Orsini –?«
Der Burgvogt warf einen furchtbaren Blick zum Himmel. »Wehe dem, der Gottes Hand vorgegriffen!« Und er hob die geballten Fäuste wie zum Schlag. »Otternbrut! Otternbrut! Tod, Tod, Tod allüberall, wo der Pesthauch der Borgia weht! Mein Herr vergiftet im Kerker zu Rom – und hier, seine geliebte Rose, sein Stern, sein Alles zerblättert, verlöscht!« Er stielte die blutunterlaufenen Augen vor und schrie, daß es von der Wand gellte: »Hütet euch, Borgia! Hüte dich, Cesare, dem der Schatten des Avernus auf dem Fuße folgt! Dieser Tod in Rom wird auf Monterotondo furchtbares Leben wecken!« Das Antlitz Spinozzis war verbleicht. Und er strich leise wie ein kummervoller Vater über die Stirn der gebrochnen Frau. Da kam ihr Blut zur Macht. Und ihre Augen öffneten sich.
»Herrin, Herrin!« stammelte der Burgvogt mit knirschenden Zähnen.
In Tizianas starren Blicken lag eine fremde Seele.
Montone trat vor der Gewalt des Schmerzes ehrfurchtsvoll zurück. Seine Bewegung gab Tiziana einen Ruck ins Leben. Ihre Finger krallten nach dem Saum seines Mantels. »Bleibt!« Die Augen blickten fremd alle Männer der Reihe nach an. »Wie – ist – das geschehen?« tönte es hohl und verloren.
Spinozzi näherte sich ihr mit den hilfsbereiten Armen. »Wir wissen es nicht – aber – er starb im Kerker der Borgia. Heute nach Mitternacht – wurde seine Leiche mit ehrenvollem Geleit nach San Salvatore gebracht.«
»Ja, ja – es geschieht alles sehr ehrenvoll – bei den Borgia,« sagte Tiziana mit einem Ton, in dem der Seele Weh und Hohn splitterten.
Dann blieb es furchtbar still im Gemach. Draußen begann der Wind zu heulen. Durch das bleichende Dämmern dunkelte es von Westen wie eine neue Nacht heran.
Da richtete sich Tiziana wie mit überirdischen Kräften seherhaft groß auf und im nächsten Augenblick gellte ihr Kassandraruf hinaus in die sturmzitternde Frühe: »Papst! Cesare Borgia! Des Toten Blut über euch! Stirb! Alexander Borgia! Denn du hast ihn gemordet!«
Die Geister Aeolos' trugen den Fluch hinüber nach Rom.
Montone überlief ein Grauen. Er sah, wie die Gestalt vor ihm zu pythienhafter Hehrheit emporwuchs, wie sich in diesen kohlschwarzen Augen ein unheimliches Feuer entzündete und wie die Nerven dieser ins Dämonische spielenden Frau einer Tat zuzudrängen schienen. Er glaubte, daß das ganze Wesen vor ihm im nächsten Augenblick zu einer einzigen Flamme werden würde, die durch Zauberkraft alles Leben ringsum versengen mußte. La strega! Die Hexe! fieberte die Einbildungskraft in ihm.
Im nächsten Augenblick riß Tiziana mit gelöster Riesenkraft den heiligen Willen aus ihrer Heldenseele. »Saget Cesare Borgia, dem Herzog der Romagna und Fürsten des Orkus, Tiziana de' Calvi verlangt nach ihm! Er möge sie holen kommen! Aber merkt euch: jeder Mauerstein dieser Burg wird sich in eine Löwenkralle wandeln!« Wie der drohende Ton des Atheneschildes klang es an des bestürzten Herolds Ohr.
Da brach sich dumpfes Gemurmel und Gepolter an den Wänden des Gemaches. Die Tür flog auf. Unter dem wehenden brandroten Schein einiger Fackeln stand dicht zusammengeballt ein Häuflein graubärtiger Burgknechte. Dahinter Frauen und Mädchen in tuskischer Tracht.
»Was wollt ihr?« rief Spinozzi den grimmverzerrten Gesichtern entgegen.
Da schmiß sich einer nach vorn, einer mit zerrauftem Bart, eckigen Schultern, die sich hilflos hin und her rissen, einer mit treuen Hundeaugen und krallig verkrampften Händen, die die Mütze zerknüllten. »Das Schloß ist in Aufruhr – der Cesare zieht heran und sie sagen – verzeiht, Herrin – aber es läuft so von Maul zu Maul – und ist von Rom herübergekommen – daß unser edler, guter Herr –«
»Mach's kurz!« warf sich ein zweiter an seine Seite, dem der Zorn die Kehle noch nicht so zugeschnürt hatte. »Seine Herrlichkeit, der Kardinal – soll in Rom vergiftet sein?! Ist's wahr, Herrin?«
Tiziana riß die Hände empor an ihren Hals, als wollte sie die Flammen darin ersticken. »Euer Herr – ist tot!« Die Klage scholl wie ein Donnerruf aus der Höhe in die Ohren der erregten Knechte.
Da fuhren die Leiber auseinander, die Hälse streckten sich, Fäuste schwangen sich in die Luft, Schultern duckten sich wie zum lauernden Angriff und die Wut stieß ihre wilden Laute aus den Brüsten. »Hunde und Schurken in Rom! Den Orsini gemordet! Die Rose der Kardinäle! Die Pest über Rom!«
Und ein andrer stieß sich mit den stiermächtigen Ellbogen den Weg durch den Haufen und warf sich der Herrin vor die Füße wie ein Klotz: »Wir wollen ihnen Igelstacheln zeigen. Stellt mich hinaus, allerschönste Frau, dorthin, wo er selber ankommt, der Cesare Borgia, und ich will Euch sein Hirn und Blut in meiner Sturmhaube bringen, angefüllt bis zum Rand!«
»Leute – ihr liebtet euern Herrn?« schluchzte Tiziana in den wüsten Haufen hinein.
Da schleuderten sie sich alle zu Boden und hoben beschwörend und schweigend die Hände empor. Es war ein ergreifendes treues Bekennen der Liebe, daß es dem Hauptmann Montone heiß in die Augen schoß.
Tiziana wankte in die Arme Spinozzis. »Helft mir – wie soll ich diese Liebe lohnen?«
»Stellt sie auf die Probe!« rief der Burgvogt; dann wandte er sich an die Knechte, markig und erregt, daß sein eisgrauer Bart zu zittern begann: »Männer von Monterotondo, der Kardinal ist tot, sein Geist lebt, sein Auge sieht vom Himmel auf euch und sein Ohr horcht dem Pulsschlag eurer Herzen. Es kommt ein Feind heran, schlimmer denn alle Feinde des Herrn, einer, der sich eure schöne, liebe, gute Frau holen will zum fürchterlichen Zeitvertreib –«
Die verkrampften Körper bäumten sich auf und warfen sich in heftigster Wut hin und her.
»Eure Herrin soll ein Glied der Dirnenkette werden, mit der der stolze, herzogliche Lüstling prahlt!«
Montone wurde schneebleich. Aber er wagte sich nicht zu rühren.
»Satanshunde kämpfen an seiner Seite, die Hölle hängt sich an seine Fersen, alle Ungeheuer der entmenschten Natur sind sein Gefolge. Ihr habt nicht mit Menschen, sondern mit Teufeln zu kämpfen. Wollt ihr das?«
Der ganze Gang heulte auf. Es klang wie lachende Lust, wie wilder, zornbeschwingter Jubel. Und aus dem Haufen schälten sich die Weiber und Mägde los und warfen sich Tiziana zu Füßen. »Liebe, süße Donna, Ihr kamt in unsre Stuben, wenn wir krank waren,« weinte eine Matrone mit zottigen Strähnen. »Ihr habt meine Jungen mit dem kleinen Valerio spielen lassen,« schluchzte eine andre. »Unsre Kleinen gingen nie schlafen, ohne für Euch zu beten.« »In jeder Hütte hat man deine schwarzen Augen gesegnet.« »Nach der Madonna kommst du. Heilige!« »O du schöne, schöne Heilige!« »Du gabst uns Brot und Wein!« »Wir verlassen dich nicht!« So warfen sie ihr einfältig und ehrlich und erschütternd ihre Liebe zu Füßen.
Da taumelte Tiziana aus ihrer Schmerzzerrissenheit empor. Sie stand inmitten der knienden Frauen und der kampflechzenden Burgknechte. Langsam schob sie den stützenden Arm Spinozzis beiseite. Ein gewaltiges Feuer entzündete sich in ihrem Busen, genährt von der treuen Liebe ihres Burgvolkes. Und ihr war, als hätte in diesem Augenblick ihr Kardinal den metallnen Sarkophagdeckel gesprengt, den ihm die Gnade seines Mörders geschenkt, und er stünde nun neben ihr in Harnisch und Helm, um seinen Mut und seine Herzhaftigkeit in ihre weibliche Schwachheit zu werfen. Mit hellglutendem Blick warf sie das Feuer ihres Herzens in die Seele des Herolds. »Meldet Eurem Herrn, was Ihr gesehen. Und fügt hinzu: Er soll mich holen kommen. Er wird mich aus den Krallen und Zähnen der Liebe und Treue reißen müssen. Und wir wollen ihm die Arbeit nicht leicht machen, wollen Totenberge häufen auf seinem Wege in mein Brautgemach.«
»Edle Herrin,« bebte Montone.
»Und wollen Täler zwischen den Totenbergen schaffen, durch die das Würgerblut strömen soll. Meine Söldlinge werden Körperwälle vor sich auftürmen, um vor dem tötenden Blick Cesare Borgias sicher zu sein, dem einzigen, vor dem sie das Fürchten lernen könnten. Seht diese Getreuen, sie halten mir die Treue, die sie dem Toten nicht mehr recht halten können. Seht nach, Söldner Cesares, ob der Herzog in seinen Reihen einen einzigen so treuen Mann sein eigen nennen kann, wie diese hier zu meinen Füßen. Der Geist der Menschenliebe, den der Kardinal auf Monterotondo großzog, zwang sich ein ganzes Volk zur unbedingten Treue. Sie denken nicht daran, daß nur der Nachruhm Kranz ihr einziger Lohn sein wird. Ihr Mut ist geschwellt von Todestrunkenheit, Cesare mag ihn in Stücke hauen, wenn er's vermag. Ihre Herzen dampfen vor Racheglut, denn man hat ihren Herrn gemordet. Wenn Cesare seiner Söldner sicher sein will, muß er Gold und Silber unter sie werfen. Diesen warf ich meine Liebe in die Herzen und sie färben mir dafür ihre Schilde rot, schmücken mit blutigen Rosen ihre Lanzenspitzen und füllen ihre Helmkannen mit Borgiablut. Ihr Leben ist meines, meines ist das meines Herrn. Rennt an die Mauern, ein furchtbar Wechselmorden soll seine Schauder nach Rom hinüberrauchen, daß die Sonne ihr Antlitz verhüllt und der Papst im Ave Maria erzittert. In seinem Sohn will ich den Vater treffen.«
Sieghaft, statuenhehr stand sie da, dreifach gewachsen durch die Kraft leidenschaftlicher Bewegtheit, Todesverachtung und Racheglut.
Den Burgleuten schauderte. Aus dem zärtlich liebenden Weib, dessen Schmuck die Liebesträne war, hatte die Tücke der Borgia eine Eumenidengestalt gemacht. Sie war ihrer eigenen Natur entronnen, dämonische Gewalten waren über sie hergefallen.
Da wälzte sich der Reckenleib Spinozzis auf den Gesandten zu, der völlig verblüfft wie ein überrannter Knabe dastand. »Wollt Ihr's wagen, Hauptmann, nachdem Ihr das gehört? Und sagt dem Cesare, er soll den Zerberus Spinozzi kennen lernen, der seinen Leib vor der Tür aufpflanzen wird, hinter der seine Herrin atmet. Und wer ihr schönes Brautbett besteigen will, muß zuerst meine Zähne einzeln aus den Kiefern reißen. Das sagt der ganzen Mörderbrut, die sich unter seiner Fahne zusammenverfilzt hat wie ein Rattenkönig.«
»Und hört meinen Abschiedsgruß,« jubelte Tiziana völlig entflammt hinzu. »Eher wechselt die Sonne ihren Lauf und dampft der Mond Feuerqualm aus, bevor Tiziana de' Calvi ihren geheiligten Mutterschoß dem Spießgesellen Luzifers öffnet! Mit Stricken in sein Bett gezerrt, will ich mein Brauthemd mit dem Blut des gräßlichsten Tyrannen färben. Vom Turm herab will ich sein Nahen sehen und meine Augen sollen wie zwei Todesfackeln seinen Weg zu mir bestrahlen. Das dunkle Halsband meiner Haare schling' ich um seinen Hals und würge, würge, würge zu, bis sich das Auge der Hyäne mit Nacht bedeckt.« Ihre Seele rauchte wie ein Vulkan des Hasses und der Rache.
Die Kriegsleute warfen es sich schrecklich flüsternd zu: »Habt ihr je solche Schwüre gehört?« »Nun regnet's Blut vom Himmel und steigen Springbrunnen von Blut zum Himmel auf.« »Das Ungeheuer Mord kriecht durch Wolken heran.« Solche bange Reden sprangen von Mund zu Mund.
Da sprang einer, ein hagerer, von Narben zerrissener Knecht mit bleigrauen Augenringen und schrecklich geweiteten Pupillen dem Montone vor die Füße. »Und sagt noch, wir werden Bart an Bart fechten für unsre liebe Herrin und euch allen die Augen aus den Höhlen reißen beim wilden Tanz. Und dieser Turm wird in die Erde wachsen, das oberste sich zu unterst kehren, und eure Gräber werden wir euch mit dem Schwert schaufeln.«
»Heb dich, Paolomaria,« rief Tiziana dem Wildling zu.
»Er soll die Tür hinter sich schließen, der Höllenhund,« murrte der Söldling. »Ich steh nimmer für meine Geduld.«
Tiziana ordnete den Leuten eine Gasse an. Mit eiskalter Haut durchschritt sie der romagnolische Hauptmann.
Die Stunde wandelte alle Herzen zu glühenden Laven. Es war wie ein Opferfest der Treue vor dem Tod.
»Alle Mann auf Posten!« rief Tiziana ohne Grauen und Angst.
Mit pfeifendem, johlendem Geheul hetzte die Kriegsmeute hinab in den Hof. Dort empfing sie eine schrille, mißklingende Musik von Lauten, Trommeln, Kastagnetten und Pfeifen, ein Tanz von infernalischer Wildheit, der alle zur Kampfwut aufstachelte.
Tiziana horchte auf den brausenden Donner der Begeisterung. »Mir ist so leicht, Spinozzi, als fielen alle Erdenschleier von mir ab, kein Lebenspanzer drückt die Glieder mehr. Und nun, hoher Mut, dein Eisen in meine Brust, und du, Tod, dein Eisen in die seine!« Sie stand von Himmelsflammen verklärt im fahlen Licht des Morgens.
Die Burgglocke setzte mit hallendem Sturmruf ein. Von den Wehrgängen sausten wilde Gesänge in die windgepeitschte Landschaft. Sie grüßten das herankribbelnde Geschmeiß der würgerischen Soldateska des Cesare Borgia.
Unheimliches schwefelgelbes Gewölk zog in zerrißnen Fetzen von Korsika her nach der römischen Erde, die in furchtbarer Bängnis lag. Über dem Meer begann es zu dröhnen und zu zürnen.
 So wie der See um eine Insel seine breiten Wasser legt, so schloß Cesare seinen lebendigen Eisengürtel um den Leib der Burg.
So wie der See um eine Insel seine breiten Wasser legt, so schloß Cesare seinen lebendigen Eisengürtel um den Leib der Burg.
Der Morgen hob sich. O, welch ein Morgen! Rom erschauerte unter diesem Morgenhimmel. Kein liebliches Erglühen Auroras zeigte Sol den Weg in den jungen Tag. Furchtbare Wetter brauten über dem Tyrrhenischen Meer und wälzten ihre Wolkenleiber wie gigantische schwarze Stiere heran, die mitkämpfen wollten bei dem irdischen Tanz der Frevler, mitkämpfen gegen ihren Feind Cesare Borgia, den Stier- und Menschentöter. Und plötzlich schnaubten sie aus ihren Mäulern zuckendes, rosenrotes Feuer und brüllten Schlachtrufe nieder aus den Höhen auf die zitternde Erde. Staubwirbel drehten sich unter dem grellen Geblitze wie feurige Schraubendolche gegen die Wolkenbrüste hinauf.
Aber das morgendliche Dröhnen des Himmels erschreckte den Verächter göttlicher Drohungen nicht. Cesare Borgia stand im Feldherrnzelt hochaufgerichtet mit gespannten Fibern und Nerven. Er wartete auf die Rückkehr seines Unterhändlers Montone. Der dunkle Harnisch legte sein Eisen grausigdüster um die schönen Herrenglieder, er schien wie ein stählernes Hochzeitsgewand, das Hephästos geschmiedet. Der Helm trug den phantastischen Drachen als Zier, und wenn sich der Träger bewegte, schillerten zwischen den Eisenfalten des Helmes die Korunde wie drohende Schlangenaugen, die in die Sonne blinzeln. Aber das Antlitz unter diesem unheimlichen Helm war von Heiterkeit überstrahlt, jeder dämonische Zug erschien vertilgt, die Siegeslust eines Cäsars leuchtete aus den blauen Augen, Furchtlosigkeit hieß der Stempel der schönen, hohen Stirn. Die Beulen der Lustseuche hatten sich auf Körperteile zurückgezogen, die das Kriegsgewand bedeckte, so daß ein Feldherr von achilleischer Majestät das kleine Belagerungsheer zu kommandieren schien. Es waren nur kleine zusammengewürfelte Trupps, die Cesare hier zusammengezogen hatte, denn der größte Teil des romagnolischen Heeres war aufgelöst worden, und die restlichen Häuflein waren planvoll vor die übrigen Burgen der Orsini geworfen.
Montone zögerte. Cesare wurde ungeduldig. Er sah gespannt nach den Zinnen der Burg, die wie graue Riesenzähne in das fahlgelbe Licht starrten. Noch hißte sich keine Fahne dort als Friedenszeichen. Trotzig begann sich das Gemäuer aus Nacht und Nebel zu schälen, und bald lag der ganze Koloß drohend vor den furchtlosen Augen des Herzogs Valentino.
Seine fünf Hauptleute meldeten ihm, daß der Belagerungsring geschlossen sei. Deutlich gewahrte Cesare die Linie der Söldner, die die Laufgräben aushoben. Der Sturm rüttelte an den Zeltwänden und Vorhängen. Der Herzog nahm den Helm ab und ließ die braungoldnen Strähnen flattern.
Diese Frau überlegt lange, sann er in das Grauen und Brauen hinaus. Sie wird ihre arme Angst durch Verhandlungen beschwichtigen wollen nach Frauenart. Aber ich gäbe alles darum, ihre Angst mit sanft streichelnden Händen zur Ruhe zu bringen.
Da fielen drüben die Kugelketten vor dem Tor. Die Flügel sprangen auf. Montone ritt aus dem dunklen Schlund.
Cesare stand regungslos und wartete.
Als der Feldhauptmann herangesprengt kam, warf Cesare einen Blick in ein Manuskript. Es war einer der Orsinibriefe Giambattistas, den ihm der Papst geschickt hatte. Lässig nahm er das Heft zur Hand und tat, als ob er gedanklich mit dem Inhalt beschäftigt gewesen wäre. Aber er war ein großer Komödiant. In Wirklichkeit fieberte sein Herz nach der frohen Nachricht, dieses Herz, das die hemmungslose Sinnlichkeit regierte. Cesare warf seine wildeste Soldateska vor die Burg, um sich ein Weib zu erobern, nach dem sein ungestümes Hengstblut begehrte. Skrupellos opferte er dafür Menschenblut hin. Er haßte die Orsini nicht wie sein Vater, aber sie waren ihm unbequem geworden in seinem großen politischen Kalkül. So mußten sie fallen als das letzte baronale Geschlecht. Der Schachplan der Borgia hatte die Vernichtungsarbeit gründlich vorbereitet und die feindlichen Figuren waren zum größten Teil gefallen. Der Feldhauptmann Pagolo und der Herzog von Gravina waren erwürgt, der Kardinal Orsini vergiftet; nun hieß es noch, das Haupt des Hauses Giangiordano Orsini in Bracciano unschädlich zu machen. Aber die Aufgabe lockte Cesare persönlich weniger als die Niederringung der stolzen Kardinalskurtisane, die sich das Mäntelchen der Ehefrau umgeworfen hatte. Der romagnolische Feldzug hatte ihn sinnlich ausgehungert und nun sollte ihn ein Leckerbissen, dessen mühevolle Gewinnung ihn noch begehrenswerter machte, für alle Entbehrung entschädigen. Ein Tyrann, der mit Ländern und Städten Fangball spielte, konnte am Ende auch skrupellos Frauentugenden brechen und mit einem edlen Herzen Katze und Maus spielen. Diese Belagerung sollte ein Meisterstück seiner Tyrannenlaune werden, aber keines seiner Waffenkunst, die er ja überhaupt nie beherrscht hatte. Alle Erfolge verdankte er einer treulosen Verräterpolitik, keinen einzigen seinem Feldherrngenie. Und jetzt sollte die Welt mit maulaufsperrender Bewunderung von der Erfindungskraft seines Hirns erzählen, das den Gedanken eines neuen Helenakampfes aussann. Ihn reizte der Widerstand des Geschicks. Frauen, die sich seiner Männerkraft hingaben, hatte er zu Dutzenden in den Armen gehalten, denn es war so weit gekommen, daß man es als eine Art Ehre empfand, die Glutküsse des verseuchten Teufelherzogs getrunken zu haben. Aber hier widerstand ihm ein Weib, um das schon einmal ein kleiner Baronalkrieg entbrannt war. Die Siegerin sollte nun zur Besiegten werden. Und diese seltsame Frau hatte, um ihren Reiz zu erhöhen, auch den Dolch nach Cesares Vater gezückt. Es stand ihm also der Kampf mit einer Judithnatur bevor. Er hatte Mut genug, ihn aufzunehmen. An den Wahnwitz eines zweiten Imola dachte Cesare nicht. Ein Gott wiederholt sich nicht in seinen Prüfungsarten.
Aber Gott wiederholte sich doch. Er schuf in dieser Tiziana de' Calvi eine zweite Katharina Sforza.
Mit gesenktem Haupt stand der schmucke Feldhauptmann Montone vor seinem Herrn.
»Sie ergibt sich?« fragte Cesare ohne nervöse Hast. Und doch brannten ihm die Eingeweide.
Montone schüttelte das Haupt. »Ihr müßt sie selbst holen kommen.« Und mit nachschauernder Ergriffenheit erzählte er, was er erschaut, gehört, erlebt.
Cesare blieb rührungslos. »Sonderbare Frau,« sagte er. »Mit einer Handvoll abgekämpfter Greise die Bezwingerlust eines Cesare Borgia ins Wanken bringen zu wollen! Es soll ein kurzer Tanz werden. Um so zärtlicher will ich den Mund küssen, der solche Dolche zu sprechen weiß. Und es ist doch auch gar zu verführerisch, die Fingerchen zu liebkosen, die das Mordeisen umkrallt hatten, das nach meines Vaters Brust zielen sollte. Ich will ihr eine gelinde Strafe diktieren. Die Küsse der von ihr verfluchten Lippen sollen sie lehren, das Geschenk der Gnade zu würdigen.«
In seine frevlerischen Gedanken hinein brüllten die Wolkenstiere, und Blitz auf Blitz schleuderte der erzürnte Himmel in das umlagerte Gemäuer der Burg. Aber ohnmächtig prallten die Feuerstacheln von den steinernen Turmleibern ab.
In das erste Prasseln des Regens warf Cesare das Blitzlicht seiner List hinein. »Montone, ich soll sie holen kommen, sagst du? Den Stolz liebe ich. Und ich will ihn befriedigen. Doch wirst du so gut sein, mir dabei behilflich zu sein, die blühende Beute zu bergen.« Er sah seinen Hauptmann mit einem bezwingenden Lächeln an. »Du bist schmuck und jung und stählern wie ich.«
Montone strahlte vor Stolz. »Hoheit –«
»Du hast meine Gestalt und Haltung,« schmeichelte der listige Herzog weiter. »Sag', hättest du Lust für deinen Herrn einen zweiten Gang in die Höhle der Löwin zu wagen?«
Montone war in seinen Herrn verliebt, er war geneigt, noch viel mehr für ihn zu tun. »Ihr macht mich zum glücklichsten der Menschen.«
»Du nimmst meinen Harnisch und Helm. Denn siehst du, ich liebe Jupiters List. Tiziana de' Calvi soll in Cesares Gestalt, aber nicht von ihm selbst eingeholt werden, damit das schlanke Mäuschen nicht hinterher triumphiert, der Kater hätte sich ihrem Willen gebeugt.«
»Die Idee ist mit Gold nicht zu bezahlen,« lachte Montone.
»Wenn die Burg niedergerungen ist, gehst du in meinem Panzer, meinen Drachen auf der Brust, hinein und holst mir mein Liebchen ins Brautbett. Die Sänfte nimmst du gleich mit, führst dann die Schöne in mein Zelt, lüftest das Visier und wir weiden uns an den erschreckten Taubenaugen. Heda! Läufer!«
Reichbetreßte Knechte in rotgelben Wämsern traten herein.
»Schmückt dieses Zelt mit den kostbarsten Gehängen, streut Blumen auf das Lager, tragt weiche Löwenfelle herbei, gießt Narden aus und laßt die Flötenbläser kommen. Die Himmelsmusik wird nicht lange dauern, wir wollen sie sanfter fortsetzen.« Dann wandte er sich zu Montone und klatschte ihm leicht und leutselig die Wange ab. »Mein guter, braver Bursche. Du willst belohnt sein für deine Treue. Siehst du, wenn dieses Glück zu Ende geschlürft sein wird, dann –« er senkte die Stimme und blinzelte seinen Freund geheimnisvoll an – »ich liebe es nicht, Rosen allzu lange in meiner Vase zu belassen. Es sollen sich auch andere Rosenfreunde an ihrem Duft erfreuen. Und am Ende ist sie eine Frau mit Mordgedanken. Nimm den Panzer! Stücke los!«
Vor dem Zelte bäumte sich Cesares Rappen im Krachen des Himmels, das die Donner der Stücke begleiteten. Der Orkan tobte. Das Gewitter prasselte nieder und geißelte Erde und Menschen.
*
Wie springende Flammen loht die Begeisterung von Herz zu Herz. Die Burgknechte lauern mit den Augen und den drohend gespannten Armbrüsten in das furchtbare Wetter hinaus, das graue Schleier von Regen über den Belagerungsring wirft. Des Himmels wilde Sinfonie prasselt in ihre Ohren und übertönt zuweilen den Donner der herzoglichen Stücke. Bäche ergießen sich von der Burghöhe hinab in das Lager, als wollten sie des Titanen Soldateska ersäufen. Und manchmal kräuseln sich die Regenströme zu einem Wirbel zusammen, der sturmgepeitscht an den Mauern vorübergeistert wie ein Schattenbild des Orkus. Von Wolke zu Wolke zucken und zacken die grausig schönen Blitzschlangen und wecken die krachenden Zornpauken des Himmels.
Durch die Gänge huscht mit fliegender Brust das zur Heldin gewordene Weib. Sie eilt von Mann zu Mann und wirft ihren Mut in die Herzen. Wenn die Söldner sie kommen sehen, laufen sie zusammen, um einen Feuerblick aus ihrem Auge zu erhaschen. Sie kennen sie nicht mehr. Sie spornt alles zur höchsten Aufopferung an. Ihr rotseidenes Gewand mit dem perlenübersäten weißen Mantel leuchtet schon von weitem durch die Nacht der Korridore wie eine daherfliegende Flamme. In Trauer wollte sie an diesem Ehrentag des Orsini nicht durch ihr Volk schreiten, sie wollte Farben der Rache und des Blutes tragen.
Jetzt, jetzt mußte Montone bei Cesare angelangt sein und ihm den fürchterlichen Willkomm vor die Füße gelegt haben. Tiziana lugte bei einer Schießscharte hinaus in das Zwielicht des grauen, von allen Elementen durchwüteten Morgens. Da hielt das Unwetter einen Augenblick den Atem an. Und jetzt krachten die ersten Schüsse von drüben her. Orsini und Borgia verbissen sich ineinander wie Hund und Igel.
Tiziana flog zum ersten Wehrgang hinan, von wo sie das Kampffeld von einer vorgemauerten Nische übersehen konnte. Dort stand ein alter Schütze, der schweigend einen Pfeil nach dem andern in den dichter werdenden Ring sandte. Sie hörte die Befehle der Unterführer im Schlosse undeutlich hallen und ihr Geist wußte nicht, was sie bedeuteten. Aber ihr Gefühl raunte es ihr zu: alles für dich! alles! Sie sammelte die zerrissenen Stücke ihrer Seele und versuchte, das zarte Gebilde wieder neu erstehen zu lassen. Aber es wollte nimmermehr gelingen. In ihr loderte die andre, die nach des Frevlers Blut lechzte, die Seele der Tigerin. Vater und Sohn Borgia verschmolzen in ihrer Vorstellung zu einer Einheit, der eine hatte ihren Gatten getötet, der andre kam, ihre Seele zu töten. Ausgespien aus des Kokytos dunklen Bezirken waren beide, und nun schwangen sie das schwarze Banner der Vernichtung über die erschreckte Erde.
Eine Kette von Söldnern lief den Gang herauf zur breiten Scharte. Als die kampfwilden Gesichter ihre Herrin erblickten, jubelte alles ihr zu. Sie nahm einem Bogen und Köcher ab und machte sich bereit zu töten. Sorgsam spannte sie die Sehne mit den weiten Fingern und bat Gott um eine sichere Hand. Dann schnellte sie ihren bittern fraulichen Gruß in den eben heranwurlenden Knäuel Menschen. Sie sah einen fallen, und durch ihren Leib jagte ein paar Herzschläge lang das Entsetzen. Sie jagte sich den Trost in die Seele, daß es nicht ihr Pfeil war, der getroffen hatte. Wieder spannte sie die Armbrust, um sich an das Morden zu gewöhnen. Sie zupfte kräftig an der Sehne, und da klang diese, als wäre es die Saite einer Laute. Das Herzweh zerriß Tiziana. Sie warf die Armbrust weg.
Da nahm einer in jauchzender Kampflust seinen Panzer ab und legte ihn im Spaß der Herrin um den Leib. Ihr Auge leuchtete in der eisernen Wehr und ihre Hände streichelten das kalte Metall, das sich starr an ihre hochgehende Brust preßte. Und einen Helm setzte ihr ein junger Orsiniknecht aufs dunkle Gelock, und alles schrie um sie vor Lust und Begeisterung. Sie hatte ein eisern Brautgewand angelegt für den lüsternen Freiersmann.
Immer tiefer sank die Frauenseele in ihr. Schon aus der Ferne hatte der Titan der Vernichtung alles Weibliche in ihr getötet, mit seinem Näherkommen nahm seine Wandlungskraft zu. Ihr Gemüt verhärtete sich, über ihre Seele legte sich die Kruste des Hasses und der Rachsucht. Gerüstet mit dem leuchtenden Erz, klirrend und gewaltig wie eine Nemesis, schritt sie jetzt durch den finstern Gang hinauf zur höchsten Burgzinne.
In den Lüften über ihr tanzen die Wetter endlos ihren donnernden Reigen. Und zu ihren Füßen speit der Erzfeind seine wilden Feuer und Pfeile gegen die Burg. Es ist, als müßten sich im nächsten Augenblick die Schrecken der Offenbarung erfüllen. Die Natur breitet ihr Grauen über die Welt, die Menschen helfen schrecklich mit.
Tiziana steht da, ein weit leuchtendes Fanal der Treue.
Das Gemäuer zittert und kracht. Im Südturm bersten die Backsteinmauern, und aufstäubende Breccien taumeln in die Tiefe, in das Gewipfel der Eichen hinein, in die heranstürmenden Teuflinge des Cesare Borgia. Hart an den Burgwänden beginnt der Kampf.
Noch immer steht die Erbin der Orsiniehre hochaufgerichtet da, sie scheint zur Reckengröße eines Orlando emporwachsen zu wollen. Auf Helm und Rüstung prasselt der Regen nieder. Der weißseidene Mantel trieft. Tizianas Blicke spannen sich ins Wasser und Feuer speiende Chaos da unten. Ein schrecklicher Freier naht. Blutgeruch geht ihm voraus. Jetzt, jetzt beginnt der Feind zu stürmen. Gerade zu ihren Füßen. Leiber wälzen sich heran, schnauben und branden gegen die Mauern, und sie meint den Kampfschweiß zu riechen und die blutigen Stirnen zu sehen. Grünt diese Erde noch? Warum färbt sich das Gras nicht blutigrot, warum wird's nicht zum stimmungsvollen Teppich, über den des Blutes Herr wandelt?
Da stürmt Spinozzi herauf auf die Zinne. Seine Augen sind gläsern, seine Haare triefen, sein Gesicht zuckt. »Herrin – es steht schlecht –« Der Schmerz bricht wie ein Schluchzen aus seiner Brust.
Tiziana reißt ihm das Schwert aus der Hand und hebt es himmelwärts. Eine lebendige Nike, steht sie da. Sie will sprechen, kann nicht – ihre Augen irrlichtern nach Rom. Dort drüben liegt es. Kugeln, Türme, Dächer sind von den geisterdüstern Floren des Wetters überhängt. Aber sie will den Turm von San Salvatore erkennen, wo die Gruftschatten den geliebten Leib vor der Qual dieser Zerstörungsorgie behüten. Aber was ewiges Leben war an Giambattista, das muß sie im Himmel suchen. Und so wendet sie den Blick wieder nach oben, wo die Wolkenungeheuer tanzen. Es ist eben, als kriegten Himmel und Erde um die Wette. Aber Tizianas Wille wandelt chaotisches Wolkengebräu in blauschimmernde Weiten. Sie locken und winken der Seele und zaubern ihr einen Wanderweg vor, der zum Geliebten führt. Und mitten in die trügerische Vision saust der Sturm, der wilde Harfner, und singt ihr ein Lied von vergeblichem Heldenmut. Nein, nicht der Sturm. Das ist der Burgvogt Spinozzi neben ihr.
»Unsre Alten sind müd gekämpft oder tot da unten. Der Hof ist ein einziger Friedhof. Was soll nun kommen, edle Frau?«
»Das Ende,« weht es kalt über Spinozzi hin. Tizianas Leib liegt im Fieberbrand. Sie drängt sich an den erschütterten Burgvogt hin und krallt ihre feingeknöchelten Hände in seinen Bart. »Bringt ihn mir, bringt ihn mir, o, bringt ihn mir, guter Spinozzi! Doch bringt Ihr mir das ganze feindliche Heer, die Männerleichen einzeln aneinander gereiht wie tote Störe, bringt Ihr mir die alle und Cesare nicht, dann soll sich die Hölle in Euer Gebein brennen, scheidet Ihr vom Leben. Ich will ihn haben, haben, haben!«
Sie starrt ins Leere und sieht plötzlich ihr Leben an des Orsini Seite von zwei Schauernächten eingegrenzt. In einer Sturmnacht kam sie an des Kardinals Herz, still und leblos, dem Tode nah; und in einer Sturmnacht beginnt sie, eine furchtbare Lebendige, von allem Abschied zu nehmen, was sie noch an den Kardinal band.
Jetzt fließen die Regenschleier auseinander – gespenstisch grau dämmert das Feldherrnzelt herauf. Die Borgiafahne peitscht der Wind.
Da starren die dunklen, von Todesweihe verklärten Augen hinab auf den unheimlichen Magnet. Noch einmal arbeitet ihr Hirn die Untat des Fürchterlichen durch. Sie meint das wollüstige Lechzen des Vampirherzens herauf zu hören durch den Sturm. »Beugst du dich, Unhold, vor keiner Majestät Gottes?« ruft sie hinab. Es verhallt im Gebrüll von Kampf und Wetter. »Cesare Borgia, es ist der Liebe heiliger Schmerz, dessen du spottest, der Treue heilige Not, die du verlachst! Soll ein schwaches Weib das Werkzeug Gottes sein, den Giganten des Bösen zu vernichten? O, er ist mehr! Er ist dieser Zeit ungeheurer Dämon, ihr Sinnbild! Er setzt in seiner Überwinderherrlichkeit seinen Fuß auf der Menschheit Nacken und verlacht Gottes gütigen Willen. Komm an, Cesare! Ein Weib schlägt dich zu Boden mit Männermut und Heldenzorn, und deine Leiche wird ein schrecklich Monument für den Tyrannengeist und wild verwegenes Laster sein. Mit dir ist das Gesetz überwunden, das deine Gewalt der Welt gab, und aus deiner Verwesung flammt das Morgenrot der Freiheit, Tugend und Menschenliebe! Du bist sterbensreif, besinnungsloser Kain und Nero! Ausgeschöpft ist dein Leben, und deine Fackel lösch' ich aus.«
Ihr Verdammungsruf reißt ab. Ihre Augen haken sich in das Zelt ein – dort hebt es sich – schreitet mit königlicher Formbildung heran – in schwärzlichem Panzer und Helm – das Visier über die höllische Larve gezogen – mit den dunklen Farben des Todes geschmückt, schreitest du in die Freierstunde hinein? Freier, Freier, ich will dir einen Odysseischen Freierwillkomm bieten!
Und sie schwingt das Schwert grüßend über dem Haupt. Das Scharlachgewand mit dem weißen Mantel fliegt wie eine Sturmfahne.
Wie gierige, blutlechzende Spinnen kriecht es an den Hängen empor. Alle Leiber in Eisen geschlagen, darüber der Sturm seine dampfenden Regenschleier fetzt. Da wälzen sich die Feindeshaufen ans erkämpfte Tor heran – prasselnd fliegen die Brandkugeln – weit gähnt über Leichen das offene Tor – heulend taumelt die wilde Mordmeute in den dunklen Schlund. Eisen, Pflüge, Sensen, Kugeln, brennende Pechkränze und rotglühende Speere sausen den herzoglichen Söldnern aus dem Hof entgegen.
Dort haben sich die letzten Alten, lauter zerschmissene, vom Krieg braun und hart gegerbte Eisenfresser, hinter Leichenhügeln verschanzt. Mitten unter ihnen steht auf einem Faß im schwarzen Talar der junge Burgdiakon und schwingt nun das Kreuz über die heranstürmenden Haufen. Wie unter einer Vision werfen sich die Cesareknechte zu Boden. Im nächsten Augenblick saust eine Pfeilsalve in sie hinein. Da heult der betrogene Sturmhaufe auf und stürzt sich mordgierig auf die spartanischen Greise. Das Meer von Blut droht überzuwallen. Man kennt keine Gesichter mehr, nur vermetzgerte Fleischmassen, von Panzer, Schienen und Waffen überdeckt.
In die Wutorgie starrt der Burghauptmann von der Zinne. »Herrin – die Treue verblutet – es geht nicht mehr –« Heiser gurgelt es aus der verschnürten Kehle.
Tiziana wankt. Die schwarzen Wimpern schließen sich über der Seele, die in diesen Augen glüht. Dann wirft sie das Schwert und den Helm und den Panzer fort und stürmt davon, die Treppe hinab ... zum letzten Opfer. Der Wettergraus heult und peitscht ihr nach.
Spinozzi weiß, was kommen wird. Und er steht aufrecht da und läßt Sturm und Tod um sich brausen. Keine weiße Fahne soll den Vollender grüßen.
Im Turmzimmer liegt Tizianas schwarzer Kopf über dem lächelnden Knabenantlitz des Valerio Orsini. In Fieberschnelle rast das letzte Unheil an ihrem verstörten Geist vorbei. Giambattista tot! Ein Held und Kind zugleich! Sein Leib zerfällt, und meiner sollte blühen für des Polypen blutsaugende Lust? Und plötzlich sehen ihre Augen den Himmel offen. Giambattista, ein Friedensfürst in strahlender Schönheit, sitzt auf elfenbeinernem Stuhl und seine Blicke leuchten himmlische Lieblichkeit auf sie herab. Und seine Stimme beginnt zu tönen: Treue, Treue, Treue! Das klingt durch den Kampflärm wie sanfter Äolsharfenklang, wie Glockenton, der auf Morgenschwingen in eine Sonntagsstille weht. Und immer schwingen dieselben Worte: Treue ... Treue ... Treue!
Da reißt sie den Knaben an sich und flüstert in den geschauten Himmel hinein: Treuer, Getreuer ... ich komme! Treuer! Treuer! Es klingt wie ein Echo der Erde in den Himmel zurück. Das reine Gold der Gattenliebe soll sich im schrecklichsten der Feuer bewähren. Treuer! Hätt' ich nicht so sehr geliebt, ich hätte nicht so sehr gehaßt. An meiner Liebe Größe maß ich meinen Haß, und so geschah's, daß aus der Trauer Sanftmut der Rache Ingrimm wurde. O, daß der Köcher Seele neben soviel Liebe soviel Haß bergen muß, daß seine Pfeile nach beiden Seiten so tief verwunden müssen! Mein Leben verrauscht und Rache ist sein Schwanengesang.
Sie reißt das Kind empor und eilt ans Fenster. Hinter einem Wall von päpstlichen Eisenmännern schreitet der furchtbar gepanzerte Werber über den Hof. Es ist, als träte Satan selbst die Brautfahrt an. Auf dem schwarzen Brustharnisch leuchtet die goldne Schlange.
Cesare Borgia! Ich will dir ein feuriges Kurtisanenbett bereiten. Brich Herz im Tod, ehe du in Schande brichst!
Rotglühend schlängelt sich vor ihrem Auge der Pfad ins Totenreich. Der Himmel erhellt sich, die Wetter verziehen, rote, düstre Nachglut breitet sich über die römische Erde. Es ist wie des Karfreitags Todespracht.
Und Tiziana eilt, den Knaben im Arm, aus dem Gemach. Dämmerdunkel umfängt sie im feuchten Gang. Da am Ende schwelt im Mauerring eine Fackel. Sie ergreift sie und schwingt sie jubelnd zur feuchten Decke. Himmel, wenn deine Wetter nicht das Werk vollenden, reiß' ich dir deinen Blitzstrahl aus der Herrscherhand und lenke ihn selbst in meiner Würger Gebein! Schon hat ein Todesgott ihr die Binde über den Geist gelegt.
Die Borgiahörner tönen. Jetzt betritt der Würger den Turm, hinter ihm zwei Hauptleute im Harnisch. Der Hof wimmelt von wüsten, siegestrunkenen Gesellen.
In der Frist von zehn Atemzügen muß sie sich entscheiden. Der weiche Kinderhauch schmeichelt an ihre Wange. Sie steigt die Wendeltreppe hinab, vorbei an dicken Rundmauern mit winzigen Luglöchern. Vor einer eisernen Pforte hält sie still, drückt die Klinke nieder ... stygische Finsternis gähnt ihr aus einer kühlen Tiefe entgegen. Nur aus einer kleinen Fensterluke wirft das Licht seine rosige Scheibe auf den furchtbaren Vernichter der Menschheit, der hier in schwarzgrauen Hügeln heimtückisch schlummert. Eine Weckerin kommt! Eine, in deren Seele schon der Himmelsklang seraphischer Chöre wogt. Eine, deren Psalmwort lautet: Selig alle, die den Tod erflehen, denn sie halten liebliche Ausschau nach dem Garten Gottes.
Vor dem Turmtor unten hält der schwarze Ritter still. Zwei qualmende Siegesfackeln rahmen ihn rechts und links ein. Dann tritt er mit schweren, vom Eisen gehemmten Schritten zur Treppe.
Die Wolken reißen auseinander. Phöbus küßt befreit die Welt.
Und mitten im Glutenkuß erbebt die Erde. Ein furchtbarer Donner wälzt sich über das tuskische Hügelland. Ein Turm von Monterotondo bricht in sich zusammen wie von dämonischen Händen gestürzt. Qualmende Feuersäulen schießen in die Luft, dicke braune Nebel verfinstern die junge Sonne.
Der Stern des Orsini erlischt.
Aus dem Schwadengewölk, das flammende Trümmer umwogt, steigt unsichtbar eine Phönixseele zu den goldnen Fernen empor.
Im Feldherrnzelt kniet der unüberwindliche Tyrann zum Gebet nieder, er, dem der Hölle Listen dienen und vor dem das Gute schaudernd die Waffen streckt.
Über Menschenleibern verbrennt in flammenden Zungen das Banner der Orsini, ein Opferfeuer der Liebe.
