
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

 Es gibt kaum ein traulicheres Wort in der deutschen Sprache, als Heimat. Wie süß und weich der Klang, der daraus spricht! Ein jeder liebt das Fleckchen Erde, auf dem sein erster Laut erklungen, auf dem er die ersten Schrittchen als stolzer kleiner Mensch machte, auf dem er den goldenen Traum sorgloser Kindheit träumte.
Es gibt kaum ein traulicheres Wort in der deutschen Sprache, als Heimat. Wie süß und weich der Klang, der daraus spricht! Ein jeder liebt das Fleckchen Erde, auf dem sein erster Laut erklungen, auf dem er die ersten Schrittchen als stolzer kleiner Mensch machte, auf dem er den goldenen Traum sorgloser Kindheit träumte.
Und es ist gleich, wo sich diese Heimat befindet: ob der Älpler sich nach seinen blauen Bergen sehnt, nach seinen Seen, die darinnen gebettet sind, der Küstenbewohner nach dem Meere, der Städter nach dem hohen, grauen Hause, in dem seine Wiege gestanden: die Liebe zur Heimat ist dieselbe, tief im Herzen eingewurzelte. Ob es ein grauer, nordischer Himmel oder ein tiefblauer südlicher ist, der sich über der Heimat wölbt, wir lieben ihn, wir lieben sie. –
Da, wo die Werra durch die Thüringer Lande ihre Wellen geschwätzig und schnell über Gestein und durch tiefe Wälder eilen läßt, liegt nahe einer kleinen Stadt eine Mühle im Tal. Schützend umgibt sie eine Reihe hoher Pappeln. Hinter dem zweistöckigen Hause liegt ein Obstgarten voll knorriger, schiefstehender Bäume.
Im Frühling lockte die warme Sonne dort die ersten Veilchen hervor. Dann trippelte ein kleines Mädchen barfuß, im feuerroten Röckchen, die zwei blonden Zöpfe steif geflochten, durch die Küche in den Obstgarten. Das war ich selbst, die Liesel, das jüngste meiner Geschwister.
Ich kauerte mich dahin, wo ich das blaueste Fleckchen gesehen hatte, und raffte mit beiden Händen die Veilchen zusammen.
Daß ich die Hälfte Gras und Blätter hatte, störte mich nicht. Tell, unser großer Hofhund, trottete mir nach. Mein rotes Röckchen mußte ihm überall leuchten; er knurrte, als wenn er sagen wollte: »Ich bin auch da!« und streckte seinen Körper, der größer war als ich selbst, neben mir in das Gras.
Ich war auf einer Mühle aufgewachsen, wo die Kühe in den Ställen brummten, die Pferde wieherten, die Hühner mir über die Kinderfüße gelaufen waren, ich kannte keine Furcht vor Tieren. Tell, der schwarze zottige Tell, war mein ganz besonderer Freund, dem mein ganzes kleines Herz gehörte. Auch später, als ich verständiger wurde, blieb ihm diese Liebe aus den Kindertagen erhalten; noch heute denke ich an den wahrhaft tiefen, einschneidenden Schmerz, den ich empfand, als er eines Tages tot in seinem Korbe lag. –
»Tell, das sind Veilchen!« sagte ich und hielt ihm eine Handvoll unter die Nase. Mit sehr innigem Verständnis blickte er bald mich, bald die Veilchen an. »Siehst du, das wird ein Strauß für Großmama!« erklärte ich ihm und fing an, die einzelnen Blümchen aneinander zu fügen. Er blinzelte mich an; er und ich waren ja des alten Großmütterchens Lieblinge, ihre treuen, nie ermüdenden Lauscher, wenn sie Märchen erzählte, und ihre stolzen Begleiter, wenn sie ein kleines Stückchen spazieren ging. Sie zählte bald achtzig Jahre, die Mutter meines Vaters, und ihr einziger Spaziergang war bis zum alten Friedhof, der nicht sehr weit lag.
Als sie immer älter wurde, reichten ihre Kräfte nicht mehr aus; dann kam sie nur bis zu einem Fleckchen, wo einige Baumstämme übereinander lagen, und dort setzte sie sich hin. Ich sehe sie noch, die alte Frau in ihrer Thüringer Tracht, das bunte Kopftuch fest um die weißen Haare gelegt, mit dem runzelvollen alten Gesicht, aus dem die braunen Augen noch so jugendlich frisch blickten. Sie war stets bis zur Peinlichkeit sauber gekleidet, oft glitten ihre alten, faltigen Hände über die schwarzseidene Schürze.
Tell und ich liefen neben ihr her, setzten uns zu ihr, und ich blickte sie mit großen, ehrfurchtsvollen Augen an.
Mein Vater war der Besitzer der Rittersmühle, welche die ganze Umgegend mit Mehl versorgte. Tag und Nacht ging es klipp! klapp! In der großen Stube, wo der Vater und die Burschen arbeiteten, – alle waren weiß vom Mehl, – duftete es so eigentümlich, so kräftig und rein nach Korn. – Draußen trieb die Werra das alte, grünbemooste Rad. Wie oft habe ich dort gestanden und aufgepaßt, wie es brausend in das Wasser tauchte und wie die Tausende von Tropfen dann von oben herabrieselten! Eine hölzerne, breite Brücke führte von dem schmalen Fußwege herüber aus den Hof, den rund im Halbkreis Wohnhaus, Scheune und Ställe umgaben. Ein uralter steinerner Tisch, rund wie ein Rad, stand vor dem Wohnhause, dahinter rankten sich die Rosenstöcke in die Höhe; die vollen roten Rosen lugten gerade in die Fenster der Staatsstube. Diese war für uns Kinder – ich besaß noch zwei ältere Brüder – eine Art Kirche. Wir betraten sie stets mit andächtigen Augen, denn sie öffnete sich fast nur, wenn das Christkind darinnen seine Geschenke aufgebaut hatte. Die Möbel waren mit weißen Bezügen verhüllt, die wir nie zu lüften wagten. In einer Ecke stand ein Glasschrank, fast ganz mit Porzellan gefüllt. Da gab es Tassen und Kannen, Teller und Gläser, Figuren, Wachsblumen, alles durcheinander. An den Fenstern hingen schneeweiße Vorhänge, aber wegen der stets heruntergelassenen Rouleaus herrschte ein dämmeriges Licht in dem kühlen Raume. – Daneben lag ein Stübchen, das sah freilich anders aus! Die Fenster waren immer offen, damit – so meinte Großmutter – Licht und Luft, die schönen Gottesgaben, herein könnten. Blumen blühten, sorgsam gepflegt, Sommer und Winter auf den Fensterbrettern; im Sommer stand Großmutters Ledersessel am Fenster, im Winter an dem alten grünen Kachelofen. –
Überall im ganzen Hause hörte man das Klappern der Mühle, es hatte sich ja mit dem ersten Schrei gemischt, den wir Müllerskinder ausgestoßen, war gleichsam unser Wiegenlied gewesen. Wenn das Rad einmal stillgestanden hätte, so wären wir wohl alle starr vor Schrecken gewesen, es wäre uns gleichsam der Lebensodem ausgegangen. Und doch ist diese schreckliche Stunde gekommen, wo die liebe, alte Melodie, die Rad und Wasser gesungen, verstummt ist, um spät erst wieder zu erwachen …
Wie oft geschah es, unzähligemal, daß die Wellen der Werra über einem der Müllerskinder, mich mit einbegriffen, zusammenschlugen! Die arme Mama bekam trotzdem jedesmal einen neuen Schreck, wenn die Kunde von einem unfreiwilligen Bade an ihr Ohr drang. –
Mutter war eine eigenartige, sinnige Natur, äußerlich eine kleine, blonde Frau, häuslich, tüchtig und doch keine der Frauen, die förmlich untergehen in den tausend Sorgen des Haushalts. Es blieben ihr noch viele Stunden, die sie schönen Künsten, besonders der Musik, widmete. Sie spielte Klavier, aber nicht mit jener verblüffenden, beängstigenden Fingerfertigkeit, die das heißersehnte Ziel so vieler Spieler ist, die Töne rieselten nicht unter ihren Fingern, aber sie erklangen so weich, so innig, als fließe ihre ganze weiche Seele hinein.
O die traulichen Abende, wenn es still auf dem Hofe war, über den hohen Pappeln der Mond heraufstieg, durch die offenen Fenster linde Frühlingslust hereindrang!
Großmutter, ihre Enkelin auf dem Schoß, saß in der Sofaecke, Papa am Fenster, Mama am Klavier.
›Wellenrauschen‹, so hieß das Stück, das sie spielte. Es war wohl schon alt; sie spielte so leise, daß man meinte, die Wellen, welche draußen vorbeirauschten, wären die echte Begleitung, so ineinanderschmelzend erklang es. –
Dann sank der Abend immer tiefer herunter, klipp! klapp! machte die Mühle, klipp! klapp! ›Schlaf, Herzenskindchen, mein Liebling bist du‹, spielte die Mutter, ›mache die blauen Guckäugelein zu‹ … Aber Großmutter und Enkelin waren so still in ihrem Eckchen, sie schliefen. –
Es kam ein wichtiger Tag für mich: ich wurde in die Schule geführt! Papa kaufte mir eine große Zuckertüte, und deshalb erschien mir die ganze Schule sehr rosig.
Zum erstenmal trat ich als selbständiges kleines Menschenkind aus, mußte dem Herrn Lehrer meinen Namen sagen: »Elisabeth Ferner von der Rittersmühle!«
Bald hatte ich Schulfreundinnen, von denen ich alle Tage einige mit in die Mühle brachte. Da begann nun ein tolles Leben, überall tummelte sich die ausgelassene Schar Buben und Mädchen in jugendlichem Übermut. Bald saßen wir, Schuhe und Strümpfe ausgezogen, hinter der Mühle am Ufer und ließen unsere Füße in das Wasser hängen. Ein andermal stiegen wir auf den Heuboden und kletterten auf den Balken herum; tief unten lag das duftige Heu, in das wir uns manchmal versteckten.
Und die Liesel war überall vornan, ich kannte ja jeden Winkel in der Mühle. Zum Entsetzen des Vaters und seiner Arbeiter erschienen wir sogar manchmal in der Mühlstube, stellten uns hin und guckten zu, wie das Korn zu Mehl verwandelt wurde. Wenn aber endlich unsere Anwesenheit lästig wurde, so jagte uns Papa hinaus, und mit weithin hörbarem Gepolter suchten wir uns ein neues Feld der Tätigkeit.
Mutters Milchkammer, sie war noch verschont geblieben bis jetzt! Also geschwind hinein! Ah, da war's schön kühl in der heißen Sommerszeit, und die vielen blitzblanken Kübel voll Milch, auf welcher die dicke Sahne lag! Unglaublich, aber wahr: beinahe die sämtlichen Finger leckten an der Milch herum! Doch das Verlockende sollte nicht allzulange genossen werden! Das Verhängnis nahte in Gestalt der Küchenbeherrscherin Elise. Mit einem Ruck hatte sie die nur angelehnte Tür geöffnet und stand nun da, anstatt des zweischneidigen Schwertes eine der uns so heimatlich bekannt erscheinenden Weidenruten in der Hand! Kein Entrinnen schien möglich; aber arme alte Elise, die Bösewichter entkamen doch sämtlich deinen rächenden Händen, bis auf Bäckers Ernst; er heimste, obwohl unschuldig, denn er hatte nicht genascht, die Prügel für uns alle ein!
Armer Ernst! Er war ein dicker kleiner Kerl gewesen, der nicht so eidechsenartig schnell hatte fliehen können. –
Seit ich in Anneliese, der Tochter eines Kaufmanns im Städtchen, eine ›Freundin‹ hatte, vernachlässigte ich meine Großmutter sehr. Manchmal aber, wenn ich allein war, steckte ich den Kopf zu ihrer Tür hinein. Da saß mein Großmütterchen, still und friedlich. »Nur herein, du wildes kleines Ding, hast ja deine alte Großmutter ganz vergessen!«
Ich flog an ihren Hals. War ich bei unseren Spielen wie ein wilder Junge, so war ich hier oben ganz Mädchen.
»Ich glaube, ihr seid zu wild und betrübt eure Mutter,« sagte die Großmama, »warum kommt ihr nicht manchmal herauf zu mir? Ich erzähle euch eine schöne Geschichte!«
Das lockte. »Was denn für eine?«
»Ein Märchen, Liesel!«
»Ach, ein Märchen! Von der Elfenkönigin, bitte, Großmama, und von Nixen und Zwergen, alles muß dabei sein!«
»Gewiß, Kind!«
»Ach, du bist gut! Und wir dürfen doch alle kommen?« fragte ich mit strahlenden Augen, »Ernst, Max und die Anneliese? Aber – nur, wenn's regnet, gelt, Großmutterle?«
Sie lächelte und nickte. O du wilde, stürmische Jugend, du bist nur an das Zimmer zu fesseln, wenn der Regen in Strömen fließt!
Ich war überglücklich; so lange hatte ich mir kein Märchen mehr von Großmutter erzählen lassen. Und wie sehr liebte ich doch die Märchen!
Wenn die Dämmerung kam, saß ich auf Großmutters Schoß. Dann erschloß sie dem lauschenden Kinde die goldene Märchenwelt. Das bescheidene Stübchen in der Mühle ward zum Feenpalast, wo die Elfen an schneeweißen Tischchen saßen, von goldenen Tellerchen aßen und aus silbernen Becherchen nippten. Oder die liebliche Gestalt des Dornröschens erschien, oder Schneewittchen bei den Zwergen, oder Aschenbrödel, das die Linsen aus der Asche lesen mußte, wobei ihm aber seine Täubchen halfen, so daß es doch zum Königsball gehen durfte! –
Ich wünschte ganz im stillen, es sollte regnen. Lange saß ich heute bei der Großmutter, dann hörten wir Tellerklappern; es war Abendbrotzeit, und ich führte sie hinunter.
»Morgen erzählt uns die Großmutter ein Märchen!« berichtete ich.
»Da will mein wildes Töchterchen wirklich einmal stillhalten?« meinte Papa. Ich nickte ihm zu und verzehrte mit Behagen meinen Mehlkloß. Bei uns in der Mühle gab es solche nämlich jeden Tag, und vielleicht sind wir deshalb alle so stark und groß geworden.
Die Jungen hatten aufgehorcht. Hans war bereits in dem Stadium, wo er Indianergeschichten las, und fragte: »Kommen Wilde drin vor?« worauf er tüchtig ausgelacht wurde. Er hatte heute seinen Unglückstag! Aber Not läßt große Entschlüsse reifen. Unser Hans wurde nachdenklich und plauderte leise, was uns doch verboten war, mit Fritz. Nach Tisch zogen sie mich ins Vertrauen. »Liesel, kannst du ordentlich schweigen?«
»Furchtbar!« bestätigte ich.
»Fritz und ich, wir – gehen heimlich nach Amerika!«
Ich sank bald in die Knie vor lauter Hochachtung.
»Ist's wahr?« fragte ich mit großen Augen.
»Sicher!« Fritz nickte, und Hans bog den Kopf zurück.
»Aber die Eltern?«
»Sie werden schon von uns hören!« meinte Hans großmütig.
»Aber habt ihr denn Geld?«
»Jeder einen Taler und sechs Groschen!« antwortete er, »ich habe noch einen Dreier mehr!«
»Dann freilich!« sagte ich seufzend; ich sah meine beiden Brüder bereits über das Weltmeer segeln. »Und die Indianer?« fragte ich erschreckt.
»Wir töten sie und bringen dir einen Skalp mit!« Ich konnte den Reiz dieses Geschenkes nicht recht begreifen, fühlte mich aber im stillen doch hochgeehrt durch das Vertrauen meiner Brüder. Nach Amerika! »Es liegt wohl weit?« fragte ich respektvoll.
»Sehr weit, da unten, du weißt, Liese, sehr unten!«
Ich nickte ernsthaft, obwohl mir die Sache sehr dunkel war. Tröstend sagte ich: »Ich bettle mir von Elise Äpfel und Brot, das nehmt ihr mit, denn ihr müßt doch essen!« Die beiden waren voll Eifer; sie holten sich den ›Lederstrumpf‹, und die roten Köpfe verschwanden ganz in dem Buch.
Ich bewunderte den Mut der Tapferen! Aber das hinderte mich nicht, mich sehr auf die Erzählung der Großmutter zu freuen. Am andern Morgen, als ich erwachte, war mein erstes, den Vorhang ein wenig zur Seite zu schieben. Hurra, es regnete! Nicht in großen Tropfen, nein, in zarten, langen, zahllosen Wasserstraßen. Der Himmel war einförmig grau. Beim Morgenkaffee in der Wohnstube sagte ich den Brüdern, daß sie Ernst und Max für heute nachmittag bestellen sollten, ich wolle es Anneliese sagen. Sie steckten ihre Brote ein, ließen die Regenschirme stehen und gingen zur Schule.
Es regnete richtig weiter und weiter, ein echter Landregen, der tagelang anzuhalten schien.
Die Werra war gestiegen, und ihre Fluten waren gelb; die Wege waren überschwemmt, auf dem Hofe hatten sich große Pfützen gebildet, in denen die alte Ente mit ihren Jungen herumwatschelte. Die Hühner schienen das Wetter nicht zu lieben, sie hatten sich in ihre Ställe zurückgezogen. Eine Henne saß melancholisch auf der obersten Sprosse der Hühnerleiter. Tell lag in seiner Hundehütte, selbst ihm war es zu naß, um einen kleinen Ausflug zu machen. – Ich kniete auf einem Stuhl und hatte die Nase platt an die Fensterscheibe gedrückt, nach unseren Gästen ausschauend.
Mutter hatte erleichtert aufgeatmet, als sie Gewißheit hatte, heute und vielleicht auch die nächsten Tage würde Ruhe im Hause herrschen.
Unerschrocken pilgerten Max, Ernst und Anneliese der Mühle zu. Es sollte etwas erzählt werden, das war einmal zur Abwechslung ganz schön. –
Ein Weilchen später hatte Großmutter ihre Gäste um sich versammelt.
In Thüringen ist es gar nichts Außergewöhnliches, wenn mitten im Sommer ein Feuer im Ofen prasselt. So war es heute auch. Gar traulich spielten die Flammen auf dem Fußboden; einförmig pochte der Regen an die Scheiben; wir hatten uns dicht nebeneinander auf das alte, steiflehnige Sofa gesetzt, und Großmutter lehnte in ihrem Stuhl am Ofen. Als endlich Stille bei uns eingetreten war, begann sie:
»Es war einmal ein kleines Mädchen, das in einem sehr reichen Hause lebte. Es hatte sein eigenes Stübchen, sein schönes Bettchen, wo es auf blauseidenen Kissen lag. Aber es war nicht glücklich, obwohl ihm niemand etwas zuleide tat. Es war so viel allein. Der Vater war Kaufmann, er hatte eine große Fabrik, in der er den ganzen Tag war, nur des Abends kam er zum Essen. Dann freilich küßte er sein Töchterchen zärtlich. Die Mama war eine sehr vornehme Dame; sie stand erst um elf Uhr auf, dann kam sie in einem schneeweißen Spitzenschlafrock und küßte ihre kleine Frida. Aber nach ein paar Minuten ging sie doch wieder, und am Nachmittag fuhr sie aus zu ihren Bekannten. Hatte das Kind gehofft, die Mama würde am Abend bei ihm bleiben, so hatte es sich arg getäuscht. Da kam die Mama hereingerauscht, über ihr buntes Seidenkleid war ein großer Pelzmantel gelegt. Flüchtig küßte sie die kleine Frida, und ein paar Minuten später hörte diese den Wagen fortfahren.
»So war es auch heute gewesen. Frida kniete auf einem Stuhl und blickte betrübt auf alle ihre Spielsachen, die ihr doch so gar keine Freude mehr machten. Da lehnte die große Balldame steif aus dem Sofa, die blauen Puppenaugen starr und unbeweglich. Unten hatte Frida ein Tischchen gedeckt, kleine Tassen hingestellt und die andern Puppen herumgesetzt. Es war eine stattliche Anzahl und sehr bunt. Da saß eine kleine Bäuerin aus dem Elsaß, die hatte eine große, schwarze Schleife auf dem Kopf. Daneben war eine aus Bayern, eine Miesbacherin, mit dem grünen Hütchen und dem Mieder. Neben der Elsässerin saß ein Soldat; er mußte wohl Offiziersrang haben, denn er hielt den Kopf sehr steif. Neben der Miesbacherin lehnte ein blonder Junge, dessen Nachbarin ein reizendes Püppchen im blauen Kleidchen war.
»Frida blickte hinüber. ›Seid ihr langweilig,‹ dachte sie, ›eßt und trinkt doch, was ich euch gebe!‹ –
»Frida aß ihre Suppe, und eine Viertelstunde später lag sie in ihrem Bettchen, allein wie alle Abende. Sie fror, zog die blauseidene Decke hoch herauf, und doch war ihr der Kopf so heiß! Sie legte sich auf die Seite und weinte. Dabei blickte sie durch die Stäbe ihres Gitterbettchens ins Zimmer auf die Puppengesellschaft, die noch gerade so steif dasaß. Ein rosiges Licht, das von der verschleierten Lampe ausging, war über das ganze Zimmer ausgegossen. – Lange sah das kleine Mädchen hin, da schlug es vom Turme der nahen Kirche zehn. Als der letzte Ton langsam verklungen war, sah Frida zu ihrem grenzenlosen Erstaunen, daß ihr sehnlicher Wunsch in Erfüllung ging: die Puppen lebendig wurden! Der Offizier streckte und dehnte sich, was doch in Gesellschaft gar nicht fein war. Die Elsässerin hatte ganz recht, wenn sie ein Stückchen wegrückte und ihrer Freundin aus Miesbach zuflüsterte: ›Er ist gewiß kein richtiger Offizier, Nandl!‹ Nandl sagte, daß ihr die ganze Gesellschaft sehr einerlei wäre, denn sie hätte vor allen Dingen großen Hunger.
»Unsere kleine Frida war jetzt so glücklich! Sie lächelte immer, rührte sich gar nicht und blickte mit Freude und Stolz auf ihre geliebten Puppen. Jetzt begann die Nandl die winzigen Täßchen mit Kaffee zu füllen. Suzette, die kleine Himmelblaue, war aus Paris, tat sehr vornehm und ließ sich von Nandl bedienen. Eva, die Elsässerin, ärgerte sich darüber und sagte: ›Suzette, Sie können doch auch helfen, geben Sie dem kleinen Jungen sein Essen!‹
»›Das fände ich auch sehr hübsch!‹ schaltete der Offizier ein.
»›Ich bediene niemand!‹ sagte Suzette schnippisch, raffte ihr Kleidchen zusammen und setzte sich ein Stück entfernt auf ein Fußbänkchen.
»›Meine Damen!‹ rief da der Offizier, er drehte an seinem schwarzen Schnurrbart und war sehr lustig, ›meine Damen, zanken Sie sich nicht! Lassen Sie uns lieber Kaffee trinken! Bitte, Fräulein Eva,‹ – das war die Elsässerin, – ›reichen Sie die Sahne herum!‹
»Sie tat es und sagte: ›Peter, gib deine Tasse her! Suzette, Sie bekommen nichts! Hier, Nandl, hast du ein Stück Kuchen! Bitte, Herr Leutnant, der ist für Sie!‹
»›Beleidigen Sie mich nicht, Eva aus dem wiedereroberten Elsaß! Ich bin Hauptmann!‹
»›Weiter nichts?‹ fragte Suzette sehr schnippisch. Sie ärgerte sich, daß sie vom Tisch fort war, denn sie hatte Hunger, und es sah gar so appetitlich aus, wie sie alle aßen und tranken.
»Die Balldame erschien auch, verneigte sich vor allen und setzte sich auf den leeren Stuhl von Suzette. Nandl schmeckte es herrlich.
»›Es ist oft so schrecklich knapp!‹ sagte sie. Die andern lachten. ›Wie gern tränke ich einmal wieder Bier!‹ Frida, als sie das hörte, nahm sich vor, morgen eine sehr reichliche Tafel für ihre lieben Puppen zu decken.
»›Lassen Sie uns ein wenig tanzen!‹ schlug Eva vor. ›Es ist so langwellig!‹
»›Wo Offiziere sind, ist es nie langweilig!‹ sagte Suzette. Der Hauptmann war darüber so glücklich, daß er sogleich hinging und mit einer tiefen Verbeugung die kleine Pariserin zum Tanz aufforderte. Eva spielte eine Polka. Die Balldame und Nandl tanzten miteinander, und Peter, der Junge, leckte die Zuckerdose aus.
»Und wie leise und hübsch erklang Fridas Puppenklavier! Diese war ganz entzückt, sie liebte jetzt ihre Puppen über alles.
»›Meine Damen, nehmen Sie schnell Platz, es ist sogleich Zeit, sich der Ruhe wieder hinzugeben!‹ rief der Offizier. Die Balldame setzte sich auf das Sofa, Nandl war vom Hauptmann an ihren Platz geführt worden. Eva und die Pariserin nahmen ihre Sitze ein, und mit dem ersten Glockenschlage, der ertönte, war die ganze Puppengesellschaft mäuschenstill und rührte sich nicht mehr.
»Frida schlief fest und träumte weiter von ihren Puppen. Am andern Morgen war sie sehr glücklich und lustig, was alle sehr in Erstaunen setzte. Sie küßte und herzte ihre Puppen und unterhielt sich mit ihnen!«
Großmutter schwieg und blickte uns lächelnd an. Es war stockfinster geworden, aber der Strahl des Feuers aus dem Ofen spielte doch über alle hin. Klipp! klapp! machte die Mühle dazu.
»Weiter!« sagte Ernst mit seiner tiefen Stimme.
»Bekommen die Puppen nun mehr zu essen?« erkundigte sich Anneliese.
»Der Hauptmann muß die Nandl heiraten!« sagte Hans.
»Das alles erfahrt ihr morgen abend,« meinte Großmutter, »für heute ist's genug!«
Wir sprachen am andern Tage viel von der kleinen Frida, und des Abends im Dämmerstündchen saß das lauschende Völkchen wieder auf dem Sofa bei der Großmutter. Sie begann:
»Zwei Abende danach sah es ganz anders in dem schönen Zimmer der kleinen Frida aus. Auf einem Tischchen standen Arzneiflaschen, ein alter Herr kam von Zeit zu Zeit und beugte sich mit besorgtem Gesicht über das Bettchen mit den blauseidenen Kissen. Darinnen lag Frida und war sehr, sehr krank. Ein Eisbeutel war auf ihre Stirn gelegt. Neben dem Bett saß die Mama und weinte.«
Wir blickten alle mit sehr großen Augen die Großmama an. Wie war das alles so verändert! Wo war die lustige Puppengesellschaft? Und die arme, kleine Frida, muß sie sterben?
Großmutter fuhr fort: »Frida hatte gebeten, ihr sehr viel zu essen zu bringen, nicht für sie selbst, aber für ihre Puppen! Und die Köchin hatte dem kranken Kinde auf des Arztes Befehl so viel gebracht, als es nur wollte: Eier, Kuchen, Äpfel, Schokolade und, als Frida es wünschte, sogar einen Krug Bier.
»Wieder war es Abend, und wieder schlug es vom Turme zehn.
»›Sie schläft!‹ sagte der Arzt leise zu Fridas Mutter.
»Diese schlich davon, denn sie war sehr müde, und legte sich auf ein Sofa im Nebenzimmer.
»Frida wandte sich auf die Seite, wo sie wieder durch die Stäbe auf ihre Puppen sehen konnte. Jetzt wurden sie lebendig, Suzette blickte mit großen Augen den Offizier an. Er war auch sehr überrascht.
»›Sie haben sich ja so schön gemacht, mein Fräulein!‹ sagte er.
»Die Nandl war wieder eifrig dabei, das Essen herzurichten.
»›Aber heute müssen wir unsere Herrin loben!‹ sagte sie und guckte auf alle Schüsselchen, ›sehen Sie nur, meine Herrschaften, was es Gutes gibt! Wer will Schokolade?‹
»›Ich!‹ sagte Peter. Er bekam solche und ließ sie sich schmecken. Der Hauptmann reichte den Kuchen herum, dann goß er aus dem kleinen Krug der Nandl Bier ein. Darüber war die Pariserin böse. Eva aß so viel Schokolade, daß es ihr übel wurde.
»Da ging die Tür auf, und der alte Arzt trat ein.
»›Was meine Puppen jetzt wohl machen werden,‹ dachte Frida.
»Sie erstaunte sehr, daß diese sich durchaus nicht stören ließen. Frida wußte nicht, daß der Arzt das nicht sehen konnte.
»Als er wieder gegangen war, sagte Eva: ›Unsere Frida ist krank, ich glaube, das war der Doktor!‹
»›Hu, wie schrecklich,‹ rief Suzette, ›ich fürchte mich!‹
»›Warum?‹ sagte Nandl, der alle Ziererei schrecklich war, ›der tut Ihnen nix!‹
»Der Hauptmann dachte nach, ob es nicht besser sei, er heirate die Nandl, statt Suzette, wie er erst gedacht hatte.
»›Unsere arme Frida!‹ sagte Peter, ›ist sie schon im Himmel?‹
»›Nein, aber die Engel werden kommen, sie zu holen!‹ sprach da auf einmal jemand, der bis dahin geschwiegen hatte. Alle guckten hin, Frida auch; es war der Ofenschirm.
»Fing denn alles an zu sprechen?
»›Woher wißt Ihr das?‹ fragte der Hauptmann.
»Der Ofenschirm klappte mit seinen blechernen Füßen und sagte:
»›Man nennt mich Sie, merken Sie sich das! Ich weiß, daß unsere Herrin sterben wird!‹
»Die Puppen glaubten ihm nicht recht.
»›Warum sind Sie so stolz?‹ fragte Nandl den Ofenschirm. – ›Sehen Sie denn nicht, daß ich lackiert bin?‹ rief dieser. – Da waren die Puppen sogleich still, nur der Hauptmann lächelte.
»Mit einem Male ging die Tür auf, viel Licht und viel Glanz kam herein, es waren weiße Engel, die hereinschwebten. Mehr und immer mehr! Kamen sie, um Frida zu holen?
»Ein süßer Duft von Blumen kam mit den schönen Engeln ins Zimmer. Die Puppen waren erschrocken und hatten sich dicht zusammengesetzt. Von fernher erklang eine himmlische Musik.
»An Fridas Bettchen standen der Arzt und die Mutter.
»›Lieber Gott, sie wird sterben!‹ sagte Nandl, und die dicken Tränen liefen ihr die Wangen herunter, alle Puppen weinten mit; der Hauptmann suchte sein kleines rotseidenes Taschentuch und trocknete allen der Reihe nach die Augen.
»Da trat zuletzt noch ein wunderschöner Engel ein. Als er erschien, wichen alle scheu zurück. Er war ganz schwarz gekleidet, es war der Todesengel!«
Großmutter schwieg, und sie mußte wohl schweigen, denn mit einem Schrei war ich aufgesprungen und zu ihr geflogen.
»Sie darf nicht sterben, Großmutter, bitte, bitte!« rief ich schluchzend und barg mein Gesicht in ihrem Schoß.
»Meine Liesel!« Zitternd sagte es die alte Frau und streichelte mein Haar. Dann fuhr sie fort, während ich bei ihr blieb:
»›Ich werde mein armes Kind nie mehr allein lassen, Gott, nimm es mir nicht!‹ So betete die arme Mutter. Und o Wunder, als der Todesengel das gehört hatte, flog ein Lächeln über sein trauriges Gesicht. Alle blickten auf ihn, es war ganz still. Da, mit einem Male wandte er sich ab, und leise mit der Hand wie zum Abschied winkend, schwebte er zur Tür hinaus.
»›Gerettet!‹ sangen die weißen Engel und verließen das Zimmer.
»›Gerettet!‹ sagte Nandl und lachte, die andern Puppen lachten auch.
»›Gerettet!‹ sagte der Arzt, und es schlug elf vom Turme. Frida machte die Augen auf.
»Ihre Mama beugte sich über sie und küßte sie so lange, so zärtlich.
»›Mama, ich habe viele Engel gesehen!‹ sagte Frida.
»Die Mutter plauderte mit ihr, bis sie wieder einschlief. Sie ist gesund geworden und ein sehr glückliches Kind!«
»Großmutter!« rief Fritz schnell, »und wenn sie nicht gestorben ist, so lebt sie heute noch!«
»Vielleicht!« sagte die Großmutter und lächelte.
Da fiel mir blitzschnell ein, daß sie Frida hieß, und ich rief: »Du warst es selbst!«
Sie lachte nur und sagte nicht ja und nicht nein. Später erfuhr ich, daß sie ein Stückchen ihrer eigenen Kindheit uns in Märchenform erzählt hatte. –
»Großmutter!« sagte ich nachdenklich, »ob der schöne Todesengel zu allen kommt?«
»Gewiß, meine Liesel, wer weiß, wie bald er einmal deine alte Großmutter holt!«
»Nein, nein!« rief ich und hielt sie fest, »noch lange, lange nicht!« –
Die Tage vergingen, Hans und Fritz liefen mit strahlenden, manchmal auch etwas nachdenklichen und verlegenen Gesichtern herum.
»Liesel, daß du schweigst!« befahl der Ältere, »du bekommst zwei Skalpe!«
»Sehr fein, ich freue mich!« Aber es war mir gar nicht so. Eine Angst war über mich gekommen, das schreckliche Geheimnis drückte mir bald das Herz ab. Was werden die armen Eltern sagen? Ich wagte am Sonntag gar nicht mehr, die Mutter anzusehen. Und sonderbar, es schmeckten uns dreien zum erstenmal die Mehlklöße nicht!
»Morgen!« stand in den ängstlichen Gesichtern geschrieben.
Ich schlief nicht und war mehrmals nahe daran, alles zu sagen.
Am Montag früh – es war Bußtag im Lande und deshalb keine Schule – packten Hans und Fritz ihre Bündel, natürlich heimlich. Ich ließ mir Äpfel geben, dann ging ich zu Elise in die Küche und bat um ein paar große Butterbrote. Sie gab sie mir mit erstauntem Gesicht. Dann sah ich noch, wie sie eine junge, schöne Gans zusetzte.
»Die erste, Liesel, in dem Jahre; wird ein delikater Braten, dazu Kartoffelklöße!« sagte sie.
O, wie schade, das war das Lieblingsessen unserer Jungen! Wenn sie nur die Gans nicht noch röchen, das wäre ein gar zu harter Abschied für sie! Doch nein, es kam kein Bratenduft, als sie das Haus verließen, vorsichtig, einer nach dem andern, jeder sein Vermögen bei sich.
Die Mühle klapperte wie stets, der Vater schritt über den Hof, sein Anzug weißbestaubt, die Mutter begoß ihre Blumen, niemand achtete weiter auf die Jungen.
Nur ich sah sie, und zwar – vom Kuhstall aus! Dorthin hatte mich die Angst getrieben. Ich stand auf einem Holzschemel, wie ihn die Mägde zum Melken der Kühe benutzten, und guckte durch das trübe, halberblindete Fensterchen. Meine Seufzer wurden von dem Brüllen der behaglichen Wiederkäuer übertönt.
Ich sah, wie Hans sich wendete und von der Brücke aus der heimatlichen Mühle einen sehr wehmütigen Abschiedsblick sandte, ebenso machte es Fritz, der blaß war und sich heimlich ein paar Tränen aus den Augen wischte. Dann vereinigten sich die beiden Auswanderer, ich sah ihre Köpfe ein wenig über die Stachelbeerhecken ragen, eilig schritten sie vorwärts. Ich guckte, bis ich sie nicht mehr sah, dann kletterte ich von meinem Schemelchen herunter, setzte mich darauf und weinte in mein blaues Schürzchen hinein zum Herzbrechen.
Meine armen Eltern! Die Großmutter! Die guten Brüder, wie weit sind sie jetzt schon fort! Wann einmal werden sie die Mühle wiedersehen? Da sind wir vielleicht schon alle so alte Leute wie die Großmutter!
Oder es werden Bären und Wölfe kommen und die Brüder fressen!
Ich schluchzte bei dem Gedanken an die Raubtiere nur noch mehr.
Eine halbe Stunde mochte vergangen sein; ich hörte in der Ferne einen Zug pfeifen, da saßen die armen Brüder drinnen, und morgen waren sie schon bei den Skalpen! Ich stand auf und schlich zur Hintertür des Stalles hinaus. O, wenn ich doch auch mit ihnen gegangen wäre! Ob ich sie wohl noch einholen könnte?
Ich raffte mein Röckchen hoch, was doch gar nicht notwendig war, und lief über die Wiesen in weitem Bogen, bis ich über ein Brückchen der Werra auf unseren gewohnten Wiesenweg kam.
Mit fliegenden Zöpfen schoß ich dahin, denn wie weit, weit waren meine Brüder von mir, o so weit!
Da – ich blieb wie angewurzelt stehen und rührte mich wohl fünf Minuten nicht, so starr war ich vor Erstaunen!
Da saßen auf einem unserer Plätzchen in den Ästen einer Weide meine beiden – Brüder, die Bündel eröffnet neben sich, jeder ein Butterbrot verzehrend! Ich träumte nicht, nein, sie waren es wirklich! Endlich bemerkten sie mich und machten höchst verlegene Gesichter.
»Liesel, du? Was willst du denn?«
»Ich – ich, ach, ich wollte euch noch schnell sagen, daß wir heute die erste Gans essen, mit Kartoffelklößen!«
Gans und Klöße! Die beiden Auswanderer tauschten sprechende Blicke, Seufzer wurden laut, atemlose Stille.
»Fritz!«
»Hans?«
»Wir gehen lieber nicht nach Amerika!« platzte der Ältere los.
Mit einem Freudenschrei fiel Fritz dem Bruder um den Hals. Ich setzte mich zu den beiden mir wiedergeschenkten Brüdern und betrachtete sie mit strahlenden Augen.
»Hast du auch richtig gesehen?« erkundigte sich der vorsichtige Hans.
»Es war eine Gans, verlaß dich auf mich!«
Als die Mittagsglocke ihr Läuten über den Wiesengrund schickte, ging das Kleeblatt aus der Mühle höchst befriedigt der Heimat wieder zu. Selten hat uns etwas so geschmeckt wie an diesem Tage die erste Gans, diesmal keine Retterin des Kapitols, aber eine Retterin aus großer Herzenspein. –
* * *
Es war gut, daß die Brüder nicht nach Amerika gesegelt waren, sie konnten das Vergnügen einer Wasserfahrt bequemer haben: unsere Mühle stand unter Wasser, d. h. der Hof war überschwemmt. Die ungeheuren Regen, die tagelang angehalten hatten, hatten die Werra aus ihren Ufern treten lassen. Breite, gelbe Wellen wälzten sich über die Wiesen und Wege. Wir Kinder waren aufs höchste vergnügt, denn es war unmöglich, die Schule zu besuchen. Die Kinder aus dem nächsten Dorfe und wir aus der Rittersmühle waren entschuldigt.
Obwohl ich sehr gern zur Schule ging, glaubte ich doch in den Jubel der Brüder mit einstimmen zu müssen. Für Vater und Mutter waren es Martertage, an denen sie ihre Drei vom Morgen bis zum Abend um sich hatten. Die Jungen fanden es für angebracht, möglichst beizeiten aufzustehen. Um drei Uhr hörte man sie bereits in ihrem Zimmer rumoren. Arme Mutter, wir haben ihr oft den Kopf heiß gemacht!
Ich nahm mich einmal wieder meiner sehr vernachlässigten Puppen an. Eigentlich ging es mir wie der kleinen Frida: ich liebte sie nicht, weil sie immer dieselben dummen Gesichter machten. Aber seit Großmutters Erzählung blickte ich sie doch mit anderen Augen an.
Ich nahm zwei der schönsten, denen weder Arme noch Beine fehlten, und ging zur Großmutter.
Diese begrüßte mich mit Freuden, und ich setzte mich auf den Fenstertritt. Sie hatte die Bibel vor sich und ein wenig darin gelesen.
»Großmutter,« erzählte ich ihr, »weißt du, ich möchte einen Luftballon haben, so groß wie deine Stube.«
»Und was willst du damit machen?«
»Ich setze mich hinein und nehme meine Puppen mit. Dann fliegen wir in die weite Welt, und meine Puppen werden lebendig und sind meine Kinder!«
Großmutter lächelte zu dem törichten Kindergeplauder.
Als es dämmerte, setzte sie sich an das Fenster, ich kletterte auf ihren Schoß, und wir blickten hinunter auf den Hof. Wasser, überall Wasser. Wie eine Insel im See stand unser Haus. Großes Gelächter klang herauf, dann erschienen die Jungen, bis an die Knie im Wasser watend.
»Ich will auch auf den Hof!« sagte ich und war nicht mehr zu halten. Bald plätscherten die gelben Wellen über meine Füße.
Mutter sah es und rief mich hinein: »Aber, Liesel, du bist doch ein großes Mädchen, willst du nicht vernünftig sein?«
Ich horchte auf; ich ein großes Mädchen? Ich kam mir sehr sonderbar vor und wollte nicht einsehen, warum ich vernünftig sein sollte. Aber ich blieb doch im Wohnzimmer bei Mama sitzen, welche beschäftigt war, einen Riß im Kleide ihrer wilden Tochter zu nähen. –
Der Himmel klärte sich auf, sein leuchtendes Blau erschien wieder. Langsam versickerte das Wasser im Erdboden. Der Hof kam wieder zum Vorschein, drüben tauchte das Wiesengrün, noch ein wenig vom Schlamm befleckt, wieder auf. Tell sprang vergnügt herum, die Hühner erschienen vorsichtig auf der Leiter. Die Ente mit ihren Jungen wackelte herbei, und endlich war die Werra wieder in ihrem gewohnten Bett. –
Wir wanderten zur Schule, wo wir viel nachzuholen hatten, Anneliese und Ernst trabten wieder zur Mühle. So schwanden die Monate. Der Sommer reifte die Früchte, sie wurden eingesammelt. Der Herbst kam, die Äpfel fielen vom Baume, und unsere Obstkammer füllte sich mit der duftenden Frucht. Eine solche Obstkammer hat ihren gar eigenen Reiz. Ein süßer Duft strömt durch das Schlüsselloch. Man stellt sich auf die Zehenspitzen, streckt das Näschen an die Öffnung und riecht. Dann kommt auf vieles Bitten die Mutter mit, öffnet, und man steht plötzlich zwischen Bergen von rotbäckigen Äpfeln.
»Such dir den schönsten aus!« Und die Liesel guckte prüfend um sich. Der schönste? Eine schwere Wahl.
»Mutter, sie sind alle die schönsten!« bemerkte ich sehr weise, aber endlich entschloß ich mich doch zu einem.
Wie rasch ist eine Kinderhand gefüllt, wie schnell ein kleines Herz befriedigt, ein Kinderauge strahlend gemacht! –
Herbststürme zogen über den Thüringer Wald. Die Tannen bogen sich im Winde. Um unsere Mühle brausten sie auch, die Stürme, gar melancholische Weisen singend. Im Ofen prasselte das Feuer, wir saßen alle beisammen, rasch sank schon die Nacht herein.
Hans und Fritz sprachen nie mehr von Amerika, und ich war um meine Skalpe gekommen.
Manchmal klopfte es noch am späten Abend; irgendein Wanderer, oft war's ein Müllerbursch, begehrte Einlaß. Die Mühle hatte ein gastlich Dach, sie fanden alle ein Obdach, für welche die Welt keines hatte. O die bittere Armut!
»Papa,« erkundigte ich mich dann manchmal, »hat der Mann kein Bett zu Hause?«
»Mein Kind, er hat kein Zuhause!« sagte der Vater ernst.
Kein Zuhause! Herzzerreißendes Wort! Leben, so liebeleer! – Ich bat Papa, den Mann für immer in der Mühle zu behalten. Er lächelte: »Dann wäre bald kein Platz mehr für uns!«
Aber die Armen bekamen ihr Nachtlager, ihr warmes, gutes Essen. Die alte Elise war die treue Helfershelferin, sie füllte die Teller bis zum Rande, wenn es hieß, einen armen Magen zu befriedigen. Mutter schnitt dann noch dicke Stücke Brot und Speck dazu, das gab man den Weiterziehenden mit auf den Weg. Waren die Kleider gar zu zerrissen, so wurden die abgetragenen vom Vater geholt. »Vergelt's Gott!« war der Abschiedsgruß der Beschenkten, und manch ein Segenswunsch aus dankbarem Herzen mag der Mühle nachgesandt worden sein. Den Zehrpfennig erhielten sie aus ihnen unbekannter Hand: es war Großmutter, welche gebeten hatte, auch ihren Teil beisteuern zu dürfen. »Was ihr einem der Ärmsten getan, das habt ihr mir getan!« Dieses Bibelwort ward getreulich bei uns befolgt. –
Das schönste aller Feste zog heran: Weihnachten! O traute Weihnachten, die wir in der Mühle feierten! Nirgends kann es schöner, weihevoller gewesen sein, als in der einsamen Mühle am rauschenden Fluß. Ringsum Schnee, alles weiß, darüber weithin der flimmernde Sternenhimmel gespannt.
Ich hatte mir zum Erstaunen aller nichts gewünscht als einen lebendigen Ziegenbock! Aber lebendig muß er sein, hatte ich der Mutter mit flehenden Augen versichert.
»Was willst du denn mit einem Ziegenbock tun?« fragte Papa erstaunt.
Ich sagte schnell als Antwort: »Die Buben wünschen sich den Wagen dazu! Dann wollen wir spazieren fahren!«
»So schreibe es dem Christkindchen,« sagte die Mutter; »wenn es deinen Wunsch nicht zu töricht findet, so wird es ihn dir schon erfüllen! Aber soll es dir sonst nichts bringen, keine Puppe?«
»Nein, nichts! Ich habe alles, aber bitte, nur einen Ziegenbock mit richtigen Hörnern, und ganz lebendig muß er sein!«
Ich bat die Mutter um Briefbogen und Kuvert, sie gab mir beides. Mit fieberhaft glühenden Wangen setzte ich mich, einen langen Bleistift in der Hand, auf mein bekanntes Schemelchen in dem Kuhstall. Dort glaubte ich am ungestörtesten zu sein, um an das heilige Christkind zu schreiben. Die Wiederkäuer guckten mit ihren runden, großen Augen zu. Einzelne Kühe lagen kauend am Boden, andere standen.
Ich kaute auch, – an meinem Bleistift. Die Adresse, mit großen Krakelbuchstaben, hatte ich fertig: »An das heillige Kristkinnd in Hihmel.«
Aber die Überschrift! Der Herr Lehrer hatte uns gerade neulich gesagt, daß man an alle Leute, vor denen man großen Respekt hätte, »hochgeehrt« schreiben müßte. Aber das Christkind war doch auch heilig! So schrieb ich:
»Hochgehehrtes, heilliges Kristkinnd!« O weh, die Überschrift allein füllte schon die erste Seite! Auch hatte ich so fest mit meinem Bleistift aufgedrückt, daß ein Loch in das Papier gekommen war.
Aber noch einmal schreiben, das war zuviel für ein kleines Ding, welches erst das Notwendigste schreiben kann! Freilich hatte ich schon etwas gelernt, ehe ich in die Schule kam.
Ich dachte lange nach und blickte dabei einer schwarzgefleckten Kuh gerade in die Augen. Darüber fiel mir ein, daß die armen Kühe doch so gar nicht wissen, wenn Weihnachten ist. Tell bekam ja einen Teller voll Würste, mein kleines, schneeweißes Kätzchen süßen Rahm anstatt Milch, und Kuchen dazu, aber die Kühe hatten nichts.
Es wurde schon dämmerig; das kam, weil in dem Stall so kleine Fensterchen waren, und blickte man durch die trüben Scheiben, so sah man es wirbeln in Millionen weißer Flocken, es schneite.
Das Christkind! Es flog gewiß schon in seinem goldenen Wagen zur Erde herab und bekam meinen Brief nicht mehr!
Schnell schrieb ich nun, aller Orthographie ins Gesicht schlagend:
»Bite, libes Kristkinnd! Verkies nicht, das ich dig ser bitte, ich will ein lependig Zigenbock mit tzwei hörnern! Ach, bite! Deine dankbahre Liesel in der Rittersmühle.«
Lustig und vergnügt über meinen Brief lachend, weil er so wohl gelungen war, verließ ich den Stall, um mich wieder in menschenwürdigere Umgebung zu begeben.
»Hast du geschrieben?« fragte Mutter. Ich nickte.
»So lege den Brief heute abend auf das Fensterbrett. Wir wollen sehen, ob ihn das Christkind morgen früh geholt hat!«
Als ich am Abend zu Bett ging, öffnete ich das Fenster und schob vorsichtig den Brief hinaus. Dann guckte ich an den Himmel und sagte laut: »Hier ist der Brief!« Vorsichtig schloß ich das Fenster wieder und blickte dann noch einmal hinaus, wo ich den weißen Brief glänzen sah. Ich glaubte ganz bestimmt, in der Nacht etwas rauschen gehört zu haben; das waren die goldenen Flügel Christkindchens gewesen! Am andern Morgen war mein erster Gedanke der Brief. Ich öffnete das Fenster und sah, daß er weg war und – was war denn das? – da lag ja ein wenig goldener Staub! Ich wurde glühend rot vor Freude, und mit schüchternem Blick langte ich danach. Er klebte an meinen Fingern fest. Mir ward ganz weihevoll ums Herz. O heiliges Christkind! Da steht verschämt ein kleines Müllerskind und blickt voll Andacht auf den Goldstaub, den du bei deinem Flug zur Erde verloren hast! Noch trübt kein Zweifel an deinem Dasein das vertrauensvolle, gläubige Kinderherz! Wenige Weihnachten später, da hatte man mir den Glauben an das Christkind genommen, einen rührend poetischen Glauben, den man so lange wie möglich in jeder Kinderseele erhalten sollte. –
»Mütterchen!« verkündete ich der Eintretenden, »denke dir, der Brief ist richtig fort!« Ein Lächeln flog über Mutters Gesicht. Sie sagte: »Nun bete fleißig, sage auch dem Knecht Ruprecht, daß du brav warst, dann wird das Christkind schon deinen Wunsch erfüllen!«
Der Knecht Ruprecht! Vor ihm hatte ich gewaltige Angst. Wie gruselig war aber auch die Gestalt, die vor das zitternde kleine Mädchen trat! Pelz und eine hohe Mütze, derbe Handschuhe, ein langer weißer Bart! Mit tiefer Stimme fragte er mich: »Liese, warst du stets brav?«
Ich kroch in Mutters Rockfalten, denn alle meine Sünden fielen mir ein. »Ich habe manchmal genascht!« beichtete ich. Er sagte: »Das war sehr schlecht von dir! Was hast du sonst noch verbrochen?« – »Weiter nichts!« schluchzte ich. »Sie war brav!« sagte Mutter und streichelte mich. Da griff er in seinen großen Sack und warf eine Menge Äpfel und Nüsse in die Stube. Dann trabte er fort. Die Jungen hatten kichernd dem Knecht Ruprecht geantwortet, denn sie wußten sehr gut, daß unter dem Pelze unsere – Elise gesteckt hatte! –
Der heilige Abend kam. Vom Morgen an hatte es geschneit, so daß am Abend alles weiß war. Dann schneite es nicht mehr, wurde aber so bitterkalt, daß der Schnee zu knistern begann und unter den Tritten knirschte.
In der guten Stube brannte heute ein Feuer in dem Kachelofen. Wir Kinder hörten es knistern, als wir an der Tür vorbeihuschten. Wir waren heute sehr einträchtig, die gemeinsame freudige Erwartung stimmte die Gemüter friedfertig. Aber die Zeit verging doch so langsam, der Zeiger rückte so träge vorwärts. Da glaubte Fritz, die Sache beschleunigen zu müssen, trat auf den alten Ledersessel, der gerade unter der Uhr stand, und schob den Zeiger um eine halbe Stunde vorwärts. Bald erregte dieser Eingriff in das Rad der Zeit vollständige Aufregung.
Mutter steckte den Kopf zur Tür herein: »Was, schon sechs?«
»Das ist nicht möglich, es hat vor kurzer Zeit erst voll geschlagen!« hörten wir Elisens Stimme.
Trotzdem hatte Fritz seinen Zweck erreicht, man beschleunigte jetzt alles. Bratenduft kam aus der Küche und mischte sich mit dem Tannenduft, der das ganze Haus durchzog. Ich saß zusammengekauert auf der Ofenbank, die Arme um die Knie geschlungen. Am Tisch saßen die Brüder, flüsternd erzählten sie sich ihre Erwartungen. Man ließ uns ohne Lampe im Wohnzimmer sitzen, wo es ganz finster war. Nur aus dem Ofen fiel ein heller Schein, und bei diesem hatte Fritz den Zeiger vorgerückt. –
Endlich erklang die bekannte, nur einmal im Jahre ertönende Klingel von oben! Keiner von uns dreien rührte sich. Befangen schwieg alles. Da ging die Tür auf, Mutter kam und führte mich an der Hand. Und dann – aus dem finsteren Zimmer kommend – blendete doppelt, was ich nun sah: den lichtergeschmückten Baum. War das noch unsere kühle, nach Moder duftende gute Stube, jetzt von Weihnachtsglanz und -duft erfüllt?
Großmutter saß auf dem Sofa und blickte mit feuchten Augen in den Weihnachtsjubel hinein. Ist's das letztemal, daß sie ihn sieht? Sie denkt wohl um Jahrzehnte zurück, wo ihr Gatte noch bei ihr war, wo der blonde Junge, der jetzt als Mann neben ihr stand, strahlend die Eltern zu seinem hölzernen Schaukelpferd führte. – Wie muß es im Herzen aussehen, wenn man so alt ist wie Großmutter?
Endlich standen wir bewundernd vor unseren Plätzen, aber wo war der Ziegenbock? Heiße Tränen stiegen in meinen Augen auf, Christkindchen hatte gewiß meinen Brief nicht mehr erhalten.
Da ging der Vater hin und öffnete weit die Tür in Großmutters Stube, die daneben lag. Ein Rollen von Rädern, und herein trollte – mein Ziegenbock, einen kleinen Korbwagen ziehend! Ich war außer mir, stürzte hin und umschlang mit beiden Armen den ganzen Ziegenbock. Hinter mir drein kamen die Jungen, ich mußte mich in mein kleines Gefährt setzen, Hans ergriff die Zügel, Fritz setzte sich hinten auf, und unter dreistimmigem Hurra kutschierten wir um den Christbaum herum. Die Eltern und die Großmutter sahen belustigt zu.
Aber es kamen auch ernste Augenblicke. Mutter hatte für diesen Abend mit vieler Mühe das Klavier heraufschaffen lassen, und als sich der Jubel ein wenig gelegt hatte, der Ziegenbock, nachdem er gehörig gequält worden, in seinen Stall geführt war, setzte sie sich an das Klavier und spielte einige Akkorde. Die Müllerburschen samt Elise waren gerufen worden, und wir Kinder stellten uns hinter Mutters Stuhl.
Mit unseren hellen Stimmen sangen wir das schöne Weihnachtslied: ›Stille Nacht, heilige Nacht‹. Nach und nach stimmten alle mit ein, deutlich hörte man Vaters Stimme, Mutters weichen Alt heraus. Heimlich war ich an eines der Fenster gegangen und hatte es ein bißchen geöffnet, das Christkind sollte doch auch etwas davon hören! Wie schön sah unsere Mühle aus, als wir später, warm verhüllt, mit dem Vater in den Hof hinuntergingen. Er wollte uns den brennenden Christbaum hinter den Fenstern zeigen. Wir gingen ein Stückchen die jetzt kahle, aber mit Schnee verzierte Stachelbeerhecke hinein.
»Siehst du, Liesel, unsere liebe, alte Mühle?« sagte Vater und hob mich auf seinen Arm. Unvergeßlich schönes Winterbild voll süßen Friedens! Da lag wie ein Gemälde die Mühle im Tal, in Schnee gebettet.
In den Eiszapfen flimmerte es, aus den hellerleuchteten Fenstern strahlte klar der Christbaum. Man sah durch die weißen Vorhänge Gestalten sich hin und her bewegen. Und über dem friedlichen Bilde der kühle, dunkle Sternenhimmel. Gespenstisch ragten die kahlen Zweige der Weiden in die Luft, aber sie waren wie mit Zucker bestreut. Neben uns murmelte die Werra. – –
Anneliese und Ernst fanden sich natürlich in den Feiertagen ein, die erstere mit einer neuen feuerroten Schürze, die Puppe in der Hand, Ernst mit Helm und Säbel ausgerüstet. Seltsam genug war diese kriegerische Ausstattung für das gutmütige dicke Gesicht, und gar friedliebend blickten die blauen Augen unter dem Helm hervor.
Nun wurden Spazierfahrten gemacht, mein Ziegenbock kam fast nicht vom Wagen. Da Schnee lag, wurde aus letzterem ein Korbschlitten gemacht. Mit Tüchern bepackt, sausten wir stolz die einsamen Wege dahin.
Schneite es in gar zu dichten Flocken, so hatte der Ziegenbock Zeit, in seinem Stall über den Segen des fallenden Schnees nachzudenken, denn wir waren in der Weihnachtsstube. Dort hausten Anneliese und ich vor der Puppenküche, rührten Eierkuchenteig ein, backten winzigkleine Kuchen und traktierten mit diesen Herrlichkeiten unsere Brüder. Aber das war kein dankbares Geschäft, denn ein Bissen, und vom Kuchen war nichts mehr zu sehen. Ob dieser Geschwindigkeit sehr erstaunte Gesichter unsererseits. Daß wir uns in der Weihnachtswoche infolge übergroßen Genusses von Süßigkeiten stets die Magen verdarben, war eine ebenso feststehende Tatsache wie das im Sommer häufige Verschwinden in der Werra.
Am letzten Tage des Jahres wurde der Baum geleert, die Zuckersachen wurden verlost, die goldenen Nüsse geknackt, und dann verschwand der Christbaum, all seines Schmuckes beraubt.
Das neue Jahr brach an, auch über die einsame Mühle hin hallten die zwölf letzten Glockenschläge. Im Weihnachtszimmer war es finster, Tannenduft schwebte noch wie ein Abschiedsgruß darinnen.
Wir Kinder schliefen fest ins neue Jahr hinein, ebenso Großmutter, nur die Eltern saßen beisammen, trauliche Stunden des Alleinseins genießend, die ihnen selten gegönnt waren. – –
* * *
Die Jahre gingen, die kleine Liesel im kurzen roten Röckchen war ein gewaltiges Stück in die Länge geschossen. Ich war mit meinen dreizehn Jahren schon meiner zierlichen, kleinen Mutter über den Kopf gewachsen, was ich fast täglich mit großem Stolz verkündete, so oft ich nur in Mamas Nähe kam.
»Körperliche Größe ist gar nichts!« behauptete Hans, »hier muß es sitzen!« und zeigte auf die Stirn. Ich war nicht artig, sondern drehte ihm mit einem verächtlichen Achselzucken den Rücken, und zwar mit solcher eidechsenartigen Geschwindigkeit, daß meine beiden Zöpfe flogen. Da sie sehr lang waren, erwischte Hans einen und zog mich daran. Das ereignete sich oft, überhaupt waren meine Zöpfe stets willkommen, mich daran zu zupfen. Geschah dies sanft, so war es ein wohlwollendes Zeichen, zogen aber die Brüder daran, so schrie ich oft vor Schmerz auf. Ich war ein echt deutscher, angehender Backfisch mit fröhlichen blauen Augen, dicken roten Backen, schlicht gescheiteltem blondem Haar. Alle halben Jahre war ich zu Mutters Verzweiflung aus den Kleidern gewachsen. Dann wurde erfindungsreich ein Streifen unten angesetzt. Waren die Ärmel zu kurz, so gab es Samtmanschetten, was mich sehr stolz machte.
Mit Anneliese, die klein, schwarz und zierlich war, verkehrte ich nach wie vor. Die Kinderfreundschaft wuchs mit uns.
Im Hause von Bäckers Ernst gingen wir aus und ein, als gehörten wir hinein. Mit einem nie zu stillenden Hunger ausgestattet, waren uns die freigebig verteilten, duftenden warmen Semmeln eine wahre Erquickung. Und welch guter Duft erfüllte das Bäckerhaus! Wer mit den richtigen Augen blickt, sieht ein Stückchen Poesie in jedem Winkel. Mit welcher Begeisterung begleiteten wir manchmal den Bäckermeister an den großen Backofen! Da glühte aus dem runden Ofenloch ein Feuermeer, dessen Flammen zuckten. Mit geschickter Geschwindigkeit wurden die Brote hineingeschoben und kamen mit goldbrauner Kruste wieder heraus. Die lange Liesel bog den blonden Kopf am weitesten vor. Es war ja aber auch Mehl aus der Rittersmühle, was da verbacken wurde! Ernst war sehr stolz, daß wir uns in seinem Elternhause so wohl fühlten. Als sei er der Besitzer selbst, traktierte er uns mit allem möglichen. Und wie leuchtete er vor Stolz, schnitt die Meisterin einen großen Heidelbeerkuchen an und gab uns Stücke davon! Einmal geschah auch ein großes Malheur, infolgedessen wir auf einige Zeit ängstlich das Bäckerhaus mieden. Es war in einer Freiviertelstunde, und wir hatten Appetit nach frischen Semmeln. Ernst nahm Hans, Fritz, Anneliese und mich mit. Als wir alle aus dem Semmelkorb zugelangt hatten, schlug Hans vor, die Semmeln auf der Bodentreppe zu verzehren. Gesagt, getan. Wir ließen uns auf den Stufen nieder und aßen. Durch ein Fensterchen konnte man auf die Schuluhr sehen. Mit einem Male schlug es ein Viertel, zugleich hörten wir die Glocke aus dem Schulhause läuten. Es war höchste Zeit!
Mit einem wahren Kriegsgeschrei erhoben wir uns und sprangen die hohe Bodentreppe hinunter. Aber o Schreck, gerade vor der Bodentür lag ein frischer goldbrauner Quarkkuchen, den jedenfalls der Lehrjunge für einige Minuten dort hingelegt hatte. Hans war der erste, der – hineintrat! Da keiner warnen konnte und wir alle im Schuß waren, traten wir alle mit beiden Füßen in den Quarkkuchen! Welches Entsetzen, diese Weichheit unter den Füßen! Ein Rückblick, und kreideweiße Gesichter! Da lag eine zertretene Kuchenleiche, und an unsern Schuhen klebte der süße Quark! Wie Verbrecher, keiner den andern anguckend, schlichen wir hinüber in die Schule. Ernst hatte tränenfeuchte Augen; er ahnte wohl sein Schicksal: daß er für den Quarkkuchen die Prügel einheimsen würde, wie vor Jahren die in der Milchkammer. Als die Schule aus war, rannten wir drei zur Tür hinaus und schlugen den Weg zur Mühle ein. Am andern Tage erst erfuhren wir, daß der Bäckermeister sehr aufgebracht gewesen war und schlagende Beweise seiner Wut gegeben hatte, – armer Ernst!
Aber es wurden täglich neue, gute Quarkkuchen gebacken und verkauft; so geriet der verunglückte in Vergessenheit, und wir Sünder erschienen eines Tages wieder zaghaft im Bäckerhaus, von dem gutmütigen Ernst aufs dringendste eingeladen. Freilich blickten wir stets vorsichtig bei jedem Schritt auf den Fußboden, ob auch kein Kuchen in Lebensgefahr war. –
Noch einen andern Ort im Städtchen gab es, wohin wir gern unsere Schritte lenkten, das war Annelieses Vaterhaus. Es war gar stattlich, stand am Markt und gehörte dem Kaufmann Schilling. Im ersten Stock wohnte die Familie, im zweiten war ein großes Töchterpensionat, im Parterre befand sich der Laden. Eine größere Ehre konnte uns nicht widerfahren, als wenn wir uns in den freien Nachmittagsstunden ein Weilchen in einer Ecke dieses Ladens aufhalten durften. Was war das aber auch für eine kleine Welt für sich! Ein solcher Kaufmannsladen in einer kleinen Stadt enthält nicht nur einen besonderen Verkaufsartikel, – es gibt von allem! Schon das breite Schaufenster enthielt Wunderdinge. Da waren Hüte und Schuhe ausgestellt, Kleider, Wäsche, Handschuhe und Krawatten, aber friedlich leuchtete daneben ein weißer Zuckerhut hervor, brauner Kaffee, Linsen; dabei standen kleine Fläschchen Haaröl, Scheren, Arbeitstäschchen usw. Welche Pracht für unsere Augen! Und nun gar, wenn wir im Laden selbst waren! Da waren die Wände voller Regale, und darauf türmten sich die bunten Kleiderstoffe. An anderen Stellen standen buntbemalte Kannen und Tassen, blaue Gläser, Gießkannen und Kochtöpfe. An einer Seite gab es Zucker, Kaffee und, was uns am meisten reizte, Bonbons. Über dem Ladentisch, auf dem die Wage stand, hingen gelbe Tüten in allen Größen. Es roch und duftete nach allem im Laden, gut und appetitlich. – Ein kleines Stübchen daneben diente zum Kontor, dort saß Annelieses Vater, die Mutter verkaufte.
Wir durften uns still in ein Eckchen setzen und zusehen. Frau Schilling gab uns ein paar bunte Zuckerstengel, welche dankend angenommen wurden. Welche Freude, klingelte die Ladentür und die Käufer kamen! –
Überall ging ich gern hin, hielt auch manchmal ein Ständchen bei der Obstfrau und begleitete mit Vorliebe unsere Elise, wenn sie eine Partie abgerissener Schuhe zu unserem alten Schuster trug. Auch im schlichten Schusterstübchen gab es eine kleine Welt für sich. Da saß am niederen, mit allen möglichen Geräten bedeckten Tisch der weißhaarige Schuster, stets klopfend, aber auch stets freundlich aufblickend, wenn man zu ihm kam. Ein Lehrling saß neben ihm, der sah aber nicht auf, denn er war zu eifrig. War einmal ein kleiner Fehler zu verbessern an einem Schuh, so wartete ich darauf. Elise ging dann, und ich setzte mich auf ein hölzernes Schemelchen. Die Arme um die Knie geschlungen, guckte ich unverwandt den alten Schuster an, sah seinen von der Arbeit gekrümmten Rücken und dachte oft: »Wie viel leistet der alte Mann, und wie lustig lebst du in den Tag hinein!« – Ich sagte das auch einmal zu ihm. Da hörte er auf zu klopfen, sah über die Brille weg mit seinen blauen Augen, die sich einen reinen Kinderblick bewahrt hatten, zu mir hin und sagte lächelnd: »Genieße nur deine goldene Jugend, sie kommt nie wieder! Und so schön wird's auch nimmer wieder, wie's in der Jugend war!«
Seine Stimme zitterte. Durch das kleine Fenster fielen die letzten Sonnenstrahlen auf den alten Mann und mich, die nachdenklich vor sich hinsah.
»Wo habt Ihr denn Eure Jugend verlebt?« fragte ich nach einer Weile.
»Weit fort von hier, Liesel, drunten in der lustigen Isarstadt, in München! Da war's freilich schön! – Siehst du, ich war ein Findelkind gewesen, habe niemals gewußt, was Eltern sind. Im Waisenhause wurd' ich großgezogen, dann hieß es: Geld verdienen. Man gab mich zu einem Schuster in die Lehre, der damals so alt war, wie ich jetzt selber bin. Aber ich war kein Kopfhänger, trotzdem ich allein stand in der weiten Welt. Ich sang den lieben, langen Tag, der Meister war mit mir zufrieden, die Meisterin gab mir genug zu essen und zu Weihnachten einen neuen Anzug, mehr brauchte ich nicht. Unsere kleine Werkstatt war gleich neben der Frauenkirche, den Dom nennen sie's auch in München, da war's gar feierlich, wenn die Glocken läuteten, und ich sah bei der Arbeit gerade durch eine offene Kirchentür hinein, sah die Andächtigen knien, sah den Weihrauch und hörte die Orgel. Da dachte ich oft: der liebe Gott, zu dem wir alle beten, verläßt den armen Findling nicht.
»Und so war es auch. Ich verlebte in aller Armut eine glückliche Jugend. Des Sonntags ging's zu Fuß hinaus in die herrliche Umgebung Münchens. Dort genossen wir den Frühling, lagerten uns im Wald, suchten die ersten Anemonen und Himmelschlüssel, verzehrten unser Stück Brot bei einem Kruge Bier und kehrten am Abend in unser schönes München zurück. Siehst du, Liesel, so geht's in der Jugend, Sorgen kennt man nicht, der Himmel ist allezeit blau, und man denkt, es bleibt immer so!
»So, und da hast du deinen Schuh! Die Strippen sind wieder fest! Fritz, such' ein Stück Papier, und dann zünde die Lampe an!«
Fritz war sehr geschäftig, packte mir meinen Schuh ein und überreichte mir das Paketchen mit verlegener Miene. Dann holte er ein Öllämpchen, goß aus einer kleinen Kanne Öl ein, zog den Docht ein Stück herauf und zündete ihn an. Ich gab dem Alten die Hand, wir waren gute Freunde. »Gute Nacht, Liesel, komm gut heim!« nickte er mir zu.
Als ich draußen vorüberging, sah ich den alten Schuster schon wieder emsig Nägel einschlagen beim Schein des Öllämpchens.
Gedankenvoll ging ich an der murmelnden Werra entlang. Der Abend kam hier in der freien Natur nicht so rasch, als drinnen in den Häusern. Ein fahles Dämmerlicht lag über der Gegend. Des alten Schusters Worte summten mir durch den Kopf: »Es wird nie wieder so schön, als es in der Jugend war.« Eine erste, entfernte Ahnung stieg in der schlummernden Mädchenseele auf, daß einmal Zeiten kommen könnten, wo mir das immer bereite Lachen auf den Lippen ersterben würde, wo mir die Blumen am Wege, die ich hie und da pflückte, nicht mehr wie stete Begleiter meines Lebens erscheinen würden. Ein klein wenig nachdenklich wurde ich, ein Schatten war über die Sorglosigkeit der Jugend gefallen.
Aber lange dauerten solche Stimmungen nicht, sie schwanden, wie der Nebel zerfließt, der sich bisweilen vor die Sonne lagert.
Frisch und fröhlich sang ich im Hause herum, erschien des Tages auch einigemal bei der Großmutter, die fast nicht mehr ausging.
»Wenn ich nur deine Einsegnung noch erleben dürfte!« sagte sie bisweilen und legte ihre feine Hand auf meinen Scheitel. »Wie schön wird das schlichte schwarze Kleid meine Liesel kleiden, meine Enkelin! Und auch in ihr Inneres wird ein heiliger Ernst einziehen, wenn sie zum erstenmal vor Gottes Altar steht!«
Ich blickte ernst zu ihr hinauf. Mir ward schon bei dem Gedanken daran feierlich ums Herz.
»Großmütterchen, erzähle mir, wie war's bei deiner Konfirmation?«
Sie lächelte: »Kind, da war es freilich schön, wenn es auch in den großen Städten nicht so feierlich ist wie in den kleinen, oder gar auf dem Dorfe, wo einer den andern kennt und jeder teilnimmt an den Freuden des Nachbars! Aber es waren doch unvergeßliche Stunden, schon die Zeit vorher. Da hatten wir den Konfirmationsunterricht in der Sakristei der Kirche, wo wir eingesegnet werden sollten. Wie lauschten wir den Worten des Geistlichen, der uns von Gott sprach! Wie liebten wir ihn, den Verkündiger des Wortes Gottes! Siehst du, Kind, da waren wir ernst, und ganz besonders als der große Tag da war und wir reihenweise hinein in die Kirche zogen, die gefüllt von Menschen war! Es ist ein Grenzstein im Leben, die Konfirmation, meine Liesel, ein Grenzstein, wo die Kindheit uns Lebewohl sagt und ein anderes, den Pflichten geweihtes Leben beginnt!«
Ich faltete die Hände und sagte seufzend: »Großmutter, mir ist es oft, als würde ich noch sehr viel Trauriges erleben!« Ich wußte selbst nicht, wie es kam, aber ich weinte vor mich hin. Mit weicher Stimme sagte die alte Frau: »Denke, wenn einmal das Leid kommt, an deine alte, dann längst gestorbene Großmutter, sie hat dir den Rat mit auf den Lebensweg gegeben: Trage alles, und drückt es deine Seele noch so sehr zu Boden, aber hebe stets den Blick empor und vergiß nie, daß es Gottes Wille ist, daß er dir das Leid schickt und daß er diejenigen, welche an ihn glauben, mit unendlicher Güte lohnt!« – Ich nickte still und blickte auf das weiße Haupt der alten, frommen Frau, welcher aller Kummer im Leben das feste Gottvertrauen nicht geraubt hatte.
Der Sommer ging zur Neige, und an einem schönen Herbsttage feierte ich meinen fünfzehnten Geburtstag. Was war aus der kleinen Liesel mit dem kurzen roten Röckchen geworden? Ein langes Fräulein mit halblangen Kleidern stand vor dem Tischchen, auf dem fünfzehn Lichter brannten. Da ich künftige Ostern konfirmiert werden sollte, bekam ich schon einiges dafür geschenkt. Überhaupt fühlte ich nach und nach, daß es mit der Kindheit vorbei war. Die Puppen und Spielsachen waren verschwunden, statt ihrer gab es Bücher, Schulmappen, Sparbüchsen, Nähkörbchen, Federhalter, Wunderknäule. Die Liesel saß hübsch sittsam neben Mutter und strickte. Kleine Pflichten im Hause wurden mir so nach und nach übertragen. Ich kochte den Nachmittagskaffee, deckte den Tisch und stopfte Vaters lange Pfeife. Für meine Brüder nähte ich manch abgerissenen Knopf an, strickte neue Fersen in ihre Strümpfe. Großmutter half ich, so viel ich konnte. Eine Ahnung sagte mir oft, daß ich sie nicht mehr lange haben würde.
Mit der scheidenden Kindheit neigte sich noch etwas seinem Ende zu, die schöne Schulzeit. Ich ging jetzt so gern zur Schule, ich lernte mit Eifer und war stolz darauf, die Erste in der Klasse zu sein. Anneliese saß neben mir. Sie sollte auch mit mir eingesegnet werden, dann aber sollten unsere Wege sich trennen, ich in ein Pensionat kommen! Anneliese, als die von mir Beneidete, durfte zu Hause bleiben, nachdem sie einige Monate bei einer Freundin ihrer Mutter verlebt haben würde. Noch aber waren wir ja beisammen und erfreuten uns dieses Zusammenseins. –
Am Nachmittag meines Geburtstags kam Anneliese mit einem selbstgezogenen Myrtenstöckchen.
»Da,« sagte sie lachend, »mach dir dereinst deinen Brautkranz daraus!«
»Ich werde wohl keinen Mann bekommen!« sagte ich.
»Ganz recht, das glaube ich auch!« meinte Hans.
»Und du keine Frau!« sagte ich. Wir standen neuerdings manchmal auf dem Kriegsfuß.
»Zehn an jedem Finger!« rief er hohnlachend und warf die Tür zu.
»Er ist in den Flegeljahren!« entschuldigte ich ihn. Anneliese lachte, sie hatte eine Vorliebe für ihren lustigen Gespielen. Wie oft erinnerten wir uns der losen Streiche und dünkten uns mit unseren fünfzehn Jahren schon sehr weise!
Wir saßen im traulichen Wohnzimmer, Mutter besserte Säcke für die Mühle aus. Ich stellte die große Kaffeekanne auf den Tisch und holte meinen Kuchen dazu. Der Herbstregen klopfte an die Scheiben. Wir sprachen von vielerlei, denn Mutter betrachtete uns jetzt als Mädchen, mit denen man auch einmal vernünftig sprechen kann.
»Wenn nur Liesel wieder aus der Pension da wäre!« sagte Anneliese.
»Die Zeit wird auch kommen, und wie rasch! Sie vergeht ja viel schneller als wir wünschen!« meinte die Mutter.
»Möchtest du noch einmal so jung sein, wie wir jetzt sind?« fragte ich.
Mutter schüttelte den Kopf. »Nein,« sagte sie, »so viele glückliche Stunden ich auch erlebte, noch einmal möchte ich nicht das alles durchleben!«
Mutter erzählte uns vielerlei, bis es so dämmerig wurde, daß sie die Stiche nicht mehr sehen konnte. Da baten wir sie, etwas zu spielen.
»Liesel, du kannst's ja jetzt besser als ich!« sagte sie.
»Aber ich höre dich so gern, Mama!« Die noch immer jugendliche Gestalt ließ sich am Klavier nieder. Anneliese und ich saßen Hand in Hand. Weich, wie in fernen Kindertagen, klang es an mein Ohr: Wellenrauschen. Ganz leise perlten die Töne, dann wieder rauschten sie, daß man die klaren Wellen zu hören meinte. Als sie geendet, wandte sie sich zu mir: »Und nun möchte ich von dir ein Stück deines Lieblings hören, Kind!« Sie zündete die Lichter an, und bald brausten Klänge durch die stille, einsame Mühle, die in einem genialen Kopf entstanden waren: Beethoven.
Ich wunderte mich oft selbst, woher ich die Kraft in meinen Fingern nahm, woher die Geläufigkeit, denn geübt hatte ich nicht zu viel, aber ich konnte meinen Beethoven spielen und, was mehr wert ist, verstehen. Freilich versank ich in mich selbst, ich wußte nichts mehr von dem, was mich umgab. Verschwunden waren die vier engen Wände, ich sah herrliche Gegenden, Landschaften voll Reiz und Sonnenschein, von einem blauen Himmel überspannt, oder düstere, tiefdunkle Tannenwälder, wo eine einsame Quelle über alte bemooste Steine rinnt, Einsamkeit ringsum. Oder ich sah einen Leichenzug, Blumen über Blumen, hörte Glockentöne, Grabgesang. Wie aus einem Traume erwachte ich dann, und es dauerte eine Weile, bis ich zur Wirklichkeit zurückkehrte. Und diese war ja so schön! Da sah ich die kleine blonde Frau am Tische sitzen, sich mit ihren Söhnen neckend; Anneliese aber lag mit träumerischen, dunklen Augen im Lehnstuhl. Vielleicht hatte sie bei meinem Spiel ähnlich empfunden wie ich. – Es lag ein tiefer Schatz von Gemüt in ihr, ein warmempfindendes Herz; freilich geschah es viel später erst, daß ich einen Blick hineintun durfte. –
Und nun kam eine wunderschöne Zeit für mich; alle Nachmittage saßen wir Konfirmandinnen ein paar Stunden in der Sakristei unserer Stadtkirche. Gottes Wort ward uns gelehrt; lauschend blickte ich zu dem alten Geistlichen auf, dem die innere Überzeugung von dem, was er sagte, einen warmen Glanz über das Antlitz hauchte. Es waren goldene Worte, welche an das Ohr der Jugend klangen! Wer sie sich doch tief eingraben könnte, damit keine spätere Macht sie aus dem Herzen zu verdrängen vermöchte, denn solche Worte bilden einen kostbaren Schatz fürs ganze Leben!
Ich saß in einer der letzten Reihen, durch das Fenster sah ich ein Stückchen Himmel und einige beschneite Nachbardächer. Es war still auf den Straßen, kein Lärm von draußen störte uns, wir hörten nur die tiefe Stimme des Geistlichen: »Die Jahre kommen, und ihr werdet in das Leben eintreten. Hütet euch, daß nicht mit den Weltfreuden, die in euer Inneres einziehen, der Glaube hinauszieht. Fühlt ihr das, dann laßt eure Gedanken sich sammeln, blickt des Abends, ehe ihr die Ruhe sucht, hinauf an das Himmelszelt, und ihr fühlt im Anschauen des weiten Raumes Gottes Nähe und kehrt zu ihm zurück!« –
Solche Worte wirkten nach. War ich sonst nach kurzem, gedankenlosem Gebet eingeschlafen, so trat ich jetzt abends an das Fenster. – Ich hatte mein eigenes Stübchen, das gerade über dem Mühlrade lag. Ein leises Erschüttern entstand dadurch. Aber ich war es gewöhnt und liebte mein schlichtes Stübchen mit den weißen Vorhängen und dem freien Blick über Wiesen und Wald. Da ließ es sich gut träumen und andächtig sein. Gedanken, die mir fremd gewesen, Gefühle, die ich nicht gekannt, stiegen jetzt in mir auf. Ich fühlte ein neues Innenleben, ein stilles Glück der Seele. Von leisem Schauer durchbebt, stand ich am offenen Fenster und achtete nicht der Winterkälte, die auf mich eindrang. Ich blickte mit frommen Augen zum sternfunkelnden Firmament auf, mit gläubig betendem Herzen, und meine Hände falteten sich unwillkürlich, meine Lippen flüsterten leise Worte. Dann, nach langem Schauen, kam der Friede, die innere Seligkeit, ich fühlte mich geborgen und glücklich und glaubte nicht, daß es je anders werden könnte. – Köstliche, unvergeßliche Stunden, wo die junge Seele erwacht und Gott zu erkennen beginnt. Warum bewahrt sich das Menschenherz nicht diese fleckenlose Reinheit des Empfindens, warum schließt sich das Paradies der Kindheit? –
Der Winter ging wieder vorüber, mit Entzücken sahen wir mitten aus dem Schnee die grünen und weißen Spitzchen der Schneeglöckchen gucken und, als so nach und nach der Schnee schmolz, die schwarze Erde wieder auftauchen. Wärmere Lüfte wehten, Vogelstimmen wurden laut, ein feiner, brauner Schimmer lag über den alten Weiden an der Werra. Dann lockte die Sonne immer mehr hervor, zuerst grünten die Stachelbeerhecken. Das konnte ich am besten beobachten, da ich täglich so oft an ihnen vorüberging. Ich war so entzückt über das langentbehrte junge Grün, daß ich mir ein paar Zweige abbrach und in mein Stübchen stellte. –
Immer näher rückte das Osterfest. Hans sollte im Herbst die Universität beziehen, um sich zum Arztberuf vorzubereiten. Fritz, der auch schon konfirmiert war, besuchte noch das Gymnasium.
Mutter war oft ernst, als ob sie Sorgen habe. Doch, fragte ich sie schmeichelnd danach, so wehrte sie lachend ab, und dennoch ward sie gleich wieder ernst.
Auffallend war es mir, daß ein Bursche entlassen wurde. »Ich habe nicht Arbeit genug für alle!« sagte der Vater auf meine Frage. Jetzt sah ich auch, daß die Wagen nicht mehr so hoch mit gefüllten Säcken beladen waren. Ging es rückwärts mit der Mühle? Ich konnte es nicht erfahren, die Eltern in ihrer großen Güte wollten uns nichts von ihren Sorgen wissen lassen, es sollte ja kein Schatten in unsere sonnige Jugend fallen. Wie hätten sie es ertragen, wenn ihr lustiges Kleeblatt bei Tisch die Köpfe gesenkt hätte, wenn wir scheu und schüchtern herumgeschlichen wären und in übertriebener Angst nicht mehr gewagt hätten, uns satt zu essen! Nein, man ließ uns fröhlich sein, war es ja doch schon um vieles stiller geworden, seit wir erwachsen waren und die Kinderfüßchen nicht mehr wie toll durch das Haus jagten. –
Der Palmsonntag war gekommen, der Tag meiner Konfirmation! Mütterchen kam selbst und flocht mir die langen Zöpfe, Seidenschleifen am Ende befestigend. Sie zog mir das schwarze Kleid an und legte mir als ihr und Vaters Geschenk eine goldene Kette um, an welcher ein Kreuz hing. Dann schloß sie mich in die Arme und küßte mich. »Gott schütze dich, mein Kind!« sagte sie leise und ging. – Mit gefalteten Händen stand ich in meinem Stübchen, durch dessen weitgeöffnetes Fenster die Osterglocken klangen. Ich sah eine blumige Wiese, ein von der Sonne vergoldetes Frühlingsbild, einen wolkenlosen blauen Himmel.
»Wie mein Leben,« dachte ich, »Gott, laß es so bleiben, und wenn es doch anders wird, laß mich dieses Tages nie vergessen, wo ich von neuem dein Kind geworden bin.« –
Hans und Fritz brachten mir einen Ring, den sie mir von ihrem Taschengelde gekauft hatten. Sie blickten etwas scheu die Schwester an, die ihnen wohl groß und wie eine Dame erscheinen mochte. – Dann kam unsere alte Elise und legte ein Gesangbuch in meine Hände. Sie drückte mit ihren hartgearbeiteten Händen die meinen und sagte, daß sie die Eltern um die Erlaubnis gebeten habe, mir das Gesangbuch schenken zu dürfen. Ich solle es als Andenken behalten. Ich war gerührt von so viel Liebe. –
Jetzt zur Großmutter! Sie konnte nicht mit zur Kirche.
Als ich eintrat, glitt ihr Blick voll Rührung über mich hin.
»Meine Liesel!« flüsterte sie. Ich trat an ihren Sessel, legte den Arm um ihre Schultern und sagte: »Wie schade, daß du nicht auch mit zur Kirche kannst!«
»Freilich! Aber im Geiste begleite ich dich, mein Kind, Schritt für Schritt, durch die Wiesen bis zur Stadt, über den Marktplatz bis zur Kirche. Ich sitze hier am offenen Fenster, und wenn die Glocken klingen werden, dann weiß ich, daß meine Enkelin vor Gottes Altar steht!«
Sie faßte mit ihren alten, zitternden Händen eine Bibel, gab sie mir und sagte:
»Siehst du, Liesel, wenn ich dereinst nicht mehr bin, dann sei dies ein Andenken für dich. Halte das Buch heilig, die alte Großmutter hat gar oft darinnen gelesen und Trost gefunden. – Und nun geh mit Gott, mein Kind!«
Ihre zitternden Hände suchten mein Gesicht. Unwillkürlich, in tiefster Seele bewegt, kniete ich nieder und legte meinen Kopf in ihren Schoß. – Sie sagte nichts, kein Wort mehr, die alte Frau, und doch fühlte ich, daß sie mich segnete, während ihre Hände auf meinem Scheitel ruhten. –
Ich stand auf, küßte weinend ihren Mund und ihre Hände, nahm die Bibel und ging mit gesenktem Kopfe hinaus.
»Geh mit Gott, mein Kind!« Das waren die letzten Worte gewesen, welche ich von Großmutter hören, dieser Segen der letzte, den sie mir geben sollte: während ich voll heiliger Inbrunst mit all meinen Mitkonfirmandinnen in der Kirche am Altar kniete, während die Osterglocken über die Stadt klangen, saß eine alte Frau am Fenster der stillen, verlassenen Mühle, und mit dem letzten Glockenton mochte das weiße Haupt zurückgesunken sein. Als wir aus der Kirche kamen, fanden wir die Greisin entschlafen. – Mein Konfirmationstag, mein erster Schritt ins Leben, er führte an ein Totenbett! – So feierlich, so schön war's in der Kirche gewesen, ich hatte einen Spruch aus den Psalmen bekommen; als die Feier vorüber war, streckten sich viel liebe Hände mir entgegen, um zu gratulieren. Ich wurde an ein teures Mutterherz gepreßt, von treuen Vaterarmen umschlossen. Dann, als ich mich von Anneliese mit einem langen, innigen Kuß verabschiedet hatte, gingen wir der Werra entlang, der Mühle zu, ich neben Vater, das Gesangbuch in der Hand. Und dann kam das Schreckliche, Elise stürzte auf uns zu: »Die Großmutter ist tot!«
Ich lehnte mich an einen Baumstamm, denn dieses Wort, wie noch keines im Leben an mein Ohr geschallt, hatte mich gelähmt. – Wie furchtbar waren diese Stunden! Mit bleichem Gesicht stand ich da und blickte auf die tote Frau, die noch vor wenig Stunden voll Liebe und Güte zu mir gewesen war.
So verging mein Einsegnungstag, still, voll Weinen und Trauer. Ich legte die goldene Kette ab, und Mutter heftete mir einen Trauerflor ins Kleid. – Jeder ging leise, die Leute in der Mühle, Elise, die Jungen, als wollte man die Ruhe derjenigen nicht stören, die allen im Leben ein Vorbild gewesen war und nun droben in ihrem Stübchen lag, die Hände gefaltet.
Wir konnten in dieser Nacht nicht schlafen, Vater hielt die Totenwacht. –
Viel schwere Stunden folgten noch, als der schmale Sarg gebracht wurde, Kränze kamen, Besuche, bis am dritten Tage unter großer Beteiligung Großmutters sterbliche Reste neben denen ihres Mannes auf dem alten Friedhofe eingesenkt wurden. So war unser trauter Familienkreis seines Oberhauptes beraubt, um ein teures Glied ärmer. –
Mit heiliger Scheu betrat ich nach einigen Tagen das Zimmer der Verstorbenen wieder. Man glaubte, den leisen Atem derjenigen noch zu hören, die hier gelebt. Jeden Augenblick dachte ich, Großmutter müsse zum Vorschein kommen. Es war alles geblieben, wie es zu ihren Lebzeiten gewesen war. Da stand der bequeme Sessel am Fenster, die Blumen, jetzt ihrer Pflegerin beraubt, blühten weiter. – Ich saß im Lehnstuhl, eine schlanke, schwarze Gestalt, und betrachtete das Stübchen, das ich dereinst bewohnen sollte, wenn ich aus der Pension zurückgekehrt sein würde. – O, es sollte alles so bleiben, dort die Kommode aus alter Zeit mit den Porzellanfiguren darauf, das Bücherschränkchen mit den reichen, ausgewählten Schätzen einer guten Literatur; das Tischchen vor dem Sofa, alles, alles sollte so bleiben, hatte mir Mama versprochen, bis ich als Herrin hier einziehen würde. »Großmutter, laß dann deinen Geist auch in mir sein, damit ich würdig bin, deine Erbin zu sein,« betete ich; lange saß ich oben, bis es dämmerig wurde. Furcht kannte ich nicht, wie viele in unserer Gegend, die nicht in den Räumen Verstorbener sein wollen. Wenn man den Toten geliebt hat, so empfindet man kein Grauen vor dem Heim, das er verlassen hat, es ist im Gegenteil, als schwebe sein Geist hier noch um uns. – –
Wenn der Tod in eine Familie eingegriffen hat, dann schließen sich die Hinterbliebenen nur um so enger einander an. So war es auch bei uns. Als die Zeit kam, wo ich fort sollte, bat ich, daß man mich doch erst im Herbst in die Pension schicken möchte. Gern willigten die Eltern in meine Bitte. Der Tod der Großmutter hatte mich angegriffen, meine roten Backen waren verschwunden, ich war ernster geworden.
Die Schule hatte sich auch hinter mir für immer geschlossen. In der Pension sollte von neuem gelernt werden. Ich dachte mit Grauen daran, unter ganz fremden Menschen zu leben, die mir und denen ich gleichgültig wäre. An eine goldene Freiheit gewöhnt, war mir der Gedanke an den Zwang in den Pensionen schrecklich. Und wie würden mich die engen Mauern und Straßen der Stadt berühren! Kein weiter, blauer Himmel mehr über mir, keine Wiesen, kein rauschender Fluß, an dem es sich so schön ruhen ließ! Ja, wäre Anneliese mit mir gegangen, aber so mutterseelenallein! Die Vorsteherin, ein älteres, adliges Fräulein, hatte zwar geschrieben, daß ich Kameradinnen genug fände, aber vorläufig war mir der Gedanke an eine so lange Trennung vom Daheim schrecklich. –
Jetzt kam eine andere Zeiteinteilung für mich, Mutter weihte mich in das Hauswesen ein. Sie war sehr froh, daß der Sommer auf diese Weise nützlich für mich werden sollte.
»Erst mußt du praktische Hausfrau sein, Liesel, dann kommt die Gelehrsamkeit!« sagte sie, und ich ging mit Eifer ans Werk. Da, wo ich als Kind in der Milchkammer Sahne genascht, wachte ich jetzt selbst eifersüchtig, daß niemand anderes als ich den dicken, gelben Rahm abschöpfte. Mit einer blauen Kochschürze angetan, von denen Mutter mir ein halbes Dutzend geschenkt hatte, stellte ich mich neben Elise in die Küche. Unsere Mühlenküche war für mich sehr poetisch. Sie lag zu ebener Erde, durch eine Tür kam man ins Wohnzimmer, die andere, zur guten Jahreszeit stets offen stehende, führte in den Garten. An dem einen Fenster stand ein Kirschbaum, und seine weißblühenden Zweige schmiegten sich an die Scheiben. Brauchten wir Salat, so gingen wir einfach in den Gemüsegarten und holten ihn frisch aus der Erde. Wie gut schmeckte dieser, welches Erdaroma verbreitete er! Und so war es mit allem. Wir bauten alle Gemüse selbst, hatten sogar ein kleines Kartoffelfeld. Mit welch anderem Interesse verfolgte ich jetzt alles, was auf den Tisch kam! Den Kaffee des Morgens hatte ich selbst gebraut, die Sahne abgerahmt, die Butter selbst gemacht. Freilich kam das alles erst nach und nach, es gab manchen Strauß auszufechten, wenn ich unachtsam gewesen war und etwas verdorben hatte. Aber auch welche Freude, hatte ich meine Sache gut gemacht, und man lobte die kleine Köchin.
Und als die Kirschen reiften, die Erdbeeren so verlockend aus ihrem Blätterschutz glühten, die Johannisbeeren sich röteten, das war eine Lust, das herrliche Obst selbst zu pflücken, nicht nur zu naschen, wie in der Kinderzeit, sondern alles hübsch zu sammeln und des Mittags dann eine Schale voll schön geordneter Früchte auf den Tisch zu stellen. Und wie köstlich waren diese stillen Morgen im Hochsommer! Ein klarblauer Himmel, eine lachende Sonne, das frische Grün, die bunten, duftenden Blumen, und ich oft allein auf diesem Stückchen schöner Erde. Dann lehnte ich mich an einen der verkrüppelten Obstbäume und blickte durch seine Krone hinauf oder über den bunten Garten weg, in dem Schmetterlinge in der milden Luft flogen. Mit ganzer Seele empfand ich den Zauber einer solchen menschenleeren, reinen Natur. In der Ferne begrenzte der Wald die grünen Wiesen, und auf der anderen Seite sah man den Kirchturm unseres Städtchens. Scharf zeichnete sich das goldene Kreuz vom Himmel ab. Man hörte des Sonntags die Glocken herüberklingen, ich meinte oft, hier noch andächtiger sein zu können als in der Kirche, hier in Gottes freier Natur, welche der schönste Tempel, vom Himmelsblau überwölbt, ist. –
Anneliese war fort, und ein eifriger Briefwechsel hielt uns nun zusammen. Es war zum erstenmal, daß wir uns schrieben. Die Briefe waren lang, endlos lang, echte Mädchenbriefe, vom Hundertsten ins Tausendste gehend, Versicherungen ›ewiger‹ Liebe und Freundschaft. Anneliese war in der Residenz, einige Stunden mit der Eisenbahn von uns entfernt. Sie beschrieb mir genau das Schloß, die alte Feste, welche auf einem Berge lag, weithin im Lande sichtbar. Auch im Theater war sie gewesen. Mit glühenden Wangen, so schrieb sie, saß sie da und sah zum erstenmal eine Bühne und dann den geheimnisvollen Vorhang sich heben. Sie konnte mir nicht genug erzählen; es war die Oper ›Der Freischütz‹, die sie gehört hatte. – Jetzt verlangte es mich doch auch einmal nach solchen Genüssen, und ich sprach mit Mama davon.
»Das hast du alles, wenn du in der Pension sein wirst!« antwortete sie mir. Ach, in der Pension! Dann war's gewiß kein großer Genuß mehr für mich. –
Anfang September gab es ein großes Wiedersehen: Anneliese stand plötzlich im weißen Kleide, den großen Strohhut in der Hand, auf der Brücke, als ich gerade einen Korb voll Kochbirnen geholt hatte. Korb und Birnen flogen zur Erde, und ich flog in die Arme meiner Freundin. Mit glücklichen Augen betrachtete ich sie, als hätte ich sie jahrelang nicht gesehen. Ihre dunklen, freundlichen Augen mit dem tiefen Blick ruhten auf mir; sie, die Kleinere, war die Besonnenere, und doch sah ich, wie sie sich freute. Ich ragte um Kopfeslänge über sie hinweg. Sie faßte meine langen Zöpfe voller Bewunderung, als habe sie diese noch nie gesehen. Es bedurfte einiger Minuten, bis wir uns wieder aneinander gewöhnt hatten. Ich zog sie ins Haus, wo Mama sie mit herzlicher Liebenswürdigkeit begrüßte. Hans, der im Herbst nach Berlin gehen sollte, war ein großer, schmucker Mensch, den das Wiedersehen mit der hübschen Spielgenossin vergangener Tage ein wenig verlegen machte. Das war für mich ein Gaudium, denn er hatte mich oft geärgert. Aber Anneliese war auch nicht unbefangen, sie blickte zu Boden.
»Wollen Sie nicht Platz nehmen?« fragte Hans und schob Anneliese einen Stuhl hin.
Ich lachte laut auf: »Was, Hans, du sagst jetzt ›Sie‹?«
»Natürlich, deine Freundin ist doch konfirmiert!«
»Dann muß ich aber auch ›Sie‹ sagen, Hans!« meinte Anneliese lachend, »und – nein, das kann ich nicht, es klingt mir zu komisch!«
Wir lachten alle drei, und Mama sagte: »So behaltet als Jugendfreunde das schöne ›Du‹ untereinander, es ist fürs ganze Leben gemütlich und eine Erinnerung!«
Hans stimmte bei, und bald waren wir in bester Unterhaltung.
Anneliese erzählte, und Hans machte Pläne für sein Studentenleben, die mir etwas sehr kostspielig erschienen. Überhaupt war es mir, als hätte er ein wenig Hang zum Leichtsinn. Die Ferner waren vor alters ein freiherrliches Geschlecht gewesen, das aber den Adel abgelegt hatte. Hans schien die größte Lust zu haben, in Berlin diesen Adel, auf den Vater und Großvater keinen Wert mehr gelegt hatten, heimlich wieder neu aufleben zu lassen. Ich hatte einmal eine Visitenkarte mit seinem Namen und der siebenzackigen Krone darüber gefunden. Mama hatte sie zerrissen und gesagt: »Ich will doch hoffen, daß ihm der innere Adel mehr gilt, als dieser ererbte, den wir nicht mehr führen!«
Ich dachte manchmal mit Angst daran, daß Hans die Eltern in Sorge stürzen würde. Sie waren so gut und brachten alle erdenklichen Opfer, um ihm das ersehnte Studium der Medizin – oder war es die Lust am Studentenleben, das ihn zog? – zu ermöglichen. Fritz war anders geartet.
»Ich werde Müller, gehe als Wanderbursche in die Fremde, und wenn ich etwas gelernt habe, dann komme ich wieder!« sagte er.
Und Ernst, der kleine, dicke Ernst? Er wurde, was sein Vater war, Bäcker. Er strebte nicht nach dem Lorbeer der Wissenschaft oder Kunst, er dachte wie Fritz. Die beiden hatten sogar Lust, zusammen auf die Wanderschaft zu gehen. So zerstreute sich alles. Aber noch einigemal waren wir alle fünf doch vergnügt beisammen. Das Schönste, was wir dann als selbsterdachtes Vergnügen genossen, das waren Floßfahrten auf unserer Werra! Vater hatte uns ein Floß gemacht, auf dem wir alle Platz hatten. Aber wir fuhren nicht am Tage, nein, das wäre zu prosaisch gewesen. Wir warteten, bis der Vollmond in voller Klarheit am Himmel stand. Solche Mondscheinnächte, welche ohnehin voll Reiz sind, wußten wir in der Mühle noch mit besonderem Zauber zu umspinnen.
Das Floß lag am Ufer, wir konnten die Zeit kaum erwarten, bis es Abend wurde. Tell, mein alter Tell, von dem ich lange nicht gesprochen und der doch mein steter Begleiter gewesen war, hüpfte an mir hinauf, denn er sollte mitgenommen werden. Er kannte uns alle ganz genau, und seine braunen, treuen Augen redeten eine deutliche Sprache. Er wußte, wenn ich traurig war; dann schlich er schwanzwedelnd um mich, schmiegte seinen Kopf an mich und blickte so treuherzig zu mir auf. Es fehlt den Tieren nur die Sprache, wer aber ihre Sprache versteht, diese stumme, rührende Augensprache, der weiß, wie dankbar Tiere sind, ohne Falsch. – Ich liebte meinen Tell. Er hatte jetzt graue Haare in seinem Pelz, war auch ein bißchen blind geworden, aber ich hätte ihn um nichts in der Welt hergegeben.
Es waren jetzt jene schönen Herbsttage im September, an denen eine beständige Klarheit in der Luft herrscht. –
Endlich wurde es dämmerig, da stellten sich auch Anneliese und Ernst ein, und wir fünf begaben uns, Tell hinter uns hertrottend, nach der Werra. Da der Mond noch nicht nach unserem Wunsch war, lagerten wir uns am Ufer und erzählten uns etwas.
»Wie mag's heut über zehn Jahre aussehen?« fragte Anneliese nachdenklich.
Hans seufzte und sah sie schwärmerisch an.
»Heute ist der zehnte September, merken wir uns einmal diesen Tag, und dann feiern wir ihn über zehn Jahre hoffentlich als frohe, glückliche Menschen zusammen!« rief ich begeistert.
»Ich bin dann schon siebenundzwanzig!« sagte Anneliese.
»Natürlich längst verheiratet!« versicherte Hans galant.
»Und ich?« rief ich.
»Alte Jungfer!« sagte Fritz entschieden.
»Ich muß praktischer Arzt sein!« meinte Hans.
»Ich besitze die Mühle!« fuhr Fritz fort, »oder einen großen Kaufladen.«
»Ich habe Vaters Bäckerei, und ihr kriegt die besten Quarkkuchen!« sagte Ernst.
Wir lachten alle und gedachten des unseligen zertretenen Kuchens.
»Da, der Mond!« rief Anneliese und zeigte nach den Pappeln drüben auf der Chaussee. Richtig, wie schön! So voll, so silberhell kam er heraufgezogen, und jetzt floß das helle Licht durch die Bäume und über den Fluß, daß seine Wellen aufglitzerten.
Wir brachen auf und stellten uns auf unser Floß. Erst schaukelte es bedenklich, namentlich als Tell als ganz dazugehörig noch einen großen Satz vom Ufer herüber machte. Hans und Ernst nahmen zwei Stangen, und nun setzten wir uns in Bewegung. Anneliese und ich, in warme Tücher gewickelt, saßen auf niederen Bänkchen. Tell hatte sich zu meinen Füßen gelegt, Fritz lag der Länge lang am Boden. – Wie schön fuhr es sich! Jetzt kamen wir an der Mühle vorbei. Wie ein Asyl des Friedens lag sie da, die Fenster im Wohnzimmer waren hell erleuchtet. Das Rad war für diesen Abend abgestellt, sonst hätten wir ja der Bewegung des Wassers wegen nicht vorbeifahren können. Neben uns flüsterte der Abendwind in den alten Weiden, leise plätscherte das Wasser um uns.
Ich stimmte die ›Lorelei‹ an, die anderen sangen, teils in zweiter Stimme, mit. O ewig unvergeßliche Stunden voll reinsten Glücks! Poesie, Jugend, junge, keimende Liebe, Natur in voller Pracht, alles, was das Leben schön macht, das genossen wir. Kein Sorgenwölklein trübte noch unseren Himmel; wie ein Rosengarten, in den wir nur einzutreten hatten, lag das Leben vor uns.
Vaterlandslieder wurden angestimmt; kräftig und äußerst beruhigend für die deutsche Nation erscholl es voll heiliger Begeisterung: Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein! Oft noch genossen wir solche Abende, solange uns der Mond ein treuer Begleiter war. –
Dann kam ein trauriger Tag, ich verlor meinen Tell. Er lag in seinem Eckchen und war zu matt, aufzustehen.
»Mit dem wird's bald alle sein!« sagte einer der Burschen und ging pfeifend weiter.
Wie gleichgültig ist meist allen anderen, woran unser Herz hängt!
Ich ging nicht fort von meinem alten, treuen Spielgefährten und ließ ihn in seinem Korbe hinauf in mein Stübchen tragen. Dort setzte ich mich zu ihm und aß und trank nichts. Die Nacht kam; er lag so still, nur die Augen zeigten noch ein mattes Leben.
»Mein armer Tell!« sagte ich und weinte.
Die anderen schliefen längst, der Morgen graute. Da blickte er mich noch einmal mit den alten, treuen Augen an und schloß sie. Er war tot. Ich legte eine Decke über ihn und brach in ein bitterliches Schluchzen aus. Wie einem ein Tier so lieb sein kann! Ich besaß eine Photographie von Tell, und diese habe ich noch heute; genau wie im Leben, so treuherzig und gut blickten mich seine Augen an.
Er wurde feierlich am Ufer der Werra begraben, und ich pflanzte selbst ein junges Weidenbäumchen auf sein Grab. –
Der erste Oktober war da, morgen früh sollte Papa mich nach Leipzig in eine Pension bringen! Ich war bereits angemeldet, in meinem Stübchen der Reisekoffer gepackt.
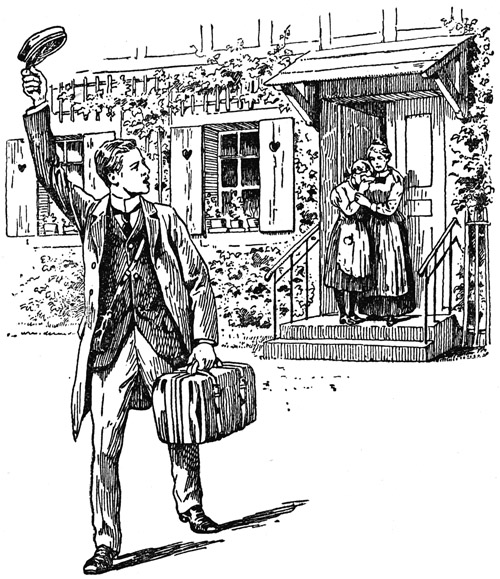
Hans war am letzten September voller Jubel nach Berlin abgefahren. Wie lange hatte die Mutter ihm nachgeblickt! Es war ja das erste Kind, das sie in die Welt hinausließ, noch dazu frei und selbständig! Und wenige Tage später sollte das zweite das Elternhaus verlassen! Das war viel für ein Mutterherz! Wie einsam mußte es in der Mühle sein, kam erst der Winter! Hans war in allem reich ausgestattet worden. Feierlich hatte er gelobt, sich nicht allzusehr von dem Strudel fortreißen zu lassen, sondern fleißig zu lernen. Mit lachendem Mund versprach er alles, umarmte die Mutter, wollte oft schreiben, hübsch Ordnung in seiner Wäsche halten. Lustig die Mütze schwingend, das Handköfferchen tragend, eilte er fort, voll Frohsinn die winkende Freiheit schon in Gedanken genießend.
»Schwesterlein, ade! Grüß mir die Anneliese noch! Werde kein verdrehtes Pensionsäffchen, Liesel!« So hatte er mir noch zugerufen.
»Schreib mir auch, Hans!« hatte ich mit tränenerstickter Stimme geantwortet, dann hatten Mutter und ich uns weinend umarmt. Da zog er fort ins Leben, unser ›Ältester‹, wie wir ihn beide nannten. Was wird es ihm bringen? Wird er halten, was er versprach? Wird er als fertiger Mann zu uns zurückkehren, der sich einen Schatz voll Wissen geholt hat? Oder – o schaudervoller Gedanke – geht er unter da draußen, hält er nicht, was er versprach?
»Es ist hart, gleich zwei Kinder entbehren zu müssen!« sagte Mama.
»Aber warum soll ich auch fort?«
»Weil wir dir das Beste geben, Kind, was Eltern geben können, eine gute Bildung! Sie gilt mehr als alle Schätze, denn sie kann dir niemand nehmen, und sie macht dich frei! Und weil du hier in unserem lieben Städtchen keine Gelegenheit dazu hast, so mußt du fort! Bleibe recht brav, meine Liesel! Hab' immer Gott vor Augen und im Herzen, das muß deine Richtschnur sein im Leben!« –
Die Stunden eilten im Fluge, zum letztenmal saßen Anneliese und ich in meinem Stübchen beisammen, Hand in Hand, fest umschlungen. Wir gelobten uns treue Freundschaft, keine von den vielen, die heute geschlossen werden und morgen vergessen sind.
»Auch in der Not müssen wir einander beistehen, Liesel!« sagte Anneliese, »laß uns wie Schwestern zusammenhalten!«
Sie wollte mir den Abschied leicht machen und malte mir aus, wie schön es doch in einer Pension sei, wie glücklich die jungen Mädchen dort stets seien:
»Eigentlich beneide ich dich! Wenn Mama mich nicht so nötig brauchte, dann würde ich die Eltern bitten, mit dir gehen zu dürfen. Vergiß mich nur nicht über neuen Bekannten! –
»Ich komme nicht an die Bahn, wir wollen hier Abschied nehmen!« sagte sie, als es spät geworden war. Wir lagen einander in den Armen. Ein letzter Kuß! Dann hörte ich ihren leichten Schritt die Treppe hinabeilen, sie noch ein paar Worte mit Mama wechseln. Auf der Brücke sah ich noch ihre Gestalt in flüchtigen Umrissen, dann war sie verschwunden. Das war schon der erste Abschied gewesen! Wie weh tat er! Ich stand am Fenster meines Stübchens. Nach mir sollte Fritz es bewohnen, denn bei meiner Rückkehr in einem Jahre sollte ich ja Großmutters Zimmer haben.
Der Abend verging in traulichem Geplauder, um die Mühle brausten die Oktoberstürme, aber das Abschiedsweh lag doch wie ein Alp auf uns.
Von Hans war eine Postkarte aus Berlin eingetroffen, er suchte nach einer ›Bude‹. –
Ich stieg zum letztenmal hinauf in mein schlichtes Mädchenstübchen und lehnte lange am Fenster, den Kopf an die Scheiben gedrückt. Das Mühlrad rauschte unter mir seine liebe Melodie. Dieselbe hatte geklungen, als ich noch ein Kind gewesen, all die langen Jahre hindurch; ob sie mich auch wieder begrüßen wird, wenn ich dereinst zurückkehre? –
Ich packte noch alles mögliche in meinen Koffer, womit ich dort mein Stübchen schmücken wollte, um es dem der Heimat ähnlich zu machen. Am andern Morgen legte ich als letztes die Bibel von Großmutter in den Koffer und schloß ihn.
Auf dem Hofe stand unser offenes Korbwägelchen, die zwei Braunen davorgespannt. – Der Kaffee wollte heute nicht schmecken, und es fielen Tränen hinein. Fritz hatte mir schon Lebewohl gesagt mit lachendem Gesicht, und doch sah ich, wie der gute Junge sich die Tränen mit der verkehrten Hand abwischte und wie er sich immer wieder nach dem Wagen umguckte, auf dem der Koffer stand.
Im Hausflur küßte ich noch einmal mein kleines, geliebtes Mütterchen und reichte weinend Elise die Hand. Dann stieg ich zu Papa in den Wagen, die Pferde zogen ungeduldig an, fort ging's, am Mühlrad vorbei, über die Brücke. Ich bog mich zurück und nickte und winkte, so lange ich konnte. Wie schnell versank mein Vaterhaus! Jetzt sah ich nur noch einen Schimmer davon hinter den entlaubten Bäumen, noch einmal die Wellen der Werra, dann war's vorbei!
Ich war tapfer, trocknete die Tränen und gab endlich Papa Antwort auf verschiedene Fragen. Wie lieb, wie herzensgut war er! Er erzählte von der Liebenswürdigkeit der Vorsteherin, der Größe der Anstalt, wieviel mir dort Gelegenheit geboten würde, zu lernen! Und wie schnell sei doch ein Jahr vergangen, vielleicht käme auch einmal jemand, mich zu besuchen. –
Es war noch früh am Tage, die Straßen leer. Jetzt fuhren wir an der Kirche vorbei, dort lag des alten Schusters Haus, es brannte schon Licht bei ihm; jetzt kam Schillings Haus. Ich guckte hinauf an Annelieses Fenster, sie schlief gewiß noch, oder weckte sie das Geräusch des Wagens, der über das holprige Pflaster fuhr? Da öffnete sich plötzlich ihr Fenster, Anneliese ward sichtbar und warf mir einen Strauß Astern zu, die gerade in den Wagen fielen. Sprechen konnten wir nicht, aber wir nickten uns zu, solange wir uns sehen konnten. –
Wir saßen in der Eisenbahn, flüchtig eilten die Bilder draußen an uns vorbei. Niedriger wurden die Berge, die Gegend verflachte sich. Papa erklärte mir alles. Ich machte zum erstenmal eine weitere Reise, und die neuen Eindrücke zerstreuten mich doch ein wenig.
Immer näher rückten wir dem Ziel, verschwunden waren die Berge meiner Heimat, wir fuhren schon stundenlang durch die Ebene, Felder rechts und links. Endlich verdunkelte sich der Horizont, der graue Dunst zeigte, daß wir uns einer Großstadt näherten. Wir suchten unser Handgepäck zusammen, und einige Minuten später fuhr mit langem, schrillem Pfiff der Zug in die Bahnhofshalle ein.
»Leipzig! Aussteigen!« riefen die Schaffner und rissen die Türen auf.
Welches Treiben um mich plötzlich, die vielen fremden Gesichter! Gepäckwagen wurden hin und her geschoben, Menschen begrüßten sich bald zärtlich, bald kühler. Als wir hinaus auf die Plattform kamen, stand eine Reihe Droschken da. In eine derselben stieg ich mit Papa. Sie war offen, und so konnte ich alles um mich sehen. Wir fuhren durch schöne Promenaden, an großen Gebäuden vorüber, Theatern, Post, Museum, Universität. Zahlreichen elektrischen Bahnen, Equipagen und Droschken begegneten wir. Ich sah schöne Läden, geputzte Menschen.
Endlich bogen wir in eine ruhigere Vorstadt ein, elegante Villen mit Vorgärten reihten sich aneinander.
»Kaiser-Wilhelmstraße zwölf!« sagte der Kutscher, sich zu uns wendend.
Papa nickte, und wir hielten vor einem schönen, zweistöckigen Hause. Es hatte grüne, jetzt zurückgeschlagene Fensterläden, einen Vorgarten, in dem die Rosenstöcke schon mit Stroh umwickelt waren, während auf einem Beet noch Astern blühten.
›Leopoldine von Reißner‹ stand auf dem glänzenden Schild. Auf unser Klingeln erschien ein Dienstmädchen. Mit dem Kutscher trug sie den Koffer hinein; dann schritten wir in das Haus. Der Eingang war von der Rückseite, und wir sahen einen großen Garten. Eine teppichbelegte Treppe ging es hinauf, dann wurden wir in ein Zimmer geführt. Gerade sahen wir noch, wie ein junges Mädchen hinaushuschte. Dann kam die Vorsteherin. Ängstlich blickte ich sie an; ich hatte mir eine hagere Frau vorgestellt, schwarz gekleidet, mit streng gescheiteltem Haar. Wie anders war diese Dame!
Voll herzgewinnender Liebenswürdigkeit streckte sie Papa die Hand entgegen und küßte mich auf die Stirn. Sie war gerade das Gegenteil von dem Bilde, das ich mir gemacht hatte, klein, stark, mit weißem Haar.
»Elisabeth heißt du, nicht wahr?« fragte sie mich, als wir Platz genommen hatten.
»Ich werde immer Liesel genannt!« berichtete ich offenherzig. Sie lächelte und sagte: »So sollst du hier auch genannt werden, namentlich da du die fünfte Elisabeth bist! Die eine heißt Elise, die andere Lisbeth, die dritte Elsbeth, die vierte mit vollem Namen Elisabeth!«
Sie unterhielt sich mit Papa, sprach über Thüringen, von dem sie begeistert war. Mit einem Male fuhr ich erschreckt zusammen, denn ich glaubte nicht anders, als es brenne: eine laute Klingel scholl in langen Tönen durch das Haus.
»Es ist die Kaffeestunde!« sagte die Dame und erhob sich. »Ich werde Liesel ihr Zimmer zeigen und muß Sie bitten, einige Minuten auf mich zu warten, Herr Ferner!«
Papa streichelte meine Wange, denn er sah mein ängstliches, unglückliches Gesicht. So lieb die Vorsteherin auch war, es war mir doch sehr, sehr traurig ums Herz. Auf der Treppe war jetzt reges Leben, ich sah eine Menge junger Mädchen; sie guckten mich neugierig an, einzelne nickten mir zu. Das sah freilich freundlich aus.
Vor der Vorsteherin machten alle einen Knicks.
»Wer besorgt den Kaffee?« fragte diese ein junges Mädchen, das vorüberging.
»Melanie!«
»Sage ihr, bitte, daß Liesel Ferner mit euch trinkt, Gretchen!«
Diese nickte eilfertig und flog den langen Korridor entlang. –
Die Vorsteherin und ich gingen eine Treppe hinauf, kamen auch an einer hohen Flügeltür vorbei, hinter welcher Tassenklappern und Mädchenstimmen laut wurden. An einer Wand hingen verschiedene Mäntel und Hüte, aufgespannte Regenschirme standen da.
Fräulein von Reißner öffnete eine der Türen und trat ein. Ich folgte ihr zaghaften Herzens. Es war aber ein Raum, der gar nicht so fürchterlich war, als ich mir gedacht hatte. Ich hatte ja geglaubt, die Pensionszimmer seien die reinen Gefängnisse, und hätte mich nicht gewundert, wären Gitterstäbe an den Fenstern gewesen. Wie anders war es hier! Der Wind, welcher durch das Öffnen der Tür entstand, ließ die weißen Vorhänge an den zwei Fenstern aufflattern. Da sah ich, was ich auch nicht gedacht hatte, ein Stückchen Himmel.
»Das Zimmer liegt nach dem Garten, Liesel,« sagte die Vorsteherin, »da siehst du im Sommer ins Grüne, und das wird dir ein wenig die Heimat ersetzen!« Mir stieg es bei diesen Worten heiß in die Augen.
Es standen drei Betten in dem Zimmer. Über dem einen sah ich ein Kruzifix; drei Schränkchen zum Aufbewahren der Wäsche, drei Waschtische, und in der Mitte, auf einem großgeblumten Teppich, drei Stühle um einen großen runden Tisch. Schreibhefte, ein Tintenfaß, eine Notenmappe, ein Strumpf, ein geöffneter Brief, eine helle Schürze und ein einzelner Handschuh lagen darauf.
Mit Entsetzen trat die Vorsteherin heran. »Ist's denn möglich, eine solche Unordnung! Das kann nur Gabriele gewesen sein! Nun, ich werde sie rufen lassen!«
Sie klingelte und befahl dem bald darauf eintretenden Dienstmädchen, Fräulein Gabriele sofort herzuschicken.
Inzwischen erklärte sie mir, daß dies mein künftiges Heim sei, das ich mit Johanna und Gabriele zu teilen hätte. Ich solle nach dem Kaffee meinen Koffer auspacken, und dann sei ich wie zu Hause.
»Hier ist für die Kleider Platz!« sagte sie, einen Schrank öffnend, »und auf dies Bücherbrettchen kannst du deine Hefte legen!«
Die Tür ging auf, und mit gesenkten Blicken trat ein junges Mädchen ein. Sie war ebenso groß wie ich und hatte kurzgeschnittenes braunes Haar.
»Tante, Sie befehlen?« fragte sie.
»Komm doch einmal hierher an den Tisch!« sagte die Vorsteherin, »gehören dir nicht alle diese Sachen, die da herumliegen?«
Sie hob jedes einzelne Stück in die Höhe und sah Gabriele streng dabei an. Diese schielte hin und nickte.
»Du scheinst durchaus keine Ordnung lernen zu wollen, Gabriele, in dem Punkt machst du mir so gar keine Freude, Kind!«
Die Vorsteherin war ernstlich betrübt, aber ganz und gar nicht war es ihr Zögling. Gabriele schien die größte Lust zu haben, laut aufzulachen, aber sie nahm sich zusammen. Manchmal schielte sie zu mir herüber. Sie hatte große, dunkle, blitzende Augen.
»Du bleibst heute vom Spaziergang zurück und ordnest deine Sachen! Ich werde Fräulein Knauer dann alles durchsehen lassen! – Hier, deine neue Stubengenossin, Liesel Ferner!« Ich verneigte mich, aber Gabriele senkte nur ein wenig den Kopf. »Gabriele von Stetten!« stellte die Vorsteherin vor. Jetzt wußte ich auch, weshalb diese Gabriele mich so von oben herab behandelte, sie hatte ja ein ›von‹ vor ihrem Namen. Ich war kaum aus meiner stillen Heimat in die sogenannte ›Welt‹ getreten und lernte schon in der ersten Stunde menschliche Schwächen kennen. Sympathisch war mir diese Gabriele nicht, ihr Benehmen gegen die Vorsteherin erschien mir nichts weniger als achtungsvoll. –
Fräulein von Reißner hatte uns allein gelassen, in wenig Minuten sollten wir im Speisesaal sein. Gabriele hielt sich die Hand an den Mund und drehte sich auf dem Absatz herum, dabei kichernd.
»Lege doch ab!« sagte sie, »damit es nicht noch ein Donnerwetter gibt, man scheint heute im besten Zuge zu sein!«
»Wer denn?« fragte ich.
»Nun, unser Fräulein Tante! So müssen wir sie doch nennen! Es ist zu dumm, mich von meinem gemütlichen Kaffeetisch wegrufen zu lassen, bloß, weil ich ein paar Kleinigkeiten wegzuräumen vergessen habe!« – »Es sah aber doch sehr unordentlich auf dem Tisch aus!« wagte ich zu sagen, weil ich die Reden dieser Gabriele über alle Maßen abscheulich fand. Sie sah mich von oben bis unten an und lachte kurz auf. Dann sagte sie: »Wenn du freilich in dies Horn mit bläst, dann werden wir keine guten Freundinnen werden!«
»Ich brauche keine neue Freundin,« sagte ich, »ich habe schon eine!« Meine zierliche Anneliese mit dem lieben, feinfühlenden Herzen stand schnell vor meinem geistigen Auge; wie anders würde sie sich benommen haben! – Mit Gabriele hatte ich es verdorben. »Komm schnell!« sagte sie ungeduldig und öffnete die Tür, mit einem tiefen Seufzer hinaustretend. Ich warf noch einen Blick in den Spiegel. Ein blasses Gesicht mit blauen Augen blickte mir entgegen; ich trug noch Trauer; mein Haar ringelte sich auf der Stirn zu ein paar Locken, und die Zöpfe fielen den Rücken hinab.
Ich folgte Gabriele, und diese hüpfte trällernd die Treppe hinunter. Vor einer hohen Eichentür blieb sie stehen. Man hörte die tiefe, sympathische Stimme der Vorsteherin. Sofort machte Gabriele ein ernstes Gesicht. »Da heißt's, Zerknirschung zeigen!« sagte sie leichtsinnig. Ich war innerlich empört über diese Heuchlerin. – Wir traten ein. Es war ein hoher, dunkel getäfelter Raum mit drei Fenstern, an welchen gelbe Spitzenvorhänge hingen. Ein Kronleuchter hing an der Decke, und darunter stand eine lange Tafel, von welcher sich bei unserem Eintritt – und das galt mir, der Neuen – etwa acht junge Mädchen erhoben.
Nun faßte mich ›Tante‹, wie ich sie nennen mußte, an der Hand und stellte mich vor. Viel Namen schwirrten an mein Ohr, ich hatte nur mit besonderem Interesse aufgehorcht, als es hieß: »Deine andere Stubengenossin, Johanna Fehlmann!«
Ein paar kühl musternde blaue Augen blickten mich an. Johanna war eher häßlich als hübsch zu nennen, sie war übergroß, hatte eine knochige Figur und ein ebensolches Gesicht. Ich sah noch, wie Gabriele sich zu ihr setzte, und hörte, wie sie ihr zuflüsterte: »Das ist keine für uns!«
In welche Gesellschaft war ich geraten? Meine beiden Stubengenossinnen waren mir sehr wenig herzlich gesinnt.
Die Tante hatte mir noch einen Platz angewiesen, ehe sie ging, und ich setzte mich schüchtern. Alles so fremd, so neu, so liebeleer um mich! Ich war dem Weinen nahe. –
Neben mir war noch ein Stuhl leer. Erst hatte allgemeine Stille geherrscht, aber jetzt schwirrten die Stimmen durcheinander, und am lautesten war Gabriele.
»Habe soeben meinen Text bekommen!« sagte sie lachend zu Johanna.
»Laß dir darob keine grauen Haare wachsen!« antwortete diese, »du weißt ja, unser Prinzip: hier zum einen Ohr herein, zum andern hinaus!«
Die beiden lachten, und einige stimmten ihnen mit zu. Die anderen schwatzten und aßen.
Meine Tasse war noch leer. Da tönte auf einmal zu meiner Linken eine sanfte Mädchenstimme: »Bitte, deine Tasse, du armes Mädel wirst hungrig sein!« Angenehm überrascht blickte ich auf und sah in ein schönes Mädchengesicht, von rötlichblondem Haar umrahmt. Graublaue, tiefe Augen suchten die meinen. Wer sie auch sein mochte, diese Pensionsschwester, sie hatte im Augenblick mein Herz gewonnen. »Tante hat vergessen, mich vorzustellen,« sagte sie freundlich, indem sie meine Tasse füllte, »ich bin Melanie Nordau. Deinen Namen kenne ich schon!«
Ich nickte ihr zu, und an meinem Blick mochte sie fühlen, wie sie mir gefiel. Schnell trug sie die Kanne auf einen Nebentisch und setzte sich zu mir. Gefällig schob sie mir die Brötchen herzu, den Zucker und plauderte dann: »Es ist nicht hübsch, Neue zu sein, Liesel, – so heißt du doch? – ich weiß es noch recht gut. Aber in ein paar Tagen bist du hier zu Hause, glaube mir! Ich bin seit Ostern da und denke mit Schauder daran, in einem halben Jahr wieder fort zu müssen!«
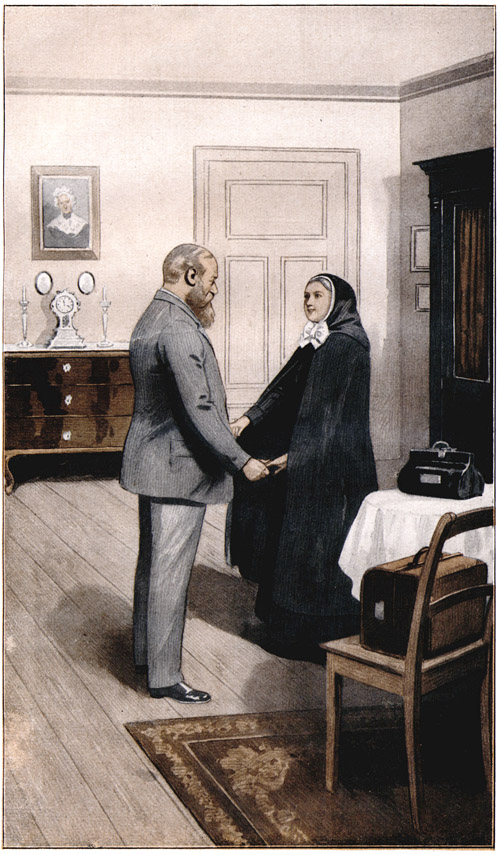
»Du gibst wohl gute Lehren?« fragte Johanna herüber.
»Nein, damit befasse ich mich nicht gern,« erwiderte Melanie ruhig, »ich finde, man bildet sich am besten selbst ein Urteil über die Menschen, mit denen man zusammenlebt!«
Ich nickte ihr zu, denn sie hatte mir ganz aus der Seele gesprochen.
»Nimm dich in acht,« rief Gabriele mir zu, »Melanie ist die reine Philosophie!«
Es klang spöttisch. Ich hätte ihr gern tüchtig geantwortet, aber ich sagte nur: »Sie gefällt mir!«
Da tauschten meine beiden liebenswürdigen Stubengenossinnen Blicke.
»Wo bist du eigentlich, in welchem Zimmer?« fragte Melanie.
Ich beantwortete ihr die Frage. Ein finsterer Blick flog hinüber zu den beiden eifrig tuschelnden Mädchen. Aber sie sagte nichts.
Es gab noch reizende Mädchen am Tisch, ein vierblättriges Kleeblatt, das waren die vier Elisabethen. Sie bewohnten ein großes, gemeinschaftliches Zimmer, das sie ›Elisabeths-Ruh‹ genannt hatten. Es schienen lustige, gutmütige Mädchen zu sein. Die vier hellblonden Köpfe waren beständig zueinander geneigt. –
Zwei schwarze Lockenköpfchen waren Gretchen und deren Cousine Susanne. Beide schienen es sehr eilig zu haben, denn sie stürzten ihren Kaffee hinunter und saßen dann am Tisch, den Kopf in die Hand gestützt, eifrig lernend.
»Margarete ist die beste Schülerin!« sagte Melanie, »sie überflügelt uns alle!«
Gabriele, welche sich selbst für die beste hielt, lachte spöttisch auf und trat an eines der Fenster.
»Aber die besten von unserem Dutzend, denn mit dir sind wir wieder ein ganzes, hast du noch nicht kennen gelernt, Liesel!« sagte Melanie. »Das sind Luise und Charlotte, die beiden Unzertrennlichen! Du wirst nie eine allein sehen, paß auf! Luise wird Ludchen genannt, ich glaube, den Namen hat sie sich selbst gegeben!«
»Aber sind sie nicht pünktlich zum Kaffee hier?« fragte ich.
»Heute nicht, sie waren bei einer befreundeten Familie in der Stadt zu Tisch geladen.«
Ein lautes Gelächter erklang in diesem Augenblick auf dem Korridor.
»Das sind sie!« sagte Melanie. Die Tür wurde aufgerissen, und hintereinander stürzten zwei Backfischchen herein. Sie waren ganz gleich gekleidet, bis auf Hut und Handschuhe, alles in hellem Grau. Um den Kopf der einen flatterten braune, um den der anderen blonde Haare.
»Melanie, süßer Schatz!« rief die Blonde, es war Lotte, und flog auf meine Nachbarin zu, diese fast erdrückend. Dabei gewahrte sie mich.
»Die Neue?« rief sie. Und als ich ihr lachend in die blauen Augen blickte, fiel sie mir ebenfalls um den Hals, küßte mich und sagte: »Du gefällst mir! – O, die Zöpfe, habt ihr schon die Zöpfe gesehen?« So rief sie laut und brachte mich in die größte Verlegenheit. Alle, außer Gabriele und Johanna, drängten sich herzu und nahmen abwechselnd die Zöpfe in die Hand.
Ludchen hatte sich inzwischen am Nebentisch schnell eine Tasse Kaffee und ein Brötchen genommen; noch kauend kam sie jetzt herzu. Das graue Hütchen an seinen Bändern am Arm baumelnd, ging sie erst gleich Lotte zu Melanie, dieser ebenso zärtlich ›guten Tag‹ sagend.
»Sie ist die Beste, mußt du wissen!« flüsterte sie mir zu. Ich mußte über die drolligen Mädchen lachen; sie waren ein paar herzige Dinger, diese Unzertrennlichen.
»Wie war's denn bei Gredners?« erkundigte sich Melanie.
Die zwei standen rechts und links von ihr, Lottchen hielt beständig einen meiner Zöpfe in der Hand.
»Höchst fidel, sag' ich dir!« berichtete Ludchen, »bloß satt bin ich nicht geworden! Es gab zu viel vornehme Leckerbissen, die weiß ich nicht zu würdigen. Nicht wahr, Lotte, dafür sind wir zu dumm!«
»Freilich!« stimmte die andere in aller Seelenruhe bei.
»Wer war denn noch da?«
»Ein paar Studenten, die furchtbar nett waren!« sagte Lotte.
»Nun, wenn sie ›furchtbar‹ nett waren,« meinte Melanie lächelnd, »dann habt ihr euch gewiß gut mit ihnen unterhalten!«
»O ja, der eine hat mir richtig den Hof gemacht, er sagte, ich hätte pyramidal schöne Augen. Ich sagte ihm aber, daß ich seine schöner fände!«
Auf Ludchens Bericht hin brach ein schallendes Gelächter los, die vier Elisabeths riefen einstimmig: »Ludchen, du bist ein Prachtmädel!«
Sogar die emsig Lernenden, Suse und Gretchen, blickten auf. Meine beiden Stubenschwestern waren Arm in Arm hinausgegangen. –
Melanie lachte, daß ihr die Tränen in die Augen kamen.
»Liesel, sie sind einzig, unsere Unzertrennlichen!« sagte sie. Dann stand sie auf und begann die Tassen zusammenzusetzen. Ich half ihr, was sie sehr erfreute. Bald war die Tafel leer, eine lange, dunkle Decke ward darübergelegt, die Stühle um den Tisch gestellt. So war es wieder peinlich ordentlich. Ein Dienstmädchen trug die leeren Tassen hinaus. – Das Kleeblatt, nach der Uhr sehend, war hinaufgegangen. Gretchen und Suse hatten ihre Bücher unter den Arm genommen, die Unzertrennlichen hatten allen lustig zugenickt, dann waren sie auch gegangen. So waren Melanie und ich allein. Schnell trat sie auf mich zu, faßte meine Hände und sagte: »Ich wünsche von Herzen, daß du dich ebenso glücklich hier fühlst, als ich! Und wenn du irgendeine Klage oder einen Kummer hast, sage ihn mir getrost, oder besser noch, sag ihn Tante! Sie ist die Güte selber!«
Wie anders klang das, als Gabrielens Worte! Ich konnte nicht anders, ich mußte auf den lieben Mund einen Kuß drücken. –
Tante trat ein: »Liesel, sage Papa Lebewohl! In zehn Minuten geht er. Dann soll dir Gabriele beim Auspacken helfen, und ist das fertig, kommst du bis zum Abendessen zu mir!«
Ich reichte den beiden die Hand und suchte Papa auf. Jetzt kam der schwere Augenblick, den ich gefürchtet, dem letzten, das mir noch von der Heimat geblieben, Lebewohl zu sagen. Ich flog in Papas Arme.
»Liesel, sei mein tapferes Mädchen! Lerne fleißig! Nütze das Jahr gut aus und bleib gesund und brav!«
»Grüße die Mutter und Elise und Anneliese!« Ich schluchzte doch herzbrechend, denn meine liebe, traute Mühle stieg vor mir auf. Aber Papa wußte, daß ein langer Abschied nur noch schwerer ist. So küßte er mich zum letztenmal, sprechen konnte er nicht, und eilte zur Tür hinaus. Ich hörte ihn mit der Vorsteherin einige Worte wechseln, dann sah ich, am Fenster stehend, die Droschke fortrollen, die meinen geliebten Vater mir entführte. Ich weinte in mein Taschentuch. Warum trennen sich freiwillig Menschen, die sich lieben? Warum entreißt man eine Pflanze dem Heimatboden, daß sie in der Fremde festwurzeln soll? Warum gibt es in der Welt – dabei weinte ich am meisten – diese schrecklichen Pensionate? Ich hörte die Tür gehen, Melanies reizende Gestalt schwebte auf mich zu.
»Ich wußte, daß du jetzt weinst,« sagte sie und legte den Arm um mich, »doch das mußt du nicht tun! Ich kann es dir nachfühlen, daß du jetzt am liebsten fortliefest, dem Papa nach! Aber bedenke, daß es für dich in einem kurzen Jahre ein schönes Wiedersehen mit all deinen Lieben gibt! Das hättest du nicht, wärest du jetzt nicht getrennt von ihnen! Und es ist doch kein Abschied für immer! Dieser ist viel schwerer zu tragen, wenn man sich sagen muß, daß es ein Wiedersehen auf Erden nicht mehr gibt, sondern erst in einer anderen Welt! Einen solchen Abschied kennst du ja auch und weißt, wieviel bitterer er ist!«
Ich trocknete die Tränen und sagte, zärtlich den Mund küssend, der mir so viel Trost zugesprochen: »Wenn du nicht hier wärest, dann hielte ich es nicht aus!«
In diesem Augenblick trat Tante ein, bereits mit Hut und Mantel angetan. Zugleich ertönte wieder die Klingel.
»Das gilt dem Spaziergange, Liesel!« sagte Tante, »heute kannst du nicht daran teilnehmen, da du erst auspacken mußt!«
Ich verabschiedete mich von ihr, Melanie flog mir voraus in ihr Zimmer, sich fertig zu machen. Unten im Hausflur sah ich schon verschiedene Pensionärinnen stehen und hörte die Stimme Ludchens.
»Später zeige ich dir unser Zimmer!« rief mir Melanie noch zu.
Ich trat in das unsrige ein. Gabriele saß am Tisch, auf dem einigermaßen Ordnung herrschte, und zeichnete.
»Willst du den Leichenzug sehen?« fragte sie mich. Ich erschrak, denn ich glaubte, es sei jemand gestorben.
»So heißt nämlich unser Pensionszug bei vielen,« sagte sie lachend und stand auf; »wir gehen hinüber nach der Elisabeths-Ruh, da sehen wir auf die Straße!«
Ich folgte ihr, und wir schritten über den Korridor in ein sehr großes, helles Zimmer. Ein Fenster desselben ging nach der Straße, zwei andere blickten in Gärten. Es sah äußerst sauber und behaglich hier aus. Nichts von Unordnung war zu spüren. Auf jeder der vier Kommoden lag die zusammengefaltete schwarze Schürze, an der Tür standen die Hausschuhe in Reih und Glied. Überall an den Wänden waren bunte Papierblumen angebracht. Gabriele sagte: »Jetzt kommen sie!«
Ich trat zu ihr und sah den Zug. Voraus gingen die Unzertrennlichen, dann kam das Kleeblatt, alle paarweise, dann Gretchen und Melanie, Johanna und Suse, zuletzt Fräulein von Reißner und eine große, blonde Dame, die ich noch nicht kannte.
»Wer ist die Dame?« erkundigte ich mich bei Gabriele.
»Unsere Lehrerin, eine Russin, Fräulein von Tolsky. Ich glaube, sie ist Baronesse, aber sie nennt sich nur mit einfachem Adel. Sie, Gretchen von Langefeld und ich, wir sind die einzigen Adligen hier.«
Ich hätte lachen mögen über den dummen Hochmut, der sich in ihren Worten aussprach. Sehr offenherzig versicherte ich ihr:
»Mir gelten die Menschen alle gleich, ob sie noch ein Wörtchen vor ihren Namen hängen oder nicht!«
O das lange Gesicht! Dieser Blick voll Ungnade!
»Das sind Ansichten, wie sie in Bürgerkreisen herrschen!« sagte Gabriele. –
Der Zug war vorbei, wir gingen in unser Zimmer, wo eben zwei Dienstmädchen meinen Koffer hinstellten. Die eine übergab mir den Strauß von Anneliese, der sorgfältig in eine Vase voll warmen Wassers gesteckt worden war. Ich bemerkte das mit Freuden und fragte, wer so liebenswürdig gewesen sei, sich meiner Blumen anzunehmen.
»Fräulein Melanie!« war die Antwort. Also wieder dies liebe Mädchen!
Nun ging's an das Auspacken. Tante hatte mir zwar versichert, Gabriele werde mir helfen. Aber diese schien sich nicht gern zu bücken. Sie begnügte sich damit, mir neugierig zuzugucken und hie und da mit tiefem Seufzer ein Stück zu reichen. Ich bat sie, sich nicht weiter zu bemühen. Flink ordnete ich die Wäsche. Wäre ich allein gewesen, so wären viel Tränen vergossen worden. Diese Wäschestücke hatte ja mein kleines Mütterchen geordnet und mit blauem Band umwickelt! Aber vor Gabriele hätte ich nicht weinen können, ich hätte mich jeder besseren, weichen Regung ihr gegenüber geschämt, wohl wissend, daß ich nicht verstanden worden wäre.
»Deine Kleider sind fesch!« sagte sie, »namentlich das braune mit den Samtärmeln muß dir gut stehen!«
Ich hängte die Kleider in den mir gewiesenen Schrank, stellte Bilder, welche meine Eltern und Brüder zeigten, auf meine Kommode, dazu einen Handschuhkasten, den Blumenstrauß und Großmutters Bibel.
»Bist du nun fertig?« fragte Gabriele. Ich nickte. Sie klingelte und ließ den leeren Koffer auf den Boden schaffen. Sie hatte etwas Barsches, Hochmütiges im Befehlen, ganz gewiß nicht den richtigen Ton, mit Dienstleuten zu verkehren. –
»Was zeichnest du?« fragte ich, an den Tisch tretend, als wir wieder allein waren.
»Ach, langweiliges Zeug! Dieser Doktor Resch, der hier im Pensionat Zeichenunterricht gibt, bringt einem ja nie etwas Interessantes. Ewig soll ich Blätter zeichnen lernen. Grete hat längst ganze Sträuße nach der Natur gemalt!«
»Vielleicht hat sie länger Unterricht?«
»Bewahre, aber er zieht sie vor! Ich kann ihn überhaupt nicht leiden!«
»Ich werde wohl statt der Malstunden lieber Klavierunterricht nehmen,« sagte ich, »auch ein wenig singen möchte ich so gern!«
»Ich lerne beides nicht,« sagte Gabriele, indem sie langsam weiterzeichnete, »aber die andern alle musizieren ja, daß man manchmal Ohrenreißen bekommt!«
»Wer spielt am besten?«
»Man sagt, Melanie. Aber das ist wahrscheinlich ein Stückchen Erbschaft. Ihre Mutter ist, glaube ich, öffentlich als Klavierspielerin aufgetreten!«
»Ach, lebt sie noch?«
»Nein, sie ist vor einigen Jahren gestorben. Du hast deine Eltern noch?«
»Gott sei Dank, ja!«
»Was ist dein Vater?«
»Wir haben eine Mühle in Thüringen.«
Gabriele rümpfte die Nase: »Also Müller?«
»Ja!« sagte ich, stolz den Kopf hebend. Was erlebte ich hier alles am ersten Tage! Wieviel Einblicke in Menschenherzen hatte ich schon getan!
Ich hatte keine Lust, mit Gabriele noch viel zu plaudern, darum bat ich sie, mir das Musikzimmer zu zeigen. Ich sehnte mich, allein zu sein, nur eine liebe Gesellschafterin um mich zu haben: die Musik. In Tönen ausklingen zu lassen, was in mir war, das war mir jetzt Bedürfnis.
Gabriele stand auf und begleitete mich hinunter. Am Ende des langen Korridors war das Musikzimmer. Sie öffnete und ließ mich dann eintreten, während sie selbst wieder zurückkehrte.
Es war dämmerig, und doch sah ich noch, wie schön und kunstsinnig dieser Raum ausgestattet war. Über dem Flügel war Beethovens Büste, sie hob sich scharf von der dunkelroten Wand ab. An einer Seite stand ein Schrank, mit Musikalien gefüllt. In einer Ecke war ein Sofa, niedere Sessel standen herum, Tischchen mit Büchern beladen; eine Gitarre mit buntem Seidenband hing an einer Wand. Längst schon mochten die Töne verklungen sein, denn die einzelnen Saiten waren gerissen. Wie ich später hörte, war es eine Erinnerung an ›Tantes‹ Vater. –
Ganz zaghaft schritt ich in dem fremden Zimmer umher, mein Fuß sank in einen weichen Teppich. Es war ein lauschiger Raum, so recht zum Träumen, zum Plaudern mit verwandten Seelen geschaffen. Und wie freute ich mich, den ernsten Künstlerkopf, meinen Beethoven, zu sehen!
Ich öffnete den Flügel und ließ mich auf dem roten Plüschsessel nieder, dann berührte ich schüchtern die Tasten. Welche Tonfülle, welch weicher Klang! Jetzt hatte ich die ersten, lockenden Töne gehört, nun gab es kein Halten mehr, ich tauchte hinein in das Meer der Klänge. Vergessen war gar bald das Pensionat, ich wähnte mich wieder an dem liebsten Ort der Welt, von dem ich erst vor wenig Stunden geschieden. Mütterchen sah neben mir, bei ihr Anneliese, Vater am Fenster, die lange Pfeife rauchend, und ich am Klavier, meinen Lieblingskomponisten spielend. Gewaltig brausten die Akkorde, wie weithin mochte man mich hören! Ich dachte nicht daran. Jetzt war es schon so finster, daß breite Schatten über die Büste über mir huschten, nur die weißen Tasten leuchteten mir noch entgegen. Da ging ich von Beethoven über zu Mutters ›Wellenrauschen‹. – Fern der Heimat in der Fremde saß das Müllerskind und zauberte sich mit der Kunst der Töne das Rauschen seines Heimatflusses vor …
Da legten sich plötzlich zwei Arme um mich, so daß ich erschrocken zusammenfuhr, Melanies liebe Stimme wurde laut: »Ist Müllerliesel jetzt in Gedanken daheim am Werrafluß gewesen?«
Ehe ich antworten konnte, hallte ein vielstimmiges ›Bravo!‹ durch das Zimmer, von allen Seiten stürmten sie auf mich ein. Das ganze Pensionat hatte mich belauscht. »Schon lange, lange!« berichtete Ludchen eifrig.
»Du spielst ja ebenso herrlich wie Melanie!« rief Lotte.
Gretchen hatte einen Leuchter auf dem Klavier angezündet. Da saß nun Liesel in vollem Licht, rot vor Verlegenheit.
»Ich freue mich, wir werden oft vierhändig spielen,« sagte Melanie.
»Und ich geige dazu!« meinte Elsbeth schüchtern. Sie spielte in der Tat sehr gut Violine, wie ich später bemerkte. Ihr Pult stand neben dem Klavier.
Jetzt kam auch Tante. Sie streckte mir beide Hände entgegen: »Jetzt weiß ich auch, welcher Schatz in dem Thüringer Kind liegt! Wie freue ich mich, dich recht oft spielen zu hören! Und deine Kunst wird dir auch eine milde Trösterin sein, wenn du einmal Sehnsucht hast!«
Hinter Tante ward die Lehrerin sichtbar. Sie hatte ein schönes, etwas strenges Gesicht. Mit einer tiefen Stimme und in reinem Deutsch sprach sie mich an, und während ihres Sprechens belebte sich ihr Gesicht, aus den blauen Augen sprach eine milde Freundlichkeit: »Wir haben einander noch nicht begrüßt! Ich hoffe, Elisabeth, du wirst mir eine liebe Schülerin sein!«
Sie reichte mir ihre schmale, feine Hand, welche ich schüchtern ergriff. Dann aber stand ich schnell auf und flüchtete mich in den Kreis der Pensionsschwestern.
Ludchen zog die langen Handschuhe aus und schwang sie wie ein Rad in der Luft.
»Du!« rief sie, »heute hast du etwas versäumt beim Spaziergange!«
»Was denn?« fragte ich.
»Wir haben zwei entzückende Leutnants gesehen, der eine mit einem schwarzen, der andere mit einem blonden Schnurrbart!« Sie schnurrte voller Übermut das ›rrr‹ möglichst laut und drehte sich einen nicht vorhandenen Schnurrbart.
Tante drohte lächelnd mit dem Finger. »Du wirst mir doch nicht kokettiert haben?« fragte sie.
»Ein bißchen, ein ganz kleines bißchen!« gestand Ludchen zur größten Heiterkeit ein, »aber ich weiß nicht, welcher mir am besten gefiel!«
»Blond oder schwarz, das ist hier die Frage!« rief Melanie lachend, Ludchens schwingenden Arm festhaltend, »du bringst einen ja in Lebensgefahr, Kleine!«
»Jetzt wird aber noch ein Stündchen gearbeitet, Kinder, es ist erst sechs Uhr!« sagte Tante.
Fräulein von Tolsky ging voraus in den Arbeitssaal, ich folgte Tante auf deren Wink.
Es galt für eine besondere Auszeichnung und Ehre, in die Privaträume der Vorsteherin zu kommen, und den Neuen ward diese meist zuteil. Wer sich später der besonderen Gunst der Tante erfreute, den lud sie sich bisweilen ein, und an Festtagen ward der Nachmittag von allen bei ihr verlebt. –
Wir traten in dasselbe Zimmer ein, in dem sie Papa und mich heute nachmittag empfangen hatte. Es war behaglich warm.
»Laß uns in mein ganz spezielles Heiligtum gehen, Liesel!« sagte sie und öffnete die nächste Tür. Ich wagte gar nicht einzutreten, so märchenhaft dünkte mich dieser Raum.
»Nur zu!« neckte Tante und schob mich über die Schwelle. Ich trat ein, und während Tante im anstoßenden Schlafzimmer verschwand, Hut und Mantel abzulegen, sah ich mich um. Mein erster Gedanke war: Vater, Mütterchen, Anneliese, ihr bescheidenen, schlichten Menschen, könntet ihr dies Nestchen sehen!
Die Wände waren mit dunkelroter Seide beschlagen und voll kostbarer Ölgemälde. Ein Kronleuchter ließ ein mattes Licht über den Raum gleiten. – In der Mitte stand ein Tisch mit Prachtbänden, über dem Klavier befanden sich Büsten berühmter Komponisten, grüne Zweige rankten sich darum. Auf einem Tischchen waren auf Staffeleien kleine Ölbildchen und Photographien aufgestellt, sowie Vasen voll frischer Blumen. Kleine japanesische Sessel standen verstreut umher, an einer Wand ein Schreibtisch, voll entzückender Dinge, daneben ein Schaukelstuhl aus weißem Fell. Und es gab keinen Ofen in dem Zimmer, sondern ein Kamin, über welchem ein Spiegel hing. Blumenkelche aus mattem Glase umrankten diesen, und ein Licht erstrahlte aus jeder Blüte. Den Sims schmückten Vasen und Leuchter; der Spiegel warf ein trauliches Bild zurück. Ein Feuer glühte im Kamin, zwei niedere Sessel standen davor. Ein Eckchen aber habe ich absichtlich noch nicht beschrieben, und es war doch dasjenige, das meine Bewunderung am meisten erregt hatte: eine Laube mit lebenden Pflanzen stand da, und in ihr ein kleines Tischchen und eine Bank. Das Grün wucherte üppig, die Laube dicht umspinnend.
Tante trat ein und lachte über mein erstauntes Gesicht.
»Es scheint dir bei mir zu gefallen!« sagte sie.
»O wie ist es schön bei Ihnen!« Ich faltete voller Andacht die Hände.
»So komm immer hierher, Liesel, wenn du einmal Sehnsucht hast nach Hause!«
»Darf ich? Ich werde gewiß manchmal kommen!«
Wir setzten uns auf die beiden Sessel am Kamin, Tante fachte die Glut an, dann wandte sie sich zu mir: »Nun erzähle mir von deinem Elternhause, damit ich vertraut werde mit dem Heim, aus dem mein jüngstes Töchterchen kommt! Papa ist schon wieder halb zu Hause um diese Zeit!«
Ich begann zu erzählen, voller Offenherzigkeit und Vertrauen. Es tat mir selbst wohl, von der Mühle zu sprechen, von den Eltern und Geschwistern, und ich sah an dem wohlwollenden Blick, der auf mir ruhte, daß meine Zuhörerin lebhaften Anteil nahm. Ich erzählte von den losen Kinderstreichen, der Schulzeit mit ihren Freuden und Leiden, der Konfirmation, der Großmutter und ihrem schnellen Scheiden, der lieben, alten Mühle am Fluß usw.
»Wie herrlich ist deine Jugend verflossen, Liesel!« sagte Tante; »so ganz in der Natur zu leben, muß das Schönste sein. Das schafft reine Herzen! Und ich sehe auch, daß das blonde Müllerskind mit den Prachtzöpfen ein echtes Naturkind geblieben ist. Wie anders wachsen wir armen Stadtkinder auf, in engen, grauen Mauern, ohne eine Ahnung von der Pracht der Wälder und Berge! Wie viele lernen nie andere Bäume kennen, als die der Promenaden! – Ich werde dir ein wenig von deinen Pensionsschwestern erzählen, ich glaube, das hilft viel dazu, daß du dich bald eingewöhnst. Zum Glück haben sich meine Pfleglinge immer wohl bei mir gefühlt, und es sind nur wenige, die ihre ›Tante‹ und die Pensionszeit vergessen haben!
»Mit dir zusammen wohnen Gabriele und Johanna. Erstere ist nicht sehr ordentlich, wie du bemerkt hast. Sie stammt aus vornehmem Hause, aber leider ist sie nur mit Brüdern aufgewachsen und infolgedessen ihre Erziehung etwas vernachlässigt. Johanna ist ihr sehr befreundet, glaube ich. Ihr Vater ist Grundbesitzer in Bayern. Sie ist begabt und klug. Ein köstliches Pärchen sind die Unzertrennlichen, die du ja nun auch kennst. Sie lernten sich hier kennen und schlossen gleich in den ersten Tagen glühende Freundschaft. Man sieht nie eine ohne die andere, ich mußte sie in ein Zimmer tun, so sehr baten sie mich. Es sind ein paar herzige, gute Mädchen, die wie die Sonnenstrahlen durch unser Haus huschen. Beide kleiden sich gleich, und da sie aus reichen Familien sind, so liegt die Zukunft sehr rosig vor ihnen. –
»Weniger leicht wird es dereinst Gretchen von Langefeld gehen. Sie ist begabt und soll sich deshalb später zur Lehrerin ausbilden. Sie und ihre Cousine Susanne werden beide sich in Zukunft ihr Brot selbst verdienen müssen; denke nicht, daß ich sie deshalb beklagenswert finde, im Gegenteil. Wenn Gott sie gesund erhält, so werden sie glücklich sein in der Pflichterfüllung ihres Berufs. Es ist so falsch, zu sagen: ›Gottlob, ich brauche mir mein Brot nicht selbst zu verdienen!‹ Alle, die so sprechen, wissen eben nicht, daß ein Stückchen selbstverdientes Brot so köstlich schmeckt. Nur das Geld, das man sich erworben hat, verschafft die rechte Freude. – Elsbeth ist Waise, begabte Geigerin, nicht reich, ich glaube, daß sie es so weit bringt, um in Konzerten mitzuwirken und später Stunden zu geben; die anderen drei Elisabethen sind junge Mädchen wie die meisten, gute, ordentliche Kinder. Ein Liebling von mir ist Melanie. Sie ist ein Künstlerkind, ihr Vater ist Professor der Musik in Köln, ihre Mutter, leider jung gestorben, war eine ausgezeichnete Klavierspielerin. An ihr hängt Melanie mit rührender Liebe. Von ihr hat sie auch das Talent geerbt. Du wirst viel Genuß haben, wenn ihr öfters zusammen spielt. Vielleicht gelingt es ihr, später Lorbeeren zu pflücken. Sie ist ein gemütvolles Kind. – So, da hätte ich dir nun eine genaue Schilderung gemacht. Bei Tische wirst du noch Fräulein Knauer kennen lernen, sie steht meiner Wirtschaft vor und führt mit Aufsicht über mein Dutzend! Und nun,« sie faßte meine Hände, »wünsche ich von Herzen, daß das Thüringer Waldkind die Heimat nicht allzusehr vermissen und fühlen möchte, man kann auch anderswo einmal recht glücklich sein!«
Ich dankte ihr schüchtern. Sie stand auf und ging an die Laube.
»Komm,« rief sie, »du mußt dich doch auch einmal hineinsetzen!«
Sie bückte sich und setzte sich auf die grün angestrichene, niedere Holzbank. Ich saß bald neben ihr. Wie eigenartig war das, jetzt, wo der Sommer vorüber war, sich in grünem Blätterwerk zu wissen! Sanft legte sich ein Röslein, ein duftiges, weißes, an meine Wange. – Auf dem ebenfalls grünen Tischchen stand eine Schale; aus feinem Moos, das in wasserdurchtränktem weißem Sand steckte, streckten zarte Vergißmeinnicht ihre blauen Köpfchen hervor.
Es klopfte an die Tür, man rief zum Abendessen. Trotz all des Neuen, das auf mich einstürmte, trotz der Sehnsucht, die sich in einem verschwiegenen Winkel des Herzens leise regte, spürte ich als echtes Waldkind doch einen guten Appetit. – Wir gingen in den Speisesaal, denselben Raum, in dem wir den Kaffee getrunken hatten. Wie anmutig sah er aus! Die Gaskrone brannte, auf der langen Tafel spiegelte sich das Licht in den Kristallschalen, im Silber wider. Diejenige, welche das Tischdecken besorgt hatte, hatte mir ein frisches Sträußchen als Willkommen hingestellt. Ich wurde Fräulein Knauer vorgestellt, einem einfachen, liebenswürdigen Mädchen. Unter ihrer Aufsicht lernten die Pensionärinnen kochen; ein Zwang war letzteres nicht, aber es gab wenige, die sich ausschlossen.
Große Teller voll kalter Braten, mit Petersilie verziert, standen auf der Tafel, Butter in Muschelform, Salat, bunt und appetitlich aufgebaut. Auf einem hölzernen, geschnitzten Teller lag geschnittenes Brot. Das Bier war in zwei Glaskrügen. –
Erst als alle beisammen waren, sprach Tante ein kurzes Tischgebet, dann gab's ein Stühlerücken, und sogleich plauderte alles.
Die Unzertrennlichen saßen mir gegenüber, beide trugen gleiche bunte Schürzen.
Lotte bediente ihre Freundin, indem sie ihr Braten vorlegte und die Brötchen mit Butter bestrich.
Gretchen füllte die Biergläser. Melanie, die mir schräg gegenüber saß, trank mir zu. Ich hatte mich vorher schnell bedankt, daß sie für meine Blumen gesorgt hatte.
»Ich dachte, daß sie aus lieber Hand wären,« sagte sie.
Die vier blonden Elisabethen saßen nebeneinander.
»Eigentlich müßte Liesel Ferner mit bei uns sitzen!« sagte Elsbeth.
»Nein,« meinte Ludchen, »das wäre dann ein fünfblättriges Kleeblatt, und diese bedeuten Unglück! – Gretel, bitte, noch ein Glas Bier! Und Suse, willst du mir einmal die Gurken reichen?«
Lotte, welche keine Verehrerin Gabrieles zu sein schien, deren Adelshochmut kennend, redete diese stets mit ›Fräulein von und zu Stetten‹ an. Die Kleine konnte also auch ein bißchen spitzig sein! Überhaupt blickten ihre blauen Augen etwas listiger als die Ludchens, aber doch nicht unangenehm.
»Fräulein Knauer,« fragte Johanna, »darf ich morgen einmal den Braten ganz allein machen? Bitte!«
»Fräulein von Tolsky, müssen wir wirklich die ganzen Hauptflüsse von Europa zur Geographiestunde auswendig wissen?«
»Tante, nicht wahr, es hat keinen Wilhelm Tell gegeben?«
»Melanie, spickst du auch den Kalbsbraten?«
»Liesel, willst du nicht nach Tische mir einmal erlauben, deine Zöpfe ganz und gar aufzuflechten?«
So schwirrten die verschiedensten Fragen durcheinander. Die letztere hatte Ludchen an mich gerichtet. Alle stürzten auf mich ein.
Und richtig, als das Abendessen vorüber war und ich ruhig neben Tante saß, spürte ich, daß sich jemand hinter mir zu schaffen machte. Mich schnell umwendend, sah ich die Unzertrennlichen. Wie zwei Teufelchen lachten sie, meine Zöpfe hatten sie heimlich fast ganz aufgeflochten. Ich mußte aufstehen, und sie legten das Haar wie einen Mantel um mich. Ich bedeckte mein Gesicht mit den Händen, denn ich schämte mich der allgemeinen Bewunderung.
»Wie die Prinzessin im Märchen!«
»Elfchen Goldhaar!«
»Entzückend! Ein goldener Mantel!« So riefen sie durcheinander, ich hätte nie geglaubt, daß Müllerliesels Zöpfe jemals Bewunderung erregen würden. –
Schnell flocht ich sie wieder und sagte, ich wolle sie von jetzt ab aufgesteckt tragen, ich sei zu alt zu Hängezöpfen. Ein Sturm der Entrüstung brach los.
Ludchen rief: »Wenn du das tust, ziehe ich dir täglich die sämtlichen Haarnadeln heraus! Und liebhaben werde ich dich dann auch nicht mehr!« –
Wir holten uns jede ein Buch oder eine Handarbeit. Tante verließ uns auf eine Stunde. Unter der Aufsicht der Lehrerin saßen wir zusammen im Arbeitssaal. Dieser war ein schmuckloses, großes helles Zimmer. Dort wurden die Schulstunden abgehalten. Eine lange Tafel, Stühle davor, ein Katheder, Landkarten, ein Schrank mit Zeichenvorlagen und Büchern, das war ungefähr der Inhalt des Zimmers, dessen drei Fenster nach dem Garten zu gelegen waren. –
Um neun Uhr kam Tante, sprach ein kurzes Nachtgebet, dann gingen wir alle zu ihr, ›gute Nacht‹ zu sagen. Für jede hatte sie einen freundlichen Blick, ein gutes Wort.
»Schlaf recht wohl zum erstenmal unter meinem Dache, Liesel!« sagte sie innig. Wie freundlich die Augen mich ansahen! Ich hatte sie schon sehr ins Herz geschlossen, diese viel gefürchtete Pensionsvorsteherin. –
»Jetzt will ich dir schnell zeigen, wo ich wohne,« sagte Melanie, »später siehst du es dir genauer an!«
Sie schob ihren Arm in den meinigen, und wir stiegen die Treppen herauf. Hinter uns kamen die anderen unter Geplauder und Lachen.
Die vier Elisabethen verschwanden miteinander in ihrem Zimmer, nachdem sie sich mit Händedrücken von uns verabschiedet hatten. Gretchen und Suse bewohnten jetzt ein Zimmer allein, das dritte Bett war leer. – Johanna und Gabriele hatten sich bereits in unser Zimmer begeben, ich hatte versprochen, sogleich nachzukommen.
»Um halb zehn Uhr kommt Fräulein Knauer, zu sehen, ob kein Licht mehr brennt, also verspäte dich nicht!« rief mir Gabriele noch zu.
Die Unzertrennlichen wohnten mit Melanie zusammen. Als wir in das große, schöne Zimmer eingetreten waren, lief Lotte eiligst hin und zündete zwei Lichter an. In jede Hand nahm sie einen Leuchter und, sie hochhaltend, rief sie:
»Nun, holde Elisabeth, beschaue dir unser Heiligtum!«
»In dem wir,« fuhr Ludchen in demselben Tone fort, »unter dem Zepter von Melanie der Braven unser friedliches Dasein führen!«
Die beiden ›Kleinen‹, wie Melanie sie nannte, liefen eiligst hin und her, auf Tisch und Stühle flogen die Kleidungsstücke, jeder Stiefel in eine andere Ecke.
Aber Melanie schalt nicht, sie wußte ganz genau, daß es nachher eine ebenso tolle Jagd gab, in zwei Minuten Ordnung zu schaffen.
Ich betrachtete mir das Zimmer; es war dem unsrigen ähnlich, doch künstlerisch ausgeschmückt. Überall waren Zweige selbstgemachter Blumen, spanische Fächer, Bilder, Hängegewächse. Es sah sehr behaglich und gar nicht pensionatsmäßig aus.
»Das macht alles Melanie!« sagte Ludchen, ihr Haar bürstend, »wir sind dazu zu dumm, nicht wahr, Lotte?«
Diesmal blieb die Bestätigung aus, denn Lotte wußte, daß sie doch diese Papierblumen verfertigt hatte. Als sie schwieg, fiel Ludchen dies ein, und sie sagte trocken:
»Richtig, du hast ja die Blumen gemacht!«
»Und hier ist meine Mama!« sagte Melanie mit einem so weichen, rührenden Tone, daß sogar die beiden Mädchen schwiegen.
Sie führte mich vor eine Staffelei, hielt selbst die Kerze, und das Licht bestrahlte ein zauberhaft schönes Frauengesicht.
»Schön, nicht wahr?« fragte Lotte schüchtern.
»Wunderschön!« sagte ich, hingerissen in das Gesicht starrend. So lieblich lächelte der kleine Mund! Wie zärtlich mochten diese schönen Augen auf dem Töchterchen geruht haben!
Ich küßte Melanie und sagte ihr leise: »Wie furchtbar der Gedanke, daß sie tot ist, du arme, arme Melanie!«
Sie nickte mit großen, feuchten Augen. Aber sie liebte es wohl nicht, ihren Schmerz so offen zu zeigen. So trat sie weg von dem Bilde und sagte, mir den Mund zum Kuß reichend: »Jetzt geh, sonst kommst du zu spät!«
Ludchen und Lotte nahmen zärtlichen Abschied, dann sagte Melanie:
»Schnell aufgeräumt, Kinder!« und begleitete mich bis zu meiner Tür. –
Ich fand Gabriele am Tische sitzend. Sie schrieb noch rasch einen Brief.
»Es ist zwar verboten,« sagte sie, einen Blick auf die vor ihr liegende kleine Uhr werfend, »aber in zwei Minuten bin ich fertig!«
Und Johanna? Sie kniete im Bett, den Blick auf das Kruzifix geheftet. Es war still, so daß man nur die raschelnde Feder Gabrieles hörte.
Fünf Minuten später sagten wir uns ›Gute Nacht!‹, die Lichter waren verlöscht. Da steckte jemand den Kopf zur Tür herein, es war gewiß das Fräulein. Als sie alles finster fand, schloß sie sie sogleich wieder. –
Ich hatte mein Abendgebet gesprochen und lag nun da, die Hände noch gefaltet und mit offenen Augen.
Ich schlief ja zum erstenmal im Leben unter einem fremden Dache! Zum erstenmal fern der Heimat, ohne dem lieben Vater, der guten Mutter den gewohnten Nachtkuß gegeben zu haben. Mein ganzes Herz war jetzt in der Mühle. Wie würde es da sein? Gewiß saßen sie am Tische im Wohnzimmer und sprachen von ihren Kindern. Fritz mochte es recht einsam sein, er war ja so an die Geschwister gewöhnt. Feierlich still ist's um die Mühle, derselbe Sternenhimmel einer kühlen Oktobernacht wölbt sich über ihr, das Rad ist die einzige Melodie, welche aber die Bewohner der Mühle längst nicht mehr hören. Die alte, liebe Werra wälzt ihre jetzt trüben Wellen in ewiger Gleichmäßigkeit dahin. Es kümmert sie wenig, ob Leid oder Freude die Herzen derer bewegt, welche sich an ihren Ufern angesiedelt haben:
»Was geht denn auch die Wellen
Ein Menschenabschied an?«
Die Müdigkeit übermannte mich; die Gedanken blieben in der Mühle die ganze Nacht hindurch. Müllerliesels Herz war daheim im Elternhause, während sie selbst, ein paar Tränen der Sehnsucht an den Wimpern, fest und tief schlief.
Als ich die Augen endlich öffnete, blickte ich mich erstaunt um, die Betten meiner Schlafkameradinnen waren leer und bereits in Ordnung. Die Vorhänge waren in die Höhe gezogen, und die Herbstsonne schien freundlich ins Zimmer herein.
Die Tür ging auf, und Melanie, gefolgt von den Unzertrennlichen, trat ein.
»Guten Morgen! Geschlafen hast du wie ein Bär, Liesel! Nichts gehört, keine Glocke, nicht das Aufstehen von Gabriele und Johanna!« rief Melanie.
»Sie erzählten,« sagte Lotte, »du hättest im Bett gelegen und im Traume gelächelt! Bitte, verrate uns, was du geträumt hast, Liesel, es geht sicher in Erfüllung! Verlaß dich drauf!«
Ich war sehr bestürzt und unglücklich, es so verschlafen zu haben, aber Melanie tröstete mich, die Tante habe es befohlen, mich nicht zu wecken.
»Geträumt habe ich von daheim,« sagte ich, »aber, was es alles war, weiß ich nicht mehr!«
»Jetzt hole ich dir schnell deinen Kaffee,« rief Ludchen und sprang zur Tür hinaus.
»Übermorgen fangen die Stunden an,« erzählte Melanie, »dann sind wir alle ein bißchen mehr ans Stillsitzen gewöhnt.«
Ludchen erschien nach einer Weile, draußen rufend: »Aufmachen, bitte!«
Allerliebst sah sie aus im weißen Latzschürzchen, voller Eifer mich bedienend. Sie legte die Buttersemmel zur gefüllten Tasse, und während ich meinen Kaffee trank, verzehrten die anderen ihr Frühstücksbrot, das Ludchen gleich für alle mitgebracht hatte. Lotte hatte sich an eines der Fenster gesetzt. Sie sprang plötzlich auf und rief: »Ich glaube, ich höre den Postengel!« Wie ein Wirbelwind flog sie zur Tür hinaus. Man hörte von unten herauf laute Stimmen, Rufe wie: »Nichts für mich, Else Vogel?« – »Bitte, mir einen!« – »Gar nichts für Melanie Nordau?« – »O, Sie sind heute nicht gut!« – »Hurra, von Mutter!« – »Hier, drei an die Tante!« –
»Das ist immer ein gewaltiger Moment in der Weltgeschichte, wenn der Briefträger kommt!« sagte Melanie, »du sollst nur mal sehen, wie wir alle ihm den Hof machen in der angenehmen Hoffnung, er holt aus seiner geheimnisvollen schwarzen Ledertasche etwas Gutes heraus! Und die langen Gesichter derjenigen, die leer ausgehen, die strahlenden der beglückten, beneideten Empfänger! Wahrlich, sie schrieben einem in der Ferne alle recht oft, wenn sie sehen könnten, welche Freude einem Pensionskind ein Brief bereitet!«
»Unser Postengel heißt Schmidt,« sagte Ludchen, »er ist arm und hat fünf Kinder. Da machen wir Weihnachten stets eine Extra-Bescherung für ihn. Diese Freude! Das ist zu schön! Dafür sagt er aber auch, daß er am liebsten in unser Haus kommt!«
Lotte kam und brachte Ludchen einen Brief. Es war ein großes Format und eine kräftige Handschrift, zudem ein Stadtbrief.
Ludchen wurde dunkelrot. Sie öffnete hastig den Brief und nahm eine Photographie heraus, eine Ansicht des Stadttheaters.
Wir drei waren sehr erstaunt. »Was ist denn das? Von wem?« hieß es.
»Ach, jetzt weiß ich's!« rief Ludchen erleichtert auf, »wie gelungen! Ich hatte mit meinem Tischherrn gestern ein Vielliebchen gegessen und gewonnen. Und da schickt er mir nun dies Bild. Hier leset, auf der Rückseite steht: ›Vielliebchen, Artur Trost‹. Das ist doch entzückend!«
Sie hüpfte im Zimmer herum, die Handschrift küssend.
»Ist das der mit den schönen Augen?« fragte Melanie lächelnd. Eifrig nickte die Kleine.
Sie flog hinaus, ihren Schatz Tante zu zeigen, denn es fiel keiner Pensionärin ein, derartige Heimlichkeiten hinter ihrem Rücken zu treiben. Erlaubte diese, den Brief anzunehmen, so war es gut, aber oftmals wanderten solche feurige Zeichen von Verehrung wieder an die Absender zurück. Tante, so hörte ich später, hatte nichts gegen den kleinen Scherz einzuwenden und zu Ludchen gesagt: »Wenn's dir ein Trost ist, so behalte das Bildchen nur!«
So prangte die Photographie sehr bald im Zimmer.
Schnell war ich in den Kleidern und machte mein Bett. Dann ging ich hinunter. Ich fand sie alle im Garten beschäftigt, die letzten blühenden Astern oder ein letztes Röslein zu finden.
»Ausgeschlafen?« riefen sie mir neckend entgegen. Tante entdeckte ich an einem Rosenstrauche stehend. Sie trug einen dunkelroten Morgenrock, dessen Schleppe sie in der Hand hatte. Ein alter, weißhaariger Gärtner stand bei ihr.
Ich ging schüchtern auf sie zu, doch unterbrach sie sogleich die Verhandlungen mit dem Manne und streckte mir freundlich ihre freie Hand entgegen.
»Interessierst du dich auch für die Gartenpflege?« fragte sie.
»Sehr!« antwortete ich, »ich habe zu Hause oft mitgeholfen!«
»Das ist recht, Liesel! – Um alles in der Welt, was macht denn Lotte dort? Ich glaube, sie umwickelt einen Rosenstock? Franz, da müssen Sie doch einmal nachsehen, daß das kleine Fräulein keine Dummheiten begeht!«
Lotte hatte wirklich einen drolligen Anblick geboten, mit vor Kraftaufwand rotem Kopfe stand sie da und umwickelte den unglückseligen Rosenstock. Aber sie mußte ihre Sache nicht ganz schlecht gemacht haben, denn man sah, wie der Alte freundlich mit dem Kopfe nickte und Lotte vergnügt einen Luftsprung machte.
Tante nahm mich unter den Arm und ging langsam mit mir durch den Garten, ihn mir zu zeigen. Er war für Stadtverhältnisse ziemlich groß. Es gab einen Spielplatz, eine Schaukel darauf, und ein Stückchen, das Tante stolz ihren Gemüsegarten nannte. Jetzt sah es freilich wild dort aus. Gras war da üppig aufgeschossen, wo es sicher im Sommer streng verbannt war. Das hohe Kraut vom Spargel stand noch, etwas Petersilie, das Blätterwerk der Erdbeeren usw.
»Es schmeckt doch nichts besser, als was man selbst erbaut hat, nicht wahr, Kind?«
Ich nickte beistimmend und erzählte von dem letzten Sommer, wo ich auch in solchen Genüssen geschwelgt hatte. –
Überall gab es reizende Lauben, mit grünen Bänken und Tischen darinnen. In einer der größten hingen einzelne bunte Papierlaternen.
»Die sind noch vom letzten Geburtstage her, den wir hier feierten,« erzählte die Tante.
Jetzt kam aber das für mich Allerschönste: ein kleiner Teich! O, ich sah wieder Wasser, ich, das am Wasser aufgewachsene Müllerskind. Ich ließ Tantes Arm los und lief an das Ufer; waren es auch nur kleine, schmutziggraue Wellchen, die leise heranrauschten, ich liebte sie doch!
»Das ist unser ganzer Stolz, Liesel,« sagte Tante, »im Winter fahren wir hier Schlittschuh, feiern sogar alljährlich ein Eisfest! Und im Sommer benutzen wir oft die kleinen Kähne, deren grüne Spitzen du dort hinter dem Gebüsch hervorragen siehst!«
Ich war entzückt und ließ meine Augen über die bewegte Wasserfläche gleiten. Wie schön war es hier! O, es war so gut von den Eltern gewesen, mich in diese Pension zu geben!
»Heute ist der letzte freie Tag, Liesel, den sollt ihr noch alle ordentlich genießen! Morgen, Sonntag, gehen wir zur Kirche, nachmittag trinken wir Kaffee bei mir, und dann ist Zeit zum Briefeschreiben. Montag aber geht das Lernen an.« –
Wir kamen wieder am Hause an, Tante ging, sich anzukleiden, ich, um eine Karte nach Hause zu schreiben mit dem Versprechen, morgen einen langen Brief zu senden.
Aus dem Musikzimmer hörte ich sehr gutes, gewandtes Klavierspiel. Es sei Melanie, sagte mir Ludchen.
Gabriele und Johanna begegneten mir auf der Treppe. Sie waren in Hut und Mantel und machten einen Ausgang in die Stadt. Gretchen und Suse sah ich mit großen Schürzen in der Küchentür verschwinden. Die beiden Unzertrennlichen saßen auf ihrem Zimmer, mit dem Ausbessern ihrer Kleider beschäftigt. Ich hatte meine Postkarte zur Besorgung abgegeben und ging ein wenig zu ihnen.
»Das ist reizend von dir!« sagte Ludchen, und Lotte schob eifrig einen Stuhl herbei. »Weißt du, alle Sonnabend nachmittag werden unsere Sachen nachgesehen, daß nichts zerrissen ist! Zuerst war mir das schrecklich, denn ich hatte nie genäht, aber jetzt bin ich's schon ganz gewöhnt, und nähe so gern, daß ich oft für Ludchen etwas mit nähe!«
»Gabriele ist die Liederlichste,« plauderte Ludchen weiter, »wer die einmal zur Frau bekommt, kann mir leid tun!«
»Wie weise du sprichst!« lachte Lotte.
»Wenn ich ein Mann wäre, so heiratete ich Melanie!« sagte Ludchen.
»So? Und mich nähmst du also nicht, und ich könnte eine alte Jungfer werden?«
»Verzeihe,« sagte die Kleine ganz niedergeschlagen, »aber ich nähme dich dann zur – zweiten Frau!« Wir lachten alle drei vergnügt auf.
Bis jetzt hatte ich nicht allzuviel vom Heimweh zu leiden gehabt, alle die neuen Eindrücke wirkten zerstreuend. Auch war ich nicht allein, sah so viele um mich, die auch fern von den Ihrigen leben mußten. Erst später sollte dies gräßliche Weh mächtig über mich kommen, als ich glaubte, ich lerne es nicht mehr kennen. –
Wir saßen noch gemütlich beisammen, Melanie, das Notenbuch im Arm, gesellte sich dazu. Aus dem Zimmer der vier Elisabethen hörten wir zweistimmig das einfache Kinderliedchen singen: ›Weißt du, wieviel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?‹
Punkt zwölf Uhr rief die Glocke zu Tisch. Alle Türen öffneten sich, hungrige Fräulein erschienen.
»Heute gibt es mein Leibessen,« sagte Elsbeth, »Nudelsuppe!«
»Darf ich dir meinen Teller voll abtreten?« sagte Lotte, »ich mag sie gar nicht!«
»Ei, natürlich, was willst du denn dafür? Mein Bier oder meinen Kuchen morgen?«
»Nichts!« rief Lotte feierlich, »ich verzichte großmütig!«
Im Speisesaal, wo wieder eine appetitliche Tafel gedeckt war, stand Suse an einem Seitentischchen, aus einer großen Terrine die Teller füllend, die Gretchen austeilte. Als alles fertig war, sprach Tante wieder ein kurzes Tischgebet. Ich saß neben ihr. Sie leitete eine anregende Unterhaltung; an Stoff dazu fehlte es ja überhaupt nicht, die Mäulchen der Pensionsmädchen stehen selten still.
»Fräulein Knauer,« sagte Elsbeth, »bitte, schauen Sie heute nicht in meine Kommode, Sodom und Gomorrha ist nichts dagegen!«
»Ich bekam nicht die passende Kleiderborte zu meinem roten Kleide, deshalb konnte ich es nicht ausbessern,« gestand Gretchen.
»Und ich suchte vergeblich nach Handschuhknöpfen,« meinte Lotte.
»Na, na, entschuldigt euch nur nicht, Strafe muß sein!« sagte Tante.
»Gabriele, hast du denn etwas Ordnung gemacht?« hieß es.
Diese nickte, aber Lotte rief: »Gabriele von und zu Stetten, ich fürchte, die heilige Himmelstochter hat nicht an deiner Wiege gestanden!«
»Lotte, nicht unartig sein!« drohte Tante. –
Nach Tische mußten wir uns alle in unsere Zimmer begeben, um eine Musterung über uns und unsere Sachen ergehen zu lassen. Ich selbst hatte ja alles neu, darum sah das Fräulein nur nach, daß alles ordentlich in die Kasten gelegt war. In Gabrieles Kommode sah es furchtbar aus, sie hatte nicht den mindesten Ordnungssinn. Fräulein Knauer war außer sich und befahl ihr, in ihrer Gegenwart jedes Fach zu leeren und dann von neuem einzuräumen. Gabriele war wütend, sie warf alles so heftig heraus, daß ein Handschuhkasten in Stücke ging, ein Knäuel weithin rollte.
»Nur nicht zu heftig!« sagte das Fräulein ruhig.
Mir war es peinlich, daß Gabriele in meiner Gegenwart Schelte bekam, deshalb bat ich das Fräulein um die Erlaubnis, etwas Klavier üben zu dürfen.
»Ich schicke dir Melanie nach,« sagte sie freundlich, »damit ihr vierhändig spielen könnt!«
Ich ging hinunter in das Musikzimmer, wo bald auch Melanie erschien. Wir spielten die Jubelouvertüre von Weber zusammen, sie klang prachtvoll, und als wir geendet, konnten wir nicht aufhören und spielten weiter und weiter.
»Ach, den ›Freischütz‹ möchte ich so gern hören,« sagte Melanie, als wir daraus gespielt hatten.
»Ich war nie in einem Theater,« gestand ich schüchtern, als ob das eine große Schande sei.
»Um so mehr Genuß wirst du haben! Wir gehen oft, unser Stadttheater ist sehr gut! Da freue ich mich, Liesel, dein erstauntes Gesichtchen zu sehen! Ich setze mich unbedingt neben dich!«
Sie kam mir so verständig vor, diese kleine Melanie! »Wie alt bist du eigentlich?« fragte ich.
»Sechzehn!«
»Ich werde es auch bald!« sagte ich, »aber ich komme mir doch so sehr dumm vor dir gegenüber!« – »Dumm?« sagte Melanie ernst, »nein, so mußt du nicht sagen! Du bist nur bis jetzt wie ein Sonnenkind durchs Leben gegangen und deshalb froh und jugendlich glücklich! Gott erhalte dich noch lange so! Siehst du, wer eine solche engelsgute Mutter verloren hat wie ich, der hat schon in frühester Jugend einen ernsten Blick ins Leben getan, so daß er andern gereifter erscheinen mag. So etwas macht den Menschen innerlich fertig. Ein unsichtbarer Trauerflor senkt sich über alle kommenden Freuden!«
Sie ließ, während sie sprach, ihre Rechte über die Tasten gleiten.
»Morgen ist ein schwerer Tag für mich, Mutters Todestag! Niemand außer dir weiß es. Aber du trägst ja selbst noch Trauerkleidung, du kannst mich am ehesten verstehen.« –
Gretchen erschien, wir sollten uns zum Spaziergange rüsten. Ich war ernst gestimmt durch Melanies Worte. Aber als ich sie dann sah, wie sie sich bemühte, ihren Schmerz nicht zu zeigen, kam auch bei mir die alte Heiterkeit wieder. Ich sollte ja heute zum erstenmal die Stadt sehen. Schnell – denn eben läutete es – ging ich mit Melanie hinauf, zog den dunklen Regenmantel an, setzte meinen großen, schwarzen Filzhut auf und nahm Handschuhe und Regenschirm. In unserm Zimmer herrschte Ordnung, Gabriele saß mit rotgeärgertem Kopfe da.
»Dumme Bimmelei!« rief sie und warf die Bücher hin, »Ruhe hat man hier doch nie!«
»Du bist heute schlechter Laune?« fragte Johanna.
Sie antwortete nicht. –
Wir versammelten uns unten im Garten, der Zug ordnete sich, ich durfte mit Melanie gehen. So sah ich denn die hohen Häuser, die Läden, Fabriken und freien Plätze. An schönen Kirchen, am Theater kamen wir vorbei. Wie ein echtes Kind vom Lande sah ich mich um, staunte die vollbesetzten elektrischen Bahnen, die eleganten Wagen, die geputzten Menschen an. –
Eine volle Stunde dauerte der tägliche Spaziergang, erfrischt, mit roten Backen kamen wir wieder zu Hause an. Im Garten löste sich der Zug auf.
»Nun, wie gefällt dir unser Leipzig, Liesel?« fragte Tante.
Ich erzählte ihr von meinen Eindrücken. Dann fragte ich sie, ob sie erlaube, daß ich noch ein Viertelstündchen länger im Garten bleiben dürfe, ich wolle einen kleinen Kranz für das Bild von Melanies Mutter binden. Gern gab sie mir diese Erlaubnis, ungesehen schlüpfte ich ins Haus und ließ mir ein Knäuelchen feinen Bindfaden geben. Während die anderen die Treppe hinaufstiegen, lief ich wieder in den Garten. Dort hatte ich eine Laube gesehen, reich mit Efeu bewachsen. Sie stand wenig Schritte vom Ufer des kleinen Teiches entfernt.
Ich beeilte mich, es war schon dämmerig. Eine Bank stand dicht am Ufer. Dorthin legte ich meinen Hut. Dann suchte ich Zweige von Efeu, und, beide Hände voll, setzte ich mich auf die Bank. Das Kränzebinden hatte ich schon in frühester Jugend bei Großmutter gelernt. Bei uns gab es nicht wie hier in der Stadt fertige frische Kränze zu jeder Jahreszeit zu kaufen, da machte man sie selber aus Tannenreisig oder anderem Grün. Und ich finde es auch schöner so; es ist eher eine Liebesgabe zu nennen, wenn man mit eigener Hand Blatt zu Blatt und Blume zu Blume fügt, als wenn man einfach einen Kranz fertig kauft. Es ist wie ein Trost, eine Genugtuung. Wie oft hatte ich mit dem seligen Großmütterchen draußen auf den Baumstämmen gesessen, Kränze für das Grab des Großvaters windend.
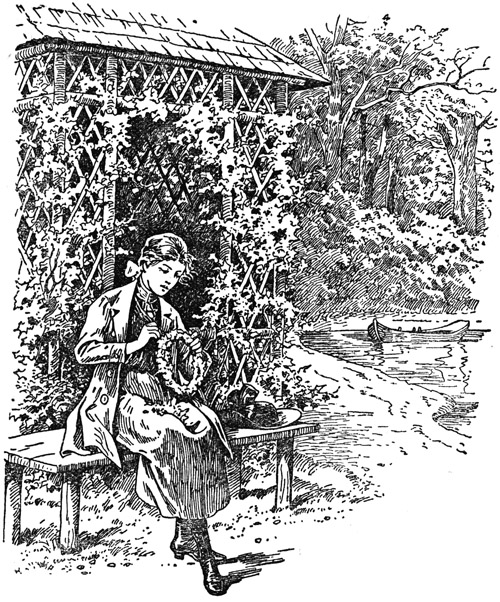
Und später dann, wo sie selbst unter der Erde ruhte, wand ich sie allein für ihre Gräber.
So geht es im Leben – im bunten, wechselvollen, Hügel reiht sich an Hügel; jetzt wand ich noch Kränze für liebe Tote, wie schnell spielt sich ein Leben ab, dann windet vielleicht ein anderer sie für mich!
Es war kein Wunder, daß ich trübselig wurde, Totenkränze bindet man nicht in heiterer Stimmung.
Zart bogen sich die Efeublätter aneinander, mit flinken Händen arbeitete ich. So still war es, nur wie fernes Brausen drang das pulsierende Leben der Großstadt zu mir. Über mir am Herbsthimmel jagten weiße und dunkle Wolken dahin. Raschelnd fiel hie und da ein Blatt zur Erde.
Mit wahrhaft zärtlichem Blick glitten meine Augen über die kräuselnden Wellen vor meinen Augen. Schon wollte etwas wie Heimweh in dieser Abgeschiedenheit in mir aufsteigen, da stand ich schnell auf, nickte den Wellen zu und schüttelte die Blätterreste von meinem Schoße. Der kleine Kranz war fertig, ich hing ihn an meinen Arm und ging ins Haus. Melanie übte, es waren ihr gestern einige Läufe nicht recht gelungen, jetzt hörte ich sie dieselben immer wiederholen. Das kam mir gelegen, ich lief schnell in ihr Zimmer, welches leer war, und befestigte mein kleines Liebeswerk um das Bild der schönen Frau. Es sah sehr hübsch aus, ein ernster grüner Schmuck. –
Als ich am Abend schon im Bett lag – Johanna und Gabriele schliefen längst – huschte eine Gestalt zur Tür herein. Es war Melanie. Das rötlichblonde Haar hing in reichem Gelock aufgelöst um ihre Schultern. Sie flog wie eine Feder auf mein Bett zu.
»Du bist's gewesen? Ich danke dir, Liesel, innig!« Sie bog sich über mich, legte ihren Kopf an mein Gesicht und blieb eine Weile so, während ich ihr Haar zärtlich strich. Dann noch ein leiser Kuß, und die nächtliche Gestalt flog hinaus. –
Der nächste Tag war ein Sonntag. Ich zog mein Konfirmationskleid an. Um neun Uhr fanden wir uns alle ein, um in eine der zahlreichen Kirchen zu gehen. Auf den Straßen sah es heute anders aus, die Läden waren geschlossen, die Menschen im Sonntagsstaat, man sah keine Lastfuhrwerke, man fühlte, es war ein Ruhetag. Jetzt begannen die Glocken fast aller Türme zu läuten, gewaltig brauste es harmonisch über die Stadt hin. Und Mensch an Mensch drängte sich zu den offenen Kirchtüren hinein. – Es ist mir jedesmal feierlich ums Herz, wenn ich über diese Schwelle schreite. Hier sammelt ja ein Gedanke alle, hier weht Gottes Odem, das hohe, säulengetragene Haus trägt seinen Namen, Gotteshaus, und ist ihm zur Ehre erbaut.
Wir setzten uns alle in eine Reihe, in kurzer Andacht senkten sich die Köpfe herab, dann begann auch schon die Orgel zu spielen. Ich betete für meine Lieben daheim, für Anneliese, bat Gott, mich in der Fremde unter Seinen Schutz zu nehmen. Der Geistliche sprach lange und schön vom Geiste Gottes, daß Sein Reich nicht von dieser Welt sei. Ich empfand alles tief, saß blaß und still in meinen Kirchenstuhl gelehnt und schloß für Augenblicke die Augen, ganz in meine Seele aufnehmend, was jetzt die Gemeinde sang, von mächtigem Orgelgetön begleitet: »Wer nur den lieben Gott läßt walten …«
Leise klang das gesungene ›Vaterunser‹ aus, ich sah in der Ferne am Altar den Geistlichen stehen, im Gebet versunken. –
Ich fühlte mich innerlich gestärkt, als wir die Kirche verließen. Ein Schritt heraus aus dem Gotteshaus, und um mich herrschte das jetzt um die Mittagsstunde lebhaftere Treiben der Großstadt. Auf den Promenaden gab es eine ganze Reihe von Spaziergängern, alle genossen noch einmal die goldene Herbstsonne. –
Das Mittagessen, bei dem es heute eine süße Nachspeise und Wein gab, verlief sehr anregend. Nach Tische genossen wir die Freiheit, holten uns Mäntel und Tücher und gingen in den Garten. Bald konnte man überall zwischen den kahlen Bäumen schlanke Mädchengestalten hinhuschen sehen. Die vier Elisabethen spielten im Verein mit den Unzertrennlichen Blindekuh. Ein Lachen und Schreien klang von ihrem Spielplatze herüber.
Gabriele saß auf der Schaukel, die von Johanna ein wenig hin und her bewegt wurde. Suse schlich, einen Band Schiller zärtlich an sich drückend, in eine Laube, und Gretchen lief trällernd, die Hände auf dem Rücken verschränkt, die Wege auf und ab.
Melanie und ich saßen auf der Bank am Teiche; es war bald mein Lieblingsplätzchen geworden.
»Du Müllerskind bist nur froh, wenn du Wasser siehst,« sagte Melanie. Es war nach und nach stiller um uns geworden. In der Ferne hörte man noch die Spielenden, Johanna hatte sich auf einen Gartenstuhl neben Gabriele gesetzt, deren Schaukel stillstand. Beide lasen eifrig und mit geröteten Köpfen.
Melanie war heute ernst und traurig, sobald sie sich allein mit mir wußte. In der Kirche hatte sie geweint.
»O Gott,« begann sie wieder, »heute vor vier Jahren! Um diese Stunde lebte Mama noch, wir hofften, sie solle genesen. Aber eine Stunde später lag sie mit geschlossenen Augen da, Papa und ich standen eng umfaßt am offenen Fenster, beide schluchzend; wir hatten ja das edelste Herz verloren.«
Sie gab sich von neuem ganz ihrem Schmerze hin und war trostlos. Ich erzählte ihr von Großmutters Tod, und das brachte sie ein wenig von ihrem eigenen Leide ab. Dann lief ich an den Teich, ließ das Wasser über mein Taschentuch gleiten und trocknete damit Melanies Augen.
Jetzt kam Ludchen höchst wichtig daher. Sie hatte die Arme auf dem Rücken verschränkt und bog sich herab zu uns. Geheimnisvoll flüsterte sie: »Soll ich euch sagen, was die zwei dort lesen? Einen Roman!« Ihre Empörung war groß. »Sie tun doch nie, was sie sollen, immer nur das, was verboten ist!«
Aber Gabriele mochte die kleine Beobachterin entdeckt haben, sie schoß mit bösem Blicke daher.
»Lude,« rief sie wütend, »wenn du uns verklatschst, dann –« Sie hielt drohend inne.
Stolz hob die Kleine das Köpfchen: »Ich klatsche nie!«
Gabriele kehrte um und las beruhigt weiter.
»Sie sind beide nicht herzensgut,« sagte Melanie.
Da hörten wir die Glocke aus dem Hause; es ging zum Kaffee, der heute bei Tante getrunken wurde.
»Da ist's immer reizend,« sagte Melanie, meinen Arm nehmend, »sag, sehe ich verweint aus?«
Ich verneinte. Und gemütlich und reizend war es in der Tat bei Tante. Im Zimmer war der Tisch gedeckt, ein großer Napfkuchen prangte in der Mitte. Die Tür ins ›Allerheiligste‹ stand offen, und nachdem der Kaffee getrunken war, durften wir noch ein wenig in diesen kleinen Raum eintreten. Jede wollte gern in der Laube sitzen. Ich aber war zuerst hineingegangen. Ich sah, wie Tante etwas abseits bei Melanie stand, freundlich mit der Hand deren Scheitel streichelnd. Gewiß sprach sie liebe Worte zu ihr. Nach einem Weilchen ward uns die Erlaubnis gegeben, Briefe zu schreiben, dies durften wir nur alle Sonntagnachmittage tun. Ich sehnte mich, endlich an die Meinen zu schreiben, hatte ich doch schon vom Vater einen Gruß bekommen. Da saßen wir nun alle im Speisesaale, jede hatte ihre Briefmappe vor sich, einige große Tintenfässer standen zerstreut umher. Zuerst wollte keine Ruhe herrschen, Ludchen begann laut: »Mein innigstgeliebter Freund, du mein Herzenstrost!« Natürlich trieb sie Unsinn. Lisbeth sagte den Anfang ihres Briefes her: »Ich bin im Sonntagskleid und ergreife die Feder« usw. Gretchen setzte die Devise über den Brief an ihren Papa: »Das Herz ist so voll, und der Beutel so leer,« Lotte trieb es noch toller, sie malte in Rundschrift über ihren Brief: »Geld her, Geld her, oder ich fall' um!«
Es war unmöglich, zu schreiben. Da bat Melanie, die an ihren Papa schrieb, mit sanfter Stimme um Ruhe. Sofort war es still, man hörte das Rascheln der Federn, das Blättern der umgewendeten Seiten. – Ich war in meinen Gedanken daheim und erzählte Seite um Seite. Ich hatte ja so viel Stoff, und dann gab's ein Fragen ohne Ende: »Papa, wie geht das Mühlenrad? Macht Mütterchen täglich einen Spaziergang? Was schreibt Hans? Ist Elise gesund? Was macht Fritz? Habt ihr Anneliese gesehen? Ich werde heute auch an sie schreiben. Vergeßt nicht, auf Großmutters Grab die Rosen einbinden zu lassen! Ach, grüßt alles, alles daheim!«
Es fehlten noch wenige Tage bis zu meinem sechzehnten Geburtstage. Ich wußte, da würde ich Briefe erhalten. –
Wir legten alle fertigen Postsachen in ein Kästchen, und dann wurden sie besorgt.
Den Abend verbrachten wir mit Gesellschaftsspielen, und am Montag begann der Unterricht. Lehrer kamen aus der Stadt, wir Neuen wurden in allen Fächern geprüft. Wie anders war es nun, als in unserer kleinstädtischen Schule! Hier wurde in der französischen Stunde nur Französisch, in der englischen nur Englisch gesprochen. In der deutschen Stunde gab es ein schweres Aufsatzthema. Ich entdeckte viele Lücken in meinem Wissen und ging mit Eifer ans Lernen. Aufsätze schreiben war immer meine Lust gewesen, ich schilderte gar zu gern und erging mich in Erzählungen.
Einzelne Stunden gab Fräulein von Tolsky. Sie hatte eine ernste, sanfte Weise, zu lehren, und ihre Schülerinnen hingen mit großer Verehrung an ihr. –
Als ich am Morgen meines Geburtstages die Augen öffnete, fand ich ein Sträußchen duftender Rosen auf meiner Bettdecke. Ein Zettelchen hing daran, und darauf stand: »Herzlichen Glückwunsch von der Jugendfreundin im Heimatstädtchen.« Es war von Anneliese. Sie hatte heimlich an Tante ein Kistchen geschickt und gebeten, mir diese Rosen aus der Heimat aufs Bett zu legen. Zärtlich drückte ich die süßduftenden Blumen der zartsinnigen Freundin an die Lippen. – Ich hatte nicht gedacht, daß es im Pensionate bekannt sein würde, daß die Müllerliesel heute Geburtstag habe. Aber auch ohne Annelieses Sendung hätte Tante daran gedacht, wie sie mir später sagte.
Johanna und Gabriele, welche vor mir aufgestanden waren, da sie noch hatten lernen wollen, kamen und gratulierten mir auf ihre eigene frostige Art; namentlich Gabriele von und zu Stetten hatte stets etwas Herablassendes, sowie sie bürgerliches Blut in ihrer Nähe wußte.
Ich war wieder allein, schon fertig angekleidet und öffnete die Fenster; die Hände gefaltet, lehnte ich da und bat Gott um Seinen Segen; der erste Geburtstag in der Fremde! Nicht mehr wird Großmutter segnend die welken Hände mir aufs Haupt legen, Mutter wird nicht mit einem innigen Kuß den Kopf ihrer Tochter an ihre Brust drücken, Vater blickt nicht lächelnd auf, wenn das Geburtstagskind eintritt, die Brüder ergehen sich nicht in Neckereien: fremd und kühl alles ringsum, so kühl wie der Herbstwind, der drüben durch die Bäume fährt.
»Nur nicht zu ernst geblickt, Geburtstagskind!« rief es neben mir. Ich sah auf. Melanie rief es, ich hatte sie nicht eintreten hören. Sie umarmte mich zärtlich. »Ich habe wohl deinen trüben Blick noch gesehen, Liesel,« sagte sie, »doch denke nicht, daß dich hier nicht auch ein bißchen Liebe umgibt!«
In dem Augenblicke stürmten die Unzertrennlichen herein und überboten sich an reizender Munterkeit.
»Etwas geschenkt bekommst du auch!« rief Lotte.
Sie zogen mich hinunter in den Speisesaal.
»Ich gratuliere dir!« rief es mir von allen Seiten entgegen. Ich wäre am liebsten in ein Mäuseloch gekrochen. Rot vor Verlegenheit faßte ich nach den sich mir hinstreckenden Händen.
Am Fenster stand ein Tischchen mit einem Kuchen, um diesen sechzehn brennende, bunte Lichter, Blumen, wohin ich sah.
»Und hier,« sagte Ludchen, »unser Geschenk für dich!«
Sie gab mir ein kleines Kästchen. Es lag ein geschmackvoll verzierter Goldreif, ein Armband darinnen. »Erinnerung an die Pension,« so stand darauf, innen waren die Vornamen der elf Spenderinnen eingraviert.
Ich war stumm vor Überraschung und fand endlich den Mut, mich bei jeder einzelnen zu bedanken.
Jetzt kam auch Tante mit ihrem freundlichen Wesen, ein Rosenstöckchen in der Hand.
»Das Kistchen von deiner Freundin steht oben in deinem Zimmer,« sagte sie mir, nachdem sie mir von Herzen alles Glück gewünscht hatte.
Wir tranken Kaffee, wobei es heiter zuging; ausnahmsweise trank auch Tante mit uns. Dann ging's zur Schule, für den Nachmittag aber war allgemeine Freiheit prophezeit. Es war stets so, die Geburtstage wurden gefeiert, sie sollten nicht wie jeder andere Tag vorübergehen. –
Einzelne besuchten nicht alle Schulstunden, diese sorgten für das Frühstück. Heute war dieses von Gretchen besonders schön bereitet.
Als wir im Speisesaal beisammen saßen, erschien der Briefträger in der Tür.
»Heute ist alles für dich, Liesel!« sagte Tante, welche bei uns war.
»Gibt's hier eine Elisabeth Freiin von Ferner?« fragte er, einen großen Brief in der Hand haltend. Mir fuhr der Schreck in alle Glieder. Das konnte nur von Hans sein! Die andern blickten mich alle höchst erstaunt und fragend an. Als habe ich ein Verbrechen begangen, ging ich vor und sagte:
»Ja, das ist für mich!« Gesenkten Kopfes nahm ich den Brief in Empfang.
»Also eine kleine Baronesse?« sagte Tante lächelnd und erstaunt.
»Nein, wir führen längst den Adelstitel nicht mehr, ich heiße Ferner! Es ist ein toller Streich meines Bruders!« sagte ich ernst.
Das längste Gesicht hatte wohl Gabriele gemacht. So sehr hatte sie ihr Spürsinn verlassen, sie hatte nicht auf den ersten Blick die Standesgenossin erkannt?! Sie begegnete mir in der Folge mit wahrer Hochachtung und bot mir ihre Freundschaft an, aber Müllerliesel hatte wohl kein blaues Blut mehr in den Adern, sondern warmes Müllerblut; sie dankte. –
Ein Kistchen von daheim! Herrlicher Augenblick, wenn es ausgepackt wird! Briefe lagen obenauf, ein Kuchen, von Mutter gebacken, Blumen, die letzten aus dem Garten. Und ein fester Gegenstand, ein Bild, wie es schien. Ich riß heftig die Papiere ab: unsere Mühle. Ich war sprachlos. Wann war sie denn photographiert worden? Ich hatte ja nie etwas davon gemerkt! Und doch war sie im vollen Frühlingsschmucke! Alle drängten sich um mich, und ich mußte erklären. Wie ein friedliches Idyll lag sie da. Rechts sah man die Werra und die Weiden im dichten Blätterschmucke. Überall blühende Bäume, hochragende Pappeln und im Hintergrunde die Berge. Und mitten drinnen im Schmucke der Natur meine Mühle; ich sah jedes Fenster. Rechts war das Mühlenrad, man meinte die Tropfen fallen zu hören. In der Tür stand Papa, zu einem Fenster heraus guckte Mutter. Eine drollige Gestalt bildete Elise, die am steinernen Tische vor dem Hause stand, einen Korb auf dem Rücken, den eigenartigen, großen Strohhut auf dem Kopf. Und wer saß keck auf dem Brückengeländer, nebeneinander? Hans, Fritz und Anneliese! Die letztere lachte ein wenig, gewiß war es ein lustiger Augenblick gewesen, als sie da hinter meinem Rücken photographiert wurden. Ich war ganz versunken in den Anblick des Bildes, konnte mich ja nicht satt sehen!
»Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp! klapp!« So sang mir Ludchen ins Ohr.
Vater hatte mir Geld geschickt, um mir mit irgend etwas eine Freude machen zu können. Mutter schrieb so lieb, wie sehr sie die Tochter vermisse, wie leer und still es im Hause sei, nun Hans und ich fort seien. Anneliese käme öfters einmal und bliebe im Dämmerstündchen bei ihr. Von Hans werde ich wohl selbst Nachricht haben, er mache den Eltern ein wenig Sorge, indem er sich doch zu sehr in das leichtlebige studentische Treiben stürze.
Über alles schrieb mir Mama, auch über Häusliches. Wie lebhaft stand wieder vor meiner Seele, was ich erst vor wenig Tagen verlassen!
Ich las nun auch Hans' Brief. »Vielliebes Schwesterlein!« so stand oben darüber. Er schrieb nun den tollsten Unsinn, er komme eben vom Frühschoppen, wo er auf mein Wohl getrunken habe. Auch seine Freunde hätten mit ihm auf das Wohl seiner Schwester angestoßen.
»Du wirst über die Adresse erstaunt sein,« schrieb er, »aber ich sehe nicht ein, warum ich mich nicht nennen soll, wie ich heiße. Nenne du dich nur getrost Freifräulein!«
Ich war sehr betrübt über Hans, ich wußte jetzt, auf wie falscher Bahn er wandelte. Welche Sorgen standen uns da noch bevor! Natürlich schrieb ich an ihn später ›Hans Ferner, stud. med.‹ und als Absender klar und deutlich ›Elisabeth Ferner‹. Das war meine Antwort auf seine Bemerkung. –
Gegend Abend – ich hatte noch manch lieben Gruß erhalten – saß ich allein in unserem Zimmer. Vielleicht ahnte man, daß ich gern für ein halbes Stündchen mir selbst angehören wollte. An einem Geburtstage hat ja das Geburtstagskind selbst am wenigsten Ruhe und Zeit, über die Bedeutung des Tages nachzudenken. – Ich saß am Fenster, das Bild in der Hand. Es war in einem schön geschnitzten schwarzen Rahmen. Keinen Blick verwandte ich davon, und doch war es schon schwer, die einzelnen Punkte zu erkennen. Da zogen auf einmal Klänge an mein Ohr, im Musikzimmer mußten alle beisammen sein. Zuerst spielte jemand, gewiß war es Melanie, die Melodie vor, sie kam mir so heimatlich bekannt vor! Und nun fielen sie alle mit ihren jungen, hellen Stimmen ein: »In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad …«
Da kam's mächtig heraufgezogen aus dem Herzen, was ich bis dahin nicht gekannt: das schwerste Weh der Seele, das Heimweh!
Ich fühlte, wie Träne um Träne auf mein Bild fiel. Ich sah, wie der Wind draußen die entlaubten Bäume rüttelte, es rauschte in der Luft, das klang mir wie das Rauschen unseres alten, bemoosten Mühlenrades. Wie weit und auf wie lange lag alles fern von mir, was ich liebte! Ein langer Winter, ein Frühling, ein heißer Sommer sollten vergehen, Hunderte von langen Tagen sich aneinanderreihen, bis ich die Meinen wiedersehen würde! Und je weicher sie da unten das rührende Volkslied sangen, desto tiefer wurde mein Schmerz.
Ich saß in Tränen aufgelöst auf meinem Stuhle am Fenster. Da stürmte Ludchen herein: »Du läßt dich ja gar nicht mehr sehen, Liesel!«
Sie kam näher und blickte ganz bestürzt, als sie mich weinen sah.
»O Gott,« rief sie und schlug die Hände zusammen, »da muß ich Melanie holen!«
Sie selbst schien keinen Mut zu haben, eine weinende Pensionsschwester zu beruhigen. Nach einer Weile kam Melanie. Still trat sie heran, – ihr Wesen erinnerte mich oft an Anneliese, – nahm meinen Kopf zärtlich an ihre Brust und sagte leise: »Heimweh?«
Dies eine Wort allein ließ mich wieder von neuem schluchzen.
»Es ist eine schwere Krankheit,« sagte sie, »aber mit ein wenig Mut und Selbstbeherrschung läßt sie sich ertragen! Denke doch immer, daß dein Kummer vorübergehend ist! Ein jeder Tag ist ja eine Annäherung an das Wiedersehen, Liesel! Und das Bildchen hängen wir hübsch über dein Bett, dann bist du allnächtlich nahe bei deiner Mühle!«
Sie lachte und suchte nach einem Lichte. Dann holte sie geschäftig den Hammer und bald hing das Bild über dem Bette. Ihr Geplauder hatte mich beruhigt. Ich kühlte mein Gesicht in frischem Wasser. Melanie leuchtete mir dazu.
Ich litt noch tagelang, und doch wollte ich mir nichts merken lassen, schrieb auch nach Hause die lustigsten Briefe. Nur Anneliese gestand ich es. Sie schrieb mir sogleich wieder, so ernst, so schön. Es ging ein seltsam trauriger Ton durch ihre Briefe. Zuweilen kam mir der schreckliche Gedanke, als sei meine geliebte, zarte, kleine Jugendfreundin nur ein flüchtiger Gast auf dieser Erde. Ich fragte Mama, wie Anneliese jetzt aussähe, und erhielt die Antwort, sie sei ein blasses, liebes, zärtliches Geschöpf.
Ich war schon über zwei Monate in der Pension und völlig eingelebt. Auf einem herzlichen Fuße stand ich mit Tante. Gar oft ließ sie Melanie und mich in ihr ›Allerheiligstes‹ kommen. Dort mußte ich von daheim erzählen, Melanie erzählte von ihrer Mutter. Dann spielten wir beide allein oder vierhändig. Tante lag im Schaukelstuhle und lauschte andächtig. Sie liebte die Musik über alles, hatte es selbst aber nur zu geringer Fertigkeit gebracht und sagte, sie habe wohl gefühlt, daß sie kein rechtes Talent dafür habe, und zur Stümperei sei ihr die Kunst zu lieb. –
Von daheim erhielt ich immer die gleichen Berichte. Mama schrieb mir mit ihrer feinen, zierlichen Handschrift lange Briefe. Auf der letzten Seite fügten dann Papa und Fritz launige Grüße bei. Einmal hatte auch Elise einen Gruß geschrieben, aber die einzige Zeile lief gewaltig bergan, und Kleckse in allen Größen umgaben sie. Über Hans äußerte sich Mama stets sorgenvoll, er scheine kein Kolleg zu besuchen, statt dessen aber alle Kneipen, und Papa könne nicht genug Geld hinschicken.
Ich konnte nicht anders, ich schrieb an Hans und bat ihn, doch vernünftig zu sein und endlich an den eigentlichen Zweck seines Berliner Aufenthaltes zu denken. Ich erhielt die Frage, ob er sich denn um meine Angelegenheiten kümmere, und seit wann ich ›meines Bruders Hüter‹ sei? Ich erreichte nichts; es war wie so oft im Leben, kein vernünftiger Rat half, der Herr Student geriet hinein in den Taumel leichtsinnigen Genießens und – das Verderben ging seinen Lauf.
Weihnachten rückte heran. Eine fieberhafte Tätigkeit entwickelte sich. Bis lange nach dem Abendbrote saßen wir im Speisesaale beisammen und machten Geschenke. Die vier Elisabethen malten gemeinschaftlich ein Dutzend Tassen, die sie Tante schenken wollten. Die Unzertrennlichen boten ein drolliges Bild: sie strickten jede für ihren Papa ein Paar – Socken. Auf meine höchst erstaunte Anfrage erhielt ich die Antwort, daß die Väter sich das ausgebeten hätten, als Beweis, daß die Töchter häuslich seien und den echt weiblichen Strickstrumpf nicht vernachlässigten. –
Die meisten blieben zum Feste in der Pension, nur drei der Elisabethen fuhren als Vielbeneidete heim. Wir arbeiteten oder kauften jede ein Dutzend kleine Geschenke, die einen bestimmten Preis nicht überschreiten durften. Diese wurden gut eingewickelt und mit Nummern versehen, dann an Tante abgegeben.
Ich hatte für jeden daheim etwas gearbeitet, sogar Hans eine grünseidene Börse gehäkelt. Auch an Anneliese hatte ich natürlich gedacht und ihr einen Rahmen gearbeitet um das Bild der Mühle, das sie auch besaß. –
Der Gärtner kam eines Abends mit einer duftenden Last an, einer mächtigen, breitästigen Tanne. Sogleich zog jener Weihnachtsduft durchs Haus, der noch in späten Jahren wirkt und mit unsichtbarem Finger an die Menschenherzen klopft. Die Kinderzeit mit ihrem selig harmlosen Genießen wird wieder geweckt aus versunkenen Jahren.
Ich war jung, und jene Zeit lag mir noch nicht fern, deshalb empfand ich den Zauber beinahe kindlich rein. Wir umstanden den Tannenbaum, der aber schnell zu unserm größten Bedauern in Tantes Zimmern verschwand. Sie behielt es sich stets allein vor, ihn zu putzen, um doch auch eine Überraschung für uns zu haben.
Später erzählte sie mir, wie eigen ihr stets ums Herz sei, wenn sie so allein bei verschlossenen Türen sitze und die Äpfel und Nüsse vergolde. Dann wäre es ihr, als sei sie in Wahrheit die Mutter all der jungen Mädchen, die bei ihr seien. Allerlei Märchen fielen ihr dabei ein vom Christkindlein, das heimlich reichbeladen zur Erde fährt. Ich erzählte ihr, mit welch heiligem Ernste ich damals mein Briefchen an das Christkindchen verfaßt habe und mit welcher Scheu ich den Goldstaub an meinem Fingerchen betrachtet hätte. –
Die drei Abreisenden erhielten ihre Geschenke im voraus, wir anderen aber feierten ein schönes, weihevolles Weihnachtsfest. Nach fleißiger Arbeit waren die Geschenke fertig, es war gestickt, gemalt, geschnitzt, gezeichnet worden. Nun gab es ein großes Einpacken, Kistchen in verschiedenen Größen wurden von uns herbeigeschleppt. Bindfaden in allen Stärken lag da, ein Wachslicht brannte beständig, und Siegellacktropfen gab es auf Tischen und Stühlen. Aber Braun, der alte Gärtner, Diener, Faktotum des Hauses, belud sich endlich doch mit all den Kisten und trug sie zur Post. Dann kamen für uns die heimatlichen Kistchen, die wir wohl öffnen durften, aber unausgepackt in den Salon stellen mußten. Und dann war Weihnachten. Die Dämmerung kam, wir standen am Fenster und sahen schon hie und da die Christbäume aufblitzen; gewiß hatten es ungeduldige Kinderherzen nicht mehr erwarten können, bis die Klingel sie rief.
Es wurde eine kurze Andacht gehalten, bei welcher wir zum Schluß ›Stille Nacht, heilige Nacht‹ sangen. Ich war ganz weltentrückt. An eines der Fenster gelehnt, sang ich mit, und während ich auf den glitzernden Schnee blickte, sahen meine Gedanken ein trautes Bild, unsere Mühle, in die schneeige Winterpracht gebettet. Lichtlein um Lichtlein taucht hinter den gefrorenen Scheiben auf, leise rauscht das Rad, – o friedliche, poesieumgebene Weihnachtsidylle! – Es ward mir schwer, mich von den Gedanken loszureißen, die das Lied in mir geweckt hatte, die überhaupt mit dem Duft des Tannenbaumes gekommen waren.
Nach der Andacht öffnete Tante die Flügeltüren. Da stand hoch und strahlend der Weihnachtsbaum. Sie hatte ihn märchenhaft geschmückt, silberne und goldene Fäden zogen sich von Ast zu Ast, im dunklen Grün leuchteten goldene Äpfel und silberne Nüsse, glitzernder Staub lag auf den Nadeln, es war ein Funkeln und Strahlen, ein Duft von Tanne und Kerzen, echt weihnachtlich. –
Zuerst packten wir unsere Kistchen aus; Mutter schickte mir allerlei Nützliches, selbstgebackene Zuckersachen, einen großen Zweig von unserem Weihnachtsbaum, den ich später um das Bild der Mühle befestigte.
Elsbeth jubelte, ihr reicher Onkel hatte ihr eine prachtvolle Geige geschickt. Mit hochroten Wangen ergriff sie sogleich den Bogen und spielte etwas. Lotte und Ludchen knieten nebeneinander auf dem Fußboden vor zwei großen Kisten. Mit beiden Händen wühlten sie darinnen und förderten die schönsten Dinge heraus. Aber sie hatten nicht den Wert für sie, wie für minder reiche Mädchen. Sie brauchten ja nur einen Wunsch zu äußern, so war er schon erfüllt. Als sie alles gesehen hatten, warfen sie es wieder hinein. Beide hatten so ziemlich die gleichen Geschenke erhalten, Schürzchen, Schleifen, Bücher, Briefmappen usw.
Johanna hatte sich einen Brillantring gewünscht. Und als sie nun unter der Fülle der wertvollsten Geschenke, die sie gleichgültig beiseite legte, den Ring, der in einem reizenden Kästchen lag, fand, steckte sie ihn an den Finger. Nicht ein Schimmer von Freude zeigte sich in ihrem Gesichte. Armes reiches Mädchen! Anders die beiden Cousinen, Grete und Suse. Sie hatten sich sehnsüchtig Pelzmützchen gewünscht, und siehe, eine jede packte ihr Mützchen aus. Sie setzten sie sogleich auf und hüpften vergnügt im Zimmer umher.
Gabriele war ebenfalls reich bedacht worden und hatte, da sie später reiten lernen wollte, einen schwarzen Reitanzug bekommen.
»Zieh ihn doch gleich einmal an!« schlug Ludchen vor, aber Gabriele wollte nicht. Sie war auf Ludchen nicht gut zu sprechen, seit diese um die verbotene Lektüre wußte. Melanie hatte von ihrem Papa auch eine Kiste und darin das erhalten, was sie sich gewünscht hatte: Noten. Sie stand da und blätterte.
»Liesel,« rief sie mich, »das ist etwas für uns, ›Tannhäuser‹ vierhändig! Da wird in den Feiertagen fleißig geübt!« –
Von Hans hatte ich eine schöne Schreibmappe erhalten; ich wußte, daß sie viel zu kostbar und daß es der Eltern schwerverdientes Geld war, von dem er diesen Luxus bezahlte. Ich hätte mehr Freude über ein einfaches Geschenk gehabt. –
Nun ging es an ein Verlosen unserer Geschenke. Da gab es viel Spaß, denn der Zufall hatte bewiesen, daß er nicht immer blind ist: Gabriele packte einen kleinen Kuchen aus, der in Form einer Krone gebacken war; die fünf Punkte waren von Schokolade. Ludchen freute sich über ihr gelungenes Werk, Gabriele zog sich beleidigt zurück, erhielt aber dann noch viel Hübsches, was sie wieder versöhnte. Ich hatte viel zu wickeln und viel Papiere abzureißen, und was kam nach und nach zusammen? Sechs Schreibzeuge und vier Nähsteine. Das Gelächter nahm kein Ende, als die anderen meine Bescherung mit ansahen. Ich tauschte nun aus, man nahm mir gern meine Tintenfässer ab.
Bei Tische ging es heiter zu. Dann saßen wir wieder in dem Bescherungszimmer, wo von neuem die Lichter angezündet wurden, plaudernd umher, einzelne naschten Zuckerzeug, probierten Schürzchen und Schleifen, andere hatten die Köpfe eifrig lesend über die erhaltenen Bücher gebeugt, Elsbeth spielte Geige, Melanie probierte dazwischen einmal ein neues Stück, Ludchen hatte sich heimlich mit Gabrieles Reitanzuge aus dem Staube gemacht. Plötzlich trat sie als Reiterin ein; da sie dieselbe Größe wie Gabriele hatte, paßte ihr das Kleid sehr gut. Sie sah allerliebst aus, das Reithütchen auf dem dunklen Haar, die Gerte in der Hand. Gabriele machte große Augen, lachte aber doch gleich uns laut auf, als Ludchen mit einem ›Hü! Hott!‹ hüpfend umhersprang, als ob sie auf einem Pferde säße. Elsbeth spielte die brillantesten Triller dazu. –
»Kinder, ich glaube, es ist Zeit, zu Bett zu gehen!« sagte Tante und – horch – es zischte ein wenig, und ein Lichtlein war verloschen. Schnell brannte eins nach dem andern herab. Tante wollte nach einer Lampe schicken, aber wir baten sie, zu warten, bis es ganz finster war.
Und merkwürdig, je düsterer es wurde, um so stiller wurden wir. Dicht saßen wir beisammen; hie und da ein leises Wort, ein Flüstern, dann war es ganz still.
»Die heilige Nacht!« sagte Tante. Es ward uns feierlich und weihevoll ums Herz. Noch drei matte Lichtchen brannten, das eine davon hoch oben. Es war fast finster geworden, denn der matte Schein leuchtete nicht weit. Da verlöschte wieder eins, wieder ein Schein weniger, noch eins; matt wie ein ferner kleiner Stern glühte und knisterte das letzte Licht, ein leises Zischen, Glimmen, das Flüstern der sterbenden kleinen Flamme, ein letztes, bläuliches Aufstrahlen, – dann saßen wir im Dunkeln.
Es blieb still, niemand wagte dies Schweigen zu brechen. Es flog in weißen Flocken an die Scheiben, Glockentöne schwebten heran, ein mattes, silbernes Licht brach sich durch die Scheiben Bahn: der Mond.
Endlich ein vielfaches Seufzen, dann ward der Bann gebrochen, und zwar auf die drolligste Weise, die uns Träumende schnell in die Wirklichkeit zurückbrachte. Ludchen sprang auf und rief in komischer Verzweiflung: »Nein, das halt' ich nicht mehr aus, Lotte, wo steckst du denn? Macht doch Licht!«
Schnell kam Leben in die Gesellschaft. Als wir uns wieder in heller Beleuchtung sahen, wischte manche heimlich schnell über die Augen. Wir nahmen nun Abschied von Tante, sagten uns heute doppelt herzlich gute Nacht, und keine wohl hat je diese Weihnachten vergessen. Ich wenigstens dachte an jeder künftigen noch daran zurück, denn es waren für lange Zeit die letzten Weihnachten, die ich in vollster Sorglosigkeit verlebte. –
Am ersten Feiertage kam Ludchen gestürmt, eine Zeitung in der Hand: »Hört, heute abend ›Der Freischütz‹, wer geht mit? Tante läßt fragen, wieviel Eintrittskarten Braun holen soll!«
Ein Jubel folgte ihren Worten. Auf den ›Freischütz‹ hatten wir schon lange gewartet. Einigemal war ich im Theater gewesen, doch nicht im Neuen und auch nur in Lustspielen. Zum erstenmal sollte ich eine Oper hören. Alle entschlossen sich einstimmig, mitzugehen, und so bestellte Franz eine ganze Parkettreihe.
»Nicht zu nahe der Bühne!« rief Melanie noch nach, »denn sonst hört man die Musik zu deutlich!«
Wir waren den ganzen Tag wie aus dem Häuschen. Keine Schule, vollste Freiheit nach der Kirche, Tante machte Gesellschaftsspiele mit uns, der Christbaum wurde einiger süßer Sachen beraubt, wir alle waren im schönsten Sonntagsstaat, kurz, es war ein echter Feiertag. – Als wir nun aber wußten, wir gehen ins Theater, setzten Melanie und ich uns gleich ans Klavier, um alles aus dem ›Freischütz‹ zu spielen, was wir nur besaßen. Ich glaube, ich kannte fast jede Melodie. Elsbeth begleitete vieles auf der Geige, und Tante saß lauschend in ihrem kleinen ›Allerheiligsten‹. Am Mittag gab es einen Gang mehr und Wein. Am Nachmittag machten wir unsern täglichen Spaziergang; die beiden Pelzmützchen wurden von ihren Besitzerinnen das erstemal an die Luft geführt. Dann wurden Dankbriefe nach Hause geschrieben. So eifrig waren wir dabei, daß Ludchen uns melden mußte: »Anziehen!«
Das war nun ein Vergnügen für uns Pensionsmädel! Tante hatte uns erlaubt, helle Kleider zu wählen. Wie die Mücken schwärmten wir durcheinander, von einem Zimmer ins andere. Sogar die ernste Melanie war von der allgemeinen Putzsucht angesteckt worden. Elsbeth kam in unser Zimmer mit, da es ihr zu einsam war; sie trug ihr hellgraues Kleidchen über den Arm gehängt. Tante hatte mir gesagt, daß ich für diesen Abend die Trauer um Großmutter einmal ablegen sollte. So zog ich ein hellblaues Kleid an. Melanie fragte, ob sie so gehen könne. Sie sah allerliebst aus in dem zartgelben Kleide, Rosen an der Brust. Die Unzertrennlichen glichen ein paar Elfen in ihren schneeweißen Kleidern, das Haar aufgelöst und Moosrosen am Ausschnitt. Johanna legte ein dunkles Samtkleid an und sah fürstlich aus, Gabriele ein rosafarbenes. Suse und Gretchen erschienen in hellen Kattunkleidchen, die ihnen sehr gut standen.
Es läutete; nun ging das Hin- und Herjagen erst recht los. Überall hörte man die Türen klappen.
»Meinen Abendmantel, Lotte, hast du ihn?«
»Mein Opernglas! Elsbeth, du hast es mir noch nicht zurückgegeben von neulich!«
»Gabriele, bitte, nimm doch meine Handschuhe! Die langen, gelben auf der Kommode!«
»Liesel, laß dir den Theaterzettel von Braun geben!«
Wir waren am Theater angelangt. Der Kunsttempel war erleuchtet, eine schwarze Masse von Theaterbesuchern drängte sich an den Eingängen. Mir ward schon feierlich ums Herz, als wir die marmornen Treppen hinaufstiegen. In der Garderobe waren viele Leute, wir halfen uns untereinander beim Ablegen der Mäntel, jede warf noch schnell einen Blick in den Spiegel. Dann folgten wir Tante und Fräulein von Tolsky. Die kleinen, innen dunkelrot tapezierten Türen, die in das Parkett führen, wurden geöffnet. War es in den Garderoben und Gängen schon für meine Begriffe hell gewesen, so strahlte mir jetzt eine Fülle blendenden Lichts entgegen. Ein leises Gemurmel ertönte rings um uns, als wir unsere elf Plätze eingenommen hatten. Melanie saß neben mir.
»Liesel, sieh dich nur einmal erst ordentlich im Raume um!« sagte sie.
Ich wagte es; hoch droben in schwindelnder Höhe an einer köstlich gemalten Decke hing der Kronleuchter. Ringsum waren Logen, die sich mit Menschen füllten. Das Ganze war so bunt und farbenprächtig, so strahlend, daß es mich überwältigte. Ein leises Summen, wie es von Fächerrauschen und Flüstern entsteht, ging durch den Raum, ein Duft von feinen Wohlgerüchen floß hindurch. Ich sah den Vorhang an und das Gemälde darauf, es stellte verschiedene Szenen aus den Klassikern dar; in Lebensgröße sah man die rührende Gestalt der Jungfrau von Orleans mit Panzer und Helm, daneben Fausts Gretchen, vor dem Muttergottesbilde kniend. Auf der anderen Seite Tasso inmitten der beiden Leonoren, Egmont mit Klärchen usw. – Immer mehr Menschen strömten herein; ich versuchte trotz des Flüsterns um mich her ein wenig im Textbuch zu lesen.
Aber kaum hatte ich einige Seiten überflogen, so schreckte mich das Klopfen des Taktstockes auf. In den Orchesterraum hatten sich die Musiker begeben, aus grünbeschirmten Lampen fiel das Licht auf ihre Noten. Am Pulte stand der Kapellmeister; seine schmale, weiße Hand, welche den Taktstock hielt, leuchtete förmlich.
Im Nu erstarb das Summen, Rauschen, Flüstern, ein langgezogener Ton erscholl, die Ouvertüre begann. Nach wenig Sekunden waren meine Gedanken fort, nicht mehr im Theaterraume, ich schwelgte förmlich im Genuß. Wie wunderherrlich war diese Musik! Wie so ganz anders, so viel machtvoller erklang diese Ouvertüre hier, von so viel Instrumenten ausgeführt, als auf einem Klavier!
Und nun hob sich der Vorhang, ein buntes, ländliches Bild, das mich an die Heimat gemahnte, ein Platz vor einer Weinschenke, Jäger, Bauernmädchen, Kinder. Ich lauschte dem gesungenen Wort und mußte doch lachen, als ich auf einen Augenblick zu Melanie hinsah; mit gespanntem Ausdrucke hingen ihre Augen nicht auf der Bühne, sondern an mir.
Ich drückte ihr die Hand, und nun folgten wir beide dem Spiele.
Wer kennt nicht die schönste, volkstümlichste der deutschen Opern? Sie ist so echt deutsch in Text und Melodien, daß sie wohl so lange gesungen werden wird, so lange es Deutsche gibt.
Ich selbst kannte diese weichen Melodien, diese frischen Jägerlieder schon lange. Wie entzückend war das Duett in der einfachen Forststube, das Ännchen, das lustige, übermütige Kind, mit der blonden, sanften Jägerbraut Agathe sang! Diese letztere wurde von einer ätherisch schlanken Mädchengestalt dargestellt, das liebliche Gesicht war von blondem Haar umrahmt, zwei lange Zöpfe fielen auf das grüne Kleid. Sie hatte eine kraftvolle und doch wieder der zartesten Töne fähige Stimme.
Eine wahrhaft weihevolle Stimmung herrschte in dem menschengefüllten Raume, als Agathe jetzt allein auf der Bühne war. Durch die Fenster fiel helles, silbernes Mondlicht auf die schöne Mädchengestalt, die auf den Stufen zum Altan stand.
»Leise, leise, fromme Weise!
Schwing' dich auf zum Sternenkreise!
Lied erschalle! Feiernd walle
Mein Gebet zur Himmelshalle! –«
Mir kamen die Tränen, und es ging auch wie ein leises Weinen, Beben durch die wie atemlos lauschenden Menschen. Die Worte allein sind schon ein schönes Gebet, und nun noch in diese wunderbare, weiche Melodie gekleidet! –
Es folgte die Szene in der Wolfsschlucht, grausige Gestalten umgaben die beiden Jäger, welche die Freikugeln gossen, die Gestalt der Agathe erschien gespenstisch. Mir wurde doch erst wieder wohl, als die hellen Gasflammen aufstrahlten und der Vorhang vor das düstere Bild gerollt war.
Es war ein Zwischenakt, und wir gingen hinaus. In dem langen Saale drängten sich die Menschen, eifrig miteinander plaudernd. Manch freundlich lächelnder, hie und da auch ein bewundernder Blick fiel auf den Pensionszug. Man mochte wohl auf den jugendlichen Gesichtern die Begeisterung lesen. Melanie und ich plauderten eifrig. So entging uns eine kleine Szene, die nach Elsbeths Schilderung sehr drollig gewesen sein muß. Plötzlich hatte Ludchen, die natürlich neben Lotte ging, einen tiefen Gruß von einem Herrn erhalten. Mit flammend rotem Gesichtchen hatte sie gedankt. Es war Herr Trost gewesen. Daß unser Ludchen, welches den betreffenden Herrn dann in einer der ersten Parkettreihen entdeckte, von da ab dem ›Freischütz‹ nicht mehr die schuldige Aufmerksamkeit schenkte, war sicher.

Wir anderen, denen kein solcher Trost ward, lauschten begeistert weiter und hatten rotglühende Wangen, als der letzte Ton verklang. –
In der Garderobe war ein großes Gewühl, endlich hatten wir aber doch sämtlich unsere Mäntel um und hielten uns eng aneinander, damit keine verloren ging.
Wie sonderbar ist der Kontrast: eben noch mit der ganzen Seele wo anders, in einer fremden, phantastischen Welt, von Melodien umschmeichelt, und jetzt in die nüchterne Wirklichkeit hinein! Und doch nicht nüchtern! Ist eine Winternacht wirklich nicht noch tausendmal schöner, als alle erträumte gemalte Pracht? Hier die mondbeschienenen, stillen, grauen Häuser, darüber ein sternbesäter Himmel, zu Füßen glitzernder Schnee! Um uns noch kurze Zeit die aus dem Theater strömenden Menschen, dann waren wir allein. Auf dem Schnee verhallten die Schritte lautlos. Melanie und ich gingen still nebeneinander hin; ohne daß wir davon sprachen, fühlten wir die Majestät dieser Naturschönheit. –
Zu Hause angekommen, legten wir nur in unseren Zimmern die Mäntel ab, und dann fanden wir uns alle im Speisezimmer wieder. Wie gut uns nach dem ästhetischen Genusse doch der materielle tat!
»Erst die Seele, dann der Leib!« meinte Lotte vergnügt.
Ludchen aß wenig, was ihr eine Menge Neckereien eintrug. Es war gewiß ein buntes, belebtes Bild, alle die hellgekleideten jungen Mädchen in dem erleuchteten Zimmer.
Braun kam und meldete dem gnädigen Fräulein, – das war Tante, – daß er den Teich gekehrt und mit Wasser begossen habe, nun glaube er sicher, es gebe morgen gutes Eis zum Schlittschuhfahren, die Nacht verspreche ohnedies sehr kühl zu werden.
Eine neue Freude in Aussicht! Bis jetzt hatten wir oft ratlos an dem kleinen Weiher gestanden, der durchaus nicht zufrieren wollte. Wir warfen Steine auf die Fläche, sie versanken sogleich. Aber nun endlich hatten wir Aussicht, daß er seine Schuldigkeit tun würde. Für den Januar war ja das Eisfest bestimmt, das Tante alljährlich einmal gab. Es wurden einige befreundete Familien mit ihren Söhnen dazu eingeladen. –
Wir wußten nicht, wovon wir mehr sprechen sollten, von den eben genossenen Freuden oder von den künftigen. – Glückliche, sorgenlose Pensionszeit! Nur immer Sonnenschein gab es da. –
Nach dem Essen schlich sich Melanie ins Musikzimmer, und bald hörten wir, andächtig lauschend, noch einmal die schöne Melodie des Gebetes: Leise, leise …
Ludchen warf einen sehnsüchtigen Blick an die Decke, als suche sie da oben einen Trost. –
Am andern Morgen sahen wir, daß es sehr kalt gewesen sein mußte, denn das Wasser in unseren Krügen war gefroren.
Gabriele war jetzt, seit sie etwas wie das Wörtchen ›von‹ bei mir vermutete, von großer Zuvorkommenheit. Wenn mich das auch nicht über ihren Charakter täuschen konnte, so war es doch bei dem täglichen Zusammenleben angenehmer als früher. Sie öffnete das Fenster, das bis oben gefroren war, und rief: »Hört, heute gibt es ganz entschieden Schlittschuhbahn!«
Wir jubelten und brachten alle an den Kaffeetisch schon unsere Schlittschuhe mit. Viele davon waren stark verrostet, wurden aber mittelst Sandpapier und Öl wieder glattgemacht.
Tante befahl Braun, daß er erst einmal die Eisdecke prüfe. Dieser tat es, indem er am Rande ein Loch hineinhackte.
»Sie trägt!« war der Ausspruch unseres alten Faktotums, der von Mund zu Munde ging. Nun gab es bei uns kein Halten mehr. Ich selbst sehnte mich ja, wieder einmal auf dem Wasser zu sein, und wenn es auch gefrorenes wäre. Auf der Werra selbst hatte es selten Eisbahn gegeben, aber Papa hatte stets eine der die Mühle umgebenden Wiesen unter Wasser setzen lassen, und das war dann eine prächtige und dabei noch ungefährliche Eisbahn geworden. Wie oft hatten wir Müllerskinder, Ernst und Anneliese mit inbegriffen, auf der Nase gelegen! Wie oft waren wir heulend, halb erstarrt, blau vor Kälte, bei einbrechender Dunkelheit endlich in die Stube gekommen, zu Mutters Schreck, die sogleich die erfrorenen Glieder mit Schnee zu bearbeiten begann!
Das war in der Kinderzeit gewesen, jetzt sah die Sache freilich anders aus. In Hut und Mantel, warmen Handschuhen, setzte ich mich gleich den anderen auf eine der Bänke, die um den Weiher standen, und ließ mir von Braun die Schlittschuhe anschnallen. Dann ging's hinaus. Ich raste wie toll über den kleinen Weiher hin, so daß keine mir folgen konnte. Verschiedene der Pensionärinnen lernten es erst, Melanie fuhr leicht und sicher, Elsbeth glitt sogleich aus, die Unzertrennlichen faßten sich an und wagten sich schüchtern auf die Eisdecke.
»Hand in Hand mit dir, so fordre ich mein Jahrhundert in die –
»Schranken«, hatte Ludchen sagen wollen, kam aber nicht so weit, denn sie und Lotte befanden sich bereits in engster Berührung mit dem Eise und durchaus nicht mehr in jener aufrechten Haltung, die den Menschen vom Tier unterscheidet. Wir anderen bildeten eine lange Reihe, fuhren zu Paaren und nahmen auch die Armen, die es noch nicht konnten, mit unter unsere Flügel. Ich holte mir Ludchen, Melanie nahm Lotte. Es war freilich keine leichte Aufgabe, denn bei jedem Schritte klammerte sich Ludchen ängstlich an mich, rufend: »Ich falle!«
Tante, in einen Pelz gehüllt, erschien auch und ermahnte, daß alle sich gut einüben sollten, sie wolle das Eisfest nun baldigst geben, da man das gute Wetter und die Bahn benützen müsse.
»Ludchen,« rief sie neckend, »lerne es fleißig, damit sich Herr Trost nicht allzusehr mit dir plagen muß!«
Ein Schrecken durchfuhr Ludchen, ihr glühend rotes Gesichtchen wandte sie der Tante zu: »Sie wollten ihn wirklich einladen?«
»Gewiß!«
Nun hätte jemand den Feuereifer Ludchens sehen sollen!
»Laß mich einmal allein probieren, Liesel!« bat sie und stolperte los. Glückselig fuhr sie eine kleine Strecke, dann wandte sie sich wieder hilfesuchend um. –
Als es zum zweiten Frühstück läutete, wollte keine hinein.
»Ich esse nichts!« rief Ludchen und übte sich weiter.
»Lotte, du könntest das Frühstück holen, wenn es Tante erlaubt!« schlug ich vor.
Ich hatte nämlich gesehen, daß Lottchen bereits einen Schlittschuh verloren hatte. Schnell, erlöst, stieß sie den andern ab, daß er ein Stück auf dem Eise hinrutschte. Dann flog sie wie ein Pfeil nach dem Hause hin und kehrte nach einiger Zeit mit einem Körbchen zurück, das unsere Brötchen enthielt. Hinter ihr in langsamem Schritte kam Fräulein Knauer und brachte für jede ein Glas Wein, das Tante schickte. Wir setzten uns alle der Reihe nach in den Schnee längs des Ufers und ließen es uns schmecken. Braun, in sein dickes Butterbrot beißend, sah in einiger Entfernung lächelnd zu.
Es schmeckte herrlich nach dem Laufe in der frischen Winterluft. Wir ließen die Gläser aneinander klingen, und ich stieß mit Ludchen noch einmal besonders auf Herrn Trost an. Darauf leerte sie ihr Glas mit einem Zuge. Wie tief muß dieser junge Mann in dem kleinen Herzen sitzen, dachte ich. O ihr Anfänge einer jener rührenden ersten Neigungen in einem reinen Mädchenherzen! Noch mit grauen Haaren gedenkt man jener Zeiten, wo die Liebe wie ein erstes Morgenrot in die Seele zog. –
Wir fuhren bis gegen Mittag, und am Nachmittag konnte man eine einsame Gestalt sich üben sehen: Ludchen. Sie wagte nicht zu fragen, wann Tante das Eisfest geben wollte, sie wartete geduldig und übte sich täglich, so daß sie wahrhaftig schon sicher auf ihren zwei Füßchen war, als der große Tag, der fünfzehnte Januar, sich nahte. –
Von daheim hörte ich allerlei, was meine Freude freilich ein wenig trübte; fern, fern begannen schon die Schatten heraufzuziehen, die so bald auf meinen Lebensweg fallen sollten. Hans nahm keine Vernunft an; es schien wohl bisweilen, als kehre er zu besserer Einsicht zurück. Dann atmeten wir auf. Ich liebte ja unsern schönen, flotten, herzensguten Hans; ich hoffte im stillen, meine zarte, gemütvolle Anneliese solle guten Einfluß auf ihn haben, so wie ein edler Mensch schon durch sein bloßes Wesen veredelnd auf andere wirkt. Aber er lebte fern von ihr, und sie wagte nicht, brieflich auszusprechen, was sie von Angesicht zu Angesicht so leicht gekonnt hätte. – Papa hatte Sorgen im Geschäfte, es ging nicht mehr so gut wie früher, und dabei kosteten die Kinder jetzt dreimal so viel.
Auffallend war es mir auch gewesen, daß Anneliese zu dem Taschentuchbehälter, den sie mir gearbeitet hatte, nur wenige Zeilen mit Bleistift geschrieben hatte, sich mit allzuviel Arbeit entschuldigend. Ich bat Mama, mir doch offen zu schreiben, wie es meiner Freundin ginge. Da schrieb sie mir: »Anneliese war am ersten Feiertage bei mir, sie sieht blaß aus und fühlt sich müde. Ich fürchte, das arme Kind ist nicht recht gesund und will es doch niemand wissen lassen. Sie will dir bald einen Brief schicken.«
Ich wartete nun sehnlich, daß dieser Brief käme; unser Eisfest war schon in den nächsten Tagen. Eines Morgens brachte mir Melanie endlich das ersehnte Schreiben. Anneliese schrieb wie immer, doch fiel mir auf, daß ein seltsamer, müder Zug durch ihre Zeilen ging. Eine innere Angst stieg in mir auf, ich weinte mich an Melanies Schulter aus, ich ahnte, daß ich meine geliebte Jugendfreundin nicht allzulange mehr haben würde. Voll zärtlicher Liebe schrieb ich ihr, kaufte in einem Blumenladen ein paar blühende Rosen und schickte sie ihr. Ein Dank, so rührend und wahr gemeint, traf von ihr ein. Sie schrieb, daß sie fast täglich nach der Mühle wandere und dabei in Erinnerungen an unsere schöne Jugendzeit schwelge. Sie freue sich, daß doch schon mehr als ein Viertel meiner Pensionszeit abgelaufen sei. Jeder Tag, der uns getrennt hielte, sei ein Schritt zum Wiedersehen.
Annelieses Bild stand mit auf meiner Kommode. Wie oft lehnte ich sinnend davor und betrachtete das hübsche Gesicht mit den treuen, dunklen Augen! –
Obwohl die Sorge um meine Freundin auf mir lag, ging ich doch mit Eifer an die Vorbereitungen für unser Fest. So vergißt die sorglose Jugend leicht das Trübe, und das ist eben ihr glückliches Vorrecht.
Das Wetter hatte sich gehalten, es war kalt geblieben und wenig Schnee gefallen. Wir saßen am Morgen des Festes, wo wir von aller Schule frei waren, im Speisezimmer zusammen. Es sah bunt dort aus, auf dem Tische lag eine Menge Papierlaternen in allen Farben. Wir waren dabei, Lichte in diese Laternen zu stecken und banden dann aus Tannengrün breite Girlanden. Den Hauptteil der Arbeit besorgte freilich der alte Braun, aber es war doch ein großer Spaß für uns, auch ein wenig zu helfen. Fräulein Knauer hatte viel zu tun, denn es sollte natürlich auch etwas zu essen geben für die Gäste, deren wir wohl zwanzig erwarteten. Auch Herr stud. theol. Trost hatte dankend zugesagt. Aber merkwürdig, Tante meinte, seine Karte sei aus der Visitenkartenschale verschwunden. Ludchen blickte rot vor Schreck auf ihren Teller. – Sie war ohne Zweifel die fleißigste in diesen Tagen. Unermüdlich machte sie bunte Papierketten, suchte Braun auf, um ihm zu raten und zu helfen, fragte Fräulein Knauer über alles aus, was es gebe, und ging sogar in die Küche, um daselbst zu helfen.
Viele der Gäste kannten wir, da Tante sie stets zu uns geführt hatte. Es waren Familien mit Töchtern und Söhnen, dann einige Studenten und Schüler des Konservatoriums. –
Am Mittag wurde natürlich von nichts anderem gesprochen, als von dem Feste, das um sechs Uhr beginnen sollte. Braun kehrte alle Wege sauber von Schnee, dann begann er, die letzte Hand an die Ausschmückung zu legen, und wir durften nicht dabei helfen, denn es sollte ja für uns alle eine Überraschung werden. Auch hatten wir jetzt im Hause genug zu tun.
Mit Staubtüchern bewaffnet, eilten wir von Zimmer zu Zimmer, putzten Leuchter und Silberzeug, polierten Teller und Gläser und halfen Fräulein Knauer, ein herrlich appetitliches Büfett aufzubauen. Überall war es schon festlich; da es zeitig dunkel wurde, brannten die Kronleuchter und Lichte. Tantes ›Allerheiligstes‹ duftete wie ein Garten zur Rosenzeit. –
Nun mußten wir selbst uns fertig machen. Wir trugen dunkle Winterkleider, ich selbst ein schwarzes, denn ich trauerte ja noch um Großmutter.
Die Unzertrennlichen aber und Johanna hatten sich weiße Eiskostüme machen lassen; es waren entzückende Kleider, mit weißem Schwan besetzt, dazu Mützchen und Muff. –
Vorläufig fanden wir uns alle in Tantes Zimmer ein, die Gäste zu begrüßen. Diese ließen auch nicht lange auf sich warten. Wir waren natürlich alle sehr neugierig auf Herrn Trost. Ludchen, in ihrem weißen Wollenkleidchen, hatte sich in die äußerste Ecke des Salons geflüchtet. Und dorthin sahen wir auch sogleich einen hübschen Studenten, die bunte Mütze in der Hand, steuern. Nun, guten Geschmack hatte die Kleine; der Trost ihres Herzens war ein hübscher, frischer Student mit klugen, lustigen Augen, die mit sehr viel Entzücken auf unserer kleinen Pensionsschwester ruhten.
Als alle versammelt waren, bat Tante, erst ein Glas Wein zu nehmen oder Tee mit Gebäck, dann wollten wir in den Garten. Die Dienstmädchen reichten die Getränke herum, und wir standen nicht müßig, sondern boten Gebäck und Früchte an.
Nach einem Viertelstündchen gab es einen allgemeinen Aufbruch. Mäntel und Hüte wurden genommen und dann ordnete sich der Zug zu Paaren.
Herr Trost verbeugte sich vor Ludchen, welche wie ein Schneeflöckchen aussah. Ihre Schlittschuhe nahm ihr Herr Trost sogleich ab und hing sie zu den seinigen an den Arm. –
Jeder der jungen Herrn hatte sich einer von uns genähert, die Gäste untereinander sich auch zu zweien aufgestellt. Den Zug eröffnete Tante mit einem alten Medizinalrate. Wir gingen heiter plaudernd die Treppe hinab, da empfing uns unten – Musik! Wie horchten wir! Sechs Musikanten mit Blasinstrumenten zogen uns voran. Jetzt war es erst recht schön. Die Nacht schien sternklar zu werden.
Durch die Wege des Gartens, vom alten Braun geführt, ging der Zug. Aber welch ein Garten war das jetzt! Von Baum zu Baum hingen bunte Laternen, schaukelten Girlanden über uns, so dicht, daß wir das letzte Stück bis zum Weiher wie unter einer gewölbten Laube gingen.
Und nun der Weiher selbst! Ein lautes, allgemeines »Ah!« der Bewunderung; sicher glitt in diesem Augenblicke ein schmunzelndes Lächeln über des alten Braun Gesicht. – Es war in der Tat feenhaft. Den ganzen Teich umsäumten dicht kleine Lämpchen, deren Flämmchen sich in der glatten Fläche funkelnd widerspiegelten. Künstliche Blattpflanzen standen in kleinen Gruppen ringsum, und aus diesen leuchteten wieder helle Blumenkelche. In der Mitte des Teiches war eine hohe Pflanzengruppe aufgestellt, und von dieser aus gingen über unseren Häuptern nach allen Richtungen hin Girlanden, die drüben an den Bäumen befestigt waren. Und an diesen Girlanden schaukelten Laternen in allen Größen und Farben.
Es war ganz überraschend schön. Den ganzen Teich umsäumten Bänke. Auf diesen ließen sich jetzt die Damen nieder, und die Herren schnallten ihnen die Schlittschuhe an. – »Ob der Weiher uns auch alle trägt?« hörte ich ein schüchternes Stimmchen neben mir. Es war Ludchen. Ihr Trost antwortete sehr laut, daß, wenn die Decke bräche, ja nur eine Nixe zur anderen käme. –
Für die Musikanten war ein Bretterboden, dick mit alten Teppichen belegt, errichtet.
Jetzt erklang eine Polonaise, und alles, was fahren konnte, ging auf das lockende Eis. Die älteren Herrschaften blieben noch eine Weile zuschauend stehen und kehrten zeitweise in das Haus zurück, sich zu wärmen. – Mein Herr war Engländer und Musikstudent, und wir fanden so viel Gesprächsstoff, daß die Unterhaltung nicht stockte. – Die Musikanten spielten Stück auf Stück. Wie schön lief es sich nach dem Takte der Musik!
Lotte mußte erleben, daß ihre sonst so zärtliche Lude heute kaum ein flüchtiges Lächeln für sie hatte, und das betrübte sie ernstlich. Ich tröstete sie und sagte, daß Ludchen ihr doch sicher jedes Wort beichten werde, das sie mit ihrem Herrn gesprochen. –
Wir hatten nun doch auch Appetit bekommen vom Fahren in der kalten Winterluft und entledigten uns gern der Schlittschuhe für einige Zeit, denn daß wir noch mehr fahren wollten, stand fest. – Wie reizend hatte inzwischen Fräulein Knauer alles allein hergerichtet! Unser armes Fräulein von Tolsky hatte Trauer bekommen und war verreist, da sie nun ohnehin nicht an dem Feste hätte teilnehmen können.
Im Empfangszimmer und in den angrenzenden Räumen waren kleine Tischchen mit bunten Decken aufgestellt. Ein Körbchen mit Weiß- und Schwarzbrot stand darauf und an jedem Tischchen standen vier Stühle. Wie sich die Menschen gerade fanden und zueinander hingezogen fühlten, so nahmen sie Platz. Melanie mit ihrem Herrn und mein Engländer und ich nahmen ein Tischchen für uns. Die Herren eilten, gefüllte Biergläser und Wein zu holen, während wir für uns vier die Teller mit all den guten Sachen füllten, welche das Büfett enthielt.
Auf dem Sofa und um den großen, ovalen Tisch davor hatten die älteren Herrschaften Platz genommen.
Unsere Musikanten stärkten ebenfalls Seele und Leib, sie waren im Schulzimmer untergebracht. Da sie aber, wie es schien, schneller aßen als wir, so versammelten sie sich nach einiger Zeit auf dem großen Vorsaale und machten uns eine heitere Tafelmusik.
Daß es äußerst angeregt bei uns zuging, versteht sich von selbst. Jugend, Wein, Licht und Glanz, Musik, alles so reichlich vertreten, – da hörte man nur heiteres Lachen und Plaudern.
Herr Trost klopfte an sein Glas und hielt eine Rede, so voll von Witz und drolligen, studentischen Redensarten, daß die Gesellschaft aus dem Lachen nicht herauskam. Unwillkürlich dachte ich mir Hans an seine Stelle; so flott mochte er auch sein. Tante trat an unsern Tisch und bat uns, doch etwas vierhändig zu spielen. Gern willigten wir ein und trugen unter dem Beifalle der Gäste verschiedenes vor. Übermütig sangen wir schließlich alle miteinander Volkslieder, bis Tante sagte, wenn wir noch etwas fahren wollten, sei es hohe Zeit.
Nun löste sich alle Ordnung auf. Wir ließen uns abermals die Mäntel umlegen und wanderten in den Garten. Braun, der inzwischen den Teich gekehrt hatte, war nicht sichtbar, dafür leuchtete plötzlich ein prachtvolles Rotfeuer auf, als wir am Weiher ankamen. Es war wie in ›Tausend und eine Nacht‹, märchenhaft.
Schnell waren die Schlittschuhe angeschnallt, und nun trieben wir den tollsten Unsinn.
Wir tanzten auch einen Konter, führten einen ›Ringelreihen‹ auf, spielten ›Schlange‹ und wurden nicht müde, uns auf dem Eise herumzubewegen, trotzdem es empfindlich kühler zu werden begann. Aber alle Lust hat ein Ende. Tante schickte, wir möchten kommen. –
Eine Viertelstunde später lag der Weiher, eben noch so belebt, im Dunkeln. Von den vielen Lämpchen, die ihn umsäumt hatten, stieg ein dünner Qualm auf, die Laternen, jetzt ihres leuchtenden Inhalts beraubt, baumelten schneeweiß dort oben, die Girlanden rauschten leise im Nachtwinde.
Wir fragten Tante, ob wir in unsern dunklen Kleidern tanzen sollten. Sie sagte:
»Wenn ihr binnen fünf Minuten umgezogen sein wollt, dann tut es meinetwegen!«
Lotte hüpfte die Treppe voraus, sah nach ihrer Uhr und rief: »Da ich bleibe, wie ich bin, so werde ich aufpassen, daß ihr in fünf Minuten fertig seid!«
Eine war der anderen behilflich, wir zogen dieselben Kleider wieder an wie in die Oper.
Bei unsern Gästen erregte unsere Schnelligkeit Bewunderung.
Die Tischchen waren inzwischen verschwunden; jetzt erklangen die ersten Töne einer Polonaise, welche unsere fleißigen Musikanten spielten, und wenige Minuten später bewegten sich etwa fünfzehn Paare durch die Zimmer. Von da ging es hinaus in die teppichbelegten Korridore und in Tantes Zimmer wieder herein. Im Empfangszimmer, aus dem alle störenden Möbel entfernt waren, wurde getanzt. Mitternacht war längst vorüber, als die Gäste ernstlich an ein Fortgehen dachten. Es wurde ihnen von Tante gesagt, daß sie sich alle wieder einfinden sollten zur Feier ihres Geburtstages, der in den Juli fiel. Selbstverständlich wurde dieser Tag in der Pension ordentlich gefeiert mit Aufführungen aller Art und einem schönen Sommerfeste. Wir hatten sogar heimlich schon die kühne Idee gehabt, diesmal alle Aufführungen in den Garten zu verlegen. –
* * *
Die Monate vergingen, ich machte Fortschritte in den Schulstunden und im Klavierspiele. Manchmal, wenn Klagen von daheim kamen, gedachte ich meiner unsicheren Zukunft. Bis dahin hatte ich in sorgloser Kindheit gelebt, man hatte nie die Frage an mich gerichtet: »Willst du etwas werden? Wovon lebst du in deinem Alter?« Es war ja den Eltern so selbstverständlich gewesen, daß die Mühle in Fernerschen Händen bleiben, daß dann auch für die einzige Tochter des Hauses darin ein Heim sein würde. Aber die Eltern hatten nicht bedacht, daß es einmal mit der Mühle rückwärts gehen könne, daß ihr Ältester die besten Anlagen zu einem Verschwender hatte.
So dachte ich jetzt oft heimlich darüber nach, auf welche Weise ich mir einmal meinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Da Melanie die Vertraute meines Herzens war, besprach ich alles mit ihr. Sie selbst wollte dereinst Stunden geben, vielleicht auch einmal gelegentlich in einem Konzert mitwirken, da ihr Können sie dazu berechtigte.
»Dasselbe könntest du doch auch tun, Liesel,« meinte sie, »denn wir sind beide gleich weit im Spiel!«
Ich sann nach; es war doch ein Hoffnungsstrahl, so konnte sich meine Zukunft einmal gestalten! In meinem Heimatstädtchen gab es nur einen alten Klavierlehrer und eine Menge Kinder. Melanie und ich machten daraufhin wieder die schönsten Pläne. –
Eines Tages war ich mit den Unzertrennlichen in der Küche beschäftigt. Die Frühlingssonne schien zu den Fenstern herein; zwar wärmte sie noch nicht sehr, doch ihr Strahl war golden und weckte Hoffnung und Freude. Einzelne dichte Knospen waren an den Bäumen sichtbar, die dicht an den Fenstern standen.
Nachdem der Braten zugesetzt war, saßen wir drei auf niederen Holzschemeln und putzten Spinat. Von oben hörte man Melanies Spiel.
»Hört,« begann Lotte, »an Ostern gehen ja so viele unserer guten Schwestern ab!«
»Wer eigentlich alles?«
»Elsbeth und die beiden anderen Elisabethen, dann Johanna, vielleicht Gabriele.« Sie wollte noch mehr darüber sprechen, als wir einen dumpfen Fall und Schrei hörten. Wir sahen uns erschreckt an. Was war da geschehen? Eine Minute später stürzte Elsbeth bleich herein und rief atemlos: »Melanie ist gefallen; kommt!«
Wir waren keines Wortes mächtig, ließen die Messer fallen und gingen Elsbeth nach. Mir zitterten die Knie. Im Klavierzimmer hörten wir viele Stimmen durcheinanderschwirren. Wir blickten durch die offene Tür hinein. Da sah ich Melanie totenblaß auf dem Sofa liegen, die Augen geschlossen. Meine Melanie, meine geliebte Freundin! Im nächsten Augenblicke kniete ich neben ihr, umfaßte sie und rief weinend ihren Namen.
Endlich erfuhr ich aus den Reden der anderen, daß Melanie ohnmächtig geworden sei und man sie so gefunden habe. Als Elsbeth zum Üben gekommen war, war Melanie eben hingestürzt. Sie blutete aus einer Kopfwunde. Wir wußten nichts zu tun, als mit einem feuchten Tuche das Blut zu stillen. –
Stunden waren vergangen, Melanie lag in dem hellen, freundlichen Krankenzimmer, das nach dem stillen Garten hinaus gelegen war. – Sie schlief, der Arzt hatte gesagt, es würden Wochen vergehen, bis sie das Bett wieder verlassen könnte. Tante, die sehr bestürzt war, nahm den Vorschlag des Arztes nicht an, Melanie in ein Krankenhaus zu schicken, sie wollte lieber eine Pflegerin nehmen.
»Tante, lassen Sie mich Melanie pflegen!« bat ich leise. Der alte Medizinalrat nickte und sagte:
»Wenn das Fräulein es sich zutraut, so wäre es mir lieber, denn die Kranke hat ein sehr empfindliches Nervenleben. Jedes fremde Gesicht wird sie ängstigen, während das der Freundin ihr lieb und vertraut ist. Und so schwer wird die Pflege nicht sein, da habe ich schon schlimmere Fälle gehabt. Auch ist ja noch andere Hilfe da!«
Ich blickte dankbar den alten Herrn an. Tante gab es zu, sie wolle wenigstens den Versuch machen. So zog ich in das kleine Stübchen, das vom Krankenzimmer nur durch einen Vorhang getrennt war. – Während draußen mit aller Pracht der Frühling ins Land zog, saß ich still am Fenster und blickte oft träumend hinaus. Mit Melanie ging es langsam besser, der alte Arzt meinte lächelnd, das käme nur von meiner Pflege. Ich schrieb fast täglich an Melanies Vater und freute mich, ihm immer Besseres melden zu können. –
Als Melanie zum erstenmal die Augen in vollem Bewußtsein öffnete, galt ihr dankerfüllter Blick mir. Eines Tages, als ich sie frisch gebettet hatte, sagte sie: »Liesel, Gott hat dir deinen künftigen Beruf ins Herz gelegt, werde Krankenpflegerin! Du bist dazu wie geboren. Wenn ich aus unruhigem Fieberschlafe erwachte und sah dein frisches, ruhig lächelndes Gesicht über mir, so kam es wie Friede über mich!«
Ich setzte mich an ihr Bett, sie liebkoste meine Zöpfe und legte sie auf die Bettdecke, bis ich neckisch durch eine schnelle Wendung des Kopfes sie ihr nahm.
»Wen du pflegst, Liesel, der wird gewiß gesund, schon dir zuliebe!« sagte sie und wandte ihr schönes, jetzt etwas abgezehrtes Gesicht mir zu. Das rötlichblonde Haar lag auf ihren Schultern.
»Es ist mir auch schon der Gedanke gekommen, diesen Beruf zu ergreifen, falls die Not mich zwingt, auf eigenen Füßen zu stehen. Er erscheint mir so hoch und heilig, Melanie! Kranke pflegen, ihnen die schwere Last des Leidens erleichtern, ist so schön! Du sagst, es sei dir wohltuend gewesen, als du mein Gesicht sahest. Aber siehst du, der schönste Lohn liegt doch für die Pflegerin in dem dankbaren Blick des Genesenden. Hat dir mein Anblick Ruhe gegeben, so waren mir deine dankbar erfüllten Augen ebenso herzerfreuend. Es muß hochbefriedigend sein, als Krankenpflegerin zu wirken!«
Melanie legte sich in die Kissen zurück und sprach leise weiter: »Ich kannte ein junges, schönes Mädchen. Sie hatte viel Unglück, Enttäuschungen im Leben erfahren, da entschloß sie sich, Krankenpflegerin zu werden. Nach einigen Jahren sah ich sie, als sie zu kurzem Besuche ins Elternhaus kam. Weißt du, Liesel, der Anblick des Mädchens hatte für mich etwas Heiliges. Sie war eine Erscheinung wie du, groß, blond, und trug ein Mützchen, dessen weiße, gefaltete Spitze ein wenig in die Stirn ging; sie war in der Tracht der Pflegerinnen, schwarz und schlicht. Ein milder Ernst lag auf ihrer jugendlichen Stirn, eine unbeschreibliche Weichheit und Güte über ihrem Wesen. Die Kranken nennen ja oft ihre Pflegerinnen Engel; Margarete hatte etwas von einem solchen an sich. Kein Neid, keine Bitterkeit, kein tolles Jagen nach Vergnügungen, wie sie andere Mädchen ihres Alters lieben, nur eine heilige Begeisterung für ihren Beruf. Ach, Liesel, ich beneidete sie um ihres Friedens willen!«
Ich schwieg. Immer klarer ward mir der Gedanke, es jener Margarete nachzutun. Freilich, blieb zu Hause alles beim alten, dann wußte ich nur einen Beruf: den Lebensabend der Eltern zu verschönern. –
Ludchen steckte den Kopf zur Tür herein: »Darf ich?« Ich nickte, und sie flog ans Bett: »Geht's besser, meine süße Melanie?« –
Die Pensionsschwestern waren rührend in ihrer treuen Sorge gewesen. Solange Melanie in Lebensgefahr geschwebt hatte, war kein lustiges, ja kein lautes Wort im Hause gesprochen worden. Mit gesenkten Köpfen schlichen sie umher. Kein Musikton wurde gehört, alles ging auf den Zehen.
Ließ ich mich einmal blicken, so hingen gleich ein paar mir am Arme: »Wie geht's, Liesel?«
Tante hatte mich öfters abgelöst, auch Elsbeth und Johanna auf vieles Bitten einmal die Nachtwache übernehmen dürfen, aber die meiste Zeit hatte ich die stillen Stunden im Krankenzimmer bei meiner Melanie zugebracht. Hier las ich, arbeitete, schrieb Briefe und ging nur manchmal zu den Mahlzeiten hinunter. –
Inzwischen war Ostern da, und vier aus unserem schönen Kreise sollten die Pension verlassen. Elsbeth erschien schon immer mit verweinten Augen. Gabriele freilich war wohl innerlich froh, aus dem ihr so lästigen Zwange wieder in die Freiheit zu kommen. Johanna sollte mit ihren Eltern nach Paris; ihre Gedanken waren schon immer auf der schönen Reise und sie nur noch mit halbem Herzen hier. Freilich, solange Melanie ernstlich krank war, gedachte wohl keine der lockenden Aussichten.
Eines hatte sich im Laufe der Zeit geändert. Melanie hatte auch zu denen gehört, welche Ostern abgehen sollten. Aber auf meine und ihre Bitten gab es ihr Vater zu unserer großen Freude zu, daß sie noch bis zum Herbste bleiben durfte.
Dieses Ostern würde überhaupt ein stilles werden: vier fort, vier nach Hause, denn auch die Cousinen Gretchen und Suse holten schon fleißig Koffer herbei, Melanie aber war noch Rekonvaleszentin. Fräulein von Tolsky wollte bis zur russischen Grenze ihren Verwandten entgegenreisen und dann an irgendeinem Orte die Ferien verleben. –
Tante saß an Melanies Bett, morgen sollte diese zum erstenmal aufstehen. Es war zwei Tage vor dem Abschiedsessen.
»Traurig und still wird's zu Ostern sein!« sagte Tante. »Es tut mir immer so weh, wenn einige fortgehen von meiner Schar! An die neuen muß man sich erst wieder gewöhnen.«
Ich saß am Fenster und blickte in den dämmernden Frühlingsabend hinaus.
»Tantchen, werden viel Neue kommen?« fragte ich.
»Nur zwei. Eine aus Grimma, die Tochter eines Arztes, Karola Bachschild, und ein junges Mädchen aus Magdeburg, Elisabeth Tittmann. So erhält doch die Elisabeths-Ruh wieder einen Zuwachs. Melanie siedelt doch zu ihrer Liesel über, nicht wahr?«
Wir stießen einen Freudenschrei aus. Es war ja ein längst gehegter Wunsch von uns gewesen, daß wir zusammenziehen wollten, aber wir hatten Tante noch nicht zu bitten gewagt, da wir wußten, sie liebte die steten Umzüge nicht.
Ludchen und Lotte sollten die Karola, die noch sehr jung war, zur Stubengenossin haben, Elisabeth kam natürlich, das war schon bestimmt, in die Elisabeths-Ruh.
Ich war in einer sehr gedrückten Stimmung. Trotzdem meine geliebte Freundin als genesen zu betrachten war, konnte ich zu keiner rechten Freude des Herzens kommen. Wie ein Alp lag es auf mir. Von Mama hatte ich vor einigen Tagen einen traurigen Brief erhalten. Hans war wieder um einen Schritt gesunken und hatte beträchtliche Schulden gemacht, die Papa bezahlt hatte, ihn ernstlich ermahnend. Das war ja aber nur ein neuer Kredit für diesen Leichtsinn. So fürchtete wenigstens Mama. Sie mußte viel Sorgen haben, und ich war fern und konnte sie nur aus der Ferne mit ihr teilen. Es ging auch im Geschäft nicht gut. »Es ist, als sei aller Segen mit unserer Liesel aus dem Hause!« schrieb Mama. Und nun gar Anneliese! Meine kleine, zarte Anneliese! Sie war wie eine welkende Blume. Mama schrieb, daß sie bei ihr war; da sei sie voller Hoffnung gewesen, aber so fieberglühend und dabei so matt. »Mache dich gefaßt, mein Kind,« hieß eine furchtbare Stelle in Mamas Brief, »deine Freundin vielleicht auf dieser Erde nicht wiederzusehen!« Ich hatte, das war das Schwerste, alles das gelesen und gelitten, ohne Melanie etwas davon ahnen zu lassen. Kein Mensch wußte um das furchtbare Weh in meiner Brust.
»Du bist blaß, mein Kind!« hatte Tante gestern gesagt. »Geh in den Garten, Herzchen, es ist so schön dort! Die Krankenluft hat dir deine roten Bäckchen genommen!«
Als Melanie das hörte, geriet sie außer sich: »O, es ist meine Schuld!«
So trat ich lachend an ihr Bett und verbiß die Tränen. Ich wandelte allein in den Wegen des Gartens auf und ab, nichts empfindend von der herrlichen, keimenden Pracht um mich. Wie hatte ich mich sonst über jedes grüne Blättchen freuen können, wie jede Blume verfolgt! Und diesmal sah ich es gar nicht, was so herrlich sich in knospender Pracht entfaltete.
Die quälenden Gedanken, eben erst von der täglichen Sorge um Melanie befreit, irrten bald zu den Eltern, die ich sorgend und einsam wußte, bald zu Anneliese, die ich nicht anders als sterbend sah. Und als greller Gegensatz zu alledem Hans im tollen, gewissenlosen Rausche, von einem Vergnügen zum andern jagend.
Ja, die Schatten kamen immer näher. Großmütterchens Worte fielen mir ein: »Verliere nie das Gottvertrauen …« In der Zeit der Prüfung erst zeigt sich der wahre Glaube, denn im Sonnenscheine, im Glücke, ist es leicht, gut und fromm zu sein. –
Es wurde dunkel, ich ging wieder hinauf in unser Krankenstübchen. Tante war noch da, Ludchen und Lotte saßen auf dem Sofa. Ich mußte Melanie die Versicherung geben, daß mir gar nichts fehle, und zog mich wieder auf meinen Sitz am Fenster zurück.
Es war noch ein wenig Zeit bis zum Abendessen, deshalb wollten die drei noch bleiben. Melanie schlief ein; das leise Musizieren, das vom Musikzimmer heraufklang, und ein frischer Frühlingsregen, der an die Fenster klopfte, hatten sie eingeschläfert.
Alle schwiegen. Tante lehnte im Sessel, sie konnte uns nicht sehen. Die Unzertrennlichen saßen Hand in Hand. Ich hatte die Hände gefaltet und blickte in den Garten. Vor mir auf dem Fensterbrette stand Annelieses Bild. Nur noch schattenhaft sah ich es. Ich ahnte es wohl, aber ich wußte es nicht, daß sich in dieser Stunde die treuen, dunklen, gemütvollen Augen meiner Jugendfreundin für immer schlossen. –
Am andern Morgen, als ich Melanie ihre Schokolade brachte, fand ich einen Expreßbrief, den mir Ludchen leise und von Melanie ungesehen auf mein Tischchen am Fenster gelegt hatte. Mit zitternden Knien mußte ich mich setzen. Dann erbrach ich das Schreiben Mamas. Es enthielt nur die kurze Nachricht, daß Anneliese gestern abend sanft entschlafen sei, ohne schweren Todeskampf. Mama schrieb noch mit erregter Hand einige liebe Trostesworte an mich.
Ich saß da und war wie vom Schlage getroffen. Und wenn man es sich auch zehnmal in Gedanken ausmalt, was Schweres kommen muß: tritt es dann wirklich ein, so ist es noch viel furchtbarer. Ich fühlte, daß ich totenblaß sein mußte, ich war eiskalt.
Zum zweitenmal griff der Tod erbarmungslos in die Reihe meiner Lieben. Und diesmal war es ein Leben, das erst am Erblühen gewesen! Siebzehn Jahre war Anneliese alt geworden; Großmütterchen stand ja am Ende des Lebens, sie war gern bereit, den Schritt ins dunkle Jenseits zu tun. – Aber meine junge Anneliese, war sie gern gegangen? Ich würde sie nicht mehr finden, wenn ich wieder nach Hause kam, nur ihr Grab. – Ich mußte wohl laut geschluchzt haben, denn Melanie rief: »Um Gottes willen, was hast du, Liesel!«
Ich zwang meine Stimme zu einer Harmlosigkeit, die mir einen schneidenden Schmerz verursachte, und sagte: »Aber, Melanie, du hast geträumt!«
»Komm, Liesel, setze dich zu mir!« bat sie.
Ich spielte die Entrüstete, denn meine verweinten Augen hätten alles verraten, sprang in mein Stübchen und rief: »Was denkst du, Kind? Mein Bett noch nicht gemacht, keinen Staub gewischt, das geht nicht! In einer Viertelstunde stehe ich dir zu Diensten!« Drüben tat ich freilich weder das eine noch das andere, sondern steckte den Kopf in die Kissen meines Bettes und weinte mich aus. Ich schrie den Namen meiner toten Freundin; jetzt erst ward mir klar, wieviel ich verloren hatte. So war ihr Gruß an jenem nebeligen Herbstmorgen, als ich abreiste, der letzte gewesen! – –
Ich hörte Schritte, Tante kam, sich teilnehmend zu erkundigen, welche Nachricht mir der Eilbrief gebracht hatte.
Leise, erschrocken richtete sie mich auf: »Liesel, was ist denn geschehen?«
»Meine Freundin ist tot!« Jetzt, da ich es selber aussprach, kam es mir noch viel entsetzlicher vor. – Tante preßte mich an sich; sie streichelte mein Haar, küßte mich und sagte:
»Ihr ist wohl, deiner jungen Freundin!«
Wir weinten beide. – Nach und nach, als Tante wieder fort war, kamen auch die anderen. Sie waren rührend in ihrer Teilnahme. Die meisten wußten freilich noch nicht, was es heißt, ein Liebes als tot beweinen zu müssen, aber sie ahnten es doch. Ludchen suchte mich aufzuheitern. Sie zog mich auf einen Stuhl und sagte:
»Hier bleibst du sitzen, bis ich dein Bett gemacht habe! Und Lotte, du staubst ab!«
Die Kleinen überboten sich an Liebenswürdigkeit. Wie zwei Täubchen flatterten sie in ihren hellen Morgenkleidchen hin und her.
Elsbeth und Suse hatten sich zu Melanie gesetzt, um diese zu zerstreuen. Gabriele und Johanna waren in der Stadt, um noch einige Einkäufe zu machen.
Selbstverständlich machte ich die Feier nicht mit, welche den Abgehenden galt. Ich war am Nachmittage in der Stadt gewesen und hatte für meine arme Anneliese einen prachtvollen Kranz gekauft von Immergrün, Lorbeer und Rosen. Ich trug ihn in Ludchens Zimmer, und dort wurde er in eine große Kiste gepackt, wobei mir der alte Braun mit einem ernsten Gesicht half.
Ich hatte schon an Annelieses und meine Eltern geschrieben. Der Beerdigung konnte ich der weiten Entfernung wegen nicht beiwohnen. Aber Mutter hatte mir Tag und Stunde geschrieben, damit ich im Geiste doch meine Freundin zu ihrer Ruhestätte begleiten könne. Ich wußte auch so ungefähr den Platz, nahe der Tannenhecke, welche den Friedhof umgab.
Während nun unten im Speisesaale ein fröhliches Treiben herrschte, freilich schon etwas vermischt mit Abschiedsweh, saß ich bei Melanie. Tante hatte gesagt, daß diese soweit genesen sei, daß ich mit ihr ruhig von dem Verluste, der mich betroffen hatte, sprechen könnte.
Es war fast finster bei uns im Zimmer. Melanie wollte kein Licht, sie liebte gleich mir ein Plaudern im Dunkeln. Es ist, als ob sich da der innere Mensch eher zeige, denn die edelsten Gefühle haben sonderbarerweise mit den schlimmsten ein Gleiches: sie scheuen das Licht. –
Ein Schein des letzten Tagesschimmers fiel auf mich, als ich an Melanies Bett saß. Ich trug mein schwarzes Kleid, diesmal in der Trauer um Anneliese.
»Hör' einmal, Liesel, jetzt habe ich dich allein und ganz fest!« sagte Melanie und nahm meine beiden Hände zwischen die ihrigen, die nicht mehr fieberglühend waren, »nun beichte ins treue Herz deiner Freundin, was sich ereignet hat!«
»Melanie! Gern; aber du mußt dich nicht von neuem aufregen!«
Sie richtete sich empor, legte ihren Arm um meine Schulter und sah mir in die Augen:
»Du bist blaß und schmal geworden in diesen letzten Tagen, Liesel! Die Liebe sieht scharf, ich bemerkte es wohl. Hat Hans neue Sorge gemacht?«
»Nein, Melanie, das ist es nicht, obwohl auch er uns nur Kummer macht. Aber – Anneliese ist gestorben!«
Ich wunderte mich selbst, mit welcher Ruhe ich das jetzt sagte, da ich mir Mühe gab, Melanie nicht aufzuregen.
Sie schwieg, ein schmerzlicher Zug legte sich um ihren Mund. Jedes neue ›Tot!‹ schien in ihr furchtbare Erinnerungen zu wecken.
»Tot!« sagte sie leise vor sich hin, »ich habe sie nie gesehen, aber sie muß ein liebliches, reines Geschöpf gewesen sein. Arme Liesel! Gott helfe dir, es zu tragen. Wenn du einmal im Leben wissen willst, wo ein Herz ist, das dich mit gleicher Liebe liebt wie Anneliese, so denke an mich!«
Sie streichelte meine Hand, und wir umschlangen uns stillschweigend und innig.
Unsere Tränen um verlorene Lieben mischten sich. Ein Bund, der in solchen Stunden geschlossen wird, ist für das Leben. Gott war uns gnädig, er hat mir meine Melanie erhalten, und sie hat auch ihrer Liesel eine treue Liebe bewahrt, trotzdem unsere Wege von Gott so verschieden geführt wurden. –
Wir plauderten an jenem Abende noch lange. Melanie suchte mich von meinem Schmerze ein wenig abzulenken. Dann kamen auch einzelne der Pensionsschwestern herauf und brachten uns allerlei von den guten, leckeren Sachen, die es heute gab. Elsbeth zündete ein Licht an, Ludchen und Lotte folgten reichbeladen, Lisbeth brachte Wein. Da Melanie alles genießen durfte und auch in mir, die ich seit Tagen nichts genossen hatte, der Appetit sich regte, so langten wir tapfer zu.
»Ihr habt's gut!« sagte Elsbeth und zerbröckelte ein Stückchen Kuchen. »Ach, könnte ich noch bleiben!«
»Tröste dich!« sagte ich. »Wie bald ist solch ein Sommer herum, und dann heißt's wieder für uns: scheiden!«
»Es ist ja das ganze Leben nichts wie ein ewiges Kommen und Gehen,« meinte Melanie, »des einen Zeit währt länger, dem anderen ist sie kurz bemessen! Ganz gewiß ist jeder zu beneiden, der fertig mit allem ist!«
»Aber, das finde ich gar nicht!« sagte Ludchen. Sie, als Liebende, empfand anders. »Kinder, seid nicht tragisch! Dazu ist noch Zeit, wenn wir weiße Haare haben! Aber jetzt heißt's: ›Noch sind die Tage der Rosen!‹ Hört, das müssen wir nachher singen! – Kommt, stoßt an! Auf daß wir uns dermaleinst als glückliche Gattinnen wiedersehen!«
Wir mußten lachen trotz aller Trauer. Alle stießen an. Da steckte noch jemand den Kopf zur Tür herein. Es war Tante.
»Hier geht's ja sehr fidel zu, das freut mich! Elsbethchen, dein Abschiedsschmerz wird sehr versüßt! Paß auf! Soeben schreibt mir Johannas Vater, daß er auf den Wunsch seiner Tochter eingeht und dich, wenn du es wünschest, mit nach Paris nimmt. Dort sollst du ein halbes Jahr studieren, er will für alles sorgen. Was sagst du nun?«
Wir waren alle zuerst stumm. Johanna, die wir alle nicht leiden mochten, sollte so brav gehandelt haben!? Unserer Elsbeth standen Tränen in den Augen.
»Ach Gott, die Johanna!« rief sie und stürzte zur Tür hinaus.
Wir ergingen uns in Lobeserhebungen über diese. Ihr Vater war sehr reich, er konnte Elsbeth, die es nicht war, leicht die Mittel vorstrecken, ihr Talent auszubilden.
Die Tür ging auf. Elsbeth zog Johanna herein, die sich sträubte. Sie war ganz verlegen, als wir ihr alle zujubelten.
»O, es ist nichts!« wehrte sie ab.
Es war uns ein freudiger Gedanke, daß wir Elsbeth jetzt so glücklich wußten und auch Johanna in gutem Andenken behalten konnten. Auch Gabriele schien zum Schlusse alles wieder gutmachen zu wollen. Sie überreichte jeder von uns einen kleinen goldenen Ring, in den ihr Name graviert war. –
Als Tante mit ihren Schützlingen wieder fort und ich mit meiner Freundin allein war, ließ auch sogleich die heitere Stimmung wieder nach. Anneliese stand wieder vor meinen Augen, so wie sie mir Mutter in einem kurzen Briefe heute geschildert hatte: »Wie ein Bild des Friedens liegt sie im Sarge, still und bleich, mit der Myrtenkrone über ihrem lieben Gesichtchen und mit dem Schleier bekleidet.«
Ich konnte diese Zeilen nicht aus dem Gedächtnisse bringen, sie ließen von neuem heiße Tränen mir aus den Augen stürzen.
Während sie unten sangen voll Jubel und Lust: ›Noch ist die blühende, goldene Zeit, noch sind die Tage der Rosen‹ – flüsterten Melanie und ich vom Sterben und vom Wiedersehen. –
Wenige Tage später ward es still in unserem Hause. Elsbeth war unter strömenden Tränen endlich in den Wagen gestiegen. Beim Abschiedsweh hatte selbst Paris nichts Lockendes mehr für sie. Gabriele hüpfte leicht in den Wagen; einer ihrer Brüder, ein junger Offizier, hatte sie abgeholt. Sie ging freilich einem lachenden Leben entgegen. Es war ein reizender Anblick, das hübsche Geschwisterpaar zu sehen. Er grüßte, die Hand an der Mütze, sich immer wieder verneigend, Gabriele winkte mit dem Taschentuche, so lange sie das Haus erblicken konnte.
Johanna hatte sich Elsbeths liebevoll angenommen. Ihr Vater war ein gemütlicher älterer Herr gewesen. Am zweiten Tage schon erhielt Tante eine Karte von den dreien aus Köln, die sehr vergnügt lautete. Man fuhr soeben ein Stück auf dem Rhein, ehe die Weiterreise nach Paris angetreten werden sollte.
Lisbeth wurde von ihrer Mutter abgeholt, die sich sichtlich freute, ihr ältestes Töchterchen wieder zu haben. Da Suse und Gretchen ein Stück denselben Zug benutzten, war Lisbeths Mama sogleich bereit, die beiden jungen Mädchen unter ihre Flügel zu nehmen. Die drei Pensionsschwestern waren sehr froh, noch einige Stunden beisammen zu sein. Die beiden anderen aus der nun verlassenen Elisabeths-Ruh waren auch fort in die Ferien.
Die Unzertrennlichen, Melanie und ich waren allein übriggeblieben. Wie still war es jetzt in dem sonst so belebten Hause!
Lotte und Ludchen erhielten zu guter Letzt noch am Ostermorgen eine Einladung, sich einer befreundeten Familie Gredners zu einem Osterausfluge anzuschließen. Da Herr Trost dabei war, so gab es keinen Zweifel. Gleich nach dem Morgenkaffee sah man die Unzertrennlichen in reizenden Frühjahrskleidern, Regenmäntel über den Armen, fortgehen.
Nun war es vollends wie ausgestorben. Fast wehmütig war es uns, als wir, Tante und ich, zur Kirche gingen. Sonst der lange Zug lustiger Schwestern, jetzt wir beide, still, allein.
Melanie saß im Garten. Es war mildes Wetter. Mit Decken warm verhüllt, lag sie im Schaukelstuhle. Jetzt, beim hellen Tageslichte sah man erst, wie blaß sie war. Ehe ich mit Tante ging, war ich schnell noch einmal zu ihr geeilt. Schon läuteten die Glocken.
»Wie ernst deine ganze Erscheinung ist, Liesel!« sagte sie, als ich auf sie zukam, »groß, schwarz!«
Ich küßte sie.
»Bete für mich mit!« bat sie. Ich wußte, daß auch sie jetzt beten würde, sobald sie allein war. –
Es war zum erstenmal, daß ich wieder in dem Gotteshause war, seit ich Anneliese verloren hatte. Wie weh taten mir die leisen Orgeltöne, die vom Chore herabschwebten! So weh, daß ich weinen mußte. Aber diese Tränen waren mir wie eine Erlösung. – Der Prediger sprach so schön vom heiligen Osterfeste, ich sah die andächtigen Gesichter der Menschen, Tantes gütiges Antlitz neben mir, sah den hohen, säulengetragenen Raum, durch dessen bunte Fenster sich ein goldener Strom von Sonnenlicht ergoß; da ward es endlich stiller in mir. Der Friede, der wie ein unsichtbarer Hauch durch diese heiligen Räume wehte, senkte sich in mein wundes Herz. Ich dachte nicht mehr mit wildem Schmerze an die tote Freundin, sondern mit Liebe und Wehmut, und senkte den Kopf tief, als der Geistliche das Vaterunser betete. Alle meine Lieben schloß ich in mein Gebet mit ein. –
Innerlich gehoben, wie selten zuvor, verließ ich die Kirche.
Gerade ein Jahr war es her, daß ich konfirmiert war, damals hatte Anneliese noch neben mir am Altar gekniet. Wer hätte es ahnen können, daß sie ein Jahr später zu den Toten zu zählen sein würde?
Und gerade ein Jahr auch war vergangen, daß mein liebes Großmütterchen die Augen geschlossen hatte.
Als Tante und ich auf der Promenade, die im ersten frischen Grün prangte, nach Hause zu gingen, fuhren zwei Wagen an uns vorüber. Ein Winken, Grüßen, Nicken, – als sie schon fast vorbei waren, erkannten wir Gredners und unsere Unzertrennlichen. Zu unserer Überraschung fanden wir ein Billett an Tante zu Hause vor, das von Lotte geschrieben war:
»Liebes, goldenes Tantchen! Nicht böse sein, bitte! Wir bleiben drei Tage fort. Gredners wollen nach der Wartburg. Dienstag abend sind wir zurück.
Die Unzertrennlichen.«
Tante wollte erst böse sein, aber wir besänftigten sie. Die beiden waren ja in bester Gesellschaft. –
Was für eigenartige Ostern verlebten wir nun erst! Tante wandelte mit mir nach Tische, wobei wir zu vieren gewesen waren, im Garten auf und ab, Melanie ruhte.
»Ich könnte diese Einsamkeit auf die Dauer nicht mehr ertragen,« sagte Tante, »seit vielen Jahren sind es die ersten Ostern, wo es so ganz leer bei uns ist!«
»Mir ist das lieb, Tante,« sagte ich, »diese Ruhe tut mir wohl, da hat man ungestörte Muße, sich seinen Gedanken hinzugeben!«
»Und seinem Kummer, Kind,« vollendete Tante und legte ihren Arm in den meinen; »aber ich habe mich gefreut über dich, Liesel, du gingst heute innerlich gestärkt aus dem Gotteshause heim, ich sah es in deinen Augen! Wenn man so viel in junge Augen zu blicken hat wie ich, liest man darinnen wie in einem aufgeschlagenen Buche.«
»Ist's auch immer Erfreuliches, was Sie da lesen, Tante?«
Ich blickte neckisch zu ihr herab, denn ich war ein gutes Stück über sie hinausgewachsen.
Sie lächelte: »Nicht immer, Kind! Manchmal ist's Verstocktheit, Eigensinn, Scham, Angst vor verdienter Strafe, kurz, durchaus nichts Erbauliches. Aber dem Himmel sei Dank, meistens ist es doch, als ob man in einen frischen, klaren Bergsee schaut, wenn man in junge, gute Mädchenaugen blickt; so viel zarte Sinnigkeit, Herz, Gemüt, Frömmigkeit, süße Unschuld leuchten einem da entgegen. Dann fallen mir oft die Dichterworte ein: ›Mir ist's, als ob ich die Hände aufs Haupt dir legen sollt‹. – So ist wohl auch Anneliese gewesen, denke ich!«
Begeistert berichtete ich von ihr, von ihrem dunklen, innig treuen Auge, ihrer zierlichen Erscheinung. Als wir drei beim Kaffee saßen, erzählte ich von daheim. Idyllisch mußte meinen Zuhörerinnen unsere Mühle und unsere Jugend erscheinen.
»Ich komme sicher einmal, dich zu besuchen, Liesel!« sagte Tante. »Ich auch!« meinte Melanie.
»Ach, wie mich das freuen würde, o Sie müssen, sicher!« rief ich und sah im Geiste schon Tante neben Mutter und Melanie auf dem Plätzchen am Hause sitzen.
»Aber viel Mehlklöße müssen Sie essen!« sagte ich scherzend. »Dafür sind wir Müllersleute!«
Melanie sprang auf und setzte sich in Tantes Stübchen ans Klavier. Dort spielte sie: ›Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp! klapp!‹ –
Dann folgten Tante und ich ihr, und so saßen wir drei plaudernd den ganzen Nachmittag beisammen. Jede empfand den Reiz eines solchen ungestörten Beisammenseins. Manchmal glaubten wir, die Tür müsse aufgerissen werden, und ein halbes Dutzend stürme herein, aber die heiligste Stille lag über unserem Hause.
Ganz erschrocken fuhren wir zusammen, als die schon seit Tagen verstummte Glocke plötzlich geläutet ward. Fräulein Knauer hatte es sich zum Spaße gemacht, uns drei zum Abendessen zu versammeln.
Nach Tisch lasen wir noch und trennten uns dann von Tante mit einem Gutenachtkuß.
Zum erstenmal bewohnten Melanie und ich heute gemeinschaftlich unser Zimmer. Die Dienstmädchen hatten fleißig gearbeitet und sofort die Umräumung begonnen, als Johannas letzter Koffer hinaus war.
Melanie und ich fielen uns in die Arme, als die Tür hinter uns zu war; ein Herzenswunsch von uns war nun erfüllt, wir waren beisammen. Da jetzt ein Bett weniger im Zimmer war, erschien dieses noch wohnlicher und größer. Ich hatte Melanies Staffelei, auf welcher das Bild ihrer Mutter stand, in die freie Ecke gestellt und auf ein paar einfache Ständer dunkle Blattpflanzen zu beiden Seiten. Melanie sah es sofort und dankte mir gerührt. Aber auch sie hatte mir eine Überraschung bereitet. Neben Annelieses Bild stand ein Blumengestell, und von diesem aus rankten sich blühende Vergißmeinnicht und einzelne Blätter von Immergrün um das Bild. So hatte eines heimlich des anderen tote Lieben geschmückt.
Wir konnten nicht einschlafen, wir plauderten bis nach Mitternacht. »Bist du noch wach?« fragte ich nach einer kleinen Pause, aber keine Antwort kam. So mußte ich wohl oder übel auch schweigen. –
Lustige Karten von der Wartburg meldeten, daß Lotte und Ludchen im siebenten Himmel waren. Auch die anderen ließen von sich hören. –
Mama schrieb mir ausführlich über Annelieses Beerdigung. Ein paar Blumen aus meinem Kranze hatte sie ihr in die gefalteten Hände gelegt. So oft ich auch den Brief las, es kamen jedesmal von neuem die Tränen. – Ich fragte Mama, wie Hans die Nachricht aufgenommen habe. Mama war fast ebenso erschüttert wie ich, das las ich aus ihren Briefen; Anneliese mochte ihr wie eine junge Freundin gewesen sein, bei der sie feines Verständnis für alles gefunden hatte. –
Die Tage vergingen schnell, das Fest war vorüber, und die ersten, welche im Reißnerschen Pensionat wieder angeflattert kamen, heiter wie sie gegangen, waren die Unzertrennlichen. Wir saßen beim Abendessen, und Tante hatte sich eben besorgt geäußert, daß die zwei ›Kleinen‹ doch nicht pünktlich seien, als die Tür aufging und sie hereinstürmten.
Nun war es freilich vorbei mit der Stille, und jetzt tat uns auch dieses wohl. Die beiden konnten nicht genug erzählen, Lotte mehr als Ludchen, welche wie in stilles Glück versunken schien. Es war natürlich ganz himmlisch auf der Wartburg gewesen.
»Ach, Liesel, dein Thüringen ist einzig schön!« rief Lotte. Ich konnte mir nicht genug von der Heimat erzählen lassen, denn, lag auch unsere Rittersmühle ein gutes Stück von der Wartburg entfernt, so waren es doch dieselben tiefen Tannenwälder, welche um die Wartburg rauschen, wie sie um unsere Mühle sich ziehen. Eine Schönheit geht durch diese Thüringer Berge, ob sie nun im Norden oder Süden liegen. –
Wenige Tage später kamen die beiden Elisabethen zurück; sie fanden ihr Heim sehr verödet, da zwei der Namensschwestern fehlten. Besonders Elsbeth, die kleine Geigerin, war uns allen so lieb gewesen. Sie befand sich bereits im schönen Paris und sandte glückatmende Berichte an Tante, auch Johanna schrieb stets ein kurzes Briefchen mit.
Fräulein von Tolsky erhielt noch acht Tage länger Urlaub. So bat mich Tante zu meinem Stolze, Aufsicht zu führen. Sonst wäre dies Amt wohl Melanie zugefallen, aber diese sollte rasch völlig gesund werden und machte täglich Spaziergänge mit Tante.
So waltete ich meines Amtes, trat mit wichtiger Miene bei Lotte und Ludchen ein und sagte, ich wolle ihre Kommoden nachsehen. Aber ich konnte mir keine Ehrfurcht erringen. Die beiden hatten am Tische gesessen und Bonbons genascht. Dies war verboten.
»Liesel, zanke nicht, iß mit!« schrien beide, und jede hielt mir die offene Tüte hin. Aus einer blickten große Pralinen, aus der andern die herrlichsten kandierten Früchte. Was tat Müllerliesel? Anstatt die zwei lachenden Mädchen tüchtig auszuschelten, langte sie tapfer zu und war im Bunde die dritte! – Als alles aufgegessen war, kam von jeder Seite eine und schmiegte sich an mich.
»So war's recht, jetzt sind noch Ferien, da hätte Tante auch nicht gescholten, daß wir einmal ein bißchen genascht haben!«
Sie öffneten nun bereitwilligst ihre Kommoden, in denen die schönste Ordnung war. Für die morgen zu erwartende ›Neue‹ war schon alles bereit.
»Bin neugierig, wie sie sein wird!« seufzte Ludchen.
»Wenn sie nur nicht so groß und erhaben wäre, lieber ein bißchen lustig!« meinte Lotte; »Karola, das klingt schon so feierlich, so hieß ja die Königin von Sachsen!«
Grete und Suse kamen auch zurück, mit ihnen neues Leben. Melanie war gesund; von Mutter erhielt ich einen liebevollen Brief, möglichst kurz schilderte sie das eintönige, stille Leben, das sie jetzt führte. Hans habe kein Wort über Annelieses Tod verloren. Papa denke ernstlich daran, Hans aus Berlin zurückzuholen. Er spiele dort den Freiherrn, Studieren sei Nebensache.
Immer wieder traten doch Kummer und Sorgen zurück, wenn ich mit den guten, lustigen Pensionsschwestern beisammen war. Ich hätte nicht so jung sein müssen, um lange trüben Gedanken nachzuhängen.
Auch waren es trostreiche Stunden, wenn ich mit Melanie in unserm Zimmer zusammensaß. Es ist etwas Sonniges, Herzerwärmendes um eine solche Freundschaft. Voll unbegrenzten Vertrauens alles ins Herz der Freundin schütten können und wissen: du wirst verstanden, ist einzig schön. Es gab nichts, Ernstes, Tiefes oder Heiteres, das ich nicht mit Melanie hätte besprechen können. Wir liebten uns und verstanden uns. Ohne Schwestern aufgewachsen, wurden wir jetzt einander solche. Gott hatte mir Anneliese genommen, und ihr Bild wird mir wie eine lichte Gestalt aus den goldenen Tagen der Kindheit vorschweben, unvergeßlich, so lange ich atmen werde; aber in Seiner reichen Güte hatte er mir einen Ersatz gegeben in Melanie. Ich tat auch alles, was nur meine Liebe zu ihr mir eingab, und sie nannte mich wegen meiner Sorge um sie oft ihr Mütterchen. Tante freute sich innig über uns beide, wie sie oft sagte. –
Die Neuen kamen! Vor einem halben Jahre hatte ich auch zu diesen Erwarteten gezählt, heute sah ich behaglich zu. Zuerst führte uns Tante Elisabeth Tittmann in das Speisezimmer, als wir gerade beim Nachmittagskaffee saßen. Es war ein hübsches Mädchen, dessen graue, kluge Augen seltsam mit dem aschblonden Haare kontrastierten. Elisabeth mochte sich fremd fühlen, schüchtern blickte sie um sich. Ihre beiden Namensschwestern aber nahmen sich sogleich ihrer an und führten sie nach der geliebten Elisabeths-Ruh. Beim Abendbrote schon erschien die Neue nicht mehr so fremd, sie taute auf und schien sich gleich uns sehr wohl zu fühlen.
»Gottlob, daß wir wieder drei sind!« sagte Elsa; »Tante, die Elisabeths-Ruh dürfen Sie nie auflösen, die muß immer bleiben! Wenn dann eine oder die andere einmal zurückkommt, so logiert sie dort. Das ist dann das angestammte Recht der Elisabethen!«
Tante nickte zustimmend. »Was mag aus euch Kindern einmal werden!« meinte sie lächelnd und blickte uns der Reihe nach sinnend an.
»Aus mir eine Hausfrau!« sagte Ludchen, »ich tauge zu nichts anderem! Nicht wahr, Lotte, du auch? Wir sind zu dumm zu einer Künstlerlaufbahn!« schloß sie wie gewöhnlich, Lotte stets mit in die eigene ›Dummheit‹ einschließend.
»Kind, welche Ansicht!« rief Tante. »Als ob das nicht der beste Beruf sei, der einer Gattin und Mutter! Nur mit dem rechten Ernste und Verständnis an diese höchste Aufgabe herangehen, dann ist sie die größte! Glaubst du, es ist leicht, einem gebildeten Manne die rechte, verständige Gefährtin zu sein? Und wieviel schwerer noch ist es, aus einem Kinde einen guten, brauchbaren Menschen zu erziehen?! Das kann keinem jungen Mädchen hoch und ernst genug hingestellt werden! Aus Gottes Hand wird das Kind rein wie ein Blumenblatt in die Hände der Mutter gelegt. Nun ist es ihre Lebensaufgabe, diese Knospe zu herrlicher Blüte zu bringen!«
Wir hatten ganz ernst Tantes Worten gelauscht. Wie recht hatte sie! Ob unser Ludchen sich alles recht ins eigene Herz schrieb? Sie war nachdenklich geworden.
»Du, Elisabeth, kleiner Neuling,« fragte Tante, nach einer Pause, »willst du etwas werden?«
»Malerin!« sagte diese leuchtend, »ich studiere schon lange!«
Wir guckten bewundernd auf unsere neue Pensionsschwester. So war also wieder eine Kunst bei uns vertreten. Elisabeth ging auf Tantes Wunsch und holte einige Bilder, die sie gemalt hatte.
Wir drängten uns alle um sie, als sie zurückkam. Ein »Ah!« begrüßte jedes neue, kleine Kunstwerk, das sie bescheiden aus seiner Umhüllung zog.
Da war ein sogenanntes Stilleben. Auf einem mit bunter Decke belegten Tische stand eine angebrochene Weinflasche, ein halbgefülltes Glas daneben. Auf einer Schüssel lagen Austern, eine zerschnittene Zitrone dabei, ein Messer mit silbernem Griffe, Obst; der Wein funkelte so natürlich, daß wir einstimmig meinten, das Bild mache Appetit.
»Darf ich es in dem Speisezimmer aufhängen, d. h. für immer als ein Andenken an mich?« fragte Elisabeth mit schüchternem Aufblick zu Tante. Gern ward ihr diese Erlaubnis gegeben, und wir suchten eifrig einen Platz. Über dem Anrichtetische nahm es sich reizend aus. Alle bedankten wir uns bei Elisabeth, die aber sich diesem Danke entzog, indem sie mit ihren Bildern schnell hinaufging.
Wir setzten uns wieder, denn wir waren noch gar nicht fertig mit dem Abendessen.
»Mir, bitte, grünen Salat!«
»Gebt doch einmal den Schinken herunter, das Oberhaus ist zu geizig!« rief Ludchen.
»Noch ein Glas Gerstensaft!«
»Mir etwas attisches Salz!«
»Bitte um le beurre!«
» La beurre!«
»Falsch!«
So schwirrte es durcheinander.
»Es heißt le beurre!« entschied Tante. – Da klopfte es. Das Dienstmädchen meldete, die neue Pensionärin sei da. Wir waren alle aufgesprungen. Sehr gespannt waren wir auf diese Karola. Ob sie als Letzte zu uns paßte? Wir harmonierten alle so gut. Es wäre ewig schade, käme jetzt ein Element, das unser schönes Zusammenleben stören würde. Namentlich die Unzertrennlichen, die sich eng aneinandergeschmiegt hatten, waren die Erwartung selber.
Tante verließ uns, um Karola zu begrüßen. Nach einigen Minuten hörten wir ihre Stimme wieder und auch eine sehr lustige Mädchenstimme sagen:
»Gewiß, gnädiges Fräulein, ich fürchte mich gar nicht vor dem Pensionat, o nein!« Jetzt ging die Tür auf, und mit Tante erschien ein kleines, zierliches Figürchen im feuerroten Kleide. Große, tiefschwarze Augen blickten aus einem feingeschnittenen Gesichtchen, das aber blaß war; nur die Lippen zeigten ein gesundes Rot. Das dunkle Haar hing in einem dicken Zopfe geflochten den Rücken hinab.
»Hier stelle ich euch eure neue Schwester Karola vor!« sagte Tante.
Eine zierliche, flinke Verbeugung des jungen Mädchens. Tante nannte nun unsere Namen; damit aber diese wie so oft im Leben nicht nur leerer Schall seien, sagte Tante:
»Jetzt setzt euch, Kinder, und jede hat Karola ihre linke Nachbarin vorzustellen und dabei zugleich eine kleine Charakterisierung zu machen!«
Wir saßen erstaunt da. »Ich bin baff!« sagte Ludchen offenherzig. Wir lachten, die Neue mit. Sie saß neben Tante.
»Na, wenn du dich von deiner Starrheit erholt hast, Ludchen, dann fange an!« meinte Tante lächelnd.
»Ach Gott!« rief diese erschrocken und sah mich an, denn ich saß zu ihrer Linken. Plötzlich schien ihr alter Humor ihr wieder zu kommen.
»Nun denn,« sie legte Messer und Gabel hin und blickte zu Karola hin, »so stelle ich dir hiermit Elisabeth Freifräulein von Ferner vor.«
»O nein, wie falsch du berichtest,« unterbrach ich sie errötend, »ich heiße Liese Ferner, anders nicht!«
»Also, Liesel genannt,« fuhr Ludchen fort, »ist sie nächst mir die beste! Sie spielt hinreißend Klavier, kocht ausgezeichnet, pflegt Kranke wie ein Engel, ist lieb und gut, und wie du siehst, liebe neue Schwester Karola, ist sie auch sehr hübsch!«
»Genug!« rief ich und hielt ihr ohne weiteres den Mund zu.
In ähnlicher Weise verfertigten wir freilich alle unsere Charakterisierungen. Aber das gab einmal eine ganz neue Unterhaltung, Karola, oder, wie sie genannt wurde, Karla, lebte sich auf diese Weise schnell ein. Es war ein kluges Ding, schien viel gelernt und gelesen zu haben, ein geweckter Verstand leuchtete aus ihren Augen.
»Ich glaube, du bist viel zu gescheit für uns, Karla,« sagte Ludchen, als wir nach dem Essen noch am Tische saßen, »denn wir sind sehr dumm im Grunde, nicht wahr, Lotte?«
»Ja!« stimmte diese wie immer bei.
Karla lachte und versicherte, daß sie noch sehr viel zu lernen habe. –
Wir waren alle erfreut, daß Karola so gut zu uns paßte. Noch lange saßen wir bei Pfänderspiel und Gesang beisammen.
Dann hörten Melanie und ich später ein Kichern und Schwatzen im Nebenzimmer. Dieses Kleeblatt schien ja vortrefflich zusammenzupassen. Als es gar zu bunt wurde, klopfte ich an die Tür.
Ein »St! Stille!« wurde drüben laut, dann endlich ward Ruhe. –
Fräulein von Tolsky kehrte auch zurück, die Stunden begannen wieder, und ein Tag verging heiter und schön wie der andere.
Wir fingen an, uns viel im Freien aufzuhalten. Der Mai kam mit seinem Blütenschnee und seinen warmen Frühlingslüften. Es wurde täglich schöner im Garten. Längst war unser Weiher vom Wintereis befreit, und seine Wellchen schlugen leise rauschend an die Ufer. Die Kähne schaukelten verlockend, und eines Sonntags durften wir am Nachmittag fahren. Ich verstand zu rudern. Tante aber und die anderen wollten es nicht recht glauben. Was tat ich? Nicht an mein schneeweißes Kleid denkend, sprang ich in den Kahn, hakte ihn los und stieß mit kräftigem Ruck vom Ufer ab, ehe die anderen nur recht ahnten, was da geschehen war. Sie schrien laut auf, als sei ich schon in den Wellen versunken. Ich aber lachte sie aus, ergriff die Ruder und erlebte nun die Freude, pfeilschnell dahinzufliegen und ganz erstaunte Gesichter zu sehen.
»Entzückend!« rief Ludchen, »die reine Nixe!«
Auf Tantes Wink wendete ich mit rascher Schwenkung und einigen kräftigen Schlägen mein leichtes Fahrzeug um und fuhr dem Ufer wieder zu. Melanie lachte vergnügt und rief:
»Ich hatte um Müllerliesel keine Angst!«
Nun stiegen noch ein halbes Dutzend zu mir in den Kahn, Tante fuhr mit den übrigen im zweiten. – Wir sangen, natürlich, und, gerade weil wir sehr vergnügt waren, nach echt deutscher Art: ›Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin‹ …
Als wir nach einem halben Stündchen wieder ausstiegen, war zu unserer Überraschung der Kaffeetisch mit dem großen Napfkuchen in der Mitte gedeckt, und zwar im Freien unter einer Kastanie, deren große, weiße Blüten aus dem dichten Blätterwerk herausleuchteten. Wie gut schmeckte es uns nun! Fräulein Knauer mußte es erleben, daß von dem großen Kuchen auch nicht ein Krümelchen übrig blieb, denn auch diese wurden gesammelt und den Vögeln gegeben. – Einige lasen, andere machten Handarbeiten, Melanie übte; ihr herrliches, gewandtes Spiel drang deutlich durch die offenen Fenster bis zu uns.
Karla hatte sich in die Hängematte gelegt, und Ludchen schaukelte sie. –
Als die Abende immer wärmer wurden, aßen wir auch das Abendbrot im Garten, wobei vier hohe Windlichte auf der Tafel standen. Dann hörten wir in solchen lauen Frühlingsnächten die Nachtigallen schlagen, die aufbrechenden Rosen dufteten, es war schön, sehr schön. Wir empfanden es auch alle dankbaren Herzens. Des Abends halfen wir dem alten Braun beim Gießen; es gab mehrere kleinere Gießkannen, und wir rissen uns förmlich darum. Auch zum Jäten kam Braun nicht viel. Wir versicherten ihm, daß das Bücken nicht mehr gut sei für seinen alten Rücken. Er lächelte und gab uns gern die Erlaubnis, das Unkraut auszurupfen. Nur auf Karla paßte er ein bißchen auf, als er einmal gesehen hatte, wie sie ein eben gepflanztes Resedastöckchen mit herausriß. –
Die Wochen vergingen. Das Pfingstfest hatten wir, da keine verreiste, sehr vergnügt in unserem Garten verlebt. Eine sehr überraschende Neuigkeit hatte es uns gebracht, nämlich die Verlobungsanzeige von Gabriele von Stetten mit einem Leutnant von Mark. Das war natürlich etwas ganz Absonderliches für uns. Wir konnten uns Gabriele gar nicht als Braut denken. Wir verfaßten sogleich ein gemeinsames Gratulationsschreiben und erhielten acht Tage später eine große Photographie des Brautpaares. Das Bild war im Rahmen und von Gabriele für das Speisezimmer bestimmt. Sie schrieb sehr glücklich. –
Aus der Heimat erhielt ich immer die gleichen Nachrichten. Auf Annelieses Grab blühten die Rosen. Ihre Mutter schickte mir ein paar davon. Mit welch wehem Schmerze betrachtete ich die dunklen Blumen, die auf dem frühen Grabe meiner geliebten Anneliese erblüht waren! –
Dem Gedanken, mich zur Krankenpflegerin auszubilden, hatte ich immer mehr Raum in meinem Innern gegeben. An Mutter schrieb ich nichts, aber ich war einig mit mir über die Zukunft: brauchte mich Mutter und hatte das Elternhaus Raum für mich, d. h. blieb ich ein vermögendes Mädchen, so war bei Vater und Mutter mein Platz, sie zu pflegen und ihnen die Last der Arbeit abzunehmen, so lange Gott sie mir ließ. Hatte aber der arme Papa Sorgen um Hans, und ging die Mühle nicht mehr so gut, so wollte ich die Eltern bitten, mich auf eigene Füße stellen zu dürfen.
Außer Melanie wußte nur noch Tante um meinen Entschluß. Ich ging eines Abends mit ihr durch die Stadt, Einkäufe machen. Da kam schlicht und anspruchslos eine Schwester in ihrer ernsten, schwarzen Tracht an uns vorbei.
»Diese Mädchen in ihrer Entsagung haben für mich geradezu etwas Heiliges,« bemerkte Tante, »ich glaube, wenn ich wieder jung wäre, ich würde auch Schwester!«
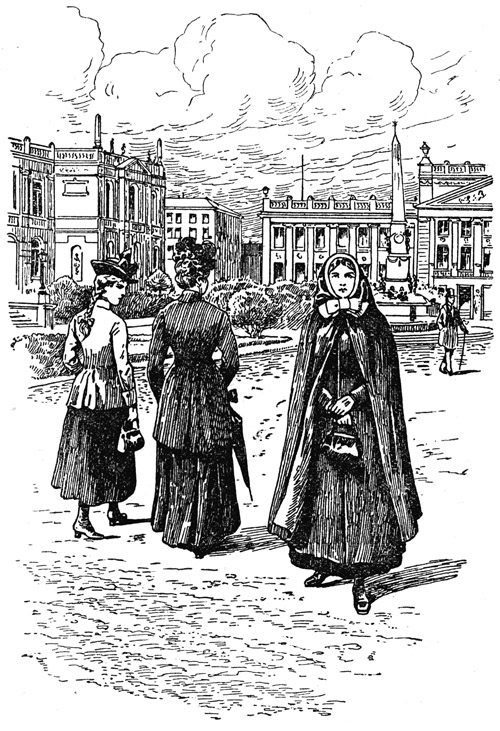
»Ach Tante,« fuhr es mir heraus, »es ist mein sehnlicher Wunsch, ich möchte Pflegerin werden!« –
Ganz überrascht, aber voll Liebe, blickte Tante mich an. »Du eignest dich gut dazu, das sah ich, als Melanie krank war!« sagte sie. »Vielleicht findest du einmal darin dein Lebensglück! Auch wenn ein Mädchen reich ist, sollte sie sich einen Lebenszweck suchen, irgend etwas, für das sie sich begeistert! Du glaubst nicht, wieviel trostlose Existenzen junger, vermögender Mädchen ich kenne, deren äußeres Leben gewiß vielen beneidenswert erscheint. Aber blickt nur hinein! Die ödeste Langeweile. Dann fangen sie schließlich an, launisch zu werden, verstimmt, nervös, es werden alle möglichen Kuren gebraucht. Nur das eine kann den armen Dingern niemand verschreiben: Arbeit, Beschäftigung. Es braucht ja nicht eine gerade die allergewöhnlichsten Arbeiten zu machen, aber sie kann sich meinetwegen ein halbes Hundert Blumentöpfe anschaffen und in diesen ziehen, was ihr gefällt. Ich hatte eine Freundin, eine Fabrikbesitzerstochter in Thüringen, Liesel. Denke dir, sie hatte sogar dreihundert Blumentöpfe in ihrer Wohnung. Wieviel Arbeit machte ihr diese Pflege, aber welch ein Schmuck war das auch, und wie manche sonst müßige Stunde füllte sie mit der sorgsamen Pflege der Blumen aus! Und welche Pracht in den Zimmern! Da war das kleine Speisezimmer zu einem Blumenhaine geworden. Es schmeckte wahrhaftig noch einmal so gut, saß man da drinnen.
»Wenn eine ein wenig Talent verspürt zum Malen, gut, so soll sie streben, es mit Fleiß zu etwas zu bringen. Und fühlt sie sich zu stolz, ihre Bilder für Geld hinzugeben, so soll sie Armen eine Freude damit machen. Fällt doch dann auch ein Sonnenstrahl mit solch kleinem Kunstwerk in die Hütten der Armen, und wieviel Seligkeit mag dann ein solches junges Mädchen im Geben empfinden! Es lohnt sich tausendfach, mild und gut zu sein, Arme zu erfreuen! – Da liegt ein weites, unermeßlich großes Feld der Tätigkeit für reiche Mädchen. Und es ist, als ob sie da für unsern Herrgott selber arbeiteten, denn die Armen, Hungernden, Frierenden stehen ihm wohl am nächsten, liebt doch eine Mutter ihr krankes Kind am meisten, und die Armen sind solche Schmerzenskinder Gottes. – Und siehst du, Liesel, so viele spielen Klavier, alle diese reichen Mädchen halten es ja für nötig, zu spielen. So sollen sie armen Kindern unentgeltlich Unterricht geben. Wie manche würde vielleicht auf Gold stoßen, d. h. in schlichter Hülle ein Talent entdecken! Welcher Lohn dann! Und können die Kinder auch selbstverständlich nicht zu Hause üben, weil sie kein Klavier haben, so findet sich schon einmal ein solches altes, aus der Mode gekommenes, das ein reiches Mädchen ihnen schenken kann. Im Geben, im Glücklichmachen anderer beruht so viel Seligkeit!«
»Ach, Tante,« bat ich, »lassen Sie mich alles das, was Sie mir jetzt sagten, den Pensionsschwestern erzählen!«
Sie nickte lächelnd. Wie lauschten diese, als ich sie am Abend in unser Zimmer rief, mich auf meinen Lieblingsplatz, das breite Fensterbrett, setzte und von dort aus ihnen meine Rede hielt.
»Tante hat recht!« rief Melanie. »Sollte ich später einmal Stunden geben, die Armen erhalten sie umsonst!«
Mit feierlichem Ernst verkündigte Ludchen: »Ich male!«
Und sie machte diese Drohung wahr! Als Elisabeth eines Nachmittags aus der Malstunde kam, fand sie Ludchen in ihrem Zimmer. Sie versteckte etwas auf dem Rücken.
»Ich habe etwas gemalt!« sagte sie endlich schüchtern, so erzählte mir Elisabeth später, und nun hatte sie ihr ein Bild hingehalten, eine Seelandschaft. Elisabeth besaß eine großartige Selbstbeherrschung, denn sonst hätte sie laut auflachen müssen beim Anblicke des Bildes. Es war in den grellsten Mißtönen verfertigt, so daß man Augenschmerzen fühlte. Wie ein hellblaues Band lag der See da, ohne Schatten, ohne ein einziges harmloses Wellchen. Die Berge waren grün vom Fuße bis zum Gipfel, trotz ihrer enormen Höhe, jedenfalls eine gesegnete Gegend, welcher unser Ludchen das entnommen hatte. Von Elisabeth wurde sie nun aufgeklärt, wie vieler Vorstudien es bedürfe, um es zu etwas leidlich Hübschem zu bringen.
»Ach, dann lasse ich's lieber!« hatte Ludchen halb entmutigt, halb erlöst gemeint, »da verschenke ich lieber ein altes Klavier!«
Ihr Bild stand dann auf ihrer Kommode. Eines Tages befestigte ich ein Zettelchen daran, worauf ich in Rundschrift geschrieben hatte:
»O du himmelblauer See,
Du stillst mei' Herzleid nit,
Stillst nit mei' Weh!«
Dieses ›Du‹ unterstrichen sagte alles, und Ludchen verstand es auch, daß ihr See gewiß kein Herzleid zu stillen vermochte. Aber Früchte hatten Tantes Worte doch getragen.
Eine befreundete Dame hatte angefragt, ob nicht eine junge Dame aus dem Pensionate sich entschließen könnte, einem sehr begabten, aber armen Knaben Klavierunterricht zu geben. Als Tante uns dies mitteilte, schrien alle, die Klavier spielten: »Ich!«
Tante lachte: »Na, jeder von euch würde ich den Kleinen nun nicht anvertrauen, Kinder! Aber das Los soll zwischen Melanie und Liesel entscheiden!«
Wir losten also; es traf Melanie. Wie gern hätte ich selbst es übernommen, aber ich freute mich auch, als ich Melanies strahlendes Gesicht sah.
»Meine Freundin will die Stunden nicht ganz umsonst, Melanie,« sagte Tante.
»Nein, bitte!« wehrte Melanie, »nur unter der Bedingung, daß mein erster Schüler freien Unterricht genießt, nehme ich ihn an!«
»Bravo!« riefen wir. »Recht so, mein Liebling!« sagte Tante und küßte Melanie.
Die alte Dame war hocherfreut gewesen. Die junge Lehrerin wurde mit ihrem Schüler bekanntgemacht. Es war ein dunkellockiger, klugblickender Knabe, der bald mit einer Art Vergötterung zu seiner Lehrerin aufblickte. Er kam täglich, und nach der Stunde spielte ihm Melanie vor, oder er durfte ihr vorspielen, dann glitten die kleinen Hände in eigenen Phantasien über die Tasten. Keusche, liebliche Melodien, wie Blumen auf einer Flur, klangen an Melanies Ohr. – Hatte er geendet, so nahm sie den Lockenkopf in ihre Hände und küßte ihn. Zuweilen auch ließ sie mich holen, und wir spielten ihm vierhändig vor.
Die alte Dame, Frau von Krafft, war glücklich; sie gehörte zu jenen edlen Wohltäterinnen, die im stillen schaffen. Jetzt, so hatte sie erzählt, spare sie eifrig, um ihrem ›Jungen‹, wie die selbst Kinderlose ihren armen Schützling nannte, ein gebrauchtes Klavier zu schenken. Sein Vater war Volksschullehrer, er hatte noch eine ganze Reihe Kinder. –
»Wißt ihr was?« sagte ich eines Tages, als Melanie zufällig nicht mit im Speisezimmer war, »ich habe eine Idee!«
»Liesel, was denn? Fix!« hieß es, und alle acht guckten mich erwartungsvoll an.
»Wir sammeln und überreichen Frau von Krafft eine Summe als Beitrag zu Fritzchens Klavier! Was meint ihr?«
»Herrlich!«
»Einverstanden!«
»Aber Melanie muß damit überrascht werden!«
»Selbstverständlich!« sagte ich, »und an Gabriele und Johanna schreiben wir auch!«
Auch Tante sollte nichts erfahren. Wir waren Feuer und Flamme für unser Vorhaben. Ludchen und Lotte spendeten mit der erst eingeholten Erlaubnis der Eltern jede zwanzig Mark. Sie hüpften wie ein paar glückliche Kinder herum. Wir anderen sechs brachten auch vierzig zusammen. Gabriele sandte mit Freuden ebenfalls zwanzig Mark, Johanna die gleiche Summe. So hatten wir hundertzwanzig Mark beisammen, eine große Summe für unsere Begriffe! Wir waren glückselig. Die Freude am Geben leuchtete uns aus den Gesichtern. Melanie sagte: »Irgend etwas habt ihr vor, ich sehe es euch an, aber was?«
Wir lachten die Unwissende aus. Tante merkte nichts, sie war zu sehr beschäftigt.
Eines Sonntagnachmittags bat ich Tante, mit Lotte und Ludchen einen kleinen Spaziergang machen zu dürfen.
»Gern, nur bleibt nicht allzulange!« war die Antwort.
Mit unseren hundertundzwanzig Mark in der Hand gingen wir nun zu Frau von Krafft. Sie empfing uns höchst liebenswürdig, aber erstaunt. Sie konnte sich natürlich den Grund unseres plötzlichen Besuchs nicht erklären. Ich, als die älteste von uns dreien, mußte reden. Sehr verschämt brachte ich unser Anliegen heraus und legte mit einem erleichterten »Hier ist das Geld, gnädige Frau!« den Briefumschlag mit den Scheinen in ihre Hände.
»Es sind hundertundzwanzig Mark, gnädige Frau!« ließ sich Lotte vernehmen, Ludchen nickte dazu.
»O, ihr guten, guten Kinder!« sagte Frau von Krafft, und dabei stürzten ihr die hellen Freudentränen aus den Augen.
Uns wurde selbst ganz weich und feierlich ums Herz, als sie uns der Reihe nach in die Arme schloß und sagte: »Gott lohne es euch, meine Lieben! Ach, welche große Freude habt ihr da mir und dem Jungen gemacht! Was für Augen wird er machen, wenn ich ihm zu seinem Geburtstage, der am 2. Juli ist, ein Klavier schenken kann! Ich selbst habe schon fünfzig Mark bereit, den kleinen Rest treibe ich leicht auf. So veranstalten wir hier bei mir die Feier, nicht wahr? Ihr kommt mit Tante zum Kaffee zu mir?«
Wir sagten erfreut zu. Nachdem sie uns noch allerlei von ›ihrem Jungen‹ und dessen Begabung erzählt hatte, verabschiedeten wir uns.
Tante meldete uns einige Wochen später erfreut, daß wir alle zu ihrer Freundin zum Kaffee eingeladen seien. –
»Da bist du ja auch!« rief Melanie höchst erstaunt ihrem kleinen Schüler zu, als wir in das Zimmer kamen, wo dieser vergnügt an einem Tischchen stand und Bilderbücher ansah. Sofort flog er auf seine Lehrerin zu und hing sich vertraulich an sie. Wir zwinkerten uns vergnügt zu. Jetzt erschien auch Frau von Krafft. Sie strahlte vor Freude und drückte uns allen die Hände.
»Liebe Melanie,« sagte sie, – sie nannte uns alle bei den Vornamen, – »heute ist Fritzchens zehnter Geburtstag, und da haben wir ihm eine Überraschung zugedacht!«
Sie öffnete die Flügeltüren ins Nebenzimmer. Da stand, ganz mit Blumen geschmückt und mit grünen Girlanden verziert, ein – Klavier!
Tante schob Melanie und Fritz über die Schwelle. Die beiden waren sprachlos.
»Leopoldine,« sagte nun die alte Dame zu ihrer Freundin, die ein ungläubiges Gesicht machte, »deine Mädels sind wahre Perlen! Die Große, Blonde dort, das liebe Thüringer Waldkind, hat die Idee zuerst gehabt, zu sammeln, um Fritz ein Klavier zu verschaffen,« – ich kroch in die fernste Ecke bei ihren Worten, – »und die übrigen, selbst die Fernweilenden, haben bereitwilligst gegeben. Durch diese glänzende Beisteuer war es mir möglich, unserm Jungen heute ein Klavier zu geben!«
Da stieß Melanie, die jetzt erst begriff, einen Freudenschrei aus; mit feuchten Augen fiel sie Frau von Krafft um den Hals und dankte ihr. Dann lag sie in meinen Armen. »Liesel, du bist zu gut! Ach, muß es schön sein, wenn man so gut ist wie du!« sagte sie.
»Sei nicht so dumm,« antwortete ich höchst menschenfreundlich, »ich bin nicht besser, als alle anderen auch! Sie haben ja so gern gegeben, unsere Schwestern!«
Fritzchen war dunkelrot, Frau von Krafft legte den Arm um seine Schultern und führte ihn dicht ans Klavier. Mit seinen wunderschönen braunen Augen blickte er sie groß an.
»Das ist nun dein Klavier!« sagte die alte Dame, »heute abend lassen wir es zu Vater und Mutter schaffen, und da kannst du ihnen nun nach Herzenslust vorspielen!«
»Ich danke Ihnen!« sagte der Kleine schüchtern, und rührend war es zu sehen, wie er sich auf die Fußspitzen hob und seiner Gönnerin den roten Mund zum Kusse hinhielt. –
Es herrschte nun eine unendliche Freude, Tante war gerührt über ihre Pflegekinder. Das Klavier wurde von Melanie geprüft. Das erste, was sie spielte, war der Choral: ›Wer nur den lieben Gott läßt walten‹. Mächtig, tief und voll klangen die Töne, wir lauschten voll Andacht.
Dann, nachdem auch der Kleine mit hochroten Wangen sein Eigentum probiert hatte, führte uns Frau von Krafft in eine Glasveranda, welche sich an ihr Wohnzimmer schloß. Große Blattpflanzen standen dort, in der Mitte eine gar appetitlich gedeckte Kaffeetafel. Es tat der alten Dame sichtlich wohl, einmal so viel heitere Jugend um sich zu haben. Und heiter waren wir! Die Neckereien flogen beständig hin und her. – Elisabeth war von dem Blicke, den man auf die Stadt von hier aus hatte, ganz entzückt und bat sich die Erlaubnis aus, hier einmal skizzieren zu dürfen. Gerne gewährte sie ihr die Gastgeberin.
Karla, die am liebsten den ganzen Tag ihr Näschen in Bücher steckte, hatte deren auf einem Seitentischchen entdeckt und saß dort, die Ellenbogen aufgestützt, und las. Nichts konnte sie da stören; sie hörte es gar nicht, als wir sie einen kleinen Bücherwurm nannten. Die Ohren fest zugehalten, war sie für andere nicht mehr da.
Melanie und ich spielten einige Sachen, dann jede noch allein, da Frau von Krafft eine leidenschaftliche Musikfreundin war.
Es war spät, als wir aufbrachen.
»Auf Wiedersehen am fünfzehnten!« hieß es. Da war Tantes Geburtstag. –
Allabendlich seit Wochen hatten jetzt Beratungen stattgefunden, wie wir diesen Tag, an dem zugleich ein Sommerfest gefeiert werden sollte, am schönsten verherrlichen könnten. Drei lebende Bilder hatten wir bestimmt, und zwar wollten wir sie im Garten selbst stellen. Unser alter Braun war begeistert für diese Idee. Er suchte selbst den schönsten, passendsten Platz aus, eine Wiese mit Bäumen im Hintergrunde. War der Abend dunkel, so ließ sich mit einigen Kulissen gewiß etwas Reizendes herstellen. Das erste Bild sollte eine Illustration sein zu: ›Wenn die Schwalben heimwärts ziehn‹, das Lied von den Nichtbeteiligten im Hintergrunde gesungen werden. – Das zweite war ›Heideröslein‹. Über das dritte waren wir noch nicht einig. Melanie wollte ›Werthers Lotte‹, das reizende, bekannte Bild, wo sie im Kreise der Geschwister steht und Brot schneidet, während Werther in der offenen Tür steht, dargestellt haben. Aber dann fiel uns ein, daß ja die Bilder im Garten gestellt werden sollten. Da griffen wir schließlich zu einem Märchenbilde: ›Dornröschen‹.
Buntfeuer sollten die einzelnen Bilder beleuchten. Wir sprachen von nichts anderem mehr. In der Schule gab es zerstreute Antworten. In der Küche versalzte Ludchen die Suppe; sie war nämlich jetzt sehr eifrig dabei, das Kochen gründlich zu erlernen. Melanie gab sogar ihrem Schüler Ferien, da sie keine Zeit mehr hatte.
Tante schrieb ihre Einladungen und besprach sich mit Fräulein Knauer der materiellen Genüsse wegen, die sie ihren Gästen bereiten wollte.
Ich war oft erstaunt, wie rasch die Zeit verflogen war. Schon drei Viertel meiner Pensionszeit lagen hinter mir. Mit wie viel Vorurteil und Angst hatte ich dieses Haus betreten, und wie nahe würde mir der Abschied gehen! –
Wir lebten in beständiger Aufregung, keine ruhige Stunde gab es mehr. Bis in die späte Nacht hinein saßen wir heimlich und nähten. Melanie und ich veranstalteten die gemütlichsten Teeabende, ohne daß Tante etwas davon merkte. Wir haben es ihr später freilich alles der Wahrheit getreu erzählt.
Trotz all meines Sträubens war es mir nicht erlassen worden, das ›Dornröschen‹ zu stellen. Ich schlug Ludchen vor, denn ich sei viel zu groß, aber die Pensionsschwestern meinten, meine Haare könne ich doch nicht auf Ludchens Kopf zaubern, und so gab ich nach. Melanie stellte das ›Heideröslein‹, wozu sie sich sehr gut eignete, und im ersten Bilde wirkte Ludchen mit. Die drei Herren, die wir zu den lebenden Bildern nötig hatten, stellte der älteste Sohn von unserem Braun, ein sehr schöner Mann, den wir mit Tantes Erlaubnis aufgefordert hatten. Er besuchte die Malerakademie, da er viel Talent hatte. So war er uns auch bei der Wahl der Kostüme behilflich. –
Da saßen wir nun bei verschlossener Tür. Es war drei Tage vor dem Feste. Ludchen und Lotte waren mir beim Anfertigen meines Kleides behilflich, da der Anzug der ersteren schon fertig war. Sie hatte ein Bauernkostüm gewählt, das sie allerliebst kleidete, ein hellroter Rock, ein schwarzes Samtmieder, und ein rotes Mützchen auf dem dunklen, lockigen Haare. Ihr Begleiter besaß einen ebenso schönen Bauernanzug.
Melanie hatte einen Berg Heidekraut vor sich. Sie benähte damit ihr weißes, duftiges Kleid. Karla war beschäftigt, einen Kranz aus Heide herzustellen, den Melanie aufsetzen sollte. Wir hatten uns dies lebende Bild ganz nach eigener Idee gedacht und glaubten, es werde sich sehr gut machen.
Mein Kleid war eine einzige zartrosa Gazewolke, auf welche die Unzertrennlichen und ich jetzt zahllose silberne Sternchen nähten. Bei einer Märchenprinzessin kann es ja nicht genug Funkelndes geben. Dazwischen ward hie und da ein Röschen befestigt. Ein Kranz aus täuschend nachgemachten künstlichen Blumen, zarte, kleine Rosen, vorn ein wenig breiter werdend, wie ein Diadem, war fertig gekauft worden.
Aber die Hauptüberraschung war ja noch etwas anderes: wir alle zehn führten einen Rosentanz auf. Das sollte den Schluß bilden. Eine Tanzlehrerin hatte uns diesen sehr schönen Reigen seit Wochen einstudiert. Wir trugen dazu ganz gleich gemachte Kleider von weißem Tarlatan, die wir uns alle selbst verfertigt hatten, freilich mit Hilfe einer Schneiderin, die mehrere Tage in unserem Zimmer saß und nähte. Tante amüsierte sich höchlichst über uns und bat nur immer, uns nicht zu viel Arbeit zu machen.
»Hast du eigentlich deinen Reifen schon fertig?« fragte mich Lotte. Ich verneinte. Wir brauchten nämlich zu dem Reigen große Reifen, die vollständig mit rosa Rosen umwunden waren. Diese verfertigten wir aus Seidenpapier. Bis jetzt hatten wir zu den Übungen nur die leeren Reifen benutzt, aber übermorgen war die Generalprobe in Kostüm. – Da galt es, noch tüchtig zu arbeiten.
»So, der Heidekranz ist fertig!« rief Karla und drückte vorsichtig das zarte lila Gewinde auf Melanies Kopf. Sie sah entzückend aus, als sie jetzt aufblickte.
Ehe ich mich's versah, hatte Ludchen mir meinen Rosenkranz auch aufgesetzt, und alle klatschen in die Hände vor Freude über ihr Heideprinzeßchen und Dornröschen.
»Liesel, bitte um deinen Reifen!« rief Lotte, »ich glaube, ich habe jetzt Rosen genug dafür und will ihn dir machen!«
»Sehr liebenswürdig, meine Lotte!« Ich holte von einem Nagel über meinem Bette den Reifen; später sollten nämlich alle unsere Rosenreifen zum Schmucke der Zimmer verwendet werden.
Lotte brauchte nun viel Platz zu ihrer Arbeit, wir rückten also bescheiden zusammen.
Melanie hatte ihr Kleid vollendet, es sah allerliebst aus. Vorsichtig trugen wir alles Fertige nach der Elisabeths-Ruh, denn das war der größte Raum. Weder Tante noch die Lehrerin betraten jetzt eines unserer Zimmer. Das hatten sie uns feierlich versprechen müssen.
»Ludchen, lege doch einmal deine Arbeit hin,« bat Melanie, »und hilf mir Tee bereiten!«
Wir waren ob dieser Meldung sehr vergnügt. Es war elf Uhr, und wir hatten noch ein Stündchen zu tun. Alle, die jetzt nicht beschäftigt waren, halfen Melanie, das ›leckere Mahl‹ zu bereiten. Auf dem Fußboden am Ofen leuchtete bald die Spiritusflamme, weil uns das der ungefährlichste Platz dünkte.
Ludchen legte sich höchst malerisch daneben hin, die blauen Flammen zuckten über sie hinweg.
»Jetzt bin ich Zigeunerin!« rief sie. »Schade, daß ich mein Kostüm nicht anhabe!«
»Höre einmal, ist das deine ganze Leistung?« fragte Melanie, welche mit den anderen die Tassen zusammenstellte.
»Laßt mich, ich werde auf dieses Element, das leicht gefährlich werden kann, aufpassen!« Sie blickte träumend in die Flammen. Gewiß waren ihre Gedanken bei ihrem Herzens-Trost. –
»Es wallet und siedet und brauset und zischt!« deklamierte sie plötzlich. Schnell wurde der Tee aufgebrüht. Wir legten alle Arbeiten weg und setzten uns um unsern nächtlichen Imbiß. Auf einem Papiere, das als Teller diente, lagen die abgezählten Stückchen Kuchen. Es schmeckte uns natürlich ausgezeichnet! Immer wieder wurden die Tassen gefüllt. Dann machten sich zwei darüber, das Geschirr zu reinigen, welches in unseren Kommoden aufbewahrt wurde.
Bald saßen wir wieder bei der Arbeit und vollendeten nun an diesem Abende alles. Mein Dornröschenkleid wurde endlich für flimmernd und strahlend genug erklärt und in einen zu diesem Zweck leergemachten Kleiderschrank gehängt.
Melanie packte die Reste ihres Heidekrautes weg, Lotte überreichte mir meinen fertigen Rosenreifen, Ludchen räumte auf. Karla hatte zuletzt wieder gelesen; jetzt klappte ich ihr das Buch zu, und sie sah mich darob sehr verwundert an.
»Es ist zwölf, Kinder!« sagte ich, und »bumm!« klang es dumpf von der nächsten Kirche her.
»Die Geisterstunde! Hu!« machte Lotte und kroch mit dem Kopfe unter die nächste Bettdecke. Aber Ludchen zog ihre Freundin sehr energisch wieder heraus.
Wir trennten uns, d. h. die andern gingen in ihre Zimmer, und wir öffneten noch einmal die Fenster und ließen die kühle, frische Sommerluft herein. Umschlungen, eng aneinandergeschmiegt, lehnten wir in einem der Fenster und blickten an den mit Sternen besäten Nachthimmel.
»Und da gibt es noch Menschen,« sagte Melanie, »die nicht an Gott glauben! Wer soll dieses große Weltall erschaffen haben? Wer leitet es? Ein Wesen muß es doch geben, das hoch über unserer kleinen Menschenweisheit thront.«
Ich antwortete nicht, Melanies Worte hatten mich wie ein Stich ins Herz getroffen. Nicht, daß ich zu jenen Unglücklichen gehörte, die Gott verleugnen, – ich glaubte fest an Ihn, – aber es waren Wochen vergangen, ohne daß ich so recht von Herzen gebetet hatte. Wo waren jene stillen, seligen Stunden innerer Andacht hin, wie ich sie zur Zeit meiner Konfirmation empfunden? Wie aus ferner Vergangenheit klangen mir plötzlich ganz deutlich die Worte unseres alten Geistlichen ins Ohr: »Die Jahre werden kommen, wo ihr in das Leben eintretet. Hütet euch, daß nicht mit den Weltfreuden, die in euer Inneres einziehen, der Glaube hinausziehe. Fühlt ihr es, so blickt des Abends hinauf an den Nachthimmel. Im Anschauen dieses weiten Raumes fühlt ihr Gottes Nähe!«
Mein Stübchen in der Mühle stand vor mir; wie so anders war ich damals gewesen! Großmütterchen, deine Enkelin ist nicht mehr das fromme Kind, als welches du es segnetest vor dem Scheiden aus dieser Welt, es ist in den Strudel der Vergnügen hineingeraten und findet sich nur schwer wieder heraus!
»Was hast du nur, Liesel?« fragte Melanie und zog mich an sich, »die ganze Zeit machst du so große, ängstliche Augen!«
Ich sagte nichts und weinte an ihrer Schulter. Glücklich der Mensch, der in solchen Stunden voll Vertrauen sein Haupt an die Brust eines Freundes legen kann! Ihm wird wohl.
Als ich an diesem Abende zur Ruhe ging, schlief ich nicht so gedankenlos ein, wie seit langem, ich faltete die Hände und betete wieder. –
Der große Tag brach an, und als Tante die Augen öffnete, begrüßte sie der Morgengesang ihrer ›Kinder‹. Gar feierlich hallte es durch das große Zimmer, wo wir uns aufgestellt hatten: ›Wer nur den lieben Gott läßt walten‹. –
Nach einer Weile erschien Tante selbst und wurde jubelnd beglückwünscht. Mit ihrem lieben Lächeln nahm sie alle die guten Wünsche entgegen und sagte: »Möchtet ihr, wenn ihr einmal so alt seid, wie ich heute, auch so glücklich und zufrieden sein!«
Wir tranken heute gemeinschaftlich Kaffee, was lange nicht mehr der Fall gewesen war, der großen Vorbereitungen wegen, die wir für diesen Tag getroffen hatten. Fräulein Knauer hatte einen mächtigen Kuchen auf den Tisch gestellt, von einem Kranze umgeben. Ludchen fand, daß er ausgezeichnet schmeckte. »Kein Wunder, ich habe ja die Mandeln dazu gewiegt und die Zitronen abgerieben!« sagte sie.
Wir hatten für Tante, die sich Handarbeiten streng verbeten hatte, einen schönen Tafelaufsatz gekauft. Natürlich lagen Blumen in allen Farben und Größen auf dem Geburtstagstische. Am Vormittage kamen viele Gratulanten. Mächtige Torten wurden ins Haus getragen, deren eine wir auf Wunsch der Spenderin, der Frau von Krafft, zum zweiten Frühstücke verzehren sollten. Tante schickte Wein dazu ins Speisezimmer. – Wir hatten uns alle möglichst in helle Sommerkleider gesteckt. Zu den offenen Fenstern des großen Speisesaals herein flutete das warme, goldene Sonnenlicht, draußen sah man ins Grüne, die Vögel sangen. Wir saßen am Tisch, Melanie schnitt die Torte an.
»Möglichst große Stücke, bitte!« bat Lotte, »dies ist nämlich meine Lieblingstorte! Wenn wieder mein Geburtstag ist, schenkt mir eine solche!«
»Natürlich!« hieß es. Ich goß den golden funkelnden Wein in die Römer. »Tante soll leben!« sagte ich, und wir stießen an und sangen ein – abgestimmtes Hoch, das wir uns einstudiert hatten. Da ging die Tür auf, und Tante mit Frau von Krafft wurden sichtbar.
»Hoch!« war es eben dreistimmig verklungen.
»Das nenne ich ein reizendes Bild, Wein, Weib, Gesang; alter Luther, du hattest recht!« rief Frau von Krafft.
Wir begrüßten sie, und Lotte meinte: »Ihre Torte ist wirklich famos, gnädige Frau! Melanie, gib mir das zweite Stück, bitte!«
Frau von Krafft lachte, Tante drohte Lotte mit dem Finger. Voll Liebe ruhten die Augen der beiden Damen auf uns jugendfrohen Mädchen. Die Schnäbelchen gingen gewaltig, im Plaudern und Kauen.
»Frau von Krafft bleibt den ganzen Tag bei uns!« sagte Tante.
»Bravo!« riefen wir ausgelassen. Ein Dienstmädchen brachte eine Depesche aus Paris, Glückwünsche von Johanna und Elsbeth. Von den früheren Pensionärinnen waren auch Gratulationen mit zum Teil reizenden Geschenken gekommen. –
Aber das Wort blieb uns allen im Munde stecken, als jetzt die Tür abermals geöffnet wurde und – Gabriele hereintrat, hinter ihr ihr Bräutigam. Sie sah anders aus als früher, lustig, gut und glücklich. – Wir fuhren von unsern Sitzen in die Höhe. Gabriele! Eine richtige Braut unter uns! Wir umdrängten sie. Sie begrüßte natürlich zuerst Tante und Frau von Krafft, stellte diesen ihren sehr eleganten und liebenswürdigen Bräutigam vor, aber dann küßte sie uns der Reihe nach. Das Glück und die Freiheit hatten eine andere aus ihr gemacht. Sie war jetzt ein schönes, sympathisches Wesen. Auch äußerlich war sie besser geworden, die einst so unordentliche Gabriele schien verschwunden. Sie trug ein helles Seidenkleid, das ihr sehr gut stand.
Wir freuten uns unendlich, die frühere Pensionsschwester wieder da zu haben. Sie erzählte uns, während ihr Bräutigam sich mit den älteren Damen unterhielt, daß einer ihrer Brüder sie begleitet habe. Beide Herren würden im Hotel bleiben, aber sie wolle Tante bitten, sie diese eine Nacht wieder in der Pension wohnen zu lassen.
»Schatz – o Pardon, meine Damen!« rief der Bräutigam, »Gabriele, Fräulein von Reißner will dich gütigst für heute noch einmal als Pensionsfräulein aufnehmen!«
»Ach, wie reizend!« rief Gabriele erfreut.
Am Mittag war es sehr heiter zugegangen, aber an einen Nachmittagskaffee dachte niemand; nur die beiden Damen hatten in Tantes Zimmer ein Täßchen getrunken und sich dann ebenfalls in bequeme Eckchen gelehnt. Ein wahrer Dornröschenschlaf hielt alle umfangen. Die Fliegen summten, die Sonnenstrahlen prallten an den grünen Jalousien ab, die wir herabgelassen hatten. –
»Brrr« – so schnarrte laut und deutlich der Wecker in unserem Zimmer los, den Melanie vorsichtigerweise auf sechs Uhr gestellt hatte. Wir fuhren in die Höhe. Auch nebenan hatte man den Wecker gehört, denn Karla rief die Unzertrennlichen:
»Steht auf, es läutet zum Kaffee!«
Nach und nach ist ihr wohl klar geworden, daß es nicht früh, sondern abends um sechs war.
Da wir um sieben Uhr zum Empfange der Gäste im Salon sein mußten, so sputeten wir uns, wieder ein menschenwürdiges Aussehen zu bekommen.
Wir begrüßten nun die Gäste, bedienten sie, indem wir Tee herumreichten, bis alle erschienen waren. Dann gingen wir paarweise zu Tische. Das sonst so kahle Schulzimmer war in einen Tannenhain verwandelt. An den Wänden waren grüne Zweige angebracht, überall standen hohe Tannenbäume. Welch köstlicher Waldduft!
»Da fühlt sich unsere blonde Müllerliesel gewiß in die Thüringer Heimat versetzt!« sagte Melanie zu mir.
»Sie sind aus Thüringen?« erkundigte sich nun mein Tischherr. Ich bejahte es, war aber noch gleich den anderen sprachlos über diesen Glanz. In Hufeisenform stand eine Tafel da, reichlich mit köstlichen Fruchtpyramiden, Blumenvasen, Silber usw. bedeckt.
Als wir alle unsere Plätze eingenommen hatten, – es gab auch Tischkarten, – kam der erste Gang. Bald herrschte die heiterste Stimmung. Sogar Herr Wagner, mein Nachbar, ein stiller Geistlicher, ward lebendig. Ich berichtete ihm von meiner Jugendzeit, Ernstes und Heiteres, gedachte auch meiner früh verlorenen Freundin. Er sah mir so freundlich in die Augen, daß er mir wie ein längst vertrauter Freund erschien.
Mir gegenüber saß meine Herzensfreundin und unterhielt sich in ihrer stillen, anmutigen Art mit dem Musiker an ihrer Seite. Karlas dunkles Köpfchen war in beständiger Bewegung, sie lachte und plauderte nach allen Seiten. In ihrem Elternhause hatte ein geselliges Leben geherrscht, deshalb schwamm sie wie ein Fisch in seinem Elemente bei derartigen Festlichkeiten. – Toaste wurden ausgebracht, wir standen auf und stießen mit Tante an, die Gläser klangen aneinander. Sie sah so glücklich aus.
»Dies wunderbare Haar!« hörte ich hinter mir flüstern. Müllerliesels Zöpfe machten Aufsehen. –
Vor dem letzten Gange, es war inzwischen acht Uhr geworden, gab uns Tante einen Wink, daß es Zeit sei, uns für die Vorstellungen anzukleiden, die gegen neun Uhr beginnen sollten, d. h. sobald es eben anfing dämmerig zu werden.
Eine nach der anderen huschte hinaus, draußen tanzten wir zu zweien die Korridore entlang. Aus dem Gesellschaftszimmer tönte das summende Geräusch von sprechenden Menschen. Es mochten wohl noch vierzig und mehr Gäste da sein.
Wie sonderbar war es, als uns das dämmernde Tageslicht begrüßte!
Wir kleideten uns an. Ludchen sah allerliebst aus in ihrem Bauernanzug, märchenhaft schön aber meine Melanie im kurzen weißen Kleide. Um Schulter und Hüften war ein weißes Fell geschlagen; auf dem blonden Haare, dessen zartroter Schimmer seinen Reiz nur erhöhte, lag der Heideblumenkranz. Ich flocht nun schnell mein Haar auf. Dann zog ich rosa Strümpfe und ebensolche Schuhe an, schlüpfte in mein Dornröschenkleid und blickte nun in den Spiegel. Höchst verblüfft betrachtete ich mein eigenes Bild. War das wirklich die Müllerliesel, vor Jahresfrist noch dick und rotwangig wie ein echtes Landkind? Mein Gesicht war schmäler geworden, hatte die sogenannte Stadtfarbe bekommen; dadurch erschienen die Augen größer. Wie ein Mantel fielen meine dicken, blonden Haare um mich, bis an die Knie reichend. Einzelne Locken lagen auf der Stirn.
Ich holte nun den Rosenkranz, setzte ihn auf und musterte noch einmal das flimmernde Kleid, das wirklich ganz märchenhaft war. Die Ärmel fielen vom Ellenbogen ab in zwei langen Flügeln herunter.
»Gut so, Liesel!« sagte ich zu meinem Spiegelbilde, raffte die Gazewolken, die in langer Schleppe endigten, auf und ging hinunter.
»Liesel, o wie herrlich!« rief da mit einemmal jemand mir entgegen. Es war Melanie. Heideröslein und Dornröschen fielen sich in die Arme.
»Laß dich betrachten,« sagte Melanie, »kein süßeres Märchenbild als meine Liesel!«
Ein Bauernbursche kam die Treppe herauf, es war Herr Braun. Er schwenkte grüßend die Mütze. Dann rief er: »Meine Damen! Der Weg ist offen, der zur Bühne führt!«
Schnell schlüpften wir, ungesehen von den Gästen, den schmalen Gang entlang. Es war tief dämmerig, gut für unsere Bilder geeignet.
Wir blickten durch die Spalte im Vorhang. Auf den Sitzen lagen heute rote Kissen und Programme. Jetzt kam ein Brausen näher und näher. Es war der Schwarm der Gäste.
»Ah!« riefen sie, als sie das Ganze erblickten.
Nachdem alle Platz genommen, kam die erste Nummer. Die ›Bühne‹ war in ihrem Naturzustande. Im Hintergrunde stand Susanne, welche ausgezeichnet vortrug. Sie sollte einen kurzen Prolog sprechen. Allerliebst sah sie aus in einem grünen Kleidchen. Sie stand erhöht, und zu ihren Füßen waren allerlei Blattpflanzen aufgestellt.
»Kinder, ich habe Angst!« sagte sie. Wir waren in den Bäumen versteckt. Ein feiner Klingelton. Das Sprechen verstummte, wir hörten Suses sympathische Stimme. Sie sprach laut und gut. Als sie geendet, ward geklatscht, sie verbeugte sich lächelnd und hüpfte zu uns.
Nun kam das Bauernbild. Gretchen, Karla und Suse, welche die bestgeschulten Stimmen hatten, stellten sich hinter den Bäumen auf. Weich kam es aus dem Grün hervor: ›Wenn die Schwalben heimwärts ziehn, wenn die Rosen nicht mehr blühn‹ … Bei der Stelle: ›Ob ich dich auch wiederseh? Scheiden, ach Scheiden, Scheiden tut weh‹ öffnete sich der Vorhang, und ein einfach schönes Bild ward sichtbar. Links stand der Bauernbursche, wie rüstig in die Fremde vorwärts schreitend. Die Mütze schwenkte er hoch wie zum Abschiedsgruß. Sein Kopf war zurückgewandt, dahin, wo sein Liebchen auf einem Hügel stand, das liebreizende Gesicht ihm voll zugewandt, beide Hände ihm nachgestreckt, in den Augen Trauer und Liebe. – Mehrmals mußte sich der Vorhang vor dem schlichten, ergreifenden Bilde heben. – Jetzt mußte sich Herr Braun zum Hirten umwandeln; er nahm den falschen Bart und die dunkle Perücke ab und legte ein Fell über die Schultern.
Bald war die Gruppe gestellt, Gretchen stimmte mit heller Stimme das neckische, anmutige Lied an: ›Sah ein Knab' ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden‹ … Der Vorhang teilte sich, und ein Ruf des Entzückens entfuhr allen.
Von einem bläulichen Lichte übergossen, das wie Silber über allem lag, standen die beiden schönen, jugendlichen Gestalten da. Heiderösleins Stellung war eine abwehrende, der ideal schöne Kopf war stolz zurückgebogen, die rechte Hand hielt einen Schäferstab, auf den sich Melanie leicht stützte, die linke hatte sie gegen den vor ihr Knienden ausgestreckt.
Es war ein entzückendes Bild. ›Röslein auf der Heiden‹, klang der Gesang dazu. Immer wieder tönte rauschender Beifall, immer wieder mußte der Vorhang sich teilen.
Abermals zog sich Herr Braun um. Es war sehr drollig, als wir nach einer Weile einander auf der ›Bühne‹ bewunderten. Er war ein prächtiger Prinz geworden, trug jetzt lange, blonde Locken, die ihm auf die Schultern fielen. Sein Anzug bestand aus zartblauer Seide, um die Schultern lag ein kurzer Mantel aus purpurrotem Samt, der kleine goldene Säbel hing an der Seite. Auf die Hände fiel zartes Spitzengewebe; man konnte sich wirklich keinen schöneren Märchenprinzen denken. Wir schüttelten uns beiderseitig zufrieden die Hände.
Unser heute so vielgeplagter Braun war eifrig beschäftigt, Dornröschens Sitz herzurichten. Er mußte mit besonderer Vorliebe an dieses Bild gedacht haben, denn er verwandelte nach und nach den Rasenfleck in einen kleinen Rosenhain. Teils waren es kleine Stückchen Kulissen, die er in den Hintergrund schob, teils echte Rosenstöcke.
Der Prinz und Dornröschen halfen mit. – Nun wurde mein Sitz gemacht. Ich saß, halb liegend, mitten im Grünen, d. h. auf Decken und Kissen, von denen aber der Zuschauer nichts sah. Mein Kopf lehnte am Stamm einer Rose, um mich nichts als Rosen in allen Farben, märchenhaft. Sie rankten sich um meine Schultern, sie lagen auf dem Kleide, dessen zartrosa Wolken mit dem Grün verschwommen. Mein Haar fiel auf die Schultern und hing dann am Boden. Die Hände leicht verschlungen, lag ich da.
Vorher kniete noch mein Prinz neben mir nieder. Er beugte sich halb über mich wie zum Kusse, der ja Dornröschen bekanntlich aus ihrem Schlafe erweckt, ich sah die wallenden blauen und weißen Federn seines Hutes über mir. –
Das Publikum ward ungeduldig; da verschwand der alte Braun nach einem letzten Beifallsgemurmel, die leise, melancholische Geige begann zu spielen. Unwillkürlich schloß ich wie träumend die Augen. Doch sah ich trotzdem, daß wir in rotes Licht getaucht waren, und hörte leise rauschend den Vorhang sich auseinanderschieben.
Es war eine halbe Minute totenstill, dann brauste ein solcher Beifall los, daß ich förmlich erschrak.
»Wundervoll!«
»Herrlich!«
»Ach, wie entzückend!«
Noch viele ähnliche Rufe wurden laut. Jetzt wechselte das Licht und ein ganz helles, wie Vollmondschein, mußte auf uns fallen. Mäuschenstill, wie versunken im Schauen, waren unsere Zuschauer. Als der Vorhang fiel, brauste ein wahrer Beifallssturm los. Immer wieder wollten sie uns sehen, aber Herr Braun sagte lachend, diese Stellung sei ihm zu schwer, immer nur das schlafende Dornröschen betrachten zu müssen, ohne es doch wachküssen zu dürfen, das sei zu viel der Qual. –
Gabrieles Bruder, der Leutnant von Stetten, schob ein paar vom vielen Klatschen in Fetzen gerissene Handschuhe durch den Vorhangsspalt, was große Heiterkeit bei uns verursachte. Aber viel Zeit blieb uns nicht, denn wir hatten uns für den Rosentanz anzuziehen. Melanie und ich liefen in das Haus, in wenig Minuten waren wir fertig, Ludchen hüpfte vor uns die Treppe hinab. Mit unseren ganz gleich gemachten weißen Kleidern, Rosen auf dem Kopfe, um Schultern und Ärmelausschnitt, die großen Rosenreifen in der Hand, schritten wir hinter dem geschlossenen Vorhange auf und ab, bis die ›Bühne‹ frei war. Den Hintergrund bildeten Bäume, auch rechts und links standen kulissenartig solche, es sah aus wie ein echter Rosenhain. Wir waren zu Paaren geordnet, unser beliebter, reizender Walzer begann mit seinem wiegenden Tempo. Das fuhr uns in die Füße. Der Vorhang ging weit zurück, ein rosiger Schimmer umgab uns, als wir hervortanzten. Jubelnder Beifall empfing uns.
Es waren allerliebste Gruppen, die wir stellten, bald bildeten wir einen Stern, bald vereinigten sich die rosengeschmückten Reifen hoch in der Luft.
Der Schluß war besonders schön: wir formten einen Gang, eine Art Brücke von unseren Reifen, die zwei ersten knieten malerisch nieder. Lottchen, einen Blumenkorb tragend, den ihr Herr Braun gereicht, schritt durch diesen Gang bis zu Tante, ihr mit einem allerliebsten, kurzen Gedichtchen den Korb überreichend. –
Der Vorhang fiel, und ein Beifall ohnegleichen lohnte uns. Dann kamen die Gäste auf die Bühne; Tantchen hatte Tränen in den Augen, als sie sich bei jeder einzelnen bedankte.
»Schönes Dornröschen, Sie müssen wieder in Ihr Kostüm!« sagte der Medizinalrat zu mir. Er hatte Melanie behandelt, als sie krank war, und behauptete scherzend, deren gute Pflegerin sei ihm ordentlich ins Herz gewachsen.
»Haben alle Thüringer Waldmädel so prächtiges Haar?« sagte seine Frau.
Auch Melanie wurde bestürmt, ins Heiderösleinkleid zu schlüpfen. Tante nickte uns bestimmend zu. Die anderen blieben wie sie waren.
So zogen Melanie und ich unsere gewünschten Anzüge wieder an und wurden jubelnd umringt, als wir den inzwischen feenhaft beleuchteten Garten wieder betraten. Gabriele flog auf uns zu; sie war ganz entzückt von allem und behauptete, das müßten wir zu ihrem Polterabend aufführen, denn daß wir alle zu ihrer Hochzeit kämen, nahm sie als selbstverständlich an. –
Bis in die Nacht währte das schöne Fest. Wir gondelten, lagerten uns am Ufer, sangen Volkslieder und bewunderten die glänzende Beleuchtung, die Braun ins Werk gesetzt hatte. Eine Polonaise wurde getanzt, ganz gespenstisch spiegelte sich der buntfarbige Zug im dunklen Weiher wider.
Der neue Tag war angebrochen, als die letzten Gäste gingen. – Es war längst die Kaffeestunde vorüber, als ich am nächsten Morgen erwachte. Melanie schlief noch fest, auch im Nebenzimmer war es still. Ich kleidete mich leise an und schaffte ein wenig Ordnung, damit Melanie nicht allzuviel Arbeit habe.
Es war leer im Speisesaale, noch keine der aufgestellten Kaffeetassen berührt. Aber Briefe lagen da, auch einer für mich von Mutter.
Ich trank schnell meinen Kaffee, dann nahm ich meinen Brief und ging damit in den Garten. Wieviel fleißige Hände hatten sich da schon gerührt, während wir geschlafen hatten! Niemand hätte eine Spur entdecken können, daß vor wenigen Stunden hier eine ausgelassene Gesellschaft sich vergnügt hatte, alle Wege waren geharkt, die Bühne verschwunden, kein Laternchen mehr zu sehen. Hinten am Weiher die tiefste Morgenstille; mir wurde ganz heimatlich ums Herz. So war es oft um diese Stunde auf der Mühle gewesen, dann war mir immer das Lied durch den Kopf gegangen: ›Da gehet leise, nach seiner Weise, der liebe Herrgott durch den Wald‹ …
Ach, meine Mühle! Es überkam mich eine tiefe Sehnsucht nach diesem Idyll am Werraflusse; bald, bald kann ich wieder daheim sein! –
Ich öffnete Mutters Brief, lehnte mich bequem in die grüne Bank am Weiher zurück und las, las folgendes mit immer größer werdenden Augen, mit immer bleicher werdendem Gesicht:
»Mein liebes Herzenskind!
Wieviel Trauriges muß ich Dir heute melden, meine Liesel! Unser Hans hat Vater so schweren Kummer zugefügt, daß dieser seine Hand von ihm abgezogen hat und ihm geraten, nach Amerika zu gehen und arbeiten zu lernen. Kehrt er einst als ordentlicher Mann zu uns zurück, so findet er die Arme der Seinen offen. – Hans hat Wechsel unterschrieben, so viel Schulden, auch im Spiel, gemacht, daß Vater alles Ersparte hingeben mußte, nur um den Namen Ferner vor öffentlicher Schande zu bewahren. Hans hat nicht mehr geschrieben, aber es scheint doch eine Art Besinnung über ihn gekommen zu sein; wir hörten, daß er sein Bündel geschnürt habe und fort von Berlin sei. Daß er sich überhaupt aus dieser lockeren Gesellschaft, in die er geraten ist, losgemacht hat, ist ein Beweis, daß ein guter Kern in ihm steckt.
Liesel, wie schwer ist es für uns! Wäre er tot, es wäre nicht so schlimm, als es für ein Mutterherz ist, einen verlorenen Sohn draußen in der Welt allein zu wissen. Meine Tränen und meine heißen Gebete begleiten ihn. Möge Gott ihn durch eine Lebensschule läutern und ihn bald wieder zu uns heimkehren lassen.
Fritz ist ein lieber, zärtlicher Sohn. Er hat alle Wanderpläne aufgegeben, trotzdem es so verlockend für ihn war, Ernst nach Bayern zu begleiten. Er hilft Vater, dem er einen Gesellen erspart.
Vater hat viel Sorgen, Du wirst ihn grau geworden wiederfinden. In der Mühle geht es nicht mehr so gut wie früher. Die Konkurrenz dringt sogar bis in unsere stillen Täler. Papa hat schon ernstlich daran gedacht, ob es nicht am besten sei, sein ganzes Besitztum zu verkaufen, solange es noch nicht ganz wertlos geworden ist, und sich wo anders niederzulassen.
Das Jahr, seit Du fort bist, hat viel geändert. Wie glücklich habe ich meinen Ältesten fortziehen sehen! Und nun – ich finde nirgends Ruhe, die Sorgen lassen mich nicht schlafen. Armes Kind, Du solltest jetzt deine Jugend genießen und erlebst schon so viel Trauriges! Wie so manches findest Du nicht mehr, wenn Du heimkommst! …«
Ich lag noch weinend in der Ecke meiner Bank, als mich eine liebe Stimme aus meinem Schmerze weckte. Ganz bestürzt beugte sich Melanie über mich: »Um Gottes willen, Liesel, was ist dir denn geschehen? Sag mir alles!« Sie umschlang mich voll Liebe.
»Lies selbst, du bist ja meine Herzensfreundin und darfst alles wissen!«
Sie las den Brief. »O Gott!« rief sie erschrocken, als sie von Hans las.
Dann sagte sie: »Liesel, ist's nicht wie ein Fingerzeig von Gott?«
Ich blickte sie verständnislos an.
»Werde nun Krankenpflegerin, Liesel, du wirst dann glücklich und nimmst deinen Eltern die Sorge um dein Fortkommen!«
Ich konnte nur weinen. Ich war mit einem Schlage über Nacht ein armes Mädchen geworden, das daran denken mußte, den Kampf ums Dasein aufzunehmen. Denn die ohnedies so schwer mit Sorgen beladenen Eltern noch mehr hineinstürzen, das wollte ich nicht. Aber es ward mir nicht leicht, ernstlich diesen Entschluß zu fassen, jetzt, wo ich davor stand. Ich war fassungslos und lief händeringend auf und ab.
»Mein Hans!« rief ich verzweifelt, »mein lieber, armer Hans!«
Ich kniete weinend an der Bank hin und legte meinen Kopf auf das harte Holz.
»Liesel,« bat Melanie, »sei doch meine starke Freundin! Soll der erste harte Schicksalsschlag dich gleich werfen?« Sie streichelte mich: »Warum bist du so trostlos? Gott hat dir noch nicht das Schwerste auferlegt, er weiß, daß du es tragen kannst, mein Herz! Deinen Bruder wird er in harter Lebensschule läutern; wäre es dir lieber, wenn er ganz und gar untergegangen wäre? Und fürchte dich nicht vor dem sogenannten Kampfe ums Dasein, Liesel! Ich muß ihn so gut wie du kämpfen, und mit uns müssen es Millionen! Und wieviel hast du vor anderen voraus! Dir bleibt das Vaterhaus, und du hast eine Mutter!«
Ganz erbärmlich kam ich mir vor in meinem kleinlichen Zagen, ich umschlang meine Freundin und legte meinen Kopf an ihre Schulter.
»Du hast recht, Melanie, ich bin ein feiges Ding!« sagte ich. »Aber laß mich nur erst mich an den Gedanken gewöhnen, dann wirst du eher mit mir zufrieden sein!«
»Schreib deine Pläne recht bald nach Hause, Liesel; wenn du willst, lege ich ein paar Zeilen bei – weißt du, Schatz,« sagte sie lächelnd, »so eine Art Zeugnis Nummer 1, denn du warst ja doch zuerst meine Pflegerin!«
Ich küßte die milde Trösterin. Wie erinnerte sie mich oft an meine tote Anneliese! Ich kühlte mit dem Wasser des Weihers meine Augen, damit niemand die Spur von Tränen entdecken sollte. Dann blieb ich noch ein Weilchen mit Melanie sitzen. Wir machten ernste Zukunftspläne. –
Jetzt, im vollsten Lebensglücke, denke ich mit Rührung an jene Zeit zurück. Ich sehe im Geiste uns zwei jugendlichen Mädchen eng umschlungen beisammensitzen. Blondkopf an Blondkopf gelehnt, die apfelblütenfrischen Gesichter vor Eifer gerötet, die Herzen voller Ideale, voller Mut, es trotzig mit dem Leben aufzunehmen. Und dabei jener stille Sommermorgen, der wie ein Gebet ist, und das leise Rauschen der Wellen des kleinen Weihers. Schöne, glückliche Mädchenzeit! – – –
Ich lief in mein Zimmer, und Melanie bewirkte, daß niemand mich bei diesem wichtigen Brief stören sollte. Sie versammelte die ganze Pension im Musikzimmer und spielte dort das Schönste, was sie konnte.
Ich schrieb indessen an die Eltern, wie schmerzlich mich Mutters Brief berührt habe. Dann sprach ich ihnen von dem Entschlusse, der schon lange in mir gereift sei: »Laßt mich Krankenpflegerin werden, bitte! Ich will nicht noch Eure Sorgen vermehren, sondern arbeiten. Mütterchen ist noch jung genug, dem kleinen Haushalt vorzustehen. Die lange Zeit, bis sie dereinst nicht mehr kräftig genug sein wird, will ich nützlich ausfüllen. Wir sind nicht reich, und deshalb will ich gerne tun, was so viele in meiner Lage tun müssen, um mir mein Brot zu verdienen. Sorge nicht, liebe Mama, daß ich dadurch um eine sorglose Jugend käme. Dank Eurer Güte haben wir Müllerskinder eine so schöne Jugend verlebt wie wenige. Und wie herrlich war das Pensionsjahr! Wir sind ja aus der fröhlichen Sorglosigkeit nicht herausgekommen.
»Bald bin ich siebzehn Jahre alt, da kann ich wohl daran denken, etwas zu leisten. Mir ist's auch oft, als sei ich älter. Bitte, schreibt mir, daß Ihr meinen Entschluß billigt! Ich erwarte Eure Zusage mit Sehnsucht. Bleibt mir auch mein liebes, liebes Daheim vorläufig verschlossen, so werde ich doch sehr glücklich sein, wenn ich ernste Pflichten zu erfüllen habe. Ich würde dann gleich von der Pension aus in ein Mutterhaus eintreten, um meinen Kursus durchzumachen. Tante weiß in allen solchen Dingen Bescheid, sie würde mir behilflich sein.«
Ich schrieb viel und eindringlich, tröstete auch die arme Mama wegen Hans, um den ich mich doch selbst so sehr grämte.
Melanie steckte den Kopf zur Tür herein: »Fertig?« Ich nickte und legte die Feder hin. Ich hatte mir ganz heiße Wangen geschrieben.
»Nun erlaube mir eine Nachschrift!« sagte Melanie und setzte sich lächelnd hin. Dann schrieb sie, während ich ihr über die Schulter zusah und über das mir gespendete Lob noch röter wurde: »Lassen Sie, bitte, auch die Freundin Ihrer Liesel ein paar Worte senden. Ich weiß es ja aus Erfahrung, wie geschaffen meine liebe, gute Liesel für den Beruf ist, den sie ergreifen will. Sie hat so sanfte Hände, man wird gesund, wenn ihr liebes Gesicht sich über einen neigt. Es ist ein schwerer Beruf, und es gehört Engelsgüte und Engelsgeduld dazu, ihn zu ergreifen. Aber unsere Liesel besitzt beides. Geben Sie ihr, bitte, die Erlaubnis, sich selbständig zu machen; so jung sie auch ist, sie ist innerlich reif, den Ernst und die Heiligkeit dieses Berufes einzusehen.«

»Höre auf,« sagte ich, »du schilderst ja eine ganz andere Elisabeth, ein Ideal, aber nicht die Müllerliesel!«
»Laß mich nur!« wehrte Melanie.
Der Brief wurde von uns beiden auf die Post getragen. – Wir wollten Tante nicht eher etwas sagen, bis die Erlaubnis von den Eltern da war.
Ich kam mir innerlich um Jahre gealtert vor. Es war ja ein so ernster Wendepunkt in meinem Leben. Ich betrachtete meine Umgebung mit anderen Augen, es war mir, als trüge ich jetzt schon die schwarze, ernste Tracht und passe nicht mehr unter diese jungen, sorglosen, fröhlichen Mädchen. Wie zwei Blumen erschienen mir Lotte und Ludchen, weich im Schoß des Reichtums gebettet. An sie würde wohl nie im Leben die Frage herantreten: Von was lebst du?
Ich erschrak vor mir selber; sah das nicht wie Neid aus, Neid auf den Reichtum anderer?
Ich schämte mich meiner Gedanken. »Blick unter dich!« pflegte Großmutter oft zu sagen; wie recht hatte sie! Wenn einem einmal die Last des Lebens zu schwer erscheint, so braucht man nur ins blasse Angesicht wirklicher Armut zu blicken, und dankbar faltet man die Hände und findet seine Last leicht. Ein jeder hat sein Kreuz zu tragen im Leben; im wahrsten Sinne des Wortes ist ja unser Heiland uns vorangegangen und hat sein Kreuz zur Richtstätte getragen. Wieviel mehr kommt es uns Menschen zu, unser Kreuz auf uns zu nehmen! – –
Nach wenigen Tagen hielt ich zitternd einen Brief von Mutter in der Hand. Welche Entscheidung würde er bringen? Ich öffnete und las liebe, liebe Worte, aus denen die ganze Treue des Mutterherzens sprach: »Mein Kind, wenn Du den inneren Beruf fühlst, Dich auf diese Weise der leidenden Menschheit nützlich zu machen, so wollen Deine Eltern Dir gewiß nicht hinderlich sein. Aber, meine Liesel, Du bist noch jung, bedenke, welch schweres Los Du Dir erwählst! Du kannst jeden Augenblick nach Hause kommen, Vater und ich sind glücklich, unsere Tochter wieder zu haben. Ob es uns freilich möglich sein wird, Deine Zukunft ganz sicher zu stellen, das weiß ich nicht, es steht in Gottes Hand. – Der Gedanke, Dich, mein Herzenskind, so lange nicht zu sehen und Dich so angestrengt zu wissen, ist mir schwer. – Wähle Du selbst, meine Liesel, unser Segen begleitet Deine Entschlüsse, ob diese Dich ins Elternhaus oder in Deinen erwählten Beruf führen …«
Von Hans war Nachricht aus Hamburg gekommen, er war bereits auf dem Wege nach Amerika. –
Ich war fest entschlossen, als ich Mutters Brief gelesen hatte, den erwählten Beruf zu ergreifen. Was Tausende vermochten, das würde ich wohl auch können, und ein wenig vom barmherzigen Samaritertum steckte ja in mir. – Als Melanie, welche in der Stadt gewesen war, zu mir kam, flog ich ihr an den Hals und rief: »Melanie, ich darf!«
Sie küßte mich gerührt und sagte: »Gott gebe dir Seinen Segen, du kleine Samariterin. So wollen wir beide tüchtig in unsern Berufen werden. Liesel, ich will Stunden geben, und du gehst als helfender Engel von Bett zu Bett! Ach, meine Liesel, es ist so herrlich, kein ganz unnützes Glied der menschlichen Gesellschaft zu sein! Siehst du,« sie hatte Hut und Handschuhe abgelegt und setzte sich zu mir auf das Sofa, »die kleinen, lieben Dinger da nebenan sind ja glücklich, aber bloß, weil sie gerade die Herzen voller Liebesglück haben. Glaubst du, daß sie es ohne das wären? Sie können sich jeden Genuß verschaffen, jeden Wunsch erfüllen, sie kennen nicht das himmlisch Schöne, das im Streben liegt! Sich etwas erkämpfen, heißt unsichtbare Mauern übersteigen, hohe Ziele erreichen, endlich siegen; ach, das allein ist ja des Lebens wert, Liesel!« –
Ich trat einige Tage später bei Tante ein und erzählte ihr meine Pläne. Sie war hocherfreut und sagte, daß ich durchaus nicht das erste Pflegekind sei, welches sie an das Mutterhaus nach Halle sende. Sie wollte sofort die nötigen Schritte tun, freilich könnte es sein, daß ich bereits am ersten September dort eintreten müßte. Mir wäre das lieb, sagte ich, denn der Abschied würde mir ohnehin so schwer.
Wir saßen nebeneinander und unterhielten uns lange. Ich hörte Tante so gerne sprechen, man holte sich Trost und Herzensfrieden bei ihr.
»Wenn eine sich zur Pflegerin eignet, so bist du es, Liesel!« sagte sie. »Der liebe, blonde Kopf birgt so viel Gemüt.« – Ich küßte sie, damit sie nicht weitersprechen sollte. Sie lachte und sagte: »Nun genieße nur die wenigen Wochen deines Hierseins noch recht, Kind; wir wollen fleißig spazieren gehen, damit du mit frischen Kräften an deine schwere Pflichterfüllung gehst. – Weißt du, Liesel, in Leipzig gibt es ein ganz spezielles Kinderkrankenhaus. Hättest du Lust, dort dereinst deinen Beruf zu erfüllen, dich der kleinen kranken Menschheit zu widmen?«
»Gern, Tante! Ich habe Kinder so lieb! Und wenn ich etwas erreicht habe, dann gönne ich mir eine Fahrt in die Heimat. Wie sehne ich mich oft danach, so sehr ich hier auch eine zweite Heimat habe!«
»Das begreife ich! Es wäre unnatürlich, wäre es nicht so! Aber auch dort wirst du bald ein Heimatgefühl haben, wo du deinen Beruf erfüllst!«
In der Pension war meine Absicht auf meinen Wunsch bekannt geworden. Zuerst betrachteten sie mich mit heiliger Scheu, als stehe jetzt schon die fertige Diakonissin vor ihnen, dann aber kam eine doppelte, rührende Liebe und Zärtlichkeit hervor.
Ludchen und Lotte sagten, sie wollten einen großen Abschied feiern, wenn ich wirklich schon am ersten September ginge. Elisabeth wollte mir ein Bild malen, Karla eine Schürze nähen.
Gabriele von Stetten war am Tage nach dem Feste mit herzlichem Abschiede wieder fortgereist, sie und ihr Bräutigam luden die Pension zur Hochzeit ein. Melanie und ich genossen jede Stunde, die uns noch beschieden war. Wir spielten Klavier zusammen, plauderten viele stille Abende lang, fuhren auch oft allein auf dem Weiher.
Unsere Photographien von Tantes Geburtstag her waren gemacht worden, als diese verreist war. Es waren sehr gut gelungene Bilder, der Rosentanz in einer der hübschesten Gruppen; dann war das Bildchen zum Schwalben-Abschied; Heideröslein, das wie ein Idyll aussah, ganz wunderschön, und mein Dornröschenbild. – Noch heute hängen diese lieben Bilder in selbstgeschnitzten Rahmen über meinem Schreibtische. –
Die Wochen vergehen so rasch, wenn ein Abschied vor einem liegt! Ich lag oft des Abends in meinem Bette und weinte. So weh war mir ums Herz, als liege die Zukunft schwarz vor mir. Endlich fand ich Trost im Gebet, ich schlief dann ruhiger ein. – Von Hause bekam ich viel liebe Briefe, Mutter wurde es so schwer, mich ziehen zu lassen, jetzt, wo sie mich bald wieder bei sich zu haben geglaubt hatte. Fritz, der brave Junge, schrieb, wieviel mehr Achtung er vor seiner Schwester habe als vor Hans, doch las ich wohl zwischen den Zeilen, wie sehr er sich nach dem Bruder sehne. Es klang gar wehmütig, als er schrieb: »Nun ist er doch noch nach Amerika gegangen, Liesel! Weißt Du noch, als wir damals auswandern wollten, aber heilfroh umkehrten, als Du uns Klöße und Gänsebraten meldetest? Wo sind die schönen Zeiten hin!?«
Tante hatte inzwischen Schritte getan, damit ich als Probeschwester im Mutterhause aufgenommen wurde. Es war alles nach Wunsch gegangen, man freute sich dort über jede, welche Lust und Liebe zu diesem Berufe zeigte. Und es gab noch so viele Stellen zu besetzen, überall suchte man Schwestern. Welch weites, unbebautes Feld für alle Müßigen, das der barmherzigen Nächstenliebe!
Also am ersten September sollte ich die Pension verlassen; noch zwei Wochen waren es bis dahin. Vier Wochen später gingen freilich noch einige: Gretchen und Suse, meine Melanie und eine aus der Elisabeths-Ruh. Meine Freundin kehrte nach Köln zu ihrem Vater zurück, um dort weiter zu lernen und zugleich Unterricht zu geben. –
Ein Abschied wirft seine Schatten weit voraus. Ich blickte schon alles um mich mit scheidenden Augen an. – Viel Liebes erwiesen mir die Pensionsschwestern noch; ein Photographiealbum, das sämtliche Bilder der Pensionsschwestern enthielt, auch das von Tante, schenkten sie mir. Welche Freude für mich! Das Schönste aber gab mir Melanie, ein Bild vom Weiher, dem lieben, alten Weiher, an dem ich so oft gesessen!
»Ach, Melanie, wie lieb von dir!« rief ich beglückt.
»Guck nur genau hin, wer da auf der Bank sitzt!« sagte sie.
Ich traute meinen Augen nicht, es waren Melanie und ich selbst, auf den ersten Blick zu erkennen! Eng aneinandergeschmiegt, wie wir zwei stets dort gesessen, in unsern einfachen Hauskleidern mit den Latzschürzchen, deutlich waren meine Zöpfe zu erkennen, die mir über die Schultern gefallen waren.
Welch schönes, liebes Andenken für mich! Aber wie hatte sich Melanie das schlau ausgedacht! Ganz heimlich hatte sie an dem Tage, wo unsere Bilder aufgenommen worden waren, ein Komplott mit dem Photographen geschmiedet, hatte mich an den Weiher gelockt, und im Augenblicke waren wir verewigt.
Ich wußte nicht, was ich sagen sollte, konnte nur wortlos alle küssen und ihnen die Hand reichen. –
Oben stand mein Koffer gepackt; nur noch eine Nacht sollte ich in dem lieben Hause verbringen. –
»Weißt du noch, Liesel, als du ankamst voller Scheu vor dem fremden Pensionate?« sagte Tante. Ich nickte.
»Ich gehe auch nicht gern fort!« versicherte eine nach der andern.
»Kinder, ihr müßt auch mein Haus stets als eure zweite Heimat betrachten!« meinte Tante. »Habt ihr einmal Sorge im Leben und ihr steht vielleicht allein da, so denkt nur an mich! Es soll keine vergeblich an meine Tür klopfen!«
»Sie sind engelsgut!« sagte ich, und Ludchen meinte: »Ich werde Tantchen dafür einen Kuß geben, d. h. ich küsse für euch alle!« –
Melanie half mir, alle die schönen Geschenke noch in meinem Koffer unterzubringen. Es war fast Mitternacht, von den andern hatte ich schon einmal stürmischen Abschied nehmen müssen, obwohl sie mich morgen alle zur Bahn begleiten wollten.
Ludchen hatte ich gebeten, Melanie immer recht aufzuheitern, wenn ich fort sei. –
Jetzt saßen wir beide auf meinem Koffer. Wir sprachen nichts, denn die tiefsten Gefühle haben keine Worte. Wir wußten, daß wir ›Schwestern‹, Freundinnen fürs Leben geworden waren, die nichts trennen konnte, die einander in Freud und Leid verstehen würden. Eine solche Freundin ist ein Schatz fürs Leben. Nichts Tröstlicheres, als ein Herz zu besitzen, das einem in Liebe und Treue ergeben ist. –
So golden brach der Herbstmorgen des ersten September herein; wie weh tut einem der Abschied, wenn man ein schönes Heim, in Sonnengold getaucht, verläßt! Es ist, als gehöre grauer Himmel dazu, um es einem leichter zu machen. Es war also nicht ›zum Abschiednehmen just das rechte Wetter‹, wie es im Trompeter von Säckingen heißt.
So ging es denn fort, ins Leben hinein; die traute Pensionszeit mit ihrem unbeschreiblichen Reize, der im Zusammenleben mit so vielen Altersgenossinnen liegt, lag nun hinter mir. Wieder versank mit ihr ein Stück wunderschöner Jugendzeit. –
»Du siehst, wie lieb wir dich alle haben!« sagte Tante, als ich, schon im Reisemantel, zum letztenmal in ihrem Zimmer war. Sie weinte. Da stürzten auch mir die lange zurückgehaltenen Tränen hervor. Ich vergaß alle Scheu vor meiner ›Vorsteherin‹, sie war mir ja eine mütterliche Freundin geworden, um deren Hals ich jetzt meine Arme schlang, an deren Schulter ich mein tränenüberströmtes Angesicht verbarg. Lange hielten wir uns umschlungen.
»Ich habe selten eines so liebgehabt, wie das blonde Thüringer Waldkind! Gott schütze dich, meine Liesel!«
Das war unser Abschied gewesen. –
Ich stand in der Coupétüre. Vor mir sah ich zum letztenmal all die lieben vertrauten Gesichter, Tante, Fräulein von Tolsky, die Unzertrennlichen, Arm in Arm, Ludchen mit feuchten Augen, Lotte und wie sie alle hießen. Von allen nahm ich Abschied. Das dritte Klingelzeichen! Ich umarmte Melanie. Dann stieg ich schnell ein, der Schaffner kam, die Fahrkarten fordernd, die Tür krachte zu, der Zug setzte sich in Bewegung. Ich bog mich so lange zum Fenster hinaus, als es nur ging. Jetzt sah ich nur noch in weiter Entfernung wehende Tücher, ein Trüppchen Menschen, dann war alles verschwunden. – Ich faltete die Hände, gedachte der Heimat und der lieben Stätte, die ich eben verlassen, der schweren Pflichten, die meiner harrten.
Unwillkürlich fiel mir Großmütterchen ein, ihre große Geduld, mit der sie alles ertragen, ihr freudiges Gottvertrauen, das sie nicht verlassen hatte. – Ich hatte Muße, über mich nachzudenken; der Zug fuhr durch weite, öde Felder, ich war allein im Abteil geblieben.
* * *
Ein wenig vor der Stadt, entfernt von ihrem Treiben, Staub, Wagenrasseln, liegt das neuerbaute Kinderkrankenhaus. Schon von außen sieht es sauber und freundlich aus. Gärten mit großen Rasenplätzen umgeben es, das Vorder- und Hauptgebäude enthält die Säle, Wohnungen der Ärzte, Operations- und Sprechzimmer.
Weiter hinten liegen noch zwei getrennte Gebäude, eines für die Scharlachkranken, das andere für die an Diphtheritis Leidenden. Ein niederes Gebäude birgt die hohe, helle Küche, die Wäscheräume und die Zimmer der Oberin. –
Fast ein Jahr war vergangen, seit ich die Pension verlassen hatte, wieder war es Sommer, ein durchsichtiger Himmel blaute herab.
Augenblicklich befanden sich über neunzig Kinder im Krankenhause, von den allerkleinsten an bis zu den größten. In den weiten, hohen, hellen Sälen lagen sie in ihren schneeweißen Bettchen oder saßen und spielten miteinander.
Ein kleinerer Saal enthielt die allerjüngsten Menschenkinder. Wie weiße Blüten lagen sie in ihren Bettchen, über jedem war eine Tafel angebracht mit dem Namen, Alter und Tage der Ankunft.
Hier in diesem weiten Gebäude war seit Monaten Müllerliesels Heimat! Ob ihr sie wiedererkennen würdet? Sie war nicht mehr das übermütige Pensionsfräulein in den modischen Kleidern mit den Hängezöpfen, – sie hatte innerlich und äußerlich eine Schule durchgemacht. ›Schwester Elisabeth‹ trug die ernste, schwarze Tracht der Schwestern vom roten Kreuz; die Zöpfe waren um den Kopf geschlungen, darüber lag die Haube, deren weiße Krausen die Stirn begrenzten. Das war Schwester Elisabeth äußerlich, – innerlich war ich um Jahre gereift, seit ich meinen Beruf angetreten, begeistert für denselben, das Herz voll warmen Gottvertrauens.
Nicht nur der Sinn für christliche Barmherzigkeit und Nächstenliebe wird ja bei den ›Schwestern‹ geweckt und gepflegt, vor allem auch legt man in die jugendlichen Herzen den Gottesglauben, der sie zu ihrem schweren Berufe stärkt und ohne den das Leben des heiligsten Haltes entbehrt.
Ich hatte fleißig gelernt im Mutterhause zu Halle; die Oberin war zufrieden, das sah ich an ihren schönen, gemütstiefen Augen. Der heilige Ernst, mit dem sie lehrte, ging auf die lernende junge Schar über.
Ich hatte Gelegenheit gehabt, meine jungen Augen in die Nachtseiten des Lebens blicken zu lassen. Krankheit, Tod, Verzweiflung, Kampf um Sein oder Nichtsein hatte ich kennen gelernt. Ich hatte junge, knospenhafte Menschenkinder sterben sehen, hatte die wahnsinnigen Schmerzen der Mütter beim Tode ihrer Lieblinge erblickt und bei alledem selbst gelitten. Ich hatte aber auch Tröstliches, Herrliches erlebt: welke Kindergesichtchen blühten auf, krüppelhafte Gliederchen wurden gelenkig, erblindete Augen lernten sehen, bleiche Wangen rundeten sich. Welche Freude für die Eltern, den Arzt, die Pflegerin! Welch schöner Lohn für die schlaflosen Nächte! – –
Es war am Spätnachmittage. Unsere Kleinen waren in ihren Bettchen auf die Veranda geschoben worden, um in der frischen Luft zu liegen. Da hatte sich auf manch weißes Gesichtchen ein zartes Rot gelegt.
Vor langen Wochen war Pfingsten gewesen. Die Stämmchen mit dem maigrünen Laube, welche fast an jeder Tür im Krankenhause standen, hatten sich dank der Pflege ausgezeichnet gehalten, erst jetzt fingen die Blätter an, welk zu werden.
»Schwester Elisabeth!« rief mich jemand. Ich wandte mich um; es war einer unserer Ärzte, Doktor Pohlmann. Er fand es für gut, die Kinder jetzt wieder in den Saal bringen zu lassen. Es geschah.
Ich stand am letzten der langen Reihe und hatte ein Wickelkindchen im Arme. Es war ein süßes kleines Geschöpf. Schwester Rosa bereitete eben das Milchfläschchen, und bis dieses fertig war, schrie die Kleine aus Leibeskräften. Ich wiegte sie hin und her, lachte sie an, schnell reichte mir Schwester Rosa die Flasche. Im Nu ein anderes Bild, die Kleine lacht, während die hellen Tränen noch an den Wimpern hängen. Doktor Pohlmann beugt sich lächelnd über die Kleine in meinem Arme und streichelt ihr Gesichtchen. Er ist um einen halben Kopf größer als ich, sein Organ ist weich und tief. Die Kinder alle hängen mit Vergötterung an ihm, obgleich sie auch die beiden anderen Ärzte lieben. Aber wenn Doktor Pohlmann einen der Säle betritt, tönt es ihm aus allen jugendlichen Kehlen ›Guten Tag!‹ entgegen. Dann geht er von Bett zu Bett, hat für jedes der Kinder ein scherzendes Wort.
»Wer bist du?« fragt er, einen Blondkopf zupfend.
»Meiner Mama ihr Goldsohn!« ist die Antwort.
Da liegt ein Junge, der beide Beine gebrochen hat, sie sind auf Bretter gebunden.
»Noch ein paar Tage, Max, und du stehst auf!« Der Junge strahlt und erträgt gern die Schmerzen. Er darf ja bald aufstehen, hat der liebe Herr Doktor gesagt! –
»Lenchen, wie geht's dir?« fragt er weiter, »tut's weh im Halse?«
Sie nickt schüchtern, die arme Kleine. Ihr Hälschen ist fest umwickelt. Ein feuchter Schimmer, der rührende Ausdruck still ertragener Schmerzen, liegt in den blauen Augen. – Der Doktor streichelt die Kleine und legt ihr ein Spielzeug auf das Bettchen. –
Die nächsten zwei spielen ›Doktors‹, sie lachen vergnügt auf. Wie reizend klingt ein solches Kinderlachen in einem Krankensaale!
Und jetzt steht Pohlmann am Bette seines Lieblings. Es ist ein zartes kleines Mädchen, eine nahe Verwandte von ihm, Waise. Das Kind ist sehr krank.
»Lottchen, mein Liebling, wie geht es?« Er beugt sich über das Bettchen, in dem ein Wesen, das einem Engel gleicht, liegt, still, blaß, duldend. –
Als Doktor Pohlmann mich zum erstenmal durch die Säle führte, blieb er am längsten bei Lottchens Bett stehen.
»Sie ist mein Sorgenkind, die kleine Lotte, das einzige Wesen auf der Welt, das mir verwandt ist. Und so schwer krank!«
So hatte er mir leise gesagt.
Ich mochte ihn wohl fragend angeblickt haben: was fehlt dem süßen Ding, da man äußerlich nichts sieht?
»Sie hat ein schlimmes Knie,« sagte er; »vielleicht muß das eine Beinchen amputiert werden!«
Die Kleine hatte gelächelt bei seinen Worten, sie wußte ja nicht, daß das fremde Wort für sie hieß: mit deinen fünf Lenzen sollst du ein Krüppel auf Lebenszeit werden! Es war ein erschütterndes Bild für mich. Und des Arztes Stimme hatte gezittert vor Schmerz, er selbst vielleicht sollte dem einzigen Wesen, das ihm nahestand, weh tun. – Schon damals war eine warme Sympathie für den menschenfreundlichen, guten Menschen in mir aufgestiegen. Wir verstanden uns in unserer beiderseitigen Liebe zum Berufe. – Lottchen ward auch gar bald mein Liebling. Wie wohl tat es mir, als ich sah, daß auch das süße blonde Kind mich liebte! Wie herzig war es, als sie zum erstenmal zaghaft die Ärmchen um mich schlang und sagte: »Schwester Elisabeth, ich habe dich so lieb!«
Und wie leuchteten Pohlmanns Augen, als er häufig dazu kam, wenn ich an Lottchens Bett saß und mit ihr spielte oder ihr das goldige weiche Haar kämmte. Manchmal erzählte ich auch den Kindern Märchen, solche, die mein seliges Großmütterchen mir erzählt hatte. Dann war es so still im Saale, wo ›Schwester Elisabeth‹ leise erzählte, wie vor langen Jahren auf der lieben, alten Mühle am Werraflusse. All das Vergangene fiel mir dann ein, ich sah Großmütterchen, meine Brüder, sah Anneliese, – und mitten im Erzählen stockte ich, denn die aufsteigenden Tränen ließen mich nicht weiter sprechen. Zuerst schwiegen die Kinder auch, dann hob sich da und dort ein erstauntes Gesichtchen aus dem Bette, bis endlich Lottchens silbernes Stimmchen sagte:
»Weiter! Schwester Elisabeth, bitte, bitte!« –
Oft ist Rudolf Pohlmann Zeuge meiner Erzählstunden gewesen, ohne daß ich davon eine Ahnung hatte. »Ich horchte gewiß am andächtigsten auf die so lieb erzählende Stimme der Schwester Elisabeth,« gestand er mir später.
Hier also war mein Wirkungskreis. Mit vier Schwestern und einigen anderen Pflegerinnen teilte ich mich in die Pflichten.
Wir wohnten in einem gemeinsamen, großen Zimmer, die neuen Schwestern waren die Sanftmut und Güte selbst. Eintracht und Friede herrschten; wir nahmen die Mahlzeiten gemeinsam, wir wechselten in den Nachtwachen. Unser Interesse gehörte unsern Kindern.
Die Oberin war eine ältere adelige Dame, sie hatte ihre eigenen Zimmer, die sehr reich mit selbstgezogenen Pflanzen ausgestattet waren.
Manchmal, ehe ich meine Nachtwache antrat, rief Schwester Sophie, so hieß die Oberin, mich in ihr Zimmer. Dann saßen wir gemütlich auf dem Sofa, und ich plauderte von der Heimat, von dem Pensionsjahre.
Dann, um zehn Uhr, wenn die anderen zur Ruhe gingen, trank ich noch Kaffee, den mir eine der Schwestern vorsorglich hingestellt hatte, und ging in den Krankensaal, der mir zugewiesen war. – – –
Es war eine ganz neue Welt, in welche ich da eingetreten war. Wie einsam und doch schauerlich poesievoll waren diese stillen Nächte der Wache an den Bettchen! Die Lampe verbreitete einen matten Schein. Ruhig, blaß lagen die Kinder da, manche ließen die Schmerzen nicht schlafen, unheimlich kam hie und da ein leises Stöhnen von einem Bettchen her. Gab es schwerkranke Kinder, so kam der betreffende Arzt noch einigemal während der Nacht.
Wie langsam verstrichen die Stunden! Ich hörte jeden Glockenschlag. Mitternacht! Ich trat dann gewöhnlich an ein Fenster; aus dem Dunkel ragten die Gebäude der schlafenden Stadt hervor. Vom Himmel herab flimmerten die ewigen Sterne, nach und nach dröhnten von den zahlreichen Kirchen die langsam verhallenden zwölf Glockentöne. Dann graute allmählich der Morgen. Wie wenige kennen den Reiz, die hehre Majestät einer Nacht! Alles Kleinliche scheint verschwunden, alles Hasten und Treiben ruht, der einsam wachende Mensch fühlt sich Gott näher.
Ein leiser, dämmernder Schein im Osten verkündet die heraufsteigende Sonne. Wie wundervoll ist es, zu sehen, wie sie nach und nach mit ihren Strahlen die schwarzen Häusermassen vergoldet! – Bald regt sich am Morgen hie und da einer der kleinen Schläfer.
»Schwester Elisabeth!« ruft ein Stimmchen. Im Nu beuge ich mich über das Bettchen und suche die Wünsche des kleinen Kranken ihm aus den Augen zu lesen.
Dann gibt's am Morgen ein allgemeines Erwachen, ein Köpfchen nach dem anderen hebt sich aus den weißen Kissen. Diejenige aber, welche die Nachtwache hatte, darf sich nun ein paar Stunden der wohlverdienten Ruhe gönnen.
Wir Schwestern haben unser Heim so freundlich wie möglich ausgestattet, jede pflegt eine Anzahl Blumen, jede hat über ihrer Kommode die Bilder der fernen Lieben. Über dem Sofa hängt ein großes Bild, der gekreuzigte Heiland. Wie so manches Mal habe ich allein, die Hände gefaltet, in Gedanken verloren vor diesem Bilde gestanden, Mut schöpfend, wenn ich glaubte, der Kummer werde mich erdrücken. »Hat Er so viel getragen,« dachte ich dann, »unschuldig, ohne zu murren, so darf ich armseliges, schuldbeladenes Menschenkind erst recht mich nicht gegen eine höhere Macht auflehnen, sondern ich muß mich beugen und still ertragen. – Und wahrlich, nicht immer waren es sonnenhelle Tage, die ich erlebte. Es gab schwere Stunden im Berufe, aber schwerer noch war mir das Herz, erhielt ich Nachricht aus der Heimat. Immer trauriger wurde es dort, Vater wurde krank und bedurfte der aufopferndsten Pflege. Wie sehnte ich mich heim! Mein Platz wäre an seinem Krankenbette gewesen, mich aber fesselte hier die selbsterwählte Pflicht.
Und dann wurde mir das Schwere nicht erspart: Vater war gezwungen, die Mühle eingehen zu lassen. Mehr als ein Jahrhundert war das Mühlenrad gegangen, jetzt stand es still! Als ich diese Nachricht empfangen hatte, war ich in Tränen ausgebrochen. Es war mir, als habe ich mein Vaterhaus verloren. Lange konnte ich mich nicht beruhigen, konnte es nicht fassen, das Traurige. –
Für Vater fand sich eine Agentur, er reiste; Mütterchen wußte ich nun oft allein. Da konnte ich die Sehnsucht nicht mehr bemeistern, ich bat um einen Urlaub, der mir für den Monat August auch gewährt wurde.
Die Freude der Eltern, als ich schrieb: »Ich komme!« war groß, waren doch fast zwei Jahre vergangen, seit ich sie nicht gesehen hatte. Ich hatte freiwillig den Flug ins Leben, in die Fremde gewagt. Mit Stolz konnte ich mir sagen: »Du hast's erreicht, stehst auf eigenen Füßen!«
Ich wußte nicht, wer sich mehr auf ein Wiedersehen freute, die Eltern oder ich. Fast ein Jahr war es her, seit ich die Pension verlassen hatte. Alle gaben sie mir häufig Nachricht, die lieben Schwestern aus der unvergeßlichen, sorgenlosen Pensionszeit. Meine Herzensfreundin war längst wieder bei ihrem Vater in Köln, mit ihr natürlich verband mich ein eifriger Briefwechsel. Sie hatte schon in kleinen Konzerten gewirkt, sehr günstige Kritiken erhalten und schien einem aufsteigenden Sterne zu gleichen. –
Mein Klavierspiel war verstummt, es wußte niemand im Krankenhause, daß ich spielte. Erst später bin ich zu dieser herrlichen Kunst wieder zurückgekehrt und ihr treu geblieben. –
Gabriele war bereits Frau Leutnant von Mark. –
Johanna war längst von ihrer Pariser Reise zurück, aber Elsbeth studierte dort eifrig. Gretchen besuchte ein Seminar, und Suse bildete sich zur Kindergärtnerin aus. Lotte und Ludchen hatten ein halbes Jahr nach mir die Pension verlassen, zu eigenem und Tantes Kummer, welche das liebe Pärchen sehr vermißte. Elisabeth und Karla waren noch die einzigen von unserem damaligen Kreise. Sie erzählten immer viel von all den Neuen. –
Die Kinder in meinem Saale durften es nicht erfahren, daß ich sie auf vier Wochen verließ. Es tat mir ordentlich weh, als ich am Abende vor meiner Abreise zum letztenmal mit ihnen betete. Es war rührend; all die jungen Gesichtchen blickten mich an, die schmalen Hände falteten sich, und alle flüsterten sie, oft Worte vergessend, das kurze Gebet.
Ich setzte mich dann noch ein Weilchen zu Lottchen.
»Schwester Elisabeth, was ist denn ein Sensenmann?« fragte sie mich zu meinem Schrecken mit einemmal. Wie sonderbar klang die Frage von dem kleinen, blassen Munde des kranken Kindes!
»Muß man dem Sensenmanne folgen?« fragte Lottchen weiter, ehe ich geantwortet hatte. Doktor Pohlmann kam hinzu und blickte mich erschreckt an.
»Weißt du, Lottchen, dem Sensenmanne muß man folgen, wenn er einen ruft, gerade so wie man der Mutter folgen muß oder der Schwester!« sagte ich.
»Aber wer ist denn der Sensenmann?«
»Es ist der Tod!« sagte der Arzt; er glaubte, die Kleine verstände ihn gar nicht.
Plötzlich, nach kurzem Sinnen, zog sie mit beiden Ärmchen meinen Kopf zu sich herunter und flüsterte, doch so, daß auch der Doktor es hören konnte: »Aber wenn dich der Sensenmann ruft, so tust du, als hörst du es nicht, nicht wahr, Schwester Elisabeth?«
Ich küßte das süße Geschöpf und nickte ihm zu, dann trat ich ans Fenster, um meine Tränen zu trocknen. –
* * *
Ich fuhr der Heimat zu! Wieviel lag zwischen dem trüben Oktobertage, als ich sie verließ, und heute! –
Unterwegs erregte meine Tracht Aufsehen, und doch fühlte ich mit Stolz, daß man voll Ehrerbietung für die Trägerin dieser Schwesterntracht war. Es war, als ziehe ein jeder den Hut vor dem roten Kreuze, das in mein Kleid gestickt war. Stand ich vor einem vollen Coupé, so rückte man still zusammen und machte mir Platz. Mit einer Art heiliger Scheu musterte man die ›Schwester‹, umschwebt es eine solche doch wie ein Helligenschein des Samaritertums. –
Ich hatte den Eltern Tag und Stunde meiner Ankunft nicht gemeldet, ich wollte sie überraschen. –
Mit welchem Herzklopfen sah ich jetzt, es war am Abend, mein Heimatstädtchen auftauchen, noch von einem Scheine der untergehenden Sonne bestrahlt! Da lagen sie, dunkel, blau, die Berge, nach denen ich mich so manches Mal gesehnt. Ich hörte wieder den Dialekt meiner Heimat. Der Zug hielt, ich war am Ziele.
Ich ließ mein Gepäck hier, um später jemand von der Mühle aus zu schicken. Dann trat ich allein den wohlbekannten Weg in die Stadt an. Mein Herz war zum Springen voll von Freude und – Weh.
Als seien die zwei Jahre spurlos an der kleinen Stadt vorübergegangen, so unverändert ist sie. Rechts und links freilich ein paar neue Häuser, aber dort auf dem Marktplatze plätschert noch der alte Röhrenbrunnen seine Melodie. Frauen und Mädchen, die Butten Wassergefäße. auf den Rücken, stehen plaudernd davor, während der helle Wasserstrahl die Gefäße füllt. Kinder biegen sich über den Brunnenrand, ihre nackten Füßchen stehen auf den bemoosten Steinen. Als sei ich eine Erscheinung aus einer anderen Welt, so staunen sie mich alle an. Ich möchte ihnen zunicken: Kennt ihr die Müllerliesel nicht mehr?
Das Pflaster ist noch genau so holprig wie damals. Ein hochbeladener Heuwagen, mit zwei Ochsen bespannt, kommt mir die schmale Gasse herauf entgegen. Unwillkürlich schmiege ich mich an eines der alten Häuser, den Wagen vorbeizulassen. Das herabhängende Heu streift mich. Wie süß ist der Duft dieses Heues!
Jetzt fühle ich einen Stich im Herzen; dort liegt Annelieses Vaterhaus! Da oben ist ihr Fenster, zu welchem sie mir den letzten Abschiedsgruß herauswinkte. Ich kann's nicht glauben, daß sie schon zu den Toten zählt; hier erst recht nicht, wo mich alles an sie erinnert. Mit gesenktem Kopfe gehe ich vorüber, das Haus ist mir ja fast fremd geworden, seit man das junge Menschenkind über die Schwelle zur ewigen Ruhe getragen hat.
Am Laden des alten Schusters komme ich auch vorüber. Da sitzt er richtig, das Haar noch mehr ergraut, und hämmert noch genau so im Takte, als habe er gar keine Pause gemacht. Als ich vorübergehe, fällt ein Schatten auf seine Arbeit. Er blickt über die großen, horngefaßten Brillengläser hinweg herauf zu mir. Er kennt mich nicht; erst als ich ihm freundlich zunicke und seinen Namen nenne, blitzt es wie eine Erinnerung in den alten Augen auf, und er nickt und winkt.
Nun ging es an den letzten Häusern vorbei, doch erst sah ich noch die Schule und das Bäckerhaus, in dem der kleine dicke Ernst und seine Bundesgenossen einst einen Quarkkuchen zertraten. Im Schulhause standen die Fenster weit offen. Ich blieb ergriffen einen Augenblick stehen. Da waren noch dieselben weißgetünchten Wände, die Schulbänke mit den Tintenfässern, deren eines die kleine Anneliese einmal umgeworfen hatte. Dort das Katheder, vor dem ich als kleiner Sündenbock gar manchmal zitternd gestanden hatte! Daneben die schwarze Wandtafel, auf welcher von Kindeshand stand: 1x7=7, 2x7=14 usw. Und neben der Tafel hing die Landkarte von Palästina.
Ich ging weiter, jetzt aber im Sturmschritte. Hinter mir lag das Städtchen, vor mir in der Ferne die Mühle. Rechts weite Wiesengründe, von bewaldeten Bergen begrenzt, und links begleitete mich die Werra mit ihrem Plätschern. Das war noch derselbe Wiesenweg, den wir Müllerskinder gegangen. Da standen noch dieselben alten Weiden, von denen die Brüder unzählige Ruten geschnitten hatten; hier war der weit ins Wasser hineingewachsene Ast, auf dem wir uns oft geschaukelt hatten. Aber kein Rauschen kündete das Dasein der Mühle! Still war's, feierlich still, weit und breit. Abendsonnenschein lag über allem, und nun hallte feierlich ein Glockenton über das friedliche Bild meiner über alles geliebten Heimat. Sie läuteten den Sonntag ein.
Zur selben Stunde saß mein Mütterchen im Wohnzimmer, ein wenig traurig, weil sie umsonst auf mich gewartet hatte. Sie hatte das Fenster geöffnet, wie sie mir später erzählte, und ganz andächtig in die Landschaft, die so friedlich dalag, geblickt. Da sei plötzlich hinter den Stachelbeerhecken eine große Mädchengestalt aufgetaucht und sei auf die Brücke getreten. Mutter hatte ihre Liesel in der Tracht der Schwestern nicht gleich erkannt. Erst als sie gesehen hatte, wie ich beim Anblicke des bemoosten, stillen Rades ein wenig zusammenzuckte, da hatte sie gewußt, wer da über die Brücke kam.
Im nächsten Augenblicke stürzte ich in die Arme meiner Mutter. Wir konnten lange nicht sprechen. Endlich sagte sie: »Mein armes Kind!« Ich schlang die Arme um die kleine Gestalt meines Mütterchens.
»Vater kommt erst morgen, Liesel!« sagte sie, als wir ins Wohnzimmer getreten waren.
Ich war daheim, in meiner Mühle! Ach, tief sog ich den unaussprechlichen Duft ein, der in der Luft lag. Ich hätte weinen und lachen mögen in einem Atem. Alles noch wie damals, das Sofa, der Tisch, der Kachelofen mit der Ofenbank, auf der eine Katze schlief, der Fenstertritt mit Mamas Nähtisch, daneben ein Blumentisch, das alte Klavier, draußen der Hof. – Nur still war's, so traurig still! Kein Leben mehr, kein lustiges Kindergeschrei, kein Stampfen in der Mühlstube, kein Rauschen des Rades.
Aber eines war mir geblieben, das Kostbarste: Vater und Mutter!
Ich lief auf und ab und blieb manchmal stehen, die Hände gefaltet und wie im Traume vor mich hinlächelnd. Mutter ließ mich still gewähren. Dann aber saßen wir Arm in Arm, Wange an Wange auf dem alten Sofa.
»Bist du auch glücklich, mein armes Kind?« fragte Mama.
»Sehr, sehr glücklich, Mutter, darum nenne mich nicht arm,« sagte ich. Ja, ich war es auch; mit warmem Herzen dachte ich an unser Krankenhaus, an alle, ich wußte, ich würde mich sogar eines Tages wieder dorthin sehnen. –
Ich erzählte nun Mama von allem, doch erst ging ich in die Küche, wo die alte Elise mich ansah, als sei ich ein Geist.
»Elise!« rief ich und streckte ihr beide Hände hin. Da flogen Lappen und Schürze in eine Ecke, und die gute Alte schüttelte mit ihren hartgearbeiteten Händen die meinen. Mutter stand in der offenen Tür, die in die Küche führte.
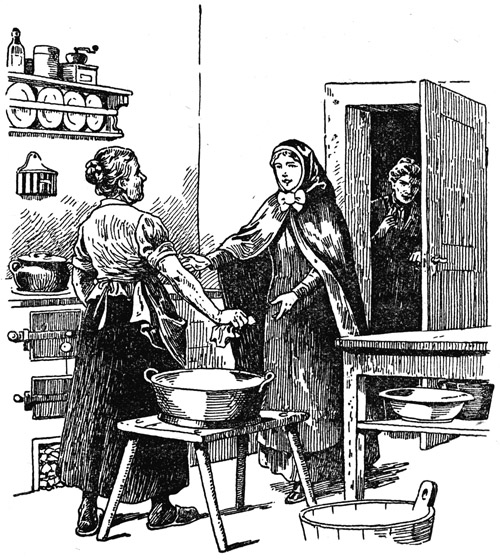
»Wie verändert das gnädige Fräulein aussieht!« sagte Elise. Ich traute meinen Ohren nicht. Die alte Magd wußte etwas von unserem abgelegten Adel und glaubte, mich nun als fertiges Freifräulein behandeln zu müssen. Ich umfaßte sie und lachte sie tüchtig aus. »Wenn du mich nicht Liesel nennst, wie in den Tagen, wo du mich noch auf den Armen herumgetragen hast, so reise ich gleich wieder ab!« sagte ich. Damit war sie zufrieden.
Wir traten ins trauliche Wohnzimmer zurück, während Elise einen Burschen, der noch auf der Mühle geblieben war, nach dem Bahnhofe schickte und für mich schnell etwas zu essen richtete.
Im Zimmer war's dämmerig, die alte Wanduhr tickte, dabei fiel mir ein, wie Fritz sie damals zu Weihnachten eine halbe Stunde vorgestellt hatte. Ich trat an ein Fenster. Dort rauschte die Werra, auf dem Hofe standen einige große Wasserbecken, in denen sich der Himmel spiegelte, drüben die Ställe waren geschlossen, die Stallfensterchen noch mehr erblindet. Plötzlich überkam mich ein so herzzerreißender Schmerz beim Anblick all dieses zurückgegangenen Wohlstandes, daß ich weinend mein Gesicht an Mutters Schulter lehnte und schluchzte: »Mama, wir sind ja so arm geworden!«
Mutter sprach nicht; da fühlte ich ein paar heiße Tropfen auf mein Gesicht fallen, sie weinte! –
Nein, weinen sollte sie nicht, wie konnte ich ihr nur das Herz noch schwerer machen! War's nicht Zeit genug, mich auszuweinen, wenn ich droben in meinem Stübchen war? – Schnell trocknete ich die Tränen, fuhr scherzend mit meinem Taschentuche über Mamas Augen und setzte mich an das Klavier, während Elise mein Essen hinstellte.
»Wellenrauschen!« bat Mama, die hinter mir saß und mir leise die Haube abnahm. Ich spielte, lange hatte ich keine Tasten mehr berührt. – Als ich geendet, faßte Mama meinen Kopf in ihre Hände und sagte: »Jetzt sehe ich doch deine blonden Haare wieder, Liesel; komm, mach die Zöpfe auf und zieh das gute Kleid aus. Droben hängen noch alte genug von dir!«
Ich fühlte, es tat ihr weh, mich in dieser ernsten Tracht zu sehen, die ihr jede Minute zeigte, daß ihr Kind nicht mehr ihr gehörte. Ich bat sie, inzwischen zu spielen. Dann stieg ich allein die knarrende Treppe hinauf.
»Liesel, dein Koffer ist oben!« rief mir Elise nach.
Mit einer heiligen Scheu trat ich in Großmutters Zimmer. Es war so unverändert, als habe die Besitzerin diesen Raum nie verlassen. Kein Staub auf den Möbeln, die Blumen in voller Blüte. Ich schloß die Tür hinter mir und faltete unwillkürlich betend die Hände. Da war's, als ob der Geist der Seligen über mich käme; ich war noch eben trostlos über unsere Armut gewesen, hier oben fielen mir Großmutters Worte ein: Blick unter dich und sei zufrieden! – –
Es hatte ja mein Stübchen sein sollen, wenn ich aus der Pension zurückkäme; wieviel Pläne macht der Mensch, und wie oft werden sie durchkreuzt! –
Nun ging ich weiter: das gute Zimmer war noch ebenso geschlossen und dumpf, wie zu unseren Kinderzeiten, wo sich diese Türen nur einmal im Jahre geöffnet hatten, um das Christkindchen hereinzulassen! Ich ging und öffnete ein Fenster, die erfrischende, kräftige Thüringer Luft drang herein und mit ihr einzelne Töne von Mutters Klavierspiel. Ich lehnte eine Weile im Fenster und ließ den Blick über die liebliche Gegend schweifen. Meine Gedanken flogen auch an die Stätte, wohin mich mein Beruf geführt hatte. Ich gedachte all der kleinen Pfleglinge. »Heute gibt ihnen die Schwester Elisabeth keinen Gutenachtkuß. Wie mag es dem blonden Engelsköpfchen ergehen, meinem armen Lieblinge? Gott schütze sie alle, die ich liebe,« dachte ich.
Nun kam ich in mein Mädchenstübchen. Wie heimelte es mich an! Mutter hatte mir Blumen auf den Tisch gestellt. Und dort an der Wand hingen Kleider, die ich als Backfisch getragen hatte! Eines war mir noch besonders in der Erinnerung, ein feuerrotes; Anneliese hatte ein ebensolches gehabt.
Ich trat hin und drückte das Gesicht in die Falten des feuerroten Kleidchens. Meine arme Anneliese! Wie würdest du deine Freundin begrüßt haben!
Ich wußte, daß man von meinem Fensterchen aus ein Stück vom Friedhofe sehen konnte, und öffnete die Riegel. Wie altmodisch sie waren! Wie lange hatte ich sie nicht geöffnet! Ja, dort drüben blitzten weiße Kreuze auf, sah ich Zypressen, den Schmuck der Gräber. Dort also ruht meine Anneliese! Ich blickte so lange hinüber, bis mir die Augen übergingen.
Dann befolgte ich Mutters Wunsch, legte mein Schwesternkleid ab, löste die Flechten, die um den Kopf geschlungen waren, und zog eines der alten Kleider an. Die gute Mama, sie hatte sie wahrhaftig nach Gutdünken vergrößert, damit ich sie passend finden sollte!
Nun noch einmal das Gesicht in das kühle, weiche Wasser getaucht, dann hüpfte die Müllerliesel die Treppe hinunter, jetzt nicht mehr die ernste ›Schwester Elisabeth‹, sondern das fröhliche, siebzehnjährige Kind der Mühle.
Mama war erfreut: »Gott sei Dank! So bist du doch die Liesel, wie ich sie zuletzt gesehen habe! So, und nun iß, was die alte Elise dir vorgesetzt hat! Guten Appetit!«
Sie streichelte mir Haar und Gesicht. – Wie köstlich mundete nach so langer Zeit die einfache Kost im Elternhause! Mama lachte über den Heißhunger, mit dem ich zulangte. Es war, als ob ich mit dem schwarzen Anzuge auch eine gewisse ernste Würde abgestreift hätte. Ich war so lustig und glücklich mit einemmal in meinem verwaschenen Kattunkleidchen, als sollte ich nie wieder in meinen Beruf, der mich mitten in das Elend des Lebens führte, zurückkehren. Und doch liebte ich ihn, war mit Leib und Seele Krankenpflegerin. Aber hier auf meiner alten, geliebten Mühle wollte ich einmal alles abstreifen, was mich daran erinnerte, daß es noch eine Welt da draußen gäbe. Nur an Doktor Pohlmann dachte ich oft, doch noch mit jener leisen, unverstandenen Sehnsucht, mit welcher ein junges Herz unbewußt liebt. –
»Mama, ich kann nicht mehr!« sagte ich endlich hoch aufatmend. Elise räumte ab und ließ nur den Steinkrug mit dem schäumenden Biere stehen.
Nun saßen wir, da Elise keine Lampe bringen durfte, in der tiefen Dämmerung allein. Ich ließ mir von allem erzählen, auch Annelieses gedachten wir. Vom Papa ließ ich mir berichten. Wie freute ich mich, den lieben, armen Vater, der inzwischen so viel Sorgen erlebt hatte, wiederzusehen!
Auch von Hans sprachen wir. Gott sei Dank, der gute Kern in ihm war nicht verloren gegangen. Er war endlich vernünftig geworden. Amerika, das schon so manchen den Weg der Arbeit finden ließ, führte auch ihn diese für ihn so harte Straße. Hans, der so wenig gearbeitet hatte in der letzten Zeit, war jetzt in fester Stellung, die ihn vom Morgen bis zum Abende fesselte. Wie gut das war! So lernte er in der Neuen Welt, was er in der Alten nicht begreifen wollte, daß ein Segen in der Arbeit liegt. Nur der schläft am Abend ruhig ein, der sich sagen kann: heute hast du deine Pflicht nach Kräften erfüllt.
Von Fritz, der in der Lehre war, kamen gute Nachrichten. Sein sehnlicher Wunsch war, die Mühle später zu übernehmen. Ernst war wieder im Elternhause und seinem Vater eine Stütze. – –
Nun mußte ich erzählen. Wieviel Stoff gab es da! Zuerst die sorglose, glückliche Pensionszeit! Meine Melanie, Tante, all die Schwestern führte ich Mama vor, sie kannte ja alle schon aus meinen Briefen. Dann kam die Lehrzeit im Mutterhause zu Halle, wo ich ganz der Pflicht gelebt hatte. Und dann erzählte ich breit und behaglich von unserem Krankenhause, von den Ärzten, den Schwestern, den Kindern, besonders dem Lottchen. Mama konnte nicht genug hören, und rührend war es, wie die liebe Mutter keinen Blick von mir verwandte.
Wie lange wir geplaudert, glaubten wir selbst kaum, aber wir zählten beide, als die alte Wanduhr zu schlagen begann, zwölf!
»Nun heißt's aber, zu Bett!« sagte Mama und zündete Licht an, nicht erst die Lampe, sondern ein paar Wachslichte. Das duftete so heimlich, das Licht flackerte über die alte, traute Stube.
Elise hatte längst die Haustür geschlossen und war zur Ruhe gegangen. Mama und ich sagten uns mit vielen Küssen ›Gute Nacht‹.
»Möglich, daß du Vater morgen früh schon findest, Liesel, er kommt manchmal mit einem der ersten Züge am Morgen.«
Ich war wieder allein in meinem Stübchen. So still war's, die Mühle ging ja nicht mehr klipp! klapp! – Durch das offene Fenster wehte der kühle Nachtwind herein, ein Rauschen war draußen; ich konnte nicht schlafen, ich glaube, ich habe noch stundenlang dort gelehnt und in die stille, feierliche Nacht hinausgelauscht. Es war nicht dunkel, denn der Mond stand im Viertel am Himmel, und einzelne Sterne blitzten auf. Stille, wundervolle Majestät der Nacht! Es ist, als ob Gott, da seine Menschenkinder schlafen, selbst die Erde berührte und sich im geheimnisvollen Rauschen der Wipfel ankündete. –
Mir war, als fände ich mich in der alten, trauten Heimat wieder. Da draußen in der ›Welt‹ hatte ich gar manchmal Gott vergessen gehabt, hier lehrte die einfache und doch so göttlich schöne Natur mich beten und voll innerer Andacht die Hände falten. –
Wie köstlich schlief ich, bis tief in den Tag hinein! Die Sonne brach golden herein in mein Stübchen und weckte die Langschläferin. Es war Sonntag, die Glocken läuteten. Wie weit und mahnend klangen sie über das breite Tal hin. Hier brachen sie ihren Schall nicht an einem grauen Häusermeere wie in der Stadt; sie durften ihre Tonwellen hinrollen und fluten lassen über Wiese, Wald und Fluß, über die Ansiedelungen der Menschen.
Als ich, frisch und gesund an Leib und Seele, angetan mit einem weißen Kleide, das die gute Mutter ebenfalls vergrößert hatte, die Zöpfe um den Kopf geschlungen, die Treppe hinuntersprang, fing mich Papa mit einem Jubelrufe unten auf. Er war tief bewegt, das fühlte ich an der zitternden Hand, aber auch ich war es, denn ich fand ihn grau geworden, tiefe Sorgenfurchen auf Stirn und Wangen.
Ich zog ihn an die offene Haustür. »Papa, du mußt dich nicht krank machen,« rief ich, »hier, die bösen Falten müssen fort!«
Er lächelte wehmütig; wie schnitt mir das ins Herz! »Siehst du, Liesel,« sagte er und führte mich an die Brücke, auf das trockene Rad deutend, »seit ich das da habe abstellen müssen, bin ich krank!«
»Papa, lieber Papa!« sagte ich, seine Hände streichelnd. »Paß nur auf, es wird wieder alles gut! Verzage nur nicht!«
»Wie mein Töchterchen gut trösten kann!«
»Denke doch, wenn Fritz erst zurückkommt, welche Aussicht! Der gute Junge wird's schon möglich machen, daß die Mühle wieder tüchtig zu tun bekommt! Und dann bist du der Oberbefehlshaber, Papa. – Komm, laß uns Mutter suchen, ich glaube, sie ist im Obstgarten!«
Arm in Arm – ich reichte mit meinem Scheitel gerade bis zu den Schultern meines großen Papas – wanderten wir in den Garten. Ich hatte ihn noch nicht wiedergesehen. Wie groß waren die Bäume geworden, wie dicht die Hecken! Ich ließ Papas Arm los und schlüpfte zwischen den Beeten hin. Dort sah ich endlich Mutter, sie half Elise beim Beerenpflücken.
Flugs war ich bei ihr, nahm ihr die Schüssel ab und pflückte nun selbst.
»Die guten ins Töpfchen,
Die schlechten ins Kröpfchen!«
sagte Papa, der, die Hände auf dem Rücken verschränkt, herangekommen war. Wir lachten und ließen es uns schmecken.
Ich fühlte, wie glücklich die Eltern waren, endlich wieder eines ihrer Kinder da zu haben; wie wohl tut dem Alter die Gegenwart eines jungen, frischen Blutes! Sie leben mit ihm wieder auf.
Am Nachmittage ging ich mit Mutter zur Kirche, denn die Glocken klangen so mahnend bis zu unserer stillen Mühle.
Da sah ich die Kirche wieder, den Altar, an dem ich mit Anneliese damals eingesegnet wurde. – Die Menschen kannten mich leicht wieder, oder sie dachten es, daß das hochaufgeschossene Mädchen neben der kleinen Mutter wohl die Müllerliesel sei.
Ich war tief bewegt, als die kleine Kirche – im Vergleiche zu den großen Kirchen in Leipzig war sie klein – voll von Andächtigen war und die Orgel zu spielen begann. Dann erschien die ehrwürdige Greisengestalt unseres Geistlichen auf der Kanzel. Alles, was er sprach, war so wahr! Und was mich so anheimelte, war, daß man nicht unter Menschen saß, deren Wohl und Wehe einem fremd und gleichgültig ist, sondern daß eines das andere kannte. So war es in der Tat wie eine große Familie, welche den Worten ihres Geistlichen lauschte.
Als wir unter den Klängen der Orgel die Kirche verließen, bat ich Mama, mich auf den Kirchhof gehen zu lassen. Sie verstand mich wohl in meinem Empfinden, wie sehr es mich an das Grab der Freundin zog und daß man den Gang an eine solche Stätte des Schmerzes am liebsten allein macht.
Ich kaufte einen Rosenstrauß und ging die Bergstraße hinauf. Die Sonne brannte herab, kein Blatt regte sich. Das holprige Pflaster war staubig und trocken. Aber dort winkte es grün: es war der Friedhof. Er glich nicht einem weiten Totenfelde, sondern eher einem Parke, denn die schönsten Pappeln, Eichen und Linden standen dort. Ihre Zweige beschatteten weithin die Gräber der in ihrem Bereiche Ruhenden.
Ich öffnete das hohe Tor und ging zuerst dem Häuschen zu, das mitten unter den Gräbern stand und aus dem heiteres Kindergeplauder erscholl. Die Kleinen des Totengräbers wuchsen hier im Reiche des Todes auf, und doch konnte man nicht leicht ein paar frischere Geschöpfchen sehen, als die Zwillingsgeschwister Hans und Gretel. Sie saßen auf einem Schubkarren und spielten mit einigen Blumen. Der Vater war beschäftigt, ein neues Grab zu machen, er schaufelte Erde heraus, die Mutter putzte Salat. – Der Totengräber kannte mich, ich fragte nach Annelieses Grab.
»Das Fräulein Schilling! Sie liegt dort an der Mauer, Sie können's leicht finden, das mittelste ist's!«
»Ich danke Ihnen!«
Da stand ich nun, bleich und erschüttert, meine Rosen in der Hand, an dem Hügel, an den ich mich oft im Geiste versetzt, an meiner lieben Freundin Grabe. Zu Häupten desselben befand sich ein dunkler Marmorobelisk, auf dem in goldenen Lettern der Name der Verstorbenen stand, darunter die Geburts- und Sterbedaten. Das Grab war mit Blumen überschüttet; man sah, die Liebe pflegte es, und Anneliese war unvergessen. Ich weinte in meine Rosen hinein. Da drunten in deinem engen Schreine liegst du, geliebte, herzensreine Freundin, kannst dich deines jungen Lebens nicht mehr freuen, erschlossen sind dir die Rätsel des Lebens und des Todes!
Ich legte die Rosen auf das Grab. Ein leichter Sommerwind bewegte die Blumen und Blätter, wie kosend strich er darüber hin. War's ein Gruß der Toten? – Draußen hinter der Kirchhofsmauer gingen Burschen und Mädchen vorüber, ich hörte sie ein lustiges Lied singen; was ging sie der Kirchhof an? Jenseit der Mauer ist ja das Leben, nur hier der stille, schweigende Tod. – Auf Annelieses Grab standen Rosenstöcke, auf dem einen ließ sich ein kleines Vöglein nieder, guckte mit den klugen Äuglein umher und schaukelte sich auf dem Zweige.
Ich pflückte eine der Rosen, dann ging ich langsam, oft den Blick zurückgewendet, zwischen den Gräbern wieder zurück. Einzelne waren verfallen, vergessen, andere reich geschmückt. –
Am selben Sonntagabend besuchte ich auch die Gräber der Großeltern. Sie lagen auf dem alten, nicht mehr benutzten Friedhofe, Großmutter war ja die Letzte gewesen, die man dort beerdigt hatte.
Alt, uralt mochte dieser Kirchhof sein, der am Bergabhange lag. Das Tor war verrostet und knarrte, als ich es öffnete. Ein Bild der Vergänglichkeit alles Irdischen war dieser Friedhof, und mitten unter den eingesunkenen Hügeln stand ich, in diesem Augenblicke die verkörperte glückliche Jugend. Ich war allein, wer sollte auch diese Gräber noch besuchen? Diejenigen, die einst an ihnen geweint, sie waren wohl schon selbst begraben worden.
Alte, verrostete Denkmäler standen schief auf den grasbewachsenen, eingesunkenen Hügeln, nirgends war noch ein Name zu erkennen. Sie waren vergessen, die selbst schon lange Staub geworden! Es lag für mich ein Hauch von Poesie über dem allem; ich dachte: »Wie klein bist du, Mensch, gegenüber der Vergänglichkeit! Von deinem ganzen Dasein bleibt nichts zurück, als ein eingesunkener Hügel, selbst dein Name fällt der Vergessenheit anheim!«
Wer mochten sie alle gewesen sein, über deren Ruhestätten ich jetzt stieg? – Dort leuchteten wie eine Oase in der Wüste zwei Grabmäler, hohe Kreuze nebeneinander; da ruhten meine lieben Großeltern. Wie schön Mütterchen hier alles gepflegt hatte! Efeu umspann die beiden Hügel, er kletterte an den Kreuzen hinauf und reckte seine Zweige über den schmalen Weg zwischen den beiden Gräbern, als wollte er sagen: Ich verbinde wieder, was im Leben zusammengehört hat.
Den Großvater hatte ich nicht gekannt, aber ihn aus Großmutters Gesprächen lieben gelernt. Nun ruhen sie zusammen da unten. –
Ich blieb lange oben auf dem alten Friedhofe. Es war ein Ort zum Träumen. Drüben guckte der dunkle Tannenwald herein, der Wind bewegte die Wipfel, droben war ein durchsichtig blauer Himmel. Schmetterlinge flogen über die Gräber hin und setzten sich an die wenigen wild gewachsenen Blumen, die es hier oben gab.
Noch oft war ich während meines Aufenthaltes in der Mühle hier und auch an Annelieses Grabe.
Die Stadt besuchte ich, sah mit Entzücken jedes Haus an, ging auch zu meinem alten Freunde, dem Schuster. Dort saß ich auf einem Holzschemel und plauderte mit ihm. Ich mußte ihm von meinem Berufe erzählen, für alles interessierte er sich. Draußen Vorübergehende hätten wohl leicht an Hans Sachs und Evchen denken können, als sie das junge Mädchen bei dem alten Schuster sitzen sahen.
Auch zu Annelieses Eltern ging ich natürlich, mein Anblick mochte wohl alle Schmerzen wieder in ihnen wecken. Frau Schilling weinte; ich konnte nicht anders, als tröstend meine Arme um sie legen. Niemand wußte es ja so wie ich, was sie verloren hatte und wieviel Schönheit, Edelsinn und Tugend der blumengeschmückte Grabhügel deckte, an dem ich fast täglich stand. –
Ein lustiges Wiedersehen gab es zwischen Bäckers Ernst und mir. Er war ein stämmiger Bursche geworden, die Fremde hatte ihn gestählt. Und doch war etwas von dem Knaben in seinem Gesichte zurückgeblieben. Das waren noch dieselben gutmütigen blauen Kinderaugen des kleinen Ernst, noch dasselbe Lächeln, halb schüchtern, halb pfiffig. – Wir begrüßten uns so herzlich, wie nur alte Kameraden sich begrüßen, und schüttelten uns die Hände. Dann saßen wir – er war heraus auf die Mühle gekommen – an dem steinernen Tischchen vor dem Hause, aßen große Stücke Heidelbeerkuchen, den Ernst als Selbstgefertigtes mitgebracht hatte, und ergingen uns in Erinnerungen.
Erst wollte Ernst mich ›Sie‹ nennen, aber ich lachte ihn aus, und das ›Du‹ war uns nun sehr geläufig. Vater und Mutter saßen auch mit da. Ernstes und Heiteres ward durchgegangen. Man braucht ja nur einmal die Tore der Vergangenheit zu öffnen, und man tritt in eine liebvertraute, bekannte Welt. Lange Vergessenes taucht wieder auf, Gestalten werden lebendig, welche schon die Erde deckt. Köstliche Sachen aus unserer Kindheit fielen uns ein; wir gedachten der geschwärzten Gesichter, mit denen wir die Menschen zum Fürchten bringen wollten.
Jetzt sprachen wir auch ohne Scheu von Hans. Da er kein verprassender Mensch mehr war, sondern ein tüchtiger Arbeiter, so fühlte jedes, daß es keinem wehtun würde, seinen Namen zu nennen.
Fritz wollte künftige Weihnachten nach Hause kommen und mich besuchen. Er schrieb, er sehne sich, seiner Liesel einen ordentlichen Kuß zu geben. Wir gedachten auch der Abende, wo wir beim Vollmondscheine auf der Werra gegondelt hatten. Und jener zehnte September war nicht vergessen, an dem wir ausgemacht hatten, uns in zehn Jahren an derselben Stelle wiederzufinden. Freilich, schon war eines aus dem Kreise nicht mehr dabei; wer konnte wissen, wohin uns andere das Schicksal bis dahin geweht hatte!
»Hast du Tells Grab schon besucht?« fragte mich Ernst. Ich nickte und erzählte ihm, daß mein Weidenbaum darauf schon sehr hoch gewachsen sei. Der gute Freund Tell! Sein zottiger Kopf steht im Bild noch auf meinem Schreibtische, und das treue Tier habe ich nicht vergessen. –
Die Tage vergingen mir so schön! Vom Krankenhause erhielt ich durch die Schwestern häufigen Bericht. Einzelne meiner kleinen Pfleglinge waren als gesund entlassen worden, dafür gab es neue Patienten. Die Kinder ließen mich täglich grüßen, und einige schlossen die ›gute Schwester Elisabeth‹ in ihr Nachtgebet mit ein. Lottchen sollte im Oktober operiert werden, d. h. der Herr Doktor wollte den letzten Versuch wagen, ob er das kranke Beinchen erhalten könne. Mißglücke dieser, so sei die Amputation gewiß. Arme Kleine! – Ich las alle die Briefe, auch die von Melanie, in einem Birkenwäldchen, das Vater angepflanzt hatte. Man hörte die Werra rauschen, sah das Haus nahe vor sich und war selbst doch ganz versteckt im Grün. Dort verplauderte ich mit Mutter manche Stunde, wir putzten Gemüse oder machten Handarbeiten. Hier las ich also die Briefe. Dann kam manchmal eine leise Sehnsucht nach meinem Wirkungskreise über mich. Ich war so gewöhnt daran, daß ich mich oft mit meinen Gedanken dort ertappte. Mein schwarzes Kleid und das Häubchen waren sorgsam aufbewahrt, denn als ›Schwester Elisabeth‹ hatte ich die Heimat betreten, ich mußte sie als solche auch wieder verlassen.
Die Tage gingen mir so angenehm hin, wir lebten einander so völlig zuliebe, ich genoß mit ganzem Herzen, was ich so lange entbehrt hatte, das Daheim! Manchmal ging ich, einen großen, weißen Strohhut auf dem Kopfe und den Korb an der Hand, an einzelne Stellen des Waldes, wo ich Heidekraut wußte. Ganz blau sahen von ferne diese Flecke aus, wo die Bäume abgeschlagen worden waren und nun das Heidekraut üppig wuchern konnte. Hatte ich meinen Korb gefüllt, so machte ich mich auf den Heimweg. Wie herrlich wanderte es sich mutterseelenallein durch den Tannenwald! Trotz des heißen Augusttages, der draußen im Flachlande eine sengende Glut spendete, war es hier im Walde kühl. Nur hie und da zitterte das Sonnenlicht zwischen den hohen Tannen hindurch und spielte in goldenen Lichtern auf dem nadel- und moosbedeckten weichen Waldboden. Die Bäume strömten jenen süßen Duft aus, den die Sonne ihnen entlockt. Manchmal sang ein Vogel, oder ein Eichkätzchen huschte am Baume hinauf. Ich kam an einer Wiese vorbei, wo es ein dreifaches Echo gab. Dort blieb ich regelmäßig stehen und rief alles mögliche, sehr vergnügt in meiner Einsamkeit lachend, wenn das Echo es mit verblüffender Deutlichkeit zurückgab. – Zu Hause angekommen, setzte ich mich ins Birkenwäldchen oder an den steinernen Tisch vor das Haus und flocht Kränze aus dem Heidekraute. Diese trug ich am Abende noch an ihren Bestimmungsort. Einmal bekam Anneliese sie, ein anderes Mal die Großmutter. Wie oft saß ich dann bei Sonnenuntergang auf dem ruinenhaften, verfallenen Friedhofe! Ich hatte mich auf irgendeines der Gräber gesetzt, die Arme um die Knie geschlungen, und konnte hier stundenlang träumen. Da sah ich den Sonnenball feurig verschwinden, bis zuletzt ein schönes Rot die Wolken säumte. Aus hohen Pappeln herauf schimmerte ein rotes Dach, die Mühle. Ganz zärtlich blickte ich da hinunter und dachte: »Gott erhalte dich, traute Heimat!«
Näher und näher kam die Stunde, wo ich wieder Abschied nehmen mußte. Am letzten Abende spielte mir Mutter noch einmal mein ›Wellenrauschen‹ vor; sie tat es lächelnd, indem sie sagte, daß ich es selbst doch weit besser könnte. Aber ich hörte es am liebsten von Mama; die kleine blonde Frau spielte ja für mich am besten. Ihre kleinen Hände glitten so weich über die Tasten; auch weckte ihr Spiel alte Kindheitserinnerungen in mir. – Bis tief in die Nacht saßen die Eltern und ich zusammen. Ich empfand es stolz und glücklich, daß sie kein unverständiges Kind mehr in mir sahen, sondern daß sie über ihre eigensten Angelegenheiten mit mir sprachen. Sie gedachten mit demselben Schmerze an den Abschied, wie ich selbst, obwohl ich mich auf meine Tätigkeit freute.
Papa sprach den Gedanken aus, die Mühle zu verkaufen, falls sich ein Käufer fände, aber er mußte es erleben, daß seine Frau und Tochter ihn beinahe mit Tränen baten, nur das nicht zu tun. Da gab er seufzend nach, und unser liebes, altes Mühlenrad ward immer mehr bemoost, bis – ja, bis es eines Tages zu ungeahnter Herrlichkeit wieder erstehen sollte! Doch ehe es soweit kam, ereignete sich noch mancherlei.
Wieder mußte ich den geliebten Eltern, der Heimat, dem trauten Leben in der Einsamkeit entsagen, um in die Welt zurückzukehren. Doch diesmal stand es weit besser um mich, als damals. Ich ging keiner neuen Umgebung entgegen, nicht fremden Menschen, sondern einem vertrauten Orte, der friedvollen Stätte meines so geliebten Berufes. Damals wurde ich als eine ›Neue‹ in der Pension erwartet, hier als bekannte und, wie ich im Herzen mir froh gestand, gern gesehene ›Schwester Elisabeth‹.
Papa hatte mich voll Staunen und Rührung betrachtet, als ich ihm zum Abschiede entgegentrat. Sein liebes Vaterauge ruhte auf der ›Schwester‹ in ihrer schwarzen Tracht, auf der Samariterin, die doch seine Tochter war. Schweigend schloß er mich in die Arme und drückte einen Kuß auf meine Stirn. –
Ich hatte die Eltern gebeten, ihnen in der Mühle Lebewohl sagen zu dürfen, sie sollten mich allein gehen lassen. Sie waren gern damit zufrieden. Hand in Hand, ich zwischen den Eltern, gingen wir über die Brücke. Es war ein herrlicher Sommermorgen, golden, klar, balsamischer Düfte voll und still. – Zum letztenmal küßte ich die guten Eltern, bat sie, sich nicht allzuviel Sorge um ihre Kinder zu machen, die ja so glücklich seien, und dann ging ich festen Schrittes fort. Noch einmal wandte ich mich um, da standen sie noch immer an der Brücke und blickten ihrem Kinde nach. Gibt's Köstlicheres als Elternliebe?
* * *
Wieder wanderte ich die Werra entlang. Sie rauschte und schwatzte neben mir, als wolle sie mir weissagen, daß die Zeit nicht allzufern mehr sei, wo ich denselben Weg wandern würde als glückselige junge Braut …
Ich sah den Abendhimmel wieder über mir, der sich über unserem Krankenhause wölbte. Voll Jubel und Herzlichkeit ward ich von den Schwestern begrüßt. In wenig Minuten war ich vollständig wieder eingelebt.
Das Gesicht mit frischem Wasser vom Reisestaube gereinigt, die vorgeschriebene weiße Schürze umgebunden, war ich wieder die Schwester Elisabeth.
Als ich in den Saal kam, wo meine Kranken lagen, fand ich diese gerade beim Abendbrote. Welch ein Jubel, als sie mich erkannt hatten! Lächelnd stand Doktor Pohlmann in der Tür, ohne daß ich es wußte, und sah dem Willkommen zu.
»Schwester Elisabeth!« riefen die Großen und »Schwester Elisabeth!« die Kleinen. Händchen mit und ohne Butterbrot streckten sich mir aus allen Bettchen entgegen. Die lieben, guten Kinder! Mir traten die Tränen in die Augen. – An jedes Bett ging ich, sprach mit jedem Kinde etwas, manche zupften mich am Kleide, ich sollte nicht weitergehen. Ein kleiner Junge befahl sogar sehr energisch: »Dableiben!« Nichts Dankbareres gibt es, als sein Leben Kindern zu widmen, noch dazu kranken, der Hilfe bedürftigen! Sie kennen noch keinen Unterschied im Leben, sie trennen nicht Mein und Dein, für sie gibt es nur die lautere Wahrheit, keine Lüge, kein Falsch, und dabei eines, was die Erwachsenen nicht immer kennen: Dankbarkeit!
Ein Kinderherz ist ein Stückchen Himmel, wolkenlos und rein. Gläubig nimmt es alles auf, was du ihm sagst.
Auch an das Bett meines Lieblings – ich hatte sie ja alle lieb, die Kinder – kam ich, wo Klein-Lottchen lag. Sie war noch durchsichtiger geworden. Als ich mich über sie neigte und sie beim Namen nannte, erkannte sie mich sogleich. Sie schlang die mageren Ärmchen um mich und zog meinen Kopf zu sich herunter. Eine Weile blieb ich über sie gebeugt; ganz dicht sah ich die großen, tiefblauen Augen vor mir, atmete den Duft des goldigblonden Haares. –
Ich war nun den ganzen Tag bei meinen Kleinen, saß mit einer Handarbeit in dem kühlen Saale und erzählte ihnen Geschichten. »Nicht wahr, Schwester Elisabeth,« fragte mich eines Tages ein kleiner dicker Junge, der mit einem Pferdchen spielte, »nicht wahr, Lügen ist etwas sehr Schlechtes?« – »Gewiß, Hans, kein Mensch darf lügen, am allerwenigsten dürfen es die Kinder. Da war einmal ein kleines Mädchen, das hat bitter leiden müssen, als es seine erste Lüge ausgesprochen hatte.« – »Ach!« riefen einige und richteten sich in die Höhe, »erzähle uns, bitte, bitte!«
Auch Lottchen, in deren Nähe ich an einem Tischchen saß, hob das Köpfchen und sah mich bittend an. Von einem kleinen Mädchen, das gelogen hatte, so etwas hatte ich ja noch nie erzählt! So faltete ich meinen Mull zu Rüschen an die weißen Häubchen und begann dabei zu erzählen, während ein echter Herbstregen gegen die Scheiben prasselte:
»Die kleine Klara hatte noch zwei Schwestern, Gertrud und Toni. Klara, die älteste, war stets ein braves Kind gewesen, das seinen Eltern nur Freude gemacht hatte. Die Familie bewohnte ein großes Haus an einem See. Ein Garten ging vom Hause bis an die Ufer des Sees, der von hohen Bergen umgeben war. Dort, in dem schönen Garten, spielten die kleinen Mädchen den ganzen Tag. Klara und Gertrud hatten freilich schon Schularbeiten zu machen. – Eines Tages sagte der Papa, daß Besuch käme; die kleinen Mädchen waren sehr neugierig und fragten: ›Wer denn?‹ – ›Euer Bäschen Melanie aus Berlin!‹ sagte der Papa. ›Aber das ist kein Junge!‹ sagte Trudchen ganz enttäuscht. Der Papa lachte und sagte, dafür sei das Bäschen schon vierzehn Jahre alt. ›Da hat sie wohl Kleider mit Schleppen wie die Mama?‹ fragte Toni. Aber die Kleine wurde ausgelacht. Und am nächsten Sonntage war die Melanie da! Die kleinen Mädchen hatten schneeweiße Kleidchen an, alle Spielsachen und Schulbücher waren in Ordnung, alles Melanie zulieb. Diese war gar keine Dame, trug keine Schleppkleider und war sehr lustig. Die Kinder hingen Melanie immer am Kleide, so lieb hatten sie sie. Sie spielte mit ihnen, fuhr sogar im Kahne hinaus auf den See, pflückte für jedes Kind eine Wasserrose und sang schöne Lieder. Die Kinder wollten am Abende gar nicht ins Bett, so vergnügt tollten sie mit Melanie herum. Klara hatte noch keine Ferien, gar nicht gern ging sie jetzt in die Schule; wie oft mußte die Mama fragen: ›Hast du deine Schularbeiten gemacht?‹ Dann stampfte Klärchen böse mit dem Fuße auf, warf die Spielsachen hin und setzte sich ärgerlich an ihre Schularbeiten. Eines Tages regnete es sehr. Melanie war in ihrem Stübchen und schrieb an ihre Eltern. Die drei kleinen Mädchen saßen vor ihrer Puppenküche. Mama hatte Milch und Schokolade hergegeben. Mitten im schönsten Kochen rief die Mama Klärchen zu sich und fragte nach den Schularbeiten. ›Nur die Rechenexempel noch!‹ sagte Klara. Die Mama befahl dem Kinde, das Kochen nun den Schwestern zu überlassen und erst die Aufgaben zu machen. Bitterböse warf Klärchen ihre Bücher durcheinander, nahm endlich ihr Heft und setzte sich mit an den Tisch zur Mama. Aber das Rechnen wollte nicht gehen. ›So bitte Melanie, daß sie dir helfe!‹ sagte die Mama. Klara stand auf und kam nach einem Weilchen wieder, aber allein. ›Nun,‹ sagte die Mama, ›und wo ist Melanie, hilft sie dir?‹ – ›Sie hat gesagt, sie mag nicht!‹ antwortete Klärchen. Aber sie blickte die Mama nicht an, denn Klara hatte ihre erste Lüge gesagt! Die Mama war ganz erstaunt und sehr betrübt, daß Melanie so ungefällig sei. Klärchen aber rechnete mit einemmal sehr gut. Ihr Kopf glühte. Sie fürchtete sich, denn sie wußte ganz genau, daß sie etwas sehr Böses getan hatte. Sie war ja gar nicht bei Melanie gewesen, sondern vor ihrer Tür wieder umgekehrt. Und nun kam Melanie und ging freundlich auf die Tante zu. Aber diese war so anders, ach, Klara sah das wohl! Sie hatte mit einemmal keine Freude mehr am Kochen und schlich sich hinaus in den Garten. Der Regen hatte aufgehört, aber die Wege waren überschwemmt. Klara blieb in einer Laube, bis man sie zum Abendessen rief. Inzwischen hatte die arme Mama von Melanie erfahren, daß ihr Kind gelogen hatte. Ach, wie sehr hat die arme Mama da geweint! Und als Klärchen ihr wie alle Abende den Gutenachtkuß geben wollte, wandte sie sich ab. – Klara konnte nicht beten und nicht einschlafen, sie weinte leise in ihr Kopfkissen hinein und bereute bitterlich, was sie getan hatte. ›Die Mutter weiß alles,‹ dachte Klärchen, ›sie liebt mich nicht mehr.‹ – Am andern Morgen sprach die Mama fast gar nichts mit Klara. Diese aß nichts und ging heimlich weinend in die Schule. Sie konnte nicht wie sonst lustig sein, es lag ihr wie ein Stein auf der Brust. Nun kam der Herr Pfarrer, der die Religionsstunde gab. Es war Klara, als hätte er sie ganz ernst angeblickt. Wußten denn alle Menschen, daß sie gelogen hatte? Und nun begann er mitten in der Stunde von der Lüge zu sprechen. ›Laßt euren Mund nie eine Unwahrheit sagen, liebe Kinder,‹ so sagte er, ›hütet euch vor der ersten Lüge! Und wenn eines von euch wirklich einmal gelogen hat, so sagt es Vater und Mutter frei, dann ist die Last herunter vom Herzen, und der liebe Gott hat verziehen!‹ Klärchen hatte den Kopf auf die verschränkten Hände gelegt und immerzu geweint. Auf dem Nachhausewege klopfte Klaras Herz zum Zerspringen; sie hatte sich vorgenommen, der Mama und Melanie Abbitte zu tun.
»Sie sah die beiden im Garten sitzen, wo sie Kirschen auskernten. Nicht wie sonst riefen sie Klärchen heran. Diese merkte es wohl. Ganz bleich war das Kind geworden, seit es die Gewissensbisse wegen seiner Lüge fühlte. Klara sah, wie Melanie ins Haus ging. Jetzt war die Mama ganz allein! Wenn sie hinginge? Ach, wenn nur erst die liebe Mama wieder gut wäre, weiter wünschte sich Klärchen nichts. Langsam kam sie heran, und plötzlich lag sie an der Brust ihrer Mama und weinte und schluchzte. Die Mutter fragte nicht, sie wußte ja, weshalb ihr Klärchen so unglücklich war. ›Du wirst es nie wieder tun?‹ fragte die Mama. ›Nein, nie, Mama!‹ rief das Kind, und nun war es erlöst, der schwere Stein war vom Herzen gefallen. Ach, wie wohl war dem Klärchen jetzt! ›Und der liebe Gott ist nicht mehr böse auf mich?‹ fragte Klara. ›Nein, mein Kind!‹ sagte die Mama. Auch Melanie war wieder gut, und unser Klärchen war wieder das fröhliche, sorglose Kind wie ehedem. Und eine Lüge hat es nie wieder gesagt!«
Wie hatten meine Kleinen gelauscht! Kein Fingerchen hatten sie gerührt. »Is will nie lügen!« sagte Hans und lief auf Doktor Pohlmann zu, der die ganze Geschichte mitangehört hatte. »Recht so, mein Junge!« sagte er und hob den Kleinen auf seinen Arm. –
Die Wochen vergingen in Arbeit und Befriedigung bei derselben. Die Tage wurden kürzer, und die Blätter fielen gelb zur Erde. Wenn ich mit den gesünderen Kindern auf der Veranda saß, flogen weiße Gewinde auf mein schwarzes Kleid: Spätsommerfäden.
Gesunde Kinder wurden entlassen; sie gingen oft mit Tränen fort, denn es hatte ihnen bei den vielen kleinen Geschwistern gar zu gut gefallen.
Lottchen saß jetzt manchmal auf meinem Schoße. Dann lehnte das blonde Köpfchen an meiner Schulter. Ich hatte das süße Kind so lieb. Wie lange wird es mich noch ›Schwester Elisabeth‹ nennen können? Nur wenige Tage noch, und die Entscheidung kam. Doktor Pohlmann hatte mich gebeten, da Lottchen besonders an mir hinge, ihr und ihm das Opfer zu bringen, die Pflege zu übernehmen. Ich hatte ihm gesagt, daß es kein Opfer sei und daß ich niemand sonst dies Amt abgetreten haben würde.
Auf uns Schwestern lag es wie ein Alp, wir alle hatten die Kleine so lieb; ich selbst sah und fühlte es, daß ich bleich geworden war.
»Sie sorgen sich so treulich mit mir, Schwester Elisabeth!« sagte Pohlmann. »Sie haben tiefe Schatten unter den Augen. Wenn alles vorüber ist,« – er seufzte tief, – »so müssen Sie an sich selber denken!«
»Nur erst Lottchen gerettet, dann bin ich schon gesund!« sagte ich. Auch die Kleinen im Saale fühlten es, daß etwas Unsichtbares, Schweres in der Luft lag, sie sahen wohl, denn Kinder haben ein feines Empfinden, daß der Herr Doktor und die Schwestern so ernst und still waren. Nur Lottchen merkte nichts; sie spielte mit ihrer Puppe, lachte vergnügt auf, ließ sich geduldig pflegen und war heiter und guter Dinge.
Es war ein düsterer Oktobertag, ich werde ihn nie vergessen. Ich hatte kaum geschlafen und stundenlang über mir die Schritte des Arztes gehört, der ruhelos auf und ab ging. In einem besonderen Zimmer war Lottchens Bett zurechtgemacht, dorthin trug ich mein Gebetbuch, meine Sachen, denn ich richtete mich auf eine lange Pflege ein und wollte das Kind keine Minute verlassen.
Ein grauer Himmel war es, in den ich blickte, nicht licht und blau mehr wie zur Sommerszeit. Ich hatte die Hände über meinem Gebetbuche gefaltet und wartete, bis die Tür sich öffnen sollte. Drüben im Operationssaale litt Doktor Pohlmann jetzt Qualen, aber vielleicht nicht größere als ich. Ich wußte: was ärztliche Kunst, gewissenhafteste Pflege vermögen, ein Menschenleben zu retten, das wurde getan, dies Kind zu erhalten und vor dem furchtbaren Leide zu bewahren, ein Krüppel zu werden. Unendlich wie die Ewigkeit erscheinen einem die Stunden, die man wartend vor einer großen Entscheidung hinbringt. Es war totenstill in dem großen Hause, nur manchmal hörte ich ein plauderndes Kinderstimmchen in der Ferne.
Endlich kamen Schritte, fast unhörbar ging die Tür auf, und Lottchen wurde hereingebracht. Sie war wie tot, ich wagte kaum zu hoffen, daß noch Leben in dem weißen Geschöpfchen sei. – Fast ebenso bleich stand der Arzt da. Wir sprachen beide kein Wort, sondern walteten schweigend unseres Amtes. Der andere Arzt und die Wärter waren gegangen.
Lottchen lag nun auf weichen Kissen, ein matter Sonnenstrahl flog über ihr Bettchen.
Doktor Pohlmann fühlte den Puls. Noch war ja nicht zu sagen, ob das Kind gerettet war, ob es fieberlos die Operation überstehen und für immer genesen sollte, oder ob dies alles nur der Übergang zu viel Schwererem sei. – Nach kurzer Zeit schlug Lottchen die lieben Blauaugen auf und blickte wie in eine fremde Welt. Erst als der Doktor sich über sie neigte und mich heranwinkte, erkannte sie uns beide.
»Warum bin ich nicht bei den anderen?« fragte sie mit schwacher Stimme.
»Bald kommst du wieder zu ihnen, mein Kind, heute bleibt dafür die Schwester Elisabeth den ganzen Tag bei dir!«
Lottchen gab sich zufrieden, und ich trat mein Pflegerinamt an. In der Nacht kam der Arzt alle Stunden einmal und beobachtete das schlafende Kind. Fieber hatte sich eingestellt und stieg stets gegen Abend.
Es war die Nacht, in welcher es sich entscheiden mußte. Voll Glück hatte mir Doktor Pohlmann strahlenden Auges mitgeteilt, die Operation wäre gelungen, das kranke Beinchen brauche nicht amputiert zu werden.
Ich war so aufgeregt, daß ich ihm nur schweigend die Hand hatte reichen können.
Nun noch den kämpfenden kleinen Körper der Wut des Fiebers entrissen, und Lottchen konnte als gerettet betrachtet werden. Noch aber war sie es nicht, der Arzt und ich wußten, daß die nächsten Stunden entscheidend waren, und daß die Morgensonne entweder ein sterbendes oder ein sanft der Genesung entgegenschlafendes Kind bescheinen würde. –
Meine durchwachten Nächte machten sich fühlbar, nur die Aufregung hielt mich aufrecht. Stunde um Stunde verrann, Mitternacht war nahe. Matt schimmerte die Kerze, ich lehnte am Fenster, blickte in die Nacht hinaus und lauschte auf jeden Atemzug des Kindes. In solchen Augenblicken empfindet der Mensch seine Kleinheit gegenüber der Allmacht, die über uns wacht.
Ich wagte nicht mehr, mich zu bewegen, und hörte stockenden Herzens, daß der laute, pfeifende Atem des mit dem Tode ringenden Kindes plötzlich verstummte. Totenstille! Großer Gott, war es zu Ende?
Noch eine bange Minute, dann hörte ich Schritte hinter mir. Ich wandte mich langsam um. Mit bleichem Gesichte stand Doktor Pohlmann dicht vor mir. Wortlos streckte er mir beide Hände entgegen; ich las in seinen glückstrahlenden, feuchten Augen, was sein Mund jetzt leise und voll Bewegung aussprach: »Gerettet!«
Da stürzte ein Tränenstrom aus meinen Augen, ich fühlte noch, daß ich lächelnd zu dem Arzt aufblickte, aber sprechen konnte ich nicht, denn ich brach ohnmächtig zusammen.
Als ich, unfähig, zu fassen, was geschehen war, wieder zu mir kam, sah ich sein Gesicht über mir.
»Nicht sprechen, Elisabeth!« bat er leise. – Wie rührend lieb waren sie alle um mich besorgt, jetzt, wo das Kind ruhig schlummerte und die pflegende ›Schwester‹ nun selbst auf Hilfe angewiesen war! Hätte ich noch nicht gewußt, wieviel Segen in meinem Berufe lag, so hätte ich es selbst an mir gefühlt. –
Was bis dahin nur unbewußt in mir gelebt hatte, das wußte ich jetzt, ich liebte Pohlmann. Aber ganz still verbarg ich dieses Geheimnis noch in mir, da ich ja noch keinen Beweis hatte, ob er diese große Liebe erwidern würde. –
Meine kräftige Natur erholte sich bald wieder, am andern Tage schon konnte ich meinen Platz an Lottchens Bett wieder einnehmen. Man wollte nicht, daß ich die weitere Pflege übernähme, aber die Kleine bat so lieb, daß der Herr Doktor mich fragend ansah: »Noch mehr der Opfer willst du bringen?«
Er hatte mich nie wieder bei meinem Namen genannt, wie jenes einzige Mal, wo ich aus der tiefen Ohnmacht zum Bewußtsein erwachte. –
Unser Lottchen blühte förmlich, es war, als ahne das Kind, daß es jetzt gesunden sollte von langwierigem Leiden.
Stundenlang mußte ich ihr erzählen, alle möglichen Märchengestalten wanderten auf ihre Bitten durch unser dämmeriges Zimmer, bis es geschah, daß die Kleine plötzlich mitten in der schönsten Geschichte einschlief. – Die Tage kamen, wo Rudolf sein Lottchen über die langen Korridore führte. Langsam schwebte die zierliche Gestalt des kleinen Mädchens daher. Strahlend, triumphierend über diese stolzen Gehversuche blickten die Augen des Kindes.
* * *
Was die Werra, als ich zum letztenmal an ihren Ufern hingeschritten war, geschwätzig erzählt hatte, das wurde wahr! Ein Weihnachtsabend dämmerte über mein geliebtes Heimatstädtchen herab. So recht weihnachtlich sah es aus, die Laternen brannten trübe, um so heller strahlten an einzelnen Fenstern schon die flackernden Kerzen am Christbaume auf. Der Schritt verhallte lautlos, denn eine dicke Schneedecke war über die Erde gebreitet. Weiß, weich und glitzernd lag der Schnee auf den altersgeschwärzten Giebeln der Häuser, auf den steinernen Sitzen vor den Türen, auf den verzierten Brunnenröhren.
Durch die stillen Straßen wanderte ein Paar, junge, glückselige Menschenkinder. Aneinandergeschmiegt, zuweilen sich mit den Augen suchend, schritten sie dahin, die Müllerliesel mit ihrem Bräutigam! Ja, es war zur seligen, berauschenden Wahrheit geworden, Rudolf hatte sein gutes, treues Herz mir zu eigen gegeben, so wie er schon lange das meine besaß. Ob ich sein Weib werden wollte, hatte er mich gefragt. Und ›Schwester Elisabeth‹? Sie hatte weinend »Ja!« gesagt und geduldet, daß er ihr die Tränen wegküßte.
Ich lebte seit diesen wenigen Tagen, in denen ich Braut war, wie im Traume. –
Die Eltern und Geschwister wollten wir am Weihnachtsabende beide überraschen, ich sollte dann bis zur Hochzeit auf der Mühle bleiben. So hatte ich für immer die Schwesterntracht abgelegt, hatte damit meinem lieben Berufe entsagt. –
Wir wanderten durch die dämmerigen Straßen. Niemand kannte uns. Rudolf war entzückt von der Poesie, die über dem allem lag. Und ich war in einer so erwartungsvollen, freudigen Stimmung, daß ich mir vorkam, als sei ich eine Träumende. Und doch war alles so greifbar wahr!
Wir hatten das letzte Haus des Städtchens hinter uns, das breite Tal lag in tiefer Dämmerung vor uns.
Einträchtig wandelten wir den Wiesenweg entlang, aber mein Herz fing an, stärker zu klopfen. Ich plauderte erst noch ein Weilchen, dann wurde ich still. Wir waren zwischen den beschneiten Stachelbeerhecken. Da tauchten die schwarzen Umrisse eines Gebäudes auf: die Mühle. Ich konnte nur mit der Hand dahin zeigen.
»Deine Heimat!« rief Rudolf bewegt und schloß mich in die Arme, ehe wir Hand in Hand auf die Brücke traten. –
Im Wohnzimmer war Licht, ein heller Schein fiel heraus auf den Schnee, der glitzerte. Oben die Staatsstube war finster; sie schienen also keinen Weihnachtsbaum zu haben. –
Fast atemlos und jedenfalls blaß bis in die Lippen vor Erregung stand ich an der Wohnzimmertür. Ich hörte die Stimmen der Eltern. Entschlossen klinkte ich auf und mußte wohl wie ein Geist aussehen, denn Mutter rief entsetzt: »Liesel, bist du's wirklich?«
Im nächsten Augenblicke hing ich schluchzend an ihrem Halse: »Mama, ich bringe euch meinen lieben Bräutigam!«
Rudolf war zu Vater geschritten, sich vorstellend und um sein Jawort bittend. –
Aus meinen Briefen war Rudolf den Eltern kein Fremder mehr, und Mutter hat mir später erzählt, wie deutlich sie zwischen den Zeilen meine Liebe zu dem jungen Arzte herausgelesen habe. Damals freilich sei ihr bange gewesen, ob ich auch mit dieser Neigung glücklich werden würde. Wie bald konnte das treue Mutterherz darüber beruhigt sein! –
Traute, alte Mühle im stillen Tale, wieviel Glück hast du an diesem heiligen Weihnachtsfeste in deinen starken, schützenden Mauern gesehen! Du sahst ein sonst so sorgenvolles Vaterauge leuchten vor Stolz und Freude, sahst eine Mutter, die feuchten Auges immer wieder sagte: »Ist's auch wahr? Großer Gott, wie wunderbar sind deine Wege!«
Und du, alte liebe Heimat, sahst auch das glückseligste Brautpaar, den schönen, herrlichen Bräutigam mit dem goldtreuen Herzen voller Liebe und die junge Braut, die mit strahlenden Augen zu ihm aufsah!
* * *
Bis hierher Müllerliesel selbst. – Nun war wieder sonniges Leben in die Mühle eingekehrt. Lottchens Kinderfüßchen trippelten umher, eine schlanke Mädchengestalt, den Liebesfrühling im Herzen, huschte wie der lachende Sonnenschein selber durchs Haus!
Und um der geprüften Eltern wiedererwachendes Glück noch größer zu machen, liefen von Hans nur die besten Berichte ein. Er freute sich über seine bräutliche Schwester und hoffte, in nicht zu ferner Zeit heimzukehren. »Nur freilich erst dann, wenn ich mit Ehren in Eure guten Augen blicken kann!« schrieb er den Seinen.
Die Verlobung der schönen Müllerliesel erregte natürlich viel Aufsehen.
Als der Mai seinen Blütenschnee über das alte Dach der Mühle schüttete, trat eines Tages eine wunderschöne junge Braut im köstlichen Schmucke aus der Tür. Das weiche, liebliche Gesicht war bleich vor Erregung, die langen, dunklen Lider hoben sich kaum von den tiefblauen großen Augen. Unter dem Brautschleier schimmerten golden die langen Flechten.
Da, wo sie vor mehreren Jahren aus den Händen des alten Geistlichen das Abendmahl genommen, kniete jetzt die schöne Braut, um den Segen des alten Mannes nun auch für ihren neuen Lebensabschnitt zu empfangen.
Klein-Lottchen war wie ein Engel vorangeschwebt, mit den kleinen Händen Blumen zu streuen.
* * *
Heute feiert die junge Frau Doktor Pohlmann ihren fünfundzwanzigsten Geburtstag.
»Du hast eine alte Frau!« hat sie scherzend zu ihrem Manne gesagt, als er ihr gratulierte. Er schließt das blühend schöne Wesen in Liebe an sein Herz.
Sie hat ihn bis jetzt nur glücklich gemacht, seine Liesel. Ihr Töchterlein, die kleine fünfjährige Melanie, und das verwaiste Lottchen, dem Liesel die beste Mutter geworden ist, wachsen wie Schwestern auf. Sie sind in ihrer Liebe zur Mama beinahe eifersüchtig.
Rudolf hat sich als Arzt in einer großen Provinzialstadt niedergelassen und ist glücklich in seinem schweren Berufe. Friede, Erholung findet er, sobald er sein Heim betritt. Dort fliegt ihm mit ausgebreiteten Armen sein Weib entgegen, jede Falte auf der Stirn streichelt und schmeichelt sie weg.
Alljährlich verlebt die junge Frau einen Teil des Sommers und ihren Geburtstag am Beginn des Herbstes im Elternhause. Wie wohl fühlt sie sich hier, trotz des glänzenden Heims, das sie verläßt, um hier ein paar Monate in der ländlichen Einsamkeit zu verleben!
Rudolf hat dafür, daß Liesel mit ihren Kindern alljährlich hier Sommerfrische genießt, dem Fritz geholfen, daß er die Mühle wieder flott in die Höhe bringen konnte. Die Eltern erfreuen sich der verdienten Ruhe, soweit bei ihnen von Ruhe die Rede sein kann. Der Vater hilft mit Rat und Tat seinem Fritz, dessen Eifer und Stolz groß sind.
Die Mutter steht der Wirtschaft vor, eine junge, kräftige Magd wird von der alten Elise angelernt, damit diese sich dann mehr der verdienten Ruhe hingeben kann. Sie ist glücklich, sie weiß, sie braucht die Mühle nicht eher zu verlassen, bis man sie dereinst hinaustragen wird.
Und Hans? Er ist vor zwei Jahren heimgekehrt, der einst verlorene Sohn, ein großer, gesunder Mann, gesund an Leib und Seele. Die Eltern haben ihn erschüttert in die Arme geschlossen und Gott gedankt für ihr ihnen von neuem geschenktes Kind.
Er hatte sich ein Vermögen gespart und gründete ein Bankgeschäft in der nahegelegenen Residenz.
Ernst ist Besitzer der väterlichen Bäckerei, bereits verheiratet. Vor seiner Haustür kann man oft im Sandhaufen einen kleinen Jungen spielen sehen. Wer vor zwanzig Jahren den dicken kleinen Ernst gekannt hat, der sieht auf den ersten Blick, daß der Junge des jetzigen Bäckermeisters Söhnchen ist.
Fritz und Ernst sind die besten Freunde, sie besuchen einander sehr oft. –
Der frühe Herbst liegt über dem Tale, durch das die Werra fließt. Die Wälder sind prachtvoll gelb, rot und braun gefärbt, nur der Tannenwald hat sein dunkles Grün behalten. – Es ist noch keine kalte, frostige Oktoberluft, die über das Tal weht, sondern sie ist weich und warm.
Über dem rauschenden Mühlenrade hat Rudolf eine große Terrasse bauen lassen. Liesel hat diese Überraschung mit Entzücken gesehen, war sie doch ohnedies schon froh, wenn sie ihr altes, trautes Rad gehen sah. Lange konnte sie über das Brückengeländer gelehnt stehen und sinnend auf die alte Melodie lauschen. –
Auf der Terrasse ist eine Gesellschaft fröhlicher, guter Menschen versammelt, von denen die meisten alte Bekannte von uns sind.
Der herrliche Herbst hat sie aus der Großstadt in die Thüringer Berge gelockt, und zu Liesels Geburtstag fanden sie sich alle in der Mühle ein.
Wer nicht hier Wohnung fand, hatte sich im nahen Städtchen einquartiert. –
Dort unter dem vollen Oleanderbaume liegt im Schaukelstuhle eine schöne, elegante Dame. Das köstliche, rotgoldene Haar fällt genial in Locken auf das dunkle Seidenkleid. Es ist Melanie Nordau, gefeierte Pianistin und von ihren zahlreichen Schülern vergötterte Lehrerin. Jedes Jahr ist sie mit Freuden dem Leben der Großstadt entflohen und hat sich in die Mühle zurückgezogen, dort ein lieber, willkommener Gast. Sie findet Liesels einstiges Heim idyllisch, steht auf dem besten Fuße mit ›Papa Ferner‹ und nennt Liesels Mama auf deren Wunsch ihr ›Mütterchen‹.
Mit Fritz hat sie längst Brüderschaft gemacht. Und Hans? Dessen Lebensschule hat ihr gefallen, sein ernstes, gediegenes Wesen ist nach ihrem Geschmacke, sie erfährt so manchen schönen Charakterzug von ihm.
Lebhaft geht es am Tische zu. Rudolf unterhält sich mit seinem Nachbar, Herrn Pfarrer Trost, beide Herren rauchen.
Die ehemals Unzertrennlichen sitzen beisammen: Charlotte, die längst Frau Leutnant von Stetten ist, und Ludchen, Pfarrer Trosts Gattin.
»Wo ist denn mein Sohn?« fragt letztere.
»Hier, Mama!« antwortet eine helle Kinderstimme, und ein kleiner dicker Kerl im braunen Samtanzuge, die Peitsche in der Hand, kommt langsam heran. »Ich habe ganz gewiß reine Hände, Mama!« versichert er ängstlich, was einen Sturm von Heiterkeit erregt.
Ludchen küßt ihren Jungen auf Wangen, Mund und Augen, gibt ihm ein Stück Kuchen und führt ihn wieder in das Spielwinkelchen auf der Terrasse, das Liesel hergerichtet hat. Dort sitzt an dem niederen Tischchen ganz allein ein niedliches, blondes Mädchen, das kleine Ludchen. Wie ein Püppchen sieht das Kind aus in seinem weißen Kleidchen, blaue Schleifen auf beiden Achseln. Es ist Charlottes Tochter. Die Frau Leutnant von Stetten ist eine zierliche, blonde Frau. Ihre Freundschaft mit Ludchen ist immer die gleiche.
Sie ist eine wunderschöne Frau geworden, unsere Müllerliesel. Über der Stirn trägt sie die blonden Flechten wie ein Diadem. In ihren schönen Augen spiegelt sich ihr Inneres, ihre harmonische Seele. Rudolfs Blick ruht manchmal wie verloren auf seiner Frau. »Die anderen jungen Frauen sind ja auch prächtig,« denkt er, »aber keine kann sich mit meiner Liesel messen!« –
Eben sieht Liesel die Briefe noch einmal durch, die heute für sie ankamen.
Ludchen hilft ihr, es interessiert sie lebhaft.
»Was schreibt Tante von Reißner eigentlich?« fragt Lotte und sucht in dem Haufen von Briefen nach der bekannten Handschrift.
»Es geht ihr gut,« erzählt Liesel; »wie lieb, daß sie an uns alle immer noch denkt!«
»Du warst ihr Liebling!« äußert Ludchen neidlos, »wir waren ihr zu dumm, nicht wahr Lotte?«
»Da muß ich bitten! Wenn das meine Tochter hört!« sagt die Frau Leutnant entrüstet.
Ludchens Sohn drängt sich an seine Mama, und Frau Liesel hebt seine kleine Spielgefährtin eben auf den Schoß. Lotte guckt zärtlich auf ihr Töchterchen, mit dessen Händchen die zwölfjährige Charlotte spielt.
»Friedrich Karl Theodor Trost, du wünschest?« fragt Ludchen und hebt den schweren Jungen herauf.
»Kuchen!« antwortet der Dicke ernsthaft. Es ist sein Liebstes. Mama Liesel füllt seine Händchen.
Unter dem Oleanderbaume wird leise geplaudert, die kleine Melanie sitzt ganz geduldig, ihr Püppchen im Arme. Mit ihren Blauaugen – es sind Liesels schöne Augen – blickt sie unverwandt hinüber zu ihrer Mutter.
Aus der Laube drüben dringen ebenfalls heiteres Lachen und Plaudern herüber, dort sitzen Fritz und Ernst, zu denen sich Rudolf und Pfarrer Trost gesellen, beim Kruge kühlen Bieres. –
Es ist spät geworden, lange haben die Bewohner der Mühle mit ihren Gästen beisammengesessen.
Jetzt ist's still, Vater und Mutter Ferner sind zur Ruhe gegangen, die Kinder schlafen in ihren Bettchen. Oben in Liesels einstigem Mädchenstübchen, das Melanie Nordau jetzt bewohnt, ist Licht. Dort sitzt eine junge, glückselige Braut auf ihrem Bettrande, faltet die Hände und betet zu Gott und ihrem toten Mütterchen. Morgen wird sie dem Vater und ihrer Liesel mitteilen, daß sie sich mit Hans Ferner verlobt hat. –
Auf der Terrasse stehen, eng aneinandergeschmiegt, Rudolf und sein Weib. Sie sehen, wie einzelne Lichter sich der Stadt zu bewegen, hie und da tauchen sie aus dem Dunkel auf. Es sind die Gäste, welche nach dem nahen Städtchen zurückgehen.
Finster liegt der schweigende Wald drüben, vereinzelte Sterne blinken am dunklen Nachthimmel auf, majestätische Ruhe liegt über der Natur. Nur das Mühlenrad rauscht und perlt wie zu Liesels Kinderzeit. –
»Bist du glücklich?« fragt die junge Frau ihren Mann, zu ihm aufsehend. – In wortlosem Glücke schaut er lange auf das liebliche Wesen herab, seines Lebens höchsten Schatz.
»Meine Liesel!« Er küßt den weichen Mund, der nur Liebes sprechen kann, und drückt den goldblonden Kopf an sein Herz.
* * *