
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ein elegantes Coupé mit zwei schönen Rappen fuhr in schnellem Trabe auf die Rampe des Bahnhofs; ein hoher, schlanker Mann mit edlen Zügen, dessen ganze Erscheinung den ehemaligen Offizier verriet, stieg aus und schritt auf eine Gruppe von Herren zu, die ihn zuvorkommend begrüßten und ihn aufforderten, an ihrem Ausfluge teilzunehmen, wenn es seine Zeit erlaube.
Der Hauptmann von Wildburg dankte artig und bedauerte, verhindert zu sein, da er seinen von langjährigen Reisen heimkehrenden Vetter im Auftrage des Vaters begrüßen und abholen wolle.
Das Erstaunen der Herren war groß; man wußte, daß sich der Majoratserbe von Wildburg mit seinem Vater nie gut gestanden hatte, weil ihre Neigungen zu weit auseinander gingen. Der Hauptmann von Wildburg, ein naher Verwandter, lebte seit langem auf dem Schlosse mit seiner Familie und galt allgemein als die rechte Hand des alten Herrn; er regierte eigentlich unumschränkt; an eine Aussöhnung von Vater und Sohn hatte niemand gedacht, und nun diese Überraschung, die einen solchen Umschwung der Verhältnisse herbeiführen mußte!
Die Herren waren taktvoll genug, jede weitere Bemerkung zu unterdrücken, und der Hauptmann sprach sich nicht weiter aus, sondern zog seine Uhr und sagte nur: »Der Zug hat Verspätung, und zwar eine ziemlich bedeutende.«
Das war in der Tat der Fall; die Ungeduld der zahlreich versammelten Menge wurde zur Unruhe; man bestürmte die Beamten, die keine Auskunft zu geben vermochten und offenbar selbst besorgt waren; die Türen zu den Expeditionsräumen wurden geschlossen, der Telegraph arbeitete ununterbrochen und die Beamten wollten von dem geängstigten Publikum nicht gestört werden.
Jetzt trat der Inspektor heraus, blaß, verstört, seine Miene zeigte Unheil an und nun verkündete er mit bebender Stimme: »Der Schnellzug ist entgleist, viele Wagen sind zerstört. Die Zahl der Verletzten sehr groß.«
Ein Aufschrei des Entsetzens folgte seiner Mitteilung, man umdrängte ihn, wollte mehr wissen, verlangte einen Extrazug, um nach der einige Stationen entfernten Unglücksstätte zu eilen, denn jeder wollte sich selbst über das Los der von ihm Erwarteten vergewissern. Die Frauen jammerten und weinten, die Männer machten es nicht viel besser, die Pein war zu groß.
Die Beamten taten indes ihre Pflicht; in kurzer Zeit stand eine Lokomotive mit einigen Wagen bereit, die Ärzte, Krankenträger, alles zum Transport und ersten Verband Erforderliche aufnehmen sollten. Nun entstand ein wildes Drängen, jeder wollte mitfahren, aber fast alle wurden zurückgewiesen; mit Mühe erhielt der Hauptmann die Erlaubnis auf seinen Hinweis, daß er auf vielen Schlachtfeldern gewesen sei und Samariterdienste ausgeübt habe.
An den kränkelnden Majoratsherrn hatte er vorsorglich eine Botschaft abgesandt, die ihm von einer Verspätung des Zuges berichtete; im Falle eines Unglücks erfuhr er das Schlimmste noch immer früh genug. Das Schlimmste? Der Hauptmann fuhr bei dem Gedanken zusammen. Welcher Ausblick eröffnete sich ihm, dem Mittellosen, den die Rückkehr des Erben seines Asyls beraubte? Eine ungeheure Sorgenlast hatte ihn fast erdrückt, nun zeigte sich ihm die Möglichkeit, daß ihm das reiche Erbe zufiel.
Die Unglücksstätte war bald erreicht, der Anblick ein grauenhafter. Überall Vernichtung, die Wagen zu einem Trümmerberge zusammengehäuft, überall Stöhnen, Wimmern, Hilferufen. Nur in einem Abteil erster Klasse war es ganz still bis auf ein schwaches Stöhnen. Mit unendlicher Mühe bahnte man sich einen Zugang, der Hauptmann arbeitete selbst mit Aufbietung aller seiner Kräfte. Eine verstümmelte Menschengestalt wurde wie leblos und blutüberströmt hervorgezogen, und in dem bleichen, schmerzverzerrten Antlitz erkannte der Hauptmann den Majoratserben von Wildburg, über den das Leben einst seine Gaben so verschwenderisch ausgeschüttet hatte, ein Wunder war es, daß er noch atmete mit dem eingedrückten Brustkasten und den zerschmetterten Beinen.
Die ärztliche Kunst vermochte hier nichts mehr, die Helfer wandten sich andern zu, denen sie noch von Nutzen sein konnten. Der Hauptmann ließ den Todwunden in ein Wärterhäuschen bringen; er wich nicht von seiner Seite und leistete ihm jeden Beistand; noch hatte er das Bewußtsein nicht wieder erlangt.
So saß er bei dem Sterbenden, die kalte, feuchte Hand in der seinen, den kaum fühlbaren Puls beobachtend, auf die röchelnden Atemzüge lauschend. Uhr und Börse des Verwundeten lagen auf dem Tisch, die Brieftasche hatte der Hauptmann zu sich gesteckt. Er schob seinen Stuhl zurück, so daß ihn der Leidende nicht erblicken konnte, wenn er die Augen aufschlüge, und sah die Papiere durch, die das dichtgefüllte Portefeuille enthielt.
Wechsel und Banknoten schob er gleichgültig beiseite, ebenso Briefe mit großen, zitternden Buchstaben, wie sie eine alte Menschenhand niederschreibt, dann fanden sich Briefe mit zierlichen, ungeübten Schriftzügen, offenbar von einer Frau herrührend, nun kamen Dokumente mit amtlichen Siegeln, Stempeln und Unterschriften, kein Zweifel, es waren die Zeugnisse einer Heirat, die in einer kleinen italienischen Stadt vollzogen und amtlich beglaubigt war.
Die Hand des Hauptmanns zerknitterte krampfhaft die Papiere; der Schweiß perlte ihm von der Stirn. Also war doch sein Hoffen vergebens gewesen. Mit fieberhafter Hast suchte er nach dem Geburtsschein eines Kindes; er blickte nun auf das Datum des Trauzeugnisses, es war vor Jahresfrist ausgestellt. Vielleicht war doch noch nicht alles verloren.
Jetzt stieß der Verwundete ein leises, schmerzhaftes Stöhnen aus und der Hauptmann, der die Papiere in ihr Behältnis zurückgelegt hatte, trat zu ihm. Der Kranke sah ihn mit großen, weitgeöffneten Augen an.
»Ich bin es, dein treuer Vetter Hans,« sagte der Hauptmann dicht an seinem Ohr.
»Was ist geschehen?« kam die Frage von den bleichen Lippen.
»Du wurdest verletzt, der Zug ist entgleist, du bist der Heimat nahe,« sagte der Hauptmann.
Der Kranke schien sich zu besinnen. »So nahe dem Ziel und so nahe dem Ende,« sagte er mit kaum verständlicher Stimme. »O, es ist hart.«
Der Hauptmann wollte ihm ermutigend zusprechen, aber er wies den Trost zurück.
»Der Tod sitzt in meiner Brust,« murmelte er. »Meine arme Annunziata! Nie werde ich mein Kind sehen! Wo ist mein Vater? Ich will seinen Schutz für Weib und Kind anrufen!«
»In wenigen Stunden können wir ihn herrufen,« sagte der Hauptmann.
»So lange habe ich nicht mehr zu leben,« hauchte der Kranke.
»So vertraue mir, ich werde dich vertreten.«
Der Sterbende rang nach Atem, das Röcheln verstärkte sich, einige Blutstropfen traten auf seine Lippen.
»Erhole dich erst,« ermahnte ihn der andere.
»Keine Zeit – es ist vorbei –« murmelte der bleiche Mund. »Meine Frau bedarf des Beistandes – die Reise war zu viel für sie, sie ist in –«
Der Name erstarb in einem Hauch, aber der Hauptmann hatte ihn doch verstanden und wiederholte ihn laut. Der Sterbende nickte bejahend, ein Blutstrom brach aus seinem Munde, der Todeskampf begann, und bald war alles vorüber.
Der Hauptmann drückte ihm die Augen zu; noch glaubte er den Druck der erkaltenden Hände zu spüren, womit ihm jener für sein Versprechen danken wollte. Wie ihn dieser Dank peinigte! Eine furchtbare Versuchung war an ihn herangetreten und er vermochte ihr nicht zu widerstehen. Wie oft hatte er gegen das Schicksal gemurrt, das all sein Ringen vergebens sein ließ. Was half es ihm, daß er sich schon als Kadett ausgezeichnet, daß er wie ein Löwe auf den französischen Schlachtfeldern gefochten hatte. Warum hatte ihn nicht die tückische Kugel getötet, die seine Lebenskraft für immer schwächte! Umsonst hatte er sich eine neue Existenz zu gründen versucht, und dazu waren zwei Wesen an ihn gefesselt, die kränkelnde Frau und sein junger Sohn, der zu großen Hoffnungen berechtigte.
Wie dankbar war er für die Berufung seines Verwandten gewesen, der ihn zum Verwalter der Wildburg'schen Güter machte und wie hatte er gelitten, als die Rückkehr des Majoratserben seine Stellung gefährdete! Nun kam diese plötzliche Wendung. Karl von Wildburg lag tot vor ihm und er selbst war der Erbe seiner Aussichten – wenn nicht ein kleines, vielleicht noch ungeborenes Kind ihm alles streitig machte. Mußte denn dieses Kind wirklich ein Sohn und Erbe sein? Vielleicht würde es gar nicht leben, und wenn es lebte, dann mochte die Mutter für sein Recht eintreten, er würde es nicht tun, nicht seinen heißgeliebten, hoffnungsvollen Sohn zugunsten eines fremden Kindes berauben!
Es wurde ihm immer mehr zur Gewißheit, daß nur er für seinen Sohn ein Recht an das Erbe der Wildburgs habe, und bei Gott, er wollte es verteidigen und behaupten.
Vielleicht gehörte die Mutter, diese Annunziata Ferrari, die den leicht entflammenden Karl von Wildburg betört hatte, der Hefe des Volks an, vielleicht war sie ein Modell, das er auf der Straße gefunden, weshalb sonst diese geheime Vermählung, die abenteuerliche Heimkehr? Nein, das edle Blut und das alte Wappen der Wildburgs sollte nicht durch den Sprößling einer solchen Verbindung entehrt werden, es war sogar Pflicht, dies zu verhindern, selbst durch eine Handlung, die nicht mit den Ansichten der Moral und des allgemeinen Rechtes zu vereinen war.
So nahm der Hauptmann die Brieftasche nochmals hervor, prüfte sorgfältig ihren Inhalt und behielt alle Papiere, die sich auf die Eheschließung und das junge Weib bezogen, zurück.
Dann trat er hinaus, um den erfolgten Tod zu melden. Die Ärzte waren nicht überrascht. Ihre Arbeit war hier beendet, sie traten mit dem Zuge, der die Verwundeten fortführte, die Rückreise an, mit ihnen auch der Hauptmann von Wildburg, der die Leiche des verstorbenen Majoratsherrn heimgeleitete.
![]()
In einer kleinen schlesischen Stadt stand ein altmodisches Wirtshaus, das überall im besten Rufe stand wegen der Tüchtigkeit und der Freundlichkeit der Frau Rößler, die seit dem Tode ihres Mannes hier als alleinige Herrin waltete. Vor einiger Zeit waren am späten Abend ein Herr und eine Dame, letztere sehr jung und von fremdländischem Aussehen, bei ihr abgestiegen und hatten gleich nach dem Arzte verlangt, denn die junge Frau war sehr leidend.
Dr. Blanden, zu dem geschickt wurde, saß voll tiefer Betrübnis bei seiner Frau in ihrem jetzt so stillen Hause, denn vor wenigen Wochen wurden ihnen drei Kinder, die der Scharlach dahingerafft, begraben und sie fanden noch keinen Trost in ihrem Unglück.
Als der Arzt seine Patientin sah, mit der er sich nur mit Hilfe ihres Mannes verständigen konnte, denn sie selbst sprach nur Italienisch, erklärte er unbedingt Ruhe und Schonung für notwendig.
Das schien dem Herrn, der etwas sehr Vornehmes in seinem Wesen hatte, eine schwere Forderung; er verweilte noch einen Tag und beriet viel und eifrig mit seiner Frau, und endlich kamen sie zu dem Entschlusse, der wohl durch die vertrauenerweckende Art des Doktors und das mütterliche Wesen der Wirtin ihnen eingegeben worden war, daß der Mann die Reise allein fortsetzen und nach einigen Tagen wiederkehren sollte.
Der Wirtin wurde doch etwas bange bei der seltsamen Geschichte und sie dachte sogar zweifelnd, die beiden möchten gar kein Ehepaar sein, aber der Doktor zerstreute ihre Besorgnisse, denn er vertraute den Worten des Fremden, daß ihn verwickelte Familienverhältnisse fortriefen, daß aber bald alles seine Aufklärung finden werde.
So reiste dieser ab, und die junge Frau, die einstweilen Signora Annunziata genannt sein wollte, hatte etwas so Unschuldiges und war zugleich so hilfsbedürftig, daß sie bald das ganze Herz der Wirtin gewann, die für sie sorgte, als sei sie ihre eigene Tochter, auch der Doktor besuchte sie getreulich, denn sie war sehr leidend.
Die Trennung von ihrem Gatten machte die junge Frau wohl sehr traurig, aber in den ersten Tagen war sie doch voll Hoffnung und guten Mutes; als jedoch fast eine Woche vergangen und sie noch immer ohne Nachricht war, wurde sie immer bleicher und verzagter und verbrachte all ihre Zeit am Fenster, um nach dem Briefträger auszuschauen, der doch nie etwas für sie hatte.
Die Wirtin und der Doktor trösteten sie, so gut sie vermochten, obwohl ihnen selbst recht bange war; die Signora war nicht zu bewegen, sich über ihre Verhältnisse auszusprechen, außerdem bildete ihre gänzliche Unkenntnis des Deutschen ein großes Hindernis.
Eines Tages brachte der Briefträger ein Schreiben von dem ältesten Sohn der Frau Rößler, der bei den Soldaten stand und schwenkte vergnügt den Brief in der Hand, um es ihr zu melden. Das sah die Fremde von ihrem Fenster aus und bezog es auf sich; sie wollte in ihrer Freude ihm entgegeneilen, trat fehl, und als sie zu Boden fiel, schlug ihr Kopf gegen die Kante des Tisches.
Frau Rößler war gleich zur Stelle, brachte die Bewußtlose zu Bett und schickte zu Dr. Blanden, der sie schon in äußerster Lebensgefahr fand. Sie gab einem Kinde das Leben, dessen erster Schrei sich mit dem letzten Seufzer seiner Mutter vereinte, der suchende Blick der erlöschenden Augen habe noch dem fernen Gatten gegolten, meinte die weinende Wirtin.
Nun galt es zunächst, diesen aufzufinden, aber es gab nur wenig, was als Fingerzeig dienen konnte. Der Trauring, den man der Toten vom Finger zog, enthielt ein Datum aus dem vergangenen Jahre, also den Hochzeitstag, eine sehr ähnliche Photographie des Mannes und ein goldenes Medaillon, das eine Locke von blondem Haar umschloß und auf dem Deckel ein adeliges Wappen trug. Gepäck hatte die Fremde nicht viel bei sich gehabt, nur etwas Wäsche und einen zweiten Anzug nebst den unentbehrlichsten Gerätschaften. Papier und Briefschaften fanden sich nicht vor, nur eine Geldsumme, die zur Bestreitung der Kosten für Aufenthalt und Begräbnis hinreichte.
Den Behörden wurde der Vorfall angezeigt und sie erließen einen Aufruf, der aber ohne Erfolg blieb. Für das Kind sorgte vorläufig die gute Frau Rößler, die auch der Toten noch alle Liebe erwies, wie sie es der Lebenden getan und die sie in ihrem weißen Sterbekleide unter Blumen in den Sarg bettete.
Ehe dieser geschlossen wurde, wollte der Doktor noch einmal hin, um Abschied von dem anmutigen Rätsel zu nehmen, das ihn so tief ergriffen hatte. Da sagte seine Frau, die sonst teilnahmslos und ganz in ihren Schmerz versunken dazusitzen pflegte, plötzlich zu ihm: »Ich möchte dich begleiten.«
Er fürchtete die Aufregung für sie, weil sie aber auf ihrem Willen bestand, gab er ihrem Verlangen nach und nahm sie mit sich. Tief ergriffen stand sie regungslos am Sarge des jungen Weibes, dabei doch nur ihrer Kinder gedenkend, die sie auch so still und so bleich vor sich gesehen hatte. Da fing das mutterlose Kleine in der Wiege zu weinen an, und sogleich wandte sich die Frau zu ihm, während die Wirtin sagte:
»Das arme Kind! Ich werde es doch dem Waisenhause übergeben müssen, noch vermochte ich es nicht, aber ich bin nicht imstande, bei meinen vielen Geschäften ordentlich für das Würmchen zu sorgen.«
Als die Frau Doktor das hörte, wandte sie sich zu ihrem Manne und bat: »Laß mir das Kind, Georg, es soll mein sein.«
Er nickte ihr Gewährung, sprechen konnte er nicht vor Rührung, denn er sah wieder ein mattes Lächeln um ihren schmerzverzogenen Mund und ihre Augen hatten den starren Blick verloren, der ihn für ihren Verstand fürchten ließ.
Nun kehrte die Frau zu der Toten zurück, das Kind im Arm. Sie beugte sich über sie und flüsterte ihr unter Tränen zu: »Grüße mir meine Kinder dort oben, das deine hat wieder eine Mutter gefunden.«
Die einzige Sorge der Frau Doktor war, daß der Vater sich melden und sein Kind verlangen werde. Aber aus den Wochen wurden Monate und Jahre, und keine Nachfrage fand statt. Der kleine Karl, wie man den Knaben getauft hatte, wuchs und gedieh und wurde die Freude und der Stolz seiner Pflegeeltern. Allmählich vergaß man im Städtchen die Geschichte seiner Geburt und kannte ihn nur als Doktors Karl; selbst Frau Rößler, mit der er sehr befreundet war, sprach nie von der Vergangenheit. Oft begleitete Karl die Pflegemutter auf den Kirchhof zu den Geschwistern, und dann besuchten sie stets einen Hügel und schmückten ihn mit Blumen, unter dem eine engelsgute Frau, die er lieb haben müsse, wie die Mutter sagte, den letzten Schlaf schlief.
![]()
Den Freiherrn von Wildburg hatte der Tod seines einzigen Sohnes sehr erschüttert, aber mit der Selbstsucht des gebrechlichen Alters gab er sich dem Schmerze nicht zu sehr hin. Zwischen Vater und Sohn hatte nie große Sympathie bestanden und mit den Jahren war die Entfremdung gewachsen, wozu die künstlerischen Neigungen des jungen Mannes wesentlich beitrugen. Nun war er lange auf Reisen gewesen und in dieser Zeit hatte sich der alternde Majoratsherr ganz an seinen Verwandten, den Hauptmann von Wildburg, gewöhnt, der ihm jede Anstrengung und Last abnahm.
Die Gruft hatte den wappengeschmückten Sarg aufgenommen, der Freiherr aber lebte und wollte noch lange leben: da nichts so sehr der Gesundheit schadet, als Gram und Kummer, so suchte er beides sich fern zu halten. Erloschen war ja sein Geschlecht noch nicht; erschien ihm der Hauptmann als nächster berechtigter Erbe in unbehaglichem Licht, so wurde ihm dessen Sohn desto lieber und er betrachtete ihn fast wie seinen leibhaften Enkel. Er verzog den munteren, aufgeweckten Knaben grenzenlos und erfüllte ihm jeden Wunsch, indem er sagte: »Für den Erben von Wildburg ist nichts gut genug.«
Der Hauptmann ließ den alten Herrn gewähren, wie er ihm überhaupt eine fast seltsame Fügsamkeit bewies, wie er sie früher nicht gekannt hatte. Er war sehr verändert seit dem unglücklichen Familienereignis, ging gebückt einher, sein Haar ergraute und er alterte zusehends. Bei Tage suchte er sich durch fieberhafte Tätigkeit zu betäuben, des Nachts quälten ihn die auf ihn einstürmenden Gedanken um so mehr, oder sie gestalteten sich zu furchtbaren Träumen. Oft riegelte er sich ein und nahm aus einem Geheimfache seines Schreibtisches jene Papiere heraus, die der Fluch seines Lebens geworden waren und die er doch nicht zu vernichten wagte. Solange sie existierten, konnte er sein Unrecht gegen jenes ungeborene, schattenhafte Kind wieder gut machen, und doch wußte er, daß er dies nie tun würde. Noch hoffte er, daß es gar nicht ins Leben getreten sei, bis er jenen Aufruf in den Zeitungen fand, der seine schlimmsten Befürchtungen zur Gewißheit machte.
Von nun an war er ganz gebrochen, stets quälte ihn die Angst, daß ein unberechenbarer Zufall die Entdeckung herbeiführen könnte und er verlor Seelenruhe und Gesundheit darüber. Aber mochte es sein! Für sich selbst begehrte er nichts mehr, er wollte auf das Erbe verzichten, wenn nur sein Sohn in den Besitz gelangte, der so teuer von ihm erkauft war.
Frau von Wildburg bemühte sich vergebens, ihren Gatten zu erheitern oder die Ursache seines Kummers zu ergründen; sie war von jeher sehr zart gewesen, jetzt wurde sie täglich mehr leidend und verfiel fast in Trübsinn. Da kam der Hauptmann auf den Gedanken, eine Gesellschafterin für sie zu nehmen, die sie zerstreuen und sich zugleich dem alten Herrn widmen sollte, damit er nicht mehr so große Ansprüche an die kränkelnde Frau stelle.
Eine Menge von Bewerbungen liefen um die ausgeschriebene Stelle ein, darunter auch die eines Fräuleins, das sich in Person vorstellte. »Emilie von Weber« stand auf ihrer Karte und Frau von Wildburg empfand aufrichtiges Mitleid mit ihr, als sie die kleine, unscheinbare Gestalt mit den früh gealterten unschönen Zügen in so demütiger Haltung und in so unansehnlicher Kleidung im Salon empfing.
Sie hielt das arme Mädchen für ganz ungeeignet für den Posten und sagte ihr in bedauerndem Tone, daß die Stelle schon besetzt sei.
»Wieder eine gescheiterte Hoffnung,« lautete die traurige Antwort. »Ich dachte es wohl, überall ist mir mein unvorteilhaftes Äußere hinderlich.«
Frau von Wildburg tat sie innig leid und so bat sie die Fremde freundlich, sich erst etwas auszuruhen und einen Imbiß auf dem Schlosse einzunehmen. Diese faßte ein Herz zu der gütigen Dame und erzählte derselben ihre Geschichte, eine alltägliche und doch so trübe. Sie war arm, verwaist und auf den Erwerb angewiesen; aber sie hatte nichts Rechtes gelernt und ihre Erscheinung nahm nicht für sie ein. So befand sie sich nach manchem Fehlschlag im Kampf mit der bittersten Not.
Frau von Wildburg forderte sie mitleidsvoll auf, zum Mittagessen zu bleiben und stellte sie ihrem Mann vor, der ihr leise zuraunte: »Aber ich bitte dich, wo hast du diese Jammergestalt her?«
Bald gefiel sie ihm besser, denn sie hatte vernünftige Ansichten und besaß ein sehr angenehmes, einschmeichelndes Organ; auch Albrecht schloß Freundschaft mit ihr und brachte sie nach Tische zum Großpapa. Der alte Herr wurde gleichfalls gewonnen, sie spielte unermüdlich Dame und Domino mit ihm, las ihm die Zeitung zur Befriedigung vor und verstand es, eine Pfeife zu stopfen, wie er es liebte.
So erhob sich allgemeines Bedauern, als das Fräulein nun fort wollte, sie wurde für einige Tage eingeladen und nach deren Verlauf als Gesellschafterin angestellt. Als solche machte sie es allen Familiengliedern recht, bis auf den Hauptmann, der eine geheime Abneigung gegen sie nicht unterdrücken konnte; sie empfand dasselbe für ihn, ohne es sich je merken zu lassen.
Nach einigen Monaten dachte er noch ungünstiger über die Gesellschafterin; sie erschien ihm als eine Störung des Familienlebens, sollte beseitigt werden und erhielt ihre Kündigung, trotzdem sie Frau von Wildburg mitleidig in Schutz nahm. Demütig wie stets empfing sie ihr Urteil, aber einige Tage darauf trat sie am Arm des alten Freiherrn ins Zimmer und dieser stellte sie als seine liebe Braut vor.
Sie warf sich Frau von Wildburg an die Brust, dankte ihr für alle Güte und sprach die Hoffnung aus, sie würden sich nun noch näher treten und stets eng verbunden bleiben. Frau von Wildburg blieb verstört und konnte ihren Schrecken nicht verbergen, während sich der Hauptmann schnell faßte und in tadelloser Form seine Glückwünsche abstattete.
»Das ist der Anfang des Endes,« klagte Frau von Wildburg, als sie mit ihrem Manne wieder allein war.
»So leicht soll es ihr nicht werden,« murmelte er mit zusammengebissenen Zähnen. »Wir haben der Schlange selbst den Eingang verschafft, aber Albrecht ist der Erbe von Wildburg, und das schiebt ihren Plänen den Riegel vor.«
Der Brautstand währte nur kurze Zeit, Fräulein von Weber blieb gleich demütig, aber ihr Bestreben war stets, ihrem teuern Erwin den Willen zu tun, und dieser wollte immer nur, was ihr paßte. Nach der Trauung, die ganz in der Stille stattfand, reisten die Neuvermählten nach Italien und blieben fast ein Jahr fort, währenddessen der Hauptmann unumschränkter denn je herrschte. Nur durch die bedeutenden Summen, die er nachzusenden hatte, wurde er an die veränderte Lage erinnert.
Doch eines Tages lief ein Brief ein, bei dessen Durchsicht sich seine Züge mit fahler Blässe bedeckten, denn das Schreiben meldete die Rückkehr des Ehepaars, das in Bälde einem glücklichen Ereignisse entgegensah. Sie trafen ein: aus der unscheinbaren, demütigen Gesellschafterin war eine anspruchsvolle vornehme Frau geworden, aus dem Freiherrn ein schwacher, hinfälliger Greis, der von seiner Gattin treu umsorgt wurde und gänzlich ihrem Willen unterworfen war.
Trotz der düsteren Ahnungen, von denen die Freifrau laut sprach, während sie im geheimen die stolzesten Hoffnungen hegte, ging alles gut und sie gab einem Sohne das Leben, dessen Geburt überall auf den Wildburg'schen Besitzungen durch Glockenläuten und festliche Veranstaltungen gefeiert wurde, er war ja der ersehnte Erbe.
Den Hauptmann trieb es ruhelos umher, Haß, Grimm, Rachegedanken erfüllten ihn. Oft nahm er die Papiere heraus in dem Entschluß, durch sie den wahren Erben in seine Rechte einzusetzen. Hatte Albrecht doch alles verloren, so sollte wenigstens der Sohn dieser verhaßten ränkeschmiedenden Frau hier nicht als Herr regieren. Aber damit gab er auch seinen fleckenlosen Namen preis, das einzige, was er seinem Sohne hinterlassen konnte, und so mußte er schweigen und alles geschehen lassen.
Die Freifrau erholte sich bald, die Mutterschaft hatte sie verjüngt, sie war stärker geworden und sah blühend und wohl aus; dazu verstand sie die Kunst der Toilette und ihr ganzes Auftreten zeugte von Sicherheit und Selbstbewußtsein.
Dem Hauptmann wurde bald klar, daß seine Macht in Wildburg zu Ende ging. Die Freifrau beherrschte nicht nur ihren Gatten unumschränkt, sie wollte auch regieren und gebieten, wollte niemand neben sich dulden.
Es fand ein glänzendes Tauffest statt, und schon am nächsten Morgen führte sie den völligen Bruch mit dem Hauptmann herbei. Er verließ mit den Seinen das Schloß, indem er stolz jede Unterstützung für sich ablehnte, aber für seinen Sohn gewann er es über sich, die Rente anzunehmen, welche der alte Freiherr diesem bis zu seiner Selbständigkeit aussetzte.
Bald darauf starb dieser, und in seinem Testament fand sich diese Bestimmung vor, während des Hauptmanns mit keiner Silbe gedacht war.
Letzterer war zu einem sehr beschränkten Leben verurteilt; dazu begann seine Frau zu kränkeln und starb einige Jahre nach der Geburt einer Tochter. So erwuchs Lilly von Wildburg in trüben Verhältnissen und mußte schon früh die Pflege des leidenden Vaters übernehmen. Sie lernte nie die Sorglosigkeit der Kindheit kennen, aber ihr Charakter erstarkte unter der Bürde, die sie zu tragen hatte, und sie verlor ihre Heiterkeit und ihren frischen Mut nicht, sondern freute sich an jeder Blume, die sich auf ihrem Wege fand.
![]()
In einem eleganten Hause in einer der vornehmsten Straßen Berlins zeigte der strahlende Lichtglanz an, daß ein Fest gefeiert wurde; die Equipagen und das wenige, was beim Aussteigen von den Toiletten der Damen und den glänzenden Uniformen oder den mit Orden geschmückten Anzügen der Herren sowie von der Pracht des Treppenhauses sichtbar wurde, hatte viele Zuschauer herbeigelockt, die durch die feurigen, mit Mühe lenkbaren Pferde eines Coupés gefährdet wurden, dem ein junger Offizier entstieg.
Am Portal traf er mit einem andern Herrn zusammen, der sich noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte, und begrüßte ihn herzlich.
»Ach, du bist es, Albrecht, aber wie kannst du dich nur zu Fuße in dieses Gewühl wagen,« rief er halb verlegen, halb vorwurfsvoll aus.
»Bei schönem Wetter vermeide ich gern eine Droschke, und nicht alle Kutscher sind so rücksichtslos gegen das zu Fuße gehende Proletariat,« entgegnete Albrecht bitter.
»Wie scharf du wieder bist,« sagte Erwin, der junge Majoratsherr von Wildburg. »Hättest du mir eine Karte geschrieben, so würde ich dich mit Vergnügen abgeholt haben. Ich möchte dich so wie so um einen Dienst bitten, doch davon später.«
An der Tür trat Albrecht zurück, um seinen Vetter den Vortritt zu lassen, der ihn ohne Umstände vor sich herschob, obwohl Albrecht behauptete, er müsse die Ehre als Haupt der Familie haben.
In der Garderobe fanden sie zufällig keine Gäste und den Diener schickte Erwin hinaus.
»Ich muß dir etwas anvertrauen, Albrecht,« sagte er hastig. »Ich bin so gut wie verlobt und du sollst der erste sein, der es erfährt.«
Albrechts schönes, regelmäßiges Gesicht wurde sehr blaß. Endlich sagte er mit erzwungener Ruhe: »Da gratuliere ich dir.«
»Und nach dem Namen meiner Braut fragst du gar nicht? Aber du ahnst ihn wohl. Ich habe ihr lange genug den Hof gemacht, und Melanie von Dettelsbach wird eine reizende Schloßfrau werden.«
»So hast du um sie angehalten?« fragte Albrecht, den Arm seines Vetters umklammernd.
Dieser suchte sich frei zu machen, indem er lachend sagte: »Du hast wahrhaftig den Griff eines Tigers. Ihr Jawort habe ich übrigens noch nicht, aber es ist nicht daran zu zweifeln. Mit meinem Junggesellenleben will ich nun ein Ende machen. Ich habe es ja toll getrieben, aber das soll die besten Ehemänner geben. Nur die kleine Fanny macht mir noch Sorgen. Sie ist ein allerliebstes Käferchen, aber auch eine wahre Furie. Natürlich werde ich mich anständig mit ihr abfinden, und da wollte ich eben deine Vermittlung in Anspruch nehmen. Du bist so kaltblütig und so klug, und ich kann hübschen Mädchen so gar nicht widerstehen. Du tust mir den Gefallen, nicht wahr?
Arm in Arm betraten die Vettern die Festräume. Der Majoratserbe war kaum mittelgroß und zeigte schon jetzt Neigung zum Starkwerden; seine unbedeutenden Züge strahlten vor Heiterkeit, der Mund hatte etwas sehr Kindliches, in seinem ganzen Wesen sprach sich eine gewisse Unentschlossenheit aus, daneben aber auch das Bewußtsein seiner bevorzugten Stellung. Auf den Wunsch seiner vor zwei Jahren verstorbenen Mutter war er in das Heer eingetreten, aber der Dienst war ihm lästig und er dachte daran, seinen Abschied zu nehmen.
Albrecht von Wildburg hatte das zweiunddreißigste Jahr überschritten und der Ernst und die Gemessenheit seines Auftretens ließen ihn älter erscheinen. Die dunkeln Augen blickten ernst und durchdringend, in Momenten der Erregung flammte es in ihnen auf, wie von leidenschaftlicher Glut, die hohe, freie Stirn, die edel geschnittene Nase, der energische Mund vereinten sich, ihn zu einer interessanten Erscheinung zu machen, er war hoch und schlank gewachsen, die tiefe Blässe seines Gesichts wurde durch das dunkle Haar noch mehr hervorgehoben, seine Hände waren von tadelloser Schönheit. Er hatte sich der diplomatischen Laufbahn gewidmet und man prophezeite ihm ein glänzendes Los. Auch als Gesellschafter war er gern gesehen; er bewegte sich in den ersten Kreisen, war von äußerster Einfachheit, aber musterhafter Eleganz in seinem Auftreten, unterließ nie eine Ausgabe, die der Anstand erforderte und wußte doch damit eine strenge, sich auf alle Einzelheiten des Lebens erstreckende Sparsamkeit zu verbinden.
Nachdem die beiden Vettern der Herrin des Hauses ihre Huldigung dargebracht hatten, suchten ihre Blicke Melanie von Dettelsbach. Sie war von einem Schwarm von Verehrern umringt wie stets, denn wo sie sich zeigte, galt sie als die Königin der Gesellschaft. Sie war von strahlender Schönheit; oft hatte man sie mit der Königin Marie Antoinette verglichen, nur fand man sie schöner, ihre Züge regelmäßiger, ohne einige störende Eigentümlichkeiten der unglücklichen Fürstin. Das Auge des Arztes hätte vielleicht Anlaß zur Besorgnis gefunden, dem Laien erhöhten der strahlende Glanz der Augen, der jähe Wechsel der Farben, das bläuliche Weiß der Perlenzähne nur ihren Reiz.
Sie war eine leidenschaftliche und sehr begehrte Tänzerin und Erwin von Wildburg wurde allgemein beneidet, als er sie zur Polonaise davonführen durfte. Er blieb ihr bevorzugter Tänzer, die bevorstehende Verlobung bildete den geheimen Gesprächsstoff im Ballsaal. Melanies Schönheit und die Bewunderung, welche diese erregte, mußte auch von ihren Neiderinnen anerkannt werden; zugleich rechneten sie ihr aber nach, daß dies schon die vierte Saison sei, die sie sich als Ballkönigin behauptete, und so prophezeiten sie ihr, sie werde am Ende doch sitzen bleiben und alte Jungfer werden.
»Ja, der Majoratsherr von Wildburg kann es sich schon leisten, eine so schöne und so kostspielige Frau zu nehmen,« flüsterte die Gräfin Rosen ihrer Nachbarin hinter dem Fächer zu. »Die Verhältnisse bei Dettelsbach sollen furchtbar sein. Schulden, nichts als Schulden! Es ist ein Wunder, wie sie sich behaupten können. Und nun diese Toilette! Ich möchte sie nicht bezahlen!«
»Wird auch wohl nicht bezahlt werden,« spottete die Baronin Sellheim, »oder schließlich müssen wir es bezahlen, denn für das, was Schneider und Modistin bei solchen Kunden verlieren, kreiden sie uns doppelt und dreifach an. So ist der Lauf der Welt, meine Liebe!«
Die beiden Damen seufzten tief und die Gräfin fuhr fort: »Es ist klar, daß Melanie diesen kleinen Leutnant nur seiner Stellung wegen nimmt; sie hat ja ein Verhältnis mit seinem Vetter. Sehen Sie nur, sie läßt sich von dem Assessor von Wildburg in den Wintergarten führen, wo es an lauschigen Plätzchen nicht fehlt. Daß ihre Mutter, die Geheimrätin, das duldet!«
»Was wollen Sie, liebste Gräfin, die arme Frau kann sich ja kaum aufrecht halten,« meinte die Baronin. »Die beständigen häuslichen Stürme haben ihre Kraft erschöpft, sie soll irgend ein Leiden haben.«
Melanie ließ sich von ihrem Tanzherrn, dem Assessor von Wildburg, fortführen. Er hatte sie geflissentlich den ganzen Abend gemieden, aber sie winkte ihn zu sich heran und zeigte ihm auf ihrer Karte den Tanz, den sie ihm aufgehoben hatte. Schweigend gehorchte er ihr und aller Augen folgten dem schönen Paar, als es durch den Saal schritt.
»Sie werden sich erkälten,« sagte er zu ihr, als sie jetzt schwer atmend auf eine Bank sank, die von einer Palmengruppe beschirmt wurde.
»Was liegt daran, mir ist das Leben eine Qual!« rief sie aus.
»Spricht so eine glückliche Braut?« fragte er mit Hohn.
Sie sprang auf. »Albrecht, nicht diesen Ton! Ich bin tief unglücklich. Laß mich dir alles erklären und du wirst mir verzeihen. Wenn du mich je liebtest, so gewähre mir noch eine letzte Unterredung zur gewöhnlichen Stunde bei Frau Brandt.«
»Ich werde dort sein,« sagte Albrecht von Wildburg, und dann traten sie wieder hinaus in den Ballsaal und Melanies Augen glänzten und ihre Lippen lächelten.
Der Assessor verließ das Fest, sein glücklicher Rivale aber erhielt noch an diesem Abende Melanies Jawort; am nächsten Vormittag wollte er förmlich um sie anhalten bei Seiner Exzellenz, dem Geheimrat von Dettelsbach.
Dieser mahnte jetzt zum Aufbruch; seine Gemahlin vermochte sich nicht länger aufrecht zu erhalten; kaum war sie zu Hause angelangt, als einer jener furchtbaren Anfälle eintrat, gegen die sie so herrisch kämpfte und die sie immer dem Tode nahe brachten.
![]()
In derselben Nacht saß Lilly von Wildburg in ihrem Wohnzimmer, eifrig an einer feinen Stickerei arbeitend, die sie für ein Geschäft anfertigte. Sie sah müde und angegriffen aus, denn obwohl sie erst achtzehn Jahre zählte, hatte sie den Ernst des Lebens vollauf kennen gelernt; aber es lag ein großer Reiz über ihrer anmutigen Erscheinung, und selbst die große Einfachheit ihres Anzugs tat ihrem schlanken, biegsamen Wuchse und ihren lieblichen Zügen keinen Abbruch.
Während ihre Nadel unermüdlich tätig war, weilten ihre Gedanken bei dem Bruder, den sie so zärtlich liebte und den sie hoch über alle andern Menschen stellte. Sie freute sich schon auf seine Berichte von dem Fest, auf dem er jetzt weilte; diese Erzählungen waren ja das einzige, was aus einer Welt zu ihr drang, die sie sich so schön und glänzend vorstellte.
Der Vater warf sich unruhig auf seinem Lager umher; sie trat zu ihm in das anstoßende Gemach und legte beschwichtigend ihre kleine Hand auf seine Stirn; er starrte sie mit hohlen Augen an und sagte:
»Ich habe dir doch befohlen, Türen und Fenster zu schließen und doch ist das Kind hier? Ich höre sein Wimmern.«
Lilly versuchte vergebens, den Kranken zu beruhigen, sie mußte nun alles erforschen nach den Schreckbildern, die ihn quälten und bei denen ein kleines Kind und einstige Papiere eine große Rolle spielten. Sie kannte diese Erregung, der dann die äußerste Erschöpfung, die an Lähmung grenzte, zu folgen pflegte.
Heute trat der Anfall stärker als je auf; der Kranke war kaum im Bett zu halten. Eine furchtbare Angst sprach aus den verfallenen Zügen, der Blick wurde stierer, die Wahngebilde hatten ihn ganz in ihrer Gewalt, alle Mittel blieben erfolglos.
Lilly weckte das Mädchen und schickte es nach dem Arzte; aber dieser war bei andern Kranken und ebensowenig war ein zweiter anzutreffen, der schon manchmal Beistand geleistet hatte.
»So holen Sie den ersten besten Arzt,« gebot Lilly, und das Mädchen erinnerte sich, daß gestern ganz in der Nähe das Schild eines neuen Arztes angeschlagen worden sei.
Der Hauptmann fing jetzt laut zu jammern an, seine Brust sei eingedrückt, er könne nicht mit all den Toten zusammen sein, die ihm in der starren Hand Brieftaschen entgegenstreckten.
»Ich ertrage es nicht, ich will die Papiere ausliefern,« rief er. »Aber ich kann ja nicht, sie verfolgen mich, ich will mich retten. Ein Sprung aus dem Fenster macht aller Qual ein Ende.«
Lilly rang mit ihm, sie konnte ihn kaum im Bette halten. In diesem schrecklichen Augenblick trat der Arzt ein.
»Erlauben Sie, mein Fräulein, daß ich an Ihre Stelle trete,« sagte er, und schon stand er vor dem Kranken und suchte ihn zu beruhigen. Seine leise, tiefe Stimme, der kräftige und doch sanfte Druck seiner Hand übten eine wohltätige Wirkung aus, die Erregung legte sich und der Patient atmete ruhiger, während der Arzt am Bette Platz behielt und ein Rezept verschrieb, mit dem das Mädchen zur Apotheke geschickt wurde.
Lilly hatte ruhig und geschickt alle Hilfsleistungen verrichtet; erst jetzt überfiel sie ein heftiges Zittern und es wurde ihr klar, wie schrecklich das Erlebte gewesen.
Der Arzt, der sich als Dr. Blanden vorgestellt hatte, blickte teilnehmend auf sie und sagte: »Sie bedürfen der Ruhe und Schonung, mein Fräulein. Ich verlasse den Kranken noch nicht, ehe ich die Wirkung meiner Verordnungen erkannt habe. Legen Sie sich etwas nieder, Sie sind hier jetzt nicht nötig.«
Seine freundliche Art tat Lilly wohl, die so wenig daran gewöhnt war, daß jemand für sie sorgte. Sie gehorchte ihm und legte sich im Nebenzimmer auf das Sofa. Von dort aus konnte sie die von einer Nachtlampe matt erleuchtete Krankenstube überblicken und auch den Arzt betrachten, der sich über seinen Patienten beugte. Er mochte ungefähr dreißig Jahre zählen; der Ernst seines Berufs vereinte sich mit einem milden Wohlwollen in seinem Antlitz; die scharfen und doch so gütigen Augen, die hohe Stirn des Denkers, das gewinnende Lächeln, das seinen Mund umspielte, mußten für ihn einnehmen und noch mehr tat dies der tiefe, volle Klang seines Organs.
Allmählich verschwand alles um sie her in einem Nebel und die Müdigkeit überwältigte sie: trotzdem fühlte sie, daß sie fror. Einmal erwachte sie dann, ohne zum klaren Bewußtsein zu gelangen; eine Decke wurde über sie gebreitet, ein Kissen unter ihren Kopf geschoben und sie vernahm die leisen Worte: »Armes Kind, arme Kleine!«
Als sie erwachte, kämpfte der Lampenschein mit dem Schimmer des anbrechenden Tages; erschrocken sprang sie auf, was mußte der fremde Arzt von ihr denken? Schnell ordnete sie ihren Anzug, strich das Haar glatt und trat zu ihm.
Er streckte ihr wie ein guter Freund die Hand entgegen und freute sich, daß sie geruht hatte, auch dem Patienten gehe es besser.
»Ja, ich habe geschlafen und Sie wachten an meiner Stelle,« stammelte Lilly.
»Es ist gerne geschehen, und für einen Arzt ist das Opfer einiger Nachtstunden nicht zu groß,« entgegnete er.
Der Hauptmann öffnete jetzt die Augen und schien sich mit Mühe zu besinnen; mit Anstrengung streckte er die Hand aus, die ihm kaum gehorchte, und sagte: »Sie kommen doch wieder?«
»Wenn Sie gestatten, erkundige ich mich noch einmal nach Ihrem Befinden, Herr Hauptmann. Nun wird Sie Ihr Arzt weiter behandeln.«
»Nein, nein, ich will keinen andern Doktor, Sie haben mir gut getan,« rief der Kranke aus.
Dr. Blanden gab eine ausweichende Antwort und empfahl sich. Lilly schickte nun zu ihrem Bruder, der sofort erschien und der einen sehr ernsten Eindruck von dem stattgehabten Anfall empfing. Da der Hauptmann darauf bestand, den jungen Arzt zu behalten, so hielt es sein Sohn für das beste, diesem Verlangen nachzugeben, er sprach mit Dr. Blanden, und so wurde dieser Hausarzt bei Hauptmann von Wildburg.
Seinem Patienten suchte der junge Doktor Mut und Vertrauen einzuflößen, zu dem Assessor sprach er offen aus, daß er an ein sehr schweres, unaufhaltsam fortschreitendes Nervenleiden glaube, dem ein psychisches Motiv zugrunde liege. Könnten wir ihm mehr Seelenruhe verschaffen, so würde eher an Besserung, wenn auch nicht an Genesung zu denken sein,« schloß er.
»Mein armer Vater hat viel Schweres erlebt und ist tief verbittert,« entgegnete der Assessor. »Doch das ist Menschenlos, die meisten Sterblichen haben ein verfehltes Leben zu beklagen.«
Lilly hatte die ausgestandene Angst völlig überwunden, es lag sogar ein rosiger Schimmer auf ihren meist bleichen Wangen und ihre Augen blickten froh und vertrauend, sie fühlte sich so geborgen, nun der neue Arzt ihr in der Pflege des Vaters zur Seite stand.
![]()
Melanie von Dettelsbach stieg die vier Treppen zur Wohnung der Frau Brandt hinauf, ihrer einstigen Kinderfrau, die ihr sehr ergeben war. Diese war erschrocken über ihr müdes, bleiches Aussehen und machte daraus kein Hehl.
»Meine Mutter ist schwer erkrankt und ich habe die ganze Nacht kein Auge geschlossen,« gab Melanie die Erklärung. »Für den Augenblick ist zwar keine Lebensgefahr, aber der Arzt befürchtet eine langwierige Krankheit.«
»Ach Gott, wir haben alle unsere Sorgen, der eine um die Eltern, der andere um die Kinder,« sagte Frau Brandt mit einem Seufzer.
»Wieder schlechte Nachrichten von Ihrem Sohne, Frau Brandt?« fragte Melanie.
»Danke für die Nachfrage, gnädiges Fräulein. Um Geld schreibt er ja wieder, mein Paul, davon kann er nie genug kriegen, aber sonst scheint er sich zu machen. Er hat eine gute Stelle in einem Hotel auf Stubbenkammer, so etwas wie Buchhalter, und der Wirt ist zufrieden mit ihm. Wenn er nur aushält! Er ist nun schon so viel in der Welt herumgekommen, aber nirgends findet er Ruhe!«
Melanie hörte der alten Frau zerstreut zu, sie wartete klopfenden Herzens auf Albrecht. Bald darauf trat dieser ein und sie warf sich in leidenschaftlicher Glut an seine Brust. Er preßte sie an sich und küßte sie heiß und oft, dann besann er sich und machte sich aus ihren Armen los.
»Meine Verlobung mit Erwin von Wildburg wird noch nicht stattfinden,« sagte sie leise.
Er stieß einen Freudenschrei aus. »Dann bist du doch mein, Geliebte, und willst geduldig warten und mutig ertragen, wie es unser beschiedenes Los sein wird.«
Melanie schüttelte traurig den Kopf und streifte den Handschuh ab, um den prachtvollen Solitär, der an ihrem Finger blitzte, zu zeigen.
»Ich gehöre ihm an und trage seinen Ring,« sagte sie. »Nur soll die Verlobung nicht veröffentlicht werden, weil meine Mutter todkrank ist. Diese Zusammenkunft muß unsere letzte sein.«
»Warum findet sie überhaupt unter diesen Umständen statt?« fragte er bitter. »Es war dein Wunsch. Doch nun leben Sie wohl, mein gnädiges Fräulein.«
Er wollte sich zum Gehen wenden, aber sie hielt ihn zurück und beschwor ihn, zu bleiben.
»Ich habe dich unendlich geliebt, Albrecht, und ich muß mich vor dir rechtfertigen,« sagte sie. »Höre mich an, ob du mich dann noch verurteilst.«
Und nun sprach sie ihm von dem Elend ihres scheinbar so glänzenden Lebens, von diesen täglichen Kämpfen mit ungeduldig drohenden Gläubigern, von der Not, die beständig vor der Türe stand, von der Schande, die fortwährend drohte. Auch ihre Eltern hatten sich aus Liebe geheiratet, hatten auf keine Warnung geachtet und ihren Hausstand in Mittellosigkeit begonnen. Die Stellung des Vaters hatte stets Repräsentation nach außen verlangt, nach innen sei alles morsch und hohl gewesen. Unter solchem Elend sei die Liebe gestorben, Bitterkeit und Vorwürfe an ihre Stelle getreten, und die Mutter gehe daran zugrunde. Sie selbst sei für den reichen Freier erzogen worden, auf den sie so lange vergebens gewartet. Als dann Albrecht in ihr Dasein getreten, habe sie alle Lehren der Weltklugheit vergessen und nur auf ihr Herz gehört.
»Aber ich bin zur Besinnung gekommen, mein Geliebter. Weil du mir teurer bist, als alles in der Welt, will ich dich nicht an mein trauriges Los fesseln,« sagte sie. »Du sollst nicht mit gelähmten Flügeln auf deine stolzen Hoffnungen verzichten. Mir wird es ein Trost sein, daß für meine Eltern die Sorge endlich aufhört. Nun laß uns scheiden. Zürne mir nicht und vergib mir.«
So gingen sie auseinander, ohne Groll und in tiefem Schmerz. Beide sahen sie ein, daß die Armut ihre Liebe zu einer Quelle des Unglücks machen würde, und sie fügten sich. Albrecht gelobte sich, von nun an nur seinem Ehrgeiz zu leben. Er wußte, wie reiche Geistesgaben er besaß, wie viel seine Vorgesetzten von ihm erwarteten und er wollte ihre kühnsten Hoffnungen übertreffen.
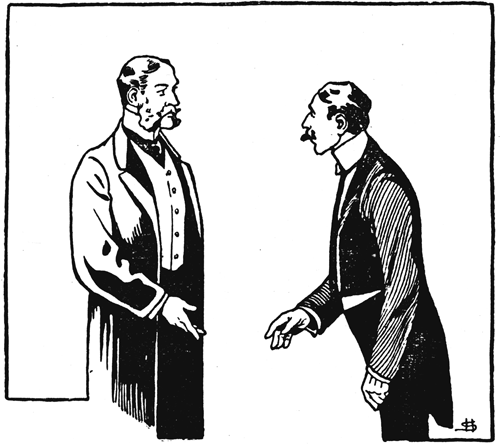
Zwei Tage darauf wurde er zum Minister beschieden und sehr huldvoll empfangen. Ein Posten bei der französischen Gesandtschaft war für ihn bestimmt.
»Es ist eine hohe Auszeichnung,« sagte Seine Exzellenz, »und doch ist es nur die erste Staffel auf der Leiter. Ich habe Großes mit Ihnen vor, lieber Wildburg, und werde Sie stets im Auge behalten. Betrachten Sie diese Anstellung nur als einen Übergangsposten. Nur eins, eine etwas peinliche Frage, lieber Wildburg. Ihre Laufbahn verlangt Repräsentation, Sie bedürfen großer Mittel. Daß Ihnen das Majorat entgangen ist, weiß ich ja, doch Ihr Verwandter hat hoffentlich außerdem für Sie gesorgt?«
»Das ist nicht der Fall, Exzellenz, eine Rente, die mir ein bescheidenes Auskommen ermöglichte, hörte mit meiner Selbständigkeit auf.«
»Nun, dann wird es Ihnen ein leichtes sein, mit Ihrem Vetter eine Verabredung zu treffen, er soll enorm reich sein.«
»Unmöglich, Exzellenz, von ihm am allerwenigsten könnte ich ein Geschenk annehmen.«
»Überlegen Sie wohl, es handelt sich um Ihre ganze Zukunft,« sagte der Minister kühl.
Der Assessor verneigte sich tief und erwiderte mit erzwungener Ruhe:
»Es bleibt mir nur noch übrig, Ew. Exzellenz meinen tiefempfundenen Dank für das mir bewiesene Wohlwollen zu Füßen zu legen.«
Der Minister betrachtete ihn scharf, wie er so dastand in untadeliger Haltung, aber doch in sichtlicher Bewegung. Gewiß, das war kein leichtsinniger Starrkopf, der ohne wichtige Beweggründe seine ganze Laufbahn zerstörte; seine wohlwollende Teilnahme regte sich von neuem.
»Unter diesen Verhältnissen kann ich Ihnen nur raten, auf den diplomatischen Beruf zu verzichten,« sagte er, »aber ich möchte Ihnen zugleich ein anderes Feld eröffnen. Ich habe ausgedehnten Grundbesitz, besonders in den östlichen Provinzen. Selbst kann ich mich der Verwaltung nicht widmen, mein Generaldirektor hat meine unumschränkte Vollmacht. Der jetzige, Major von Thumm, will die Stellung aufgeben, seines Alters wegen, da eine volle Manneskraft erforderlich ist. Selbstverständlich ist die Stelle den hohen Anforderungen gemäß dotiert, ebenso ehrenvoll ist die gesellschaftliche Stellung. Überlegen Sie sich meinen Vorschlag, ich bringe Ihnen das vollste Vertrauen entgegen, und wenn Sie darauf eingehen, werden wir uns leicht über alles andere einigen.«
Mit freundlichem Gruße entließ er den Assessor, der nun ernst mit sich zu Rate ging und bald zu einer Entscheidung gelangte. Dort hinderte ihn das elende Geld, das er nicht besaß, am schnellen Aufsteigen; sich langsam empor zu arbeiten und mit grauem Haar eine Stellung zu erringen, wie er sie erstrebte, war nicht sein Fall. Hier bot sich ihm eine wirkliche Macht, ein Heer von Beamten stand zu seiner Verfügung, mit fürstlichen Mitteln würde er wirken und schaffen, ohne von dem großherzigen Minister beschränkt zu werden. Auch die kümmerliche Existenz von Vater und Schwester würde ein Ende haben, er konnte beide in behagliche Verhältnisse versetzen, Lilly würde nicht ungeachtet verblühen.
So traf er die Entscheidung, und die Freude, mit der der Minister seine Zusage empfing, tat ihm wohl. Mit dem Vater hatte er einen schweren Stand, denn dieser wollte nicht zustimmen, daß er aus dem Staatsdienst schied, und alle heiteren Zukunftsbilder, welche seine Kinder vor ihm aufrollten, besänftigten und erfreuten, ihn nicht.
Albrecht würde seinen Wohnsitz auf dem schön gelegenen Schlosse Frankenstein nehmen, das so ziemlich im Mittelpunkte der Besitzungen lag und dorthin wollte er auch die Seinen mitnehmen.
Dr. Blanden stimmte dem Plane zu und erhoffte dann einen günstigen Einfluß auf seinen Patienten, den die Gemütsbewegungen der letzten Zeit sehr zurückgebracht hatten. Seine schlaflosen Nächte waren furchtbar, er war sehr abgemagert, die eingesunkenen Augen flackerten in einem unsteten Feuer, die gebrechliche Gestalt konnte sich kaum aufrecht halten und die Hände befanden sich beständig in zitternder Bewegung.
Der Assessor sollte unverzüglich in seinen neuen Wirkungskreis eintreten, so kam er, um sich von dem Vater zu verabschieden, den er später nachholen wollte. Er erschrak über die Veränderungen der letzten Tage und dachte sogar daran, seine Reise aufzuschieben, aber der Kranke wollte von solcher Verzögerung nichts wissen.
»Schloß Frankenstein soll reizend liegen, dort wirst du neue Kräfte erlangen,« sagte der Assessor tröstend.
Der Leidende schüttelte den Kopf. »Wozu solche falsche Vorspiegelungen,« sagte er herbe. »Meine Bahn führt zum Grabe und ich sehne mich nach dem Ende meiner Qual. Keine Zunge kann aussprechen, wie ich mein verfehltes Leben verwünsche und noch mehr demjenigen fluche, durch den es vernichtet wurde. Haß und Rachedurst haben mir den Schlummer geraubt und schwer habe ich mit mir gekämpft, ob ich ihren Eingebungen gehorchen solle.«
»Du gehst zu weit, lieber Papa,« suchte ihn Albrecht zu beschwichtigen. »Erwin ist der rechtmäßige Erbe, und wenn sein Vater uns mehr Großmut hätte beweisen können, so trifft ihn doch keine Schuld.«
Der Hauptmann lachte bitter.
»Er, der rechtmäßige Erbe! Das ist ja die Hand der Nemesis! Für diesen Knaben habe ich meine Seele der Hölle verkauft, und wenn nicht der Pfeil auf mich zurückgeprallt sein würde, so hätte ich nicht gezögert, ihn zu vernichten noch bei Lebzeiten jener Frau, die all meine Hoffnungen zerstörte.«
Albrecht legte kein großes Gewicht auf diese Reden, die er für die Wahngebilde eines kranken Gehirns hielt. Aber der Hauptmann erhob sich mühsam und wankte zu seinem Schreibtisch. Er drückte auf einen Knopf, ein Geheimfach sprang auf und er entnahm diesem einen dicken Briefumschlag, der an verschiedenen Stellen mit seinem Wappen versiegelt war.
»Hier sind die Beweise meiner Behauptungen,« sagte er. »Gib mir dein Ehrenwort, daß du erst nach meinem Tode dieses Paket öffnen und von seinem Inhalte Kenntnis nehmen wirst. Ich habe dann die Schande nicht mehr zu fürchten und dich trifft kein Vorwurf, denn das Verbrechen des toten Vaters haftet nicht an dir.«
Der Assessor blickte den Sprechenden erschrocken an. Sollte es sich um plötzlich ausgebrochenen Wahnsinn bei ihm handeln? Er mußte sehr krank sein.
»Gib mir dein Ehrenwort,« wiederholte der Vater dringender. »Erst nach meinem Tode darfst du die Dokumente ansehen. Dann magst du nach deinem Ermessen mit ihnen verfahren.«
So leistete Albrecht das Versprechen und nahm die Papiere in Empfang. Er war so besorgt, daß er Lilly fragte, ob sie sich fürchte, mit dem Leidenden allein zu bleiben.
»O nicht doch, ich habe ja den Doktor zum Beistand hier,« erwiderte sie, und ihr Gesichtsausdruck gab ihm zu denken. Gut, daß sie bald nach Frankenstein kommen würde, dann fand diese zu große Freundschaft ja ein Ende.
![]()
Als der Assessor am nächsten Morgen den Zug besteigen wollte, hörte er aus einem Abteil erster Klasse seinen Namen rufen und gewahrte mit Erstaunen seinen Vetter Erwin, der ihn zu sich winkte.
»Bedaure, ich fahre nie erster Klasse,« sagte er, und lehnte kühl das Zusatzbillett ab, das jener für ihn lösen wollte.
Lachend sprang dieser heraus und stieg zu Albrecht ein, der in einem neu angehängten Wagen Platz gefunden hatte. So waren sie beide allein trotz der Überfüllung des Zuges, die durch das bevorstehende Pfingstfest herbeigeführt war.
»Wo kommst du denn eigentlich her oder vielmehr wo gehst du hin?« begann der junge Majoratsherr, nachdem er sich eine Zigarre angezündet und seinem Vetter vergeblich eine solche angeboten hatte.
Dieser gab kurz Bescheid.
»Schade, daß du die Diplomatie aufgegeben hast, aus dir wäre sicher etwas Großes geworden,« meinte Erwin bedauernd. »Das leidige Geld hätte dich nicht hindern sollen, warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich hätte dir mit Freuden geholfen.«
»Ein Almosen wäre das in meinen Augen stets gewesen und lieber wäre ich gestorben,« versetzte Albrecht schroff.
»Verzeih, ich bin ein täppischer Gesell,« sagte Erwin gutherzig. »Weshalb habe ich deine Forderung erst abgewartet. Ich hätte dir alles zur Verfügung stellen sollen. Wir sind ja fast Brüder. Ist es wirklich zu spät?«
»Meine Entscheidung ist getroffen, aber ich danke dir herzlich für deinen guten Willen,« sagte Albrecht, unwillkürlich bewegt durch das offenbar so treu gemeinte Anerbieten. »Ich bin auf dem Wege nach Frankenstein, und du?«
Erwin wurde verlegen.
»Ja, siehst du, auf dem Wege der Tugend wandle ich gerade nicht. Aber ich bin in einer fatalen Lage. Die Geheimrätin von Dettelsbach ist schwer erkrankt, da kann die Verlobung nicht veröffentlicht werden, Melanie verläßt ihre Mutter kaum, ich bin Bräutigam und auch nicht. Um mir die Zeit zu vertreiben, mache ich einen kleinen Pfingstausflug nach Rügen. Morgen werde ich in Stubbenkammer mit der kleinen Fanny zusammentreffen, sie hat sich so um mich gegrämt, da will ich ihr noch einige vergnügte Tage bereiten.«
»Und Melanie?« fragte Albrecht mit unverhohlener Entrüstung.
»Sie weiß es ja nicht,« entschuldigte sich Erwin. »Ganz korrekt handle ich nicht, aber ich mache auch ganz gewiß meinen letzten Streich. Nun verzeih mir, Alter, und sieh nicht so böse aus.«
Albrecht war aufs tiefste empört. So wenig wußte sein Vetter ein Glück zu schätzen, das ihm über alles gegangen wäre. Aber er vermochte nichts zu ändern; vielleicht hielt Erwin sein Versprechen. Dieser bot alles auf, Albrecht zu versöhnen, an dessen guter Meinung ihm sehr gelegen war, und er drang so lange in ihn, bis dieser einwilligte, seine Reise zu unterbrechen und den morgenden Tag, an dem die Tänzerin noch nicht anwesend sein würde, mit Erwin zu verleben.
![]()
Das Hotel auf Stubbenkammer war so überfüllt, daß die beiden Herren nur mit Mühe Aufnahme fanden. Das herannahende Fest und das schöne Wetter hatten einen Fremdenstrom herbeigelockt, in dem der einzelne kaum Beachtung fand. Alle Angestellten des Hotels hatten einen Tag voll Arbeit und Mühe hinter sich und der wachehabende Hausdiener kümmerte sich nicht um die Reize der wundervollen Mondnacht, als er sich müde und verschlafen in der Portiersloge auf ein Ruhelager warf und bald in lautes Schnarchen verfiel.
Nur durch eine spanische Wand von diesem Gelaß getrennt, befand sich ein dürftig ausgestatteter Raum für den Buchhalter. Auch er hatte ein anstrengendes Tagewerk gehabt und er war kein Freund der Arbeit, er sehnte sich bereits wieder fort, hinaus in die Welt, lange würde seines Bleibens hier so wie so nicht sein, denn sein Prinzipal machte keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit.
Ein Klopfen an der Tür nebenan schreckte ihn aus seinem Brüten auf; es mußte mehrmals wiederholt werden, ehe der Hausdiener erwachte; dann fragte eine jugendliche Männerstimme nach den Schlüsseln zu den Kähnen im Herthasee.
»Mitten in der Nacht?« fragte der Hausdiener erstaunt.
»Gestern abend, als wir da waren, fanden wir die Kähne angeschlossen und konnten nicht fahren; es hieß, die Schlüssel seien beim Portier. In der Nacht beim Mondschein soll es am schönsten sein.«
Der Mann nahm nun den Schlüssel vom Haken und schärfte den Fremden ein, ihn ja zurückzubringen, denn er sei verantwortlich dafür. Das wurde versprochen und aus seinem sehr freundlichen Dank schloß der Lauscher, daß ihm eine gute Belohnung für seine Mühe geworden sei.
Die Neugier des Buchhalters war erwacht; er glaubte fest, daß es sich um das Stelldichein eines Liebespärchens handle und, kurz entschlossen, schwang er sich zum Fenster hinaus, um den nächtlichen Wanderern zu folgen, indem er Sorge trug, sich im Schatten der Bäume oder im Gebüsch vor Entdeckung zu schützen.
Tiefer Frieden herrschte im Walde; nur in der Ferne ertönte der Ruf eines Käuzchens, dem andere antworteten, und unheimlich hallten die schauerlichen Laute durch die Stille. Dann vernahm man einen Schuß, aber dumpf, wie aus weiter Entfernung, und wieder wurde es still, doch nicht für lange. Ein Windstoß fuhr pfeifend durch die Baumkronen, ein zweiter und dritter folgte; einzelne Wolken verdunkelten den Mond, dunkle, schwere Massen schoben sich ihnen nach, bläuliche Blitze erhellten die Nacht und der Donner rollte majestätisch einher. Langsam zog das Gewitter herauf, nur der Schoß der Wolken blieb noch verschlossen.
Jetzt kehrte der Buchhalter von seinem Spähergange zurück; sein Antlitz war totenbleich und seine Brust keuchte schwer und mühsam, vielleicht vom atemlosen Lauf, um vor Ausbruch des Unwetters unter Schutz zu sein. Ungesehen kehrte er auf demselben Wege, wie er es verlassen, in sein Zimmer zurück. Ehe er sich auf sein Lager warf, nahm er ein Päckchen und eine Hand voll zerknitterter Banknoten aus der Tasche und verschloß beides sorgfältig. Er war todmüde, aber der Schlaf floh ihn, und als er ihn endlich fand, graute bereits der Tag und ein angstvolles Stöhnen rang sich aus seiner Brust.
»Was ist? Habe ich etwas gesagt?« fragte er in furchtbarem Schreck den Hausdiener, der ihn weckte.
»Nein, aber geächzt und gestöhnt haben Sie, als hätten Sie einen Mord auf der Seele,« lautete dessen Antwort.
»Ich verbitte mir solche Redensarten,« schrie ihn der Buchhalter an. »Der Alp hat mich gedrückt, weiter nichts.«
»Na, mir auch recht, Sie brauchen mich nicht gleich so anzufahren,« meinte der andere. »Stehen Sie auf, es gibt heute einen schweren Tag für uns alle.«
Das Gewitter hatte sich ausgetobt, die Sonne schien hell und strahlend und trocknete die letzten Spuren des Regens auf, die Natur trug ein lachendes Antlitz voll Anmut und Reiz, das sich in den vergnügten Gesichtern der Menschen widerspiegelte.
Nur Fräulein Fanny, die hübsche Tänzerin, sah verdrießlich aus, sie hatte aber auch Ursache, diese Pfingstreise zu verwünschen. Erst diese alberne Einrichtung, daß sie sich erst in Saßnitz treffen wollten, statt zusammen zu reisen! Dann war Erwin nicht einmal da, um sie abzuholen. Zum Glück hatte sie unterwegs die Bekanntschaft eines netten Bankiers gemacht, der sich ihr als Sally Bach, Teilhaber der Firma A. G. Bach Erben vorstellte und der es sich nun zur Ehre schätzte, für sie zu sorgen. Auch im Hotel von Stubbenkammer war Erwin nicht; der Wirt fand zwar in seinem Buch die Bestellung zweier schöner Zimmer für den Freiherrn von Wildburg, aber diese standen noch leer und er wollte sie nun nicht an Fräulein Fanny ausliefern.
Sie weinte vor Wut und war nur froh, daß Herr Sally Bach ihr seine weiteren Ritterdienste anbot; Erwin hatte gewiß Abhaltung bekommen und konnte es ihr unmöglich übel nehmen, wenn sie sich unterdessen von einem andern trösten ließ. Es verging Tag nach Tag, ohne daß der Erwartete eintraf, nicht einmal eine Nachricht von ihm. Endlich verlor die Tänzerin die Geduld, sie willigte ein, den Ungetreuen ganz aufzugeben und mit ihrem neuen Freunde zurückzukehren.
Am nächsten Morgen wollten sie abreisen, eigentlich mit Bedauern, es war eine gar zu nette Zeit gewesen. Arm in Arm schlenderten sie durch den Wald, dem Herthasee zu, von dem Fanny nicht sehr entzückt war, sein Düster mißfiel ihr.
Eine Wasserfahrt lehnte sie ab, weil es ihr hier zu einsam und daher langweilig war, aber sie versprach sich Vergnügen davon, den Leuten, die in einem kleinen Kahn das Krebsen betrieben, zuzusehen.
Einer der Fischer machte einen Kahn für sie los und stieg mit seinem Haken und dem Käscher, die er für den Krebsfang brauchte, zu ihnen ein. Seite an Seite hielten sich die beiden Fahrzeuge, und die Männer begannen den Grund des Sees nach den ausgeworfenen Krebskörben abzusuchen. Bald waren einige gefunden und ihres Inhalts entleert; die Krebse des Herthasees waren ein beliebter Leckerbissen.
Fanny jubelte laut über jeden Fang und auch Herr Sally Bach fand die Sache sehr vergnüglich, so daß sie den Sonnenuntergang am Meer ganz vergaßen. Plötzlich haftete der Haken des einen Fischers an etwas Schwerem, das er nicht hoch zu bringen vermochte.
»Vielleicht ein versenkter Schatz der Göttin Hertha!« meinte Fanny lächelnd, aber die Fischer machten ernste Gesichter und antworteten nicht. Den Bankier beschlich eine unheimliche Ahnung und er wollte ans Ufer zurück, aber die Männer achteten nicht auf ihn, und obwohl Fanny wie ein Espenlaub zitterte, war sie doch von unbezwinglicher Neugier erfaßt.
Langsam und mit Anstrengung zogen die Fischer, jetzt tauchten Kleider und eine rechte Hand aus dem Wasser, und während Fanny vor Entsetzen laut aufkreischte, faßten die Männer zu und hoben einen leblosen Körper in ihren Kahn.
Sie legten die Leiche am Ufer nieder, der eine Fischer lief nach Stubbenkammer, um Meldung zu erstatten, Fanny wollte mit der Lust halbgebildeter Menschen am Grausigen nicht von der Stelle, es liefen noch andere Fremde und Leute hinzu, die sich im Walde aufgehalten hatten, das Entsetzen war allgemein.
»Die Leiche hat einige Tage im Wasser gelegen, aber sie ist noch wenig entstellt,« sagten die Fischer.
Die Gerichtskommission konnte erst am nächsten Morgen eintreffen; um die Rekognoszierung der Leiche zu ermöglichen, die an Ort und Stelle bleiben mußte, durfte keine Zeit verloren werden. Der Schlamm, der dem Körper anhaftete, wurde entfernt, man fand die Züge eines vornehmen, jugendlichen Mannes. Es war ein Fremder, den niemand kannte, seine Taschen waren mit Steinen beschwert, weder Brieftasche noch Portemonnaie trug er bei sich. Er hatte wohl Selbstmord verübt und alles entfernt, was zur Entdeckung seiner Persönlichkeit führen konnte, so nahm man an.
»Nein, er ist ermordet,« sagte jetzt ein Polizist, »hier hinter dem Ohr befindet sich eine kleine Schußwunde, die von einem Revolver herrühren muß.«
Ein Gemurmel des Entsetzens lief durch die angesammelte Menge, übertönt von einem furchtbaren Schrei, den Fanny ausgestoßen hatte; dann sank sie ohnmächtig zu Boden, aber außer ihrem Begleiter beachtete sie kaum jemand. Alles Interesse hatte sich dem entsetzlichen Fall zugewandt, jeder hatte das Gefühl, als sei er selbst einer großen Gefahr ausgesetzt gewesen, denn da dem Toten auch die Uhr und eine Busennadel, deren Vorhandensein die Stiche im Oberhemd andeuteten, genommen waren, so mußte es sich um einen Raubmord handeln.
»O, ich kenne ihn, es ist mein Erwin,« rief Fanny jetzt laut weinend aus, als sie das Bewußtsein wieder erlangt hatte.
Alles drängte sich um sie und sie fuhr unter strömenden Tränen fort: »Es ist Erwin von Wildburg, der reiche Majoratsherr. Deshalb habe ich ihn vergebens erwartet, er war mir nicht untreu, er war tot; während ich lachte und scherzte, hauchte er sein Leben aus!«
»Derselbe Herr, der die Zimmer bestellte und nicht erschien,« fügte der Wirt hinzu.
Eine ungeheure Aufregung entstand. Ein so vornehmer junger Mann mußte auf solche Weise enden! Das erhöhte das Entsetzen noch. Der Telegraph spielte nach allen Richtungen, die Untersuchung wurde mit dem größten Eifer geführt. Der nunmehrige Majoratserbe Albrecht voll Wildburg erschien, sobald er benachrichtigt worden und folgte als einziger Vertreter der Familie dem Sarge in dem ungeheuren Zuge, der ihm das letzte Geleit gab. Wie tief er ergriffen war, zeigte seine gebrochene Haltung, sein wankender Schritt; er schien um zehn Jahre gealtert. Er war um so mehr bewegt, als er, wie er auch zu Protokoll gab, mit seinem Vetter im Eisenbahnabteil zusammengetroffen und mit ihm eine Strecke gereist war; in Stettin hatten sich ihre Wege getrennt.
Der Hausknecht erinnerte sich dunkel, daß ihm der Schlüssel zum Kahn abverlangt worden war; aber er war zu verschlafen gewesen, um irgend eine Beobachtung anzustellen. Der Buchhalter hielt es für geraten, über seine Wahrnehmungen tiefes Schweigen zu bewahren; er behielt seine Stellung noch kurze Zeit, kündigte dann und niemand hatte ein Interesse daran, wo er sich hinwandte.

Daß der Hauptmann von Wildburg, der jetzige Majoratsherr, ein geistig und körperlich gebrochener Mann, zugunsten seines Sohnes auf die Erbschaft verzichtete, konnte niemand in Erstaunen setzen. Ebenso begreiflich war ein gewisses Grauen vor dem Unheil, das sich an den Besitz der Wildburgs knüpfte, der eine Erbe durch ein Unglück, der andere durch ein Verbrechen aus dem Leben geschieden, der dritte fast ein Sterbender, unheilbarem Siechtum verfallen. Was würde das Los des jetzigen Majoratsherrn sein?
![]()
Anmutig in die seidenen Polster ihres Wagens zurückgelehnt, fuhr die Freifrau Melanie von Wildburg durch die Alleen des Tiergartens und dankte freundlich für die Grüße, die ihr von allen Seiten dargebracht wurden. Bewundernd folgten die Blicke der schönen Frau in der eleganten Equipage. Seit vier Jahren war sie mit Albrecht vermählt und das Glück ihrer Ehe hatte seinen Höhepunkt erreicht, als ihnen nun auch noch zu einem Töchterchen ein Sohn geboren wurde. Melanies Natur bedurfte des Sonnenscheins des Glückes zu ihrer vollen Entfaltung, und an der Seite des heißgeliebten Mannes, dem sie eine aufopfernde und bewundernde Gefährtin war, waren ihre stolzesten Träume in Erfüllung gegangen. Obwohl sie auf der Höhe stand, war sie gütig und wohlwollend geblieben, waltete sie mit feinem Takt und größter Liebenswürdigkeit als Schloßfrau von Wildburg und bewegte sie sich ebenso im Strudel der hauptstädtischen Geselligkeit.
Der jetzige Freiherr von Wildburg hatte sich in den fünf Jahren, die seit dem schrecklichen, noch immer nicht aufgeklärten Tode seines Vetters verflossen waren, die größte Hochachtung erworben; er verwaltete seinen großen Besitz in ausgezeichneter Weise und nahm auch im politischen Leben eine hervorragende Stellung ein; daneben lieh er jeder Klage und jeder berechtigten Bitte ein williges Ohr. Daß sein Antlitz nie ein Lächeln erhellte und daß Haar und Bart des noch nicht Vierzigjährigen ergraut waren, mochte befremden; wer aber die innige Liebe und Zärtlichkeit sah, womit er Frau und Kinder umfaßte, sein mildes Wohlwollen gegen Hilfsbedürftige, die von aller Bitterkeit freie Art, mit der er seinen Gegnern entgegentrat, der mußte sich sagen, daß dieser ruhige Ernst wohl einer philosophischen Auffassung des Lebens, nicht aber eignem Leid entsprang.
Sein Vater war beständig mehr eine Beute seines Leidens geworden; jetzt hatte er nur noch selten lichte Momente und schleppte sein Dasein hin, ein müder, gelähmter Greis. Lilly pflegte ihn mit aufopfernder Hingebung, sein Sohn sorgte für die behaglichste Lebensweise und umgab ihn mit einem Luxus, den der Kranke kaum zu würdigen verstand. Melanie hegte eine fast mütterliche Zuneigung für ihre junge Schwägerin und bemühte sich, sie dem Kreise des Hauses zu entziehen und zur Teilnahme an der Geselligkeit zu bewegen, an der sie selbst so viel Freude fand.
Lilly sah jünger aus, als sie war; ihre Züge hatten etwas Kindliches, ihre Augen blickten groß und vertrauensvoll, nur um den Mund lagerte ein Ausdruck stiller Entsagung; ihre ganze Erscheinung trug den Charakter der Lieblichkeit und Einfachheit und bildete einen großen Gegensatz zu Melanies üppiger Schönheit und glänzender Toilette.
Die beiden Schwägerinnen begrüßten sich zärtlich und Lilly fragte nach den Kindern.
»Sie sind bei Frau Brandt vorzüglich aufgehoben,« sagte Melanie. »Aber du hast sie lieber als mich und sie hängen an dir mehr als an mir.«
»Bist du mir böse?« fragte Lilly mit Tränen in den Augen.
Melanie küßte sie ihr fort. »Böse, du kleine Törin,« schalt sie lächelnd. »Dankbar bin ich dir. Es ist mir eine Beruhigung, zu denken, meine Kinder würden nicht verwaist sein, wenn ich von ihnen gehen müßte.«
»Wie kommst du auf solche Gedanken, Melanie? Fühlst du dich unwohl?« fragte Lilly erschrocken.
»O nein, ich bin nur zu glücklich, die Erde hat mir kaum noch etwas zu bieten. Und dann, du weißt, meine Brust war nie stark und meine Mutter ist an einem Lungenübel gestorben.«
»Albrecht muß es wissen, dir fehlt gewiß etwas,« sagte Lilly wieder.
»Nein, mein Kind, Albrecht darf nicht mit solchen Dingen belästigt werden, die nur in Stimmungen ihren Grund haben. Ich habe eine schlechte Nacht gehabt, da entstehen solche Gedanken. Albrecht ist jetzt wieder so ruhelos, erst gegen Morgen legt er sich nieder, er ist mit Arbeit und Geschäften überhäuft. Ich nehme ihm die geselligen Pflichten ab, soviel ich kann, doch das genügt nicht. Wenn nur der Reichstag erst geschlossen würde, in Wildburg ist alles besser, und später gehen wir an die See.«
»Wenn er sich nur schonen wollte!« sagte Lilly.
Melanie schüttelte den Kopf. »Arbeit ist ihm Freude und in der Ruhe ginge er zugrunde. Er hat eine so hohe Auffassung von seinen Pflichten, weil das Schicksal ihm so viel verliehen, möchte er auch Großes wirken; da kann ich ihn nicht zurückhalten. Doch nun wollen wir von dir sprechen. Wie steht es mit dem jungen Grafen Meerheim? Darf er wirklich nicht hoffen? Er liebt dich treu und sein Vater ist ganz hingerissen von dir, die ganze Familie kommt dir mit offenen Armen entgegen.«
»Ich kann doch Papa nicht verlassen,« stellte Lilly vor.
»Der Grund ist nicht stichhaltig, Kind. Der Papa ist jetzt so apathisch, daß ein guter Pfleger für ihn genügt, außerdem könnte er ja in deinem neuem Heim eine Unterkunft finden. Es ist eine vorzügliche Partie in jeder Beziehung, Konrad Meerheim, ein ausgezeichneter Mensch, dabei reich und unabhängig. Du siehst ja sehr hübsch und sehr jung aus, mein liebes Herz, aber bedenke, du wirst dreiundzwanzig Jahre und wir müssen für deine Zukunft sorgen. Du kannst doch gewiß nichts gegen den Grafen Konrad haben.«
»O nein, nein,« versicherte Lilly, »nur heiraten kann ich ihn nicht, ich will mich überhaupt nie vermählen, sondern bei euch und euren Kindern bleiben.«
»Das geht aber nicht,« sagte Melanie sehr bestimmt. »Solltest du vielleicht eine Neigung haben? Willst du mir nicht Vertrauen schenken?«
Lilly wurde glühendrot, aber die Antwort blieb ihr erspart, denn in diesem Moment wurde Dr. Blanden gemeldet und Melanie erteilte in ihrer raschen Art die Erlaubnis zu seinem Eintritt.
»Störe ich?« fragte der Arzt, dem Lillys Aufregung nicht entging.
Frau von Wildburg versicherte ihm das Gegenteil und forderte ihn auf, ihre Vorstellungen zu unterstützen, vielleicht würde Lilly mehr Gewicht auf seine Worte legen, als auf die ihren. Sie dürfe sich nicht völlig für den Vater aufopfern, sondern müsse auch an sich denken.
Dr. Blanden versprach, sein möglichstes zu tun und Melanie verabschiedete sich, da ihre Zeit abgelaufen war. Der Arzt, der die Rückkehr seines Patienten von einer Spazierfahrt, die er im Rollstuhl unternommen, abwarten wollte, blieb zurück und setzte das begonnene Gespräch fort.
Er bewunderte das junge Mädchen in seiner Selbstlosigkeit und Pflichttreue, aber es tat ihm auch leid, daß sie ihre Jugend so ganz verlor. Lilly widersprach. Sie fühlte sich befriedigt in ihrem Stilleben und dabei blickte sie scheu zu ihm auf und er las in ihren Augen ein süßes Geheimnis, das sie ihm sonst sorgfältig verbarg.
Die beiden jungen Menschen standen seit fünf Jahren im engsten Verkehr; der Arzt widmete seinem Patienten die treueste Sorge und bot alles auf, um Lilly ihr schweres Amt zu erleichtern; in wie viel bangen Stunden hatte er helfend und beratend ihr zur Seite gestanden und sie hatte sich gewöhnt, ihm unbedingt zu vertrauen und jedes seiner Worte zur Richtschnur ihres Handelns zu machen.
War ihre Liebe zu dem Arzt eine halb unbewußte, so war er sich über seine Gefühle vollkommen klar, aber er beherrschte sich, denn er erkannte wohl die große Kluft, die ihn von der Schwester des Majoratsherrn von Wildburg trennte, und es war ihm Ehrensache, dem geliebten Mädchen jeden Kampf zu ersparen, indem er sich in unverbrüchliches Schweigen hüllte.
Doch nun war die Stunde herangenaht, in der die Macht ihrer gegenseitigen Liebe alle Schranken niederriß, ohne es zu ahnen, hatte Melanie selbst die erste Veranlassung dazu geboten, indem sie vor den beiden das gefährliche Kapitel von Lillys Zukunft berührte. Sie wußten es selbst nicht, wie alles geschehen war, plötzlich waren sie zur Klarheit über die große Lebensfrage gelangt, der Doktor hielt das zitternde Mädchen in seinen Armen und küßte ihr das Geständnis ihrer Liebe von den Lippen.
Als sie nach dem ersten Taumel eines hohen Glücks wieder zur Erde zurückkehrten, wiederholte Lilly nochmals: »Dein auf ewig, o, wie bin ich selig in solchen Gedanken.«
»Was wird aber dein Bruder zu unserem Bunde sagen?« fragte Dr. Blanden sehr ernst.
»O, Albrecht sprach erst neulich seine Überzeugung aus, daß du ein berühmter Arzt werden würdest, dessen Name überall mit Anerkennung genannt wird.«
Der Doktor stieß einen Seufzer aus und erwiderte: »Hier liegt das Unglück meines Lebens. Mir fehlt selbst der Name. Der, den ich trage, gehört mir nicht.«
Dann erzählte er der Geliebten die Geschichte seiner Geburt. Die Pflegeeltern seien ihm teuer gewesen, wie leibliche Eltern es nur sein könnten, aber von dem Augenblick an, wo er alles erfahren, habe er sich gelobt, nicht eher zu ruhen, als bis das Dunkel gelichtet und der Zweifel getilgt sei, der durch das Verhalten seines Vaters heraufbeschworen werde. Diese Ungewißheit habe ihn stumm gemacht, denn er habe Lilly vor langen Jahren des Harrens bewahren wollen.
Die Liebenden kamen überein, ihr Geheimnis fürs erste zu bewahren, denn auch Lilly verhehlte sich nicht, daß ihr Bruder sowie Melanie ihrer Neigung widerstreben würden. Dr. Blanden schrieb jetzt ein Werk über Nervenkrankheiten, auf das er große Hoffnungen setzte; doch mußte noch Jahr und Tag bis zu seiner Vollendung vergehen und dann mußte noch abgewartet werden, ob der Erfolg seinen Wünschen entsprechen werde. So hieß es denn, weiter Geduld und Selbstbeherrschung üben.
![]()
Die Reichstagssession war geschlossen und Freiherr von Wildburg konnte mit seiner Familie nach dem Stammschloß übersiedeln, einem entzückenden Besitztum, in dessen Frieden alle Erwartungen, die Melanie davon gehegt hatte, in Erfüllung zu gehen schienen. Noch nie hatte sich Albrecht so heiter und sorglos gezeigt und sie strich ihm lächelnd die tiefen Falten seiner Stirn mit den schlanken Fingern glatt und meinte, es bedürfe nur einer guten Haarfärbetinktur, um die vorzeitig gebleichten Haare verschwinden zu lassen, um den Albrecht von früher zurückzubringen.
Ein wehmütiges Lächeln huschte über die Züge des Freiherrn, als er sagte: »Das gelingt selbst deinem Zauberstabe nicht, meine geliebte Melanie. Mein Leben neigt sich dem Abend zu.«
Melanie wollte das nicht gelten lassen, sie zog ihren Gatten mit sich fort dem schattigen Platze zu, wo die Kinder unter Frau Brandts Obhut sich tummelten. Sie jubelten und jauchzten laut, denn die liebe Tante Lilly spielte mit ihnen und etwas Schöneres kannten sie gar nicht.
Die Eltern sahen beglückt zu und Melanie sagte zu ihrem Gatten: »Sieh Lilly an! Ist sie nicht jetzt wie ein achtzehnjähriges Mädchen, das von allem Schweren nie berührt wurde, und doch lag lange Zeit eine beständige Wehmut auf ihr. Ob die Liebe an dieser Veränderung die Schuld trägt; Graf Meerheim wirbt so treu um sie, vielleicht sind ihr doch die Augen für seinen Wert aufgegangen.«
Der Freiherr runzelte die Stirn, als er erwiderte: »Leider nicht. Gestern hatte ich eine sehr ernste Unterredung mit ihr und stellte ihr vor, wie sehr sie uns erfreuen würde, wenn sie den Grafen erhörte. Sie weigerte sich entschieden und forderte von mir, ihm dies mitzuteilen. Ich werde es tun müssen, denn da seine Werbung hoffnungslos ist, haben wir kein Recht, Konrad Meerheim die Wahrheit vorzuenthalten.«
»Wie schade,« sagte Melanie bedauernd. »Was kann nur der Grund sein? Sie wird doch nicht – –«
Sie hemmte sich selbst und setzte abwehrend hinzu, als ihr Gatte sie forschend ansah: »Es ist nichts, nur ein dummer Einfall von mir, der mir eben in den Sinn kam. Du glaubst nicht, wie töricht ich sein kann. Auch über die Kinder mache ich mir oft Sorge.«
»Wahrlich unnütze, Liebling, sie gedeihen und sind unter Frau Brandts Aufsicht gut ausgehoben. Wie ist unser kleiner Kurt unter ihrer Pflege erstarkt.«
»Gewiß,« stimmte Melanie zu. »Wenn wir diese tüchtige Frau nur behalten!«
»Aber sicher, Kind. Ihr Taugenichts von Sohn ist ja in die weite Welt gegangen und verschollen. Sie hat die Kinder lieb und vergißt darüber ihr eigenes Unglück. Anzustrengen braucht sie sich nicht und sie erhält sehr hohen Lohn. Weshalb sollte sie da fortgehen?«
»Du hast recht, wie immer, lieber Albrecht. Es muß in meinen Nerven liegen, daß ich mich so beunruhige. Oft schlafe ich nicht, in dem Wahne, es könne mich ein plötzliches Unglück überfallen oder es quälen mich schreckliche Träume.«
»Die Anstrengungen der Berliner Saison waren zu groß für dich, hier wirst du dich erholen,« suchte der Freiherr seine Gattin zu beschwichtigen. »Gut, daß wir Dr. Blanden für den Vater erwarten; er soll dich auch in die Kur nehmen.«
Melanie schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht krank, und meine abergläubische Schwäche kann kein Arzt heilen. Ich bin zu glücklich und das macht mir bange. Seit Kurts Geburt ängstigt mich das Verhängnis, das über den Erben von Wildburg geschwebt hat.«
Sie hatte zögernd gesprochen und blickte nun zu ihrem Manne auf, auf Tadel und Spott gefaßt; aber wie erschrak sie, als sie sein fahles Antlitz mit den verdüsterten Augen sah!
»Bist du mir böse, Albrecht, oder fürchtest du gleich mir?« fragte sie beklommen, sich dicht an ihn schmiegend.
»Nein, nein,« stieß der Freiherr heraus. »Das sind törichte Ammenmärchen, und doch, heißt es nicht, daß die Schuld der Väter an den Kindern gerächt werden soll bis ins dritte und vierte Glied? Sollte dieser schuldlose Knabe Erbe des Fluches sein? Würde es nicht genügen, wenn ein anderes Dasein der Sühne gereicht würde?«
»Was hast du nur, Albrecht, du sprichst so seltsam,« sagte Melanie ängstlich.
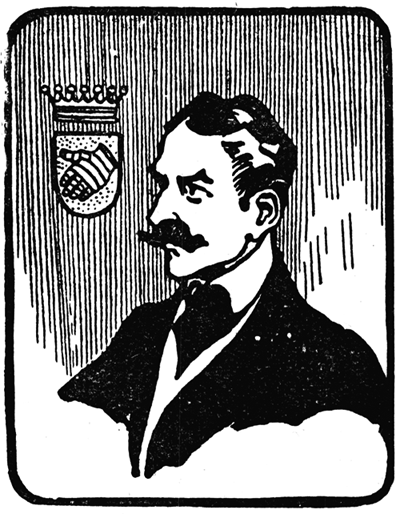
Der Freiherr fuhr mit der Hand über seine Stirn, als wolle er schlimme Gedanken verjagen, dann sagte er: »Vergib meine dunklen Reden. Wir sind auf ein Gebiet geraten, das mich oft beschäftigt. Ich habe manchen Blick in das Leben getan und von mancher geheimen Schuld erfahren, die sich dem Auge der Menschen verbirgt. Wie viele, die sich selbst den Tod gaben, taten es, um eine Schuld zu sühnen, um im Grabe endlich den Frieden zu finden, den sie verwirkt hatten! Zahn um Zahn, Leben um Leben lautet die Forderung der Schrift. Aber ist es nicht würdiger, durch sein Leben zu sühnen, das ein solcher Sünder dem Dienste der Menschheit opfert, und an der Gesamtheit gut zu machen, was er an dem einzelnen verbrach?«
»Ich verstehe dich nicht,« sagte Melanie. »Von wem sprichst du? Von welcher Schuld und welchem Frevel? Es klingt, als klagest du dich selbst an, aber wer kann edler und reiner dastehen als du?«
Albrecht lächelte so traurig, daß es ihr ins Herz schnitt, als er erwiderte: »Wer hätte stets seine Schuldigkeit getan? Ist nicht jede versäumte Pflicht eine Schuld? Wem viel verliehen ward, von dem wird auch viel verlangt. Aber achte nicht auf meine Worte, es sind die Grübeleien eines überreizten Gehirns, und ich verspreche dir, du sollst sie nicht wieder vernehmen.«
Er begann eine andere Unterhaltung, aber Melanie erschien seine Art und Weise unnatürlich, und in ihrer Seele blieb ein Stachel zurück.
Als sie in das Schloß zurückkehrte, meldete ein Diener, daß ein Fremder den Herrn Baron zu sprechen wünsche.
»Hat er keine Karte abgegeben?« fragte der Freiherr.
»Er hatte wohl kaum eine, er machte einen ziemlich dürftigen Eindruck,« lautete die Antwort.
»Fragten Sie nicht nach seinem Namen?«
»Jawohl, aber er meinte, der Herr Baron würden ihn doch nicht kennen.«
»Wahrscheinlich ein Hilfesuchender,« sagte der Schloßherr zu seiner Gemahlin und ging mit leichtem, sicherem Schritt in seine Gemächer.
Melanie blickte ihm sinnend nach. Welches war sein eigentliches Ich, jener gebrochene, mit finsteren Zweifeln und düsteren Vorstellungen kämpfende Mann oder dieser stolze, gebietende Herr des Schlosses?
Stunden waren verflossen und noch immer weilte der Fremde im Kabinette des Freiherrn. Der Diener, der eine Botschaft seiner Gebieterin überbrachte, fand die Tür verriegelt und sein Klopfen wurde nicht beachtet. Endlich ging der Fremde, diesmal nicht demütig, sondern in stolzer Haltung, und der Freiherr gab ihm das Geleit und nahm zum Erstaunen des Dieners die Hand, die ihm jener mit unverschämter Vertraulichkeit und einem: »Also auf Wiedersehen, lieber Freund,« darbot.
Der Schloßherr riegelte sich wieder ein und erschien auch nicht an der Abendtafel.
Zum ersten Male fand seine Gemahlin seine Tür verschlossen, und auf ihre angstvollen Fragen antwortete die geliebte Stimme müde und matt: »Laß mich, Melanie, und wenn du mich liebst, quäle mich nicht mit Fragen. Ich werde bis spät in die Nacht zu arbeiten haben. Gehe also ruhig zu Bett.«
Mit mühsam beherrschter Fassung erfüllte die Schloßfrau ihre Pflichten im Speisesaale; nur beschäftigt mit ihren Sorgen, um darauf zu achten, wie glückstrahlend Lilly in ihrer reizenden, ganz neuen Sommertoilette aussah.
Ein Wagen fuhr in den Schloßhof und Lilly eilte ans Fenster, um Dr. Blandens Ankunft zu verkünden.
Der Arzt betrat zum ersten Male das Schloß, das er sich nicht so großartig und umfangreich vorgestellt hatte Es machte mit seinen Türmen und Erkern eigentlich einen düsteren Eindruck, da es von Backsteinen erbaut war, die im Laufe der Zeit einen tiefdunklen Ton angenommen hatten; die blumengeschmückte Terrasse lag nach der Gartenseite.
Das Hauptportal, das in die prächtige, reich geschmückte Eintrittshalle führte, wurde von einem Turm mit großer Uhr überragt; darunter befand sich, in Stein gehauen, das Wappen der Wildburgs, drei Löwenköpfe und im vierten Felde eine geharnischte Hand, das Ganze flankiert von gekrönten Greifen, die dem Beschauer feindlich entgegenzüngelten. Darunter las man in Riesenbuchstaben den Wahrspruch des Geschlechts: »Ich halt's.«
Brachte dem Doktor das mächtige Gebäude schmerzlich zum Bewußtsein, daß er fast ein Findling, um eine Tochter dieses stolzen Hauses zu werben wagte, so beschäftigte ihn bald noch mehr das Wappen, das ihn: so vertraut erschien.
Jetzt blieb ihm keine Zeit zum Nachdenken, ein Diener führte ihn in die ihm bestimmten Gasträume und dann zu seinem Patienten, der seine gewahrte Apathie so weit abstreifte, daß er seinen Arzt mit einigen schwache Freudenbezeigungen begrüßte, während Lilly neben ihm stand und dem Geliebte:: glückstrahlend zulächelte.
Es waren einige Besucher aus der Nachbarschaft gekommen; der Freiherr erschien nicht im Salon, aber seine vielen Geschäfte hielten ihn oft zurück und seine Gemahlin vertrat ihn. Sie hatte den Arzt um so freudiger begrüßt, als sie ihn über Albrecht zu Rate ziehen wollte und es auch sofort tat; aber der Doktor schob alles auf Überanstrengung und verordnete größere Ruhe und mehr Muße, und mehr konnte Melanie nicht von ihren Sorgen verraten.
Als die Liebenden endlich einige Worte miteinander sprechen konnten, empfanden sie beide das Drückende des Geheimnisses, mit dem sie sich umgeben mußten und Lilly fragte eifrig nach dem Termin der Vollendung des Buches, von dem sie so viel hofften.
»In einigen Monaten,« sagte Dr. Blanden. »In diesem Moment beschäftigt mich etwas anderes, nämlich das Wappen über dem Portal. Ich dachte, die Wildburgs führten nur den geharnischten Arm, das Wappen am Schloßportal habe ich noch nie gesehen.«
Lilly erklärte ihm, daß dies größere Wappen das der gesamten Herrschaft sei, zu dessen Führung nur der Majoratsherr das Recht habe, und fragte ihn neckend, seit wann er sich so lebhaft für Heraldik interessiere, und nun erzählte ihr der Doktor, daß das Medaillon, welcher von seiner verstorbenen Mutter herstammt, dasselbe Wappen zeige.
»Wie wunderbar!« rief Lilly aus. »Solltest du in irgend einer Beziehung zu unserer Familie stehen?«
»Ich kann es kaum glauben,« versetzte der Doktor, »aber vielleicht hilft mir dieser Umstand bei meinen Forschungen, ich bin unablässig bemüht, das Rätsel meiner Herkunft zu lösen.«
Melanie beobachtete die beiden unbemerkt, aber scharf; es war ihr plötzlich eine Ahnung von der Natur ihres Verhältnisses erwacht und diese wurde ihr nun zur Gewißheit. Sie erschrak. Albrecht würde diese Heirat nie zugeben, und sie selbst war auch nicht vorurteilsfrei genug, um einen jungen bürgerlichen Arzt für einen geeigneten Bewerber für Lilly zu halten. So zeigte sie sich zum ersten Male weniger freundlich gegen den Doktor und in ihrem Benehmen lag ein Anflug von hochmütiger Kälte.
Bis lange nach Mitternacht saß sie dann am Bett ihres Knaben und die Beklommenheit, welche ihr die Brust zusammenschnürte, verlor sich auch nicht beim Anblick des in ruhigem Schlaf daliegenden Kindes.
Sollte ihr Sohn auch von dem Fluche ereilt werden, der auf dem Erben der Wildburgs lastete? Sollte sein unschuldiges Dasein einer Sühne verfallen sein für das Böse, das er nicht getan?
Die alte Kinderfrau redete ihr verwundert und besorgt zu, sie solle sich zur Ruhe begeben oder sie werde sich krank machen. So erhob sie sich und schlich an Albrechts Tür, um auf ihr Pochen und Bitten eine neue Abweisung zu erfahren. In angstvoller Bekümmernis kehrte sie in ihr Schlafgemach zurück und legte sich angekleidet auf ein Ruhebett, ängstlich auf die ersehnten Fußtritte lauschend; aber es dauerte noch lange, bis ihr Gatte endlich erschien. Er schalt sie liebevoll aus und sie fand nun endlich den Schlummer.
Am nächsten Morgen begegneten sich die Gatten bleich und übernächtig; keiner von ihnen sprach über die Vorgänge des gestrigen Tages; bisher hatten sie alles miteinander geteilt, jetzt stand eine unsichtbare Scheidewand zwischen ihnen.
![]()
Die Freifrau von Wildburg leitete und überwachte die Vorbereitungen zu einem großen Feste, das auf Wunsch ihres Gemahls stattfand. Zum ersten Male empfand sie dies als eine schwere Aufgabe, denn in ihrer Seele wohnten Angst und Zweifel, die ihren Nächten den Schlaf, ihren Tagen den Frieden raubten; ihre Augen zeigten zuweilen die Spuren heimlich vergossener Tränen, eine tiefe Blässe lag auf ihrem Antlitz, nur auf den Wangen zeigte sich ein unnatürliches Rot und sie machte den Eindruck herben Leides.
Albrecht hatte äußerlich seine Ruhe wieder gefunden, nur trug er oft eine geräuschvolle, ihm sonst ganz fremde Heiterkeit zur Schau und die Nächte verbrachte er nicht auf seinem Lager, sondern in ruheloser Wanderung in seinen, Arbeitszimmer.
Ungefähr eine Woche nach seinem ersten Erscheinen im Schlosse hatte sich der Fremde wieder eingestellt, diesmal in tadellosem Besuchsanzuge, in eleganter Equipage, und hatte dem erstaunten Diener eine Visitenkarte mit dem Namen Alois von Stadler unter der siebenzackigen Krone übergeben.
»Für die Frau Baronin?« fragte der Bediente.
»Zunächst für den Freiherrn,« lautete die Antwort.
Dieser saß an seinem Arbeitstisch, auf dem eine große Menge von Schriftstücken lagen, die der Erledigung harrten.
»Ich bin für niemand zu sprechen,« lautete sein Bescheid an den Diener, als er die Karte von dem silbernen Teller nahm und gleichgültig betrachtete.
»Das kann unmöglich Ihr Ernst sein, lieber Freund, wir sind zu gute Bekannte, als daß Sie sich mir gegenüber verleugnen würden,« ertönte die Stimme des Fremden, der dem Diener unbemerkt gefolgt war.
Dieser war ganz entsetzt über eine solche Zudringlichkeit und erwartete eine harte Abweisung von seinem Herrn.
Zu seiner Verwunderung trat der Freiherr dem Eindringling mit höflichem Gruße entgegen, wenn er auch die ausgestreckte Hand zu übersehen schien und es bei einer Verbeugung bewenden ließ.
»Nicht so förmlich, lieber Wildburg, unter Freunden muß Herzlichkeit herrschen,« rief der Fremde, indem er die Hand des Freiherrn ergriff und kräftig schüttelte. »Sie sind wohl erstaunt, mich so bald wiederzusehen? Ja, ich habe mein Wanderleben aufgegeben und mich in Neustadt häuslich niedergelassen. Mein Junggesellenheim lasse ich mir jetzt behaglich einrichten; an Familienanschluß wird es mir ja nicht fehlen, da ich Sie so in der Nähe habe und Sie werden meine Einführung in die Gesellschaft besorgen.«
Der Diener erwartete noch immer einen Befehl seines Herrn; nun sagte der Fremde, dies gewahr werdend: »Sie schicken wohl erst den Mann fort, ich beabsichtige einen längeren Besuch, wie das unter Freunden üblich ist; er kann meinem Groom den Befehl zum Ausspannen überbringen.«
»Tun Sie nach dem Begehren des Herrn –« sagte der Freiherr, wie sich mühsam besinnend.
»Von Stadler,« ergänzte dieser, und seine Stimme hatte etwas Drohendes, als er hinzusetzte: »Sie scheinen sich schwer auf alte Erinnerungen zu besinnen, wir müssen sie auffrischen.«
Später klingelte der Freiherr und ließ Wein bringen; der Fremde saß bequem zurückgelehnt in einem Sessel und rauchte eine feine Zigarre, der Schloßherr schritt ruhelos im Zimmer auf und ab.
Als er ihn später zu seiner Frau brachte, hatte diese Mühe, ihr Erstaunen zu verbergen. Dieses Raubvogelgesicht, die buschigen Brauen, unter denen ein Paar stechende Augen funkelten, die den Blick anderer nicht ertragen konnten, dazu der boshafte Mund mit den spitzen, gelben Zähnen, alles machte einen abstoßenden Eindruck, und diesen Menschen nannte ihr Gatte seinen Freund! Auch der hochmoderne Anzug erinnerte wohl an Schneider und Friseur, vermochte aber nicht dem Träger das Aussehen eines vornehmen Mannes zu geben.
»Küß die Hand, Gnädigste,« sagte er, »Sie glauben gar nicht, wie ich froh bin, in den Ruhehafen einzulaufen. Wundert mich, daß mein guter Albrecht Ihnen nicht von mir erzählt hat, wir waren früher sehr gute Freunde.«
»Diese Zeiten müssen allerdings dem Gedächtnis des Freiherrn entschwunden sein,« entgegnete Melanie kalt, »und so werden Sie begreiflich finden, daß ich in Ihnen nur einen Fremden sehen kann.«
»Nehm's Ihnen nicht übel, Gnädigste, werden schon mit mir bekannt werden,« fuhr Stadler mit seiner gemachten Zutraulichkeit fort, »denn ich mein', so leicht werden's mich halt nicht los. Der Herr Gemahl hat mich zu Tisch geladen und Gnädigste werden doch nicht so grausam sein, mich nicht an Ihrer Tafel zu dulden.«
Melanie mußte notgedrungen die Einladung wiederholen, aber sie gewann es nicht über sich, ihrem Gast mehr als die unumgänglichste Höflichkeit zu erweisen.
Da man allein speiste, trat der Zwang noch mehr heran. Lilly, der der Fremde zwar auch mißfiel, die aber nicht den gleichen Abscheu wie ihre Schwägerin vor ihm hegte, tat er leid und sie erwies sich ihm freundlich, während Albrecht in tiefe Gedanken versunken war und durch jede Anrede aufgeschreckt wurde.
Alle atmeten auf, als sich Herr von Stadler verabschiedete. Melanie behielt ihre ablehnende Haltung und erwiderte kein Wort auf die Versicherung des Scheidenden, daß er bald wiederkommen werde, so daß Lilly sich veranlaßt fühlte, zu sagen: »Wir werden uns freuen.«
Die Damen blieben auf der Terrasse und der Schloßherr gab seinem Gaste selbst das Geleit.
Melanie erklärte ihm bei seiner Rückkehr, daß sie Befehl geben würde, diesen Menschen ein- für allemal abzuweisen unter dem Vorwande, sie seien nicht zu Hause.
»Ich möchte dich sehr bitten, dies nicht zu tun,« entgegnete der Freiherr in ernstem Ton, »und dem armen Stadler auch in Zukunft das Entgegenkommen zu beweisen, das jeder unserer Gäste von der Herrin des Schlosses erwarten kann und an dem du es leider heute sehr fehlen ließest!«
Noch nie hatte er so zu ihr gesprochen, aber Melanie bezwang sich und versetzte ruhig: »Ich würde ihm die Höflichkeit der Hausfrau nicht versagt haben, wenn seine aufdringliche Vertraulichkeit nicht fortwährend eines Zügels bedurft hätte. Auch hast du nie den Namen Stadler erwähnt und ich bin erstaunt, daß ein solcher Mensch sich auf deine Freundschaft berufen darf.«
»In der Jugend wählt man nicht immer mit Bedacht,« sagte der Freiherr heftig. »Stadler ist bei allen seinen Schwächen das, was man einen guten Kerl nennt, er stammt aus Bayern und die ungezwungene Art der Süddeutschen entschuldigt manches. Bei seinem umherschweifenden Leben mag er sich nicht immer in guter Gesellschaft bewegt haben, und ich muß ihm dies nun erleichtern.«
»Nicht möglich, du wirst ihn doch nicht in unsere Kreise hier einführen wollen!« rief Melanie fast entsetzt aus.
»Das ist meine Absicht, die ich dich bitte, als unabänderlich zu betrachten. Wir wollen eine Gesellschaft geben und bei dieser Gelegenheit werde ich ihn vorstellen.«
»Dann erwarte aber nicht von mir, daß ich anwesend bin und gewissermaßen eine Bürgschaft übernehme, wenn ich diesen Menschen empfange!« rief Melanie aus, indem sie ihre gewohnte Sanftmut ganz verließ.
Mit einem unendlich traurigen Ausdruck sagte ihr Gatte nun: »Arme Frau! Glaube mir, auch ich leide darunter, daß ich so Schweres von dir verlangen muß. Aber es geht nicht anders.«
Melanie begriff, daß ein ihr Unbekanntes zwingende Gewalt über ihren Mann ausübte, sie warf sich in seine Arme und bat ihn ängstlich, ihr alles zu sagen, sie wolle ihm ja gern tragen helfen, er erwiderte zwar ihre Zärtlichkeit, aber er blieb dabei, er habe ihr nichts Besonderes mitzuteilen und sie sei krankhaft überreizt.
Arm in Arm standen sie auf der Terrasse und blickten hinaus in die Gegend; alles, was sie sahen, gehörte ihnen, sie besaßen Reichtum und hohen Rang, wurden hoch geehrt und liebten sich innig, und doch waren sie tief unglücklich. Melanie richtete keine Frage mehr an ihren Gatten, sie richtete sich ganz nach seinen Wünschen, aber ihr Vertrauen war zerstört.
Lilly war so mit sich beschäftigt, daß sie wenig von der schwülen Stimmung um sie her bemerkte; sie freute sich an den häufigen Besuchen des Geliebten, die durch den Zustand seines Patienten herbeigeführt wurden, und sie erblühte täglich schöner. Sie war auch freundlich und gütig gegen alle Menschen, selbst gegen Stadler, der ein häufiger Besucher auf dem Schloß war und aus seiner Bewunderung für Lilly bald kein Hehl machte.
Als sie dies bemerkte, behandelte sie ihn allerdings mit großer Zurückhaltung, ohne daß er sich in seinen Huldigungen stören ließ. So hatte er ihr auch zu dem Feste, das nun stattfand, prachtvolle Blumen geschickt; Lilly hatte sie in eine Vase gestellt, während sie im Gürtel einige Rosen trug, die von Dr. Blanden stammten, und sie erklärte Stadler, als er sich bei ihr beklagte, jene Blumen seien viel zu schön gewesen, als daß sie dieselben für sich allein hätte in Anspruch nehmen wollen.
Sie vermied den ihr so unsympathischen Menschen so viel sie nur konnte, aber er verfolgte sie förmlich mit seiner dreisten Bewunderung. Herr von Stadler fand auch bei den andern Festteilnehmern wenig Gunst; man begegnete ihm mit kühler Zurückhaltung und erstaunte nicht wenig, daß sich der Schloßherr seine Vertraulichkeit, mit der er offenbar großtun wollte, so ruhig gefallen ließ.
Nach ländlicher Sitte hatte das Fest schon am Nachmittag begonnen, abends sollte getanzt werden; vorher zerstreute sich die Gesellschaft durch den herrlichen Park oder in den weiten Räumen des Schlosses, die alle gastlich geöffnet waren und deren Kunstschätze zur Betrachtung einluden.
Dr. Blanden hatte bisher nur die von der Familie bewohnten Gemächer kennen gelernt, aber die Festräume waren ihm fremd und Lilly machte sich mit Vergnügen jetzt zu seiner Führerin.
Jetzt traten sie aus der Rüstkammer, die die von den Wildburgs im Laufe der Jahrhunderte getragenen Waffen enthielt, in die Ahnengalerie, die eine sehr große Anzahl von Bildern aufwies. Einige der Gäste wanderten betrachtend umher, doch wurde es dem jungen Paare nicht schwer, sich von den übrigen abzusondern.
»Bis in das Jahr 1254 gehen die Bilder zurück,« sagte Lilly nicht ohne Stolz, »unser Geschlecht ist uralt; sieh, diesem Wildburg hat der Kaiser Rudolf von Habsburg eigenhändig den Ritterschlag erteilt.«
»Das alles zeigt mir so recht den Abstand zwischen dir und mir, dem Namen- und Elternlosen,« sagte der Doktor traurig.
»Wenn es dir an Ahnen fehlt, so wirst du dir selbst alles zu verdanken haben,« erwiderte das junge Mädchen mit leuchtenden Blicken, »und mit Stolz werde ich dereinst deinen Namen tragen.«
»Wie ist es schrecklich, daß ich nicht offen mit unserem Bündnis hervortreten kann,« sagte der Arzt. »Diese Heimlichkeit erscheint mir unwürdig und verräterisch.«
Lilly seufzte.
»Ich leide ja so sehr darunter,« sagte sie, »aber glaube mir, es muß sein. Warten wir den Erfolg deines Buches ab, dann wird mein Bruder die rechte Schätzung für dich gewinnen. Jetzt würde er uns ein schlimmer Gegner sein und sogar meine Schwägerin würde ebenso denken.«
»Die Baronin ist so gut, könnten wir uns ihr nicht anvertrauen?« fragte der Arzt.
Lilly lächelte trübe.
»Ich glaube kaum. Wollte sie doch selbst einst ihre Liebe zu meinem Bruder zum Opfer bringen, um sich dem damaligen Majoratsherrn zu vermählen. Sein unerwarteter Tod brachte die Lösung.
»Unbegreiflich, daß ein solches Ereignis unaufgeklärt blieb,« sagte der Doktor sinnend. »Das Bild des unglücklichen jungen Mannes befindet sich doch hier?«
»Gewiß, dort jenes Porträt, das letzte Bild stellt meinen armen Vater dar, Albrecht hat sich noch nicht bewegen lassen, sein und Melanies Bild den andern anzureihen, so oft diese in ihn drang. Es ist eine seltsame Laune von ihm. Aber was hast du, Lieber? Du hörst ja gar nicht auf mich und starrst jenes Porträt so an?«
»Was ist damit? Wen stellt es dar?« fragte Dr. Blanden in größter Aufregung.
»Das ist Karl, der älteste Sohn des alten Freiherrn von Wildburg, der Stiefbruder des armen Erwin. Er starb in Papas Armen nach jenem schrecklichen Eisenbahnunglück und das Entsetzen darüber hat den Grund zu Papas Krankheit gelegt.«
»Karl von Wildburg,« wiederholte der Doktor. »Auch ich heiße Karl, weil meine arme Mutter den Ausspruch getan hatte, ihr erwartetes Kind solle diesen Namen tragen. Ich kenne diese Züge, es sind dieselben wie auf dem kleinen Bilde, das ich als Erbe meiner Mutter erhielt. Diese wunderbare Tatsache – der Name – das Todesjahr – das Datum meiner Geburt, alles stimmt.«
Lilly war hocherfreut; zwar begriff sie den Zusammenhang noch nicht vollständig, denn es schien ihr eine außerordentlich günstige Wendung des Geschicks, wenn ihr Geliebter ihrer eigenen Familie angehören sollte. Sie hätte am liebsten ihrem Bruder sofort die Mitteilung gemacht.
Dr. Blanden mußte ihre Freude dämpfen, denn er erklärte ihr, daß er erst die Dokumente über die Schließung einer gültigen Ehe auffinden müsse, sonst bleibe ein Makel auf der Ehre seiner Mutter und der Rechtschaffenheit seines Vaters. Er wollte alles aufbieten, um die Kette zu schließen, von der er soeben wieder einen Ring entdeckt hatte.
Zu Lillys Erleichterung hielt sich Herr von Stadler für den Rest des Abends fern von ihr; er saß am Spieltisch und spielte mit wechselndem Glück; aber man mußte ihm zugestehen, daß er mit Anstand gewann und verlor, und dies stimmte die Herren zu seinen Gunsten, so daß er, als er einigen von ihnen seinen Besuch in Aussicht stellte, die Versicherung erhielt, er werde willkommen sein.
![]()
In dem Befinden des Hauptmanns von Wildburg war eine Verschlechterung eingetreten, so daß Dr. Blanden öfter das Schloß besuchte, als es ursprünglich beabsichtigt gewesen war. Die Baronin hatte mehrere geheime Beratungen mit ihm, denn sie wünschte für ihren Gemahl einen längeren Aufenthalt im Seebade zur Wiederherstellung seiner Nerven, und dieser war nicht dazu zu bewegen.
»Können wir nicht meine Gesundheit zum Vorwande nehmen?« fragte sie den Arzt. »Ich glaube, dann würde sich mein Mann eher zu der Reise entschließen.«
»Und damit sprächen wir nur die Wahrheit, gnädigste Frau. Ich habe zwar nicht die Ehre, Ihr ärztlicher Berater zu sein, aber ich muß doch aussprechen, daß Ihr Aussehen mir Sorge macht und daß Sie der Schonung im höchsten Grade bedürfen.«
»O, das hat nichts zu sagen,« lächelte Melanie. »Wenn mein Gemüt erst wieder ruhig ist, bin ich so wohl wie früher.«
Sie schwieg erschrocken, als habe sie bereits zuviel gesagt und der Arzt gab sich den Anschein, als habe er ihre Äußerung nicht bemerkt.
Dr. Blanden sprach mit dem Freiherrn, der sofort für seine Gemahlin einwilligte, aber zugleich sein Bedauern aussprach, daß er sie nicht begleiten könne; Melanies Bitten waren umsonst und er behauptete, eine ihm aufgezwungene Ruhe würde ihm nur Qual bereiten.
»Dann verzichte ich auch auf die Reise,« sagte Melanie. »Was meinst du, wenn wir, da wir doch beträchtliche Ausgaben dadurch gehabt hätten, nun tausend Mark an die Ferienkolonien schickten? Ich denke, was wir andern Kindern erweisen, das segnet uns der liebe Gott an den eigenen.«

Der Freiherr lachte bitter.
»Du meinst, sie bedürfen besonders des göttlichen Schutzes. Aber der läßt sich nicht erkaufen, und was dem Fluche verfallen ist, kann nicht gerettet werden.«
»Um Gottes willen, wie sprichst du, Albrecht,« rief die Baronin entsetzt aus. »Ich sehe nur ein Unheil, dasjenige, daß du dich von so furchtbaren Vorstellungen beherrschen läßt.«
»So achte nicht darauf, liebes Kind; ich wußte selbst kaum, was ich sprach. Es tut mir sehr leid, dir deine Bitte abschlagen zu müssen, aber ich kann die Summe jetzt nicht entbehren. Ein Hauptgrund, daß ich gegen die Badereise bin, ist der, daß ich die Kosten scheue.«
Melanie sah ihren Mann mit ungläubigem Erstaunen an. Stets hatte sie von seinem großen Reichtum gehört, und nun sollten einige tausend Mark für ihn von Bedeutung sein.
Plötzlich überfiel sie die Angst, sein reicher Geist möchte sich verwirrt haben, dies eine Wahnvorstellung von ihm sein!
»Ich bin von mancherlei Verlusten heimgesucht,« fuhr der Freiherr fort, »und so schwer es mir wird, habe ich mich zum Verkaufe von Hohenwalde entschlossen.«
»Welcher Jammer! Dieses prachtvolle Gut!« sagte die Baronin. »Könnten wir es denn nicht halten! Du hast ja überall Kredit, die Ernteaussichten sind günstig, deine industriellen Unternehmungen stehen in voller Blüte und im Haushalt könnte ich mancherlei Einschränkungen vornehmen, die ich bisher nicht für nötig hielt.«
»Dafür würde ich dir sehr dankbar sein, sonst aber muß ich dich bitten, alles meinem Ermessen zu überlassen. Frauen sollten sich nie in geschäftliche Angelegenheiten mischen. Übrigens habe ich in Herr von Stadler einen sehr annehmbaren Käufer gefunden.«
»In ihm! O Albrecht, gib ihm das Gut nicht, und wenn er dir eine noch so hohe Summe bietet!« rief Melanie in tiefster Erregung aus. »Ich habe ein Grauen vor diesem Menschen, und gelangt er in den Besitz von Hohenwalde, so scheitert meine letzte Hoffnung, daß alles wieder gut werden wird. Seit er hier erschien, hast du mir dein Vertrauen entzogen und bist du ganz verändert.«
Der Freiherr stampfte zornig mit dem Fuße. »Immer dasselbe Lied! Du bist nicht besser als andere Weiber! Weil es dem armen Stadler nicht geglückt ist, sich deine Gunst zu erwerben, dichtest du ihm alles mögliche an. Er ist mein Freund aus früheren Tagen, und ich leugne nicht, daß ich ihm noch Verbindlichkeiten schulde. Als kluge Frau solltest du dich in die Verhältnisse fügen, statt dessen erschwerst du mir das Leben.«
Melanie blieb in tiefster Betrübnis zurück, als ihr Gatte sie verließ. Sie wollte sich bei ihren Kindern Trost und Seelenfrieden holen und ging in den Park, wo sie wie gewöhnlich mit ihrer Kinderfrau weilten.
Frau Brandt war durch Kummer und Sorge früh gealtert, sie grämte sich um ihren verschollenen Sohn und hatte erst wieder einigermaßen Ruhe erlangt, als die Baronin Wildburg ihr ein Asyl gewährte. Sie hing an den ihr übergebenen Kindern mit zärtlicher Liebe und behütete sie Tag und Nacht; nur in den Salon begleitete sie sie nicht, wenn Besuch da war, denn sie hatte eine Abneigung gegen Fremde, und so gestattete Melanie ihr gern, sich dann durch die zweite Wärterin, die ihr zur Unterstützung beigegeben war, vertreten zu lassen.
Die Kinder liefen ihrer Mutter jubelnd entgegen und im Getändel mit ihnen vergaß Melanie auf einige Zeit ihre Sorgen. Das Geräusch eines herannahenden Wagens schreckte sie aus diesem Spiel auf.
Es war Herr von Stadler, der sie ehrerbietig grüßte und dem sie mit eisiger Kälte dankte. Trotzdem warf er dem Groom die Zügel zu, sprang ab und näherte sich ihr, ihr in seiner schwulstigen Weise allerlei Verbindliches über ihr Mutterglück sagend.
»Diese reizenden Kleinen! Ich muß ihre nähere Bekanntschaft machen! Wie freut es mich, daß ich sie unter meinen Augen heranwachsen sehen werde, ich bin ja ein so treuer Freund ihres Vaters. Nicht wahr, du wirst mich auch lieb haben, liebes Kind?« wandte er sich an Edith und wollte ihr Händchen ergreifen.
»Nein, du bist zu häßlich, du siehst wie ein Menschenfresser aus,« antwortete diese mehr aufrichtig als höflich.
Stadler wurde rot vor Zorn, suchte aber seinen Arger hinter einem Lachen zu verbergen.
»O weh, die kleine Dame hegt nicht mehr Wohlwollen für mich als die gnädige Mama. Das habe ich doch nicht verdient. Wollen Sie nicht ein gutes Wort für mich einlegen, gnädige Frau?«
»Edith ist schwer zu beeinflussen,« erwiderte die Baronin mit großem Stolz, »ich will ihr aber sagen, daß Sie noch keine Menschen gefressen haben.«
»Danke untertänigst für so viel Gnade, vielleicht werden Gnädigste mir eine bessere Fürsprecherin, wenn Sie mich näher kennen lernen,« entgegnete Stadler, und es lag etwas wie eine versteckte Drohung in seinem Ton.
Ehe sie etwas erwidern konnte, wurde sie durch einen lauten Schrei erschreckt und erblickte die alte Kinderfrau, totenbleich, mit ausgestrecktem Arm, die Augen starr auf Herrn von Stadler gerichtet.
»Mein Sohn! Mein Paul!« schrie sie auf und wollte auf ihn zueilen.
Stadler hatte sich beim Laut ihrer Stimme umgewandt und sie wild angestarrt; auch er war blaß geworden, faßte sich aber sogleich wieder.
»Was wollen Sie, gute Frau? Ich verstehe Sie nicht,« sagte er mit erzwungener Ruhe.
»Kennst du mich denn nicht, mich, deine Mutter?« fing die alte Frau wieder an. »O, daß ich das noch erleben muß. Du bist sehr verändert, bist ein feiner Herr geworden, aber ich erkannte dich doch auf den ersten Blick. Freust du dich denn gar nicht?«
»Was hat die arme Frau? Ist sie nicht ganz zurechnungsfähig?« fragte Stadler die Baronin.
»Sie ist durchaus klar und vernünftig,« entgegnete diese. »Ich begreife den Zusammenhang nicht.«
Frau Brandt beteuerte laut, daß dies ihr Sohn sei und fing bitterlich zu weinen an, weil er nichts von ihr wissen wollte.
Nun schien Stadler die Geduld zu verlieren und er sagte: »Sie sind entweder verrückt oder betrunken und ich kann der Frau Baronin nur raten, eine solche wahnwitzige Person von ihren Kindern fern zu halten. Was mich betrifft, so bitte ich mir ein für alle Male aus, daß Sie mich in Frieden lassen.«
Er lüftete den Hut vor der Schloßfrau und wandte sich achselzuckend ab, um seinen Wagen zu besteigen und dem Schlosse zuzufahren, während die alte Frau ihm weinend und an allen Gliedern bebend nachsah und mit ihren Beteuerungen und Klagen fortfuhr.
Melanie suchte sie zu beruhigen; sie wußte selbst nicht, was sie denken sollte.
Als der Freiherr den Vorfall erfuhr, war er sehr ärgerlich; er ließ die alte Frau rufen, gebot ihr Schweigen und verbat sich jede Belustigung seiner Gäste durch ihre Einbildungen.
Sie hörte ihn betrübt an und schlich weinend von dannen; überzeugt war sie nicht.
Der Verkauf von Hohenwalde erregte in der ganzen Gegend großes Aufsehen. Stadlers Stellung änderte sich nun sehr; hatte man ihn so lange wie eine Art Abenteurer betrachtet, so gehörte er nun zum angesessenen Adel.
Er ließ das Herrenhaus von Hohenwalde sehr schön und geschmackvoll einrichten und übte eine sehr angenehme Gastfreundschaft aus, unterstützt durch eine reich besetzte Tafel und die edelsten Weine. Bald waren die jungen Herren vom Adel sowie die Offiziere der benachbarten Garnison oft gesehene Gäste bei ihm, er veranstaltete große Jagden, aber man munkelte auch von hohem Spiel, das unter seinem Dach statthatte und bei dem große Geldsummen hin- und herflogen.
![]()
Melanie hatte noch nie das Herannahen des Winters mit solcher Freude begrüßt, wie in diesem Jahre, weil sie dann aus Stadlers verhaßter Nähe kam. Sie fühlte sich müde und matt; oft raubten ihr heftige Schmerzen den Atem und ein leises Hüsteln, das sie vergeblich zu unterdrücken suchte, erschütterte ihre Brust. Einen Arzt wollte sie nicht befragen, weil sie überzeugt war, die Ursache ihres Leidens liege in seelischen Zuständen, und es könne nicht besser mit ihr werden, so lange sie sich in stiller Sorge verzehrte.
Mit dem Hauptmann von Wildburg ging es sichtlich zu Ende; die Umnachtung seines Geistes nahm in erschreckender Weise zu, und der Freiherr hielt es nun für das beste, die Häuslichkeit seines Vaters aufzulösen und diesem in dem großen Hause, das er selbst bewohnte, eine Wohnung einzurichten, um so jeden Augenblick zum Beistände bereit zu sein. Während Lilly zwar das Aufgeben der eigenen Selbständigkeit bedauerte, aber doch im ganzen zustimmte, glaubte Melanie den wahren Grund dieser Maßregel in den dadurch erzielten Ersparnissen zu sehen. Diese Sparsamkeit des Freiherrn machte sich überall geltend; einige Luxuspferde wurden abgeschafft, die Loge im Opernhause nicht wieder genommen, einige Diener entlassen; trotz alledem schien Albrechts Kasse nicht gefüllter zu werden; einmal hatte er sogar die immerhin beträchtliche Summe, die er ihr monatlich zur Führung des Haushalts übergab, nicht zur Verfügung gehabt, obwohl dieselbe längst fällig war. Wo blieb das Geld? Spielte er oder was hatte er sonst für geheime Ausgaben?
Herr von Stadler war kurze Zeit nach ihnen in die Residenz übergesiedelt. Melanie mußte ihn in ihrem Hause dulden und es mit ansehen, daß er sich unter dem Schutze ihres Gatten in die Gesellschaft drängte. Sie behielt ihre ablehnende Haltung; Lilly vermied ihn jetzt gleichfalls, seit sie zu bemerken glaubte, daß er die Freundlichkeit, mit der sie anfangs Melanies hochmütige Zurückhaltung auszugleichen suchte, mißverstand.
Das junge Mädchen lebte im Hause ihres Bruders sehr still und zurückgezogen, wozu ihr das Befinden des Vaters die Erklärung bot. Was lag ihr an Gesellschaften und Vergnügungen? Sie hatte nur den einen Wunsch, endlich mit dem Geliebten vereint zu sein, und sie ersehnte das Erscheinen seines Buches, auf das sie so große Hoffnungen setzte.
Nun war es endlich soweit und sie hielt das Werk in der Hand, auf dessen Titelblatt der teure Name als der des Verfassers stand.
Dann folgten schwere Tage der Erwartung, bis die Kritik sich über das Werk ausgesprochen hatte und nun brach eine Zeit des Triumphes für sie an, denn alle Urteile lauteten mehr als günstig, das Buch machte großes Aufsehen, sehr bald wurde eine zweite Auflage nötig und der Verfasser hatte einen berühmten Namen erlangt.
Mit hoffendem Herzen entließ sie Dr. Blanden, als er sich zu ihrem Bruder begab, um seine Werbung vorzubringen; wie sehr hatte die Heimlichkeit ihres Verlöbnisses auf ihnen beiden gelastet, jetzt konnte Albrecht nicht mehr feindlich sein, denn sein Werk sprach ja so beredt für ihren Erkenner.
Aber Lilly mußte lange harren, noch immer zögerte die Entscheidung. Endlich faßte sie sich ein Herz und begab sich nach Albrechts Zimmer, in dem sie laut und heftig sprechen hörte. Ihr Klopfen blieb unbeachtet, rasch entschlossen öffnete sie die Tür und trat ein. Beide Männer standen sich erregt gegenüber, offenbar in feindseliger Stimmung.
»Was willst du hier?« fuhr sie der Freiherr an. »Mit dir werde ich später reden. Was ich dir zu sagen habe, geschieht am besten unter vier Augen.«
»Ich werde nicht dulden, daß Lilly gekränkt wird!« rief der Doktor aus, »Sie haben mir genug Bitteres gesagt, was ich um ihretwillen ertrug.«
»Mit welchem Recht führen Sie eine solche Sprache, mein Herr Doktor?« fragte der Freiherr mit vernichtendem Hohn. »Wenn es Ihnen gelungen ist, ein junges Mädchen zu betören, dem Sie in Ausübung Ihres Berufs sich nahen durften, so werde ich meine Schwester zu den Ansichten und Grundsätzen zurückführen, die einzig für sie maßgebend sein können und sie wird dann einsehen, daß Beziehungen zwischen der Freiin Lilly von Wildburg und einem Herrn Dr. Blanden unmöglich sind.«
»Das wird nie geschehen!« rief Lilly aus.
»Du hast unbedacht und unverständig diesen Herrn ermutigt, wie ich zu meinem Bedauern erkenne,« fuhr der Freiherr fort. »Glücklicherweise stehst du unter meiner Autorität als Familienoberhaupt und ich verbiete dir jeden Gedanken an eine solche Verbindung mit diesem Herrn, der solchen Vertrauensbruch begangen hat.«
»Diesen Vorwurf habe ich bereits zurückgewiesen,« sagte der Arzt. »Allerdings hatten sich unsere Herzen schon lange gefunden und es kam zu einer Aussprache vor der von mir beabsichtigten Zeit. Aber was ich erhoffte, ist erreicht; mein Name hat einen guten Klang, es ist mir bereits auf Grund meines Buchs die Berufung an eine Universität in Aussicht gestellt. So werde ich den Namen meiner Pflegeeltern mit Ehren tragen. Vielleicht habe ich Aussicht, das Dunkel meiner Geburt zu klären und dann ist es möglich, daß ich demselben Geschlechte angehöre, dem Lilly entsprossen ist.«
Der Freiherr lachte höhnisch auf. »Sie erzählten ja soeben eine märchenhafte Geschichte, die aber höchstens die Illegitimität Ihrer Herkunft beweisen kann, da Sie selbst den gänzlichen Mangel von Dokumenten, besonders eines Trauzeugnisses, zugeben.«
»Ich werde nicht ruhen, bis meine Bemühungen und Nachforschungen mit Erfolg gekrönt sind,« entgegnete der Arzt. »Die Achtung vor dem Andenken Ihres verstorbenen Vetters sollte Sie, Herr Baron, moralisch überzeugen, daß es sich um eine Eheschließung, nicht um ein unlauteres Verhältnis gehandelt hat.«
»Da trauen Sie mir allerdings eine große Uneigennützigkeit zu, Herr Doktor,« sagte der Freiherr. »Es scheint Ihnen nicht klar zu sein, welche Zumutung Sie mir stellen. Entspräche Ihre Behauptung der Wahrheit, so wären Sie der einzig berechtigte Erbe von Wildburg und es bliebe mir nur übrig, alles, was ich besitze, Ihnen auszuliefern. Wenn ich auch Ihre Kühnheit, sich durch eine solche Fabel Namen und Vermögen zu verschaffen, bewundere, so gehöre ich doch natürlich nicht zu den Gläubigen.«
Doktor Blanden wollte auffahren, bezwang sich aber mit Mühe.
»Es ist genug, Herr Baron,« sagte er ruhig. »An alle diese Folgerungen hatte ich nicht einmal gedacht, ich wollte nur für die Ehre meiner Eltern und um mein gutes Recht kämpfen. Leben Sie wohl, Ihr Haus werde ich natürlich nicht mehr betreten.«
»Aber ich stehe zu dir und bleibe dir treu!« rief Lilly aus.
»Und ich hoffe auf die Erfüllung deines Wortes, meine Lilly, wenn ich mein Ziel erreicht habe,« sagte der Arzt.
»Du vergißt, daß du mir zu gehorchen hast und ich verbiete dir jeden solchen Gedanken als deiner selbst und deiner Familie unwürdig,« entschied der Freiherr.
Das junge Mädchen richtete sich stolz aus.
»Ich erkenne nur die Macht der Liebe an und bin stolz, daß ein solcher Mann mich seiner wert hält,« sagte sie mit Würde. »Wenn er mich ruft, folge ich ihm, und müßte ich auch auf alles verzichten, was mir bisher teuer war.«
»Törichte Romantik eines irregeleiteten Mädchens,« sagte der Freiherr verächtlich. »Solange du in meinem Hause und unter meinem Schutze lebst, verbiete ich dir jeden Verkehr mit diesem Herrn. Im andern Falle verläßt du mein Haus und wir sind uns hinfort fremd.«
»Und der Vater?« fragte Lilly.
»Der bleibt natürlich in meiner Obhut, du scheidest dich von ihm.«
»Wie vermöchte ich das,« rief Lilly aus. »So lange er lebt, gehöre ich zu ihm. Sei doch barmherzig, Albrecht.«
Der Freiherr würdigte sie keiner Antwort und entzog ihr seine Hand, nach der sie flehend griff.
Nun zog sie Dr. Blanden an sich und schloß sie einen Augenblick in seine Arme, indem er sagte: »Mut, meine Lilly. Wir müssen uns trennen; jedes von uns hat eine Aufgabe zu erfüllen. Unsere Liebe ist treu und unerschütterlich, die Hindernisse werden zu beseitigen sein. Lebe wohl!«
Er küßte sie, verbeugte sich gegen den Freiherrn und verließ das Zimmer.
Der letztere blickte ihm fast mit Verachtung nach, denn er sah in ihm einen Betrüger, der aus vergangenen Irrungen den größtmöglichen Nutzen für sich ziehen wollte. Für seine Schwester empfand er dagegen ein zärtliches Mitleid, sie war eine Betörte und er klagte sich selbst und Melanie an, daß sie die arme Kleine gegen einen solchen Menschen nicht besser behütet hätten.
So hatte er kein Wort des Tadels für Lilly, sondern suchte sie zu trösten, und Melanie verfuhr ebenso milde und schonend, obgleich sie ebenso sehr wie ihr Gatte gegen eine Verbindung mit dem Arzte war, den sie als nicht gleichstehend betrachtete. Solche Neigung mußte bekämpft werden, sie war ja auch einst bereit gewesen, ihrer Liebe zu entsagen, dann hatte sich alles so wunderbar gefügt, sie hatte sich für die glücklichste Frau der Erde gehalten, bis das Leid sie dennoch ereilte. Wie viel schwerer war die Bürde, die sie trug, als der Liebesgram eines jungen Mädchens.
![]()
Herr von Stadler wußte bei seinen häufigen Besuchen im Wildburg'schen Hause mit vieler Geschicklichkeit ein Zusammentreffen mit der alten Kinderfrau zu vermeiden; geschah dies dennoch, so verhielt sich Frau Brandt zwar stumm, sie geriet aber in eine furchtbare Erregung. Der Freiherr schlug nun vor, sie zu entlassen, doch davon wollte Melanie nichts hören, und so blieb alles beim alten.
Während Stadler alle Vorrechte eines Hausfreundes in Anspruch nahm, ertrug Melanie seine Gegenwart kaum noch und sie fand es unmöglich, ihre Abneigung zu verbergen. Er schien das kaum zu bemerken und versuchte sich Beachtung zu erzwingen und so behandelte sie ihn wie Luft.
Dies war wiederum an einem der Gesellschaftsabende der Baronin geschehen; sie hatte kaum seinen Gruß erwidert und ihn sonst mit auffallender Geringschätzung übersehen, und er war in solche Wut geraten, daß er die Nacht mit Racheplänen verbrachte.
Stadler wußte, daß der Freiherr durch ein parlamentarisches Diner lange festgehalten sein würde und so sandte er an die Baronin einen Brief, in dem er sie um eine Unterredung bat, von der Glück und Leben anderer Menschen abhinge.
Melanie fühlte die versteckte Drohung und ihr Herz krampfte sich in ahnungsvollem Bangen zusammen; sie besaß aber auch Mut und hielt es für das beste, sich endlich einmal Klarheit über Stadlers Verhalten zu schaffen.
So empfing sie ihn, bleich und ruhig, unnahbar stolz. Er begann sogleich:
»Ich danke Ihnen, gnädige Frau, daß Sie mir Gelegenheit geben, Ihnen zu beweisen, wie sehr ich Ihr Freund und der Ihrer Kinder bin.«
»Ein Vorzug, auf den ich ohne Bedauern verzichte,« sagte die Baronin hochmütig. »Ich bin gewohnt, mir meine Freunde selbst auszuwählen.«
»Und auf mich wäre Ihre Wahl nie gefallen,« ergänzte Stadler. »Bin ich Ihnen doch stets als ein Eindringling in Ihr Haus erschienen und als solcher von Ihnen behandelt worden. Deshalb will ich Ihnen Klarheit verschaffen. Aber was ich Ihnen mitzuteilen habe, ist nur für Ihr Ohr bestimmt. Wir sind hier sicher vor jeder Störung?«
Unwillkürlich fühlte sich die Baronin in der Gewalt des verhaßten Menschen und sie antwortete matt: »Ich bin bereit, Sie anzuhören.«
»So bitte ich untertänigst, den Befehl zu geben, daß niemand eintreten darf.«
Sie klingelte und tat nach seinem Begehren und dann wies sie ihm einen entfernten Sessel an; er rollte denselben aber dicht an sie heran, indem er sagte: »Es geschieht in Ihrem Interesse, Frau Baronin, jedes laute Wort muß vermieden werden.«
»Sprechen Sie endlich,« sagte sie ungeduldig.
»Ganz nach Ihrem Befehl, gnädigste Frau Baronin. Sie müssen mir schon einen längeren Bericht gestatten. Erst will ich mich Ihnen vorstellen als das, was ich in Wahrheit bin, als Paul Brandt, den Sohn Ihrer Kinderfrau.«
»So sind Sie also ein frecher Betrüger, und der Freiherr soll noch heute erfahren, wie Sie ihn hintergangen haben!« rief Melanie aus. »Weitere Geständnisse bedarf es nicht, wir sind zu Ende.«
Sie wies mit einer nicht mißzuverstehenden Bewegung nach der Tür, aber Stadler blieb ruhig sitzen und versetzte frech:
»Wie gut Ihnen diese Entrüstung steht, gnädige Frau. Aber Sie müssen mich weiter anhören und ich muß mit mir beginnen, so wenig Anteil Sie auch an mir nehmen. Das Schicksal hat mich also wenig begünstigt und ich trieb mich in der Welt umher, um mein Los zu bessern. Schätze sammelte ich dabei nicht, aber ich erwarb Gewandtheit, Entschlossenheit und die Kunst, den Augenblick auszunutzen.«
»Ihr Lebensweg hat in der Tat keine Bedeutung für mich,« unterbrach ihn die Baronin.
»Diese Vorausschickungen sind unerläßlich, ich werde sogleich zu interessanteren Dingen übergehen,« sagte der Erzähler. »Vor ungefähr sechs Jahren hatte ich eine sonst gute Stellung als Buchhalter in einem Hotel gefunden, war aber schon wieder mit meinem Prinzipal in Meinungsverschiedenheiten geraten. Es war der Tag vor Pfingsten, das Hotel war überfüllt, ich schlief in meinem Zimmerchen neben der Portierloge, als mich das Verlangen eines Fremden nach dem Schlüssel, womit die Kähne im nahen See festgemacht waren, weckte.«
»Wo war das?« fragte Melanie atemlos.
»Auf Stubbenkammer. Fängt meine Geschichte an Sie zu interessieren, gnädige Frau? O, Sie werden mir das Lob nicht versagen, daß ich Sie in Spannung erhalten habe. Also, die Neugier trieb mich ans Fenster. Ich gewahrte einen Mann, dem sich ein zweiter zugesellte, beide jung und gut gekleidet. Ich schwang mich hinaus und folgte ihnen, sie wandten sich dem Herthasee zu. Der Kleine, derselbe, der den Schlüssel verlangt hatte, war mit dem Vorhaben nicht einverstanden, aber sein Gefährte bestand darauf; sonst befanden sie sich im besten Einvernehmen, plauderten, lachten und rauchten ihre Zigarren, die wie Glühwürmchen durch das nächtliche Dunkel schimmerten. Nun lösten sie die Kette, nachdem sie das Schloß geöffnet hatten, sprangen in den Kahn und stießen vom Lande. Plötzlich ertönte ein Schuß, der Kahn geriet ins Schwanken, dann sah ich nur noch eine Gestalt.«
»Und Sie ließen den Mord geschehen und eilten dem Überfallenen nicht zu Hilfe?« rang es sich mit Mühe von den bleichen Lippen der Baronin.
»Zuerst lähmte mich das Entsetzen, wohl auch die Furcht, denn ich mußte mir sagen, daß ich es mit einem erbarmungslosen Menschen zu tun haben würde, der die zweite Kugel nicht gespart hätte, um sich des gefährlichen Zeugen zu entledigen; dann fesselte mich auch eine mit Grausen gemischte Neugier. Der Mann im Kahn beschäftigte sich nun mit dem leblosen Körper, durchsuchte die Taschen und steckte von ihrem Inhalt zu sich, auch Uhr und Kette nahm er an sich und zog dem Toten einen Ring vom Finger.«
»Also ein schändlicher Raubmord, verübt von einem Elenden!« sagte die bebende Frau mit tonloser Stimme.
»Zuerst dachte ich es auch, doch bald sollte ich andern Sinnes werden,« fuhr der Erzähler fort. »Der Mörder lenkte den Kahn ans Ufer, sprang heraus und begann Steine aufzulesen. Damit füllte er die Taschen der Leiche, lenkte auf den See zurück, in dessen Mitte hob er den leblosen Körper mit beiden Armen empor und stürzte ihn in das Wasser, das sich mit dumpfem Geräusch über der Untat schloß. Dann schöpfte er Wasser in das Fahrzeug, wohl, um es von etwaigen Blutspuren zu reinigen, danach befestigte er es wieder an der Kette und schritt in den Wald. Unter einer Buche, die von üppigem Unterholz umgeben war, kniete er nieder und begann ein Loch in die Erde zu graben; es dauerte lange, denn er machte es sehr tief. Hier hinein versenkte er, was er dem Toten abgenommen hatte. Der Mond schien hell auf ihn, als er jetzt sein Angesicht erhob und ich erkannte –«
»Um Gottes willen, sprechen Sie den Namen nicht aus!« schrie Melanie auf und umklammerte seinen Arm.
»Ihr Wort ist mir Befehl, gnädige Frau, auch ohne den Namen verstehen wir uns,« sagte Stadler mit einer Verbeugung. »Der Namenlose verließ nun die Stelle und verschwand im Walde, ich blieb wie betäubt zurück. Nach langer Zeit schlich ich zu der Buche, nachdem ich nirgends mehr ein Geräusch vernahm. Nur der tastenden Hand verriet sich die gelockerte Erde. Ich grub und schaufelte; endlich fand ich die Brieftasche des Ermordeten, dazu seine Uhr mit Kette, auch seinen Brillantring; ich nahm alles an mich und noch einen Fund von größter Wichtigkeit. Dann stampfte ich die Erde wieder zu und schlich davon; das Gewitter, das nun losbrach, beseitigte die letzten verdächtigen Anzeichen der nächtlichen Tat.«
Hier schwieg Stadler und betrachtete die in furchtbarster Seelenqual ringende Frau.
Plötzlich ging eine Veränderung mit ihr vor, sie richtete sich auf und schleuderte ihm verachtungsvoll die Worte zu: »Sie sind der Mörder! O, jetzt ist mir alles klar. Sie haben den Unglücklichen getötet und beraubt und nun klagen Sie meinen Mann an, der schwach genug war, aus Scheu vor der Beschimpfung Ihr Schweigen erkaufen zu wollen! O, warum war Albrecht nicht offen gegen mich! Aber nun ist Ihre Macht zu Ende. Ich erhebe die Anklage gegen Sie wegen Erpressung und ruhe nicht eher, als bis Sie die Strafe erreicht hat.«
Mit wogendem Busen und blitzenden Augen stand die Frau da, zum Äußersten entschlossen.
Stadler weidete sich voll Hohn an ihrer Erregung und antwortete mit einer Gelassenheit, die seine Worte noch verletzender machte: »Sie übersehen einen Umstand, gnädige Frau, der alle Ihre Behauptungen umwirft und Zeugnis ablegt.«
»Sprechen Sie!« herrschte ihm Melanie zu.
»Ich gebe zu, daß ich das Eigentum des Toten an mich nahm und die Banknoten für mich verausgabte, aber einen Gegenstand behielt ich, er wird Ihnen nicht unbekannt sein, Frau Baronin.«
Damit entfernte er sorgfältig die Hülle von einem Päckchen, das er aus seiner Tasche zog und legte vor sie eine Manschette, vergilbt und mit dunkeln Flecken bespritzt, mit einem goldenen Knopf geschlossen, dessen Monogramm ein A und ein W und darüber die siebenzackige Krone zeigte. Wie wohl war Melanie dies Zeichen vertraut, das ihr Gatte auf allen seinen Sachen führte. Nun breitete Stadler auch noch ein Taschentuch vor ihr aus mit denselben Flecken und den Abdrücken von Fingern in bräunlicher Färbung, welche eine so fürchterliche Bedeutung hatte, und auch hier das Monogramm mit der Krone.
Die Baronin war wie vernichtet und Stadler fuhr fort: »Vor meinen Augen trocknete der Mörder seine blutigen Finger an diesem Tuch ab, zog er die befleckte Manschette von seiner Hand, wohl ohne an den Knopf zu denken und vergrub beides mit den andern Sachen, deren Fehlen die Idee eines Raubmordes erwecken sollte.«
»Warum schwiegen Sie so lange und warum sprechen Sie jetzt?« fragte die Baronin.
»Für beides hatte ich triftige Gründe. Ich war arm und freundlos, weshalb mich in eine lange peinliche Untersuchung verwickeln lassen. Durch die Banknoten, die ich der Brieftasche entnahm, war ich vorläufig vor Not geschützt und die Beweise blieben mir. Natürlich folgte ich den Verhandlungen über den Mord mit größter Spannung. Von dem nunmehrigen Erben von Wildburg blieb jeder Verdacht fern. Nach seiner Angabe war er mit seinem Vetter nur bis Stettin zusammengereist, seine Anwesenheit auf Stubbenkammer war in dem Gewühl der Fremden ganz unbemerkt geblieben. Ich selbst führte bald meine Entlassung herbei und dann trieb mich meine Reiselust wieder in die Welt hinaus. Als ich des Wanderlebens überdrüssig und ziemlich in Not geraten war, suchte ich Albrecht auf und hatte eine freundschaftliche Aussprache mit ihm. Er zeigte sich verständnisvoll, edel und großmütig. Sie, gnädigste Frau, behandelten mich um so härter. Das wird jetzt anders werden. Wir müssen Freunde bleiben. Hier ist meine Hand, schlagen Sie ein.«
Er reichte ihr die Hand, aber Melanie stieß sie mit einer Gebärde des Abscheus zurück.
Ihm stieg die Zornesröte ins Gesicht und er rief aus: »Hüten Sie sich. Nicht ich habe die Entdeckung zu fürchten, und Sie sind in meiner Gewalt. Sie brauchen Zeit, um sich zu sammeln und Ihre Lage zu begreifen. Aber von jetzt an erwarte ich die Rücksicht von Ihnen, die Sie mir schuldig sind.«
Damit verließ er sie und sie blieb ganz vernichtet zurück. Mühsam schleppte sie sich nach der Tür, um den Riegel vorzuschieben und sich vor Überraschung zu sichern.
Furchtbare Stunden zogen an ihr vorüber und sie war eine Beute der widerstreitendsten Gefühle. Zuerst empfand sie nur Abscheu vor ihrem Gatten und das Verlangen, sich von ihm loszureißen, um mit ihren Kindern den verbrecherisch erworbenen Reichtum von sich zu tun und sie vor dem Fluche zu bewahren, der ihr Erbteil sein mußte. Allmählich erwachte ein unsägliches Mitleid in ihrem Herzen. Was mußte Albrecht in seiner Seele leiden. Er war ja ursprünglich gut und edel und doch hatte er eine so furchtbare Tat begangen. Aber sühnte er diese nicht durch sein Leben und Streben, das den höchsten Zielen galt? Und für wen hatte er gesündigt? Doch um sie, die er liebte, und die sich ihm versagte, um dem vom Glück begünstigten Erben anzugehören. So trug sie einen Teil der Schuld. Wie hatte er sie geliebt, wie sie so glücklich gemacht!
Nein, sie würde ihn nicht verlassen, sie würde treu zu ihm stehen, mit ihm leiden und büßen. Jetzt verstand sie ihn erst völlig, besaß sie den Schlüssel zu seinem Wesen. Kein Wort, kein Blick sollte ihm ihre Mitwissenschaft verraten, aber sie wollte ihm in unverbrüchlicher Treue und doppelter Hingebung angehören bis in alle Ewigkeit.
Eine wunderbare Ruhe kam über die unglückliche Frau. Es war ihr, als sei sie in dieser Stunde für jede Freude des Daseins gestorben, als lebe sie nur noch, um ihre große Aufgabe zu erfüllen. Sie überdachte nochmals, was sie soeben erfahren, und ging dann innerlich beruhigt zu ihren Kindern, wo sie Lilly antraf.
In der letzten Zeit hatte eine gewisse Entfremdung zwischen den Schwägerinnen geherrscht; heute schlang Melanie ihren Arm um das junge Mädchen und zog sie an sich; Lilly erwiderte ihre Umarmung mit zärtlicher Liebe, aber sie blickte sie auch besorgt an und forschte nach der Ursache ihres bleichen und verstörten Wesens.
»Es ist nichts, nur ein schlimmer Kopfschmerz,« versicherte Melanie, »und dann steigen so düstere Gedanken in mir auf, deren ich nicht Herr werden kann. Nicht wahr, Lilly, du nimmst dich meiner Kinder an, wenn ich nicht mehr bei ihnen bin. Sie bedürfen wohl mehr des Schutzes als alle andern. Denke an den Fluch, der auf dem Erben von Wildburg ruht,« setzte sie schaudernd hinzu.
Lilly suchte sie zu beruhigen; sie hielt sie für krank und drang in sie, sich niederzulegen. Endlich mußte ihr Melanie willfahren und nun setzte sich die Schwägerin vor ihr Bett, nahm ihre Hand und redete ihr liebevoll zu. Erst als sich der Schlaf auf die verweinten Augen der armen Frau gesenkt hatte, verließ sie dieselbe.
Aber Melanie fand auch im Schlummer keine Ruhe; furchtbare Schreckbilder peinigten ihre Träume, mit einem Schrei des Entsetzens fuhr sie empor, sie hatte Albrecht vor sich gesehen, blutbefleckt, etwas Weißes, das die furchtbaren Flecken zeigte, in der Hand.
Als sie die Augen aufschlug, erblickte sie ihn in Wahrheit, bleich und ernst, aber voll inniger Liebe sich um sie bemühend.
Sie richtete sich empor und schlang die Arme um seinen Hals. Er zog sie an seine Brust und hielt sie lange so. Ohne ein Wort zu sprechen, empfanden die Gatten, wie treu und fest ihre Gemeinschaft war und daß sie nichts zu trennen vermochte als der Tod.
![]()
Melanie ging still und gefaßt ihren Weg. Stadler begegnete ihr mit scheinbarer Überlegenheit; er hütete sich vor einem Mißbrauch der erlangten Macht, aber sie empfand dennoch in jeder Minute ihre Abhängigkeit und suchte ängstlich jeder Forderung zuvorzukommen, die er an sie stellen mochte.
So entschloß sie sich auch zur Entfernung der alten Kinderfrau, die in dem zu Wildburg gegründeten Waisenhause angestellt wurde. Diese selbst erhob keinen Widerspruch; so schwer sie sich von den ihr so lieben Kindern trennte, so regten sie doch die Begegnungen mit Stadler jedesmal so sehr auf, daß sie lieber den Platz räumte.
Stadler ließ sich bei Melanie melden und sie wagte nicht, ihn zurückzuweisen. Er sprach ihr seinen Dank aus, daß sie die ihm so lästige Frau entfernt habe. Zugleich erbat er sich von ihr eine Beihilfe in finanzieller Beziehung, er sei in augenblicklicher Verlegenheit und wolle Albrecht nicht gern belästigen.
Ohne ein Wort der Erwiderung schloß die Baronin ihren Schreibtisch auf und übergab ihm einige tausend Mark, die zu ihrem Toilettengelde bestimmt waren.
Er steckte die Scheine ein, indem er sagte: »Ein Junggesellenleben ist nichts für einen Mann, dem es ernst mit seiner Solidität ist. Es wird Zeit, daß ich mich unter den Töchtern des Landes umsehe. Ich rechne dabei auf Ihren Beistand, gnädigste Baronin. Sie glauben nicht, wie ich Ihre Schwägerin verehre. Wollen Sie nicht Fräulein Lilly erforschen, was sie für Gesinnungen gegen mich hegt?«
»Das wird nicht nötig sein, denn Lillys vollständige Gleichgültigkeit gegen Sie tritt klar zutage,« sagte Melanie schonungslos.
»Nun, so will ich auf die Zukunft hoffen. Ihrer Unterstützung darf ich ja sicher sein, gnädige Frau,« entgegnete Stadler in gereiztem Ton und empfahl sich.
Melanie war tief erschrocken und sie sah mit Bangen in die Zukunft; sie wagte zu niemand von ihren Befürchtungen zu sprechen, aber ihre Unruhe wuchs.
Es vergingen indes mehrere Wochen, ohne daß Stadler etwas von seiner Absicht verlauten ließ. Er bereitete dem Freiherrn aber große Verlegenheiten durch sein unpassendes Benehmen, denn jetzt, wo er sich sicherer fühlte, tat er sich keinen Zwang mehr an und verletzte die Gebote der guten Lebensart aufs gröblichste. Der Freiherr hatte schon manche verwunderte Frage über Stadler anhören müssen, der in der Gesellschaft eben mehr als unbefugter Eindringling betrachtet wurde, und er hatte Mühe gehabt, ihn vor der Ausschließung aus dem vornehmen Klub, in den er durch ihn Eingang gefunden, zu bewahren.
Er stellte Stadler sehr ernsthaft zur Rede, aber dieser antwortete:
»Was wollen Sie? Ein Mensch kann sich nicht immer in der Gewalt haben. Ich sehe ja selbst ein, daß ich in diese Kreise nicht passe. Auch mein Doktor verlangt ein solideres Leben. Ich werde mich nach Hohenwalde zurückziehen und dort meinen Kohl bauen. Aber ich brauche eine Fee, und zwar eine vornehme, die mir Halt gibt vor der Welt. Geben Sie mir Lilly.«
»Wie können Sie es wagen, nur an sie zu denken!« rief der Freiherr empört aus.
Stadler maß ihn mit frechen Blicken.
»Lieber Freund, das Wort betrachte ich als ungesprochen. Für Sie kann nichts Besseres eintreten. Wenn ich mich herablasse, der Schwager eines Mannes mit einer solchen Vergangenheit zu werden, so ist Ihnen das die sicherste Bürgschaft, daß Ihnen keine Gefahr durch mich droht. Ich habe die Kleine lieb genug, um über die Flecken in Ihrer Verwandtschaft fortzusehen, obwohl es nicht angenehm bleibt, daß ihr Bruder vom Beile des Henkers bedroht ist. Natürlich würde ich es für meine Pflicht halten, jeden andern zu warnen, der sich unwissentlich in eine so fatale Lage brächte.«
Der Freiherr bebte vor Zorn, Stadler trat einen Schritt zurück.
»Möchten Sie mich auch ermorden, wie jenen andern!« rief er aus. »Nehmen Sie sich in acht, ich bin auf meiner Hut, daß Sie mich nicht hinterrücks überfallen können.«
»Elender!« sagte der Freiherr verachtungsvoll. »Lieber will ich alles erdulden, als mich länger von dir knechten lassen. Ich werde mich dem Gericht stellen?«
»Und Ihre Frau und Ihre Kinder? Ihr Sohn erhält als einziges Erbe die Schande des Vaters, wie werden die Ihren, wenn Sie in Not und Schmach zurückbleiben, Ihr Andenken segnen!«
»Teufel!« schrie der Freiherr auf.
»Das bin ich nicht, aber ein Mensch, der sich Gewissensbisse macht, so lange die Wahrheit verschwiegen zu haben; für einen Freund und Bruder will ich auch ferner leiden, aber nicht für einen Undankbaren. Geben Sie mir Ihre Schwester, damit ich durch die Verschwägerung mit dem edlen, hochangesehenen Herrn von Wildburg meine sonst unhaltbare Lage befestige. Mir gefällt das Mädel außerdem, und daß sie sich den Doktor in den Kopf gesetzt hat, will ich ihr nicht anrechnen. Als meine Frau will ich sie schon behüten. Ich werde meinen Willen durchsetzen oder – Das ist mein letztes Wort. Einige Tage gebe ich Bedenkzeit. Auf Wiedersehen, mein lieber Schwager in spe.«
Er war fort. Der Freiherr blieb in furchtbarer Erregung zurück. Haß, Zorn, Demütigung kämpften in seiner Seele. Daß Stadler ohne Erbarmen seine Macht gebrauchen würde, war nicht zu bezweifeln. Aber Lilly durfte nicht das Opfer werden. Eher wollte er sich der Sühne darbieten. Was lag ihm noch am Leben! Er sehnte sich nur nach Ruhe. Wie lange schon floh ihn der Schlaf, selbst die starken narkotischen Mittel, die er anwandte, blieben erfolglos. Seine Nächte waren fürchterlich und mit Grauen sah er dem Anbruch eines neuen Tages entgegen. Nun lockte ihn der Todesschlummer mit unwiderstehlicher Gewalt.
Er schritt zu seinem Gewehrschrank und nahm einen Revolver heraus. Noch ein leichter Druck und alles war vorüber; es gab ja nur eine kleine Wunde, wie sie Erwin damals hinter dem Ohr gehabt, er würde nicht entstellt sein und der so heißgeliebten Frau würde sein Anblick kein Entsetzen einflößen. Aber wie er die kleine Waffe erhob, mußte er wieder an Erwin denken; er hatte es seitdem stets vermieden, einen Revolver zur Hand zu nehmen. So legte er die Waffe fort und vergrub sein Gesicht in den Händen. War er denn ein Feigling? Warum vollbrachte er nicht, was doch geschehen mußte. Für ihn gab es keinen Platz mehr auf der Erde, er durfte nicht schwach sein.
Es klopfte an der verschlossenen Tür und Melanie bat ängstlich um Einlaß. Er griff nach der Waffe, es sollte schnell geschehen, was sie lange gefürchtet haben mochte, dann würde sie sich in das Unabänderliche ergeben, die Pein, die sie jetzt ausstand, hatte wenigstens ein Ende.
»Albrecht, öffne, ich bitte dich, wir müssen zum Vater, er ist sehr krank, es geht wohl zu Ende mit ihm,« flehte Melanie von neuem.
Er erhob sich mit Mühe, wie gelähmt. Ehe er die Tür aufschloß, legte er die Waffen an ihren Platz, während er der Harrenden mit heiserer Stimme zurief: »Sei ruhig, ich bin sogleich bereit.«
Melanie stand vor ihm, totenbleich, ihr angstvoller Blick durchirrte das Gemach und sie klammerte sich fest an ihn und zog ihn mit sich fort an das Sterbelager.
Es war vorüber. Ein sanfter Tod hatte dies Dasein beendet, das kaum noch ein Leben zu nennen war.
Melanie empfand das Ende fast wie eine Erleichterung, in Lilly dagegen erwachte der ganze Schmerz um den Verlust des Vaters, wie sie ihn früher gekannt, und sie weinte sich aus an der Brust des Bruders, in dem sie wieder ihren Beschützer und Tröster fand, während alle Entfremdung der letzten Zeit vergessen war.
![]()
Die Beisetzung hatte ganz in der Stille auf Schloß Wildburg stattgefunden, wohin sich die Familie zu dauerndem Aufenthalt zurückzog, um dort die Zeit der tiefen Trauer zu verbringen.
Auch Stadler hatte der Feierlichkeit beigewohnt und sich dann nach Hohenwalde begeben, da er sich ohne den Schutz des Freiherrn nicht wohl in der Gesellschaft fühlte. Er war wütend über den Aufschub, den seine Pläne erlitten, trank noch mehr als gewöhnlich, gab die widersprechendsten Befehle und behandelte seine Leute roh, wenn sie sich nicht immer in seine Launen zu finden wußten.
Heute plagte ihn die größte Langeweile; ruhelos durchschritt er die Reihe der Zimmer und blieb stets am Büfett stehen, um sich von den starken Weinen und Likören, die dort standen, einige Gläser einzugießen, die er hastig hinunterstürzte.
Plötzlich befiel ihn ein Schwindel, daß er sich am Tisch festhalten mußte, um nicht hinzustürzen. Das war ja der fatale Zufall, der ihm schon öfter zu schaffen gemacht und von dessen Wiederkehr ihn sein Arzt so dringend gewarnt hatte. Es ging vorüber, verstimmte ihn aber sehr.
Er brauchte Bewegung und Zerstreuung; er wollte hinüber nach Wildburg. Warum auf einen Toten Rücksicht nehmen, der ihn nichts anging. Konnte ein weinendes Mädchen besser getröstet werden als durch eine Bewerbung, und er hatte unbedingt eine Frau nötig.
Er klingelte nach seinem Groom und befahl, ihm ein Pferd zu satteln, das er erst vor kurzem gekauft hatte. Der Mann stellte vor, das Tier sei schlecht zugeritten und habe noch andere Fehler, es sei besser, es erst zu erproben. Stadler ärgerte sich, zumal, da er hierin einen Zweifel an seiner Reitkunst, die viel zu wünschen übrig ließ, zu erblicken glaubte und wiederholte seinen Befehl.
Das Pferd wurde vorgeführt, die Begleitung des Reitknechts lehnte er ab. Das Tier sah tückisch aus, es legte die Ohren an und scharrte mit den Vorderbeinen. Stadler hatte Mühe, in den Sattel zu kommen, dann lenkte das Pferd und endlich stürmte es davon.
Am liebsten hätte der Reiter seinen Vorsatz aufgegeben, aber es verdroß ihn vor seinen Leuten und so suchte er sich im Sattel festzusetzen und bekam das Tier wieder mehr in seine Gewalt.
Dennoch sahen ihm seine Leute kopfschüttelnd nach und meinten: »Wenn das nur kein Unglück gibt.«
»Ich habe ihn gewarnt, es ist seine eigene Schuld,« fügte der Reitknecht hinzu.
Eine Zeitlang ging alles gut und Stadler hatte schon die Hälfte des Weges zurückgelegt, als es ihm vor den Augen zu flimmern begann und ein neuer leichterer Schwindelanfall eintrat.

Es dauerte nur einen Moment, aber seiner Hand entglitten die Zügel und sogleich sprengte das Pferd in rasendem Tempo davon. Der Reiter wurde zu Boden geschleudert und blieb besinnungslos liegen. So fanden ihn Vorüberkommende und brachten den Schwerverletzten auf das Wildburger Schloß.
Dort lag er in einem mit allem erdenklichen Behagen ausgestatteten Gemach, still und bleich, ein dem Tode verfallener Mann.
Er hatte das Bewußtsein wieder erlangt, er fühlte keinen Schmerz, er war aber auch unfähig zu jeder Bewegung und die tödliche Lähmung beängstigte ihn unsäglich. Die Ärzte, die sofort herbeigerufen waren, erklärten, daß der Bruch der Wirbelsäule ihm kaum noch einige Tage Frist ermöglichte.
Nichts wurde unterlassen, was dem Kranken heilsam sein konnte, die Ärzte wichen nicht von seinem Lager und die Baronin beteiligte sich selbst an seiner Pflege. Er wußte, daß es keine Hoffnung für ihn gab und er klammerte sich dennoch wie ein Verzweifelnder an das enteilende Leben. Seine Augen lasen in den ernsten Mienen der Ärzte, seine Angst und Not waren entsetzlich.
Endlich wagte er die Frage, die so lange schon auf seinen Lippen schwebte. »Ich bin schwer verletzt, ich weiß es. Aber ich werde es überstehen.«
Die Ärzte schwiegen, endlich sagte der eine: »Wenn Sie etwas zu ordnen haben, so tun Sie es, Ihr Fall ist sehr ernst.«
»Doch nicht tödlich?« flehte er angstvoll. »Geben Sie mir Hoffnung.«
»Das Rückgrat ist schwer, unheilbar verletzt,« war die Antwort.
»Und wenn ich ein Krüppel bin, nur leben will ich,« schrie er auf. »Laßt mich nur nicht sterben.«
Die Ärzte sprachen ihm beruhigend zu und versicherten, sie würden alle ihre Kunst aufbieten, aber er wußte, daß sein Todesurteil auf ihren Lippen schwebte.
Er stieß einen wilden, furchtbaren Schrei aus; hätte er nur die Hände ringen, sich winden dürfen in seiner Verzweiflung! Er war schon jetzt ein lebender, denkender Leichnam, dem jede Bewegung versagt war. Konnte es etwas Entsetzlicheres geben?
Die Ärzte mahnten zur Ruhe. Jeder Schmerzensausbruch raubte ihm von der Lebenskraft, die sich nicht ersetzen ließ, verkürzte seine Daseinsfrist. Nun wollte er wissen, wie lange es noch währen könne.
Sie zögerten mitleidig; erst auf sein ungestümes Verlangen nannten sie als äußerstes Ziel noch zwei Tage. Er nahm sein Urteil schweigend hin, aber in ihm gärte es. Wie herrlich war ihm bisher alles gelungen; nun er auf dem Gipfel des Glücks angelangt zu sein wähnte, kam das Verhängnis und warf alle seine Pläne über den Haufen.
Und einen Menschen gab es, der würde über seinen Tod triumphieren, der konnte nun wieder aufatmen, befreit von jeder Furcht, konnte die Früchte seines Verbrechens genießen.
Aber nein! Das sollte nicht sein! Er haßte diesen Freiherrn von Wildburg, noch war er bei klarem Verstande und seine letzten Stunden wollte er dazu anwenden, ihm die Maske abzureißen und ihn der strafenden Gerechtigkeit zu überliefern.
Wie ein Wütender verlangte er die Entfernung des Freiherrn, der eben in das Zimmer getreten war, das die Ärzte für einige Zeit verlassen hatten.
Melanie, die am Bette saß, winkte ihrem Gatten, er möge gehen, und so wurde sie allein Zeugin der wilden Drohungen, die der Kranke ausstieß. Am nächsten Morgen sollte ein Gerichtsbeamter gerufen werden, dem er alle Enthüllungen machen wollte.
Sie sank zur Seite des Lagers auf die Knie und beschwor Stadler mit gerungenen Händen und herzbewegenden Worten, seinen Racheplan nicht auszuführen, aber all ihr Bitten und Flehen blieb vergebens.
Endlich trat die erschöpfte Natur des Kranken in ihre Rechte, eine unendliche Schwäche überfiel ihn, kalter Schweiß trat auf seine Stirn, er vermochte kaum noch einige Worte zu hauchen.
Melanie trocknete ihm das feuchte Antlitz, reichte ihm belebende Arzneien, badete ihm Stirn und Hände. Er empfand ihr sanftes Sorgen, aber es rührte ihn nicht, sie war ja das Weib des Verhaßten, war ihm selbst verhaßt, sie sollte ihn nicht betören und um die Rache betrügen, die ihm der einzige Zweck seines Daseins geworden war.
Aber ihre leichte, zarte Berührung erinnerte ihn an andere Hände, die rauh und hart von der Arbeit waren und die doch so liebevoll und sanft seine Wangen gestreichelt, sein Haar geglättet hatten, und eine heiße Sehnsucht nach der alten Frau, die er so sehr gekränkt hatte, überfiel ihn.
»Mutter! Mutter!« kam es wie ein Schrei der Verzweiflung über die bleichen Lippen
Die Baronin beugte sich über ihn und fragte: »Soll ich sie rufen?«
»Sie wird nicht kommen, ich habe sie zu schwer gekränkt,« seufzte er.
»Eine Mutter vergibt stets, ich werde sie holen,« erwiderte Melanie.
»Verlieren Sie keine Minute,« bat er mit einem dankbaren Blick.
Sie rief den Wärter aus dem Nebenzimmer herbei, dann glitt sie wie ein Geist durch die langen Korridore des Schlosses, öffnete mit einem Schlüssel, den sie bei sich trug, ein Seitenpförtchen und trat hinaus in die kalte, stürmische Winternacht. Sie hüllte sich fröstelnd in das große Tuch, das sie übergeworfen hatte, aber der Wind durchkältete sie und der nasse Schnee durchfeuchtete ihre Schuhe, aber sie achtete kaum darauf.
Das Schloß lag dunkel und massig da, nur aus dem Krankenzimmer drang ein matter Lichtschein und Albrechts Fenster waren erhellt, sein Schatten wanderte ruhelos auf und ab.
Sie eilte die Dorfstraße entlang bis zum Waisenhause, in dem gleichfalls ein erleuchtetes Fenster durch die Nacht schimmerte.
Als sie durch die Scheiben blickte, sah sie die alte Frau mit gefalteten Händen dasitzen, die Lippen wie im stillen Gebet bewegend. Natürlich war die Kunde von dem Unglücksfall auch zu ihr gedrungen und ihre Gedanken und Gebete umgaben den Sohn, dem sie nicht zu nahen wagte.
Mit wenigen Worten verständigten sich die beiden Frauen. Frau Brandt zögerte keinen Augenblick und so traten sie wieder die Wanderung an.
Endlich mußte Melanie stille stehen, weil sie in der Brust einen stechenden Schmerz empfand, der ihr den Atem raubte.
»Es geht vorüber,« beruhigte sie die alte Frau, und dann setzte sie zögernd hinzu:
»Meine Sorge ist groß, der Kranke kann das Glück meines Lebens vernichten, er ist im Besitz eines schweren Geheimnisses, das meinen Gatten betrifft. Er haßt ihn und will es gegen ihn gebrauchen.«
Sie umklammerte die Hand der Alten, die ihr verständnisvoll zunickte und dann setzten sie ihren Weg fort. Sie erreichten das Schloß und glitten geräuschlos in das Krankenzimmer, Melanie als die erste.
Der Kranke hatte sie sofort wahrgenommen und in seinen Augen stand eine bange Frage. Sie neigte bejahend das Haupt und schickte den Diener hinaus, dann führte sie die alte Frau an das Bett.
»Mutter!« rief der bleiche, regungslose Mann, während ihm die Tränen über die eingefallenen Wangen liefen.
»Mein Sohn, mein Paul, mein lieber, lieber Junge. Nun hast du doch noch an mich gedacht,« sagte die Mutter und bedeckte sein Gesicht mit Küssen.
Sie sprach zu ihm, wie sie einst zu dem Knaben getan und es schien, als habe sie alle Zärtlichkeit, die sich in den Jahren der Trennung in ihrem Herzen angehäuft, für ihn aufgespart, und er vergaß Krankheit und Todesnot und empfand mit Freuden, daß er noch eine Mutter hatte.
»Du bleibst nun bei mir,« bat er.
»Gewiß, mein Sohn, ich pflege dich wieder gesund,« sagte sie zuversichtlich.
Ein schwaches Lächeln umspielte seine Lippen.
»Das kannst auch du nicht, Mutter,« sagte er, »es wird bald zu Ende sein.«
»Dann komme ich zu dir, mein Paul,« tröstete sie. »Sieh, ich bin alt und gebrechlich, und es kann nicht mehr lange mit mir dauern. Dann sind wir für immer beisammen.«
Sie saß an seiner Seite und befeuchtete ihm die trockenen Lippen oder strich ihm über das Haar, und alles übrige hatten sie vergessen, bis der Blick der alten Frau aus die Baronin fiel, die bleich und zitternd an der Wand lehnte und sie mit flehenden Augen anschaute.
»Die gute, gnädige Frau hat mich durch Nacht und Wind zu dir geholt, füge ihr nichts Böses zu,« sagte die Mutter nun.
»Ich will nur ein Verbrechen aufdecken, das ein anderer beging und das ich viel zu lange verschwieg,« erwiderte der Sohn.
»So schweige auch ferner, laß Gott richten,« sagte die alte Frau feierlich.
»Nein, der Frevel soll nicht ungestraft bleiben, und wenn ich meine Augen schließe, gibt es keinen Zeugen mehr.«
Aber die Mutter ließ nicht nach mit Flehen. »Tue es um meinetwillen, mir zuliebe,« bis er nicht länger widerstehen konnte.
»Es geschehe, wie du willst, Mutter,« sagte er, »die Schuldbeweise sollen vernichtet werden.«
Melanie konnte sich nicht länger beherrschen, unter strömenden Tränen bedeckte sie seine Hände mit Küssen und sprach ihm die heißesten Dankesworte und Segenswünsche aus.
»Arme Frau,« flüsterte er, zum ersten Male empfand er aufrichtiges Mitleid für sie.
Er ließ sich seine Brieftasche bringen, in der sich zwei Schlüssel fanden, der eine zu seinem Schreibtisch, der andere zu einem Kästchen, das sich in einem geheimen Schubfache daselbst befand.
Ohne Säumen eilte Melanie nun zu den Ställen und ließ anspannen.
Als der fahle Wintertag anbrach, war sie in Hohenwalde gewesen und hatte ihren Auftrag ausgeführt, nun brachte sie dem Kranken das Kästchen.
»Es ist das rechte,« murmelte er. »Nehmen Sie es hin und tun Sie damit nach Ihrem Gefallen. So möge mir Gott vergeben, wie ich allem Haß und aller Feindschaft entsage.«
»Gottes Segen über Sie, ich will für Sie beten,« stammelte Melanie.
»Bald bedarf es dessen nicht mehr,« entgegnete er. »Aber es tut mir wohl daß Sie mich segnen. Auch das danke ich der Mutter.«
Melanie wollte hinausgehen, als eine plötzliche Schwäche sie überkam; sie taumelte und mußte sich hinsetzen. Heiß stieg es in ihr empor, auf der Zunge empfand sie einen eigentümlichen süßlichen Geschmack. Sie zog ihr Taschentuch heraus und hielt es vor den Mund, es färbte sich purpurn von dem Blute, das aus ihrer Brust hervorquoll. Niemand hatte auf sie geachtet, so verbarg sie das verräterische Tuch und schleppte sich auf ihr Zimmer, immer in Furcht vor einem neuen Anfall.
Ihre Jungfer, die sich hier befand, war sehr erschrocken, wollte den Arzt holen und ihre Herrin zu Bette bringen, so schlecht sah diese aus.
Aber Melanie wollte sich keine Ruhe gönnen, ehe ihre Aufgabe beendet war. Sie gebot der Jungfer, das Feuer im Kamin hell zu entflammen und ihr einen bequemen Sessel hinzuschieben; so würde sie sich am besten von den Aufregungen und der durchwachten Nacht erholen; auch wollte sie allein sein.
Sobald das Mädchen sie verlassen hatte, schob die Baronin den Riegel vor und nahm das Kästchen zur Hand. Sie öffnete es und fand darin alle die Zeugen einer grausigen Tat: eine mit vergilbten Papieren gefüllte Brieftasche, eine kostbare Taschenuhr, einige diamantene Chemisetteknöpfe, einen Ring, alles einst Eigentum des unglücklichen Erwin von Wildburg, dann das Taschentuch mit den dunkeln Flecken und die Manschette mit dem Knopf, der das Monogramm ihres Gemahls zeigte.
Mit Grausen starrte sie auf diese unseligen Zeugen, dann ermannte sie sich und warf alles in das Feuer, das sie zu heller Glut entfachte. Es knisterte und knatterte im Kamin und ein Geruch von verbranntem Leinen verbreitete sich im Zimmer.
Mit unsäglicher Anstrengung legte die Baronin neue Scheite in das Feuer; sie wärmte ihre erstarrten Hände daran und suchte das Frösteln, das sie durchrieselte, zu vertreiben, indem sie sich über die Flammen beugte.
Endlich war alles getan. Das Feuer fand keine Nahrung mehr und erlosch ganz, die letzten Funken, die zurückblieben, erstarben, nur tote Asche blieb übrig. Sie wartete, bis diese erkaltet war, dann durchwühlte sie mit eigener Hand diese Reste und achtete nicht auf die Befleckung durch Ruß und Rauch. Einige formlose Klümpchen ließen noch deutlich das edle Metall erkennen, ebenso waren die Brillanten unversehrt geblieben. Sie sammelte alles sorgfältig, auch die Asche, tat es in das Kästchen und verschloß dieses. Dann wankte sie mühsam zu ihrem Gatten.
Dieser hatte die Nacht in furchtbarer Seelenqual durchwacht. Er hielt die Entdeckung für unvermeidlich und glaubte sich und die Seinen verloren. Nun reichte ihm Melanie das Kästchen hin.
»Öffne es,« bat sie, und als er es tat, fügte sie hinzu: »Das ist alles, was von der Vergangenheit zeugen kann. Du bist gerettet, von dem furchtbaren Drucke befreit, denn Stadler wird sein Schweigen nicht brechen.«
»Aber meine Schuld besteht,« sagte der Freiherr tief ergriffen. »Wirst du das je vergessen können, Melanie? Wirst du dich nicht schaudernd von mir abwenden.«
»Nein, mein Geliebter,« erwiderte sie innig, »denn auch ich fühle mich nicht frei von Schuld. Gemeinsam wollen wir sie zu sühnen suchen. Unsere gegenseitige Treue und Liebe kann durch nichts erschüttert werden.«
![]()
Die furchtbaren Gemütserschütterungen der letzten Zeit machten den leidenden Zustand der Baronin erklärlich. Sie hatte den ganzen Umfang ihres Leidens verheimlicht und weigerte sich noch immer, einem Arzt sich anzuvertrauen, weil sie behauptete, sie brauche nur Ruhe. Ach, gerade diese konnte sie nicht finden. Ihre Seele bebte in Angst um ihre Kinder, denn sie hielt an dem Glauben fest, daß die schwere Schuld sich auch auf sie vererben müßte zugleich mit dem Fluche, der auf dem Erben der Wildburgs lastete.
Über Stadler hatte sich das Grab geschlossen, ohne daß seine wahre Herkunft entdeckt worden wäre. Die Papiere des österreichischen Edelmannes, den er auf seinen Reisen getroffen und die er nach dessen Tode an sich genommen hatte, waren für die gesetzlichen Förmlichkeiten genügend gewesen. Frau Brandt hatte über ihre Beziehungen zu dem Verstorbenen Schweigen bewahrt, sie galt für seine Pflegerin, die bis zum Tode treu bei ihm ausharrte; danach kehrte sie still und ergeben auf ihren Posten im Waisenhause zurück.
Albrecht atmete auf. Die Zukunft gehörte wieder ihm, er war vor Schmach und Schande gerettet, und alles verdankte er seinem treuen Weibe, seiner unaussprechlich geliebten Melanie. Wie wollte er dieses neugeschenkte Leben ausnützen, wie wirken und schaffen zum Heile vieler. Seine Buße sollte eine würdige und wahrhaft große sein.
So saß er an seinem Schreibtische, seine Briefschaften und Akten ordnend, was er lange vernachlässigt hatte. In dem Fache, in dem er seine wichtigsten Familiendokumente aufbewahrte, leuchtete ihm das Wappen der Wildburgs aus den großen, noch unerbrochenen roten Siegeln entgegen, darauf standen von der Hand seines Vaters die Worte: »Nach meinem Tode zu öffnen.«
Nun erinnerte er sich wieder daran, wie ihm sein Vater dieses Schriftstück vor Jahren übergeben hatte. Er hatte wenig Wert darauf gelegt, da dessen Geist schon damals getrübt gewesen war, dann hatte er das Ganze vergessen.
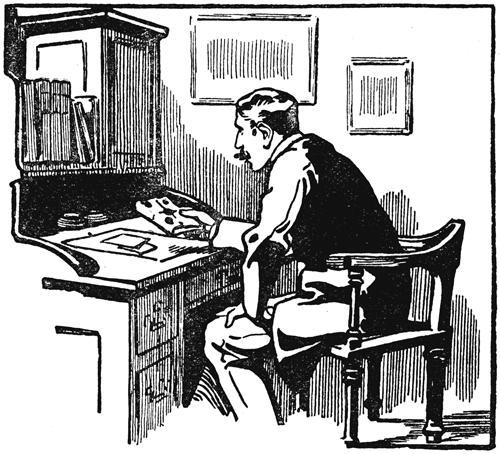
Nun drängten sich diese Papiere plötzlich in sein Leben und ein seltsamer Schrecken ergriff ihn; mit hastiger Hand löste er die Siegel.
Einige Blätter mit der Handschrift seines Vaters waren es, dann große Bogen auf starkem Papier, mit Unterschriften und Stempeln bedeckt. Er schlug diese Dokumente auseinander und überflog sie in Hast – kein Zweifel, es war das Trauzeugnis des Majoratserben Karl von Wildburg mit Annunziata Ferrari. Nichts fehlte, die Ehe war in gültigster Form vollzogen nach allen Vorschriften der Gesetze.
Noch waren dem Freiherrn nicht alle Folgerungen, die sich aus diesem Umstand ergaben, klar; er mußte sich erst in die Bekenntnisse seines Vaters versenken. Der kalte Schweiß trat ihm auf die Stirn und die Buchstaben grinsten ihn wie tückische Kobolde an, als sich ihm die furchtbare Wahrheit enthüllte. Hier hatte er den Schlüssel zum Leben seines Vaters. Auch er war in Schuld verfallen und dann den Gewissensqualen zum Opfer geworden.
Aber die Niederschrift ging weiter. Ein Sohn war aus dieser Ehe geboren, in einer kleinen schlesischen Stadt, wie der Aufruf der Behörden, der beigefügt war, bewies. Es gab also einen rechtmäßigen Erben, und er, der Freiherr, war doch ein Betrüger, der unrechtmäßig fremdes Erbe an sich genommen.
Lange sann er über die unheilvolle Verkettung der Verhältnisse nach und erwog die Frage, wer und wo dieser Erbe sein könnte, und plötzlich stand es in flammender Klarheit vor seiner Seele, daß er den wahren Erben kannte, daß dies kein anderer als Dr. Blanden sein konnte.
Was sollte er nun tun? Ihn: das Erbe ausliefern, um das sein Vater so schwer gelitten, das er selbst so teuer erkauft hatte?
Das hieß auf alle seine großartigen Pläne verzichten, bedeutete nicht nur für ihn, sondern auch für seinen Sohn ein Hinabsteigen in Niedrigkeit und Entsagung. Nein, er vermochte nicht ein solches Opfer zu bringen. Doch das Geschick zeigte ihm ja einen vermittelnden Ausweg, der ihm gestattete, an Dr. Blanden gutzumachen, wenigstens teilweise, was er ihm rauben mußte. Er liebte ja Lilly, so wollte er ihm diese zur Frau geben, er wollte sie überreich ausstatten mit Geld und Gut und sein ganzer Einfluß sollte seinem zukünftigen Schwager zu Gebote stehen und ihm die Wege zu Ehre und Ruhm ebnen.
Mit einem tiefen Seufzer, aber doch einem solchen der Erleichterung, schloß er die Papiere ein und erhob sich. Sein Entschluß war gefaßt und sollte mit Ruhe und Besonnenheit durchgeführt werden. Die Vergangenheit war nicht zu ändern, aber die glückliche Gestaltung der Zukunft stand in seiner Macht.
Am nächsten Morgen überraschte er Melanie durch die Frage, ob sie wisse, wie es mit Lilly und Dr. Blanden stehe. Diese antwortete, daß sie jede Aussprache mit der Schwägerin über diesen Punkt vermeide, weil sie überzeugt sei, daß Lilly sich hierin nie dem Willen des Bruders unterwerfen würde. Sie werde dem Doktor ihr gegebenes Wort einlösen, sobald dieser es verlange und so würden gewiß schwere Kämpfe in der Familie bevorstehen.
»Was würdest du sagen, liebes Herz,« fragte der Freiherr mit dem Anfluge eines Lächelns, »wenn ich meine Ansichten geändert hätte und dieser Verbindung nichts mehr in den Weg legen würde?«
Melanie sprang von ihrem Ruhebette mit der Elastizität früherer Tage auf und umschlang seinen Hals. Sie hatte durch die schrecklichen Erfahrungen der letzten Zeit viel von ihrer Weltlichkeit abgestreift und so dachte sie jetzt mehr an Lillys wirkliches Lebensglück, als an eine glänzende Partie.
Der Freiherr führte seinen Entschluß ungesäumt aus. Er schrieb an Dr. Blanden, bat ihn offen um Verzeihung für sein verletzendes Benehmen gegen ihn und lud ihn auf Schloß Wildburg ein, um sich mit Lilly auszusprechen. Der Doktor ging ebenso bereitwillig auf die Versöhnlichkeit des Freiherrn ein und folgte seiner Aufforderung.
Es schien, als solle nun endlich ein Sonnenstrahl in das Düster fallen, das so lange auf der Familie gelastet hatte, durch das Glück des jungen Paares, das sich nun endlich gefunden hatte.
Trotzdem blickte Dr. Blanden mit Sorge in die Zukunft, denn die Veränderung, die mit Melanie vorgegangen war, erschreckte ihn tief
Sie klagte nie und suchte ihr Leiden zu verbergen, ihn vermochte sie nicht zu täuschen, die Anzeichen, die ihr ein frühes Ende andeuteten, standen für ihn fest; auch die Kunst des Arztes würde ihr Los nicht zu ändern vermögen, nur hinausschieben konnte sie das Traurige.
Melanie selbst schien von ungetrübter Heiterkeit; sie nahm innigen Anteil an den Zukunftsplänen der Verlobten, beriet mit Lilly die Ausstattung und war ganz damit einverstanden, den Hochzeitstag nicht mehr lange hinauszuschieben. Daneben widmete sie sich der Wohltätigkeit in rastloser Weise; kein Bittender wandte sich vergeblich an sie und sie beteiligte sich mit regstem Eifer an der Beratung über milde Stiftungen, die Albrecht ins Leben rufen wollte. Stillschweigend befanden sich beide Gatten im engsten Einverständnis; durch ihr Leben und ihr Wirken wollten sie die große Schuld tilgen, die stets in ihrer Erinnerung gegenwärtig war.
Wenige Tage nach seiner Ankunft auf Waldburg erhielt Dr. Blanden die Berufung als Professor an eine bedeutende Universität; es war ihm keine Überraschung, aber eine um so größere Freude, daß gerade jetzt ein solcher Erfolg sein Streben krönte.
Zugleich wurde sein Verweilen bei seiner Braut dadurch für jetzt beendet, dringende Geschäfte harrten seiner, denn er sollte ohne Zeitverlust in den neuen Wirkungskreis eintreten. So wurde, da er seine junge Gattin gerne mitgeführt hätte, der Vermählungstag angesetzt, der ohne jedes Gepräge, ganz in der Stille, gefeiert werden sollte, und man trennte sich in heiterer, froher Stimmung.
Jeden Abend pflegte die Baronin an das Lager ihrer Kinder zu treten, um sich von deren Wohlergehen zu überzeugen, und sie folgte dieser Gewohnheit auch heute. Edith fand sie in friedlichem Schlummer, aber ihr Sohn lag im heftigen Fieber wie betäubt, und als er sich ermunterte, hatte seine Stimme einen heiseren, unheilvollen Klang. Die Wärterin entschuldigte sich, er sei leicht erkältet gewesen und sie habe dem Unwohlsein weiter keine Bedeutung beigelegt.
Professor Blanden mußte leider die Befürchtung der entsetzten Mutter bestätigen, es handelte sich um Diphtheritis, und zwar in der schlimmsten Form. Wenn er der Mutter noch einige Hoffnung ließ, hegte er selbst keine; aber auch Melanie sah das Schlimmste voraus.
»Mein Sohn wird sterben, ich weiß es,« sagte sie in dumpfer Verzweiflung, »er ist der Erbe der Wildburgs, also lastet der Fluch auf ihm.«
Der Freiherr versuchte vergebens, sie aufzurichten; sie wandte sich scheu von ihm und er hatte nicht den Mut, sie von neuem zu trösten, erschien er sich doch selbst wie der Mörder seines Sohnes, der für seine Schuld litt.
Es war unmöglich, Melanie vom Lager ihres Kindes zu entfernen; sie kannte weder Ermüdung, noch Anstrengung, und so furchtbaren Schmerz ihr auch die Leiden ihres Sohnes bereiteten, wich sie doch nicht von seiner Seite. Alles war umsonst. Nach einigen Tagen der Qual war das Kind eine Leiche.
Albrecht, selbst aufs tiefste erschüttert, schlang den Arm um seine Gattin, um sie fortzuführen; da durchrann ihren Körper ein schauderndes Beben und sie machte sich fast ungestüm von ihm los.
Er verstand ihre Empfindung und fragte sie voll Schmerz: »Willst du mir nun doch deine Liebe entziehen, Melanie? Werden wir dieses neue Leid nicht mehr zusammen tragen?«
Sie bat nur: »Laß mich allein, ich kann jetzt niemand sehen, selbst dich nicht,« und man mußte ihr willfahren.
Eingeriegelt in ihr Zimmer, überließ sie sich völliger Verzweiflung. Sie klagte sich laut an als Mörderin ihres Kindes.
Warum war sie nicht von Albrecht geflohen, wie ihr erster Antrieb gewesen war, statt den Knaben aufwachsen zu lassen in Schuld und Sünde als Erben der Wildburgs? Sollen nicht die Sünden der Väter heimgesucht werden an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied? Er war dem Tode verfallen, weil er der Sohn seiner Eltern war, und alle Qual, in der er sein Leben geendet, verschuldeten diese. Sie verabscheute sich selbst und ihr grauste vor ihrem Gatten. Laut hätte sie es hineinschreien mögen in alle Welt, daß sie beide die Sünder waren und daß das schuldlose Kind für seine Eltern habe büßen müssen.
Endlich beruhigte sich ihr wilder Schmerz und ging in eine dumpfe Erstarrung über.
Sie verschmähte jede Nahrung, sie schlief nicht, sie vergoß keine Träne mehr, sie sprach kein Wort.
Der Freiherr vergaß fast sein Leid um den Sohn in der Sorge um die geliebte Frau, und ihr aus Schrecken und Furcht gemischtes Benehmen ihm gegenüber verwundete ihn aufs tiefste.
Lilly hatte die kleine Leiche mit Blumen geschmückt in ihrem letzten Bettchen, jede Spur des Leidens war aus den stillen Zügen gewichen, das Kind schien zu schlafen. Nun führte sie die Mutter zu ihm, die lange in den Anblick versunken dastand; endlich löste sich eine Träne aus ihrem Auge und rann langsam über die bleiche Wange, dann brach sie in lautes Weinen aus und verbarg ihr Gesicht an der Brust ihres Gatten.
»Verzeih mir, Albrecht, daß ich gegen dich lieblos war,« bat sie, »jetzt habe ich mich wieder zurechtgefunden. Alle meine Sorge um unseren Sohn ist beendet, er steht in Gottes Hut und kein Unheil kann ihn mehr treffen.«
Wieder öffnete sich die Gruft der Wildburgs, um den Erben des Geschlechts aufzunehmen; ein leises Flüstern ging durch die Menge, die von nah und fern herbeigeströmt war, und von Mund zu Mund teilte man sich die wunderbare und erschreckende Tatsache mit, daß der jedesmalige Erbe des stolzen Geschlechts dem Unglück verfallen sei.
Der Freiherr, obwohl tief gebeugt, zeigte sich männlich gefaßt und wie er hinter dem kleinen Sarge einherschritt, las man auf seiner Stirn den unbeugsamen Willen, dem Geschick zu trotzen; aber sein Haar und Bart hatten sich in wenigen Tagen wie in Schnee verwandelt.
Die Baronin folgte Lilly im geschlossenen Wagen, den sie dann verließ, um am Arm ihres Gemahls an die letzte Ruhestätte ihres Kindes zu treten. So wenig sie einer solchen Aufregung gewachsen sein mochte, hatte ihr Wunsch doch gewährt werden müssen, da sie so fest daraus bestand.
Mit stiller Ergebung lauschte sie den Worten des Geistlichen und verweilte noch einige Zeit an der Gruft, die sich nun über ihrem Lieblinge geschlossen hatte. Als sie sich zum Gehen wandte, wankte sie plötzlich, und ein Blutstrom quoll aus ihrem Munde.
Der Freiherr fing sie in seinen Armen auf, Professor Blanden bemühte sich um die Leblose, aber er sah wohl, daß hier jede Hilfe zu spät kam und daß die arme Dulderin allem Erdenleid entrückt war.
![]()
Die ersten Frühlingsstürme brausten über die Erde und der Orkan rüttelte an den Fenstern von Schloß Wildburg, als begehre er Einlaß in das Gebäude, dessen Bewohner in ihrer Seele nicht minder heftige Stürme durchlebt hatten.
Melanie schlief in der Familiengruft neben ihrem Sohne und Lilly hatte an Ediths Bettchen gesessen und sie liebevoll behütet, bis die Kleine, die bitterlich um die Mama geweint hatte, ohne doch den ganzen Ernst der Ereignisse zu verstehen, endlich eingeschlafen war.
Der Professor, der nicht länger auf dem Schlosse verweilen konnte und dessen Abreise für den nächsten Tag festgesetzt war, trat leise in das Gemach und umfaßte seine Braut, die ihr weinendes Antlitz an seiner Brust barg.
»Wie viel habe ich an Melanie verloren und wie sehr habe ich sie geliebt,« schluchzte sie. »O Karl, es ist mir ein schrecklicher Gedanke, daß sie nun so einsam in der düsteren Gruft liegt.«
»Gönne ihr die Ruhe, mein Lieb,« sagte der Professor. »Ich bin überzeugt, sie hat unendlich gelitten Sie war eine Heldin, die ohne Klagen ihre Leiden ertrug; aber ich kann nicht anders, ich muß immer denken, ihr seelisches Leid war das größere.«
»Auch mir erschien sie nicht glücklich,« sagte Lilly nachdenklich. »Was kann sie nur bedrückt haben. Sie hatte alles, was das Leben nur bieten kann, und doch – Todesahnungen sind oft in ihr erwacht. Dann bat sie mich, mich ihrer Kinder anzunehmen. Nun ist ja nur noch Edith da. Nicht wahr, Karl, wir werden treu und liebevoll ihr zur Seite stehen, sollte sie unserer bedürfen?«
»Gewiß, mein geliebtes Herz, in uns soll sie ein zweites Elternpaar voll zärtlicher Liebe finden,« versicherte der Professor. »Nun will ich mich bei deinem Bruder verabschieden, denn ich werde morgen früh abreisen.«
»Ich gehe mit dir zu Albrecht,« sagte Lilly. »Vielleicht läßt er uns ein. Er hat seit Melanies Tode kaum Speise zu sich genommen und Tag und Nacht vernimmt man sein ruheloses Umherwandern. Was soll nur werden?«
Fast gegen ihre Erwartung fanden sie Einlaß bei dem Freiherrn.
Aber welch erschreckende Wandlung war mit ihm vorgegangen! Die hohe Gestalt gebeugt, das ergraute Haar verwildert, das Auge erloschen, der Anzug vernachlässigt, so stand er vor ihnen.
»Was willst du, Lilly?« fragte er die Schwester mit tonloser Stimme.
»Vor allem dich bitten, daß du an dich selbst denkst,« flehte sie. »Versuche doch zu schlafen, lege dich nieder, lieber Albrecht.«
Er schüttelte den Kopf.
»Wenn du wüßtest, wie ich mich nach Vergessenkönnen und Schlaf sehne! Aber ich finde ihn nicht. Stets vernehme ich anklagende Stimmen, die mir zurufen, daß ich mein Weib gemordet habe und –«
Er hemmte sich gewaltsam, als habe er schon zu viel gesagt.
»Willst du nicht zu Edith gehen?« bat Lilly.
Albrecht verneinte.
»Das Kind würde sich vor mir fürchten, denn ich muß mich sehr verändert haben. Ich übergebe sie euch. In eurem Schutze wird sie vor dem Wetterstrahle behütet sein, der die Ihren vernichtete.«
Der Professor erkannte mit Schrecken, wie tief der Geist dieses Mannes durch den Kummer gelitten hatte; er beschloß, seine Abreise doch zu vertagen, er mochte hier zu nötig gebraucht werden.
»Nun geht und laßt mich allein,« fuhr der Freiherr fort. »Vielleicht finde ich die ersehnte Ruhe. Sie werden meine Schwester glücklich machen, Herr Professor. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen. Gott segne dich, meine Lilly. Habe Dank für alles, was du meiner geliebten Melanie gewesen bist und für alles, was du Edith sein wirst.«
»Schicke mich nicht fort, laß mich noch bei dir bleiben,« bat Lilly, erschreckt von seinen Worten, die wie ein letzter Abschied klangen.
Aber der Freiherr bestand auf seinem Willen und wies die Vorstellungen des Professors ebenso entschieden zurück wie die Bitten seiner Schwester. Es blieb ihnen nichts übrig, als ihm zu gehorchen.
Als sich der Freiherr wieder allein sah, fuhr er mit der Hand über die Augen und murmelte: »Gottlob, auch das ist überstanden! Lilly wird glücklich werden, und Edith möchte ich davor bewahren, ihren Vater durch Gewissenspein und Reue dem Grabe zuwanken zu sehen, wie ich es an dem meinen erlebte. Mir wird der Tod zum Befreier.«
Er trat ans Fenster und blickte hinaus. Der Sturm hatte sich gelegt, obwohl die schweren Wolkenmassen noch immer am Himmel hinjagten.
Als er das Fenster öffnete, schlug ihm eine schwüle, warme Luft entgegen. Zuweilen blickte der Mond durch die zerrissenen, von einem hellen Rande umsäumten Wolken, dann verschwand er wieder und tiefe Dunkelheit trat ein.
Die wechselnde Beleuchtung erfüllte ihn mit unwillkürlichem Schauder, sie erinnerte ihn an eine andere Nacht, in der ihn der durch die Wolken brechende Mond wie eine drohender Zeuge erschreckt, hatte. Bald würde das alles für ihn vorüber sein. Ruhe, Vergessenheit, Schweigen für immer!
Aber er hatte noch vieles zu tun, ehe er dem sehnsüchtigen Verlangen nachgeben durste. Was er gutmachen konnte, das sollte nicht ungetan bleiben, das Recht sollte doch zum endlichen Siege gelangen. Nur der edle Name, den er trug und für dessen Glanz er sich verantwortlich fühlte, sollte geschont werden, die Schande, die durch ihn gedroht hatte, deckte dann sein Grab. Der neue Träger des Namens, der wahre Erbe der Wildburgs, würde das Wappenschild rein und fleckenlos halten, wie es seine Vorfahren getan hatten.
Mit schwerer Hand schloß der Freiherr das Geheimfach seines Schreibtisches auf und entnahm ihm die Dokumente, die ihm sein Vater hinterlassen hatte.
Die Bekenntnisse des Toten übergab er den Flammen, niemand sollte seine Schuld erfahren; dann schrieb er an den Professor, daß durch einen wunderbaren Zufall, den er nicht enthüllen könne und wolle, vor kurzem diese Dokumente in seinen Besitz gelangt wären. Daß er sie verborgen gehalten, gab er zu, er bat nur, daß der Professor Edith nicht sein Verschulden zur Last legen sollte.
Der Freiherr legte den Brief mit den Dokumenten in einen festen Umschlag, den er mit seinem Wappen versiegelte und an den Professor Dr. Blanden adressierte. Das Schreiben legte er auf seinen Schreibtisch, wo es sogleich in die Augen fallen mußte, wenn man ihn am nächsten Morgen fand, einen stillen, bleichen Mann. Niemand würde sich wundern, daß er den Verlust von Frau und Sohn nicht zu überleben vermochte.
Eben wollte er zum Revolver greifen, wie er bereits einst getan, als er an das Totenbett seines Vaters gerufen wurde. Da fuhr er zusammen, denn es wurde an der Tür gerüttelt. Nur jetzt, keine Störung, wo er mit der ganzen Welt abgeschlossen hatte!
Es war der Sturm gewesen, der sich von neuem erhoben hatte und in einzelnen Stößen pfeifend und brausend dahersauste. Dazwischen ließ sich fernes Donnergrollen vernehmen, und fahle, bleiche Blitze verjagten für kurze Momente die Finsternis. Das erste Frühlingsgewitter zog herauf. Das tat ihm wohl. Er sah in dem Kampf der Elemente ein Abbild desjenigen, der in seiner Seele geherrscht hatte.
So öffnete er das Fenster und ließ Regen und Wind sich ins Gesicht peitschen: das kühlte seine brennende Stirn und beschwichtigte das Bohren und Hämmern in seinen Schläfen, das ihn so gequält hatte. Er wurde ruhiger, brauchte nicht mehr zu fürchten, daß die in fiebernder Schwäche bebende Hand nicht sicher zielen würde
Wie schnell das Gewitter heraufzog! Blitz folgte auf Blitz, der Donner zerriß krachend die Wolkenschichten und doch wurde sein Rollen fast übertäubt durch das Brausen des Orkans, der Regen stürzte prasselnd in Strömen herab. Die Fenster des Schlosses erhellten sich, die Schrecken des Unwetters trieben die Bewohner aus den Betten. Man bangte vor dem Unheil, das sich ereignen konnte. Er freute sich, wenn er überhaupt noch einer solchen Regung fähig war.
Nun schloß er das Fenster und setzte sich in dem Sessel zurück, der seinen leblosen Körper aufnehmen sollte, und griff zu der befreienden Waffe.
Da durchzuckte ein leuchtender prächtiger Blitz von ungeheurer Mächtigkeit die Luft, ein Prasseln und Knistern vermischte sich mit einem furchtbaren, betäubenden Donner. Ehe der Freiherr, der unwillkürlich zusammengefahren war, wieder Herr seiner Nerven geworden war, trat rötliches Licht an die Stelle der Finsternis, der Blitz mußte gezündet haben.
Rufen und Schreien ließ sich hören, durch die Bäume des Parkes schimmerte der in rote Glut getauchte Himmel, flackernd stiegen die Flammen in die Höhe, es brannte im Dorfe und dort erhob sich heulend und wimmernd der Hilferuf der Sturmglocke.
Auch an das Ohr des Schloßherrn drang ihr Ton und verscheuchte alle Gedanken an ihn selbst, alles, was soeben noch seine Seele bewegt hatte. Es galt zu retten, zu helfen, wie durfte er da seinen Beistand versagen?
Er eilte hinaus, und nun war er wieder der Gebieter, der ruhig und kühl die Gefahr erwog, um ihr beherzt und kühn entgegenzutreten.
»Wo brennt's?«
»Im Dorfe, es muß beim Waisenhause eingeschlagen haben,« lautete der Bescheid.
Der Freiherr gab einige Befehle und eilte an der Spitze seiner Leute dorthin.
Das Feuer hatte mit Windeseile um sich gegriffen, durch den Sturm den nächstliegenden Gebäuden zugeweht. Der Regen hatte leider aufgehört, so fanden die Flammen kein Hemmnis.
Das Waisenhaus selbst war ein züngelndes Flammenmeer, aus allen Fenstern brach sich das entfesselte Element Bahn und wirbelte als mächtige Flammensäule zum Dache empor.
»Sind die Kinder in Sicherheit?« fragte der Freiherr.
Man bejahte es und zeigte auf die kleine Schar, die in einiger Entfernung jammernd und weinend zusammengedrängt stand und nicht wußte, wohin sie sich flüchten sollte.
»Bringt sie auf das Schloß, meine Schwester wird für sie sorgen,« gebot der Freiherr und befahl ein planmäßiges Vorgehen gegen das Feuer, bisher war man ziemlich kopflos verfahren.
Der Blitz mußte in allen Stockwerken gezündet haben, daher stand das ganze Haus in Flammen und war nicht mehr zu retten, nur für die nächstliegenden sehr gefährdeten Gebäude konnte etwas geschehen.
Der Freiherr stürzte selbst in die Ställe, um Pferde und Rinder von ihren Ketten zu lösen und herauszuziehen, eine schwierige Aufgabe, da die entsetzten Tiere heftigen Widerstand leisteten.
Da pflanzte sich eine Schreckenskunde von Mund zu Munde fort und lähmte die Arbeit der Rettenden.
»Frau Brandt fehlt, die Kinder meinen, sie wäre im Hause geblieben.«
»So müssen wir hinein und sie retten, ist es sicher, daß sie vermißt wird?« fragte der Freiherr.
»Da ist die Liese, die sagt's für gewiß!« rief ein Mann.
Ein weinendes Bauernmädchen, die Schürze vor dem Gesicht, wurde vorgeschoben, denn sie fürchtete sich augenscheinlich.
»Ich konnt' gewiß nicht dafür,« jammerte sie. »Ich schlief so fest und da hat mich die Frau wecken wollen, und sie hatte Mühe mit mir, denn ich war sehr verschlafen und wollte von Aufstehen nichts wissen, und als ich das Unglück sah, verlor ich erst recht den Kopf und wußte mir nicht zu helfen.«
»Weiter, weiter,« drang man von allen Seiten in das Mädchen.
»Ach Gott, da hat mir die Frau geholfen, daß ich etwas auf den Leib kriegte und nicht so nackt und bloß fortmußte und dann sind wir an die Treppe gelaufen und da ist sie gefallen und konnte nimmer ausstehen. Und ich traute mich nicht, ihr aufzuhelfen und bin fortgestürmt und –«
»Du hast die arme, alte Frau in ihrer Not verlassen!« schrie ihr einer der Männer zu.
»Ach Gott, ich dachte ja nur an mich selbst,« entschuldigte sich das weinende Mädchen, »es war gar zu schrecklich, und nun ist's mir eingefallen, wie schlecht ich an der Frau Brandt gehandelt habe und ich fürchtete mich, es zu sagen.«
»Oben an der Treppe blieb Frau Brandt liegen?« forschte der Freiherr.
»Jawohl, oben auf dem Boden, wo meine Kammer war.«
»Dann ist sie nicht mehr zu retten, Gott sei ihr gnädig, sie ist verloren,« hieß es nun.
»Nicht, wenn ich sie retten kann,« sagte der Freiherr.
Sie wollten ihn nicht lassen, ihn lieber mit Gewalt zurückhalten, aber er befahl: »Laßt mich, ich will es.«
Nun wollten einige der Beherztesten mit ihm gehen, aber er wies ihre Begleitung zurück, indem er sagte: »Es ist genug, wenn ein Menschenleben gefährdet wird.«
Der Professor wagte noch eine Vorstellung und sagte: »Sie wollen kein Leben retten, Sie wollen das eigene vernichten, weil es Ihnen unerträglich geworden ist.«
»Und wenn es so wäre, so gönnen Sie mir auf solche Weise zu enden,« erwiderte der Freiherr und damit verschwand er in dem brennenden Gebäude.
Furchtbare Minuten vergingen, jeden Moment konnte der Einsturz des Hauses erfolgen.
Endlich erschien der Freiherr an einem der Fenster, inmitten von Rauch und Qualm, in seinen Armen die bewußtlose, halberstickte alte Frau.
Tücher wurden gespannt, Betten ausgebreitet; der Freiherr schwang sich auf die Brüstung des Fensters und ließ den wie leblosen Körper aus seinen Armen gleiten. Ein dumpfer Fall und der Angstschrei, der sich der beklommenen Brust von Hunderten banger Menschen entrang, ertönten zusammen, dann atmeten alle auf, es war gelungen, die Frau aufzufangen, ohne daß sie Schaden erlitten hatte.
Nun wandten sich die angstvollen Blicke dem Retter zu. Unbegreiflicherweise zögerte er noch und beachtete die immer dringender werdenden Zurufe nicht. Nur wenige Sekunden hatte sein Säumen gedauert, und doch sollte es ihm verhängnisvoll werden, denn jetzt erfolgte ein Krachen, ein Beben und Erzittern der Mauern und nun stürzte das Gebäude zusammen und begrub ihn unter seinen Trümmern vor den Augen der entsetzten Zuschauer.
Am andern Tage fand man die bis zur Unkenntlichkeit entstellten verkohlten Überreste des Freiherrn. Die alte Frau Brandt hatte sich erholt und beklagte jammernd, daß er um ihretwegen sein Leben hingegeben hatte.
Der Professor hatte als der erste das Gemach des Verunglückten betreten. Der Revolver auf dein Schreibtisch, den der Freiherr sich nicht die Zeit genommen fortzutun, als er zu dem Feuer eilte, sagte ihm alles und bestätigte ihm die Vermutung, daß jenem das Leben eine unerträgliche Last gewesen. Aber niemand sonst sollte ahnen, daß sein Tod nicht bloß der edelsten Menschenliebe entsprungen war. So schloß er den Revolver in den offenstehenden Gewehrschrank und steckte den Brief, der daneben gelegen und dessen Aufschrift seinen Namen trug, zu sich.
In der ersten stillen Stunde, die ihm wurde, las er Brief und Dokumente, durch die er erfuhr, daß er selbst der Erbe der Wildburgs war.
Dunkle Ahnungen von Schuld und Frevel stiegen vor der Seele des tief erschütterten Mannes auf, aber er gelobte sich, den Schleier, der jetzt darüber lag, nicht zu lüften und keinem neugierigen Auge, keinem zweifelnden Gedanken das Eindringen in die düsteren Geheimnisse, die hier gewaltet hatten, zu gestatten.
![]()
Jahre sind vergangen, seit der Freiherr Albrecht von Wildburg die so heiß ersehnte Ruhe gefunden hat.
Als neuer Herr waltet der wahre Erbe der Wildburgs, der einstige Professor Blanden, an der Seite seiner lieblichen Gemahlin aus dem Schlosse. Allerdings sind ihm jährlich nur wenige Wochen der Ruhe dort vergönnt, denn sein Leben gehört dem rastlosen Forschen und Arbeiten im Dienste der Menschheit, aber er kennt keine Ermattung, denn in der Vereinigung mit Lilly hat er das reinste Glück gefunden, und wie sie selbst jung und frisch sich erhält, so weiß sie die Falten von der Stirn des Denkers zu verwischen und ihm durch das Bewußtsein ihrer treuen Liebe stets neue Kraft zu verleihen. Edith ist ihnen eine geliebte Tochter, die kaum missen würde, was sie alles verloren hat, wenn Lilly nicht in ihr das Andenken an ihre Heimgegangenem: und kaum gekannten Eltern wach erhielte.
Die Freifrau Lilly von Wildburg ist von heranblühenden Kindern umgeben, die ihren Stolz und ihr Glück bilden; ihr ältester Sohn ist nun der Erbe der Wildburgs, aber die Angst und Sorge, mit denen die arme Melanie einst auf ihren Sohn blickte, sind Lilly fremd, denn sie weiß nichts von Schuld und Sühne sie kennt nur treu erfüllte Pflicht.
