
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

E. T. A. Hoffmann. Königl. Preuß. Kammergerichts Rath
H = Aus Hoffmann's Leben und Nachlaß. Herausgegeben von dem Verfasser des Lebensabrisses F. L. Z. Werners [= Julius Eduard Hitzig]. 2 Teile. Berlin, Dümmler, 1823.
Der erste Abschnitt (S. 1-80) ist »fast ganz« von Hoffmanns Freunde Th. v. Hippel niedergeschrieben: Randbemerkung Hippels in seinem Handexemplar des Hitzig'schen Buches (siehe Hippel's Biographie von Dr. Bach. Breslau 1863).
K = Erinnerungen aus meinem Leben in biographischen Denksteinen und andern Mitteilungen. Herausgegeben von Z. Funck [= C. F. Kunz]. Leipzig, Brockhaus, 1836. Erster Band. Seite 1-172: E. T. W. Hoffmann.
H3 = E. T. A. Hoffmann's Leben und Nachlaß. Von Julius Eduard Hitzig. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. 3 Bände. Stuttgart, Brodhag, 1839.
Die wichtigsten Vermehrungen bestehen in bisher ungedruckten Briefen Hoffmanns an Hippel und C. F. Kunz, zahlreichen Anmerkungen von Kunz, sowie Erinnerungen Fouqués an Hoffmann.
F = Briefe an Friedrich Baron de la Motte Fouqué. Mit einer Biographie Fouqué's von Jul. Ed. Hitzig. Berlin, Adolf & Comp., 1848.
Enthält S. 122-145 Hoffmanns Briefe an Fouqués von 1812-1819.
*
Ellinger = E. T. A. Hoffmann. Sein Leben und seine Werke. Von Georg Ellinger. Hamburg und Leipzig, Leopold Voß, 1894 (XII und 230 Seiten, in gr. 80).
S. W. = E. T. A. Hoffmanns sämtliche Werke in fünfzehn Bänden: die gegenwärtige Ausgabe.
*

Der nordöstlichsten Landschaft des Deutschen Reiches, der altpreußischen Provinz Ostpreußen, die unsrer Nationallitteratur im 18. Jahrhundert den ausgezeichneten Romandichter Theodor Gottlieb von Hippel, einen deutschen Sterne, schenkte, entstammt auch der romantische Dichter, Musiker und Maler, der im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts seine dämonischen Werke schuf – E. T. A. Hoffmann. Sein Ruhm als eines der größten Erzähler der Weltlitteratur ist weit über sein Vaterland hinausgedrungen: zahlreiche Übersetzer verpflanzten ihn nach Frankreich und Balzac, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, George Sand feierten ihn, Alfred de Musset besang ihn; Carlyle übersetzte ihn ins Englische; 1835 wurde er ins Italiänische übersetzt; seine Kompositionen und seine Oper erkannten C. M. v. Weber und Robert Schumann bewundernd an; dem posthumen Porträt, das Adolf Menzel von ihm entwarf, lag Hoffmanns eigne Zeichnung zu Grunde. – In Deutschland hat er im Laufe der Zeit an seiner früheren Popularität eingebüßt. Wesentlich hat dazu die Behandlung beigetragen, die er in der Ende der dreißiger Jahre zuerst erschienenen, vielverbreiteten Litteraturgeschichte des Heidelberger Professors Gervinus erfahren mußte, der gerade das Hoffmann am meisten Auszeichnende als seinen, ihn aus der Poesie hinausweisenden Fehler brandmarkte. »Er hatte, sagt der Professor, die Maximen und Praxis, die alle Humoristen haben, das Selbstangeschaute unmittelbar darzustellen, ohne es über das Zufällige zu erheben. In seinen Schriften figurieren seine Verwandten und sein Leben, in den Serapionsbrüdern sein Berliner Freundeskreis, im Kater Murr sind die Beziehungen auf seine Eigenheiten und sein Leben am häufigsten; Erinnerungen aus Königsberg und Glogau sind in den Nachtstücken verarbeitet und so anderes anderswo. Alles liegt in einem ungestalteten Haufen (!), aus dem ein anderer, der das Talent hätte, erst etwas bilden müßte (!!).« Also ein verblasener Idealist soll den realistischen Dichter erst umdichten!! Die Persönlichkeit Hoffmanns war dem ganz unkünstlerischen Gelehrten ebenfalls höchst zuwider: »Alles was den Geist natürlich hält (!), Gespräche über Politik, Staat, selbst Religion haßte Hoffmann frühe und immer … Seine excitierten Nerven reizte er mit Wein und Nachtarbeiten, unachtsam, daß ihm ein mäßiges Leben für Geist und Körper das zuträglichste war« u. s. w. u. s. w. Hätte unser Dichter diese Salbadereien lesen können, so würde er ausgerufen haben, wie in den »Serapionsbrüdern« (S. W. VI, 16): nicht ohne einiges Entsetzen kann ich diesen tiefen gespenstischen Philistrismus anschauen! Inzwischen scheint die Volkstümlichkeit Hoffmanns im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wieder im Wachsen zu sein, wie namentlich die vielen »ausgewählten Werke« beweisen. Aber auch von der zwölfbändigen Ausgabe der »Gesammelten Schriften« (Berlin, Georg Reimer, 1844 und 1856) erschien 1871-78 ein neuer Abdruck (leider weist diese Ausgabe recht zahlreiche Druckfehler, namentlich versehentliche Auslassungen von Worten auf); 1883 kam eine neue Gesamtausgabe: »E. T. A. Hoffmanns Werke« (Berlin, Gustav Hempel) in 15 Teilen heraus, die zwar vollständiger und korrekter als die Reimersche, aber durch willkürliche Änderungen, Sprach- und Stil-»Verbesserungen« des Herausgebers entstellt ist. Die gegenwärtige Gesamtausgabe ist vollständiger als ihre beiden Vorgänger, indem sie, im XV. Bande, eine ganze Reihe bisher unbekannter oder verschollener kleinerer Schriften des Dichters darbietet. Übrigens geht sie durchweg auf die Hoffmannschen Originalausgaben zurück und reproduziert auch zum erstenmal aus ihnen von Hoffmann selbst herrührende oder von ihm angeordnete Originalillustrationen.
In dem folgenden biographischen Kommentar, der durch zahlreiche ungedruckte Briefe Hoffmanns bereichert werden konnte, habe ich alles zusammengetragen, was zur Erläuterung der Werke und der Persönlichkeit ihres Verfassers dienen kann.
*
Das Geschlecht Es scheint einen Palmbaum im Wappen geführt zu haben, wenigstens siegelte unser Dichter seine Briefe mit diesem Symbol., dem Hoffmann entsprossen ist, läßt sich von seinen Eltern aus nur Eine Generation zurückverfolgen. Vom Großvater väterlicherseits ist gar nichts überliefert, von der Großmutter nur, daß sie eine geborene Vöthöry gewesen, Schwester des Königsberger Justizraths Ernst Theodor Vöthöry (H3 I, 5). Hoffmanns Vater, Christoph Ludwig Hoffmann, geboren 1736, hatte wie sein Onkel die juristische Laufbahn eingeschlagen. Als höherer Justizbeamter in Königsberg heiratete er, am 29. Oktober 1767, seine Cousine, die älteste Tochter des mit einer andern Schwester Vöthörys verheirateten Königsberger Advokaten und weltlichen Konsistorialraths Dörffer. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor: von dem erstgeborenen ist nichts Näheres bekannt geworden, der zweite sollte den Namen Hoffmann berühmt machen. Er wurde am 24. Januar 1776 zu Königsberg geboren und auf die Namen Ernst Theodor Wilhelm evangelisch getauft. Die Vornamen Ernst Theodor erhielt der Knabe von seinem Großonkel Vöthöry (S. W. III, 164), den dritten Namen Wilhelm – den er nachmals aus Verehrung für Mozart in Amadäus umwandelte – vermutlich von dem Bruder seiner Mutter. Ernst war der Rufname. Humoristisch hat er später – in der »Biographie Kreislers« (S. W. X, 82) – die Geburtsscene beschrieben: »Am Tage Johannis Chrysostomi, das heißt am vierundzwanzigsten Januar des Jahres Ein tausend siebenhundert und etzliche dazu, um die Mittagsstunde, wurde Einer geboren, der hatte ein Gesicht und Hände und Füße. Der Vater aß eben Erbsensuppe und goß sich vor Freuden einen ganzen Löffel voll über den Bart, worüber die Wöchnerin, unerachtet sie es nicht gesehen, dermaßen lachte, daß von der Erschütterung dem Lautenisten, der dem Säugling seinen neuesten Murki vorspielte, alle Saiten sprangen und er bei der atlassenen Nachthaube seiner Großmutter schwor, was Musik betreffe, werde der kleine Hans Haase ein elender Stümper bleiben ewiglich und immerdar. Darauf wischte sich aber der Vater das Kinn rein und sprach pathetisch: Johannes soll er zwar heißen, jedoch kein Haase sein.«
Drei Jahre nach Ernsts Geburt wurde der Vater als Kriminalrath und Justizkommissarius an das Oberlandesgericht in Insterburg versetzt, ließ aber seine Familie in Königsberg zurück, so daß die Ehe von nun ab faktisch getrennt blieb. Über die Gründe dieser Trennung sind wir nicht genauer unterrichtet; angedeutet finden sie sich a. a. O.: »Weshalb mein Vater mich ganz dem Bruder meiner Mutter überließ oder überlassen mußte, darf ich dir nicht sagen, da du Ähnliches in manchem verbrauchten Familienroman, oder in irgend einer Ifflandschen Hauskreuzkomödie nachlesen kannst« (S. W. X, 89). An der unglücklichen Ehe hatte wohl den Hauptanteil die Kränklichkeit der Frau: wir wissen, daß sie an Hysterie litt (S. W. IX, 104). Indessen scheinen auch die Charaktere der Ehegatten sich abgestoßen zu haben. Christoph Ludwig Hoffmann soll (wie es H I, 2 heißt) »ein Mann von vielem Geiste, aber von unordentlichen Neigungen gewesen sein«, während sich im Gegensatz dazu die Familie seiner Frau durch eine »fast peinliche Ordnungsliebe und die höchste Decenz in allen äußeren Formen« auszeichnete. Frau Hoffmann kehrte, mit ihren beiden Söhnen, in das Haus ihrer inzwischen verwitweten Mutter zurück, die mit einem unverheirateten Sohne und einer gleichfalls unverheirateten Tochter zusammenlebte. Um die Erziehung der von ihrer ältesten Tochter in das Haus gebrachten beiden Enkelkinder – von denen der ältere übrigens demnächst dem Vater nach Insterburg nachgesandt wurde – bekümmerte sie sich nicht, ebensowenig wie die Mutter. Es wird berichtet, daß beide Frauen sich ganz auf den Kreis ihres gemeinschaftlichen Wohnzimmers beschränkten, das sie nie verließen (H I, 4). So lebte Frau Hoffmann noch mehr als ein Jahrzehnt vegetierend dahin, sie starb am 15. März 1796, wie der Sohn noch am selben Tage seinem vertrautesten Freunde meldet: »Heute morgen fanden wir meine gute Mutter tot aus dem Bette herausgefallen. Ein plötzlicher Schlagfluß hatte sie in der Nacht getötet, das zeigte ihr Gesicht, von gräßlichen Verzuckungen entstellt … Du wirst meinen Schmerz mit mir fühlen« (H I, 111 f.). Später bekannte er indes, daß »der Tod seiner Mutter keinen sonderlichen Eindruck auf ihn gemacht habe« (S. W. X, 89). Er glaubte jedoch, wie es an einer andern Stelle (S. W. IX, 104) heißt, von ihr die ihn auszeichnende Fantasie geerbt zu haben: »Man sagt, daß der Hysterismus der Mütter sich nicht auf die Söhne vererbe, in ihnen aber eine vorzüglich lebendige, ja ganz excentrische Fantasie erzeuge und es ist einer unter uns [nämlich er selbst], an dem sich die Richtigkeit dieses Satzes bewährt hat.«
Andrerseits leitete er seine dichterische Anlage überhaupt vom Vater ab, denn er schreibt seinem älteren Bruder im Jahr 1817: »Das Dichten ist bekanntlich Familiensünde väterlicherseits« (H II, 202). Auch sein musikalisches Talent scheint auf den Vater zurückzugehen. In demselben Briefe an den Bruder heißt es freilich: »in der Musik haben, soviel ich weiß, unsere Altvordern nicht sonderlich viel geleistet. Soviel ich mich erinnere, spielte Papa Viola di Gamba, worüber ich einmal, als drei- oder vierjähriger Knabe, in ein entsetzliches Weinen ausbrach, und nicht zu beschwichtigen war, nisi durch einen schicklichen Pfefferkuchen. Papa hatte aber keinen Takt, und böse Verleumdung behauptete, er habe einmal eine Menuett nach einer Polonaise getanzt.« Und in einer Parallelstelle hierzu, in der »Biographie Kreislers«, heißt es: »So war auch eines andern Verwandten Spiel auf der Viola di Gamba gar angenehm und verlockend, wiewohl derjenige Onkel, der mich erzog, oder vielmehr nicht erzog, … ihm mit Recht Mangel an Takt vorwarf. Der Arme geriet auch bei der ganzen Familie in nicht geringe Verachtung, als man erfahren, daß er in aller Fröhlichkeit nach der Musik einer Sarabande eine Menuett a la Pompadour getanzt« (S. W. X, 88 f.). Allein an einer andern Stelle läßt er den Orgelbauer Liscov »den tiefen musikalischen Sinn des Vaters« rühmen (S. W. X, 105). Dieser Meister Abraham Liscov »war in seinen Jünglingsjahren der vertrauteste Freund des Vaters gewesen« und der Sohn, »dessen ganze Seele durchdrungen war von dem Gedanken an Den, der ihm der nächste gewesen, und den er nie gekannt, wollte immer noch mehr hören« von seinem Vater, aber »Liscov verstummte plötzlich« (a. a. O.). – Die letzten Jahre des Vaters waren keine glücklichen: sein Sohn schreibt, am 23. Januar 1796, seinem Freunde: »Daß meinen alten Vater zweimal der Schlag gerührt hat, ist mehr als traurig, – seine und die Umstände des Bruders, sind dadurch die elendesten geworden, und für mich ist das Gefühl, nicht helfen zu können, niederdrückend« (H I, 92 f.). Am 27. April 1796 starb er. Daß der Sohn dem Vater so fern gestanden, spricht sich in seiner bitter ironischen Erwähnung des Todesfalles demselben Freunde gegenüber aus (Brief vom 10. Mai 1797): »Mancher ist gestorben im Jahr meiner Abwesenheit, z. B. mein Vater!«
Noch bezeichnender ist ein Erlebnis, welches der Musikschriftsteller Friedrich Rochlitz in Leipzig an einem Winterabend des Jahres 1813 mit Hoffmann (damals Musikdirektor daselbst) hatte. In einem Gespräche mit ihm und noch einem Freunde über Goethes Iphigenie recitierte Rochlitz die Stelle: Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt etc. Da sprang Hoffmann, der mit stechenden Blicken an Rochlitz gehangen, plötzlich auf und rannte in den entferntesten Fensterbogen des Zimmers. Erst nach zwei Minuten kam er zurück und sagte: »Heute vormittags hab' ich auch Probe auf die Schwestern von Prag gehalten. Es ist doch ein göttlicher Unsinn in dem tollen Dinge etc.« (Für Freunde der Tonkunst. 3. Aufl. II, 6 f.)
»Der schlechte Vater ist noch immer viel besser als jeder gute Erzieher«, heißt es in der ›Biographie Kreislers‹: im großmütterlichen Hause hatte der kleine Hoffmann aber nicht einmal einen guten Erzieher gefunden, denn der ältere Bruder seiner Mutter, Otto Wilhelm Dörffer, der Vaterstelle an ihm vertreten sollte, vernachlässigte diese Verpflichtung in jeder Weise: »er zog oder erzog mich ganz und gar nicht, so daß sich kein Mensch auf Erden darüber verwundern darf, daß ich ungezogen bin« (S. W. X, 89 f.). Dieser Onkel hatte sich aus dem Justizdienst, mit dem Titel eines Justizrathes, zeitig zurückgezogen und lebte nun, als wunderlicher pedantischer Junggeselle im Hause seiner Mutter, die ihn immer noch »Ottchen« nannte. Er war »beschränkten Verstandes und voll der lächerlichsten Eigenheiten«, ein kleines »lächerlich aussehendes« Männchen (S. W. X, 104, 92). Seine Hauptbeschäftigung war die Musik, und die komischen Konzerte, die er veranstaltete, hat sein Zögling später, in den »Fantasiestücken« (S. W. I, 302 f.) und in der Erzählung ›Die Fermate‹ (S. W. VI, 59 ff.) ergötzlich geschildert. »Seltsam genug war es die Musik allein, erzählte Hoffmann weiter (in der ›Biographie Kreislers‹), die zu treiben mich der Oheim mit Strenge anhielt, unerachtet der Lehrer, getäuscht von dem nur momentanen Widerwillen, den ich dagegen äußerte, mich für ein durchaus unmusikalisches Prinzip hielt. Was ich übrigens lernen oder nicht lernen mochte, das war dem Oheim völlig gleich. Äußerte er manchmal lebhaften Unwillen, daß es so schwer hielt, mich zur Musik anzuhalten, so hätte man denken sollen, daß er von Freude hätte durchdrungen sein müssen, als nach ein paar Jahren der musikalische Geist sich so mächtig in mir regte, daß er alles übrige überflügelte; das war aber nun wieder ganz und gar nicht der Fall. Der Oheim lächelte bloß ein wenig, wenn er bemerkte, daß ich bald mehrere Instrumente mit einiger Virtuosität spielte, ja, daß ich manches kleine Stück aufsetzte zur Zufriedenheit der Meister und Kenner. Ja, er lächelte bloß ein wenig und sprach, wenn man ihn mit Lobeserhebungen anfuhr, mit schlauer Miene: Ja, der kleine Neveu ist närrisch genug« (S. W. X, 92). Konnte ihm aber der Onkel weder Liebe noch Achtung abnötigen, daher er ihn auch aufzog und mystifizierte, wo er nur konnte, so hing er dagegen an der Tante mit ganzer Liebe und Verehrung. »Ich finde mich, heißt es a. a. O. von ihr, ein Kind von noch nicht drei Jahren, auf dem Schooß eines Mädchens, deren mildblickende Augen mir recht in die Seele leuchteten, daß ich noch die süße Stimme höre, die zu mir sprach, zu mir sang, daß ich es noch recht gut weiß, wie ich der anmutigen Person all' meine Liebe, all' meine Zärtlichkeit zuwandte.« Dies war aber eben Tante Sophie, die in seltsamer Verkürzung »Füßchen« gerufen wurde« (S. W. X, 84 f.). An einer andern Stelle, in den ›Fantasiestücken‹, hat er ihrer nicht minder warm gedacht: »manchmal geschah es, daß die Schwester meiner Mutter eine Arie sang. Ach, wie freute ich mich immer darauf! Ich liebte sie sehr; sie gab sich viel mit mir ab, und sang mir oft mit ihrer schönen Stimme, die so recht in mein Innerstes drang, eine Menge herrlicher Lieder vor, die ich so in Sinn und Gedanken trage, daß ich sie noch für mich leise zu singen vermag« (S. W. I, 303). Sophie Dörffer sang aber nicht nur, sondern war auch Virtuosin auf der Laute. Ihr Lehrer war der obenerwähnte Lautenist, der zu des Knaben Geburt ein Murki spielte. »Gesetzte Männer,« erzählte Hoffmann später, »die schreiben und rechnen können und wohl noch mehr als das, haben in meiner Gegenwart Thränen vergossen, wenn sie bloß dachten an das Lautenspiel der seligen Mamsell Sophie. Mir ist es deshalb gar nicht zu verdenken, wenn ich, ein durstig Kind, meiner selbst nicht mächtig, noch ohne in Wort und Rede aufgekeimtes Bewußtsein, alle Wehmut des wunderbaren Tonzaubers, den die Lautenistin aus ihrem Innersten strömen ließ, in begierigen Zügen einschlürfte« (S. W. X, 84). Seinen ersten Musikunterricht hat Hoffmann in den ›Fantasiestücken‹ lebendig geschildert (›Kreisleriana‹: Der Musikfeind). Der »alte eigensinnige« Organist, der ihn unterrichtete, war ein Pole, mit Namen Podbielski (S. W. VI, 59; H I, 9). Die Schule, und zwar das deutsch-reformierte Gymnasium, besuchte der Knabe seit dem Jahre 1786. Rektor desselben war Dr. Wannowski, Kants, Hamanns und Hippels Freund. Hoffmann gedachte diesen seinen Lehrer in seinem (über einige Notizen nicht hinausgekommenen) Werke ›Jacobus Snellpfeffer‹ zu verewigen: »Erziehung. Rektor Wannowski nicht zu vergessen« heißt es in den betreffenden Aufzeichnungen aus den Jahren 1821/22 (H II, 295). Es wird berichtet, daß er die eigentlichen Schulwissenschaften gegen die Beschäftigung mit den Künsten hintangesetzt habe. Neben seinem immer entschiedener hervortretenden Talente zur Musik machte sich alsbald ein nicht minder hervorstechendes Talent zum Zeichnen und Malen geltend. In der Malerei unterrichtete ihn »ein anspruchsloser, gemütlicher Maler«, Namens Sämann. Erwähnt wird besonders seine Treffsicherheit im Porträtieren, sowie sein Hang, »jede auffallende Gestalt als Karikatur hinzustellen« (H I, 16). Unter seinen Mitschülern erkor er nur Einen zum Freunde: Theodor von Hippel. Es war der am 13. Dezember 1775 geborene Sohn des Landpredigers Gotthard Friedrich von Hippel, der einzige Bruder seines Vaters war Theodor Gottlieb von Hippel, Geheimer Kriegsrath und Stadtpräsident von Königsberg, der Verfasser der ›Lebensläufe in aufsteigender Linie‹. Der junge Hippel kam ein Jahr später als Hoffmann auf das Gymnasium, sie hatten sich schon vorher in einem Landhause bei Königsberg kennen gelernt und waren von nun ab unzertrennlich. Nachdem die gemeinsam ausgeführten Knabenstreiche aufgehört hatten, trieben sie, in die höheren Klassen aufgerückt, zusammen häusliche Lektüre der Klassiker, wie Cicero und Xenophon, lasen aber auch Rousseaus » Confessions«, von denen Hoffmann eine deutsche Übersetzung in seines Onkels Bibliothek entdeckt hatte. Wie er nach Rousseau's Beispiel eine Oper zu komponieren versucht und welche Folgen dieser Versuch hatte, davon ist die Schilderung in der ›Biographie Kreislers‹ köstlich nachzulesen (S. W. X, 90 ff.). Da Hippel weder musikalisch noch malerisch begabt war, so schloß sich Hoffmann neben Hippel noch an zwei Mitschüler an, mit denen er seinen Lieblingskünsten oblag: es waren Faber (später Geheimer Archivar), mit dem er Violinduos einübte und Matuszewski, mit dem er gemeinschaftlich zeichnete und malte. Der letztere wurde Berufsmaler und seiner wird noch in den ›Serapionsbrüdern‹ gedacht. (S. W. VI, 162). Hoffmanns erste Schülerliebschaft machte Hippel getreulich mit, ihn bei den Fensterpromenaden begleitend, seine verliebten Verse bewundernd und die Porträts, die aus dem Gedächtnis entworfen wurden, begutachtend. Amalie Neumann Den Namen dieser ersten Liebe hat Hippel in seinem Handexemplar der Hitzigschen Biographie beigeschrieben. hieß die Angebetete, ein schönes Mädchen, die in die dem Gymnasium benachbarte französisch-reformierte Schule ging, von Hoffmann aber gar nichts wissen wollte, so daß er zu Hippel äußerte: »Da ich sie nun einmal nicht durch ein angenehmes Äußere interessieren kann, so wollt' ich, daß ich ein Ausbund von Häßlichkeit wäre, damit ich ihr auffiele und sie mich wenigstens ansähe!« (H I, 20.)
Was sein Äußeres betrifft, so zeichnete er sich, wie seine Mutter und deren Geschwister, durch einen fast abnorm kleinen Wuchs aus, sein dunkles, beinah schwarzes Haar war ihm tief bis in die Stirn gewachsen, er hatte graue Augen und eine besonders hervortretende, aber feine, gebogene Nase. Leider hat sich kein Jugendbild von ihm erhalten.
Nachdem er eben sein 16. Lebensjahr vollendet, am 27. März 1792 Das Datum zuerst im Artikel Hoffmann in der Allgemeinen Deutschen Biographie., wurde er als Studiosus juris bei der Königsberger Universität inskribiert. Die Jurisprudenz, die er der Familientradition folgend ergriffen, trieb er nur als Brotwissenschaft, war aber vorzüglich fleißig. Von Kants Vorlesungen, die er ebenfalls besuchte, erklärte er, daß er sie nicht verstehe. Vom sogenannten Studentenleben, d. h. Trinken, Fechten, Reiten etc. hielt er sich gänzlich fern. Seine ganze freie Zeit widmete er den Künsten, durch deren Ausübung er sich auch einen Zuschuß zu verdienen suchte. Mit der Malerei mißlang ihm dies freilich. Er hatte zwei Bilder aus der französischen Geschichte gemalt und übersandte dieselben dem Onkel seines Freundes, in der Hoffnung, daß dieser sie kaufen und ihn dann weiter empfehlen sollte. Allein Hippel ließ ihn zu sich bescheiden und sprach ihm seinen freundlichen Dank für die ihm gewidmete Gabe aus! »Das Resultat der ganzen Begebenheit,« schrieb Hoffmann dann seinem Freunde, »ist nun nichts weiter, als daß ich mit großem Aufwand von Zeit und Mühe mich lächerlich gemacht habe, und dieser Gedanke ist für mich jetzt sehr erbaulich« (H I, 27).
In der Musik gab er dagegen mit Erfolg Unterricht. Den jugendlichen Musiklehrer ereilte aber auch das Geschick, das für lange Jahre seinem Leben verhängnisvoll geworden ist: er verliebte sich in eine verheiratete Schülerin, die seine Liebe erwiderte. Hippel schildert sie als »ein reizendes weibliches Wesen, voll Sinn und Gefühl für die Kunst.« Die junge Frau hieß Cora Hatt (H I, 43 und 94: der Familienname von Hippel in sein Handexemplar der Hitzigschen Biographie beigeschrieben) und Hoffmanns Beziehung zu ihr begann in seinem letzten Studienjahr. »Ich liebe sie und bin unglücklich, weil ich sie nicht besitzen kann, weil, in dem süßesten Genuß der Liebe, ich qualvoll daran erinnert werde, daß sie nicht mein ist, – nicht mein sein kann,« gesteht er dem Freunde (H I, 86).
Am 22. Juli 1795 bestand er sein Auskultator-Examen, und wurde am 29. September bei der Regierung in Königsberg vereidigt. Schon vorher hatte ihn sein Großoheim, der Justizrath Vöthöry, der
als Justitiar der großen ostpreußischen Familien fungierte, oft als juristische Hülfskraft verwendet, er nahm ihn auch mit, wenn er die Güter seiner Mandanten bereiste: eine dieser Reisen zum Gerichtstag, auf das Rittergut des Freiherrn von Rossitten am Gestade der Ostsee, hat Hoffmann später in der Novelle ›Das Majorat‹ meisterhaft geschildert (S. W. III, 162 ff.). Er setzte darin seiner Verehrung des dem »Vetter« auch besonders zugethanen Verwandten ein schönes Denkmal, nicht minder aber seiner Liebe zu Frau Hatt. Denn in der Baronin, mit der er auf dem Schlosse musiziert, und zugleich den ersten, und einzigen, Kuß der Liebe küßt, haben wir das Porträt der geliebten Frau zu erkennen. Die geschilderte war übrigens die letzte Gerichtsfahrt des alten Vöthöry gewesen: er starb bereits im Oktober des Jahres 1795. Hoffmanns Freund Hippel war inzwischen als Auskultator in Marienwerder angestellt worden und beschwor ihn von da aus, sich den Fesseln des Verhältnisses zu Frau Hatt zu entwinden und an seiner Seite, in Marienwerder seine Dienstlaufbahn zu vollenden. Nach heftigem Kampfe riß sich Hoffmann mit »männlichem Entschluß« wirklich los
In dem biographischen Artikel
Hoffmann der »
EncycIopaedia Britannica« (Edinburgh 1881) heißt es in geradezu niederträchtiger Verdrehung der Thatsachen: »
a discreditable (!) love episode with one of his pupils drove him from Koenigsberg« (!!). Bei der Behandlung die
Byron in England noch immer erfährt, kann uns eine solche moralische Verunglimpfung eines deutschen Dichters freilich nicht Wunder nehmen.
Frau Hatt starb 1800. Vier Jahre später traf er in Plozk ihre Tochter, »ein junges blühendes Mädchen, schön wie Corregios Magdalena, gewachsen wie die Grazie der Angelika Kaufmann … es war Malchen Hatt. Sie hatte der Mutter Grazie. Das Ideal meiner kindischen Fantasie von dem
Vormals meiner Inamorata stand vor mir, eine süße, unbekannte Wehmut ergriff mich … Ich bin sonderbar bewegt. Der Toten sei hier ein Monument gesetzt!« (Tagebuch vom 18. Februar 1804: siehe unten S. XXIII, Anmerkung.), doch ging er nicht nach Marienwerder, sondern nach Glogau, wo der jüngste Bruder seiner eben gestorbenen Mutter als Oberamts-Regierungsrath stand. Anfang Juni 1796 verließ er seine Vaterstadt. Die damit abgeschlossene Königsberger Periode Hoffmanns, vom Dezember 1794 an, spiegelt sich in seinen sehr ausführlichen Briefen an Hippel anschaulich wieder (H I, 38-130). Aus diesen Briefen erhalten wir auch die erste Kunde, daß ihn, neben Musik (hier macht er sich besonders Mozarts Don Juan zu eigen) und Malerei, »die glücklichen Stunden der Autorschaft« beschäftigen: er schreibt
Romane. Der Titel des ersten war »
Cornaro, Memoiren des Grafen Julius von S.«,
der des zweiten »Der Geheimnisvolle«. Ein aus letzterem mitgeteiltes kleines Fragment feiert die ihn mit Theodor verbindende Freundschaft und satirisiert über die Unmöglichkeit der Mädchenfreundschaften (H I, 113-115). Außerdem wirft er mit Bleistift Vignetten satirischen und amorösen Inhalts hin, die ihm Stoff zu einem Werke geben sollen, das er unterm Namen Ewald Trinkulo schreibt. »Du wirst wissen, daß in Shakespeares Sturm der Hofnarr des Königs
Trinkulo heißt, und das war mein Ahnherr« (H I, 79).
Erhalten hat sich sonst nichts von diesen ersten schriftstellerischen Versuchen. Dagegen ist die anmutige Schilderung einer Maskerade, in an Wieland erinnernden Reimversen aufbewahrt (H I, 36-38), wie er denn auch in den seinen späteren Werken eingestreuten Gedichten, Sonetten, Glossen, Terzinen sich stets als gewandter Verskünstler bewährt hat. Was den Kreis seiner Lektüre in jenen Königsberger Entwickelungsjahren betrifft, so finden wir – außer den schon erwähnten Shakespeare und Rousseau – verzeichnet: Lorenz Sterne (H I, 148, 202, 205); Goethes Faust – die Gretchenepisode in der Kirche, das Iudex ille quum sedebit, setzt er in Musik, und beabsichtigt auch die Claudine von Villa bella zu komponieren (H I, 74), Werthers Leiden hatte er schon in seinem zwölften Jahre gelesen (S. W. VII, 146); Hippels Lebensläufe und Jean Paul; Schillers Räuber und Don Carlos – den letzteren las er siebenmal hintereinander, König Philipp wurde ihm zum »Hatt«, Elisabeth zu Frau Hatt, sich selbst identifizierte er mit Carlos, seinen Hippel mit Posa (H. I, 94). Von Schillers ›Geisterseher‹ erwähnte er (in der, Mitte der neunziger Jahre spielenden Novelle ›Das Majorat‹), daß er das Buch »wie damals jeder, der nur irgend dem Romantischen ergeben, in der Tasche getragen« (S. W. III, 169). Von geringeren Geistern machte der Roman des Abenteurers Karl Große ›Der Genius. Aus den Papieren des Marquis v. G.‹ (4 Bde., Halle 1790-94) Eindruck auf ihn, er wirkte auf seine Produktion: »Unbemerkt entschlüpften die Ideen aus dem Buche und eigene traten an ihre Stelle« (H. I, 47; über Große vgl. Bürgers sämtliche Gedichte. Berlin, Grote, 1889 II, 61). Eine köstliche Entdeckung war es für ihn, als er in dem Kriegsrath J. G. Scheffner den Verfasser der »Gedichte im Geschmack des Grécourt«, des unzüchtigsten Buches in der ganzen deutschen Litteratur, erkannte. Scheffner, eine lange hagere Gestalt, mit dem Kopfe eines Satyrs, stets in Grau gekleidet – »in einem altmodisch zugeschnittenen aschgrauen Rocke, ebensolcher Weste und gleichen Beinkleidern« wie der Advokat Coppelius (S. W. III, 11) oder wie Herr Dapsul von Zabelthau: »Ein langer hagerer Mann … Er trägt einen kleinen grauen Filzhut … eine durchaus graue Kleidung, Rock, Weste und Hose, graue Strümpfe und Schuhe, ja selbst der sehr hohe Stock ist grau lackiert« (S. W. IX, 192) – war ihm längst ein Gegenstand beißender Bemerkungen gewesen. Nun hatte der junge Hippel bei seinem Onkel in einem diesem von Scheffner geliehenen Buche das von Scheffners Hand geschriebene und von ihm eigenhändig korrigierte Manuskript eines einzelnen Gedichtes aus den ›Gedichten im Geschmack des Grécourt‹ gefunden und den Fund triumphierend seinem Hoffmann gezeigt. Des letzteren satirischer Jubel darüber war um so inniger, als Scheffner »ihm immer nur als strenger Sittenrichter bekannt geworden war« (H. I, 28).
»Mittwoch den 15ten Junius [1796], früh um 6 Uhr« traf Hoffmann in Glogau ein. Ein Reiseabenteuer mit dem Knopfmacher Küster in Marienwerder, seiner schönen Frau und den Kindern hat er mit dem Stifte des Verfassers der ›Sentimentalen Reise‹ geschildert (H I, 148 ff.: der Name von Hippel in seinem Handexemplar beigeschrieben). Bei seinem Onkel und dessen Familie fand er die freundlichste Aufnahme, aber die Sehnsucht nach der Königsberger Geliebten trübt doch das erste Jahr seines Glogauer Aufenthalts, er korrespondiert mit ihr und empfängt ihr Miniaturbild. »Getroffen ist sie und schön gemalt, – das Gemälde ist aber in Nova Zembla gemalt. – Kein warmes Kolorit, – kein feuriger Blick führt's zum Herzen. – Sie ist's nicht. – Sie, die mich liebt; – ich arbeite an einer Kopie, der meine glühende Fantasie Leben und Geist geben soll« (H.1, 165). Der in ihm schlafende Genius der Malerei wurde besonders durch die Bekanntschaft mit dem Maler Molinari geweckt, der sich in Rom zum Künstler ausgebildet und nun einige Zeit in Glogau bei Verwandten lebte. Erinnerungen an ihn finden wir in den ›Nachtstücken‹, in der Novelle ›Die Jesuiterkirche in G.‹[logau], auch die hier so anschaulich geschilderte Scene des Ausmalens der Kirche beruht auf persönlichem Erlebnis: in einem Briefe an Hippel vom 20. Juli 1796 berichtete er: »Eben kehre ich aus der Jesuiterkirche zurück – sie wird neu gemalt, und ich habe den excentrischen Einfall zu helfen« (H I, 152). Die Schriftstellerei ruhte ebenfalls nicht: er schrieb an einem Buche, »was jovialischer und witziger ist als ich selbst« (H I, 167). Auch führte er Schattenspiele auf ( Ombres Chinoises) und stellte in ihnen u. a. Goethes »Jahrmarkt« dar.
In einem Briefe an Hippel vom 21. Januar 1797 findet sich die erste Hindeutung, daß die Bekanntschaft mit einem Mädchen aus der Glogauer Gesellschaft Eindruck auf ihn gemacht hat. Er hat »dieser Michaeline zu gefallen einige Male bei den Franziskanern Messe gehört«; er tanzt auf der Redoute nur mit ihr, sie ist »ganz ausgezeichnet hübsch« und ihr Kopf liegt in seinem Portefeuille. Im Briefe vom 15. März erzählt er von einem Frühlingsabend, an dem er mit ihr in frohster Laune zusammensaß, da spielte plötzlich eine Flötenuhr das Mozartsche Vergißmeinnicht, er dachte an die Königsberger Geliebte und aller Frohsinn schwand dahin (H I, 182). Den Zwiespalt zwischen beiden hat er später (in der Novelle ›Der Artushof‹: S. W. VI, 163 f.) im Verhalten Traugotts zu Felicitas und Dorina geschildert: »Felicitas stand ihm wieder lebhaft vor Augen, und doch war es ihm, als könne er Dorina nicht lassen. – Dorina kam ihm oft in Gedanken als sein liebes Weib, süße Schauer durchbebten ihn, eine sanfte Glut durchströmte seine Adern, und doch dünkte es ihm Verrat an seiner ersten Liebe, wenn er sich mit neuen unauflöslichen Banden fesseln ließe.«
Im Mai begleitete er seinen Onkel auf einer Reise nach Königsberg und sah die dortige Geliebte wieder: »Laß dir's mit zwei Worten sagen, daß ich sie wieder fand, – daß sie nur für mich lebt, und daß in diesem Wiedersehn alles um mich her versunken ist … daß ihr Wesen ins meine verschmolzen, – ewig in mir leben wird« (H. I, 187.) Nach Glogau zurückgekehrt, machte er im Juni 1797 sein Examen als Referendar. Einen erfreulichen Verkehr unterhielt er mit dem Schauspieldirektor Franz von Holbein, den er in einem Briefe vom August 1797 »den einzigen« nennt, »der es hier der Mühe wert hält, sich mir anzuschmiegen«. Die Bekanntschaft mit der Gräfin Lichtenau, die im Hause seines Onkels viel verkehrte, erwähnt er ebenfalls; vortrefflich ist seine Charakteristik der verwitweten Maitresse Friedrich Wilhelms II., die sich bald darauf mit Holbein verheiratete (H I, 206 f.). Auch gedachte er nachmals mündlich oft seines Umgangs mit Julius von Voß, dem späteren fruchtbaren Romanschriftsteller und Lustspieldichter, der damals in Glogau lebte. Ein Porträt Voßens von Hoffmanns Hand hat sich erhalten (H3).
Um die Jahreswende 1797/98 vollzog sich inzwischen seine völlige Loslösung von der Königsberger Geliebten, ohne daß wir über die näheren Umstände unterrichtet sind. Er schreibt am 25. Februar 1798 an Hippel: »mit der Welt in Königsberg habe ich vollkommen abgerechnet« und am 1. April: »Mit Königsberg hab' ich wirklich abgerechnet … ich bin so gut gefesselt als ehemals, aber jetzt ist's ein Mädchen,« eben die obengenannte Michaeline, seine spätere Frau.
Der Glogauer Onkel wurde im Juni als Geheimer Obertribunalsrath nach Berlin versetzt und Hoffmann kam nun ebenfalls um seine Versetzung an das Kammergericht ein, und, nach einer vierzehntägigen Reise im Riesengebirge und nach Dresden, traf er am 29. August 1798 in Berlin ein, wo er »in der Kurstraße, im Hause der Madame Patté« Wohnung nahm. Eine Episode der schlesischen Reise hat er später in der Novelle ›Spielerglück‹ erzählt (S. W. VIII, 202 ff.): sein darin porträtierter Reisebegleiter war der Glogauer Regierungsrath Jagwitz. Eine begeisterte Schilderung der Naturschönheiten des Riesengebirges enthält ein Brief an Hippel (H I, 225-227). Die Eindrücke, die die Dresdener Galerie auf ihn als Maler gemacht, bewirkten, daß er in Berlin »die Farben wegwarf und Studien zeichnete wie ein Anfänger«. Im Porträtmalen allein glaubte er trotzdem starke Fortschritte gemacht zu haben (H I, 224). Die Kunstausstellungen auf der Akademie der Künste besuchte er ebenso eifrig wie die italiänische Oper, ließ es aber dabei keineswegs an Fleiß in seinem Amte fehlen. Als er im Anfange gar keine Arbeiten bekam, bat er den Kammergerichts-Präsidenten von Kircheisen ausdrücklich um Instruktionen und Spruchsachen, und nun erhielt er »seit dem 11. Oktober 15 Instruktionstermine zugeteilt, 2 Spruchsachen, 1 Kriminalsache … 2 Appellationsberichte, 2 Deduktionen und 1 Schlußbericht« (H I, 222). Im Juli 1799 berichtet er, daß er sich vor 9 Wochen zu den zum großen Examen erforderlichen Probearbeiten gemeldet habe. »Meine Carriere geht langsam und ich bin nicht unzufrieden damit, weil ich jetzt die Zeit sehr nutze, und meinen Lieblingsstudien, Musik und Malerei, schlechterdings nicht ganz entsagen kann« (H I, 233). Die Schriftstellerei war also in jenen Jahren seines ersten Berliner Aufenthalts ganz zurückgetreten. – Nachdem er sein Assessorexamen mit dem Prädikat vorzüglich bestanden, wurde er am 27. März 1800 zum Beisitzer der Regierung zu Posen, u. z. mit uneingeschränkter Stimme, ernannt. Sein alter Freund Hippel, der damals ebenfalls des Examens halber nach Berlin gekommen war, begleitete ihn, über Dessau, Leipzig und Dresden an den Ort seiner neuen Bestimmung.
In Posen entstand das erste Musikopus Hoffmanns, welches auf die Nachwelt gekommen ist: er komponierte eine kirchliche Ouvertüre – › Overtura (Musica per la Chiesa. D moll)‹ – welche das Datum des 4. März 1801 trägt. Dieselbe ist zuerst (1823) flüchtig erwähnt in A. B. Marx' Abhandlung »Hoffmann als Musiker« (H II, 369), genauer aber in dem liebenswürdigen Aufsatz ›E. T. A. Hoffmann als Musiker. Von Hieronymus Truhn‹ (in der Zeitschrift ›Freihafen‹ 1839. III, 66-105), wo der damals im Besitz des Herrn von Zuccalmaglio befindliche musikalische Nachlaß Hoffmanns S. 71-72 verzeichnet ist: jetzt befindet sich der Nachlaß auf der Königl. Bibliothek in Berlin. Eine sehr anerkennende Würdigung dieses ersten erhaltenen Hoffmannschen Musikwerks giebt Ellinger S. 26. Auch trat er zum ersten Mal öffentlich als Musiker hervor: seine (nicht erhaltene) Komposition von Goethes Singspiel ›Scherz, List und Rache‹ wurde mit großem Beifall auf dem Posener Theater aufgeführt (H. I, 236). Weniger glücklich fiel sein Debüt als Karikaturenzeichner aus. Auf einer Fastnachtsredoute ließ er durch zwei als Bilderhändler maskierte Freunde von ihm entworfene farbige Karikaturen auf Posener markante Persönlichkeiten, mit höchst witzigen Unterschriften, verteilen (siehe die nähere Beschreibung dieser Karikaturen bei Ellinger S. 197). Unter den Karikierten befand sich auch der kommandierende General von Zastrow, der sich bei Hoffmann und seinen Freunden mißliebig gemacht hatte, weil zu den von ihm arrangierten thés dansant nur Adlige, Offiziere und Richter, die den Rathstitel hatten, zugelassen wurden. Hoffmann stellte Seine Excellenz als Regimentstambour in Uniform, mit umgehängter Theemaschine dar, auf der er mit zwei Theelöffeln trommelte: au Thé! Au Thé! Dem von Zastrow wurde dieses Blatt natürlich alsbald bekannt und er »soll noch in der nämlichen Nacht eine Estafette mit dem Bericht über den Vorfall nach Berlin gesandt haben«. Über den Assessor Hoffmann als Zeichner der Karikaturen bestand gar kein Zweifel. »Nur ein Mensch in Posen wußte so zu treffen und dieser eine war Hoffmann« (H I, 240). In Berlin hatte gerade seine Ernennung zum Regierungsrath in Posen zur Unterschrift vorgelegen, als die Estafette des von Zastrow eintraf: zur Strafe für den Fastnachtscherz wurde er nun zum Regierungsrath in dem kleinen Neste Plozk an der Weichsel ernannt. Bevor er an den Ort der »Verbannung« abging, im April 1802, heiratete er seine Glogauer Michaeline, die er in Posen, ihrer Heimatstadt, wiedergefunden hatte. Maria Tekla Michaelina war die Tochter des Bürgermeisters und Stadtpräsidenten Rorer-Trzynski in Posen. Sie war, als sie sich mit Hoffmann verheiratete, 22 Jahre alt, »mittler Statur, – wohlgewachsen, dunkelbraunes Haar, dunkelblaue Augen« (H I, 259 und H3 I, 208). Bald nach der Eheschließung traf das junge Paar in Plozk ein. In dem ersten von dort geschriebenen Brief an Hippel wirft Hoffmann einen Rückblick auf die Posener Zeit. Der Brief ist vom 25. Januar 1803: ein volles Jahr, seit einem Rendezvous, das sie sich im Herbst 1801 in Danzig gegeben, hatte die Korrespondenz gestockt. »Du schreibst in Deinem letzten Briefe, unser letztes Zusammensein in Danzig hätte nicht so wie vormals die reine, unverdorbene Laune, den Erguß der innigen Freundschaft, herbeigeführt; – aber, Freund, – Wein, der eben gärt, hat niemals einen guten Geschmack, und ich war damals wirklich in Gärung. Ein Kampf von Gefühlen, Vorsätzen etc., die sich geradezu widersprachen, tobte schon seit ein paar Monaten in meinem Innern, – ich wollte mich betäuben, und wurde das was Schul-Rektoren, Prediger, Onkels und Tanten liederlich nennen. – Du weißt, daß Ausschweifungen allemal ihr höchstes Ziel erreichen, wenn man sie aus Grundsatz [nämlich in diesem Fall um sich zu betäuben] begeht, und das war denn bei mir der Fall Aus dieser Briefstelle hat Hoffmanns Biograph Hitzig, indem er die von mir gesperrt gedruckten Worte wegläßt, in beinahe verleumderischer Weise folgendes gemacht: »Er wurde liederlich und zwar in dem Maße, Ausschweifungen aus Grundsatz zu begehen« (H I, 286). Von den späteren Biographen wiederholt Goedeke: »Hoffmann sei aus Grundsatz liederlich geworden.« Kurz (in den ›Ausgewählten Werken‹, Leipzig 1870) spricht von Hoffmanns »argen Ausschweifungen«, Boxberger (der Herausgeber der Hempelschen Ausgabe) gar von den »Vergehungen« des »für Wein- und Liebesgenuß nur allzu Empfänglichen« in Posen. Natürlich läßt sich auch Gervinus die Sache nicht entgehen: »Hoffmann führte zeitweilig [! also von Zeit zu Zeit!] ein grundsätzlich lüderliches Leben.« Alle diese moralisierenden Philister hat übrigens der Dichter selbst im »Kater Murr« (S. W. X, 312 f.) herrlich abgethan: »Ich merk' es schon, Freund Murr! Mein Alter hat dir allerlei Böses vorgeredet von meinem Treiben; er hat mich liederlich, allen tollen Streichen und Ausschweifungen ergeben geschildert. Sei nicht so thöricht, von dem allem auch nur ein Wörtchen zu glauben. Fürs erste! – Schau mich recht aufmerksam an und sage mir, was du von meiner äußern Erscheinung hältst? – Den jungen Ponto betrachtend, fand ich, daß er nie so wohl genährt, so glau ausgesehen, daß nie diese Nettigkeit, diese Eleganz in seinem Anzuge, nie diese wohlthuende Übereinstimmung in seinem ganzen Wesen geherrscht. Ich äußerte ihm dies unverhohlen. Nun wohl, sprach Ponto, nun wohl, guter Murr, glaubst du wohl, daß ein Pudel, der sich in schlechter Gesellschaft umhertreibt, der niedrigen Ausschweifungen ergeben der recht systematisch liederlich ist, ohne eigentlichen Geschmack daran zu finden, sondern bloß aus Langeweile, wie es denn nun wirklich bei vielen Pudeln der Fall ist, – glaubst du wohl, daß ein solcher Pudel so aussehen kann, wie du mich findest? …«« (H I, 252).
In demselben Briefe zeigt er dem Freunde auch an, daß er »seit dreiviertel Jahren verheiratet« sei. Über seinen Aufenthalt in Plozk sagt er: »Ich müßte verzweifeln oder vielmehr, ich würde längst meinen Posten aufgegeben haben, wenn nicht ein sehr liebes, liebes Weib mir alle Bitterkeiten, die man mich hier bis auf die Neige auskosten läßt, versüßte, und meinen Geist stärkte, daß er die Centnerlast der Gegenwart tragen und noch Kräfte für die Zukunft behalten kann« (H I, 254). Seine junge Frau pflegte ihn auch in der Krankheit – Leberverhärtung –, die er in Plozk durchzumachen hatte; was er in einem ungedruckten Briefe an Hippel rühmend hervorhebt (H I, 238). In einem späteren Briefe geht er den Freund an, sich in Berlin für seine Versetzung zu verwenden. Inzwischen war die Weltabgeschiedenheit in Plozk für seine literarische und musikalische Weiterentwickelung keineswegs ungünstig. Schon im Briefe vom 25. Januar 1803 hatte er erwähnt: »Auch geb' ich mich wieder mit literarischen Arbeiten ab.« Die erste dieser Arbeiten war eine Kritik der Einführung des altgriechischen Chores in Schillers, 1803 erschienene ›Braut von Messina‹ und des Stückes überhaupt. Eingekleidet war diese schalkhaft ironische, besonders die musikalische Seite der Sache behandelnde Kritik in ein fingiertes »Schreiben eines Klostergeistlichen an seinen Freund in der Hauptstadt« und er sendete sie an Kotzebues Zeitschrift der ›Freimütige oder Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser‹. Sie erschien anonym in der Nr. 144, Freitags den 9. September 1803; erst am 26. Oktober kam das Blatt in Plozk an und Hoffmann schreibt in seinem Tagebuch Das Original dieses Tagebuchs befand sich im Besitz des Geh. Hofraths Kürschner in Eisenach, aus dessen Nachlaß es Hans von Müller erworben hat (vgl. meinen Weltlitteratur-Katalog2 Nr. 1952a). Bis jetzt sind nur Fragmente davon (H I, 270-280) gedruckt. Der nunmehrige Besitzer bereitet eine vollständige Publikation des Tagebuchs vor.:
»Den 26ten Oktober.
Mich zum ersten Mal gedruckt gesehen im Freimütigen. Habe das Blatt zwanzigmal mit süßen, liebevollen Blicken der Vaterfreude angekuckt; frohe Aspekten zur litterarischen Laufbahn! Jetzt muß was sehr Witziges gemacht werden.« Als Klostergeistlichen bezeichnet er sich, weil er in Plozk gleichsam nicht mehr »in der Welt« war: daß zu dem Titel die 1797 anonym erschienenen ›Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders‹ Anlaß gegeben, ist mir nicht wahrscheinlich, es ist völlig unerwiesen, daß Hoffmann dieses Buch damals schon gekannt hat. Er erwähnt es in seinen sämtlichen Werken und Briefen nirgends. Er wurde mit den Schriften der Romantiker erst in Warschau bekannt: die erste Erwähnung Tiecks, und zwar der ›Genoveva‹, des ›Octavian‹ und des ›Sternbald‹, findet sich in einem Briefe an Hippel, Warschau den 16. September 1805 (H I, 325.) Inhaltlich hat das Hoffmannsche allerliebste Erstlingsschriftchen mit dem Werke Wackenroders und Tiecks erst recht nichts zu thun.
Der Abdruck der maiden speech in der gegenwärtigen Gesamtausgabe (S. W. XV, 5 ff.) ist mit dem Original sorgfältig verglichen, ein im letzteren in das Seneka-Citat ( Sen. ep. LXXXV) eingeschlichener Druckfehler ( rides statt vides) ist von mir verbessert worden.
Das in der obigen Tagebuchsnotiz in Aussicht genommene neue witzige Werk war übrigens schon in der Arbeit. »Acht Wochen vor Michaeli« hatte er nämlich ganz zufällig in demselben ›Freimütigen‹ die in der Nr. 1 vom 8. Januar 1803 enthaltene Preisausschreibung von 100 Friedrichsdor auf das beste Lustspiel gelesen und sich sofort hingesetzt und ein Preislustspiel verfaßt, welchem er den Titel » Der Preis« gab und dem Blatte einschickte. In Nr. VI des litterarischen und artistischen Anzeigers zum ›Freimütigen‹ von 1804 wurde das Urteil der Preisrichter verkündigt. Wir erfahren daraus, daß ›Der Preis‹ ein Lustspiel in drei Aufzügen gewesen, dessen Inhalt auch im Urteil kurz skizziert wird. Das Urteil selbst lautet: »Unter allen Mitbewerbern hat der Verfasser dieses Lustspiels die meiste Anlage zum Lustspieldichter … Ob wir nun gleich auch diesem Stücke den Preis versagen müssen, so zweifeln wir doch nicht, daß es einen Verleger finden und … den Leser überzeugen werde, daß das Publikum wahrscheinlich von dem Verfasser noch viel Gutes zu erwarten habe.« Leider ist das Lustspiel nie gedruckt und das Manuskript verloren gegangen.
Nur als Pläne werden im Briefe an Hippel vom 28. Februar 1804 erwähnt: »Wie wär's, wenn wir noch auf einige witzige Aufsätze dächten und ein Taschenbuch für 1805 edierten? – es ist nur des Absatzes und der Kupfer wegen … diese müßten durchaus satirischen Inhaltes sein … ich würde hoffen (ich zeichne alles selbst) ein gutes Honorar zu erhaschen und die gelehrte Welt mal zu einem Lachkrampf zu reizen.«
Sodann heißt es: »Der Riese Gargantua muß ausgearbeitet werden.« Aus dem letzteren Plane sehen wir, daß er damals Rabelais kennen gelernt, daneben las er, wie die Fragmente aus dem Tagebuch ergeben, Voltaires »Candide«, er fand darin »die Norm eines guten Romans. Der philosophisch ausgeführte Satz versteckt sich hinter den Vorhang voll Karikaturen. Die Würze ist der Menschen Albernheit, mit lebhaftem Kolorit dargestellt.« Aus derselben Quelle erfahren wir, daß er Rousseaus Bekenntnisse vielleicht zum dreißigsten Male gelesen. In einem Briefe an Hippel citiert er dreimal Shakespeare, in A. W. Schlegels Übersetzung, von der bis zum Jahre 1801 neun Bände erschienen waren.
Ebenso fleißig wie auf dem litterarischen Felde war er in der Musik. Er arbeitete gleichzeitig an zwei Singspielen. Das erste, in 2 Aufzügen, war ›Der Renegat‹ betitelt. »Es erscheint darin ein dicker Dey von Algier, der nur dadurch zum Lachen zu bringen ist, wenn seine Geliebten weinen, und der eine ihrem Gatten geraubte Französin zur Favorite erhebt, weil sie um ihren Mann natürlich weint, während alle anderen Bewohnerinnen des Harems die Kunst beim Schluchzen nicht verbergen können (H I, 246).« In dem zweiten, in einem Aufzuge, tritt der Musiker Hasse, Leonardo Leo, und die Sängerin Faustine Bordoni auf. Für Klöster in Plozk und Umgebung schrieb er Messen und Vespern, ferner eine, von der gewöhnlichen Sonatengattung abweichende umfangreiche, nach den Regeln des doppelten Kontrapunktes gearbeitete Fantasie. Auch entstanden hier mehrere Sonaten, darunter eine in As dur (H I, 246 f.), die, wie die vorgenannten Musikstücke nicht erhalten ist. Dagegen werden auf der Königlichen Bibliothek in Berlin noch zwei, zuerst von Truhn (a. a. O.) verzeichnete Klaviersonaten in F moll und F dur verwahrt, die schon Truhn, und nun auch Ellinger der Plozker Zeit zuweisen. Ellinger hat sie (S. 31) charakterisiert. Das in Truhns Nachlaßverzeichnis aufgeführte (von Ellinger nicht erwähnte) › Grand Trio in E dur für Pianoforte, Violine und Cello‹ dürfte auch in Plozk ausgeführt sein; denn im Tagebuch heißt es, unterm 8. Oktober 1803: »Ich quäle mich mit einer Idee zum Trio für Fortepiano, Violine und Cello. Meinem Bedünken nach werde ich in diesem Genre etwas leisten. Haydn soll mein Meister sein, so wie in der Vokalmusik Händel und Mozart« (H I, 271 f.). Endlich begann er hier die große Missa in D (Truhn S. 71), auf die wir später zurückkommen.
Aber auch die dritte Kunst, der er sich ergeben, ließ ihn in Plozk nicht ruhen: er porträtierte viel, zeichnete auch mit der Feder alle damals bekannten etrurischen Vasengemälde der Hamiltonschen Sammlung nach, von denen Hitzig noch einzelne Blätter gesehen hat, »die durch die ungemeine Sauberkeit ihrer Ausführung die höchste Bewunderung erregen«, eben so wenig ruhte sein Karikaturstift. Eine dieser Karikaturen stellte das Plozker Publikum vor, im Schlamme der Gemeinheit versunken. Nur Hoffmann hielt mit aller Anstrengung den Kopf noch daraus in die Höhe; aber aus dem Olymp, der sich über der Gruppe öffnete, und in welchem der Großkanzler als Jupiter mit seinen Blitzen thronte, fuhr dessen in Bedienungssachen Vortragender Rath, sprechend getroffen, mit einer gewaltigen Stange herunter und suchte auch ihn definitiv in den Morast unterzutauchen (H I, 247).
In einem Briefe an Hippel (vom 28. Februar 1804) heißt es mit Bezug auf seine dreifache Begabung: »eine bunte Welt, voll magischer Erscheinungen, flimmert und flackert um mich her, – es ist, als müsse sich bald was Großes ereignen, – irgend ein Kunstprodukt müsse aus dem Chaos hervorgehn! – ob das nun ein Buch, – eine Oper, – ein Gemälde sein wird, – quod diis placebit …« (H I, 266 f.). Dabei war derselbe Mann ein vorzüglicher Beamter. Er war in Plozk »der fleißigste Arbeiter und der als ein eigner harter Mann bekannte Präsident B. mit ihm sehr zufrieden, welches ihm denn auch die Gnade des Großkanzlers erwarb« (H I, 259). Der Lohn blieb denn auch nicht aus: am 10. März 1804 erhielt er das Versetzungsreskript als Regierungsrath nach Warschau.
Nachdem er zuvor noch seinen Freund Hippel, der in Berlin seine Versetzung thätig betrieben hatte, auf dessen Rittergut Leistenau im Marienwerderschen Kreise allein besucht hatte, traf er mit seiner Frau im Mai in seinem neuen Bestimmungsorte ein, wo er im dritten Stock eines »Palazzos« in der Fretagasse Nr. 278 Wohnung nahm. Den ersten Eindruck Warschaus schildert ungemein lebendig und mit köstlichem Humor sein Brief an Hippel vom 14. Mai 1804 (H I, 314-318). »Wo nehme ich Muße her, um zu schreiben, – zu zeichnen, – zu komponieren!« heißt es am Schlusse. Die Muße fand sich zwar später ein, aber sie kam seinem litterarischen Schaffen weniger zu gute als dem Musiker und Maler Hoffmann. Literarisch wurde die Warschauer Zeit mehr durch das Fremde, das er in sich aufnahm, wichtig. Es wurde ihm zugetragen durch einen eben von Berlin nach Warschau versetzten jüngeren Kollegen, den Assessor Itzig Es ist Hoffmanns späterer Biograph Julius Eduard Hitzig, welche Namen er bei seiner Taufe angenommen hat. Erinnert sei hier an Heinrich Heines Scherze über diese Namensänderung im »Romanzero« (Jehuda den Halevy)., der in Berlin mit A. W. Schlegel, Tieck, Fouqué und Chamisso verkehrt hatte, und nun an Hoffmann ›Sternbalds Wanderungen‹, den Schlegelschen ›Calderon‹ (dessen 1. Band 1803 in Berlin erschienen war), u. a. Werke der romantischen Schule lieh. Zu eigner Produktion regte diese ihm neue Welt Hoffmann nicht an, wohl aber wirkte sie auf seine Musik höchst befruchtend. Schon im Dezember 1804 komponierte er »eine äußerst geniale Oper von Clemens Brentano: Die lustigen Musikanten« und brachte sie im April des folgenden Jahres auf das Warschauer Theater (H I, 319). Brentano hatte dies Singspiel bekanntlich im Winter 1802 in Düsseldorf für den dortigen Musikdirektor Bergmüller geschrieben, ließ es aber (im April 1803) im Druck erscheinen, weil Bergmüller mit der Komposition nicht fertig werden konnte: er empfahl es, in der Vorrede, nun irgend einem andern Tonkünstler zur Komposition. (Übrigens war die Bergmüllersche Oper doch inzwischen fertig geworden und wurde am 6. April 1803 in Düsseldorf aufgeführt: siehe A. v. Arnim und Clemens Brentano von R. Steig [Stuttgart, Cotta, 1894], S. 61. 351). Die Wothesche Truppe, welche die Hoffmann-Brentanoschen »Musikanten« auf dem deutschen Theater in Warschau aufführte, war leider so mittelmäßig, daß die Oper d. h. der Text mißfiel. »Vorzüglich, schreibt Hoffmann, nahm man daran einen Ärger, daß sich die komischen Masken der Italiäner darin herumdrehen … Aber, – heiliger Gozzi, was für Mißgeburten wurden hier auch aus den anziehenden Gestalten des jovialen Mutwillens!« Dagegen »von der Musik urteilten sie günstiger, sie nannten sie feurig und durchdacht … in der eleganten Zeitung wurde ich, dieser Komposition wegen, ein kunstverständiger Mann genannt!!« (H I, 319 f.). Im Jahre 1828 kam die Handschrift der Oper aus Warschau in Hitzigs Hände, und der Musikgelehrte Friedrich Wollank (Mitstifter der Zelterschen Liedertafel) beurteilt sie in der Zeitschrift ›Der Gesellschafter‹ Nr. 68 vom April 1828 folgendermaßen: »Man erkennt in der Hoffmannschen Partitur dies hohe Vorbild [Mozart] nicht allein in den Formen der einzelnen Musikstücke, sondern auch in der ganzen Behandlung der Instrumental-Partie, ohne deshalb sklavische Nachahmung oder Mangel an Eigentümlichkeit zu finden; das Ganze ist vielmehr reich an originellen Zügen.« Leider gelangte das Manuskript nicht, wie der übrige musikalische Nachlaß an die Berliner Königliche Bibliothek, daher Truhn und Ellinger das Werk als nicht erhalten bezeichnen. Indessen ist Hoffnung vorhanden, daß es noch einmal zum Vorschein komme. Denn in den achtziger Jahren hat es der Berliner Musik-Antiquar Leo Liepmannssohn besessen und an einen, leider nicht mehr zu ermittelnden Liebhaber Jetzt ist das Manuskript im Besitz der Bibliothek des Pariser Konservatoriums. verkauft. Nach der freundlichen Mitteilung des Herrn Liepmannssohn aus dem betreffenden Kataloge, bestand die ganz eigenhändige Partitur aus 2 Bänden, 176 und 145 Seiten in klein Querfolio; auf dem Titelblatt des als »Singspiel in 2 Akten« bezeichneten Werkes befand sich der Stempel: » Musikalische Gesellschaft in Warschau.« (Siehe über diese Gesellschaft unten, S. XXIX.) Eine gewisse Verwandtschaft mit dem Singspiel hatte ein Ballett, Arlequin, dessen Partitur, schon von Truhn verzeichnet, sich jetzt auf der K. Bibliothek in Berlin befindet.
Verschollen ist wiederum das Manuskript der zweiten Warschauer Oper Hoffmanns: »Die ungeladenen Gäste oder der Kanonikus in Mailand.« Hitzig erwähnt die »auf das Sauberste geschriebene Partitur« als noch vollständig vorhanden, ebenso A. B. Marx, aber schon Truhn bezeichnet sie als im Nachlaß fehlend. Hoffmann hatte sich den Text selbst, nach dem Französischen, geschrieben, und urteilte über das Werk, als er es eben in der Arbeit hatte, im Brief an Hippel vom 16. September 1805: daß sich in der kleinen Oper der freie Geist der Franzosen, ihr komischer graziöser Genius ganz ausspreche. Später aber legte er keinen Wert mehr auf das Werk, indem er (Brief an Hitzig vom 20. April 1807) schreibt: »Wegen des Kanonikus von Mayland thun Sie nur keine weitern Schritte [behufs Aufführung in Berlin], denn es würde nicht der Mühe lohnen, und die Musik hat viele schwache Stellen« (H I, 328).
Wie er Brentanos Musikanten komponiert hatte, ohne damals irgend eine persönliche Beziehung zu dem Dichter zu haben, so lieh er einem andern Romantiker seine musikalische Mitarbeit, mit dem ihn Hitzig in persönliche Verbindung gebracht hatte: Zacharias Werner, der damals in Warschau bei der Regierung eine Stelle als expedierender Sekretär bekleidete. Werner hatte in Königsberg mit Hoffmann in Einem Hause gelebt, dieser mit dem 8 Jahr Älteren aber nicht verkehrt. Nun wurden sie sehr vertraut und Hoffmann komponierte die Chöre und eine ganze Scene zum ›Kreuz an der Ostsee‹ und giebt darüber einen ausführlichen Bericht im schon citierten Brief an Hippel vom 16. September 1805 (H I, 322-325, vgl. dazu auch Hoffmanns schöne Charakteristik Werners in den Serapionsbrüdern S. W. IX, 97-110). Die noch erhaltene Komposition wird von Ellinger (S. 45-48) eingehend charakterisiert und sehr hochgestellt.
Den höchsten Wert legte Hoffmann selbst auf sein letztes und umfangreichstes, in Warschau begonnenes Musikwerk: ›Liebe und Eifersucht, Oper in 3 Akten. Nach Calderons Schärpe und Blume‹ (H I, 327-330), vollendet wurde das Werk erst erheblich später: im April 1808 arbeitet er noch daran (H3 I, 279). Die Oper, der Schlegels Text zu Grunde liegt, ist vollständig erhalten, sie befindet sich auf der Königlichen Bibliothek in Berlin: siehe die ausführliche Beurteilung bei Ellinger S. 48-52. Eine Aufführung ist dem Werke nie zu teil geworden.
Neben den Opern vollendete er noch die schon in Plozk begonnene Messe: siehe die Charakteristik derselben bei Ellinger S. 52 f. Außerdem schuf er eine Symphonie in Es dur, die sich – vollständige Partitur und Stimmen – auf der Berliner Bibliothek befindet. Ellinger, der sie S. 29-31 ausführlich charakterisiert, meint, daß sie schon in Plozk entstanden sei, weil Hoffmann sie »in einem Briefe aus Warschau als bereits fertig vorliegend erwähnt«: der Brief aus Warschau an Hitzig ist aber der letzte, den er von dort aus geschrieben (14. Mai 1807) und spricht nur von in Warschau entstandenen Musikwerken, nämlich seiner letzten Oper, seinen Ouvertüren (zu den Opern), seiner Symphonie und seiner Messe. Schon Truhn gab an, daß die Symphonie in Es dur in Warschau entstanden sei.
Wie als schaffender Musiker, so ist Hoffmann in Warschau auch als ausübender Musiker – er sang als Tenor in den Musikaufführungen der Bernhardiner –, namentlich aber als Dirigent aufgetreten. Ein Musikenthusiast unter den preußischen Beamten stiftete nämlich eine Musikalische Gesellschaft, die alsbald den durch Feuer beschädigten Mniszekschen Palast ankaufte und für ihre Zwecke ausbauen ließ. Am 3. August 1806, dem Geburtstag des Königs Friedrich Wilhelm III., wurde das neue Gebäude eingeweiht und Hoffmann dirigierte das erste in dem durch zwei Etagen gehenden Saal gegebene Konzert.
In der Folge brachte er daselbst hauptsächlich Mozartsche Kompositionen zur Aufführung, daneben Gluck und Cherubim, Haydn, die alten italiänischen Kirchenmusiken, aber auch bereits eine Symphonie von Beethoven (H I, 298 f.).
Doch nicht nur als Dirigenten war ihm die ›Musikalische Gesellschaft‹ verpflichtet: er hatte auch die Ausmalung des Musikpalais übernommen, eigenhändig malte er figurenreiche Friese und Plafonds, teils hatte er den übrigen Malern die Entwürfe geliefert (H I, 296 f.). Auch sonst ließ er den Stift nicht ruhen, namentlich zeichnete er im Lazienkischen Park viel nach der Natur, porträtierte, so namentlich Zacharias Werner (siehe unten S. XXXVI), auch stellte er eine Sammlung der fantastischen polnischen Uniformen in farbigen Blättern zusammen. Im Amte bewährte er sich dabei, nach wie vor, als vorzüglicher Arbeiter. Als im September 1805 drei Revisoren aus Berlin erschienen, schrieb er an Hippel: »mich kümmert das wenig, da ich nie Reste habe und gehabt habe; ich muß ja wohl frisch von der Hand wegarbeiten, um nur die Akten mit Partituren verwechseln zu können« (H I, 321 f.).
Seine Frau hatte ihn inzwischen, im Juli 1805, mit einem Töchterchen beschenkt, die er auf den Namen Cäcilia taufen ließ. Sein Hausstand hatte sich ferner durch eine zwölfjährige »Nichte aus Posen« vermehrt, deren Erziehung er übernommen hatte (H3 II, 151: sie heiratete später einen Tribunalsassessor von Leczycki). Auch hatte er nun ein neues Quartier, in einem sehr schön gelegenen großen Hause in der Krakauer Vorstadt bezogen. Da besetzten am 28. November 1806 die Franzosen Warschau, die Preußische Regierung wurde aufgelöst, Hoffmanns neues Wohnhaus wurde so stark mit Einquartierung belegt, daß er, da die Kosten derselben für ihn unerschwinglich, nicht bleiben konnte, und froh war, eine leere Dachkammer im Mniszekschen Palais für sich und seine Familie eingeräumt zu erhalten. Dadurch, daß Daru im Hause residierte, war er von allen Kriegslasten befreit. Die schöne Bibliothek der Musikalischen Gesellschaft konnte er jeden Augenblick benutzen, sein Fortepiano stand im Quartettzimmer: »mehr bedurfte es nicht, um ihn Franzosen und Zukunft vergessen zu machen« (H I, 306). Doch hielt er es für geratener, seine Familie, bei sich bietender Gelegenheit, unter sicherer Eskorte nach Posen zu den dortigen Verwandten zu senden, wie auch viele seiner Kollegen ihre Angehörigen nach der Heimat zurücksandten. Durch die Aufregungen der Kriegszeit verfiel er bald darauf, nach dem März 1807, in ein bedenkliches Nervenfieber. Seine Freunde und Kollegen Kuhlmeyer und Loest pflegten ihn, und er genas. Aus seiner Krankheitszeit berichtet der schon vorher nach Berlin zurückgekehrte Hitzig nach den Mitteilungen eben jener Freunde, eine sehr charakteristische Anekdote:
»Sie verstehen mich doch alle nicht, sagte er in der Nacht, wo sein Zustand am gefährlichsten war, zu Kuhlmeyer. Es ist mir recht lieb, daß Sie hier sind: ich habe Ihnen schon immer die Schönheiten der Zauberflöte auseinandersetzen wollen; heute Nachmittag, als ich allein lag, habe ich die ganze Oper gehört. Und nun entwickelte er …, in der Fieberhitze, das große Werk von Anfang bis zu Ende« (H I, 308).
Zu Anfang des Sommers 1807 ging Hoffmann nach Posen, zum Besuch seiner Familie, dann aber, allein, nach Berlin, wo er »etwa im Juli« eintraf und Friedrichsstraße Nr. 179 ein kleines Stübchen bezog. Hier erfuhr er alsbald, im August, daß seine kleine Tochter gestorben und seine Frau lebensgefährlich erkrankt sei. Dazu war von einer anderweitigen Anstellung im Staatsdienst »wegen der nunmehrigen Beschränktheit der preußischen Staaten« gar keine Rede. Es wurde sogar im ›Allgemeinen Anzeiger der Deutschen‹ (Nr. 222 vom 20. August 1807) die öffentliche Wohlthätigkeit für die königlich preußischen verheirateten Regierungsbeamten in Posen und Warschau angerufen – Nr. 229 enthält eine Quittung über eingegangene 5 Thaler! Ein Aufsatz in demselben Blatte (Nr. 293 vom 30. Oktober 1807) teilte mit, daß nach einer Bekanntmachung des Königs von Sachsen – dem das neugebildete Herzogtum Warschau von Napoleon übertragen war – die vertriebenen preußischen Beamten auch von Sachsen keine Wiederanstellung zu erwarten hätten, und ruft dazu auf, dem Kaiser Napoleon Nahestehende möchten an dessen Großmut appellieren! Der ›Anzeiger‹ (Nr. 330 vom 7. Dezember 1807) enthält dann einen neuen ›Aufruf an Menschenfreunde bei dem harten Schicksal der deutschen Beamten in Warschau‹ – und es gingen wieder einige kleine Beiträge ein, worüber in den Nummern 341, 342 und Nr. 67 von 1808 quittiert wird. Hoffmann, der von dem ersten Aufrufe wohl gehört hatte, entwarf daher seinerseits (am 22. August 1807) ein für den Reichsanzeiger (dies war bis 1806 der Titel des Allgemeinen Anzeigers der Deutschen) bestimmtes Inserat, in dem er sich als Musikdirektor bei irgend einem Theater anbot (im Konzept abgedruckt H II, 8 f.). Hitzig besorgte die Drucklegung, die aber in einem andern Blatte erfolgte, wenigstens habe ich sie im ›Anzeiger‹ vergebens gesucht. Neben diesem Schritte hatte Hoffmann sich auch um eine Korrektorstelle in der Petersschen Musikhandlung in Leipzig beworben, worauf ihm der Inhaber derselben, Kühnel, unterm 4. November 14 Thaler Monatsgehalt und außerdem ein »Meßgeschenk«, dagegen weder Kost noch Logis anbot. Hoffman antwortete (am 14. November 1807): »es sollte mir höchst erfreulich sein, mit einem humanen Manne wie Sie in Verbindung zu treten, aber aufrichtig gesagt, das Gehalt von 14 Thaler ist so geringe, daß es selbst bei den eingeschränktesten Ansprüchen nicht möglich ist, es annehmbar zu finden.« (Veröffentlicht von Ellinger im ›Euphorion‹ 1898, Band V, S. 110 f.) Gleichzeitig deutet Hoffmann an, daß sich ihm in Luzern und Bamberg Aussichten zu einer Musikdirektorstelle geöffnet hätten. Nun erhöhte Kühnel, im Schreiben vom 26. November den »Gehalt« auf 20 Thaler, und als er keine Antwort erhielt, drängte er auf dieselbe, am 30. Dezember. Aber Hoffmann hatte glücklicherweise inzwischen mit Bamberg abgeschlossen, wohin ihn der Reichsgraf Julius von Soden, der Unternehmer des dortigen Theaters, als Musikdirektor berief, aber erst zum 1. September 1808. Bis dahin hatte er die schwerste Zeit seines Lebens durchzumachen. Zu seiner von Warschau mitgebrachten fertigen Musik fand er keine Verleger, wenigstens keine zahlende: für drei in Werckmeisters Kunst- und Musikhandlung gestochene Kanzonetten erhielt er 80 Freiexemplare und ein Darlehn von zwei Friedrichsdor. Nägeli in Zürich nahm drei Sonaten von ihm, »die durchgehends thematisch gearbeitet sind, in das Repertoire de clavecinistes auf« (Brief an Hofrath Rochlitz vom 10. Mai 1808: Euphorion a. a. O. 111 f. Daselbst ist S. 112, Z. 27 v. o. hinter »3« das Wort »Sonaten« zu ergänzen. Wenn Ellinger meint, der Brief könne nicht an Rochlitz sein, weil die Anrede »Hofrath« widerspreche: so hat er übersehen, daß Hoffmann auch sonst (H3 I, 279) ausdrücklich vom Hofrath Rochlitz spricht. Und mit Recht! Denn Rochlitz verdankte seiner Verbindung mit Goethe den sachsen-weimarschen Hofrathstitel. Ob die Angabe (H II, 4), daß Nägeli auch ein Harfenquintett von Hoffmann in Verlag genommen habe, richtig ist, habe ich nicht feststellen können. In Hoffmanns Nachlaß fand sich aber ein Harfenquintett, das vielleicht mit dem angeblich von Nägeli verlegten identisch ist: siehe über dasselbe unten S. XLI.), aber die Zusendung des Honorars ließ auf sich warten. Vom 23. Januar bis 27. Februar 1808 hatte er die vieraktige Oper ›Der Trank der Unsterblichkeit‹ komponiert, deren Text Graf Soden gedichtet und ihm übersandt hatte – aber ein Honorar ließ auch auf sich warten. So sah er sich denn genötigt, seinen Freund Hippel um Geld zu bitten, im Brief vom 12. April 1808 (H3 I, 277-279). Ein 1 Monat späterer Brief an Hippel ist erst 1863 zum Vorschein gekommen: ich lasse ihn hier – aus Bachs Biographie Hippels – im Wortlaut folgen:
Berlin, den 7. Mai 1808.
Mein einziger theuerster Freund!
Wie kommt es, daß ich gar Nichts von Dir höre? Alles schlägt mir hier fehl, weder aus Bamberg, noch aus Zürich, noch aus Posen erhalte ich einen Pfennig; ich arbeite mich müde und matt, sehe fort die Gesundheit zu und erwerbe Nichts! Ich mag Dir meine Noth nicht schildern; sie hat den höchsten Punkt erreicht! – Seit fünf Tagen habe ich nichts gegessen, als Brod – so war es noch nie! Jetzt sitze ich von Morgen bis in die Nacht und zeichne an Scenen für Werner's Attila, der in der Realbuchhandlung verlegt wird. Noch weiß ich nicht gewiß, ob ich alle Kupfer zu zeichnen erhalte, gelingt mir dies, so verdiene ich etwa 4 bis 5 Friedrichsd'or, die dann auf Miethe und kleine Schulden aufgehen. Ist es Dir möglich mir zu helfen, so schicke mir etwa 20 Friedrichsd'or, sonst weiß ich bei Gott nicht, was aus mir werden soll. Uebrigens ist mein Contrakt mit dem Bamberger Theater-Direktor jetzt abgeschlossen, und vom 1. September geht mein Officium an, so daß ich im August schon abreisen muß. Mein einziger Wunsch wäre es, mich jetzt schon von Berlin loszureißen und nach Bamberg zu gehen. Hierzu würde aber mehreres Geld gehören, da ich auch meine Garderobe zur Reise in Stand setzen muß. – Gelingt es mir nur erst, Geld zu erwerben, so will ich darauf bedacht sein, wenigstens nach und nach meine große Schuld bei Dir abzutragen. Wäre es Dir wohl möglich, im Fall Du eine bedeutende Summe reponirt habest, mir noch 200 Thlr. zu borgen? In diesem Falle wäre ich nicht allein aus aller Noth, sondern könnte auch nach Bamberg abgehen! – Mein Freund! Verkenne mich Unglücklichen nicht! – Gott weiß es, wie nahe es mir geht, so zu Dir sprechen zu müssen! Antworte mit umgehender Post, darum fleht Dein treuer bis in den Tod
Hoffmann.
Die in diesem Briefe erwähnten 5 Kupfer zur 1. Ausgabe des ›Attila‹ (1808) sind jedoch mit der Bezeichnung » Study del.« versehen; Werner hat also die Hoffmannschen ›Scenen‹ refüsirt. In diese Zeit fällt auch vermutlich eine ›Sammlung grotesker Gestalten nach Darstellungen auf dem Königlichen National-Theater in Berlin. Gezeichnet und in Farben ausgeführt von E. T. W. Hoffmann. Erstes Heft‹. Die vier Bilder befanden sich 1839 im Besitz des bekannten Kunstschriftstellers Joseph Heller in Bamberg (jetzt in der Bamberger K. Bibliothek). Der begleitende Text ist im XI. Bande von E. T. A. Hoffmanns ›Ausgewählten Schriften‹ (Stuttgart, Brodhag, 1839) S. 390-392 abgedruckt. Die Einleitung lautet: »Das, was herzliches Lachen erregt, ist immer willkommen, zumal in einer Zeit, in der man gern hinaustritt aus der trüben Umgebung, um einzugehen in das fantastische Reich, wo der Scherz regiert, und wo der Ernst selbst zur komischen Maske wird. Der Zeichner und Herausgeber dieser Blätter glaubt daher gerade jetzt mit einem Werke, das nur in jenem fantastischen Kreise lebt, und es nur mit seinen Bewohnern zu thun hat, hervortreten zu dürfen.
Wie nun das Publikum dieses Werk aufnimmt, davon wird es abhängen, ob diesem ersten Hefte der Sammlung grotesker Gestalten noch mehrere folgen sollen, die dann nur immer fantastisch komische Darstellungen liefern und sich auf groteske Gestalten der hiesigen Bühne keineswegs einschränken würden.«
Allein er vermochte schon für das erste Heft keinen Verleger aufzutreiben. Von den schon aus Warschau mitgebrachten Zeichnungen konnte er schließlich wenigstens die Sammlung polnischer Uniformen, bei Gräff in Leipzig, unterbringen.
Die Hülfe seines alten, übrigens sehr vermögenden Freundes, wird auch diesmal nicht ausgeblieben sein. Sie wird ihm die Muße verschafft haben, um die Kirchenmusikkompositionen auszuführen, welche Truhn folgendermaßen verzeichnet:
Canzoni per 4 voci alla capella.
Nr. I. Ave maris stella in F dur den 27. Juni 1808.
Nr. II. De profundis clamavi in E moll mit Durschluß den 28. Juni 1808.
Nr. III. Gloria patri in C Dur den 30. Juni 1808.
Nr. IV. Salve redemptor in A moll mit plagialischem Schluß auf der Dominante den 4. Juli 1808.
Nr. V. O sanctissima in F dur den 6. Juli 1808.
Nr. VI.
Salve regina in
D moll
mit
Durschluß den 26. Mai 1808.
(Vgl. Ellinger S. 66 u. 196, der diese Chöre unrichtig nach Bamberg, bez. Nr. VI infolge Lesefehlers nach Warschau verlegt: ich habe das Originalheft der › Canzoni‹ auf der Musikabteilung der Berliner Königlichen Bibliothek eingesehen, es ist eine ganz gleichmäßig ausgeführte eigenhändige Reinschrift auf starkem Velin, das Datum der Nr. VI lautet »26. May 8.«)
Was Hoffmanns Umgang in diesem traurigsten Jahre seines Lebens betrifft, so hat er Hitzig, der damals in Potsdam lebte, wenig gesehen, daher dieser auch so gut wie nichts über diese Zeit zu berichten weiß. Dagegen erfahren wir Einiges aus den 1868 veröffentlichten »Erlebnissen von F. W. Gubitz«, des bekannten Professors für Holzschnittkunst an der Berliner Akademie. Er berichtet (Band I, S. 245-252) über Hoffmann: »Ich sah ihn nach 1806 in Berlin zuweilen in Abendgesellschaften … In einem der geselligen Kreise machte Hoffmann die Bekanntschaft einer jungen, sehr schönen kinderlosen Gattin eines preußischen Beamten … Sie lebte in unglücklicher Ehe und ihr Mann trug im Antlitz Zeichen einer Krankheit, die jeden Widerwillen begreiflich macht …« Während ihr Mann in Ostpreußen war, lud sie ihre wenigen Bekannten zu sich zum Abend ein. »Ich selbst folgte nur das erste Mal der Einladung und fand Hoffmann dort, der sich, wie es mir schien, in der engen Wohnung sehr heimisch benahm … in tollster Laune die Anwesenden unterhielt, auch die Musik zu Hülfe nahm. Etwa ein paar Monate nachher verließ er Berlin und wurde Musikdirektor in Bamberg.« Soweit die von Gubitz erlebten Thatsachen. Was nun weiter folgt, beruht auf Hörensagen. Er erzählt nämlich, jene Frau habe sich scheiden lassen wollen, um Hoffmann zu heiraten, sie habe »dann (nach Hoffmanns Abreise) einen Knaben geboren, sei von dem 1809 zurückgekehrten Ehemann deshalb mißhandelt, habe sich aufgehängt, sei abgeschnitten und ins Irrenhaus gebracht, der Knabe aber von einer der Mutter befreundeten Familie einem Küster in Bernau zur Pflege übergeben, »nachdem vergebens versucht worden war, von Hoffmann Bestimmungen und Unterstützung zu erwirken«. Der Knabe wäre sehr musikalisch gewesen, oft nach Berlin entlaufen, um sich ins Opernhaus einzuschleichen, schließlich aber mit 13 Jahren beim Baden ertrunken. Irgend welche Beweise oder anderweite Bestätigungen dieser »düsterhaften Begebenheit«, wie sie Gubitz nennt, fehlen natürlich vollständig: für uns bleibt daher als wirklich thatsächlich allein bestehen, daß Hoffmann im Sommer 1808 bei jener schönen Strohwitwe Trost in seiner traurigen Lage gefunden hat.
Schon im August holte er seine Frau von Posen ab und traf mit ihr am 1. September 1808 in Bamberg ein (H³ II, 33). Ihre erste Wohnung befand sich Zinkenwörth Nr. 56 beim Schönfärber Schneider, sie zogen aber im folgenden Jahr in das Haus des pensionierten Hofmusikus Wahrmuth. Im zweiten Stock dieses kleinen schmalen am Theaterplatz, dem Theater schräg gegenüberliegenden Hauses hat Hoffmann die ganze übrige Zeit seines Bamberger Aufenthalts gewohnt: die Wohnung bestand nur aus einer, den zweiten Stock einnehmenden Stube und einer darüber gelegenen Dachkammer. »In dieser beschränkten Behausung befand er sich doch recht bequem und behaglich, und lebte mit seinen Hausleuten in stetem Frieden und gutem Einverständnisse« (K 122). In seinem ersten Bericht an den Freund Hippel (vom 28. Dezember 1808) spricht er sich über seine Lage recht zufrieden aus. Freilich hatte er sich vom Theater beinahe ganz zurückgezogen, da Graf Soden dieses an den, als Verfasser von Ritter- und Räuberstücken später berüchtigt gewordenen Direktor Heinrich Cuno abgetreten hatte und die – »im Wilhelm Meister getreu geschilderten« – Theaterverhältnisse unter diesem Direktor Hoffmann nicht zusagen konnten. Er dirigierte nur höchst selten, komponierte aber die Ballette und Gelegenheitsstücke, gegen einen Monatsgehalt von 30 Gulden. Dagegen hatte er sich aber als Gesanglehrer in den ersten Häusern »eine recht gemütliche Existenz« begründet. »Ich fühle nun erst recht,« schreibt er, »wie durchaus nicht für mich die frühere Carriere war und wie wohl mir das Künstlerleben thut, wozu die Wiedervereinigung mit meinem lieben, herrlichen Weibe nicht wenig beiträgt!« (H3 II, 34). In einem etwas späteren Briefe, an Hitzig, nennt er den in der Musikkunst ganz ausgebildeten Freiherrn von Stengel als denjenigen, der ihn in der Bamberger Gesellschaft als Gesanglehrer eingeführt habe. Unter den ersten Häusern, in denen er unterrichtete, führt er besonders das gräflich Rotenhansche Haus auf, wo er fünf Komtessen im Gesange unterrichtete. Sein Verkehr in diesem Hause beschränkte sich auch nicht bloß auf den Gesangsunterricht: so erwähnt er, daß »Gräfin Gabriele, ein recht liebenswürdiges sechzehnjähriges Mädchen, sein großes Crayonbild Werners kopiere« (H II, 13). Eine andere Schülerin, Frau von Redwitz, äußerte: Hoffmann verdiene, daß man ihm, neben dem Honorar für seine Lektionen, ebensoviel für seine Unterhaltung bezahle. Inzwischen stellte der Theaterdirektor Cuno im Februar 1809 seine Zahlungen ein, und Hoffmann behielt nun »von seinem Amte nichts übrig als den Titel Musikdirektor« Schade ist, daß ich hier nicht einen Brief einrücken kann, den Hoffmann am 26. Februar 1809 an seinen Freund, den Violinisten Morgenroth in Dresden geschrieben hat »über den tragikomischen Gang meines Eintritts in die Künstlerwelt«: dieser bisher ungedruckte Brief wurde vor einigen Jahren in der Auktion der gräflich Paar'schen Autographensammlung verkauft.. Da Cuno jedoch schon vorher schlecht oder gar nicht gezahlt hatte, so hatte Hoffmann, um seine Einnahmequellen zu vermehren, sich schon vor dem Termin des Theaterzusammenbruchs dem Redakteur der im Verlag von Breitkopf & Härtel erscheinenden Leipziger Allgemeinen ›Musikalischen Zeitung‹, Hofrath Rochlitz, mit dem er, wie wir gesehen, schon früher korrespondiert hatte, als Mitarbeiter und zwar im litterarischen wie im musikalischen Fache angeboten. Leider ist der betreffende, von Rochlitz In dem aus der Allg. Musik.-Ztg. vom 9. Oktober 1822 in das oben (S. XI) citierte Rochlitzsche Buch aufgenommenen Aufsatze. als sehr launig gerühmte Brief nicht erhalten. Als Probe seiner musikalischen Befähigung hatte er ein »in früherer Zeit komponiertes« Requiem beigelegt, von dem Rochlitz später urteilte, daß, wie nahe es auch an das Mozartsche Vorbild erinnere, es ihm doch nicht an Originalität der Erfindung und noch weniger an Innigkeit und Kraft des Ausdrucks fehle; die Ausführung des Technischen aber müsse man bewundern. Als Probe seiner litterarischen Befähigung hatte er, wie ich vermute, das Fantasiestück ›Ritter Gluck‹ beigelegt.
Rochlitz erzählt (a. a. O.), er habe dem Antragsteller sogleich zustimmend geantwortet und ihm zugleich die Partitur von »Beethovens eben in den Händen der Notenstecher befindlichen C moll-Symphonie« gesandt. Darauf sei schon nach 10 Tagen der Aufsatz »Johannes Kreisler u. s. w.« und »Beethovens Instrumentalmusik« eingegangen. Diese Erzählung beruht auf starken Gedächtnisfehlern.
Die Hoffmannsche Besprechung der Beethovenschen, im Verlage von Breitkopf & Härtel erschienenen C moll-Symphonie ist erst über ein Jahr später, nämlich im XII. Jahrgang Nr. 40 der A. M. Z. vom 4. Juli 1810, der Aussatz »Beethovens Instrumentalmusik« aber überhaupt nicht in der A. M. Z. erschienen. Dagegen brachte die A. M. Z. im XI. Jahrgang Nr. 33 vom 17. Mai 1809 die Besprechung der beiden Symphonien Friedrich Witts und Hoffmann bemerkte zu dieser Besprechung, im Tagebuch, ausdrücklich: » Opus 1. dieser Art, es ging besser, als ich gedacht hatte« (H II, 23). Es ist also zweifellos, daß Rochlitz dem Antragsteller als erste Arbeit die Recension der Wittschen Symphonien übertrug, und ihm dies Musikwerk allererst übersandt hat, dagegen Beethovens C moll-Symphonie erst viel später an ihn hat gelangen lassen.
Was den Aufsatz »Johannes Kreisler u. s. w.« betrifft, so sind damit »Johannes Kreisler's des Kapellmeisters, musikalische Leiden« gemeint. Dieses erste Kreislerianum sandte Hoffmann aber nicht zehn Tage, nachdem ihn Rochlitz zum Mitarbeiter angenommen, sondern etwa ein Jahr später, denn der Aufsatz erschien im Druck im XII. Jahrgang der A. M. Z. Nr. 52 vom 26. September 1810!
Dagegen ist › Ritter Gluck‹ im XI. Jahrgang der A. M. Z. Nr. 20 vom 15. Februar 1809 als Leitartikel gedruckt, unterzeichnet: »– – – – nn.«
Es ist daher zweifellos, daß Hoffmann mit dieser Dichtung sich bei Rochlitz eingeführt, sehr wahrscheinlich (schon wegen des bereits am 15. Februar 1809 erfolgten Abdrucks), daß er das Manuskript gleich seinem ersten, die Mitarbeiterschaft an der A. M. Z. nachsuchenden Briefe beigelegt hat.
Auf eine glänzendere Weise konnte er sich bei dem Publikum der damals bedeutendsten musikalischen Zeitung allerdings nicht einführen. Wenn eins der Lieblingsbücher Hoffmanns, Diderots köstlicher, von Goethe 1805 verdeutschter › Neveu de Rameau‹ auch einzelne kleine Züge zu dieser musikalischen Fantasie geliehen hat, so ist das Werk doch in allem Wesentlichen ein ganz originales, und ich stehe nicht an es als eins der Meisterwerke der Weltlitteratur zu erklären. Das Hineinragen einer fantastischen, aber mit den Augen des realistischen Dichters geschauten Geisterwelt in das Alltägliche, in das moderne Berlin von 1809, mit seinen namentlich bezeichneten Straßen, Wirtshäusern, Theater ist mit staunenswerter Glaubhaftigkeit, im Lapidarstil des Genies dargestellt. Ein unbeschreiblicher Zauber der Stimmung ruht über dem Ganzen. Die Dichtung ist ein Symbol des Triumphes »jenes stillen ernsten Geisterreiches« der Faustzueignung über die gemeine Deutlichkeit der Dinge, des »Romantischen« über das Praktische der Weltmenschen. Mit dem, was Hoffmann später so oft das Romantische nennt, das romantische Geisterreich, meint er aber keineswegs das Romantische der romantischen Schule, sondern das buddhistische »Jenseits der Erkenntnis«, die Schopenhauersche Verneinung des Willens, zu welcher bereits die künstlerische Betrachtung und namentlich die von Schopenhauer als die höchste Kunst gefeierte Musik führt. »Sie ist die romantischte aller Künste, heißt es in der obenerwähnten Besprechung der Beethovenschen C moll-Symphonie – fast möchte man sagen, allein rein romantisch. Orpheus' Lyra öffnete die Thore des Orcus. Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf; eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt.« So schlug Hoffmann schon in seinem ersten dichterischen Werke den Grundaccord so vieler späteren an, ja er hat dies kleine Erstlingswerk nach meiner Meinung kaum jemals übertroffen.
Bescheiden schrieb er in sein Tagebuch, wohl als er den ›Ritter Gluck‹ gedruckt gesehen: »meine litterarische Carriere scheint beginnen zu wollen« (H II, 22).
Nicht minder originell ist die schon erwähnte Skizze Im Originalmanuskript, d. h. in der ersten Niederschrift, lautet der Titel: ›Des Kapellmeisters, Johannes Kreisler, musikalische Leiden.‹ Dies Manuskript befindet sich im Besitz meines Freundes Hans von Müller, der es mir mitgeteilt und dem ich auch sonst für sein an der gegenwärtigen Ausgabe vielfach bethätigtes Interesse hier meinen Dank wiederhole., mit der er sich, unter der Maske des genialen, dem gewöhnlichen Philister als toll erscheinenden Kapellmeisters Kreisler, dem Leser vorstellte. Denn Kreisler ist der Musiker Hoffmann. Weshalb er zu seinem Vornamen Johannes wählte, das haben wir bereits oben, S. IX, gesehen. Für gänzlich windig halte ich die Behauptung Rochlitzens, er habe, in seinem Antwortschreiben auf den Antrag Hoffmanns, ihm diese Figur suppeditiert – eine Behauptung, mit der er erst nach Hoffmanns Tode hervorgetreten ist: denn in einer (später zu erwähnenden) Besprechung (vom Jahre 1814) sagt er vom Kreisler: »Dieser vom Vers, ebenso glücklich erfundene als konsequent und wacker durchgeführte Herr.« In Kreislers selbsterlebten musikalischen Leiden wird die Kehrseite der Thätigkeit Hoffmanns als Gesanglehrer, der auch Talentlosigkeit unterrichten und zu den Bamberger musikalischen Abendgesellschaften aufspielen muß, mit dem ihm so besonders zu Gebote stehenden skurrilen Humor aufs Ergötzlichste geschildert. Ein weiteres in Bamberg entstandene ›Kreislerianum‹ schloß sich in dem XIV. Jahrgang der A. M. Z. Nr. 31 vom 29. Juli 1812 an: ›Des Kapellmeisters, Johannes Kreislers, Dissertatiuncula über den hohen Wert der Musik.« An den »Ritter Gluck‹ schloß sich der im September 1812 geschriebene › Don Juan‹, der im XV. Jahrgang der A. M. Z. Nr. 13 vom 31. März 1813 gedruckt erschien. Auf diese musikalische Novelle beziehen sich die Verse des größten französischen Lyrikers des Jahrhunderts:
Quant au roué français, au Don Juan ordinaire
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
C'est l'ombre d'un roué qui ne vaut pas Valmont.
Il en est un plus grand, plus beau, plus poétique,
Que personne n'a fait, que Mozart a rêvé,
Qu' Hoffmann a vu passer, au son de la musique,
Sous un éclair divin de sa nuit fantastique,
Admirable portrait qu'il n'a point achevé,
Et que de notre temps Shakespeare aurait trouvé.
( Alfred de Musset, Namouna. 1883).
In Deutschland sagte der Musikgelehrte A. B. Marx schon 1823 sehr treffend: »Hoffmann hat ein Bild des Don Juan niedergelegt, von dem man mit Wahrheit sagen kann: es ist Mozarts Don Juan als Gedicht.« Aber er klagte auch: »Es ist unerfreulich, daß die Schauspieler in den Darstellungen des Don Juan so wenig zeigen, daß sie Hoffmanns Don Juan gelesen, geschaut und durchdacht haben« (H II, 368 f.). Gerhart Hauptmann läßt diese Klage seinen genialen ›Kollegen Crampton‹ (1892) wiederholen: »Ihr lest zu wenig, ihr jungen Künstler! Ihr seid Ignoranten schlimmster Sorte … Kennen Sie Swift? Nein. Kennen Sie Smollet, kennen Sie Thackeray, kennen Sie Dickens? Wissen Sie, daß ein Mann Namens Byron einen Kain geschrieben hat? Kennen Sie E. T. A. Hoffmann? Ihr seid Ignoranten schlimmster Sorte.«
Die neben diesen Dichtungen zur A. M. Z. während der Bamberger Jahre und später beigesteuerten musikkritischen Beiträge, d. h. die Recensionen neuer Musikalien (sämtlich anonym) sind bei Ellinger, S. 200 f. zum Teil verzeichnet nun S. 69 eingehend besprochen. In unserer Ausgabe der ›sämtlichen Werke‹ konnten sie ihres specifisch musikgelehrten Charakters wegen keine Aufnahme finden, ebensowenig wie die Operntexte und überhaupt alles Reinmusikalische.
Neben der von Hoffmann mit solchem Glück beschrittenen litterarischen Laufbahn, die ja auch von der Musik ausging, nahm gleichzeitig die schöpferische Beschäftigung mit der Musik einen breiten Raum ein.
Für das Theater komponierte er ein selbstgedichtetes Festspiel zur Feier des Namenstages der Prinzessin von Neufchatel, die damals bei ihrem in Bamberg residierenden Vater, dem Herzog von Bayern lebte: es gefiel ungemein, wurde sogar wiederholt und Hoffmann erhielt von der Prinzessin Mutter »für die verschaffte Rührung« 30 Carolin (siehe den humoristischen Brief Hoffmanns darüber L II, 14 f.). Das Gelegenheitsstück ist natürlich nicht auf die Nachwelt gekommen, ebensowenig seine Komposition der Kotzebueschen Oper ›Das Gespenst‹, zweier Melodramas ›Dirna‹ und ›Saul‹, sowie der Oper ›Aurora‹ des Grasen von Soden, leider aber auch nicht die Komposition der Gesänge zur ›Genoveva‹ des Malers Müller, deren Hoffmann noch in den Serapionsbrüdern gedenkt. Dagegen wird von der Sodenschen Oper ›Julius Sabinus‹ der 1. Akt (ohne Ouvertüre) und Bruchstücke des 2. Aktes auf der Berliner K. Bibliothek aufbewahrt. Ebenda befinden sich 2 Klaviersonaten in Cis moll und F moll Vielleicht ist die eine schon in Berlin entstanden, denn Hoffmann spricht (im Briefe an Rochlitz siehe oben S. XXXII) von 3 Sonaten, womit wohl die beiden in Plozk entstandenen und eine neue gemeint sind.; ein Quintett in C moll für Harfe, 2 Violinen, Bratsche und Cello; ein Vokalquartett › o nume che quest' anima‹; zwei Hefte Duettini (italiänischer Text und Übersetzung) für Sopran und Tenor mit Klavierbegleitung; endlich die vollständige Partitur eines Miserere in B. Das letztere (vom 12. Januar bis 11. März 1809 komponiert) wird von Ellinger, der alle diese Musikstücke S. 64-68 bespricht, am höchsten gestellt. Nicht von ihm erwähnt werden zwei Arien › prendi I'acciar ti rendo‹ und › mi lagnero tacendo‹, sowie ›einzelne Lieder und Kanzonetten‹ (siehe H II, 23. 34 und Truhns Nachlaßverzeichnis). Außerdem sang Hoffmann in den herzoglichen Konzerten und in der Kirche in Haydnschen Messen.
Das Jahr 1810 führte ihn wieder ans Theater zurück, da sein Glogauer Freund Holbein, mit einem zum Teil vorzüglichen Personal für Schauspiel und Oper nach Bamberg kam und ihn gegen ein Honorar von 50 Gulden als Theater-Komponist, Dekorateur und Architekt engagierte. Über die Neugestaltung des Bamberger Theaters durch Holbein hat Hoffmann einen kurzen Bericht in die ›Zeitung für die elegante Welt‹ (Nr. 82 [1811] S. 656) geschrieben (siehe Ellinger S. 200). Einige ›Xenien‹ auf die Holbeinschen Schauspieler sind, nach dem ersten Druck (K. 50-54) in unserm XV. Bande wiedergedruckt (S. 200 ff. Die Anmerkungen sind von C. F. Kunz). Ebendaselbst (S.202-206) finden sich zwei Bamberger Kleinigkeiten, nach dem ersten Druck (E. T. A. Hoffmanns ausgewählte Schriften. Erster Band, S. 379-386), wiederholt. Das Lokal der Erzählung nach aufgegebenen Stichworten, das Dörfchen Bug bei Bamberg, war der Lieblingsspaziergang Hoffmanns. Alle klassischen Opern, besonders die Mozartschen wurden gegeben. Im Schauspiel wußte Hoffmann seinen Freund zu bewegen, die Dramen des größten romantischen Dramatikers, Calderons, in Schlegels Übersetzung aufzuführen. Mit welchem Erfolge, darüber hat er berichtet in dem interessanten Aufsatze, der in unserm XV. Bande (S. 195ff.), nach dem ersten Drucke in Fouqués Zeitschrift ›Die Musen‹ (1812) wiedergedruckt ist. Die Dekorationen zu den drei Calderonschen Stücken hatte er selbst gezeichnet: Hitzig sah in Hoffmanns Nachlaß noch die »ausgezeichnet schönen, sauber in Farben ausgeführten Entwürfe«, ebenso solche zu dem von Holbein für die Bühne eingerichteten ›Käthchen von Heilbronn‹. Auch solche zu Klingemanns ›Entdeckung der Neuen Welt‹ werden erwähnt (H II, 26. 35). Er malte aber nicht nur fürs Theater. Für einen seiner besten, in Bamberg gewonnenen Freunde, den Medizinaldirektor Adalbert Marcus, entwarf er 1811 die Kartons zu Fresken, welche einen Turm des unweit der Stadt gelegenen Schlosses, die Altenburg, das Markus gekauft hatte, schmücken sollten. Die Altenburg war einst der Wohnsitz des Grafen Adalbert von Babenberg gewesen und dessen Gefangennehmung stellte Hoffmann dar, sich selbst nebst Bamberger Freunden unter den gefangenen Rittern abkonterfeiend. Er führte die Fresken auch in der Folge aus, leider fielen sie aber – nach Marcus' 1816 erfolgtem Tode – der allmählichen Zerstörung anheim und wurden dann von einem Maler Namens Ruprecht übermalt und durch dessen neue Fresken »ersetzt« (K 66 f.). Die einzige Erinnerung an Hoffmann, die im Turm der Altenburg noch heute erhalten ist, besteht in der Kopie eines Porträts der Freunde mit folgender Über- und Unterschrift:
Ernst Theodor Amadäus Hoffmann,
Novellist, 1808-1813,
Musikdirektor in Bamberg,
wohnte, dichtete und malte in diesem Turme.
*
F. A. Marcus und Amadäus Hoffmann,
nach dem Original von Amadäus Hoffmann
in der königlichen Bibliothek in Bamberg.
1812 als Gast seines Freundes Dr. Adalbert Marcus.
Es ist der erste urkundliche Nachweis, daß Hoffmann seinen Vornamen Wilhelm in Amadäus Auch die Titelblätter der obenerwähnten beiden Hefte ›Duettini‹, ganz von Hoffmanns Hand geschrieben, lauten: » Duettini italiani composte da E. T. A. Hoffmann«. umgewandelt hat, worauf wir später noch zurückzukommen haben.
Einen andern Freund, den Bamberger Weinhändler und Besitzer eines Leseinstituts, Carl F. Kunz, hat Hoffmann auch vielfach porträtiert (K 128 f.). Erhalten haben sich drei (H3 in Radierung wiedergegebene) Blätter, die ihn in Hoffmanns Gesellschaft darstellen. Nicht erhalten ist leider eine (H3 II, 177 f. beschriebene) kolorierte Zeichnung, welche Hoffmann und Kunz rittlings auf einem Fasse Burgunder ( Nuits) sitzend darstellt, wie sie, sich die Gläser direkt aus dem Fasse füllend, anstoßen wollen, aber im selben Augenblick durch einen durch die Kelleröffnungen zuckenden Blitz erschreckt werden. Hoffmann trank gern einen guten Tropfen, aber nur in Gesellschaft, bei belebtem Gespräch und niemals bemerkte der hier als klassischer Zeuge auftretende Kunz an ihm »einen Rausch, der ihn seiner Vernunft beraubt hätte« (K 22).
Außer den schon erwähnten Zeichnungen sind noch a. a. O. in Radierung wiedergegeben:
1) Porträt des Kanonikus Seubert
2) ein Blatt mit der Unterschrift: Ausgearteter Phantasie grausenerregende Bilder etc.
3) Werner die ›Söhne des Thales‹ vorlesend.
Ferner zeichnete er, wie in Warschau die polnischen Uniformen, Gruppen des Bamberger Bürgermilitärs, malte einen 17 Fuß hohen ägyptischen Tempel zur Verzierung des Kasinos, den Theatervorhang des Theaters in Würzburg u. a. (H II, 23 f. 35).
Im März des Jahres 1811 machte er die Bekanntschaft des Bamberg besuchenden Kollegen Carl Maria von Weber, und besuchte am 30. desselben Monats in Bayreuth Jean Paul, dessen Gattin er bereits während seines ersten Berliner Aufenthalts kennen gelernt hatte. Sie war bekanntlich die Tochter des Geheimen Obertribunalraths Mayer und hatte viel im Hause von Hoffmanns Onkel verkehrt, bis sie im Mai 1801 Jean Paul folgte.
Zu Anfang des folgenden Jahres verlebte er einen merkwürdigen Tag im Bamberger Kapuzinerkloster, wo namentlich der greise Pater Cyrillus sein Freund wurde. Wir finden die Eindrücke dieses Verkehrs mit den Mönchen in den späteren Schilderungen des Klosterlebens wieder (in den ›Elixieren des Teufels‹ und in der ›Biographie Kreislers‹). Im März 1812 unternahm er eine Reise nach Nürnberg, der die Erzählung ›Meister Martin‹ und noch seine letzte ›Der Feind‹ ihre anschauliche Frische verdanken.
Im Juli 1812 legte Holbein die Theaterleitung nieder und Hoffmann verlor damit sein sicheres Einkommen. Obwohl ihn sein zu Ende 1811 verstorbener Königsberger Onkel und Erzieher zum Universalerben eingesetzt hatte, auch gleich eine Abschlagszahlung von 500 Thlr. erfolgt war (die aber grade hingereicht seine Gläubiger zu befriedigen), befand er sich nun, zumal sich die Erbregulierung in die Länge zog, wieder in pekuniärer Notlage. Aber weit entfernt, sich davon niederdrücken zu lassen, faßte er im selben Juli, und zwar auf der Altenburg, den Plan, Fouqués Undine in Musik zu setzen, wandte sich wegen des Textes an Hitzig, und empfing alsbald die Nachricht, daß Fouqué selbst die Bearbeitung übernehmen wolle. In einem entzückten Briefe vom 15. August 1812 dankt er Fouqué dafür und übersendet das Scenarium (F 122 f.). An den windigen renommistischen Nachrichten, die der Weinhändler Kunz über die Entstehung des Plans zur Undine giebt, wird nur das richtig sein, daß der Brief mit der erfreulichen Nachricht Hitzigs »mit echtem 83er Rüdesheimer« begossen wurde (K 77). Fouqué sandte schon am 27. August den Anfang der Oper, wofür sich Hoffmann am 4. Oktober bedankt (F 124 f.). Am 14. November fand er, bei der Zurückkunft von einer Exkursion nach Würzburg, den fertigen Operntext vor (H II, 39 f.) und schreibt dann über die begonnene Komposition den höchst interessanten Brief an Hitzig vom 30. November (F 125 bis 129). Wenn man diesen Brief liest, begreift man nicht, wie er am 26. November in sein Tagebuch schreiben konnte: »den alten Rock verkauft, um nur essen zu können« (H II, 34). Es kann sich jedenfalls nur um eine ganz vorübergehende Geldkalamität gehandelt haben. Freilich heißt es in der Eintragung vom 1. Januar 1813: »unter den schlechtesten Auspicien im höchsten Druck der Umstände, ist das neue Jahr angegangen; – wie wird das werden!« Aber schon am 9ten notiert er: »Seit lange der erste frohe Tag! nämlich 36 Rthlr. Honorar aus Leipzig erhalten.« Am 10. Februar ruft er nach einer Aufführung des ›Titus‹: » anch' io son pittore!« und am 25. desselben Monats trafen aus Königsberg 485 Thlr. Erbgelder ein: »Aller Kummer ein Ende« (H II, 40 f.).
Wie der Kummer über seine äußere Lage vorüber war, so war es grade jetzt auch der Fall mit einem Liebeskummer, der ihn die ganze Zeit seines Bamberger Lebens verfolgt hatte. Unter den Häusern, in denen er Musikunterricht erteilte, war auch das der Konsulswitwe Mark, und er verliebte sich in deren sechzehnjährige schöne und mit einer köstlichen Stimme begabte Tochter Julie. Die Stimmungen, in die ihn diese Leidenschaft versetzte, sind in kurzen Auszeichnungen seines Tagebuchs verzeichnet (H II, 42-45). Ausführlicher erzählt das – übrigens ganz platonische Es galt davon, was er später im ›Artushof‹ von der Tochter des Malers Berklinger sagte: »Felizitas stellte sich ihm dar als ein geistig Bild, das er nie verlieren, nie gewinnen könne. Ewiges geistiges Inwohnen der Geliebten – niemals physisches Haben und Besitzen« (S. W. VI. 163). – Verhältnis Kunz (K 85-93), wenn wir die Mitteilungen eines Mannes auch mit großer Reserve aufzunehmen haben, der gar nicht imstande war, einen Künstler wie Hoffmann zu begreifen und, wie er einerseits das von Natur aus gute Herz und Gemüt seines »Freundes« rühmte, andrerseits als die Grundlage von Hoffmanns Charakter »Egoismus und Eitelkeit« bezeichnete (K 26. 79). Allerdings hat der nervöse Hoffmann ihm einmal, als er, der gar keine Stimme hatte, vor ihm eine Mozartsche Arie singen wollte, nachdem ein »Liebster ich bitte Sie, hören Sie auf« nichts gefruchtet, den Inhalt eines großen Glases Wasser ins Gesicht gegossen! – wodurch eine längere Pause in der Freundschaft herbeigeführt wurde.
Nach kaum zurückgelegtem 18. Jahre heiratete Julia Mark (im Winter 1812) den Hamburger Kaufmann und Senatorssohn Georg Gräpel. Siehe ›Heinrich Stieglitz. Eine Selbstbiographie.‹ Gotha 1865, S. 41-43. – Stieglitz war der Vetter Julias und besuchte sie im Jahre 1820, als sie, als geschiedene Frau, in Arolsen lebte. Er brachte »die schöne Julia« auf Hoffmann, von dem sie sagte, »daß Einen, den er durch seinen schneidenden Witz lächerlich zu machen sich vorgesetzt, man nicht ohne Hohngefühl habe wieder ansehen können, daher ihm auch während Gräpels Bewerbung die Mutter das Haus verboten habe.« Hiemit vergleiche man die schönen Worte, die Hoffmann ihr, in demselben Jahre 1820, durch einen Freund übersandte: II I, 46.
Eine, als Julias Verlobung im Gange war, niedergeschriebene Tagebuchsaufzeichnung Hoffmanns lautete: »göttliche Ironie, herrliches Mittel, Verrücktheit zu bemänteln und zu vertreiben, stehe nur bei! Jetzt wird es Zeit, in literis zu arbeiten!« (H II, 43 f.) Und er legte die Geschichte seiner Liebe zu Julia in der dem berühmten Hundedialoge des Cervantes nachgebildeten höchst originellen ›Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza‹ nieder. Der Hund Pollux, der der Besitzerin des Bamberger Gasthofes »Zur Rose« – Hoffmanns Stammlokal – gehörte, hatte zu der Wahl des Cervantesschen Rahmens den ersten Anstoß gegeben, da er diesen Hund einmal bei Mondschein, hinter dem Standbild des h. Nepomuk getroffen, stöhnend und winselnd und erst nach vielem Zureden bewogen hatte mit ihm nach Hause zu gehn. Auch sonst verkehrte er viel mit diesem von ihm sehr geliebten Hunde. Am 17. Februar 1813 notiert er im Tagebuch: »mit Glück am Berganza gearbeitet.« Nach Vollendung des Werkes beschloß er, die in der Allg. M. Zeit. erschienenen Dichtungen mit dem ›Berganza‹ in Einer Sammlung zu vereinigen, und da die in der Freiherrlich von Stengel'schen Sammlung gesehenen Callotschen Kupfer ihm einen großen Eindruck gemacht hatten, so bestimmte er den Gesamttitel als › Fantasiestücke in Callots Manier‹. Der befreundete Weinhändler und Leseinstitutsbesitzer Kunz bot sich zum Verleger für dies Werk und weitere drei noch ungeschriebene an und sie schlossen folgenden
Vertrag
zwischen dem Buchhändler Carl Friedrich Kunz und dem Musikdirektor Ernst Theodor Amadeus Hoffmann den Verlag der litterarischen Werke des letztern betreffend.
Es hat sich begeben, daß Hr. Kunz, nachdem er für die Verbreitung der Litteratur auf mehrfache Weise gesorgt, mit großer Vorliebe für jedes litterarische Geschäft, sich auch entschlossen, eigne Verlagswerke ans Licht zu stellen, wogegen der Musikdirektor Hoffmann, der eigentlich nur Noten schreiben sollte, sich auch nicht ohne Glück auf mannigfache Art in das litterarische Feld gewagt. Beide, in Freundschaft stehend, wollen sich nun in ihren litterarischen Bemühungen möglichst unterstützen, damit das fernere Gedeihen ihnen Freude bringe, und haben die nähere Art und Weise ihres litterarischen Bundes in folgenden Punkten unwiderruflich festgestellt.
§ 1.
Der M.-D. Hoffmann verpflichtet sich, diejenigen vier Werke, welche er von heute an in den Druck giebt – – – – dem Hrn. Kunz in Verlag zu geben.
§ 2.
Der Hr. Kunz verpflichtet sich dagegen die genannten Werke, wenn auch nicht mit typographischem Aufwande, doch auf würdige Weise, d. h. mit guter Schrift auf gutem Druckpapier abdrucken zu lassen und für das erste Werk den Druckbogen mit … Reichsthaler, für die folgenden Werke aber den Druckbogen mit … zu honorieren.
§ 3.
Das erste Werk unter dem Titel: ›Fantasiestücke in Callots Manier‹, soll in zwölf Druckbogen mehrere Aufsätze enthalten, von denen einige schon in der Musikalischen Zeitung enthalten sind. Die übrigen verspricht der M.-D. Hoffmann in der Art zu liefern, daß der Druck schon jetzt beginnen und ununterbrochen fortgesetzt werden kann. Sollten die jetzt projektierten Aufsätze mehr als zwölf Bogen betragen, so verlangt der M.-D. Hoffmann für die mehreren Blätter kein besonderes Honorar.
§ 4.
Der Hr. Kunz verpflichtet sich, das für das erste Werk bestimmte Honorar dem M.-D. Hoffmann bis zum … d. J. zu zahlen. – – – –
§ 5.
[Betrifft das dem Kunz eingeräumte Näherrecht rücksichts der litterarischen Werke, die M.-D. Hoffmann nach den hier in Rede stehenden vier Werken schreiben sollte.]
§ 6.
[Neue Auflagen betreffend.]
In dem festiglichen Glauben, daß dem geschlossenen Bunde Gutes entsprießen werde, haben die Kontrahenten in Fröhlichkeit und gutem Willen den Kontrakt, so wie folgend, durch ihre Namensunterschrift vollzogen und abgeschlossen.
So geschehen Bamberg den 18. März 1813.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Musikdirektor.
Carl Friedrich Kunz.
Wir haben nebenbei in diesem Verlagsvertrage Abgedruckt in Brockhaus' Litterarischem Konversationsblatt Nr. 1 vom 1. Januar 1823. Die durch Punkte angedeuteten Lücken finden sich schon im ersten Abdruck, die von mir vorgenommenen Abkürzungen sind durch – – – angedeutet. Der Vorname ist diesmal Amadeus (nicht Amadäus) geschrieben. den zweiten urkundlichen Beweis über die Annahme des neuen Vornamens seitens Hoffmanns.
Noch ehe das vollständige Manuskript aber dem neugebackenen Verleger übergeben werden konnte, folgte Hoffmann dem von Leipzig ihm gemachten Antrag, bei der Joseph Secondaschen Truppe in Dresden als Musikdirektor einzutreten. Als der Ruf an ihn erging, erkundigte er sich zuvor vorsichtig bei Rochlitz über Seconda Brief vom 3. März 1813: siehe › Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Bovet‹ (Paris, Charavay 1885), p. 392., Die Auskunft fiel günstig aus, er sagte zu und am 11. März heißt es im Tagebuch: »Den Brief erhalten, der meine Anstellung bei Seconda richtig macht. Große Freude!« (H II, 41).
Am 21. April 1813 verließ er Bamberg.
Am 25. April traf er mit seiner Gattin in dem von den Preußen und Russen besetzten Dresden ein, wo sie im vierten Stock der Stadt Naumburg in der Wilsdruffer Straße Wohnung nahmen. Ihre kriegerischen Reiseabenteuer schildert er im Briefe an den Verleger vom 26. April (H³ III, 158-162). Zugleich meldet er, daß er seinen Freund, den Kammermusikus Morgenroth angetroffen und dieser ihm versprochen habe, ihm »den Gluck« (d. h. die betreffende Nummer der Musikalischen Zeitung) für den Neudruck in den ›Fantasiestücken‹ zu verschaffen. An demselben 26. April hatte er die Freude, seinen alten Freund Hippel, der als Vortragender Rath den Staatskanzler Hardenberg ins Feld begleitete, ganz zufällig im Linkschen Bade zu treffen, leider sehr bald wieder zu verlieren, denn am 8. Mai verließ der König von Preußen die Stadt um 10 Uhr und um 5 Uhr desselben Tages traf unter dem Geläute der Glocken, und von Deputationen empfangen, der Kaiser Napoleon ein. Nun beschossen die jenseits der Elbe verbliebenen Russen Dresden und Hoffmann erhielt bei dieser Gelegenheit in der Nähe des Schloßthores einen Prellschuß, der aber eigentlich nur seine neue Stiefelklappe verwundete, ihm selbst aber nur einen blauen Fleck eintrug. Trotz dieser und anderer im Brief an den Verleger vom 10. Mai geschilderten Fährlichkeiten kann er ihm doch die Abschrift des Ritter Gluck übersenden (K 149). Er hatte inzwischen das teure Hotel verlassen und Altmarkt Nr. 33 vier Treppen hoch »ein höchst romantisches Stübchen« gemietet. Hier schrieb er, wie das Tagebuch vom 18. Mai meldet, »mit großem Glück den Anfang der Erzählung › Der Magnetiseur‹. Der Schauspieldirektor Seconda hatte inzwischen, der Kriegsunruhen halber, nicht nach Dresden kommen wollen, sondern forderte Hoffmann auf, zu ihm nach Leipzig zu kommen. Nachdem dieser das Reisegeld erhalten, bestieg er, am 20. Mai, mit seiner Frau die Leipziger Postkutsche, die aber kurz vor Meißen umschlug, wobei eine Mitreisende Gräfin F. vor den Augen ihres ihr erst kürzlich angetrauten Mannes getötet, Hoffmanns Frau aber am Kopfe, anscheinend gefährlich verwundet wurde, und zwei Tage in Meißen liegen bleiben mußte. Indes konnte sie dann, nach chirurgischer Behandlung, die Reise fortsetzen und am 23. Mai, nachmittags 3 Uhr, trafen sie glücklich in Leipzig ein. Am 24. dirigierte Hoffmann bereits die Flügel-, am 25. die Orchester-Probe einer neuen Oper! (H II, 67 f.) Vier Wochen später kehrte er, diesmal mit der ganzen Secondaschen Truppe, nach Dresden zurück, wo ihnen das Hoftheater eingeräumt war. Die Reise der Truppe, in neun Halbwagen, hat Hoffmann äußerst ergötzlich geschildert in einem Briefe vom Anfang Juli an seinen Bamberger Arzt und Freund Dr. Speyer, Neffen des obengedachten Medizinalraths Marcus (H II, 68-83). Der Brief schildert auch die erste Zeit in Dresden, wo er diesmal Am Sande in der Allee, die nach dem Linkischen Bade führt, wohnte. Für Kunz war dem Briefe die erste Abteilung »des für die ›Fantasiestücke‹ bestimmten letzten Aufsatzes«, nämlich des ›Magnetiseurs‹ beigefügt. Mitte Juli erhielt er von Kunz die beiden ersten Druckbogen der ›Fantasiestücke‹ (H³ III, 163). In dem Begleitschreiben des Verlegers hatte dieser die Absicht ausgesprochen, von Jean Paul eine Vorrede zu dem Buche zu erbitten. Hoffmann bemerkt dazu (Brief vom 20. Juli 1813): »Alle Vorreden sind mir … in den Tod zuwider, am mehrsten aber solche, womit berühmte Schriftsteller die Werke unbekannter wie mit einem Attestat versehen … Finden Sie als Verleger, ihres bessern Nutzens wegen, es aber geraten, meinem Werklein ein solches Attestat vorsetzen zu lassen, so schreiben Sie immerhin an ihren Freund Jean Paul …« (H³ III, 164). In demselben Briefe findet sich, beiläufig, die Notiz, daß Hoffmann Prévost, den Verfasser der unsterblichen Manon Lescaut gekannt hat, denn er schreibt: in seinem Gärtchen, mit der Pfeife und in einem ziemlich abgelebten Überrock umherwandelnd, komme er sich vor wie der homme de qualité qui se retiroit du monde. Im folgenden Brief an Kunz, vom 26. Juli, quittiert er wieder über weitere erhaltene Druckbogen und freut sich über »den schönen Druck herzlich«. Am 12. August sendet er zwei Zeichnungen zu Vignetten für die beiden Bände der Fantasiestücke (vgl. die Erklärung dieser allegorischen Vignetten H³ III, 176). Unter die für den ersten Band bestimmte hatte er gez. v. Hoffmann in Dresden gesetzt: er nannte dies ein »Versteckspielen«, denn das Buch sollte durchaus anonym erscheinen, »indem mein Name nicht anders als durch eine gelungene musikalische Komposition der Welt bekannt werden soll« (H³ III, 164). Indem er, mit Brief vom 19. August den Schluß des Magnetiseur-Manuskripts übersendet, kündigt er zugleich »ein Märchen« für einen dritten Band der ›Fantasiestücke‹ an. »Denken Sie dabei nicht, Bester! an Scheherezaden und Tausend und eine Nacht – Turban und türkische Hosen sind ganz verbannt – feenhaft und wunderbar, aber keck, ins gewöhnliche alltägliche Leben tretend und seine Gestalten ergreifend, soll das Ganze werden« (K 161). Im selben Briefe meldet er, daß von ›Undine‹ zwei Akte fertig seien: »ich arbeite ungeheuer! – was kann man in böser Zeit Besseres thun!« Sein Häuschen »am Sande« hatte er, da es im Schußbereich einer Batterie lag, in dieser Zeit (am 22. August) mit einem Logis in der Altstadt, Moritzstraße vertauschen müssen. Die der Dresdener Schlacht vorhergehenden Tage und die Schlacht selbst hat er seinem Freunde Dr. Speyer in Tagebuchsform äußerst anschaulich geschildert (vom 15. bis 29. August 1813: H II, 83-95).
Kunz hatte inzwischen einen Besuch in Bayreuth gemacht, um Jean Paul persönlich um die Vorrede zu den Fantasiestücken zu bitten. Auf seinen Bericht: Jean Paul habe zuerst die ihm mündlich vorgetragene Bitte um die Vorrede abgelehnt, als er aber das Druckmanuskript eingesehen, seinen Entschluß geändert Kunz berichtete später: um 10 Uhr morgens habe er Jean Paul verlassen, der die Vorrede deswegen abgelehnt, weil ihm seine Frau »Dinge« (aus der Zeit von 1798-1800) erzählt habe, die Hoffmanns Herz in keinem vorteilhaften Lichte erscheinen ließen; – um 1 Uhr aber, als der von ihm zum Essen geladene Jean Paul im Hotel erschienen, sei er ins Zimmer getreten mit den Worten: »Das Manuskript (der Fantasiestücke) bringe ich nicht mit, das bleibt bei mir; denn ich schreibe die Vorrede, und hoffentlich eine recht gute und wahre! Wie konnte ich mir einbilden, daß das Buch ein so überaus vortreffliches wäre: ich gratuliere Ihnen zu dem gefundenen Schatze« (K 115 f.), antwortete Hoffmann, am 8. September, sehr erfreut über den Hergang, daß also sein Genius eigentlich Jean Paulen bestimmt habe, die Vorrede zu schreiben: »er mag mich nennen und meiner Musikdirektorschaft erwähnen, wie er will und wie es ihm die Laune und Lust eingiebt, – es ist ehrenvoll, von ihm genannt zu sein« (H³ III, 175 f.). In demselben Briefe ruft er aus: »Gott lasse mich nur das Märchen enden, wie es angefangen, – ich habe nichts Besseres gemacht.« Dieser Stoßseufzer wird durch die infolge der Schlacht (allein 10 000 österreichische Gefangene) in Dresden grassierende Hungersnot und Krankheiten, Ruhr, pestartiges Nervenfieber etc. hinreichend erklärt. Aber weder er noch seine Frau, obwohl sie dicht am Lazarett wohnten, erkrankten, und so konnte er am 17. November dem Verleger melden: »Das Märchen sub titulo: Der goldne Topf, ist fertig, aber noch nicht ins Reine gebracht … Undine naht der Vollendung« (H³ III, 188 f.). In demselben Briefe meldet er, daß er einen »den Callots« zuzuwendenden humoristischen Aufsatz › Schreiben Milo's, eines gebildeten Affen‹ unter der Feder habe, auch teilt er ein größeres Fragment aus dem Aufsatze › Der Komponist und der Dichter‹ mit, welcher durch das Zusammentreffen mit seinem Freunde Hippel angeregte Aufsatz in der Allg. M. Z. vom 8. und 15. Dezember im Druck erschien.
Am 9. Dezember verließ Hoffmann Dresden mit der Secondaschen Truppe, welche nun wieder in Leipzig spielen sollte. Einen Rückblick auf die Dresdener Zeit gewährt ein Anfang Dezember geschriebener Brief an Hitzig (H II, 96-100: in allen Ausgaben fälschlich vom 21. Dezember datiert). In diesem Brief meldet er auch die Vollendung Im Widerspruch hiermit steht die Mitteilung, die der Sprachlehrer und Übersetzer Adolf Wagner in Leipzig, mit dem Hoffmann dort freundschaftlich verkehrte, unterm 27. April 1814 an Fouqué richtete: »Hoffmann hat mir auch Ihre Oper Undine mitgeteilt, an welcher er nur noch den dritten Akt zu komponieren hat« (F 581). der › Undine‹: »ich thue mir auf diese Oper etwas zu gute«, und macht Hitzig auf die bevorstehende Erscheinung der ›Fantasien in Callots Manier‹ aufmerksam.
Mit der anschaulichen Schilderung von Hoffmanns Erscheinung und des Eindrucks seiner Persönlichkeit, die uns der Dresdner Novellist Friedrich Laun (= Friedrich August Schulze) in seinen ›Memoiren‹ (Bunzlau 1837) hinterlassen, möchte ich diese Dresdner Periode Hoffmanns schließen. Laun erzählt: »Ich pflegte mich in einem Kaffeehause an der Ecke der Seegasse einzufinden … In einem der Zimmer fiel mir ein kleiner, in der Regel die eine Ecke einnehmender Mann auf. Ihm war fast immer ein anderer, größerer zur Seite, mit dem er sich, meistenteils leise, unterhielt. Nicht selten saß er dann wieder in tiefen Gedanken und sprang oft ohne allen äußern Anlaß plötzlich vom Stuhle empor, um, beide Hände in die Tasche seines braunen Fracks so tief wie möglich herabgedrückt, hastig im Zimmer auf und ab zu gehn … seine Physiognomie verwandelte sich alle Augenblicke. Das kleine, kluge Gesicht war fast immer ein anderes. Die dunkeln stechenden Augen zeugten von einem gewaltigen Leben und um die Lippen zuckten ihm offenbar Sarkasmen, die es bedauern ließen, daß das schweigsame Männchen sie nicht in lauten Worten von sich gab. Zuweilen setzte er sich auch wohl auf einen, so weit als möglich von der Gesellschaft entfernten, einsamen Stuhl, um unbemerkt, wie er vermutlich glaubte, seinem Mienenspiel alle mögliche Zügellosigkeit verstatten zu können … Sein gewöhnlicher Gefährte war ein Schauspieler, Namens Keller … Die Freundlichkeit und Bildung, welche dieser Künstler darlegte, erleichterte mir das Anknüpfen eines Gesprächs mit ihm, wodurch ich zugleich die mir unvergeßliche Bekanntschaft E. T. W. Hoffmanns (denn der kleine Mann war kein anderer als dieser ausgezeichnete Humorist) mit gewann. An Hoffmann fand ich bei vielgewandtem Geiste eine ungemeine Feinheit … Er war damals, wie er mir mitteilte, eben beschäftigt, Fouqués Undine zu komponieren … Mit aufrichtigem Danke nahm ich sein Erbieten, mir den Text der Oper mitzuteilen an … Leider scheiterte mein sehnlicher Wunsch, des längeren Umgangs … mit dem höchst genialen Hoffmann, hinter dessen Satyr nicht selten eine recht einnehmende Herzlichkeit hervorblickt, an dem damals in Dresden herrschenden Nervenfieber, das mich niederwarf.« Hoffmann gedenkt seines Verkehrs in Eichelkrauts Kaffeehause am Altmarkt im Briefe an Kunz vom 8. September 1813 (H³ III, 179), wo er außer dem »jovialen Sekretär Schulze (Friedrich Laun)«, auch noch Theodor Hell »und den Kind« nennt. Auch im letzten Band der Serapionsbrüder schildert er den »Klubb« bei Eichelkraut, dessen Seele »ein sehr gemütlicher liebenswürdiger Dichter«, nämlich Laun gewesen (S. W. IX, 118 f.).
Das hier erwähnte Gesichterschneiden gehörte allerdings zu Hoffmanns originellen Eigentümlichkeiten. So sagt er selbst, unter der Maske des Malers Bickert im ›Magnetiseur‹: »Gesichter schneiden muß ich frei können, soviel ich will, das lasse ich mir nicht nehmen.« Alsbald heißt es denn auch: »Sowie Ottmar das Wort: Magnetismus, aussprach, zuckte es auf Bickerts Gesicht, erst leise, dann aber crescendo durch alle Muskeln, so daß zuletzt wie ein Fortissimo solch eine über alle Maßen tolle Fratze dem Baron ins Gesicht kuckte, daß dieser im Begriff war, hell aufzulachen, als Bickert aufsprang …« Und schon vorher ist Bickert also geschildert: »er hatte, wie er manchmal pflegte, bisher an dem Gespräch gar keinen Anteil genommen, sondern war mit über den Rücken zusammengeflochtenen Armen, allerlei skurrile Gesichter schneidend und wohl gar bisweilen einen possierlichen Sprung versuchend, auf und ab geschritten« (S. W. I, 152 f. 145).
In Leipzig ließ sich Hoffmann in dem kleinen Gasthof ›Zum goldnen Herz‹ in der Fleischergasse nieder und sandte von da am 28. Dezember an Kunz das Manuskript einer › Vision auf dem Schlachtfelds bei Dresden‹, welches den Anhang einer Broschüre bildete, in der er die wichtigen Tagesereignisse in Dresden »auf pittoreske Weise« erzählen wollte. Auch den Anfang des auf 5 bis 5 ½ Bogen berechneten und Kunz kontraktgemäß zum Verlage angebotenen Werkes legte er bei (K 157 f.).
Am 31. Dezember in der Sylvesternacht beendete er die Reinschrift des ›goldnen Topfes‹ und bemerkte dazu im Tagebuch »Von neuem gefunden, daß es gut ist« (H II, 100).
Als eine Probe und Vorankündigung der ›Fantasiestücke‹ waren inzwischen in der Leipziger ›Zeitung für die elegante Welt‹ die Kreisleriana ›Beethovens Instrumentalmusik‹ (dieser Aufsatz war eine Neubearbeitung der Besprechungen der C moll-Symphonie und der Trios in der A. M. Ztg. Besonders auf dieses Stück der ›Kreisleriana‹ bezieht sich das Urteil des Musikgelehrten Philipp Spitta in seinem zuerst in der »Deutschen Rundschau« vom Dezember 1892 erschienenen Aufsatze ›Über Robert Schumanns Schriften‹: »In den ›Kreisleriana‹ steckt ein Gärstoff von erstaunlicher Kraft, der die ganze Musikschriftstellerei unsers Jahrhunderts durchdrungen hat … Die Bilder der drei großen österreichischen Instrumentalkomponisten, welche Hoffmann … zeichnet und einander gegenüberstellt, sind mit solch tiefschauender, musikalischer Intention erfaßt und zugleich mit so siegreicher dichterischer Kraft herausgestellt, daß sie heute noch ihre volle Wirkung thun.«), sowie die ›Höchst zerstreuten Gedanken‹ nach den Aushängebogen abgedruckt worden. Aber »die Callots« selbst wollten noch immer nicht kommen, obwohl Kunz schon in der zweiten Dezemberwoche die Absendung des fertigen Buches versprochen hatte. Hoffmann schob, im Brief an den Verleger vom 16. Januar 1814, die Schuld der Verzögerung – und zwar mit Recht – auf »die Säumnis seines Vorredners«. In demselben Briefe ersucht er Kunzen, der die Verlagsübernahme der intendierten »Broschüre« abgelehnt hatte, ihm den Anfang derselben zurückzusenden Durch Kunzens unqualifizierbare Weigerung ist die »Broschüre« nun überhaupt unter den Tisch gefallen., die ›Vision‹ aber in irgend eine Zeitschrift, ohne Honorar, einrücken zu lassen. Kunz ließ sie darauf, in seinem Verlage, aber ohne Firma, mit der Bezeichnung »Deutschland 1814« als besonderes Heft erscheinen. Ich habe mir dies Flugblatt leider nicht verschaffen können, und so mußte die kleine Schrift nach dem ersten Wiederdruck in ›E. T. A. Hoffmanns ausgewählten Schriften‹ (Stuttgart, Brodhag, 1839) Zwölfter Band, Seite 219-226 in unsern XV. Band aufgenommen werden.
Mit demselben Brief übersandte Hoffmann die Reinschrift der ersten vier »Vigilien« des ›goldnen Topfes‹.
Im Januar vollendete er noch das obenerwähnte ›Schreiben Milo's‹, sowie die Erzählung › Die Automate‹. Ein Fragment aus der letzteren wurde in der A. M. Z. vom 9. Februar 1814 gedruckt mit folgender Fußnote der Redaktion:
In kurzem erscheinen zwei Bändchen Fantasiestücke in Callots Manier, mit einer Vorrede von Jean Paul Friedrich Richter. Im ersten dieser Bändchen finden die Leser verschiedene Stücke, die früher in unsrer Zeitung gestanden haben: in das dritte, das vielleicht noch in diesem Jahre erscheint, wird der originelle, scharfsinnige, lebensvolle Verf. unter anderm Scenen aus dem Leben zweier Freunde aufnehmen; und von diesen empfängt man hier ein Fragment.
Diese ›Scenen aus dem Leben zweier Freunde‹ (nämlich Ludwig und Ferdinand), zu denen auch das Gespräch ›Der Dichter und der Komponist‹ gehörte, hatte er für den dritten Band der ›Fantasiestücke‹ bestimmt, sie blieben aber dort fort und kamen erst Jahre nachher in den ›Serapionsbrüdern‹ wieder zum Vorschein.
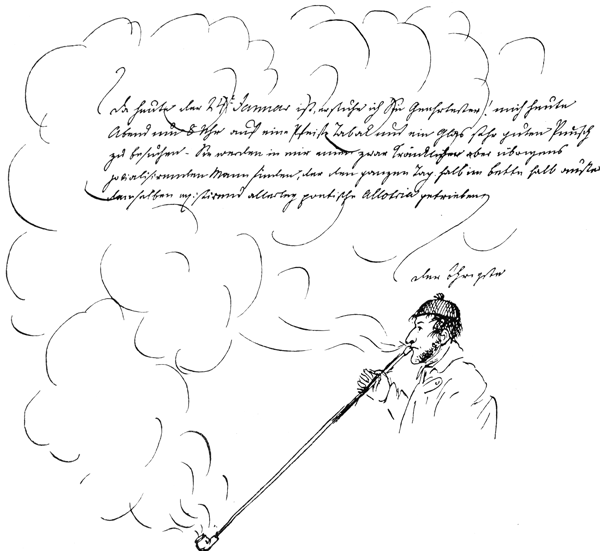
Den 24. Januar 1814, seinen 39sten Geburtstag, beging er mit seiner Frau und dem obenerwähnten Schauspieler Keller, den er durch das, nach Bovets Autographenkatalog, hier beigefügte Schreiben zu der Feier einlud. Im Tagebuch bemerkte er: »Gemütlicher Abend, sich in eigner Glorie gesonnt und was auf sich gehalten« (H II, 102).
In den letzten Tagen des Februar zog er sich bei den Opern- und Ballettproben im, bei 16-18 Grad Kälte, ungeheizten Theater rheumatische Beschwerden zu, die sich auf die Brust warfen, so daß er nur »durch einen Aderlaß und achthundert und vierzig andre Mittel der wirklichen Brustentzündung und vielleicht dem Tode entging« (Brief an Kunz vom 4. März 1814: H³ im Faksimile mitgeteilt, nebst einer Federzeichnung, die ihn im Sofa, in Betten gehüllt, mit großer Schlafmütze, die Füße in Flanell gehüllt, an einem Tisch mit Medizinflaschen sitzend darstellt).
Mit diesem Briefe sandte er zugleich den Schluß der Reinschrift des ›goldnen Topfes‹ ein.
Während dieser Krankheitsperiode suchte ihn der eben aus Weimar von einem Besuche bei Goethe zurückgekehrte Rochlitz auf und berichtet darüber (a. a. O.): »ich fand ihn in einem der geringsten Teile der Stadt, einem der geringsten Gasthöfe, einem der geringsten Zimmer desselben. Da saß er, auf einem schlechten Bett, wenig gegen die Kälte verwahrt, die Füße von Gicht herauf- und zusammengezogen. Die Frau saß still und sehr niedergeschlagen an seinem Lager. Er hatte ein Brett vor sich liegen … Mein Gott! rief ich, wie steht's denn um Sie? – »Es steht gar nicht, es liegt und krumm genug.« – Was machen Sie denn da? – »Karikaturen auf Napoleon und seine verwünschten Franzosen. Ich erfinde, zeichne und koloriere sie. Ich bekomme für jede von [Baumgärtner] dem Knauser, einen Dukaten.« Drei dieser »allerliebsten« Karikaturen sind von Hitzig genau beschrieben (H II, 103).
Im Brief an Kunz vom 24. März (H³ III, 203) erwähnt Hoffmann noch eine vierte Karikatur, die Baumgärtner hat stechen lassen, »ein kleiner Schnörkel … mit vieler Ironie gemacht … Ich erhielt für das Ding ein artiges Honorar und es geht reißend.« Auch führt er als nächstens bei Joachim erscheinend auf: › The exequies of the universal monarchy. Feierliche Leichenbestattung der Universalmonarchie‹.
In demselben Briefe teilt er dem Verleger mit, daß »der Traumgott ihm einen Roman inspiriert, der in lichten Farben hervorbricht, indem Tom. I beinahe vollendet. Das Büchlein heißt: Die Elixiere des Teufels aus den nachgelassenen Papieren des Paters Medardus, eines Kapuziners«.
Von den Fantasiestücken hat er jetzt (also am 24. März) Titel und Jean Pauls Vorrede erhalten, aber noch immer nicht den Schluß des 2. Bändchens, nämlich die Erzählung ›Der Magnetiseur‹. Jean Paul hatte die Vorrede erst am 13. Februar 1814 eingesandt. »Hier folgt die schon im November vollendete Vorrede … Ich habe vielleicht, um die Unparteilichkeit eines Vorredners wenigstens von einer Seite zu behaupten, eher zu wenig, als zu viel gelobt« (K 116). Woher Kunz die Nachricht geschöpft hat, daß »das Niederschreiben der Vorrede zwar ganz im Geiste Jean Pauls jedoch nicht von ihm selbst, sondern von seinem Freunde Otto geschah« – ist mir unerfindlich. Die Vorrede ist ganz zweifellos Wort für Wort von Jean Paul, der sie 1825 in seine ›Kleine Bücherschau‹ – mit den andern beiden Vorreden, die er zu von Dobenecks und Kannes Büchern geschrieben – aufnahm, auch an einer Stelle eine wichtige Korrektur anbrachte (»Und soll von weiblichen Paradiesvögeln das Kunstparadies … verschüttet werden?«, während es im ersten Abdruck [und auch im zweiten Abdruck von 1819] »verspottet« hieß). Was die Unterzeichnung der fingierten Recension mit Frip. betrifft, so war dies bekanntlich Jean Pauls Chiffer in den ›Heidelberger Jahrbüchern‹: siehe ›Kleine Bücherschau‹ S. VIII. Anmerkung. Hoffmann hatte sich die Vorrede »weniger von seiner Wenigkeit handelnd – kürzer – genialer gedacht«.
Der Theaterdirektor Seconda, der sich anschickte, wieder nach Dresden zu gehen, benahm sich seinem erkrankten Musikdirektor gegenüber, dem vom Arzte das Theater, sowie die Reise nach Dresden untersagt war, im höchsten Grade anständig, er zahlte ihm, der doch die Proben nur im Hause abhalten konnte, die volle Gage (H³ III, 202). Hitzigs Nachricht, daß Hoffmann am 26. Februar, infolge erhaltener Kündigung, das Theater sofort verlassen und nun wieder ganz ohne äußeren Halt dagestanden habe (H II, 104) – ist also irrig. Richtig scheint allerdings zu sein, daß einmal ein Zerwürfnis Hoffmanns mit Seconda stattgefunden hat, denn auch Rochlitz erwähnt, daß Hoffmann einmal seine Stelle gekündigt habe.
Im Mai schrieb er für die künftigen Callots (Band 3 und 4) ›Kreislers musikalisch-poetischen Klubb‹, worin der 1. Akt eines romantischen Spiels › Prinzessin Blandina‹ eingeflochten war, ebenso im selben Monat die später noch zu erwähnende Erzählung ›Der Revierjäger‹.
Gleichzeitig komponierte er – vom 8. bis 10. Mai – auf Bestellung Baumgärtners ein großes Musikstück ›Die Schlacht bei Leipzig‹ – gab aber seinen Namen nicht dazu her, sondern nahm das Pseudonym ›Arnulph Vollweiler‹ an.
Außer Recensionen schrieb er für die A. M. Z. den Aufsatz ›Über einen Ausspruch Sachinis‹, der in Nr. 29 vom 20. Juli 1814 erschien und später unter die Kreisleriana des vierten Bandes der Fantasiestücke aufgenommen wurde. Ferner erschien in Nr. 35 vom 31. August der ausgezeichnete Aufsatz ›Alte und neue Kirchenmusik‹ (vollständig wiedergedruckt bei Ellinger S. 201-213), den Hoffmann später, abgekürzt, in die ›Serapionsbrüder‹ eingeflochten hat. Seine Kränklichkeit und die Ungewißheit, ob er im Herbst, nach Secondas Rückkehr von Dresden, sein Amt wieder würde übernehmen können, namentlich aber wohl auch die Aussichtslosigkeit, seine Oper ›Undine‹ aufs Theater zu bringen Rochlitz, der in Leipzig am einflußreichsten in allen Musikangelegenheiten war, berichtet (a. a. O.), daß, als er an der Partitur der Undine, die ihm Hoffmann mitgeteilt, Kritik geübt, dieser sehr in Zorn geriet und ausrief: »O Gott! könnte ich doch nur einmal eine allmächtige Kritik über die Kritik schreiben, die diese mit einem Happ auffräße und – zerplatzte vom fetten Fraß.« Dann, als er seine Galle ausgeschüttet, »wurde er wieder sehr freundlich, packte guter Dinge seine Partitur zusammen und ging.« – Über Hoffmanns musikalische Begabung bemerkt Rochlitz noch beiläufig: »er zeigte sich als guten Klavierspieler, auch sang er angenehm, vorzüglich komische Stücke.«, alles das hatte ihm den Aufenthalt in Leipzig mehr und mehr verleidet. Wie »einen heiteren Sonnenblick, der in sein Leben fiel«, begrüßte er daher die plötzliche Erscheinung seines alten Freundes Hippel, der ihn am 6. Juli in Leipzig besuchte (H³ II, 81). Im Tagebuch heißt es: »Er ist noch immer der Alte, er sagte mir eine Anstellung in Berlin augenblicklich zu; er schenkte mir seine goldne Repetieruhr u. s. w.« (H II, 105). Er schrieb nun den ostensibeln Brief vom 7. Juli 1814 (H³ II, 79 ff.), in welchem er den alten Jugendfreund bittet, »ihm eine Anstellung in irgend einem Staatsbureau zu verschaffen, die ihn nähre«.
Als drei Wochen verstrichen waren, fragt er »von tödlicher Ungeduld, von einem gänzlichen Mißbehagen an allem, was mich hier umgiebt, geplagt«, warum er noch immer keine Nachricht erhalte? Endlich – am 16. August, traf der Brief Hippels ein, der ihm eine Expedientenstelle im Justizministerium in Aussicht stellte. Er schrieb nun sofort durch eine Mittelsperson (den ihm befreundeten Geheimen Oberjustizrath von Diederichs) an den Justizminister von Kircheisen. Das Resultat war aber, daß ihm angeboten wurde, beim Kammergericht ein halbes Jahr, ohne Gehalt, gleichsam auf Probe zu arbeiten, um dann nach seiner Anciennetät als Rath einzurücken. Obwohl er die bescheidene, aber ihm mehr freie Zeit lassende Expedientenstelle weit vorgezogen haben würde, nahm er die Proposition so wie sie gestellt war an und bereitete seine Übersiedlung vor.
Inzwischen waren die beiden ersten Bände der ›Fantasiestücke‹ Den Untertitel ›Blätter aus dem Tagebuch eines reisenden Enthusiasten‹ verwendete später der erste französische Übersetzer des Goetheschen Faust, Gérard de Nerval, als Untertitel seines Buches › Lorely‹: » Sensations d'un voyageur enthousiaste«. Hoffmanns wird öfter darin gedacht: gleich im ersten Kapitel schreibt er in Straßburg: » de l'autre côté, là-bas à l'horizon … savez-vous ce qu'il y a? Il y a l'Allemagne! la terre de Goethe et de Schiller, le pays d'Hoffmann; la vielle Allemagne, notre mère à tous! … Teutonia!« längst erschienen. Beide Bände sind »Bamberg 1814« datiert und tragen die Verlagsfirma: »Neues Leseinstitut von C. F. Kunz«. Die im ersten Bande enthaltenen bisher noch nicht erwähnten Kreisleriana › Ombra adorata!‹ (ein Hymnus auf seine Julia) und die Humoreske ›Der vollkommene Maschinist‹ dürften beide noch in Bamberg entstanden sein.
Ein Anonymus lieferte eine, wie er sagte, verspätete Recension in der A. M. Z. Nr. 33 vom 17. August 1814. Sie war nicht nur verspätet, sondern auch so absprechend als irgend möglich, vom ›Berganza‹ z. B. hieß es, recht von oben herab: »dies Stück hat uns weit weniger zugesagt (als Don Juan) der Hund hätte sich kürzer als 219 Seiten fassen sollen« u. s. w. Der Anonymus war niemand anders als Rochlitz und er berichtet (a. a. O. 1822), Hoffmann habe bei seinem Abschiedsbesuch seine Galle über diese Recension an ihm ausgelassen.
Ende September verließ er mit seiner lieben Mischa den goldnen Hahn in der Fleischergasse und kam am 27. September in Berlin an, wo er in der Französischen Straße Nr. 28, 2 Treppen hoch ein bescheidenes Quartier bezog (H II, 106 und K 160). Seinem Hippel schrieb er (am 1. November 1814: H³ II, 133 ff.): »Die beiden ersten Tage, als ich in Berlin angekommen, lebte ich in der That wie in einem Freudentaumel. Der herrliche Fouqué kam nämlich grade von Nennhausen herein und mit ihm lernte ich bei einem Mahl, das Hitzig angeordnet, Tieck, Franz Horn und Chamisso kennen. Denselben Abend hatte ich Gelegenheit … vieles aus meiner Undine … recht brav vortragen zu hören.« An Kunz hatte er ebenfalls geschrieben und jenes, im ersten Restaurant stattgehabten Diners gedacht, »eines der interessantesten, die ich erlebt … Nach dem Diner wurde ich gestern bei einem Thee unter dem Namen eines Doktor Schulz aus Rathenow eingeführt und erst, nachdem viel und gut musiziert, sagte Fouqué: der Kapellmeister Johannes Kreisler befindet sich unter uns, und hier ist er« (K 161: wo der undatierte Brief fälschlich in den November oder Dezember gesetzt wird; als Teilnehmer an dem Diner nennt Hoffmann hier noch: Bernhardi [Tiecks Schwager], den Professor Moretto und den Maler Veith). Der letztgeschilderten Scene wird auch gedacht in einer kleinen gemeinsamen Publikation Fouqués und Hoffmanns, die in Fouqués und Neumanns Zeitschrift ›Die Musen‹, Jahrgang 1814, drittes und letztes Stück (S. 272-293) erschien. Diese Publikation enthält zuerst einen ›Brief des Baron Wallborn an den Kapellmeister Kreisler‹, der von Fouqué verfaßt ist, darauf folgt ›Der Kapellmeister Johannes Kreisler an den Baron Wallborn‹, dessen Vorwort unterzeichnet ist: »Hoffmann, Verfasser der Fantasiestücke in Callots Manier«. Dieser Briefwechsel eröffnet später die ›Kreisleriana‹ im 4. Bande der ›Fantasiestücke‹.
Durch den, nach Ifflands Tode, zum Intendanten ernannten Grafen Brühl, »einen herrlichen Mann«, wurde nun auch die Aufführung der Undine auf dem Berliner Theater wahrscheinlich, um so mehr, als Fouqué der Prinzessin Wilhelm, sowie dem Kronprinzen von der Oper erzählt und beide sich dafür interessieren (H³ II, 136 und 139, K 161).
Einstweilen wurde im Großen Opernhause (am 18. Januar 1815) ein anderes Stück aufgeführt, zu dem Fouqué den Text und Hoffmann die Musik geschrieben: nämlich das zur Säkularfeier des Hohenzollernschen Hauses »gedichtete« Fouquésche Vorspiel ›Thassilo‹, zu dem Hoffmann die Chöre und Märsche gesetzt hatte (K 165).
Mit Brief vom 12. März 1815 (H³ II, 137 ff.) übersandte er Hippeln das erste eben eingetroffene Exemplar des dritten Bandes der ›Fantasiestücke‹ (Bamberg 1814 bei C. F. Kunz), das Märchen ›Der goldne Topf‹ enthaltend. Zugleich meldete er: »So wenig die Juridica anschlagen wollen, so sehr steigt, wider mein Erwarten, mein Ruf in der Litteratur, da die Callots viel Glück gemacht haben. Ich merke dies an den verschiedenen Anträgen, die mir von Buchhändlern gemacht werden … in diesen Tagen habe ich zwei Erzählungen für das Frauentaschenbuch und die Urania gemacht.« Es waren ›Die Fermate‹ und ›Der Artushof‹. Von dem letzteren sagt er, er werde den Freund gewiß interessieren, da die Scene nach Danzig verlegt sei (wo sie einst beide zusammen gewesen waren). »Das Ganze dreht sich um ein wunderbares Bild im Artushof, welches in der Seele eines jungen Kaufmanns den Funken der Kunst entzündet, so daß er sich von allem losreißt und Maler wird.« Die Erzählung wurde eine seiner vorzüglichsten: der Gegensatz des Philisters und des Künstlers ist in den Figuren des Handelsherrn nebst Tochter und des Associés, bei dem der Maler, infolge seines Umgangs mit dem etwas gespenstischen, wahnsinnigen Maler Berklinger Auf die Wahl des Namens Berklinger für den alten Maler war er wohl durch Wackenroders »Tonkünstler Joseph Berglinger« geführt: Tieck hatte grade 1814 (Berlin, in der Realschulbuchhandlung) alles das, was von Wackenroder in den »Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders« und den »Phantasien über die Kunst« (1799) herrührte, neu herausgegeben unter dem Titel ›Phantasien über die Kunst von einem kunstliebenden Klosterbruder‹. Die II. Abteilung (S. 159 bis 244) nehmen hier ›das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Joseph Berglinger‹ und die ›Musikalischen Aufsätze von Joseph Berglinger‹ ein. durchbricht, ist mit poetischer Meisterschaft zur Anschauung gebracht.
Für den vierten und letzten Band der ›Fantasiestücke‹ hatte er inzwischen ›Die Abenteuer der Sylvesternacht‹, sowie die Kreisleriana ›Der Musikfeind‹ und ›Johannes Kreislers Lehrbrief‹ geschrieben: am 24. Mai 1815 meldet er dem Verleger (und zwar von einem »heiligen Orte«, nämlich dem Kammergericht aus, daher auf Foliokanzleipapier): »Den vierten Teil der Callots habe ich in Händen und somit ist nun das ganze Werk geschlossen und gedruckt. Hätte ich gewußt, daß der Teil so unverhältnismäßig stark werden würde, so hätte ich die Blandina, als mein schwächstes Produkt, nicht eingeschoben … Dagegen kann, wie ich glaube, die musikalische Welt mit Kreislers Lehrbrief zufrieden sein« (K 162).
Das erste Stück der ›Abenteuer der Sylvesternacht‹ enthält eine wundervoll geschilderte Scene des Wiedersehens der Geliebten: obwohl er sie Julia nennt, scheinen doch starke wiederaufgelebte Reminiscenzen an Frau Hatt mit hineinzuspielen. Im zweiten Stück trifft er in einem Berliner Keller mit Peter Schlemihl Eine Zeichnung Hoffmanns: der »graue Mann aus dem Peter Schlemihl« ist vor dem elften Bande von ›E. T. A. Hoffmanns ausgewählten Schriften‹ (Stuttgart 1839) in Kupfer radiert. zusammen. Von Chamissos Erzählung ist dann auch die den Schluß bildende ›Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde‹ inspiriert.
In diesem vierten Bande Der 3. und 4. Band haben keine Titelvignette. Eine offenbar für einen dieser Bände bestimmte befindet sich, und zwar in Originalzeichnung, auf der Handschriften-Abteilung der Berliner Königlichen Bibliothek (aus Köpkes Nachlaß). (Bamberg 1815, bei C. F. Kunz) nannte sich Hoffmann auch zum ersten Male öffentlich Amadäus: indem er sich S. 103 vom »reisenden Enthusiasten« (seinem andern Ich) anreden läßt: »Du siehst, mein lieber Theodor Amadäus Hoffmann! Amadäus (und nicht Amadeus) ist der Name auch in der zweiten Ausgabe (1819) gedruckt. daß nur zu oft eine fremde dunkle Macht sichtbarlich in mein Leben tritt.« Bekanntlich berichtet Hitzig (H I, 1), Hoffmann habe ihm auf seine Frage, woher das »A« aus den Titeln der Hoffmannschen Werke komme? erklärt: »es ist ein Schreibfehler auf einem der ersten Manuskripte« – womit also Hoffmann seinen Freund, wie er gern that, mystifizierte. Kunz berichtet dagegen (K 78 f.): auf eine ähnliche Frage seinerseits habe Hoffmann ihm anfangs nicht geantwortet, nach einem Jahre (!) aber »von freien Stücken gestanden, daß er aus unbegrenzter Liebe zu jenem großen Meister (Mozart), dem er Zeit seines Lebens nachzustreben sich bemühe, sich auch dessen Vornamen beigelegt habe«. In dieser ihm von Hoffmann »gestandenen« Vornamensänderung sieht Kunz, beiläufig bemerkt, einen neuen Beweis, daß die Grundlage von Hoffmanns Charakter Egoismus und Eitelkeit gewesen sei!!!
Die Nachricht von Napoleons am 1. März erfolgter Landung regte Hoffmann zu einem patriotischen Fantasiestück an, welches in der bei Duncker & Humblot verlegten Zeitschrift ›Freimütige Blätter in Beziehung auf Krieg, Politik und Staatswirtschaft‹ im 2. Heft (1815) S. 76-92 unter dem Titel: Der Dey von Elba in Paris anonym erschien, seitdem aber gänzlich verschollen war. Im Brief vom 14. Mai 1815 erzählt Hoffmann an Fouqué, daß er zum zweiten Heft der › Deutschen Wehrblätter‹, »die just hier erscheinen sollen«, einen Aufsatz: Der Dey von Elba in Paris geliefert habe (F 135); im Brief vom 18. Julius aber an Hippel erwähnt er den nunmehr erfolgten Druck des Aufsatzes: Der Dey von Elba in den › freimütigen Blättern etc.‹ (H³ II, 147). Der ursprünglich beabsichtigte Titel der Zeitschrift › Wehrblätter‹ war also inzwischen in › Freimütige Blätter‹ umgewandelt worden. Die Zeitschrift, »in zwanglosen Heften«, von der nur der Jahrgang 1815 (vier Hefte, die Vorrede zum ersten ist vom April 1815 datiert) erschienen zu sein scheint, befand sich glücklicherweise auf der Berliner Königlichen Bibliothek und so vermochte ich, in unserm XV. Bande (S. 248 ff.) zum ersten Mal einen Wiederdruck dieses schönen Aufsatzes zu geben. Wie schon in der ›Vision‹ und in dem Dialog ›Der Dichter und der Komponist‹ (oben S. LI) so noch mehr in diesem »Sendschreiben des Türmers in der Hauptstadt an seinen Vetter Andres« zeigt Hoffmann, daß ihm keineswegs das Verständnis für die nationale Erhebung gegen die Napoleonische Zwingherrschaft gefehlt hat.
In dem gedachten Brief an Fouqué kündigt er auch an, daß er jetzt den zweiten Teil der › Elixiere des Teufels‹ Balzac ehrte Hoffmann, indem er an den Titel des 1829 ins Französische (nicht unter Hoffmanns Namen) übersetzten Romans anknüpfend, sein L'Élixier de longue vie für ein verschollenes Werk Hoffmanns ausgab: » c'est une fantaisie due à Hoffmann de Berlin, publiée dans quelque almanach d'Allemagne et oubliée dans ses oeuvres par les éditeurs.« – In Balzacs Roman › Une fille d'Eve‹ tritt ein Kapellmeister des Markgrafen von Anspach, Namens Schmucke, auf, von dem der Dichter sagt: » il appartenait à ces étranges créations qui n'ont été bien dépeintes que par un Allemand, par Hoffmann, le poëte de ce qui n'a pas l'air d'exister et qui néanmoins a vie.« Schmucke hat auch einen Kater, den er ›Mirr‹ getauft hat, » pour glorifier notre grand Hoffmann de Berlin que j'ai beaucoup connu.« – Schmucke ist auch der Musiklehrer der Ursule Mirouet, und die zweite Hauptperson im Roman › Le Cousin Pons‹, wo es von ihm heißt: » Sa religion n'arrivait pas à ce point où elle frise la manie, comme chez les Kreisler d'Hoffmann.« vollenden müsse, der zur Michaelismesse erscheinen solle. Es wurde ihm einigermaßen schwer, da er seine Fantasie durch den bereits gedruckten I. Band (Berlin 1815 bei Duncker & Humblot) festgelegt hatte: deshalb äußert er auch einmal, er hätte den ersten Band nicht gleich drucken lassen sollen, sondern beide auf einmal. Der zweite Teil erschien mit der Jahreszahl 1816.
Das Spukhafte in diesem Roman erscheint weniger glaubhaft als sonst bei Hoffmann, dagegen sind einige Episoden, wie das Leben am Fürstenhofe, glänzend dargestellt, auch die skurrilen Figuren des Schneidermeisters, sowie des Irländers meisterhaft gezeichnet. Über das englische Vorbild des Romans, das Hoffmann angeregt, hat er selbst berichtet; wie er denn überhaupt solche »Quellen« stets selbst gewissenhaft angiebt.
An Kunz meldet er, am 24. Mai, daß er für die ›Elixiere des Teufels‹ »von Duncker & Humblot 80 Friedrichsdor erhalten habe, – bar in blankem Golde.« Zugleich verlangte er von Kunz, für die im Meßkatalog bereits angezeigten ›Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers. Ein Buch für Kenner‹, dessen Manuskript er bis Ende Juli liefern könne, 30 Friedrichsdor. (Das war Kunzen wohl zu viel und so ist das Buch nie erschienen!) Ein Blatt, auf welchem eine ganze Reihe von Themen, die in dem Buche behandelt werden sollten, niedergeschrieben ist, hat sich im Nachlaß gefunden (abgedruckt H II, 145 f.).
Durch das Honorar für die Elixiere, sowie durch eine ihm, neben der immer noch bis auf Urteilsgebühren unhonorierten Arbeit am Kammergericht, zu teil gewordene bezahlte Beschäftigung im Büreau des Justizministeriums, war es ihm inzwischen möglich geworden, »ein gutes Logis« zu beziehen: Taubenstraße 31 (Eckhaus der Charlottenstraße, dem Schauspielhause grade gegenüber), was er an Hippel in dem schon erwähnten Brief vom 18. Juli 1815, mit den Worten meldet: »So siehst du mich, mein teuerster, geliebtester Freund, nach so vielen Stürmen endlich im Hafen.« Von dieser im obersten Stock (2 Treppen hoch) gelegenen Wohnung und der Aussicht aus seinen Fenstern entwarf er, wohl bald nachher, eine humoristische Federzeichnung (in Lithographie reproduziert H³). Wir sehen daraus, daß man von der Treppe aus durch ein Vorzimmer zu dem zweifenstrigen »Prunkzimmer« gelangte, aus diesem führte eine Thür zum dreifenstrigen »Zimmer der Frau« (das Eckzimmer an der Tauben- und Charlottenstraße), die andre Thür führte in Hoffmanns »Arbeitsstube«, aus deren Fenster er selbst mit der Pfeife im Munde herausguckt, über seinem Kopfe steht » Regierungsrath Hoffmann«. In dem daranstoßenden »Schlafkabinett« hat er sich und seine Frau in den nebeneinanderstehenden Betten liegend angedeutet. Ein weiteres »Kabinett« und »Domestiken-Stube« und »Küche« nehmen den Rest der Wohnung ein. Aus dem Fenster der an der Charlottenstraße anschließenden Wohnung guckt ein Kopf heraus, der den Rauch seiner Cigarre in Hoffmanns Gesicht bläst, und über diesem klassischen Profil steht » Schauspieler Devrient«. Das von den beiden Gensdarmenmarkttürmen eingerahmte Schauspielhaus zeigt im Direktionszimmer den Grafen Brühl, wie er drei mit Manuskripten heranstürmende Dichter empfängt; die Köpfe der »Choristen« sind als antike Masken dargestellt; auf der Bühne tanzen zwei Ballettpaare; in der »Restauration des Theaters« stehen zwischen zwei riesigen Gläsern Chambertin und Madera der kolossale Kapellmeister Weber Nicht Carl Maria von Weber, sondern der Berliner Kapellmeister Bernhard Anselm Weber. An Kunz erzählte Hoffmann (15. Dezember 1815): »Mit Weber stehe ich sehr gut, wir trinken zuweilen ein Gläschen johannisberger Schloßwein« (K 165). und der winzige »Kreisler«, der Fußboden ist mit Beefsteaks gepflastert. Auf dem Gensdarmenmarkt und in den angrenzenden Straßen wandeln unter vielen andern auch Figuren aus den ›Fantasiestücken‹ umher: der Student Anselmus und der Konrektor Paulmann (aus dem ›goldnen Topf‹), der Doktor-Dapertutto, Peter Schlemihl und Erasmus Spikher (aus der ›Sylvesternacht‹), auch der Verleger »Kunz aus Bamberg« studiert in Schonerts Restaurant einen durch das halbe Lokal reichenden Weinzettel. Die Taubenstraße entlang fährt »Baron Fouqué aus Nennhausen« in Uniform, mit ungeheurem Dreimaster und Federbusch, in der Markgrafenstraße gehen Bernhardt, Ludwig Tieck und Brentano spazieren. Am obersten rechten Ende des Blattes thront das Kammergericht, in dessen Nähe ein » Anonymus« sitzt, in jener klassischen Situation, in der Goethe Nicolai'n auf Werthers Grabe abgebildet hat. Am untersten linken Ende ist ein Zimmer der Weinstube von ›Lutter & Wegner‹ (Ecke der Charlotten- und Französischen Straße) abgebildet, und Hoffmann und Devrient sitzen sich darin gegenüber. In einem (im Besitze des Verlagsbuchhändlers Geibel in Leipzig befindlichen) Billet Hoffmanns an Devrient hat er als Unterschrift sich und seinen Freund, in ähnlicher Weise wie auf der Federzeichnung abgebildet, ich gebe diese, weit ausgeführtere (zuerst in Koenneckes ›Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Litteratur‹ veröffentlichte) Skizze hier wieder:

Unter den in der großen Federzeichnung figurierenden Bekannten und Freunden Hoffmanns nimmt Clemens Brentano ein besonderes Interesse in Anspruch. Brentano war um die Wende der Jahre 1814/15 nach Berlin gekommen und scheint den Komponisten seiner »Musikanten« zuerst ausgesucht zu haben. Es wird erzählt, daß, als Brentano sich bei Hoffmann melden lassen wollte, die Dienerin den Bescheid gab, der Herr sei sehr krank und könne mit niemandem sprechen. »Das ist mir eben recht,« erwiderte Brentano. »Nun ist es an der höchsten Zeit; deshalb geh' Sie gleich zu Ihrem Herrn hinein und melde Sie ihm, daß der Doktor Dapertutto draußen stehe, der allenfalls auch durch Fenster und Thüren passieren kann.« Nun habe ihn Hoffmann in der That in bester Laune empfangen. (›Aufzeichnungen des schwedischen Dichters P. D. A. Atterbom, übersetzt von Maurer.‹ Berlin 1867, S. 71). Der 4. Teil der ›Fantasiestücke‹ war der einzige, den Brentano gelesen, von den drei ersten kannte er nur Bruchstücke. Er schrieb darüber (3. Februar 1816) an Achim von Arnim: »Ich habe neulich einen Band von den Fantasiestücken des Justizraths Hoffmann gelesen, in welchen wirklich viel Vortreffliches ist … Alles Musikalische drin ist ganz ungemein gründlich und zugleich einfach und lieb wie Asmus« (R. Steig, Achim v. Arnim und Clemens Brentano. S. 344). Auch einen Brief hat Brentano später (1817) an Hoffmann über den 4. Band der Fantasiestücke geschrieben, jedoch nicht abgesendet. Es heißt darin: »Ihr Wesen hat mich lebendig gerührt, vieles war mir, als hätte ich es selbst geschrieben … Ihr › Musikfeind‹ (mir das Liebste) … bin ich ganz … Daß ich unmittelbar an Sie schreibe, ist erstens, weil ich Sie nicht gleich da habe … Etwas drängt es mich, vor allem zu sagen, nämlich ich gratuliere Ihnen mit Erstaunen, daß es Sie alles dies zu sagen drängte. Welch glücklicher Erdenmann sind Sie, mit solcher Lust in den Schnee zu pissen Vgl. Lichtenbergs (eines Lieblingsschriftstellers Hoffmanns) Anekdote von dem Manne, der Voltaires Silhouette in den Schnee pissen konnte., in die Luft zu knallen, den Winterhauch zu betrachten, und selbst den Tabaksrauch, und sich selbst an ein Eisfenster des Lebens anzugestirnen! … [Folgt ein sehr schöner Passus über die › Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde‹, welcher schließt:] Lieber Hoffmann, warum haben Sie Spikher seine Unschuld nicht wieder finden lassen, und zwar durch Jesum? … In der Prinzessin Blandine hat mir vieles sehr gefallen, die Ironie des aus dem Stück Fallens allein schien mir sich überlebt zu haben; ich halte es für frühere Arbeit« (Brentanos Gesammelte Schriften VIII, 235-237).
Den persönlichen Verkehr mit Brentano bezeugt Hoffmanns Brief an Fouqué vom 2. März 1816: »Dieser wahnsinnige Clemens schleppt mich heute Abend … zu einem Souper im englischen Hause«, wo auch Achim von Arnim und dessen Freunde die Gebrüder von Gerlach mittafelten (F 189
Dies ist die einzige mir bekannte Andeutung, daß Hoffmann und Arnim zusammengetroffen sind. In Hoffmanns Werken wird Arnims niemals gedacht. – Heine hielt bekanntlich Arnim für den größeren Dichter, aber Théophile Gautier sagt sehr richtig von Arnim: »
écrivain fantastique, il n'a pas cette netteté à la Callot d'Hoffmann qui dessine d'une pointe vive des silhouettes extravagantes et bizarres, mais d'un contour précis comme les Tartaglia, les Sconroconcolo, les Brighella, les Scaramouche, les Pantalon, les Truffaldin et autres personnages grotesques«.
(›Portraits et Souvenirs littéraires‹.)).
Mit Devrient, der der Federzeichnung zufolge in der Charlottenstraße neben ihm wohnte, hatte Hoffmann die innigste Freundschaft geschlossen, außer Hippel war der große Schauspieler einer der wenigen Menschen, mit dem er sich duzte. Eine in den Hamburger ›Jahreszeiten‹ von 1846 von einem Augen- und Ohrenzeugen berichtete Anekdote über den Verkehr der Freunde möge hier Platz finden: »Die intime Freundschaft der beiden berühmten Männer zeigte sich äußerlich niemals, ja sie zankten häufig miteinander, aber jeder von ihnen verehrte den andern als eine Größe seiner Art. Sie verstanden sich mit einem kurz hervorgestoßenen »Hm!«, einem Augenblinzeln, und Hoffmann war einer der wenigen, auf deren Urteil Devrient wirkliches Gewicht legte. Nach Beendigung der Vorstellung im Schauspielhause begab sich Devrient regelmäßig zu Lutter und Wegner, wo er Hoffmann bereits vorfand, in seinem langschößigen braunen Frack, gelber Nankinghose und geblümter Weste auf dem umgekehrten Stuhle sitzend, die Arme auf die Lehne gelegt und gewöhnlich an den Nägeln kauend. Devrient trat schweigend an ihn heran und Hoffmann – kniff ihn ebenso schweigend ins Bein. Das war seine Kritik. Je stärker er kniff, desto besser hatte Devrient gespielt, desto glücklicher fühlten sich beide und – desto größer wurde die Anzahl der Flaschen auf ihrem Tische. Eines Abends hatte der Künstler in »Heinrich IV.« den Falstaff gespielt und ungeheuren Beifall geerntet. Im Vollgefühl seines Triumphes begab er sich in die Weinstube und trat zu Hoffmann heran, ein gründliches Kneifen erwartend – aber dieser rückte und rührte sich nicht. Aufs höchste verwundert schritt Devrient im Zimmer auf und ab, hin und wieder den Freund streifend, der aber kaute ruhig an seinen Nägeln. In dem Mimen stieg die Wut auf, schneller und schneller stürmte er durch das Gemach, bis er, die Geduld verlierend, mit einem knurrenden »Hm?« den Dichter in die Seite stieß. Da blickte dieser auf und sagte ganz gelassen: »Du hast gespielt wie ein Schwein!« – Außer sich vor Zorn faßte Devrient den andern an der Brust: »Satan, ich zerreiße dich!« – Sich losmachend, erwiderte Hoffmann: »Setze dich und hör' mir zu. Du hast den ersten Teil gespielt wie ein Gott; weil du aber den zweiten Teil ebenso gespielt, so hast du gespielt, wie – ich gesagt habe!« – Devrient saß bei diesen Worten da, wie ein Vogel, der den tödlich magischen Blick der Schlange empfindet; kalte Schweißtropfen perlten auf seiner Stirn. »Bedenkst du denn nicht« – fuhr Hoffmann fort –, »daß Falstaff im ersten Teil meist der Gefoppte und Gehänselte ist, im zweiten Teil aber selber foppt und hänselt und da also ein ganz anderer Kerl sein muß? Das aber hast du nicht hervorgehoben, und darum hast du gespielt wie …« »Teufel!« – unterbrach ihn Devrient, ihn bei den Haaren packend – »Teufel, du hast recht!« – Auf ausdrückliches Verlangen des Künstlers wurde »Heinrich IV.« bald darauf noch einmal gegeben, und nun machte Falstaff seine Sache so gut, daß Devrient mehrere Tage lang mit sonderbarem Lächeln sein Bein rieb …«
In der noch heute in demselben Hause befindlichen Weinstube hängt ein altes Aquarellbild, das Hoffmann und Devrient beim Champagner sitzend verewigt (photographisch vervielfältigt im Verlage von Paul Bette in Berlin erschienen). Das ( H II, 127 und H3 II, 100 erwähnte) »ganze Portefeuille voll charakteristischer Blätter«, bei Lutter & Wegner verkehrende Gäste darstellend, welches sich in jener Weinhandlung befand, ist jetzt leider verschwunden. Von Porträts Berliner Persönlichkeiten sind außer einem Scherzblatte »Chamisso auf dem Nordpol« (in der unten citierten Faksimilesammlung Dorows) nur drei, den in der Berliner Börsenhalle am Spieltisch sitzenden Feldmarschall Blücher (aus Einem Blatte) darstellende Porträts erhalten (H II in Lithographie wiedergegeben).
Am 1. Mai 1816 wurde Hoffmann zum Kammergerichtsrath ernannt, mit 1000 Thlr. Gehalt. Dies Datum beweist, daß die große Federzeichnung früher entstanden sein muß, da er sich auf derselben noch als Regierungsrath bezeichnet.
Am 3. August wurde die »Undine«, und zwar im Schauspielhause, zum ersten Male aufgeführt. Am 29. August wurde sie zum sechsten Male »bei überfülltem Hause« gegeben. »Die Dekorationen«, schreibt der glückliche Komponist an Hippel, »sind das genialste der Art, das ich jemals gesehen«. Sie waren von Schinkel ausgeführt, an den Entwürfen hatte sich aber auch Hoffmann beteiligt. »Alle rühmen die Musik«, heißt es in demselben Briefe, während der Text nicht allgemein gefiel (H3 II, 148 f.). Hinsichtlich der Oper verweise ich auf die ausführlichen Beurteilungen von C. M. von Weber (H II, 376-378), A. B. Marx, Truhn, Ellinger und V. da Motta in den »Bayreuther Blättern« von 1898, Stück VII-IX (mit Notenbeispielen). Dreiundzwanzigmal wurde sie in Jahresfrist gegeben und würde gewiß noch weiter auf dem Repertoir geblieben sein, wenn nicht Dienstag den 28. Juli 1817 das Schauspielhaus mit sämtlichen Dekorationen, Kleidern, Noten etc. zu der am Sonntag zuvor noch gegebenen »Undine« abgebrannt wäre (K 171 und Vossische Zeitung vom 31. Juli 1817). Den Brand und die seiner eigenen Wohnung dabei drohende Gefahr schildert der Brief an Hippel vom 15. Dezember 1817 (H3 II, 154). In den oben erwähnten Aufzeichnungen Atterboms berichtet dieser, wie er Hoffmann aus dem Eckfenster seines Hauses kuckend, vom Feuerschein des brennenden Schauspielhauses beleuchtet, gesehen habe. Zu einer Wiederaufführung der »Undine« ist es nie gekommen, eine neue Oper, zu der Hoffmanns Freund C. W. Contessa nach Calderons El galan fantasma den Text gedichtet, und die bis zum Herbst 1818 komponiert sein sollte – ist nie ernstlich begonnen worden. Die dichterische Thätigkeit hatte nunmehr die musikalische völlig erstickt.
Als erste Berliner Erzählung erschien 1815 in Fouqués Frauentaschenbuch für das Jahr 1816 die schon oben erwähnte köstliche »Kunstnovelle« › Die Fermate‹, die durch ein Bild auf der Berliner Kunstausstellung angeregt wurde. Sie ist ganz heiter und aus dem vollen Künstlerleben gegriffen, von dem Spuk der Elixiere ist gar nichts darin. Gervinus Schüler, der Berliner Professor Wilhelm Scherer, der in seiner »Geschichte der deutschen Litteratur« nur von Hoffmanns »Spukgeschichten« zu berichten weiß, scheint die Fermate – und viele folgende ähnliche Erzählungen – gar nicht zu kennen.
Das erste Buch, das Hoffmann nach den »Elixieren des Teufels« veröffentlichte, gab er mit Fouqué und Contessa zusammen heraus: › Kinder-Mährchen. Von C. W. Contessa, Friedrich Baron de la Motte Fouqué und E. T. A. Hoffmann.‹ Berlin, bei G. Reimer, 1816. Hier erscheint also das berühmte »E. T. A.« zum ersten Mal auf dem Titelblatt eines Buches von ihm. Jeder der drei Verfasser ist durch ein Märchen vertreten: Hoffmann durch den › Nußknacker und Mausekönig‹. Aber auch die künstlerische Ausschmückung des Büchleins rührt von Hoffmann her, wie aus folgendem (im Besitz Hans von Müllers befindlichen) Briefe an den Verleger hervorgeht:
Anliegend übersende ich Ihnen, werthgeschätztester Freund! die fertig gewordenen Anfangs- und Schlußvignetten, sowie die Manuskripte meines und des Fouquéschen Mährchens. – Ich glaube, daß die leichte Aqua tinta Manier die beste zu jenen kleinen Bilderchen seyn wird. So viel möglich, habe ich immer den Titel genau in der Vignette, sowie das Resultat in der Schlußarabeske bezeichnen wollen! –
Schon seit mehreren Tagen bin ich sehr unwohl und vorzüglich heute in einem fortdauernd febrilischen Zustande, dies bringt mich um das so sehr gewünschte Vergnügen, Sie heute Abend zu sehen. –
Sollte es wohl möglich seyn, den Berliner Kindern das Büchelchen noch zu Weihnachten einzubescheeren?
Hochachtungsvoll
der Ihrigste
Hoffmann
d. 16 novbr. 1816
Der Titel jedes Mährchens wird wohl so, wie ich angegeben, über der Vignette gestochen werden können.
Hoffmann war stolz darauf, daß er sich in dem Märchen »nach Gneisenaus Zeugnis als vortrefflicher Militär ( videatur die große Schlacht) gezeigt habe« (H3 II, 152 und K 170). Der in dem allerliebsten Märchen auftretende Obergerichtsrath Drosselmeier ist Hoffmann, der Medizinalrath Stahlbaum Hitzig.
Im Herbst 1816 erschien die schon erwähnte Erzählung ›Der Artushof‹, in Brockhaus ›Urania auf das Jahr 1817‹.
Mit der Jahreszahl 1817 auf dem Titel, aber wohl noch im Jahre 1816, erschienen vier Erzählungen unter dem Titel › Nachtstücke‹ herausgegeben von dem Verfasser der Fantasiestücke in Callots Manier‹ Erster Teil. Berlin 1817. In der Realschulbuchhandlung.
Auf diesen Teil bezieht sich ein (im Besitz Hans von Müllers befindlicher) vermutlich als die erste Erzählung ›Der Sandmann‹ bereits gesetzt war, geschriebener Brief an den Verleger:
Ew. Wohlgeboren haben heute früh, als ich noch im Bette lag, zu mir geschickt, wahrscheinlich, um sich nach dem Manuskript der Nachtstücke erkundigen zu lassen, und ich muß daher recht sehr bitten, es gütigst zu entschuldigen, daß ich nicht schon längst selbst mit Ew. Wohlgeboren darüber gesprochen habe. Bloß Dienstgeschäfte, vorzüglich aber, daß ich außer der Oper ›Undine‹ noch eine andere Komposition für das Theater schnell vollenden mußte, haben die Bearbeitung der Nachtstücke verzögert, jetzt aber arbeite ich schon seit etlichen Tagen unausgesetzt daran, so daß ich den Revierjäger in ein paar Tagen, die beiden übrigen Erzählungen, die schon längst entworfen sind und nur der Feile bedürfen, bis zum Ende dieses Monats bestimmt abliefern werde. Sehr lieb würde es mir seyn, wenn die Korrektur in Leipzig meinem Freunde, dem Doktor Adolph Wagner übertragen werden könnte.
Hochachtungsvoll
Ew. Wohlgeboren
ganz ergebenster
Hoffmann
Berlin
den 9. Febr. 1816
Die Ablieferung des Restmanuskripts verzögerte sich indessen um viele Monate, denn erst mit Billet vom 2. September sendet Hoffmann den »Anfang der letzten Erzählung« und verspricht »bis Donnerstag oder Donnerstag selbst den Schluß bestimmt« (v. Müllers Sammlung).
Von dem Revierjäger haben wir gesehen, daß er schon in Leipzig geschrieben wurde. Auch sandte Hoffmann das Manuskript für den 4. Band der »Fantasiestücke« ein. Kunz fand die Erzählung jedoch »schwach« und sandte sie zurück! Als sie nun in den ›Nachtstücken‹ – wo im letzten Augenblick der Titel in ›Ignaz Denner‹ (Name des zweiten Helden der Erzählung) umgeändert wurde – erschien, schreibt Hoffmann an Kunz: »Lesen Sie doch die ›Nachtstücke‹, worin sich der von Ihnen verschmähte Revierjäger nicht uneben ausnimmt«, (H3 III, 193). Die andern drei Erzählungen des I. Teils der ›Nachtstücke‹ sind, wie sich aus dem obigen Briefe an die Verlagshandlung ergiebt, im Laufe des Jahres 1816 in Berlin geschrieben. Eine prächtige Zeichnung zum ›Sandmann‹ ist in Lithographie reproduziert H II. Alte Märchenmotive sind in der Erzählung verwendet worden. Welche Anregung der ›Jesuiterkirche‹ zu Grunde lag, habe ich schon oben (S. XVIII) angegeben. Veranlassung zum ›Sanctus‹ hat ebenfalls ein wirklicher Vorfall, der sich in Berlin ereignete, gegeben (siehe H II, 135 f.).
Zu Ende des Jahres 1817 kam der II. Teil der › Nachtstücke‹ heraus. Mit Billet vom 28. November 1817 (in der Handschriften-Abteilung der Berliner Königl. Bibliothek) dankt Hoffmann dem Verleger für Übersendung der Autorexemplare. Er hatte an den vier Erzählungen derselben das ganze Jahr hindurch gearbeitet. Schon am 15. Februar quittiert er über »zehn Friedrichsd'or aus Abschlag des für den zweiten Teil der ›Nachtstücke‹ zu erhaltenden Honorars« (Sammlung Hans von Müllers). Am 3. Mai schreibt er an den Berliner Leihbibliothekar Kralowski:
An Ew. Wohlgeboren habe ich qua Dichter ein ganz eignes Anliegen. – Es kommt mir eben mit einer Erzählung beschäftigt, darauf an, mich in den galanten Styl von den Jahren 1740-60 oder auch wohl noch etwas später hineinzudenken. Ohne Original möchte das Portrait unähnlich werden, sollten Sie nicht vielleicht noch irgend einen Roman aus jenen Jahren besitzen? – Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier wäre mir das liebste, aber wo den auftreiben! – Von Ew. Wohlgeboren Güte und Gefälligkeit überzeugt, darf ich hoffen, daß Sie, steht es in Ihrer Macht, dem unglücklichen in schwerem Brüten befangenen Autor mit Rath und That aushelfen werden.
Hochachtungsvoll
Hoffmann
d. 3ten May 17.
Die Erzählung, auf welche sich dies (ebenfalls in v. Müllers Sammlung befindliche) Billet bezieht, ist die letzte der Nachtstücke: ›Das steinerne Herz‹ (siehe S. W. III, 264). Hoffmann sandte, mit Brief vom 15. Dezember 1817, diese zweiten Nachtstücke »als Weihnachtsgabe« an Hippel und schrieb dazu: »Dir insbesondere empfehle ich die ostpreußische Geschichte vom Majorat, die vielen Beifall erhält, und wie mich dünkt, mit Recht. – Erheitere Dich vom ernsten Geschäft und lies meine Allotria wie der Staatskanzler, der ordentlich was darauf hält« (H³ II, 152 f.). An Kunz schrieb er, am 8. März 1818: »Im zweiten Teil der ›Nachtstücke‹ empfehle ich Ihnen das › Majorat‹ und das › Gelübde‹; das › öde Haus‹ taugt nichts, und das ›steinerne Herz‹ ist so – so! (K 170).
Über die Anregung zum ›Majorat‹ habe ich schon oben (S. XVI) das Nötige gesagt. Das in Polen spielende ›Gelübde‹ beruhte auf Mitteilungen von Hoffmanns Gattin. »Das öde Haus« war das Berlin Unter den Linden Nr. 9, neben der Nr. 8 befindlichen berühmten Fuchsischen Konditorei gelegene, dessen stets geschlossene Läden Hoffmanns Fantasie beschäftigten. (Die Hausnummern sind festgestellt von Julius Rodenberg: ›Deutsche Rundschau‹ vom Januar 1888, S. 104). Der in der Erzählung auftretende »Graf P.« ist niemand anders als der (später gefürstete) Pückler, auf dessen Beziehungen zu Hoffmann ich alsbald zurückkomme.
Ebenfalls Ende des Jahres 1817 erschien der zweite Teil der ›Kindermärchen‹. In dem oben citierten Billet vom 28. November bittet er um noch 10 Autorexemplare der Märchen, da er bisher nur 2 erhalten. Von den erbetenen 10 Exemplaren will er je 4 an Fouqué und Contessa geben.
Das Hoffmannsche Märchen in diesem zweiten und letzten Teile war betitelt: › Das fremde Kind‹. Er schickte das Buch ebenfalls an Hippel und an Kunz schrieb er: »ich empfehle Ihnen mehr [als das vorjährige] mein diesjähriges Märchen … Es ist reiner, kindlicher und eben deshalb für Kinder, fassen sie auch nicht die tiefere Idee des Ganzen, brauchbarer« (K 170). Die 6 Vignetten dieses Bändchens rührten wieder von Hoffmann her.
Im Jahre 1817 erschien endlich noch in Fouqués Frauentaschenbuch für das Jahr 1818: »Ein Brief von Hoffmann an Herrn Baron de la Motte Fouqué«. Unter Bezugnahme auf Le Sages hinkenden Teufel (inbesondere die Scene zwischen dem Studenten Don Cleofas … und dem hagern Mann) entschuldigt sich Hoffmann, daß er diesmals nichts liefern könne, wie 1816 die Fermate, denn »solcher Erfahrungen im Leben und solcher Zufälle, daß man eben diese Erfahrungen in heitern Farben gemalt wiederfindet, giebt es überhaupt wenig« …
»Eben habe ich wie Rameaus famoser Neffe, an die Stirne geklopft … und … gefragt: Ist denn niemand zu Hause? – Aber keine Antwort! –«
Schließlich liefert er aber doch, im Postskriptum (S. 224-263) die Erzählung vom Rath Krespel, die später ohne besondre Überschrift in die ›Serapionsbrüder‹ aufgenommen wurde. Der Rath Krespel ist identisch mit dem in Goethes »Dichtung und Wahrheit‹ erwähnten Frankfurter Sonderling.
Aus der zweiten Hälfte des Jahres 1817 haben wir einen interessanten Bericht über den Verkehr des bekannten dänischen Dichters Adam Oehlenschläger mit Hoffmann erhalten. In Oehlenschlägers ›Lebenserinnerungen‹ (Leipzig 1850) sind im III. Bande »Auszüge aus meinen Reisebriefen 1817« mitgeteilt, wo es (S. 200) heißt: »Ich habe Hoffmanns Bekanntschaft gemacht. Seine Erzählungen sind trotz des Konvulsivischen und Entsetzlichen, das zuweilen zur Manier wird, voll von poetischem Feuer, einer starken Fantasie und von Humor. Er ist Regierungsrath, klein, mager. Er zeigt in seiner Unterhaltung viel Verstand. Er ist auch ein guter Musiker und hat Fouqués Undine [in Musik] übersetzt. Er und der Buchhändler (später Kriminaldirektor) Hitzig luden mich ein, mit ihnen in einer Restauration zu essen, wo ich auch Berlins größten Komiker Devrient fand.«
Noch interessanter ist die folgende Stelle (S. 203 f.): »Vor kurzem kam Fouqué sieben Meilen weit von seinem Gute her, um meine Bekanntschaft zu machen. Hoffmann bat uns, diesen Abend bei ihm zuzubringen, und so hatten wir drei nun wirklich einen echten Dichterabend … Hoffmann, ein burlesker, fantastischer Gnome, mit vielem Verstand, stand mit einer weißen Schürze wie ein Koch da, und bereitete Cardinal aus Rheinwein und Champagner. Der Pokal ging unablässig umher; wir erzählten uns einander kleine abenteuerliche Geschichten … Während wir bei solch gräßlichen Geschichten dasitzen und die Fantasie durch Cardinal erhitzen, wende ich den Kopf zur Seite und sehe – einen kleinen schwarzen Teufel, mit einem Horn auf der Stirn, und einer roten Zunge aus dem Munde hängend, sich über meine Schulter beugen. Es war dies eine Marionettenpuppe, die Hoffmann gekauft hatte (er hat den ganzen Schrank voll), mit der er manövrierte, um mich in einem grausigen Märchen zu erschrecken. Einmal erzählte Fouqué etwas und nun setzte Hoffmann sich ans Klavier, akkompagnierte Fouqués Erzählung und malte alles mit Tönen aus, je nachdem es grausig, kriegerisch, zärtlich oder rührend war, und das machte er ganz vortrefflich.«
Unter der Jahreszahl 1818 erschien von Hoffmann im 2. Bande von Stephan Schützes Sammelwerk ›Der Wintergarten« (Frankfurt bei Wilmans), die Erzählung › Ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde‹: eine ächte Berliner Novelle, die, wie Ritter Gluck, in den Zelten des Tiergartens beginnt, deren Centrum aber die Neue Grünstraße mit einer daselbst wohnenden charmanten Berliner Geheimrathstochter ist, auch fehlt nicht etwas hineinspielender Spuk einer als alte Jungfer verstorbenen Tante, ebensowenig ein wahnsinniges Original u. s. w. In den Zelten findet die mit heiterstem Humor vorgetragene Geschichte ihren Schluß.
Der Herbst des Jahres brachte in den Taschenbüchern drei weitere Erzählungen.
Erstens erschien in dem von demselben Schütze herausgegebenen ›Taschenbuch der Liebe und Freundschaft für 1819‹ (Frankfurt, Wilmans) die Erzählung › Doge und Dogaressa‹: die aus Anlaß eines Bildes der Berliner Kunstausstellung trefflich erzählte Geschichte des Marino Falieri. Nichts Spukhaftes kommt darin vor, was den Professor Scherer nicht abhielt, nur von »Hoffmanns Spukgeschichten« zu sprechen.
Sodann eröffnete die Erzählung › Meister Martin der Küfner und seine Gesellen‹ das von Fr. Kind herausgegebene »Taschenbuch zum geselligen Vergnügen a. d. J. 1819« (Leipzig, Gleditzsch). Diese klassische Erzählung ist wieder keine Spukgeschichte, sie wird daher von Scherer völlig ignoriert. Richard Wagner Über die Beziehungen zwischen Hoffmann und Richard Wagner überhaupt vgl. Hans von Wolzogens Aufsatz »E. T. A. Hoffmann, der deutsche Geisterseher« in den ›Bayreuther Blättern‹ Jahrg. XVI., XVII und XVIII (1893-95). wurde durch den Nürnberger Böttchermeister zu seinen ›Meistersängern‹ angeregt.
Endlich erschien in Brockhaus »Urania auf das Jahr 1819«: › Der Kampf der Sänger. Einer alten Chronik nacherzählt‹. Er hatte diese Erzählung bereits im Frühjahr 1818 abgeliefert, denn in einem Briefe an Brockhaus Die Unterschrift dieses Briefes ist oben (S. VII) im Faksimile wiedergegeben. vom 7. Mai 1818 (in v. Müllers Sammlung) heißt es: »Ew. Wohlgeb. würden mich innigst verbinden, wenn Sie die Gewogenheit hätten, das Honorar für die Erzählung, der Kampf der Sänger an den Buchhändler F. Dümmler dahier … zu assigniren.« Die Figur des Heinrich von Ofterdingen in dieser Geschichte hat gar nichts mit Novalis zu thun, den Hoffmann übrigens ebenso wie Heinrich von Kleist und Tieck sehr hoch hielt. Richard Wagner wurde durch Hoffmanns Sängerkrieg (wie andrerseits durch Heinrich Heines im III. Bande des ›Salons‹ (1837) mitgeteilte Tannhäuserlieder) zu seinem ›Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg« angeregt. Hoffmanns Klingsor erscheint dann im ›Parsifal‹.
Das Ende des Jahres 1818 brachte das von köstlichem Humor getränkte Büchlein › Seltsame Leiden eines Theaterdirektors‹ (Berlin, 1819 in der Maurerschen Buchhandlung). Die Jahreszahl auf dem Titel wird auf der üblichen Vordatierung beruhen, denn die »E. T. A. Hoffmann« unterzeichnete Vorrede ist vom Oktober 1818 datiert. Dieser Dialog zweier Schauspieldirektoren – es sind Hoffmann selbst und Holbein gemeint – war schon vorher im »Dramaturgischen Wochenblatt« gedruckt gewesen. Die erste Veranlassung zur Niederschrift hatte die Weigerung des Bassisten Joseph Fischer in der Undine zu singen gegeben. Nach Gubitz Bericht (a. a. O. II, 87 ff.) hätte Fischer erklärt: er singe den Kühleborn nicht »aus dem Grunde, weil unsangbar sei, was der Herr Kammergerichtsrath dem Sänger in Noten vorlege«. Hoffmann schreibt darüber zur Zeit des ersten Abdrucks an Fouqué (3. April 1817), er habe seine Galle, die durch die Unarten und Unziemlichkeiten des Schauspielervolks erregt sei, in diesem Gespräch ausgesprützt: »Brühl ist molto contento – Fischer kommt übel weg!« (F 144). Hoffmann scheint dem arroganten Sänger auch später noch seinen Groll haben fühlen lassen. Gubitz erzählt: am 20. Februar 1818 habe Fischer in ›Figaros Hochzeit‹ die Arie
Dann vergiß leises Flehn, süßes Wimmern
gesungen, sie sei da capo verlangt, der Sänger sei dem Verlangen des Publikums aber nicht nachgekommen, worauf er bei seinem Wiederauftreten in der nächsten Scene »ausgepocht« worden sei.
Als Fischer dann am 18. März in einer zu Gunsten des »Vaterländischen Vereins« veranstalteten Matinee des Opernhauses in dem Intermezzo › Il Geloso‹ wieder singen wollte, wurde er mit einem solchen Lärm des Publikums empfangen (man rief »Niederknieen! Abbitten! etc.«), daß er überhaupt nicht singen konnte. Er verließ dann bald darauf Berlin.
Nun behauptet Gubitz, der als Ehrenmitglied des »Vaterländ. Vereins« bei jener Matinee mitwirkte: hinter dieser ganzen »Intrigue« gegen Fischer habe »der Kammergerichtsrath Hoffmann-Callot« gesteckt, der auch am 17. März »in den Zeitungen« darauf hingewiesen, daß einst der französische Schauspieler Michel Baron auf der Bühne knieend habe Abbitte leisten müssen.
Am 18., vor der Matinee, habe er, Gubitz, »den Bericht empfangen, daß Hoffmann mit dem Schwarm seines Anhangs im Weinhause bei Lutter & Wegner sei, alle sich feierlichst verbündet hätten, Fischer nicht singen zu lassen.« Und um 11 Uhr sei ihm Hoffmann »mit seinem Troß« auf dem Gange hinter den Parquetlogen begegnet und habe ihm höhnisch zugerufen: »Sie glauben doch nicht, daß wir dies Intermezzo dulden?«
So viel wird wohl richtig sein, daß Hoffmann sich an den Demonstrationen gegen den anmaßenden Sänger beteiligt hat – aber wer wird ihm, der zuerst gereizt war, daraus einen besondern Vorwurf machen? » I love a good hater«, sagte Samuel Johnson.
Das Jahr 1819 eröffnete er mit der Märchendichtung › Klein Zaches, genannt Zinnober‹ (Berlin 1819. Bei Ferdinand Dümmler), in welcher besonders die Satire aus den darin vorkommenden Duodez-Hof (die Schaffung eines besondern Ordens für den Helden, Creirung von Hofchargen etc.) köstlich gelungen ist. Den Namen des eine Hauptrolle in der Geschichte spielenden Doktor Prosper Alpanus hat Hoffmann wohl einem italiänischen Arzte entlehnt (siehe Prosperi Alpini ›De praesagiende vita et morte aegrotantium‹ Padua 1601) und desselben › Medicina Aegyptiorum‹ ( Venezia 1591). – Die Scene, wie Alpanus auf der Leiter herauf und herabspringt, um die Folianten herbeizuschaffen, beruht auf einem persönlichen Erlebnis Hoffmanns (siehe H3 III, 139). Wir wissen diesmal das Erscheinungsdatum des Büchleins auf den Tag, ja den Augenblick: wie aus einem Briefe Hoffmanns an den Grafen Pückler hervorgeht. Ich freue mich, diesen Brief, der selbst ein kleines Kabinettsstück Hoffmannschen Humors ist, hier mitteilen zu können. Er lautet (nach dem auf der Berliner Kgl. Bibliothek verwahrten) Original:
HochGebohrner Herr Graf!
Es ist wohl schon eine geraume Zeit her, als Sie, Hochverehrtester Herr Graf! mich auf eine Art nach Muscau einluden, die mich nicht anders als recht tief ins Gemüth hinein erfreuen konte, da sie mir aufs neue die freundschaftliche Beachtung bewies, der Sie mich während Ihres Aufenthalts in B. werth hielten. Mein innigster Wunsch war, Ihrer gütigen Einladung folgen zu können; das Hochlöbliche Kammergericht hielt mich aber bey den Rockschössen fest oder vielmehr, es ging mir mit meinem Urlaubsgesuch ebenso, wie jenem Kranken vor dem Teich zu Bethesda in der Bibel, der immer zu spät kam, wenn der Engel das Wasser bewegt hatte, immer war schon ein andrer vor ihm hineingesprungen! –
Später schrieb ich an Sie, Hochverehrtester Herr Graf! einen langen sehr verwunderlichen Brief. – Es war darin viel von der deutschen Kirche auf dem Gens d'Armes Platz die Rede, in die mich der Zufall, der die Laune hatte, sich in die Uniform eines Polizeyinspektors zu werfen, hineinführte, als eben eine sehr feierliche Trauung eines überaus schönen Paars vollzogen wurde. Aber unter allen Lichtern, Sternen, goldnen und silbernen Blitzen, suchte mein Geist, sich dazu meiner leiblichen Augen bedienend, jenes höchst interessante Mädchen, mit der ich einst das Glück hatte, auf einer wüsten Insel zusammen zu kommen und ihr zu beweisen, daß der zarte keusche Schaum des sphärischten aller Weine, nehmlich des Champagners, von Rosen lippen genippt (mit weniger Mühe läßt sich das in Verse bringen) jeden Kopfschmerz der Inhaberin jener Lippen verscheuche! – Es war ferner die Rede von einem glänzend erleuchteten Hochzeitshause und von den verlockenden Seufzern einer Musik, in der die Clarinetten, Flöten und Hoboen selbst in Françoisen und Gavotten nichts weiter sprachen als: Bald bist du mein – mein – mein! Wie ich mich hingesetzt, erzählte ich ferner, in tiefer Dämmerung etwas somnambül gestimmt auf einer schnöden Bank unter den Linden und wirklich ganz öffentlich in conspectu omnium nur von einiger Nacht und den nicht brennenden Laternen, so wie dem blendenden Glanz des Hochzeitshauses geschüzt mit einem seltsamen Mann, der sich bey mir eingefunden, eine Flasche Champagner leerte. (Der Restaurateur Jagor hatte sie nebst dem erforderlichen Trinkgeschirr höchst eigenhändig oder vielmehr eigentaschig herbeygebracht.) Der seltsame Mann erzälte mir die wunderbarsten Dinge. Am Ende war's ein alter Bekannter, nehmlich Ahasverus, der ewige Jude! – Noch viel mehr stand in dem Briefe, als ich ihn indessen absenden wollte, erfuhr ich, daß Sie, Hochverehrtester Herr Graf! sich auf weiten Reisen befänden. Ich schickte den Brief daher nicht ab und glaube aus diesem Grunde mit Recht vermuthen zu können, daß Sie ihn nicht erhalten haben. –
Eben erfahre ich durch den G. R. Koreff, daß Sie Hochverehrtester Herr Graf! Sich wieder in Muscau befinden und ich beeile mich Sie auf das angelegentlichste um die Fortdauer Ihres gütigen Wohlwollens zu bitten.
Sie fanden einiges Wohlgefallen an meinen schriftstellerischen Versuchen, eben in dem Augenblick hat ein Mährchen von mir die Presse verlassen, das, wie mir scheint, die Geburt einer etwas ausgelassenen ironisirenden Fantasie ist. Ich überreiche Ihnen, Hochverehrtester Herr Graf dies Fantasiestück, den kleinen Zinnober und empfehle den humoristischen Wechselbalg Ihrer Protektion. Damit sich das Buch als Autorexemplar bewähre, habe ich einige Druckfehler mit Bleystift herauskorrigirt. Zinnobers Portrait auf den Deckel ist sehr ähnlich, denn da sonst niemand den Kleinen zu Gesicht bekommen konnte als ich selbst, so verfertigte ich auch selbst die Zeichnung.
Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung habe ich die Ehre zu seyn
Hochgebohrner, hochverehrtester Herr Graf
Ihr ganz gehorsamster
Hoffmann.
Berlin
d. 24. Januar 1819
Da von den Beziehungen Hoffmanns zu Pückler in den bisherigen biographischen Darstellungen nichts verlautet Indessen hat Kunz seine ›Erinnerungen‹ an Hoffmann dem Fürsten Pückler gewidmet, »dem Verstorbenen, dessen Grabesstimme sie ins Leben rief« (K XI)., so möge hier auch die (im Koncept erhaltene) Antwort des geistreichen Mannes folgen:
Bester, höchstverehrter Herr Kammer-Gerichts-Rath
Wie viel Freude mir Ihr freundliches Andenken und Uebersendung Zinnobers gemacht hat, werden Sie kaum glauben, da Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, wie sehr ich Sie liebe und mich wie ein Eisen-Stäubchen vom Magnete, zu Ihnen mit einer Gewalt hingezogen fühle, daß ich es Kopf unten, Kopf über nennen würde, wenn ich nicht zugleich fühlte, es sey noch passender zu sagen: Kopf unten, Herz über, weßhalb ich auch bitte, diese meine Antwort mehr mit dem letzten als mit dem ersten zu beurtheilen.
Bis jetzt habe ich von Zinnober noch nichts gelesen, nur mich blos am Umschlags-Kupfer ergözt, den alten Bekannten aber gleichfalls sprechend ähnlich gefunden, denn um etwas weit auszuhohlen Caesar (versteht sich nicht der Welt-Eroberer in bello gallico, sondern nur der Preußische Husaren-Rittmeister dieses Namens aus dem Aachner Congreß, wo es so manche Gelegenheit gab, sich an Klein-Zaches zu erinnern, wer nehmlich vorher etwas von ihm wußte), Caesar also verfolgte mich schon damahls, um mir die Geschichte des kleinen Mannes zu erzählen. Ich hielt mir aber standhaft die Ohren zu, und wollte mir keine Freude der Ueberraschung verderben lassen, obgleich der Versucher mir zu wiederhohltenmahlen versicherte: Zinnober sey ein solcher Ausbund, daß er gar nicht das Licht der Welt werde erblicken dürfen. Es muß eine Ahndung des mir bevorstehenden, nun so angenehm Eingetroffenen gewesen sein, der mich stärkte, meine Neugierde zu zähmen, und wie froh bin ich, daß er jetzt [kommt], da ich von Klein-Zaches nichts weiter weiß, als daß er Minister gewesen ist, ein Umstand, den er mit so viel andern Ministern gemein hat, daß dem Interesse dadurch nichts abgebrochen werden kann. Sie aber, Verehrtester Herr Kammer-Gerichts-Rath, sehe ich als den Potentaten an, der ihn abschickte, und da er mir eben ein von seinem Herrn eigenhaendig geschriebenes und was bei Souverainen noch seltner ist, sogar höchstselbst verfaßtes Creditiv überreicht hat, so wird er hier am Hofe, obgleich noch unbekannt, schon als einheimisch angesehen, und zu den andern Lieblingen der Phantasie und Nacht in des Teufels Küche logirt. Bey der ersten Audienz wollen aber einige Damen durchaus gegenwärtig seyn, die sich schon nach Erblickung des blosen Portraits so sehr in den Gesandten verliebt haben, daß ich ihn kaum vor schleuniger Entführung aus ihren schönen Händen retten konnte. Alle drey sind alte Bekanntinnen, und wenn ich nicht irre, war die Eine mit Ihnen, Hochverehrtester, auf der wüsten Insel Champagner nippend. Bey dieser Anspielung muß ich Ihnen nun rund heraussagen, daß der lange Brief, von dem Sie im Auszuge davon sprechend, uns lüstern machen, Ihnen gar nicht erlassen werden kann; man fühlt sich durch gewisse Ausdrücke zu sehr geschmeichelt, um nicht auf das Ganze höchst begierig zu sein, und wie mir scheint, eignen sich zwey den Preis zu, der doch nur Einer gelten kann.
Suchen Sie nun dem Kammergerichte diesmahl zuvorzukommen, und lassen Sie sich von mir mitnehmen, wenn ich im Frühling von Berlin, wo ich in 14 Tagen einzutreffen gedenke, wieder nach Muskau zurückkehre. Um meiner bis dahin zu gedenken, schicke ich dem neuen Callot ein kleines Bild des Alten, sonderbar genug an vielartiger Gestalt sich in Nebel und Duft phantastisch verlierend. Die Rückseite giebt auch eine Federprobe Callots und die naiven alten Worte gelten wieder für den Empfaenger.
Schloß Muscau
den 2ten Februar 1819.
Am 27. Januar sandte er das Buch auch an Hippel und nannte ›das tolle Märchen‹ im Begleitbriefe »das Humoristischte, was ich geschrieben« (H3 II, 156).
Im Laufe des Jahres 1819 wandte sich sein alter Verleger Kunz an ihn, um sich einen Beitrag für eine in Bamberg zu gründende belletristische Zeitung zu erbitten. Hoffmann sandte ihm eine humoristische Erzählung in Briefen, betitelt › Haimatochare‹, im Vorwort berichtete er, daß ihm Chamisso diese Briefe von seiner Weltreise mitgebracht hätte. Dies war aber nur ein Scherz, denn die Erzählung ist zweifellos von Hoffmann, wenn sie auch auf Grund Chamissoscher Reise-Mitteilungen entstanden ist. Da diese Humoreske, weil aus der Kunzschen Zeitung nichts wurde, erst im zwölften Bande der ›Ausgewählten Schriften‹ (Stuttgart, Brodhag 1839) gedruckt ist, so habe ich mit ihr die ›Letzten Erzählungen‹ Unter diesem Titel hatte Hitzig (1825) und Hoffmanns Witwe (1839) die Erzählungen Hoffmanns, welche auf die Sammlung der ›Serapionsbrüder‹ folgten, herausgegeben. im XIII. Bande unsrer Gesamtausgabe eröffnet.
Als zweiten Beitrag für jene Zeitung hatte Hoffmann einen › Brief des Kapellmeisters Johannes Kreisler‹ übersandt, der dann ebenfalls a. a. O. zuerst gedruckt wurde: ich habe diesen humorvollen Brief im XV. Bande wiederholt.
Ebenfalls im Jahre 1819 sandte Hoffmann an Kunz einen Weinreisenden mit einem Empfehlungsbrief ohne Datum, der (a. a. O. zuerst gedruckt) ein so köstliches Produkt Hoffmannscher Laune ist, daß ich ihn, zumal jene Sammlung von 1839 vergriffen ist, hier einfüge:
Verehrungswürdigster!
Der Ueberbringer dieser Zeilen ist ein reisender Voyageur auf höchst sublime Weine, der namentlich einen Chambertin führt, wie ich ihn seit den schönen Tagen in Aranjuez mit Ihnen kaum getrunken. Auch solchen Champagner Silleri – von nobelster Physiognomie – wie er ihn führt, ich fand ihn nie – was sagen dazu Sie – verehrter Weinzahn! Wie?
Aber in vollem Ernste, Vortrefflichster! darf ich Ihnen nicht nur den Wein des Mannes, sondern den Mann selbst empfehlen, und sollte es mich freuen, wenn Sie ihm dorten etwas Angenehmes erzeigen könnten. Devrient, der eben mit mir ist, und über der Achsel diese Zeilen liest, vereinigt seine Bitte mit der meinigen. Klingen Ihnen nicht die Ohren vom Dreiklang der Gläser? Wir stoßen so eben – den Voyageur mit eingerechnet – auf Ihr Wohl an, und flehen zum Himmel, daß er Ihrer Zunge und Ihrem Bauche ferneres Gedeihen schenken möge. O wären Sie doch im Augenblick hier, – ein Vierter im Bunde!
Nachdem ich die Feder niedergelegt, eine dritte Flasche herbeigeholt wurde, unterhielten Devrient und ich – er von seinem Zusammenleben in Dessau mit Ihnen, ich von dem meinigen, mir unvergeßlichen, in Bamberg – den Nektarlieferanten, der, beiläufig gesagt, ein ebenso großer Theaterenthusiast ist, als Sie es früher waren, wohl eine Stunde. Ich machte ihn einstweilen mit allen Orten bekannt, wo wir im seligen Selbstvergessen himmlisch geschwärmt, und wo so manche Idee zu meinen nachherigen Schriften keimte. Sie müssen nämlich wissen, der Mann hat an meinen Schriften einen wahren Narren gefressen, und alles ist ihm an mir merkwürdig, selbst der Knopf von meinem Frack, den mir Devrient in der Zerstreuung soeben spielend abgedreht, und den ich ihm verehre. Der Enthusiast wird Ihnen bei seiner Dahinkunft solchen vorzeigen. Zeigen Sie ihm dagegen meine in glücklichen Stunden, vis à vis von Ihnen, entworfenen Handzeichnungen, namentlich Werner, die Söhne des Thales vorlesend, – die Bleistiftzeichnung, wie Professor Pfeufer ein Bläschen auf dero Zunge untersucht – die ditto der Umstülpscene auf dem Balle u. s. w. Zeigen Sie ihm auch die Wege und Steege, die wir durch den romantischen Park, nach dem eben so romantischen Bug gemeinschaftlich so oft gewandelt, die Statue des heiligen Nepomuk, von der aus ein gewisser » Berganza« entstand, das Ihnen hinterlassene große Familienbild u. s. w. Lesen Sie ihm auch, wenn Sie gemüthlich dazu gestimmt sind, die Scene aus Tiecks Zerbino im Dichtergarten vor, die, seitdem ich sie von Ihnen nicht mehr hören kann, ich nicht mehr lesen mag; theilen Sie ihm Ihre grandiose Auffassung des Wallenstein mit, rezitieren Sie ihm wo möglich mit Ihrem göttlichen Organe »die Sterne lügen nicht!« – »Max bleibe bei mir!« u. s. w. u. s. w., und sagen Sie ihm vor allem, daß Sie mich nicht vergessen. Und nun addio amico porchissimo tempo finito questo di reni de la bucca!
Der Ihrigste
Hoffmann.
Einen Handkuß ihrer lieben Frau wird vielbesagter Voyageur in meinem Namen zierlichst selbst applizieren. Kanzler Flessel grüßt inständigst und bittet um Entschuldigung, daß er nicht eigenhändig diesem Briefe eine Nachschrift geben kann, da er diesen Abend, an welchem ich den Brief siegele, mit einem gewissen Shylock auf einen Schweinebraten eingeladen. Er bedauert sehr, daß Sie nicht dabei sein und so thätigen Anteil nehmen können, als damals in Dessau, wo Sie ihn der Bühne wieder gaben. Ja, ja theuerster Freund! wir wissen, was wir wissen, wenn wir uns der schönen Tage in Aranjuez erinnern.
(Über die in diesem Briefe erwähnten 3 Zeichnungen siehe oben S. XLIII. Das kauderwelsche Italiänisch am Schluß des Briefes ist eine Bamberger Reminiscenz: mit solchen Brocken hatte Hoffmann oft, wenn er sich von Kunz nach einer Abendkneiperei trennte, ihm Lebewohl zugerufen. Was die Bezeichnung Devrients in der Nachschrift als »Kanzler Flessel« betrifft, so ist dies eine Rolle in den ›Mündeln‹ von Iffland, in der Devrient einst in Dessau auftrat, und deren Gelingen ihn bestimmte, den schon gefaßten Vorsatz, der Bühne zu entsagen, wiederaufzugeben.)
Im Herbst des Jahres 1819 brachten die Taschenbücher wieder vier Hoffmannsche Erzählungen. Im ›Taschenbuch zum geselligen Vergnügen auf das Jahr 1820‹ erschien › Signor Formica. Eine Novelle.‹ Ausnahmsweise hat Hoffmann diesmal seine Quelle nicht besonders angegeben: es ist Salvator Rosas Biographie von Passeri, wo das Auftreten Salvators während des römischen Karnevals von 1639 unter der Maske des Formica berichtet wird (siehe Satire di Salvator Rosa illustrate da G. Carducci [Firenze 1860] p. XVI sq.) Das Manuskript der mit schönstem Humor durchgeführten Novelle hat Hoffmann schon im Frühjahr dem Verleger des Taschenbuchs eingeliefert, wie aus folgendem Briefe (aus v. Müllers Sammlung) hervorgeht:
Ew. Wohlgebohren erhalten in der Anlage die versprochene Erzälung mit der gehorsamsten Bitte es entschuldigen zu wollen, daß sie etwas zu lang gerathen, ich hoffe indessen, daß sie nicht langweilig ausgefallen seyn wird. Gönnen Sie mir diesmal ein größeres Plätzchen, künftig werd' ich mich bescheiden zu beschränken wissen.
Nach genauer Berechnung wird mein Manuskript zu 9 Druckbogen ausreichen und würde es mir sehr erfreulich seyn, wenn Sie die Güte hätten, das stipulirte Honorar a 3 Frdor p. Bogen mir baldigst zu übersenden.
Meine hiesigen Freunde haben sehr günstig über meine Arbeit geurtheilt und so wird sich wohl Signor Formica doch nicht ohne Noth so breit gemacht haben.
Hochachtungsvoll
Ew. Wohlgeb.
ganz ergebenster
Hoffmann.
Berlin
d. 27 März 19
Im ›Taschenbuch der Liebe und Freundschaft f. d. J. 1820‹ erschien sodann › Das Fräulein von Scuderi‹. Diese historische, psychologisch vertiefte Kriminalnovelle ist, wie Signor Formica, ohne eine Spur von Spuk oder Wahnsinn: daher beide Novellen von Scherer als nicht vorhanden betrachtet werden, nach ihm mußte Hoffmann ja nur ›Spukgeschichten‹ geschrieben haben. Ludwig Devrient ging seinen Freund vergebens an, die Geschichte zu dramatisieren, damit er den verruchten Goldschmidt spielen könne. (Später hat Otto Ludwig eine Dramatisierung versucht).
Die in der ›Urania auf das Jahr 1820‹ erschienene Erzählung › Spielerglück‹ (auch keine »Spukgeschichte«) ist schon oben (S. XX) auf ein wirkliches Erlebnis Hoffmanns zurückgeführt.
Endlich brachte der ›Berlinische Taschenkalender‹ auf das Gemeinjahr 1820 (herausgegeben von der Kgl. Preuß. Kalender-Deputation) die »Berlinische Geschichte« › Die Brautwahl‹. Das Hineinragen des Spuks in die Alltagswelt ist hier ebenso glücklich wie im ›goldnen Topf‹ dargestellt, noch ergötzlicher als in jenem Märchen ist die Satire auf die deutsche Titelsucht durchgeführt. Namentlich der erste Teil der Geschichte, – die Scenen vor dem Berliner Rathaus, die Kneiperei in dem Weinhaus an der Spandauer Straße u. a. – gehört zum schönsten, was Hoffmann gedichtet.
Gegen den Schluß des Jahres 1819 kamen die ersten beiden Bände seiner »gesammelten Erzählungen und Märchen‹ unter dem Titel › Die Serapionsbrüder‹ (Berlin 1819. Bei G. Reimer) heraus. (Als Voranzeige des Buches waren Proben daraus im ›Freimütigen für Deutschland‹ 1819, Nr. 4, 6, 8 erschienen). Über die Veranlassung der Titelgebung hat der Dichter sich im Vorwort ausgesprochen: die dort erwähnten Freunde waren Hitzig (der im Buche als Ottmar erscheint), der Arzt Dr. Koreff (Vinzenz), Contessa (Sylvester). Sie kamen einmal wöchentlich teils in Hoffmanns Wohnung, teils im Wirtshause zusammen, ab und an wurden in diesen kleinen litterarischen Klub auch Fremde eingeführt, wie General von Pfuel, Freiherr von Haxthausen u. a. (H II, 133). Unter der Fiktion, daß die einzelnen Erzählungen als eben entstanden von den Freunden vorgetragen würden, hat Hoffmann in diesen beiden ersten Bänden seine sämtlichen bis 1818 entstandenen und einzeln gedruckten Erzählungen und Märchen – wie sie oben der Reihe nach aufgeführt und besprochen worden – gesammelt, neu hinzugekommen (abgesehen von dem verbindenden Dialog und einzelnen in denselben eingeflochtenen kürzeren Erzählungen) sind im I. Bande nur › Die Bergwerke von Falun‹. Den Anlaß zu dieser einfach herzlichen Geschichte hat er selbst berichtet, den Namen der von ihm erfundenen Figur des gespenstigen Bergmanns hatte er wohl dem Buche › Bergmani Torberni Seiagraphia regni mineralis. Lipsiae 1783‹ entnommen. – Zum II. Bande ist keine neue Erzählung hinzugekommen.
Endlich erschien im Jahre 1819 die »zweite, durchgesehene Auflage in zwei Teilen« der ›Fantasiestücke in Callots Manier‹ (Bamberg 1819 bei C. F. Kunz). Die vier Bände der ersten Auflage waren hier in zwei gleichmäßigen Bänden wiedergedruckt. Im gegenwärtigen I. Bande unsrer Gesamtausgabe ist diese Ausgabe der letzten Hand wiederholt, an der Spitze des Bandes das Titelbild, das einzige von Hoffmann selbst veröffentlichte Selbstporträt: die Titelblätter sind auf den Schutzblättern reproduziert, wie auch in allen übrigen Bänden unsrer Ausgabe die Originaltitelblätter auf den Schutzblättern wiederholt sind. Die weggebliebene ›Prinzessin Blandina‹ (siehe oben S. LVI) ist in unserm XV. Bande, nach dem Texte des 4. Bandes der 1. Ausgabe der ›Fantasiestücke‹ wiederaufgenommen. Wenn Hoffmann dies Fragment auch einmal als »sein schwächstes Produkt« bezeichnet hat, so darf dieser durch Gozzi, Tieck und Brentano angeregte Schwank doch einer Gesamtausgabe, die alles von ihm zum Druck gegebene Litterarische umfassen muß, nicht fehlen. In dem oben (S. LXXIX) gedachten Brief Kreislers erfreut sich Hoffmann an dem »glatten Papier« dieser 2. Auflage: es war von Friedrich Vieweg in Braunschweig geliefert bei dem das Buch auch sehr schön und korrekt gedruckt worden.
So glücklich das litterarische Jahr 1819 für Hoffmann verlaufen war, so wenig erfreulich war es anfangs in gesundheitlicher, später in geschäftlicher Beziehung für ihn gewesen. Er war im Frühjahr schwer erkrankt »an einem Unterleibsübel mit gichtischen Zufällen« (H II, 137) und mußte im Sommer das Bad Warmbrunn aufsuchen: mit Brief vom 15. Juli nahm er von Fouqué Abschied für »zwei oder drittehalb Monat … meine Frau, die ausnehmend vergnügt ist, aus dem staubigten Berlin einmal herauszukommen empfiehlt sich Ihrer Güte und Freundschaft angelegentlichst« (F 145). In Warmbrunn erholte er sich indes bald und verlebte mit Contessa und dem Breslauer Lustspieldichter Karl Schall, eine angenehme Zeit (auch der sog. Humorist Weisflog hatte sich anzuschließen gewußt).
Nach seiner Rückkehr wurde er zum Mitgliede der Immediat-Untersuchungs-Kommission zur Ermittlung geheimer staatsgefährlicher Verbindungen ernannt. Was er bei dieser Ernennung empfand, hat er später dem Freunde Hippel (im Brief vom 24. Juni 1820) anvertraut:
Du erinnerst dich des Briefes, den du mir durch Tettau sandtest, und in dem du dich über die jetzige Gestaltung der Dinge aussprachst … Gerade in jener Zeit wurde ich zum Mit-Kommissarius bei der zur Untersuchung der sogenannten demagogischen Umtriebe niedergesetzten Immediatkommission ernannt, und wie du mich kennst, magst du dir wohl meine Stimmung denken, als sich vor meinen Augen ein ganzes Gewebe heilloser Willkühr, frecher Nichtachtung aller Gesetze, persönlicher Animosität, entwickelte! – Dir darf ich nicht erst versichern, daß ich ebenso wie jeder rechtliche vom wahren Patriotismus beseelte Mann überzeugt war und bin, daß dem hirngespenstischen Treiben einiger jungen Strudelköpfe Schranken gesetzt werden mußten, um so mehr, als jenes Treiben auf die entsetzlichste Weise ins Leben zu treten begann. Aus dem Gießner Verein der Schwarzen ging die Verbreitung des aufrührerischen sogenannten Frag- und Antwortbüchleins hervor, aber noch mehr, Sand's verabscheuungswürdige meuchelmörderische That gebar den Fanatismus, den die Grundsätze der sogenannten Unbedingten (»der Zweck heiligt die Mittel etc.«) die aus dem Bunde der Schwarzen hervorgingen, entzündeten. – Jenes Büchlein hatte die Unruhen im Odenwalde zur Folge! – Hier war es an der Zeit, auf gesetzlichem Wege mit aller Strenge zu strafen und zu steuern. Aber statt dessen traten Maßregeln ein, die nicht nur gegen die That, sondern gegen Gesinnungen gerichtet waren (H3 II, 157 f.).
Zu diesen Maßregeln frecher Willkür gehörte in erster Linie die auf Denunziation des Regierungsraths Janke in der Nacht vom 13. zum 14. Juli 1819 erfolgte Verhaftung des Dr. Friedrich Ludwig Jahn, der nach Spandau abgeführt und in Ketten gelegt wurde, eine Verhaftung, die das Oberhaupt der Demagogenverfolger, der Wirkliche Geheime Oberregierungsrath von Kamptz, in einem der Vossischen und der Spenerschen Zeitung vom 15. Juli zugesandten Entrefilet folgendermaßen zu rechtfertigen suchte: »Nach den … in Beschlag genommenen Papieren hat der Dr. Friedrich Ludwig Jahn nicht allein … auf den Turnplätzen demagogische Politik jeder Art getrieben, sondern auch fortgesetzt versucht, die Jugend gegen Sie bestehende Regierung einzunehmen und zu revolutionären und andern gefährlichen Grundsätzen, z. B. der bedingten Rechtmässigkeit des Meuchelmordes der Staatsdiener, der Zierde des Dolches für jeden Mann – bei ihm fand man deren zwei – zu verleiten. Er ist daher gestern verhaftet und zur strengsten Untersuchung auf eine Festung abgeführt.«
Das Hauptmaterial in den beschlagnahmten Papieren hatte ein ›Goldkörnlein aus Vater Jahns Munde‹ betiteltes Heft geliefert, in welchem ein, überdies schwerhöriger, Gymnasiast (!) Aussprüche Jahns gesammelt hatte, unter denen sich insbesondere einer befand, wonach Jahn eine Ermordung des Kamptz als zulässig bezeichnet haben sollte. Hinc illae lacrimae! –
Mit der Führung des Prozesses betraute die Immediat-Kommission Hoffmann. Dieser brandmarkte in einem dem Justizminister von Kircheisen erstatteten Gutachten, den p. Zanke als leichtfertigen und gehässigen Denunzianten, legte auf die von dem Gymnasiasten niedergeschriebenen »Goldkörnlein« kein Gewicht, und schloß damit, daß in Jahns Reden und Schriften nichts zu finden sei, was eine längere Verhaftung rechtfertigen könne (Ellinger, S. 157, nach dem in der Berliner Goeritz-Lübeck-Bibliothek befindlichen Konzept Hoffmanns). Das Gutachten wurde dem von Kamptz mitgeteilt, der dem Justizminister brieflich erwidert: Hoffmanns Beweisführung beruhe aus einer Verdrehung, Jahns Schuld sei erwiesen u. s. w. In der That dauerte trotz des Gutachtens und wiederholter auf Haftentlassung gerichteter Anträge der Kommission Jahns Verhaftung fort. Nachdem drei Monate seit Abgabe des Gutachtens verflossen waren, wiederholte die Kommission (in einem aus Hoffmanns Feder stammenden Schriftstücke) ihren Antrag und erklärte: »Sollte auch dieser erneute Antrag unberücksichtigt bleiben, so würden wir uns genöthigt finden, Se. Majestät den König zu imploriren, uns in der mittelst … Allerhöchster Kabinettsorder uns gegebenen Stellung aufrecht zu erhalten, da eine andere Stellung, die unsere nach rechtlicher Ueberzeugung gefaßten Beschlüsse ganz wirkungslos macht, als mit unserem Richteramt unverträglich uns veranlassen müßte, sofort um unsere Entlassung von der uns übertragenen richterlichen Kommission zu bitten« (a. a. O. S. 159). Nun wurde wirklich durch K. Kabinettsorder vom 31. Mai 1820 Dr. Jahn aus der Untersuchungshaft entlassen, und – ihm zum vorläufigen Aufenthalt die Festung Kolberg angewiesen. (Erst 1825 wurde er gerichtlich freigesprochen.)
Noch mehr zeigte sich Hoffmann als furchtlosen und den in oberen Regionen herrschenden Strömungen rücksichtlos sich entgegenstemmenden Mann in einer gleichzeitig spielenden, ebenfalls Jahn und von Kamptz betreffenden Sache. Dr. Jahn hatte nämlich, durch seinen Sachwalter, den Justizkommissar Schulze, den von Kamptz als Verfasser des oben wiedergegebenen Zeitungsartikels, beim Kammergericht wegen Beleidigung verklagt Hoffmann, in dieser Injuriensache zum Decernenten bestellt, lud den Verklagten zum Termin, den 19. Januar 1820, zur Verantwortung auf die Klage vor. Darauf weist der Justizminister von Kircheisen das Kammergericht an, das Verfahren zu sistieren, da von Kamptz bei Lancierung jenes Zeitungsartikels nicht als Privatmann gehandelt habe, sondern amtlich (in Vertretung des Polizeiministers Fürsten zu Sayn und Wittgenstein). Von Kamptz sei daher Gerichtshöfen nicht unterworfen.
Hoffmann erwiderte seinem höchsten Chef darauf:
»Nach unserer festen Überzeugung dürfen wir … dem Kläger, dessen Anspruch wir für rechtsbegründet erachtet haben, ferner rechtliches Gehör nicht verweigern …« In dem Reskript vom 31. Oktober 1815 (v. Kamptz' Jahrbücher Heft XI, S. 21) heiße es:
»»Hat ein Polizeiofficiant jemanden arretirt und dieser will seine Arretirung als unrechtmäßig rügen, so bleibt dies reine Dienstsache, deren Rüge die Vorgesetzte Behörde allein entscheidet, – hat aber jener Officiant sich bei der Arretirung Beleidigungen des Arretirten zu schulden kommen lassen, so ist dies ein Vergehen, das der Beleidigte ohne Rücksicht auf das dabei begangene Amtsvergehen als Injurie rügen kann.««
Excellenz möge also dem von Kamptz hochgeneigt eröffnen, »daß der von dem Doktor Jahn wider ihn angestrengte Injurienprozeß nicht sistirt sei, vielmehr es bei dem angesetzten Termin sein Bewenden habe.«
Berlin, den 10. Januar
1820
Königl. Kammergericht
Hoffmann.
Darauf erging ein Erlaß des Justizministers in Gemeinschaft mit dem Staatskanzler dd. 3. Februar 1820:
»Der vorliegende Fall betrifft vorzüglich eine Staatsdienstverfassungsangelegenheit und ist deshalb von mir, dem Staatskanzler, und von mir, dem Justizminister, gemeinschaftlich erwogen worden … Dem Königl. Kammergericht gebührt in der sich angemaaßten Privat-Injurienklage des Jahn wider den v. Kamptz gar keine Kognition und es erhält dasselbe hiermit die wiederholte Anweisung … den … Dr. Jahn mit der versuchten Klage abzuweisen.«
C. F. v. Hardenberg. Kircheisen.
Aber der kleine Kammergerichtsrath ließ sich nicht einschüchtern. Er erwiderte, unterm 14. Februar 1820:
»daß wir zwar sofort jenen Prozeß sistirt haben, zur gänzlichen Abweisung des Klägers mit seiner Klage uns aber nicht befugt finden. Die von dem Jahn eingereichte Injurienklage mußten wir für rechtlich begründet achten nach dem klaren Inhalt der Gesetze, weil auch die höchsten Staatsbeamten nicht außer dem Gesetz gestellt, vielmehr demselben, wie jeder andere Staatsbürger unterworfen sind. Wir bemerken hierbei ehrerbietigst, daß wir demgemäß unsern Standpunkt nicht verkennen und uns frei von jeder ungeziemenden Anmaßung fühlen, wenn wir diejenige Pflicht, nämlich: jedermann ohne Ansehen der Person und Unterschied des Standes nach Vorschrift der Gesetze und nach unserer besten Kenntniß und Ueberzeugung unparteiische und rücksichtslose Justiz zu administriren, welche wir als die heiligste in unserem Amtseide beschworen haben, mit der strengsten Gewissenhaftigkeit, mit der unerschütterlichsten Treue zu erfüllen streben und auf der Ueberzeugung beharren, daß nur Se. Majestät der König unmittelbar die Macht haben, aus höheren Staatsgründen den Gang des Rechtes zu hemmen.«
Aus höheren Staatsgründen erfolgte nun in der That folgendes Kabinettsschreiben Friedrich Wilhelms des Dritten an das Kammergericht:
»Obwohl das Kammergericht aus den demselben ertheilten Belehrungen des Staatskanzlers und des Justizministers hätte entnehmen sollen, daß die von dem Doctor Jahn gegen den Wirklichen Geheimen Ober-Regierungsrath von Kamptz angestellte Injurienklage nicht begründet sei, so will Ich doch auf den mir vorgelegten, an den Staatskanzler und Justizminister erstatteten Bericht vom 14. v. M. die an das Kammergericht dieserhalb erlassenen Reskripte hierdurch ausdrücklich bestätigen. Die Akten sind daher zu reponiren und dies dem Sachwalter des Jahn bekannt zu machen.
Berlin, den 13. März 1820.
Friedrich Wilhelm.«
Auf diese Kabinettsorder verfügte Hoffmann:
Br. man.
1. Die Akten sind auf Kosten des Klägers zu reponiren;
2. Notif. dem Schulze, daß des Königs Majestät mittelst Allerhöchster Cabinetsordre vom 13. März 1820 die Reposition der Akten zu befehlen geruht hätten.
Berlin, den 20. März 1820.
Hoffmann.
Alle vorstehend abgedruckten Aktenstücke sind zuerst von »R. F.« in der Kgl. Privilegierten (Vossischen) Zeitung von 1884, aus dem Geheimen Staatsarchiv mitgeteilt und Sonntagsbeilage, Nr. 23 von 1885 wiederholt worden. Es ist daher sehr bedauerlich, daß sie dem Verfasser der Einleitung zu der in Kürschners ›Deutscher Nationallitteratur‹ 1889 erschienenen Auswahl aus Hoffmanns Werken entgangen sind, denn sonst würde er von ihm wohl nicht (S. 127 f.) geschrieben haben: »der Mangel [an Patriotismus] kann sein rücksichtsloses Verfahren als Kriminalrichter in der schmählichen Verfolgung der deutschgesinnten Jugend in etwas entschuldigen.« Für den Verehrer des großen Schriftstellers ist es vielmehr hocherfreulich, daß dieser sich auch als Mann und Richter groß bewährt und in Preußens trübster Zeit sich nicht etwa zum gefälligen Werkzeug der Exekutoren der Karlsbader Beschlüsse hergegeben hat. –
Mit demselben Briefe (vom 24. Juni 1820), in dem er sich über die demagogischen Umtriebe und deren Untersuchung ausgesprochen, sandte Hoffmann dem Freunde Hippel »den ersten Teil der Lebensansichten des scharfsinnigen Katers Murr«. Bedauernd setzt er hinzu: »Es folgen noch zwei Theile, die längst fertig wären, wenn mir nicht aus oben entwickelten Gründen Zeit und Humor fehlte« (H3 II, 158 f.). An diesem ersten Bande des › Kater Murr‹ (Berlin 1820, bei Ferdinand Dümmler) war schon im Sommer 1819 gedruckt worden, wo Hitzig während Hoffmanns Aufenthalt in Warmbrunn die Korrektur der Druckbogen besorgt hatte. Zum Dank dafür erhielt er von dem zurückgekehrten Freunde einen krystallenen Prachtpokal, in welchen er den Kater nach einer sehr gelungenen, von ihm in Warmbrunn entworfenen Zeichnung hatte schneiden lassen, mit der Umschrift: »Der junge Autor seinem vielgeliebten Correktor« (H II, 140).
Die Umschläge zu dem Werke hatte Hoffmann ebenfalls gezeichnet: auf dem Vorderdeckel den Kater, auf dem Hinterdeckel (in der nämlichen Arabeskenumrahmung) Kreisler. In unsrer Gesamtausgabe ist das Porträt Murrs, auf das am Schlusse der Vorrede ausdrücklich hingewiesen wird, und ebenso Kreislers Bild zum ersten Mal reproduziert worden. Ein zur Zeit des Erscheinens des ersten Teils (am 2. März 1820) entstandenes Sonett Kater Murrs ist (nach dem ersten Druck im Berliner ›Gesellschafter‹ vom 1. Juli 1833) in unserm XV. Bande mitgeteilt.
Die humoristische Verwendung der Tiere, zur Satire auf die Menschen, die ihm schon im ›Berganza‹ so vorzüglich gelungen war, ist im ›Kater Murr‹ in noch höherem Maße auf das Glücklichste durchgeführt. In der mit der Katerbiographie in origineller Weise verbundenen Biographie Kreislers spiegelt sich Hoffmanns Jugendgeschichte ergreifend wieder, nicht minder sein Verhältnis zu der Bamberger Julia und deren Mutter, mit köstlichem Humor ist der Duodezhof des Fürsten Irenäus geschildert. (Wir kommen beim zweiten und dem ungeschriebenen dritten Teile auf dies Hauptwerk Hoffmanns zurück).
Ebenfalls mit der Jahreszahl 1820 erschien der III. Band der ›Serapionsbrüder‹.
Am 6. Juni sandte er dazu die obenerwähnte Eröffnungsnovelle an den Verleger, mit folgendem Billet (v. Müllers Sammlung):
Anliegend die rektifizirte Brautwahl! Könnte ich, verehrtester Freund, wohl jetzt die versprochene Remesse, die mir sehr Noth thut, erhalten? –
Bitte um gütige Antwort! – Ueberbringerin ist eine sichre treue Person!
Mich Ihrer Güte und Freundschaft gehorsamst empfehlend
Hoffm.
6 Jun 20
Was die »Rektifikation« der ›Brautwahl‹ anlangt, so bedeutet sie die Ausmerzung einiger lokalberliner Anspielungen, wovon er auch in dem Wiederdruck in den Serapionsbrüdern spricht. Neu war in diesem III. Bande die zweite Erzählung › Der unheimliche Gast‹. Sie schildert das Hineintreten einer, die Verkörperung eines bösen Prinzips darstellenden Person in den Kreis guter friedlicher Menschen – dasselbe Motiv, welches schon den ›Magnetiseur‹ und ›Ignaz Denner‹ beherrschte. Wie Schopenhauer, so unterschrieb auch Hoffmann das Aristotelische ἡ φνσις δαιμονια, ἀλλ οὐ θεια ἐστιν … oder, wie er es im gewöhnlichen Leben mit einer Lieblingswendung ausdrückte: »Der Teufel legt auf Alles seinen Schwanz« (Ê 42; H3 III, 28 f.). Daß auf seinem Schreibtisch eine kleine Teufelsfigur zu liegen pflegte (mit der er auch, wie oben erzählt, Oehlenschläger neckte), berichtet er selbst in der Erzählung ›Die Irrungen‹ (S. W. XIII, 91). Vgl. auch S. W. XII, 122: »Der finstere arglistige Dämon pflegt in die hellsten Sonnenblicke des Lebens hineinzugreifen mit seinen schwarzen Krallen« u. s. w. Die dritte Erzählung (›Das Fräulein von Scuderi‹) und die vierte (›Spielerglück‹) sind schon oben besprochen.
Im Herbst des Jahres 1820 erschien im ›Taschenbuch zum geselligen Vergnügen f. 1821‹ › Die Marquise de la Pivardiere‹, eine nach Richers › Causes célèbres‹ bearbeitete Kriminalnovelle (siehe unsern Band XIII: ›Letzte Erzählungen‹). Ferner im ›Berlinischen Kalender für 1821‹ die teilweise durch ein Ludwig Devrient begegnetes Abenteuer angeregte Erzählung › Die Irrungen‹, und im folgenden Jahrgang die Fortsetzung derselben unter dem Titel: › Die Geheimnisse‹. Diese Erzählung gehört zwar zu Hoffmanns schwächeren, aber auch sie hat glänzende Partien, so die Satire auf die männlichen Modenarren des Tages und auf die als Zeitkrankheit grassierende Griechenbegeisterung. Zwei dazu gehörige kleine Bilder von Wolf sind im XIII. Bande unserer Gesamtausgabe zum ersten Mal reproduziert: alle früheren Ausgaben lassen, um das Fehlen der Bilder zu verdecken, die auf sie bezüglichen Textstellen einfach aus!
Zu seinem diesjährigen Geburtstage hatte ihm der Serapionsbruder Koreff eine Sammlung Callotscher Blätter geschenkt, die ihn zu dem ›Capriccio‹ Prinzessin Brambilla anregten. Das Buch, mit 8 jener Callots geschmückt, erschien mit der Jahreszahl 1821 (Verlag von Josef Max in Breslau), wird aber noch im Jahre 1820 ausgegeben sein, da die Vorrede vom September 1820 datiert ist. In dein Wiederdruck in unserer Gesamtausgabe (S. W. XI) sind die Callotschen Originalkupfer, die in allen bisherigen posthumen Ausgaben (»unverantwortlicherweise«, wie Wolfgang Menzel in seiner »deutschen Dichtung« sagte), weggelassen sind, getreu reproduziert. Hitzig, der »zu den Leuten gehörte, die alles gern ernst und wichtig nehmen,« hatte keinen Sinn für das »kecke launische Spiel«, er erklärte nach der Lektüre der ›Brambilla‹ seinem Freunde: er erblicke ihn hier aus dem »Abwege des Nebelns und Schwebelns« und empfahl ihm dagegen Walter Scott zu lesen, den Hoffmann noch nicht kannte. »Schon am nächsten Morgen« nach diesem Gespräch erhielt Hitzig folgendes Billet Hoffmanns: »Gestern Abend war Koreff bei mir, und hatte die Güte, mir auf mein Bitten noch ganz spät den Astrologen zu schicken, den ich nächstens lesen werde, da ich ihn in diesem Augenblick – verschlinge. – Ein ganz treffliches – treffliches Buch, in der größten Einfachheit reges lebendiges Leben und kräftige Wahrheit! – Aber! – fern von mir liegt dieser Geist, und ich wurde sehr übel thun, eine Ruhe erkünsteln zu wollen, die mir, wenigstens zur Zeit noch, durchaus gar nicht gegeben ist. Was ich jetzt bin und sehn kan, wird pro primo der Kater, dann aber, will's Gott, auf andere Weise noch der Jakobus Schnellpfeffer, der vielleicht erst 1822 erscheinen dürfte, zeigen« (H II, 147 f.).
Die Brambilla gehört zu Hoffmanns gelungensten Fantasiestücken. »Prinzessin Brambilla«, schreibt Heinrich Heine in den ›Briefen aus Berlin‹, »ist eine gar köstliche Schöne, und wen diese durch ihre Wunderlichkeit nicht den Kopf schwindlich macht, der hat gar keinen Kopf.« Wolfgang Menzel (›Deutsche Dichtung‹ III, 369) rühmt den »köstlichen Humor des geistvollen Capriccios«. Keiner aber hat das Buch höher gepriesen als Charles Baudelaire in seinen › Curiosités esthétiques‹: » La rêveuse Germanie nous donnera d'excellents échantillons de comique absolu … Je pourrais tirer de l'admirable Hoffmann bien d'autres exemples de comique absolu … il faut lire … Daucus Carota, Peregrinus Tyss, le Pot d'or et surtout, avant tout, la Princesse Brambilla, qui est comme un catechisme de haute esthétique.«
Mit der Jahreszahl 1821 erschien auch der vierte und letzte Band der ›Serapionsbrüder‹. Er eröffnet mit ›Signor Formica‹. Die folgenden drei Erzählungen sind neu: › Die Erscheinungen‹ beruhen auf Erinnerungen aus der Kriegszeit in Dresden; › Der Zusammenhang der Dinge« spielt teils in Berlin, teils in Spanien. Eine der Hauptpersonen, ein Berliner Baron, ist eine ungemein glücklich aus dem Leben gegriffene Figur, der immer die Redensart: »das lag nicht im Zusammenhang der Dinge« im Munde führt, seine Frau bemerkt einmal darauf, als wenn sie Schopenhauer gelesen hätte: »Den wahren Zusammenhang unsers ganzen Seins bilden, denk' ich, die Thorheiten, die wir begehen, bereuen, und wieder begehen, so daß unser Leben ein toller Spuk scheint, der uns, unser eigenes Ich, rastlos verfolgt, bis er uns zu Tode neckt und hetzt!«; – die Schlußerzählung des Bandes ist das sehr amüsante Märchen › Die Königsbraut«, zu dessen Kern ein wirklicher Vorfall den Anlaß gegeben hatte (Ellinger, S. 148 f.). Im Dialog zu diesem vierten Bande finden wir auch eine begeisterte Lobpreisung Walter Scotts Walter Scott seinerseits ist unserm Hoffmann nicht gerecht geworden: in seinem, an Carlyles Übersetzung des ›goldnen Topfes‹ ( German Romance vol. IV) anknüpfenden, namentlich aber auch die 1824 ins Englische übersetzten ›Elixiere des Teufels« im Auge habenden Aufsatze › On the Supernatural in fictitious Compositions‹ (»The foreign Quarterly Review.« No. 1. July 1827) nannte er die Hoffmannschen Märchen fieberhafte Träume eines leichtbeweglichen kranken Gehirns«, vergleicht sie mit »den Einbildungen, die ein unmäßiger Gebrauch von Opium hervorbringt«, spricht von dem »krankhaften Zustande seines zerrütteten Wesens« u. s. w. Als ob Hoffmann diese posthume Kritik vorgeahnt hätte, hat er die ›Serapionsbrüder« mit folgender Abwehr geschlossen: »Es giebt sonst ganz wackre Leute, die so schwerfälliger Natur sind, daß sie den raschen Flug der erregten Einbildungskraft irgend einem krankhaften Seelenzustande zuschreiben zu müssen glauben und daher kommt es, daß man von diesem, von jenem Dichter bald sagt, er schriebe nie anders, als berauschende Getränke genießend, bald seine fantastischen Werke auf Rechnung überreizter Nerven und daher entstandenen Fiebers setzt. Wer weiß es denn aber nicht, daß jeder auf diese jene Weise erregter Seelenzustand zwar einen glücklichen genialen Gedanken, nie aber ein in sich gehaltenes, gerundetes Werk erzeugen kann, das eben die größte Besonnenheit erfordert.« Jenen Walter Scottschen Aufsatz hat Goethe 1828 in »Kunst und Altertum« (S. 397 des VI. Bandes) flüchtig erwähnt, ausführlicher aber in einer erst nach seinem Tode im sechsten Bande der ›Nachgelassenen Werke‹ (S. 270-274) veröffentlichten Aufzeichnung. Goethe spricht hier zwar von »Hoffmanns talentreichem Natürell«, stimmt aber sonst dem englischen Kritiker vollkommen bei: »denn welcher treue, für Nationalbildung besorgte Teilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, daß die krankhaften Werke jenes leidenden Mannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen und solche Verirrungen als bedeutend fördernde Neuigkeiten gesunden Gemütern eingeimpft worden.« Diese Bemerkung zeigt, daß Goethe nur eine unzureichende Kenntnis von Hoffmann gehabt hat. Er tadelt dann weiter, daß ein vorzüglicher Geist wie Hoffmann sich nur auf die Eine Weise versucht habe, von dem einmal betretenen Wege nicht habe weichen können und mögen: woraus ersichtlich, daß er die sehr zahlreichen Dichtungen Hoffmanns, auf welche die Walter Scottsche Charakteristik gar nicht paßt, überhaupt nicht gekannt hat. Schließlich giebt Goethe übrigens zu, »daß eine gewisse humoristische Anmut aus der Verbindung des Unmöglichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne« und führt als Beispiel sein Märchen von der neuen Melusine an. Er habe sich aber gehütet, den Versuch zu wiederholen, »weil das Unternehmen schwieriger ist als man denkt.«: »zwar las ich erst seinen Astrologen, aber – ex ungue leonem« (S. W. IX, 171 f.). Wir ersehen daraus, daß dieser Schlußband der ›Serapionsbrüder‹ später als die ›Brambilla‹, also wohl in den letzten Wochen des Jahres 1820 erschienen ist.
Dieses Jahr hatte ihm mehrere erfreuliche Besuche und interessante Bekanntschaften gebracht:
Im Frühjahr suchte ihn ein Freund Beethovens auf und überbrachte einen Brief (vom 23. März 1820) des von ihm nächst Mozart höchstverehrten Meisters, in dem dieser für den Anteil, den Hoffmann an ihm nehme, seinen Dank ausspricht (H II, 142).
Als Spontini zum Berliner General-Musikdirektor ernannt war, rief Hoffmann ihm in der Vossischen Zeitung einen begeisterten Willkommengruß zu (wiedergedruckt in unserm XV. Bande) und berichtet an Hippel: »Eine neue sehr interessante Bekanntschaft habe ich an dem als Komponisten wirklich großen Spontini gemacht, dessen neueste Oper ›Olympia‹ ich, weil es der König gewünscht, nolens volens ins Deutsche übertragen muß. Eine ganz verfluchte Arbeit, da im Französischen alle Rhythmen dem Deutschen entgegengesetzt sind, und ich mir in den Kopf gesetzt habe, auch in den Rezitativen nicht ein Nötchen zu ändern und die französischen Schlagwörter durch deutsche volltönende Kraftwörter tot zu schlagen. Das gilt nun in den Abend- und Nachtstunden als meine Erholung!« (H3 II, 159). Das Textbuch erschien Berlin 1821.
Ludwig Tieck schickte den dänischen Dichter Molbech zu ihm mit einem Empfehlungsbriefe, auf welchem Hoffmann alsbald antwortete. Diese Antwort lautet: Dieser einzige bisher bekannte Brief Hoffmanns an Tieck ist zuerst gedruckt in den von Holtei herausgegebenen »Briefen an Tieck« I, 367 f.; das Original befindet sich jetzt in meinem Besitz und ist nach diesem der obige Abdruck hergestellt.
Berlin d. 19 August 1820
Mit innigem Vergnügen habe ich Ihre freundlichen Worte, mein hochverehrtester Freund! (stolz bin ich darauf Sie so nennen zu dürfen) durch H. Molbeck erhalten ohne den Ueberbringer zu sehen, der mich leider nicht im Hause traf, da ich in Geschäften abwesend. Morgen werde ich aber den interessanten Norden bey mir bewillkommnen und mich mühen dem günstigen Vorurtheil, das Sie, mein gütiger Freund! ihm für mich eingeflößt zu haben scheinen, zu entsprechen! –
Ach! – wie zu sehr fühle ich das, was Sie mir über die Tendenz, über die ganze (hin und her wohl verfehlte) Art meiner schriftstellerischen Versuche sagen. Mögen Sie aber meiner übrigen Verhältnisse qua Kammer Gerichts Rath etc. etc. etc. gedenken? – Doch freilich, in der Kunst gelten dergleichen Ausreden ganz und gar nichts –
Ich empfehle Ihnen H. Kühne, Schauspieler aus Hamburg der in der That auf schöne Weise in den höchstherrlichen Phantasus hineingehört, und zwar, wie ich denke, rühmlicher Weise. –
Er überbringt Ihnen diese wenigen Worte, die ich mir weiteres vorbehaltend, eilig aufschrieb.
Hochachtungsvoll
Ihr innigst ergebenster
Hoffmann
durch Güte
Herrn Professor L. Tiek
zu
Dresden
Die Bescheidenheit, die er hier Tieck gegenüber (wie auch öffentlich im Vorwort zu den ›Serapionsbrüdern‹) rührend an den Tag legt, gehört zu den liebenswürdigsten Charakterzügen Hoffmanns. Niemand war weiter von Eitelkeit entfernt als unser Dichter. Aber Leute wie Kunz und Hitzig haben ihn trotzdem in den Ruf eines besonders eitlen Mannes gebracht, so daß, auf Grund solcher Gewährsmänner, sogar in der »Allgemeinen Deutschen Biographie« unziemlicherweise behauptet wird, Hoffmann sei »nicht ohne Eitelkeit und Egoismus« gewesen!
Trotz ihrer amtlichen Differenzen hatte ihm der Staatskanzler Fürst Hardenberg »die Ehre angethan, ihn zu seiner Familientafel zu laden« (H3 II, 159). Übrigens hatte er sich aus den Berliner Theegesellschaften, die er anfangs frequentiert hatte, längst auf das schon mehrfach erwähnte Weinhaus von Lutter & Wegner zurückgezogen, wo er sicher war, jeden Abend seinen besten Berliner Freund Ludwig Devrient zu treffen. Wenn Hitzig von seinen » Zechbrüdern« spricht, die ihn seinen wahren Freunden entfremdet hätten (H II, 130), so spricht daraus wohl der Neid auf Devrient. Übrigens gehörten zu den »Zechbrüdern« auch sonst noch ganz respektable Leute. So findet sich in der von Radowitzschen Autographensammlung (auf der Berliner Kgl. Bibliothek) folgendes undatierte Billet:
Sr Hoch und Wohlgeboren
Herrn Baron von
Rebeur
Recht leid thut es mir gerade heute verhindert zu werden an dem fröhlichen Mittagsmahl theil zu nehmen. Aber! – die Götter wollen es so! Nächstens hoff' ich das heute versäumte nachzuholen und mit Dir, Verehrtester! und den Freunden den vorzüglichsten Saft, der unter dem Nahmen Champagner gedeiht, einzunippen.
Dein treu ergebenster
Hoffmann
Hitzig hat sich dann auch später genötigt gesehen, über Devrient, den er in seiner Biographie überhaupt totgeschwiegen hatte, einen Nachtrag in der ›Abendzeitung‹ zu liefern, und auch den übrigen »Zechbrüdern« gegenüber einigermaßen den Rückzug anzutreten (H3 III, 113 ff.).
Der Ruf als »Trinker«, ist, Dank dem biedern Hitzig, unserm Hoffmann aber doch geblieben. Wir wollen daher als Antidoton die schöne Stelle aus ›Kater Murr‹ (S. W. X, 262 f.) hierher setzen: »Ich, wandte sich nun der Meister zu mir, ich bin selbst bisher unzufrieden gewesen mit Deinem Betragen, Murr, und es ist Zeit, daß Du einmal wieder ordentlich und vernünftig wirst, damit Du wieder zu besserem Ruf gelangest, als in dem Du jetzt zu stehen scheinst. Wäre es möglich, daß Du mich ganz verstündest, so würde ich Dir rathen, immer still, freundlich zu sein und Alles, was Du beginnen magst, ohne alles Geräusch zu vollbringen; denn auf diese Weise erhält man sich den guten Ruf am Besten. Ja, ich würde Dir als Beispiel zwei Leute zeigen, von denen der Eine jeden Tag still für sich allein im Winkel sitzt und so lange eine Flasche Wein nach der andern trinkt, bis er in völlig trunkenen Zustand geräth, den er aber vermöge langer praktischer Uebung so gut zu verbergen weiß, daß ihn Niemand ahnet. Der Andere trinkt dagegen nur dann und wann in Gesellschaft fröhlicher, gemüthlicher Freunde ein Glas Wein. Das Getränk macht ihm Herz und Zunge frei; er spricht, indem seine Laune steigt, viel und eifrig, doch ohne Sitte und Anstand zu verletzen, und eben ihn nennt die Welt einen leidenschaftlichen Weintrinker, während jener geheime Trunkenbold für einen stillen, mäßigen Mann gilt. Ach, mein guter Kater Murr, kenntest Du den Lauf der Welt, so würdest Du einsehen, daß ein Philister, der stets die Fühlhörner einzieht, es am Besten hat.«
Der Freundeskreis bei Lutter & Wegner war, wenn Hoffmann auch der liebste, doch nicht der einzige, in dem er verkehrte. Er war Mitglied der 1819 von Rellstab u. a. gegründeten »jüngeren Liedertafel« geworden und hat für diese eine ganze Reihe von Texten, u. a. auch sein famoses Katzburschenlied komponiert (vgl. Ellinger, S. 220).
Als im Spätherbst 1820 die Christianische Musikhandlung in Berlin eine neue ›Allgemeine Zeitung für Musik und Musiklitteratur‹ gründete, wurde Hoffmann gebeten, eine Einleitung dazu zu schreiben. Sie erschien in Nr. 2 vom 9. Oktober 1820 unter der Überschrift › Zufällige Gedanken bei dem Erscheinen dieser Blätter‹, der Schluß in Nr. 3 vom 16. Oktober. Mit dieser Nummer ging die Zeitschrift wieder ein, »aus Mangel an Teilnahme«, wie eine handschriftliche Notiz in dem auf der Musikabteilung der Berliner Kgl. Bibliothek befindlichen Exemplar der Zeitschrift sagt. Wiedergedruckt wurde der Aufsatz in der ›Cäcilia‹ (Mainz, Schott) von 1825, ungenau und mit durchweg irrigen litterarischen Notizen über den ersten Druck. In unserm XV. Bande sind die interessanten »Gedanken« nach dem ersten Druck wiedergegeben.
Ebenda habe ich, zum erstenmal, den Panegyrikus wiederholt, den Hoffmann zu Spontinis Festspiel »Lalla Ruth« in der Berliner »Zeitung für Theater und Musik … Eine Begleiterin des Freimütigen« Nr. 8, vom 24. Februar 1821, angestimmt hat.
Im Frühjahr des Jahres 1821 brachte ihm ein junger dänischer Gelehrter einen an den oben geschilderten Abend von 1817 anknüpfenden Brief Oehlenschlägers. Dieser hübsche (zuerst H II, 133 f. gedruckte) Brief lautet:
Kopenhagen den 26. März 1821.
Hochzuverehrender Freund!
Ich labe mich noch immer in der Erinnerung an den herrlichen Cardinal, den Ew. Ehrwürden mit eigener gelehrter Hand verfertigten, und den die dichterische Tria juncta in uno zusammen genossen, wodurch unsere Seele, Gedanken, Phantasien, Klugheiten und Tollheiten, zusammen flossen, und einen vollständigen Pabst ausmachten.
Vergeben Sie meinen Styl, ich bin der humoristischen und deutschen Sprache nicht so gewohnt wie Sie.
Hier schicke ich Ihnen einen jungen gelehrten, sehr gutmüthigen und bescheidenen Dänen, der bei euch Fremden Mores u. s. w. lernen soll.
Tunken Sie ihn auch ein wenig in die Zaubersee Ihrer Laune, mein Werthester, und lehren Sie ihn, wie man im ironischen Tollhausmantel ein Philosoph und Weltweiser seyn kann, und was mehr ist, ein sehr liebenswürdiger Mann.
Der ich ewig verharre Ihr wahrer Freund und Verehrer
A. Oehlenschläger,
Serapionsbruder.
Aus der Thatsache, daß distinguierte Ausländer, mit solchen Empfehlungsbriefen wie dieser Oehlenschlägersche, den Dichter aufsuchten, wird bei Goedeke: Hoffmann habe »zu den unglücklichen Merkwürdigkeiten Berlins«(!!) gehört und sei deshalb von Fremden, natürlich »im Weinhause«, aufgesucht worden!
Dem großen Ereignis der ersten Aufführung von C. M. v. Webers › Freischütz‹, am 18. Juni 1821, wohnte Hoffmann bei und verfaßte den in der Vossischen Zeitung vom 21. Juni darüber erschienenen begeisterten Bericht, den, ebenso wie den zweiten, ausführlicheren, in der Vossischen Zeitung vom 26. und 28. Juni, ich dem XV. Bande unsrer Gesamtausgabe, als litterarische Dokumente, einverleibt habe. Eine köstliche Episode aus der Festfeier am Abend nach der ersten Aufführung in Jagors Saale Unter den Linden, hat der Biograph C. M. von Webers uns aufbewahrt (citiert bei Ellinger, S. 200). Als nämlich bei dieser Feier der Professor Gubitz ein recht elendes von ihm verfaßtes (und in der ›Abendzeitung‹ veröffentlichtes, später in seinen ›Erinnerungen‹ nochmals in extenso aufgewärmtes) Gedicht vorzutragen sich anschickte, kroch Hoffmann, sowie Gubitz den Mund aufthat, unter den Tisch und kam erst wieder – mit einem riesigen Lorbeerkranz für Weber – zum Vorschein, als der »Dichter« sich gesetzt hatte. Diese, an Gubitz geübte, von ihm verschwiegene Malice würde allein genügen, um des Mannes gehässige Schreiberei über Hoffmann zu erklären.
Eine Reihe interessanter Erzählungen lieferte der Unermüdliche auch dieses Jahr wieder in die Taschenbücher:
Im ›Taschenbuch zum geselligen Vergnügen auf das Jahr 1822‹ (Leipzig, Gleditsch) erschien › Der Elementargeist‹. In der durch Cazottes › Le diable amoureux‹ angeregten Erzählung ist wohl das Gelungenste die von Hoffmann ungemein glücklich erfundene Figur des Paul Talkebarth. Dieser Reitknecht des Obristen Victor von S. kann sich nicht unwürdig neben Diderots Meisterfigur › Jacques le fataliste‹ sehen lassen.
Im ›Rheinischen Taschenbuch für 1822‹ (Frankfurt a. M., Sauerländer) erschienen › Die Räuber‹, eine Erzählung, in der die Schillerschen Hauptfiguren auftreten, die aber Schillers Trauerspiel kennen und es gleichsam unwillkürlich noch einmal im Leben aufführen.
Die in Brünn bei Trassler erscheinenden ›Feierstunden« enthielten im 2. Bande (1822) › Die Doppeltgänger‹. Die Erzählung verarbeitet ein Motiv aus den ›Elixieren des Teufels‹ und führt es ebensowenig glaubhaft durch, aber einige sehr glückliche Episoden fehlen auch hier nicht, so z. B. die Geschichte von den feindlichen Gastwirten, die Figur des Fürsten Remigius u. a. Diesem Beitrage Hoffmanns ist sein ganz besonders schönes Profilporträt, gezeichnet von Hensel, gestochen von Passini, beigegeben. In Koennecke's ›Bilderatlas‹ wiederholt. Von Porträts fremder Hand, die bei Hoffmanns Lebzeiten erschienen, ist mir sonst nur ein im Th. Völkers Lagerkatalog Nr. 220 aufgeführtes, von M. R. Toma bekannt: »E. T. A. Hoffmann, sitzend, am Lehnstuhl seine Frau.«
Endlich lieferte er im Juli 1821 die Erzählung › Datura fastuosa ‹ an Stephan Schütze ab (H3 III, 113), für das ›Taschenbuch der Liebe und Freundschaft‹, wo sie erst im Jahrgang 1823 erschien. Wie der (H II im Faksimile reproduzierte) Brief an Professor Lichtenstein vom 13. Januar 1818 zeigt, hatte Hoffmann schon damals an dieser botanischen Novelle, deren Hauptmotiv er von Chamisso überkommen hatte, zu arbeiten angefangen. Welche Geduld und welche Künste es Schützen kostete, das Manuskript von Hoffmann herauszubekommen, hat Schütze später sehr spaßhaft, sein persönliches Zusammentreffen mit Hoffmann höchst interessant geschildert (H3 III, 107-113).
›Der Elementargeist‹ und ›Die Räuber‹ sind, nach den ersten Drucken, in unserm XIII. Bande wiederholt, ›Die Doppeltgänger‹ eröffnen den XIV. Band: ihr Abdruck erfolgte nach der ersten »aus den ›Feierstunden‹ besonders abgedruckten« Einzelausgabe (Brünn 1825, Josef G. Trassler). Dagegen ist › Datura fastuosa ‹ wieder nach dem ersten Taschenbuchsdrucke abgedruckt.
Nach Beendigung dieser kleineren Arbeiten ging er an die Lichtung des zweiten Teils des ›Kater Murr‹. Einen hierauf bezüglichen Brief an den Verleger vom Herbst 1821 lasse ich, aus meinem Besitz, hier im Wortlaut folgen:
Endlich, Verehrteste Freund! erhalten Sie den Anfang des zweiten Theils vom Kater Murr. Das Manuskript wird über sechs Bogen betragen und da der schnellste Setzer wohl nicht gut mehr liefern kan als drey Bogen wöchentlich, so würde ich einen Vorsprung von vierzehn Tagen haben und so viel Zeit habe ich auch nur nöthig um im Gange zu bleiben so daß gar keine Stockung und zwar um so weniger erfolgen soll als ich mit der übrigen Arbeit gänzlich aufgeräumt und eben deshalb so lange gewartet habe um mich mit dem schnurrig angelegten Buche, dessen Credit ich auf alle Weise bewahren muß ganz ausschließlich zu beschäfftigen.
Fangen Sie daher getrost mit dem Druck in folgender Woche an und es kann das Buch wohl Anfangs November fertig werden. Der dritte und letzte Theil könte dann wohl, da ich nun nicht mehr abbreche zur Neujahrsmesse fertig werden. Die Vignetten (der Rand bleibt derselbe) zum Umschlag des zweiten Bandes werde ich auch in dieser Woche zeichnen.
Da ich Sie, Verehrtester Freund! als einen sehr billig denkenden Mann kenne, so werden Sie gewiß nicht zürnen, wenn ich Rücksichts des Honorars mir zu bemerken erlaube, daß mir die Verleger (wie z. B. Willmanns, Sauerländer, Traßler, Max) für Werke im ordinairen Druck 4 Frid'or bieten und auch wohl mehr geben würden. So viel verlange ich gar nicht von Ihnen, theuerster Freund, wäre es aber doch nicht der Sache angemessen, wenn ich für den Kater, an den ich ganz besonderen Fleiß wende und der mir Ehre so wie bey Ihnen viel Nachfrage erwecken soll, 3 Frid'or für den Druckbogen erhielte? – Zalung verlange ich keines Falls eher, als nach dem Abdruck jedes Theils da ich Gottlob nicht mehr so in Verlegenheit gerathe als es sonst wohl bey geringerer Einnahme der Fall war. Schelten Sie nicht länger und behalten Sie lieb
Ihren demüthigsten und treusten
Autor Hff.
B. d. 2 September 1821.
Aus einem im v. Meusebachschen Nachlaß (auf der Berliner Königl. Bibliothek) befindlichen Billet vom 3. Dezember 1821 ersehen wir, daß damals der Druck beendigt war, denn Hoffmann kündigt dem Adressaten (Kralowski) an: »Käter Murr Zweiter Theil erscheint in wenigen Tagen, und ich werde das Vergnügen haben, Ihnen denselben zu übersenden.«
Mit diesem ›Zweiten Bande‹ (Berlin 1822, bei Ferd. Dümmler) ist der Kater Murr insofern völlig beendet, als der Dichter in einer »Nachschrift‹ den Tod seines Helden anzeigt. Er verspricht nur, »Reflexionen und Bemerkungen, die sich in den nachgelassenen Papieren des verewigten Katers gefunden«, in einem » dritten Bande, der zur Ostermesse erscheinen soll«, zugleich mit der Fortsetzung von › Kreislers Biographie‹ mitzuteilen. Der Tod des Katers war keineswegs erdichtet. Hoffmann besaß nämlich wirklich einen Kater, der in der Nacht vom 29. zum 30. November 1821 verstarb. Seine Freunde erhielten von Hoffmann selbst in zierlichen Antiquabuchstaben geschriebene Todesanzeigen, von denen die an Hippel gesendete in dem Werke »Faksimile von Handschriften berühmter Männer und Frauen aus der Sammlung des Herausgebers. Bekannt gemacht von Dr. Wilhelm Dorow« (Berlin 1837. Verlag von L. Sachse & Co.) im dritten, mit Hoffmanns Porträt von Adolph Menzel Nach einer Kreidezeichnung in Lebensgröße, auf einem Royalfoliobogen, die Hitzig nach Hoffmanns Tode unter dem Bücherschrank fand, »zerknittert und die Zeichnung fast ganz verwischt« (H I, XV): hiernach, »nach diesen spärlichen Resten« ist das Titelkupfer zu H I von Professor Buchhorn hergestellt. Vielleicht lag Menzeln nur dieses Buchhornsche Blatt vor. – Außer den schon oben erwähnten Selbstporträts Hoffmanns (von denen Hitzig das von 1819, das einzige von Hoffmann selbst veröffentlichte, ohne irgendwelche Beweise für eine Karikatur erklärt) ist nur noch ein etwa 1816 entstandener Kopf bekannt, mit physiognomischen Erklärungen, welcher (aus Immermanns Besitz) H3 I reproduziert ist. geschmückten Hefte, lithographisch vervielfältigt ist. Die Anzeige lautet daselbst:
In der Nacht vom 29ten bis zum 30ten November d. J. entschlief, um zu einen bessern Dasein zu erwachen, mein theurer geliebter Zögling der Kater Murr im vierten Jahre seines hoffnungsvollen Lebens. Wer den Verewigten Jüngling kante; wer ihn wandeln sah auf der Bahn der Tugend und des Rechtes, misst meinen Schmerz und ehrt ihn durch Schweigen.
Berlin d. 1ten Decbr. 1821.
Hoffmann.
(Eine Variante dieser Anzeige siehe H II, 150, wo auch der dem Freunde Hitzig mündlich geäußerte Schmerz Hoffmanns ergreifend geschildert wird.)
Im Frühherbst dieses Jahres rückte Hoffmann, dessen Gehalt sich inzwischen auch bedeutend vermehrt hatte, als Mitglied in den Ober-Appellations-Senat des Kammergerichts ein, wodurch er von der Teilnahme an den zweimal wöchentlich stattfindenden Sitzungen befreit wurde und von jetzt ab nur schriftliche Relationen zu Hause zu bearbeiten hatte.
Im Spätherbst hatte er wieder eine schwere Erkrankung durchzumachen, von der wir durch einen Brief an den Frankfurter Verleger Wilmans erfahren, dem er ein › Meister Floh‹ betiteltes Märchen zugesagt hatte. Der (in meinem Besitz befindliche) Brief lautet:
Berlin d. 6. Novbr: 1821.
Hochverehrtester Herr!
Beinahe hätten Sie so wenig als das Publikum nur noch eine einzige Zeile von mir gesehen! – Eine Leberverhärtung (Folge des Stubensitzens und Mangels an Bewegung) hat mich an den Rand des Grabes gebracht. Dauerte nun auch die eigentliche Krisis nur wenige Tage, so waren für mein ganzes Thun und Treiben doch die Folgen der Krankheit eben so schlimm als die Krankheit selbst, da ich natürlicher Weise auch nur die mindeste Anstrengung vermeiden mußte. Den Gedanken kan man sich wohl nicht entschlagen, mag auch der Arzt sagen was er will und so habe ich denn auch im Bette den Meister Floh bis ins kleinste Detail in Gedanken fertig gemacht, und glaube daß die Unterbrechung doch die Herausgabe des Buchs nicht aufhalten wird. Die vollständige Skizze des Werks liegt vor mir und so bedarf ich des fertigen Mnskrpt's nicht um weiter zu schreiben. Ich sende Ihnen, Hochverehrtester Herr! daher in der Anlage pag 1 – 12 des Mnskr welches 4½ D. B. auch wohl etwas mehr mithin beinahe den dritten Theil des ganzen Werks austragen wird um, beliebt es Ihnen, den Druck beginnen zu können. In acht – zehn Tagen erfolgen wieder fünf Bogen und dann in gleicher Frist die letzten, so daß das Büchlein Anfangs Dezember fertig gedruckt sehn könte. – Es ist mir sehr daran gelegen daß des bösen Zufalls unerachtet die getroffene Abrede ganz erfüllt werde und ich bitte Sich zu überzeugen, daß ich die Bereitwilligkeit, mit der Sie, Hochverehrtester Herr! meine Bedingungen bethätigt haben, zu erkennen und zu schätzen weiß. – Uebrigens fühle ich mich jetzt dem Himmel sey es gedankt! recht munter und im Geiste vorzüglich frisch, das Zimmer kann ich aber noch nicht viel verlassen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung habe ich die Ehre zu seyn
Hochverehrtester Herr
Ihr ganz ergebenster
Hoffmann
(Recht sehr bitte ich um die genaueste sorgfältigste Korrektur. Meine Hand ist leider der Kleinheit wegen oft undeutlich, vorzüglich was die Nomina propria betrifft würde der H. Korrektor sehr aufmerksam seyn müssen. – Vor dem Anfang kommt noch ein Vorwort)
Über den Fortgang der Dichtung berichtet ein weiterer (in v. Müllers Sammlung befindlicher) Brief an Wilmans:
Berlin dem d. 21. Dezbr: 1821.
Wie gern arbeitete ich fleißiger am Märchen, aber zu leichtsinnig habe ich nicht an die Folgen einer so schweren Krankheit gedacht als ich sie überstanden und meine Kräfte zu hoch angeschlagen. – Mehrere Tage habe ich ruhen müssen, jezt erhalten aber Ew Wohlgebohr pag 13-24 incl: des Manuskripts und in wenigen Tagen den Rest der etwa noch 16 Seiten betragen wird, von denen schon 5 geschrieben sind. – Aber ein großes Bedenken ist mir aufgestoßen! – Da ich nehmlich die Arbeit mehrere Tage aussetzen mußte, so ist es mir entfallen, ob die pag 14 roth angestrichene Stelle oder eine ähnliche Entwicklung, wohin George Pepusch an dem Abende da er Leuwenhöck verlassen, hingeräth, nicht schon früher in demselben Abentheuer vorkomt? Sollte es der Fall seyn, so muß die roth angestrichene Stelle weg im Gegentheil kann aber alles so stehn bleiben. – Ich bitte dies gütigst nachzusehen, so wie auch den H. Korrektor zu bitten offenbare Schreibfehler, die der sorgfältigsten Durchsicht unerachtet doch manchmal stehen bleiben, nachzubessern.
Auf das dringendste bitte ich aber, mir jeden Falls die fertigen Aushängebogen mit umgehender Post gütigst zusenden zu wollen.
Uebrigens hoffe ich daß das Publikum mit meiner Arbeit zufrieden seyn, nur scheint es eine der besten zu werden.
Mit vorzüglichster Hochachtung
Ew. Wohlgeboh
ganz ergebenster
Hoffmann
Nachdem in den folgenden Wochen das Restmanuskript eingegangen war, teilte der Verleger plötzlich mit, daß die Preußische Regierung Einsicht in das Buch begehre. Hoffmann erklärte darauf, am 28. Januar 1822 Dieser Brief ist im XVII. Autographen-Katalog von Otto Aug. Schulz in Leipzig verzeichnet, woselbst die obigen Bruchstücke abgedruckt sind. dem Verleger: »Mir Übelwollende hatten nehmlich bey einem Gespräch mir abzuhorchen geglaubt, daß das Buch Aktenstücke der Kommission der demagogischen Umtriebe enthalten würde.«
… »Da nun unser Meister besage des Inhalts Wort für Wort das harmloseste Thierchen von der Welt ist, daran kein Staat in der Welt, den größten und den kleinsten nicht ausgenommen, nicht den allermindesten Anstoß nehmen kann, so muß sich jenes alberne Gerücht durch die Einsicht des Buchs von selbst widerlegen.«
So lieferte denn der Verleger dem von Berlin eigenst nach Frankfurt a. M. gesandten Dr. Klindworth das Manuskript des ›Meister Floh‹ aus, der es dem Minister des Innern von Schuckmann überbrachte. Der Minister betraute darauf den bekannten Demagogenriecher Regierungsrath von Tzschoppe mit der Abfassung eines Gutachtens über das verdächtige Buch. Richtig war nun allerdings, daß wenn Hoffmann auch keineswegs »Aktenstücke der demagogischen Kommission« im Meister Floh mitgeteilt, er doch, im fünften Abenteuer, eine Satire auf die Untersuchungsverhandlungen gegen einen wegen polizeilichen Verdachts gefänglich eingezogenen Mann Namens Knarapanti eingewebt hatte (vgl. Dorow, ›Denkschriften und Briefe‹ III, 20).
Als Hoffmann, der inzwischen wiederum erkrankt war, von der bevorstehenden Untersuchung hörte, schrieb er an Hippel, der sich damals glücklicherweise in Berlin aufhielt, folgendes Billet:
»Vergiß nicht, mein theuerster, einziger Freund, mein ganzer Hort und Heil, dem Pückler zu sagen, daß ich gern streichen will. Vielleicht läßt sich auf diesem Wege die Sache am beßten einlenken und ausgleichen? Sage nur, der ganze Knarapanti sollte heraus, wenn's nicht anders wäre. Noch immer sind die Sachen gut gegangen. Ich bin noch sehr schwach.«
Aber es war zu spät. Der von Tzschoppe gab, eben jener Episode wegen, sein Gutachten dahin ab: Der Minister möge bei Sr. Majestät in Antrag bringen »den Kammergerichtsrath Hoffmann, nachdem er eine Urfehde wegen künftiger Schriftstellerei unterzeichnet, an das Oberlandesgericht zu Insterburg zu versetzen.«
Als erschwerend wurde hervorgehoben, daß er zu seiner travestierten Demagogenverfolgung amtliche Akten benutzt habe.
Nun soll Hippel seinen Freund bewogen haben, ein »Gnadengesuch« an den König zu richten. Jedenfalls befahl der König, auf den von Schuckmannschen Antrag, daß Hoffmann erst mit seiner Verantwortung gehört und diese Sr. Majestät zur Entscheidung vorgelegt werden sollte. Hoffmann reichte die Verteidigungsschrift ein, der König nannte sie »meisterhaft« und befahl dem Justizminister, dem Verfasser, der den Knarapanti zu streichen habe, einen Verweis wegen begangener Indiskretion zu erteilen, im übrigen aber das Strafverfahren gegen den KGR Hoffmann einzustellen. (Nach den oben [S. LXXXVIII] erwähnten Aktenstücken.) Am 4. April 1822 verkündigte die ›Zeitung für die elegante Welt‹ in einem Korrespondenzartikel aus Frankfurt: »Hoffmanns ›Meister Floh‹ darf nun, nach eingeholter Entscheidung der hiesigen preußischen Legation gedruckt werden«. Im Intelligenzblatt derselben Zeitung, am 30. April 1822 wurde denn das Buch auch als fertige Novität angezeigt (Frankfurt am Mayn bei Friedrich Wilmans, 1822). Die Umschlagsdeckel waren wieder von Hoffmann gezeichnet. In dem Buche gehört namentlich das erste Abenteuer, in welchem der Held Peregrinus Tys, nach dem Tode seiner Eltern, sich selbst allein den Weihnachten beschert, ebenso der Weihnachten beim Buchbinder Lämmerhirt zum Rührendsten, was je einem Poeten gelungen; schon Heinrich Heine nannte dies Kapitel »göttlich«, George Sand schuf daraus ihr Theaterstück › La nuit de Noël‹ (› Théatre de Nohant.‹ Paris 1865) und sagte in der Vorrede » Ses contes ont ravi notre jeunesse, et nous Ies relisons jamais, sans nous sentir transportés dans une région d'enivrante poésie.« – Zu dem Märchenhaften der übrigen Abenteuer hat Gozzis Re cervo die Anregung gegeben, worauf Ellinger (S. 163. 226) zuerst aufmerksam gemacht hat.
Die im letzten Briefe an Hippel angedeutete neue Erkrankung hatte sich bereits an seinem 47. Geburtstage gezeigt, zu dem er Hippel, Devrient, Hitzig, Koreff u. a. bei sich eingeladen hatte: er trank Selterswasser, während er seiner Gesellschaft die köstlichsten Weine vorsetzte, und wenn er sonst bei solchen Gelegenheiten mit der unermüdlichsten Beweglichkeit den Tisch umkreiste, um einzuschenken und die Unterhaltung anzufachen, wo sie stockte, so saß er heute den ganzen Abend an seinem Lehnstuhl gefesselt. Nach Tische nahm die Unterhaltung zwischen Hippel und Hoffmann eine Wendung, die, wie sie Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit herbeirief, auch des Todes und Sterbens erwähnen ließ. Hitzig warf ein Wort dazwischen, dessen Sinn ungefähr das bekannte: »das Leben ist der Güter höchstes nicht,« war; aber Hoffmann fuhr ihm mit einer Heftigkeit, die so den ganzen Abend nicht zum Ausbruch gekommen war, entgegen: »Nein, nein, leben, leben, nur leben – unter welcher Bedingung es auch seyn möge!« – (H II, 156).
Sein Geist hatte übrigens weder durch die Krankheit, noch durch die – allerdings nur für die Regierung beschämende – Untersuchung wider ihn, im mindesten an Frische und Munterkeit verloren. So schrieb er, wenige Tage vor seinem Geburtstage, am 19. Januar 1822 an Karl Schall, einen seiner launigsten Briefe, dessen Eingang ich hier einfüge:
Berlin den 19. Januar 1822.
Hochverehrtester Herr!
Um aller Wunden willen, die sämtliche Litteratur Blätter jemals Schriftstellern und Dichtern geschlagen haben, bitte ich Sie Hochverehrtester Herr! benehmen Sie unserm guten Kaiser das unseelige Vorurtheil, daß ich an der schriftstellerischen Diarrhoe leide und daß mir bey jeder schicklichen Ausleerung ganz leicht und anmuthig ein Histörchen, ein Romänchen abgeht! – Besagter Kaiser weiß, daß ich eben den Meister Floh beendigt, daß zu Ostern Murrs dritter und letzter Theil erscheinen muß und doch verlangt er nichts geringeres als daß ich, wohl bestallter und mit Akten genugsam überhäufter Kammergerichts Rath zu Johannis d. J. das fertige Manuskript von Schnellpfeffers Flitterwochen vor der Hochzeit, bestehend in Fünfzig Druckbogen abliefern soll! – Bloß das mechanische Schreiben! – man müßte vier Hände haben wie der Floh und da zu vier Händen zwey Köpfe gehören, so würd es nöthig seyn, daß der Kopf einen Vizekopf ernenne als Vizekönig, Lieu-tenant oder wenigstens umsichtigen Departements Rath. Und auf wen anders könte die Wahl fallen als auf den Theil der gewißermaßen die geringer geprägte Rückseite der besseren Antlitzseite ist. Doch wie die Arbeit vertheilen? I nun! Der unten bekäme die Taschenbücher! – Doch ganz blamiren will sich kein Mensch gern, geschieht es dann und wann auch ein bischen! –
Aus diesem Lamentoso werden Sie, Hochverehrtester! wohl schon entnehmen, daß ich mich Rücksicht des in Rede stehenden Beitrages auf kein bestimmtes Versprechen einlassen kann; ich bitte mir aber den spätsten Termin zu nennen, bis zu dem der Beitrag eingehen müßte und inspirirt mich der Himmel mit einem recht ordentlichen Gedanken so will ich sehen daß ich ihn fein ausspinne, denn zwischen Euch, Ihr Herren, muß man sich wohl tüchtig zusammennehmen.
(Veröffentlicht von G. Ellinger im ›Euphorion‹ V, 113.)
»Murrs dritter und letzter Teil« erschien nicht zu Ostern, keine Zeile davon ist niedergeschrieben worden, eine (H II reproduzierte) für den Umschlag bestimmte Zeichnung, den tanzenden, aus seiner Thonpfeife hervorgeblasene Tabaksringe anlächelnden Kreisler darstellend, ist das Einzige, was von diesem dritten Bande, in dem er sein Höchstes leisten wollte, vorhanden ist. Aber schon die ersten beiden Teile des ›Kreisler‹ geben uns ein bei allem Fragmentarischen abgeschlossenes Bild seines mit dem Auge des Dichters erschauten Ichs und der dasselbe umgebenden Figuren, wie Meister Abraham, der Abt Chrysostomus, der nach Rabelais entworfene Mönch Hilarius u. a. Sein Erstlingsroman, ›Die Elixiere des Teufels‹ war hier weit übertroffen.
Zu dem die Welt mit der Ironie jener tiefen Gemüter, die an einer Todeswunde kranken, betrachtenden Kreisler bildet dann der Kater, der sich an die Welt in derber Liebeslust mit klammernden Organen hält, den wirksamsten Gegensatz. Es ist der Gegensatz zwischen Don Quixote und Sancho Pansa noch tiefer aufgefaßt, nämlich der der Verneinung und Bejahung des Lebens, den Arthur Schopenhauer aufgestellt grade zur Zeit, als Hoffmann den »Kater Murr« konzipierte. – In Professor Scherers Literaturgeschichte wird dies größte Werk des Dichters mit keiner Silbe erwähnt!! Allerdings ist es keine »Spukgeschichte«.
Hoffmanns Krankheit hatte sich inzwischen als tabes dorsualis enthüllt! Am 26. März 1822 begehrte er eine Deputation, um sein Testament zu errichten. Der besonders seine Gattin ehrende Wortlaut desselben ist von Hitzig (H II, 214 f.) mitgeteilt.
Am 14. April 1822 mußte sein lebenslanger Mit welch böswilliger Leichtfertigkeit die moralisierenden Philister über Hoffmann zu schreiben pflegen, davon liefert ein empörendes Beispiel E. Brenning in der Allgemeinen Deutschen Biographie, Artikel Theodor von Hippel, wo es heißt: die Freundschaft zwischen Hippel und Hoffmann hätte sich gelöst, »als bei Hoffmann die geniale Liederlichkeit, an der er zu Grunde ging, mehr hervortrat.« Freund Hippel Berlin verlassen und sie nahmen rührenden Abschied. Hoffmann wollte anfangs die Notwendigkeit der Abreise nicht Ansehen und verweigerte ihm die schon halb erstorbene Hand. Endlich wurde er ruhiger, gab dem Freunde die Hand zum Lebewohl, sprach vom Wiedersehn und weinte bitterlich: »eine bei ihm seltene Erscheinung«, bemerkt Hitzig.
In der zweiten Hälfte des April trat zu der Lähmung der Beine eine totale Lähmung der Hände hinzu, und er sah sich nun genötigt, einem Schreiber, der zugleich als Krankenwärter fungierte, zu diktieren. Das Erste, was er dictando geschrieben, war die Erzählung › Meister Wacht‹. Die Geschichte dieses herben Bamberger Zimmermeisters ist mit der alten Kraft, die Meister Martin geschaffen, durchgeführt. Eine Spukgeschichte ist es nicht im entferntesten, weshalb das Werk von Professor Scherer natürlich totgeschwiegen wird. Wacht hat, wie Kleists Kohlhaas, eine fixe Idee vom Recht, geht aber schließlich doch nicht daran zu Grunde, sondern wird zur Einsicht in sein Unrecht geführt. Hoffmann hat die schöne Dichtung noch selbst an den Verleger seiner Brambilla abgeliefert, der sie dann, in das Sammelwerk ›Geschichten, Märchen und Sagen von Fr. H. v. d. Hagen, E. T. A. Hoffmann und Henr. Steffens‹ (Breslau 1823) aufnahm. Nach diesem ersten Druck erscheint ›Meister Wacht‹ in unserm XIV. Bande.
Sodann diktierte er den Dialog › Des Vetters Eckfenster‹, ein Meisterstück ersten Ranges, das sich den Diderotschen Dialogen ebenbürtig an die Seite stellt. Da es keine Spukgeschichte, so existiert dies litterarische Juwel für Scherer nicht, nach Gervinus müßte diese persönlichste Dichtung erst von einem Idealisten umgedichtet werden, um etwas zu sein.
Ferner diktierte er eine als Fragment bezeichnete Novelle › Die Genesung‹. Den Anlaß dazu hatte die unbeschreibliche Sehnsucht gegeben, die er nach dem Grünen empfand, und die ihn mehrmals den Tiergarten aufsuchen ließ. »Ganz entzückt kehrte er immer von diesen Jammerfahrten, wobei vier Menschen ihn in den Wagen tragen mußten, und er oft die heftigsten Schmerzen litt, heim« (H II, 163).
In der Mitte abgebrochen, bei der Schilderung des erkrankten Albrecht Dürer, ist die Erzählung › Der Feind‹.
Hitzig sieht sich genötigt, von diesen diktierten Stücken zu sagen: »Diese Produkte mögen selbst für die Geisteskraft ihres Verfassers reden … einiges darunter gehört zu dem Besten, was Hoffmann je geleistet« (H II. 168 f.). Früher, als er über das »Weinhausleben« des Freundes moralisierte, hatte er von Hoffmanns geistigem »Verfall«, seinem »Versinken, am Ende leider mit furchtbarer Schnelle« gesprochen (H II, 116. 124).
›Des Vetters Eckfenster‹ erschien zuerst in der Berliner Zeitschrift ›Der Zuschauer‹ vom 23. April bis 4. Mai 1822; ebendaselbst, am 4. und 6. Juli ›Die Genesung‹. Beide sind in unserm XIV. Bande wiederholt. Auf die letztere habe ich eine Anekdote (in der Art von H. v. Kleists Anekdoten) › Naivetät‹ folgen lassen, das letzte was bei Hoffmanns Lebzeiten von ihm gedruckt ist: der rührende kleine Aufsatz erschien im ›Zuschauer‹ Nr. 71 vom 13. Juni 1822. Daran schließt sich als »Unvollendetes aus dem Nachlaß« das H II, 203-213 zuerst gedruckte, jedenfalls älterer Zeit entstammende Fragment › Neueste Schicksale eines abenteuerlichen Mannes‹, sowie ›Der Feind‹ (erschienen in Fouqués ›Frauentaschenbuch auf das Jahr 1824‹).
Wie bei Heinrich Heine, wurde auch bei Hoffmann der Versuch gemacht durch Brennen mit glühendem Eisen an beiden Seiten des Rückgrats herunter die Lebenskraft wieder zu erwecken. Als Hitzig ihn eine halbe Stunde nach der Operation besuchte, rief ihm Hoffmann mit demselben Humor, der auch Heine nicht verließ, entgegen: »Riechen Sie nicht noch den Bratengeruch?«
Am frühen Morgen des 25. Juni fingen die Wunden seines zerfleischten Rückens heftig zu bluten an. Er rief den Schreiber und Wärter und sagte ihm etwas, was dieser nicht mehr verstand. Später aber ermunterte er sich wieder, und sagte, er fühle sich wohl, wolle heut Abend an der Erzählung, ›der Feind‹, weiter diktieren, was er seit mehreren Tagen nicht gethan, und verlangte, man solle ihm die Stelle vorlesen, wo er stehen geblieben. Seine Frau suchte es ihm auszureden, er ließ sich im Bette umdrehen, mit dem Gesicht gegen die Wand gekehrt, und verfiel in Todesröcheln (H II, 166 f.). Zwischen 10 und 11 Uhr morgens starb er.
Seine Leiche wurde auf dem Neuen Friedhof vor dem Hallischen Thore, an der Bellealliance Straße, beigesetzt. Das Grab erhielt einen aufrecht stehenden Denkstein mit folgender Inschrift:
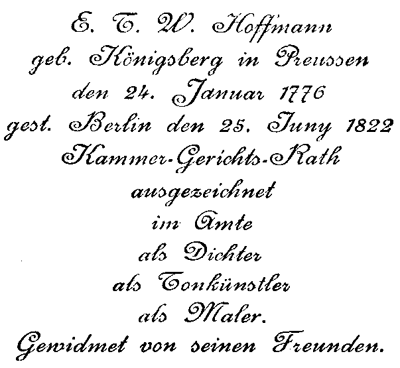
Wie die sorgsam gepflegte, jetzt mit dichtem Epheu bewachsene Grabstätte, so weist die Stadt Berlin auch an zwei andern Stellen Erinnerungsmale an ihren Novellisten auf. An dem Neubau der Tauben-Straße 31 ist Sein Reliefporträt in Bronze angebracht, darunter eine Bronzetafel mit folgender Inschrift:
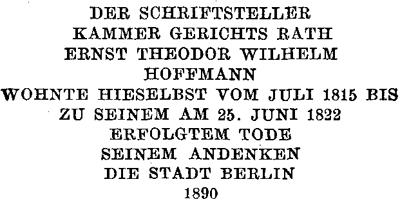
Und in der Charlottenstraße an Lutters Weinhause (vormals Lutter & Wegner) ist gleichfalls eine Bronzetafel eingelassen:
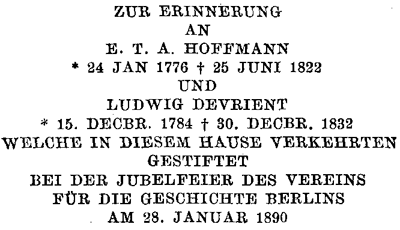
Als ein Monument zu Ehren Hoffmanns darf sich auch die gegenwärtige, vollständige Gesamtausgabe seiner Werke bezeichnen, die zum ersten Male mit seinem Erstlingswerke, den ›Fantasiestücken‹, an der Spitze erscheint (und zwar in seiner Schreibung »F« statt Ph) und dann streng chronologisch die ganze Reihe seiner Dichtungen folgen und so erst den Stufengang seiner Entwicklung übersehen läßt. Die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Hoffmannschen Rechtschreibung sind in unserer Ausgabe beibehalten, wenn auch, auf Wunsch des Herrn Verlegers, übrigens die sogenannte neue Orthographie durchgeführt ist. Der Text der Originalausgaben ist auch sonst mit peinlicher Sorgfalt wiederholt Zweifellose Druckfehler sind stillschweigend verbessert, versehentlich ausgelassene Worte in [ ] gesetzt. Hie und da wurde der erste Taschenbuchs-Abdruck der in den ›Serapionsbrüdern‹ gesammelten Erzählungen herangezogen, um eine Textverderbnis zu heilen., die einzige Zuthat des Herausgebers sind die Kolumnenüberschriften; wo sich also Anmerkungen unter dem Texte Von überflüssigen und thörichten Anmerkungen des Herausgebers wimmelt die Hempelsche Ausgabe: nennt Hoffmann z. B. im Texte (der ›Fantasiestücke‹) Cervantes, so setzt der Herausgeber die Note dazu, »der berühmte Verf. des Don Quixote (1547-1616)«; kommt im Texte (des ›Meisters Floh‹) Peking vor, so »erläutert« die Anmerkung »Hauptstadt und kaiserliche Residenz von China«; als (in den ›Serapionsbrüdern‹) der Geheime Kanzlei-Sekretär Tusmann Hufelands »Kunst, das Leben zu verlängern« ins Wasser wirft, um selbst nachzuspringen – berichtet des Herausgebers Note zu Hufeland »In erster Auflage erschienen Jena 1796«!! Unter den Büchern, die Kater Murr mit Meister Abraham studiert, befindet sich auch Francisci Petrarca Gedenkbuch: dazu bemerkt der Notenverfasser, nach Mitteilung von Geburts- und Todesjahr des »ausgezeichneten Dichters«, derselbe sei »besonders bekannt durch seine Rime« … »Das Gedenkbuch ist sonst nicht bekannt« d. h. ihm nicht bekannt, denn von der unter dem Titel »Gedenkbuch« erschienenen deutschen Übersetzung der Petrarkischen › rerum memorandarum libri‹ kam die 1. Ausgabe Augsburg 1541, eine zweite Frankfurt a. M. 1566 heraus. – Beiläufig ist Hoffmanns Kenntnis auch der Prosaschriften Petrarcas ein kleiner Beleg zu des Gervinus Behauptung: »keine Lektüre bildete ihn, das Wenige, was er las, war nach den Eigenheiten seines zerstörten Wesens gewählt«. Unser Namenregister wird zeigen, wie belesen in inländischer und ausländischer Litteratur Hoffmann war. finden, rühren diese ausnahmslos von Hoffmann her. Wünschenswerte Erläuterungen zu einzelnen Stellen habe ich teils schon in dieser Einleitung gegeben, teils werden sie im ›Namen- und Sachregister‹ am Schlusse des XV. Bandes erscheinen. Was die genauere Bibliographie der unsrer Gesamtausgabe zu Grunde gelegten, immer seltener werdenden Originalausgaben E. T. A. Hoffmanns betrifft, so darf ich mir erlauben, auf meinen ›Weltlitteratur-Katalog eines Bibliophilen‹ (Berlin, Ernst Hofmann & Co. 1898) zu verweisen, insbesondere aber auf den demnächst erscheinenden Ergänzungsband zu diesem Werke, wo auch die Übersetzungen von Hoffmanns Werken ins Französische, Englische und Italiänische verzeichnet werden sollen.
Berlin-Charlottenburg den 31. Juli 1899.
Revidiert im Februar 1905.
Eduard Grisebach.
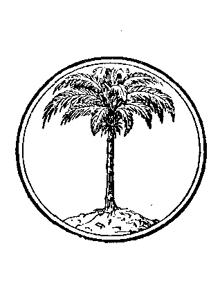
Wenn ich in der verstehenden »Biographischen Einleitung« S. XL, erklärte, daß Hoffmanns musikkritische Beiträge zur »Allgemeinen Musikalischen Zeitung« keine Aufnahme in meine Ausgabe der Werke hätten finden können: so hat mich das Erscheinen von H. vom Endes Sammlung »E. T. A. Hoffmanns musikalische Schriften, mit Einschluß der nicht in die gesammelten Werke aufgenommenen Aufsätze über Beethoven, Kirchenmusik usw.« in Übereinstimmung mit dem Herrn Verleger veranlaßt, im gegenwärtigen Neudruck alles zu wiederholen, was jene Publikation von Hoffmanns Beiträgen zur A. M. Z. enthält. Schon von Dr. Edgar Istel ist jedoch, in der »Frankfurter Zeitung« von, 24. März 1900, hervorgehoben, daß H. vom Ende die von ihm ausgewählten Rezensionen in seiner Publikation »oft ganz willkürlich verstümmelt« hat. In unserm XV. Bande erscheinen sie zum erstenmal genau und vollständig nach dem Original. Ganz neu hinzugefügt sind die Rezensionen über Pustkuchens Choralbuch, Beethovens Musik zu Goethes Egmont, sowie die von Dr. Istel entdeckte »köstliche« Besprechung, die Hoffmann dem Opernalmanach des Herrn von Kotzebue hat zuteil werden lassen. Der Leser wird also jetzt in unserer Ausgabe zahlreiche die Musik betreffende Schriften Hoffmanns beisammenfinden, die in sämtlichen früheren Ausgaben seiner Werke fehlten.
Mein am Schlusse der »Biographischen Einleitung« erwähnter »Weltlitteratur-Katalog eines Bibliophilen« ist inzwischen in einer neuen, durchweg verbesserten und stark vermehrten Auflage (Berlin, B. Behr's Verlag, 1905) erschienen. Der Artikel »E. T. A. Hoffmann« ist darin ganz neu bearbeitet (S. 448-459) und enthält u. a. auch wichtige Nachträge zu meiner Hoffmann-Biographie.
Berlin-Charlottenburg, den 29. Dezember 1904.