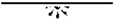|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In der Fontanestraße blühten die Erdbeeren. Nicht in den Gärten dieser Straße, denn solche hatte sie nicht; sie besaß auch keine Häuser, sie bestand nur aus einem Aushau durch einen Teil des Forstes dicht bei dem Bahnhofe Grunewald. An beiden Seiten dieses Aushaues ragten die Kiefern noch unversehrt, doch auf der sogenannten Straße zeigten sich nur noch die Stümpfe der geschlagenen Bäume in gelblichem Schimmer und geziert mit goldglänzenden Harztropfen. Dazwischen wuchs Gras und Kraut, und, wie schon gesagt worden ist, blühten die Erdbeeren. Es sah ganz hübsch aus, zumal wenn man diese Straße mit anderen Berliner Straßen verglich, die sich endlos, ohne jeden Baum und jedes Grün, dahinziehen, und deren himmelhohe Häuserwände in öder Maurermeisterarchitektur mit Gipsornamenten aus dem großen Vorratskasten und schwindsüchtigen Balkons bekleckst sind.
Daß nun aber dieser lange abgeholzte Streifen eine Straße bedeuten sollte, und zwar die Fontanestraße, darüber konnte kein Zweifel sein, denn verschiedene auf Pfählen errichtete weiße Tafeln bezeugten dies durch ungemein deutliche Inschriften. Ich befand mich nämlich in der neuen Villenkolonie Grunewald und zwar in ihrem westlichsten Teile, der, wie die weiteren Namen Bettinastraße, Auerbachstraße u. s. w. bewiesen, einen durchaus litterarischen Charakter zur Schau trägt. Da ich nun auch ein Schriftsteller bin, so fühlte ich mich von dieser Ecke, obwohl dort noch weit und breit kein Haus zu sehen war, kollegialisch angeheimelt und empfand ein wohlthuendes Gefühl innerer Berechtigung, gerade dort spazieren zu gehen. Doch ich ging eigentlich gar nicht spazieren, sondern ich hatte einen Zweck. Der Porträtmaler Fritz Dankwart hatte mich eingeladen, ihn zu besuchen, um mir sein in dieser Kolonie neu erbautes Landhaus zu zeigen, und ich befand mich auf dem Wege dorthin. Noch vor vier Jahren war ich in dieser Gegend des Grunewaldes, die jetzt von den teils bebauten, teils noch unbebauten Straßenzügen der neuen Kolonie durchschnitten ward, in der Einsamkeit spazieren gegangen. Dann hatte ich die Gegend gemieden, weil Greuel der Verwüstung dort anfing zu herrschen. Doch muß man sagen, daß keine der vielen um Berlin herum gegründeten Villenkolonien in so großartiger Weise in Angriff genommen worden ist, als diese, und daß sie in späterer Zeit, wenn alles fertig sein wird, einmal einen höchst anmutigen Anblick gewähren muß. Der Grunewald ist durchschnitten von alten Wasserläufen, die zum Teil verwachsen sind und dann moorige, mit Erlen, Birken und krüppeligen Kiefern bedeckte Sümpfe, sogenannte Fenne, bilden, zum Teil aber an den tieferen Stellen sich als eine Kette von meist langgestreckten, lieblichen Seen hinziehen. Diese bilden die größte Zierde des sehr ausgedehnten Waldes und solchen Schmuck hat man auch der neuen Kolonie zuwenden wollen, indem man die dort vorhandenen ausgedehnten Fenne mit großen Kosten ausgegraben und wieder in anmutige Seen mit schön geschwungenen Ufern verwandelt hat. Ich gelangte bald an einen Ort, wo einer dieser Seen im Entstehen begriffen war. Schon vorher hatte ich das Schnaufen der kleinen Lokomotive vernommen und das Rasseln der Kippkarren, die, mit braunen torfigen Moorklumpen beladen, überall an geeigneten Stellen düstere Dämme aufhäuften, und bald gelangte ich auch an ein improvisiertes Dorf, wo biedere Polacken ihre Erdhütten errichtet hatten, wo schlampige Weiber in roten Unterröcken auf schwelenden Feuern polackische Leibgerichte kochten, wo schmutzige weißhaarige Kinder mit Torf spielten und behängte Wäscheleinen die tiefsten Toilettengeheimnisse einer ansprechenden Bedürfnislosigkeit verrieten. Doch bald wurde die Gegend kultivierter. Die Straßen hatten, wenn auch noch keine Häuser, doch schon Pflaster, und stellenweise sah man eingezäunte Grundstücke. Dann endlich schimmerte der erste halbfertige Neubau rötlich durch die Kiefernstämme. Dann mehrten sich an den mit jungen Bäumen bepflanzten Straßen die Häuser, halbfertige, ganzfertige und solche, die schon bewohnt waren. In den Gärten hatte man, soviel es anging, die vorhandenen Kiefern stehen lassen; darunter zeigten sich frischgrüne Rasenflächen, Gebüschgruppen mit jungem Laube und leuchtende Blumenbeete. Dort, wo noch vor vier Jahren meine Kinder Erdbeeren gepflückt hatten, und ich für meine Frau einen Strauß von zierlichen Graslilien, streckte sich jetzt ein eingezäunter großer Park dahin mit saftigem Rasen und schön geschlängelten, sandbestreuten Wegen; dort, wo ich um dieselbe Zeit noch an dem einsamen, in der Sonne brütenden Fenn auf das monotone Zirpen der Goldammern und das langhingedehnte »Ziaziazia« des Baumpiepers gelauscht hatte, kräuselte jetzt ein lieblicher See seine Gewässer und aus blühenden Gärten an seinen Ufern schimmerten freundliche Villen hervor.
In dieser Gegend wohnte Dankwart, und ich fand bald das mir vorher beschriebene Haus, ein luftiges Gebäude mit allerlei Türmchen, Giebeln und Vorbauten, gedeckt mit farbigen glasierten Ziegeln und umgeben von einem funkelnagelneuen Garten. Alles sah noch so frisch lackiert, neu und sauber aus, als sei es soeben erst aus einer Schachtel genommen. Ich fand den Maler in seiner schönen und großen Werkstatt, wo er sich noch mit dem Einräumen beschäftigte, denn ganz vor kurzem war er erst hierher gezogen. Wie abweichend erschien mir dieser Raum von anderen Malerateliers, die ich gesehen hatte. Da war nicht jene Ueberfülle von kostbaren Stoffen, Pelzdecken, alten Möbeln und Geräten, sondern alles trug einen einfachen, fast strengen Charakter. An den einfarbigen Wänden hingen wenige, aber gute Bilder, und die Möbel schienen vor allen Dingen zum Gebrauch da zu sein und nicht ausschließlich zum Besehen. An ihnen sah man keine Säulen, Simse und sonstige überflüssige Architekturteile, sondern ihre Umrisse waren von einfachen und edlen Linien begrenzt und ihr Schmuck bestand in sparsam angebrachten Flächenornamenten. Dies alles fiel mir auf den ersten Blick auf, und ich redete Dankwart darauf an. Das schien ihm Vergnügen zu machen, und alsbald machte er sich daran, mir die ganze Einrichtung seines neuen Hauses und aller seiner Räume zu zeigen. Ueberall fand ich dasselbe Streben nach einfacher Zweckmäßigkeit unter Vermeidung überflüssigen und aufdringlichen Ornamentenwerkes. Ich hatte in der letzten Zeit so viele Salons gesehen, die in der Fülle der in ihnen aufgehäuften Gegenstände eher aufgedonnerten Trödlerläden, als menschlichen Wohnungen glichen, daß mir bei der ruhigen und einfachen Schönheit dieser Räume ganz wohl ums Herz wurde und ich meine Befriedigung in warmen Worten kundgab. Das freute den Maler sichtlich und er holte aus zu einem kleinen kunstgeschichtlichen Vortrage.
»Es ist ein merkwürdiges Jahrhundert,« sagte er, »dies neunzehnte, dies Jahrhundert der Dampfmaschine. Die Hast, die diese neue Erfindung in die Welt gebracht hat, zeigt sich auf allen Gebieten, auch auf dem der Baukunst. Wir haben in diesen hundert Jahren wie in einem Fiebertraum Entwickelungen durchgemacht, wozu die Welt vorher über zweitausend Jahre gebraucht hat. Mit den Griechen fingen wir es an und mit Empire enden wir es. Dazwischen liegen alle Sorten von Renaissance, Gotisch, Romanisch und was Sie wollen, wir haben uns nichts geschenkt, sogar Bauten in dem wunderlichen Uebergangsstil vom Gotischen zur Renaissance leisten wir uns heute. In der Bellevuestraße können Sie es sehen. Wie Schmock in den ›Journalisten‹ schreibt in allen Richtungen, so auch unsere Baumeister, sie bauen Ihnen in allen Richtungen – Sie brauchen nur zu wünschen. Ich kenne einen, und zwar gehört er zu den besten, die wir haben, der baut augenblicklich gleichzeitig eine gotische und eine romanische Kirche, ein Museum im strengsten Renaissancestil und eine Rokokovilla. Verlangen Sie was Indisches, so macht er es Ihnen auch. Darum eben, weil wir alles können, hat unsere Zeit keinen Stil. Unsere Bauwerke sind nicht gewachsen, sondern gemacht. Nicht aus den inneren Bedingungen heraus ist ihr äußeres Kleid entstanden, sondern meist umgekehrt, der Fassade hat sich das Innere zu fügen, oder wenn das nicht geht, wird mächtig darauf losgelogen und wo uns die Außenarchitektur einen mächtigen Saal von doppelter Etagenhöhe vorflunkert, haben wir inwendig ganz gemütlich zwei Stockwerke und dergleichen mehr. Das Sonderbarste aber ist, daß die Dampfmaschine oder überhaupt die Maschine, der wir die ganze hastige Ueberstürzung und Unruhe der neuen Zeit verdanken, zugleich für sich einen wirklichen Stil ausgebildet hat. Sie werden es für paradox halten, aber einen eigentlichen Stil findet man heutzutage nur im Maschinenbau. Denn Stil besteht nicht darin, daß man, wo nur Platz ist, möglichst viel Ornament von einer bestimmten Sorte anbringt, wie bei vielen von unseren heutigen Bauwerken und Möbeln, sondern darin, daß jeder einzelne Teil seine Bestimmung möglichst klar und schön ausdrückt und dabei zu jedem anderen Teile in einem richtigen Verhältnisse steht. Dies ergibt sich bei der Maschine schon von selbst aus ihren inneren Bedingungen und aus mathematischen und statischen Gesetzen, und ich kann wohl sagen, daß eine große Dampfmaschine, die von einem Ingenieur mit feinem Formgefühl richtig konstruiert ist, mir mehr ästhetisches Behagen erweckt, als viele unserer modernen Bauten und Möbel.«
»Das ist mir,« sagte ich, »der selbst lange Jahre diesem Fache angehört hat, sehr schmeichelhaft zu hören.«
»Doch genug hiervon,« fuhr der Maler fort, »es freut mich nur, daß Ihnen mein Häuschen und seine Einrichtung gefällt, wie es scheint, und daß Sie sich wohl darin fühlen.«
Er holte eine Flasche Rheinwein und Zigarren herbei und wir setzten uns in dem schönen Werkstattsraume behaglich zum Plaudern nieder. Dabei fiel mein Blick auf ein ziemlich großes Bild, das an die Wand gelehnt stand und in einer Weise gemalt war, wie es vor etwa fünfundzwanzig Jahren üblich war. Es stellte Penelope dar, die von den Freiern bei der Auftrennung ihres Gewebes überrascht wird. Ein korrekt und fleißig gemaltes Bild, wie es viele gibt, ohne besondere Fehler, aber auch ohne besondere Verdienste. Nur Penelope hob sich hervor, wie sie erschrocken und doch hoheitsvoll das Haupt nach den eindringenden Freiern über die Schulter wandte. In dieser Bewegung lag im Gegensatz zu den herkömmlichen Gesten der übrigen Gestalten des Bildes Wahrheit. Zudem hatte man die Empfindung, in diesen festen und doch zarten Zügen ein Porträt vor sich zu sehen, und zwar ein solches, bei dem man sagt, obwohl einem das Urbild unbekannt ist: das ist ähnlich.
Dankwart bemerkte die Richtung, die meine Augen genommen hatten, und sagte: »Ja, dieser alte Schinken ist beim Umräumen auch wieder zum Vorschein gekommen. Mein erstes größeres Bild, eine sogenannte Komposition. Damals wußte ich noch nicht, daß ausschließlich ein Porträtmaler in mir stecke, und träumte von hohen Dingen und großen Wandflächen. Ich besitze noch eine ganze Mappe voll ähnlicher Entwürfe aus jener Zeit. Erst kürzlich habe ich diese trübseligen Verirrungen meines Geistes betrachtet mit dem Lächeln dessen, der überwunden hat. Aber dies Bild, obwohl es nicht viel taugt, ist mir doch lieb und wert, denn es hat eine Geschichte und erinnert mich an eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Das Kramen in den alten Sachen hat alles wieder frisch in meine Erinnerung zurückgeführt – haben Sie Lust, eine kleine Geschichte zu hören?«
Ich bejahte natürlich, der Maler schlürfte langsam den Rest aus seinem Glase, schenkte neu ein, blies nachdenklich einige Wölkchen aus seiner Zigarre und begann zu erzählen.
An einem nebligen Winterabend vor etwa dreiundzwanzig Jahren hatte ich beschlossen, in die Zauberflöte zu gehen. Natürlich nicht ins Parkett, sondern, wie es meinen damaligen kümmerlichen Geldverhältnissen entsprach, so hoch man steigen konnte, ins Amphitheater. Wer diesen Platz kennt, der weiß, daß man dort kein schlechtes Publikum trifft, und daß dort meist mehr Andacht herrscht, als auf den besseren Plätzen. Dort sitzen Leute mit schmalen Geldbeuteln, aber vollen Herzen, Leute, denen es ein Opfer ist, einen halben Thaler für einen Kunstgenuß zu geben, die dafür aber auch zu genießen wissen, und denen eine gute Vorstellung aus dieser Höhe gesehen und gehört, oft noch lange wie ein schöner Traum nachgeht.
Die Vorstellungen der Zauberflöte sind im allgemeinen nicht so gut besucht, wie die der modernen Opern, doch fand ich, als ich mich mehr als eine Stunde vor Beginn am Opernhause einfand, hinter dem schmalen Eingangsgitter doch schon eine ganze Reihe von Menschen eingepfercht, die auf die Kassenöffnung warteten. Ich stellte mich dazu und hatte das Glück, bald darauf schon beim zweiten Schub als der letzte mit eingelassen zu werden. Sehen Sie, so spielt der Zufall in unserem Leben eine Rolle. Hätte der Cerberus an der Thür, der eben schon abschließen wollte, nicht in einer milden Anwandlung mich gerade noch mit hinein gelassen, so hätte meine Zukunft wahrscheinlich eine ganz andere Gestalt angenommen. Von der Laune eines Thürschließers hängen oft unsere ferneren Schicksale ab. Als ich dann nach einer Weile an die Kasse gelangte, stand dort ein schön gewachsenes Mädchen, das sehr einfach, aber sauber und zierlich gekleidet war. Sie hatte zehn Groschen in Silber, die übrigen fünf Groschen aber in lauter Dreiern auf den Kassentisch gelegt, und in dem Augenblick, als ich dies bemerkte, schob der Kassierer das stattliche Häufchen Kupfer unwirsch zurück und sagte: »Das nehmen wir hier nicht.« Enttäuschung und ein wenig Scham malten sich in dem schönen, aber blassen Antlitz des Mädchens und eine Weile stand es ratlos da.
Ich schob schnell entschlossen ein Fünfgroschenstück hin und nahm die zwanzig verachteten Dreier an mich. »Erlauben Sie, daß ich wechsle,« sagte ich. Im ersten Augenblick sah sie voll Schreck über die Schulter auf mich hin, dann wandelte sich die weiße Rose ihres Antlitzes in eine purpurne, sie nahm rasch die verächtlich hingeschleuderte Papptafel, verbeugte sich ein wenig, indem sie sagte: »Ich danke sehr, mein Herr!« und ging schnell davon. Als ich ihr sehr bald darauf folgte, hörte ich, wie ihre leichten eiligen Schritte auf den alten ausgetretenen Steinstufen vor mir her den olympischen Höhen zustrebten. Ich bekam, oben angelangt, einen Platz neben ihr, was sie offenbar anfangs bedrückte; sie faßte sich aber schnell und wiederholte ihren Dank. Dann fuhr sie fort: »Ich hätte wieder umkehren müssen, denn anderes Geld hatte ich nicht. Ob der Mann das wohl zurückweisen darf; es ist doch richtiges Geld. Mancher arme Mensch muß lange arbeiten, ehe er so viele Dreier zusammenbringt.«
»Ich wollte nur, ich hätte ein paar Scheffel davon,« sagte ich.
Sie lächelte: »Was wollten Sie wohl mit so viel Dreiern machen?«
»Nun, zunächst würde ich sie in schöne blanke Thaler umwechseln und die sollten schon springen lernen.«
»Da könnten Sie alle Wochen ins Theater gehen,« meinte sie mit einem kleinen Seufzer.
»Sie gehen wohl gern ins Theater?« fragte ich.
»Es ist mein Schönstes,« war die Antwort.
»Da besuchen Sie es wohl oft?«
»Ach nein,« erwiderte sie, »es kommt nur sehr selten vor. Der Verdienst ist gering und wir müssen das Unsrige zusammenhalten. Das ist heut ein Festtag für mich.«
Obwohl mich etwas in der Klangfärbung an Berlin erinnerte, so fiel mir doch die Reinheit ihrer Sprache auf, besonders wenn ich den wahrscheinlich geringen Stand dieses Mädchens in Betracht zog. Besonders ein Kennzeichen der meisten Eingeborenen fehlte ihr ganz. Ich fragte deshalb: »Sie stammen wohl nicht auf Berlin?«
»O doch,« antwortete sie, »ich bin mit Spreewasser getauft, ebenso wie meine beiden Eltern.«
»Das wundert mich,« sagte ich, »denn Sie sprechen ja das R aus. Ein richtiga eingeboana Bealina thut das doch nicht. Dea geht in die Opa und wenn ea dann die Zaubaflöta von Mozacht, oda Zaa und Zimmamann von Lochzing gehöat hat, soupiat ea entweda voanehm und wundavoll bei Hilla oda trinkt sein Nüanbega Bia beim schwean Wagna, oda seine Weiße mit Gewea üba, wo ea sonst Lust hat.«
Sie lachte: »Wie Sie das gleich heraus haben. Sie sind wohl Geheimpolizist? Aber das haben wir, meine Schwester und ich, Vatern zu verdanken. Der hat es von Anfang an nicht gelitten, als wir noch Kinder waren, und jetzt, da wir beide erwachsen sind und selber was verdienen, da kostet es gleich einen Dreier in die Strafkasse, wenn wir: ick, det, wat, weeste, Oogen, glooben, Fleesch und Beene sagen, oder einmal das R nicht aussprechen.« Sie stockte eine Weile, als scheue sie sich fortzufahren, dann spielte ein eigentümliches Lächeln um ihre Lippen, als sie sagte: »Nun können Sie sich auch die vielen Dreier erklären; sie stammen alle auf der Strafkasse. Denn für dieses Geld gehen wir Schwestern ins Theater, eine um die andere. Da müssen immer erst sechzig Fehler gemacht werden, ehe eine Oper dabei herauskommt.«
Mit lieblich lustigem Ausdruck fuhr sie dann fort: »Aber manchmal helfen wir ein bißchen nach, besonders die, die gerade an der Reihe ist. Die Zauberflöte habe ich mir schon lange gewünscht, und als ich las, daß sie heute gegeben würde, da fehlten gerade noch fünf Dreier in der Kasse. Da habe ich denn so ganz aus Versehen gesagt, als meine Schwester mich fragte, ob ich diesmal hingehen könne: ›Weeste, det gloob ick nich!‹ und da waren mit dem einen kleinen Satz gleich die fehlenden fünf Dreier da.«
Sie hatte offenbar Vertrauen zu mir gefaßt und war ins Plaudern gekommen, und so erfuhr ich denn in der Stunde, die wir auf den Beginn der Vorstellung warten mußten und während sich der große Raum langsam füllte, noch vieles von ihren und der Ihren kleinen Schicksalen.
»Vater,« sagte sie, »hat sich von klein auf fürs Theater interessiert. Er wäre auch wohl sicher ein Schauspieler geworden, wenn er nicht den Schaden am Bein hätte, nämlich einen Klumpfuß. Sein Vater war bei der Theatermaschinerie angestellt und dadurch kam er oft mit hinein und konnte zusehen, meist auf der Bühne, manchmal aber auch von der Galerie aus. Er hat noch den großen Ludwig Devrient gesehen, und wenn er auf den kommt, kann er kein Ende finden, von ihm zu erzählen. Zuletzt sagt er dann immer: ›Ja, so etwas gibt es heute nicht mehr, kommt auch wohl so leicht nicht wieder. Ludwig Devrient war der größte deutsche Schauspieler, ja manche sagen, überhaupt der größte Schauspieler, der je gelebt hat.‹
»Mit dem Theater ist Vater auch immer in Verbindung geblieben. Die glücklichste Zeit seines Lebens war, als er bei einem großen Liebhabertheater als Souffleur angestellt war. Da hat er von seinem Kasten aus alles dirigiert, und die Leute haben gespielt, daß man sich verwundert hat. Da war auch ein Kommis darunter Namens Hahnke, der ist nachher ein berühmter Heldenspieler geworden und tritt in großen Stadttheatern auf. Wenn er von dem jetzt liest in der Theaterzeitung, wie er wieder schön gespielt hat: den Karl Moor, den Wilhelm Tell, den Fiesko oder sonst eine gute Rolle, dann kommen ihm die Thränen in die Augen und er nickt vor sich hin und sagt: ›Ja, ja, das war mein Schüler.‹
»Später aber hat sich diese Gesellschaft aufgelöst, und da hat er sich ganz auf das Theaterbauen gelegt, was er vorher schon angefangen hatte. Das Haus und die Dekorationen macht er, und wir, meine Mutter, meine Schwester und ich, ziehen die Figuren dazu an; den kleinen niedlichen Gelenkpuppen schnitzt er die Köpfe zurecht, ordentlich nach dem Charakter, und malt sie schön an. Bei uns können Sie alles bekommen, was Sie wollen, Kaiser und Könige mit Hermelinmänteln und Dienstmänner mit roten Mützen und blauen Blusen, Naturburschen, Kommerzienräte und den reichen Onkel aus Amerika. Wir machen feine Damen mit seidenen Schleppkleidern und Kammerzofen mit Latzschürzen, Gecken mit karrierten Hosen und weißen Cylindern und den dummen Hans vom Lande. Wir haben Bonvivants und erste und zweite Liebhaber und Komiker von allen Arten auf Lager und alles, was nur auf der Bühne vorkommt. Wir haben auch Schachteln, in denen die Figuren für einzelne Stücke sortiert sind, zum Beispiel ›Monsieur Herkules‹ oder ›Das Fest der Handwerker‹. Die Puppen zu den Räubern, was Vaters Lieblingsstück ist, sind besonders schön. Die Amalia geht in Atlas und Karl Moor hat wunderschöne Stulpenstiefel von Handschuhleder. Die Räuber tragen richtige kleine Säbel und niedliche Gewehre, und man kann sie alle auseinander kennen, den schuftigen Spiegelberg, den braven Schweizer und wie sie alle heißen. Und sind doch eben nur sechs Zoll lang. Der alte Moor geht ganz in Schwarz und hat einen weißen Bart aus ganz wenig Kaninchenfell. Manchmal Sonntag nachmittags, wenn schlechtes Wetter ist und wir nicht ausgehen können, spielt uns Vater die ganzen Räuber vor. Er weiß sie auswendig. Und alle Personen spricht er mit verschiedenen Stimmen und kriegt sie nie durcheinander. Sie glauben gar nicht, wie erbärmlich das klingt, wenn der alte Moor tief unten in seinem Turme sagt: ›Bist du's, Hermann, mein Rabe?‹«
Vor meinen Augen stieg ein Bild auf, das ich auf dem Lustgarten zur Zeit des letzten Weihnachtsmarktes gesehen hatte. Eine ziemlich große Eckbude hatte dort gestanden, die mir durch ihre sonderbaren Waren aufgefallen war. Dort hingen an Drähten reihenweise die mannigfachsten kleinen Menschlein in allen möglichen Kostümen, dort standen unzählige Schachteln, die, wie die obersten geöffneten zeigten, ebenfalls mit derartigen Püppchen gefüllt waren, und im Hintergrunde sah man eine Menge von Theatern mit schön bunt gemalten Dekorationen, die alle möglichen Räume und Gegenden darstellten. Diese wunderliche Liliputanerwelt hatte mich interessiert und ich hatte mir eine ganze Weile diese ganz nett gemachten Figürchen angesehen, bis ich darauf aufmerksam wurde, daß ein ältlicher glattrasierter Mann und zwei hübsche blasse Mädchen im Innern der Bude mich mit erwartungsvollen Blicken betrachteten. Da es mir stets peinlich ist, vergebliche Hoffnungen zu erwecken, war ich weiter gegangen. Mir war nun schon immer so gewesen, als hätte ich meine Nachbarin irgendwo einmal gesehen, und darum begann ich: »Auf dem letzten Weihnachtsmarkt sah ich eine Bude . . .«
Sie unterbrach mich fast freudig: »Das war unsere. Wir haben zwar das ganze Jahr durch unsere Abnehmer, aber zu Weihnachten ist doch das beste Geschäft und wir finden dann oft neue Kunden, die uns später treu bleiben. Ach, darunter sind manchmal schnurrige Leute. Einen haben wir, der schreibt alle Jahre ein paar neue Stücke, die er an die Theater verschickt; sie werden aber nie aufgeführt. Dann kommt er zu uns, und wir müssen ihm Puppen und Dekorationen dazu machen, ganz nach seiner Vorschrift. Eins von unseren besten Theatern hat er schon lange. Da ladet er denn ein paar Kinder aus der Nachbarschaft ein, die er nachher mit Schokolade und Windbeuteln traktiert, und spielt ihnen seine Stücke vor. Zuerst hat er's mit Erwachsenen versucht, die sind ihm aber meist weggelaufen, oder wer es einmal ausgehalten hatte, kam nie wieder. Er sagt: ›Die Kinder haben heutzutage mehr Sinn für die Kunst als die Erwachsenen.‹«
Unterdes war die Zeit des Beginnes der Aufführung herangenaht, die Musiker fanden sich nach und nach im Orchester ein und es tönte von dort her jenes verworrene musikalische Getöse, das manche ganz aus dem Theater verbannt wissen wollen, das auf mich aber gerade einen ganz besonderen Reiz ausübt. Mich erinnern diese Flöten- und Klarinettenläufe, dieses Geigenklingen, diese sanften Horntöne und dies vorsichtige Anschlagen der Kesselpauken an den Gesang der Vögel in einem reichbesetzten Park, wo auch jeder, unbekümmert um den anderen, seine Melodien flötet, pfeift, trillert, tireliert und kuckuckt. Und wie viel Erinnerung an meine Knabenzeit bringt es herauf, wo mir das Theater eine Wunder und Zauberwelt war und dies verworrene Tönen zugleich mit dem Anblick des geheimnisvollen Vorhanges in mir die Vorahnung märchenhafter Genüsse erweckte.
Die Vorstellung nahm ihren gewohnten Verlauf. Die Besetzung der Rollen habe ich zum Teil vergessen, ich weiß nur noch, daß Krüger den Tamino und Fricke den Sarastro sang. Dieser große Bassist, groß in beiden Bedeutungen des Wortes, ist mir immer als der geborene Vertreter dieser Rolle erschienen. Die majestätische Ruhe und Würde seiner mächtigen Erscheinung, die edle Hoheit, die er sich zu geben weiß, und seine den gewaltigsten Anforderungen scheinbar ohne Mühe gehorchende Stimme, mit der er das Hohelied der Humanität: »In diesen heiligen Hallen« vorträgt, haben mich stets aufs tiefste gerührt und ergriffen. Nachdem er jetzt schon seit Jahren in seiner vollsten Kraft von der Bühne zurückgetreten ist und sich ganz seiner stets nebenher betriebenen geliebten Landschaftsmalerei gewidmet hat, habe ich Gelegenheit gehabt, diese wunderbare Arie noch in neuester Zeit im Freundeskreise mehrfach von ihm zu hören, und immer ist der Eindruck derselbe geblieben. Auch damals war er mir in dieser Rolle nicht neu, denn im vorhergehenden Winter hatte ich sogar, so sonderbar es auch klingen mag, in der »Zauberflöte« mitgewirkt.
Ich sagte zu meiner Nachbarin, nachdem sich die Wogen der Begeisterung, die dem Schlusse der zweiten Abteilung folgten, etwas gelegt hatten: »Glauben Sie wohl, daß auch der große Sarastro hinter den Kulissen sich ängstigt, ehe er auftritt?«
»Nein, das denke ich nicht,« sagte sie scheinbar etwas verwundert über meine Frage, »das kann gar nicht an ihn kommen.«
»Ich weiß aber, daß er sich ängstigt, denn ich habe es im vorigen Jahre selber gesehen.«
»Wo wollen Sie denn das gesehen haben?«
»Nun, auf der Bühne im vorigen Jahre, als ich in der Zauberflöte mitspielte.«
Sie sah mich sehr verwundert an. »Sind Sie denn Sänger?« fragte sie.
»Durchaus nicht,« war meine Antwort, »ich habe keinen Ton in der Kehle.«
»Nun, als was denn?« fragte sie wieder.
»Als ägyptisches Volk,« antwortete ich. »Ich hatte Tricots an und Sandalen, einen weißen, buntgesäumten Kittel und so eine Art Jockeymütze mit zwei Schirmen, einen hinten und einen vorn, und half in passenden Momenten den Hintergrund füllen.«
Sie sah etwas enttäuscht aus. Sie hatte offenbar mehr hinter mir vermutet, als einen bloßen Statisten. »Ach,« sagte sie bloß.
»Ich will es Ihnen erklären,« fuhr ich fort. »Der Mann, der für die nötigen Statisten zu sorgen hat, nimmt gern Studenten oder ähnliches junges Volk, weil diese doch eine gewisse Anstelligkeit besitzen und weil sie, was die Hauptsache ist, über die ihnen als Spielhonorar zustehenden fünf Silbergroschen quittieren, ohne sie empfangen zu haben, und somit zu einer Quelle des Wohlstandes für ihn werden. Da ich mir nun gerne das Treiben hinter der Bühne ansehen wollte, so habe ich mich auch einmal dazu anwerben lassen. Da habe ich denn gesehen, daß der große Sarastro, wie die meisten bedeutenden Sänger und Schauspieler, auch das Kulissenfieber hat, bevor er auftritt. Er stand seitwärts hinter der Scene auf seinem Löwenwagen, der hier allerdings nur mit Pferden bespannt ist, etwas vorgebeugt und wartete auf sein Stichwort; alle seine Würde und Höhe war von ihm gewichen, er atmete ängstlich und tief und glich mehr einem, der seine Hinrichtung erwartet, als dem edelsten und weisesten der Männer. Doch plötzlich kam seine Zeit und wie mit einem Zauberschlage war der ganze Mann verändert. Hoheit kam in seine Züge und edler Stolz in seine Haltung, und hinaus fuhr, jeder Zoll ein König, der große Sarastro.«
»Es ist nur gut, daß man das alles hier nicht mitsieht,« meinte sie, und dann wurde unsere Aufmerksamkeit wieder von der beginnenden dritten Abteilung in Anspruch genommen. Sie verfolgte das Stück mit außerordentlicher Spannung und Teilnahme und sprach nicht während der Handlung, auch schien sie es nicht gern zu haben, wenn ich Bemerkungen machte. Nur als Tamino und Pamina ihren Schreckensgang beendigt hatten, flüsterte sie: »Durch Feuer und Wasser und alle Gefahren – das ist die wahre Liebe.«
Im nächsten Zwischenakt meinte sie: »Ich muß sehr scharf und genau aufpassen und darf mir nichts entgehen lassen, denn die Zauberflöte muß nun auf lange Zeit vorhalten. Wenn ich mit meiner Schwester sitze und wir die kleinen Puppen anziehen, da muß ich alles haarklein beichten, wie es gewesen ist, das ganze Stück und alle die einzelnen Spieler, und natürlich auch, was sie angehabt haben.«
Als dann am Schluß der vierten Abteilung der große Chor der Priester im Sonnentempel und damit die Oper zu Ende war, gingen wir selbander mit dem großen Strome die Treppen hinab und es erschien mir selbstverständlich, daß ich das junge Mädchen nach Hause begleitete. Im Flur war ein ziemliches Gedränge und als wir in die nebelige Winternacht hinaustraten, wurde gerade ein paar mutiger Equipagenpferde unruhig. Die Leute drängten zurück, wir wurden auseinander gewirbelt, und als ich endlich aus dem Menschenknäuel wieder frei kam, hatte ich meine Nachbarin verloren. Vergeblich strich ich dort noch eine Weile umher, doch sie war und blieb verschwunden. Ein wenig mißmutig wandte ich mich dann dem Siechenschen Bierlokale zu, das damals noch an der Kurfürstenbrücke lag, und träumte dort noch eine Weile bei einem der berühmten billigen Beefsteaks und einigen Gläsern Bier von der Zauberflöte und meiner schönen Nachbarin.
In jener Zeit plagte ich mich mit meinem ersten größeren Bilde, das auf die nächste Ausstellung kommen sollte. Als Stoff hatte ich gewählt: Penelope, von den Freiern bei der Auftrennung ihres Gewebes überrascht. Auf einem stattlichen Karton hatte ich in Kohlezeichnung die Komposition so ziemlich zusammen und alles ging gut ineinander, nur mit der Hauptfigur der Penelope quälte ich mich vergeblich. Stellung und Bewegung hatte ich schon wer weiß wie oft geändert und war an dieser widerspenstigen Dame schier verzweifelt. Als ich nun am Tage nach jener Aufführung der »Zauberflöte« vor mein Bild trat, da wußte ich mit einemmal, wie durch ein Wunder, wie es sein mußte. Die Gestalt der Penelope, die sich vorher nicht aus dem Nebel hatte lösen wollen, der ich durch alles Grübeln und alle Versuche nicht hatte näher kommen können, stand vor mir in Haltung und Bewegung scharf und klar umrissen, wie sie, die Hände noch an dem verräterischen Gewebe, erschrocken und doch hoheitsvoll über die Schulter nach den eindringenden Freiern blickt. So hatte ich es gestern gesehen, als sich das junge Mädchen an der Kasse des Opernhauses nach mir umsah; unvergeßlich hatte sich mir dies eingeprägt. Mit einem wahren Feuereifer ging ich an die Arbeit und war nach einigen Tagen so weit im klaren, daß ich mit dem Malen beginnen konnte. Was war natürlicher, als daß auch meine Penelope die Züge der schönen Unbekannten annahm. Die edle reine Linie ihres Profils, der ich, während sie mit mir plauderte, wer weiß wie oft mit den Augen gefolgt war, das ein wenig gewellte aschblonde Haar, das sie nach antiker Art hinten in einem einfachen Knoten trug, die feine, edelgeformte Muschel ihres Ohres, die widerspenstigen Löckchen am Nacken ihres schöngebauten weißen Halses, alles kam auf mein Bild, und ich kann wohl sagen, es ward zuletzt fast ein Porträt. Hätte ich sie nur bewegen können, zu meinem Bilde zu sitzen, sie war das geborene Modell dazu. Aber ich wußte ja nicht einmal ihren Namen und hatte keine Ahnung davon, in welchem Stadtteil sie wohnte; ich sah sie in dieser menschenwimmelnden Stadt vielleicht nie wieder. Doch hatte ich noch immer die stille Hoffnung, ihr einmal wieder zu begegnen, und dehnte meine abendlichen Dämmerungsspaziergänge immer weiter und in immer andere Gegenden aus. Meine gute Kenntnis dieser Stadt und der entlegenen Straßenzüge danke ich dieser Zeit. Wie oft glaubte ich in dem ungewissen Dämmerlichte die schöne Gestalt vor mir herschweben oder mir entgegen kommen zu sehen, aber immer führte es zu neuer Enttäuschung. Es war alles vergebens, ich fand meine Penelope nicht wieder.
Aber wenigstens besaß ich eine Erinnerung an sie, das waren die zwanzig Dreier. Ich hatte sie in ein schön gesticktes kleines persisches Täschchen gethan, das ich einmal bei einem Trödler aufgefunden hatte, und zuweilen nahm ich es hervor, um mit seinem Inhalt zu klimpern oder die braunen Münzen in Reihen auf den Tisch zu zählen und mit Blicken zu betrachten wie ein Geizhals seine Dukaten. Aber einmal, muß ich zu meiner Schande gestehen, war dieser kleine Schatz doch in großer Gefahr. Meine Mittel waren damals sehr beschränkt; ich bekam zwar einen Zuschuß von Hause, doch reichte der für meinen Lebensunterhalt bei weitem nicht aus und ich mußte mir das übrige durch schlecht bezahlte Arbeiten für Buchverleger und lithographische Buntdruckanstalten verdienen, wozu ich die langen Winterabendstunden verwendete, und bei fleißiger Arbeit auch immer das Nötige zusammenbrachte. Alles mögliche habe ich gemacht damals, sogar Heiligenbilder, die, wie nicht jedem bekannt ist, vorzugsweise und massenhaft gerade in dem ketzerischen Berlin hergestellt werden. Bei meiner letzten Reise nach Tirol habe ich mit verwunderter Rührung einige davon in dortigen Bauernhäusern wiedergefunden. In der letzten Zeit nun hatte ich mehr Ausgaben als gewöhnlich gehabt; die Modelle zu meinem Bilde, die ich Tag für Tag benutzen mußte, waren sehr kostspielig, und mein Geld ging reißend zu Ende. Zwar hatte ich von einem auswärtigen Verleger eine Geldsendung zu erwarten, doch diese traf nicht ein. – Mahnen mochte ich nicht, denn die Herren Verleger pflegen gegen Leute, die ganz von ihnen abhängig sind, merkwürdig empfindlich zu sein. Wenn der Geldbriefträger die Straße entlang kam, so verfolgte ich ihn mit jenem eigentümlich gespannten Blick, den die Raubtiere im zoologischen Garten annehmen, wenn der Wärter vorbeigeht, der ihnen für gewöhnlich das Futter bringt. Aber immer ging dieser gern gesehene Mann an dem Hause vorüber, oder wenn er eintrat, kam er nicht zu mir. Schließlich war es so weit, daß ich nicht mehr mein einfaches Mittagsessen bezahlen konnte. Ich hatte gar nichts mehr, hatte auch versäumt, mir durch Versetzen oder Verkaufen von augenblicklich entbehrlichen Sachen etwas zu verschaffen, weil ich an diesem Morgen den Geldbriefträger mit Sicherheit erwartet hatte. Ich besaß allezeit einen gesunden Appetit, es war bereits vier Uhr und mich hungerte. Mich hungerte sogar mächtig.
Da fiel mir beim Herumkramen in dem kleinen Schranke, wo ich meine Wertsachen und Papiere aufbewahrte, das persische Täschchen mit den Dreiern in die Hände; das feine Geklimper dieser Geldstücke drang wohlthätig an mein Ohr und erweckte allerlei Phantasiebilder. Eine reizende Guirlande von Knackwürstchen, für die ich damals eine kleine Schwärmerei hatte, schwebte plötzlich vor meinem geistigen Auge, wurde aber alsbald verdrängt durch das Bild einer stattlichen dicken Scheibe rosigen gekochten Schinkens, die ich deutlich auf einem Teller liegen sah. Leberwurst war auch nicht übel – für fünf Groschen gab es schon ein mächtiges Ende. Oder vom Budiker unten im Hause konnte ich mir vielleicht eine Portion Braten heraufholen, köstlichen Schweinebraten mit brauner knusperiger Kruste. Während diese Träume einer vom Hunger geschärften Phantasie mich umgaukelten, fiel mein Blick zufällig auf mein Bild, auf das schöne hoheitsvolle Antlitz meiner Penelope, und alle meine lüsternen Wünsche verflogen plötzlich wie Nebel vor der Sonne. Zugleich kam mir eine Idee, die mich lächeln machte, und die ich sogleich zur Ausführung brachte. Ich holte einen zierlichen Tisch mit eingelegter Arbeit herbei, den ich einmal billig von einem Trödler erstanden hatte, und deckte ihn mit einem schön gestickten Tuche, stellte einige Majolikaschüsseln darauf und einen fein gemalten Teller von Berliner Porzellan aus dem vorigen Jahrhundert. Gelegentlich hatte ich mir in Zeiten des Ueberflusses auch einige schöne Gläser angeschafft und daraus wählte ich einen edel geformten Römer von grünem Glase und ein wundervoll zierliches venetianisches Spitzglas. Eine köstliche Flasche mit eingeschliffenen Ornamenten füllte ich aus der Wasserleitung und stellte sie dazu. So, der Tisch war gedeckt. Nun holte ich alles, was ich an Eßwaren noch besaß, ein halbes Brot und ein wenig Butter herbei und verfertigte mir eine stattliche Anzahl von Stullen, wie der Berliner sagt, wobei ich allerdings die Butter, um damit zu reichen, erheblich quälen mußte. Diese Butterbröte verteilte ich in die verschiedenen Schüsseln und sagte mir: dies ist frischer Rheinlachs, dies köstlicher Rehbraten und dies ein herrlicher Kabinettspudding. Durch diese Vorbereitungen zu meinem opulenten Mahle war ich ganz fröhlich gestimmt worden und sang trotz meines Hungers noch zuvor die schöne Strophe:
»Ça, ça, geschmauset,
Laßt uns nicht rappelköpfisch sein!
Wer nicht mit hauset,
Der bleib' daheim.
Edite, bibite, collegiales!
Post multa saecula pocula null!«
Dann begann ich mit dem frischen Rheinlachs. Dazu trinkt der verständige Mann, sagte ich mir, einen guten Rauenthaler und ich schenkte mir ein in den schönen grünlichen Römer, prüfte schlürfend den klaren Trunk und schätzte ihn für Fünfundsechziger. Zum folgenden Rehbraten hätte ich nun gern einen guten Chateau la Rose gewählt, traute aber der Stärke meiner Einbildungskraft nicht zu, daß sie den ungeheuren Unterschied der Farbe zu bewältigen vermöchte und blieb deshalb bei derselben Sorte. Dann ging ich zum Champagner über – Cliquot veuve war meine Wahl. Hei, wie er perlte in dem feinen venetianischen Spitzglase. Zwischendurch erfreute ich mich an dem wohlhabenden Geklimper der »Friedrichsdors« in meinem persischen Täschchen, und so wurde ich schön satt und geriet in so fröhliche Stimmung, daß ich zum Schluß zu singen begann:
»Freude, schöner Götterfunken . . .«
Als ich aber gerade dabei war, mit gewaltiger Stimme herauszuschmettern:
»Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt! . . .«
da klingelte es bei mir. Als ich öffnete, stand der Geldbriefträger da und hielt mir das schiefe Kreuz fünf roter Siegel auf einem stattlichen Briefe mit einem Schmunzeln vor die Augen, als wollte er sagen: »In diesem Zeichen wirst du siegen!«
Ich aber vollendete im stillen die begonnene Strophe:
Brüder – überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.«
Doch alsbald gerieten meine so glücklich geretteten zwanzig Dreier in neue Gefahr, denn ich konnte ohne sie, wie ich in der ersten Bestürzung dachte, das Bestellgeld nicht bezahlen. Doch auch diese Wolke verzog sich; der Briefträger wechselte mir einen der dem Schreiben entnommenen Fünfthalerscheine, wurde fürstlich belohnt und alle Not hatte nun für eine Weile ein Ende.
Zugleich mit dem Penelopebilde, das mir so sauer wurde, malte ich damals das Porträt eines jungen mir befreundeten Bildhauers, der unten im Garten des Hauses sein Atelier hatte. Das ging mir weit leichter von der Hand, und ich legte vielleicht gerade deshalb weit weniger Wert darauf. Es war mir hauptsächlich darum zu thun, noch ein zweites Ausstellungsobjekt zu haben. Der junge Bildhauer war, als ich beide Bilder fertig hatte, anderer Meinung und sagte in seiner berlinischen Weise: »Weeste, Fritz, mit den jroßen Schinken da wirste nich ville machen. Aber det Porträt hier – det kannste. Da is Mumm drin.«
Ich lachte darüber, denn ich dachte ganz das Gegenteil. Er sollte aber recht bekommen, denn als die Ausstellung, damals noch in den ungenügenden Räumen des alten Akademiegebäudes, eröffnet wurde, fand die Penelope kaum Beachtung, das Porträt aber ward von Ludwig Pietsch sofort entdeckt und entlockte diesem begeisterungsfähigen und wohlwollenden Kritiker so anerkennende Worte, daß auch die Berichterstatter der anderen Blätter aufmerksam wurden und ihm im Lobe nachfolgten. Man suchte das Bild auf, die Leute standen davor in vorschriftsmäßiger Bewunderung, ich bekam die silberne Medaille, erhielt Aufträge und war mit einemmal ein gemachter Mann. Das Glück kommt oft um eine ganz unvermutete Ecke.
Eines Tages im Spätsommer besuchte ich die Ausstellung und richtete meinen Schritt nach der Gegend, wo meine einsame Penelope hing. Einsam, sage ich, denn das Bild gehörte zu denen, die im Vorübergehen betrachtet werden; fast niemals hielt sich jemand davor auf. Um so mehr wunderte es mich, als ich schon von ferne eine Dame bemerkte, die scheinbar wie gebannt vor dem Bilde stand. Sie hatte offenbar im Vorübergehen den Kopf über die Schulter dorthin gewendet und war so stehen geblieben, starr mit großen Augen und etwas geöffnetem Munde, als schaue sie in ein Medusenantlitz. Dann sah sie sich scheu um, trat etwas zurück und warf noch einmal einen langen, fast feindseligen Blick auf das Bild, während sie sich auf die Unterlippe biß. Als ich mich näherte, ließ sie, ohne nach mir hinzublicken, den Schleier vor ihr Gesicht fallen und ging mit eiligen Schritten davon. Diese Haltung, dieser Gang, diese Art sich zu bewegen – plötzlich erkannte ich sie. Es war meine Unbekannte aus der Zauberflöte. Endlich hatte ich sie wieder, und diesen Augenblick durfte ich nicht vorübergehen lassen, sonst verschwand sie mir vielleicht für immer oder doch wenigstens bis zum nächsten Weihnachtsmarkt. Ich folgte ihr also schnell. Sie ging, ohne sich weiter umzusehen, dem Uhrsaale zu und dann ins Treppenhaus. Wie damals vor mir hinauf hörte ich jetzt die leichten schnellen Schritte die alten Steinstufen vor mir hinabeilen. Vor der Thür des Akademiegebäudes angelangt, schien sie erleichtert aufzuatmen. Sie befestigte den Schleier wieder auf ihrem Hute, mäßigte ihre Schritte und ging auf das Brandenburger Thor zu. Ich hatte sie bald eingeholt und fragte, ob sie sich meiner noch erinnere. Nach dem ersten Stutzen bei meiner Anrede ging, wie es mir schien, ein freundliches Lächeln der Wiedererkennung über ihre Züge.
»Glauben Sie, ich werde meinen Retter so bald vergessen?« sagte sie.
»Auch bei mir,« erwiderte ich, »ist kein Tag seitdem vergangen, daß ich nicht an Sie gedacht hätte. Und die Dreier habe ich auch noch, alle zwanzig.«
Sie antwortete nicht, sah gerade vor sich hin und ein leichtes Rot stieg in ihre Wangen. Nun aber mußte ich wissen, was sie vorhin so bewegt hatte, und sprach: »Wie gefällt Ihnen mein Bild? Sie standen vorhin lange davor und sahen es an.«
Sie sah mich ganz entsetzt an. »Das haben Sie gemalt?« rief sie. »O das ist abscheulich! Sie haben mich gestohlen, während ich arglos nichts ahnte. Nur die Kleidung ist anders, sonst Haltung, Gesicht, Haar und alles ist von mir genommen. Ein jeder muß denken, daß . . . und das will ich nicht. Wie kann man so etwas thun, wie darf man es. Das Bild hat mich in Angst gejagt und ich dachte zuletzt nur: Wär' ich doch erst glücklich heraus. Ich glaubte, sie müßten alle mit Fingern auf mich zeigen: ›Das ist sie, das ist sie!‹«
Ich war erschrocken über diesen Ausbruch, denn er überraschte mich aufs höchste. Alles andere hatte ich erwartet, nur dieses nicht. Und doch stimmte es eigentlich genau zu der fein begrenzten Zurückhaltung, die dies Mädchen trotz aller Freiheit des Benehmens immer bewiesen hatte. Ich suchte, so gut es ging, ihre Bedenken zu zerstreuen. Ich sagte ihr, daß es gar nicht in meiner Absicht gelegen habe, ihr Porträt in diesem Bilde zu geben, es sei ganz von selbst gekommen aus einem inneren Zwange heraus. Seit jenem Abend habe mir Penelope so vorgeschwebt, und ich hätte sie gar nicht anders darstellen können. Für mein starkes Formengedächtnis könne ich doch nichts, es wäre vielmehr eine Gabe, wofür ich dem Schöpfer aufs innigste zu danken hätte. – Und so redete ich noch vielerlei.
Wir waren unterdes in den Tiergarten gelangt, und als wir den Goldfischteich erreicht hatten, war bereits jede Spur des Unmuts aus ihrem Gesicht entschwunden. Bei der Rousseauinsel redeten wir schon von ganz anderen Dingen und als wir nachher die sogenannten »wilden Wege« entlang schlenderten, da war alles vergeben und vergessen. –
Der Maler war während des letzten Teiles seiner Erzählung mehrfach in seiner Werkstatt hin und her gegangen, jetzt stand er an dem großen Fenster und sah hinaus in den Garten. Er winkte mir und ich trat hinzu. »Penelope,« sagte er. Im Garten stand eine schöne, stattliche Frau, etwa in dem Alter, das Penelope gehabt haben muß, als ihr Gatte nach zwanzigjähriger Abwesenheit wieder zu der Vielumworbenen zurückkehrte. Sie war beschäftigt gewesen, einen Rosenstock anzubinden. Dabei war ihre Aufmerksamkeit nach der Seite hin abgezogen worden und sie sah über die Schulter nun dorthin, daß die edle, reine Linie ihres Profils sich schön von dem laubigen Hintergrunde abhob. Dann wendete sie sich wieder ihrer Arbeit zu.
Wir gingen hinunter, sie zu begrüßen. »Zeige mal dein Armband!« sagte Dankwart nachher. Sie hob die schöne schlanke Hand und ich erblickte ein Armband, zusammengesetzt aus zwanzig stark vergoldeten Dreiern.
»Das war mein erstes Geschenk damals,« sagte der Maler. »Meine Frau läßt es nie von sich und trägt es bei jeder Gelegenheit. Es ist aus Glücksgeld, sagt sie.«
»Du hast wohl wieder einmal Geschichten erzählt?« meinte die schöne Frau.
»Ja, die beste, die ich weiß!« war die Antwort, und der Maler drückte die schlanke Hand zwischen den beiden seinen und schüttelte sie, daß die goldenen Dreier lieblich klimperten.
Als ich in später Nachmittagsstunde diese glücklichen Leute wieder verließ, wanderte ich denselben Weg zum Bahnhof Grunewald wieder zurück, den ich vorhin gegangen war. Ich schlenderte nachdenklich dahin. Die sinkende Sonne sandte zuweilen einen Strom von Licht durch die Lücken der einförmigen Kiefernstämme und ihr Schein lag rosig auf den regungslosen Wipfeln. In der Fontanestraße blühten die Erdbeeren.