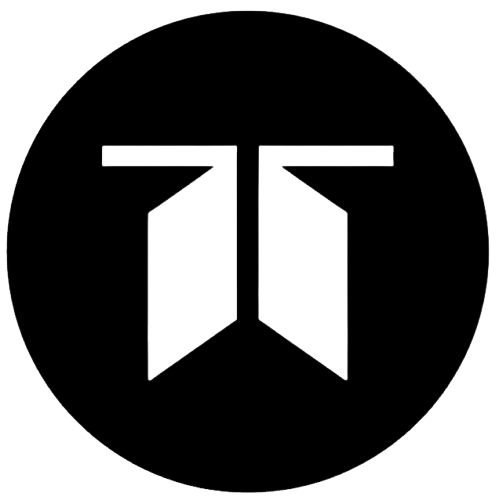Benito Cereno
Verlag: Claassen & Goverts | Jahr: 1948
Wenn Sie das Buch lieber in der Hand halten möchten, können Sie es hier erwerben:
Kapitel
Herman Melville
Benito Cereno
Im Jahre 1799 lag Kapitän Amasa Delano aus Duxbury in Massachusetts, Kommandeur eines großen, als Frachter fahrenden Robbenfängers, mit einer wertvollen Ladung im Hafen der Insel St. Maria vor Anker – eines kleinen, wüsten und unbewohnten Eilands am südlichen Ende der langen chilenischen Küste. Er hatte den Hafen angelaufen, um Wasser zu fassen.
Am zweiten Tag in aller Morgenfrühe, als er noch in seiner Koje lag, kam sein Steuermann zu ihm und meldete, ein fremdes Schiff laufe in die Bucht ein. Der Schiffsverkehr in jenen Gewässern war damals noch nicht so zahlreich wie heute. Der Kapitän erhob sich, zog sich an und ging an Deck.
Es war ein Morgen, wie man ihn an jener Küste häufig beobachtet. Alles war stumm und lautlos; alles war grau. Die See, von einer flachen Dünung bewegt, schien dennoch stillzustehen; an der Oberfläche wirkte sie glatt wie gewelltes Blei, wenn es in dem Schmelzform erkaltet und erstarrt ist. Der Himmel glich einem grauen Mantel. Schwärme rastloser grauer Wasservögel, den rastlosen grauen Dünsten verschwistert, in deren Mitte sie ihr Spiel trieben, flitzten niedrig, in zuckendem Flug, übers Wasser hin, so wie Schwalben vorm Gewitter überm Wiesengrund. Schattenbilder – Vorboten späterer tieferer Schatten.
Zu Kapitän Delanos Überraschung zeigte das fremde Schiff, mit dem Glas beobachtet, keine Flagge, obwohl es, selbst an unbewohnter Küste, unter friedlichen Seeleuten aller Länder allgemein üblich war, beim Anlaufen eines Hafens, in dem ja immerhin ein fremdes Schiff liegen konnte, seine Farben zu zeigen. An diesem gottverlassenen Fleck herrschte freilich weder Gesetz noch Ordnung, und da man sich überdies von jener Gegend des Weltmeers dazumal allerlei düstere Geschichten erzählte, so hätte sich Kapitän Delanos Überraschung leicht zu einem unbehaglichen Gefühl vertiefen können, wenn er nicht, als ein von Natur gutartiger, allem Mißtrauen abholder Mensch, ganz außerstande gewesen wäre, sich – außer bei ungewöhnlich wichtigem und nachdrücklichem Anlaß und auch dann nur ungern – persönlich beunruhigen zu lassen, was ja immer darauf hinausläuft, daß man bei seinen Mitmenschen Bosheit und Tücke voraussetzt. Denkt man daran, wessen die Menschheit alles fähig ist, so muß man sich freilich fragen, ob ein solcher Wesenszug, gepaart mit Herzensgüte, überhaupt noch vereinbar ist auch nur mit der gewöhnlichsten Behendigkeit und Schärfe des wägenden Verstandes – aber darüber mögen sich andere den Kopf zerbrechen.
Übrigens mußten alle Befürchtungen, die sich beim ersten Anblick des fremden Schiffs allenfalls erheben mochten, für ein Seemannsauge sogleich hinfällig werden bei der Feststellung, daß die Unbekannten beim Ansteuern des Hafens viel zu nah auf die Küste zuhielten, wo eine blinde Klippe gerade in ihrem Kurs lag. Es schien sich demnach um ein Schiff zu handeln, das nicht allein dem Robbenfänger unbekannt, sondern das auch hier an der Insel fremd war, und keinesfalls um einen Freibeuter, der gewohnheitsgemäß diese Gegend des Ozeans befuhr. Mit nicht geringer Spannung setzte Kapitän Delano seine Beobachtungen fort – was ihm nicht gerade erleichtert wurde von den Dunstschwaden, die den Schiffsrumpf teilweise verhüllten, so daß das ferne Kajütlicht nur unbestimmt herüberblinkte. Auch die Sonne schimmerte in einer gewissermaßen zweideutigen Weise: sie stand in diesem Augenblick als halbe Scheibe überm Horizont und schien gemeinsam mit dem fremden Schiff in den Hafen einlaufen zu wollen – hinter dem Schleier der niedrighängenden, träg dahinkriechenden Wolken aber wirkte sie nicht unähnlich dem boshaft spähenden Auge, mit dem eine listenreiche Schöne zu Lima in der Hauptstadt aus dem indianerhaften Hinterhalt ihrer dunklen Saya-y-manta über die Plaza hinäugt.
Vielleicht war es eine Täuschung, vom diesigen Wetter verursacht, aber je länger man das fremde Schiff beobachtete, desto eigenartiger wirkten seine Manöver. Nach einiger Zeit wurde sogar ungewiß, ob es überhaupt einzulaufen gedachte und ob irgendwelcher Sinn und Verstand hinter seinen Manövern lag. Der Wind, der während der Nacht eine Kleinigkeit aufgefrischt hatte, war schon wieder schwach und unberechenbar, und die Bewegungen des Schiffs wurden davon immer noch unsicherer.
In der Vermutung, es müsse sich um ein Schiff in Seenot handeln, ließ Kapitän Delano schließlich das Walboot flottmachen; trotz dem vorsichtigen Widerspruch seines Steuermanns hatte er vor, auf dem fremden Segler an Bord zu gehen und ihn, wenn nichts anderes zu tun wäre, in den Hafen zu lotsen. In der Nacht vorher waren einige von seinen Mannschaften zu einer entfernten Klippenpartie hinausgefahren und kurz vor Tagesanbruch mit einem ansehnlichen Fischfang zurückgekehrt. In der Annahme, die Fremden seien vielleicht lang nicht zum Fangen gekommen, packte der gute Kapitän mehrere Körbe mit Fischen als Mitbringsel in sein Boot und ruderte los. Das Schiff trieb weiter auf die blinde Klippe zu; es schien ernstlich in Gefahr, und er trieb seine Leute an und tat alles, die fremden Seeleute auf ihre gefährdete Lage aufmerksam zu machen. Bevor das Boot aber sein Ziel erreichte, war der Wind wieder umgesprungen und hatte, so schwach er war, das Schiff zum Abdrehen gebracht und zugleich die Dunstschwaden wenigstens teilweise zerstreut.
Aus größerer Nähe betrachtet bot das Schiff, seit es sich nun so deutlich von dem Untergrund der bleifarbenen Dünung abhob, mit den da und dort noch umherstiebenden Nebelfetzen ungefähr den Anblick eines weißgetünchten Klostergebäudes bei abziehendem Gewitter, auf bräunlicher Klippe hoch in den Pyrenäen. Die Ähnlichkeit entsprang nicht einfach nur der Phantasie; einen Augenblick lang glaubte Kapitän Delano sogar allen Ernstes, er habe ein Schiff voller Klosterbrüder vor sich. Überm Schanzkleid schien sich's wie von neugierig ausspähenden Gestalten in dunklen Kutten zu drängen, soweit man bei dem Dunst und der Entfernung erkennen konnte, und hinter den offenen Stückpforten gewahrte man deutlich wandelnde Schattenbilder, Dominikanermönchen ähnlich, die durch Kreuzgänge schritten.
Bei weiterer Annäherung freilich wandelte sich der Eindruck, und es wurde offenbar, wie es sich in Wahrheit mit dem Schiffe verhielt. Es war ein spanischer Kauffahrer von der ersten Klasse, der neben anderer wertvoller Fracht eine Ladung Negersklaven von einem Kolonialhafen nach dem andern beförderte. Ein großes und zu seiner Zeit sicher auch sehr schönes Schiff, derengleichen man auf jener Route damals mitunter begegnen konnte: zum Teil waren es ausrangierte Schatzschiffe aus Acapulco, oder auch ehemalige Fregatten der königlich spanischen Flotte, altehrwürdigen Adelspalästen aus Italien vergleichbar, die auch nach dem Niedergang ihrer Herrschaft die Zeichen einstiger Pracht bewahrten. je mehr sich das Walboot näherte, desto ersichtlicher wurde, daß das seltsam hinfällige Aussehen des fremden Schiffs einfach auf eine schauderhafte, überall sichtbare Vernachlässigung zurückzuführen war. Rundhölzer, Tauwerk, große Teile des Schanzkleids sahen förmlich flockig aus, so lang waren sie von Schraper, Teer und Bürste unberührt geblieben. In dem Tal der trockenen Totenbeine, von welchem im Propheten Hesekiel zu lesen steht, schien dies Wunder von einem Schiff dereinstens gebaut und vom Stapel gelaufen.
Auch für seine gegenwärtige Verwendung hatte es offenbar keinen Umbau und keine Veränderung seiner Takelage erfahren. Wie einst war es ein Kriegsschiff, dem Stift eines Froissart entsprungen. Kanonen allerdings sah man keine.
Die Marse waren geräumig, mit den Überresten eines achtseitigen Netzwerks umgittert, das jetzt freilich trostlos in Fetzen hing. Man mochte diese drei Marse hoch oben drei schadhaften Vogelhäusern vergleichen, und wirklich hockte in dem einen auf einer Webeleine ein weißer Vogel, eine sogenannte Dummschwalbe, ein seltsames Geschöpf, das seinen Namen daher führt, weil es von schläfrig-träger, geradezu nachtwandlerischer Wesensart ist, deswegen es denn auch auf See häufig mit der Hand gefangen wird. Die mit reichen Aufbauten versehene Back glich ihrerseits einem alten Turm, der vor Zeiten vom Feind erstürmt und dem Verfall preisgegeben worden war. Achterschiffs schwebten zwei hochgetürmte Quartergalerien mit Säulengeländern, die an vielen Stellen von zunderdürrem Seemoos bewuchert waren, Vorbauten der unbenützten Luxuskajüte, deren Fenster trotz der milden Witterung hinter den kalfaterten Schutzklappen wohlverwahrt lagen, so daß man an verödete Balkone überm Canale Grande zu Venedig denken mußte. Als gewichtigstes Überbleibsel verblichener Größe schließlich gewahrte man eine schildähnliche Heckverzierung, ein weites Oval mit dem Wappen von Leon und Kastilien in überladener Schnitzerei und umrahmt von reichem mythologisch-symbolischem Figurenwerk, als dessen oberste Bekrönung eine satyrähnliche Gestalt mit Maske einem sich windenden, gleichfalls maskierten Geschöpf den Fuß auf den gebeugten Nacken setzte.
Ob das Schiff auch ein Gallionsbild trug oder am Bug unverziert war, blieb ungewiß, weil man es vorn mit Segeltuch abgedichtet hatte, entweder zum Schutz während einer Reparatur, oder einfach, um eine Schadhaftigkeit recht und schlecht zu verbergen. Unter dem Segeltuch kam eine Art Postament zum Vorschein, und an dessen Vorderseite hatte man, wohl als einen Scherz unter den Matrosen, mit Farbe und Kalk in ungelenken Buchstaben die Inschrift hingepinselt »Seguid vuestro jefe« (»Folgt eurem Führer«), während an der Bordwand nicht weit davon in prachtvollen, einst vergoldeten Großbuchstaben der Name des Schiffs angeschrieben stand: San Dominick. In die metallenen Buchstaben hatte sich der Rost wie mit Nägeln tief eingegraben, und Seegras schlingerte in dicken schlammigen Gehängen über den Namen hin, im Leichenwagenrhythmus des schwerrollenden Schiffsrumpfs.
Sie kamen endlich ans Ziel und wurden mit Haken vom Bug nach dem Fallreep mittschiffs gezogen. Dabei fuhren sie, noch einige Handbreit vom Schiffsrumpf entfernt, knirschend auf, als wären sie an ein unsichtbares Korallenriff geraten. Es war ein riesiger Klumpen ineinander verfilzter Entenmuscheln, die dem Schiff unter Wasser anhingen wie ein Auswuchs – ein Zeichen, daß widrige Winde und langdauernde Flauten das Schiff irgendwo auf hoher See festgehalten hatten.
Der Besucher kletterte nach oben und sah sich sogleich von einem Schwarm lärmender Weißer und Schwarzer umgeben, von denen die letzteren in ganz unerwarteter Weise überwogen, auch wenn man in Betracht zog, daß es sich um ein zum Transport von Negern bestimmtes Schiff handelte. Übrigens strömten sie alle in einer Sprache und gleichsam mit einer Stimme über von ihrer Leidensgeschichte, wobei sich die Negerweiber, deren nicht wenige an Bord waren, mit besonderer Schmerzensinbrunst hervortaten. Der Skorbut, zusammen mit einem bösartigen Fieber, habe schwer unter ihnen gewütet, namentlich unter den Spaniern. Auf der Höhe von Kap Horn seien sie mit genauer Not einem Schiffbruch entgangen und später hätten sie tagelang wie verhext in einer Flaute gelegen. Dabei hätten sie nur knappe Vorräte und beinahe kein Wasser mehr gehabt – ihre Lippen seien noch jetzt wie ausgedörrt.
Während Kapitän Delano derart zum Ziel der vielen regen Zungen wurde, nahm er selber mit seinem einen regen Augenpaar alle die vielen Gesichter in sich auf, samt allem, was ihn sonst umgab.
Wenn man auf einem großen, stark bemannten Schiff auf See zum erstenmal an Bord geht, besonders wenn es aus dem Ausland kommt und mit schwer durchschaubaren Leuten, etwa Laskaren oder Filippinos, bemannt ist, so unterscheidet sich der erste Eindruck in einer ganz charakteristischen Weise vom ersten Besuch in einem fremden Haus in fremdem Lande und mit nicht minder fremdländischen Bewohnern. Zwar halten Haus und Schiff – jenes hinter Mauern und Fensterläden, dieses hinter seinem hohen, festungsähnlichen Schanzkleid – ihr Inneres gleichmäßig bis zum letzten Augenblick verborgen, aber beim Schiff kommt noch etwas anderes hinzu: das lebendige Schauspiel in seinem Inneren wirkt, wenn es sich so plötzlich und rückhaltlos enthüllt, im Gegensatz zu dem umgebenden öden Ozean gleichsam verzaubert. Das Schiff scheint unwirklich; die fremdartigen Trachten, Gebärden und Gesichter wirken als Schattenspiel, aus der Tiefe emporgestiegen und der Tiefe alsbald wieder zubestimmt.
Vielleicht empfand auch Kapitän Delano Regungen, wie wir sie eben zu schildern versucht haben, und sah im Lichte einer höheren Bedeutung, was bei nüchterner Untersuchung höchstens ein wenig ungewöhnlich berührt hätte: zum Beispiel die sehr ins Auge springenden Gestalten von vier älteren, grauhaarigen Negern mit Köpfen wie schwärzliches, mooszerfressenes Weidengestrünk, die in sphinxartiger Haltung, ein ehrwürdiges Gegenbild zu dem unter ihnen tobenden Tumult, dahockten, der eine auf dem Steuerbordkranbalken, der zweite an der entsprechenden Stelle backbords, und die beiden andern einander gegenüber auf der Bordwand über den Großrüsten. Sie hatten aufgedröseltes Tauwerk in der Hand und zerzupften es in einer gewissen stoischen Selbstzufriedenheit zu Werg, das neben ihnen langsam zu einem Häuflein anwuchs. Zur Arbeit vollführten sie einen anhaltenden leisen und eintönigen Singsang – ein Brummen und Dröhnen, als bliesen vier grauhaarige Dudelsackspieler einen Trauermarsch.
Das Achterdeck erhob sich zu einer weitläufigen Hütte; auf ihrem vorderen Rande saßen, wie die Wergzupfer in erhabener Höhe thronend, in einer Reihe, acht Fuß hoch überm Gedränge der andern, sechs Schwarze mit untergeschlagenen Beinen – durch regelmäßige Abstände voneinander getrennt. Sie hielten jeder ein rostiges Beil in der Hand und reinigten es mithilfe eines Ziegelscherbens und eines Lumpens, anzusehen wie Küchenjungen beim Geschirrputzen. Zwischen sich hatten sie, je zwei und zwei, ein Häufchen Beile liegen, die rostigen Schneiden nach vorn gekehrt und auf den reinigenden Zugriff wartend. Die vier Wergzupfer richteten dann und wann ein kurzes Wort an einen der Vorübergehenden; die sechs Beilpolierer dagegen sprachen niemanden an und tauschten auch untereinander kein Sterbenswörtchen, sondern saßen stumm in ihre Arbeit vertieft, und ließen nur ab und zu, nach Negerart Arbeit und Zeitvertreib miteinander vereinend, unvermittelt ihre Axt seitwärts gegen die des Nachbars klingen, daß es metallisch dröhnte wie ein Beckenschlag. Alle sechs hatten, sehr zum Unterschied von der Mehrzahl ihrer Gefährten, noch ganz das rohe Aussehen des unzivilisierten, eingeborenen Afrikaners.
Übrigens ruhte der erste prüfende Blick des Betrachters nur ganz kurz auf den zehn erwähnten Gestalten und den vielen weniger auffallenden, die es noch zu sehen gab, denn bald ermüdete den Gast das heillose Durcheinander der vielen Stimmen und er wandte sich von dannen, den Kommandeur des Schiffs zu suchen, wenn es einen solchen Kommandeur überhaupt gab.
Diesem spanischen Kapitän nun schien es gar nicht unlieb zu sein, daß sich die Lage der Dinge unter den leidenden Menschen an Bord so augenfällig kundtat, oder er hatte es fürs erste aufgegeben, gegen die allgemeine Auflösung einzuschreiten – jedenfalls lehnte er, ein vornehm und verschlossen aussehender, auf den Amerikaner reichlich jugendlich wirkender Mann in auffallend üppiger Kleidung, im Gesicht freilich die Spuren schlafloser und sorgenvoller Nächte, tatenlos am Großmast und blickte abwechselnd mit traurigem, verzagtem Ausdruck auf seinen wildgewordenen Haufen und auf den, wie es schien, ohne Freude erwarteten Besucher. Neben ihm stand ein Schwarzer von kleinem Wuchs; jedesmal wenn er, mit der stummen Gebärde eines Wachthunds, zu seinem Herrn aufblickte, waren in seinem groben Gesicht Kummer und liebevolle Besorgnis zu lesen.
Der Amerikaner bahnte sich einen Weg durch die Menge, trat auf den Spanier zu, versicherte ihn seiner Teilnahme und erbot sich gleichzeitig zu jeder nur möglichen Hilfe. Der Spanier erwiderte fürs erste nur mit einigen gravitätisch klingenden Dankesworten; das steife und förmliche Wesen, das seinem Volk eigentümlich ist, war bei ihm gleichsam verdüstert von der Finsternis körperlichen Leidens.
Kapitän Delano verlor weiter keine Zeit mit Komplimenten. Er kehrte ans Fallreep zurück und ließ den Korb mit den Fischen heraufbringen, und da der Wind weiterhin schwach blieb, so daß es bestimmt einige Stunden dauern würde, bis das Schiff richtig vor Anker gebracht war, so hieß er seine Leute zurückrudern und Wasser holen, soviel das Fangboot tragen konnte, dazu alles Weichbrot, das der Steward zur Hand hatte, die noch nicht verzehrten Kürbisse, ein Kistchen Zucker und zwölf Flaschen Apfelwein aus seinem persönlichen Vorrat.
Das Boot war eben fortgerudert, als sich der Wind zum allgemeinen Verdruß vollends legte und die eintretende Ebbe das Schiff von neuem hilflos seewärts trieb. Kapitän Delano verließ sich indessen darauf, daß dieser Zustand nicht allzulang dauern würde, und machte den Fremden nach Kräften Mut, wobei es ihn nicht wenig befriedigte, daß er sich mit ihnen gerade in ihrer gegenwärtigen Lage dank seinen häufigen Fahrten an der spanischen Küste Südamerikas ziemlich unbefangen in ihrer Muttersprache unterhalten konnte.
Seit er mit ihnen allein war, fiel ihm so mancherlei auf, was geeignet war, ihn in seinen ersten Eindrücken zu bestärken. Doch machte sein anfängliches Befremden bald einem tiefen Mitleid Platz, und zwar mit Spaniern und Schwarzen gleichermaßen, weil er wohl merkte, daß sie ohne Ausnahme von Wasser- und Nahrungsmangel schwer mitgenommen waren. Bei den Negern waren infolge der dauernden Entbehrungen ersichtlich auch die weniger erfreulichen Eigentümlichkeiten ihrer Natur ans Licht getreten, während gleichzeitig die Autorität des spanischen Kapitäns ganz offensichtlich gelitten hatte. Wie die Dinge lagen, war gar nichts anderes zu erwarten. In Kriegsheeren und Flotten, in Städten und Familien, ja in der Natur selbst wirkt nichts so auflösend auf Zucht und Ordnung wie die Not. Allerdings konnte sich Kapitän Delano des Gefühls nicht erwehren, daß bei größerer Energie des jungen Benito Cereno die Mißwirtschaft schwerlich so tief eingerissen wäre. Seine Schlappheit, mochte sie nun in seiner Natur liegen oder auf die durchgemachten Nöte körperlicher und seelischer Art zurückgehen, war nur allzu augenscheinlich. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit schien ihn völlig in den Fängen zu halten; offenbar hatten ihn seine Hoffnungen so lange genarrt, daß er sich jetzt, wo sie ihn nicht länger narren würden, keinen Erwartungen mehr hingeben mochte und auch die Aussicht, noch im Lauf des Tages oder spätestens am Abend sicher vor Anker zu liegen, mit Wasser versorgt zu werden und einen Berufsgenossen als Ratgeber und Helfer in der Nähe zu wissen, ohne ersichtliche Freude zur Kenntnis nahm. Sein Geist hatte etwas Schweifendes; es war aber auch denkbar, daß er dauernden Schaden genommen hatte. In die Wände aus Eichenholz eingesperrt, an seinen zur Routine erstarrten Kommandoposten gefesselt, dessen unumschränkte Gewalt ihm schon zum Überdruß war, schlich er herum wie der hypochondrische Abt eines Klosters, blieb manchmal unvermittelt stehen, zuckte zusammen, starrte ziellos vor sich hin, biß sich auf die Lippen, nagte an den Fingernägeln, zwirbelte seinen Bart, wurde abwechselnd rot und blaß und zeigte überhaupt alle Symptome eines unsteten in Schwermut entrinnenden Geistes. Diese zerrüttete Seele wohnte, wie schon angedeutet, in einem nicht minder zerrütteten Gehäuse. Er war ziemlich groß, machte aber nicht den Eindruck, als wäre er je wirklich kräftig gewesen, und sah nun, infolge seines krankhaften Gemütszustandes, nur noch wie Haut und Knochen aus. Wie es schien, war ein heimliches Lungenleiden bei ihm in letzter Zeit endgültig zum Durchbruch gekommen. Seine Stimme jedenfalls klang, als atmete er nur noch mit halber Lunge – heiser und gepreßt, ein rauhes Flüstern. So brauchte es einen nicht zu erstaunen, daß hinter dem dergestalt hilflos Einherwankenden der Leibdiener in seiner Besorgnis auf Schritt und Tritt herlief. Er reichte ihm manchmal den Arm, zog ihm auch das Taschentuch aus der Tasche und bezeugte bei diesen und ähnlichen Handreichungen einen fürsorglichen Eifer, der auch aus an sich untergeordneten Dienstleistungen Taten der Pietät und Brüderlichkeit werden ließ. Den Negern hat diese besondere Gabe den Ruf eingetragen, daß sie die angenehmsten Kammerdiener von der Welt sind; der Herr braucht sich ihnen gegenüber nicht einmal sehr von oben herab zu benehmen, sondern kann sie als nahestehende Vertrauenspersonen behandeln – als handle es sich um treuergebene Familiengenossen und nicht um Diener.
Kapitän Delano erinnerte sich wohl daran, wie laut und störrisch es unter den Schwarzen auf dem Schiff sonst zuging; er überlegte weiterhin, wie mürrisch und tatenlos die Weißen sich verhielten – und damit verglichen machte die ruhige und verständige Aufführung des Negers Babo einen menschlich recht erfreulichen Eindruck auf ihn.
Indessen schien auch Babos Wohlverhalten kaum mehr als die Disziplinlosigkeit der übrigen Mannschaft dazu angetan, den wie in Betäubung wandelnden Don Benito aus seiner traumversponnenen Wolkenwelt herauszureißen. Nicht als ob der Besucher genau diesen Eindruck von dem Spanier empfangen hätte. Die in ihm umgehende Unruhe wirkte auf den Betrachter zunächst nur als ein besonders auffälliger Zug in der auf dem Schiff herrschenden allgemeinen Verwilderung. Nur das eine gab Kapitän Delano zu denken, daß Don Benito ihm gegenüber eine, wie er sich sagen mußte, schon geradezu unfreundliche Gleichgültigkeit an den Tag legte. Aus seinem Verhalten sprach obendrein eine Art säuerlicher, übellauniger Geringschätzung, die er offenbar nicht einmal zu verbergen trachtete. Der Amerikaner schrieb es in seiner Nächstenliebe den Auswirkungen der Krankheit zu. Er hatte des öfteren beobachtet, daß bei gewissen Naturen ein langanhaltendes körperliches Leiden den geselligen Instinkt der Güte völlig überdeckt, so daß sie es, wenn sie schon selber vom schwarzen Brote zehren müssen, nur für recht und billig halten, daß jedermann, der in ihre Nähe kommt, gleichfalls gekränkt und vernachlässigt wird und so mittelbar auch an ihrer Elendskost teilnimmt.
Schon nach kurzem Überlegen kam Kapitän Delano übrigens zu der Vermutung, daß er vielleicht, so nachsichtig er den Spanier von vornherein beurteilt hatte, immer noch zu wenig Mitgefühl ihm gegenüber walten ließ. Was ihn verdroß, war Don Benitos reserviertes Wesen; aber es äußerte sich jedermann gegenüber, mit Ausnahme seines treuen Leibdieners. Wenn ihm zum Beispiel, wie es auf See üblich ist, zu gewissen festgesetzten Zeiten von einer Ordonnanz – einem Weißen, Mulatten oder Neger – der fällige Rapport erstattet wurde, hörte er mit sichtlicher Ungeduld zu und gab deutlich zu erkennen, wie unerwünscht ihm die Störung war. Ähnlich mochte sich dereinst sein kaiserlicher Landsmann, Karl der Fünfte, verhalten haben, zu der Zeit, da er dem Thron entsagte und sich zu seinem weltabgeschiedenen Eremitenleben rüstete.
Es war ein durch und durch lustloses und gramvolles Verhältnis der eigenen Stellung gegenüber, und es kam in fast jeder dienstlichen Handlung des Kapitäns zum Ausdruck. Zu seiner Schwermut gesellte sich ein starrer Stolz, der ihn abhielt, sich etwa persönlich mit der Befehlsübermittlung abzugeben. Erwies sich ein außerordentliches Kommando als nötig, so lag seine Weitergabe in den Händen des Leibdieners, der es durch Läufer an den Bestimmungsort übermittelte, weshalb immer eine Schar von Botenjungen, junge Spanier oder Sklaven, in Rufweite um Don Benito herumschwärmten, wie Pagen oder wie jene Lotsenfische, von denen man sagt, sie zeigten dem Haifisch den Weg. Er selber aber schlich teilnahmslos und schweigend herum, ein unauffälliger, kranker Mensch – und kein zur See Unbewanderter wäre im entferntesten auf den Gedanken gekommen, daß in ihm eine unumschränkte Machtvollkommenheit versammelt lag, gegen die es, so lange das Schiff auf See war, keine Berufung gab.
Hielt man dem gegenüber sein zurückhaltendes, abweisendes Verhalten, so mußte man in ihm wohl oder übel das Opfer einer seelischen Erkrankung erkennen. Doch konnte es auch möglich sein, daß seine Zurückhaltung bis zu einem gewissen Grad vorbedachter Absicht entsprang. Wenn dem so war, dann tat sich hier, in ungesunder Übersteigerung, jene eiskalte, peinlich ausgeklügelte Berufspraxis kund, die sich die Befehlshaber größerer Schiffe eigentlich alle zu eigen machen. Sie besteht darin, daß man, abgesehen von ganz eklatanten Notfällen, jedes Betonen der Befehlsgewalt und gleichzeitig auch jedes Hervorkehren menschlich liebenswürdiger Züge unterläßt und sich sozusagen in einen Holzklotz verwandelt, oder sagen wir besser, in eine geladene Kanone, welche nichts zu sagen hat, so lange es ihres Donners nicht bedarf.
In diesem Licht betrachtet, mochte es nur der natürliche Ausdruck einer lang und streng geübten Selbstbeherrschung und der daraus entwickelten starren Gewohnheit sein, wenn Don Benito auch jetzt, ganz ohne Rücksicht auf den derzeitigen Zustand seines Schiffes, ein Verhalten an den Tag legte, das an sich zwar harmlos und bei einem tadellos ausgerüsteten Schiff vielleicht sogar zweckmäßig war, zum gegenwärtigen Zustand der San Dominick aber eben einfach nicht passen wollte. Möglicherweise hielt es der Spanier mit der Ansicht, daß für Kapitäne dasselbe gelte wie für Götter: daß vornehme Zurückhaltung unter allen Umständen ihre Parole bleiben müsse. Wahrscheinlicher aber war, daß sich hinter dem Anschein einer im Schlaf versunkenen Befehlsgewalt einfach das Gefühl der eigenen geistigen Unzulänglichkeit verbarg – daß es sich also nicht um wohlüberlegte Taktik handelte, sondern um einen kümmerlichen Notbehelf. Mochte dem nun sein, wie ihm wollte, mochte Don Benitos Art bewußter Absicht entspringen oder nicht – für Kapitän Delano jedenfalls war es, je länger er den Spanier in seiner undurchdringlichen Reserviertheit beobachtete, immer weniger beunruhigend, daß sich diese Reserviertheit auch ihm gegenüber äußerte.
Auch wurden seine Gedanken beileibe nicht von dem fremden Kapitän allein in Anspruch genommen. Von seinem Robbenfänger her, wo die Leute wie eine große Familie friedlich beisammenlebten, war er an Ruhe und Ordnung gewöhnt, und immer wieder beleidigte es sein Auge, daß unter dem demoralisierten Haufen auf der San Dominick eine derartig geräuschvolle Verwilderung herrschte. Grobe Verstöße gegen die Disziplin nicht nur, sondern gegen den gewöhnlichsten Anstand waren zu beobachten. Kapitän Delano mußte es sich damit erklären, daß es auf dem Schiff ganz an jenen subalternen Deckoffizieren fehlte, denen auf einem stark besetzten Schiff außer anderen, höheren Pflichten das Polizeiwesen, wie man es nennen könnte, anvertraut ist. Die alten Wergzupfer übernahmen zwar, wie es schien, manchmal ihren Landsleuten, den Negern, gegenüber das Amt des Gewissenspolizisten und vermochten dann und wann kleinere Streitigkeiten von Mann zu Mann zu beschwichtigen; allgemeine Zucht und Ordnung heraufzuführen, gelang ihnen aber so gut wie gar nicht. Die San Dominick befand sich in der Lage eines transatlantischen Auswandererschiffs: auch da sind unter der vielköpfigen Menschenfracht zweifellos zahlreiche Einzelne, die so wenig Grund zur Beanstandung bieten, als wären sie wirklich nur Ballen und Kisten; sie richten aber mit all ihrem freundlichen Zureden bei ihren weniger zartbesaiteten Gefährten durchaus nicht das aus, was der Steuermann mit rücksichtslosem Arm bewirkt. Auf der San Dominick fehlte es an dem, was das Auswandererschiff allerdings aufzuweisen hat: an energischen höheren Offizieren. Auf ihren Decks war nicht einmal ein Vierter Steuermann zu erblicken.
Bei dem Besucher weckte es das Bedürfnis, die näheren Unglücksumstände zu erfahren, die den besagten Mangel an Offizieren und die damit zusammenhängenden Mißstände verursacht hatten. Das allgemeine Wehklagen, das ihn bei seinem Eintreffen begrüßt hatte, vermittelte ihm allerdings eine gewisse Vorstellung von der Unglücksfahrt, doch war ihm noch keine nähere Erklärung zuteil geworden. Am besten würde sicher der Kapitän Auskunft geben können; doch mochte sich der Besucher nicht gern an ihn wenden, weil er sich nicht eine hochmütig abweisende Antwort zuziehen wollte. Er faßte sich indessen ein Herz, trat auf Don Benito zu, versicherte ihn aufs neue seiner Teilnahme und Hilfsbereitschaft und erklärte ihm anschließend, es werde sich vielleicht empfehlen, daß er, Kapitän Delano, in die Unglücksfahrt des Schiffs etwas näher eingeweiht werde, weil er dann vielleicht besser in der Lage sei, zu helfen und die Not zu lindern. Don Behrto möge ihm sein Vertrauen schenken und die Geschichte von A bis Z erzählen.
Der Angeredete begann eine Antwort zu stammeln, unterbrach sich dann, starrte den Besucher wie ein plötzlich wachgerufener Nachtwandler geistesabwesend an und schlug den Blick sogleich auf die Deckplanken nieder. In dieser Stellung verharrte er, und Kapitän Delano, angesteckt von seiner Unsicherheit, sah sich schließlich keinen anderen Ausweg, als gleichfalls alle Höflichkeit fahren zu lassen: er wandte sich kurzerhand von ihm ab und trat auf einen von den spanischen Matrosen zu, von dem er die gewünschte Auskunft zu erhalten hoffte. Kaum war er indessen fünf Schritt weit gegangen, als ihn Don Benito mit plötzlich erwachter Teilnahme zurückrief, für seine vorübergehende Geistesabwesenheit um Entschuldigung bat und sich bereit erklärte, seine Bitte zu erfüllen.
Während er seine Geschichte vortrug, standen die beiden Kapitäne fast die ganze Zeit auf dem rückwärtigen Teil des Hauptdecks, einem für gewöhnliche Sterbliche nicht zugänglichen Ort. Nur der schwarze Diener war Zeuge ihrer Unterredung. »Es ist jetzt hundertundneunzig Tage her«, begann der Spanier mit seiner heiseren Flüsterstimme, »daß unser Schiff, vollzählig an Offizieren und Mannschaften, mit einer Reihe von Kajütpassagieren – fünfzig Spanier waren wir alles in allem – von Buenos Aires nach Lima in See ging. Wir hatten gemischte Fracht: Eisenwaren, Matetee und anderes, und außerdem –« er deutete nach vorn – »– unsere Partie Neger, jetzt nur noch hundertundfünfzig an der Zahl, damals aber über dreihundert Seelen stark. Bei Kap Horn gerieten wir in schweren Sturm. Bei Nacht verlor ich auf einen Schlag drei meiner besten Offiziere und fünfzehn Mann mit der Großrah: die Spiere krachte mitsamt den Stroppen durch, als sie versuchten, das vereiste Segel mit Hievern einzuholen. Um das Schiff zu erleichtern, warfen wir die schwereren Matesäcke über Bord, ebenso die meisten Wasserschläuche, die auf Deck verzurrt lagen. Das ist uns übel bekommen, denn da wir nachher lang festgehalten wurden, hat das Fehlen des Wasservorrats am meisten dazu beigetragen, daß es zur Katastrophe kam. Als wir nämlich ...«
In diesem Augenblick unterbrach ihn ein jäher Hustenanfall, der sicher auf die von ihm durchgemachten seelischen Nöte mit zurückging. Der Diener stützte ihn; er zog ein stärkendes Mittel aus der Tasche und führte es ihm an die Lippen. Der Leidende erholte sich einigermaßen; doch schien es der Schwarze noch nicht wagen zu wollen, ihn in diesem Zustand halber Schwäche ohne Stütze zu lassen, und er hielt weiter den Arm um seinen Herrn geschlungen und blickte ihm dabei forschend ins Antlitz, um jedes erste Zeichen der völligen Erholung, oder auch eines neuen Rückfalls, sofort zu erspähen.
Der Spanier fuhr in seiner Erzählung fort, aber stockend und in rätselhaften Wendungen, wie einer, der im Traum spricht.
»Gott im Himmel! Was ich durchgemacht habe – lieber den schwersten Sturm, als das noch einmal durchmachen! Wenn ich Ihnen sage ...«
Der Husten stellte sich mit vermehrter Wucht ein und wollte lang nicht weichen. Mit unnatürlich geröteten Lippen und geschlossenen Augen ließ er sich seinem Beschützer an die Brust sinken.
»Sein Geist wandert. Er denkt an die Seuche nach dem Sturm«, flüsterte der Diener mit bekümmertem Ausdruck. »Der arme, arme Herr!« – er hob wehklagend die Hand, während er mit der andern eine wischende Bewegung über den Mund vollführte. »Haben Sie bitte Geduld, Sennor« – er wandte sich von neuem an Kapitän Delano. – »Die Anfälle dauern nicht lang. Der Herr wird gleich wieder bei sich sein.« Don Benito erholte sich in der Tat wieder und fuhr in seiner Geschichte fort. Da er aber die folgenden Teile seines Berichts sehr stockend von sich gab, soll hier nur der Inhalt seinem Kern nach wiedergegeben werden.
Offenbar war nach den tagelangen Stürmen am Kap Horn auf dem Schiff der Skorbut ausgebrochen und hatte unter den Weißen und Schwarzen zahlreiche Opfer gefordert. Als sie sich endlich in den Pazifik durchgearbeitet hatten, waren Spieren und Segel so stark beschädigt und von den am Leben gebliebenen, größtenteils noch kranken Matrosen so unzulänglich bedient, daß das hilflos gewordene Schiff nicht beim Wind auf Nordkurs zu halten war, sondern viele Tage und Nächte lang nach Nordwesten getrieben wurde, wo der bis dahin starke Wind plötzlich aufhörte und sie in unbekannten Gewässern in einer tropisch heißen Flaute liegen ließ. Das Fehlen der Wasserschläuche erwies sich jetzt als verhängnisvoll, während sie damals als Ballast verhängnisvoll geschienen hatten, denn die mehr als dürftige Zuteilung an Wasser ließ auf den Skorbut ein bösartiges Fieber folgen oder leistete ihm wenigstens Vorschub. Bei der unerträglichen Hitze, die während der Windstille herrschte, hatte die Krankheit leichtes Spiel und fegte, wie mit Wogenschwall, ganze Familien von Negern über Bord, von den Spaniern aber im Verhältnis sogar eine noch größere Anzahl, darunter unglückseligerweise die sämtlichen noch an Bord befindlichen Offiziere. Als dann nach der Windstille steife westliche Winde einsetzten, war man nicht mehr in der Lage, die schon ziemlich mitgenommenen Segel ordnungsmäßig zu beschlagen, sondern mußte sie einfach hängen lassen, und so gerieten sie schließlich in den gegenwärtigen zerlumpten und bettlerhaften Zustand. Um für die verlorenen Matrosen Ersatz zu beschaffen und Wasser und Besegelung zu erneuern, hatte der Kapitän bei erster Gelegenheit Kurs auf Valdivia genommen, den südlichsten brauchbaren Hafen von Chile und Südamerika, aber bei der Annäherung an die Küste war das Wetter so diesig geworden, daß sie den Hafen nicht einmal sichteten. Seitdem war die San Dominick, beinahe ohne Tuch und ohne Mannschaft, so gut wie ohne Wasser und nur manchmal damit beschäftigt, der See neue Tote darzubringen – wie ein Spielball von den widrigen Winden herumgeworfen und von Strömungen verschlagen worden, wenn sie nicht in neue Flautenzonen geriet und dort versumpfte. Wie ein im Walde verirrter Mensch war sie mehr als einmal auf die eigene frühere Spur geraten. »Und doch«, fuhr Don Benito heiser fort und wand sich wie in einem Krampfanfall in der halben Umarmung seines Dieners, »und doch bin ich bei allen diesen Widerwärtigkeiten, die wir erlebt haben, unseren Negern hier Dank schuldig, denn wenn sie auch für ihren erfahrenen Blick etwas Zuchtloses haben mögen, so haben sie sich doch weit gesitteter aufgeführt, als es selbst ihr Eigentümer unter solchen Umständen hätte für möglich halten können!«
Er sank von neuem ermattet zurück. Sein Geist schien sich wieder zu verlieren, doch kam er bald zu sich und fuhr, klarer als bisher, fort:
»Er hat ganz recht gehabt, der Eigentümer, als er mir versicherte, bei seinen Schwarzen würde ich keine Fesseln brauchen. Darum haben wir auch, wie es in diesem Transportzweig ohnehin üblich ist, die Neger nicht nur immer oben auf Deck gelassen – während sie auf den Sklavenfängern nach unten gestopft werden – sondern wir haben sie auch von Anfang an in gewissen Grenzen frei herumlaufen lassen.«
Wieder ein Schwächeanfall, wieder die seltsame Geistesabwesenheit – dann atmete er auf und fuhr fort.
»Nächst Gott danke ich es aber meinem Babo hier, wenn ich bewahrt geblieben bin – und ihm gebührt auch das Hauptverdienst, daß die Unwissenderen unter seinen Kameraden, wenn sie gelegentlich aufbegehren wollten, rasch wieder zur Raison gebracht waren.«
»Eia, Herr«, hauchte der Schwarze und senkte das Antlitz, »nicht von mir sprechen! Babo hat nichts zu sagen, was Babo getan hat, war nur Pflicht.«
»Treuer Bursche!«, sagte Kapitän Delano anerkennend. »Don Benito, ich beneide Sie um solch einen Freund – einen Sklaven möchte ich ihn nicht nennen.«
Wie sie so vor ihm standen, Herr und Diener, der Schwarze die Stütze des Weißen, drängte es sich ihm mit Macht auf, welch schönes Verhältnis sich da offenbarte: ein Schauspiel der Treue hie, des Vertrauens dort. Und zwar umso markanter bei dem betonten Unterschied in der Kleidung der beiden, aus dem der Rangunterschied zwischen ihnen deutlich zu erkennen war. Der Spanier trug eine weite chilenische Jacke aus dunklem Samtstoff, dazu weiße Kniehosen und Strümpfe, mit silbernen Schnallen an Knie und Schuhverschluß. Seinen Kopf bedeckte ein hoher Sombrero aus feinem Stroh. Ein schmaler Degen, silberbeschlagen, hing aus einem Knoten seiner Schärpe – dieses so gut wie unentbehrlichen Zubehörs, das bis zum heutigen Tag, mehr der Nützlichkeit dienend als dem Schmuck, unweigerlich zur Männerkleidung in Südamerika gehört. Wenn nicht gerade die ihn von Zeit zu Zeit befallenden nervösen Zuckungen seine Kleidung in Unordnung brachten, lag über seiner äußeren Erscheinung ein gewisser Hauch der Adrettheit, in seltsamem Gegensatz zu der ringsum herrschenden peinlichen Schlamperei. Der Eindruck war besonders stark angesichts der vor dem Hauptmast gelegenen verwahrlosten Schiffsteile, dieses ausschließlich von Schwarzen bevölkerten Ghettos.
Der Diener hatte nichts weiter an als ein Paar weite Hosen, die, dem groben Stoff und den mannigfachen Flicken nach zu urteilen, aus einem alten Marssegel angefertigt waren. Übrigens waren sie sauber und mit einem groben Strick um den Leib gegürtet. Zusammen mit dem gesetzten, zuweilen wohl auch mitleidheischenden Gesichtsausdruck gab es dem Schwarzen ein wenig das Aussehen eines Bettelmönchs vom Orden des Heiligen Franziskus.
Für die augenblicklichen Umstände und zum mindesten für den Blick des nüchtern denkenden Amerikaners mochte Don Benitos Aufmachung mithin ziemlich unzweckmäßig erscheinen, ein seltsames Überbleibsel inmitten solch trauriger Verwüstung – doch mußte man zugeben, daß sie, ihrem Charakter nach, nicht über das hinausging, was damals bei Südamerikanern seines Standes gang und gäbe war. Zwar hatte er seine letzte Reise von Buenos Aires aus angetreten, er hatte sich aber als gebürtigen und ansässigen Chilenen bezeichnet, und gerade bei den Chilenen waren der bürgerliche Rock und die langen Hosen, dieses einstige Kennzeichen des Plebejertums, noch nicht so allgemein in Aufnahme gekommen; sie hielten noch, mit gewissen schicklichen Abwandlungen, an ihrer Landestracht fest, die an malerischem Reiz auf der Welt ihresgleichen suchte. Und doch: gemessen an der fahlleuchtenden Geschichte seiner Schiffsreise, gemessen an seinem eigenen fahlen Antlitz hatte des Spaniers äußere Erscheinung etwas durchaus Widersinniges, so daß man an einen kranken Hofmann denken konnte, der zur Zeit der großen Pest durch Londons Straßen wankt.
Der auffallendste und wohl auch überraschendste Teil von Don Benitos Erzählung war die anhaltende Windstille, von der er gesprochen hatte und die in jenen Breiten ungewöhnlich war, und die lange ziellose Drift des Schiffs. Zwar hütete sich der Amerikaner natürlich, etwas von seinem Verdacht zu äußern, insgeheim aber mußte er wohl oder übel wenigstens einen Teil der Hemmnisse auf ungenügende seemännische Tüchtigkeit und fehlerhafte Navigation zurückführen. Bei einem Blick auf Don Benitos schmale, gelbliche Hände kam er ohne viel Schwierigkeit zu dem Schluß, daß der junge Kapitän wohl nicht von der Pike auf gedient, sondern auf bequemere Weise seinen Posten erlangt hatte. Wenn dem so war, brauchte man sich nicht weiter zu verwundern, daß Jugendlichkeit, Kränklichkeit und Kastendünkel hier in holdem Verein ein tatsächliches Versagen bewirkt hatten.
Indeß ließ Kapitän Delano alle kritischen Überlegungen in einem neuen, großen Aufwallen seines Mitgefühls untergehen. Die Leidensgeschichte schien zu Ende erzählt; nun hielt er es nicht für genug, Don Benito und die Seinen wie ursprünglich versprochen mit dem Nötigsten zu versehen, sondern er machte sich überdies anheischig, ihm fortlaufend einen auskömmlichen Vorrat von Wasser und das Dringendste an Segeln und Takelage zu verschaffen. Außerdem wolle er, obwohl es ihn nicht wenig in Verlegenheit bringen würde, drei von seinen besten Leuten zur Aushilfe als Deckoffiziere abgeben. Das Schiff könne dann ohne Verzug nach Concepcion steuern und sich dort zur Weiterreise nach Lima, seinem Bestimmungshafen, fertig machen.
Das großmütige Angebot verfehlte nicht seine Wirkung, mehr als man es bei Don Benitos hinfälligem Zustand erwarten mochte. Das Antlitz des Kranken leuchtete auf; ein freudig, ja fieberisch glänzender Blick begegnete dem ruhig-freundlichen seines Besuchers. Fast schien ihn die Dankbarkeit zu übermannen.
»Die Aufregung nicht gut für den Herrn«, flüsterte der Diener. Er nahm den Leidenden beim Arm und führte ihn mit begütigenden Worten bei Seite.
Als Don Benito wieder erschien, mußte der Amerikaner zu seinem Kummer feststellen, daß das Hoffnungslicht in ihm, gleich der jähen Glut seiner Wangen, nur eine vorübergehende, fieberhafte Erscheinung war.
Mit freudlosem Blick zur Schiffshütte emporstarrend forderte er seinen Gast auf, er möge ihm dorthin folgen und in seiner Gesellschaft den leichten Windhauch genießen, der dort oben wehen mochte.
Kapitän Delano war während des Zuhörens immer wieder zusammengeschrocken, wenn die Beilputzer ihren klingenden Beckenschlag vollführten, und hatte sich gewundert, daß sie sich eine solche störende Unterbrechung erlauben durften, noch dazu in dieser geheiligten Region des Schiffs und vor den Ohren ihres leidenden Kapitäns. Die Äxte waren durchaus kein einladender Anblick, und die sie in den Händen schwangen, noch viel weniger – so kam es denn, daß Kapitän Delano, die Wahrheit zu sagen, zwar scheinbar bereitwillig, in Wirklichkeit aber mit einem unbestimmten Widerwillen, ja Schaudern der Einladung seines Gastgebers folgte. Zu allem Überfluß legte Don Benito gerade in diesem Augenblick eine ganz unangebrachte zeremoniöse Förmlichkeit an den Tag, die mit seinem todgeweihten Äußeren im traurigsten Widerspruch stand, und nötigte seinen Gast unter wahrhaft kastilianischen Bücklingen, vor ihm die Leiter zu dem Decksaufbau hinaufzuklettern. Oben aber, rechts und links von der obersten Stufe, hockten als Wappenträger und Schildwachen, zwei von dem verdächtigen Gelichter. Mit etwas spitzem Stechschritt passierte der gute Kapitän Delano zwischen ihnen hindurch, und in dem Augenblick, als er sie hinter sich ließ, fühlte er, wie beim Spießrutenlaufen, ein ominöses Zucken seiner Wadenmuskeln.
Nachher freilich, als er sich umwandte und die sechse wie nebeneinanderhockende Drehorgelspieler stur in ihre Arbeit versunken sah, sichtlich gleichgültig gegen alles ringsum Geschehende, mußte er innerlich lachen über seine kaum überwundene Panik.
In solchen Gedanken stand er noch neben seinem Gastgeber und blickte über die unter ihm liegenden Decks hin, als ihm unvermutet einer jener Fälle von Insubordination ins Auge sprang, deren vorhin gedacht worden ist. Bei der Luke saßen drei Negerjungen mit zwei spanischen Schiffsjungen und scharrten eine grobe Holzschüssel aus, in der man irgend eine kümmerliche Mahlzeit zubereitet hatte. Einen von den Schwarzen schien eine Bemerkung zu erbosen, die einer von den weißen Kameraden gemacht hatte; er griff nach einem Messer und hieb es dem andern, obwohl einer von den Wergzupfern ihm versöhnlich zuredete, mit Macht über den Kopf, so daß jener aus einer klaffenden Wunde zu bluten begann.
Kapitän Delano war wie erstarrt und wandte sich fragend an Don Benito. Dieser war blaß geworden und erklärte mit dumpfer Stimme, das seien halt so Jungensstreiche.
»Aber recht ernste Jungensstreiche, muß ich sagen«, versetzte Kapitän Delano. »Wenn bei uns auf der »Bachelor's Delight« dergleichen vorgekommen wäre, hätte die Strafe nicht auf sich warten lassen.«
Bei diesen Worten wandte der Spanier, wie er manchmal tat, dem Amerikaner unvermittelt einen langen, halbirren Blick zu. Er sank sogleich wieder in seine Starre zurück und sagte nur: »Sicher, sicher, Sennor!«
Der Unselige!, dachte Kapitän Delano. Ist er vielleicht eine Art Schießbudenkapitän, wie es manche gibt – einer von denen, die aus Diplomatie ein Auge zudrücken, wo sie mit Gewalt doch nichts ausrichten? Nichts Traurigeres als ein Kommandeur, der nur dem Namen nach das Kommando führt.
»Ich möchte meinen, Don Benito«, sagte er und blickte angestrengt nach dem Wergzupfer, der sich in den Streit der Schiffsjungen einzumischen versucht hatte, »ich möchte meinen, daß es vielleicht von Vorteil wäre, wenn Sie alle Ihre Schwarzen, namentlich die Jüngeren, beschäftigt hielten, gleichgültig ob es sich um überflüssige Arbeit handelt und was sonst mit dem Schiff geschieht. Sie müssen wissen, auch ich bei meinem kleinen Haufen finde diese Maßregel unentbehrlich. Ich habe einmal die ganze Mahnschaft auf dem Achterdeck für meine Kajüte Matten spicken lassen, während ich schon seit drei Tagen das ganze Schiff – mit Mann und Maus und Matten – verloren gab, weil wir in einen wüsten Sturm geraten waren, vor dem wir uns nur hilflos treiben lassen konnten.«
»Gewiß, gewiß«, murmelte Don Benito.
»Allerdings«, fuhr Kapitän Delano fort und blickte wieder nach den Wergzupfern und diesmal auch nach den in der Nähe sitzenden Beilputzern, »einige von Ihren Leuten erhalten Sie ja immerhin beschäftigt.«
»Ja« – die Antwort klang wieder recht geistesabwesend.
»Die alten Männer da, unten auf ihrer Kanzel«, fuhr Kapitän Delano fort und deutete auf die Wergzupfer, »spielen wohl die Rolle von Schulmeistern, wenn sie sicher auch manchmal tauben Ohren predigen. Ist das wohl ihr freier Wille, Don Benito, oder haben Sie sie eingesetzt – als Hirten über Ihre Herde schwarzer Schafe?«
»Was sie tun, das tun sie auf mein Geheiß«, erwiderte der Spanier mit einer gewissen Bitterkeit, als wittere er einen versteckten spöttischen Vorwurf.
»Und die andern da, diese Aschantizauberer?« fuhr Kapitän Delano fort und musterte mit Mißbehagen, wie es in den Händen der Äxteschleifer von keck geschwungenen, da und dort schon scharf aufblitzenden Stahlklingen zuckte. »Sieht komisch aus, was die Burschen da treiben, Don Benito!«
»Bei dem stürmischen Wetter«, gab der Spanier zur Antwort, »haben Ladung und Zubehör, soweit sie nicht über Bord gingen, vom Salzwasser schwer gelitten. Ich habe drum, seit wir wieder Flaute hatten, jeden Tag einige Kasten mit Messern und Beilen heraufbringen und gründlich durchsehen und putzen lassen.« »Wie vorsorglich, Don Benito! Sie sind wahrscheinlich an Schiff und Ladung selbst beteiligt? An den Sklaven aber wohl nicht, oder?«
»Was Sie hier sehen, gehört alles mir«, antwortete Don Benito nicht ohne Ungeduld. »Außer dem großen Haufen der Schwarzen. Die haben meinem verstorbenen Freund Alexander Aranda gehört.«
Der Name schien einen tiefen Schmerz in ihm wachzurufen. Seine Knie begannen nervös zu zittern; der Diener mußte ihn stützen.
Kapitän Delano schien es nicht zweifelhaft, was den Spanier derartig bewegte, und um sich bestätigen zu lassen, was er eigentlich schon wußte, fragte er nach einem kurzen Schweigen: »Sie haben vorhin von Kajütpassagieren gesprochen, Don Benito – darf ich fragen, ob auch der Freund, dessen Verlust Sie so bewegt, unter den Mitreisenden war und seine Schwarzen begleitet hat?«
»Ja.«
»Und ist auch am Fieber gestorben?«
»Auch am Fieber gestorben. Könnte ich nur bloß ...«
Ein Zittern durchbebte den Spanier. Er konnte nicht weiter sprechen.
»Ich will mich nicht einmischen«, sagte Kapitän Delano mit gesenkter Stimme, »aber ich glaube, ich habe Ähnliches erlebt, Don Benito, und kann deshalb mitfühlen, was Ihren Schmerz so besonders bitter macht. Auch ich habe das Unglück gehabt, auf See einen lieben Freund zu verlieren, meinen leiblichen Bruder, er war Kargadeur. An seinem Seelenheil brauchte ich nicht zu zweifeln; was das betrifft, hätte ich sein Hinscheiden mannhaft ertragen können. Aber zu denken, daß sein ehrliches Auge, seine brave Hand – wie oft hatte sie in der meinen geruht! – und daß sein warmes Herz, daß das alles, wie Abfall vor die Hunde, den Haifischen vorgeworfen werden mußte! Ich habe mir damals geschworen, ich würde niemals wieder einen geliebten Menschen mit auf die Reise nehmen, es sei denn, ich hätte zuvor hinter seinem Rücken jede Vorkehrung getroffen, daß bei einem Unglücksfall seine sterblichen Überreste einbalsamiert und später an Land beerdigt würden. Wenn Sie die Überreste Ihres Freundes noch hier an Bord hätten, Don Benito, würde die Nennung seines Namens Sie gewiß nicht so seltsam bewegen.«
»Hier an Bord?« wiederholte der Spanier. Ein Zucken und Schaudern überkam ihn, als wehre er Gespenster ab, und er sank besinnungslos seinem Diener in die ausgestreckten Arme. Der schlug einen vorwurfsvollen Blick zu Kapitän Delano auf, als ersuchte er ihn, künftig kein Thema mehr zu berühren, das seinem Herrn so unaussprechlich zu Herzen ging.
Der arme Kerl!, dachte der Amerikaner mit einem gewissen Befremden. Er ist also auch einer von den Abergläubigen, die jeden entseelten Leib von bösen Geistern umlagert glauben und jedes verlassene Haus von Gespenstern. Was sind wir doch für grundverschiedene Menschen! Was für mich in einem solchen Fall Beruhigung und ernste Freude wäre, das erschreckt ihn bei der bloßen Andeutung schon halb zu Tode. Armer Alexander Aranda! – Was würdest du sagen, wenn du deinen Freund jetzt sehen könntest. Früher, wenn er eine Reise antrat und dich auf Monate verlassen mußte, hat er sich sicher bitterlich danach gesehnt, dich nur ein einziges Mal vor Augen zu haben – und jetzt gerät er vor Entsetzen förmlich außer sich beim bloßen Gedanken, du könntest in der Nähe sein.
In diesem Augenblick verkündete die Schiffsglocke, von einem der grauhaarigen Wergzupfer geschlagen, mit trübem Grabesklang, dem man einen Sprung im Metall anhörte, die zehnte Stunde, und während es noch durch die bleierne Stille hallte, gewahrte Kapitän Delano die langsam nähertretende Gestalt eines riesenhaften Negers, der sich aus der Menge unten herauslöste und schweren Schritts auf die Hütte zustrebte. Ein eiserner Kragen umgab seinen Hals; eine Kette war daran befestigt, und dreifach um seinen Leib gewunden, und die freien Kettenglieder hatte man ihm mit einem Vorhängeschloß an einem breiten Eisenreif festgemacht, den er als Gürtel um die Hüften trug.
»Als wie ein Stummer kommt Atufal daher!« flüsterte Babo.
Der Schwarze stieg die Stufen zur Hütte empor. Einem kühnen Gefangenen ähnlich, den man zum Empfang des Urteils schleppt, stand er klaglos und stumm vor Don Benito, der sich eben wieder von seinem Anfall erholt hatte.
Der Anblick des Herannahenden schien den Spanier seltsam zu erregen. Ein Schatten des Unmuts flog über sein Gesicht, und der Gedanke, an eine fast schon gegenstandslos gewordene Wut machte seine Lippen bleich und schmal.
Der Rebell, wie er leibt und lebt!, dachte Kapitän Delano und betrachtete nicht ohne ein gewisses Wohlgefallen die riesige Gestalt des Negers.
»Schau, er warten auf die Frage, Herr!« sagte der Diener Babo.
Solcherart an seine Pflicht gemahnt, ließ Don Benito, den Blick unschlüssig abgewandt, als erwarte und scheue er im voraus eine widerspenstige Antwort, mit seltsam unbeteiligter Stimme die Frage vernehmen: »Atufal, wirst du mich jetzt um Verzeihung bitten?«
Der Schwarze blieb stumm.
»Nochmal, Herr!« flüsterte Babo mit einem bitteren Blick des Vorwurfs auf seinen Landsmann. »Nochmal, Herr – er schon noch nachgeben.«
»Antworte«, sagte Don Benito, immer noch abgewandten Blicks. »Sprich nur das eine Wort Verzeihung, und deine Ketten werden losgemacht.«
Der Schwarze hatte langsam die Arme gehoben. Nun ließ er sie leblos fallen, daß die Ketten klirrten, und senkte den Kopf, wie um zu sagen: »Nein, mir ist es recht so.«
»Geh«, sagte Don Benito mit mühsam beherrschter, ihm selber vielleicht unbewußter Erregung.
Bedächtig, wie er gekommen, wandte sich der Schwarze zum Gehen.
»Verzeihen Sie, Don Benito, aber der Vorfall überrascht mich,« sagte Kapitän Delano. »Darf ich erfahren, um was es sich handelt?«
»Es handelt sich darum, daß dieser Neger, als Einziger, mir Anlaß zu schwerer Rüge gegeben hat. Ich habe ihn in Ketten gelegt, ich habe ...«
Er schwieg. Die an die Stirn gelegte Hand schien anzudeuten, daß eine plötzliche Blutleere oder ein Anfall von Gedächtnisschwäche ihn überkommen hatte. Erst der freundlich zu ihm aufgeschlagene Blick seines Dieners schien ihn zu beruhigen, und er fuhr fort: »Ein solches Prachtexemplar konnte ich nicht wohl auspeitschen lassen. Aber ich sagte ihm, er müsse mich um Verzeihung bitten. Das hat er bis jetzt noch nicht getan. Alle zwei Stunden lasse ich ihn mir vorführen.«
»Und wie lang geht das schon?«
»Rund sechzig Tage.«
»Im übrigen ist er gehorsam? Benimmt sich ordentlich?«
»Ja.«
»Dann muß ich schon sagen«, rief Kapitän Delano in warmer Aufwallung,»in dem Burschen scheint ja ein wahrhaft königlicher Geist zu wohnen.«
»Vielleicht nicht ohne Grund«, versetzte Don Benito. »Er behauptet, in seiner Heimat sei er König gewesen.«
»Ja«, warf der Diener unvermutet ein, »da, wo er die Schlitze hat in seinen Ohren, hat der Atufal früher Goldklötzchen getragen. Der arme Babo aber ist auch in der Heimat nur ein armer Sklave gewesen. Ein Sklave beim schwarzen Mann war Babo, und jetzt beim Weißen!«
Etwas befremdet von der ungebetenen Mitteilsamkeit wandte sich Kapitän Delano dem Schwarzen mit erstaunter Miene zu und schaute dann fragend nach seinem Herrn. Der schien längst an dergleichen kleine Unregelmäßigkeiten gewöhnt zu sein: weder er noch Babo zeigten Verständnis für Kapitän Delanos Erstaunen.
»Was hat sich Atufal denn zu Schulden kommen lassen, wenn ich fragen darf?« sagte der Amerikaner. »Wenn es nicht etwas sehr Ernstes war, dann lassen Sie sich doch von mir in aller Einfalt einen Rat geben und schenken Sie ihm die Strafe, mit Rücksicht auf seine sonstige gute Aufführung und seine achtenswerte Gesinnung.«
»Nein, das tut unser Herr nicht«, sagte der Diener vorschnell vor sich hin. »Erst muß der stolze Atufal den Herrn um Verzeihung bitten. Er ist der Sklave und trägt das Schloß – und hier ist der Herr und trägt den Schlüssel.«
Erst diese Worte machten Kapitän Delano darauf aufmerksam, daß Don Benito in der Tat an einer dünnen seidenen Schnur einen Schlüssel um den Hals trug. Jetzt war ihm auch klar, welchen Zwecken dieser Schlüssel diente, und mit einem kleinen Lächeln bemerkte er: »Ach, so ist das, Don Benito! – Schloß und Schlüssel – wahrlich bedeutsame Symbole!«
Don Benito biß sich auf die Lippen und wußte offensichtlich nichts Passendes zu erwidern. Kapitän Delano war zwar in seiner Herzenseinfalt ganz und gar außerstande zu hämischen oder ironischen Sticheleien und hatte mit seiner Bemerkung nur scherzhaft darauf anspielen wollen, daß der Spanier seine richterliche Gewalt über den Schwarzen gar so beweiskräftig zur Schau trug; Don Benito hatte in seiner Empfindlichkeit aber offenbar doch so etwas wie leisen Hohn herausgehört, des Inhalts, daß er ja zugegebenermaßen unfähig gewesen sei, den verbissenen Eigensinn des Sklaven einfach mit der Macht seines Worts und Befehls zu brechen. Kapitän Delano bedauerte dieses offenkundige Mißverständnis, sah aber keine Möglichkeit es zu beheben und wechselte rasch den Gegenstand des Gesprächs. Freilich mußte er entdecken, daß Don Benito nun wieder stärker in sich abgekapselt schien als zuvor. Er schien immer noch mißvergnügt, gleichsam bis zur Neige, die ihm vermeintlich angetane Kränkung auszukosten, und unwillkürlich schwand dadurch auch bei Kapitän Delano die Lust an der Unterhaltung und es legte sich ihm als eine Last auf die Brust, daß der krankhaft empfindliche Mensch nun auch noch heimliche Rachegefühle gegen ihn nährte. Er seinerseits blieb seinem durchaus anders beschaffenen Naturell treu und enthielt sich jedes Anzeichens wie auch jedes Gefühls der Betroffenheit. Wenn auch er verstummte, so nur als Antwort auf das Verstummen des andern.
Übrigens entfernte sich der Spanier gleich darauf, von seinem Diener begleitet, in einer schon beinahe brüsken Weise von seinem Gast. Man hätte es sich allenfalls als Ausfluß einer vorübergehenden Übellaunigkeit erklären können, wenn nicht beide, Herr und Diener, gar so geflissentlich hinter dem hochgeklappten Deckfenster verschwunden wären und dort alsbald leise miteinander zu tuscheln begonnen hätten. Das hatte etwas Unangenehmes. Etwas Abstoßendes sogar – das mürrische Wesen des Spaniers, dem bis dahin eine gewisse leidende Großartigkeit nicht abzusprechen war, entbehrte auf einmal aller Würde, und auch die halb unterwürfige halb zutrauliche Art des Dieners verlor ihren ursprünglichen Reiz und wirkte nicht mehr so sehr als Einfalt und Treuherzigkeit.
Der Gast wußte nichts Besseres zu tun, als sich der anderen Seite des Schiffs zuzuwenden. Sein Blick fiel dort zufällig auf einen jungen spanischen Matrosen, der eben im Begriff war, mit einem aufgeschossenen Tau in der Hand in die Kreuzmastwanten aufzuentern. Er wäre vielleicht gar nicht weiter aufgefallen, wenn er nicht bei seinem Aufstieg zu den Rahen seinen Blick mit einer heimlichen Eindringlichkeit auf Kapitän Delano hätte ruhen lassen, um ihn dann, gleichfalls auf bedeutungsvolle Weise, von ihm abzuwenden und den beiden miteinander Flüsternden zuzukehren.
Der Gast sah sich so von neuem nach dem eben verlassenen Ort zurückverwiesen und empfand, als er dorthin blickte, ein leises Erschrecken. Etwas in Don Benitos Haltung schien anzudeuten, als sei er, der Gast, soeben der Gegenstand oder wenigstens mit der Gegenstand ihrer heimlichen Beratung gewesen – und wenn das zutraf, konnte es für ihn nicht sehr angenehm sein, und für seinen Gastgeber erst recht nicht schmeichelhaft.
Ein seltsames Wechselspiel jedenfalls von Artigkeit und Ungezogenheit – und erklären ließ es sich eigentlich nur durch zwei Vermutungen: entweder war der spanische Kapitän ein unschuldiger Geisteskranker oder ein bösartiger Betrüger.
Einem unbefangenen Beobachter mochte sich jener erste Verdacht längst aufgedrängt haben, und auch Kapitän Delano war er nicht ganz fremd geblieben. Nun aber, wo Don Benito allmählich Veranlassung hatte, das Verhalten des Spaniers als eine Art absichtlicher Kränkung anzusehen, mußte er von dem Gedanken ablassen, daß es sich um einen Fall von Geisteskrankheit handle. Wenn er jedoch kein Irrer war, was dann? War es denkbar, daß sich ein Mann von Erziehung, ja daß sich selbst ein Ungebildeter, gesetzt er war redlichen Sinnes, auf ein Gaukelspiel einließ, wie es ihm der Spanier vorführte? Der Mann mußte ein Betrüger sein. Ein niedriggeborener Abenteurer wahrscheinlich, der sich als seefahrender Grande aufspielte, von den einfachsten Erfordernissen anständigen Benehmens unter gebildeten Menschen aber keine Ahnung hatte, und deshalb die Taktlosigkeiten beging, mit denen er sich selbst am meisten bloßstellte. Auch das seltsam steife, höfische Wesen, das er mitunter an den Tag legte, paßte nur zu gut zu einem Mann, der sich eine Rolle über seinem eigentlichen Stand anmaßte. Benito Cereno – Don Benito Cereno – ein klingender Name! Ein wohlbekannter Familienname außerdem zu jener Zeit, mit dem Kargadeure und Handelskapitäne in den spanisch-südamerikanischen Gewässern eine ganz bestimmte Vorstellung verbinden mußten, da er einer der unternehmendsten und weitläufigsten Kaufmannsfamilien aus jener Gegend angehörte. Mehrere Mitglieder dieses Hauses trugen Adelstitel; es war eine Art kastilischer Familie Rothschild mit einem vornehmen Bruder oder Vetter in jeder größeren Handelsstadt Südamerikas. Der angebliche Don Benito stand im frühen Mannesalter – er mochte neunundzwanzig oder dreißig Jahre zählen. Konnte es für einen jungen Gauner von Talent und Witz einen schlaueren Einfall geben, als sich vorübergehend einen Nachwuchsposten in den Seehandelsgeschäften jenes berühmten Hauses anzumaßen? Allerdings war der Spanier eine schwächliche Erscheinung, ein kranker Mensch. Aber das war kein Gegenbeweis. Man hat Hochstapler gekannt, deren Betrügerkunst bis zum Vortäuschen tödlicher Krankheit reichte. Und so mochten sich unterm Anschein kindlicher Schwäche sehr wohl die übelsten Kräfte verbergen – und das sammetweiche Wesen dieses Spaniers war vielleicht nur das Seidenpfötchen mit den spitzigen Krallen.
Es war keine innere Überlegung, aus der diese Gedanken entsprangen. Sie kamen überhaupt nicht von innen, sondern von außen, und zwar so unvermittelt und mit einem Schlag wie Rauhreif. Und ebenso schnell verschwanden sie auch wieder, als Kapitän Delanos arglose Natur, der milden Sonne vergleichbar, wieder zum Durchbruch kam und ihren Zenit erklomm.
Er blickte noch einmal nach dem fremden Kapitän, dessen Gesicht sich ihm über dem hochgeklappten Deckfenster in voller Seitenansicht darbot, und er erschrak vor der Reinheit dieses Profils, dem die Magerkeit der abgezehrten Züge etwas Zartes, der ums Kinn sprossende Bart etwas Vornehmes verlieh. Hinweg mit allem Argwohn! Dieser Mensch war gewißlich ein echter Hidalgo, ein echter adliger Cerenosproß.
Erleichtert von diesen und anderen guten Gedanken, begann der Gast, ein Liedchen summend, gelassen die Hütte entlangzuschlendern, auf daß Don Benito nichts von der ihm fälschlich zugetrauten Unart oder gar Zweideutigkeit verspüre. Alles Mißtrauen dieser Art würde sich als hinfällig erweisen, als augenscheinlicher Wahn, wenn auch fürs erste der argwöhnisch stimmende Vorfall noch ungeklärt blieb. Sowie sich das kleine Geheimnis aufgelöst hätte, würde es für ihn, Kapitän Delano, aufs äußerste peinlich sein, wenn Don Benito auch nur im geringsten gewahr würde, daß er seinetwegen kleinmütige Vermutungen gehegt hatte. Was an seinem Verhalten schrullig anmuten mochte, das ließ man am besten eine Weile ruhig auf sich beruhen.
Übrigens kam der Spanier in diesem Augenblick wieder zu seinem Gast herübergeschritten. Sein Antlitz war bleich; er ging immer noch auf seinen Diener gestützt und schien ein nervöses Zucken seiner Gesichtszüge nur mühsam zu bemeistern. Das Sprechen fiel ihm noch schwerer als sonst, und seine heisere Flüsterstimme hatte bei der nun folgenden Unterhaltung einen seltsam an die Nerven gehenden Ton.
»Sennor«, sagte er, »darf ich fragen, wie lang Sie schon hier an der Insel liegen?«
»Erst ein paar Tage, Don Benito.«
»Und aus welchem Hafen sind Sie zuletzt gekommen?«
»Aus Kanton.«
»Dort haben Sie wohl Ihre Robbenfelle gegen Tee und Seide getauscht, Sennor – sagten Sie nicht so?«
»Ja. – Hauptsächlich Seide.«
»Und die Differenz haben Sie vermutlich in Hartgeld bekommen?«
Kapitän Delano zögerte ein wenig. »Ja«, sagte er dann. »In Silber – es ist übrigens nicht viel.«
»Ah – schön. Und darf ich fragen, wieviel Mann haben Sie?«
Kapitän Delano stutzte, gab aber doch Antwort: »Etwa fünfundzwanzig alles in allem.«
»Die wohl jetzt sämtlich an Bord sind?«
»Sämtlich an Bord, Don Benito«, erwiderte der Kapitän, mit einem unvermittelten Ausdruck der Befriedigung. »Und auch zur Nacht dort bleiben, Sennor?«
Das war nach solch hartnäckigem Ausfragen so ganz und gar ungebührlich, daß Kapitän Delano denn doch einen ernsten Blick auf den Frager werfen mußte. Der wich dem Blick aus und schlug das Auge zur Deckplanke nieder, offensichtlich verdutzt und aus der Fassung gebracht und insofern in diesem Punkt unvorteilhaft abstechend von seinem Diener, der in diesem Augenblick zu seinen Füßen kniete, eine aufgegangene Spange an seinem Schuh in Ordnung zu bringen und dabei ein von keinem Hintergedanken beschattetes Gesicht mit dem unverhohlenen Ausdruck bescheidener Neugier zu dem gesenkten Antlitz seines Herrn emporhob.
Mit schuldbewußtem Rucken und Zucken seines Körpers wiederholte der Spanier seine Frage: »Und – die Leute bleiben auch zur Nacht an Bord, Sennor?«
»Ja, nach allem, was ich weiß«, versetzte Kapitän Delano. »Oder vielmehr« – er ermannte sich, unerschrocken die Wahrheit zu sagen – »ein paar Mann haben davon gesprochen, sie wollten um Mitternacht noch einmal zum Fischen fahren.«
»In der Regel sind eure Schiffe doch – einigermaßen armiert, nicht wahr, Sennor?«
»Nun ja, einen oder zwei Sechspfünder für den Notfall«, war die kaltblütig-gelassene Antwort, »dazu etliche Musketen, Robbenspieße und Entermesser – was man eben so hat.«
Auch diesmal schaute Kapitän Delano Don Benito scharf an, aber der wandte den Blick zur Seite. Er wechselte unvermittelt und eigentlich ziemlich ungewandt den Gegenstand des Gesprächs, machte eine mißvergnügte Bemerkung über die Flaute und zog sich sodann, ohne sich zu entschuldigen, wie vorhin mit seinem Diener ans Schanzkleid gegenüber zurück, wo sie wieder zu flüstern begannen.
In diesem Augenblick und ehe sich Kapitän Delano über die Geschehnisse klar Rechenschaft zu geben vermochte, kam der vorhin erwähnte junge spanische Matrose aus den Wanten heruntergestiegen. Er duckte sich, um nach innen an Deck zu springen, und bei dieser Bewegung öffnete sich sein weitgeschnittener, unverschnürter Kittel, ein hemdartiges, über und über mit Teer beschmiertes Gewand aus grobem Wollstoff, über der Brust und ließ ein Stück Unterkleidung sehen, schmutzig, aber, wie es schien, vom feinsten Leinen und am Hals mit einem schmalen, stark ausgebleichten und zerfranzten blauen Band eingesäumt. Der Blick des jungen Seemanns hing wie vorhin an den beiden flüsternden Gestalten, und Kapitän Delano meinte eine versteckte Bedeutung darin wahrzunehmen, als würden da, nach Freimaurerart, irgendwelche stummen Zeichen vor seinen Augen ausgetauscht.
Unwillkürlich wandte sich auch sein Blick wieder in Don Benitos Richtung, und abermals sah er sich zu dem Schluß genötigt, daß er selber es war, der den Gegenstand der Beratung bildete. Er wartete. Das Geräusch des Äxteschleifens senkte sich ihm ins Ohr. Wieder warf er einen raschen Seitenblick auf die beiden. Sie hatten etwas von Verschworenen. Zusammen mit der eindringlichen Befragung vorhin und der Erscheinung des jungen Matrosen waren die Umstände ganz danach angetan, ihn aufs neue wider seinen Willen in einen Zustand des Argwohns zu versetzen, und das wiederum vermochte er bei seiner tiefinneren Unschuld einfach nicht auszuhalten. Er zwang sich zu einer lustigen Miene, als sei er auf Schabernack bedacht, trat schnellen Schritts an die beiden heran und sprach: »Na, ich muß schon sagen, Don Benito: Ihr Schwarzer genießt scheints eine ganz besondere Vertrauensstellung – er ist wohl Wirklicher und Geheimer Rat bei Ihnen?«
Der Diener hob den Kopf mit einem gutmütigen Lachen übers ganze Gesicht, der Herr aber zuckte zusammen wie unter einem Natternbiß. Es dauerte sichtlich einige Augenblicke, bis er sich zu einer Antwort aufraffen konnte, und es klang kalt und gezwungen, als er sagte: »Jawohl, Sennor, ich habe Vertrauen zu Babo.«
Bei diesen Worten veränderte sich Babos Lachen; aus dem gutartigen, aber doch ziemlich animalischen Grinsen wurde ein verständnisvolles Lächeln und der Blick, mit dem er seinen Herrn betrachtete, verriet etwas wie Dankbarkeit.
Der Spanier verharrte weiter in seiner schweigsamen und reservierten Haltung, und Kapitän Delano konnte nicht verkennen, daß damit absichtlich oder unabsichtlich seine Gegenwart als augenblicklich unerwünscht gekennzeichnet wurde. Ihm widerstrebte es ungezogen zu erscheinen, selbst einem solchen Muster von Ungezogenheit gegenüber, und so wandte er sich mit einer gleichgültigen Bemerkung zum Gehen, nicht ohne des Don Benito Cereno rätselhaftes Betragen wieder und immer wieder in seinem Sinn zu bewegen.
Er war von der Hütte hinabgestiegen und schritt eben gedankenversunken an einer dunklen Luke vorüber, die ins Zwischendeck führte, als er unten etwas sich bewegen sah und neugierig näher trat. Im Dunkel der Luke funkelte es, und er gewahrte einen von den spanischen Matrosen, der sich scheu zur Seite drückte und eilig die Hand in seinem Kittel verbarg, als wolle er etwas verstecken. Der Mann konnte noch gar nicht richtig gesehen haben, wer oben vorbeiging, aber schon war er in der Tiefe verschwunden. Soviel hatte Kapitän Delano freilich zweifelsfrei erkennen können, daß es sich um denselben jungen Matrosen handelte, den er vorhin in den Wanten wahrgenommen hatte.
Und was hat da so gefunkelt?, fragte er sich. Es war keine Lampe, keine Lunte, auch keine Kohlenglut. Ein Edelstein vielleicht? Aber wie kommt man als Matrose zu Edelsteinen? – und wie zu seidengesäumter Unterwäsche? Hat der Mann das Gepäck der toten Kajütpassagiere geplündert? Aber auch dann würde er schwerlich etwas von dem gestohlenen Gut öffentlich an Bord herumtragen. Freilich, freilich – wenn es nun wirklich ein geheimes Zeichen war, das ich vorhin zwischen dem verdächtigen Gesellen und seinem Kapitän habe hin und her gehen sehen – wenn ich nur Gewißheit hätte, daß mich in meiner Unruhe meine Sinne nicht getäuscht haben – dann ...
Ein Verdacht zeitigte den andern, und schon kreisten seine Gedanken aufs neue um die seltsamen Fragen, die man wegen seines Schiffs an ihn gerichtet hatte.
Er überlegte Punkt für Punkt, und ein merkwürdiges Zusammentreffen fügte es, daß die schwarzen Aschanti-Gaukler jedesmal mit ihren Äxten einen Wirbel schlugen, als wollten sie die Gedanken des Weißen mit unheilvoller Nebenbedeutung unterstreichen. Unter dem Drucke solch rätselhaft-unheilschwangerer Stimmung mußten sich selbst dem Vertrauensvollsten förmlich mit Naturgewalt häßliche Befürchtungen ins Herz stehlen.
So beobachtete unser Freund denn von neuem das Schiff, das hilflos einer Strömung überantwortet war und mit verzauberten Segeln immer schneller seewärts trieb: beobachtete auch, daß ein jetzt erst sichtbar gewordener Landvorsprung den Robbenfänger außer Sicht brachte, und ertappte sich plötzlich auf Gedanken, die er sich kaum einzugestehen wagte, die ihn aber, so kräftig er auf der Welt stand, erbeben machten. Vor allem empfand er auf einmal eine schmähliche Angst vor Don Benito. Einen Augenblick nur – dann raffte er sich auf, atmete tief ein, spürte, wie fest er auf den Beinen stand, und überlegte alles mit kühlem Sinn – und nun schien alles Hirngespinst und wesenloser Dunst.
Bestanden bei dem Spanier irgendwelche finsteren Pläne, so konnten sie weniger ihm (Kapitän Delano) gelten als seinem Schiff, der »Bachelor's Delight«. Daß die Schiffe voneinander abtrieben, konnte also derartige Anschläge jedenfalls nicht begünstigen, sondern mußte ihnen, wenigstens für den Augenblick, abträglich sein. Ein Verdacht, der sich auf zwei so widersprüchliche Beobachtungen stützte, mußte demnach offenbar irreführend sein. Überdies: war es nicht ein unsinniger Gedanke, daß ein Schiff in Seenot, ein durch Krankheit seiner Bemannung so gut wie beraubtes Schiff, ein Schiff, dessen Insassen aus Wassermangel beinahe verschmachteten – war es nicht ein in jeder Weise unsinniger Gedanke, daß ein solches Schiff bei alledem als Räuberschiff gelten sollte? Und konnte es seinem Kommandeur, für seine Person und für seine Untergebenen, auf irgend etwas anderes ankommen als darauf, schleunigst Hilfe und Erholung zu finden? Gut; konnte aber nicht die ganze Notlage, und namentlich der Durst, auch nur geheuchelt sein? Und war es nicht denkbar, daß die spanische Bemannung, die angeblich bis auf geringe Überreste umgekommen war, zur Stunde vollzählig im Laderaum versammelt saß? Mit dem Vorwand, man sei am Verschmachten und bitte nur um einen Schluck kalten Wassers, hatten sich schon oft genug Bösewichter in Menschengestalt in einsame Wohnstätten eingeschlichen und dort, ehe sie wieder entwichen, Böses verübt. Bei den malaiischen Piraten war es gang und gäbe, Schiffe hinter sich bis in die Räubernester der Häfen zu locken oder den Feind zur See zum Entern zu veranlassen, indem man ihm dünn bemannte oder menschenleere Decks vorgaukelte, unter denen aber von gelben Armen Hunderte von Speeren bereitgehalten wurden, um im geeigneten Augenblick durch die deckenden Matten nach oben zu stoßen. Nicht als ob Kapitän Delano dergleichen Vorkommnissen kritiklos Glauben geschenkt hätte. Er hatte davon gehört – und jetzt, wie es mit solchen Geschichten geht, kamen sie ihm wieder in den Sinn. Das fremde Schiff hatte vor, den Ankerplatz anzusteuern. Dort würde es in der Nähe seines eigenen Kahns liegen. Und wenn es erst einmal dort lag, konnten natürlich auf der »San Dominick«, wie in einem schlummernden Vulkan, unversehens Kräfte losbrechen, die jetzt noch verborgen blieben.
Er ließ sich durch den Kopf gehen, wie der Spanier sich bei seinem Bericht benommen hatte. Eigentlich war es ein fortgesetztes mißvergnügtes Zögern und Drumherumreden gewesen. Genau so würde jemand erzählen, der mit seiner Geschichte, schon während er sie berichtet, Übles im Schilde führt. Allerdings, wenn die Geschichte nicht stimmte, wo lag dann die Wahrheit? Etwa darin, daß der Spanier das Schiff unrechtmäßig in seine Gewalt bekommen hatte? Andererseits: in vielen Einzelheiten, besonders was die eigentlichen Unglücksfälle betraf, die Todesfälle unter den Seeleuten, das anschließende lange Umherkreuzen, die Widrigkeit der anhaltenden Flauten und die bis zur Stunde nicht behobenen Unbilden des Durstes – in allen diesen Punkten und in manchen anderen bestätigte Don Benitos Erzählung ja nur das jammernde Geplärr der namenlosen Menge, der Weißen und der Schwarzen, und ward überdies erhärtet von dem kaum nachzufälschenden Ausdruck und Mienenspiel, wie Kapitän Delano es ringsum erblickte. War Don Benitos Geschichte eine reine Erfindung, dann war jede Seele an Bord, bis herab zum jüngsten Negerkind, sorgsam auf die Verschwörung eingedrillt – eine wenig glaubhafte Schlußfolgerung. Mißtraute man jedoch Don Benitos Glaubwürdigkeit an sich, dann war allerdings auch die Schlußfolgerung füglich nicht von der Hand zu weisen.
Und dann waren da eben immer wieder die Fragen des Spaniers. Sie konnten einem wirklich zu denken geben. Schienen sie nicht ganz mit der Absicht gestellt, mit der ein Einbrecher oder Meuchelmörder bei Tageslicht die Wände eines Hauses abtastet? Wiederum, mit bösen Hintergedanken ganz offen den Hauptgefährdeten um Auskunft angehen und so praktisch auf seine Hut bringen – das wäre ein höchst widersinniges Unterfangen. Widersinnig also auch die Annahme, daß üble Absichten hinter den Fragen stünden. Was in diesem Fall zur Beunruhigung Anlaß gab, diente gleichzeitig auch wieder dazu, die Unruhe zu zerstreuen. Mit einem Wort: unter allen Mutmaßungen und bösen Gedanken, wie wohlbegründet sie eine Zeitlang geschienen hatten, war kaum einer, den man nicht auch wieder und zwar mit ebenso gutem Grunde hätte verwerfen müssen.
Er kam schließlich zu dem Ergebnis, seine Ängste einfach lächerlich zu finden. Lächerlich das wunderliche Schiff, das in seinem Aussehen diesen Ängsten in gewisser Hinsicht Vorschub geleistet hatte. Lächerlich die Schwarzen in ihrer absonderlichen Aufmachung, und namentlich die alten Scherenschleifer aus Aschantiland. Lächerlich schließlich die gichtbrüchigen alten Strickweiber, die Wergzupfer, und beinahe auch den dunklen Spanier selber, diesen Oberkobold im Mittelpunkt des Ganzen.
Was im übrigen noch bei ernstlicher Betrachtung rätselhaft blieb, ließ sich bei einigem guten Willen leicht hinwegerklären, wenn man sich nur vor Augen führte, daß Don Benito als leidender Mensch meistens gar nicht so recht wußte, worum es eigentlich ging. Er hatte sich bald in finstere Melancholie vergrübelt, bald hatte er müßige Fragen ohne Sinn und Verstand von sich gegeben. Eins war klar: bis auf weiteres konnte man dem Mann unmöglich das Schiff anvertrauen. Unter irgendeiner freundlichen Begründung mußte ihm Kapitän Delano das Kommando entziehen und das Schiff dann unter seinem zweiten Offizier, einem vertrauenswürdigen Menschen und guten Steuermann, nach Concepcion segeln lassen. Damit wäre für die San Dominick das Beste getan, und ebenso auch für Don Benito, denn aller Sorge ledig könnte sich der Kranke ganz in seine Kammer zurückziehen und würde dann unter der guten Pflege seines Dieners bei Beendigung der Reise vermutlich wieder soweit zu Kräften gekommen sein, daß man ihn auch in seine Machtbefugnisse wieder einsetzen könnte. So überlegte der Amerikaner. Seine Gedanken wirkten beruhigend auf ihn. Welcher Unterschied zwischen der Vorstellung, daß Don Benito auf eine undurchsichtige Weise über Kapitän Delanos Schicksal waltete, und der andern Vorstellung, daß er, Delano, umgekehrt mit leichter Hand über Don Benito verfügte. Mochte dem sein wie ihm wollte, es fiel unserem guten Kapitän doch ein Stein von der Seele, als er in diesem Augenblick in der Ferne sein Fangboot auftauchen sah. Es war so lang ausgeblieben, weil es beim Mutterschiff unerwartet festgehalten worden war und weil sich die Rückfahrt durch das beständige Abtreiben der San Dominick überdies verlängert hatte.
Schon hatten auch die Schwarzen das herannahende Pünktchen entdeckt. Von ihrem Schreien aufmerksam gemacht, näherte sich Don Benito mit einem Aufflackern von Höflichkeit dem Gast und drückte ihm seine Freude darüber aus, daß nun einige Hilfsmittel kämen, wenn sie auch natürlich nur vorübergehend eine notdürftige Erleichterung gewähren könnten. Kapitän Delano gab entsprechende Antwort. Während er aber noch sprach, wurde seine Aufmerksamkeit von einem Vorgang unten auf Deck in Anspruch genommen. Dort hatte sich die Menge, in begieriger Erwartung des nahenden Boots, an dem landwärts schauenden Schanzkleid förmlich hochgekrallt, und dabei hatte es sich begeben, daß zwei Neger, offenbar unabsichtlich, von einem der Matrosen angerempelt worden waren. Nun stießen sie ihn in wüster Weise beiseite und schlugen ihn, als er sich das nicht gefallen lassen wollte, einfach nieder, obwohl die Wergzupfer sie laut zur Ruhe mahnten. »Don Benito!« sagte Kapitän Delano sofort, »sehen Sie doch da unten! Da!«
»Den Spanier überkam in diesem Augenblick ein neuer Hustenanfall; er taumelte und wäre, die Hände vors Gesicht erhoben, beinahe gefallen. Kapitän Delano wollte ihm beispringen, aber der Diener war schneller und hätte seinen Herrn bereits mit einer Hand aufgefangen, während er ihm mit der andern das Stärkungsmittel reichte. Don Benito kam zu sich, und der Schwarze ließ ihn sogleich los und trat zur Seite, blieb aber pflichtbewußt so nah, daß er mit einem Flüstern zu erreichen war. Aus alledem sprach ein hohes Maß von Zucht und Besinnung, und für den Gast verwischte sich ganz der Eindruck des Unschicklichen, den er von dem Bedienten empfangen haben mochte, als dieser vorhin so unpassend mit seinem Herrn tuschelte. Man sah nun: mochte der Diener Tadel verdienen, so lag der Fehler doch mehr beim Herrn als bei ihm, denn sich selbst überlassen, ließ er es an guter Aufführung nicht fehlen.
Jedenfalls war Kapitän Delanos Blick von dem Bild der Unordnung ganz auf die erfreulichere Szene zwischen den beiden abgelenkt und abermals drängte sich ihm ein Wort der Anerkennung auf die Lippen, wie glücklich Don Benito zu preisen sei, daß er einen solchen Diener besitze, der, ungeachtet eines vielleicht manchmal etwas naseweisen Wesens, im ganzen für einen Leidenden wie ihn unschätzbar sein müsse.
»Sagen Sie, Don Benito«, so schloß er lächelnd seine Rede, »– ich würde den Mann am liebsten selber besitzen, – was soll er kosten? Fünfzig Dublonen, wäre das ein Angebot?«
»Der Herr trennt sich von Babo auch um tausend Dublonen nicht«, sagte der Schwarze halblaut. Er hatte das Angebot gehört und ernstgenommen, und mit der seltsamen Eitelkeit des von seinem Herrn geschätzten treuen Sklaven vermerkte er es offenbar übel, daß er von einem Fremden so lumpig veranschlagt wurde. Don Benito übrigens, der offenbar noch gar nicht richtig wieder zu sich gekommen war und immer noch vom Husten geschüttelt wurde, gab eine ziemlich unzusammenhängende Antwort. Es ging ihm sichtlich schlechter, und da er auch geistig nicht mehr bei der Sache schien, machte der Diener dem traurigen Schauspiel ein Ende und führte seinen Herrn sachte nach unten.
Der Amerikaner blieb sich selber überlassen. Um die Zeit bis zur Ankunft seines Boots zu vertreiben, hätte er sich ganz gern mit einem der wenigen spanischen Matrosen unterhalten. Ihm fiel aber ein, daß Don Benito etwas davon gesagt hatte, sie hätten sich nicht gut betragen, und das hielt ihn ab, denn als Skipper wollte er Feigheit und Unzuverlässigkeit bei Seeleuten nicht begünstigen.
Er hing noch diesen Überlegungen nach und hatte dabei den Blick auf die paar Matrosen unten gerichtet, als er plötzlich den Eindruck hatte, sein Blick werde von dem und jenem erwidert und zwar in einer bedeutsamen Weise. Er rieb sich die Augen und schaute abermals hinunter, und wieder hatte er denselben Eindruck. In neuer Gestalt, wenn auch undeutlicher als zuvor, stellten sich die Besorgnisse von vorhin wieder ein, freilich, da Don Benito nicht mehr zugegen war, nicht ganz mit der alten Schreckhaftigkeit. Was man ihm auch Schlechtes von den Leuten erzählt hatte, er wollte nun doch einen von ihnen ansprechen. Er stieg von der Hütte nach unten und bahnte sich einen Weg durch die Schar der Schwarzen, wobei seltsame Zurufe von Seiten der Wergzupfer ihn anzukündigen schienen und die Neger dazu veranlaßten, sich beiseite zu drängen und ihm eine Straße freizugeben. Doch waren sie ganz offensichtlich neugierig, was er mit seinem Besuch in ihrem Ghetto beabsichtigte; jedenfalls drängten sie sich hinter ihm wieder dicht zusammen und folgten in leidlicher Ordnung seinem Schritt. Sein Vordringen hatte etwas von einem feierlichen Aufzug; gleichsam von berittenen Herolden angekündigt und von einer Kaffern-Ehrengarde eskortiert, schritt er langsam voran und gab sich, so gut er konnte, ein leutseliges, unbefangenes Ansehen. Dazwischen wandte er sich manchmal mit einem munteren Wort an die Neger und ließ seinen Blick neugierig über die Gesichter der Weißen schweifen, die da und dort wenig zahlreich unter den Schwarzen verstreut standen, wie verirrte weiße Bauern auf dem Schachbrett, die sich kühn in die Reihen der gegnerischen Figuren vorgewagt haben.
Noch überlegte er, an welchen er sich wohl wenden sollte, als sein Blick auf einen Matrosen fiel, der auf Deck saß und damit beschäftigt war, den Blockriemen eines Flaschenzugs mit Teer einzuschmieren, wobei ihm ein Haufen Schwarzer, im Kreis um ihn herumhockend, neugierig zusah.
Die untergeordnete Beschäftigung des Mannes stand in einem gewissen Gegensatz zu dem vornehmen und überlegenen Ausdruck seiner Person. Seine Hand, schwarz von dem Teertopf, den ein Neger für ihn hielt und in den er immer wieder hineingriff, schien nichts gemein zu haben mit seinem Gesicht, das man hätte schön nennen dürfen, wenn es nicht so abgezehrt ausgesehen hätte. Ob sich hinter dieser Ausgezehrtheit verbrecherische Züge verbargen, ließ sich nicht entscheiden; durchdringende Hitze und Kälte rufen ja, so ungleich sie untereinander sind, ähnliche Wirkungen hervor, und so zeichnen auch Unschuld und Schuld, wenn sie zufällig mit seelischem Leiden zusammentreffen, ihr Opfer nach außen hin mit einem und demselben Stempel – der übrigens in seiner Verwischtheit nicht leicht zu lesen ist.
Wieder ist zu sagen, daß sich diese Betrachtung Kapitän Delano keineswegs sofort aufdrängte – so wach sein Mitgefühl sonst auch war. Ihn bewegte vielmehr ein anderer Gedanke. Er sah eine merkwürdig heruntergekommene Gestalt vor sich, sah ein dunkles Auge, abgewandt wie aus Scham und schlechtem Gewissen, und ließ sich wieder durch den Kopf gehen, was Don Benito Nachteiliges über seine Leute gesagt hatte; und unwillkürlich bemächtigten sich seiner jene allgemeinen Vorstellungen, die Leid und Verlegenheit nicht als Begleiterscheinungen des Guten, sondern immer nur in einem Zusammenhang mit dem Bösen sehen wollen.
Wenn an Bord wirklich krumme Dinge geschehen sind, dachte er, dann hat dieser Mann bestimmt seine Hand dabei im Spiel gehabt, so wie er sie jetzt mit Pech besudelt. Ich will ihn lieber nicht ansprechen. Lieber spreche ich mit dem Alten hier am Bratspill.
Damit trat er an einen alten Matrosen heran, der ihm mit seinen zerfetzten kurzen Hosen und seiner schmutzigen Zipfelmütze, seinen tiefeingefurchten, dunkelgebrannten Zügen und dem dichten, wie verfilzten Backenbart aufgefallen war. Er hockte zwischen zwei verschlafen aussehenden Negern und war wie sein jüngerer Kamerad mit Takelarbeit beschäftigt, indem er ein Tau splißte, wobei ihm die Schwarzen, die Tauenden rechts und links festhaltend, behilflich waren.
Bei Kapitän Delanos Annäherung ließ der Mann den Kopf merklich tiefer sinken, weit tiefer, als es für seine Arbeit nötig gewesen wäre. Offenbar wünschte er den Anschein zu erwecken, als wäre er weit über alles gewöhnliche Maß hinaus in seine Aufgabe vertieft. Als der Kapitän ihn ansprach, blickte er zwar auf, zeigte aber eine ganz merkwürdig scheue und lammfromme Miene, die sich auf seinem wettergebräunten Antlitz seltsam genug ausnahm, etwa so als verlege sich ein Grizzlybär, statt zu knurren und zu beißen, auf ein jungfernhaftes Gelächel und Geknixe. Die Fragen, die ihn gestellt wurden, bezogen sich auf die Schiffsreise – und, zwar absichtlich auf Einzelheiten von Don Benitos Bericht, die sich nicht ohne weiteres bestätigt hatten, als das wilde, erlöste Geschrei den Gast bei seinem ersten Erscheinen an Bord begrüßte. Auf jede Frage antwortete er kurz, in einem Sinn, der alles bisher noch Unbestätigte an der Geschichte erhärtete. Die am Bratspill versammelten Neger fielen bald mit ein. Je geschwätziger sie aber wurden, umso mehr verstummte der Alte und bald schien er in seiner sauertöpfischen Laune ganz und gar unwillig, überhaupt noch weitere Fragen zu beantworten, wiewohl nach wie vor Bär und Lamm in seiner Miene im ergötzlichsten Widerstreit miteinander lagen.
Kapitän Delano gab es schließlich auf, mit einem solchen Zwiegeschöpf in eine ersprießliche Unterhaltung zu gelangen, und nachdem er vergebens nach einem aufgeschlosseneren Gesicht ausgeschaut hatte, bat er die Schwarzen freundlich, sie sollten ihm Platz machen, und begab sich unter manchem Grinsen und Zähnefletschen der Neger zur Hütte zurück. Ihm war zunächst, ohne daß er einen Grund hätte angeben können, etwas sonderbar zu Mut, doch hatte sich im ganzen sein Zutrauen zu Benito Cereno wesentlich verstärkt.
Recht durchsichtig und kindlich, dachte er, wie der alte Schnauzbart da drunten sein schlechtes Gewissen zur Schau trug! Ah er mich kommen sah, dachte er natürlich, ich hätte von seinem Käptn gehört, wie übel sich die Mannschaft aufgeführt hat, und würde ihm nun sauber den Kopf waschen – also duckte er sich. Und doch, und doch ... wenn ich mir's recht überlege, war grade dieser Alte einer von denen, die mich vorhin so ernst fixiert haben. Der Teufel hole diese Meeresströmungen – man verliert auch im Kopf jeden festen Standort, genau wie das Schiff! Ha: endlich was Erfreuliches – bei dem Anblick glaubt man wieder an den Menschen!
Er hatte eine schlafende Negerin gewahrt, die unter Tauwerk halb verborgen im Schutz des Schanzkleids lag, die jungen Glieder achtlos hingebreitet, einer Hindin im Schatten eines Felsens tief im Walde vergleichbar. Über ihre schwellenden Brüste krabbelte und tapste ihr Junges, splitternackt und hellwach, das schwarze Körperchen, halb von den Deckplanken aufgerichtet. Mit den Händchen hielt es sich an ihr festgeklammert, und mit wühlenden Bewegungen von Mund und Nase suchte es, vergeblich sein Ziel zu erreichen. Dazu stieß es von Zeit zu Zeit ein verärgertes kleines Grunzen aus, das sich mit dem seelenruhigen Schnarchen der Mutter vermischte.
Der zähen Beharrlichkeit des Kindes gelang es schließlich, die Mutter zu wecken. Sie richtete sich auf und gewahrte den Kapitän. Es schien ihr aber nichts auszumachen, daß sie in solch ungewöhnlicher Haltung beobachtet worden war; unabgelenkt wandte sie ihr mütterliches Entzücken ihrem Kindchen zu und hob es unter Liebkosungen in die Höhe.
Da haben wir endlich die nackte Natur, dachte Kapitän Delano mit Wohlgefallen. Reine Zärtlichkeit und Liebe. Er richtete nun auch auf die anderen Negerinnen eine besondere Aufmerksamkeit, und was sich ihm da zeigte, gefiel ihm gut: wie fast alle von der Kultur unbeleckten Frauenzimmer wirkten sie warmherzig und dabei körperlich widerstandsfähig und schienen jederzeit bereit, für ihre Brut zu sterben und zu kämpfen. Ungezähmt wie Leopardinnen, liebevoll wie Tauben. So, müssen die Frauen gewesen sein, dachte Kapitän Delano, die Ledyard in Afrika gesehen und von denen er so schön berichtet hat.
Unbewußt trug dieser Blick in ein natürliches Leben zu seiner wieder erstarkenden Zutraulichkeit und Gemütsruhe bei. Er besann sich auf sein Boot, schaute nach, wie es vorankäme, mußte aber feststellen, daß es noch ein gutes Stück entfernt war. Auch nach Don Benito sah er sich um; er war aber noch nicht zurückgekommen.
Es gelüstete ihn, seinen Standort etwas zu wechseln und sich in aller Ruhe der Beobachtung seines herannahenden Boots zu widmen, und so trat er auf die Kreuzrüsten hinaus und suchte sich seinen Weg zur Steuerbordseite der Achtergalerie – zu einem jener früher beschriebenen, an Venedig erinnernden Wasserbalkönchen, die wie Einsiedeleien überm Achterdeck aufgebaut waren. Sein Fuß trat auf Seetang, der halb noch feucht, halb schon morsch die Planken deckte, und eine unvermutete kleine Brise – ein Inselchen Kühle, unerwartet und ganz vereinzelt – fächelte geisterhaft seine Wange. Sein Blick glitt über die Reihe der kleinen, runden Bullaugen hin – geschlossen wie kupferbesponnene Augen Eingesargter – und über die Tür der Luxuskajüte, von der aus man einst auf die Gallerie hatte hinaustreten und durch die Bullaugen hinausschauen können, die aber jetzt fest verkalfatert war wie ein Sargdeckel. Von schwärzlichem Rotbraun Schwelle, Rahmen und Füllung – und unversehens überfiel ihn der Gedanke an alte Zeit, als Kajüte und Balkon geklungen hatten von den Stimmen Königlich spanischer Offiziere – hier aber, wo er jetzt stand, hatte vielleicht des Vizekönigs von Lima Töchterlein biegsam gelehnt. Dies und anderes mußte er denken; es zog ihm durch den Sinn, wie die Brise durch die Windstille, und langsam überkam ihn eine träumerische Unrast, wie den einsamen Wanderer in der Prärie Unrast überkommt beim Schweigen des Mittags.
Er lehnte sich gegen das geschnitzte Geländer und blickte angestrengt nach seinem Boot. Aber bald fing sich sein Blick in dem Rohrglanzgras, das in der Wasserlinie des Schiffs mitschleppte wie eine Einsäumung aus grünem Buchs. Ganze Bänke von Algen, wie breite Scheiben und Halbmonde geformt, schwebten ringsum im Wasser; es gab lange feierliche Durchgänge zwischen ihnen, beiderseits aber schwoll es zu üppigen Terrassen und wölbte sich, als ginge es da in die Tiefe unerhörter Grotten. Über allem aber hing das Geländer, darauf sein Arm ruhte, ein Geländer halb teerverschmiert, halb moosbekrustet: die verwitterte Ruine gleichsam, eines Lusthäuschens in längst vom Wildwuchs überwuchertem Park.
Wollte er den einen Zauber abschütteln, so überfiel ihn sogleich ein anderer. Da stand er auf dem großen Ozean – und doch war ihm, als wäre er tief im Innern des Landes: Gefangener in einem verlassenen Chateau, den Blick auf leeres Gelände gerichtet, auf verkehrslose Straßen, wo nicht Roß noch Wanderer nahte.
Ein wenig fiel die Verzauberung von ihm ab, als sein Auge sich auf die ausgewaschenen Großrüsten richtete. Altmodisch gebaut, massig und verrostet überall, schienen sie der gegenwärtigen Verfassung des Schiffs beinahe mehr angemessen als seiner ursprünglichen Bestimmung. Mit einem Male hatte Kapitän Delano den Eindruck, als bewege sich dort etwas. Er rieb sich die Augen und blickte scharf hin. Ein dichtes Gewirr von Tauwerk lief kreuz und quer durch die Püttinge, und hinter einem dicken Stag, wie ein Indianer im Schierling, lauerte ein spanischer Matrose, einen Marlpfriem in der Hand, und machte, soviel man erkennen konnte, so etwas wie eine winkende Bewegung nach dem Balkon. Gleich darauf aber, offenbar abgeschreckt von einem innen auf Deck herannahenden Schritt, verschwand er wie ein Wilderer in den Schlüften des hänfernen Waldes.
Was sollte das bedeuten? Der Mann hatte etwas mitteilen wollen, und zwar in aller Heimlichkeit, auch hinter dem Rücken seines Kapitäns. Handelte es sich um ein Geheimnis, das auf Don Benito ein ungünstiges Licht fallen lassen würde? Sollten sich Kapitän Delanos frühere Befürchtungen doch noch bewahrheiten? Oder hatte er ganz einfach in der etwas spukhaften Stimmung des Augenblicks eine zufällige, unabsichtliche Bewegung des Mannes, der vielleicht an dem Stag etwas in Ordnung gebracht hatte, für ein beabsichtigtes Winken und Zeichengeben gehalten?
Mit leichter Beunruhigung schaute er von neuem nach seinem Boot aus. Es war für den Augenblick hinter einem Felsvorsprung der Insel verborgen. Als er sich etwas stärker vorbeugte, um es gleich beim ersten Wiederauftauchen seines Bugs zu erspähen, gab das Geländer wie Holzkohle nach. Es gelang ihm gerade noch, ein freihängendes Tau zu packen, sonst wäre er ins Meer gestürzt. Es hatte nur ein schwaches Geräusch gegeben und die verfaulten Holztrümmer hatten bei ihrem Fall nicht viel Lärm gemacht; trotzdem mußte man es gehört haben. Er blickte auf, und sah sich von einem der alten Wergzupfer, der von seinem Sitz auf eine Spiere hinausgeklettert war, mit ruhiger Neugier gemustert. Tiefer als der alte Neger, und von ihm nicht gesehen, kam der spanische Matrose von vorhin aus einer Luke hervorgeschlüpft: es hatte etwas Spähendes, wie wenn ein Fuchs aus seinem Bau hervorwittert. Irgendetwas im Ausdruck des Mannes gab Kapitän Delano den verrückten Gedanken ein, Don Benito habe das Unwohlsein, mit dem er sich zurückgezogen hatte, nur vorgeschützt. Jetzt saß er vielleicht unten und ließ seinen Plan reifen; der Matrose aber hatte davon irgendwie Wind bekommen und wollte den Fremden warnen, vielleicht weil er ihm für ein freundliches Wort bei der ersten Begegnung an Bord dankbar war. Womöglich hatte Don Benito irgendeine derartige Störung vorausgesehen und deshalb vorsorglich seine Leute schlecht gemacht und die Neger herausgestrichen, obwohl gerade umgekehrt die Weißen und nicht die Schwarzen einen höchst fügsamen Eindruck machten. Die Weißen waren ja zweifellos ihrer Veranlagung nach die schärfer denkende Rasse. Wenn einer also Übles vorhatte, so würde er freundlich von den Dummköpfen sprechen, die seine verruchten Absichten nicht durchschauten, und sich absprechend über die Intelligenz äußern, vor der er sich nicht zu tarnen vermochte. Dafür sprach einiges. Hatten aber die Weißen dunkle Kunde über Don Benito, hieß das dann, daß Don Benito mit den Schwarzen unter einer Decke stecken mußte? Sie waren dazu gar nicht intelligent genug. Außerdem, wer hätte je von einem Weißen gehört, der seiner eigenen Rasse derart abtrünnig geworden wäre, daß er sich gegen sie mit Negern auf ein Bündnis eingelassen hätte? Schwierige Überlegungen, wie er sie schon einmal angestellt hatte. Tiefer als je ins Labyrinth seiner Gedanken verloren, erreichte Kapitän Delano seinen alten Platz auf Deck und wanderte in unbehaglicher Stimmung auf und ab, als er ein neues Gesicht gewahrte, einen alten Matrosen, der mit untergeschlagenen Beinen in der Nähe der Hauptluke saß. Seine Haut war geschrumpft und gerunzelt wie ein leerer Pelikankropf, sein Haar grau bereift, sein Antlitz ernst und gesammelt. In den Händen hatte er ein Bündel Taue, die er zu einem großen Knoten verschlang. Einige Schwarze hatten sich um ihn geschart und reichten ihm hilfsbereit die Taulitzen hin, wie er sie gerade brauchte.
Kapitän Delano ging zu ihm hinüber und sah sich schweigend das Knotenschlingen an, wobei, in seinem Gemüt ein vielleicht nicht ganz unbegreiflicher Übergang vom einen zum andern, von dem Gedankenwirrwarr in seinem Kopf zu den Knoten und Verschlingungen des Hanfseils, vor sich ging. Einen Knoten von solcher Verzwicktheit hatte er noch auf keinem amerikanischen Schiff und auch sonst nirgends gesehen. Der Alte sah auch ganz aus wie ein ägyptischer Priester, der für den Ammonstempel gordische Knoten wand. Achtknoten, Kreuzknoten und Timmerstek, Pfahlstek und Fallreepsknoten schienen in diesem Gebilde miteinander kombiniert.
Was ein solcher Knoten bedeuten sollte, war dem Kapitän unfaßlich. Er wandte sich an den Alten.
»Was knüpfst du denn da?«, fragte er freundlich.
»Den Knoten«, hieß es kurz ohne daß der Alte den Blick gehoben hätte.
»Anscheinend! Aber wozu?«
»Damit jemand anders ihn aufmacht«, brummelte der andere und ließ seine Finger noch emsiger arbeiten, denn der Knoten war nun beinahe fertig.
Kapitän Delano schaute weiter zu, aber plötzlich warf ihm der Alte den Knoten entgegen und sagte dazu in gebrochenem Englisch – den ersten englischen Worten, die er auf dem Schiff vernahm – etwas, was ungefähr heißen konnte: »Aufmachen, aufschneiden, schnell!« Es war leise gesprochen und so überaus hastig zusammengeballt, daß das langstielige Spanisch, das er vor und nachher sprach, wie ein Deckmantel für das kurze bißchen Englisch wirkte.
So geschah's, und Rätselknoten in der Hand, Rätselfragen im Gemüt stand Kapitän Delano sprachlos da, indes der Alte, ohne sich weiter um ihn zu kümmern, anderes Tauwerk in Angriff nahm. Gleich darauf raschelte etwas hinter Kapitän Delanos Rücken. Er wandte sich um und gewahrte den gefesselten Neger, Atufal, der ruhig hinter ihm stand. Der alte Matrose hingegen schien plötzlich aus der Ruhe gebracht. Unverständliches Zeug murmelnd entfernte er sich mit seinen Negergehilfen nach dem Vorderschiff und verschwand dort unter der Menge.
An seine Stelle trat ein älterer Neger in einer Art Kinderkittelchen, jedoch mit graumeliertem Kopf und gleichsam amtsrätlichem Äußeren, auf Kapitän Delano zu. In leidlichem Spanisch und mit einem gutmütigen Blinzeln des Einverständnisses teilte er ihm mit, der Alte mit dem Schifferknoten sei ein bißchen schwachsinnig, doch harmlos; er mache öfters solche Späße. Ob er den Knoten vielleicht haben dürfe – denn er, der Kapitän, werde sich wohl nicht damit plagen wollen. Ohne viel Überlegung ward er ihm hingereicht. Er nahm ihn mit einem Diener entgegen, drehte sich um und begann an dem Ding herumzugeheimnissen wie ein mißtrauischer Zöllner an einem Posten geschmuggelter Spitzen. Es dauerte aber nicht lang. Mit einem Negerausdruck, der zweifellos Geringschätzung ausdrückte, schleuderte er den Knoten über Bord.
Seltsam und immer noch seltsamer, dachte Kapitän Delano, und eine bedrängende Gemütsregung, beinahe eine Art Übelkeit, bemächtigte sich seiner. Wie man es bei beginnender Seekrankheit macht, bemühte er sich, die Anzeichen von sich zu weisen und so das Übel selber abzuwenden. Wieder schaute er nach seinem Boot aus. Zu seiner Freude war es jetzt wieder in Sicht und hatte den Felsvorsprung hinter sich gelassen.
Der Anblick gab ihm ein Gefühl erst der Erleichterung, bald sogar der völligen Beruhigung, wie er sie so vollständig gar nicht erwartet hätte. Da war es nun zu sehen und gar nicht so sehr weit entfernt, das wohlbekannte Boot – es war nicht mehr, wie vorhin, halb im Dunst zergangen, sondern der Umriß stand scharf ausgeschnitten, so daß an seiner Individualität, wie bei einem Menschen, kein Zweifel mehr bestand. Es war sein Boot, ›Seeräuber‹ geheißen, und wenn es jetzt auch auf fremder See schwamm, so hatte es doch oft genug den Strand vor Kapitän Delanos Haus gedrückt, war dorthin gebracht worden, um in Stand gesetzt zu werden, und hatte vertraulich vor seiner Schwelle gelegen wie ein Neufundländer. Er brauchte es nur zu sehen, das Boot von zuhause, und schon wurden tausend vertrauenerweckende Anklänge in ihm wach und erfüllten ihn nach den vorhergegangenen Ungewißheiten mit Frohsinn und Zuversicht, ja geradezu mit einer halbhumoristischen Stimmung des Selbstvorwurfs, weil er es bisher an solcher Zuversicht so sehr hatte fehlen lassen.
»Ausgerechnet ich, Amasa Delano – Hans vom Strand, wie sie mich als Jungen nannten – ich, Amasa, der ich mit dem Schulränzel in der Hand zu Wasser in unser Schulhaus in dem alten Schiffsrumpf hinübergerudert bin – ich, Hans vom Strand, der ich mit Vetter Nat und den andern Beerensuchen gegangen bin – ich sollte mich hier am Ende der Welt auf einem verhexten Piratenschiff von einem widerlichen Spanier ermorden lassen! Hat man solchen Unsinn je gehört? Wer sollte Amasa Delano umbringen? Er hat ein reines Gewissen. Und droben wacht einer. Pfui Kuckuck, Hans vom Strand: du bist mir doch ein rechtes Kind – in zweite Kindheit verfallen, alter Knabe – kindisch und altersschwach zugleich, muß ich fürchten!«
Leichten Schritts, wie leicht im Herzen, wandte er sich nach achtern und traf da alsbald Don Benitos Diener, der ihm mit gefälliger Miene, ganz seiner eigenen gegenwärtigen Stimmung entsprechend, kundtat, sein Herr habe sich von den Folgen seines Hustenanfalls erholt und heiße ihn nun seinem lieben Gast Don Amasa seinen Gruß entbieten mit der Nachricht, daß, Don Benito, sich glücklich schätze, bald wieder bei ihm zu sein.
Siehst du nun und merkst du was?, dachte Kapitän Delano, die Hütte mit langen Schritten abmessend. Was bin ich für ein Esel gewesen. Ein braver Mensch, ein Ehrenmann, der mir freundliche Grüße ausrichten läßt – ich aber habe noch vor zehn Minuten nicht anders gedacht, als daß er sich unten mit der Blendlaterne um einen Wetzstein herumdrückt und die Axt für meinen Hals schleift. Da sieht man's wieder: so eine lange Flaute macht die Seele krank, wird immer behauptet, hab's freilich bisher nicht glauben mögen. Haha, kann ich nur sagen: da kommt ja mein Boot, da kommt mein »Seeräuber«, guts Hundchen, mit 'nem weißen Knochen im Maul. Reichlich groß der Knochen übrigens, scheint mir. Wahrhaftig, da haben sie schon wieder abgedreht, wegen der Untiefe – strudelt ja ordentlich. Nun müssen sie andersrum vorbei. Na, Geduld bringt Rosen.
Es mochte etwa Mittag sein. Freilich, bei dem diesigen Licht überall, hätte man auch meinen können, es sei schon Dämmerungszeit.
Die Windstille war ungebrochen. Weit hinaus, dem Einfluß des Lands entzogen, schien der bleifarbene Ozean regungslos hingebreitet, wie unter Glas, kein Leben mehr darin, keine Seele mehr, lauter Abgestorbenheit. Nur die Strömung von Land her bestand noch und nahm zu. Schweigend wurde das Schiff weiter und weiter hinausgetragen zu den erstarrten Wassern da draußen.
Kapitän Delano aber kannte diese Breiten und ließ sich, allen gegenwärtigen Aussichten zum Trotz, nicht von der Hoffnung abbringen, daß jeden Augenblick eine Brise, und zwar eine ganz ansehnliche und frische, losbrechen könnte, so daß er seine kühne Erwartung nicht aufzugeben brauchte, die »San Dominick« doch noch vor Einbruch der Nacht sicher vor Anker zu bringen. Die Strecke, die sie abgetrieben waren, hatte nichts zu bedeuten. Mit gutem Wind hätten sie mit zehn Minuten Segeln eine Stunde Abtreiben wieder eingebracht. Er wandte sich bald nach der einen Seite um zu sehen, wie der »Seeräuber« dem Ebbestrudel auswich; bald nach der andern, ob Don Benito käme, und wanderte so unablässig auf und ab.
Allmählich fiel ihm die Verspätung seines Boots doch auf die Nerven. Das Gefühl verwandelte sich in neue Unruhe, und als er nun auch noch wie von einer Loge ins Parkett hinunter auf die fremde Menschenmenge vor und unter seinem Blick hinabsah und dabei nach einiger Zeit das jetzt zu einem Ausdruck der Gleichgültigkeit zusammengeraffte Gesicht des spanischen Matrosen erkannte, der ihm von den Rüsten aus das vermeintliche Zeichen gegeben hatte – da kehrte beinahe wieder die alte Bangigkeit bei ihm ein.
Zum Donner, dachte er (und es war ihm kein Spaß) – das ist ja wie beim Wechselfieber! Wenn es fort ist, so folgt daraus noch lange nicht, daß es nicht wiederkehrt.
Wohl schämte er sich seines Rückfalls, aber er konnte ihn nicht gänzlich überwinden. Doch drängte er sich, so sehr er nur konnte, zum Guten und kam so unmerklich zu einer Zwischenlösung.
Zugegeben: eine merkwürdige Bemannung; eine merkwürdige Geschichte; und merkwürdige Menschen an Bord. Aber – weiter nichts.
Um sich allen bösen Grübeleien zu entziehen, bis sein Boot da wäre, zwang er sich zu einem regelmäßigen und rein theoretischen Durchdenken aller möglichen Einzelheiten über Kapitän und Mannschaft. Da kehrten unter anderem vier seltsame Punkte immer wieder:
Da war erstens die Geschichte mit dem jungen Spanier, den der Sklavenjunge mit dem Messer angefallen hatte, ohne daß Don Benito eingeschritten wäre. Da war zum zweiten die herrschsüchtige Art, wie Don Benito den Neger Atufal behandelte; man mußte da an ein Kind denken, das einen mächtigen Stier am Nasenring führte. Zum dritten das Niedertrampeln des Seemanns durch die beiden Schwarzen – eine Ungehörigkeit, die ohne jedes Wort des Tadels hingegangen war. Und schließlich viertens die kriecherische Unterwürfigkeit aller kleinen Leute auf dem Schiff und namentlich der Schwarzen gegen ihren Herrn, als fürchteten sie bei der geringsten Unachtsamkeit seine despotische Ungnade auf sich herabzuziehen.
Wenn man diese Punkte nebeneinanderstellte, hatten sie etwas Widerspruchsvolles. Und wenn schon?, dachte Kapitän Delano mit einem Blick auf das endlich näherkommende Boot – und wenn schon? Sicher, Don Benito ist ein höchst launischer Kommandeur. Aber er ist nicht der erste von dieser Art, den ich sehe; wenn er auch freilich alle andern in den Schatten stellt. Andererseits sind diese Spanier ja allesamt wunderliche Burschen. Schon das Wort Spanier hat einen sonderbaren, hochverräterhaften, verschwörermäßigen Nebenklang. Und doch, möcht' ich meinen, sind sicher auch die Spanier im großen ganzen genau so brave Leute wie die bei uns daheim in Duxbury, Massachusetts. Na, gottlob! Endlich ist »Seeräuber« da!
Als das Boot mit seiner willkommenen Ladung den Schiffsrumpf berührte, mußten die Wergzupfer mit ehrbarer Gebärde erst lang auf die andern Schwarzen einwirken, die sich beim Anblick der drei im Boot verstauten Wasserfässer und der nicht mehr übermäßig frischen Kürbisse im Bug wie die Rasenden gebärdeten und sich förmlich wütig übers Schanzkleid nach außen beugten.
In diesem Augenblick erschien auch Don Benito mit Diener; es ließ sich denken, daß sein Erscheinen von dem Lärm beschleunigt worden war. Kapitän Delano wandte sich sogleich an ihn und suchte um die Erlaubnis nach, das Wasser auf geordnete Weise auszuteilen, damit alle gleichmäßig davon bekämen und sich keiner durch ein sinnloses Übermaß einen Schaden zuzöge. Ein vernünftiger und Don Benito gegenüber sehr entgegenkommender Vorschlag – jener aber nahm ihn mit offenbarem Unmut auf. Vielleicht war es ihm bewußt, daß er es als Kommandeur an der richtigen Entschlußkraft mangeln ließ, und er empfand deshalb mit der Eifersucht der Schwäche jedes fremde Eingreifen als eine Kränkung. Für Kapitän Delano jedenfalls gab es keine andere Erklärung als diese.
Nicht lang, und die Fässer wurden hochgewunden, wobei es nicht ausbleiben konnte; daß Kapitän Delano, der am Laufsteg Posto gefaßt hatte, von den aufgeregten Schwarzen ab und zu aus Versehen angerempelt wurde. Das zwang ihn, ohne Rücksicht auf Don Benito dem Impuls des Augenblicks nachzugeben und den Schwarzen gutmütig, aber bestimmt zu befehlen, sie sollten zurücktreten, und um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, unterstrich er sie mit einer halb spaßhaften, halb drohenden Gebärde. Die Schwarzen hielten alsbald inne; sie verharrten alle, Männer und Weiber, wo sie gerade standen, und wie erstarrt und von den Worten festgebannt rührte sich einige Augenblicke keins vom Fleck, während, wie zwischen den Semaphoren einer Telegraphenleitung, ein unbekanntes Wort – ein Zeichen nur oder ein Stichwort – unter den Wergzupfern auf ihrer Stange von Mann zu Mann flog. Der Fremde schaute gebannt auf das Schauspiel – da sah er plötzlich die Axtschleifer halb aufspringen und hörte Don Benito einen kurzen, gejagten Schrei ausstoßen. Er dachte nicht anders, als daß er auf dieses Zeichen des Spaniers würde hingeschlachtet werden, und war schon entschlossen, sich mit einem Sprung in sein Boot zu retten. Ein nächster Blick aber zeigte ihm, daß sich die Wergzupfer unter die Menge gemischt hatten und mit ernsten, ermahnenden Worten so Weiße wie Neger beiseitedrängten, wobei sie ihnen mit freundlichen und zutraulichen, beinahe komikerhaften Gebärden bedeuteten, sie sollten sich gefälligst zusammennehmen. Gleichzeitig nahmen die Axtschleifer ihre Sitze wieder ein und hockten friedlich da wie die Schneider, und alsbald begann auch, als wäre nichts geschehen, das Hochhieven der Fässer weiterzugehen und Weiße und Schwarze sangen einträchtig am Flaschenzug.
Kapitän Delano warf einen Blick auf Don Benito. Der Spanier, mager zum Erbarmen, richtete sich eben wieder in den Armen seines Dieners auf, in die er vor Erregung und Schwäche zurückgesunken war, und Kapitän Delano mußte sich ernstlich wundern, daß er einer solchen Schreckvorstellung hatte zum Opfer fallen und vorschnell hatte annehmen können, ein Schiffskommandeur wie dieser, der bei einem ganz harmlosen und offenbar auch ganz unbedeutenden Zwischenfall so sehr die Selbstbeherrschung verlor, werde imstande sein, in kaltblütiger Niedertracht auf seinen Mord zu sinnen.
Die Fässer lagen auf Deck; ein Gehilfe des Schiffsstewards reichte Kapitän Delano eine Reihe von Krügen und Bechern und ersuchte ihn im Namen seines Kapitäns, zu tun, wie er vorgeschlagen hatte – nämlich das Wasser auszuteilen. Er erfüllte die Bitte und ließ dabei eine republikanische Unparteilichkeit walten, ganz, im Sinne des Wassers, dieses republikanischen Elements, das immer auf eine ebene Oberfläche hinstrebt. Kein Weißer, er mochte selbst ein alter Mann sein, bekam besser eingeschenkt als der jüngste Negerjunge, und nur für den armen Don Benito wurde eine Ausnahme gemacht, weil sein körperlicher Zustand, wenn schon nicht sein Rang, eine Extraration erheischte. Er reichte ihm sogar an erster Stelle ein reichliches Gemäß des Tranks; der Spanier aber, so sehr ihn der Durst peinigen mochte, schlürfte auch nicht einen Tropfen, bevor er nicht etliche zeremoniöse Verneigungen und Komplimente vollführt hatte. Es kam zu einem richtigen Austausch von Höflichkeiten, wozu die Mohren in ihrer Freude an allem äußeren Schauspiel begeistert in die Hände klatschten.
Zwei etwas weniger eingeschnurrte Kürbisse wurden für die Kapitänskajüte beiseitegelegt; die übrigen schnitt man auf der Stelle klein und ließ die Menge sich daran gütlich tun. Das Weißbrot allerdings, den Zucker und den auf Flaschen gezogenen Apfelwein hatte Kapitän Delano den Weißen allein zugedacht und namentlich ihrem Kommandeur. Dieser widersetzte sich aber, was dem Amerikaner als ein Zug der Uneigennützigkeit nicht wenig gefiel, und so wurde denn auch von diesem Mundvorrat gleichmäßig an Weiße und Schwarze ausgeteilt. Nur eine Flasche Apfelwein wurde ausgenommen; Babo bestand darauf, sie für seinen Herren beiseitezutun.
Es möge hier bemerkt werden, daß der Amerikaner ebenso wie beim ersten Besuch seines Bootes auch jetzt seinen Leuten nicht erlaubt hatte, an Bord zu gehen. Er wollte zu dem Durcheinander auf Deck nicht seinerseits noch beitragen.
Die gute Stimmung, die im Augenblick vorherrschte, hatte sich ihm mitgeteilt und alle unfreundlichen Gedanken waren aus seinem Gemüt verscheucht. Aus verschiedenen Anzeichen hatte er sich ausgerechnet, daß in nächster Zeit, spätestens in ein bis zwei Stunden, eine Brise zu erwarten sei, und so schickte er das Boot noch einmal zum Robbenfänger zurück mit dem Auftrag, es sollten sogleich alle verfügbaren Leute leere Wassertonnen nach dem Ort flößen, wo es Frischwasser gab, und sie dort füllen. Außerdem bestellte er seinem Ersten Offizier, wenn das Schiff wider Erwarten bis Sonnenuntergang nicht vor Anker gebracht sei, so brauche er sich nicht zu beunruhigen. Es sei eine mondhelle Nacht, und er (Kapitän Delano) werde auf jeden Fall an Bord bleiben und im Notfall den Lotsen spielen, ob der Wind nun früher oder später aufkäme.
Die beiden Kapitäne standen beisammen, und beobachteten das wegrudernde Boot, indes der schwarze Diener sich still damit beschäftigte, einen zufällig auf dem Samtärmel seines Herrn entdeckten Flecken wegzureiben. In das Schweigen hinein machte Kapitän Delano die Bemerkung, es sei bedauerlich, daß die San Dominick keine Boote besitze – oder doch nur das seeuntüchtige, wrackartige Langboot, das, windschief wie ein Kamelsgerippe in der Wüste und auch beinahe ausgebleicht wie ein solches, nach Art eines umgestülpten Topfs mittschiffs lag, auf einer Seite ein wenig hochgekippt, so daß eine Art unterirdischer Höhle entstand, eine Zufluchtsstätte für allerlei schwarzes Familienleben. Auf alten Matten hockend oder auch in der dunklen Wölbung des Boots auf den hohen Sitzbänken thronend sah man sie, namentlich Frauen und kleine Kinder, einem Häuflein Fledermäuse vergleichbar im Dämmer ihrer schützenden Behausung kauern, und ab und zu schwirrte es, ein schwärzliches Vogelgewimmel nackter, drei- und vierjähriger Negerkinder beiderlei Geschlechts, durch den Spalt der Höhle ein und aus.
»Hätten Sie jetzt nur drei oder vier Boote, Don Benito«, sagte Kapitän Delano, »dann, glaube ich, könnten uns Ihre Neger ein ganzes Stück weiterhelfen, wenn sie sich ein wenig in die Riemen legten. Sind Sie denn schon ohne Boote in See gegangen?« »Sie sind bei Sturm leck geworden, Sennor«.
»Böse Sache. Leute haben Sie doch auch eine ganze Menge verloren. Boote und Leute. Das müssen schwere Stürme gewesen sein, Don Benito.«
»Man kann es gar nicht beschreiben«, sagte der Spanier ausweichend.
»Sie müssen mir aber doch erzählen, Don Benito«, sagte der andere, dessen Interesse nun erst recht erwachte, »Sie müssen mir aber doch erzählen: haben Sie gleich Sturm bekommen, als Sie Kap Hoorn passiert hatten?« »Kap Hoorn? – wer hat etwas von Kap Hoorn gesagt?«
»Sie, Don Benito, als Sie mir von Ihrer Reise berichteten«, antwortete Kapitän Delano, ganz erstaunt, daß der Spanier zu aller Unberechenbarkeit seiner seelischen Regungen nun auch noch in dem wankelmütig wurde, was er laut und deutlich erklärt hatte. »Sie selber, Don Benito, haben von Kap Hoorn gesprochen«, wiederholte er mit Nachdruck.
Der Spanier wandte sich von ihm ab. Er stand gleichsam abwartend da, in einer vornübergebeugten Haltung, wie jemand, der taucherartig von einem Element ins andere hinüberwechseln will, von der Luft ins Wasser.
In diesem Augenblick kam ein Botenjunge, ein Weißer, vorbeigelaufen, wohl in der regelmäßigen Ausübung seines Dienstes, der darin bestand, die abgelaufene halbe Stunde vom Chronometer in der Kajüte abzulesen und nach der Back vorzumelden, um sie an der großen Schiffsglocke glasen zu lassen.
»Herr«, sagte der Diener Babo und ließ von dem Jackenärmel ab, nicht ohne in der schüchternen und beinahe furchtsamen Art, wie er zu seinem offenbar schon wieder sehr erregten Herrn sprach, erkennen zu lassen, daß er sich einer Pflicht entledige, deren Erfüllung dem Herrn selber statt einer Erleichterung gewiß nur einen Ärger bedeuten würde – »– – Herr«, sagte er, »Babo hat gesagt bekommen, er soll den Herrn, gleichgültig wo und wann und was er eben vorhat, immer auf die Minute daran erinnern, daß Rasierzeit ist. Miguel ist eben gelaufen und läßt die halbe Stunde glasen. Jetzt ist die Zeit, Herr. Will der Herr in die Messe kommen?«
»Ja – richtig, richtig«, erwiderte der Spanier mit einem Aufschrecken, als kehrte er von Traum in Wirklichkeit zurück. Er wandte sich an Kapitän Delano und erklärte ihm, er werde alsbald zurückkehren und das Gespräch fortsetzen.
»Wenn der Herr also noch weiter mit Don Amasa sprechen will, kann sich dann nicht Don Amasa zum Herrn in die Messe setzen«, sagte der Schwarze. »Der Herr kann reden, Don Amasa kann zuhören, so lang der Babo einseift und das Messer abzieht.«
»Ja«, sagte Kapitän Delano, dem dieser Gedanke eines Beisammenseins gar nicht übel gefiel, »ja, Don Benito, wenn Sie nichts dagegen haben, komme ich mit.«
»Nun gut, Sennor.« Indem sie selbander nach achtern gingen, konnte der Amerikaner nicht umhin, es seltsam zu finden und eine neue Launenhaftigkeit seines Wirts darin zu erblicken, daß er sich mit einer derartig erstaunlichen Pünktlichkeit am hellen Tag rasieren ließ. Allerdings hatte der Diener in seiner geradezu ängstlichen Pflichttreue offenbar den Vorfall erst herbeigeführt, und zwar war es ihm vielleicht gerade darauf angekommen, seinen Herrn durch eine wohlberechnete Unterbrechung aus einer drohenden neuen Gemütsverfinsterung herauszuziehen.
Was Babo als Messe bezeichnet hatte, war in Wahrheit ein vom Aufbau der Hütte aus den Decksbauten ausgeschnittener leichtgezimmerter Raum, den man auch als eine Art Dachkammer über der darunterliegenden eigentlichen Kapitänskajüte ansehen konnte. Ein Teil davon hatte früher den Offizieren zum Aufenthalt gedient; seitdem sie aber tot waren, hatte man alle Trennungswände niedergerissen und den ganzen Innenraum in eine geräumige, luftige Wohnhalle umgewandelt. Da es an ordentlichem Mobiliar fehlte und ein malerisches Durcheinander mehr oder weniger überflüssiger Dinge den Raum füllte, konnte man sich etwas an die weite, unordentliche Halle im Heim eines wunderlichen weiberfeindlichen Landjunkers erinnert fühlen, der seine Jagdjoppe und seinen Tabaksbeutel am nächsten besten Hirschgeweih aufhängt und Angelrute, Feuerzange und Spazierstock in derselben Zimmerecke aufbewahrt.
Die Ähnlichkeit wurde dadurch noch erhöht, wenn nicht überhaupt hervorgerufen, daß man dann und wann die See von draußen hereinblitzen sah; denn in gewisser Hinsicht sind das freie Land und das Meer ja Geschwisterkinder.
Den Fußboden bedeckte eine Matte. In guter Kopfhöhe hatte man vier oder fünf alte Musketen in waagerechte Vertiefungen zwischen den Wandbalken geschoben. Auf einer Seite stand, an der Deckplanke befestigt, ein alter Tisch mit geschnitzten Füßen. Ein abgegriffenes Meßbuch lag darauf, und darüber war ein kümmerliches, kleines Kruzifix am Schott festgemacht. Unter dem Tisch lagen ein paar schartige Entermesser, auch eine unbrauchbar gewordene Harpune; daneben ein trauriger Haufen altes Takelwerk, anzusehen wie Stricke von Bettelmönchen. Ferner bemerkte man zwei breite, kantige Rohrkanapes mit Rückenlehne, schwarz vor Alter und schon beim Anschauen unbequem wie Folterinstrumente, sowie einen großen Lehnsessel von schlechten Proportionen, der mit seinem hinten befestigten, mit einer Schraube verstellbaren Barbierbecken ebenfalls wie ein groteskes Folterwerkzeug aussah. Ein Flaggenschrank in der Ecke stand offen und zeigte allerlei farbenprächtige Wimpel, zum Teil aufgerollt, zum Teil halb entrollt, manche auch unachtsam zu Boden geworfen. Gegenüber stand ein überladener Waschtisch aus schwarzem Mahagoni, aus einem Stück gearbeitet, mit einem Untergestell, daß man an einen Taufstein denken konnte, und oben mit Gittern und Fächern, in denen Kämme, Bürsten und andere Toilettegegenstände untergebracht waren. Eine Hängematte schaukelte daneben: zerfetzt, mit zerwühlten Laken und einem sorgenvoll zerknitterten Kissen, so daß man denken mußte, wer hier schlief, der schlief nicht gut, sondern wurde abwechselnd heimgesucht von traurigen Gedanken und bösen Träumen.
Das hinterste Ende der Messe, da wo sie über das Heck des Schiffs vorsprang, zeigte drei Öffnungen, die man als Fenster oder auch als Stückpforten ansprechen mochte, je nachdem Menschen oder Geschütze, in freundlicher Absicht, nach außen blickten. Im Augenblick waren weder Menschen noch Kanonen zu sehen, aber mächtige Ringbolzen und andere verrostete Eisenteile an der Holzwand deuteten darauf hin, daß hier einmal Vierundzwanzigpfünder gestanden hatten.
Kapitän Delanos Blick war an der Hängematte haften geblieben. »Sie schlafen auch hier, Don Benito?«, fragte er.
»Jawohl, Sennor – seit das Wetter wieder mild ist.«
»Und so ist das also Schlafsaal, Wohnraum, Segelmacherwerkstatt, Schiffskapelle, Waffenkammer und Geheimkabinett in einem?«, bemerkte Kapitän Delano, rundum blickend.
»Jawohl, Sennor – die Umstände sind nicht danach gewesen, daß ich sehr viel auf Ordnung hätte halten können.«
Der Diener, die Serviette überm Arm, machte in diesem Augenblick eine Geste, die besagen wollte, daß er mit Verlaub seines Herrn gern beginnen würde. Don Benito gab sein Einverständnis zu erkennen, und alsbald begann der Schwarze seine Handreichungen, nötigte ihn in den Lehnsessel, zog für den Gast eins von den Kanapees herbei und öffnete seinem Herrn Kragen und Kravatte.
In der Natur des Negers liegt etwas, was ihn im besonderen Maße für persönliche Hilfs- und Dienstleistungen geeignet macht. Die meisten Schwarzen sind die geborenen Kammerdiener und Friseure. Sie haben zu Kamm und Bürste ganz ebenso ein natürliches Verhältnis wie zu den Kastagnetten und handhaben sie auch mit derselben Begeisterung. Beim Umgang mit diesen Werkzeugen zeichnet sie ein hoher Grad von Gewandtheit und Feinfühligkeit aus, eine wunderbar geräuschlose, flinke und gleichsam huschende Art, die der Anmut nicht entbehrt und für den Beobachter etwas ausnehmend Angenehmes hat, noch mehr aber für den Gegenstand ihrer Bemühungen. Zu allem andern kommt noch ihre große Gabe des Humors. Darunter ist nicht einfach ein Grinsen und Lachen zu verstehen, das ja ganz und gar unpassend wäre. Nein – eine gewisse natürliche Heiterkeit, ausgewogen in jedem Ausdruck und jeder Gebärde, so daß man denken möchte, Gott selber habe den Kerl gewissermaßen freundlich in Musik gesetzt.
Rechnet man dazu noch ihre Gelehrigkeit, wie sie aus der anspruchslosen Zufriedenheit ihrer beschränkten Gemüter hervorgeht, und das Talent zu blinder Ergebenheit, das ja gerade bei untergeordneten Naturen mitunter besonders stark hervortritt, dann kann man wohl verstehen, warum gerade solche hypochondrischen Gestalten wie Johnson und Byron – und offenbar ebenso der Hypochonder Benito Cereno – ihre Leibdiener, die Neger Barber und Fletcher, beinahe bis zur Unduldsamkeit gegen die gesamte weiße Rasse ins Herz geschlossen haben. Wenn es sich nun so verhält, daß der Neger alle eingefleischte Sauertöpfischkeit eines reizbaren und menschenfeindlichen Gemütes überwindet, wie müßte er dann in seinen gewinnenden Zügen erst auf einen wohlwollenden Betrachter wirken? Kapitän Delano war von Natur so beschaffen, daß er, wenn von außen keine Störungen kamen, menschenfreundlich im höchsten Maß war und dem auch den zutraulichsten und heitersten Ausdruck verlieh. Daheim hatte er sich oft das Vergnügen gegönnt, sich unter seine Haustür zu setzen und einem freien Schwarzen bei der Arbeit oder beim Spiel zuzusehen. Hatte er auf einer Reise unter seinen Leuten einen Schwarzen, so stand er regelmäßig auf Gesprächs- und oft auch auf Neckfuß mit ihm. Wie die meisten gutherzigen, freundlichen Menschen hatte Kapitän Delano eine nicht so sehr philantropisch gemeinte, sondern aus dem Herzen kommende Neigung zu Negern, so wie andere Menschen zu Neufundländern.
Bisher hatten die Umstände, unter denen er die San Dominick angetroffen hatte, ihn in dieser seiner Neigung gehemmt. Jetzt aber in der Messe fühlte er sich von seiner früheren Unruhe erlöst und aus den verschiedensten Gründen umgänglicher gestimmt als je vorher an diesem Tag, und als er nun den guten Babo mit seinem Handtuch überm Arm so zuvorkommend um seinen Herrn besorgt sah, noch dazu bei einem so wohlvertrauten Geschäft wie dem des Rasierens, da kehrte seine alte Schwäche für die Neger vollends zurück.
Was ihn besonders vergnügte, war eine kleine Beobachtung, aus der die Vorliebe der Schwarzen für leuchtende Farben und prunkende Stoffe wieder einmal ersichtlich wurde. Babo griff nämlich ganz unbefangen in den Flaggenschrank und holte ein großes Stück in allen Farben schillerndes Fahnentuch hervor, um es seinem Herrn als Serviette ohne viel Umstände unters Kinn zu stopfen.
Das Rasieren spielt sich bei den Spaniern ein wenig anders ab als bei anderen Völkern. Man benutzt eine Schale, die auch ganz ausdrücklich als Rasierschale bezeichnet wird, und die auf einer Seite ausgeschnitten ist, so daß das Kinn genau hineinpaßt und beim Einseifen fest in das Gefäß gepreßt werden kann. Zum Einseifen bedient man sich nicht eines Pinsels, sondern man tunkt die Seife ins Wasser der Schale und verreibt sie auf dem Gesicht.
In Don Benitos Fall wurde wohl oder übel Salzwasser verwendet, und eingeseift wurde übrigens nur die Oberlippe und die Partie unterhalb der Kehle, während alles andere wohlgepflegter Bart war.
Für Kapitän Delano hatten die Vorbereitungen manches Neue, und so beschränkte er sich darauf, neugierig zuzuschauen, und es entspann sich keine Unterhaltung, zumal da auch Don Benito fürs erste keinen Wert darauf zu legen schien.
Der Neger stellte den Rasiernapf beiseite und suchte unter den vorhandenen Messern nach dem schärfsten. Als er es gefunden hatte, schärfte er es erst noch einmal nach, indem er es fachmännisch über die feste, glatte, ölige Haut seines Handballens abzog. Hierauf machte er eine Bewegung, als wollte er beginnen, unterbrach sich aber noch einmal und blieb einen Augenblick in vorgebeugter Haltung stehen, das Rasiermesser in der einen Hand erhoben, mit der andern die schäumende Seifenkruste am hageren Hals des Spaniers kennerisch betastend. Der Anblick des blitzenden Eisens so nah vor seinen Äugen schien Don Benito nicht ganz gleichgültig zu lassen. Er zuckte nervös zusammen; sein fahles Aussehen wirkte noch krankhafter, jetzt wo sein Gesicht eingeseift war, zumal da der Seifenschaum von dem schwärzlichen Hintergrund des Mohrengesichts ganz besonders grell abstach. Die Szene hatte überhaupt etwas Eigentümliches, wenigstens für Kapitän Delano, und er konnte bei der Haltung der beiden den Einfall nicht unterdrücken, daß er in dem Schwarzen einen Kopfabschneider und in dem Weißen einen Mann auf dem Block erblickte. Es war eine von jenen fratzenhaften Vorstellungen, wie sie einem auch bei kühlem Verstand, von einem Atemholen zum andern, bisweilen durch den Kopf schießen.
Der Spanier hatte mit einer seiner unruhigen Bewegungen das Flaggentuch an seinem Hals etwas gelockert, so daß es in breiter Falte wie ein Stück Vorhang über die Seitenlehne des Sessels zu Boden sank und dabei außer vielen heraldischen Querbalken und Grundfarben – Schwarz, Blau und Gelb – in diagonal einander überschneidenden Feldern ein Kastell auf blutrotem Grunde und einen steigenden Löwen auf Silber zeigte.
»Kastell und Löwe«, rief Kapitän Delano, »– das ist ja die spanische Flagge, die Sie sich da angesteckt haben, Don Benito! Wie gut, daß nur ich und nicht der Herr König es sieht.« Er lächelte. »Aber–«, damit wandte er sich an den Schwarzen, »nicht wahr: wenn schon alles einerlei ist, wollen wir wenigstens lustige Farben setzen.« Es war spaßhaft gemeint, und es verfehlte nicht seine Wirkung auf den Schwarzen.
»Also, Herr«, sagte er, brachte das Flaggentuch in Ordnung und drückte den Kopf mit sanfter Gewalt tiefer in die Mulde des Sessels zurück. »Also, Herr« – und das Messer blinkte nah an des Sitzenden Kehle.
Wieder sah man Don Benito leise zittern.
»Nicht so zittern, Herr! Da sehen Don Amasa: der Herr zittert immer so, wenn ich ihn rasiere. Dabei weiß er doch genau, ich habe ihn noch nie blutig geschnitten, obwohl freilich, wenn er so zittert, kann's wohl einmal vorkommen. Also, Herr! – und Don Amasa, bitte, fragen ruhig weiter nach dem Sturm und was Sie wollen wissen. Mein Herr kann zuhören, und zwischenhinein kann er wohl auch Antwort geben.«
»Ach ja, die Stürme«, sagte Kapitän Delano. »Je länger ich über Ihre Reise nachdenke, Don Benito, umso mehr muß ich mich wundern – nicht über die Stürme, so schrecklich sie gewesen sein mögen, sondern über die schauderhafte Zeit nachher. Da sind Sie, wie Sie sagen, zwei Monate und darüber von Kap Hoorn nach Santa Maria unterwegs gewesen, eine Strecke, die ich selber, freilich mit gutem Wind, in ein paar Tagen gesegelt bin. Natürlich, Sie hatten Flauten und zwar langandauernde, aber zwei Monate in einer Flaute liegen, das ist zum mindesten ungewöhnlich. Offen gesagt, Don Benito, wenn nicht gerade Sie es wären, müßte ich mich doch weiß Gott als ungläubiger Petrus verhalten, einer solchen Geschichte gegenüber.«
Den Spanier überkam bei dieser Bemerkung ein inneres Aufwallen, dessen er offenbar nicht Herr war, ähnlich wie vorhin auf Deck. Mochte er nun eine jähe Bewegung gemacht haben, oder war es ein ungeschicktes Rollen des Hecks in der Windstille oder eine vorübergehende Unsicherheit von Babos Hand, jedenfalls fuhr in diesem Augenblick das Messer in die Haut, und Blutstropfen färbten den schneeigen Seifenschaum an Don Benitos Kehle. Der schwarze Barbierer ließ das Messer sofort zurückzucken. Immer noch in seiner Haltung von vorhin, Kapitän Delano den Rücken kehrend und das Gesicht Don Benito zugewandt, hielt er die tropfende Klinge in die Höhe und sprach mit einem Ausdruck gleichsam belustigten Kummers: »Der Herr selber sehen – haben so gezittert – nun hat's bei Babo zum erstenmal Blut gegeben.«
Wäre vor Jakob dem Ersten von England ein Schwert blankgezogen worden – hätte in dieses hasenfüßigen Königs Gegenwart ein Meuchelmord stattgefunden – er hätte kein so entsetztes Antlitz zeigen können wie Don Benito.
Armer Kerl, dachte Kapitän Delano; so aufgeregt, daß er es nicht einmal sehen kann, wenn der Barbier ihn schneidet. Und von diesem aus dem Leim gegangenen, kranken Menschen habe ich mir einbilden können, er wolle mir an Blut und Leben, wo er nicht einmal ein Tröpfchen eigenes Blut sehen kann! Weißgott, Amasa Delano, du bist heute ein bißchen außer dir. Davon würde ich daheim lieber den Mund halten, sonst meinen die, du bist noch nicht trocken hinter den Ohren. So schauen sie aus, die Meuchelmörder! Ich würde eher sagen, er macht ein Gesicht, als sollte es ihm selber ans Leben. Eins will ich mir merken: was ich heute erlebt habe, soll mir eine Lehre sein.
Indes dem braven Seemann diese Überlegungen durch den Kopf gingen, hatte der Schwarze das Handtuch vom Arm genommen und zu Don Benito gesagt: »Aber Herr, antworten doch Don Amasa bitte! Ich wasche so lange das häßliche Zeug vom Messer und ziehe es neu ab.«
Während er dies sagte, war sein Gesicht halb zur Seite gewandt, so daß sie ihn beide sehen konnten. Etwas in seiner Miene schien auszudrücken, daß es ihm lieb wäre, wenn sein Herr die Unterhaltung fortsetzte, weil auf diese Weise seine Aufmerksamkeit von dem unliebsamen Zwischenfall abgelenkt würde. Don Benito schien auch wirklich froh über die gebotene Gelegenheit; unverdrossen berichtete er Kapitän Delano aufs neue, es habe sich um Flauten von ganz ungewöhnlicher Dauer gehandelt, und überdies sei das Schiff hartnäckigen Strömungen zum Opfer gefallen. Dies und anderes erzählte er; manches war nur eine Wiederholung früher gesagter Dinge, und alles diente dazu, begreiflich zu machen, wie es möglich war, daß die Überfahrt von Kap Hoorn nach Santa Maria so über die Maßen lang gedauert hatte. Ab und zu mischte er, wenn es die Gelegenheit ergab, Lobsprüche auf die Neger in seine Rede, wiewohl nicht mehr so ins einzelne gehend, ihre allgemeine gute Aufführung betreffend. Übrigens sprach er keineswegs im Zusammenhang, denn öfters ersah sich der Diener eine günstige Gelegenheit und legte mit dem Rasiermesser Hand an, so daß, vom Barbieren unterbrochen, die Erzählung und die Lobeshymnen ziemlich abgerissen und schwerverständlich zum Vortrag kamen.
Schon war in Kapitän Delanos Phantasie ein neuer Geist der Unruhe erwacht, und er glaubte in Don Benitos Benehmen etwas Zweideutiges zu erkennen, was sich in dem düster-beifälligen Schweigen seines Dieners gewissermaßen wiederholte, bis schließlich der Gedanke in ihm aufschoß, ob nicht womöglich Herr und Diener zu unbekannten Zwecken in Wort und Tat, ja selbst in dem Schauspiel von Don Benitos nervösen Zuckungen ein wohlverabredetes Spiel mit verteilten Rollen vor ihm aufführten. Es fehlte für diesen Verdacht einer bewußten Täuschung auch nicht an dem und jenem Augenschein, wenn man etwa an die früher erwähnten heimlichen Flüsterreden zwischen den beiden dachte. Was sollte es aber dann für einen Sinn haben, das Barbierschauspiel vor ihm aufzuführen? Kapitän Delano kam schließlich doch wieder dazu, alles für eine Grille zu halten, die sich ihm vielleicht unbewußt aus dem theatralischen Anblick Don Benitos in seiner harlekinshaften Flaggenumhüllung aufgedrängt hatte, und er verwies den Einfall schleunigst aus seinem Gemüt.
Nach dem Rasieren kramte der Diener ein Fläschchen mit wohlriechendem Wasser hervor, goß seinem Herrn einige Tropfen davon aufs Haupt und verrieb sie gründlich. Er legte so viel Nachdruck in seine Bewegung, daß sich die Muskeln in seinem Gesicht förmlich verkrampften.
Als nächstes griff er zu Kamm, Schere und Haarbürste. Er machte seine Sache sehr genau, glättete hier eine widerspenstige Locke, schnitt dort ein aus der Reihe wachsendes Haar aus dem Backenbart, strich an der Schläfe die Frisur noch einmal gefällig zurück und gab überhaupt durch hundert Kleinigkeiten zu erkennen, daß hier die Hand eines Meisters waltete. Don Benito, gottergeben wie man es unter den Händen eines Friseurs ja meistens ist, ließ alles mit sich geschehen; etwas weniger nervös als vorhin beim Rasieren, aber dafür bleich und regungslos in seinem Sessel sitzend, so daß man meinen könnte, der Neger arbeite als ein schwarzer Bildhauer an einem weißen Statuenkopf.
Endlich war alles vorüber; das spanische Flaggentuch wurde entfernt, flüchtig zusammengerollt und in den Flaggenschrank verstaut, Babos warmer Negeratem blies auch das letzte verirrte Härchen aus seines Herrn Hals hinweg. Kragen und Kravatte wurden befestigt und vom samtenen Rockaufschlag ein Endchen Charpie säuberlich weggewischt. Dies geschehen, trat der Geschäftige einen Schritt zurück und musterte seinen Herrn einen Augenblick mit dem Ausdruck schlechtverhohlener Befriedigung, als erblickte er in ihm, wenigstens was die Toilette betraf, das Geschöpf seiner kundigen Hände.
Kapitän Delano ließ sich das Vergnügen nicht entgehen, ihm zu seiner Leistung zu gratulieren, ihm und auch Don Benito. Auf den Spanier freilich schienen Toilettenessenzen und Kopfmassage genau so wenig Eindruck zu machen wie ihm dargebrachte Bezeugungen der Treue und Freundlichkeit. Er war schon wieder in sein abweisendes Brüten verfallen und machte keine Miene, sich vom Platz zu erheben. Kapitän Delano mußte sich sagen, daß seine Gegenwart nicht länger erwünscht sei, und so zog er sich denn zurück, unter dem Vorwand, er wolle nachsehen, ob seine Voraussage eintreffe und irgendwelche Anzeichen einer Brise wahrzunehmen seien.
Er ging bis zum Großmast und ließ sich die soeben erlebte Szene noch einmal durch den Kopf gehen, nicht ganz ohne ein unklares Gefühl der Beunruhigung, als ein Geräusch aus der Richtung der Messe ihn umblicken ließ und er den Neger sah, wie er sich mit der Hand die Backe rieb. Nähertretend gewahrte er, daß die Backe blutete, und bevor er sich noch nach der Ursache hatte erkundigen können, erfuhr er aus dem wehklagenden Selbstgespräch des Schwarzen schon alles Nötige.
»Wann wird der Herr denn endlich wieder gesund werden? Schlechtes Herz kommt von schlechter Gesundheit – drum hat er Babo auch so mitgespielt. Hat ihn mit dem Rasiermesser geschnitten, nur weil Babo ihn rein aus Versehen ein einziges klein bißchen geritzt hat, zum allerersten Mal noch dazu in all der langen Zeit. Au, au, au! –« – er hielt sich wehleidig die Hand an die Backe.
Sollte man es für möglich halten?, dachte Kapitän Delano. Um sein spanisches Mütchen in aller Heimlichkeit an seinem armen Freund zu kühlen, hat mich der biedere Don Benito also, indem er den Verdrießlichen spielte, zum Hinausgehen veranlaßt! Ich sag's ja: das Sklavenhalten macht die Menschen schlecht und niederträchtig. Der arme Kerl!
Er wollte ein paar freundlich teilnehmende Worte zu dem Neger sprechen, aber eine Schüchternheit hielt ihn davon ab. Ungern genug entschloß er sich, in die Messe zurückzukehren.
Siehe, wer kam ihm entgegengeschritten? Herr und Diener in schönster Eintracht: Don Benito auf den Schwarzen gestützt, als wäre nicht das mindeste vorgefallen.
Eine Art. Liebesstreit also, dachte Kapitän Delano. Er gesellte sich zu Don Benito, und sie gingen langsam weiter. Übrigens kamen sie nicht weit, denn der Steward, ein großgewachsener, herrschaftlich aussehender Mulatte in orientalischer Aufmachung, einen pagodenartigen Turban aus drei oder vier indischen Seidentüchern schichtweise übereinander um den Kopf gewunden, trat mit höflichem Salaam vor sie hin und bat sie in die Kajüte zum Essen.
Auf dem Weg dorthin ging ihnen der Mulatte voran, wobei er sich immer wieder halb zu Ihnen umwandte und mit Lächeln und Geknix die Bedeutung des Augenblicks unterstrich. Neben solchem Aufwand von Pracht und Herrlichkeit wirkte der kleine Babo, der nicht den kleinsten Kopfputz trug, doppelt unbedeutend, und er schien sich seiner untergeordneten Situation auch einigermaßen bewußt und maß den anmutsvollen Steward mit mißgünstigen Blicken. Zu einem Teil führte Kapitän Delano seine jäh erwachte Eifersucht aber auch auf die eigentümliche Empfindlichkeit zurück, die der Vollblutneger dem mit anderem Blut vermischten Rassegenossen gegenüber empfindet. Der Steward wiederum verriet in seiner Art vielleicht nicht gerade ein besonderes Maß von Würde und Selbstgefühl, aber doch den ausgesprochenen Wunsch, sich gefällig zu zeigen – und das ist doppelt verdienstlich, da es sowohl den Forderungen des Christentums wie denen des Lords Chesterfield entspricht.
Was Kapitän Delano an dem Mann fesselte, war der Unterschied zwischen seiner gemischten Hautfarbe und seinem Gesichtsschnitt, der durchaus europäisch, ja sogar klassisch europäisch heißen durfte. »Don Benito«, sagte er leise. »Wie schön, daß ich auch Ihren Empfangschef vom Goldenen Szepter zu sehen bekomme. Sein Anblick ist der beste Gegenbeweis zu einer bösen Bemerkung, die ich einmal von einem Pflanzer auf Barbados gehört habe. Der sagte: wenn ein Mulatte ein recht europäisches Gesicht habe, müsse man vor ihm auf der Hut sein, er sei bestimmt ein Satan. Ihr Steward hier hat Gesichtszüge, regelmäßiger als Georg von England, und doch nickt er uns zu und verbeugt sich und lächelt – wahrhaftig auch wie ein König, ein König der Liebenswürdigkeit und der guten Manieren. Seine Stimme ist auch höchst angenehm.«
»Das ist sie, Sennor.«
»Nun müssen Sie mir aber sagen: hat er sich nicht auch, soweit Sie ihn kennen, immer als ein guter, anständiger Kerl erwiesen?«, sagte Kapitän Delano stehenbleibend, indes der Steward mit einer letzten tiefen Verneigung in der Kajüte verschwand. »Aus dem eben erwähnten Grund wäre es mir recht lieb, wenn ich das wissen dürfte.«
»Francesco ist ein guter Mann«, – mit einer Art Gleichgültigkeit antwortete es Don Benito phlegmatisch zustimmend, wie jemand, der sich weder mit Lob noch mit Tadel in Unkosten stürzen möchte.
»Das habe ich mir doch gedacht. Wäre ja auch sonderbar, und nicht besonders schmeichelhaft für uns Bleichgesichter, wenn ein Tropfen von unserem Blut mit dem afrikanischen untermischt es nicht etwa verbessern, sondern nur betrüblicherweise einen Schuß Vitriolsäure in die schwarze Brühe hineinbringen würde. Die Farbe wäre vielleicht aufgebessert, aber nicht die Bekömmlichkeit!«
»Gewiß, gewiß, Sennor. Aber ich muß sagen – –«, – er warf einen Blick auf Babo – »von Negern habe ich eigentlich nie gehört, was Ihr Pflanzer da behauptet hat. Immer nur von den Mischungen zwischen Spaniern und Indios in unseren Kolonien. Übrigens verstehe ich nichts davon«, sagte er, gleichsam abschließend.
Damit betraten sie die Kajüte.
Die Mahlzeit war einfach. Es gab aus Kapitän Delanos Vorräten frischen Fisch und Kürbisse, Schiffszwieback und Salzfleisch; ferner die zurückgelegte Flasche Apfelwein und eine Flasche kanarischen Wein, die letzte, die sich auf der »San Dominick« fand.
Als sie eintraten, schwärmte Francesco mit einigen farbigen Gehilfen noch um den Tisch und legte die letzte Hand an die Gedecke. Beim Anblick ihres Herrn zogen sie sich zurück. Francesco mit einem liebenswürdigen Bückling, auf den der Spanier indessen nicht zu achten geruhte.
Er bemerkte vielmehr in mäkelndem Ton zu seinem Gast, überflüssige Bedienung bei Tisch schätze er nicht.
So geschah es denn, daß die beiden ohne Gesellschaft, wie ein kinderloses Ehepaar, an den gegenüberliegenden Enden des Tisches Platz nahmen. Don Benito wies Kapitän Delano mit einer Gebärde seinen Platz an und bestand trotz seiner Schwäche darauf, daß jener sich vor ihm niederließe.
Der Neger breitete einen Fußteppich unter Don Benito aus und legte ihm ein Kissen in den Rücken; dann stellte er sich nicht etwa hinter seines Herrn, sondern hinter Kapitän Delanos Stuhl. Der Gast war im ersten Augenblick darüber erstaunt. Es stellte sich aber bald heraus, daß der Schwarze, indem er diesen Posten einnahm, seinem Herrn immer noch zu Gebote stand – ja, er konnte sogar, wenn er ihm ins Gesicht sah, jeden Wunsch doppelt schnell von seinen Augen ablesen.
»Ein ungewöhnlich verständiger junger Mensch, den Sie da haben, Don Benito«, flüsterte Kapitän Delano seinem Gastgeber über den Tisch weg zu.
»Da haben Sie recht, Sennor.«
Während der Mahlzeit kam der Gast noch einmal auf gewisse Abschnitte von Don Benitos Geschichte zu sprechen und bat zu verschiedenen Punkten um weitere Einzelheiten. So fragte er, wie es habe zugehen können, daß Skorbut und Fieber unter den Weißen so gräßliche Verheerungen anrichteten, während von den Schwarzen noch nicht einmal die Hälfte umgekommen war. Die Frage schien bei dem Spanier alle Schreckensszenen der Seuche neu erstehen zu lassen und ihn wehmütig daran zu erinnern, wie einsam er jetzt in seiner Kajüte saß, wo früher so viele Freunde und Offiziere ihn umgeben hatten. Seine Hand zitterte, sein Gesicht verlor alle Farbe, aus seinem Mund kamen unzusammenhängende Worte, und schon schienen sich über die begreiflichen Erinnerungsbilder aus der Vergangenheit unbegreifliche Schreckbilder des Augenblicks zu breiten. Mit einem Ausdruck des Entsetzens starrte er vor sich hin ins Leere. Nichts Beunruhigendes war zu sehen; nur die Hand seines Dieners, der ihm den Kanarenwein zuschob. Er trank, er trank noch einmal, und langsam beruhigte er sich wieder. Ziemlich nebenhin gab er zu bedenken, die Rassen seien eben verschieden veranlagt und so bringe die eine in gewissen Krankheitsfällen mehr Widerstandsfähigkeit auf als die andere. Für Kapitän Delano war das ein neuer Gedanke. Übrigens wechselte er alsbald den Gegenstand, denn nun oblag es ihm, mit seinem Gastgeber ein Wort über die pekuniäre Seite der zwischen ihnen schwebenden Angelegenheiten zu sprechen, namentlich (da er den Schiffseignern zu genauer Abrechnung verpflichtet war) hinsichtlich der neuen Besegelung und ähnlicher Dinge. Diese Angelegenheiten hätte er begreiflicherweise lieber unter vier Augen erledigt, und er wünschte deshalb, daß der Diener sich zurückzöge, da er wohl annehmen durfte, daß sich Don Benito einige Augenblicke lang auch ohne ihn würde behelfen können. Er sagte jedoch vorerst noch nichts; denn er dachte sich, bei fortschreitender Unterhaltung werde Don Benito wohl auch ohne besondere Aufforderung die Zweckmäßigkeit eines solchen Schrittes bemerken,
Dem war aber nicht so. Es blieb Kapitän Delano nichts anderes übrig, als seinen Gastgeber scharf anzusehen und mit kurzem Rückwärtsdeuten seines Daumens halblaut zu sagen: »Don Benito, Sie müssen verzeihen, aber ich fühle mich ein bißchen gehemmt in dem, was ich Ihnen zu sagen habe.«
Der Spanier wechselte bei diesen Worten merklich die Farbe; offenbar nahm er den Wink übel auf, vielleicht deshalb, weil ein gewisser Rückschluß auf seinen Diener darin enthalten war. Er verstummte einen Augenblick und erklärte seinem Gast sodann mit Bestimmtheit, es werde nicht im mindesten störend sein, Wenn der Schwarze zugegen bleibe. Seit dem Verlust seiner Offiziere habe er Babo (dessen ursprüngliches Amt, wie sich nun zeigte, das eines Hauptmanns der Sklaven gewesen war) nicht nur zu seinem beständigen Aufwärter und Begleiter gemacht, sondern zu seinem Vertrauten in allen Angelegenheiten.
Darauf ließ sich nichts mehr erwidern. Kapitän Delano konnte allerdings nicht umhin, sich heimlich ein wenig zu empören darüber, daß selbst ein so nebensächlicher Wunsch von ihm unerfüllt blieb, und zwar von einem Mann, dem er doch recht entscheidende Dienste zu erweisen im Begriffe stand. Es ist eben wieder sein altes mäklerisches Wesen, dachte er, und füllte sein Glas, um das geschäftliche Gespräch zu beginnen.
Man einigte sich auf den Preis der Segel und der übrigen Aufwendungen. Bei alledem machte der Amerikaner jedoch die Beobachtung, daß ganz im Gegensatz zu der beinahe fieberischen Begeisterung, mit welcher sein erstes Hilfsangebot aufgenommen worden war, jetzt, wo es nur noch um geschäftliche Unterhandlungen ging, eine ausgesprochene Gleichgültigkeit und sogar Apathie vorherrschte. Don Benito schien sich die einzelnen Punkte überhaupt nur deshalb notgedrungen anzuhören, weil er einer gewissen äußerlichen Schicklichkeit genügen wollte, nicht aber aus dem Gefühl, daß für ihn und seine Reise ein ganz gewaltiger Vorteil dabei im Spiel war.
Er wurde sogar zusehends zugeknöpfter. Der Versuch, ihn wieder in ein geselliges Gespräch zu ziehen, blieb vergeblich. Verzehrt von seiner galligen Laune saß er da und zupfte am Bart, während die Hand des Dieners, stumm wie der Finger an der Wand, ihm manchmal, ohne viel Gegenliebe zu finden, vorsichtig den Kanarenwein zuschob.
Nach Beendigung der Mahlzeit setzten sie sich auf den gepolsterten Heckbalken. Der Diener breitete ein Kissen hinter seinen Herrn. Die langandauernde Windstille machte sich nun deutlich in der Atmosphäre bemerkbar. Don Benito seufzte schwer, als ringe er nach Luft.
»Wollen wir nicht lieber wieder in die Messe gehen?«, sagte Kapitän Delano. »Dort ist es luftiger.« Er bekam keine Antwort; sein Gegenüber saß wie erstarrt.
Der Diener hatte sich vor ihm auf die Knie niedergelassen, einen großen Fächer aus Federn in der Hand, Francesco kam in diesem Augenblick auf Zehenspitzen hereingehuscht; er reichte dem Neger ein Schälchen mit aromatischem Wasser, mit dem er von nun an seinem Herrn immer wieder die Stirn einrieb, nicht ohne ihm gleichzeitig das Haar an den Schläfen glattzustreichen, wie es eine Kindsmagd bei einem Kinde macht. Er sagte kein Wort dazu. Nur sein Auge ruhte auf dem Antlitz seines Herrn, als wollte er ihm inmitten aller seiner Bedrängnis durch den Anblick seiner stummen Ergebenheit wenigstens eine kleine Erquickung bereiten.
In die Stille hinein schlug die Schiffsglocke die zweite Stunde, und durchs Kajütenfenster gewahrte man ein leichtes Sichkräuseln der See aus der gewünschten Richtung.
»Da!« rief Kapitän Delano. »Ich hab's Ihnen doch gesagt, Don Benito! Schauen Sie!«
Er war aufgesprungen und sprach mit lebhaftem Stimmklang, schon deshalb, weil er so seinen Gefährten ein wenig mitzureißen gedachte. Don Benito indessen, obwohl ihm im selben Augenblick der rote Vorhang des Heckfensters gegen die bleiche Wange flatterte, schien der Brise nicht günstiger gesonnen als der Windstille.
Der Arme, dachte Kapitän Delano; er weiß aus bitterer Erfahrung, daß ein Wellengekräusel noch keinen Wind macht, so wenig wie eine Schwalbe den Sommer. Aber diesmal täuscht er sich. Ich bringe ihm sein Schiff ein, das soll er sehen. Mit einem kurzen Hinweis auf Don Benitos geschwächten Zustand erklärte er ihm, so nachdrücklich er konnte, er möge nur ruhig an Ort und Stelle bleiben. Ihm (Kapitän Delano) werde es ein Vergnügen sein, die Verantwortung auf sich zu nehmen und aus dem Wind herauszuholen, was sich herausholen ließe.
Als er aufs Verdeck hinaustrat, stieß er unerwartet auf Atufal, den Neger, der hochaufgerichtet vor der Schwelle stand, wie einer von den Türhütern aus schwarzem Marmor, die als Wächter am Eingang der ägyptischen Grabkammern stehen.
Kapitän Delanos Erschrecken war in diesem Fall wohl nur körperlicher Art. Atufals Gestalt, die bei all ihrem gramvollen Ausdruck immer etwas sonderbar Gefügiges bezeugte, lenkte den Blick auf die Axtschleifer, die immer noch geduldig ihrem Geschäft nachgingen, und beide zeigten das eine, daß es zwar im allgemeinen mit Don Benitos Autorität nicht zum besten stehen mochte, daß sich ihr aber, wurde sie einmal ausgeübt, kein Mann geradezu entziehen konnte, er mochte noch so wild und riesenmäßig aussehen.
Kapitän Delano griff nach einem Sprachrohr, das am Schanzkleid hing, trat mit energischem Schritt an den Rand der Hütte vor und gab in seinem besten Spanisch die nötigen Befehle. Die wenigen Seeleute schienen ebenso gern bereit anzupacken wie das Negervolk, und alles machte sich willig an die Arbeit, das Schiff auf den Kurs nach dem Hafen zu bringen.
Während er sich bemühte, ein zusätzliches Leesegel setzen zu lassen, vernahm Kapitän Delano mit einemmal eine Stimme, die seine Befehle getreulich wiederholte. Er blickte um und gewahrte Babo, der also als Hilfskraft des Lotsen in sein altes Amt als Hauptmann der Sklaven zurückgekehrt war. Seine Unterstützung erwies sich als wertvoll. Bald kam doch etwas Ordnung in die zerschlissene Besegelung und das verquollene Tauwerk. Und natürlich war es unvermeidlich, daß die begeisterte Negerschar beim Bedienen von Brasse und Fall immer wieder einen herzerhebenden Gesang anstimmte.
Das sind brave Burschen, dachte Kapitän Delano; mit ein wenig Übung könnte man gute Seeleute aus ihnen machen. Da schau einmal: sogar die Weiber packen mit an und singen! Wahrscheinlich Aschantinegerinnen, von denen ich mir habe sagen lassen, daß sie auch als Soldaten ausgezeichnet zu brauchen sind. Und wer mag am Ruder stehen? Da muß ich einen guten Mann haben.
Er ging sogleich, sich zu überzeugen. Die »San Dominick« fuhr mit einer schwerfälligen Ruderpinne, an die beiderseits mächtige waagrechte Kloben angesetzt waren. An jedem Klobenende stand ein schwarzer Hilfsrudergast, und zwischen ihnen, am Helmstock, befand sich der verantwortliche Rudergänger, ein spanischer Matrose, auch er, seinem Gesichtsausdruck nach zu schließen, angesteckt von der allgemeinen Hoffnungsfreude und Zuversicht beim Aufkommen der Brise.
Wie sich zeigte, war es derselbe Mann, der sich am Bratspill so blöde angestellt, hatte.
»So, du bist es also!« sagte Kapitän Delano zu ihm. »Mach mir nur keine Schafsaugen mehr – immer hübsch ausgeschaut und das Schiff auf Kurs gehalten! Verstehst doch dein Geschäft, wie? Und möchtest auch endlich in den Hafen, oder nicht?«
Der Mann bejahte mit einem unhörbaren kleinen Glucksen und faßte kräftig nach dem Ruderkopf. Den beiden Schwarzen entlockte seine Bewegung, ohne daß der Amerikaner es bemerkte, einen aufmerksamen Blick auf den zwischen ihnen Stehenden.
Hier am Ruder schien also alles klar zu sein, und der Lotse wandte sich zur Back um nachzusehen, wie dort die Dinge stünden.
Das Schiff machte inzwischen soviel Fahrt, daß es gegen die Strömung ankommen konnte: Beim Herannahen des Abends würde die Brise überdies gewiß noch auffrischen.
Für den Augenblick war alles Nötige geschehen, und Kapitän Delano wandte sich, nach einigen abschließenden Befehlen an die Seeleute, nach achtern, um Don Benito in der Kajüte Bericht zu erstatten. Vielleicht kam die Erwartung hinzu, es werde ihm jetzt Gelegenheit zu einem kurzen Privatgespräch vergönnt sein, so lange der Diener auf Deck beschäftigt war.
Es gab unterhalb der Hütte von verschiedenen Seiten her zwei Zugänge zur Kajüte, von denen der eine weiter vorn lag. Kapitän Delano vergewisserte sich, daß Babo noch auf Deck stand, und steuerte auf den zunächstgelegenen Eingang zu – denselben, von dem zuletzt die Rede war und an dessen Schwelle Atufal immer noch stand. Er beeilte sich sehr und verhielt nur an der Kajütentür einen Augenblick, um seinen fliegenden Atem zur Ruhe kommen zu lassen. Dann trat er ein, die Worte, die er sich zu sprechen vorgenommen, schon auf den Lippen. Der Spanier saß noch immer an der alten Stelle; er trat auf ihn zu, aber da hörte er einen fremden Schritt, der sich in den seinen schmiegte. Aus der gegenüberliegenden Tür trat mit einem Präsentierteller in der Hand im selben Augenblick der schwarze Diener herein. »Verflixt, nun steht er schon wieder da in seiner Anhänglichkeit!« dachte Kapitän Delano. »Das ist schon ein lästiges Zusammentreffen!«
Es würde ihm vielleicht noch weit lästiger erschienen sein, wenn ihn nicht die vom aufkommenden Wind ausgehende Zuversicht neu beflügelt hätte. Immerhin spürte er etwas wie ein leises Nagen und Zweifeln in sich, wenn, er – ohne recht zu wissen, in welchem Sinn – Babos und Atufals Gestalt in Gedanken nebeneinanderstellte.
»Don Benito«, sagte er, »ich verkündige Ihnen große Freude. Die Brise wird anhalten und sie wird noch auffrischen. Da fällt mir ein, Ihr Riesenkerl und Zeitansager, Atufal, steht draußen. Auf Ihren Befehl, nehm ich an?«
Don Benito prallte zurück wie unterm Stachel einer in Liebenswürdigkeit eingehüllten Verhöhnung, die mit solch geschicktem Anschein guter Lebensart dargeboten wäre, daß sich keine Handhabe zur Gegenwehr böte.
Als ob man ihm die Haut abgezogen hätte!, dachte Kapitän Delano. Ich möchte wissen, wie man ihn anfassen soll, damit er nicht zusammenzuckt.
Babo war es, der sich als erster in Bewegung setzte. Er schob das Kissen hinter seinem Herrn zurecht, und erst jetzt ermannte sich dieser zu den Geboten der Höflichkeit und antwortete förmlich: »Wie Sie sagen! Der Sklave tritt auf mein Geheiß draußen an. Genauer gesagt: wenn ich zur festgesetzten Stunde noch unten bin, hat er sich aufzustellen und mein Kommen abzuwarten.«
»Ja? – Da muß ich schon sagen, verzeihen Sie mir, Sie behandeln den armen Kerl ja aufs Haar, wie man einen Exkönig behandeln muß!« Er lächelte. »Ich fürchte beinahe, Don Benito, Sie sind bei aller Nachsicht, die Sie in mancher Hinsicht walten lassen, im Grunde doch ein höchst gestrenger Herr.«
Wieder sah man Don Benito zurückschrecken; diesmal aber, so schien es unserem guten Kapitän, mehr aus einer echten Gewissensregung.
Die Unterhaltung wurde von Augenblick zu Augenblick gezwungener. Vergebens wies Kapitän Delano darauf hin, daß man nun schon ganz deutlich sehen konnte, wie der Kiel des Schiffs sanft die See teilte. Don Benitos Blick blieb glanzlos, und er antwortete nur in spärlichen, zurückhaltenden Worten.
Der Wind hatte unterdessen mehr und mehr zugenommen und trug, da er gerade in Richtung auf den Ankerplatz wehte, die »San Dominick« rasch voran. Nach Umsegeln einer Landspitze bekamen sie in der Ferne nun auch den Robbenfänger voll in Sicht. Kapitän Delano hatte sich noch einmal auf Deck begeben und war eine Weile dort geblieben. Er veränderte den Kurs des Schiffs eine Kleinigkeit, um dem Riff sicher aus dem Weg zu gehen, und ging dann kurz nach unten.
Diesmal will ich meinen armen Freund aber doch ein bißchen aufheitern, dachte er.
»Es geht immer besser!« rief er Don Benito gleich beim Eintreten fröhlich zu. »Sie können Ihren Sorgen bald Gutenacht sagen, wenigstens für eine Weile. Das wissen Sie ja: wenn nach langer, kummervoller Reise an der Reede geankert wird, dann fällt mit dem Anker dem Käptn eine schwere Last von der Seele. Es geht prächtig voran, Don Benito. Mein Schiff ist schon in Sicht. Da, schauen Sie hinaus – da liegt sie, die Bachelor's Delight, tadellos aufgetakelt, geben Sie's zu! Fein, wie einen der Wind gleich aufmöbelt. Hören Sie zu, heut abend müssen Sie bei mir eine Tasse Kaffee trinken. Mein alter Steward kocht Ihnen einen Kaffee, wie ihn kein Sultan besser trinkt. Was meinen Sie, Don Benito, wollen Sie kommen?«
Einen Augenblick schien es, als leuchte der Spanier förmlich fieberisch auf und werfe einen sehnsüchtigen Blick auf den Robbenfänger. Der Schwarze forschte mit stummer Besorgnis in dem Antlitz seines Herrn. Aber gleich darauf überkam den Sitzenden wieder die alte Erstarrung; er sank ins Kissen zurück und blieb stumm.
»Sie geben keine Antwort? Hören Sie, nun bin ich den ganzen Tag Ihr Gast gewesen – soll denn die Gastfreundschaft so sehr auf einer Seite bleiben?«
»Ich kann nicht gehen« – dies als einzige Antwort.
»Aber warum denn? Es wird Sie nicht anstrengen. Die Schiffe werden ganz nah nebeneinander gelegt, so daß sie nicht schwojen können. Sie brauchen dann eigentlich nur von Deck zu Deck zu gehen – von einem Zimmer ins andere. Nein, Sie dürfen mir wirklich keinen Korb geben.«
»Ich kann nicht gehen« Don Benito wiederholte es entschieden und beinahe feindselig.
Er hielt kaum noch den letzten Anschein der Höflichkeit aufrecht; ja, mit einem Ausdruck leblosen Trübsinns, tierisch an den Fingernägeln kauend, starrte er seinen Gast beinahe herausfordernd an, als wüte in ihm ein heimlicher Groll, daß der Fremde ihn hindere, sich seiner Zuchtlosigkeit ganz zu überlassen. Derweilen drang das Geräusch des vom Schiff durchteilten Wassers mit immer stärkerem, fröhlicherem Gurgeln durchs Fenster, ein Vorwurf gleichsam für seine weltschmerzliche Laune, als sollte ihm gesagt werden, daß er wohl Trübsal blasen und darüber zum Narren werden konnte, daß aber die Natur sich kein Jota darum kümmern würde – also bitte später keine unnützen Vorwürfe!
Was half's? Der üble Geist in ihm war an seinem Tiefpunkt angekommen, im selben Augenblick, da der günstige Wind seinen Höhepunkt erreichte.
Bisher hatte man denken können, es sei Ungeselligkeit, es sei Verbitterung, die aus ihm sprach. Aber wie er sich jetzt zeigte, das ging so weit darüber hinaus, daß selbst Kapitän Delanos Nachsicht und Menschenfreundlichkeit nicht mehr damit fertig wurde. Er verzagte an einer Erklärung für solches Benehmen; er konnte sich nicht entschließen, krankhafte Wunderlichkeit, mochte sie noch so gespenstisches Ausmaß erreichen, als Entschuldigung gelten zu lassen; er mußte sich sagen, daß er in seinem Verhalten keinen Anlaß zu derartiger Behandlung gegeben hatte. Kurzum, sein Stolz begann sich zu regen. Auch er hüllte sich nun in Zurückhaltung. Nicht als ob er den Spanier damit sonderlich bewegt hätte. Er ließ ihn also allein und begab sich wieder an Deck:
Sie waren auf weniger als zwei Meilen an den Robbenfänger herangekommen. Das Walboot sah man zwischen beiden Schiffen pfeilschnell dahinschießen.
Um es kurz zu machen: nicht lang, und die beiden Schiffe lagen dank der Geschicklichkeit des Lotsen nachbarlich nebeneinander vor Anker.
Vor der Rückkehr auf sein eigenes Schiff hatte Kapitän Delano vorgehabt, die Einzelheiten der weiter von ihm geplanten Hilfeleistung eingehend mit Don Benito zu besprechen. So wie die Dinge lagen, wollte er sich aber nicht von neuem einer Zurückweisung aussetzen, und so entschloß er sich, als er die »San Dominick« sicher verankert wußte, sich sogleich zurückzuziehen und weder von freundschaftlichem noch von geschäftlichem Verkehr weiter ein Wörtchen zu reden. Was schließlich geschehen würde, mochte später entschieden werden; jedenfalls wollte er sein künftiges Handeln ganz von den jeweiligen Umständen abhängen lassen. Sein Boot lag bereit, ihn aufzunehmen; sein seltsamer Wirt aber wollte und wollte sich nicht zeigen. Gut, dachte Kapitän Delano, wenn er nicht weiß, wie man sich benimmt, muß ich mich um so richtiger benehmen. Er begab sich in die Kajüte und gedachte dort auf förmliche, vielleicht sogar auf schweigend vorwurfsvolle Weise Abschied zu nehmen. Zu seiner großen Genugtuung indessen schien Don Benito doch verspürt zu haben, daß der vor den Kopf gestoßene Gast ihm, würdig zwar aber doch mit gleichen Mitteln, heimgezahlt hatte. Jedenfalls erhob er sich, auf seinen Diener gestützt, von seinem Sitz, faßte Kapitän Delanos Hand und stand wortlos, und sichtlich bewegt vor ihm. Das damit aufleuchtende gute Gestirn verblaßte aber alsbald wieder: er versank gleich wieder in seine frühere Starre, womöglich sogar in eine noch größere Verfinsterung, wandte den Blick halb zur Seite und ließ sich schweigend in seine Polster zurücksinken. Bei Kapitän Delano kehrten im selben Maß die Gefühle einer Abkühlung wieder; er verneigte sich kurz und zog sich zurück.
Noch hatte er den schmalen Gang, der finster wie ein Tunnel von der Kajüte zur Treppe führte, kaum zur Hälfte durchschritten, als ein Ton, ähnlich wie das Zeichen zur Hinrichtung in einem Gefängnishof, an sein Ohr drang. Es war der Widerhall der geborstenen Schiffsglocke, die die Stunde schlug, und er brach sich hier in dem unterirdischen Gewölbe zu einem traurigen Gebimmel. Mit unwiderstehlicher Schicksalsgewalt antwortete sein Gemüt auf das böse Vorzeichen mit neuem Aberglauben, neuem Verdacht. Er blieb stehen. In Bildern – einer Flucht, viel schneller als wir sie niederschreiben können – glitten alle Befürchtungen von früher bis in die kleinste Kleinigkeit wieder durch seinen Sinn.
Die ganze Zeit über war er in seiner Leichtgläubigkeit und Gutmütigkeit allzu schnell bereit gewesen, für wohlbegründete Befürchtungen eine Begütigung und harmlose Erklärung beizubringen. Warum ließ der Spanier, der doch zu Zeiten so zeremoniös sein konnte, nun auf einmal die gewöhnlichste Anstandspflicht außeracht und begleitete seinen scheidenden Gast nicht einmal bis ans Fallreep? Verbot es ihm seine Unpäßlichkeit? Aber seine Unpäßlichkeit hatte ihm nicht verboten, während des Tages weit beschwerlichere Anstrengungen auf sich zu nehmen. Da war nicht zu vergessen sein zweideutiges Verhalten noch im legten Augenblick. Er war aufgesprungen, hatte seinem Gast kräftig die Hand gedrückt und schon nach seinem Hut gegriffen. Und dann, von einem Augenblick zum andern, war alles wieder untergegangen in Finsternis, Grämlichkeit und Schweigen. Was sprach daraus? Vielleicht eine kurze Aufwallung der Reue und des späten Bedauerns inmitten eines frevelhaften Anschlags und ein Zurücksinken in die ursprüngliche, von keiner Gewissensregung beeinträchtigte Absicht? Sein letzter Blick schien nichts anderes auszudrücken, als daß er Kapitän Delano auf immer Lebewohl sagte, daß er vielleicht mit sich selber haderte, aber eben doch mit allem einverstanden war. Warum hatte er die Einladung; abgelehnt, am Abend auf den Robbenfänger herüberzukommen? Oder war dieser Spanier doch um einen Grad weniger verhärtet als der Jude, der unbedenklich das Nachtmahl einnahm an Bord des Schiffs, das er zur selbigen Nacht zu verraten gedachte? Wozu überhaupt all die Rätsel und Widersprüche den ganzen Tag hindurch, wenn sie nicht der Irreführung dienen sollten, zur Vorbereitung eines späteren, hinterlistigen Schlags? Atufal, den sie als Rebellen bezeichneten und der doch stets als pünktlicher Schatten zur Stelle war, lauerte in diesem Augenblick draußen vor der Schwelle. Er war wie ein Wachtposten – vielleicht war er mehr. Und wer hatte ihn, zugegebenermaßen, da draußen aufgepflanzt? Womöglich zu keinem andern Zweck als auf der Lauer zu liegen?
Hinter sich den Spanier, vor sich seinen Leibeigenen – so war Kapitän Delanos Lage, und ohne viel Nachdenken war dies sein Entschluß: durchs Dunkel zum Licht!
Er biß die Zähne zusammen, er ballte die Faust – und so kam er an Atufal vorüber und stand unbehelligt im Licht. Da lag sein Schiff, das schmucke, lag friedlich vor Anker, so nah, daß er es beinahe mit einem einfachen Zuruf erreichen konnte. Da war auch sein Boot, mit lauter vertrauten Gestalten bemannt; es schwankte geduldig auf und ab auf den kurzen Wellen zu Seiten der »San Dominick«. Und auch auf den Decks der »San Dominick« selber, wenn er sich umblickte: da waren immer noch die Wergzupfer und regten mit unerschütterlicher Miene die Finger, und an sein Ohr schlug das leise, schwirrende Geräusch, mit dem die Axtschleifer immer noch unermüdlich ihre Arbeit taten. Über allem aber sah er das liebreiche Leuchten der Natur, wie sie unschuldsvoll zur abendlichen Ruhe ging: die Sonne, wolkenverhangen, im stillen Zelt des Westens wie Lampenschimmer aus Abrahams Hütte. Er nahm es in sich auf mit entzücktem Aug und Ohr, die gefesselte Gestalt des Schwarzen nicht ausgenommen, und sein Antlitz lächelte über die Truggespenster und fühlte es fast wie Vorwurf, daß er ihnen auch nur einen Augenblick Obdach gewährt und damit doch andeutungsweise einen gottlosen Zweifel an der wachsamen Vorsehung im Himmel droben kundgetan hatte.
Es gab noch einen kurzen Aufenthalt, während das Boot, seinem Befehl entsprechend, ans Fallreep gebracht wurde. Indes er wartete, empfand Kapitän Delano etwas wie eine gedämpfte, mit Trauer untermischte Genugtuung beim Gedanken an die Liebesdienste, die er während des Tages einem Fremden erwiesen hatte. Es bleibt doch wahr, dachte er; wenn man etwas Gutes getan hat, wird es einem im Gewissen vergolten, wenn auch nicht immer von dem Empfänger der guten Tat. Der Augenblick war gekommen, und er setzte den Fuß, zum Abstieg in das Boot bereit, auf die oberste Sprosse der Bordleiter, das Antlitz dem Schiffsdeck zugewandt. In diesem Augenblick hörte er, wie sein Name freundlich gerufen wurde, und sah zu seiner freudigen Überraschung Don Benito näherkommen, mit einem ganz neuen Ausdruck der Spannkraft, als wollte er im legten Augenblick sein ungebührliches Verhalten von vorhin wieder gutmachen. Sogleich zum Guten bereit, zog Kapitän Delano seinen Fuß zurück und ging seinerseits Don Benito entgegen. Bei diesem Anblick schien sich der Spanier sofort wieder in eine gewisse Erregung zu verlieren; der lebendige Ausdruck in seinen Bewegungen erlahmte zugleich, und der Diener mußte ihn kräftiger stützen. Zu diesem Zweck legte er sich die Hand seines Herrn auf die nackte Schulter und hielt sie dort mit sanfter Gewalt fest, so daß sich Don Benito wie auf eine Krücke auf ihn stützen konnte.
Als die beiden voreinander standen, faßte der Spanier abermals fast mit Inbrunst nach der Hand des Amerikaners und maß ihn mit einem ernsten und nahen Blick. Zum Sprechen aber schien er, wie vorhin, allzu bewegt.
Ich habe ihm unrecht getan, dachte Kapitän Delano mit schlechtem Gewissen. Seine scheinbare Kälte hat mich irregeführt. Er hat es gewiß niemals bös mit mir gemeint.
Es war zu merken, daß dem Diener die lange Dauer der Abschiedsszene Sorge machte, weil er wohl fürchtete, sie könne seinen Herrn zu sehr aufregen, und daß er sie abzukürzen trachtete. Zwar lieh er sich dem Herrn immer noch als Stütze und schritt zwischen den beiden Kapitänen, doch lenkte er sie ans Fallreep zurück, während Don Benito, anscheinend von Fürsorge und Reue erfüllt, Kapitän Delanos Hand nicht fahren lassen wollte und über den Leib des Schwarzen hinweg immer noch krampfhaft festhielt.
So standen sie eine Weile an der Bordwand und schauten zu dem Boot hinunter, dessen Bemannung mit neugierigem Blick nach oben starrte. Immer noch wartete Kapitän Delano, daß der Spanier seine Hand freigebe; ihm war die Szene beinahe schon peinlich, und er hob den Fuß, um über die Schwelle weg aufs offene Fallreep hinauszusteigen – und immer noch wollte ihn Don Benito nicht loslassen. Dabei sprach er doch, und er sagte es in einem Ton der unruhigen Bewegung: »Weiter kann ich nicht mitgehn; hier muß ich Ihnen Lebewohl sagen. Leben Sie wohl, lieber, lieber Don Amasa. Gehen Sie, gehen Sie –« – er ließ jählings seine Hand los – »– gehen Sie – und Gott behüte Sie besser als mich, mein liebster Freund.«
Die Worte verfehlten nicht ihren Eindruck auf Kapitän Delano, und er wäre nun gern noch verweilt. Er begegnete aber dem milden Vorwurf im Blick des Schwarzen, und mit einem hastigen Lebewohl stieg er ins Boot hinunter, indes Don Benito wie festgewurzelt am Fallreep stehen blieb und ihm ein Abschiedswort übers andere nachrief.
Kapitän Delano setzte sich ins Heck, salutierte ein letztes Mal und ließ seine Leute abstoßen. Die Männer legten die Ruder aus, und die Leute am Bugriemen stießen das Boot von der Bordwand ab, so daß die Ruder der Länge nach eintauchen konnten. In dem Augenblick, als dies geschehen war, sprang Don Benito übers Schanzkleid, so daß er Kapitän Delano gerade vor die Fuße fiel, und erhob im selben Augenblick seine Stimme gegen das Schilf, aber in einem so aufgebrachten, tobenden Ton, daß ihn keiner im Boot verstehen konnte. Indessen schienen ihn doch manche verstanden zu haben, denn von drei ganz verschiedenen und entfernten Teilen des Schiffs warfen sich drei Matrosen ins Meer und schwammen hinter ihrem Kapitän her, als gedächten sie ihn zu retten.
Den Offizier im Boot packte die helle Bestürzung, und er fragte aufgeregt, was das alles zu bedeuten habe. Kapitän Delano hatte darauf nur die Antwort, daß er mit einem verächtlich-abschätzigen Blick auf den wunderlichen Spanier zu verstehen gab, ihn kümmere solch ungereimtes Betragen nicht; im übrigen habe es den Anschein, als wolle Don Benito bei seinen Leuten mit Gewalt den Eindruck erwecken, daß das Boot ihn entführen wolle. »Oder aber – rudert, rudert, rudert, sonst wird's ernst!« rief er plötzlich laut, denn vom Schiff herab ertönte ein Klirren und Rumoren, darüber das Sturmgeläut der Äxteschleifer, und nun fuhr Kapitän Delano Don Benito jäh an die Gurgel: »Der hinterlistige Räuber will uns ans Leben!« Es schien sogleich buchstäblich bewahrheitet zu werden, denn oben an der Reeling erblickte man den schwarzen Diener mit einem Dolch in der Hand, wie er eben zum Sprung ansetzte und offenbar in verzweiflungsvoller Treue seinem Herrn bis zulegt beizustehen gedachte. Ihm kamen außerdem die drei weißen Seeleute zu Hilfe, indem sie den Versuch machten, von der Bugseite her das Boot zu entern. Auf dem Schiff aber schwappte die ganze Meute der Neger, gleichsam aufflammend beim Anblick ihres gefährdeten Kapitäns, wie ein rußiger Schneesturz übers Schanzkleid vor. All dies, mit Vorspiel und Nachspiel zugleich, begab sich in solch übersteigerter Hast, daß Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichsam in eins gerannen.
Beim Anblick des herannahenden Negers hatte Kapitän Delano den Spanier beiseitegeschleudert, den er eben noch zu würgen gedachte, und da er vom Gegenprall unwillkürlich etwas beiseiterückte,, und die Arme hochwarf, bekam er den herabspringenden Schwarzen förmlich im Fluge zu fassen, so daß es aussah, als habe jener, mit seinem auf Kapitän Delanos Herz zielenden Dolch, absichtlich dieses Ziel gewählt. Die Waffe ward ihm entwunden und der Angreifer selber niedergeschlagen, so daß er auf dem Boden des Boots liegen blieb, das mit seinen endlich klargekommenen Riemen über die See zu jagen begann.
Dies war der Augenblick, da Kapitän Delano mit der Linken abermals den halb hintenüberliegenden Don Benito packte, ohne Rücksicht darauf, daß jener fast bewußtlos und keines Wortes mächtig war, während er auf der andern Seite mit dem rechten Fuß den Neger am Boden festkeilte. Mit der Rechten half er, damit sie rascher vom Fleck kämen, am Heckriemen, und sein Blick, nach vorn gewandt, ermunterte die Männer, ihr Bestes zu geben.
Der Bootsoffizier hatte unterdessen endlich die am Boot hängenden Matrosen abgewehrt und legte sich, rückwärts sitzend, mit in die Bugriemen. Plötzlich rief er Kapitän Delano zu, er möge sich mit dem Schwarzen vorsehen; und im selben Augenblick ließ sich auch einer von den Ruderern, ein Portugiese, vernehmen, man solle achtgeben, was der Spanier zu sagen habe.
Kapitän Delano blickte vor sich nieder und sah, wie der Sklave mit der freien Hand einen zweiten Dolch gefaßt hielt – einen kleinen, den er vielleicht in seinem Kraushaar verborgen gehalten hatte – und sich schlangengleich von den Bootsplanken aufbäumte, um seinem Herrn mit der Waffe nach dem Herzen zu zielen. Aus seinem Gesicht glomm finstere Rachsucht und verriet, wie seine Seele in ihrem Kern beschaffen war. Der Spanier aber, halb erstickt, suchte vergeblich auszuweichen. Er stieß heisere Worte hervor, die aber keinem verständlich waren außer dem Portugiesen.
In diesem Augenblick zuckte durch Kapitän Delanos allzu lang verblendeten Geist der Blitz der Erkenntnis und ließ ihn in unvorhergesehener Klarheit das ganze geheimnisvolle Verhalten seines Gastfreunds durchschauen, samt allem Rätselhaften dieses Tages und der vorhergegangenen Seereise der »San Dominick«. Er schmetterte Babos Hand beiseite, aber der Vorwurf in seiner Brust fiel noch weit zerschmetternder über ihn her. Von Mitleid ganz übermannt ließ er seine Hand von Don Benito sinken. Nicht auf ihn, Kapitän Delano, sondern auf Don Benito hatte der Schwarze, als er in das Boot sprang, den Dolch gezückt.
Man packte Babo an beiden Händen, und als Kapitän Delano nun aufs neue zur »San Dominick« emporblickte, da fielen ihm wahrhaft die Schuppen von den Augen. Er sah die Neger, nicht mehr zuchtlos, nicht mehr in schlechter Ordnung, nicht mehr in scheinbar regelloser Besorgnis um Don Benito, sondern nun ganz ohne Maske, Äxte und Messer schwingend, in blutdurstig-piratenhaftem Aufruhr.« Wie wahnwitzige schwarze Derwische tanzten die sechs Aschantis auf der Hütte. Die jungen Spanier, die noch an Bord waren, wurden von ihren Feinden verhindert, ins Wasser zu springen, und flüchteten in die höchsten Spieren, während die wenigen älteren Matrosen, die nicht bereits auf See trieben, weil sie nicht behend genug gewesen waren, hilflos in dem Getümmel der Schwarzen eingekeilt standen.
Kapitän Delano rief unterdessen von weitem sein Schiff an und ließ die Stückpforten öffnen und die Kanonen ausfahren. Auf der »San Dominick« hatten sie inzwischen das Ankertau gekappt, und das losschnellende Kabelende riß die Segeltuchhülle am Schiffsschnabel weg und zeigte beim Abdrehen des wetterzernagten Schiffsrumpfs zur offenen See den Tod selber als Gallionsfigur, in Gestalt eines menschlichen Skeletts, kalkigweiß und die rechte Erklärung zu den kalkweiß darunter geschriebenen Worten: »Folgt eurem Führer.«
Bei dem Anblick bedeckte Don Benito sein Gesicht und rief klagend: »Das ist er! Aranda! Mein Freund, den sie umgebracht, den sie nicht bestattet haben!«
Beim Robbenfänger angelangt ließ Kapitän Delano Taue herunterwerfen und den Neger binden, der keinen Widerstand leistete, auch dann nicht, als sie ihn an Bord hievten. Als nächster sollte Don Benito, der ganz von Kräften schien, von Männern nach oben geleitet werden; er weigerte sich aber bei all seiner Schwäche, zu gehen oder sich wegbringen zu lassen, so lange der Neger nicht unter Deck außer Sicht gebracht war. Erst als er dessen sicher war, gab er seinen Widerstand auf.
Das Boot wurde sogleich zurückgesandt, um die drei schwimmenden Matrosen aufzufischen. Die Kanonen waren unterdessen klar zum Gefecht, wenn auch infolge eines Manövers der »San Dominick«, die nun achteraus vom Robbenfänger trieb, im Augenblick nur das äußerste Heckgeschütz Schußfläche hatte. Sie feuerten sechsmal, in der Absicht, das fliehende Schiff durch ein Abschießen der Spieren manövrierunfähig zu machen. Doch wurden nur unwesentliche Teile des Tauwerks getroffen, und bald war das Schiff außer Schußweite und steuerte gemächlich aus der Bucht. Die Schwarzen drängten sich in dicken Scharen am Bugspriet; sie schienen mit höhnischen Zurufen ihrer weißen Verfolger zu spotten und mit aufgeregten Gebärden dem herandunkelnden Moorgelände des Ozeans entgegenzuflattern – kreischende Krähen, die der Hand des Vogelstellers entgangen waren.
Der erste Gedanke wäre gewesen, die Anker zu lichten und die Verfolgung aufzunehmen. Bei näherem Überlegen schien es aber erfolgverheißender, mit Fangboot und Jolle hinterherzusetzen.
Kapitän Delano fragte Don Benito, was für Feuerwaffen sie an Bord der »San Dominick« hätten, und erhielt die Antwort, es sei überhaupt nichts Brauchbares vorhanden. Ein Kajütpassagier, der nicht mehr lebte, habe gleich zu Beginn der Meuterei an den wenigen vorhandenen Musketen heimlich die Schlösser beschädigt. Im übrigen bat Don Benito den Amerikaner mit all seiner letzten Kraft, er möge weder mit dem Schiff noch mit Booten die Verfolgung aufnehmen. Die Neger hätten hinlänglich bewiesen, daß sie zum äußersten entschlossen seien, und wenn es nun zu einem offenen Angriff käme, könne nur mit einem heillosen Massaker unter den Weißen gerechnet werden. Diese Warnung hielt der Amerikaner für den Ausfluß eines vom Unglück gebeugten Gemüts, und er ließ sich nicht von seinen Absichten abbringen.
Die Boote wurden klargemacht und bewaffnet. Kapitän Delano gab Befehl, wer mitfahren sollte, und wollte sich auch selbst anschließen, als Don Benito ihn am Arm faßte.
»Aber nicht doch, Sennor! Haben Sie mir das Leben gerettet und wollen nun selbst das Ihre wegwerfen?«
Auch die Offiziere, die an ihr eigenes Interesse und an den Fortgang der Reise dachten und den Schiffseignern gegenüber eine gewisse Verantwortung empfanden, wandten sich heftig dagegen, daß der Kommandeur mitführe. Kapitän Delano erwog bei sich das Gewicht ihrer Einwände und sah, daß er bleiben müsse. Er ernannte seinen Obersteuermann, einen hünenhaften, entschlossenen Mann, der früher auf einem Kaperschiff gefahren war, zum Kommandanten der Unternehmung. Um die Leute noch mehr anzufeuern, sagte man ihnen, der spanische Kapitän betrachte sein Schiff als verlorenes Gut; Schiff und Ladung, darunter Gold und Silber, hätten einen Wert von über tausend Dublonen. Wenn sie die Prise nähmen, wäre ein ansehnlicher Anteil ihrer. Die Seeleute antworteten mit begeistertem Zuruf.
Die Flüchtlinge hatten inzwischen schon beinahe die offene See erreicht. Die Nacht brach herein, doch war der Mond im Aufgehen. Nach langem, angestrengtem Rudern holten die Boote mit dem Achterdeck des Schiffs auf, so daß die Männer sich über die Riemen legen und ihre Musketen abfeuern konnten. Da sie keine Kugeln zurückzusenden hatten, antworteten die Neger mit einem Wutgeheul. Bei der zweiten Salve indessen besannen sie sich auf die Kriegsweise der Indianer und schleuderten ihre Äxte nach dem Boot. Einem Matrosen wurde der Finger abgeschnitten. Eine andere Axt traf das Walboot am Bug, schnitt das Tau entzwei und blieb im Dollbord stecken wie das Beil eines Holzfällers. Der Steuermann faßte nach dem bebenden Griff, riß es aus der Spalte und schleuderte es zurück. Als heimgesandter Fehdehandschuh stak es nun in der zerbrochenen Achterdecksgallerie des Schiffs und blieb dort haften.
Immerhin hielten die Weißen nach diesem allzu heißen Empfang einen respektvollen Abstand von den Negern ein. Sie richteten es so ein, daß sie gerade außer Reichweite der heranwirbelnden Äxte blieben, und suchten im Hinblick auf den bevorstehenden Nahkampf die Schwarzen dazu zu verleiten, daß sie sich ihrer dabei mörderischsten Waffen vorzeitig entledigten, indem sie sie als unbedacht abgesandte Wurfgeschosse vor Erreichen des Ziels ins Meer schleuderten. Es dauerte nicht lang, da hatten die Neger die Kriegslist durchschaut und stellten ihre Kampfweise ein. Immerhin mußten sich viele von ihnen statt der verlorenen Äxte mit Hebestangen bewaffnen, ein Wechsel, der sich, wie erwartet, am Ende für die Angreifer günstig auswirken sollte.
Das Schiff machte währenddessen bei kräftigem Wind weiter gute Fahrt, so daß die Boote immer wieder abfielen und erst aufholen mußten, um neue Salven abgeben zu können.
Das Feuer richtete sich größtenteils gegen das Heck, wo die Neger jetzt vor allem zusammenströmten. Es kam indessen nicht darauf an, die Schwarzen zu töten oder außer Gefecht zu setzen. Es galt sie, samt ihrem Schiff, gefangen zu nehmen. Dazu mußte das Schiff geentert werden, und das war von Booten aus nicht zu machen, so lang das Schiff so rasch segelte.
Dem Steuermann kam ein erlösender Gedanke. Er sah, daß die spanischen Schiffsjungen immer noch, so hoch sie konnten, in den Masten hingen, und er rief ihnen zu, sie sollten zu den Rahen heruntersteigen und die Segel Iosschneiden. Das geschah. Bei dieser Gelegenheit wurden aus später zu schildernden Gründen zwei Spanier in Seemannskleidung, die sich auffällig zur Schau gestellt hatten, getötet, und zwar nicht durch Salvenfeuer, sondern durch gezielte Schüsse von Scharfschützen, während vom Massenfeuer, wie sich später herausstellte, der Neger Atufal und der spanische Rudergänger ebenfalls ums Leben kamen. In seiner jetzigen Verfassung, ohne Segel und ohne Anführer, war das Schiff für die Neger nicht länger zu beherrschen.
Mit knarrenden Masten legte es sich schwerfällig an den Wind. Das Vorschiff kam langsam in Sicht, und das Skelett am Vordersteven schimmerte im waagrecht einfallenden Mondlicht und warf einen riesenhaften, gerippten Schatten aufs Wasser. Mit seinem einen ausgestreckten Arm schien das Gespenst die Weißen zur Rache herbeizuwinken.
»Folgt eurem Führer!«, rief der Steuermann, und von beiden Seiten des Bugs legten die Boote an. Robbenspieße und Entermesser kreuzten sich mit Äxten und Hebestangen. Auf dem Langboot mittschiffs kauerten noch immer die Negerweiber und hoben ein wehklagendes Singen ab, als dessen Chor die Waffen stählern aufeinanderklirrten.
Eine Zeitlang kam der Angriff nicht recht vom Fleck, denn die Neger formierten zur Abwehr einen Keil, und die Seeleute, halb schon zurückgedrängt und ohne genügenden Halt, mußten wie Kavalleristen gleichsam aus dem Sattel fechten, das eine Bein seitlich über die Bordwand geschwungen, das andere noch draußen, mit Armbewegungen, als hätten sie statt der Entermesser Fuhrmannspeitschen in der Hand. Sie drangen nicht durch. Schon schien es um sie geschehen, als sie sich plötzlich wie ein Mann zusammenrafften und mit einem Hurrah nach innen sprangen, wo sie sogleich ins Handgemenge gerieten und entgegen ihrer Absicht wieder voneinander getrennt wurden. Ein paar Atemzüge lang erhob sich ein undeutliches, ersticktes, nach innen gekehrtes Geräusch, wie wenn unterm Wasser Schwertfische blitzschnell zwischen Schwärmen von Schwarzfischen einherfahren. Nicht lang, und die Weißen hatten sich, von den spanischen Matrosen verstärkt, aufs neue zu einem Haufen zusammengefunden und drängten nun die Schwarzen unwiderstehlich aufs Heck zurück. Am Großmast freilich hatte man von Bordwand zu Bordwand aus Fässern und Säcken eine Barrikade errichtet. Hier wandten sich die Neger noch einmal zum Widerstand und hätten gern, wenn sie auch Frieden und Waffenruhe verschmähten, eine Atempause gewonnen. Die ward ihnen aber nicht gegönnt; denn ohne innezuhalten, überstiegen die Seeleute das Hindernis und blieben am Feind. Die Schwarzen waren erschöpft; sie kämpften in Verzweiflung. Die roten Zungen hingen, wie bei Wölfen, aus den schwarzen Mäulern. Die Seeleute aber, die Bleichgesichter, hielten die Zähne zusammengebissen; kein Wort ward gesprochen, und binnen fünf Minuten war das Schiff gewonnen.
An die zwanzig von den Negern waren tot. Abgesehen von den Schußverletzungen gab es auch viele breitklaffende Wunden, zum größten Teil hervorgerufen von den langkantigen Robbenspießen und den scharfen Schnittwunden vergleichbar, wie die Engländer sie bei Prestonpans von den langgestielten Sensen der Hochländer empfangen hatten. Auf der andern Seite gab es keine Toten, wohl aber mehrere Verwundeten, von denen einige, darunter der Steuermann, schwer mitgenommen waren. Die überlebenden Neger wurden provisorisch festgesetzt und das Schiff in den Hafen geschleppt, wo es um Mitternacht abermals vor Anker lag.
Wir können die folgenden Geschehnisse und Maßregeln übergehen und uns darauf beschränken mitzuteilen, daß nach zweitägigen Ausbesserungsarbeiten beide Schiffe nach Concepcion in Chile und von dort nach Lima in Peru segelten, wo vor dem vizeköniglichen Gerichtshof die ganze Angelegenheit vom ersten Beginn an gründlichst untersucht wurde.
Während der Reise schien es eine Zeitlang, als sollte sieh der unglückliche Spanier, seit er nicht mehr unter Zwang stand, zugleich mit der ihm wiedergeschenkten Selbstbestimmung auch gesundheitlich erholen. Es kam aber anders: wie er selbst es vorausgesehen hatte, erlitt er kurz vor der Ankunft in Lima einen Rückfall und verfiel in solche Schwäche, daß er auf dem Arm an Land getragen werden mußte. Auf die Kunde von seinen Erlebnissen und seiner traurigen Lage öffnete ihm eine der zahlreichen religiösen Anstalten in der Stadt der Könige gastlich ihre Pforten; Arzt und Priester bemühten sich dort abwechselnd um ihn und ein Angehöriger des Ordens erbot sich freiwillig, als Wächter und Seelsorger ausschließlich für ihn bei Tag und bei Nacht zur Hand zu sein.
Die folgenden Auszüge, die nach einem der amtlichen spanischen Schriftstücke übersetzt sind, werden, wie wir hoffen, Licht auf die im vorstehenden berichtete Erzählung werfen und vor allein auch erläutern, von welchem Hafen die Reise der »San Dominick« in Wirklichkeit ausgegangen ist und wie sie sich tatsächlich abgespielt hat bis zu dem Zeitpunkt, wo das Schiff die Insel Santa Maria berührte. Vor der Wiedergabe der Auszüge wird es sich jedoch empfehlen, eine kleine einleitende Bemerkung vorauszuschicken.
Das unter zahlreichen anderen Dokumenten zur Übersetzung ausgewählte Schriftstück enthält die Zeugenaussage des Benito Cereno, die erste in diesem Verfahren niedergelegte. Einige der darin enthaltenen Mitteilungen wurden gleich während der Aussage aus juristischen wie aus Erwägungen des gewöhnlichen Menschenverstandes für fragwürdig gehalten. Das Gericht neigte zu der Ansicht, daß sich der Zeuge, an dessen Geist die Erlebnisse der jüngsten Zeit offenbar nicht ganz ohne Folgen vorübergegangen waren, manche Dinge in einer Weise zusammengereimt habe, wie sie nie geschehen sein konnten. Die anschließenden Zeugenaussagen der überlebenden Seeleute jedoch, die die Bekundung ihres Kapitäns gerade in einigen besonders merkwürdigen Einzelheiten bestätigten, ließen auch alles übrige glaubwürdig erscheinen. So kam es, daß das Gericht bei seiner endgültigen Entscheidung die Todesurteile auf Bekundungen stützte, die es, wären sie nicht anderweitig bestätigt worden, pflichtgemäß hätte zurückweisen müssen.
Ich, Don Jose de Abos und Padilla, Seiner Majestät Notarius für den Bereich der Königlichen Finanzkammer und Protokollar gegenwärtiger Provinzen, öffentlicher Notarius beim Heiligen Kreuzzug im hiesigen Bistum etc. etc.
Bestätige und erkläre nach Vorschrift des Gesetzes, daß in dem Strafverfahren vom vierundzwanzigsten September und folgenden Tages des Jahres siebzehnhundertundneunundneunzig gegen die Neger des Schiffes »San Dominick« folgende Erklärung vor mir abgegeben worden ist: –
(Erklärung des ersten Zeugen, Don Benito Cereno)
Zu besagtem Tag, Monat und Jahr forderte Seine Ehrwürden, Doktor Juan Martinez de Rozas, Rat beim Königlichen Audienzgericht in gegenwärtigem Königreich und Rechtskundiger auf dem Gebiete des Verwaltungsrechts, zu persönlichem Erscheinen auf den Kapitän des Schiffes »San Dominick«, Don Benito Cereno, welchem Ansuchen der Besagte auf einer Tragbahre entsprach, begleitet von dem Mönch Infelez; vor welchselbigem der Zeuge den Eid ablegte im Namen Gottes unseres Herrn und im Zeichen des Kreuzes; unter gleichzeitigem Gelöbnis, in jeder Hinsicht wahrheitsgemäß auszusagen, was er wisse und wonach er gefragt werde. Es wurde sodann besagter Zeuge in Übereinstimmung mit dem ordnungsgemäßen Gang des Verfahrens formgerecht vernommen, wobei er erklärte, er sei am verwichenen zwanzigsten Mai mit seinem Schiff vom Hafen Valparaiso aus unter Segel gegangen, mit dem Bestimmungsort Callao; die Ladung habe neben Landesprodukten bestanden aus dreißig Kisten Eisenwaren und einhundertundsechzig Schwarzen beiderlei Geschlechts, zum größten Teil Eigentum des Wohlgeborenen Herrn, Don Alexandro Aranda, aus der Stadt Mendoza. Das Schiff habe eine Bemannung geführt von sechsunddreißig Mann, nicht eingerechnet die mitreisenden Passagiere. Unter den Negern seien im einzelnen folgende gewesen:
(Hier folgt im Urtext eine Liste von etwa fünfzig Namen, Personenbeschreibungen und Altersangaben, zusammengestellt nach geretteten Schriftstücken des Herrn Aranda und teilweise auch nach der Erinnerung des Zeugen. Die Liste wird nur auszugsweise wiedergegeben.)
– Ein gewisser José, zwischen achtzehn und neunzehn Jahre alt; selbiger war zur persönlichen Aufwartung bei seinem Herrn, Don Alexandro, bestimmt und sprach, da er schon vier oder fünf Jahre bei ihm gedient hatte, gut Spanisch. – ein Mulatte namens Francesco, Kajütsteward, angenehm von Ansehen und Stimme, weshalb er auch in den Kirchen von Valparaiso gesungen hatte; gebürtig aus der Provinz Buenos Aires, Alter etwa fünfunddreißig Jahre. – ein aufgeweckter Neger namens Dago, früher viele Jahre Totengräber bei den Spaniern, sechsundvierzig Jahre alt. – vier alte Neger, in Afrika geboren, zwischen sechzig und siebzig, aber noch arbeitstüchtig, Kalfaterer von Beruf, die Namen lauten im einzelnen: erstens Muri, beim Gefecht umgekommen (ebenso wie sein Sohn, Diamelo); zweitens Nacta; drittens Yola, ebenfalls umgekommen; viertens Ghofan. Sodann sechs Neger von ausgewachsener Statur, zwischen dreißig und fünfundvierzig, alle ungezähmt, im Aschantiland geboren – Matiluqui, Yan, Deche, Mapenda, Yambaio, Akim; vier davon umgekommen. – ein kräftiger Neger namens Atufal, der in Afrika angeblich Häuptling gewesen war und auf den sein Besitzer große Stücke hielt. – ein kleiner Senegalneger, der jedoch etliche Jahre unter den Spaniern gelebt hatte, etwa dreißig Jahre alt, sein Name: Babo – an die Namen der übrigen kann sich Zeuge nicht erinnern; er hofft jedoch, daß auch Don Alexandros übrige Papiere noch gefunden werden und wird dann die fehlenden Angaben ordnungsgemäß zusammenstellen und dem Gericht nachreichen. – außerdem neununddreißig Frauen und Kinder verschiedensten Alters. (Nach Abschluß des Verzeichnisses fährt die Zeugenaussage fort wie folgt:) Die Neger hätten sämtlich an Deck geschlafen, wie es auf jener Route üblich ist, und seien nicht gefesselt gewesen, da dem Zeugen vom Eigentümer, seinem Freund Aranda, erklärt worden war, sie seien alle leicht zu lenken. – Am siebenten Tag nach der Ausreise, drei Uhr morgens, als die Spanier sämtlich schliefen, mit Ausnahme der beiden wachhabenden Offiziere, nämlich des Bootsmanns Juan Robles und des Zimmermanns Juan Batista Gayete, sowie des Rudergängers und seines Jungen, hätten die Neger unvermutet gemeutert, den Bootsmann und den Zimmermann gefährlich verwundet und der Reihe nach achtzehn von den an Deck schlafenden Mann getötet, teils mit Handspaken und Äxten, teils indem sie sie gebunden lebendig über Bord warfen. Von den an Deck befindlichen Spaniern hätten sie, wie Zeuge vermutet, sieben deshalb in gefesseltem Zustand am Leber gelassen, weil sie sie zur Lenkung des Schiffs brauchten; drei oder vier weitere, die sich verborgen hielten, seien gleichfalls verschont geblieben. Während des Aufstandes hätten sich die Neger zwar in den Besitz der Hauptluke gesetzt; doch sei es sechs oder sieben Verwundeten dennoch gelungen, ungehindert zum Verbandplatz durchzukommen. Andererseits hätten während des Aufstands der Steuermann und eine weitere Person, auf deren Namen sich der Zeuge nicht mehr besinnt, den Versuch unternommen, durch die Luke nach oben zu gelangen; sie seien dabei alsbald verwundet worden und hätten sich in die Kajüte zurückziehen müssen. Bei Tagesanbruch habe sodann er, der Zeuge, sich entschlossen, über den Niedergang das Verdeck zu erreichen; er sei dort auf den Neger Babo gestoßen, der als Rädelsführer gewirkt habe, sowie auf dessen Gehilfen Atufal, und habe zu den beiden gesprochen und sie ermahnt, keine weiteren Scheußlichkeiten dieser Art zu verüben, wobei er die Frage an sie richtete, was sie wünschten und zu tun gedächten, und sich seinerseits erbot, ihren Anweisungen zu gehorchen. Dessenungeachtet hätten sie, in seiner Gegenwart, drei Männer, in gefesseltem Zustand, lebendig über Bord geworfen. Ihm, dem Zeugen, hätten sie bedeutet, er möge nach oben kommen, sie würden sein Leben schonen. Als er willfahrte, habe der Neger Babo ihn gefragt, ob sich in jenen Meeresgegenden irgendwelche Negerländer befänden, wohin er sie führen könne, und er habe geantwortet: Nein. Der Neger Babo habe ihn späterhin aufgefordert, sie nach dem Senegal oder nach der benachbarten Inselgruppe St. Nicholas zu bringen; er habe erwidert, dies sei unmöglich, wegen der großen Entfernung, der damit verbundenen Notwendigkeit, Kap Hoorn zu umsegeln, wegen des schlechten Zustands, in welchem sich das Schiff befand, und wegen des Mangels an Proviant, Besegelung und Wasser. Hierauf habe der Neger Babo indessen zur Antwort gegeben, irgendwie müsse er sie an Ort und Stelle bringen; sie seien bereit, sich nach jedem seiner Wünsche zu richten, was Essen und Trinken betreffe. Nach einer langen Unterredung habe er sich zwingend genötigt gesehen, ihrem Wunsch zu willfahren, da sie alle Weißen zu töten drohten, wenn sie nicht, komme was da wolle, nach dem Senegal gebracht würden, und habe ihnen eröffnet, daß es für die Reise vor allen Dingen an Wasser fehle. Man wolle sich nahe der Küste halten, dort Wasser einnehmen und sodann den geplanten Kurs weiter verfolgen. Dem habe der Neger Babo zugestimmt, und er, der Zeuge, habe alsdann die auf der Route liegenden Häfen angesteuert, in der Hoffnung, einem spanischen oder ausländischen Schiff zu begegnen, das ihnen Rettung bringen könnte. Nach zehn oder elf Tagen hätten sie Land gesichtet und seien in der Gegend von Nasca der Küste entlanggesteuert. Der Zeuge habe beobachten müssen, wie die Neger merklich unruhig und aufrührerisch wurden, weil er mit dem Wassereinnehmen nicht Ernst machte, und der Neger Babo habe unter Drohungen von ihm verlangt, es müsse ohne Verzug am darauffolgenden Tag geschehen. Er habe ihm erwidert, er sehe ja selbst, daß es eine Steilküste sei und daß sich die auf den Karten verzeichneten Flüsse nicht finden ließen, und habe weitere, den Umständen nach einleuchtende Gründe vorgebracht. Am besten werde es sein, die Insel Santa Maria anzulaufen, wo man, da es sich um ein verlassenes Stück Land handle, leicht Wasser werde finden können, wie es ja auch der Überlegung der ausländischen Seeleute entsprochen hatte. Den nahegelegenen Hafen Pisco oder einen anderen an der Küste liegenden Hafen habe der Zeuge deshalb nicht angelaufen, weil der Neger Babo ihm mehrere Male bedeutet hatte, er werde alle Weißen in dem Augenblick töten, in dem er an der von ihnen berührten Küste eine Stadt, ein Dorf oder eine andere Ansiedlung gewahrte. Man habe sich also entschlossen, nach der Insel Santa Maria zu fahren, wobei der Plan des Zeugen darin bestanden habe, während der Fahrt oder in der Nähe der Insel ein zur Hilfeleistung geeignetes Schiff zu finden oder von der Insel aus in einem Boot nach dem nächstgelegenen Teil des Festlandes bei Arruco zu entkommen; im Hinblick auf diesen seinen Vorsatz habe er sofort den Kurs geändert und habe auf die Insel zugehalten. Die Neger Babo und Atufal hätten täglich Besprechungen abgehalten darüber, was für ihren Plan einer Rückkehr nach dem Senegal notwendig sei und ob sie die sämtlichen Spanier und insbesondere den Zeugen umbringen sollten. Acht Tage nach ihrem Abdrehen von der Küste, bei Nasca, als der Zeuge kurz nach Tagesanbruch Wache hatte, sei bald nach einer der Zusammenkünfte unter den Negern der Neger Babo bei ihm erschienen und habe ihm erklärt, er habe sich entschlossen, seinen Herrn, Don Alexandro Aranda, zu töten, einmal deshalb, weil er und seine Kameraden sonst ihrer Freiheit nicht sicher wären, zum andern weil er die Seeleute in Respekt halten und ihnen ein warnendes Beispiel dafür vor Augen führen wolle, welches Schicksal ihnen bereitet würde, wenn sie oder sonst jemand an Bord sich ihm widersetzten. Don Alexandro müsse sterben; das sei das beste Mittel, eine solche Warnung auszudrücken. Was diese letzte Bemerkung bedeutete, habe der Zeuge dazumal noch nicht verstanden; ihm konnte nichts anderes klar sein, als daß Don Alexandros Tod geplant sei. Im übrigen habe der Neger Babo ihn, den Zeugen, ersucht, den Steuermann Raneds herbeizurufen, der in diesem Augenblick, vor Verübung der Tat, in der Kajüte schlief; vermutlich aus Besorgnis, der Steuermann, ein in der Navigation erfahrener Offizier, könne mit Don Alexandro und den andern getötet werden. Der Zeuge, der von Jugend auf mit Don Alexandro befreundet war, habe sich mit guten und bösen Worten ins Mittel gelegt; es sei aber umsonst gewesen, denn der Neger Babo habe nur geantwortet, es sei beschlossene Sache und die Spanier riskierten ihr Leben, wenn sie in dieser oder einer anderen Angelegenheit seinem Willen entgegenzuhandeln versuchten. In diesem Zwiespalt habe der Zeuge denn also den Steuermann Raneds herbeigerufen, dieser sei gewaltsam beiseitegeführt worden, und der Neger Babo habe darauf alsbald den beiden Aschantis Matiluqui und Lecbe befohlen, hinzugehen und den Mord zu verüben. Die beiden seien mit Äxten nach Don Alexandros Kammer hinuntergegangen. Halbtot und gräßlich verstümmelt hätten sie ihn an Deck geschleift und seien schon im Begriff gewesen, ihn so über Bord zu werfen; da habe ihnen aber der Neger Babo Einhalt geboten und sie geheißen, den Halbtoten vor seinen Augen auf Deck erst vollends zu erschlagen, was geschehen sei, und den Leichnam sodann nach vorn zu bringen. Er, der Zeuge, habe sodann drei Tage lang von dem Erschlagenen nichts mehr gesehen. – Ein gewisser Don Alonzo Sidonia, ein alter Herr, der lang in Valparaiso wohnte und auf einen Beamtenposten in Peru berufen war, wohin er mit dem Schiff zu reisen gedachte, habe die Koje neben derjenigen Don Alexandros innegehabt. Bei dem Geschrei des Überfallenen sei er erwacht und habe sich in der Verwirrung, und bei dem Anblick der Neger mit den blutigen Äxten, durch das neben ihm liegende Bordfenster ins Meer gestürzt, wo er unterging, ohne daß der Zeuge die Möglichkeit besaß, ihm zu helfen oder ihn aufzunehmen. Kurze Zeit nach der Ermordung Arandas habe man auch seinen Vetter, Don Francisco Masa aus Mendoza, einen Herrn mittleren Alters, sowie den jungen Don Joaquin Marques de Aramboalaza, der soeben aus Spanien eingetroffen war, mit seinem spanischen Diener Ponce, und Arandas drei junge Angestellte José Mozairi, Lorenzo Bargas und Hermenegildo Gandix, alle drei aus Cadix, an Deck gebracht. Don Joaquin und Hermenegildo Gandix habe der Neger aus Gründen, die erst später klarwerden sollten, am Leben gelassen; Don Francisco Masa dagegen, José Mozairi, Lorenzo Bargas und den Diener Ponce, ferner den Bootsmann Juan Robles, die Bootsmannsmaate Manuel Viscaya und Roderigo Hurta sowie vier Matrosen habe der Neger Babo lebendig ins Meer werfen lassen, obwohl sie keinen Widerstand leisteten und nur um ihr nacktes Leben baten. Der Bootsmann Juan Robles, der schwimmen konnte, habe sich am längsten über Wasser gehalten; er äußerte dabei Zeichen der Reue und trug mit seinen letzten Worten dem Zeugen auf, für seine arme Seele unserer Lieben Frau von der Barmherzigkeit eine Messe lesen zu lassen. – Während der folgenden drei Tage habe der Zeuge in seiner Ungewißheit, was mit Don Alexandros Überresten geschehen sei, den Neger Babo häufig danach gefragt, ob sie, falls sie noch an Bord seien, für eine Bestattung an Land aufbewahrt würden; er habe ihm auch dringend nahegelegt, so zu verfahren. Der Neger Babo habe bis zum vierten Tag darauf keine Antwort erteilt; als der Zeuge aber an besagtem Tag mit Sonnenaufgang an Deck kam, zeigte ihm der Neger Babo ein Gerippe, das an Stelle der ursprünglichen Gallionsfigur – des Christoph Columbus, Entdeckers der Neuen Welt – am Schiff angebracht war. Der Neger Babo habe dabei die Frage an ihn gerichtet, wessen Skelett dies wohl sei, und ob er nach dem weißen Aussehen der Gebeine nicht den Schluß ziehe, daß es sich um einen Weißen handle. In seinem Anlitz lesend, sei der Neger Babo darauf nahe an ihn herangetreten und habe etwa folgendes zu ihm gesagt: »Daß Du uns Schwarzen Treue hältst, von hier bis Senegal! – sonst sollst du im Geist, wie jetzt im Körper, deinem Führer folgen!« – und damit habe er nach dem Schiffsschnabel gedeutet. – – – Noch am selbigen Morgen habe der Neger Babo der Reihe nach jeden einzelnen Spanier nach vorn geholt und dieselbe Frage an ihn gerichtet: wessen Gerippe dies sei, und ob er nach der Weiße der Knochen nicht dafürhalte, daß es eines Weißen Gebeine seien. Die Spanier hätten Mann für Mann ihr Gesicht bedeckt. Der Neger Babo habe hierauf einem jeden die Worte wiederholt, die er zuerst an den Zeugen gerichtet hatte. – – Sodann habe der Neger Babo sie, die Spanier, achtern zusammengetrieben und ihnen in einer Ansprache erklärt, es sei nunmehr das Nötige geschehen; er, der Zeuge, möge als Steuermann im Dienst der Schwarzen seinen Kurs weitersteuern, er möge sich aber mit allen andern gesagt sein lassen, daß sie mit Leib und Seele desselben Weges gehen würden wie Don Alexandro, wenn er sie, die Spanier, gegen sie, die Schwarzen, nur im geringsten mucksen oder sich verschwören sehe – eine Drohung, welche täglich wiederholt wurde. Schon vor den zuletzt erwähnten Vorgängen habe man den Schiffskoch gebunden über Bord werfen wollen, weil er irgend eine dem Zeugen unbekannt gebliebene Äußerung getan hatte; doch habe der Neger Babo ihm schließlich auf Bitten des Zeugen das Leben geschenkt. Einige Tage später habe der Zeuge, in der Absicht kein Mittel zur Rettung der überlebenden Weißen unversucht zu lassen, den Negern gegenüber Ruhe und Einsicht gepredigt und, sich bereit gefunden, ein Schriftstück zu entwerfen, welches von ihm und den schreibenskundigen Seeleuten, sowie auch von dem Neger Babo namens seiner eigenen Person und aller Schwarzen, unterzeichnet wurde; in selbigem habe Zeuge sich verpflichtet, die Schwarzen nach dem Senegal zu bringen, sie aber hätten zugesagt, künftig keine Tötungen mehr vorzunehmen, wie er ihnen denn auch das Schiff mitsamt der Ladung förmlich übermachte, womit sie sich fürs erste befriedigt und beruhigt erklärten. – – Am darauffolgenden Tag jedoch habe der Neger Babo, um einem Entkommen der Matrosen desto sicherer vorzubeugen, sämtliche Boote zerstören lassen, mit Ausnahme des Langboots, welches nicht seetüchtig war, sowie eines zweiten Bootes, eines in guter Verfassung befindlichen Kutters, von welchem er wußte, daß er zum Einholen der Wasserfässer gebraucht werden würde, den er jedoch zur Vorsicht im Laderaum verstauen ließ.
(Es folgen verschiedene Einzelheiten über den langen und wirren Fortgang der Schiffsreise, unter anderem über die Begleiterscheinungen einer verhängnisvollen Windstille, wovon nur eine einzelne Stelle im Auszug wiedergegeben wird, nämlich die folgende:
– Am fünften Tag der Windstille sei es dahin gekommen, daß alles an Bord schwer unter der Hitze und dem Wassermangel litt, und daß fünf Personen unter krampfartigen Erscheinungen und Anfällen von Irresein mit Tod abgingen. Die Neger seien unter diesen Umständen reizbar geworden, und eine zufällige Geste (durchaus harmlos, in ihren Augen aber verdächtig), die der Steuermann Raneds dem Zeugen gegenüber machte, als er ihm einen Quadranten überreichte, genügte als Anlaß, ihn umzubringen. Sie hätten den Vorfall übrigens später bedauert, da der Steuermann außer dem Zeugen der einzige in der Navigation erfahrene Mann war, der an Bord noch übrig blieb.
– Andere Ereignisse, die sich von Tag zu Tag begeben hätten, die aber nur dazu dienen könnten, vergangene Not und Unbill nutzlos wieder zu erwecken, wolle der Zeuge übergehen und nur berichten, daß sie nach dreiundsiebzigtägiger Fahrt, von dem Kurswechsel bei Nasca an gerechnet, während welcher Zeit sie mit einem winzigen Wasservorrat auskommen mußten und viel unter der erwähnten Windstille litten, endlich an der Insel Santa Maria anlangten, und, zwar am siebzehnten des Monats August, etwa um sechs Uhr nachmittags, zu welcher Stunde sie in der Nähe des amerikanischen Schiffs »Bachelor's Delight« Anker warfen, als welches unter dem Kommando des edlen Kapitäns Amasa Delano in selbiger Bucht vor Anker lag. Schon um sechs Uhr morgens hätten sie den Hafen gesichtet, und die Neger seien sogleich unruhig geworden, als sie in der Nähe das Schiff sahen, da sie dort keines anzutreffen erwarteten. Der Neger Babo habe sie aber beschwichtigt und ihnen versichert, sie brauchten keine Furcht zu haben. Er habe sofort angeordnet, daß die Bugfigur mit Segeltuch zugedeckt wurde, als ob dort eine Reparatur im Gange wäre, und habe die Decks notdürftig aufräumen lassen. Eine Zeitlang hätten der Neger Babo und der Neger Atufal die Lage unter sich beraten. Der Neger Atufal habe weitersegeln wollen, aber der Neger Babo sei dazu nicht bereit gewesen und habe ganz aus eigenem Entschluß die weiteren Kriegspläne ausgeheckt: Er sei schließlich auch zu ihm, dem Zeugen, gekommen, und habe ihm eingeschärft, all das zu sagen und zu tun, was der Zeuge, wie er bekundet, dem amerikanischen Kapitän gegenüber gesagt und getan hat. – Der Neger Babo habe ihm angekündigt, wenn er auch nur im geringsten von der Anweisung abwiche oder mit Wort und Blick irgendeine Andeutung über das Geschehene und den gegenwärtigen Stand der Dinge machte, werde er ihn mit allen seinen Kameraden auf der Stelle töten; dazu zog er einen Dolch, welchen er bei sich verborgen trug, und machte eine Bemerkung, die – wenn der Zeuge sie recht verstanden hat – ausdrücken sollte, der Dolch werde nicht minder aufmerksam wachen als Babos Auge. Der Neger Babo habe sodann seinen Spießgesellen den Plan offenbart; er habe damit allseitigen Beifall gefunden. Zur besseren Verheimlichung der Wahrheit habe er des weiteren verschiedene Maßregeln ersonnen, die teilweise zugleich der Täuschung und der Abwehr dienen sollten. Von dieser Art sei zum Beispiel der Auftrag gewesen, den die obenerwähnten sechs Aschantis erhielten; sie nämlich, die als eine besondere Mördergarde des Negers Babo gelten konnten, postierte er am Aufgang zur Hütte und zwar so, daß es den Anschein hatte, als sollten sie einen Posten Beile (die, in Kisten verpackt, einen Teil der Ladung bildeten) reinigen, während es in Wirklichkeit ihre Aufgabe war, die Beile im Notfall und auf ein verabredetes Stichwort hin als Waffen zu verwenden und auszuteilen. Zu den wohldurchdachten Maßregeln habe auch die Kriegslist gehört, daß man Atufal, Babos rechte Hand, als Gefesselten auftreten ließ, dessen Ketten jedoch von einem Augenblick zum andern abzustreifen waren. Ihm, dem Zeugen, habe, der Neger Babo genau vorgeschrieben, welche Rolle er im einzelnen in jeder der Vorkehrungen zu spielen habe, und welche Erklärung er jeweils abgeben müsse, wobei ihm immer wieder sofortiger Tod angedroht wurde für den Fall, daß er von der Vorschrift abwiche. In der Überlegung, daß viele von den Negern außerstande sein würden; die, nötige Ruhe zu bewahren, habe der Neger Babo die vier alten Neger, Kalfaterer von Beruf, dazu aufgestellt, nach Möglichkeit eine Art von Hausordnung auf Deck aufrecht zu erhalten. Immer und immer wieder habe er an die Spanier und an seine Landsleute Ansprachen gerichtet, ihnen sein Vorhaben und seine Vorkehrungen auseinandergesetzt und sie in die erfundene Geschichte eingeweiht, die er, der gegenwärtige Zeuge, vorbringen sollte; habe ihnen auch immer wieder eingeschärft, daß sie von dieser Geschichte nicht abweichen dürften. Die sämtlichen Vorbereitungen seien ausgeheckt und vereinbart worden in dem Zeitraum von zwei oder drei Stunden zwischen dem ersten Auftauchen des fremden Schiffs und dem Eintreffen des Kapitäns Amasa Delano an Bord. Dieses entscheidende Ereignis habe etwa um halb acht Uhr morgens stattgefunden; Kapitän Amasa Delano sei in seinem Boot gekommen, und man habe ihn freudig willkommen geheißen. Er, der Zeuge, habe sodann, so weit er es über sich gewinnen konnte, die Rolle des Haupteigners und freien Kapitäns auf dem Schiff gespielt und dem Kapitän Amasa Delano, als dieser ihn danach fragte, berichtet; er käme mit dreihundert Negern aus Buenos Aires und sei nach Lima bestimmt. Auf der Höhe von Kap Horn und während einer anschließenden Fieberepidemie seien viele Neger gestorben: Auch die sämtlichen Seeoffiziere und der größte Teil der Bemannung sei durch ähnliche Zwischenfälle umgekommen.
(In dieser Art fährt die Zeugenaussage fort; sie berichtet umständlich die dem Zeugen von Babo vorgeschriebene Lügengeschichte, die der Zeuge an Kapitän Delano weitergab, und bekundet außerdem die freundschaftlichen Anerbietungen Kapitän Delanos und manches andere, was indessen hier nicht mitgeteilt wird. Nach der Lügengeschichte und den anderen Einschaltungen fährt die Bekundung fort, wie folgt:)
Der edelmütige Kapitän Amasa Delano sei den ganzen Tag an Bord geblieben und habe das vor Anker gebrachte Schiff erst um sechs Uhr abends verlassen. Er, der Zeuge, habe ihm während der Zeit immer nur, unter dem Zwang der obwaltenden Umstände, von seinen angeblichen Schicksalsschlägen erzählt, im übrigen aber nicht ein einziges Wort äußern oder ihm mit irgend einem Zeichen bedeuten können, wie es sich in Wahrheit mit allem verhielte, weil der Neger Babo in der Rolle eines dazu bestellten Dieners und unter dem Anschein eines unterwürfig ergebenen Sklaven ihn, den Zeugen, keinen Augenblick allein ließ. Dies habe dazu gedient, den Zeugen bei allen seinen Handlungen und Worten zu beobachten, denn der Neger Babo verstehe Spanisch gut; überdies seien auch noch andere aufgestellt gewesen, die fortwährend zu wachen hatten und ebenfalls Spanisch verstanden. – Bei einer bestimmten Gelegenheit, als er, der Zeuge, im Gespräch mit Amasa Delano an Deck stand, habe der Neger Babo ihn (den Zeugen) mit einem heimlichen Zeichen beiseitegerufen, aber immer so, daß es aussah, als ginge der Entschluß von ihm, dem Zeugen, aus. Alsdann, beiseite stehend, habe der Neger Babo ihm das Ansinnen gestellt, von Amasa Delano alle Einzelheiten zu erfragen, sein Schiff, die Bemannung und Bewaffnung betreffend. »Wozu?« habe er, der Zeuge, gefragt, und der Neger Babo habe erwidert, das könne er sich ja selber denken. Entsetzt bei dem Gedanken, was dem edlen Kapitän Amasa Delano möglicherweise bevorstehe, habe der Zeuge sich zunächst geweigert, die verlangten Fragen zu stellen, und mit jedem Mittel der Überredung versucht, den Neger Babo von seinem neuen Plan abzubringen; der Neger Babo habe jedoch die Spitze seines Dolchs gezeigt, und nach erteilter Auskunft habe ihn der Neger Babo aufs neue beiseite gezogen und ihm erklärt, noch heute abend werde er, der Zeuge, Kapitän von zwei Schiffen sein, statt des einen, denn da ein großer Teil der amerikanischen Schiffsmannschaft zum Fischen ausfahren wolle, würden die sechs Aschantis allein und ohne weitere Hilfe bequem im Stande sein, das Schiff zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit habe er auch noch weitere ähnlich lautende Dinge gesagt. Bitten und Vorstellungen seien vergeblich gewesen. Vor Amasa Delanos Eintreffen an Bord jedoch sei von einem Handstreich auf das amerikanische Schiff noch nicht die Rede gewesen. Zur Verhinderung des Plans hätten ihm, dem Zeugen, alle Mittel gefehlt. – In manchen Punkten verwirre sich ihm übrigens das Gedächtnis, und er könne sich nicht jedes einzelnen Ereignisses deutlich entsinnen. – Sowie sie, wie vorhin berichtet, um sechs Uhr abends Anker geworfen hatten, habe sich der amerikanische Kapitän verabschiedet, um auf sein Schiff zurückzukehren. Einer plötzlichen Eingebung gehorchend, von welcher der Zeuge annimmt, daß sie ihm von Gott und seinen Engeln zugekommen, sei er, nach schon geschehenem Abschied, dem edelmütigen Kapitän Amasa Delano noch bis zur Bordwand nachgegangen und dort unter dem Vorwand, er müsse sich nochmals von ihm verabschieden, stehengeblieben, bis Amasa Delano in seinem Boot Platz genommen hätte. In dem Augenblick, als das Boot abstieß, sei er, der Zeuge, vom Dollbord aus nachgesprungen und auch tatsächlich in das Boot zu fallen gekommen, wie, das wisse er nicht, Gott habe ihn wohl beschirmt. Des ferneren –
(Hier folgt im Original der Bericht über die weiteren Ereignisse bei der Flucht, über die Wiedereinnahme der »San Dominick« und die Überfahrt zum Festland; Im Text kommen zahlreiche Ausdrücke vor wie »ewige Dankbarkeit«, die der Zeuge dem »edelmütigen Kapitän Amasa Delano« schuldig sei. Die Zeugenaussage ergeht sich sodann in sich wiederholenden Bemerkungen und bringt zum Teil eine nochmalige Aufzählung der Neger, wobei ihres persönlichen Anteils an den Geschehnissen gedacht wird, im Hinblick darauf, daß das Gericht um nähere Angaben ersucht hatte, auf welche es die zu fällenden Urteilssprüche stützen könnte. Aus diesem Abschnitt zitieren wir:)
Nach Meinung des Zeugen hätten zwar zunächst nicht alle Neger von dem Plan eines Aufstandes gewußt; sie hätten ihn aber, als er ausgeführt war, alle gutgeheißen. – Der Neger José, achtzehn Jahre alt und persönlicher Leibdiener bei Don Alexandro, sei derjenige gewesen, der vor der Meuterei dem Neger Babo Nachricht über die Sachlage in der Kajüte hinterbrachte. Dies sei daher bekannt, weil er in der vorhergehenden Mitternacht aus seiner Koje, die sich in der Kajüte unterhalb derjenigen seines Herrn befand, an Deck geschlichen sei und sich dort mit dem Rädelsführer und dessen Verschworenen getroffen habe. Auch sei er mehrmals vom Steuermann beobachtet worden, wie er mit dem Neger Babo heimliche Zwiesprache hielt, und in einer Nacht habe ihn der Steuermann zweimal von dannen jagen müssen. – Selbiger Neger José sei es auch gewesen, der ohne ausdrücklichen Befehl des Negers Babo – denn dieser Befehl war an Lecbe und Matiluqui ergangen – seinen Herrn, Don Alexandro, mit Dolchstichen zu Tode brachte, als er halbtot an Deck geschleift wurde. – Der Steward, der Mulatte Francesco, gehöre zum engeren Kreis der Aufrührer und sei in allem und jedem das Geschöpf und Werkzeug des Negers Babo. Um sich einzuschmeicheln, habe er unmittelbar vor einer in der Kajüte einzunehmenden Mahlzeit dem Neger Babo vorgeschlagen, er wolle dem edlen Kapitän Amasa Delano ein vergiftetes Gericht vorsetzen. Dies sei glaubwürdig erhärtet dadurch, daß die Neger selbst es bekundet hätten; der Neger Babo habe jedoch andere Pläne gehabt, und Francesco die Ausführung untersagt. – Der Aschanti Lecbe sei einer von den Allerschlimmsten; er habe, als das Schiff wieder genommen wurde, an der Abwehr teilgenommen, in jeder Hand eine Axt, und mit einer dieser Äxte schon beim ersten Enterversuch den Ersten Steuermann des Kapitäns Amasa Delano an der Brust verwundet, wie gerichtsbekannt. Vor seinen, des Zeugen, Augen habe Lecbe aber auch Don Francisco Masa mit einer Axt niedergeschlagen, als er ihn, auf Geheiß des Negers Babo, nach der Bordwand schleppte, um ihn lebendig ins Meer zu stürzen, und er habe überdies an der oben erwähnten Ermordung des Don Alexandro Aranda und anderer Kajütpassagiere teilgenommen. Da die Aschantis bei dem Treffen mit dem Boot höchst erbittert gekämpft hätten, seien nur der genannte Lecbe und Yan am Leben geblieben. Yan sei ebenso schlimm wie Lecbe. Er sei der Mann, der auf Babos Befehl nur zu gern Don Alexandros Skelett präpariert habe, und zwar auf eine Art, von der die Neger ihm, dem Zeugen, später berichteten, die er aber, solange er noch bei gesunder Vernunft sei, nichts weiter bekannt machen möchte. Yan und Lecbe seien es auch gewesen, die während einer Flaute bei Nacht das Gerippe am Bug befestigten. Auch dies hätten dem Zeugen die Neger berichtet; der Neger Babo aber sei es gewesen, der die Unterschrift darunter malte. Überhaupt sei der Neger Babo der Anstifter von Anfang bis zu Ende; er ordnete jeden Mord an und war die wahre Seele des Aufstands. Atufal könne als sein erster Helfershelfer gelten: er habe jedoch mit eigener Hand keinen Mord verübt, ebensowenig wie der Neger Babo selbst. – Atufal sei erschossen worden; er sei bei dem Kampf mit den Booten, noch vor der Enterung, gefallen. – Die Negerinnen, soweit sie volljährig waren, hätten von dem Aufruhr gewußt und ihre Zufriedenheit mit dem Tod ihres Herrn, Don Alexandro, bezeigt. Wenn sie von ihren Männern nicht zurückgehalten worden wären, würden sie die auf Geheiß des Negers Babo erschlagenen Spanier, statt sie einfach zu töten, zu Tode gemartert haben. Auch in seinem, des Zeugen, Fall hätten die Negerfrauen alles in ihren Kräften Stehende getan, um sich seiner zu entledigen. Bei den verschiedenen Ermordungen hätten sie Lieder gesungen und getanzt – keine Freuden-, sondern strenge Feiertänze. Auch vor dem Treffen mit den Booten und später während des Kampfes sangen sie den Negern Trauerweisen vor, und dieser Trauergesang habe aufreizender gewirkt als irgend ein anderer und sei auch so gedacht gewesen. Auch dies alles sei glaubwürdig erhärtet durch eigene Aussage der Neger.
Von den sechsunddreißig Mann Besatzung (mit Ausnahme der inzwischen ausnahmslos verstorbenen Passagiere), von denen der Zeuge wisse, seien nur noch sechs am Leben, außerdem vier Kajütaufwärter und Schiffsjungen, die bei der Bemannung nicht mitgerechnet wurden. – Einem der Kajüthelfer hätten die Neger den Arm gebrochen und ihn mit Äxten geschlagen.
(Nun folgen verschiedene in keinem näheren Zusammenhang stehende Bekundungen, die sich auf verschiedene Zeitpunkte beziehen. Wir teilen die folgenden mit:)
Während Kapitän Amasa Delano an Bord war, hätten die Seeleute und einmal auch Hermenegildo Gandix den Versuch gemacht, ihm Andeutungen über den wahren Stand der Dinge zukommen zu lassen: Diese Versuche seien aber ohne Ergebnis geblieben, weil die Männer immer unter der Angst vor sofortigem Tod gestanden und weil die wohlausgeklügelten Maßnahmen an Bord immer auch eine Widerlegung des tatsächlichen Stands der Dinge dargeboten hätten. Vor allem aber habe Amasa Delanos edle und gottesfürchtige Wesensart ihn ganz unfähig gemacht, sich ein solches Ausmaß der Verworfenheit überhaupt nur vorzustellen. Luys Galgo, ein etwa sechzigjähriger Matrose, der früher auf der Königlichen Flotte gefahren war, habe zu denen gehört, die sich Kapitän Amasa Delano durch ein Zeichen verständlich zu machen suchten. Seine Absicht erregte jedoch, wiewohl sie nicht entdeckt wurde, Verdacht, und man schickte ihn unter einem Vorwand außer Sichtweite und steckte ihn schließlich in den Laderaum, wo man sich seiner entledigte. Dies geht aus einer inzwischen gemachten Bekundung der Neger hervor. – Einer von den Schiffsjungen habe aus Kapitän Amasa Delanos Gegenwart eine gewisse Hoffnung auf Rettung geschöpft und unbedachterweise ein dahinzielendes Wort geäußert, das von einem mit ihm essenden jungen Sklaven aufgeschnappt und seinem Sinne nach verstanden wurde. Daraufhin habe der junge Sklave mit dem Messer nach ihm gestochen und ihm eine schwere Wunde am Kopf beigebracht, von der der Junge aber jetzt genese. Ebenso habe, nicht lange bevor das Schiff vor Anker gebracht wurde, einer der Matrosen, der gerade als Rudergänger arbeitete, sich dadurch in Gefahr gebracht, daß er einen aus ähnlichen Erwägungen geborenen Ausdruck in seinem Mienenspiel nicht hinreichend vor den Schwarzen verbarg; da er sich nachher sehr vorsichtig benahm, gelang es ihm, davonzukommen. – Alle diese Bekundungen würden nur gemacht, um dem Gericht zu zeigen, daß es von Beginn des Aufruhr bis zu seinem Ende für den Zeugen und seine Leute unmöglich war, anders zu handeln, als wie sie gehandelt haben. – Den dritten Schreiber, Hermenegildo Gandix, habe man schon bald genötigt, bei den Matrosen zu leben; er habe Seemannskleidung getragen und durchaus wie ein Seemann ausgesehen. Er, Gandix, sei von einer versehentlich abgefeuerten Musketenkugel getötet worden, die man vor dem Entern von den Booten nach dem Schiff abschoß, und zwar deswegen, weil er in seiner Angst in die Takelung des Besanmasts gestiegen sei und den Booten zugerufen habe »Nicht entern!« – da er fürchtete, im Augenblick des Enterns von den Negern getötet zu werden. Dies habe die Amerikaner zu dem Glauben veranlaßt, er mache mit den Negern gemeinsame Sache, und sie feuerten zwei Kugeln auf ihn ab, so daß er verwundet aus der Takelung fiel und im Meer ertrank. – Auch der junge Don Joaquin, Marques de Aramboalaza, sei ebenso wie der Schreiber Hermenegildo Gandix zur Stellung und äußeren Erscheinung eines gewöhnlichen Matrosen degradiert worden. Als er bei einer Gelegenheit nicht parieren wollte, habe der Neger Babo dem Aschanti Lecbe befohlen, Teer zu holen und heiß zu machen und es Don Joaquin über die Hände zu träufeln. – Ums Leben gekommen sei Don Joaquin gleichfalls infolge eines Mißverständnisses der Amerikaner, das aber in seinem Fall unmöglich zu vermeiden war. Als nämlich die Boote ihren Angriff machten, zwangen die Neger Don Joaquin, sich mit einer, die Schneide nach außen, drohend an seiner Hand festgebundenen Axt am Schanzkleid aufzustellen, worauf er, als anscheinend Bewaffneter und zum Widerstand, wie es schien, Entschlossener, für einen zum Feind übergelaufenen Matrosen gehalten und erschossen wurde. – An Don Joaquins Person verborgen habe sich ein Edelstein gefunden, welcher auf Grund später entdeckter Papiere dem Altar unserer Lieben Frau zur Göttlichen Barmherzigkeit zu Lima zugedacht gewesen sei als eine im voraus bereitgehaltene und gelobte Votivgabe zum Zeichen der Dankbarkeit nach glücklicher Landung in Peru, dem Ziel der Reise, die Don Joaquin bis von Spanien hierhergeführt hatte. – Besagter Edelstein befinde sich mit anderen Effekten des verblichenen Don Joaquin in der Obhut der Brüder vom Spital der Ehrwürdigen Priester und werde dort für die Entscheidung des Hohen Gerichts bereitgehalten. – Der damalige Zustand des Zeugen und die Eile, in der die Boote zum Angriff schritten, seien schuld daran, daß die Amerikaner nicht vorher in Kenntnis gesetzt wurden, weshalb und inwiefern sich unter der vermeintlichen Schiffsbemannung auch ein Fahrgast und ein Schreiber befanden, die der Neger Babo falsch eingekleidet hatte. – Außer den im Kampf getöteten Negern seien auch einige noch umgekommen, nachdem das Schiff aufgebracht und nachts vor Anker gelegt worden war; dies sei geschehen, während sie an den Ringbolzen auf Deck gefesselt waren, und zwar seien diese Tötungen von den Matrosen begangen worden, bevor man dagegen einschreiten konnte. Kapitän Amasa Delano habe, sowie er unterrichtet wurde, sogleich seine gesamte Autorität aufgeboten und insbesondere den Matrosen Martinez Gola mit eigener Hand niedergeschlagen, als dieser an einem der gefesselten Neger eine ihm gehörige alte Jacke und in deren Tasche ein Rasiermesser entdeckte und damit dem Neger den Hals durchschneiden wollte. Ebenso habe der edle Kapitän Amasa Delano dem Matrosen Bartholomeo Barlo einen Dolch entwunden, den dieser während des Gemetzels unter den Weißen verborgen gehalten hatte, und mit dem er nun einen gefesselten Neger erstechen wollte, welcher ihn damals an jenem Schreckenstag zusammen mit einem Komplizen niedergeworfen und mit Fußtritten mißhandelt hatte. – Im übrigen könne der Zeuge nicht über sämtliche Ereignisse während der langen Zeit, in der sich das Schiff in den Händen des Negers Babo befand, gleichmäßige Bekundungen machen. Jedoch sei das, was er bekundet hat, das Gegenständlichste von dem, wessen er sich im Augenblick entsinnt, und es stelle unter dem von ihm geleisteten Eid die Wahrheit dar. Des zum Zeichen er vorstehende Erklärung, nachdem sie ihm vorgelesen worden, gutgeheißen und ratifiziert hat.
Er gibt im übrigen an, daß sein Alter neunundzwanzig Jahre beträgt und daß er sich an Leib und Seele gebrochen fühlt. Nach seiner endgültigen Entlassung durchs Gericht werde er nicht nach Chile zurückkehren, sondern sich in das Kloster auf dem Berg Agonia unweit hiesiger Stadt verfügen. Er hat sodann auf Unterpfand seiner Ehre unterzeichnet, sich bekreuzigt und sich vorläufig so, wie er gekommen, in seiner Tragbahre mit dem Mönch Infelez zurückbegeben nach dem Spital der Ehrwürdigen Priester.
| Dr. Rozas | Benito Cereno |
Wenn obige Zeugenaussage als passender Schlüssel für das Schloß der vorhergegangenen Wirrnisse dienen kann, dann darf man das Innere der »San Dominick« wohl als ein Gewölbe bezeichnen, das nun, nachdem die Tür aufgestoßen ist, offen vor uns liegt.
Die Natur der vorliegenden Erzählung hat bisher nicht nur die am Anfang herrschenden Unklarheiten notwendig gemacht, sondern es auch mehr oder weniger zwingend erheischt, daß vieles nicht in der Reihenfolge des Geschehens, vielmehr in der Form der Rückschau und in unregelmäßiger Reihenfolge berichtet werden mußte. Dies ist auch der Fall mit folgendem Abschnitt, welcher unseren Bericht abschließen soll:
Während der langen, milden Überfahrt nach Lima gab es, wie schon kurz angedeutet, einen Zeitraum, in welchem der Leidende sich gesundheitlich ein wenig erholte oder doch wenigstens bis zu einem gewissen Grad die Ruhe seines Gemüts zurückgewann. Vor dem später eintretenden entscheidenden Rückfall hatten die beiden Kapitäne viele herzliche Unterhaltungen – ihr brüderlich aufgeschlossenes Wesen bildete einen seltsamen Gegensatz zu früher erlebter Zurückhaltung.
Immer und immer wieder kam dabei zur Sprache, wie schwer es gewesen sei, die dem Spanier von Babo aufgezwungene Rolle zu verkörpern.
»Ach, mein lieber Freund«, sagte Don Benito einmal, »zur selben Zeit, als Sie mich für ganz versauert und undankbar hielten, als Sie zugegebenermaßen halb und halb dachten, ich sänne auf Ihren Mord, da war mir das Herz wie erstarrt. Ich konnte Sie gar nicht anschauen, denn ich mußte denken, welches Unheil auf meinem Schiff wie auf Ihrem aus fremden Händen über meinem lieben Wohltäter hing. So wahr Gott lebt, Don Amasa, ich weiß nicht, ob die Sorge um meine eigene Sicherheit allein stark genug gewesen wäre, mich zu dem Sprung in Ihr Boot zu beflügeln, wenn ich mir nicht hätte sagen müssen, daß Sie, bester Freund, bei einer ungewarnten Rückkehr auf Ihr Schiff mit allen Ihren Gefährten schon in der nächsten Nacht in Ihren Hängematten meuchlings wären beschlichen worden und hätten nie wieder erwachen dürfen. Bedenken Sie doch nur, wie Sie hier übers Deck gewandert sind, wie Sie bei mir in der Kajüte gesessen haben, und jeder Zollbreit Fußboden unter Ihnen war wie eine Honigwabe ausgehöhlt. Hätte ich nur die leiseste Andeutung gemacht, hätte ich den geringsten Schritt zu einer Verständigung unternommen, dann hätte der Tod, und zwar ein wahrer Wirbelsturm von einem Tod, für Sie und für mich das Schauspiel beendet.«
»Richtig, richtig«, rief Kapitän Delano und sprang auf. »Sie haben mir das Leben gerettet, Don Benito, mehr als ich Ihnen. Sie haben es mir gerettet gegen mein Wissen und Wollen.«
»Nicht doch, mein Freund«, versetze der Spanier, höflich bis ins Religiöse hinein. »Gott hat Ihr Leben gefeit, Sie aber haben mir das Leben gerettet. Wenn ich so an manches denke, was Sie getan haben – an ein gewisses Lächeln und argloses Plaudern, an ein unbefangenes Herumgucken und Sicheinmischen! – viel, viel weniger hat mein Steuermann Raneds riskiert, und sie haben ihn dafür totgeschlagen! Aber Ihnen hatte der Himmelsfürst selber seinen Geleitbrief durch alle Hinterhalte gegeben!«
»Ich weiß: der Vorsehung gebührt aller Dank! Aber mein Gemüt war auch wirklich heiterer als sonst an jenem Morgen, und der Anblick von soviel Leiden, mehr scheinbarem als wirklichem Leiden, bestärkte mich noch in meiner Gutmütigkeit, meinem Mitleid und meiner Hilfsbereitschaft und hat diese drei aufs glücklichste ineinander verwoben. Wäre es anders gewesen, dann wäre es sicher gegangen, wie Sie andeuten: mein Dazwischentreten hätte irgendwann einmal zu einem unglücklichen Ende geführt. Es kommt noch eins dazu: der Gemütszustand, in dem ich war, hat mich instandgesetzt, vorübergehendes Mißtrauen zu überwinden, in einem Augenblick, wo mich kalter Scharfsinn vielleicht mein Leben gekostet hätte, ohne jemand anderem zu helfen. Erst ganz am Schluß hat mich der Argwohn übermannt, und Sie wissen, wie weit vom Ziel ich gerade damit gewesen bin!«
»Weit vom Ziel, das ist wahr«, sagte Don Benito traurig. »Sie hatten den ganzen Tag mit mir zugebracht. Sie hatten neben mir gestanden und mit mir zusammengesessen, sich mit mir unterhalten und mir in die Augen geblickt; Sie hatten mit mir gegessen und getrunken, und doch bestand Ihre letzte Handlung darin, daß Sie den für einen Unhold ansahen, der in Wirklichkeit nicht allein unschuldig, sondern der jammerwürdigste aller Menschen war. So weit können böse Machenschaften und Täuschungen einen irreführen. So weit kann selbst der Beste fehlgehen, wenn er das Verhalten eines Mitmenschen beurteilen soll, dessen Wesen er nicht bis in die heimlichsten Falten kennt. Aber man hat Sie ja zum Irrtum gezwungen, und die Täuschung ist rasch von Ihnen abgefallen. Wollte Gott, daß es in allen Fällen so wäre, daß es allen Menschen so ginge!«
»Sie verallgemeinern, Don Benito. Sie verallgemeinern auf eine recht melancholische Weise. Vergangenes ist vergangen – warum nachträgliche Betrachtungen darüber anstellen? Schlagen Sie es sich aus dem Kopf. Schauen Sie: die liebe Sonne hat schon alles wieder vergessen, auch die blaue See und der blaue Himmel – die haben längst ein neues Blatt aufgeschlagen.«
»Weil sie kein Gedächtnis haben«, lautete die trostlose Antwort, »weil sie nicht von Menschenart sind.«
»Und der Passat, der Ihnen so mild die Wange streichelt – hat er nicht doch etwas von Menschenart in seinem heilenden Hauch? Das ist schon ein warmer und beständiger Freund, der Passatwind!«
Und weht mich mit seiner Beständigkeit doch nur in mein Grab, Sennor«, erwiderte der andere ahnungsvoll.
»Aber Sie sind doch gerettet«, rief Kapitän Delano, mehr und mehr erstaunt und schmerzlich berührt. »Sie sind doch gerettet – was wirft einen solchen Schatten auf Sie?«
»Der Neger.«
Sie schwiegen, und der Zerquälte raffte langsam, mit unbewußter Gebärde, seinen Umhang enger um sich, als wäre es ein Leichentuch.
An jenem Tag besprachen sie sich nicht weiter.
Wenn es also vorkam, daß des Spaniers Trübsinn bei manchen Gesprächsgegenständen, wie dem eben geschilderten, zu völligem Verstummen führte, so gab es auch andere Punkte, zu denen er überhaupt nicht sprach. Hier schien seine frühere Zurückhaltung noch ganz ungebrochen. Vom Schlimmsten wollen wir nicht reden; nur der besseren Aufklärung halber sei der eine oder andere Punkt erwähnt. Das Gewand, jenes sorgfältige und kostbare Gewand, das er an dem Tag der hier berichteten Ereignisse getragen hatte, war nicht freiwillig von ihm angelegt worden. Auch der silberbeschlagene Degen, dieses vermeintliche Symbol seiner schrankenlosen Herrschaft, war in Wirklichkeit kein Degen, nur das Gespenst einer Waffe. Die Scheide, künstlich gesteift, war leer. Was den Schwarzen angeht, dessen Hirn (nicht etwa der Körper) den Aufstand angezettelt und geführt und die weiteren Pläne ersonnen hatte, so war seine zarte Gestalt dem nicht gewachsen, was in ihr umging, und im Boot war er denn auch sogleich zusammengeklappt unter der überlegenen Muskelkraft seines Bezwingers. Er sah, daß alles vorüber war, und nun gab er keinen Ton von sich, man mochte ihm zusetzen, wie man wollte. Seine Miene schien zu sagen: da mir die Tat verwehrt ist, will ich auch nicht sprechen. Wie die andern wurde er im Laderaum in Eisen gelegt und nach Lima gebracht. Don Benito besuchte ihn nicht während der Überfahrt. Er wollte ihn nicht wieder erblicken, nicht jetzt und nicht später. Auch vor Gericht weigerte er sich. Die Richter wollten es von ihm ertrotzen, da fiel er in Ohnmacht. Es blieb der Bekundung der Matrosen überlassen, daß Babos Identität gerichtlich festgestellt wurde. Einige Monate darauf erlebte der Schwarze, am Schwanz eines Maultiers zum Galgen geschleift, wortlos sein Ende. Den Leib verbrannte man zu Asche; der Kopf aber, dieser Bienenstock an Scharfsinn und List, ward an einer Stange befestigt und trotzte viele Tage lang auf der Plaza uneingeschüchtert den Blicken der Weißen; er blickte über die Plaza hin nach der Kirche des Heiligen Bartholomäus, in deren Krypta, wie heute noch, Arandas heimgekehrte Gebeine ruhten, und blickte weiter über die Rimacbücke nach dem Kloster draußen auf dem Berg Agonia, dem Kloster, wo drei Monate nach seiner Entlassung durchs Gericht Benito Cereno, auf der Totenbahre getragen, wahrlich, wie gesagt war, seinem Führer folgte.