
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Ich habe soeben ein Buch gelesen, das den Titel fuhrt: »Über die Vorurteile«. Während ich es prüfend las, fand ich zu meinem äußersten Erstaunen, daß es selber von Vorurteilen strotzt. Es ist ein Gemisch von Wahrheiten und falschen Vernunftschlüssen, von bitteren Kritiken und chimärischen Entwürfen, vorgetragen von einem fanatisch schwärmenden Philosophen. Um Ihnen genauen Einblick zu geben, werde ich mich genötigt sehen, bei einzelnem zu verweilen. Da ich jedoch nicht viel Zeit übrig habe, will ich mich auf etliche Bemerkungen über die Hauptsachen beschränken.
Im Werk eines Mannes, der auf jeder Seite den Philosophen betont, hoffte ich bestimmt, Weisheit und sehr folgerichtige Gedankengänge zu finden; ich bildete mir ein, da werde eitel Licht und Klarheit herrschen. Weit gefehlt! Der Autor stellt sich die Welt ungefähr so vor, wie Plato sich seine Republik ausdachte: empfänglich für Tugend, Glück und Vollkommenheit. Ich kann ihm versichern, daß die Welt, darin ich lebe, anders aussieht. Hier treten Gut und Böse überall vermischt auf, Leiblichkeit und Sittlichkeit haben gleichermaßen unter den Unvollkommenheiten, die sie kennzeichnen, zu leiden. Schulmeisterhaft bekräftigt er: die Wahrheit ist für den Menschen geschaffen, und man muß sie ihm bei jeder Gelegenheit sagen. Das verdient nachgeprüft zu werden. Ich stütze mich auf die Erfahrung und die Analogie, um ihm zu beweisen, daß die spekulativen Wahrheiten ganz und gar nicht für den Menschen geschaffen sind, daß sie sich vielmehr unaufhörlich seinem mühereichsten Suchen entziehen, Es ist für unsere Eigenliebe ein demütigendes Zugeständnis: die Macht der Wahrheit entreißt es mir.
Die Wahrheit liegt auf dem Grund eines Brunnens, die Philosophen arbeiten nach Kräften, sie von dort heraufzuholen. Alle Gelehrten klagen über die Anstrengungen, die es kostet, die Wahrheit zu entdecken. Wäre sie für den Menschen geschaffen, so würde sie sich von selbst seinen Augen darbieten. Ohne Mühen, ohne langes Nachdenken, ohne erst fehlzugreifen, würde er sie empfangen; ihre Augenscheinlichkeit würde jeden Irrtum siegreich überwinden und unfehlbar überzeugend wirken. An sicheren Merkmalen würde man sie vom Irrtum unterscheiden, der so oft uns täuscht, wenn er unter der geborgten Form des Wahren erscheint. Alle Vermutungen würden aufhören. Es gäbe nur noch Gewißheiten. Die Erfahrung aber lehrt mich ganz das Gegenteil: sie zeigt mir, daß kein Mensch frei von Irrtum ist; daß die größten Narrheiten, wie die Einbildungskraft sie nur im Fieberwahn gebären kann, zu allen Zeiten aus Philosophenhirnen hervorgingen; daß nur wenige philosophische Systeme ohne Vorurteile und falsche Schlüsse auskommen. Sie erinnert mich an die Wirbel, die Descartes ersann, an Newtons, des großen Newton Erläuterungen zur Apokalypse, an die prästabilierte Harmonie, die Leibniz erfand, ein Genie, das diesen großen Männern ebenbürtig ist. Überzeugt von der Ohnmacht des menschlichen Verstandes und erschüttert von den Irrtümern so berühmter Philosophen, rufe ich aus: O Eitelkeit der Eitelkeiten, Eitelkeit des philosophischen Geistes!
Die Erfahrung dehnt ihre Untersuchung noch weiter aus. Sie zeigt mir, daß durch alle Jahrhunderte hindurch der Mensch ein Sklave des Irrtums war, der religiöse Kult sich auf absurde Fabeln gründete und absonderliche Riten, lächerliche Feste, abergläubische Bräuche im Gefolge hatte, womit die Völker das Bestehen ihrer Macht verknüpften. Erfahrung lehrt uns, daß Vorurteile den Kult beherrschen, gleichwie sie die ganze Welt von einem Ende bis zum anderen regieren.
Forscht man nach den Ursachen dieser Irrtümer, so findet man, daß ihr Ursprung im Menschen selbst liegt. Die Vorurteile sind die Vernunft des Volkes; es hat einen unwiderstehlichen Hang zum Wunderbaren. Dazu kommt, daß der größte Teil der Menschheit, da er auf tägliche Arbeit angewiesen ist, in unüberwindliche Unwissenheit versunken hinlebt. Für Denken und Nachdenken hat er keine Zeit. Da sein Geist an vernunftmäßiges Denken nicht gewöhnt, sein Urteil nicht geschult ist, so kann er unmöglich die Dinge, über die er Klarheit wünscht, nach den Regeln einer gesunden Kritik untersuchen und ebensowenig einer Kette von Schlüssen folgen, wodurch man seine Irrtümer beiseite zu räumen vermöchte. Daher stammt seine Anhänglichkeit an den Kult, dem eine lange Gewöhnung Weihe verlieh; lediglich Gewalt kann ihn davon losreißen. Mit Gewalt haben denn auch jeweils die neuen Religionslehren die alten ausgerottet. Die Henker bekehrten die Heiden, und Karl der Große verkündete den Sachsen das Christentum mit Feuer und Schwert. So müßte auch unser Philosoph mit dem Schwert in der Hand den Völkern predigen, um sie aufzuklären. Indessen, da die Philosophie ihre Jünger sanft und tolerant macht, hoffe ich, er überlegt es sich noch, bevor er Waffen und Rüstung eines kriegerischen Bekehrers anlegt.
Die zweite Ursache des Aberglaubens liegt im Charakter der Menschen: in ihrer Neigung, ihrem starken Hang zu allem, was ihnen wunderbar erscheint. Jedermann spürt etwas davon in sich; unwillkürlich schenken wir den übernatürlichen Dingen, von denen wir hören, Aufmerksamkeit. Es scheint, das Wunderbare erhebt die Seele und adelt unser ganzes Wesen, indem es ein unermeßliches Gebiet erschließt, das den Kreis unserer Vorstellungen erweitert und unserer Phantasie freien Lauf läßt; denn mit Lust verliert sie sich in unbekannte Gefilde. Der Mensch liebt alles, was groß ist, was ihm Staunen oder Bewunderung erweckt. Majestätischer Pomp, eindrucksvolle Zeremonien packen ihn. Ein geheimnisvoller Kult verdoppelt seine Anteilnahme. Verkündet man ihm obendrein die unsichtbare Gegenwart einer Gottheit, so bemächtigt sich seines Gemüts ein ansteckender Aberglaube, setzt sich darinnen fest und wächst, bis er zum Fanatismus wird. Diese seltsamen Wirkungen sind die Folgen der Herrschaft, die des Menschen Sinne über ihn ausüben; denn er lebt mehr im Gefühl als im Verstand. Wir sehen also, daß die Mehrzahl der menschlichen Lehrmeinungen auf Vorurteile, Fabeln, Irrtum und Betrug gegründet ist. Was können wir anders daraus schließen, als daß der Mensch für den Irrtum geschaffen, der ganze Erdball dessen Herrschaft unterworfen ist und daß wir so blind wie die Maulwürfe sind? Der Autor muß daher, nach der Erfahrung aller Zeitalter, gestehen, daß die Welt von abergläubischen Vorurteilen, wie wir sahen, überschwemmt und die Wahrheit also für den Menschen nicht geschaffen ist.
Was aber wird nun aus seinem System werden? Ich bin daraufgefaßt, daß unser Philosoph mich hier unterbricht und mich ersucht, die spekulativen Wahrheiten nicht mit denen der Erfahrung zu verwechseln. Ich habe die Ehre, ihm darauf zu erwidern, daß es bei Lehrsätzen und beim Aberglauben auf spekulative Wahrheiten ankommt; und darum hat es sich gehandelt. Die Erfahrungswahrheiten beeinflussen bloß das bürgerliche Leben, und ich bin überzeugt, ein großer Philosoph wie unser Autor bildet sich nicht ein, er kläre die Menschheit auf, wenn er sie lehrt, daß man am Feuer sich verbrennt und im Wasser ertrinkt, daß man Nahrung zu sich nehmen muß, um das Leben zu erhalten, daß die menschliche Gesellschaft ohne die Tugend nicht bestehen kann, und andere Gemeinplätze mehr. Aber gehen wir weiter.
Der Autor sagt im Anfang seines Werkes, da die Wahrheit allen nützlich sei, müsse man sie ihnen kühn und rückhaltlos sagen. Im achten Kapitel wenn ich nicht irre, denn ich zitiere aus dem Gedächtnis – spricht er sich ganz anders aus. Da vertritt er die Meinung, die Notlügen seien erlaubt und nützlich. Er geruhe doch sich selber zu entscheiden, ob Wahrheit oder Lüge siegen soll, damit wir wissen, woran wir uns zu halten haben! Wenn ich es wagen darf, nach einem so großen Philosophen auch meine Meinung in die Wagschale zu werfen, so möchte ich raten, ein vernünftiger Mensch solle mit nichts, nicht einmal mit der Wahrheit, Mißbrauch treiben. Ich werde nicht ermangeln, mit Beispielen diese Meinung zu stützen.
Nehmen wir an, eine furchtsame und schreckhafte Frau befinde sich in Lebensgefahr. Wollte man ihr auf unbesonnene Weise die Gefahr, in der sie schwebt, kundgeben, so würde ihr Gemüt durch die Todesfurcht erregt, erschüttert, außer Fassung gebracht werden. Hierdurch würde eine allzu stürmische Bewegung sich dem Blut mitteilen und vielleicht den Ausgang noch beschleunigen. Ließe man ihr dagegen Hoffnungen auf Genesung, so könnte die Ruhe ihrer Seele vielleicht den übrigen Heilmitteln helfen, die Wiederherstellung wirklich zu vollbringen. Was kommt dabei heraus, wenn man einen Menschen aufklärt, den seine Illusionen glücklich machen? Es kann einem gehen wie jenem Arzt, der einen Geisteskranken geheilt hatte und sein Honorar dafür forderte. Jener entgegnete ihm, er gebe nichts; denn während seiner Umnachtung habe er im Paradies zu leben geglaubt und nun, da er seinen Verstand wiederhabe, sehe er sich in der Hölle. Hätten die römischen Senatoren bei der Nachricht, daß Varro die Schlacht bei Cannä verloren habe, auf dem Forum geschrien: »Römer, wir sind besiegt, Hannibal hat unsere Heere gänzlich geschlagen!« so hätten die unüberlegten Worte den Schrecken des Volkes dermaßen gesteigert, daß es, wie nach der Niederlage an der Allia, Rom verlassen hätte. Um die Republik wäre es geschehen gewesen. Der Senat war klüger, da er dieses Unglück geheim hielt. Er trieb das Volk wieder zur Verteidigung des Vaterlandes an, ergänzte das Heer, setzte den Krieg fort, und zu guter Letzt triumphierten die Römer über die Karthager. Es scheint also festzustehen, daß man die Wahrheit mit Zurückhaltung sagen muß: niemals dort, wo sie schaden könnte, und immer nur in gutgewählter Stunde.
Wenn ich den Autor überall, wo mir Ungenauigkeiten auffallen, in die Enge treiben wollte, so könnte ich ihn auch wegen seiner Definition des Wortes paradox angreifen. Er behauptet, das Wort bezeichne jede Meinung, die nicht anerkannt sei, aber zur Geltung gelangen könne; während das Wort doch nach gewöhnlichem Sprachgebrauch eine Meinung bedeutet, die irgendeiner Erfahrungswahrheit entgegengesetzt ist. Ich will mich bei dieser Kleinigkeit nicht aufhalten. Aber ich kann mich doch nicht enthalten, diejenigen, die den Namen eines Philosophen in Anspruch nehmen, zu erinnern, daß sie richtige Definitionen geben und jedes Wort nur in seinem üblichen Sinn anwenden sollen.
Ich komme nun zu dem Ziel, das der Verfasser anstrebt. Er verhehlt es nicht, er gibt vielmehr recht klar zu verstehen, daß er es auf den religiösen Aberglauben seines Landes abgesehen hat, daß er den Kult abschaffen möchte, um auf dessen Trümmer die Naturreligion zu erheben. Dabei will er eine Moral einführen, die von allem wesensfremden Beiwerk befreit ist. Seine Absichten muten uns rein an: er will nicht, daß das Volk durch Fabeln irregeführt werde und daß die Betrüger, die diese verschleißen, allen Gewinn daraus ziehen, gleichwie die Quacksalber aus den Arzneien, die sie verkaufen. Diese Betrüger sollen nicht die einfältige Menge beherrschen, nicht weiterhin sich der Macht erfreuen, die sie mißbräuchlich gegen Fürst und Staat ausspielen. Er will, mit einem Wort, den herrschenden Kult aus dem Weg räumen, der Masse die Augen öffnen und ihr helfen, das Joch des Aberglaubens abzuschütteln. Der Entwurf ist groß; fragt sich nur, ob er auch ausführbar und der Autor richtig vorgegangen ist, um ihn durchsetzen zu können.
Wer die Welt gründlich studiert und das menschliche Herz erforscht hat, wird die Unternehmung für unausführbar halten. Alles stellt sich ihr entgegen: die Halsstarrigkeit, womit die Menschen an ihren gewohnten Anschauungen hangen, ihre Unwissenheit und Urteilsunfähigkeit, ihre Neigung zum Wunderbaren, die Macht des Klerus und die Mittel, die ihm für seine Selbstbehauptung zur Verfügung stehen. Nach alledem muß man bei einer Bevölkerung von sechzehn Millionen, wie man sie in Frankreich zählt, auf die Bekehrung von fünfzehn Millionen achthunderttausend Seelen verzichten, weil in ihren Meinungen unüberwindliche Hemmungen liegen. Für die Philosophie bleiben also zweihunderttausend. Das ist schon viel. Ich möchte es niemals auf mich nehmen, einer so großen Anzahl dieselbe Gedankenrichtung zu geben, einer Vielheit, die an Verständnis, Geist, Urteil, Anschauungsweise genau so verschieden ist wie an kennzeichnenden Gesichtszügen. Nehmen wir ruhig an, die zweihunderttausend Proselyten hätten dieselbe Ausbildung empfangen; darum wird jeder doch seine Eigengedanken, seine Sonderansichten haben, und am Ende werden unter all den vielen nicht zwei zu finden sein, die dasselbe denken. Ich gehe noch weiter. Ich möchte beinahe versichern, daß in einem Staat, wo alle Vorurteile ausgerottet wären, keine dreißig Jahre vergehen würden, ohne daß man neue aufkommen sähe; worauf die Irrtümer sich mit Geschwindigkeit ausbreiten und das Ganze wieder überschwemmen würden. Wer sich an die Phantasie der Menschen wendet, wird allemal den besiegen, der auf ihren Verstand einwirken will. Kurz, ich habe bewiesen, daß jederzeit der Irrtum in der Welt geherrscht hat. Und da eine so feststehende Erscheinung als allgemeines Naturgesetz angesehen werden darf, schließe ich, daß das ewig Dagewesene auch ewig da sein wird.
Indessen, ich muß dem Autor Gerechtigkeit widerfahren lassen, wo sie ihm gebührt. Nicht Gewalt beabsichtigt er anzuwenden, um der Wahrheit Jünger zuzuführen. Er gibt zu verstehen, daß er sich darauf beschränke, den Geistlichen den Unterricht der Jugend, von dem sie Besitz ergriffen haben, zu entziehen, um Philosophen damit zu betrauen. Das würde die Jugend vor den religiösen Vorurteilen bewahren und behüten, mit denen sie bisher durch die Schulen von klein auf angekränkelt wurden. Ich bin jedoch so frei, ihm entgegenzuhalten, daß er, selbst wenn er dies Unternehmen durchzuführen vermöchte, eine Enttäuschung erleben würde. Ich berufe mich dafür auf ein Beispiel, das in Frankreich, fast unter seinen Augen, sich zuträgt. Den Calvinisten ist dort der Zwang auferlegt, ihre Kinder in die katholischen Schulen zu schicken: da betrachte er, wie die Väter den Kindern bei ihrer Heimkehr vorpredigen, wie sie ihnen den Katechismus Calvins abhören und welchen Abscheu sie ihnen vor dem Papsttum einflößen. Das ist eine bekannte Tatsache, und es ist des weiteren einleuchtend, daß es ohne die Beharrlichkeit dieser Familienhäupter längst keine Hugenotten mehr in Frankreich geben würde. Ein Philosoph kann sich gegen eine solche Bedrückung der Protestanten auflehnen, aber er darf nicht selber dem Beispiel folgen; denn es bedeutet Gewalttätigkeit, wenn den Vätern die Freiheit genommen wird, ihre Kinder nach ihrem Willen zu erziehen. Es würde auch Gewalttätigkeit bedeuten, wenn die Kinder zur Schule der Naturreligion geschickt würden, während die Väter wünschten, daß sie katholisch seien wie sie selbst.
Ein Philosoph, der zum Verfolger würde, wäre in den Augen des Weisen ein Monstrum. Mäßigung, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Duldsamkeit: das sind die Tugenden, die ihn kennzeichnen sollen. Seine Grundsätze müssen unwandelbar bleiben, seine Worte, Entwürfe, Handlungen müssen seinen Grundsätzen entsprechen.
Gönnen wir dem Verfasser seine Begeisterung für die Wahrheit und bewundern wir die Geschicklichkeit, mit der er seine Ziele zu erreichen sucht. Wir haben gesehen, daß er einen mächtigen Gegner angreift: die herrschende Religion, den Priester, der sie verteidigt, und das abergläubische Volk, das unter ihren Fahnen steht. Aber als habe er an einem so furchtbaren Feind nicht genug für seinen Mut, erweckt er sich noch einen anderen, um seinen Triumph zu steigern, seinen Sieg glorreicher zu machen. Er unternimmt einen nachdrücklichen Ausfall gegen die Regierung und beleidigt sie ebenso grob wie unziemlich. Die Mißachtung, die er dabei an den Tag legt, empört jeden vernünftigen Leser.
Vielleicht wäre die Regierung neutral geblieben, eine friedliche Zuschauerin der Schlachten, die unser Held der Wahrheit den Aposteln der Lüge lieferte; aber er selbst zwingt sie, für die Kirche Partei zu ergreifen wider den gemeinsamen Feind. Wenn wir den großen Philosophen nicht achteten, hätten wir diesen Angriff für den Streich eines leichtfertigen Schulbuben gehalten, wofür er strenge Bestrafung durch seine Lehrer verdiente.
Kann man denn sein Vaterland nur fördern, wenn man es um und um kehrt und alle bestehende Ordnung über den Haufen wirft? Gibt es nicht mildere Mittel, die man lieber anwenden sollte, um dem Vaterland mit Nutzen zu dienen? Unser Philosoph, scheint mir, hält es mit jenen Ärzten, die kein Heilmittel als das Brechmittel kennen, mit jenen Chirurgen, die sich nur auf Amputationen verstehen. Wenn ein Weiser über den Schaden nachdenkt, den die Kirche seinem Land verursacht, wird er sich ohne Zweifel Mühe geben, es von dem Übel zu befreien; aber er wird mit Vorsicht zu Werke gehen. Anstatt das alte gotische Gebäude einfach niederzureißen, wird er sich mühen, die Fehler zu beseitigen, die es entstellen.
Er wird die abgeschmackten Fabeln entkräften, die der Dummheit der Masse zum Futter dienen. Er wird sich gegen Absolution und Ablässe auflehnen, die nur ein Ansporn zum Verbrechen sind, weil sie dem Bußfertigen die Sühne zu leicht machen und seine Gewissensbisse zu mühelos beschwichtigen. Er wird zu Felde ziehen gegen all die Ausgleichsmittel, die von der Kirche eingeführt wurden, um die größten Missetaten zu tilgen, gegen die geistlichen Exerzitien, die kindlichen Mummenschanz an die Stelle wirklicher Tugenden setzen. Er wird seine Stimme erheben wider die Ansammlungen von Nichtstuern, die vom arbeitsamen Teil der Nation lebten, wider diese Menge von Mönchen, die den Naturtrieb unterdrücken und so ihr möglichstes zum Niedergang der Menschheit beitragen. Den Herrscher wird er anfeuern, die unermeßliche Macht, die das Priestertum sträflich gegen sein Volk und gegen ihn selbst anwendet, einzuschränken, dem Klerus jeden Einfluß auf die Regierung zu nehmen und ihn denselben Gerichten zu unterwerfen, die über die Laien urteilen. Durch dieses Mittel würde die Religion ein für Sitten und Regierung gleichgültiger Gegenstand theoretischer Betrachtung werden, der Aberglaube würde nachlassen, und die Toleranz würde von Tag zu Tag an Herrschaft über die Welt gewinnen.
Kommen wir nun zu dem Abschnitt, worin der Verfasser die Politik behandelt. Welche Umwege er auch einschlagen mag, um den Schein zu erwecken, als betrachte er die Dinge nur unter allgemeinen Gesichtspunkten, man merkt doch, daß er immer Frankreich vor Augen hat und über die Grenzen seines Vaterlandes nicht hinausschreitet. Seine Darlegungen, seine Kritik, alles bezieht sich auf Frankreich, alles hängt damit zusammen. Nur in Frankreich werden die richterlichen Ämter verkauft; kein Staat hat so viel Schulden wie dieser; nirgends schreit man so laut gegen die Steuern. Man lese nur die Vorstellungen der Parlamente gegen gewisse Steueredikte und zahlreiche Broschüren über denselben Gegenstand. Das Wesentliche der Klagen gegen die Regierung ist auf kein anderes Land Europas anwendbar als auf Frankreich. Nur dort werden die Staatseinkünfte durch Steuerpächter erhoben. Die englischen Philosophen beklagen sich nicht über ihren Klerus. Von spanischen, portugiesischen, österreichischen Philosophen habe ich bisher nicht reden hören. Nur in Frankreich können also die Philosophen über die Priester klagen. Kurz, alles weist auf des Verfassers Vaterland hin, und es würde ihm schwer, wo nicht unmöglich werden, zu leugnen, daß seine Hiebe sich unmittelbar gegen Frankreich richten.
Indessen, er hat Augenblicke, wo sein Zorn sich legt und sein beruhigter Geist ihm erlaubt, seine Schlüsse mit besserer Einsicht zu ziehen. Wenn er behauptet, es sei die Pflicht des Fürsten, seine Untertanen glücklich zu machen, so ist das eine alte Wahrheit, die jedermann mit ihm anerkennen wird. Wenn er betont, Unwissenheit und Trägheit der Herrscher seien verhängnisvoll für ihre Völker, so wird man ihm versichern, daß das die Überzeugung aller ist. Wenn er hinzufügt, das Interesse der Monarchen sei untrennbar verknüpft mit dem der Untertanen und ihr Ruhm bestehe darin, über eine glückliche Nation zu herrschen, so wird ihm niemand die augenscheinliche Nichtigkeit dieser Meinung bestreiten. Verleumdet er aber mit heftiger Erbitterung und Ausfällen ätzendster Satire seinen König und die Regierung seines Landes, so sieht man ihn für einen Verrückten an, der, seinen Fesseln entronnen, sich den wildesten Ausbrüchen seiner Wut hingibt.
Wie, Herr Philosoph, Sie Schützer der Sitten und der Tugend, wissen Sie nicht, daß ein guter Bürger die Regierungsform, unter der er lebt, achten soll? Wissen Sie nicht, daß es einem Bürger nicht zukommt, die Machthaber zu beschimpfen, daß man weder seine Mitbürger noch seinen Herrscher noch sonst jemand verleumden darf, und daß ein Autor, der seine Feder zu solchen Ausschreitungen hergibt, nicht Weiser noch Philosoph ist?
Nichts verbindet mich persönlich mit dem Allerchristlichsten König; ich hätte vielleicht ebensoviel Grund, mich über ihn zu beklagen wie irgendein anderer. Aber die Entrüstung über die Schmähungen, die der Verfasser gegen ihn ausgespien hat, und vor allem die Liebe zur Wahrheit, die stärker als jede Erwägung ist, zwingen mich, Beschuldigungen zu widerlegen, die so falsch wie empörend sind.
Hier die Hauptanklagepunkte:
Der Verfasser beschwert sich darüber, daß die vornehmsten Häuser Frankreichs allein im Besitz der ersten Würden seien; daß das Verdienst nicht ausgezeichnet werde; daß man den Klerus ehre und die Philosophen mißachte; daß der Ehrgeiz des Herrschers ohne Unterlaß neue aufreibende Kriege entzünde; daß einzig die gedungenen Henker – mit diesem geschmackvollen Epitheton ehrt er die Soldaten – Belohnungen und Auszeichnungen genießen; daß die Richterstellen käuflich seien, die Gesetze schlecht, die Steuern maßlos, die Bedrückung unerträglich und die Erziehung der Fürsten ebenso verständnislos wie tadelnswert.
Hier meine Antwort:
Das Wohl des Staates fordert, daß der Fürst die bedeutenden Dienste, die der Regierung geleistet werden, anerkennt. Wenn er seine Dankbarkeit bis auf die Nachkommen derer ausdehnt, die sich um das Vaterland verdient gemacht haben, so ist das die größte Ermutigung, die er den Talenten und der Tüchtigkeit geben kann. Familien auszeichnen, die durch die trefflichen Taten ihrer Vorfahren emporgekommen sind, heißt das nicht: alle anspornen, daß sie dem Staate gute Dienste leisten, um die Nachkommen im Genusse ähnlicher Vergünstigungen hinterlassen zu können? Bei den Römern schon galt der Patrizierstand mehr als der Plebejer- und der Ritterstand. Nur in der Türkei sind die Stände vermengt, und es geht ihr darum nicht etwa besser. In allen Staaten Europas genießt der Adel dieselben Vorrechte. Die Bürgerlichen bahnen sich zuweilen den Weg zu den bevorzugten Stellen, wenn Genie, Talente und Leistungen sie adeln. Dieses Vorurteil aber, wenn man es so nennen will, dieses (wie ich betonen möchte) allgemein anerkannte Vorurteil würde es sogar dem König von Frankreich verwehren, einen Bürgerlichen als Gesandten an bestimmte fremde Höfe zu schicken.
Wo die Rechte der Geburt nicht anerkannt werden, lebt nicht philosophische Freiheit, sondern kleinbürgerliche und lächerliche Eitelkeit.
Der Verfasser klagt weiter, in Frankreich zeichne man das persönliche Verdienst nicht aus. Ich bekenne mich zu dem Argwohn, daß ein Minister ihm gegenüber in einer persönlichen Angelegenheit etwas versehen hat. Vielleicht lud er die Schuld auf sich, ihm irgendeine Pension abzuschlagen oder diesen hochweisen Lehrmeister der Menschheit in seiner Dachkammer nicht zu entdecken, wiewohl er so würdig ist, dem Minister in seinen politischen Geschäften beizustehen – was sage ich? ihn anzuleiten vielmehr!
Sie behaupten, Herr Philosoph, daß die Könige sich in der Wahl ihrer Diener oftmals täuschen. Nichts ist wahrer; die Gründe lassen sich leicht finden: auch die Könige sind eben Menschen, dem Irrtum unterworfen wie die anderen. Wer nach hohem Amte trachtet, tritt ihnen niemals anders gegenüber als mit der Maske vor dem Gesicht. Ohne Zweifel kommt es vor, daß die Könige sich irreführen lassen. Die Schliche, Ränke und Kabalen der Höflinge können gelegentlich obsiegen. Wenn aber ihre Wahl nicht immer glücklich ist, so soll man nicht sie allein anklagen. Das wahre Verdienst und die Männer von überlegenen Geistesgaben sind allenthalben viel seltener, als so ein übersinnlicher Träumer sich einbildet. Er hat ja nur theoretische Vorstellungen von der Welt des Staatsmanns, die er niemals kennen lernte. Das Verdienst wird nicht belohnt: die Klage hört man in jedem Land. Und jeder anmaßende Kerl kann sagen: Ich habe geniale Fähigkeiten; die Regierung läßt mir keine Auszeichnung zuteil werden; folglich fehlt es ihr an Weisheit, Urteil und Gerechtigkeit.
Unser Philosoph gerät sodann in den Harnisch, da er einen Gegenstand behandelt, der ihn näher angeht. Er scheint äußerst empört zu sein, weil man in seinem Vaterland die Apostel der Lüge denen der Wahrheit vorzieht. Er wird gebeten, doch nur ein paar flüchtige Erwägungen anzustellen, die vielleicht seines ungestümen Genies unwürdig, immerhin aber geeignet sind, seinen Zorn zu besänftigen. Er möge sich einmal vergegenwärtigen, daß der Klerus eine beträchtliche Körperschaft im Staate bildet, während die Philosophen vereinzelte Privatleute sind. Er erinnere sich gefälligst, daß er selbst gesagt hat, der Klerus sei durch die Autorität, die er über das Volk zu gewinnen wußte, mächtig geworden, habe sich dadurch dem Herrscher furchtbar gemacht und müsse nun auf Grund seiner Macht schonend behandelt werden. Die Natur der Dinge bringt es also mit sich, daß der Klerus sich ausgeprägterer Vorrechte und Auszeichnungen erfreut, als man sie gemeiniglich denen zubilligt, die von Standes wegen auf allen Ehrgeiz verzichten und, erhaben über die menschlichen Eitelkeiten, alles verachten, was der Haufe mit so viel Eifer begehrt.
Weiß unser Philosoph nicht, daß der Aberglaube des Volkes den Monarchen auf dem Thron in Ketten schlägt? Das Volk selbst zwingt ihn, Rücksicht auf diese widerspenstigen und aufruhrbrütenden Priester zu nehmen, auf diesen Klerus, der einen Staat im Staate errichten will und nicht davor zurückschreckt, Vorgänge von solcher Tragik heraufzubeschwören, wie sie dem Leben Heinrichs III. und des guten Königs Heinrich IV. ein Ende setzten. Der Fürst darf nur mit feinfühlig geschickter Hand an den bestehenden Kult rühren. Will er sich an das Gebäude des Aberglaubens machen, so muß er es zu untergraben suchen; es hieße allzuviel wagen, wenn er an ein offenkundiges Niederreißen ginge. Begibt es sich gelegentlich, daß Philosophen über das Regierungswesen schreiben, ohne Fachkenntnisse und Weitblick zu zeigen, so sehen die Politiker mitleidig auf sie herab und verweisen sie auf die Anfangsgründe ihrer Wissenschaft. Theoretische Spekulationen verdienen kein Vertrauen; sie halten die Feuerprobe der Erfahrung nicht aus. Die Regierungskunde ist eine Wissenschaft für sich; wer da fachgerecht mitsprechen will, muß ein langes Studium hinter sich haben. Sonst gerät man auf Irrwege oder empfiehlt Arzneien, die schlimmer sind als das Leiden, worüber man klagt.
Noch eine Standrede gegen den Ehrgeiz der Fürsten! Unser Autor ist außer sich: er klagt die Herrscher an, sie seien die Schlächter ihrer Völker, sie schickten sie als Schlachtopfer in den Krieg, um sich die Langeweile zu vertreiben.
Ohne Zweifel hat es ungerechte Kriege gegeben, Blut ist geflossen, das man hätte sparen sollen und können. Nichtsdestoweniger gibt es mehrere Fälle, in denen der Krieg nötig, unvermeidlich und gerecht ist. Ein Fürst muß seine Verbündeten verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Die Selbsterhaltung nötigt ihn, mit bewaffneter Hand das Gleichgewicht zwischen den Mächten Europas zu erhalten. Seine Pflicht ist es, die Untertanen vor feindlichen Einfällen zu schützen. Er ist durchaus befugt, für seine Rechte einzutreten, für eine Erbschaft, die angefochten wird, oder für ähnliche Streitfragen, und zwar indem er die Unbill, die man ihm antut, mit Gewalt zurückweist.
Welchen Schiedsrichter haben denn die Herrscher? Wer will ihr Richter sein? Da sie denn für ihre Rechtsstreitigkeiten kein Gericht finden, das mächtig genug wäre, das Urteil zu fällen und zu vollziehen, so kehren sie unter das Naturrecht zurück, und Gewalt muß die Entscheidung übernehmen. Gegen solche Kriege Geschrei erheben, die kriegführenden Herrscher schmähen, das heißt, mehr Haß gegen die Könige an den Tag legen als Mitleid und Menschlichkeit gegen die Völker, die mittelbar unter den Kriegen leiden. Würde unser Philosoph wohl mit einem Herrscher einverstanden sein, der sich feige seiner Staaten berauben ließe, der Ehre, Interesse und Ruhm seiner Nation dem Gelüst der Nachbarn preisgäbe und durch unnützes Mühen um Erhaltung des Friedens sich selbst, seinen Staat und sein Volk zugrunde richtete? Mark Aurel, Trajan, Julian lagen beständig im Krieg, und doch spenden die Philosophen ihnen Lob. Warum tadeln sie also die modernen Herrscher, die hierin dem Beispiel der alten folgen?
Merken Sie sich, Sie Feind der Könige, moderner Brutus, merken Sie sich, daß die Könige nicht die einzigen sind, die Krieg führen. Die Republiken haben jederzeit ein gleiches getan. Wissen Sie nicht, daß die Griechenrepubliken mit ihren unaufhörlichen Zwistigkeiten fortwährend von Bürgerkriegen heimgesucht wurden? Ihre Annalen umfassen eine ununterbrochene Folge von Kämpfen: gegen die Mazedonier, die Perser, Karthager, Römer, bis zur Zeit, da der Ätolische Bund ihren Untergang beschleunigte. Wissen Sie nicht, daß keine Monarchie kriegerischer war als die römische Republik? Um all ihre Waffentaten Ihnen vor Augen zu führen, müßte ich die Geschichte der Republik Rom vom einen Ende bis zum anderen wiedergeben.
Gehen wir zu den modernen Republiken über. Die venezianische hat gegen die genuesische gekämpft, gegen die Türken, den Papst, die Kaiser und gegen Ihren Ludwig XII. Die Schweizer haben Kriege mit dem Haus Osterreich und mit Karl dem Kühnen, dem Herzog von Burgund, ausgefochten. Und sind sie nicht – um mich Ihres feinen Ausdrucks zu bedienen – schlimmere Schlächter als die Könige: verkaufen sie nicht ihre Mitbürger zum Dienst bei Fürsten, die im Kampf stehen? Von England, das ja auch eine Republik ist, sage ich nichts; Sie wissen es aus Erfahrung, ob England Kriege führt und wie es sie führt. Die Holländer haben sich seit der Begründung ihrer Republik in alle Wirren Europas gemischt. Schweden hat seinerzeit, solange es Republik war, verhältnismäßig ebensoviel Kriege unternommen wie unter der Monarchie. Was Polen betrifft, so frage ich Sie nur, was gegenwärtig dort vorgeht, was in unserem Jahrhundert dort schon vorgegangen ist, und ob Sie glauben, daß das Land ewigen Frieden genieße? Alle Regierungsformen Europas und der ganzen Erde, die Quäker ausgenommen, sind demnach, wenn es auf Ihre Grundsätze ankommt, tyrannisch und barbarisch. Warum also beschuldigen Sie einzig die Monarchien dessen, was sie doch mit den Republiken gemeinsam haben?
Sie ereifern sich gegen den Krieg. Er ist an sich schreckensvoll, aber doch nur ein Übel, wie die anderen Geißeln Gottes, von denen man wohl annehmen muß, daß sie innerhalb der Weltordnung notwendig sind, da sie periodisch auftreten und bis jetzt noch kein Jahrhundert sich rühmen konnte, frei von ihnen geblieben zu sein. Wenn Sie den ewigen Frieden herstellen wollen, so müssen Sie sich in eine Idealwelt begeben, wo das Mein und Dein unbekannt ist, wo Fürsten, Minister und Untertanen allesamt leidenschaftslos sind und jedermann der Vernunft gehorcht. Oder schließen Sie sich den Plänen des verstorbenen Abbé Saint-Pierre an. Oder aber, wenn das Ihnen zuwider ist, weil er Priester war, so lassen Sie doch den Dingen ihren Lauf; denn in dieser Welt müssen Sie darauf gefaßt sein, daß es Kriege geben wird, wie es immer Kriege gegeben hat, soweit unsere Überlieferung zurückreicht.
Sehen wir nun zu, ob Ihre stark aufgetragenen Anklagen wider die französische Staatsleitung, die so haltlos erscheinen, vielleicht doch irgendeine Grundlage haben. Sie beschuldigen Ludwig XV. – indem Sie ihn kenntlich machen, ohne ihn zu nennen –, er habe nur ungerechte Kriege unternommen. Denken Sie nicht, es genüge, derartige Sachen mit unverschämter Frechheit vorzubringen; sie wollen auch bewiesen sein. Oder Sie werden, so sehr Sie als Philosoph erscheinen möchten, nur für einen großartigen Verleumder gehalten werden. Prüfen wir denn die Akten des Rechtsstreites, suchen wir zu beurteilen, ob die Gründe, die Ludwig XV. zu seinen Kriegen bestimmten, schlecht oder stichhaltig waren.
Der erste Krieg, der in Frage kommt, ist der von 1733. Ludwigs Schwiegervater wird zum König von Polen erwählt. Kaiser Karl VI. widersetzt sich, im Bund mit Rußland, dieser Wahl. Da der König von Frankreich dem russischen Reich nicht zu Leibe kann, greift er Karl VI. an, um die Rechte seines zweimal auf denselben Thron erhobenen Schwiegervaters zu unterstützen. Und da er in Polen nicht die Oberhand zu gewinnen vermag, verschafft er dem König Stanislaus zur Entschädigung Lothringen. Soll man nun einen Schwiegersohn verurteilen, der seinem Schwiegervater beisteht, einen König, der das Wahlrecht einer freien Nation schützt, einen Fürsten, der fremde Mächte hindert, sich das Recht zum Verschenken von Königreichen anzumaßen? Sofern man sich nicht von Erbitterung und unversöhnlichem Haß hinreißen läßt, ist es bis hierher unmöglich, das Verhalten dieses Fürsten zu tadeln.
Der zweite Krieg begann im Jahre 1741. Er wurde um die Erbschaft des Hauses Österreich geführt, dessen letzter männlicher Sproß, Kaiser Karl VI., eben gestorben war. Es ist sicher, daß die berühmte Pragmatische Sanktion, worauf Karl VI. seine Hoffnungen setzte, weder den Erbrechten der Häuser Bayern und Sachsen noch den Ansprüchen, die das Haus Brandenburg auf einige Herzogtümer Schlesiens erhob, im mindesten Abbruch tun konnte. Zu Beginn dieses Krieges war es höchst wahrscheinlich, daß ein französisches Heer, das damals nach Deutschland entsandt wurde, König Ludwig XV. zum Schiedsrichter über die miteinander streitenden Fürsten machen und sie zwingen würde, sich nach dem Willen Ludwigs gütlich über die Erbschaft zu einigen. Ganz gewiß konnte Frankreich nach der Rolle, die es beim Westfälischen Frieden gespielt hatte, keine schönere und größere als diese neue spielen. Aber Mißgeschick und allerlei Ereignisse trafen zusammen, um diese Pläne zu vereiteln. Muß man nun Ludwig XV. verdammen, weil ein Teil des Krieges unglücklich verlief? Darf ein Philosoph einen Entwurf nach seinem Ausgang beurteilen?
Allein es ist leichter, aufs Geratewohl Beleidigungen auszusprechen als zu prüfen und zu erwägen, was man sagen will. Siehe da! Der Mann, der sich im Anfang seines Werkes als eifernden Verfechter der Wahrheit ausgibt, ist also nur ein gemeiner Aufschneider, der mit seiner Bosheit die Lüge verbindet, um die Herrscher zu beschimpfen!
Ich komme zum Krieg von 1756. Der Verfasser der »Vorurteile« muß selber gar viele Vorurteile und viel Erbitterung gegen sein Vaterland hegen, wenn er nicht ehrlich zugibt, daß England damals Frankreich gezwungen hat, die Waffen zu ergreifen. Wie soll man in dem blutdürstig barbarischen Tyrannen, den Sie uns in so düsteren Farben malen, den friedlichen Ludwig XV. wiedererkennen, der mit engelgleicher Geduld und Mäßigung verfuhr, bevor er sich gegen England erklärte? Was kann man ihm vorwerfen? Will man behaupten, er hätte sich nicht verteidigen dürfen? Mein Freund, entweder bist du ein Nichtswisser oder ein Hirnverbrannter oder ein großartiger Verleumder. Ein Philosoph aber bist du nicht.
Soviel über die Herrscher. Man braucht nun durchaus nicht zu glauben, der Verfasser behandle die anderen Stände besser. Alle dienen sie ihm als Zielscheibe seines Hohns. Mit welch schmählicher Verachtung aber, wie abscheulich behandelt er die Kriegsleute! Wenn man ihn hört, muß man glauben, sie seien der niedrigste Auswurf der menschlichen Gesellschaft. Noch vergeblich sucht sein Philosophenstolz ihr Verdienst zu verkleinern; die Notwendigkeit, sich zu verteidigen, wird immer dafür sorgen daß Kriegerwert gewürdigt wird. Wollen wir aber dulden, daß ein hirnverbrannter Kopf den vornehmsten Beruf der Staatsgemeinschaft schmäht, den Beruf, die Mitbürger zu schützen?
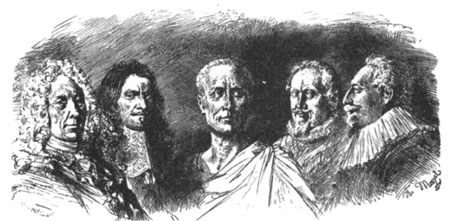
Brustbilder der als Meister des Krieges gepriesenen Feldherren: in der Mitte Cäsar, links Turenne und Prinz Eugen, rechts Prinz Moritz von Oranien und König Gustav Adolf von Schweden.
O Scipio, der du Rom aus den Händen Hannibals errettetest und Karthago niederwarfst; Gustav, großer Gustav, Schützer der germanischen Freiheit; Turenne, Schild und Schwert deines Vaterlandes; Marlborough, dessen Arm Europa im Gleichgewicht erhielt; Eugen, du Hort und Ruhm Österreichs; Moritz, du letzter Held Frankreichs! Befreit euch, erlauchte Schatten, aus dem Kerker des Todes, aus den Fesseln des Grabes! Wie werdet ihr mit Staunen vernehmen, daß man in diesem Jahrhundert der Paradoxen eure Arbeit schmäht, eure Taten, die euch mit Fug und Recht die Unsterblichkeit eintrugen! Werdet ihr eure Nachfolger unter dem geschmackvollen Namen gedungener Henker erkennen, den die Sophisten ihnen geben? Was werdet ihr sagen, wenn ihr einen Cyniker, der unverschämter als Diogenes ist, aus dem Hintergrund seiner Tonne kläffen hört wider eure leuchtende Ehre, deren Glanz ihn ärgert? Aber was vermag dieses ohnmächtige Gekreisch gegen eure ruhmumstrahlten Namen und gegen die gerechte Huldigung jedes Zeitalters, die ihr fort und fort erntet?
Die ihr in den Spuren dieser echten Helden wandelt, fahret fort, ihren Tugenden nachzustreben, und verachtet das nichtige Gezeter eines unsinnigen Sophisten, der sich Apostel der Wahrheit nennt, aber nur Lügen, Verleumdungen und Schimpferei vorbringt!
Nichtswürdiger Phrasenmacher, muß man dich lehren, daß die Künste nur unter dem Schutz der Waffen friedlich gedeihen? Hast du während der Kriege, die du erlebtest, nicht gesehen, daß, solange der furchtlose Soldat über die Grenzen wacht, der Landmann darauf rechnet, die Früchte seiner Arbeit in reichen Ernten einzusammeln? Weißt du nicht, daß der Kaufmann ungestört fortfahren kann, sein Geschäft zu treiben, solange der Krieger zu Land und zur See bereit ist, den Tod zu geben oder zu empfangen? Bist du so stumpfsinnig, daß du nicht merktest, wie du in deiner Kammer all das Flickwerk, all die Albernheiten, Frechheiten und Dummheiten, die du uns versetzt hast, ruhig ausdenken konntest, während die Feldherren und Offiziere, die deine Feder so unwürdig behandelt, den Unbilden der Witterung trotzten und sich den härtesten Strapazen aussetzten? Wie! Soll es von dir heißen, daß du alle Begriffe verwirrst? Und beanspruchst du, durch grobe Sophismen die klugen Maßnahmen weiser und weitblickender Regierungen fragwürdig zu machen? Muß man in unserem Jahrhundert noch beweisen, daß ein Reich ohne die Verteidigung durch tapfere Soldaten dem ersten besten, der zugreift, zur Beute würde?
Ja, mein sogenannter Herr Philosoph, Frankreich unterhält große Heere. Darum hat es auch die Zeiten der Unruhe und der Verwirrung hinter sich, in denen es von Bürgerkriegen zerrissen wurde, verhängnisvoller und grausamer, als es durch auswärtige Kriege geschehen könnte.
Aber was hätten Sie wohl gesagt, wenn es sich im Verlauf des letzten Krieges begeben hätte, daß die Engländer bis zu den Toren von Paris vorgedrungen wären? Wie ungestüm wären Sie da nicht über die Regierung hergefallen, die so übel für die Sicherheit des Landes und der Hauptstadt vorgesorgt hätte! Und Sie hätten recht gehabt. Warum also, Mann der Inkonsequenz, von deinen Träumen Berauschter, suchst du die wahren Säulen des Staates, das ehrenwerte Militär, in den Augen eines Volkes, das ihm höchsten Dank schuldet, zu beschimpfen und zu erniedrigen? Wie! Die kühnen Verteidiger, die ihr Leben hingeben, die Opfer des Vaterlandes, die beneidest du um die Ehren und Auszeichnungen, deren sie so ganz mit Recht genießen! Mit ihrem Blut haben sie die Vorteile bezahlt, mit dem Einsatz ihrer Ruhe, ihrer Gesundheit, ihres Lebens sie erworben. Nichtswürdiger Sterblicher, der das Verdienst in den Staub ziehen will, den gebührenden Lohn und den Ruhm, der es begleitet, ihm nehmen, die schuldigen Dankesgefühle des Volkes ersticken möchte!
Man denke indessen nicht, die Soldaten seien die einzigen, die sich über unseren Verfasser zu beklagen haben. Kein Stand im Königreich ist vor seinen Ausfällen sicher. Er lehrt uns auch, daß in Frankreich die Richterstellen käuflich sind. Das weiß man längst. Um den Ursprung dieses schlechten Brauches kennen zu lernen, muß man, wenn ich nicht irre, bis auf die Zeit zurückgreifen, da König Johann von den Engländern gefangengehalten wurdet, oder – um noch sicherer zu gehen – auf die Gefangenschaft Franz' I. Frankreich hatte die Ehrenpflicht, seinen König aus den Händen Karls V. zu befreien, der ihm die Freiheit nur unter bestimmten Bedingungen wiedergeben wollte. Der Schatz war erschöpft. Da man nun eine so erhebliche Summe, wie sie als Lösegeld für den König gefordert wurde, nicht auftreiben konnte, geriet man auf den unheilvollen Ausweg, die Richterämter feilzubieten, um mit dem Ertrag die Freiheit des Landesfürsten zu erkaufen. Der Freilassung Franz' I. folgten beinahe ununterbrochen Kriege, unter seinen Nachkommen entbrannten innere Unruhen und Bürgerkriege. So wurden die Monarchen verhindert, die Schuld einzulösen, mit der sie noch heut im Finanzwesen wirtschaften.
Das Unglück Frankreichs hat es gewollt, daß Ludwig XV. bis auf unsere Tage sich in keiner günstigeren Lage befand als seine Vorfahren. Das hat ihn gehindert, den Besitzern der Richterstellen die beträchtlichen Darlehen zurückzuzahlen, die sie in Unglückszeiten vorgeschossen hatten. Muß man sich also an Ludwig XV. halten, wenn der alte Mißbrauch noch nicht abgeschafft werden konnte? Ohne Zweifel sollte das Recht, über das Los der Bürger zu entscheiden, nicht für Geld erhältlich sein. Anklagen darf man aber deswegen nur jene, die den Mißbrauch einführten, nicht einen König, der schuldlos daran ist. Und wenn die Mißbräuche auch fortbestehen, so wird der Verfasser nichtsdestoweniger gezwungen sein, zuzugeben, daß man das Pariser Parlament in Wahrheit nicht der Pflichtvergessenheit beschuldigen kann und daß die Käuflichkeit der Ämter auf die Rechtsprechung keinen Einfluß geübt hat.
Der Verfasser sollte sich lieber über die verwirrende Menge von Gesetzen beschweren, die von Provinz zu Provinz wechseln, während sie in einem Staat wie Frankreich einfach und gleichförmig sein müßten. Ludwig XIV. wollte die Reform der Gesetze durchführen, doch Hindernisse jeder Art hielten ihn ab, das Werk zu vollenden. Unser Autor wisse denn, wenn er es noch nicht weiß, und begreife, wenn er kann, daß unendliche Mühen und immer neue Hemmungen dem bevorstehen, der an die durch Gewohnheit geheiligten Bräuche rühren will. Man muß sich in unabsehbare Einzelheiten vertiefen, um den inneren Zusammenhang so verschiedenartiger Dinge klarzustellen, die durch den Gang der Zeit geformt wurden. Wer heute an sie rührt, gerät in Mißhelligkeiten, die schlimmer sind als das Übel, dem man abhelfen will. Hier gilt das Wort: Kritik ist leicht, aber schwer ist die Kunst.
Treten Sie jetzt näher, Herr Generalkontrolleur der Finanzen, und Sie, meine Herren Finanzbeamten: die Reihe ist nun an Ihnen. In schlechter Laune ereifert sich der Verfasser gegen die Steuern, gegen die Erhebung der öffentlichen Gelder, gegen die Lasten, die das Volk trägt und die es, wie er behauptet, erdrücken, gegen die Steuerpächter, gegen die Verwalter der Einkünfte. Ihnen insgesamt wirft er Unterschleife, Erpressung und Raub vor. Recht schön – wenn er Beweise bringt. Da ich aber beim Lesen gegen seine ewigen Übertreibungen mißtrauisch ward, hege ich den Argwohn, daß er die Dinge gewaltig aufbauscht, um die Regierung verhaßt zu machen. Das Beiwort vom barbarischen Tyrannen, das sich in seinem Geist untrennbar mit der Vorstellung vom Königtum verbindet, und das er, so oft er kann, mittelbar auf seinen Herrscher anwendet, macht mir die Gutgläubigkeit seiner Deklamationen verdächtig. Sehen wir nun, ob er die Dinge kennt, über die er spricht, und ob er sich die Mühe genommen hat, den Sachverhalt zu untersuchen.
Woher kommen denn die ungeheuren Schulden, die auf Frankreich lasten? Aus welchen Gründen sind sie so angewachsen? Es ist bekannt, daß ein großer Teil davon noch aus der Regierungszeit Ludwigs XIV. stammt, und zwar aus dem Spanischen Erbfolgekrieg, dem gerechtesten von allen, die er unternommen hat. Danach gab der Regent, Herzog Philipp von Orleans, sich der Hoffnung hin, mit Hilfe des Systems, das Law ihm vorschlug, die Schulden abzutragen. Weil er aber das System überspannte, zerrüttete er das Königreich, und die Schulden wurden nur teilweise abgelöst, nicht gänzlich getilgt. Nach dem Tod des Regenten, unter der weisen Verwaltung des Kardinals Fleury, heilte die Zeit etliche Wunden des Reiches. Allein die Kriege, die dann ausbrachen, nötigten Ludwig XV., neue Schulden aufzunehmen. Treu und Glaube, die Erhaltung des Staatskredits verlangen, daß die Schulden abgetragen werden, oder mindestens, daß die Regierung die Zinsen pünktlich bezahlt. Die ordentlichen Einkünfte des Staates waren aber unter den laufenden Ausgaben verrechnet: woher sollte der König die nötigen Summen zur Bezahlung der Zinsen und zur Tilgung der Schulden nehmen, wenn er sie nicht von seinem Volk erhielt? Und da sich seit langem der Brauch im Lande eingeführt hat, daß die Erhebung bestimmter Pachtgelder und neuer Auflagen durch die Hände der Steuerpächter geht, sieht der König sich gewissermaßen genötigt, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen.
Es ist nicht zu leugnen, daß im Finanzwesen die vielleicht allzu zahlreichen Beamten und Angestellten Erpressungen und Diebstähle begehen und das Volk manchmal Grund hat, sich über die Härte ihrer Eintreibung zu beklagen. Aber wie will man das in einem Königreich vom Umfang Frankreichs hindern? Je größer eine Monarchie, desto mehr Mißstände werden in ihr herrschen. Wenn man auch die Zahl der Aufsichtführenden im Verhältnis zur Zahl der Erheber vermehren wollte, so würden diese es doch verstehen, mit neuen Listen und Kunstgriffen die aufmerksamen Augen der Wächter zu täuschen.
Wären die Absichten des Verfassers rein gewesen, hätte er die Ursache der Ausgaben, die dem Staat verderblich wurden, richtig erkannt, so würde er bescheidentlich gemahnt haben: man möge bei den Ausgaben für den Krieg mehr Sparsamkeit walten lassen und die Unternehmer abschaffen, die sich mit unerlaubtem Gewinn bereichern, während der Staat verarmt; man solle acht darauf haben, daß die Lieferungsverträge nicht, wie es vorgekommen ist, bis zur doppelten Höhe ihres Lieferungswertes gesteigert werden. Schließlich hätte er nahelegen können, daß in der Streichung aller überflüssigen Pensionen und in der Einschränkung der Ausgaben für den Hof ein Mittel zur Erleichterung der Steuerlast gegeben sei, wie es der Aufmerksamkeit eines guten Fürsten wohl wert sei. Wenn er sich dabei eines bescheidenen Tones bedient hätte, so hätten seine Ansichten Eindruck machen können. Die Beleidigungen aber erregen Zorn und überzeugen keinen Menschen. Er empfehle doch, wenn er dergleichen weiß, Mittel und Wege, um die Schulden zu bezahlen, ohne das öffentliche Vertrauen zu erschüttern und ohne die Untertanen zu bedrücken. Dann bürge ich ihm dafür, daß er sofort zum Finanzminister ernannt wird.
Früher hat man, sobald ein Nachbarstaat gefährlich ward, in aller Eile die Bauern bewaffnet. Diese Miliz erhielt keinen regelmäßigen Sold, sie war auf Raub und Plünderung angewiesen. Bei Friedensschluß wurde sie entlassen. Ein echter Philosoph würde nun wohl unparteiisch untersucht haben, ob die großen Heere, die auch in Friedenszeiten unterhalten werden, und die kostspieligen Kriege von heute vorteilhafter oder minder vorteilhaft sind als der alte Brauch.
Der einzige Gewinn, den die Alten davon hatten, lag darin, daß das Heer ihnen in Friedenszeiten nichts kostete. Sobald die Sturmglocke ertönte, ward jeder Bürger Soldat. In unserer Zeit hingegen, da die Stände sich mehr gespalten haben, fahren Bauer und Gewerbetreibender ohne Unterbrechung in ihren Verrichtungen fort, weil ein vorbestimmter Teil der Staatsbürger den Schutz der anderen übernimmt. Wenn unsere großen Heere während der Feldzüge auf Staatskosten erhalten werden und dadurch teuer sind, so ergibt sich daraus doch wenigstens der Vorteil, daß die Kriege höchstens acht bis zehn Jahre dauern können. Wenn nämlich den Herrschern dann das Geld ausgeht, so geben sie sich manches mal friedlicher, als wenn es bloß nach ihrer Neigung ginge. Unser modernes Verfahren hat also die Wirkung, daß unsere Kriege kürzer als die der Alten und minder verheerend für die Gegenden sind, die den Schauplatz bilden. Den großen Unkosten, die sie mit sich bringen, verdanken wir die Friedensepochen, deren wir uns erfreuen. Sie sind gegenwärtig noch kurz genug, durch die Erschöpfung der Mächte werden sie aber wahrscheinlich länger werden.
Ich fahre fort. Unser Königsfeind behauptet, die Herrscher hätten ihre Macht nicht von Gottes Gnaden erhalten. Wir wollen ihm dessentwillen nicht weiter zusetzen. Es glückt ihm so selten, recht zu haben, daß es üble Laune verriete, wenn man ihm auch da widersprechen wollte, wo die Wahrscheinlichkeit einmal für ihn ist.
In der Tat, die Capetinger ergriffen mit Gewalt Besitz von der Herrschaft, die Karolinger bemächtigten sich ihrer mit Geschick und List, die Valois und die Bourbonen gewannen die Krone durch das Recht der Erbschaft. Auch Titel wie Ebenbilder der Gottheit oder Statthalter der Gottheit wollen wir dem Verfasser preisgeben, da sie so wenig zutreffen. Die Könige sind Menschen wie die anderen. In einer Welt, wo nichts Vollkommenheit hat, genießen sie keineswegs des ausschließlichen Vorrechts, vollkommen zu sein. Sie bringen ihre Verzagtheit oder Entschlossenheit, ihre Tatkraft oder Trägheit, ihre Laster oder Tugenden mit auf den Thron, wohin der Zufall der Geburt sie setzt. In einem erblichen Königreich müssen mit Notwendigkeit Fürsten unterschiedlichsten Charakters einander folgen.

Ewald Friedrich von Hertzberg, preuß. Minister. Bleistiftzeichnung von Menzel.
Es wäre ungerecht zu fordern, daß die Fürsten ohne Fehl seien, während man es selber nicht ist. Es gehört keine Kunst dazu, zu sagen: dieser oder jener ist träge, geizig, verschwenderisch oder liederlich. So wenig, wie wenn man beim Spaziergang durch eine Stadt die Hausschilder liest. Ein Philosoph, der wissen muß, daß der Dinge Wesensgrund sich niemals ändert, wird sich nicht damit vergnügen, einer Eiche vorzuwerfen, daß sie keine Äpfel trägt, einem Esel, daß ihm Adlerfittiche fehlen, oder einem Stör, daß er keine Stierhörner hat. Er wird die tatsächlichen Übel, die schwer zu heilen sind, keinesfalls übertreiben, er wird nicht schreien: alles ist schlecht! wenn er nicht sagen kann, wie all das gut werden könnte. Seine Stimme wird nicht als Trompete des Aufruhrs dienen, nicht als Signal zur Sammlung der Mißvergnügten, als Vorwand zur Empörung. Er wird Achtung haben vor den geltenden, durch die Nation anerkannten Bräuchen und vor der Regierung, vor den Regierenden selbst wie vor ihren Untergebenen. So dachte auch der friedfertige du Marsais, den man nun, zwölf Jahre nachdem er tot und begraben ist, eine Schmähschrift verfassen läßt, während der wirkliche Urheber nur ein Schulbube sein kann, ein leichtherziger Neuling in dieser Welt.
Was bleibt mir noch zu sagen übrig, wenn man in einem Land, wo der Verfasser des »Telemach« den Thronfolger erzog, gegen die Erziehung der Prinzen Geschrei erhebt? Sollte der Schulbube antworten, daß es keinen Fénelon mehr in Frankreich gibt, so müßte er sich an die Unfruchtbarkeit des Jahrhunderts halten, aber nicht an Prinzenerzieher.
Das wären im wesentlichen meine allgemeinen Bemerkungen zur Abhandlung »Über die Vorurteile«. Der Stil erschien mir langweilig, weil das Ganze eine eintönige Deklamation bildet, darin dieselben Ideen immer wiederkehren und sich allzu oft in derselben Gestalt darstellen. Inmitten des Chaos fand ich jedennoch ein paar ausgezeichnete Einzelheiten. Wollte man übrigens aus dem Werk ein nützliches Buch machen, so müßte man die Wiederholungen, genialischen Schiefheiten, falschen Schlußfolgerungen, die Wissensmängel und Beleidigungen streichen. Das würde die Schrift auf ein Viertel ihres Umfanges zusammendrängen.
Was habe ich nun aus dieser Lektüre gelernt? Welche Wahrheit hat der Verfasser mich gelehrt? Daß alle Geistlichen Ungeheuer sind, die man steinigen müßte. Daß der König von Frankreich ein barbarischer Tyrann ist, seine Minister Erzschelme sind, seine Höflinge feige Schurken, die vor den Stufen des Thrones kriechen, die Großen des Reiches Ignoranten, strotzend von Anmaßung. (Nähme er wenigstens den Herzog von Nivernais aus!) Ferner erfährt man, daß die französischen Heerführer und Offiziere gedungene Henker, die Richter infame Amtsfrevler sind, die Finanzbeamten Spitzbuben wie Cartouche und Mandrin, die Geschichtsschreiber nichts als Fürstenverderber, die Dichter Vergifter der Allgemeinheit, kurz: daß es im ganzen Königreich nichts Weises, Löbliches, Achtenswertes gibt als den Verfasser und seine Freunde, die sich den Titel Philosoph verliehen haben.
Es ist mir leid um die Zeit, die ich ans Lesen eines solchen Werkes vergeudet habe, und um die obendrein, die ich hier verlor, indem ich es rezensierte.