
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Was hat man vom Leben, wenn man nur vegetiert? Wozu hat man Augen, wenn man nur Tatsachen in seinem Gedächtnis anhäuft? Mit einem Worte: was nützt die Erfahrung, die man nicht zum Gegenstand späteren Nachdenkens macht?
Vegetius sagt: »Der Krieg soll uns ein Studium und der Friede eine Übung sein.« Er hat recht!
Die Erfahrung will durchdacht werden. Erst nach wiederholter Prüfung erkennt der Künstler die Grundbedingungen seiner Kunst. In den Mußestunden, in den Zeiten der Ruhe wird neues vorbereitet, das durch die Erfahrung erprobt werden soll. Solche Untersuchungen stellt ein strebsamer Geist an. Aber wie selten ist solches Streben, und wie häufig sieht man dagegen Menschen, die ihren Körper abgenutzt, aber nie ihren Geist gebraucht haben! Nur das Denken, die Fähigkeit, Ideen zu verknüpfen, unterscheidet den Menschen vom Lasttier. Der Maulesel, der zehn Feldzüge lang den Packsattel des Prinzen Eugen trug, ist dadurch kein besserer Taktiker geworden. Zur Schande der Menschheit muß man gestehen, daß viele in einem sonst ehrenvollen Berufe alt und grau werden, ohne darin größere Fortschritte zu machen als jener Maulesel.
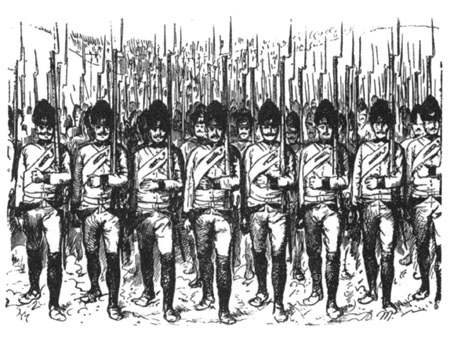
Österreichische Infanterie auf dem Marsche.
Dem hergebrachten Schlendrian des Dienstes folgen, sich um seinen Tisch und seine Bedürfnisse kümmern, marschieren, wenn marschiert wird, lagern, wenn gelagert wird, kämpfen, wenn alles kämpft – das heißt für die Mehrzahl der Offiziere gedient und Krieg geführt haben, unter den Waffen grau geworden sein. Daher sieht man so viele Militärs an Kleinigkeiten haften und in grober Unwissenheit verknöchern. Statt sich mit kühnem Flug in die Wolken zu erheben, wissen sie nur, auf ihre Methode eingeschworen, im Staube zu kriechen, unbekümmert um die Ursachen ihrer Siege und Niederlagen und ohne sie zu kennen. Und doch sind diese Ursachen mit Händen zu greifen.
Ein strenger Kritiker wie der scharfsinnige Feuquières hat uns alle Fehler erläutert, die die Heerführer seiner Zeit begangen haben. Er hat die Feldzüge, die er mitmachte, sozusagen anatomisch zergliedert und die Gründe für ihre Erfolge und Mißerfolge aufgedeckt. Er hat uns den Weg zu unserer Aufklärung gewiesen und uns gezeigt, wie man jene Grundwahrheiten entdeckt, auf denen die Kriegskunst beruht. Seitdem hat sich die Kriegführung vervollkommnet. Neue mörderische Einrichtungen haben die Schwierigkeiten vergrößert. Diese müssen wir auseinandersetzen, damit wir, nach genauer Untersuchung des Systems unserer Feinde und der Hindernisse, die sie uns entgegenstellen, die geeigneten Mittel zu ihrer Überwindung finden.
Ich will Euch nicht mit den Projekten unserer Feinde unterhalten, die sich auf die Zahl und die Macht ihrer Verbündeten stützen. Ihre Menge und vereinte Macht wäre mehr als hinreichend, nicht allein Preußen, sondern auch die Kräfte eines der mächtigsten europäischen Fürsten zu vernichten, hätte er sich dieser wilden Flut entgegenstemmen wollen. Auch brauche ich Euch wohl kaum an ihre allgemein befolgte Methode zu erinnern. Sie besteht darin, unsere Kräfte durch Diversionen nach einer Seite abzulenken, um auf der anderen, wo sie vor jedem ernstlichen Widerstand sicher sind, einen großen Schlag zu führen, sich aber einem Korps gegenüber, das ihnen die Spitze zu bieten vermag, in der Defensive zu halten und sich mit Nachdruck nur gegen die Truppen zu wenden, die infolge ihrer Schwäche vor ihnen das Feld räumen müssen.
Ich will Euch auch nicht an die Methode erinnern, die ich angewandt habe, um mich gegen den Koloß zu stemmen, der mich zu zermalmen drohte. Bewährt hat sie sich nur durch die Fehler meiner Feinde, ihre Langsamkeit, die meiner Regsamkeit zustatten kam, durch ihre Trägheit, die niemals die Gelegenheit erfaßte. Sie darf aber nicht als Muster aufgestellt werden.
Das gebieterische Gesetz der Notwendigkeit hat mich gezwungen, vieles dem Zufall zu überlassen. Ein Steuermann, der mehr den Launen des Windes als der Richtung seines Kompasses folgt, darf aber nie als Vorbild dienen.
Es kommt darauf an, sich einen richtigen Begriff von dem System zu machen, das die Österreicher in diesem Kriege befolgen. An sie halte ich mich, weil sie es von allen unseren Feinden in der Kriegskunst am weitesten gebracht haben. Die Franzosen übergehe ich mit Stillschweigen. Sie sind zwar klug und erfahren, verderben sich aber durch Leichtsinn und Unbestand von heute auf morgen die Erfolge, die ihre Geschicklichkeit ihnen verschafft hat. Die Russen sind ebenso roh wie unfähig und verdienen deshalb überhaupt keine Erwähnung.
Die Hauptveränderungen im Verfahren der österreichischen Generale, die ich während dieses Krieges bemerkt habe, beziehen sich auf ihre Lager, ihre Märsche und ihre gewaltige Artillerie. Denn diese dürfte schon allein, ohne Unterstützung von Truppen, fast hinreichen, um ein angreifendes Heer zurückzuwerfen, zu zerstreuen und zu vernichten. Glaubt nicht, ich vergäße die guten Lager, die geschickte Heerführer in früheren Zeiten ausgesucht und besetzt haben, wie die Lager Mercys bei Freiburg (1644) und Nördlingen (1645). Auch Prinz Eugen bezog ein gutes Lager bei Mantua, wodurch er dem Vordringen der Franzosen während des ganzen Feldzuges Einhalt gebot (1702). Markgraf Ludwig von Baden machte das Lager bei Heilbronn berühmt (1694). In Flandern ist das Lager von Sierk bekannt und viele andere, deren Erwähnung sich erübrigt.
Was die Österreicher gegenwärtig besonders auszeichnet, ist die Kunst, stets ein vorteilhaftes Gelände für ihre Stellungen zu wählen und besser als früher die örtlichen Hindernisse zur Aufstellung ihrer Truppen zu benutzen. Man frage sich nur, ob Heerführer es je verstanden haben, so furchtgebietende Aufstellungen zu nehmen, wie wir es jetzt bei der österreichischen Armee gesehen haben. Wo hat man jemals 400 Kanonen in verschiedenen Batterien etagenweise auf Anhöhen postiert gesehen, so daß sie nicht nur in die Ferne zu wirken vermögen, sondern auch, was der Hauptvorteil ist, ein verheerendes rasantes Feuer unterhalten können?
Ein österreichisches Lager zeigt also eine furchtgebietende Front. Aber hierauf beschränkt sich seine Verteidigung nicht. Seine Tiefengliederung und seine zahlreichen Treffen bergen wahre Hinterhalte, d.h. neue Kunstgriffe und geeignete Stellen, um über die Truppen herzufallen, die durch die Angriffe auf die vordersten Linien erschüttert sind. Diese Stellen sind im voraus dazu hergerichtet und mit Truppen besetzt, die keinen anderen Zweck haben als jenen. Allerdings muß man zugeben, daß die große numerische Überlegenheit ihrer Heere den Führern gestattet, sich in mehreren Treffen hintereinander aufzustellen, ohne eine Überflüglung befürchten zu müssen, und daß sie bei ihrem Überfluß an Truppen jedes Gelände, das ihnen geeignet scheint, zu besetzen vermögen, um ihre Stellung noch furchtgebietender zu machen.
Gehen wir noch mehr auf Einzelheiten ein, so werdet Ihr finden, daß die Grundsätze der österreichischen Kriegführung die Folgen reiflicher Überlegung sind. Ihre Taktik ist sehr kunstgerecht. In der Auswahl der Lager herrscht äußerste Vorsicht und große Geländekenntnis. Dazu haben sie bewährte Dispositionen und sind so klug, nichts zu unternehmen, ohne die im Kriege überhaupt mögliche Gewißheit des Erfolges zu haben. Sich nie zu einer Schlacht zwingen zu lassen, ist die erste Regel für jeden Heerführer. Darauf gründet sich ihr System. Daher ihre Suche nach starken Lagerplätzen auf Anhöhen und Gebirgen. Eigenheiten in der Wahl ihrer Stellungen haben die Österreicher nicht, außer daß man sie fast nie in einer schlechten Stellung findet, und daß sie ihr Hauptaugenmerk darauf richten, sich beständig in unangreifbarem Gelände aufzustellen. Ihre Flanken lehnen sich stets an Schluchten, steile Abhänge, Sümpfe, Flüsse oder Städte. Besonders aber unterscheiden sie sich von dem früheren Brauche durch die Verteilung ihrer Truppen, um, wie gesagt, alle Vorteile des Geländes auszunutzen. Mit äußerster Sorgfalt weisen sie jeder Waffe die geeignete Stellung an.
Außer der Kunst gebrauchen sie auch noch die List und schieben häufig große Kavalleriemassen vor, um den feindlichen Heerführer zu falschen Maßnahmen zu verleiten. Doch habe ich mehr als einmal bemerkt, daß sie sich nicht im Ernst schlagen wollen, wenn sie ihre Kavallerie in einer Linie aufmarschieren lassen. Stellt sie sich jedoch schachbrettförmig auf, dann wollen sie sie wirklich gebrauchen. Dabei ist aber zu beachten: wenn Ihr die Kavallerie bei Beginn der Schlacht angreift, so wird Eure Kavallerie sie zwar bestimmt schlagen, gerät aber bei der geringsten Verfolgung in einen von der Infanterie gelegten Hinterhalt, in dem sie vernichtet wird. Greift Ihr also den Feind in einer festen Stellung an, so müßt Ihr Eure Kavallerie anfangs zurückhalten, Euch nicht durch falschen Schein täuschen lassen und sie gar nicht dem Gewehr- oder Geschützfeuer aussetzen, das ihr den ersten Kampfesmut rauben würde. Vielmehr müßt Ihr sie aufsparen, um das Gefecht wiederherzustellen oder sie zur Verfolgung des Feindes zu benutzen. Dann kann sie die größten Dienste leisten.
Während dieses ganzen Krieges sahen wir die österreichische Armee stets in drei Treffen gestellt, unterstützt und umgeben von einer gewaltigen Artilleriemasse. Ihr erstes Treffen steht am Fuße der Anhöhen in fast ebenem Gelände, das nach der Seite des feindlichen Angriffs glacisartig abfällt. Das ist eine gute Methode. Sie beruht auf der Erfahrung, daß rasantes Feuer verheerender wirkt als Steilfeuer. Zudem hat der einzelne Mann auf dem Glaciskamm alle Vorteile der Höhe, ohne deren Nachteile zu empfinden. Der ungedeckte, bergan stürmende Angreifer kann ihm durch sein Feuer nicht schaden, wogegen er selbst ein rasantes und gut vorbereitetes Feuer unterhält. Versteht er nur seine Waffe zu gebrauchen, so wird er den vorrückenden Feind vernichten, bevor er heran ist. Schlägt er den Angriff ab, so kann er den Feind verfolgen, unterstützt vom Gelände, das die verschiedenen Bewegungen begünstigt. Stände dagegen das erste Treffen auf einer zu hohen oder zu steilen Anhöhe, so könnte es sich nicht herunterwagen, ohne in Unordnung zu geraten, und der Angreifer könnte bei schnellem Vordringen bald in den toten Winkel unterhalb der Schußlinie der Gewehre, ja selbst der Geschütze gelangen.
Die Österreicher haben die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Stellungen wohl erwogen und bestimmen deshalb in ihren Lagern jene amphitheatralisch aufsteigenden Höhen für das zweite Treffen, das gleich dem ersten durch Kanonen verstärkt wird. Dies zweite Treffen, das einige Kavallerieabteilungen enthält, soll dem ersten zur Unterstützung dienen. Weicht der angreifende Feind, so ist Kavallerie zur Verfolgung bei der Hand. Weicht dagegen das erste Treffen, so stößt der vordringende Feind nach hartem Infanteriekampf auf eine zweite furchtgebietende Stellung, die er abermals angreifen muß. Er ist durch die vorigen Angriffe schon ermattet und muß nun gegen frische, gut aufgestellte Truppen anstürmen, die durch die Stärke des Geländes begünstigt werden.
Das dritte Treffen, das gleichzeitig als Reserve dient, ist zur Verstärkung der Stellen bestimmt, die der Angreifer zu durchbrechen sucht. Seine Flanken sind mit Geschützen gespickt wie eine Zitadelle. Sie benutzen jeden kleinen Geländevorsprung zum Aufbau von Geschützen, die schräg schießen und das ganze Gelände unter Kreuzfeuer halten. Es ist also fast das gleiche, ob man eine Festung stürmt, deren Werke keine Minenanlagen haben, oder eine Armee angreift, die sich derart in ihrem Gelände eingerichtet hat.
Nicht zufrieden mit so vielen Vorkehrungen, suchen die Österreicher ihre Front auch noch durch Sümpfe, tiefe und schwer passierbare Hohlwege, Flüsse, kurz, durch Geländehindernisse zu schützen. Sie verlassen sich nicht nur auf ihre Flankendeckung, sondern stellen auch noch an unzugänglichen Stellen, rechts und links, ungefähr 2000 Schritt von ihren Flügeln entfernt, starke Detachements auf, um den Feind zu beobachten und ihm, falls er die Hauptmacht unvorsichtig angreift, in den Rücken zu fallen. Man kann sich leicht vorstellen, welche Wirkung eine solche Diversion auf Truppen haben muß, die gerade beim Angriff sind und sich nun plötzlich in Flanke und Rücken gefaßt sehen. Der Anfang des Kampfes wäre auch dessen Ende, und es gäbe nichts als Verwirrung, Auflösung und Flucht.
Wie kann man nun, wird man fragen, gegen so wohl vorbereitete Truppen eine Schlacht wagen? Sollten diese oft geschlagenen Truppen unbesieglich geworden sein? Keineswegs! Das werde ich nie zugeben. Doch rate ich keinem, einen übereilten Entschluß zu fassen und sich tollkühn mit einer Armee einzulassen, die im Besitz so großer Vorteile ist.
Es ist aber auf die Dauer unmöglich, daß im Verlauf eines Feldzuges jedes Gelände gleich vorteilhaft ist. Auch können diejenigen, die die Truppen aufzustellen haben, irgendwelche Fehler begehen. Ich rate sehr, solche Gelegenheiten zu benutzen, ohne Rücksicht auf die Stärke des Feindes, wenn man nur etwas mehr als die Hälfte seiner Truppen hat.
Fehler des Feindes, die man benutzen kann, sind: wenn er eine Anhöhe vor seinem Lager oder seitwärts davon unbesetzt hält, wenn er die Kavallerie ins erste Treffen stellt, wenn er seine Flanken nicht gut angelehnt hat oder eins der Korps, die seine Flügel decken sollen, zu weit vorschiebt, wenn die von ihm besetzten Höhen nicht beträchtlich sind, und vor allem, wenn der Zugang durch keine Geländehindernisse versperrt ist. Das alles sind Fälle, die ein geschickter Heerführer nach meiner Meinung benutzen soll. Das erste, was geschehen muß, ist die Besetzung der Hügel und Anhöhen, von denen aus sein Geschütz das feindliche beherrscht. Dort muß er so viele Kanonen, wie Platz finden, aufstellen und von da die Armee, die er angreifen will, mit Feuer überschütten, während er seine Angriffstruppen und seine Treffen formiert. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten bemerkt, daß weder die österreichische Infanterie noch die Kavallerie dem Geschützfeuer standhält. Damit sie die ganze Schrecklichkeit der Artillerie spürt, sind entweder Anhöhen oder ein völlig ebenes Gelände nötig; denn Kanonen und Gewehre haben, wie gesagt, von unten nach oben keine Wirkung. Den Feind anzugreifen, ohne sich den Vorteil überhöhenden oder doch aus gleicher Höhe kommenden Feuers verschafft zu haben, wäre dasselbe, wie bewaffnete Truppen mit Leuten angreifen, die nur Knüppel haben, und das ist unmöglich.
Ich komme wieder auf den Angriff zurück. Alles hängt vom richtigen Erkennen der schwächsten Stelle des Feindes ab. Hier hat man keinen so heftigen Widerstand zu erwarten wie da, wo er sich besser vorgesehen hat. Ich glaube, die Klugheit erfordert, einen bestimmten Punkt der feindlichen Armee ins Auge zu fassen, sei es den rechten oder linken Flügel, die Flanken usw. Nach dieser Stelle muß man seinen Hauptstoß richten und mehrere Treffen formieren, um den Angriff zu unterstützen; denn es ist wahrscheinlich, daß Eure ersten Truppen zurückgeworfen werden. Den allgemeinen Angriff widerrate ich als zu gewagt. Bringt man dagegen nur einen Flügel oder einen Teil der Armee ins Feuer, so behält man, falls er geworfen wird, immer noch das Gros übrig, um den Rückzug zu decken, und so kann man nie völlig geschlagen werden.
Bedenkt ferner, daß man nicht soviel Leute verliert, wenn man nur einen Teil der feindlichen Armee angreift, als bei einer allgemeinen Schlacht, und daß man im Falle des Gelingens den Feind ebensogut vernichten kann, wenn sich nicht in zu großer Nähe des Schlachtfeldes ein Defilee befindet oder ein feindliches Detachement bei der Hand ist, das den Rückzug decken kann.
Hierbei scheint es mir zweckmäßig, den Teil des Heeres, den Ihr dem Feinde versagt, zur Demonstration zu benutzen und ihn fortwährend dem Feinde zu zeigen, so daß er seine Stellung nicht zu verlassen wagt, um Verstärkung nach Eurer Durchbruchsstelle zu schicken. Dadurch legt Ihr den Teil seines Heeres, den Ihr in Respekt haltet, während der Schlacht brach. Schwächt sich der Feind aber auf einer Seite, um nach der anderen Unterstützung zu bringen, so müßt Ihr das bei genügender Truppenmacht ausnutzen, wenn Ihr seine Bewegung rechtzeitig merkt.
Überhaupt muß man das Gute an der Fechtweise des Feindes nachahmen. Die Römer führten die überlegenen Waffen der Völker ein, mit denen sie Krieg führten, und wurden dadurch unüberwindlich. Ohne Zweifel muß man sich die Lagerweise der Österreicher aneignen, sich jedenfalls aber mit einer schmaleren Front begnügen, um an Tiefe zu gewinnen, und große Sorgfalt auf die Stellung und Sicherung seiner Flügel verwenden.
Auch das System der starken Artillerie muß man annehmen, so lästig es ist. Ich habe die unsere beträchtlich vermehrt, so daß sie die Mängel unserer Infanterie auszugleichen vermag, deren Material sich, je länger der Krieg dauert, nur verschlechtern kann. Indem wir so mit richtigerem Blick und größerer Sorgfalt als früher unsere Maßnahmen treffen, befolgen wir nur die alte Kriegsregel, sich niemals wider Willen zum Kampfe zwingen zu lassen.
Bei so vielen Schwierigkeiten, den Feind in seinen befestigten Stellungen anzugreifen, kommt man auf den Gedanken, ihn auf dem Marsche zu überfallen, seinen Aufbruch aus dem Lager zu benutzen und sich mit der Nachhut in einen Kampf einzulassen, wie es z.B. bei Leuze (1691) und Senef (1674) geschah. Aber auch dagegen haben die Österreicher Vorkehrungen getroffen, indem sie nur in durchschnittenen und waldigen Gegenden Krieg führen und schon im voraus Wege herrichten, die durch Wälder oder Sümpfe ziehen, oder indem sie den Talwegen hinter den Bergen folgen und die Berghöhen oder Defileen im voraus sorgfältig mit Detachements besetzen. Zahlreiche leichte Truppen setzen sich in den Wäldern oder auf den Berggipfeln fest, decken ihren Marsch, verschleiern ihre Bewegungen und verschaffen ihnen völlige Sicherheit, bis sie ein neues starkes Lager erreicht haben, in dem man sie vernünftigerweise nicht angreifen darf.
Bei dieser Gelegenheit muß ich noch angeben, wie unsere Feinde verfahren, um sich gute Stellungen auszusuchen. Sie schicken Feldingenieure aus, die das Gelände rekognoszieren und genaue Pläne davon aufnehmen. Erst nach genauer Prüfung und reiflicher Überlegung wird das Lager gewählt und zugleich seine Befestigung angeordnet.
Die Detachements der österreichischen Armee sind zahlreich und stark, die schwächsten nicht unter 3000 Mann. Öfters zählte ich ihrer fünf bis sechs zugleich im Felde. Recht beträchtlich ist die Zahl ihrer ungarischen Truppen. Wären sie alle beisammen, so könnten sie ein starkes Armeekorps bilden. Ihr habt Euch also stets mit zwei Armeen zu schlagen, einer schweren und einer leichten. Die Offiziere, denen sie diese Detachements anvertrauen, sind geschickt und besitzen hervorragende Geländekenntnis. Sie lagern oft ganz in der Nähe unserer Armeen, halten sich dabei aber sorgsam auf den Berggipfeln, in dichten Wäldern oder hinter doppelten und dreifachen Defileen. Aus dieser Art von Schlupfwinkeln schicken sie dann Streifscharen aus, die je nach den Umständen handeln, aber das Hauptkorps zeigt sich nur, wenn es einen großen Schlag wagen kann. Bei ihrer Stärke können diese Detachements unserer Armee ganz nahe kommen, ja sie umzingeln, und es ist sehr ärgerlich, daß wir nicht ebenso viele leichte Truppen haben. Unsere aus Deserteuren zusammengerafften, schwachen Freibataillone wagen oft nicht, sich vor ihnen sehen zu lassen. Unsere Generale getrauen sich nicht, sie vorzuschicken, um sie nicht zu verlieren. Dadurch wird es dem Feind möglich, sich unseren Lagern zu nähern, uns zu beunruhigen und uns Tag und Nacht zu alarmieren. Unsere Offiziere gewöhnen sich mit der Zeit zwar an diese fortwährenden Scharmützel, verachten sie schließlich und verfallen leider in jene unheilvolle Sicherheit, die uns bei Hochkirch so teuer zu stehen kam. Damals hielten viele den Überfall der ganzen österreichischen Armee auf unseren rechten Flügel für ein bloßes Scharmützel der irregulären Truppen.
Ich glaube jedoch, um Euch nichts zu verhehlen, daß Daun seine ungarische Armee noch weit besser verwenden könnte. Sie tut uns lange nicht so viel Schaden, wie sie könnte. Warum unternahmen die Detachementsführer nie etwas gegen unsere Fouragierungen? Warum versuchten sie nicht, die elenden Nester zu überrumpeln, wo wir unsere Magazine hatten? Warum suchten sie nicht bei jeder Gelegenheit unsere Zufuhr abzuschneiden? Warum beunruhigten sie unser Lager des Nachts nur mit kleinen Detachements, anstatt uns mit Macht anzugreifen und unserem zweiten Treffen in den Rücken zu fallen? Das hätte zu viel bedeutenderen und für den Ausgang des Krieges entscheidenderen Resultaten geführt. Ohne Zweifel fehlt es ihnen, so gut wie uns, an unternehmenden Offizieren, die in allen Ländern so selten und so gesucht sind, die einzigen, die aus der großen Zahl derer, die sich ohne Beruf und Talente dem Waffenhandwerk widmen, die Beförderung zur Generalswürde verdienen.
Das sind in kurzen Worten die Grundsätze, nach denen die Österreicher gegenwärtig Krieg führen. Sie haben sich sehr vervollkommnet, aber deshalb kann man doch wieder die Oberhand über sie gewinnen. Die von ihnen so geschickt angewandte Verteidigungsart liefert uns die Mittel, sie anzugreifen. Ich habe schon einige Gedanken darüber hingeworfen, wie man sich mit ihnen in einen Kampf einläßt. Ich muß noch zwei Dinge hinzufügen, die ich wohl vergessen habe. Erstens muß man sehr darauf achten, das zum Angriff bestimmte Korps gut anzulehnen, damit es beim Vorgehen nicht selbst in der Flanke gefaßt wird, statt die des Feindes zu gewinnen. Zweitens muß man den Bataillonskommandeuren einschärfen, daß sie ihre Leute beim Angriff zusammenhalten, besonders wenn sie in der Hitze des Erfolges die feindlichen Truppen vor sich her treiben. Denn die Infanterie besitzt nur so lange Gefechtskraft, als sie geschlossen und in guter Ordnung bleibt. Ist sie aber gelockert und fast zerstreut, so kann sie durch eine Handvoll Kavallerie vernichtet werden, die im Augenblick der Unordnung über sie herfällt.
Soviel Vorsicht ein Heerführer aber auch gebraucht, er muß doch beim Angriff auf schwierige Stellungen wie überhaupt bei allen Schlachten vieles dem Zufall überlassen.
Die beste Infanterie der Welt kann zurückgeworfen und erschüttert werden, wenn sie gegen das Gelände, den Feind und das Geschütz zugleich kämpfen muß. Die unsere ist durch ihre Verluste, ja selbst durch ihre Erfolge entnervt und entartet und muß daher bei schwierigen Unternehmungen mit Vorsicht geführt werden. Man darf ihren inneren Wert nicht überschätzen und muß seine Forderungen ihrer Leistungsfähigkeit anpassen. Es wäre leichtsinnig, ihre Tapferkeit bei gewagten Unternehmungen auf die Probe zu stellen, die unerschütterliche Geduld und Standhaftigkeit erfordern.
Das Schicksal der Staaten hängt von den Entscheidungsschlachten ab. Eine gut gewählte Stellung, eine tapfer verteidigte Anhöhe kann ein Königreich erhalten oder stürzen. Eine einzige falsche Bewegung kann alles verderben. Ein General, der einen Befehl mißversteht oder schlecht ausführt, bringt Euer Unternehmen in die größte Gefahr. Besonders muß man die Kommandeure der Infanterieflügel gut instruieren und gründlich erwägen, was am besten zu tun ist. So sehr es zu loben ist, wenn man sich auf ein Gefecht einläßt, bei dem man seinen Vorteil findet, so sehr ist es zu vermeiden, wenn das Wagnis größer ist als der Erfolg, den man sich davon verspricht. Verschiedene Wege fuhren zu einem Ziele. Nach meinem Dafürhalten muß man den Feind im kleinen zu vernichten suchen. Die Mittel zum Zweck sind gleichgültig, wenn man nur die Oberhand behält.
Der Feind schickt viele Detachements aus. Ihre Führer sind nicht alle gleich klug und nicht alle Tage gleich umsichtig. Man muß sich daher vornehmen, sie eins nach dem anderen aufzureiben, und solche Unternehmungen nicht als Kleinigkeiten behandeln, sondern mit Macht darauf losgehen, kräftige Streiche führen und diese kleinen Gefechte ebenso ernst nehmen wie entscheidende Schlachten. Gelingt es Euch ein paarmal, solche einzelnen Korps zu vernichten, so habt Ihr den Vorteil, daß der Feind auf die Defensive beschränkt wird. Er wird seine Truppen aus Vorsicht zusammenhalten und Euch vielleicht eine Gelegenheit bieten, seine Proviantzüge aufzuheben oder gar etwas gegen seine Hauptmacht mit Erfolg zu unternehmen.
Noch andere Möglichkeiten fallen mir ein. Doch ich wage sie angesichts der jetzigen Zeitumstände kaum zu erwähnen. Das Gewicht von ganz Europa lastet auf uns. Wir müssen mit unseren Armeen stets unterwegs sein, um bald eine Grenze zu verteidigen, bald einer anderen Provinz zu Hilfe zu eilen. Wir sind gezwungen, die Gesetze unserer Feinde anzunehmen, statt sie ihnen zu geben, und müssen unsere Operationen nach den ihren richten.
Da jedoch solche Krisen nicht andauern und ein einziges Ereignis bedeutende Veränderungen herbeiführen kann, so will ich Euch noch einiges darüber sagen, wohin nach meiner Meinung der Kriegsschauplatz verlegt werden müßte.
Solange wir den Feind nicht in die Ebene locken können, dürfen wir uns nicht schmeicheln, große Erfolge über ihn zu erringen. Gelingt es uns aber, ihn aus seinen Bergen, Wäldern und durchschnittenen Geländen, von denen er so großen Nutzen hat, herauszubekommen, so können seine Truppen den unseren nicht mehr widerstehen.
Wo aber, werdet Ihr fragen, findet man diese Ebenen? In Böhmen und Mähren, bei Görlitz, Zittau oder Freiberg? Dort nicht, antworte ich, wohl aber in Niederschlesien. Bei seiner unersättlichen Begierde, Schlesien zurückzuerobern, wird der Wiener Hof seine Truppen früher oder später dorthin schicken. Dann müssen sie ihre festen Stellungen verlassen, und die Stärke ihrer Positionen, ihr gewaltiges Aufgebot an Artillerie wird ihnen nicht mehr viel nützen. Rückt ihre Armee bei Beginn eines Feldzuges in die Ebene, so kann diese Verwegenheit zu ihrer völligen Vernichtung führen, und dann werden alle Operationen der preußischen Armeen in Böhmen wie in Mähren mühelos gelingen.
Ihr werdet sagen, es sei ein schlimmer Ausweg, einen Feind ins eigene Land zu locken. Zugegeben! Trotzdem ist es das einzige Mittel. Es hat der Natur nun einmal nicht beliebt, in Böhmen und Mähren Ebenen zu schaffen, sondern sie hat diese Länder mit Bergen und Wäldern bedeckt. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als das vorteilhafte Gelände da zu nehmen, wo es ist, und uns um sonst weiter nichts zu kümmern.
Die kunstgerechte Taktik der Österreicher verdient alles Lob. Dagegen ist ihre Heerführung im großen zu tadeln. Diese weit überlegenen Kräfte, diese Völker, die von allen vier Enden der Welt auf uns eindrangen, was haben sie erreicht? Ist es bei so vielen Hilfsmitteln, Kräften und Armen wohl erlaubt, so wenig auszurichten? Ist es nicht klar, daß alle diese Heere bei richtigem Zusammenwirken und gleichzeitigem Handeln unsere Korps eins nach dem anderen hätten zermalmen, und daß sie, stets konzentrisch vordringend, unsere Truppen schließlich auf die Verteidigung der Hauptstadt hätten beschränken können? Aber just ihre große Zahl ist ihnen schädlich geworden. Sie haben sich einer auf den anderen verlassen, der Führer der Reichstruppen auf den österreichischen General, der auf den russischen, der Russe auf den Schweden und dieser endlich auf den Franzosen. Daher die Lässigkeit in ihren Bewegungen und die Langsamkeit bei der Ausführung ihrer Pläne. Von schmeichelnden Hoffnungen und vom festen Vertrauen auf ihre künftigen Erfolge eingelullt, haben sie sich für Herren der Zeit gehalten. Wie viel günstige Augenblicke haben sie vorbeigehen lassen, wieviele gute Gelegenheiten verpaßt! Kurz, welch ungeheuren Fehlern verdanken wir unsere Rettung!
Diese Betrachtungen sind die einzigen Früchte, die mir der letzte Feldzug geschenkt hat. Der noch frische und lebendige Eindruck dieser Bilder hat mich zum Nachdenken angeregt. Noch ist nicht alles erschöpft. Es bleiben noch viele Dinge zu sagen, deren jedes besondere Prüfung verlangt. Aber wehe dem, der beim Schreiben kein Ende zu finden weiß! Ich will lieber die Diskussion eröffnen, als allein das Wort führen. Mögen meine Betrachtungen die Leser zu neuen Gedanken anregen, die, wenn sie ihren ganzen Scharfsinn darauf verwenden, mehr taugen werden, als diese leicht und eilig hingeworfenen Ideen.