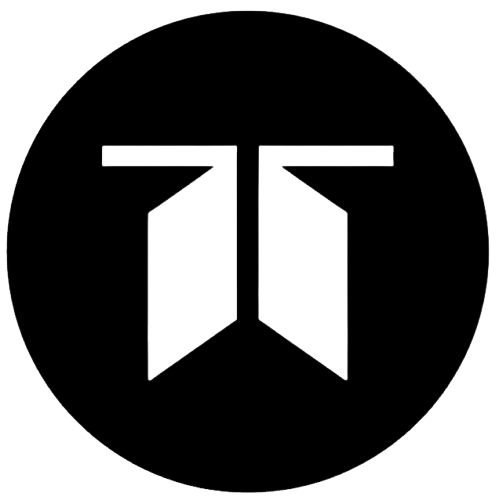← Zurück zur Startseite
Besonnte Vergangenheit
Verlag: Vier Falken Verlag
Wenn Sie das Buch lieber in der Hand halten möchten, können Sie es hier erwerben:
Kapitel 1
Titelseite
Besonnte Vergangenheit
Lebenserinnerungen 1859 - 1919
Meiner Frau Hedwig
geb. Oelschlaeger
und meinen Schwestern
Käthe und Gertrud
gewidmet
Einem frohen Wandersang
Bin ich nachgegangen,
Den am mächt'gen Strom entlang
Schilf und Wiesen klangen.
Ach! an manchem Ort vorbei
Trug mich früh mein Stecken!
Daß er mehr, als Heimat, sei.
Könnt' ich nicht entdecken.
Carl Ludwig Schleich: als Assistent an der chirurgischen Klinik in Greifswald